
17 minute read
Ein starkes Team: Organigramm
EIN STARKES TEAM
Neben der herausragenden klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit von 80 Ärzten zählt die respektvolle Zusammenarbeit in einem Team aus vielen anderen Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Advertisement
GERIATRIE Hoffmann-Weltin Y. DIREKTOR: UNIV.-PROF. DR. ROHIT ARORA
STV. DIREKTOR: ASSOZ.-PROF. PRIV.-DOZ. DR. MARTIN THALER, M.SC.
GOA TRAUMA Hengg. C
LEITENDER OA Wambacher M.
OM BUND TRAUMA Sitte I. GOA ORTHO Biedermann R.
LEITENDER OA Auckenthaler T.
OM BUND ORTHO Hackl W. EXPERIMENTELLE ORTHOPÄDIE Leitung: Nogler M.
KNIE-TEAM
Senior Consultant: Hackl W./Auckenthaler T. Teamleiter Bereich Ortho: Liebensteiner M. Teamleiter Bereich Trauma: Roth T. stv. Teamleiter Bereich Ortho: Auckenthaler T. stv. Teamleiter Trauma: Koidl C.
WIRBELSÄULEN-TEAM
Senior Consultant: Seykora P. Teamleiter: Schmid R. stv. Teamleiter Bereich Ortho: Fuderer L. stv. Teamleiter Trauma: Lindtner R. HAND-/ELLBOGEN-TEAM
Senior Consultant: Gabl M. Teamleiter: Schmidle G. stv. Teamleiter: Kastenberger T.
SCHULTER-TEAM
Senior Consultant: Wambacher M. Teamleiter Bereich Trauma: Hengg C. stv. Teamleiter: Waldegger M.
AMBULANZOBERARZT Struve P. HÜFT-/BECKEN-/TUMOR-TEAM
Senior Consultant: Nogler M. Teamleiter Bereich Ortho: Thaler M. Teamleiter Bereich Trauma: Krappinger D. stv. Teamleiter Bereich Ortho: Dammerer D. stv. Teamleiter Trauma: Lindtner R.
KINDER-/FUSS-TEAM
Teamleiter Bereich Ortho: Biedermann R. Teamleiter Bereich Trauma: Bölderl A. stv. Teamleiter Bereich Ortho: Wansch J. stv. Teamleiter Trauma: Genelin K.
GRÖSSTE BETTENFÜHRENDE KLINIK
Mit 176 Betten auf insgesamt acht Stationen ist die Klinik für Orthopädie und Traumatologie die größte bettenführende Klinik in Innsbruck. Neben 80 Ärzten sorgen rund 300 Pflegekräfte für das medizinische und persönliche Wohl der zigtausenden Patienten im Jahr. Dazu kommen 45 Mitarbeiter aus dem administrativen Bereich, etwa Chefsekretariat, OP-Planung und OP-Sekretariat, Stationssekretariate, Klinikkoordination, Projekte und Veranstaltungen, Fotografen, Callcenter, Studiensekretariat, Forschung und Lehre.
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE KINDERSTATION | KHZ STATION C; G4 Stationsarzt abwechselnd: Priv.-Doz. Dr. Rainer Biedermann und OA Dr. Jürgen Wansch Evelyn Unger-Egger, evelyn.unger-egger@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22539, Fax: 050 504-25874
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE STATION 4 SÜD Stationsärztin: Dr. Karoline Holzleitner Manuela Vorhofer, manuela.vorhofer@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22711, Fax: 050 504-25873
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE STATION 5 SÜD Stationsärzin-/arzt: derzeit offen Ruth Friedrich-Hagen, ruth.friedrich-hagen@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22703, Fax: 050 504-22742
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE STATION 6 NORD Stationsärztin: Dr. Alexandra Dal-Pont Kerstin Tscharnuter, M.Sc., kerstin.tscharnuter@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22850, Fax: 050 504-28823 ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE STATION 7 NORD Stationsärztin: Dr. Nicola Lechner Adriano Perwög, adriano.perwoeg@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22845, Fax: 050 504-25893
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE STATION 7 SÜD Stationsärztinnen abwechselnd Dr. Petra Bauer und Dr. Stefanie Vill Manuela Hangl, manuela.hangl@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22840, Fax: 050 504-25875
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE SONDERSTATION 10 NORD Stationsärztin: Dr. Beatrix Juen-Plörer Claudia Slamanig, claudia.slamanig@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22861, Fax: 050 504-25686
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE SONDERSTATION 11 NORD Stationsärztin: Dr. Mirjam Böhler Daniel Krabichler, daniel.krabichler@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-22331, Fax: 050 504-25938 Tagesklinik, kein Stationsarzt Rita Neuwirth, rita.neuwirth@tirol-kliniken.at Tel.: 050 504-80053, Fax: 050 504-22883
Sanitätshaus Konrad wünscht viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Zusammenlegung der Orthopädie und Traumatologie!
Weiters bedanken wir uns für die langjährige Zusammenarbeit bei allen MiarbeiterInnen der Tirol Kliniken, den Ärzten, den Stationsleitungen mit Team, Ambulanzen mit Team, TherapeutInnen, GipserInnen und Pfl ergerinnen und Pfl eger und allen die für einen reibungslosen Ablauf beitragen.
Rund um die Gesundheit – seit 25 Jahren

Das Team des Sanitätshauses Konrad im Ärztehaus II in Telfs sorgt für fachliche Beratung und besten Service bei Heil- und Hilfsmitteln. Hochqualifi zierte Produkte werden hier im Meisterbetrieb mit orthopädischer Fachwerkstätte maßgerecht angepasst. 2020 kann nun bereits das 25-jährige Jubiläum für den Telfer Standort mit insgesamt 10 MitarbeiterInnen gefeiert werden, insgesamt blickt Orthopädietechnikermeister Hansjörg Konrad bereits auf 44 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitsbereich zurück.
„In unserem Unternehmen werden in der eigenen orthopädischen Werkstätte nach Maß-Zeichnung oder Gipsmodell hochqualifi zierte Produkte hergestellt, aber auch Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem.“
1995 wurde das eigene Geschäft in Telfs am Wallnöferplatz erö net, 1998 übersiedelte das Sanitätshaus Konrad in das damals neu erbaute Ärztehaus Nummer 2. Das bestens ausgebildete Personal bemüht sich gerne, bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen für die KundInnen das geeignete Produkt zu fi nden. „Gerade im Gesundheitsbereich ist Vertrauen wichtig, wir freuen uns daher über viele StammkundInnen“ meint Hansjörg Konrad. „Auch unseren MitarbeiterInnen gebührt ein Dank für ihren langjährigen und freundlichen Einsatz zum Wohle unserer Kunden und den Ärzten und Krankenhäusern für die gegenseitige Unterstützung.“ Die gute Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern Innsbruck, Natters, Hoch Zirl, Zams und den niedergelassenen Ärzten gewährleisten zudem, dass das Sanitätshaus Konrad immer auf den neuesten Stand der Medizin ist. Wir sind stets um Ihre Anliegen bemüht! Ihr Sanitätshaus KONRAD im Ärztehaus
Die Serviceleistungen und Produkte sind vielfältig: • Maß- und Sonderanfertigungen • Spezialschienen • Schuheinlagen (eigene Herstellung) • Stützapparate • Mieder und Korsette (eigene Miedernäherei) • Motorschienen- und Milchpumpenverleih • Bandagen • Prothesen und Orthesen • Colostomieartikel • Blutdruckmesser • Inhaliergeräte • Inkontinenzartikel • Gehilfen, Pfl egebetten (auch Verleih) • Standard- und Pfl egerollstühle • Badewannenlift und Badehilfen • Alltagshilfen für pfl egebedürftige Menschen • Basisches, ionisiertes Wasser • Trinkwassertankstelle für Mitglieder • Vertag mit allen Krankenkassen
SANITÄTSHAUS KONRAD
Meisterbetrieb, Orthopädische Fachwerkstätte
Marktplatz 5, 6410 Telfs Tel. 05262/67696 Mo. – Fr. von 830 – 1230 und 1300 – 1700 info@sanitaetshaus-konrad.at www.sanitaetshaus-konrad.at
IM AKUTFALL

Das Herz der Innsbrucker Klinik für Orthopädie und Traumatologie bildet die Akutambulanz, die nach der Zusammenlegung nun sowohl die sogenannten „Frischverletzten“ als auch orthopädische Notfallpatienten nach höchsten medizinischen Standards behandelt. Vom Säugling bis zum Greis, von der sorgenbereitenden Bagatelle bis zur lebensbedrohlichen Verletzung.
Ob mit dem Hubschrauber, der Rettung oder selbst gehend: Der Eintritt in die Akutambulanz der Klinik für Orthopädie und Traumatologie erfolgt je nach Schweregrad der Verletzungen unterschiedlich. An 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag steht hier ein hochprofessionelles und wenn nötig interdisziplinäres Team aus Pflegekräften und Fachärzten zur Verfügung, um Akutpatienten die notwendige Versorgung zukommen zu lassen. Die Zeiten außerhalb der regulären Betriebszeiten von 7 bis 15:30 Uhr sind unfallchirurgischen oder orthopädischen Notfällen vorbehalten.
Neben der Akutambulanz zur Notfallversorgung befinden sich auch die Kontrollambulanz sowie die Spezialambulanzen, für die man als Patient jedoch einen Termin oder eine Zuweisung benötigt. „Das Gros unserer Patienten muss nicht stationär aufgenommen werden und kann in den meisten Fällen die Klinik nach der Akutversorgung wieder verlassen“, berichtet Andrea Hohenegger, M.Sc., Leitende diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin der Akutambulanz, der Kontroll- und Spezialambulanzen sowie des Gipsraumes.
HOCH FREQUENTIERTE AMBULANZEN Mit rund 45.000 Patientenerstkontakten war die vormalige „Frischverletzten-Ambulanz“ bereits vor der Zusammenlegung eine der größten Ambulanzen der Innsbrucker Kliniken. Mit Jahresbeginn 2021 kommen hier noch einmal gut 6.000 orthopädische Notfallpatienten hinzu, sodass an der nunmehr genannten „Akutambulanz“ jährlich 51.000 Patientenerstkontakte stattfinden. Nimmt man die Kontroll- und die Spezialambulanzen der verschiedenen Teams hinzu, werden an der Innsbrucker Klinik für Orthopädie und Traumatologie im Schnitt 117.000 Patientenkontakte pro Jahr absolviert. „Da kann es bei Eintreffen von schweren Notfällen bei den Leichtverletzten schon auch mal zu etwas längeren Wartezeiten kommen“, erläutert Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. med. Rohit Arora.
Insbesondere schöne Winterwochenenden sorgen für Spitzenbelastungen an der Akutambulanz, das Patientenaufkommen hat sich jedoch über die vergangenen Jahre schon mehr auf das ganze Jahr verteilt. „Wir verzeichnen durch die
Andrea Hohenegger, MSc
neuen Trendsportarten auch im Sommer immer mehr Akutpatienten, der E-BikeBoom, Downhiller und andere Freizeitsportler machen sich auch bei uns vermehrt bemerkbar“, so Arora.
PROFESSIONELL Insgesamt fünf Röntgenräume, ein Computertomograph (CT) sowie ein Magnetresonanztomograph (MRT) stehen für die bildgebende Diagnostik in der Akutambulanz zur Verfügung. Zur regulären Betriebszeit von 7 Uhr bis 15:30 Uhr bemühen sich bis zu zwölf Ärzte um das Wohl der ambulanten Patienten, außerhalb davon stehen sieben Ärzte für alle ambulanten und stationären Patienten sowie alle Operationen zur Verfügung. „Bei uns in der Akutambulanz ist eigentlich nichts planbar. Es ist kein Einzelfall, dass wir unseren OP-Plan in einem Dienst mehrfach umstellen, insbesondere wenn ein Notfall mit größerer Dringlichkeit eintrifft“, weiß auch Ass.-Prof. Dr. med. Andreas Bölderl aus jahrzehntelanger Erfahrung als Unfallchirurg.
BEI LEBENSGEFAHR: SCHOCKRAUM Lebensbedrohlich Verletzte werden in einem gesonderten Bereich, dem sogenannten Schockraum, erstbehandelt. Bereits am Unfallort verständigt der Notarzt die Rettungs-Leitstelle, welche die relevanten Vorinformationen an die Klinik weitergibt. „Notfallmedizin ist immer Teamarbeit. Unsere Ambulanz ist sicher einer der Orte, wo die engste Verzahnung zwischen den Berufsgruppen stattfindet und jedem von uns klar ist, wie wenig ohne den anderen möglich ist“, weiß Hohenegger über die großartige Teamarbeit im Haus. Und so steht bei Eintreffen des lebensgefährlich Verletzten ein interdisziplinäres Team aus einem behandelnden Facharzt für Traumatologie, einer Diplompflege der Ambulanz, einem Facharzt für Anästhesie, einer Fachpflege für Anästhesie, einem Facharzt für Radiologie sowie eine röntgentechnische Assistenz Gewehr bei Fuß, um den ankommenden Patienten unverzüglich und nach einem strengen Protokoll vom Notarzt-Team zu übernehmen. „Dieses interdisziplinäre Team aus Spezialisten mit genauer Aufgabenverteilung behandelt unsere Patienten nach dem Innsbrucker Schockraumalgorithmus“, erklärt der Klinikdirektor mit sichtlichem Stolz auf sein professionelles Team. „Je nach Verletzungsmuster werden noch Spezialisten aus anderen Fächern hinzugezogen, etwa aus der Neurochirurgie, Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie, Plastischen Chirurgie, Herzchirurgie, Neurologie, Kieferchirurgie, HNO oder andere mehr.“
„Der Leader im Schockraum ist der Unfallchirurg, er ist auch für die Diagnostik zuständig“, erklären Klinikdirektor Rohit Arora und die leitende Pflegerin Andrea Hohenegger. „Der Anästhesist übernimmt das Schmerz- und Beatmungsmanagement und stabilisiert den Patienten, die Pflegekraft nimmt die Daten des Patienten auf und ist zum Beispiel für Blutabnahmen zuständig. Ist der Patient nicht ansprechbar, wird immer ein CT vom Schädel bis zum Oberschenkel gemacht, um eventuelle innere Verletzungen auszuschließen oder festzustellen. Von den Extremitäten werden Röntgenbilder gemacht.“
In den letzten Jahren wurden durchschnittlich 855 traumatologische Patienten im Schockraum behandelt, etwa 120 davon kamen direkt in den OP und knapp 300 auf eine Intensivstation. Für 100 Patienten ging es auf eine Überwachungs-, für etwa 170 Patienten auf eine Normalstation. „So dramatisch die Situation für Betroffene

Das professionelle Gipser-Team legt im Jahr rund 80 Kilometer Gipse und Streckverbände an und assistiert bei Repositionen und Infiltrationen.
„So dramatisch die Situation für Betroffene auch immer ist, so ist es von großer Bedeutung, dass das Schockraum-Team Ruhe bewahrt und besonnen alle notwendigen Schritte setzt.“
Univ.-Prof. Dr. med. Rohit Arora
auch immer ist, so ist es von großer Bedeutung, dass das Schockraum-Team Ruhe bewahrt und besonnen alle notwendigen Schritte setzt“, ist sich Arora sicher.
ZENTRUM DER MAXIMALVERSORGUNG An die Innsbrucker Akutambulanz kommen nicht nur Frischverletzte aus der Region, sondern ebenso schwerverletzte Patienten aus den sechs Krankenhäusern in den Tiroler Bezirken. Es kommt auch vor, dass es in peripheren Häusern zu Komplikationen kommt und die Patienten in die Klinik gebracht werden. „Unser Haus ist ein Haus der Maximalversorgung. Das bedeutet, dass alle Fachrichtungen zur Behandlung schwer verletzter Patienten rund um die Uhr zur Verfügung stehen“, so Arora.
LUXUS-GIPSRAUM Neben den Diplompflegern, die mit viel Erfahrung und Ruhe die nötigen medizinischen Maßnahmen durchführen, darf die Akutambulanz an der Innsbrucker Klinik für Orthopädie und Traumatologie auch auf einen eigenen Gipsraum samt professionellem Gipserteam stolz sein. „Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr“, zeigt sich Klinikchef Rohit Arora stolz auf den Gipsraum. Ein Team aus zehn professionellen Mitarbeitern, speziell ausgebildet in Gips- und Repositionstechniken, verarbeitet jährlich in etwa 50 Kilometer Kunst- und 30 Kilometer Weißgips. Die Gipsprofis legen nicht nur Gipse an, sondern passen auch Schienen, legen Streckverbände an oder assistieren bei einer Vielzahl an ärztlichen Tätigkeiten wie Repositionen und Infiltrationen. Ausgestattet sind die drei Behandlungseinheiten mit digitaler Darstellung von Röntgenbildern, ein Sondergipsraum mit Narkoseeinheit und Bildwandler und Fluoroscan und einer Einheit zur Gipsabnahme. SPEZIELLE BETREUUNG GERIATRISCHER PATIENTEN Seit 2009 werden geriatrische Patienten nach neuesten wissenschaftlichen Standards bestmöglich betreut. Diese Versorgung basiert auf 3 Säulen: Zum einen werden alle diagnostizierenden Ärzte sowie das Pflegepersonal besonders und regelmäßig auf diese spezielle Patientengruppe ausgebildet und geschult. Zum Zweiten soll die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Orthopädie/Traumatologie, Anästhesie und Geriatrie die operative Sanierung deutlich verkürzen, um die Patienten zu schonen und zum Dritten soll eine schnelle Rehabilitation die Menschen so schnell wie möglich wieder in ihre gewohnte Lebenssituation zurückführen. So stehen dem Ärzteteam der Akutambulanz und auf den Stationen zusätzlich noch eigens ausgebildete Sekundarärzte mit Geriatriediplom zur Seite. |

TAGESKLINIK Stark im Trend sind tagesklinische Aufenthalte, das heißt, dass Patienten in der Früh für einen kleinen chirurgischen Eingriff aufgenommen werden und das Haus am selben Tag bis spätestens 18 Uhr wieder verlassen. Dazu zählen vor allem arthroskopische hand- und fußchirurgische Eingriffe mit Lokalanästhesie, aber auch Eingriffe unter Vollnarkose sind tagesklinisch möglich.
EIN MÖGLICHES SZENARIO EINER SCHWERVERLETZTENVERSORGUNG AN DER INNSBRUCKER KLINIK FÜR ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE
13:30 Uhr: Ein Rodler verunfallt auf einer Rodelbahn in der Nähe von Achenkirch.



14:10 Uhr: Der Patient wird von der internen Telefonzentrale angekündigt. Patient XY, 12 Jahre, männlich, kommt in circa 15 Minuten mit dem Hubschrauber von Achenkirch mit offener Femurfraktur rechts, Unterschenkelfraktur rechts und BWS-Verletzung. Die interne Telefonzentrale informiert das Schockraumteam. 13:35 Uhr: Der Hubschrauber wird alarmiert.
14:38 Uhr: Nach einer ersten interdisziplinären Untersuchung des Patienten von Seiten der Traumatologie, Anästhesie und Kinderheilkunde erfolgt die Durchführung eines SchockraumCTs einschließlich der unteren Extremitäten.
15:00 Uhr: Kontaktaufnahme mit dem OP und Beginn mit der OP-Vorbereitung.
15:30 Uhr: Beginn der chirurgischen Maßnahmen mit Versorgung der Oberschenkel- und Unterschenkelfraktur mittels Fixateur-Externe und Versorgung der Brustwirbelsäulenfrakturen mittels dorsaler Instrumentierung.
20:05 Uhr: Transfer des Patienten auf die Kinder-Intensivstation.
So oder ähnlich ist das Schockraumteam jeden Tag aufs Neue gefordert. Im Schnitt gelangen drei Patienten pro Tag in den Innsbrucker Schockraum, an manchen Tagen weniger, an manchen sogar bis zu zwölf. Der gewöhnliche Schockraumpatient bleibt meist nur eine Stunde im Schockraum.
Schwerverletzte erreichen die Akutambulanz bzw. den Schockraum per Hubschrauber. Vom Hubschrauberlandeplatz, an dem sich Andrea Hohenegger, M.Sc., und Klinikchef Univ.-Prof. Dr. med. Rohit Arora hier befinden, führt ein Bettenlift in den Schockraum. 14:25 Uhr: Übergabe des Patienten vom Notarzt des Hubschraubers an das Schockraumteam. Der Patient wird in den Schockraum gebracht. Es bestehen laut Notarzt ein offener Oberschenkelbruch rechts sowie der Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur rechts und eine Wirbelsäulenverletzung.
14:47 Uhr: Das CT ergibt folgenden Befund: Typ B2Verletzung Brustwirbelsäule 5/6 und A3-Verletzung Brustwirbelsäule 7/8. Fraktur der Rippenköpfchen und der Querfortsätze Brustwirbelsäule rechts. Lungenlazeration rechts. Offener Oberschenkelbruch rechts und Unterschenkelfraktur rechts. Keine Gefäßverletzung, keine größere Blutung.
15:17 Uhr: Eintreffen des Patienten im Operationssaal.
19:35 Uhr: Beendigung der chirurgischen Maßnahmen.






I N S T I T U T E



VON INNSBRUCK IN DIE WELT
Eingriffe nach Verletzungen des Beckenrings und des Hüftgelenkes gehören zu den schwierigsten Operationen in der Unfallchirurgie und erfordern ausgeprägte Spezialkenntnisse. Im Bereich der Hüftprothetik hat eine Operationstechnik aus Innsbruck sogar Weltruhm erlangt.

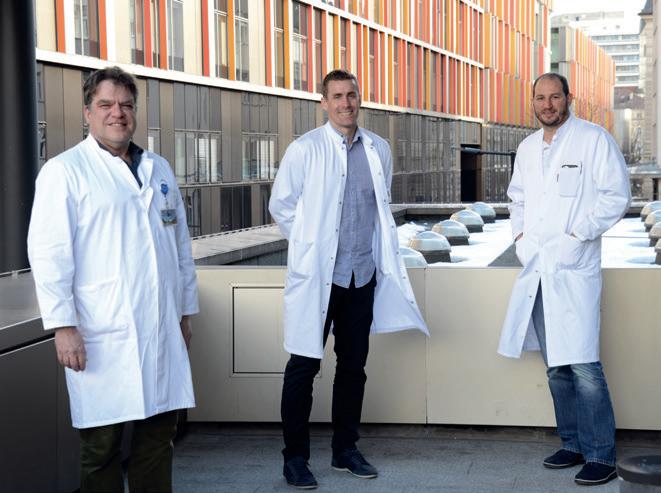
Univ.-Prof. Mag. Dr. med. Michael Nogler, MAS, M.Sc. / Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Martin Thaler, M.Sc. / Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Dietmar Krappinger, PhD: Dank ihrer Expertise ist Innsbruck zu einem international renommierten Zentrum für minimal-invasive Hüftendoprothetik gewachsen. Bis heute sind über 3.000 Chirurgen aus mehr als 50 Nationen der Welt in dieser Technik in Innsbruck ausgebildet worden. Die Innsbrucker Spezialisten werden regelmäßig als Vortragende und Lehrende zu nationalen und internationalen Kongressen, Fortbildungsveranstaltungen und Operationskursen eingeladen.
Vor einigen Jahrzehnten waren Verletzungen des Beckens und des Hüftgelenkes nicht nur mit einer hohen Sterblichkeit verbunden, sie führten auch bei vielen Patienten zu einer (Teil-)Invalidität. Denn eine annähernd anatomische Ausheilung mit konservativen Methoden war trotz oftmals mehrmonatiger Bettruhe nicht zu bewerkstelligen. Bereits in den 1980er-Jahren wurden Techniken zur offenen Einrichtung und Stabilisierung von Becken und Hüftverletzungen entwickelt. Diese Techniken wurden in den folgenden Jahren sukzessive weiterentwickelt. Heutzutage stellt die perkutane Stabilisierung vorwiegend des hinteren Beckenrings durch kleine Hautschnitte ein Standardverfahren dar. Innsbrucker Chirurgen haben diese Techniken in den letzten Jahren maßgeblich mitentwickelt. VORREITER IM HÜFTGELENKSERSATZ Um die Jahrtausendwende gelang einem Team rund um Univ.-Prof. Mag. Dr. med. Michael Nogler, MAS, M.Sc. eine innovative Operationstechnik: der minimalinvasive direkt anteriore Zugang bei Hüftprothesen. In Innsbruck und vielen Kliniken weltweit ist diese Operationstechnik heute Standard. Bis heute sind über 3.000 Chirurgen aus mehr als 50 Nationen der Welt in dieser Technik in Innsbruck ausgebildet worden. Die Ärzte des Hüftteams werden wegen dieser minimalinvasiven Technik regelmäßig als Vortragende und Lehrende zu nationalen und internationalen Kongressen, Fortbildungsveranstaltungen und Operationskursen eingeladen.
Kaum eine Operation ist so erfolgreich wie die Implantation eines künstlichen Hüftgelenks. Die Hüftprothese wurde vor Kurzem als Operation des Jahrhunderts bezeichnet und kann für die betroffenen Patienten bei einem erfahrenen Operateur zu fast 98 Prozent zu einer vollkommenen Schmerzfreiheit führen. „Ein Gelenksersatz ist dann indiziert, wenn alle nichtoperativen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind und die Lebensqualität des Patienten durch den Schmerz eingeschränkt ist“, erklärt Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Martin Thaler, M.Sc., Stellvertretender Klinikdirektor und Teamleiter im Bereich Orthopädie.
REVISIONSENDOPROTHETIK UND FEHLVERHEILUNGEN Zu den Experten der Innsbrucker Klinik gelangen Patienten auch in Fällen von Korrektureingriffen bei fehlverheilten
Beckenringverletzungen und insbesondere zur Revisionsendoprothetik. „Eine Wechseloperation am Hüftgelenk wird dann notwendig, wenn es zu Lockerungen des künstlichen Hüftgelenks oder zu einer Infektion kommt“, weiß Thaler. „Ursachen für eine Lockerung können ein Knochensubstanzverlust um die künstliche Prothese herum sein, eine akute oder chronische Infektion oder eine Fraktur im Bereich des Implantats sein. Die Zahl der Revisions- und Wechseloperationen steigt jedes Jahr aufgrund der erheblich gestiegenen Zahl von Primäroperationen an. An der Innsbrucker Klinik für Orthopädie und Traumatologie werden jährlich etwa 550 künstliche Hüftgelenke implantiert und etwa 170 Hüftwechseloperationen durchgeführt.“
VON PERIPHEREN HÄUSERN NACH INNSBRUCK Die Behandlung von Beckenring- oder Hüftverletzungen und ihrer möglichen Begleitverletzungen bedürfen ausgeprägter Spezialkenntnisse. „Ein größerer Teil unserer Patienten wird daher nach Primärdiagnostik in einem peripheren Haus zu uns verlegt. Aus diesem Grund verfügen wir in unserer Klinik auch über ausreichend hohe Frequenzen, um alle gängigen Behandlungstechniken auf hohem Niveau anbieten zu können. Besonders erwähnenswert ist der 24-stündige Bereitschaftsdienst der interventionellen Radiologie. Damit verfügen wir im Gegensatz zu vielen anderen Zentren bei blutenden Verletzungen des Beckenrings über die extrem schonende und effektive Technik der selektiven arteriellen Embolisation“, erläutert Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Dietmar Krappinger, PhD, Teamleiter Bereich Traumatologie, die Vorzüge der interdisziplinären Zusammenarbeit an der Innsbrucker Klinik. „Die optimale Vernetzung und Zusammenarbeit mit unseren Nachbardisziplinen wie der Radiologie und der Anästhesie, aber auch der Urologie und der Viszeralchirurgie kommen unseren Patienten insbesondere dann zugute, wenn Zusatzverletzungen vorhanden sind“, weiß der erfahrene Unfallchirurg.
Besonderes Augenmerk wird im Team auch auf die Behandlung von älteren Menschen gelegt. „Brüche kommen ab einem gewissen Alter häufiger vor, bei hüftnahen Brüchen war die Sterbera„Brüche kommen ab einem gewissen Alter häufiger vor. An unserer Abteilung sind sowohl Ärzte als auch Pfleger speziell auf geriatrische Bedürfnisse ausgebildet.“
Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Dietmar Krappinger, PhD
te früher relativ hoch. Minimalinvasive Operationstechniken und Kreuzstich-Anästhesie sind für ältere Menschen weitaus schonender und erfolgversprechender. Bei Brüchen der Hüftpfanne wird dabei vermehrt die sofortige Versorgung mittels einer Hüftprothese durchgeführt. Zudem sind an unserer Abteilung sowohl Ärzte als auch Pfleger speziell auf geriatrische Bedürfnisse ausgebildet“, versichert Krappinger.
KNOCHENTUMORE Die Innsbrucker Klinik für Orthopädie und Traumatologie ist eine von nur drei Kliniken in Österreich, die muskuloskelettale Tumore behandeln. Bei Tumoren des Knochens unterscheidet man zwischen gutartigen und bösartigen. Ein Großteil der Knochentumore sind als gutartig (benigne) anzusehen. Selten können auch gutartige Knochentumore vor Ort wieder auftreten (Lokalrezidiv) oder zu Tochtergeschwülsten (Metastasen) führen. Viele dieser gutartigen Knochentumore sind meist asymptomatische Zufallsbefunde, die weder eine Behandlung oder eine Kontrolle benötigen. Es gibt jedoch gutartige Knochentumore, die unbehandelt zu Schmerzen und erheblichen Knochenveränderungen wie Brüchen, Destruktionen oder Achsenfehlstellungen führen können. Dann müssen sie operativ behandelt werden.
Bösartige Tumore, die primär den Knochen befallen, sind seltene Erkrankungen, die jedoch ein hochspezifisches orthopädisches Fachwissen erfordern. „Knochentumore treten häufig bei Patienten zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr auf und betreffen meist die Knochen der Arme, des Beckens und der Beine, besonders im Oberschenkel“, berichtet Thaler. Im sogenannten Tumorboard werden in einer spezialisierten Gruppe aus Orthopäden, Radiologen, Pathologen, Onkologen, Nuklearmedizinern, plastischen Chirurgen und Strahlentherapeuten Entscheidungen über die Behandlung des Tumors mit einer Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung getroffen. „Häufig erfolgt eine Kombination dieser Therapiemaßnahmen“ weiß der Spezialist. |
HÜFT-, BECKEN- UND TUMOR-TEAM Univ.-Prof. Mag. Dr. med. Michael Nogler, MAS, M.Sc., Senior Consultant Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Dietmar Krappinger, PhD, Teamleiter Bereich Traumatologie Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Martin Thaler, M.Sc., Teamleiter Bereich Orthopädie Priv.-Doz. Dr. med. Dietmar Dammerer, M.Sc., PhD, stellvertretender Teamleiter Bereich Orthopädie Priv.-Doz. Dr. med. Richard Lindtner, PhD, stellvertretender Teamleiter Bereich Traumatologie OA Dr. med. Wolfgang Janda OA Dr. med. Julian Lair OA Dr. med. Wolfram Pawelka Priv.-Doz. Dr. med. René Schmid Dr. med. Juana Kosiol Dr. med. Matthias Rittler Dr. med. Markus Süß




