
aktuelle technik
aktuelle technik – aktuelle-technik.ch
Die Schweizer Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik
Sonderausgabe


aktuelle technik
aktuelle technik – aktuelle-technik.ch
Die Schweizer Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik
Sonderausgabe


Sind Sie ein Unternehmen entlang der Automatisierungs-Wertschöpfungskette? Dann präsentieren Sie sich mit Ihrem Firmenporträt in der auflagenstarken Sonderpublikation, mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren, im grössten Industrie-Cluster Europas: Deutschland – Österreich – Schweiz

Künstliche Intelligenz, ist ein Monster. Ein gieriges Megamonster. Dabei ist nicht die Sorge vieler Menschen gemeint, dass eine Art unkontrollierbare Superintelligenz entstehen könne Auch nicht die Bedenken, den Arbeitsplatz an die KI zu verlieren oder die Gefahr von Desinformationen und Deepfakes Gemeint ist der gigantische Energiehunger. Noch stehen wir am Anfang des KI-Zeitalters, doch die Nachfrage nach KI-Anwendungen steigt und damit auch der Energiebedarf. Je leistungsfähiger KI-Modelle sind, desto mehr Energie verschlingen sie Allein das Trainieren eines grossen Modells kann so viel Strom verbrauchen wie ein ganzes Dorf in einem Jahr Sehr anschaulich legt Michael Förtsch, CEO bei Qant GmbH, den riesigen Energiehunger dar. Er vergleicht in seinem Kommentar auf Seite 32 den Stromverbrauch eines Grafikprozessors mit dem eines Küchenherds Demnach verbraucht ein einziger Rack im Datencenter soviel Strom wie 100 Öfen. Laut Prognosen sollen 2026 Rechenzentren genauso viel Energie wie ganz Japan verbrauchen Das sind erschreckende Dimensionen, die unsere bestehende Energie-Infrastruktur hoffnungslos überlasten Hinzu kommt der negative Einfluss auf das Klima. Auch die Unmengen an Wasser, die zum Abkühlen der Datenzentren benötigt werden, sind nicht berücksichtigt. Diese Dimensionen der KI scheint noch nicht im Bewusstsein unserer Gesellschaft angekommen zu sein. Wenn, dann nur vereinzelt und punktuell. Aber eine öffentliche Debatte über den Energiehunger der KI findet nicht statt. Wir werden sie aber führen müssen, sonst limitieren wir uns selbst. Doch was sind realistische Ansätze, um den Stromverbrauch zu reduzieren? Die Nutzung von erneuerbaren Energien kann den negativen Einfluss auf das Klima verringern. Doch kann der Ausbau der Erneuerbaren Energien mit der Geschwindigkeit des zunehmenden Stromverbrauchs durch KI wirklich mithalten? Es ist zu bezweifeln. Kleinere, effizientere Modelle können den Energiebedarf reduzieren. Doch sind sie wirklich ein Gamechanger? Eher nicht, denn die Einsatzmöglichkeiten sind limitiert. Das wohl grösste Potential liegt in der Entwicklung einer effizienteren Hardware. Durch den Einsatz neuer Technologien können Prozessoren entwickelt werden, die wesentlich weniger Energie verbrauchen. Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist Qant Qant setzt auf Licht und hat einen Photonik-Prozessor entwickelt, der bis zu 30 mal energieeffizienter ist, keine Wärme entwickelt und daher auch keine Kühlung benötigt Das klingt fast zu schön um wahr zu sein? Es geht noch besser: Eine Pilotlinie als Blaupause für das Upcycling bestehender Chip-Foundries gibt es auch schon. Das Allerbeste ist aber, dass Qant und der Photonik-Prozessor nur ein Beispiel von vielen ist. Viele Unternehmen und Start-ups sind unterwegs, um neue, energiesparende Technologien für KI-Anwendungen zu entwickeln.
Anne Richter, Chefredaktorin























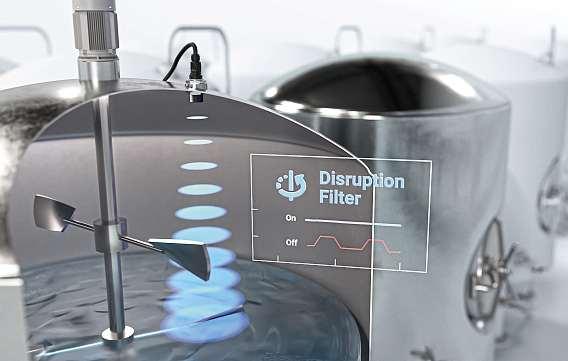
Sensorik & Messtechnik
Smarte Ultraschallsensoren können mehr

Messenachschau: Hannover Messe: «Rückenwind für die Industrie»

Digitalisierung & KI Paradigmenwechsel notwendig – für zukunftsfähiges KI-Computing


Elektrotechnik
Elektrische Verbindungskabel für Bäckerei-Anlagen
Antriebstechnik & Leistungselektronik
Flexibilität trifft auf Funktionalität
03 Editorial 04 Inhalt
Magazin
06 Treffpunkt der Embedded-Computing-Branche
09 Control 2025: Zukunft der Qualitätssicherung
10 Hannover Messe: «Rückenwind für die Industrie»
12 Die Schweiz – ein Markt mit hoher technologischer Kompetenz
14 Firmen | Fakten | Märkte
Themenspecial Sensorik & Messtechnik
18 Zum Titelbild: CO2-Kreislauf schliessen: Sichere Speicherung für eine grüne Zukunft
21 Smarte Ultraschallsensoren können mehr
25 Vollautomatische robotergestützte 3D-Erfassung ohne Teaching
Schwerpunkt
Antriebstechnik & Leistungselektronik
30 Flexibilität trifft auf Funktionalität
Schwerpunkt Digitalisierung & KI
32 Paradigmenwechsel notwendig – für zukunftsfähiges KI-Computing
Schwerpunkt Safety & Security
34 Adaptive Sicherheitskonzepte für moderne Arbeitswelten
Themen
36 OT-Asset-Management –unerlässlich für Übersicht und Risikomanagement
38 Elektrische Verbindungskabel für Bäckerei-Anlagen
41 Swiss Technology Network: Electronic Packaging News Schalter für jede Herausforderung
42 Swiss Technology Network: Sensoren News Schwingungen in drei Achsen mit IO-Link überwachen
44 Swiss Technology Network: Sensoren News Wie sichere Radarsysteme die Produktion schützen
Marktplatz
46 Produkt-News
50 Firmenverzeichnis/Impressum
Inhalt Übersicht 5





NEU EU optoNCDT 5500

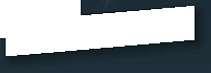
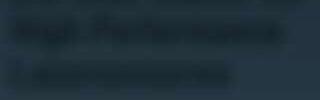
KompakterSensormit integriertem Controller fürhochpräzise Abstandsmessungen
Reproduzierbarkeit <0,15µm
Schnelle Messungmit 75 kHzMessrate auch aufwechselnden Oberflächen
HöchsteFremdlichtbeständigkeit

Abtandsmessung im 3D-Druck

Defekterkennung vonSchienen

Geometrieprüfung vonReifen
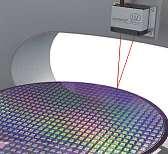
Abstandsmessung vonWafern
Idealfür Maschinenbau undAutomation Kontaktieren
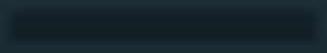
Der wichtigste Branchentreffpunkt der Embedded Computing Community steht vor der Tür: Am 27. Mai 2025 trifft sich die Branche zur Embedded Computing Conference an der ZHAW in Winterthur. Organisiert wird die jährliche Fachtagung von der Sektion Embedded Computing des Branchenverbands SwissT.net. Im Interview berichtet Sektionspräsident Hugo Ziegler über den wichtigen Branchen-Event.

at: Die Embedded Computing Conference (ECC) hat sich zum wichtigsten Treffpunkt für die Embedded Systems Community in der Schweiz etabliert. Was macht den Event besonders?
Hugo Ziegler: Es gibt nichts Vergleichbares in der Schweiz Es ist eine Veranstaltung von
Fachleuten für Fachleute Hunderte von Entwicklern und Entwicklerinnen aus Industrie und Lehre informieren sich an zahlreichen Referaten über die neuesten technischen Entwicklungen und schätzen den Austausch unter ihresgleichen Zudem bietet der Anlass Unternehmen, Organisationen und Hoch-
schulen die einzigartige Gelegenheit, neuste Forschungsergebnisse, aktuelle Entwicklungen und spannende Projekte zu präsentieren.
Sie haben im grossen Masse zu der positiven Entwicklung der ECC beigetragen

Wie haben Sie es geschafft, eine so breite Community anzusprechen?
H. Ziegler: Die ECC ist kontinuierlich gewachsen und ich bin heuer das zweite Mal an vorderster Front. Ich habe das Privileg, zu ernten, was die Vorgänger angepflanzt haben. Ganz offensichtlich ist es mit diesem Format gelungen, eine Lücke zu füllen. Die Kombination von Vorträgen, verbunden mit der Möglichkeit, den Ausstellern vor Ort noch konkrete Fragen stellen zu können, bietet eine ungemein breite Masse an Informa-
«DieriesigeInformationsvielfaltder Fachreferate,verbundenmitder Möglichkeit,sichdirektvorOrtbei denAusstellernüberneusteProdukte, TechnologienundDienstleistungenzu orientieren,isteinzigartiginder Schweiz.»
HugoZiegler,PräsidentSektionEmbeddedComputingswissT.net undGeschäftsführerderCSAEngineeringAG
tionen Dies wird offensichtlich geschätzt Mir wurde auch schon gesagt, dass dies von Betrieben als «Interne Weiterbildung» genutzt wird und diese ihre Mitarbeitenden zur Teilnahme auffordern.
Ihre Zielgruppe sind in erster Linie Entwicklerinnen und Entwickler von Embedded-Systemen. Was sind die aktuellen Fragen und Problemstellungen, die die Embedded Computing Community beschäftigen?
H. Ziegler: Es gibt die Dauerbrenner «Good Practice» in der Entwicklung von Embedded Software sowie neuste «Trends in der Hardwareentwicklung» und Kommunikation und Sicherheit generell. Ein neueres Thema ist der immer grösser werdende Einfluss der regulatorischen Vorgaben.
Ein Thema, das die Industrie besonders beschäftigt, ist die Cyber-Sicherheit. Dabei ist Cyber Security by Design bzw. Secure by Design ein wichtiger Bestand-

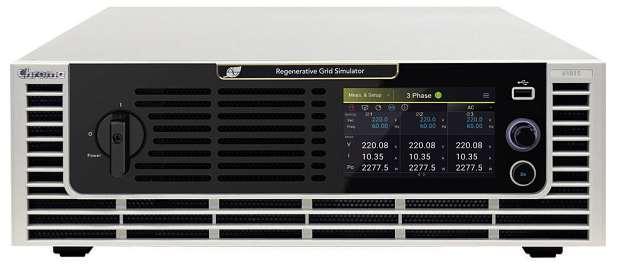

Die Embedded Computing Conference wird auch in diesem Jahr von einer Tischausstellung begleitet, wo sich die Teilnehmer über neuste Produkte, Technologien und Dienstleistungen informieren können
Ob ich mir dann vor Ort die Zeit nehmen kann, wird sich zeigen
Künstliche Intelligenz ist in den letzten Monaten fast ein Hype geworden, wird auf fast allen Messen und Veranstaltungen in den Fokus gestellt. Wie wird das in der Embedded Community diskutiert?
H. Ziegler: Natürlich ist KI ein Thema Es wird auch an der ECC25 einige Vorträge zu diesem Thema geben KI ist ein weites Feld und oft ist nicht klar, wovon im Endeffekt gesprochen wird.
teil für die Entwicklung neuer Embedded-Systeme. Wird diesem Trend auch bei den Referaten Rechnung getragen?
H. Ziegler: Sie sprechen den «Cyber Resiliency Act» an, der am 10. Dezember 2024 in Kraft getreten ist und ab dem 11 Dezember 2027 Gültigkeit hat. Auf jeden Fall – wir haben dieses Jahr zwei Vorträge, die sich explizit mit diesem Thema und dessen Auswirkungen auf die Entwicklung von Embedded-Systemen beschäftigen
Wie gehen Sie bei der Themenauswahl für die ECC vor?
H. Ziegler: Die ausstellenden Firmen haben bis Mitte Januar Zeit, Vorträge einzureichen
Dies tun sie in Form eines «Abstracts». Anschliessend macht ein Ausschuss sich an die Arbeit, die Vorträge thematisch zu ordnen. Es ist jeweils das Ziel, Streams zu drei thematisch passenden Inhalten zu bilden, so dass die Besuchenden während den Streams nicht zu oft die Vortragsräume wechseln müssen
Die Streams werden dann so in die Sessions aufgeteilt, dass jeweils ein breites und attraktives Angebot entsteht – Hardware, Software, Tools, Erfahrungsberichte
Was sind die Themenschwerpunkte in diesem Jahr?
H. Ziegler: Wie schon im Vorjahr sind Künstliche Intelligenz sowie Quantencomputing grosse Themen
KI wird auch in der Embedded-Welt neue Ansätze ermöglichen und Quantencompu-
Embedded Computing Conference
Termin: 27. Mai 2025
Ort:
ZHAW, Gebäude TN, School of Engineering
Technikumstrasse 71 8401 Winterthur
Beginn:
8.30 Uhr bis 18.10 Uhr
Eintritt:
Kostenlos mit OnlineRegistrierung
Veranstalter: swisst.net
ting wird zur Herausforderung betreffend Security über den üblicherweise langen Lebenszyklus von Embedded-Systemen.
Gibt es ein Thema oder einen Vortrag, das oder der Sie persönlich besonders interessiert?
H. Ziegler: Ich nehme mir vor, Vorträge zum Thema Post-Quantum-Kryptographie und zum Thema Cyber Resiliency Act anzuhören
Auf Large Language Models (LLMs) basierende KI werden wir meines Erachtens nicht so schnell auf Mikro-Kontroller-basierten Embedded-Systemen ausgeführt sehen Was in einigen Entwicklungsabteilungen bereits diskutiert und untersucht wird, ist, wo die Anwendungsgebiete sind, in denen mittels Deep Learning angelernte Systeme gegenüber diskret programmierten Systemen Vorteile haben.
Nach der Premiere im letzten Jahr wird es auch in diesem Jahr wieder Vorträge zum Thema Quantencomputing geben. Dabei steht die Sicherheit im Vordergrund. Wie akut ist diese Thematik?
H. Ziegler: Bis vor Kurzem war dies primär ein Thema bei interessierten Entwicklungsabteilungen und in Forschung und Lehre Der Cyber Resiliency Act wird nun aber zur Folge haben, dass sich auch die breite Masse der Entwickler damit auseinandersetzen muss Der Regulator sorgt also dafür, dass die Thematik zunehmend akut wird
Können Sie kurz zusammenfassen, warum man diesen Event auf keinen Fall verpassen sollte?
H. Ziegler: Die riesige Informationsvielfalt der Fachreferate, verbunden mit der Möglichkeit, sich direkt vor Ort bei den Ausstellern über neuste Produkte, Technologien und Dienstleistungen zu orientieren, ist einzigartig in der Schweiz. Die Teilnahme an der ECC bietet einen echten Gegenwert im Sinne von aktiver Weiterbildung – und dies kostenlos für die Teilnehmenden.
swisst.net

Vom 06. bis 09. Mai 2025 wird in Stuttgart die 37. Control, internationale Fachmesse für Qualitätssicherung, stattfinden. Traditionell fokussiert das wichtige Branchenevent Qualität, Relevanz und ein hohes fachliches Niveau. Es werden rund 35 Prozent Aussteller aus dem Ausland anreisen.

Massnahmen der Qualitätssicherung (QS) sind integraler Bestandteil der Workflows der industriellen Produktion sowie verschiedener Abläufe auch in unterschiedlichen nichtindustriellen Bereichen QS durchdringt viele Prozesse und dreht sich technologisch um das Themenspektrum Vision, Bildverarbeitung, Sensorik sowie Mess- und Prüftechnik samt modernster Software und Auswertetechnologie. Zur Tradition der Control, internationale Fachmesse für Qualitätssicherung,gehörteinefokussierteThemenrelevanz, ein hohes fachliches Niveau und eine hohe Internationalität. «Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder rund ein Drittel der Aussteller aus dem Ausland kommen», kündigt Fabian Krüger, Projektleiter der Control beim Messeunternehmen P. E Schall an. «In
den Hallen 3, 5, 7 und 9 des Stuttgarter Messegeländes werden verschiedene Messtechnik-Arten abgebildet und branchenübergreifend relevant aufbereitet. Zu den Top-Themen gehört die Künstliche Intelligenz (KI), deren Einsatz an vielen Stellen der Messe gezeigt wird», verspricht Krüger.
In diesem Jahr können die Messebesucher mit den Control Quality Talk 2025 ein neues Veranstaltungsformat erleben Unter der Überschrift «KI in der QS – Wird die Zukunft fehlerfrei? KI als Turbo für Wirtschaftlichkeit und Effizienz» soll es darum gehen, den aktuellen praxisrelevanten Stand des KI-Einsatzes zu besprechen. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Dr.-Ing. Ira Effenberger, Forschungsbereichsleiterin Künstliche Intelligenz und Maschinelles Sehen am Fraunho-
Infos zur Control
Termin: 6. bis 9. Mai 2025
Ort: Messe Stuttgart
Öffnungszeiten:
Täglich 9.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 16.00 Uhr
Eintrittspreise:
Tageskarte: 35,00 EUR
Ermässigt: 28,00 EUR
Veranstalter:
P. E. Schall GmbH & Co. KG schall-messen.de, controlmesse.de
fer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Dr.-Ing. Ralf Christoph, Geschäftsführer und Inhaber von Werth Messtechnik, Florian Schwarz, CEO CAQ AG Factory Systems, sowie Dr Christian Wojek, Head of AI, Zeiss IQS. Neben Möglichkeiten der Effizienzsteigerung begünstigt eine intelligente QS auch die Herstellung sicherer Produkte. Die Reduzierung potenzieller Fehlerkosten, die Vermeidung von Materialverschwendung und von Mehrarbeit sowie eine hohe Kundenzufriedenheit sind unmittelbar mit der QS verbunden. Je moderner und durchgängiger die QS-Abläufe, desto weniger Störungen gibt es in der Wertschöpfungskette. Der Trend geht hin zu Vollautomatisierung der Prüfprozesse noch während der Produktherstellung; sie werden schneller und effizienter, sie erfolgen inline und integriert in unterschiedlichste Abläufe. Fachbesucher werden zu diesen Themen im Rahmen des Vortragsforum auf den aktuellen Stand gebracht.
«Wir freuen uns auf die Control 2025, sie wird wieder ein erstklassiges Branchentreffen», so Bettina Schall, Geschäftsführerin des Messeveranstalters P E. Schall. «Bei diesem traditionellen Event der Expertencommunity werden viele neue Fachinformationen ausgetauscht und wichtige neue Geschäftskontakte geknüpft Deshalb ist das persönliche Gespräch auf der Messe so wichtig.» controlmesse.de
Die diesjährige Hannover Messe war einerseits geprägt von vielen wirtschaftspolitischen Unsicherheiten. Andererseits zeigte sich die Messe als Innovationsmotor: Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung, Digitalisierung und Elektrifizierung sorgen für Effizienzsprünge in der Industrie.
«Die Hannover Messe 2025 war ein kraftvolles Bekenntnis zur Zukunftsfähigkeit der Industrie in Deutschland und Europa – im Schulterschluss mit ihren internationalen Partnern», sagt Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG. «In einer von Unsicherheit geprägten Weltlage wurde sie ihrer Rolle als Tech-Show, Business-Messe und Plattform für den wirtschaftspolitischen Dialog und die internati-
onale Kooperation mehr als gerecht Die Hannover Messe ist der Ort, an dem die analoge Welt der Maschinen mit der digitalen Intelligenz vernetzt wird – hier wird sichtbar, wie Digitalisierung und KI industriellen Fortschritt möglich machen.»
Rund 127000 Besucher aus 150 Ländern tauschten sich mit den 4000 ausstellenden Unternehmen darüber aus, wie sie KI gewinnbringend einsetzen, ihre Fabriken auto-
matisieren oder Energie effizienter nutzen, gibt der Veranstalter Deutsche Messe in seiner Abschlusserklärung bekannt. Mehr als 40 Prozent der Besucher kamen demnach aus dem Ausland. Die wichtigsten Besucherländer nach Deutschland waren China, die Niederlande, Kanada, Polen, Südkorea und Japan. «Die ausstellenden Unternehmen haben eindrucksvoll gezeigt: Technologisch haben wir alle Trümpfe in der Hand, um in

Rund 127000
Besucher aus 150 Ländern und 4000
Aussteller – das ist die Bilanz der Hannover Messer 2025.


Deutschland und Europa wettbewerbsfähig, nachhaltig und innovativ zu produzieren. Die Messe hat der Industrie – gerade in herausfordernden Zeiten – Orientierung und Rückenwind geboten In vielen Gesprächen berichteten die Aussteller von einer aufkeimenden Zuversicht, die es nun zu verstetigen gilt», so Köckler.
Unternehmen und Partnerverbände ziehen positive Bilanz
«Die Hannover Messe hat abermals gezeigt, dass sie die wichtigste Plattform für industrielle Innovation ist», sagt Dr. Gunther Kegel, Präsident des ZVEI und Vorsitzender des Ausstellerbeirats der Hannover Messe «Besonders KI in der industriellen Anwendung stand im Interesse der Besucherinnen und Besucher, gerade auch aus dem Ausland. Industrielle KI ist ein neues Wachstumsfeld und wird der Automatisierung und Digitalisierung der Industrie einen neuen Schub verleihen.» Thilo Brodtmann, VDMA-Hauptgeschäftsführer: «Die diesjährige Hannover Messe hat in besonderem Masse gezeigt, wie wichtig gute Partnerschaften und offene Märkte für eine export- und innovationsgetriebene Industrie wie den Maschinen- und Anlagenbau sind. Die Bereitschaft des Gastlands Kanada, mit Europa den Handel zu vertiefen, ist eine erfreuliche und ermutigende Nachricht in einer Welt, die von zunehmenden Handelsdisputen geprägt ist Um die grossen Aufgaben, die vor uns liegen, zu bewältigen, braucht es Innovationen, wie sie auf der Messe in allen Hallen eindrucksvoll gezeigt wurden.»
Top-Thema KI in der Industrie
Das Top-Thema der diesjährigen Messe waren KI-Anwendungen für die Industrie «KI
hat das Potenzial, die Industrie innerhalb weniger Jahre stärker zu verändern, als sich die Industrie in der gesamten vergangenen Dekade gewandelt hat», sagt Köckler Die ausstellenden Unternehmen zeigten anhand konkreter Beispiele, wie produzierende Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren können
Durch den gezielten Einsatz dieser Technologien können auch kleine und mittlere Unternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöhen», sagt Köckler. Ganz konkret zeigt dies eine neue Studie auf, die vom VDMA und der Beratungsgesellschaft Strategy& auf der Hannover Messe vorgestellt wurde. Demzufolge kann der Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz die Gewinnmarge im Maschinen- und Anlagenbau um bis zu 10,7 Prozentpunkte erhöhen
In den Energiehallen der Hannover Messe drehte sich alles um Effizienz und Nachhaltigkeit. Dabei kam dem Thema Wasserstoff eine herausragende Rolle zu Allein in der Halle 13 präsentierten auf den Ständen der Hydrogen + Fuel Cells Europe rund 300 Unternehmen ihre neuesten Entwicklungen und Anwendungen im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen
Das Partnerland Kanada hat sich eindrucksvoll auf der Hannover Messe präsentiert. Besonders hervorgetreten ist die innovative Rolle kanadischer Unternehmen und Institutionen in Schlüsselbereichen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und erneuerbare Energien Die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sowie der starke Fokus auf nachhaltige Technologien unterstreichen Kanadas Bedeutung als dynamischer Akteur auf den globalen Zukunftsmärkten.

Unternehmen und Institutionen in Schlüsselbereichen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und erneuerbare Energien
Stéphane Dion, Sonderbeauftragter für die Europäische Union und Europa und Leiter der kanadischen Delegation zur Hannover Messe 2025: «Das Jahr für Kanada als Partnerland der Hannover Messe 2025 war ein voller Erfolg und hat unsere Ziele zur Marktdiversifizierung erheblich vorangebracht, da Kanada seine Bemühungen fortsetzt, seine Präsenz auf dem deutschen und europäischen Markt auszubauen. Kanada freut sich darauf, gemeinsam mit Deutschen und Europäern eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer grünen, digitalen und widerstandsfähigen Zukunft zu spielen.» Die nächste Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24 April 2026 statt. Partnerland wird Brasilien sein hannovermesse.de
Die Datatec Schweiz AG hat mit Marco Pompa einen neuen Geschäftsführer. Datatec ist seit mehr als 30 Jahren im Schweizer Markt als kompetenter Ansprechpartner für Messund Prüftechnik aktiv. Im Interview berichtet Marco Pompa über Ausrichtung und aktuelle Entwicklung des Unternehmens.

Staffelübergabe bei der Datatec Schweiz AG: Der neue Geschäftsführer Marco Pompa (rechts) übernimmt die Verantwortung von Franco Schmid, der in den Ruhestand gegangen ist
Quelle: Datatec
Die Datatec Schweiz AG begrüsst mit Marco Pompa einen neuen Geschäftsführer, der bereits zum 1. März 2025 die Leitung des Unternehmens übernommen hat. Pompa übernimmt die Verantwortung in einer Zeit, in der sich das Unternehmen auf den weiteren Ausbau seiner Präsenz und die Erweiterung seines Portfolios konzentriert.
«Wir sind seit mehr als 30 Jahren im Schweizer Markt als kompetenter Ansprechpartner für Mess- und Prüftechnik aktiv und etablieren uns nunmehr seit zwei Jahren zunehmend unter der Marke Datatec», erklärt M. Pompa Seit 2023 gehört das Unternehmen zur europaweit agierenden Datatec Gruppe, die in Ländern wie Deutschland, Österreich, Spanien, Schweden, Finnland und Estland aktiv ist. Die Datatec Schweiz AG wird auch in Zukunft mit einem engagierten Team aus Aussendienstmitarbeitern und Anwendungsspezialisten eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um die optimale Lösung für jede Messaufgaben zu finden Für den direkten Austausch können Interessierte die Datatec auf wichtigen Messen wie der Sindex in Bern oder der Maintenance in Zürich antreffen.
Interview mit Marco Pompa
at–aktuelle technik: In diesem Jahr feiert die Datatec AG ihr 40-jähriges Jubiläum. Wie können Sie in der Schweiz von der langjährigen Expertise profitieren?
Marco Pompa: Die 40-jährige Geschichte der Datatec AG in Deutschland ist für uns in der Schweiz ein unschätzbarer Vorteil Wir profitieren stark vom kontinuierlichen Know-how-Transfer und vom engen Aus-

tausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Dabei geht es sowohl um technische als auch kommerzielle Themen
Die Erfahrung, die über Jahrzehnte im deutschen Markt gesammelt wurde, hilft uns, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen und auf bewährte Prozesse und Lösungen zurückzugreifen. Das gibt uns Sicherheit – und unseren Kunden ebenfalls.
Seit 2022 ist die Marke Datatec auch in der Schweiz aktiv. Was hat sich seitdem verändert?
M. Pompa: Wir sind bereits seit vielen Jahren im Schweizer Markt als kompetenter Ansprechpartner für Mess- und Prüftechnik aktiv und etablieren uns nunmehr seit zwei Jahren zunehmend mit der Marke Datatec Besonders geschätzt wird unsere Nähe zum Kunden: Wir setzen bewusst auf den persönlichen Austausch und bauen unsere Beziehungen gezielt aus Dieses Vertrauen, das wir durch regelmässige Besuche und individuelle Beratung aufbauen, ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur – und es macht sich bezahlt.
Seit dem 1. März 2025 sind Sie neuer Geschäftsführer der Datatec Schweiz. Wie wird sich das Unternehmen weiterentwickeln?
Marco
feinern und unser Profil in der Schweiz noch weiter schärfen – insbesondere durch Kundennähe, technische Kompetenz und verlässliche Services.
In welche Richtung soll sich das Portfolio der Datatec Schweiz entwickeln?
M. Pompa: Unser Portfolio ist nie «fertig» –es entwickelt sich kontinuierlich weiter In enger Abstimmung mit unseren Ansprechpartnern bei den Herstellern analysieren wir laufend den Markt und passen unser Angebot an die spezifischen Anforderungen unserer Kunden an. Unser Ziel ist es, in der Schweiz künftig noch mehr renommierte Marken ins Portfolio aufzunehmen, die unsere bestehenden Lösungen optimal ergänzen. Dabei achten wir stets auf Qualität, Innovationsgrad und Kundennutzen.
Als Experte für Mess- und Prüftechnik ist Datatec stark auf die Industrie ausgerichtet. Was steht hier im Fokus?
M. Pompa: Die Schweizer Industrie ist vielseitig und technologisch auf höchstem Niveau
Unser Anspruch ist es, mit unseren Lösungen möglichst viele Branchen und Anwendungsfelder abzudecken – sei es in der Forschung, der Automatisierung, der Elektronikentwicklung oder in der Energie- und Medizintechnik.
Die gegenwärtigen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen sind sehr volatil. Was bedeutet das konkret für Datatec?
M. Pompa: Gerade in einem unsicheren Umfeld wird die Nähe zum Kunden noch wichtiger. Wir beobachten sehr genau, wie sich die Rahmenbedingungen auf unsere Zielbranchen auswirken und wo unsere Kunden ihre Prioritäten setzen.
Durch unsere tägliche Arbeit im Vertrieb und in der technischen Beratung gewinnen wir wertvolle Einblicke, die uns helfen, schnell und flexibel zu reagieren. Unsere Agilität ist ein grosser Vorteil – und unsere Kunden wissen das zu schätzen.
datatec.eu Bi
M. Pompa: Mein Einstieg fällt in eine sehr gute Ausgangslage. Franco Schmid als mein Vorgänger und das gesamte Team haben hervorragende Aufbauarbeit geleistet. Die Grundpfeiler, auf denen die Schweizer Niederlassung steht, sind solide, auf diesem Fundament will ich aufbauen, Prozesse ver-
Dafür arbeiten wir eng mit führenden Herstellern zusammen, um für jede Anwendung die passende Lösung bereitzustellen. Wir wollen dort präsent sein, wo Innovation entsteht – und unsere Kunden bei ihren Messanforderungen zuverlässig mit unseren Lösungen unterstützen.
Wie schätzen Sie die Lage in der Schweiz ein?
M. Pompa: Die Schweiz bleibt ein attraktiver Markt mit hoher technologischer Kompetenz und ist bekannt für ihre Präzision. Besonders erfreulich ist, wie stark hier weiterhin produziert wird – oft mit einem hohen Innovationsgrad Neben der Industrie sind auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein bedeutender Sektor für uns. Sie haben einen kontinuierlichen Bedarf an präziser Messtechnik.
Ein gutes Beispiel, wie wichtig dabei der Austausch ist, zeigen Events wie der Technologietag 2024 bei Maxon oder der M-Day in Baden im Rahmen des NI Swiss User Group Meetings im März 2025 Solche Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, unsere Expertise unter Beweis zu stellen
Wie unterstützen Sie Ihre Kunden in der Schweiz? Wo können Interessierte Sie persönlich treffen?
M. Pompa: Wir unterstützen unsere Kunden mit einem engagierten Team aus Aussendienstmitarbeitern und Anwendungsspezialisten. Datatec steht für fundierte technische Beratung und individuelle Lösungsansätze.
Persönlich treffen kann man uns auf den wichtigsten Branchenevents in der Schweiz – darunter die Sindex in Bern oder die Maintenance in Zürich. Diese Veranstaltungen sind für uns wichtige Plattformen, um im direkten Austausch zu bleiben, Trends zu diskutieren und neue Partnerschaften zu knüpfen.

Die international führende Fachmesse für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik, Erneuerbare Energie und Energiemanagement verzeichnet über 600 Anmeldungen ausstellender Unternehmen, davon 61% international, gibt der Veranstalter Mesago in einer Mitteilung bekannt. «Das grosse Interesse auf Anbieterseite verdeutlicht die hohe
Relevanz des Messeangebots und des vorgestellten Themenspektrums, das die gesamte Wertschöpfungskette der Leistungselektronik abdeckt», erläutert Lisette Hausser, Vice President PCIM der Mesago Messe Frankfurt GmbH. Zu den Ausstellern zählen Branchenführer wie Infineon, Mitsubishi, Semikron Danfoss und EPC. Die neuen Hallen 4 und 4A profitieren von dem vielfältigen Angebot von beispielsweise Toshiba, Novosense, Microelectronics, Renesas Electronics und Endrich Bauelemente Mit mehr als 160 Neuausstellern aus 20 Ländern wie zum Beispiel Italien, Japan und Frankreich verspricht die Fachmesse zudem ein noch umfangreicheres und vielfältigeres
Angebot, das die Potenziale der Leistungselektronik in all ihren Facetten präsentiert. Die Teilnahme neuer Unternehmen aus verschiedenen Nationen fördert die Vernetzung auf globaler Ebene und schafft Synergien, die die Entwicklungen neuer Technologien beschleunigen können Die PCIM Conference 2025, begleitend zur PCIM Expo, bietet drei Tage voller Inspiration, Innovation und Interaktion Mit über 450 Erstveröffentlichungen aus Industrie und Wissenschaft stellt sie eine zentrale Plattform für den Wissenstransfer und die Präsentation spannender Entwicklungen dar.
pcim.mesago.com
Die Harting Technologiegruppe, ein global führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik, hat angekündigt, überregionale Top-Management-Positionen in der Schweiz zu bündeln. Mit diesem Schritt will sich die Harting Technologiegruppe zukunftssicher zum Global Player für ConnectivityLösungen entwickeln.
Philip Harting, CEO der Harting Technologiegruppe, erklärt:
«Der Aufbau des globalen Headquarters in der Schweiz ist für Harting ein weiterer Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung und Internationalisierung mit dem Ziel, global wettbewerbsfähig und regional schlagkräftig aufgestellt zu sein. So werden wir auch den globalen Rahmenbedingungen
und den Anforderungen unserer Kunden gerecht.»
Harting ist seit mehr als 40 Jahren in der Schweiz mit einem Produktionsstandort aktiv und steuert unter anderem bereits seine globalen Innovation Hubs aus der Schweiz. «Zusammen mit der Studer Cables AG in Däniken, die die Unternehmerfamilie vor zwei Jahren erworben hat, möchten wir gemeinsam Steckverbinder-Kabellösungen weiterentwickeln und für unsere Kunden Mehrwerte schaffen», unterstreicht Philip Harting, der auch als Verwaltungsratsvorsitzender der Studer Cables AG agiert. Das globale Headquarter in der Schweiz wird laut Unternehmensangaben in Aarau auf dem alten ABB-Gelände ange-

siedelt werden. Philip Harting ist sich sicher, dass sich der Aufbau des Headquarters in der Schweiz positiv auf das Unternehmen mit seinen rund 6000 Mitarbeitern weltweit auswirken wird und sich die Unternehmensgruppe erfolg-
reich entwickelt. Mit dem Schritt sollen langfristig Arbeitsplätze und Investitionen in Deutschland sowie auch in der Schweiz und weltweit gesichert werden
harting.com
Globale Krisen und politische Konflikte prägten das vergangene Jahr, wirtschaftlich sorgten die Ereignisse für eine uneinheitliche Konjunktur. «2024 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen», sagte CEO Dr. Peter Selders auf der Bilanzpressekonferenz im schweizerischen Reinach. «Wir haben nicht alle unsere Ziele erreicht. Aber Endress+Hauser hat sich erfolgreich behauptet. Wir haben viele Themen bewegt und unser Unternehmen vorangebracht.» Der Nettoumsatz der Firmengruppe stieg leicht um 0,7 Prozent auf 3,744 Milliarden Euro. Das organische Wachstum – ohne Währungseinflüsse – bezifferte CFO Dr. Luc Schultheiss mit 1,3 Prozent
Alle drei grossen Märkte – die USA, China und Deutschland –entwickelten sich nur verhalten. In Europa sanken die Verkäufe um 0,9 Prozent, hauptsächlich wegen der rückläufigen Zahlen in Deutschland
Endress+Hauser schuf im vergangenen Jahr weltweit 514 neue Arbeitsplätze. Ende 2024 zählte die Firmengruppe 17 046 Mitarbeiter. Vor allem in der Produktion kamen neue Stellen hinzu, ebenso in der Ausbildung Die Ausbildungsquote stieg auf 3,7 Prozent; Ziel ist ein Anteil von 5 Prozent
349,3 Millionen Euro, so viel wie noch nie, investierte Endress+Hauser in neue Gebäude, Anlagen und IT. Derzeit

setzt die Gruppe Investitionsvorhaben für über 550 Millionen Euro um – das grösste davon am Produktionsstandort im süddeutschen Maulburg. Das Unternehmen brachte im vergangenen Jahr 81 Produkte neu auf den Markt. Mit 285
Erstanmeldungen bei Patentämtern in aller Welt unterstrich Endress+Hauser diesen Anspruch. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung entsprechen 7,4 Prozent des Umsatzes endress.com



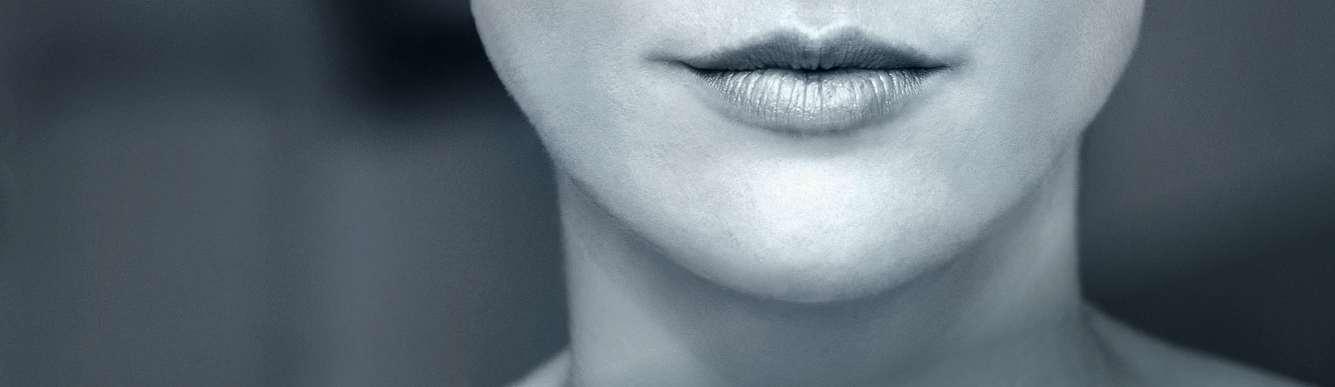

Die Sensor+Test 2025, die vom 6. bis 8. Mai 2025 in Nürnberg stattfindet, festigt ihre Position als international führende Fachmesse für Sensorik, Messund Prüftechnik. Die Sensor+Test setzt bewusst auf Spezialisierung. Hier stehen Sensorik, Mess- und Prüftechnik im Mittelpunkt, wodurch Aussteller direkt im Zentrum des Geschehens agieren können. Dies gilt für alle Schlüsselindustrien –von Automotive und Maschinenbau über Rail bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Diese klare Fokussierung ermöglicht es Fachbesuchern, effizient und zielgerichtet die für sie relevanten Innovationen und Technologien zu entdecken Elena
Schultz, Geschäftsführerin der veranstaltenden AMA Service GmbH, betont: «Unsere Messe ist gefragt wie nie zuvor, weil wir den Ausstellern eine Plattform bieten, auf der sie nicht nur gesehen, sondern auch wertgeschätzt werden.»
Die Sensor+Test zieht nach der Covid-Zeit wieder zahlreiche Aussteller und Fachbesucher aus dem In- und Ausland an. 2024 präsentierten 383 Unternehmen aus 29 Ländern das gesamte Spektrum der Systemkompetenz – von Sensoren über Cloud-Technologien bis hin zu KI-Lösungen. Diese internationale Ausrichtung unterstreicht die Bedeutung der Messe als globalen Branchen-

treffpunkt. Auch für 2025 wird eine hohe Beteiligung und grosses internationales Interesse erwartet – gestützt durch zahlreiche Presse- und Marketingprojekte sowie Einladungen zur Sensor+Test von Branchenakteuren. Für die Aussteller ist
die Sensor+Test eine wertvolle Plattform: Hier treffen sie bestehende Kunden, gewinnen neue Interessenten und initiieren fundierte, geschäftsaufbauende Projekte.
sensor-test.de

Die DMB Technics AG aus Hünenberg in der Schweiz stellt sich für die Zukunft auf: Nach 20 erfolgreichen Jahren als CEO und CMO übergeben Dieter Heimgartner und Christa Barmettler ihre Positionen in der Geschäftsleitung an das neue Management-Team. Mit dem 1. April 2025 hat Joël Heimgartner die Position des Geschäftsführers übernommen.
Gemeinsam mit Philipp Achermann als CSO, Janine Flückiger als CFO und Raphael Maurer als CTO führt das neue Management die DMB Technics AG in die nächste Wachstumsphase. Alle Managementmitglieder sind langjährige Mitarbeiter der DMB Technics und gewährleisten somit eine interne Nachfolgelösung Dieter Heimgartner wie auch Christa
Barmettler bleiben dem Unternehmen als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates erhalten, wodurch Kontinuität und Stabilität gewährleistet werden.
Mit diesem Managementwechsel geht die Führung der DMB Technics nahtlos an die nächste Generation über. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Kombination aus Erfahrung und neuen Impulsen. Joël Heimgartner verfügt über langjährige Erfahrung als Key Account Manager und Führungskraft in verschiedenen Industriebranchen. Mit seiner Expertise in der strategischen Geschäftsentwicklung und operativer Umsetzung wird er das Unternehmen gezielt weiterentwickeln und die Unternehmensstrategie mit starkem Kundenfokus vorantreiben.
Janine Flückiger ist bereits seit fünf Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und verfügt über fundierte Erfahrung im Finanzwesen, was für die Stabilität und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens essenziell ist. Raphael Maurer verstärkt das Team als Technikexperte mit langjähriger Erfahrung in der Displayindustrie. In seiner Karriere hat er unter anderem acht Jahre in China bei einem strategischen Produktionspartner der DMB Technics in verschiedenen Positionen gearbeitet. Philipp Achermann bringt als CSO umfassende Sales- und Marketingerfahrung aus verschiedenen Industriebranchen mit und wird die internationale Markterschliessung weiter vorantreiben. dmbtechnics.com

Der Siemens Industrial Copilot hat den Hermes Award 2025 gewonnen. Die Deutsche Messe AG verleiht diese führende Industrieauszeichnung zur Eröffnung der Hannover Messe Der Preis würdigt ein herausragendes Produkt, das einen hohen Grad an technologischer Innovation mit einer bedeutsa-
men Auswirkung auf die Zukunft der Industrie kombiniert.
«Der Hermes Award ist eine der höchsten Auszeichnungen der Industrie für Innovation. Mit dem Siemens Industrial Copilot revolutionieren wir, wie Menschen mit Maschinen interagieren. Es geht um Geschwindigkeit und Einfachheit. Das wird
die Vorteile der Automatisierung breit verfügbar machen, beispielsweise Codegenerierung beschleunigen und komplexe Aufgaben einfach und schneller erledigen lassen», sagte Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Siemens Digital Industries. Der Siemens Industrial Copilot ist das erste Produkt mit generativer Künstlicher Intelligenz (KI) für industrielle Umgebungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – von Design, Planung und Entwicklung bis hin zu Betrieb und Service. Der von generativer KI angetriebene Assistent ermöglicht, Code für speicherprogrammierbare Steuerungen in ihrer Muttersprache zu generie-
ren. Das bedeutet, dass sich wiederholende Aufgaben an den Siemens Industrial Copilot ausgelagert werden können Auch die Entwicklung komplexer Aufgaben wird weniger fehleranfällig. Dies wiederum verkürzt die Entwicklungszeiten und steigert langfristig Qualität und Produktivität. «Der Hermes Award ist ein Beweis für die Exzellenz und den innovativen Geist unseres gesamten Teams», sagte Rainer Brehm, CEO Factory Automation bei Siemens Digital Industries. «Mit dem Siemens Industrial Copilot befähigen wir unsere Kunden, zu nachhaltigen digitalen Unternehmen zu werden.»
siemens.com



Mit innovativen Methoden zur CO2-Nutzung und -Speicherung wird Kohlenstoffdioxid zur Ressource für eine klimaneutrale Industrie. Die CCUS-Strategie umfasst die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2, um es entweder weiterzuverwerten oder dauerhaft zu lagern. Entscheidend dabei ist eine präzise Messung der Prozessparameter.
TDLAS- und QF-Analysatoren von Endress+Hauser bieten eine zuverlässige Lösung.
Frederik Effenberger, Industry Manager Decarbonization, Endress+Hauser
Für eine klimaneutrale Zukunft strebt die Schweiz an, bis 2050 eine ausgeglichene Klimabilanz zu erreichen. Das bedeutet, dass die Schweiz nicht mehr Treibhausgase ausstossen will, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden können.
Dieses Ziel wurde im August 2019 vom Bundesrat beschlossen und ist seit Januar 2025 gesetzlich verankert. Hier gewinnt die CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) Strategie zunehmend an Bedeutung Sie umfasst die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 aus fossilen Energie-
quellen und industriellen Prozessen, um das CO2 entweder weiterzuverwerten oder dauerhaft in geologischen Tiefen zu lagern. Obwohl immer mehr Industrieanlagen auf CO2-Abscheidungsanlagen setzen, stehen einem effizienten CO2-Kreislauf noch erhebliche Herausforderungen entgegen. Der Erfolg


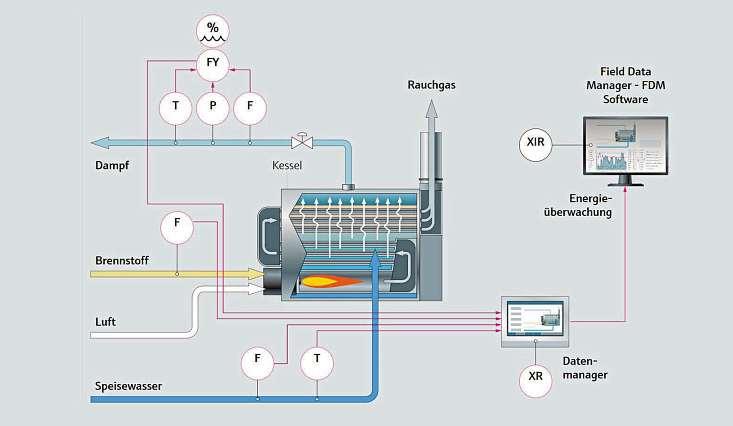
Prozessgrafik Kesseleffizienz.
hängt von der präzisen Messung der Prozessparameter sowie der CO2-Mengen und -Qualität vor, während und nach der Abscheidung ab Denn nur mit verlässlichen Daten können Unternehmen die nahtlose Weiterverwendung, den sicheren Transport und die langfristige Lagerung von CO2 gewährleisten
CO2 im Griff: Präzise Analyse für sichere CO2-Aufbereitung und -Transport Um die Menge an CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren, bedarf es der Abscheidung von CO2 direkt aus industriellen Quellen wie
Kraftwerken, Zementfabriken oder Bioenergieanlagen. Dafür bieten sich zwei aktiv abscheidende Emissionstechnologien an: Carbon Capture (CC) fängt CO2 ein, bevor es in die Luft abgegeben wird und dort einen schädlichen Einfluss auf das Klima nimmt. Besonders hier unterscheidet man zwischen biogenem CO2, welches aus nachwachsendem Pflanzenmaterial stammt, und dem CO2 aus fossilen Quellen. Direct Air Capture (DAC) hingegen fängt bereits in die Atmosphäre abgegebenes CO2 direkt aus der Umgebungsluft ein. Ist das CO2 abgeschieden,
muss es je nach Quelle entsprechend aufbereitet werden. Bei der Gasaufbereitung wird das abgeschiedene CO2-Gas behandelt, um Verunreinigungen und nicht kondensierbare Gase zu entfernen Dies ist von entscheidender Bedeutung, da diese Verunreinigungen, wenn sie nicht entfernt werden, den Kompressions-, Transport- und Speicherprozess stören könnten Besonders wichtig ist es, Korrosion in den CO2-Pipelines zu verhindern, die durch das Vorhandensein von Wasser (H2O), Schwefelwasserstoff (H2S) und Sauerstoff (O2) begünstigt wird Daher sind regelmässige Analysen erforderlich, um die Reinheit des CO2 zu gewährleisten. So können beispielsweise Korrosion und Eisbildung in den Pipelines oder auch Kondensation und Korrosion in Kompressorstationen verhindert werden
Um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden, bieten TDLAS- und QFAnalysatoren von Endress+Hauser eine zuverlässige Lösung für die Messung und Überwachung im Rahmen von CCUS-Anwendungen. Diese hochmodernen Geräte ermöglichen berührungslose Echtzeitmessungen, die besonders präzise sind. Beim CO2-Transport über Pipelines liefern TDLASAnalysatoren Echtzeitanalysen, während QF-Analysatoren O2-Rückstände aufspüren, um Korrosion zu verhindern. Dank ihrer hohen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Stabilität und ihres geringen Wartungsaufwands sind diese Technologien den alternativen Methoden überlegen und tragen massgeblich zur Sicherheit und Effizienz des gesamten Prozesses bei
CO2 als Baustein für neue Materialien Industrien können das abgeschiedene CO2 vielfältig weiterverwenden, etwa zur Herstellung von Kraftstoffen, Chemikalien und Baumaterialien.
So dient es beispielsweise als Ausgangsstoff für synthetische Kraftstoffe, Polymere, Düngemittel und Karbonate im Bauwesen. Besonders in der chemischen Industrie spielt CO2 eine wichtige Rolle bei der Produktion von Methanol, einem Grundstoff für zahlreiche alltägliche Produkte, von Kunststoffen und Kleidung bis hin zu Kraftstoffen und Medikamenten Traditionell wird Methanol durch eine Reaktion von Kohlenmonoxid (CO) mit Wasserstoff (H2) unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Doch in den vergangenen Jahren hat sich CO2 als alternativer Rohstoff für die Methanolsynthese etabliert.
Zwischen Gas und Flüssigkeit: Präzision bei der CO2-Durchflussmessung
Wird das nicht genutzte CO2 gespeichert, muss es für den Transport durch die Pipelines exakt erfasst werden: Denn in dieser Phase weist CO2 eine Viskosität auf, die der eines Gases ähnelt, aber gleichzeitig eine Dichte besitzt, die eher der einer Flüssigkeit entspricht. Das stellt eine Herausforderung für die Durchflussmessung dar. Aufgrund der ungewöhnlichen Unterschiede in den thermophysikalischen Eigenschaften von CO2 ist es besonders wichtig, dass man Temperatur und Druck in der Pipeline sorgfältig kontrolliert. Auf diesem Gebiet verfügt Endress+Hauser über das Fachwissen und die Erfahrung, um komplexe CO2-Durchflussmessungen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Quantitäts- und Qualitätsparameter durchzuführen. Die Coriolis-Massedurchflussmessgeräte bieten zuverlässige und bewährte Technologien für Messungen in der dichten CO2-Phase, die höchste Genauigkeit und Reliabilität gewährleisten. Ausserdem bieten Endress+Hauser komplette MeteringSkids für die genaue Messung am Übergabepunkt.
CO2-Transportinfrastruktur: Sicherer Weg zur Speicherung
Wohin das CO2 geliefert wird, hängt in der Regel davon ab, ob eine Pipeline, ein LKW, die Bahn oder ein Schiff zur Verfügung steht Der Eisenbahntransport ist in Bezug auf die Kosten pro Kilometer die zweitbeste Option für das Inland Der Transport per Schiff kommt vor allem dann in Frage, wenn das CO2 zur dauerhaften Sequestrierung vor der Küste deponiert oder als Rohstoff in eine Region verkauft werden soll, in der ein Transport im Inland nicht möglich ist Besonders für grosse Industriecluster oder Industrieanlagen, die grosse Mengen Kohlenstoffdioxid abscheiden und abtransportieren müssen, braucht es ein flächendeckendes Netz für Pipelines, welches die Kosten- und Mengenbasierte beste Lösung des Transports darstellt Genauso wie das dichte Netz von Ladestationen über den Erfolg und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen entscheidet, wird auch ein gut ausgebautes PipelineNetzwerk notwendig sein, um den effizienten Transport und die sichere Speicherung von CO2 sicherzustellen.
CO2-Speicherung im Meer oder in der Erde Die Speicherung von Kohlendioxid kann sowohl unter der Erde als auch unter dem Meer

erfolgen, wobei das CO2 für künftige Nutzung oder dauerhafte Isolation aufbewahrt wird. Die Nordsee wurde als potenzieller Standort für die Speicherung unter dem Meer identifiziert, da ihre Sandsteinschichten eine Kapazität von etwa 100 Milliarden Tonnen CO2 bieten. Nach der Abscheidung wird das CO2 in etwa zwei Kilometer Tiefe in den Ozean injiziert, wo es von der Atmosphäre isoliert bleibt Um sicherzustellen, dass das CO2 nicht wieder entweicht, sind kontinuierliche Überwachungen unerlässlich Daher sind umfassende Untersuchungen der Umweltrisiken bei der unterseeischen CO2-Speicherung notwendig.
CO2 kann auch sicher und langfristig in tiefen, porösen Gesteinsformationen gespeichert werden, oft über Tausende von Jahren Laut dem US National Energy Technology Laboratory (NETL) verfügt Nordamerika bei den aktuellen Produktionsraten über eine CO2-Speicherkapazität für mehr als 900 Jahre. Um geeignete Lagerstätten zu identifizieren, werden detaillierte geologische Untersuchungen durchgeführt. Geeignete Standorte sind häufig salzhaltige Aquifere oder erschöpfte Öl- und Gasfelder. Das CO2 wird in etwa 900 Metern Tiefe in poröses Gestein wie Sand- oder Kalkstein injiziert, wo es in den Porenräumen eingeschlossen wird. Dieses CO2 wird in einem «überkritischen» flüssigen Zustand gespeichert, ähnlich den Bedingungen, unter denen Flüssigkeiten stabil im Untergrund eingeschlossen
bleiben. Eine dichte Deckschicht aus nicht-porösem Gestein über der Lagerstätte verhindert ein Entweichen des CO2. Nach der Speicherung ist eine kontinuierliche Überwachung entscheidend, um sicherzustellen, dass das CO2 dauerhaft isoliert bleibt Die sorgfältige Standortwahl und Überwachung minimieren das Risiko eines Austretens und garantieren die Sicherheit der unterirdischen Speicherung.
CCUS als Wegbereiter
Damit CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) erfolgreich umgesetzt werden kann, bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Politik. Es müssen klare regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Einsatz dieser Technologien fördern und gleichzeitig die Sicherheit und Umweltverträglichkeit gewährleisten Zudem sind Investitionen in Infrastruktur, wie etwa ein flächendeckendes Netz für CO2-Transport und -Speicherung und der Nutzung, unerlässlich Investitionen in Forschung und Entwicklung sind weiterhin angezeigt, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von CCUSTechnologien zu steigern und ihre Anwendung auf breiter Basis zu ermöglichen Nur durch ein koordiniertes Vorgehen können die Potenziale von CCUS voll ausgeschöpft und ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet werden.
ch.endress.com
Für Objekterkennung, Distanzmessung und Füllstandsmessung sind Ultraschallsensoren oft die Lösung für knifflige Fälle. Aber was, wenn auch sie an ihre Grenzen stossen? Die Antwort ist ein innovatives Sensordesign von Baumer, das die Leistungsfähigkeit von Ultraschallsensoren deutlich steigert.
Ultraschallsensoren sind in der industriellen Automatisierung unverzichtbar. Sie können Medien und Objekte unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit und Farbe sicher erkennen und funktionieren auch unter staubigen sowie anderen schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig Daher kommen sie oft zum Einsatz, wenn Füllstände von Flüssigkeiten überwacht oder Objekte mit schwierigen Oberflächen erkannt werden sollen Als schwierige Oberflächeneigenschaften gelten transparent, spiegelnd oder
tiefschwarz, da hier optische Sensoren nicht immer zuverlässig detektieren. Ultraschallsensoren sind ebenfalls eine beliebte Lösung, wenn nichtmetallische Gegenstände erkannt werden sollen, da hier induktive Näherungsschalter nicht in Frage kommen Vor diesem Hintergrund sind die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschallsensoren vielfältig. Sie eignen sich für Aufgaben wie diese:
— Durchgangserkennung: In der Verpackungsindustrie sorgen sie für die präzise Zählung von Produkten.
Erkennung von Folien und Folienrissen: In Verpackungsmaschinen und Banderoliermaschinen übernehmen Ultraschallsensoren wichtige Kontrollfunktionen
— Stapelhöhenkontrolle: In der Logistik überwachen sie die Stapelhöhe von Paletten oder Kartons
— Abstandsmessung: Ultraschallsensoren bestimmen den Abstand zu Objekten, z.B in Montageprozessen.
— Schlaufenregelung: Ultraschallsensoren überwachen Rollendurchmesser, Span-

So kompakt ist die UF200Serie der Ultraschallsensoren mit NexSonic-Technologie

Das NexSonic-Ultraschallportfolio besteht aus dem ultraflachen UF200 für die Frontmontage, den äusserst kompakten UR12 und U300 sowie den besonders robusten UR18 und U500
nung und das Wickeln und Abwickeln von Materialien.
— Füllstandskontrolle von Flüssigkeiten und Schüttgut: Ultraschallsensoren messen präzise die Füllhöhe in Tanks, Behältern und Silos
NexSonic-Technologie für die ganz kniffligen Fälle
Mit der Einführung der wegweisenden NexSonic-Technologie macht Baumer eine neue Generation Ultraschallsensoren verfügbar, die deren Einsatzgebiete nochmals stark erweitert. Grundlage hierfür sind ein von Baumer entwickelter NexSonic-Ultraschallprozessor (ASIC) und ein eigenes, patentiertes Sensorelement-Design. Bei NexSonic-Ultraschallsensoren ist das Piezoelement mit dem ASIC direkt mit der Anpassschicht/Mem-

Anwendungsbeispiel
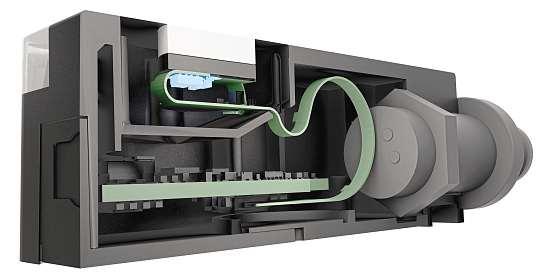
Die NexSonic-Technologie nutzt ein spezielles Sensordesign, das einen Teil der Elektronik (hellblau) direkt an das Sensorelement bringt. Das Ergebnis sind kürzere Signalwege und verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit.
bran verbunden Das Ergebnis sind kürzere Signalwege und verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit Die kompakte Bauweise der Auswerteelektronik ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Signalverarbeitung
Das NexSonic-Ultraschallportfolio von Baumer besteht aktuell aus dem ultraflachen UF200 für die Frontmontage, den äusserst kompakten U300 (kubisch) und UR12 (zylindrisch) sowie den besonders robusten U500 (kubisch) und UR18 (zylindrisch) und bietet diese besonderen Vorteile:
Hohe Geschwindigkeit und kompakte Grösse: Sensoren mit NexSonic-Technologie zählen zu den kleinsten und schnellsten auf dem Markt. Die distanzabhängige Verstärkung sorgt für eine konstante Signalqualität über den gesamten Erfassungsbereich
Kürzester Blindbereich: Dank kompakter Bauform und innovativer Technologie bieten die NexSonic-Ultraschallsensoren einen grossen Messbereich mit minimalem Blindbereich. Das ermöglicht flexible Integrationen in verschiedenen Anwendungen
Einstellbare Schallkeulenbreite: Über die IO-Link-Schnittstelle lässt sich die Schallkeulenbreite anpassen, was optimale Schalt- und Messergebnisse ermöglicht. Schmale Schallkeulen eignen sich ideal für enge Behälteröffnungen, breite Schallkeulen sind bei der Erkennung von Schüttgut in Bunkern optimal
Smarter Unterbrechungsfilter: Die integrierten Filterfunktionen erlauben eine individuelle Anpassung der Sensoren an die jeweilige Applikation. Das erhöht die Zuverlässigkeit Beispielsweise kann ein Rührwerk
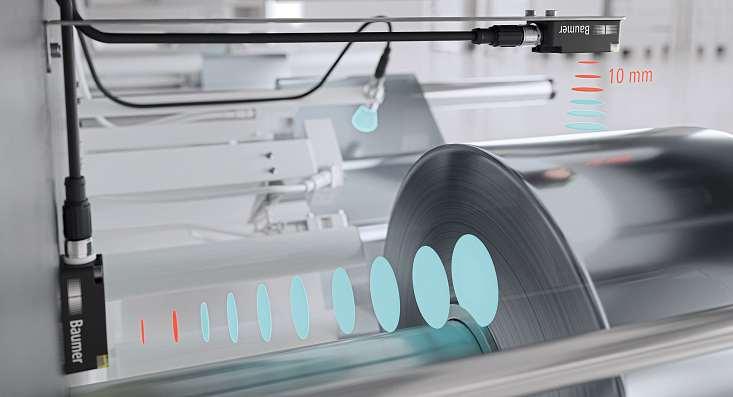
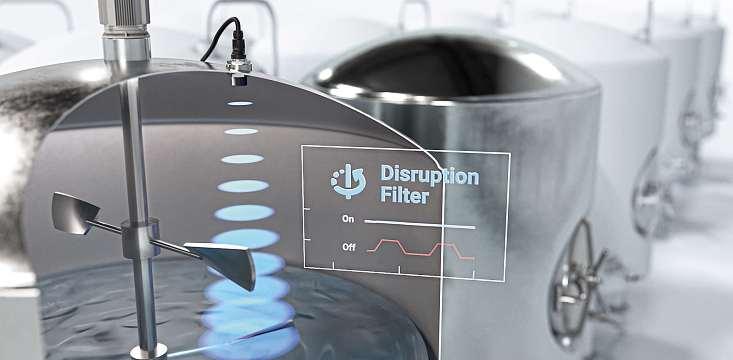

Füllstandsmessung in Behältern: Die individuelle Einstellung der Schallkeulenbreite (schmal, mittel, breit) über die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht diese Anpassung effizient
in einem Tank ausgeblendet werden, um stabile Füllstandsmessungen zu gewährleisten.
Konkrete Anwendungsbeispiele
Die neuartige Ultraschalltechnologie von Baumer bietet für viele Anwendungen messbaren Mehrwert und erschliesst durch die Verbindung von kurzem Blindbereich, kompakter Bauform und smarten Funktionen neue Einsatzfelder. Beispielhaft für diese Vielseitigkeit sind diese Szenarien:
Füllstandsmessung: Einige Anwendungen benötigen jeweils spezifische Schallkeulenbreiten, um optimale Messergebnisse zu erzielen Die Füllstandsmessung in einem grossflächigen Teilebunker erfordert eine breite Schallkeule, bei engen Behälteröffnungen muss die Schallkeule schmal sein Die individuelle Einstellung der Schallkeulenbrei-
te (schmal, mittel, breit) über die IO-LinkSchnittstelle ermöglicht diese Anpassung effizient
Schwer zu erfassende Objekte in beengtem Bauraum: Bestimmte Objektoberflächen lassen sich nur mit Ultraschalltechnologie sicher erkennen
Bei begrenztem Bauraum muss der Sensor dabei oft sehr nahe am zu erfassenden Objekt montiert werden, beispielsweise bei kompakten Maschinen und Geräten der Elektronikindustrie. Dies erfordert Ultraschallsensoren in platzsparender Bauform und einen kurzen Blindbereich bei ausreichend grossem Messbereich, wie beispielsweise der NexSonic-Sensor UF200 sie bietet. Anwendungsbeispiele sind die Überwachung des Durchmessers von Rollengütern, Stapelhöhenüberwachung von Verpackungsmaterial

Präsenzkontrolle bei beengten Platzverhältnissen ist dank sehr kurzem Blindbereich mit NexSonic-Ultraschallsensoren wie dem UF200 problemlos möglich
und Schlaufenregelung in der Zuführung von Blechbändern
Ultraschall-Portfolio auch für besondere Anforderungen
Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten erfordert ein breites Lösungsportfolio. Um den unzähligen Anwendungen gerecht zu werden, bietet Baumer ein umfangreiches Portfolio an Ultraschallsensoren Dieses Sortiment ermöglicht es Konstrukteuren, für jede spezifische Anwendung die passende Lösung auszuwählen. Baumer hat sich über viele Jahre als Experte in der Ultraschallsensorik etabliert, nicht zuletzt aufgrund des profunden Anwendungs-Know-hows und der Innovationskraft. Damit sind die Lösungen von Baumer sowohl für einfache als auch für komplexe Herausforderungen geeignet – unabhängig von den spezifischen Anforderungen wie chemischen Einflüssen, EMV-Bedingungen oder beengten Einbausituationen
Fazit
Die NexSonic-Technologie von Baumer bietet Anwendern nicht nur hohe Performance und einfache Handhabung, sondern auch intelligente Funktionen, die in der Applikation messbaren Mehrwert bieten. Mit kurzen Reaktionszeiten, flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und maximaler Konstruktionsfreiheit eröffnet die innovative NexSonic-Technologie von Baumer damit ganz neue Anwendungsfelder baumer.com
Robotergestützte Systeme zur 3D-Erfassung von Objekten und Bauteilen sind seit geraumer Zeit verfügbar. Charakteristisch für sie ist, dass sie ein Teaching benötigen Bei Bauteilen der Losgrösse 1 rentiert es sich u.U. nicht, den Roboter mit dem Pfad zur Erfassung des Objektes anzulernen – in dieser Zeit kann das Objekt ggf. auch per Handscanner erfasst werden.
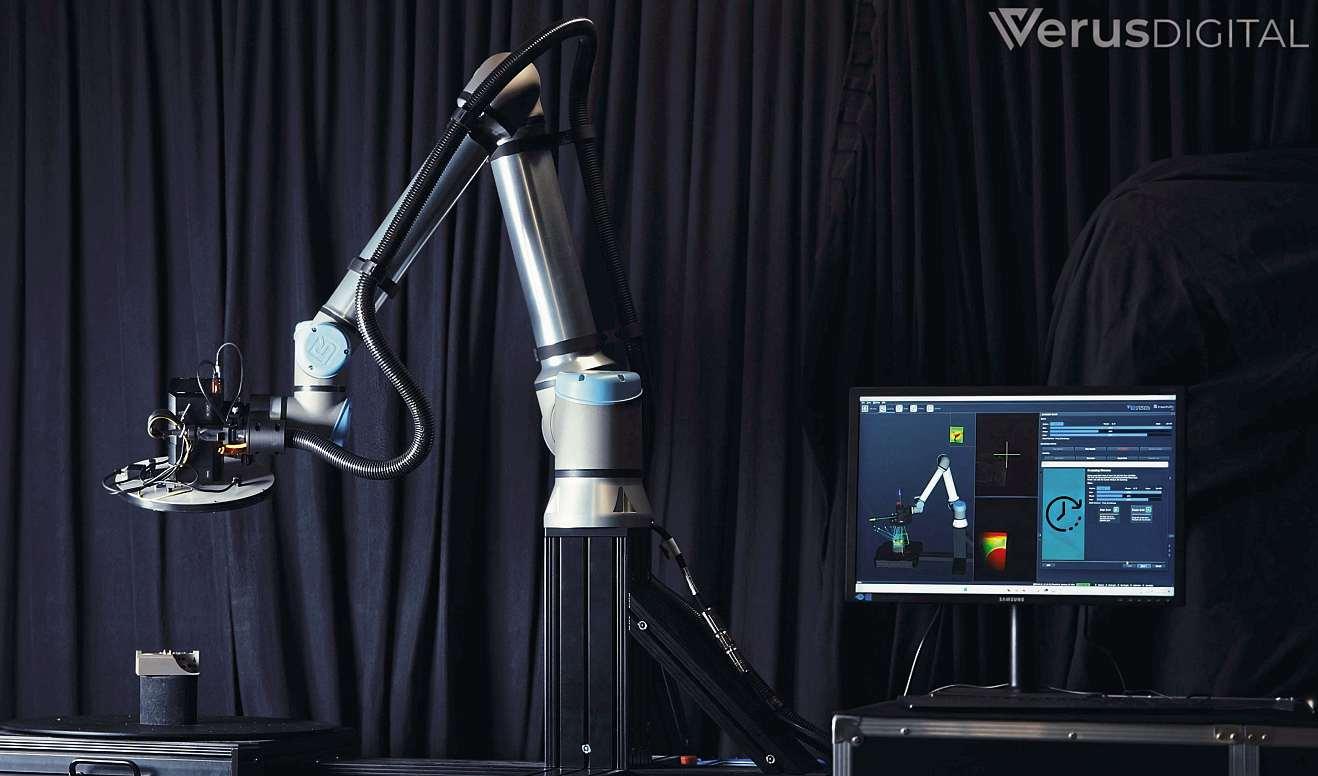
Das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD präsentiert das erste robotergestützte System, das Objekte komplett mit gewünschter Qualität vollautoma-
tisch erfasst. Ohne manuelle Nachbearbeitung generiert das System hochgenaue farbechte 3D-Modelle Der Schlüssel zur Vollautomation sind eigens von Fraunhofer
entwickelte Algorithmen zur dynamischen Pfadplanung der Ansichten des Roboters, aus denen das Objekt erfasst wird Die intel-
ligente automatische Ansichtenplanung stellt eine vollständige Abdeckung der sichtbaren Objektoberfläche in gewünschter Zielauflösung bis 10 Mikrometer sicher Das System ist zur vollautomatischen Erfassung von Kulturgegenständen wegen seiner einfachen Bedienbarkeit und hohen Güte bereits in mehreren Museen im Einsatz und auch für die Qualitätssicherung einsetzbar.
Einleitung
Durch die Verfügbarkeit preiswerter Hardware kann heute praktisch jeder, der ein Smartphone besitzt, seine Umwelt dreidimensional digital erfassen – das ist fast so einfach geworden, wie ein Foto zu machen Auf dem Weg zur Demokratisierung der 3DErfassung war die Kinect von Microsoft sicherlich mitentscheidend Heute sind deren Prinzipien in vielen Smartphones zu finden Je nach Anwendung ist neben der Geometrie des Objektes auch sein Aussehen relevant, so dass zusätzlich zu Tiefenbildern herkömmliche zweidimensionale Farbbilder erfasst werden.
In der industriellen 3D-Erfassung und Qualitätskontrolle kommen je nach Anforderungen unterschiedlichste Ansätze und Systeme zum Einsatz – diese fallen in die beiden grossen Klassen der berührungslosen bzw. nicht berührungslosen Systeme. Taktile Koordinatenmessmaschinen werden hauptsächlich zur hochgenauen punktuellen Abtastung gefertigter Features eingesetzt. Berührungsfreie Systeme hingegen werden eher zur grossflächigen 3D-Rekonstruktion von Oberflächen eingesetzt – eine vollständige Erfassung ergibt sich aus dem Zusammensetzen der aus verschiedenen Ansichten erfassten Teiloberflächen
Es müssen also viele Aufnahmen mit unterschiedlicher Position und Orientierung des

Sensors (einer oder mehrerer Kameras) gemacht werden, um die Oberfläche vollständig zu erfassen und 3D-rekonstruieren zu können, um ein 3D-Modell von dem physischen Objekt zu erhalten Recht einfach ist der Erfassungsprozess mit handgeführten 3D-Scannern, die manuell um das Objekt bewegt werden.
Je nach Form und Grösse muss der Benutzer den Scanner über viele unterschiedliche Positionen und Orientierungen bewegen, um alle sichtbaren Oberflächen oder auch nur die aufgabenrelevanten Bereiche zu erfassen – die Datenverarbeitung erfolgt dabei häufig im Stream, so dass der Benutzer zusehen kann, wie das digitale Abbild immer kompletter wird. Vollständigkeit und Qualität des Ergebnisses hängen u a. von der Erfahrung des Benutzers ab – die Wiederholgenauigkeit auch.
Der Benutzer ist während des Prozesses «gebunden» und kann nichts anderes tun –im Unterschied zum Vorgehen mit robotergestützten Ansätzen.

Da man sich in industriellen Prozessen zur Qualitätssicherung nicht auf die Erfahrung oder auch Tagesform von Menschen verlassen möchte, sind Schritte zur Automatisierung solcher Prozesse unternommen worden
Die erste Stufe bilden Kombinationen von 3D-Scannern und Drehtellern, die das Objekt vor dem Scanner rotieren lassen, so dass automatisch ein grösserer Teil der Oberfläche als aus einer Perspektive erfasst werden kann Eine zweite Stufe kombiniert den Drehteller mit einem Scanner, der automatisiert linear nach oben bzw. unten verfahren werden kann – dadurch kann noch mehr erfasst, aber keine vollständige Erfassung der sichtbaren Oberfläche ohne Umpositionierung des Objekts garantiert werden. In der dritten Stufe fährt der Roboter individuelle Positionen und Orientierungen an. Aus diesen werden jeweils Aufnahmen gemacht, um das Objekt möglichst vollständig zu erfassen.
Dem Roboter in einem Teachingprozess diese Positionen und Orientierungen beizu-

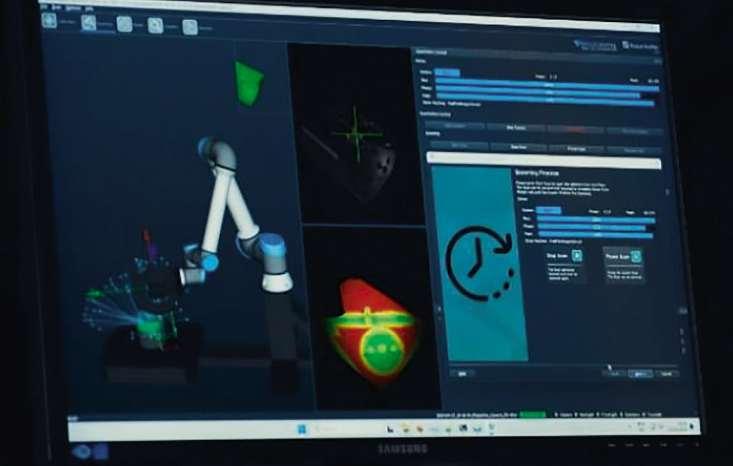
bringen, ist aufwendig Sind nur wenige Objekte eines Typs zu vermessen, dann rentiert sich das Teaching möglicherweise nicht.
Die eigentliche Herausforderung besteht aber darin, die notwendigen Positionen und Orientierungen zu bestimmen, die trainiert werden müssen, um eine vollständige Rekonstruktion in gewünschter Güte zu erreichen und dabei die Anzahl von Positionen und Orientierungen minimal zu halten, um einen möglichst schnellen Ablauf des Scanvorgangs zu gewährleisten
Genau hier setzt die Lösung an und ermöglicht eine vollautomatische 3D-Erfassung ohne vorheriges Teaching. Nach dem Aufbau des Systems erfolgt ein Kalibrierungsschritt. Danach muss der Benutzer nur noch die Höhe des Bereichs eingeben, der erfasst werden soll – der Durchmesser ist per default durch den Drehteller gegeben und kann vom Benutzer überschrieben werden. Der Prozess startet, nachdem der Benutzer das Objekt platziert hat, «mit einem Mausklick» und läuft dann vollautomatisch ab Währenddessen kann der Bediener anderen Aufgaben nachgehen – eine Visualisierung informiert über den Fortschritt bzw. das Ende des Prozesses. Standardmässig setzen wir Photogrammetrie ein. Während die Generierung des hochauflösenden finalen 3D-Modells läuft, kann ggf. schon ein nächstes Objekt erfasst werden.
Die Lösung Hardwareseitig besteht die Lösung im Wesentlichen aus einem Roboterarm, einem
Drehteller und einem Scansystem – das ist zunächst nicht ungewöhnlich. Die Hardware zeichnet sich durch Flexibilität und einen Aufbau aus, der so einfach wie möglich gestaltet ist, so dass auch Nicht-Fachkräfte ihn problemlos durchführen können
Der Clou liegt in der intelligenten Algorithmik, die den Prozess individuell dynamisch – also in Abhängigkeit von der bereits erfassten Information – steuert und weitere Schritte so anpasst, dass mit einer möglichst minimalen Anzahl von Kamerapositionen und -orientierungen eine maximale Abdeckung der sichtbaren Oberfläche in der vordefinierten Zielauflösung erreicht wird Es ist also kein Teaching des Roboters erforderlich! Eine Datenbereinigung, wie oft bei handgeführten Scannern nötig, wird automatisch durchgeführt, so dass ein 3D-Modell resultiert, an dem qualitätssichernde Untersuchungen durchgeführt werden können, welches als farbiges 3D-Modell, aber auch für andere Zwecke genutzt werden kann
Hardwarekomponenten
Wir unterscheiden die Hardwarekomponenten in Erfassungs- und Positionierungsgeräte. Beide werden von Algorithmen synchronisiert und gesteuert Die Algorithmen laufen auf einem Standard-PC Für die Erfassung kombinieren wir eine hochauflösende Fotokamera mit einem massgeschneiderten Ringlicht und einem optionalen Hintergrundlicht. Die Kamera ist eine PhaseOne iXH (150 MP) Das Ringlicht
Bild 3: Abschätzung der Schärfentiefe (grün: optimal fokussiert, blau: Fernebene, rot: Nahebene).
verfügt über ein D50-Spektrum, das ideal für eine farbechte Erfassung ist Es erlaubt, Polarisationsfilter anzubringen, um spekulare Oberflächen besser erfassen zu können
Für die Positionierung wird ein leichter Roboterarm (Universal Robots UR10 oder UR20), der die Kamera hält, mit einem Drehteller kombiniert, auf dem das Objekt platziert ist. So kann das Objekt von allen Seiten erfasst werden, während die Bewegungen der Kamera auf eine Seite des Drehtellers beschränkt bleiben
Der Roboterarm muss nicht «über das Objekt greifen», um es von der gegenüberliegenden Seite zu erfassen – somit lässt sich mit kleineren Reichweiten und günstigeren Robotern arbeiten. Hohlräume werden – so weit wie von aussen einsehbar – erfasst, da die Kamera mit dem Roboterarm in quasi beliebige Orientierungen und Positionen «gefahren» werden kann.
Da das zu erfassende Objekte keinesfalls beschädigt werden darf, treffen wir bereits auf Hardware-Ebene dafür Vorkehrungen: Bremsen, die unter Strom geöffnet bleiben, blockieren die Gelenke des Roboterarms im Falle eines Stromausfalls. Die Software stellt sicher, dass keine Kollisionen während des Scan-Vorgangs auftreten. Das trägt nicht nur zu der Sicherheit des Objektes, sondern auch der des Arbeitsplatzes bei
Das 3D-Erfassungssystem ist in zwei Varianten erhältlich:
— eine leichte, kompakte Desktop-Version, die eine Nutzlast von bis zu 100 kg trägt und ein Digitalisierungsvolumen von et-
wa 80 cm in der Höhe und einem Durchmesser von 60 cm bietet, sowie — eine schwerere, ausklappbare Version, die mit einem frei positionierbaren Bodendrehteller ausgestattet ist und eine Nutzlast von bis zu 1000 kg, ein Liftkit für den Roboterarm und einen «Pilz» für den Drehteller bietet Diese Konfiguration ermöglicht es, Objekte von z. B der Grösse einer Schraube bis hin zu einer Fahrzeugachse in einem Digitalisierungsvolumen von etwa 230 cm Höhe und 130 cm Durchmesser zu erfassen. An dem Drehteller können Spannvorrichtungen befestigt werden, um Objekte zu fixieren, die nicht von selbst stehen bleiben Beide Varianten sind mobil und können schnell an neuen Standorten eingerichtet werden Auch andere Kamera-Objektiv-Kombinationen sind möglich Alle relevanten Hardwarekomponenten wurden im Entwicklungsprozess des Systems modelliert, simuliert und in eine einheitliche virtuelle 3D-Umgebung integriert, die Software-Bestandteil des Komplettsystems ist
Softwarekomponenten
Der Schlüssel zum automatisierten Prozess ist ein dynamischer Ansatz zur Ansichtenplanung für die Kamera. Dieser stellt eine optimale Anzahl von Positionen und Orientierungen (Posen) sicher, um die gesamte sichtbare Oberfläche mit einer vordefinierten Zielauf-
HANDHELD-MESSGERÄTE:
lösung zu erfassen Dabei werden alle durch den photogrammetrischen Ansatz gegebenen Anforderungen beachtet, wie z. B 70% Überlappung benachbarter Bilder für ausreichend Merkmalsübereinstimmungen. Auch wird ein konsistenter Abstand zwischen der Oberfläche des Objekts und der Fokusebene der Kamera eingehalten
Während des Prozesses wird kontinuierlich die Bildschärfe analysiert Es werden nur die Bildregionen für die 3D-Rekonstruktion verwendet, die sich im Schärfebereich der Kamera befinden. Diese Informationen gehen fortwährend in den Prozess zur Ansichtenberechnung ein.
Die Software visualisiert für den Benutzer die aktuelle Roboterpose und den entsprechenden Kamerawinkel Dazu verarbeitet sie Sensordaten des Roboters in Echtzeit, um ein für den Menschen verständliches virtuelles 3D-Abbild der realen Situation zu erstellen. Darüber hinaus zeigt die Software die nächsten berechneten (geplanten) Ansichten in der virtuellen 3D-Szene als grünes, semitransparentes Overlay
Zwischenergebnisse der Rekonstruktion werden innerhalb des zuvor definierten und ebenfalls visualisierten Sicherheitszylinders rund um das Objekt dargestellt Sie bilden eine Vorschau auf das resultierende 3D-Modell – diese Darstellung wird kontinuierlich aktualisiert
Nicht nur die Positionen und Orientierungen für die Bildaufnahme müssen errechnet
werden, sondern auch die Roboterwege zwischen diesen Zu diesem Zweck wurden Techniken der Vorwärts- und Rückwärtskinematik implementiert Diese berechnen die Robotertrajektorien so, dass auf dem Weg von einer zur darauffolgenden Pose eine möglichst schnelle, aber sichere – also kollisionsfreie – Bewegung erfolgt Kameraperspektiven, die eine Kollision zur Folge hätten, werden verworfen bzw angepasst. Alle Roboterkomponenten sind mit Kollisionserkennungssystemen ausgestattet, um Kollisionen zu vermeiden
Initiale Kalibrierung
Nach dem Aufbau des Systems wird eine automatische Selbstkalibrierung durchgeführt, die die folgenden drei Schritte umfasst:
1. Kalibrierung der Kameraintrinsiken
2. Roboterarm-Sensor-Kalibrierung
3. Kalibrierung des Drehtellers
Diese geometrische Kalibrierung ist nötig, um die Präzision der 3D-Ergebnisse zu gewährleisten.
Zunächst werden die Kameraintrinsiken ermittelt, um das tatsächliche Sichtfeld zu bestimmen und Verzerrungen der Linse zu korrigieren Anschliessend wird die Roboterarm-Sensor-Transformation zwischen dem optischen Zentrum der Kamera (dem Sensor) und dem Werkzeugrahmen des Roboters (dem Arm) festgelegt Somit ist das optische Zentrum der Kamera relativ zur Basis des Roboterarms bestimmt Schliesslich ergibt die
Die5811A Handheld-Gerätevon Kistlerbieten eine moderne, handlicheLösungzur Aufzeichnung undVisualisierung vonDaten auspiezoelektrischen Messketten.Sie verfügen über anpassbare Messmodi, einschließlich Aufzeichnungsfunktionalität,eine Vielzahl vonVisualisierungsoptionenund eine hohe Robustheit (IP54) fürden Einsatzinrauen Umgebungen

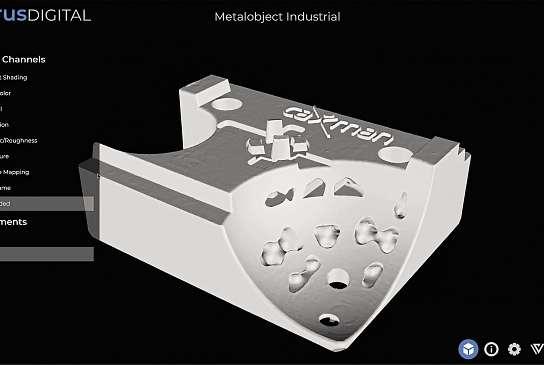

Kalibrierung des Drehtellers dessen Position im Raum und die Rotationsachse des ScanVolumens Nachdem das Kalibrier-Target auf den Drehteller gelegt und der Prozess per Mausklick gestartet worden ist, werden alle Kalibrierungsdaten automatisch bestimmt.
Anschliessend werden die Farbeigenschaften der Kamera ermittelt, indem ein Farb-Target, wie z B. der X-Rite ColourChecker SG für Standard-Setups oder das Rez Checker Target für Makro-Setups, platziert wird. Der Benutzer wird über das User Interface jederzeit über die erforderlichen Handlungen und den Fortgang der Kalibrierung informiert
Bildaufnahme und 3D-Rekonstruktion
Die 3D-Scanning-Station rekonstruiert 3DModelle mithilfe von Photogrammetrie Die erfassten Rohdaten bestehen aus hochauflösenden Bildern des Objekts Structurefrom-Motion und Multi-View-Stereo werden verwendet, um Merkmale zu identifizieren und 3D-Informationen zu triangulieren. Die hohe Qualität des finalen 3D-Modells wird dadurch erreicht, dass die Posen für den Roboter so berechnet werden, dass alle von aussen sichtbaren Anteile der Oberfläche vollständig – aus mindestens vier Richtungen –erfasst werden Typische erreichbare Auflösungen des 3D-Modells liegen im Bereich von 10–15 μm. Für eine optimale Auflösung können fokussierte Kamera-Makro-Objektive verwendet werden – auch für Objekte, die grösser sind als das Messvolumen der Kamera (definiert durch Sichtfeld und Schärfentiefe)
Typischerweise wird pro Bild nur ein Teil der aufgenommenen Objektoberfläche
scharf abgebildet. Daher werden viele Bilder benötigt, um sie insgesamt hochauflösend und scharf abzudecken. Für den Nutzer bedeutet dies, sich im Vorfeld für einen Kompromiss aus Scanzeit und Zielqualität zu entscheiden, der seine 3D-Digitalisierziele bestmöglich erfüllt
Mit einer 150-Megapixel-Phase-One-iXHKamera erfassen wir bei 14 Bit Farbtiefe und vier Kanälen 1,2 Bilder pro Sekunde, also rund 4300 Bilder pro Stunde. Für die weitere Verarbeitung werden die Bilder über die 10-Gbit-Ethernet-Verbindung der Kamera übertragen und abgelegt. Die Erfassungsrate wird hauptsächlich durch die Übertragungsgeschwindigkeit der Kamera festgelegt
Um eine möglichst hohe Erfassungsrate zu erreichen, werden die von der dynamischen Ansichtenplanung für den aktuellen Scanschritt fortwährend berechneten, aufzunehmenden Posen stets nach ihrer Nähe zueinander sortiert. Transitionen von einer Pose zur nächsten werden unter Berücksichtigung der Übertragungsdauer der Bilder von der Kamera zum PC auf dem kürzesten Weg angefahren
Die Dauer der 3D-Rekonstruktion eines farbigen 3D-Modells in voller Auflösung dauert mittels Photogrammetrie im Vergleich zu anderen 3D-Rekonstruktionsmethoden, wie strukturiertem Licht oder Lasertriangulierung, relativ lang Für komplexe Objekte kann die 3D-Rekonstruktion mehrere Stunden in Anspruch nehmen – währenddessen kann aber bereits das nächste Objekt erfasst werden Während des Scan-Prozesses berechnen wir zwischenzeitlich niedriger aufgelöste Modelle, um
—auf diesen approximativen 3D-Modellen
Entscheidungen für die Ansichtenplanung zu treffen und — den Benutzer über den Fortschritt und das aktuelle Aussehen des 3D-Modells zu informieren.
Intelligente dynamische Ansichtenplanung statt Teaching
Um den Benutzer davon zu befreien, alle Kameraposen zu bestimmen, die nötig sind, um ein Objekt komplett zu erfassen und dann einen Roboter zu teachen, haben wir eine intelligente dynamische Ansichtenplanung entwickelt und implementiert D. h., der Roboter arbeitet autonom. Somit liefert die Ansichtenplanung auch einen Beitrag zur autonomen Robotik
Die Ansichtsplanung berechnet einen möglichst minimalen Satz von Kameraposen, um alle von aussen sichtbaren Objektoberflächenteile komplett zu erfassen, die nötig sind, um eine 3D-Modell mit gewünschter Qualität zu rekonstruieren.
Die Ansichtenplanung kann als Optimierungsproblem betrachtet werden, das darauf abzielt, die Gesamtqualität des Modells zu maximieren, die Anzahl der Aufnahmen zu minimieren und während des Prozesses auch noch die Sicherheitsanforderungen einzuhalten.
Das Verfahren ist inkrementell und implementiert einen Rückkopplungsprozess von Planung, Erfassung und Rekonstruktion, wobei zwischenzeitliche Rekonstruktionen die nachfolgenden Planungsschritte beeinflussen. Eine Herausforderung war, eine Qualitätsmetrik zu finden, die während des Scan-Prozesses auf Zwischenergebnissen be-
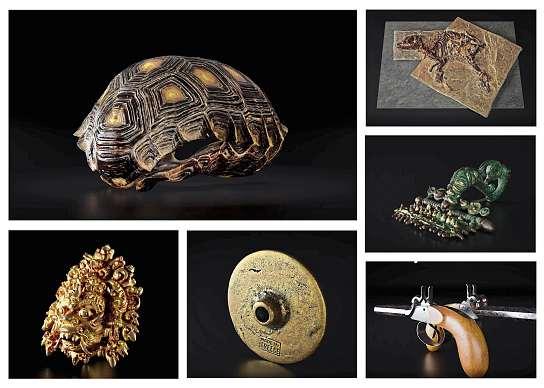
stimmt werden kann und eine zuverlässige Abschätzung der Qualität des endgültigen 3D-Modells liefert
Nach den anfänglichen Benutzereingaben von Durchmesser und Höhe des Objektes/Scanvolumens wird ein initialer Satz von Ansichten berechnet. Bild 3 zeigt eine erste 3D-Rekonstruktion aus dem anfänglichen Schnellscan mit 40 Bildern niedriger Auflösung
Das System bewertet automatisch die Dichte der Punktwolke, identifiziert Bereiche mit niedriger Dichte und Löchern (rot hervorgehoben) und solche mit ausreichend dichten Punkten (blau dargestellt) Weniger dichte Bereiche kommen zustande durch Verdeckungen oder an parallel zur Kamerablickrichtung ausgerichteten Stellen. Basierend auf den approximativen 3D-Rekonstruktionen wird während des Prozesses die Menge der weiteren anzusteuernden Ansichten geplant.
Zu diesem Zweck werden die Kameraparameter aus der Kalibrierung und RenderingTechniken verwendet, um die Effekte der Ansichtskandidaten zu simulieren Bild 3 zeigt, wie die Schärfentiefe der Kamera auf das Objekt abgebildet wird.
Es werden die Kandidaten ausgewählt, die die Fläche im Fokus für Bereiche mit niedriger Dichte maximieren. Der Roboter wird angesteuert, um die nächste Scan-Phase durchzuführen. Währenddessen wird die 3D-Rekonstruktion aktualisiert Dieser iterative Prozess wird fortgesetzt, bis die gewünschte Oberflächendichte erreicht ist.
Empirisch haben wir eine starke Korrelation zwischen den Dichtebestimmungen auf den approximativen 3D-Rekonstruktionen
Bild 5: Weitere beispielhafte 3D-Digitalisierungsergebnisse.
und der Oberflächenqualität des resultierenden finalen 3D-Modells beobachtet. Darüber hinaus ist entscheidend, dass die aufgenommenen Bilder scharf sind, d. h., der Abstand von Kamera zum Objekt vom Roboter exakt eingehalten wird, da wir bewusst auf die Verwendung von Autofokus-Objektiven zugunsten der Qualität und Schärfe der Bilder verzichten.
Ergebnisse
Am Ende des Digitalisierprozesses steht die finale 3D-Rekonstruktion des Objekts Das zu digitalisierende Objekt kann mit Auflösungen von bis zu 10 μm erfasst werden, die sich im hochauflösenden 3D-Modell widerspiegeln Die finalen Ergebnisse können im Anschluss visualisiert und analysiert werden (siehe Bild 4).
Die 3D-Modelle sind ohne manuelle Nachbearbeitung entstanden. Da das System in einer geschlossenen Umgebung arbeitet und alle Bestandteile des Systems inkl ihrer Geometrien bekannt sind, können 3D-Punkte, die zu der Umgebung gehören, automatisch herausgefiltert werden Auf den 3D-Modellen können dann Analysen erfolgen, wie z. B. ein Soll-Ist-Vergleich mit dem nominalen CAD-Modell oder Tiefenmessungen an Oberflächenstrukturen etc Aus den 3D-Modellen können automatisch gröber aufgelöste Modelle abgeleitet werden, die z. B für Visualisierungs- und Präsentationszweck dienen können
Zusammenfassung und Ausblick
Die Nachfrage nach wirtschaftlicher und genauer 3D-Erfassung von Objekten und Bauteilen steigt schnell, nicht nur für und in der
Qualitätssicherung, sondern auch für interaktive Online-Visualisierungen, virtuelle Realität etc Gleichzeitig wird mit dem steigenden Bedarf der Mangel an Fachkräften immer augenfälliger, so dass nur autonome vollautomatische Systeme mittelfristig die Nachfrage nach 3D-Erfassung decken können
Wir haben die erste vollautomatisierte und farbechte Lösung zur robotergestützten 3D-Erfassung und effizienten Weiterverarbeitung von 3D-Daten und Bildern entwickelt, welche wiederholbar hohe Qualität bei vordefinierter Zielauflösung ohne manuelle Nachbearbeitung für die finalen 3D-Modelle erreicht.
Dabei entstehen «Nebenprodukte» wie 3D-Webmodelle, gerenderte Videos und 3D-Druckmodelle – wenn gewünscht – ebenfalls automatisch.
Das System ist äusserst flexibel und kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, wodurch es als Plattform für zukünftige Verbesserungen und die Integration weiterer Messtechnologien, wie z.B für volumetrische Messsensoren und Ultraschall, dienen kann. Die Kombination aus intelligenter Algorithmik und autonomer Robotik stellt einen bedeutenden Beitrag zum Fortschritt innovativer Digitalisierungstechnologien dar
Die hier vorgestellte Lösung wird von unserer Ausgründung, der Verus Digital GmbH, insbesondere in der Branche Kreativ- und Kulturwirtschaft, vermarktet, während das Fraunhofer IGD weiterhin erster Ansprechpartner für Weiterentwicklungen des Systems ist
Über den Weg des Technologietransfers hat das Fraunhofer IGD die dieser Lösung zugrunde liegenden Konzepte bereits erfolgreich auf andere Anwendungsfelder übertragen – auch unter Nutzung von Echtzeit-Lasertriangulation. Beispielsweise wurde die erste vollautomatische, robotergestützte Dekontaminationsanlage für individuelle, mittels Höchstdruckwasserstrahl zu entschichtende Baugruppen im Rückbau von Kernkraftwerken in Biblis von der RWE Nuclear GmbH in Betrieb genommen Weiteren anforderungsgerechten Anpassungen stehen wir als unabhängige Institution offen gegenüber
igd.fraunhofer.de
Das neue Stand-alone-Gerät SB6 von Stöber eignet sich für Anwendungen mit bis zu vier Achsen und zeichnet sich durch seine hohe Regelungsperformance aus. Der kompakte Antriebsregler überzeugt durch seine zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, die eine perfekte Bewegungssteuerung ermöglichen. Der SB6 ist prädestiniert für Sondermaschinenbauer, die flexibel auf wechselnde Anforderungen ihrer Klientel reagieren müssen.
Quelle: Stöber
Mit dem neuen SB6 von Stöber haben Konstrukteure für Anwendungen von einer bis zu vier Achsen immer den passenden Antriebsregler parat Die Stand-alone-Lösung besitzt zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Erhältlich ist die Baureihe in drei Grössen für kleine bis mittlere Leistungen Regeln lassen sich sowohl lineare als auch rotative Synchron-Servomotoren und Lean-Motoren.
Flexibler Antriebsregler für unterschiedliche Anwendungen
Eine weitere Besonderheit ist die Anzahl der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge Damit bietet Stöber einen funktionalen, fle-
Der neue Regler besticht besonders durch seine kompakten Masse Damit passt er schon in Schaltschränke mit Einbautiefen ab 210 Millimeter Der Antriebsregler kann ausserdem um die Sicherheitsstandards STO und SS1 via Fail Safe over Ethercat (FsoE) und Profisafe bis SIL 3, PL e (Kategorie 4) erweitert werden. Auch ein Sicherheitsmodul für die Ansteuerung über digitale Ein- und Ausgänge ist verfügbar. Darüber hinaus ist der SB6 optional mit einer Bedieneinheit aus Text-Display und Tasten erhältlich.

Das Stöber-System bestehend aus Antriebsregler SB6 und Zahnstangentrieb mit ServoWinkelgetriebemotor der Baureihe ZVKSEZ. Verbunden sind diese über die One Cable Solution (OCS)


xiblen Antriebsregler, den Unternehmen in unterschiedlichen Anwendungen einsetzen können Für eine schnelle automatisierte Inbetriebnahme und einen unkomplizierten Service lässt sich eine SD-Karte als Applikationsspeicher einfach in den Antriebsregler stecken und somit Konfigurationen übertragen Der neue SB6 unterstützt in Kombination mit One Cable Solution (OCS) und EnDat 3 zuverlässig Leistungslängen bis 100
Das Stöber-Portfolio: Antriebsregler, Getriebemotoren, Kabel – der Anwender erhält alles aus einer Hand
Meter. Das Hybridkabel hat Stöber in Abstimmung mit dem Encoder-Hersteller Heidenhain entwickelt In Kombination mit seinen Getriebemotoren bietet Stöber ein komplett aufeinander abgestimmtes System aus einer Hand Für die Anbindung an eine überlagerte Steuerung stehen Firmware-basiert Ethercat und Profinet zur Wahl.
stoeber.ch
Der neue Antriebsregler SB6 mit und ohne Bedieneinheit.
Der steigende Einsatz von KI wird die bestehende Energieinfrastruktur schnell an ihre Grenzen bringen. Doch was ist die Lösung? Der Einsatz von Licht, davon ist Michael Förtsch, CEO Qant GmbH, überzeugt. Hier der Kommentar dazu.

Gemeinsam bauen Qant und das Fraunhofer Institut für Mikroelektronik Stuttgart, IMS Chips, eine bestehende CMOS-Produktionslinie zu einer Pilotlinie für die Fertigung photonischer Hochleistungs-Chips aus.
Michael
Förtsch, CEO Qant GmbH
Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert unsere Welt. Sie verspricht, komplexe Klimamodelle zu berechnen und treibt die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voran. Aktuelle KI-Technologien erkennen bereits Tumore in frühen Stadien, die für das menschliche Auge oder überlastete Radiologen unsichtbar
bleiben. Künftig beschleunigt sie Diagnosen und ermöglicht personalisierte Therapien auf Basis genetischer Daten Darüber hinaus eröffnet sie völlig neue kreative Möglichkeiten – etwa die Umwandlung von Sprache in lebendige Videos oder die Erstellung fotorealistischer virtueller Welten.
Doch der Preis, den wir dafür bezahlen, tritt immer deutlicher zutage: KI bedroht Energiereserven und Wasserressourcen, weil der Strombedarf rapide ansteigt und Unmengen Wasser zum Abkühlen riesiger Rechenzentren benötigt werden In diesen Einrichtungen, manche so gross wie ganze Stadtteile, finden tausende Server Platz, die mit unzähligen Grafikprozessoren, kurz GPUs, ausgestattet sind, um den weltweiten Datenstrom zu verarbeiten.
Riesiger Strombedarf überfordert die gegenwärtige Infrastruktur
Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt die Dimension des Problems: Ein Grafikprozessor verbraucht etwa 1,2 kW, so viel wie ein Küchenherd. Ein GPU-Server verbrennt 14 kW –das sind 14 Öfen, die auf volle Leistung hochgefahren sind. Und ein einziger Rack im Rechenzentrum?
Bis zu 100 kW! Stellen Sie sich 100 Öfen vor, die rund um die Uhr laufen. Und das ist nur der kleine Massstab. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass sich der Stromverbrauch von Rechenzentren von 460 TWh im Jahr 2022 auf über 1000 TWh im Jahr 2026 mehr als verdoppeln könnte – das entspricht dem gesamten Energieverbrauch Japans. Oder, um es etwas verständlicher auszudrücken: 38 Milliarden Backöfen müssten ein Jahr lang ununterbrochen laufen, um diese Menge Strom zu verbrauchen
Angesichts dieser Realität scheint jedes Mittel recht, damit immer ausreichend Energie für die Hyperscaler zur Verfügung steht: Microsoft etwa will laut Medienberichten ein Kernkraftwerk in Pennsylvania wiederbeleben und xAI, ein Unternehmen von Elon Musk, installiert eigene Gasturbinen für ein neues Rechenzentrum in Memphis, Tennessee.
Google pumpt in Oklahoma permanent kaltes Wasser durch 13 Rechenzentren, um sie vor Überhitzung zu schützen: 23 Milliarden Liter Wasser verbrauchte das Unternehmen 2023 nur zu diesem Zweck Und auch in Europa ist das Problem angekommen Bereits jetzt adressieren die SupercomputingCenter bei den Kommunen, dass sie stärkere Stromleitungen benötigen, um ihre GPU-Server in Zukunft betreiben zu können. Das wissen wir aus Gesprächen mit unseren Kunden
Die Lösung: Rechnen mit Licht Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, um KI-Technologien zukunftsfähig zu machen. Bei Qant sind wir seit unserer Gründung überzeugt, dass Licht – nicht Strom – die Grenzen der modernen Datenverarbeitung und des Hochleistungsrechnens neu definieren wird.
Die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten, muss sich ändern Das Rechnen mit Licht bietet eine energieeffiziente und skalierbare Alternative zur herkömmlichen CMOS-Technologie Konventionelle Prozessoren benötigen tausende von Transistoren, um komplexe mathematische Operationen auszuführen – insbesondere datenintensive Berechnungen für KI. Beispielsweise erfordert eine 8-Bit-Multiplikation in einem herkömmlichen CMOS-Prozessor 1200 Transistoren.
Im Gegensatz dazu erreicht der photonische Prozessor von Qant dieselbe Operation mit nur einem optischen Element – und ist dabei bis zu 30-mal energieeffizienter Wir können das, weil wir die spezifischen Eigenschaften von Licht nutzen, die es uns erlauben, komplexe mathematische Funktionen nativ und direkt auszuführen, ohne sie in digitale Nullen und Einsen zu übersetzen.
Über die Energieeinsparung hinaus bietet photonisches Computing einen weiteren entscheidenden Vorteil: Skalierbarkeit! Die Idee, dass die Verkleinerung von Transistoren eine stetige Leistungssteigerung ermöglicht, stösst an physikalische Grenzen
Denn je mehr sich die Technologie der 3-nm-Grenze nähert, desto schwieriger und kostspieliger wird die weitere Miniaturisierung
Unsere photonischen Prozessoren umgehen diese Herausforderung. Im Gegensatz zu siliziumbasierten Elektroniken nutzen sie die fundamentalen Eigenschaften von Licht für schnellere Berechnungen, ohne die Notwendigkeit extrem kleiner Strukturen.
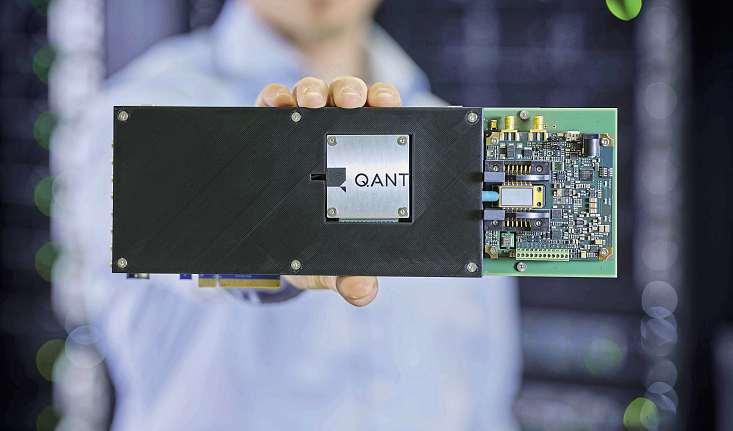
Der erste kommerzielle Photonik-Prozessor verspricht eine mindestens 30-fache Verbesserung der Energieeffizienz und einen erheblichen Leistungsschub, der die Nachhaltigkeit von Rechenzentren in
Nähe rückt.

Bi ld Qa nt
Da darauf basierende photonische Prozessoren keine überschüssige Wärme erzeugen, entfällt der Bedarf an energieintensiven Kühlsystemen Zudem verhindert das Fehlen thermischer Wechselwirkungen eine unerwünschte Beeinflussung benachbarter Rechenprozesse Dadurch ermöglichen diese Prozessoren eine hochpräzise Multiplexingund Parallelverarbeitung – ideal für KI- und HPC-Anwendungen.
Und dass die Fertigung von bahnbrechender Technologie keine Unsummen erfordern muss, demonstriert Qant in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikroelektronik Stuttgart, IMS CHIPS. Gemeinsam bauen wir eine bestehende CMOS-Produktionslinie zu einer Pilotlinie für die Fertigung photonischer Hochleistungs-Chips aus und schaffen damit eine Blaupause für das Upcycling von existierenden Chip-Foundries.
Der Autor Michael Förtsch ist CEO der Qant GmbH. Er fordert einen Paradigmenwechsel, um KI-Computing zukunftsfähig zu machen.
Bedarf an Kühlung entfällt
Ein zentraler Baustein für den Durchbruch unserer photonischen Chips ist DünnschichtLithiumniobat (TFLN) Das Material ermöglicht eine hochpräzise, ultraschnelle optische Signalmanipulation bei mehreren GHz, ohne dass Wärme zur Modulation des Lichts auf dem photonischen Schaltkreis erforderlich ist. TFLN ist damit ein echter Gamechanger
Mit dieser Pilotlinie legen wir den Grundstein für eine nachhaltige, leistungsfähige und unabhängige Chipproduktion in Europa, in der photonische Prozessoren zu StandardCo-Prozessoren in Hochleistungsrechnern werden Unser Ziel, unsere photonischen Prozessoren bis 2030 zu einem skalierbaren und energieeffizienten Eckpfeiler der KI-Infrastruktur zu machen, rückt damit einen grossen Schritt näher qant.com

Klassische Lösungen für Datensicherheit setzen auf Regeln, die nur Schwarz und Weiss kennen: Aktivitäten werden entweder geblockt oder gestattet. Dieser Ansatz hat Schwächen, weil er meist sehr restriktiv umgesetzt wird und die Mitarbeiter im Arbeitsalltag behindert Besser geeignet sind Lösungen, die Sicherheitsmassnahmen in Echtzeit an das jeweilige Risiko anpassen.
Fabian Glöser, Forcepoint
Die neue Arbeitswelt mit Remote Work und Cloud-Services birgt aus Security-Sicht viele Herausforderungen, weil sich nur noch schwer bestimmen lässt, welche Aktivitäten die Datensicherheit gefährden und welche nicht. Handelt es sich beim Download einer Datei vom zentralen Server auf einen Rechner ausserhalb des Unternehmensnetzwerks um eine normale geschäftliche Aktivität oder einen Datendiebstahl? Welche Dokumente dürfen Mitarbeiter auf USB-Sticks kopieren, per E-Mail verschicken oder von einem KI-Service in der Cloud auswerten lassen? Und ist es okay, im Online-Meeting einen Screenshot der dort gezeigten Präsentation mit Finanzdaten zu machen?
All diese Vorgänge lassen sich mit starren Richtlinien kaum beherrschen, denn diese stellen Security-Teams mangels Flexibilität vor ein Dilemma. Entweder sorgen sie mit sehr restriktiven Richtlinien für Frust bei den Mitarbeitern, weil viele Aktivitäten schlicht nicht gestattet sind und blockiert werden. Dadurch sinken Produktivität und Motivation – und es steigt die Gefahr, dass Mitarbeiter versuchen, die Sicherheitsmassnahmen zu umgehen Oder sie gestalten die Richtlinien weniger restriktiv, um Mitarbeiter im Arbeitsalltag nicht zu behindern, und lassen damit womöglich Lücken im Schutz In der Regel entscheiden sich Security-Teams für die erste Variante, da Datenabflüsse einfach
ein zu grosses geschäftliches Risiko darstellen.
Zwar können Unternehmen mit Awareness-Schulungen das Bewusstsein ihrer Mitarbeiter für den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Daten schärfen. Einen wirklich zuverlässigen Schutz garantiert das allerdings nicht, denn Mitarbeiter können –gerade in hektischen Arbeitssituationen –unaufmerksam sein oder Fehleinschätzungen unterliegen. Und auch gegen Insider-Bedrohungen und den Missbrauch kompromittierter Benutzer-Accounts helfen Schulungen nicht, sodass bei klassischen Lösungen für Datensicherheit üblicherweise kein Weg an restriktiven Richtlinien vorbeiführt
Schärfere Sicherheitsmassnahmen für riskante Aktivitäten
Eine Alternative stellen moderne Lösungen dar, die einen Risiko-adaptiven Ansatz verfolgen Sie berücksichtigen Anwenderaktivitäten und deren Kontext, um das Risiko zu ermitteln und geeignete Sicherheitsmassnahmen einzuleiten
So kann beispielsweise das Kopieren von Daten auf einen USB-Stick ohne Einschränkungen erlaubt sein, einen kurzen Warnhinweis hervorrufen, eine Verschlüsselung auslösen oder sogar komplett blockiert werden – je nachdem, welchen «Risk Score» ein Anwender hat Dahinter steht eine einzige Richtlinie, die durch den Risk Score dynamisch und in Echtzeit angepasst wird – in diesem Fall die Richtlinie für das Kopieren von Daten auf USB-Medien.
Den Risk Score berechnet die Sicherheitslösung anhand der Aktivitäten des Anwenders beziehungsweise sogenannter Verhaltensindikatoren. Das sind Aktionen wie das Erstellen, Speichern, Bearbeiten, Herunterladen, Löschen und Versenden von Dokumenten, das Installieren von Anwendungen, das automatische Weiterleiten von E-Mails und das Komprimieren von Dateien in verschlüsselten Archiven.
Die einzelnen Verhaltensindikatoren beeinflussen den Risk Score unterschiedlich stark: Der Upload eines unverfänglichen Dokuments mit technischen Informationen in die Cloud etwa erhöht ihn kaum, das Speichern von Vertragsdokumenten auf einem USB-Stick hingegen deutlich. Bei bestimmten Schwellenwerten werden die Sicherheitsmassnahmen verschärft, sodass Aktivitäten, die ursprünglich möglich gewesen wären,
«UmeinenschnellenSchutzzu bieten,nutzenguteDatensicherheitslösungensmarteFunktionen fürDataDiscoveryundDatenklassifizierung.»
FabianGlöser,TeamLeaderSalesEngineering,Forcepoint
einigen Restriktionen unterliegen Die Kundenliste kann zum Beispiel nur noch verschlüsselt auf dem Speicherstick abgelegt werden Besonders kritische Aktivitäten wie der Versand von Kundenlisten, Konstruktionsdaten oder Finanzinformationen per E-Mail an Empfänger ausserhalb des Unternehmens heben den Risk Score auf einen Schlag so stark an, dass die Aktivitäten sofort blockiert werden.
Optimale Risikobewertung mit KI und Machine Learning
Um einen schnellen Schutz zu bieten, nutzen gute Datensicherheitslösungen smarte Funktionen für Data Discovery und Datenklassifizierung. Diese spüren Daten über alle Speicherorte des Unternehmens hinweg auf und nehmen mit Hilfe von KI und Machine Learning eine automatische Einstufung in verschiedene Kategorien vor. Darüber hinaus nutzen sie ein Fingerprinting der Datei-Inhalte, anstatt einen Hashwert der gesamten Datei zu erstellen So können schützenswerte Daten, die von Fachbereichen bereitge-
stellt werden, wie zum Beispiel Code-Fragmente, Auszüge aus vertraulichen Dokumenten oder personenbezogene Daten, zuverlässig identifiziert werden – unabhängig davon, auf welchem Weg sie das Unternehmen zu verlassen drohen Der Risk Score erhöht sich also auch dann, wenn Anwender statt der gesamten Datei nur einen Teil des Inhalts in eine Mail, einen Chat oder das Eingabefeld eines Online-Übersetzungsdienstes kopieren Selbst in Screenshots versteckt Inhalte werden dank OCR-Funktionen (Optical Character Recognition) aufgespürt und erkannt. Darüber hinaus nutzen die Sicherheitslösungen maschinelles Lernen, um zu verstehen, wie normales Benutzerverhalten aussieht, sodass sie abweichende Aktivitäten identifizieren und den Risk Score entsprechend anpassen können Eine Anomalie wäre beispielsweise der Download grosser Datenmengen, wenn der betreffende Anwender sonst eigentlich nur einzelne Dokumente aus der Cloud oder vom File-Server abruft. forcepoint.com

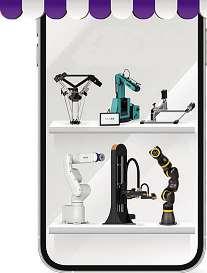





Automatisieren Sie Ihre Fabrik ab CHF 2‘000
l Komponenten von führenden Herstellern mit 100% Kompatibilitäts-Garantie l 500 bereits umgesetzte Lösungen online davon 95% unter CHF 12‘000 l Automatisieren ohne Roboterkenntnisse

Das umfassende Management aller OT- und Medical-IoT-Geräte bringt sicherheitstechnische und wirtschaftliche Vorteile und unterstützt das Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance.
Industrielle Umgebungen aller Art – von kritischen Infrastrukturen bis zu Produktionsanlagen und Gebäudeautomation –, aber auch das Gesundheitswesen kommen heute nicht mehr ohne Digitalisierung aus In all diesen Branchen sind unzählige vernetzte Geräte und Devices im Einsatz, die mit unterschiedlichen Protokollen arbeiten, an unterschiedlichen Orten stehen und wie jedes digitale Gerät an Schwachstellen leiden kön-
nen. Ob OT (Operational Technology) oder Medical IoT – industrielle Umgebungen verschaffen wie die IT eine Fülle von Möglichkeiten, bergen aber ebenso Sicherheitsrisiken, die erkannt und minimiert werden müssen.
Stets aktuelles Inventar ist grundlegend Um Sicherheitsrisiken korrekt zu identifizieren, zu bewerten und danach fallweise zu
reduzieren oder zu eliminieren, etwa durch Firmware-Updates, Virtual Patching oder Ersatz des betroffenen Geräts, ist ein laufend aktualisiertes Inventar des gesamten Geräte- oder Anlagenparks unabdingbar. Ohne umfassendes Asset-Management beziehungsweise ohne detailliertes Wissen, welches Equipment mit welcher Bedeutung und welchen Sicherheitsrisiken vorhanden ist und wo es sich befindet, ist eine effektive Bestan-
desaufnahme unmöglich. Ohne diese Transparenz wird ein ganzheitliches Risikomanagement zum Ding der Unmöglichkeit
OT-Asset-Management – was heisst das? Ein effektives Management aller OT- oder Medical-IoT-Geräte aus Security-Sicht setzt die Bestandesaufnahme, Überwachung und Verwaltung aller Geräte über den gesamten Lebenszyklus hinweg voraus Daraus ergibt sich auch eine stets aktuelle Dokumentation der Umgebung und des Status der einzelnen Geräte Damit lassen sich die wichtigsten Fragen klären, so zum Bespiel «Welches Sicherheitsrisiko steckt in einem Gerät?» Je nach Bedeutung kann das Risiko kleiner oder grösser ausfallen, und eine Aktualisierung ist eventuell gar nicht erforderlich. Falls doch, müssen die folgenden Fragen beantwortet werden: Lassen sich Sicherheitslücken durch neue Firmware oder Patches beheben, oder kann das Gerät nicht gepatcht werden? Im letzteren Fall könnte Virtual Patching helfen: Dabei wird dem riskanten Gerät ein aktualisierbares System vorgeschaltet, das Angriffe zuverlässig blockiert.
Asset-Management ist besonders wichtig, weil die Lebenszyklen von OT-Geräten typischerweise sehr lang sind. Industrielle Anlagen zum Beispiel sind oft für eine jahrzehntelange Nutzung konzipiert, und auch im Spital wird ein Computertomograf kaum alle zwei Jahre ausgewechselt Das Geräteinventar lässt zudem erkennen, ob ein Gerät überhaupt noch ausreichend genutzt wird oder ausgemustert werden kann, und dient somit nebst den Sicherheitsüberlegungen auch der Kostenkontrolle und dem wirtschaftlichen Betrieb.
Je nach Branche und Unternehmen greifen überdies regulatorische Empfehlungen oder Vorschriften wie NIS2 oder der Schweizer IKT-Minimalstandard. Auch für deren Einhaltung ist die vollständige Inventarisierung und Überwachung aller IT-, OT- und IoT-Geräte praktisch unerlässlich, von der wiederum das Risikomanagement profitiert.
Integration in weitere Systeme OT-Asset-Management-Lösungen, wie sie etwa von Claroty oder Asimily angeboten werden, sowie die Asset-Management-Funktionen von Security-Anbietern wie Fortinet oder Palo Alto Networks lassen sich darüber hinaus in bestehende Systeme und Prozesse wie Change-Management oder Ticketing integrieren Ein Beispiel: Das Asset-Management-System erkennt ein Problem und gene-

riert ein entsprechendes Ticket für das Ticketing-System. Parallel dazu wird eine Meldung an die Firewall weitergegeben, die eine Regel anpasst oder eine neue erstellt und aktiviert.
Dementsprechend lässt sich aufgrund der Informationen vom Asset-Management das Risiko des betroffenen Geräts neu bewerten boll.ch
ANZEIGE

Vollautomatische Produktionsanlagen für Bäckereibetriebe sind das Spezialgebiet von AMF Bakery Systems Das Unternehmen baut und verkauft Maschinen, die sämtliche Arbeitsschritte bei der Herstellung von Backwaren übernehmen. Die elektrische Verbindungstechnik dafür stammt aus dem Hause Helukabel und ist speziell an die hohen Ansprüche in der Lebensmittelindustrie angepasst.

AMF bietet Komplettlösungen zur Herstellung von Süssgebäck wie Donuts, Brot und Brötchen sowie Croissants und Kuchen
Quelle: Helukabel
Brot ist eines der wichtigsten und ältesten Nahrungsmittel der Menschheit: Forscher gehen davon aus, dass schon in der Steinzeit Hafer und Gerste zu Mehl vermahlen, mit Wasser vermischt und gebacken wurden. Heute ist Brot auf der ganzen Welt und in unzähligen Variationen zu finden: vom arabischen Fladenbrot über das französische Ba-
guette bis zur schwäbischen Brezel. Knapp 25 Kilogramm davon verzehrt ein Mensch durchschnittlich im Jahr – frisch vom Bäcker oder tiefgekühlt aus dem Supermarktregal
Um den immensen Bedarf an Backwaren zu decken, müssen die Hersteller mitunter neue Wege zur Steigerung ihrer Produktion gehen – etwa durch den Einsatz von Auto-
matisierungstechnik und industriellen Fertigungsverfahren Gerührt, geknetet, geformt und abgepackt wird heute meist nicht mehr von Hand, sondern mithilfe von Maschinen und kompletten Produktionsanlagen. Dies ermöglicht eine gleichbleibend hohe Qualität bei vergleichsweise geringen Herstellungskosten
«EinedurchschnittlicheBäckereilinie vonunsenthältungefähr500Meter Kabelund1,5KilometerEinzeladern. EsgibtaberauchGrossprojekte,in denenwirbiszuzehnKilometer verbauen.»
EdwardTromp,LeiterSteuerungstechnik,AMFBakerySystems

Sämtliche Prozessschritte abgedeckt Einer der führenden Spezialisten für solche Technik ist AMF Bakery Systems Das Unternehmen mit Hauptsitz im US-amerikanischen Richmond, Virginia, realisiert für Kunden auf der ganzen Welt Komplettlösungen zur Herstellung von Brot und Brötchen, Croissants, Kuchen und Süssgebäck oder auch Pizza. «Unser Portfolio deckt von der Teigherstellung und -verarbeitung über das eigentliche Backen bis zur Verpackung sämtliche Prozessschritte ab», erklärt Lex van Houten. Er ist Regional Marketing Manager Emea bei AMF in den Niederlanden, wo das Unternehmen drei Standorte besitzt «Die einzelnen Maschinen kombinieren wir mit Fördertechnik, Steuerungen und Software zu nahtlos vernetzten und vollautomatischen Linien, mit denen unsere Kunden besonders effizient arbeiten können.»
Von den Niederlanden aus beliefert und betreut AMF Bakery Systems Kunden auf der ganzen Welt. Bei den Maschinen und Anlagen handelt es sich teils um standardisierte, teils um individuelle Lösungen, je nach den Bedürfnissen des Anwenders. Elektrische Verbindungen sind ein wichtiger Teil davon, sowohl zur Stromversorgung als auch zur Übertragung von Daten und Steuersignalen Bei den hierfür benötigten Kabeln und Leitungen setzt AMF schon seit geraumer Zeit auf Helukabel: «Früher haben wir elektrische Komponenten wie etwa Verteilerkästen über einen Zulieferer bezogen, der auch Helukabel-Produkte verwendete», erinnert sich Edward Tromp, Leiter Steuerungstechnik. «Später fingen wir dann an, die Verteiler selbst herzustellen – und da wir mit den Kabeln bislang nie Probleme hatten, sind wir einfach dabei geblieben.»
Hohe Standards in der Lebensmittelbranche
Da die Maschinen von AMF in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen, sind die Anforderungen entsprechend hoch: Sämtliche Komponenten, also auch Kabel und Leitungen, müssen strenge Hygienestandards erfüllen
Gleichzeitig müssen sie beständig gegen aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie extreme Temperaturen sein «Wir nehmen den jeweiligen Anwendungsfall genau unter die Lupe und entscheiden anschliessend, welche Leitungen dafür nötig sind», beschreibt Edward Tromp.
«Oft brauchen wir zum Beispiel halogenfreie Leitungen, die im Brandfall sicherer für Mensch und Maschinen sind, oder geschirmte Leitungen, um EMV-Störungen zwischen den einzelnen Anlagenteilen zu vermeiden.»
Auch Flexibilität und mechanische Beständigkeit sind wichtige Kriterien, denn in vielen beweglichen Maschinenteilen werden auch die Kabel mitbewegt und dürfen dabei nicht kaputt gehen
Helukabel liefert AMF ein umfangreiches Sortiment zur elektrischen Ausstattung der Prozessanlagen: von den vielseitigen Steuer- und Anschlussleitungen der JZ-500- und JZ-600-Familien über die geschirmten Servoleitungen der Serie Topserv 112 PVC und die besonders flexible Megaflex 500 bis hin zu Profinet-Leitungen für die industrielle Kommunikation.
«Eine durchschnittliche Bäckereilinie von uns enthält ungefähr 500 Meter Kabel und 1,5 Kilometer Einzeladern», verrät Tromp «Es gibt aber auch Grossprojekte, in denen wir bis zu zehn Kilometer verbauen.»
Weltweite Präsenz für schnelle
Verfügbarkeit
Um auch auf kurzfristige Bedarfe vorbereitet zu sein, hält AMF die gängigsten Kabel und Leitungen immer vorrätig «Wir haben insbesondere von den Standardprodukten immer mehrere hundert Meter Länge auf Lager», erläutert Tromp. «Wenn wir für eine Anlage Sonderleitungen brauchen, bestellen wir sie projektbezogen.» Ein grosser Vorteil: Genau wie AMF ist auch Helukabel weltweit aktiv und in den Niederlanden mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten. «Dadurch sind die Kabel, die wir brauchen, immer schnell verfügbar und vor Ort», freut sich Arie Rietveld, leitender Elektroingenieur bei AMF Ein weiterer Pluspunkt: Die HelukabelProdukte sind mit allen relevanten internationalen Normen und Zulassungen erhältlich «Wir exportieren unsere Maschinen in die ganze Welt – da kann es sein, dass wir in einem Fall eine europäische CE-Zertifizierung und im anderen eine amerikanische UL-Zulassung benötigen», skizziert Arie Rietveld. «Helukabel bietet uns hier für jeden Markt und jede Region die geeigneten Leitungen.» Überzeugen können diesbezüglich vor allem die Fivenorm-Einzeladern, die nach den fünf internationalen Standards HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW zertifiziert sind und somit weltweit eingesetzt werden können. «Das ist für uns als exportorientiertes Unternehmen ein entscheidendes Kriterium», betont Edward Tromp.
Ohnehin ist der Leiter der Steuerungstechnik mit der Zusammenarbeit mit Helukabel rundum zufrieden «Unsere Unternehmen sind beide sehr serviceorientiert, da passen wir gut zusammen», resümiert er

Vollautomatische Produktionsanlagen für Bäckereibetriebe sind das Spezialgebiet von AMF Bakery Systems



Häufig werden geschirmte Leitungen benötigt, um EMV-Störungen zwischen den einzelnen Anlagenteilen zu vermeiden
Das Portfolio deckt von der Teigherstellung bis zur Verpackung sämtliche Prozesse ab. Um auch auf kurzfristige Bedarfe vorbereitet zu
«Unser Ziel ist es, unseren Kunden immer die bestmögliche Lösung zu bieten – und Helukabel unterstützt uns dabei, indem sie uns für jede Anlage die jeweils besten elektrischen Verbindungen liefern. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir diese gelungene Kombination auch in Zukunft fortführen können.»
helukabel.de
Über Helukabel
Die Helukabel Gruppe mit Stammsitz im baden-württembergischen Hemmingen ist ein international führender Hersteller und Anbieter von Kabeln, Leitungen und Kabelzubehör. Das 1978 gegründete Familienunternehmen hat sich über die Jahre in vielen Branchen und Schlüsseltechnologien eine breite Expertise und ein tiefgehendes Know-how erarbeitet. Produkte und Lösungen von Helukabel finden sich heute in den verschiedensten Anwendungen: von Maschinen- und Anlagenbau sowie der Industrieautomation über Öl, Gas und Chemie bis hin zu Gebäudetechnik, Infrastruktur, Mobilität und der Versorgung mit erneuerbaren Energien.
Mit 71 Standorten sowie rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 42 Ländern ist das Unternehmen weltweit ein verlässlicher und reaktionsschneller Partner seiner Kunden. Diese profitieren von einem umfassenden Sortiment mit mehr als 33000 Lagerartikeln, einem hochmodernen Logistikkonzept sowie der besonderen Kompetenz in der Entwicklung von kundenindividuellen Lösungen. Damit bietet Helukabel Anwendern elektrische Verbindungstechnik komplett aus einer Hand.
Offizielles Bulletin der swissT.net-Sektion Electronic Packaging
Die Nocken- und Lasttrennschalter der Carl Geisser AG sind komplett entwickelt und gefertigt in Deutschland und frei konfigurierbar mit dem Schalter Baukastensystem – für nahezu jede individuelle Anforderung.

Hektor Dervishaj ist Experte für Nocken- und Lasttrennschalter – komplett entwickelt und gefertigt in Deutschland.
Ausgewählte Mitglieder der swissT.net-Sektion Electronic Packaging
Präsident: Markus Petermann Minkels AG
Vorstand: Bruno Senn, Carl Geisser AG
In der aktuellen Ausgabe der «Elektronic Packing News» präsentiert die Firma Carl Geisser aus Frauenfeld ihre neusten Produkte
Neue Nockenschalter D1/40 bis 63 A und D1/55 bis 100 A
Der Nockenschalter D1/40 wurde überarbeitet und ist nun berührungssicher nach IP20 und ist zudem cULus approbiert Die Schaltergrösse D1/55 ist im selben Schalterbody aufgebaut wie der Schalter D1/40 Durch das neu entwickelte Hochleistungskontaktsystem ist der Schalter bis 100 A bei sehr hohen AC3- und AC23-Werten einsetzbar
Somit handelt es sich bei dem Nockenschalter D1/55 um den mit Abstand kompaktesten Nockenschalter am Markt. Auch die Grösse D1/55 ist nach cULus zugelassen.
Massgeschneiderte Schalterlösungen für jede Anforderung
Die Schalter bieten grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten, jedes Schaltprogramm lässt sich individuell konfigurieren. Auch bei den Gehäusen kann jede CAD-darstellbare Form adaptiert werden Für höchste Sicherheit gegen Umwelteinflüsse ist gesorgt Die Lösungen sind durchweg EMV-konform und lassen sich mit Griffen und Zubehör vielfältig kombinieren Mit 131 Zubehörteilen in 19 Baugrössen eröffnen sich sehr viele Schalterkonfigurationen – von Schlüsselbetätigungen bis zu Hilfskontaktblöcken. Auf Wunsch kann ein Logo präzise per Lasergravur am Schalter angebracht werden. Dank dem modularen Baukastensystem werden passgenaue Schnittstellen für die nahtlose Integration ins Gesamtsystem geschaffen

Nicolas Huber Elcase AG Carl Geisser AG 8500 Frauenfeld carlgeisser.ch
Phoenix Mecano Solutions AG 8260 Stein am Rhein phoenix-mecano.ch

Push-to-Turn-Druckentriegelung Z105 Durch die neu entwickelte Druckentriegelung Z105 ist ein Drehen bzw Schalten erst nach bewusstem Drücken des Griffs möglich. Durch diese bedachte Handlung wird die Sicherheit des Schalters erheblich gesteigert. Zwischenfälle durch unbewusstes Schalten können dadurch effektiv verhindert werden. Die Druckentriegelung kann bei allen Nocken- und Lasttrennschaltern der Baugrösse D0 und D1 eingesetzt werden, die als zentrallochbefestigte Variante erhältlich sind. Des Weiteren sind alle Griffe und Griffsperren der Baugrösse D0 kompatibel, mit Ausnahme der runden Vorhängeschlosssperre Z33. carlgeisser.ch
AG 8460 Marthalen elcase.ch

Swibox AG 3175 Flamatt swibox.ch
Electronic AG 8620 Wetzikon elma.com
Offizielles Bulletin der swissT.net-Sektion Sensoren
In der aktuellen Ausgabe der «Sensoren News» präsentiert die Firma ifm electronic AG aus Härkingen ihre neusten Produkte.

Mit Condition Monitoring lassen sich entstehende Maschinenschäden an rotierenden Maschinen frühzeitig erkennen
Ausgewählte Mitglieder der swissT.net-Sektion Sensoren
Präsident: Marc Waltisperger, Pepperl+Fuchs AG
Vorstand: Peter Bader, ifm electronic ag Pascal Fischer, Pilz Industrieelektronik GmbH
Claudio Masoch, Sick AG

Balluff AG 2504 Biel balluff.com

Vibrationen von Maschinen sind wichtige Merkmale, wenn es um die Beurteilung des aktuellen Zustands geht Schäden an Wälzlagern und anderen Maschinenkomponenten lassen sich so frühzeitig erkennen, bevor es zum kostspieligen Maschinenstillstand kommt. Der neue und smarte IO-Link-Vibrationssensor von ifm hilft dabei, ein einfaches und skalierbares Condition Monitoring zu realisieren – alles in einem einzigen Gerät.

Baumer Electric AG 8501 Frauenfeld baumer.com

Euchner AG 7320 Sargans euchner.ch Pepperl+Fuchs AG 2504 Biel/Bienne pepperl-fuchs.com
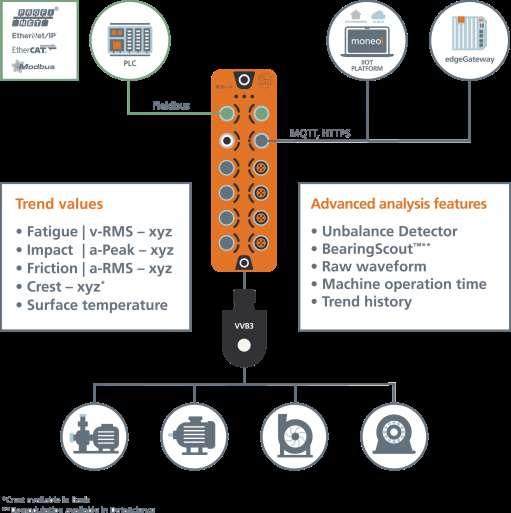
Der neue Condition-Monitoring-Sensor VVB30x von ifm erfasst kontinuierlich die Schwingungen in allen drei Raumrichtungen. Aus den aufgenommenen Messwerten berechnet der Sensor bewährte Zustandsindikatoren zur Bewertung des Maschinenzustands: Informationen über Ermüdung (v-RMS), mechanische Reibungen (a-RMS), Stösse (a-Peak) und Lagerverschleiss (Crest-Faktor) Ausserdem wird die Oberflächentemperatur als zusätzlicher Verschleissindikator übermittelt. Zusätzlich bietet der Sensor noch eine ganze Bandbreite an smarten Zusatzfunktionen: In der Ausführung Basic Condition Monitoring kann der Sensor kontinuierlich eine entstehende Unwucht der Maschine analysieren und im Bedarfsfall sicher kommunizieren, zudem erfasst der Sensor die Maschinenbetriebsstunden auf Basis des maschinenbezogenen Schwingungspegels, welcher eine weitere Hilfsgrösse in der modernen Instandhaltung darstellt. In der Ausführung DataScience Condition Monitoring bietet das Gerät zusätzlich noch ein smartes Lagerdemodulationsverfahren zur
ifm electronic ag 4624 Härkingen ifm.com

Pilz Industrieelektronik 5506 Mägenwil pilz.ch

Die Schwingungsdaten können über eine MQTToder HTTPS-Schnittstelle an übergeordnete Systeme übertragen werden.
sicheren und kontinuierlichen Lageranalyse an, den sogenannten BearingScout.
Condition Monitoring in einem einzigen Gerät
Zur Datenübertragung, Gerätediagnose und Parametrierung setzt der neue Schwingungssensor auf IO-Link Darüber können Anwender die Schwingungsüberwachung und -analyse herstellerunabhängig in jedem beliebigen SCADA-System über die marktüblichen Feldbus-Protokolle oder gleichzeitig über eine standardisierte MQTT- oder HTTPSSchnittstelle in jedem beliebigen IT-System realisieren. ifm electronic bietet hier mit der IIoT-Plattform moneo eine ganze Bandbreite von smarten Zusatzfunktionen zur Fehler-Ursachen-Analyse an, wodurch sich ein IT-basiertes Condition Monitoring einfach umsetzen lässt. Auch die Konfiguration erfolgt ganz einfach über IO-Link: Basierend auf der jeweiligen Maschinenkategorie gemäss ISO 20816-3 sind vordefinierte Grenzwert-Profile direkt im Gerät hinterlegt. Diese können über das entsprechende Systemkommando
Leuze electronic AG 8247 Flurlingen leuze.ch

Sick AG 6370 Stans sick.ch
Der neue VVB30x bietet eine Schwingungsüberwachung in alle drei Raumrichtungen.
an die jeweilige Zielapplikation angepasst werden Wird ein Grenzwert überschritten, ist dank des integrierten BLOB-Ringspeichers eine detaillierte Fehler-Ursachen-Analyse problemlos auch ohne moneo möglich Bis zu 12 Sekunden an Rohdaten können im Bedarfsfall automatisch bereitgestellt werden Darüber hinaus ist der Sensor mit einer internen Kennwerthistorie versehen, die den Einblick auf den Verlauf der vergangenen neun Tage ermöglicht
Mit dem Condition Monitoring lassen sich entstehende Maschinenschäden an Pumpen, Lüftern, Getriebemotoren, Vakuumpumpen und vielen weiteren rotierenden Maschinen frühzeitig erkennen Dadurch können Instandhaltungsarbeiten kosteneffizient und bedarfsgerecht geplant und die Maschinenverfügbarkeit maximiert werden Wenn Vibrationen an Maschinen die Qualität beeinflussen, hilft das Condition Monitoring zusätzlich dabei, den Produktionsprozess zu verbessern
ifm.com
Micro-Epsilon (Swiss) AG 9300 Wittenbach micro-epsilon.ch
Themen
Offizielles Bulletin der swissT.net-Sektion Sensoren
In der aktuellen Ausgabe der «Sensoren News» präsentiert die Firma Pilz Industrieelektronik aus Mägenwil ihre neusten Produkte.

Wenn etwa eine Roboterzelle abgesichert wird, muss Hintertretschutz und ein sicherer Wiederanlauf nach SIL 2 unbedingt gewährleistet sein. PSENradar mit FSoE-Funktionalität von Pilz erreicht diese bei Roboteranwendungen erforderliche höchste Sicherheit
Ausgewählte Mitglieder der swissT.net-Sektion Sensoren
Präsident: Marc Waltisperger, Pepperl+Fuchs AG
Vorstand: Peter Bader, ifm electronic ag Pascal Fischer, Pilz Industrieelektronik GmbH
Claudio Masoch, Sick AG
Technik

Balluff AG 2504 Biel balluff.com

Nicht trennende Schutzeinrichtungen kommen für die Bereichsabsicherung bevorzugt zum Einsatz. Zu berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen zählen auch sichere Radarsysteme. Wann aber kommt dieser Sensortyp zum Einsatz?
Markus Locke, Pilz
Als Faustformel für den Einsatz eines sicheren Radarsystems gilt: überall dort, wo optoelektronische Sensoren an ihre «Umgebungs»-Grenzen stossen, ist Radar die richtige Wahl. Denn im Vergleich zu optoelektronischen Sensortechnologien kann der Radarsensor nicht nur raue Umgebungen mit Schmutzbelastung und Stäuben gut vertra-

Baumer Electric AG 8501 Frauenfeld baumer.com

Omron Electronics AG 6340 Baar industrial.omron.ch Panasonic Industry Switzerland AG 6343 Rotkreuz industry.panasonic.eu/de
Euchner AG 7320 Sargans euchner.ch Pepperl+Fuchs AG 2504 Biel/Bienne pepperl-fuchs.com
gen, er ist auch in Umgebungen mit extremen Temperaturunterschieden und Wettereinflüssen eine ideale Schutzmassnahme Umwelteinflüsse, die bei Scannern zu Messfehlern führen können, stellen für Radarsysteme kein Problem dar. Denn Radarsysteme arbeiten mit elektromagnetischen Wellen im zweistelligen Gigahertzbereich und reagieren auf Bewegungen.
Der Einsatz der Radartechnologie sollte auch in Betracht gezogen werden, wenn es darum geht, nicht nur Flächen zu überwachen, sondern Objekte in einem dreidimensionalen Raum zu detektieren. Dabei deckt die Überwachung über Radar auch übliche Anwendungsbereiche wie Zugangsabsicherung oder Hintertretschutz ab.
Radar überwacht zweierlei Sicherheit
Ein Radarsensor hat gleich zwei sicherheitsgerichtete Funktionen auf dem Schirm: die Bereichsabsicherung und den Hintertretschutz Erstere gewährleistet, dass bei Betreten des Gefahrenbereichs die Maschine in einen sicheren Zustand versetzt wird Der Hintertretschutz verhindert den ungewollten Wiederanlauf der Maschine, solange sich noch Personen im Gefahrenbereich befinden. Skalierbarkeit und modularer Aufbau von zum Beispiel PSENradar von Pilz machen es möglich, dass das Sicherheitssystem auf das erforderliche Mass angepasst und exakt dimensioniert werden kann
Schutzbereiche «weitsichtig» sichern
Der tatsächliche Schutzraum eines Systems ist von der Anordnung, Installationshöhe und Neigung der Sensoren abhängig. Das sichere Radarsystem PSENradar von Pilz etwa kann – je nach Auswahl des Radartyps – unterschiedlich grosse Flächen oder Bereiche überwachen Zum Radarsensor mit einem Erfassungsbereich von 0 bis 5 Metern deckt
der Sicherheitsexperte nun mit einem weiteren sicheren Radarsensor sogar einen Bereich bis zu 9 Metern ab Das bietet Vorteile insbesondere bei mobilen Anwendungen im Outdoorbereich Dort leistet ein Radar, der «weit sieht», mehr als die herkömmliche Radartechnologie Ein Fallbeispiel: Ein Portalkran sollte möglichst ohne Stopp Material transportieren Ist der Radarsensor direkt am Portalkran montiert, kann der Sensor «direkt nach vorne schauen», ob der Materialtransport wie geplant verläuft. Was die Abschaltzeiten bei eventuellen Störungen anbetrifft, lässt sich so ausreichend Reaktionszeit einberechnen
Anpassbares Sichtfeld = höhere Produktivität Wenn Radarsensoren flexibel anpassbare Sichtfelder ermöglichen, dann können Anwender die Sicherheit ihrer Applikation individuell umsetzen Das ist insbesondere bei beengten Platzverhältnissen von Vorteil, z. B., wenn Maschinen in unmittelbarer Nähe zueinanderstehen Beim Pilz-System zum Beispiel ist das Sichtfeld flexibel einstell- bzw. anpassbar: über den symmetrischen Blickwinkel hinaus sind asymmetrische sowie korridorförmige Blickwinkel umsetzbar. Das Sichtfeld ist über den dazugehörigen Konfigurator individuell einstellbar. Der Anwender konfiguriert sein Sichtfeld, um es dann einfach auf den Radarsensor bzw die Radarlösung zu übertragen.
So bleibt der Radarsensor in Bezug auf seinen Platz an der Maschine oder Anlage flexibel applizierbar. Er schränkt den Produktionsbetrieb nicht ein, sondern sorgt für mehr Produktivität.
Neues Feature für «mehr» Sicht Wenn Radarsensoren zudem unterschiedliche Geometrien sicher überwachen können,

PSENradar von Pilz stellt Sensoren mit einem Erfassungsbereich von 0 bis 5 Metern oder von 0 bis zu 9 Metern zur Verfügung. Damit ist eine effiziente Absicherung mobiler Anwendungen möglich. Über die Produkt-Komponenten hinaus unterstützt Pilz mit einem breiten Dienstleistungsangebot.
ist «mehr» Sichtfeld möglich: Bei den neuartigen Radarsensoren im Pilz-System sind enge oder weite Geraden oder auch Flächen möglich, die kleinere oder grössere Winkel aufzeigen. Solche Radarsensoren überwachen darüber hinaus 3D-Räume, also Volumen. In der Praxis lassen sich über ein flexibel anpassbares Sichtfeld etwa die (Lauf-) Wege enger definieren, um den wertvollen Platz in der Fertigung effizient zu nutzen Möglich macht dies bei PSENradar der deutlich grössere Öffnungswinkel der Radarsensoren, die als 3D-System konzipiert sind Bei diesen Radarsensoren passt sich das Sichtfeld in 10°-Schritten an: der Winkel ist auf einer oder auch auf beiden Seiten verkleinerbar, je nach individueller Anforderung Die Radartechnologie ist als Anwendung im Industrieumfeld zwar noch relativ jung, aber bereits gut angenommen. Schlussendlich trägt Radar dazu bei, die Sicherheit und die Produktivität eines überwachten Bereichs zuverlässig zu gewährleisten pilz.com
ifm electronic ag 4624 Härkingen ifm.com

Pilz Industrieelektronik 5506 Mägenwil pilz.ch
Leuze electronic AG 8247 Flurlingen leuze.ch

Sick AG 6370 Stans sick.ch
Micro-Epsilon (Swiss) AG 9300 Wittenbach micro-epsilon.ch

Die G-RotorPumpe von Gribi Hydraulics ist eine selbstansaugende Verdrängerpumpe, die durch ihre robuste Bauweise und hohe Leistungsdichte beeindruckt.
Dank der speziellen Geometrie der Pumpe sorgt sie für eine konstante, pulsationsarme Förderströmung und eine hervorragende Leistung. Die Materialwahl und die Beschichtung der Einzelteile bieten hervorragende Notlaufeigenschaften, womit die Pumpe auch für das Anlaufen bei niedrigen Temperaturen oder auch das Heisslaufen in Ausnahmefällen bestens geeignet ist. Sie überzeugt mit einer zuverlässigen Funktion in Hydrauliksystemen, Schmiersystemen und Kraftstoffsystemen für Verbrennungs-
motoren. Ihre anpassbare Bauweise ermöglicht es, die Pumpe für spezifische Bedürfnisse zu optimieren – sei es für den Einsatz bei Vakuumbedingungen, bei hohen Temperaturen von bis zu 160 °C oder mit Flüssigkeiten wie Kühlmitteln oder Diesel. Die Pumpen bieten eine hohe Resistenz gegenüber schwierigen Betriebsbedingungen und arbeiten bei Druckwerten bis zu 10 bar und Drehzahlen von bis zu 3000 U/min gribi-hydraulics.ch
CMB100-Serie spart Entwicklungsund Zertifizierungskosten
Rutronik führt mit der CMB100-Serie von Telit Cinterion LTE-basierte IoT-Produkte für die Industrie. Entwickler profitieren durch die Module von reduzierten Entwicklungs- und Zertifizierungskosten sowie durch die Vorzertifizierung für Endgeräte von einer verkürzten Time-to-Market. Zudem minimieren die Komponenten die Lücke zwischen Prototyping und Produktion. Sie punkten u a. mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich (–30 °C bis 75 °C), Firmware-over-the-air (FOTA), 2Gund 3G-Fallback und GNSS. Als erstklassige 3GPP-Release-10-Plattformen sind sie ideal für (I)IoT-Anwendungen. Die CMB100-Reihe besitzt ein einheitliches Design, um aktuelle und zukünftige LTEund 5G-Technologien von Telit Cinterion zu unterstützen und die Integration kommerzieller sowie industrieller Geräte zu vereinfachen. Zusätzlich eliminieren die Module die Komplexität und die Herausforderungen bei Hochfrequenz(RF)-Applikationen. rutronik24.com


Die kompakte Steuerung mit einer Baubreite von lediglich sechs TE zeichnet sich aus durch einen flexiblen Mix aus 14 einzeln konfigurierbaren Ein- und Ausgängen, was zu einer weiteren Platz- und Kostenersparnis führt. Die acht universellen Eingänge eignen sich u a. für Temperatursensoren, 0 10-V-Schnittstellen oder als Zähler. Die beiden Universal- und vier Digitalkanäle sind alternativ als Aus- oder Eingänge einstellbar. Der Catan C1 EN, der mit einem Managed Ethernet Switch ausgestattet ist, umfasst drei Ethernet-, zwei serielle RS-485- und zwei USB-C-Schnittstellen zum Anschluss eines Control Panels sowie von
USB-Peripheriegeräten. Als erster Niagara-Controller hat er zudem eine KNX-TP-Schnittstelle on board. Das steckbare Control Panel unterstützt bei der lokalen Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung. Darüber hinaus gibt es zwei SPE-Schnittstellen für die verschiedenen Catan-Erweiterungsmodule. Als Programmierumgebung und zur Visualisierung steht mit Emalytics und dem Niagara Framework ein leistungsfähiges Werkzeug bereit, das auch der etablierte ILC 2050 BI nutzt. Mit dieser Ausstattung lassen sich Protokolle wie BACnet, KNX oder Modbus integrieren. phoenixcontact.ch
Arrow Electronics zeigt auf der diesjährigen PCIM in Nürnberg die neusten Halbleiter und passive magnetische Komponenten, mit denen Ingenieure effiziente Stromversorgungslösungen für Hochleistungsanwendungen entwickeln können. Zu den vorgestellten Technologien am Stand von Arrow (Halle 4A, Stand 211) zählen unter anderem Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC) und Galliumnitrid-Halbleiter (GaN) für mehr Energieeffizienz und Systemleistung. Arrow arbeitet mit führenden Herstellern zusammen, um ein vollständiges Systemdesign zu ermöglichen
Zu den Schwerpunktthemen gehören Lösungen für hocheffiziente Leistungsumwandlung, Elektrifizierung, Antriebsumrichter, Batteriemanagement, Wasserstoff-Brennstoffzellen und Energiemanagement – Trends, die für die Zukunft der Leistungselektronik von massgeblicher Bedeutung sind. Arrow stellt auf der PCIM modernste Lösungen für Energieanwendungen der nächsten Generation vor, darunter Leistungsmodule mit hoher Leistungsdichte und optimierte Induktivitäten für eine effiziente Stromversorgung. arrow.com



Igus stellt Energiekettenserie E2.1 auf Recycling-Material um Spätestens bis 2050 möchte die Europäische Union eine kreislauforientierte und klimaneutrale Wirtschaft aufbauen. Statt Abfall zu produzieren, setzt eine funktionierende Kreislaufwirtschaft auf das Konzept «cradle-to-cradle» –von der Wiege zu Wiege. Verbrauchsgüter werden in den natürlichen und technischen Kreislauf zurückgeführt, um wertvolle Ressourcen und Rohstoffe zu schonen. Dass das längst keine Zukunftsmusik mehr ist, zeigt Igus mit der Energiekettenserie E2.1, die ab diesem Frühjahr komplett auf Recycling-Material umgestellt wird. Das Unternehmen geht diesen Schritt, nachdem 2022 die erste Energiekette aus Rezyklat vorgestellt wurde. Hergestellt wird die Energiekettenserie nun aus dem Recycling-Werkstoff «igumid CG LW». Dieser besteht aus Post-Consumer-Rezyklat, zum Beispiel aus alten Fischernetzen, sowie ausgedienten Energieketten. igus.ch
Unerreichte KI-Leistung für COMs mit Intel-Core-Ultra-Prozessoren Congatec erhöht die KI-Leistung für Medical-, Robotics-, Industrial- sowie Retailund Gaming-Applikationen auf bis zu 99 TOPS (Tera Operations per Second). Diese enorme KI-Performance stellt Congatec durch das neue Computer-on-Module (COM) «conga-TC750» im Formfaktor COM-Express Compact Type 6 mit Intel-Core-Ultra-Series-2-Prozessoren (Codename Arrow Lake) mit Lion Cove und Skymont P- und E-Cores mit bis zu 16 Cores und 22 Threads sowie integrierter GPU und NPU bereit. Speziell Entwickler, die bereits auf COM-Express-Compact-Plattformen (95 × 95 mm) wie dem «conga-TC700» arbeiten, dürfen sich über einen kurzen Upgradepfad freuen, der ihnen nie dagewesene KI-Performance liefert. Gerade leistungshungrige Grafik- und KI-Applikationen mit höchsten Performance-Ansprüchen können so bei geringem Entwicklungsaufwand und kurzer Time-to-Market von der gesteigerten x86- und KI-Performance von Intels neuem System-on-Chip (SoC) profitieren Die 99 TOPS erreicht der SoC durch eine Kombination aus enormer KI-Performance des integrierten Grafikprozessors (iGPU) Intel Xe-LPG+ für parallele und durchsatzstarke Workloads, die im Vergleich zum Vorgänger Meteor Lake von 18 auf bis zu 77 TOPS stieg, einer NPU, die bis zu 13 TOPS bei einer hohen Energieeffizienz liefert, sowie der CPU mit 9 TOPS für schnelle Reaktionszeiten. Zudem arbeitet der neue SoC mit Intels neuer Xe-LPG+Grafikengine Dank des standardisierten Modulkonzepts für einfache Upgrades und der hohen Skalierbarkeit eignet sich das «conga-TC750» auch für leistungsstarke IPCs oder Thin Clients congatec.com

Das modulare, dynamische Multiachs-Servosystem DIAS-Drive 2000 bekommt eine leistungsstarke Verstärkung. Mit dem Einachs-Modul MDP 2200L-01 zur Ansteuerung von Synchronservomotoren stehen bis zu 20 A Nennstrom zur Verfügung. Versorgung, Netzfilter, Bremswiderstand und Zwischenkreis sind ebenfalls on board – und das auf nur 150 × 240 × 219 mm (Baugrösse 2). Das kombinierte Versorgungs-/Achsmodul wird dreiphasig 400–480 VAC betrieben und schafft bis zu 60 A Spitzenstrom. Im Standard enthalten sind zahlreiche Safety-Funktionen wie STO, SS1, SOS, SBC sowie sichere Geschwindigkeits-, Beschleunigungs-, Positions- und Drehrichtungs-Funktionen – alle bis zu SIL 3, PL e, Kat. 4 und TÜV-zertifiziert. Wie alle MDP-Module der MDD-2000er-Serie kann auch der Einachs-Drive stand-alone oder im Verbund mit beliebig vielen MDD-2000-Achsmodulen beider Baugrössen eingesetzt werden. So ist eine passgenaue Auslegung des Antriebskonzeptes einfach möglich. Im Standard kommt die digitale Motorfeedback-Schnittstelle Hiperface DSL zum Einsatz, das spart Kabel und Zeit bei der Inbetriebnahme sigmatek-automation.ch
Höchste Präzision für Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit
Das Teraohmmeter und Picoamperemeter
Sefelec 1500-M von Eaton bietet exakte Messungen von 0,1 kΩ bis 2000 TΩ und von 0,50 pA bis 20 mA – ideal für Isolationswiderstandsmessungen und Spannungsfestigkeitsprüfungen in der Qualitätssicherung, sowohl in der Produktion als auch in der Wareneingangskontrolle. Dank ARM-Dual-Core- und DSP-Technologie profitieren Anwender von hochstabilen, wiederholbaren Messwerten und hohen Testgeschwindigkeiten, was den Prüfprozess effizienter macht und zu schnellen Testergebnissen führt
Der einstellbare Spannungsbereich von 1 V bis 1500 VDC ermöglicht die präzise Anpassung an unterschiedliche Testanforderungen. Der 7-Zoll-TFT-Touchscreen unterstützt die intuitive Bedienung und sorgt für eine übersichtliche Darstellung laufender Prüfungen und Messergebnisse. Für die Speicherung von Konfigurationen und Testergebnissen steht ein grosser Speicher zur Verfügung


Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die grosse Vielfalt des Portfolios von Beckhoff zusätzlich. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels und Panel-PCs einen hohen Bedienkomfort durch modernste MultitouchTechnologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen. Im Speziellen zeichnen die sich Geräte durch ein smartes, schlankes Elektronik- und Gerätedesign, die EtherCAT-Kommunikation (FSoE) auf Tastendruck sowie hochwertige, industrietaugliche Displays mit Multifinger-Touchfunktion aus. Die
hochwertigen, langzeitverfügbaren Next-Multitouch-Panel in Schutzart IP20 und IP65 umfassen Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll in verschiedenen Formaten, Einbau- und Tragarmvarianten sowie in der Ausführung als Panel-PC auch ein breites Spektrum an CPU-Performanceklassen. Hinzu kommen verschiedenstes Zubehör und diverse mechanische Erweiterungen. Durch die Integration neuester Standards steht eine zukunftssichere Panel-Plattform zur Verfügung, mit der sich auf einfache Weise Kostenoptimierungen ohne Änderungen am Anlagendesign realisieren lassen. beckhoff.ch
Lauschangriff auf Lecks und Fehlfunktionen
Akustische Bildgebungskameras erkennen selbst in lärmintensiven Industriebereichen Hochdrucklecks, Teilentladungen und mechanische Fehlfunktionen. Anhand von Schallwellen und deren akustischer Signatur werden Problemstellen identifiziert und klassifiziert, wodurch die Sicherheit erhöht und teure Anlagenausfälle vermieden werden können. Flir stellt mit der Si2-Pro eine innovative Weiterentwicklung in diesem Marktsegment vor, die ab sofort über die Conrad Sourcing Platform erhältlich ist Industrielle Anomalien wie Lagerschäden, Teilentladungen sowie Druckluft- oder Gaslecks können mit der Flir Si2-Pro schnell und zuverlässig lokalisiert werden. Selbst in lärmintensiven Umgebungen detektiert die Kamera mit ihrem weiterentwickelten automati-
schen Filter zielgenau auf bis zu 200 Metern Entfernung potentielle bzw bereits vorhandene Lecks oder Fehlfunktionen anhand ihrer akustischen Signatur. Dadurch kann Gefahren für Mitarbeitende und Produktionsstopps vorgebeugt werden. Die Flir Si2-Pro geht den zweiten und dritten Schritt: Der Mech-Modus der Si2-Pro bietet kamerainterne Entscheidungshilfen und nimmt neben der Schadensmessung auch eine Klassifizierung des Schweregrades von Teilaustritten und eine Abschätzung der Leckgrösse vor. Anhand dieser Daten erfolgt im Anschluss eine Kostenanalyse So können Instandhaltungsmassnahmen effizient geplant und Betriebskosten gesenkt werden. Die bei Flir-Bildgebungskameras bisher schon integrierte Option der Druckluft-Leck-Quantifizierung

40-Watt-DC/DCWandler mit 4:1-Eingang
Die Hauptmerkmale der SKMW40- und DKMW40-Serie von Mean Well sind: standardisiertes Pin-Layout und kompakte Grösse, die eine bessere Stromversorgungslösung für Endgeräte mit begrenztem Volumen bieten, 4:1 (9. 36 Vdc / 18. 75 Vdc), weiter Eingangsspannungsbereich, ultraweiter Betriebstemperaturbereich –40 ° .80 °C, 2-kVdc-Eingangs/Ausgangs-Isolierung, vollständige Schutzvorrichtungen. Der interne Silikongelverguss hilft nicht nur bei der Wärmeableitung und verlängert die Lebensdauer, sondern schützt die Elektronik auch vor Staub und Feuchtigkeit und macht das Produkt vibrationsbeständig. Dank dieser Eigenschaften eignen sich diese Wandler für den Einbau in Schaltschränken, Telekommunikationsanlagen, Industrieautomation, Distributed Power Architecture und Transportanwendungen. Die DC/ DC-Wandler sind ab sofort bei Simpex Electronic AG erhältlich

und Kostenschätzung wurde bei der Si2-Pro deutlich erweitert: Sie steht jetzt auch für andere industrielle Gase wie Stickstoff, Kohlendioxid, Methan, Helium, Argon, Ammoniak und weitere Substanzen zur Verfügung. Mit nur 1,2 kg Gewicht liegt die Si2-Pro auch bei längerer Anwendung gut in der
Hand und ist einfach zu bedienen Sie verfügt über eine integrierte automatische Frequenzabstimmung und Abstandsmessung, 8-fach-Zoom, eine 12-MP-Digitalkamera, GPSDatenintegration und ein QRCode-Lesegerät
conrad.ch
Mehr Effizienz durch Vereinfachung
IEF-Werner entwickelt das Transportsystem «posyART» für Werkstückträger weiter: Das neue 90°-Kurvenelement bietet eine wirtschaftliche Lösung durch den Verzicht auf aktive Antriebs- und Steuerungskomponenten. Diese Alternative wurde im Rahmen einer Techniker-Arbeit entwickelt. Sie optimiert Materialfluss sowie Kostenstruktur. Das Innenkurvenelement ermöglicht einen präzisen Materialfluss, indem der Werkstückträger zwischen den beiden Bändern über Kugelrollen geführt wird. Die Lösung funktioniert einheitlich für alle Werkstückträgergrössen – 200, 240 und 400 Millimeter – und ermöglicht wie bisher auch eine maximale Belastung von bis zu 200 Newton pro Werkstückträger ief.de

Ein neuer und fortschrittlicher Messumformer für die kombinierte Messung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt wurde von Rotronic, Teil der Processing Sensing Technologies Group, auf den Markt gebracht Der «HygroFlex HF5A» wurde für alle Anwendungen entwickelt, bei denen schnelle, genaue und wiederholbare Messungen entscheidend sind. Er verfügt über die neueste NFC-Technologie (Near Field Communication), die es ermöglicht, ihn über ein Smartphone oder einen NFC-fähigen Computer zu programmieren und abzufragen, was den Betrieb vereinfacht und die Einrichtungszeit minimiert. Der HF5A wird mit einer Auswahl an austauschbaren Messfühlern von Rotronic geliefert. Diese ermöglichen eine schnelle Initialisierung und wurden für den Einsatz in rauen Industrie- und Laborumgebungen entwickelt. rotronic.com

«at – aktuelle technik»
Die Schweizer Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik 48 Jahrgang aktuelle-technik.ch
Herausgeberin
Vogel Communications Group AG
Seestrasse 95 8800 Thalwil Tel. 044 722 77 00 media@vogel-communications.ch vogel-communications.ch
Verlagsleitung
Matthias Böhm
Redaktion
Anne Richter, Chefredaktorin anne.richter@vogel-communications.ch
Andreas Leu andreas.leu@vogel-communications.ch
Anzeigenverkauf
Für steigende Konnektivität in der Industrie: Binder erweitert Portfolio um M8-D-Steckverbinder mit Litzen
Mit zunehmender Vernetzung und steigendem Austausch von Informationen in der Fabrikautomation wächst der Anspruch an zuverlässige und flexibel einsetzbare Verbindungslösungen. Binder, Anbieter industrieller Rundsteckverbinder, erweitert jetzt sein Portfolio um M8-D-kodierte Steckverbinder mit Litzen. Die neue Variante gibt Anwendenden die Möglichkeit, die Verdrahtung

Inserenten und Partnerfirmen in dieser Ausgabe
Arrow Central Europe GmbH, Neu-Isenburg 47
BOLL Engineering AG, Wettingen 34
BTO Solutions Schürch AG, Winterthur 15
dataTec AG, Reutlingen (D) 7
Endress+Hauser (Schweiz) AG, Reinach 01, 18
GRIBI Hydraulics AG, Bergdietikon 46
individuell an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen und noch bessere Übertragungsergebnisse (z. B. im Profinet-Standard) zu erzielen. Die werksseitig unverdrillten Litzen können durch die Möglichkeit der individuellen Anpassung vielseitig eingesetzt werden. M8-D-kodierte Steckverbinder sind ideal für die industrielle Kommunikation geeignet und ermöglichen eine zuverlässige Signal- und Datenübertragung in Maschinen und Anlagen. In der Fabrikautomation spielen sie eine zentrale Rolle, wenn es um die Vernetzung von Geräten und die sichere Datenübertragung sowie -protokollierung geht. Auch in Transport- und Logistiksystemen kommen die Lösungen zum Einsatz – etwa zur Anbindung von Sensoren und Steuerungen in Förderanlagen oder zur Steuerung und Überwachung von Transportmitteln. Darüber hinaus finden sie Anwendung in der Energiebranche sowie in der Medizintechnik, wo sie Geräte und Sensoren in diagnostischen und therapeutischen Systemen verbinden binder-connector.ch
igus Schweiz GmbH, Egerkingen 35
Ineltro AG, Regensdorf 37
KELLER Druckmesstechnik AG, Winterthur 52
Kistler Instrumente AG, Winterthur 27
Micro-Epsilon Messtechnik
GmbH & Co. KG, Ortenburg (D) 5
Motronic AG, Gossau SG 31
Rotronic AG, Bassersdorf 50
Simpex Electronic AG, Wetzikon 49 swissT.net Swiss Technology Network, Volketswil 17
Loris De Cia loris.decia@vogel-communications.ch; Julia Mirsberger julia.mirsberger@vogel-communications.ch; Margaux Pontieu margaux.pontieu@vogel-communications.ch; Abetare Yaves abetare.yaves@vogel-communications.ch
Stephan Knauer knauer@vogel-cs.de
Produktion/CvD
Barbara Gronemeier barbara.gronemeier@vogel-communications.ch
Konzeption und Layout
Alexandra Geißner Tel. +49 931 418 2736
Druck
AVD GOLDACH AG 9403 Goldach avd.ch
Fragen zur Produktsicherheit: produktsicherheit@vogel.de
Leserservice/ Abonnementsdienst
Telefon: +41 44 722 77-88
E-Mail: abo@vogelcommunications.ch
Verkaufspreis
Einzelexemplar CHF 7.–1 Jahr CHF 64.— Ausland zuzüglich Porto Druckauflage 9000 Exemplare
Alle Rechte vorbehalten ISSN 2297-9425
Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck von Artikeln ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion und genauer Quellenangabe gestattet. Mit Verfassernamen beziehungsweise Kürzel gezeichnete Veröffentlichungen geben die Auffassung der Autoren und nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Publiziertes Bildmaterial, sofern nicht angeführt, wurde dem Verlag zum Abdruck zur Verfügung gestellt. Für unaufgefordert eingereichte Manuskripte und Bilder kann keine Haftung übernommen werden

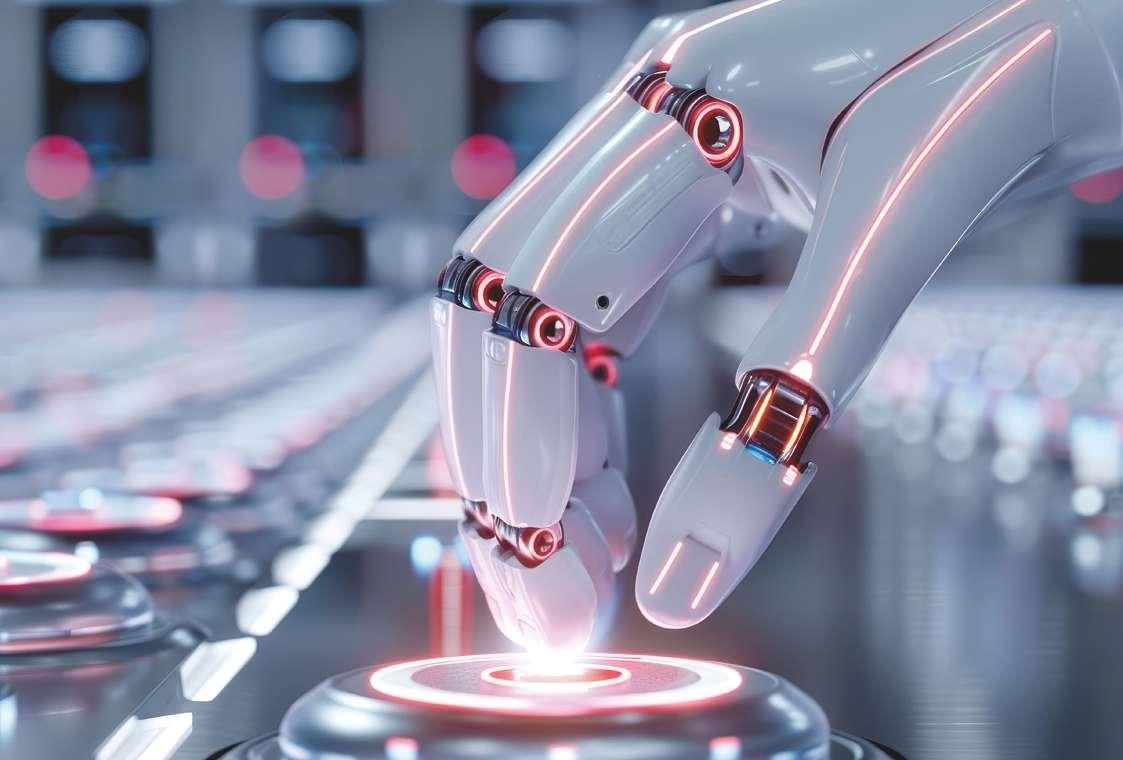
aktuelle technik
30. Oktober 2025, Messe Luzern
ANTRIEBE – STEUERUNGEN – SENSORIK – VISION – ELEKTRONIK – SOFTWARE – MESSTECHNIK – ENGINEERING


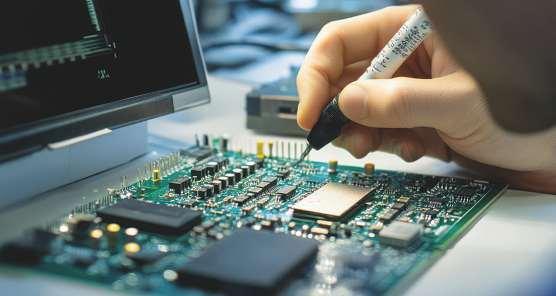
Weitere Informationen: at-technologietag.ch

















keller-pressure.com
WELTWEIT «SCHWEIZER PRÄZISION»
KELLERPressurewurde 1974 gegründet und istmarktführend in derHerstellung vonpiezoresistiver Druckmesstechnik.
Die gesamte Wertschöpfung erfolgtamHauptsitz in Winterthur
Alle Produktetragendas Gütesiegel «SwissMade» und verkörpern dasschweizerische Verständnis vonQualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit.
Erfahremehr