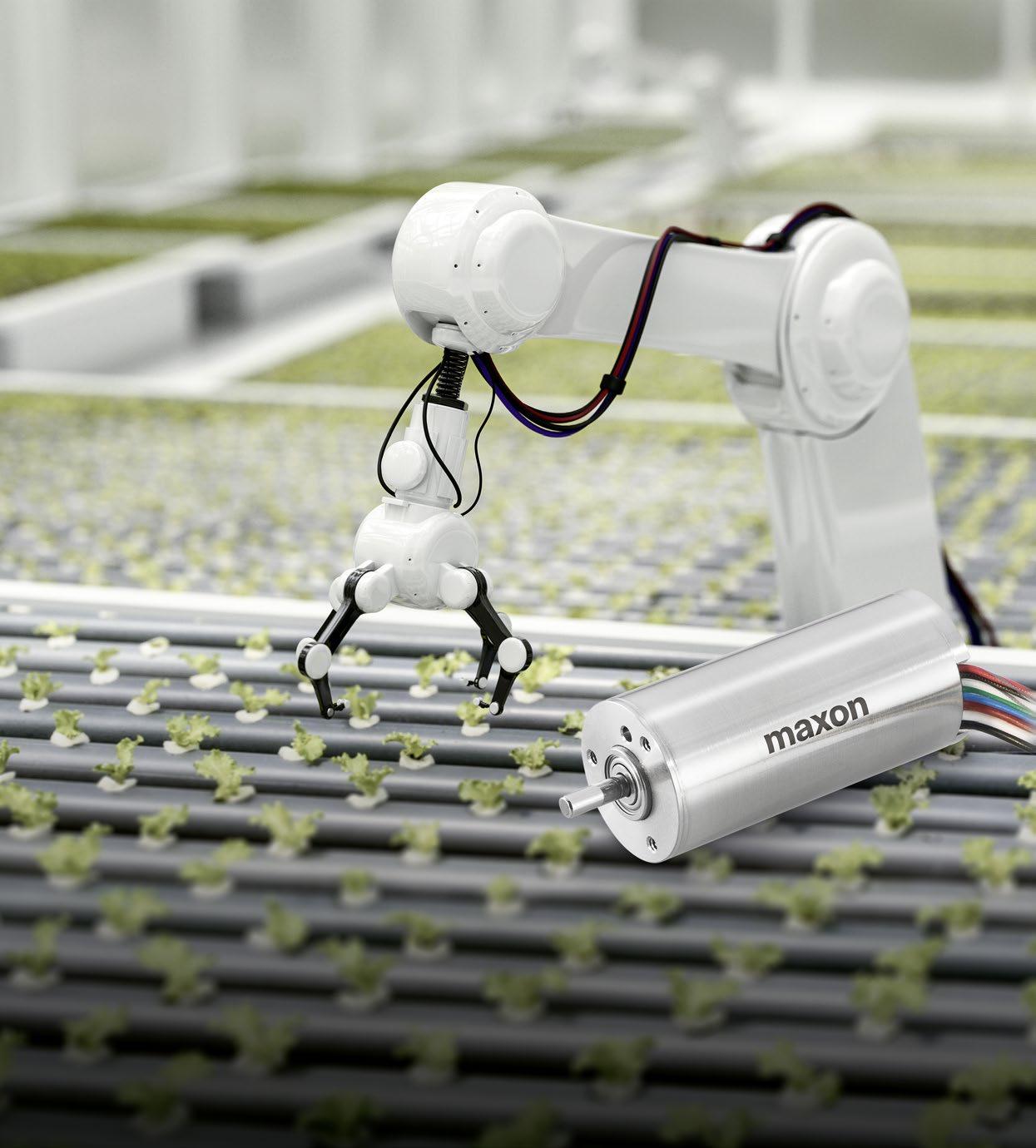
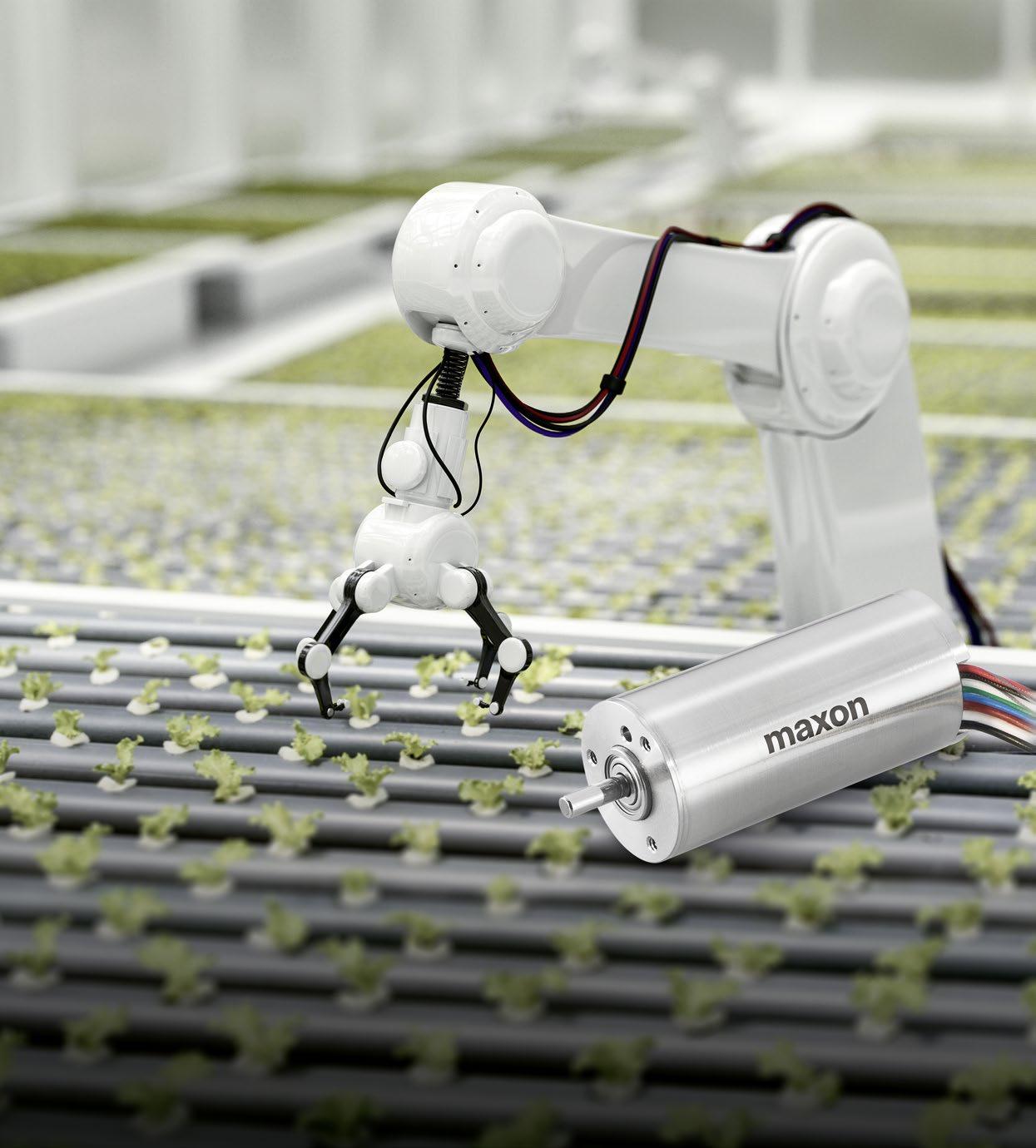
ANTRIEBE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

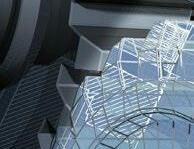







│www.digital-engineering-magazin.de/abonnement/
SMARTE ANTRIEBE
IM MITTELPUNKT
Liebe Leserinnen und Leser,
egal, ob es sich um eine Werkzeugmaschine, um ein fahrerloses Transportsystem oder um einen Roboter handelt – ohne elektrische Antriebssysteme können all diese Produkte nicht arbeiten. Des halb gehören leistungsfähige Antriebe auch zu den elementaren Bestandteilen vieler Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die zunehmende Digitalisierung führt auch in diesem Bereich zu immer intelligenteren und smarteren Lösungen, die beispiels weise eine Zustandsüberwachung oder eine vorausschauende Wartung ermöglichen.
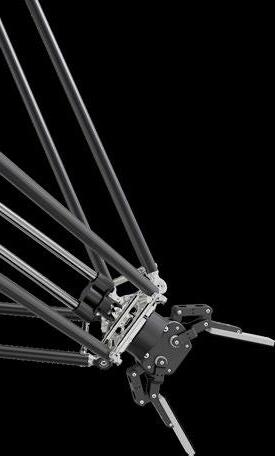
Diese intelligenten Antriebssysteme kombinieren traditionelle elektrische Antriebstechnik mit fortschrittlichen digitalen Technologien, um Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in industriellen Prozessen zu steigern.
Was sind aber derzeit die wichtigsten Herausforderungen in der Antriebstechnik, welche Vorteile bieten intelligente An triebslösungen im Maschinenbau und wohin geht die Reise in Sachen Energieeffizienz? All das haben wir im Rahmen unserer Expertenumfrage neun Antriebstechnik-Spezialisten gefragt. Die Antworten lesen Sie auf den Seiten 8 bis 13.
Intelligente Antriebslösungen kommen inzwischen in vielen Branchen zum Einsatz, so auch in der Landwirtschaft. Lesen Sie in der Titelstory auf Seite 6 und 7, was Landwirtschaft 4.0 bedeu tet und warum sich DC-Motoren leicht in IoT-Technologien inte grieren lassen, die datengestützte Entscheidungen ermöglichen.
In unserem Sonderheft kommen aber auch traditionelle Seg mente der Antriebstechnik wie Getriebe, Kupplungen, Frequenz umrichter oder Encoder nicht zu kurz. Mehrere Beiträge verschaf fen eine aktuelle Übersicht und geben spannende Einblicke.
Viel Spaß beim Lesen!

RAINER TRUMMER Chefredakteur
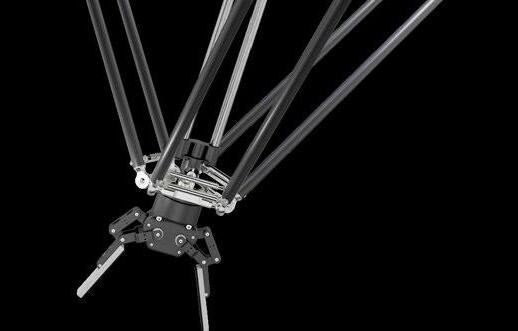

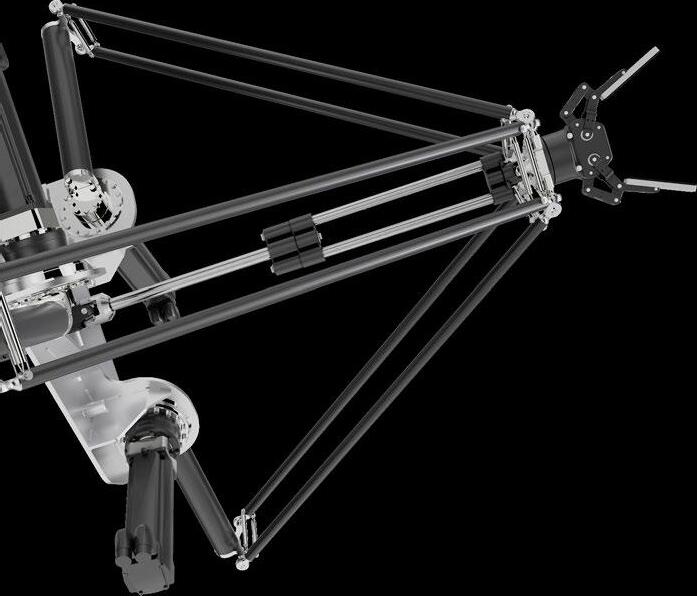
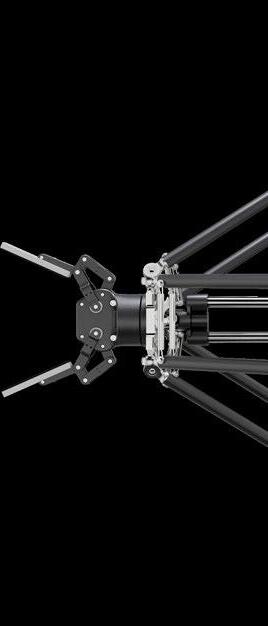
NDF: DAS MUST-HAVE FÜR DELTAROBOTER

Delta-Roboter lieben unser neues NDF so sehr, dass sie es am liebsten alle haben wollen. Denn wer sich so schnell und präzise bewegt, stellt eben besondere Ansprüche an sein Getriebe. Wir haben zugehört und das pfeilschnelle, megapräzise und hochdynamische NDF entwickelt. Und das Beste: Es ist genug für alle da!
Sprechen Sie uns an: 07825 847-0 neugart.com
Besuchen Sie uns vom 12. bis 14.11.2024 bei der SPS in Nürnberg. Halle 4 | Stand 280
5 Märkte & Trends
Neue Produkte und News aus den Unternehmen
6 Titelstory: Auf den richtigen Antrieb kommt es an DC-Motoren in der Landwirtschaft 4.0
8 Smarte Antriebslösungen im Mittelpunkt
Expertenumfrage: Antriebstechnik
14 Für einen sauberen Schnitt
Bystronic setzt bei Laserschneidmaschinen auf hybride Antriebstechnik
16 Papierbanderole
löst Schrumpffolie ab Reduzierter Projektierungsaufwand bei Getränkeverpackungsanlage
19 Auf das Wesentliche reduziert Distanzkupplung ohne zusätzliche Zwischenlagerung
20 Taktgeber der Industrie
Hightech-Getriebe für eine zukunftsfähige, automatisierte Produktion
22 Königliche Zähne
Miniaturisiertes Galaxie: Benchmark bei hochsteifen Präzisionsgetrieben
24 Freie Auswahl für Getriebebauer Lösungen für spielfreie Verbindungen
26 Gebündeltes Know-how für das Getriebe-Herzstück Verzahnung als Qualitätsfaktor bei Planetengetrieben
28 Für FTF mit hohen Ansprüchen Fahr-Lenk-System ermöglicht hohe Flexibilität und Beweglichkeit
30 Bekannter Effekt klug genutzt Encoder mit GMI-Technologie
32 Platzwunder mit hoher Datenübertragungsrate Encoder mit 1:3-Konuswelle
34 Linearachsen für alle Fälle Lineartechnik und Schutzsysteme
36 Dieser Antrieb lässt Motoren kalt Drei-Level-Frequenzumrichter für einen neuen Turbokompressor
38 High-End-Antrieb für High-Speed-Einsätze Umrichter für die Regelung sämtlicher Motorenarten
40 Beste Lagesicherung bei hohen Drehzahlen Sicherungsringe für Anwendungen in der Antriebstechnik
42 Energieeffizienter Antrieb auf dem Prüfstand Synchronreluktanzmaschine für Automotive-Forschungsprojekt
44 Natürlicher Gang trotz Beinprothese
DC-Motor als treibende Kraft im Fußgelenk
46 Über QR-Code schnell zu digitalen Services Online-Konfigurator ermöglicht eine schnelle Produktauswahl
3 EDITORIAL
45 IMPRESSUM
HYBRIDE ANTRIEBSTECHNIK
Bystronic war auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Antriebslösung für seine Laserschneidmaschine ByCut Eco. Fündig wurden die Schweizer bei AMKmotion. Der Hersteller lieferte ein System an hybrider Antriebstechnik, das nicht nur dynamisch und genau arbeitet, sondern auch die Verkabelung vereinfacht und Platz im Schaltschrank schafft.
Bild: Bystronic Laser
REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, ANBIETER UND VERANSTALTER
AMKmotion S. 8, 14, Ben Buchele S. 42, Dunkermotoren S. 9, ebm-papst S. 28, Faulhaber S. 44, Halstrup-Walcher S. 10, Hengstler S. 32, Jakob Antriebstechnik S. 19, KBK Antriebstechnik S. 10, 24, KEB Automation S. 38, Maxon S. 6, 10, Nabtesco S. 12, 20, Neugart S. 26, RK Rose+Krieger S. 34, Servotecnica S. 30, SEW-Eurodrive S. 12, 16, Sieb & Meyer S. 36, SPN Schwaben Präzision S. 12, Stöber Antriebstechnik S. 46, TFC S. 40, WEG S. 5, Wittenstein S. 13, 22
TITELSTORY:
DC-MOTOREN IN DER LANDWIRTSCHAFT 4.0
Die Landwirtschaft stellt die erste und wichtigste Stufe in der Nahrungsmittelproduktion dar. Der Sektor steht jedoch unter ständigem Druck, seine Produktivität und Effizienz zu steigern und sich den Herausforderungen einer sich wandelnden Politik zu stellen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt Landwirtschaft 4.0 auf die Integration moderner Technologien wie Robotik und automatisierte Methoden, die über Cloud-Computing mit daten gesteuert und überwacht werden. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 6

WEG
ANTRIEBSTECHNIK
NEU GEDACHT
WEG stellt einen Axialflussmotor vor, der deutliche Volumeneinsparungen im Maschinenbau ermöglicht und Konstrukteuren neue Wege in der Antriebstechnik eröffnet. Gleichzeitig setzt der W23 Sync+Ultra bei den konventionellen Bauformen neue Standards in puncto Energieeffizienz. Beide Entwicklungen sind zusammen mit den Umrichtern der CFW-Serie Teil des ganzheitlichen WEGmotion-Drives-Konzepts, das Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit in Einklang bringt.
Der W23 Sync+Ultra steht für eine Hybridtechnologie, die die

Titelanzeige: Maxon DC-Motoren in der Landwirtschaft 4.0
Die landwirtschaftliche Produktion steht am Anfang der Lebensmittelverarbeitungskette. Da die Herausforderungen für die konventionelle Landwirtschaft, wie etwa der Arbeitskräftemangel, fortbestehen, wird sich der Sektor zunehmend auf Robotik und Automatisierung verlassen müssen. Diese Verschiebung erhöht die Abhängigkeit von Bewegungssystemen in der Agrartechnik. Martin Leahy, Vertriebsingenieur des Antriebsspezialisten Maxon, erläutert die Hintergründe.
Maxon Group Germany
Truderinger Straße 210 81825 München, Deutschland Telefon: +49 89 42 04 93-0
E-Mail: info.de@maxongroup.com www.maxongroup.com

WEG-Hybridmotor der Serie W23 Sync+Ultra. Bild: WEG
Vorteile von Permanentmagnet- und Synchron-Reluktanzmotoren vereint und so eine sehr hohe Energieeffizienz erreicht. Durch sein fortschrittliches Design reduziert der Motor die magnetischen Verluste erheblich und steigert den Wirkungsgrad weit über herkömmliche Standards wie IE4 und IE5 hinaus – und das über einen weiten Betriebsbereich. Diese technologische Innovation führt zu einer deutlichen Senkung der Betriebskosten und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Ein Controller – so vielfältig wie Ihre Anforderungen

MOVI-C® CONTROLLER Typ UHX86A
Die Lösung im Automatisierungsbaukasten MOVI-C® für den oberen Performancebereich. Der Controller vereint Bewegungssteuerung mit Maschinensteuerung und lässt sich darüber hinaus auch für Industrie 4.0-Anwendungen einsetzen. Eine Vielzahl technischer Applikationen ist mit diesem Gerät zuverlässig möglich, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Industrietauglichkeit oder Bedienbarkeit.
Ihre Vorteile auf einen Blick: durchgängige, benutzerfreundliche Engineering-Umgebung • hochgradige applikationsspezifische Vernetzung
• Industrie-PC, Motion-Control-Aufgaben und SPS in einem Gerät vereint

AUF DEN RICHTIGEN ANTRIEB KOMMT ES AN
In der vertikalen Landwirtschaft werden DC-Motoren in der Regel für den Antrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen sowie von intelligenten Bewässerungs-, Dreieckspflanzund Ernterobotern benötigt.
Die Landwirtschaft stellt die erste und wichtigste Stufe in der Nahrungsmittelproduktion dar. Der Sektor steht jedoch unter ständigem Druck, seine Produktivität und Effizienz zu steigern und sich den Herausforderungen einer sich wandelnden Politik zu stellen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt Landwirtschaft 4.0 auf die Integration moderner Technologien wie Robotik und automatisierte Methoden, die über Cloud-Computing mit Echtzeitdaten gesteuert und überwacht werden. » VON MARTIN LEAHY
Dreh- und Angelpunkt des technischen Fortschritts in der Landwirtschaft 4.0 ist der DCMotor, der neben kompakten Abmessungen und geringem Wartungsaufwand auch präzise Bewegungen ermöglicht. DC-Motoren eignen sich am besten für die effiziente Umsetzung von Drehbewegungen in batteriebetriebenen Geräten und Maschinen. Vor allem lassen sie sich leicht in IoT-Technologien integrieren, die Echtzeitanpassungen und datengestützte Entscheidungen ermöglichen.
Der autonome mobile Roboter (AMR) oder Agrarroboter ist ein Paradebeispiel für die Vorteile der neuen Technologien in der Landwirtschaft 4.0. Der zunehmende Einsatz und die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme im Vergleich zu herkömmlichen Methoden werden das Gesicht der Landwirtschaft nachhaltig
verändern. Agrarroboter sind auf dem Markt auf dem Vormarsch, was auf Faktoren wie hohe Kosten für Herbizide und Arbeitskräfte, aber auch auf immer strengere Umweltauflagen zurückzuführen ist. Diese Roboter sind für Aufgaben wie mechanisches Unkrautjäten, Obsternte, Präzisionssaat und sogar für das Ausmisten und Füttern in der Viehwirtschaft konzipiert.
Obwohl viele AMR mit hochentwickelten bild- und geodatenbasierten Navigationssystemen ausgestattet sind, müssen sie dennoch sicher und relativ einfach zu bedienen sein. Für den Antrieb ihrer Räder und um Werkzeuge oder Ausrüstung zu bedienen, sind Agrarroboter auf DC-Motoren angewiesen. Diese Motoren und ihre Steuerungen müssen präzise arbeiten und sehr langlebig sein, da sie je nach Jahreszeit den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind.
Landwirtschaftliche Drohnen bieten viele Vorteile
Gleichzeitig haben Fortschritte bei unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) dazu geführt, dass landwirtschaftliche Drohnen immer häufiger für das Spritzen, Säen, Kartieren und Inspizieren von Nutzpflanzen und Vieh zum Einsatz kommen. Unwegsames Gelände stellt für Drohnen keine Herausforderung dar. Überdies können sie dazu beitragen, Kosten sowie den Wasserverbrauch zu senken, indem sie eine gezielte und präzise Ausbringung von Spritz- und Düngemitteln auf der
DC-MOTOREN LASSEN SICH LEICHT IN IOT-TECHNOLOGIEN INTEGRIEREN, DIE ECHTZEITANPASSUNGEN UND DATENGESTÜTZTE ENTSCHEIDUNGEN ERMÖGLICHEN.
Grundlage von Echtzeitdaten ermöglichen. Drohnen verursachen keine Bodenverdichtung und sind umweltfreundlich, da der Chemikalien- und Wasserverbrauch durch selektive Sprühtechniken minimiert wird.
DC-Motoren treiben die Drohne über die Propeller an und versorgen auch Zusatzausrüstung wie Sprühpumpen oder bewegliche Kameraaufhängungen mit Strom. Sicherheit und Zuverlässigkeit sind daher neben der Energieeffizienz die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl des Motors.
Ein weiteres Wachstumsfeld, das sich aus den Vorteilen der Landwirtschaft 4.0 ergibt, ist die vertikale Landwirtschaft. Obwohl dieser Ansatz derzeit noch auf hochwertige Agrarprodukte wie Blattgemüse, Kräuter, Erdbeeren und Tomaten beschränkt ist, ermöglicht er eine ganzjährige, wetterunabhängige Produktion und lässt sich im urbanen Raum umsetzen, wodurch der Weg vom Bauernhof bis auf den Tisch verkürzt wird. Hier sind anpassungsfähige Beleuchtungs- und Belüftungssysteme erforderlich, die für optimale Lichtund Klimabedingungen sorgen. In diesen Anwendungen benötigt man DC-Motoren in der Regel für den Antrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen sowie von intelligenten Bewässerungs-, Dreieckspflanz- und Ernterobotern.

Die Energieeffizienz bei kleiner Baugröße ist entscheidend, weshalb bürstenlose DC-Motoren (BLDC) mit elektronischer Kommutierung von Bedeutung sind. Bilder:
OBSTPFLÜCKROBOTER
ERFORDERN EIN HOHES MASS AN GESCHICKLICHKEIT UND PRÄZISION. DIES LÄSST SICH DURCH DEN EINSATZ VON SENSOREN UND FEEDBACKSYSTEMEN ERREICHEN.
gesetzt. Die kernlose Konstruktion zeichnet sich durch ein niedriges Rastmoment und eine ruckfreie Steuerung aus, wodurch eine präzise und vorsichtige Handhabung ermöglicht wird.
Höhere Effizienz und Ausfallsicherheit
Anforderungen an Bewegungssysteme
Die Anforderungen dieser Anwendungen stellen neue Ansprüche an die für Antrieb und Steuerung verantwortlichen Bewegungssysteme. Um die Bewegungen eines Robotergreifers so zu koordinieren, dass er eine Erdbeere pflücken kann, ohne sie zu beschädigen, ist eine hochpräzise Steue -
rung des Bewegungssystems erforderlich. Motorisch gesehen weisen Obstpflückroboter trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede oft interessante Ähnlichkeiten mit Prothesen auf. Beide Systeme erfordern ein hohes Maß an Geschicklichkeit und Präzision. Dies lässt sich durch den Einsatz von Sensoren und Feedbacksystemen erreichen. Anstelle von konventionellen Motorkonstruktionen mit Eisenläufern wird zunehmend auf die Technologie des kompakten, kernlosen DC-Motors

Landwirtschaftliche Drohnen kommen immer häufiger für das Spritzen, Säen, Kartieren und Inspizieren von Nutzpflanzen und Vieh zum Einsatz.
Statt weniger, sehr großer Maschinen kommen Roboter zunehmend in Schwärmen zum Einsatz, die sich aus kompakteren und leichteren Maschinen zusammensetzen. Diese Strategie steigert die Effizienz und sorgt durch Redundanz für eine höhere Ausfallsicherheit. So werden beispielsweise bei Drohnen zunehmend Bewegungssysteme mit einem hohen Drehmoment-Masse-Verhältnis benötigt. Dadurch kann der Roboter eine größere Nutzlast tragen und die Batterie wird weniger beansprucht. Kompakte DC-Motoren mit hoher Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad, die kleiner und leichter sind als ihre AC-Pendants, spielen daher auch weiterhin eine wichtige Rolle. Ebenso wie kernlose Bauformen, die mit einer zusätzlichen Gewichtsreduzierung einhergehen. Aus den gleichen Gründen ist auch die Energieeffizienz entscheidend, weshalb bürstenlose DC-Motoren (BLDC) mit elektronischer Kommutierung von Bedeutung sind. Diese Motorkonstruktion, wie beispielsweise die EC-Motorenreihe von Maxon, verwendet eine elektronische Kommutierung, welche die Energieverluste im Vergleich zur Bürstenkommutierung minimiert. Wichtig ist, dass sich die Roboter zu jeder Jahreszeit, bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen und an verschiedenen Orten weltweit einsetzen lassen. Bewegungssysteme müssen dafür wiederholbare Leistung, eine lange Lebensdauer und minimale Ausfallzeiten gewährleisten. « RT
Martin Leahy ist Sales Engineer bei Maxon UK.
Maxon

SMARTE ANTRIEBSLÖSUNGEN IM MITTELPUNKT
Smarte Antriebe sind ein Schlüsselelement in der Transformation hin zu einer vernetzten, flexiblen und effizienten Industrie. Was derzeit die wichtigsten Herausforderungen sind, welche Vorteile intelligente Antriebslösungen bieten und wohin die Reise in Sachen Energieeffizienz geht, erläutern uns neun Antriebstechnik-Experten. » VON RAINER TRUMMER
Smarte Antriebe sind zu einem integralen Bestandteil der modernen Industrie geworden und treiben die Entwicklung hin zu Industrie 4.0 und Smart Factories maßgeblich voran. Intelligente Antriebssysteme kombinieren traditionelle elektrische Antriebstechnik mit fortschrittlichen digitalen Technologien, um Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in industriellen Prozessen zu steigern.
FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1. Was sind Ihrer Meinung nach aktuell die wichtigsten Herausforderungen in der Antriebstechnik?
2. Welche Vorteile haben Maschinenbauer von intelligenten und smarten Antriebslösungen?
3. Wohin geht die Reise in Sachen Energieeffizienz in der Antriebstechnik?

1.
ALEXANDER HIPP
Director Sales & Customer Solution Center bei AMKmotion Bild: AMKmotion
Eine der größten Herausforderungen sind die langjährige Verfügbarkeit, immer kürzere Innovationszyklen gepaart mit der Rückwärtskompatibilität sowie der steigende Kostendruck bei den Maschinen- und Anlagenbauern. Optimalerweise sollten sich bewährte und neue Technik miteinander kombinieren lassen. Dadurch hat der Maschinen- und Anlagenbauer einen signifikanten Vorteil: Er kann nach wie vor seine bisherigen Konzepte einsetzen und zusätzlich von Innovationen für seine neuen und bestehenden Maschinen profitieren.
2.
Fehlendes Fachpersonal erfordert zunehmend intelligente Funktionen, um die Inbetriebnahme und Diagnose der Antriebstechnik zu vereinfachen, zum Beispiel Autotuning. Dabei wird die Achse vermessen, und die Parametrierung der Antriebsregler
erfolgt automatisch. Bei der Inbetriebnahme werden daher nur noch bei Bedarf Spezialisten für das Finetuning benötigt.
3.
Eine aktive Versorgungseinheit ermöglicht die Regelung des Zwischenkreises. Dadurch lassen sich Spannungsspitzen von Maschinen und die notwendige Einspeiseleistung des Antriebssystems signifikant verringern. Zusätzlich lässt sich die überschüssige Energie ins Netz zurückspeisen. Auch Lösungen für Maschinen, die rein über DC-Netze gespeist werden, sind stark im Kommen. Damit lassen sich Leistungsüberschüsse über den gesamten Maschinenpark optimal nutzen. Zusätzliche Komponenten, die für AC-Netze erforderlich sind, können dadurch eingespart werden. Wir bei AMKmotion bieten seit Jahren passende Lösungen für diese Anforderungen.

1.
BENJAMIN HOGG
Director Segment Sales Automation bei Dunkermotoren
Bild: Dunkermotoren
Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Herausforderungen für die Antriebstechnik sehr vielschichtig und, abhängig von den diversen Zielmärkten, unterschiedlich stark ausgeprägt. Zu den wichtigsten Punkten zählen die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, um den Anforderungen der CO2-Reduktion gerecht






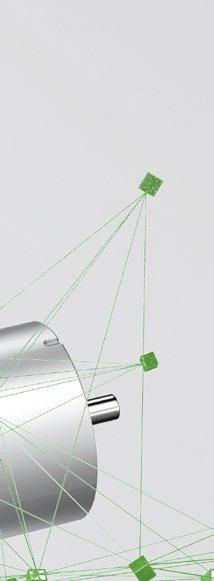



Jetzt lassen sich ebm-papst Antriebe der Baugröße 63 mm auch über eine Ether-CAT-Schnittstelle ansprechen. Das Protokoll gilt als das schnellste der Industrial-Ethernet-Technologien. Mit vielen Vorteilen für dezentrale, intelligente Antriebe und den modularen ebm-papst Antriebsbaukasten.
Mehr erfahren! Jetzt unter ebmpapst.com/modular-drive-system




ANTRIEBSTECHNIK
FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1. Was sind Ihrer Meinung nach aktuell die wichtigsten Herausforderungen in der Antriebstechnik?
2. Welche Vorteile haben Maschinenbauer von intelligenten und smarten Antriebslösungen?
3. Wohin geht die Reise in Sachen Energieeffizienz in der Antriebstechnik?
zu werden. Weiter sind robuste Antriebe mit hoher Leistungsdichte die Grundlage für jede Anwendung. Darüber hinaus ist das Thema Digitalisierung und Vernetzung für IoT-Funktionalitäten wie Remote Monitoring und Predictive Maintainance zunehmend wichtiger, damit eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichergestellt werden kann. Zu den bisher genannten Punkten kommen aus meiner Sicht noch die Themen sichere Lieferketten und natürlich wettbewerbsfähige Marktpreise hinzu.
2. Smarte Antriebslösungen, vor allem mit integrierter Regelelektronik, sind einfach in bestehende Bus- oder EthernetTopologien zu integrieren und benötigen keinen zusätzlichen Platz im Schaltschrank. Komplexe Motion-Profile werden durch den smarten Antrieb eigenständig berechnet, abgefahren und überwacht. Die intelligenten Antriebslösungen können durch die Vernetzung mit der Maschinensteuerung oder einer angebundenen Cloud-Lösung kommunizieren. Durch Echtzeit-Datenanalysen lassen sich Prozesse optimieren, und vorausschauende Wartungen reduzieren die Ausfallzeiten.
3. Die EU-Verordnung 2019/1781 (Ökodesign-Anforderungen an Elektromotoren und Drehzahlregelungen) beschreibt das Thema Energieeffizienz für die elektrische Antriebstechnik. Die Anforderungen an effiziente Antriebslösungen werden stetig steigen, und gerade für mobile Lösungen mit Batteriebetrieb ist ein bestmöglicher Wirkungsgrad notwendig.

CHRISTIAN SURA
Geschäftsführer von Halstrup-Walcher Bild: Halstrup-Walcher
1. ‚Effizient produzieren ab Losgröße 1‘ ist eine zentrale Anforderung der Maschinenbauer. Aus dem engen Kontakt mit unseren Kunden erkennen wir nach wie vor den Trend zu einer steigenden Dynamik bei dezentralen Antriebslösungen. Gleichzeitig führt die immer stärkere Modularisierung dazu, dass standardisierte Antriebe unterschiedlichste Anforderungen abdecken sollten, damit sie in der Breite und mit geringem Verkabelungsaufwand einsetzbar sind. Zudem spielen die Energieeffizienz sowie die Bereiche funktionale Sicherheit und Cybersicherheit eine entscheidende Rolle.
2.
Durch den Einsatz von integrierten Antrieben werden manuelle Prozesse ersetzt. Durch das automatisierte Verstellen, zum Beispiel von Maschinenachsen, ist höchste Positionier- und Wiederholgenauigkeit sichergestellt, was Rüstzeiten deutlich reduziert. Einstellfehler lassen sich vermeiden, was wiederum Ressourcen durch
geringeren Ausschuss schont. Smarte Antriebslösungen unterstützen ebenfalls, wenn Personalressourcen für Rüstprozesse fehlen oder wechselnde Hilfskräfte häufig neu eingelernt werden müssen. Und natürlich bieten die intelligenten Lösungen auch die Möglichkeit, datenbasiertes Condition Monitoring zu betreiben und eine vorbeugende Maschinenwartung zu realisieren, um Ausfälle zu vermeiden.
3.
Ressourcen schonend einzusetzen, steht derzeit im Fokus –das gilt natürlich auch für den Energieverbrauch von Antriebslösungen. Sowohl eine optimale Konstruktion der Antriebselemente als auch eine auf die Applikation optimierte Antriebsauslegung ermöglichen eine Maximierung des Wirkungsgrades und somit eine Steigerung der Energieeffizienz der Maschine. Darauf legen auch wir in unserer internen Entwicklungsarbeit einen großen Fokus.

1.
SVEN KARPSTEIN
Geschäftsführer von KBK Antriebstechnik
Bild: KBK Antriebstechnik
Unsere Antriebselemente kommen überall dort zum Einsatz, wo Prozesse automatisiert werden sollen. Da dies in den unterschiedlichsten Branchen gilt, sind auch die Anforderungen an unsere Kupplungen, Spannsätze und Klemmringe sehr vielfältig. Da manche Anwendungen beispielsweise auf höchste Produktion und Effizienz ausgelegt sind, andere dagegen auf Sicherheit, bieten wir ein breit gefächertes Portfolio an, um möglichst für jede Anwendung die perfekt geeignete Verbindung zu liefern.
2.
Man kann wesentlich besser erkennen und vorbeugen, bevor es irgendwo zu einem Ausfall oder einer Störung kommt. Weiterhin ist das Sammeln und Auswerten von Betriebsdaten sehr wertvoll, um Optimierungen und Anpassungen am Antriebsstrang vornehmen zu können. Hier wird die interessante Frage sein, wie viele Komponenten im Antriebsstrang welche Art der Rückmeldung geben sollen.
3.
Schon seit langem verfolgen wir den Trend, immer kompaktere, leichtere und leistungsstärkere Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Eine auf ihre Massenträgheit optimierte Kupplung kann beim Einsatz mit einem Servoantrieb im 24/7-Betrieb einen deutlichen Unterschied ausmachen. Hier haben wir schon sehr viele bewährte Lösungen im Programm und werden auch zukünftige Entwicklungen immer unter dem Aspekt der Energieeffizienz vorantreiben.

MARKUS PSIK
Area Sales Manager bei Maxon Germany
Bild: Maxon
1. Energieeffizienz, Miniaturisierung und Digitalisierung sind weiterhin die großen Herausforderungen für Unternehmen in der Antriebstechnik. Die Reduzierung des Energieverbrauchs und die
Verbesserung der Effizienz sind zentrale Themen, um die Trends bei batteriebetriebenen Fahrzeugen oder in der Robotik weiter voranzutreiben. Die dadurch erreichte Verlängerung der aktiven Betriebsstunden fällt direkt betriebswirtschaftlich ins Gewicht. Zudem spielen Gewicht und Größe bei gleicher oder besserer Performance eine große Rolle bei modernen Antriebssystemen. Die betrifft alle Komponenten wie Motoren, Getriebe, Bremsen und Encoder. Die Integration von digitalen Zwillingen und vernetzten Systemen in der Antriebstechnik ermöglicht präzisere Steuerungen und Wartungen und stellt große Herausforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung.
2.
Durch die Integration von Sensoren und Überwachungssystemen lassen sich Antriebe kontinuierlich überwachen.
Dies ermöglicht vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), wodurch Ausfallzeiten reduziert werden und die Lebensdauer der Maschinen besser bestimmt oder gar verlängert wird. Dies hilft, den Produktionsprozess stabil zu gestalten und die Ausfallzeiten zu reduzieren oder dann herbeizuführen, wenn die Anlage geplant ruht. Auch der Antrieb selbst wird zukünftig als Sensor in komplexen Anlagen agieren und zusätzliche Informationen über den Zustand der Applikation liefern können.
3.
Themen wie Automatisierung, Digitalisierung, Industrie 4.0, Verfügbarkeit und Miniaturisierung verlieren so schnell nicht an Aktualität und werden uns auch 2025 – und darüber hinaus –begleiten. Im Bereich der Steuerungstechnik wird der Fokus weiter


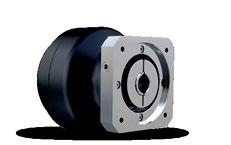





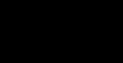
FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1. Was sind Ihrer Meinung nach aktuell die wichtigsten Herausforderungen in der Antriebstechnik?
2. Welche Vorteile haben Maschinenbauer von intelligenten und smarten Antriebslösungen?
3. Wohin geht die Reise in Sachen Energieeffizienz in der Antriebstechnik?
auf Simplicity liegen, das heißt, dem Anwender einfache, aber sehr performante Systeme zur Verfügung zu stellen.

GREGOR DIETZ
Marktmanager für Motoren bei SEW-Eurodrive Bild: SEW-Eurodrive
1. Die Fülle an neuen und kommenden europäischen Gesetzen hat tiefgreifenden Einfluss auf die Produktentwicklung. Hier werden wir als Hersteller wieder die Aufgabe übernehmen müssen, die Auswirkungen und Konsequenzen an die Ausrüster und Betreiber zu vermitteln. Technologisch machen die digitale Transformation und die Vernetzung der Antriebe weitere Fortschritte.
2.
Ausrüster nehmen einen wichtigen Platz zwischen Herstellern und Betreibern ein. Wenn die Ausrüster eigene Geschäftsmodelle aus der Digitalisierung herleiten und deren Anforderungen an die Hersteller vermitteln, werden Vorteile für den Betreiber auch erkennbar. Klassische Betätigungsfelder wie Wartung und Inspektion lassen sich bei entsprechender Gestaltung und Verwendung von Sensorik auch vorausschauend und aus der Ferne umsetzen. Digitale Zwillinge senken die Einstiegshürden zur Identifizierung von Einzel- und Ersatzteilen und ermöglichen dadurch auch eine einfachere Beschaffung über den Ausrüster.
3.
Nach den europäischen Energiespargesetzen zu den Komponenten aus den 2010er Jahren werden bis Ende der 2020er Jahre die Nachhaltigkeitsgesetze als delegierte Rechtsakte umfangreichen Einfluss auf Produkte und deren Anwender haben. Dazu müssen Hersteller, Ausrüster und Betreiber kooperieren, ansonsten wird der Industriesektor die CO2-Ziele im Jahr 2030 verfehlen.

1.
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Digitalisierung, Individualisierung, Industrie 4.0, Automatisierung, Robotik, künstliche Intelligenz (KI), Big Data, Safety, Simplicity, Mass Customisation und Low-Code-/No-Code-Konzepte gehören nach wie vor zu den wichtigsten Themen in der Antriebstechnik. Die Musik spielt dabei vor ANTRIEBSTECHNIK
allem in den Bereichen Software und Steuerungselektronik. Aber nur in Kombination mit hochwertiger Hardware-Technologie lassen sich die Performance- und Effizienzpotenziale der Software-Innovationen voll ausschöpfen. Mechatronische Systeme sind die Zukunft.
2.
Intelligente und smarte Antriebslösungen machen Produktionsprozesse effizienter, erhöhen die Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit, reduzieren Stillstandzeiten und führen zu einer höheren Produktivität. Das sorgt für enorme PerformanceSteigerungen, Energieeinsparungen und Kostensenkungen. Im Fokus stehen vor allem die Echtzeitüberwachung (Condition Monitoring) und die vorausschauende, bedarfsgerechte Wartung (Predictive Maintenance). Sensorisierte Getriebe und der digitale GetriebeZwilling von Nabtesco unterstützen dabei.
3.
Angesichts steigender Energiepreise und immer strengerer Umweltauflagen steht die Industrie unter enormem Druck, auf energieeffiziente, ressourcenschonende und emissionsarme Antriebstechnologien umzusteigen. Hybridisierung, Elektrifizierung und Downsizing sind dabei die zentralen Schlagworte. Zykloidgetriebe sind in vielen Fällen eine effiziente elektromechanische Alternative. Dank ihrer hohen Steifigkeit und kompakten Bauweise ermöglichen sie zudem den Bau kleinerer Maschinen und Anlagen. Das wirkt sich positiv auf den Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die Gesamtbetriebskosten aus.

STEFAN HUBEL
Leiter Entwicklung
bei SPN Schwaben Präzision Bild: SPN Schwaben Präzision
DANIEL OBLADEN
Director Sales & Marketing bei Nabtesco Precision Europe Bild: Nabtesco Precision Europe
1. Die Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle in der modernen Entwicklung von Antriebssystemen, insbesondere durch den Einsatz von Simulationstechnologien wie Mehrkörpersimulationen (MKS) und Fluidsimulationen. Diese Werkzeuge ermöglichen eine präzise Vorhersage des Verhaltens von Systemen und Komponenten, noch bevor physische Prototypen gebaut werden. Ein weiterer Schlüsselbereich der Digitalisierung ist die Entwicklung von digitalen Zwillingen. Diese digitalen Abbilder der physischen Getriebe und Antriebssysteme erfassen Daten aus jeder Phase des Produktlebenszyklus – von der Fertigung über Tests bis hin zum Betrieb. Durch die nahtlose Integration dieser Informationen können Unternehmen wie SPN die Leistung der Systeme nicht nur über die gesamte Lebensdauer optimieren, sondern auch tiefere Einblicke in Effizienz und mögliche Verbesserungen gewinnen. Auch die Vernetzung von Antriebssystemen und die Integration in übergeordnete IT-Systeme bieten neue Chancen.
2.
Wir als Getriebespezialist sehen in intelligenten und smarten Antrieben die Kombination aus mechanischen Getrieben und Sensorik, Datenverarbeitung sowie Kommunikationstechnologie. Mit unseren smarten Sensoren können Maschinenbauer Getriebedaten in Echtzeit erfassen und analysieren, was eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) ermöglicht. Durch direkte Messwerte aus den Kundenprozessen ist die Optimierung des Antriebes möglich. Als Beispiel wäre hier der SPN-Low-Cost-
Drehmomenten-Sensor zu nennen, welcher in der Abtriebswelle integriert ist. Durch den Einsatz von smarten Lösungen erhöhen wir die Anlagenverfügbarkeit, senken Ausfallzeiten und verbessern die Effizienz.
3.
Die wesentlichen Energieverbraucher in der Antriebstechnik sind die Prozesse, die durch diese Technologie gesteuert werden. Um den Energiebedarf langfristig zu senken, ist eine ganzheitliche Strategie zur Reduzierung von Verlusten unerlässlich. Durch den Einsatz von IoT-Technologien und Datenanalyse lassen sich Energieeffizienzpotenziale ermitteln und Betriebszustände kontinuierlich optimieren. Zusätzlich tragen eine Verringerung des Gewichts und der Einsatz von Hochleistungsstählen zur Steigerung der Steifigkeit und der Reduktion des Energieverbrauchs bei. Neue Materialien und innovative Konstruktionsansätze spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Effizienz.

1.
HANS-CHRISTIAN SPRANGER
Leiter Produktmanagement bei Wittenstein Cyber Motor Bild: Wittenstein
Wir bei Wittenstein sehen aktuell zwei zentrale Herausforderungen. Zum einen gilt es, innovative mechatronische Antriebslösungen für einen Maschinenbau zu bieten, der zunehmend durch modulare Maschinenkonzepte, die Dezentralisierung von steuerungstechnischer Intelligenz sowie vielfältige Formen von OT- und IT-Konnektivität gekennzeichnet ist. Zum anderen erkennen immer mehr Maschinenhersteller, wie wichtig die Sicherstellung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Produktionsmaschinen durch eine automatisierte und KI-unterstützte Zustandsüberwachung in Zukunft sein wird – sowohl als Merkmal einer Maschine als auch als Basis für neue, digitale Geschäftsmodelle.
2.
Smarte Antriebslösungen wie die Getriebe mit CynapseFunktionalität in Kombination mit Smart Services von Wittenstein stoßen auf reges Interesse bei Maschinenherstellern. Denn sie sind in der Lage, zustandsrelevante Betriebsdaten von sich selbst und ihrer Umgebung selbstständig zu erfassen und zu verarbeiten. Die Hersteller können den Betreibern dadurch sowohl echte Mehrwerte hinsichtlich Verfügbarkeit und Produktivität bieten als auch, darauf aufbauend, dazu befähigen, eigene digitale Services zu entwickeln und zu verkaufen. Voraussetzung dafür ist die industriegerechte Konnektivität. Daher wird beispielsweise unser Kleinservo-Antriebssystem sowohl mit einer CANopen- und Multi-Ethernet-Schnittstelle für die IT-Anbindung als auch mit OPC UA als OT-Schnittstelle für Industrie 4.0 und das IIoT ausgerüstet.
3.
Antriebe haben auch heute noch einen erheblichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch der Industrie. Entsprechend wichtig ist es, das Potenzial zur Verbrauchsreduzierung in der Antriebstechnik zu erschließen. Energieeffizienz bleibt daher eines der wichtigsten Innovationsfelder bei der Entwicklung und Auslegung von Antriebssystemen.




ANTRIEBSTECHNIK Bystronic
FÜR EINEN SAUBEREN SCHNITT
Der Maschinenbauer Bystronic war auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Antriebslösung für seine Laserschneidmaschine ByCut Eco. Fündig wurden die Schweizer bei AMKmotion. Der Hersteller lieferte ein System an hybrider Antriebstechnik, das nicht nur dynamisch und genau arbeitet, sondern auch die Verkabelung vereinfacht und Platz im Schaltschrank schafft. » VON ANJA SCHABER
Bystronic aus Niederönz in der Schweiz entwickelt und baut Anlagen zur Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.600 Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten und setzte 2022 rund eine Milliarde Euro um.
„Die Vernetzung unserer Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie“, sagt Stefan Züger, Global Media Relations & Product Communication Manager bei Bystronic. „Unsere Kunden erwarten von uns clevere Lösungen und leistungsstarke Produkte.“
Eine solche ist die Laserschneidmaschine ByCut Eco. Für die Einsteigeranlage war der Maschinenbauer auf der Suche nach einem neuen Antriebssystem, das den Schneidkopf in X-, Y- und Z-Richtung verfährt. „Dieses sollte eine hohe Dynamik bieten, die geforderte Bahn- und Teilegenauigkeit beim Laserschneiden ermöglichen und wirtschaftlicher sein als das bisher eingesetzte“, zählt Adrian Krebs auf, der zusammen mit Stefan Jacobi, Leiter Systems Engineering, bei Bystronic für das Projekt zuständig war. „Als Lösung hatte ich mir ein dezentrales System in den Kopf gesetzt“, sagt Jacobi. Und weil er mit AMKmotion und ihrer Technologie bereits bei einem früheren Projekt gute Erfahrungen gesammelt hatte, wandte sich das Bystronic-Team mit seiner Anfrage und einem groben Plan wieder an die Antriebsspezialisten aus Kirchheim unter Teck.

Bystronic suchte eine wirtschaftliche Antriebslösung für die Laserschneidmaschine ByCut Eco, die alle Anforderungen an Dynamik und Genauigkeit erfüllt.
Gemeinsam die Lösung entwickelt Andreas Ochs, Teamleiter Antriebsauslegung und Inbetriebnahme bei AMKmotion, und sein Team nahmen die Herausforderung an. „Wir starteten mit einer Grundauslegung und tasteten uns sozusagen Stück für Stück heran“, sagt Ochs. In enger Zusammenarbeit mit Bystronic und dem Getriebehersteller entstand in einem rund zwei Monate dauernden Prozess mit regelmäßigen Besuchen in Niederönz die passende Lösung.
Für die Bewegung auf der Y-Achse ist ein iDT5-Synchron-Servomotor mit integriertem Wechselrichter zuständig. Dieser vereint den Wechselrichter iwX mit dem Servomotor DT. Beide sind direkt miteinander verdrahtet. „Wie auch die Einzelkomponenten sitzt die mechatronische Funktionseinheit in einem Metallgehäuse, das den schock- und vibrationsfesten Wechselrichter und Servo-
WIR STARTETEN MIT EINER GRUNDAUSLEGUNG UND TASTETEN UNS STÜCK FÜR STÜCK HERAN.« ANDREAS OCHS, AMKMOTION
motor nach Schutzart IP65 vor Staub und Feuchtigkeit schützt“, erklärt Ochs. Auf der X-Achse befindet sich der Schneidkopf auf einem Gantry-System. „Um dieses synchron und mit der notwendigen Dynamik zu bewegen, setzen wir stärkere Motoren ein“, sagt der Teamleiter. „Verbaut haben wir zwei DT5-Synchron-Servomotoren mit je einem dezentralen Servowechselrichter iX5.“ Die hochpoligen Servomotoren sind für hohe Drehmomente ausgelegt und haben erhöhte Eigenträgheitsmomente. Das bedeutet: Sie können auch größere Lasten ohne Getriebe als Direktantrieb äußerst dynamisch beschleunigen und die Produktivität der Maschine steigern. Die Magnete im Rotor sind eingeschoben und durch eine Kunststoffumspritzung fixiert. Dies schützt sie zusätzlich vor Staub, Gasen und Feuchtigkeit – und garantiert dauerhaft stabile Magnetwerte. Die Z-Achse positioniert ein ihXT4-Synchron-Servomotor mit integriertem Wechselrichter. Die schock- und vibrationsfeste Antriebseinheit mit einem Drehmoment von 2,6 Newtonmeter sitzt in einem IP65geschützten Gehäuse und ist damit für den direkten Einbau in der Maschine geeignet.
Funktionale Sicherheit in Form von Safe Torque Off (STO) ist standardmäßig mit an Bord.
Weniger Platzbedarf im Schaltschrank
Im Schaltschrank findet sich lediglich das platzsparende Einspeisemodul KEN, das die Zwischenkreisspannung erzeugt und die angeschlossenen dezentralen kompakten Wechselrichter mittels des Hybridverteilers KHY mit Leistung versorgt. Dieser vereinfacht die Zusammenführung verschiedener Signale und Versorgungsspannungen aus der zentralen Antriebsebene. Er dient als intelligente Schnittstelle von der zentralen zur dezentralen Antriebswelt. Dabei werden über den iX der DC-Bus, die antriebsintegrierte Sicherheitsfunktion STO und 24 Volt zu anderen dezentralen Reglern weiter geschleift. Die Echtzeit-Kommunikation erfolgt über einen separaten Feldbusstrang. Das standardisierte Interface ist als Anreihmodul aufgebaut und ermöglicht so, zentrale Schaltschrankgeräte einfach zu erweitern. Für den Kurzschluss- und Überlastschutz sind Schmelzsicherungen integriert. Zusätzlich überwacht der KHY den Zwischenkreisstrom und den dezentralen Antriebsstrang über einen I²t-Zähler. Sein Abschaltverhalten lässt sich individuell konfigurieren. Der KHY ist nach dem Daisy-Chain-Konzept mit den dezentralen Servowechselrichtern der Synchron-Servomotoren verkabelt.
Zuverlässige Zusammenarbeit auf Augenhöhe
„Mit dem dezentralen Aufbau sparen wir Platz im Schaltschrank, haben elf Kabel weniger in der Energiekette und damit insgesamt einen geringeren Verkabelungsaufwand, können das ganze Drum-
LIVE AUF DER SPS 2024:

Für Bewegung auf der Y-Achse sorgt ein iDT5Synchron-Servomotor mit integriertem Wechselrichter.
Bilder: Bystronic Laser
herum schlanker gestalten – und erreichen trotzdem unsere Anforderungen an Dynamik und Präzision“, fasst Jacobi zusammen. „Dank des direkten Drahts zur Entwicklungsabteilung bei AMKmotion lief die Zusammenarbeit sehr gut, unkompliziert und immer auf Augenhöhe“, ergänzt Krebs. Ein weiterer Pluspunkt sei die Liefertermintreue von AMKmotion. „Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn Verzögerungen beim Bau einer Maschine wegen fehlender Komponenten schlagen gleich auch auf die nachfolgenden Aufträge durch. Mit AMKmotion an unserer Seite können wir unsere Liefertermine zuverlässig halten“, freut sich Markus Beier, Einkäufer Elektroteile bei Bystronic. « RT
Anja Schaber ist Marketing-Managerin bei AMKmotion.
KUNDENINDIVIDUELLE GETRIEBELÖSUNGEN
Die SPN Schwaben Präzision ist der technologieunabhängige Antriebsdesigner mit eigener Hochleistungsfertigung. Mit SPN-Drive Monitoring wird die digitale Getriebeüberwachung möglich.
FÜR AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN sind kurze Taktzeiten, robuste Technik, verschleißfreie Oberflächen und kompakte Bauformen relevant. Anwendungsbereiche in schwierigen Umgebungsbedingungen wie Reinraumanforderungen, geringe Luftfeuchtigkeit oder Korrosions- und Säurebeständigkeit werden bei der kundenindividuellen Getriebeauslegung von SPN berücksichtigt. Mit SPN-Drive Monitoring und eigens entwickelten Sensoren setzt das Unternehmen auf innovative und zukunftsgerichtete Trends in der Digitalisierung von kundenspezifischen Antriebslösungen.
Bewährte Systemkomponenten Basis für eine technisch leistungsstarke wie wirtschaftlich effiziente Umsetzung bei SPN Schwaben Präzision ist der Zugriff auf eine breite Palette bewährter Systemkomponenten. Darauf aufbauend ist die SPN Schwaben Präzision in der Lage, erwiesene Qualität mit langjähriger Lebensdauer zu kombinieren.

SPN-Stirnradgetriebe für eine kundenspezifische Antriebslösung. Bild: SPN Schwaben Präzision
wicklungsarbeit für andere Industriezweige gewinnt.
Die bewährte Kompetenz im Bereich von Verzahnung und bei der Getriebeauslegung ist branchenübergreifend und bietet den Kunden die Möglichkeit, von den Erkenntnissen zu profitieren, die SPN aus ihrer Ent-
So entwickelt die SPN Getriebelösungen für unterschiedliche Branchen wie (fahrerlose) Transportsysteme, Maschinen- und Anlagenbau, Luftfahrt, Automatisierung, Lebensmitteltechnik, Textilindustrie, Energietechnik, Medizintechnik und Verpackungsanlagen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.spn-drive.de.
ANTRIEBSTECHNIK
PAPIERBANDEROLE LÖST SCHRUMPFFOLIE AB
Mit ihrer neuen Banderolieranlage Propac ermöglicht die Project Unternehmensgruppe Flaschen mit weniger Materialund Energieaufwand zu bündeln. Zur Koordinierung der bis zu 16 Achsen setzt das Unternehmen den Automatisierungsbaukasten Movi-C von SEW-Eurodrive ein. Das Multi-Achs-System unterstützt den modularen Aufbau der Anlage.
» VON HANS-JOACHIM MÜLLER
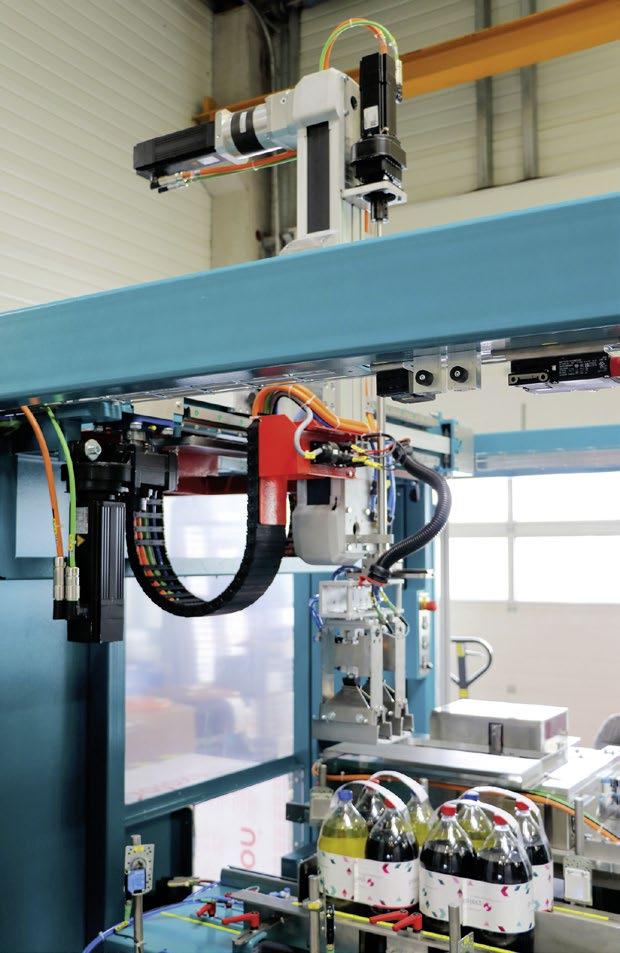
Im zweiten Gantry werden zwei Bipacks zu einem Viererpack verbunden.
Ein Blick in die Getränkeabteilung eines Supermarktes zeigt: Schrumpfverpackungen sind eine beliebte Sekundärverpackung für Flaschen und Dosen. Mit ihnen lassen sich Einzelflaschen bündeln – zum Beispiel zum klassischen Sixpack – und einfach tragen. Doch Schrumpfverpackungen erfordern einen relativ hohen Einsatz von Kunststoff und Energie. Das nehmen auch die Konsumenten wahr, bei denen Nachhaltigkeit bei Kaufentscheidungen immer mehr in den Fokus rückt. Ein Trend, auf den die Getränkeindustrie reagiert, wie Ingo Rathmann erklärt, Geschäftsführer der Firma Project Automation & Consulting: „Wir merken bei allen großen Getränkeherstellern, dass man auf der Suche nach Alternativen ist, weg von der Schrumpfverpackung, hin zu nachhaltigeren Verpackungen.“
Papier ersetzt Kunststoff
Das Unternehmen in Kranenburg am Niederrhein bei Kleve ist auf Automatisierungsprojekte spezialisiert. Es fungiert als Ingenieurbüro für alle Arten von Sondermaschinen und entwickelt Lösungen zur Automatisierung der Verpackung von Waren und Gütern, die dann im Schwesterunternehmen Project Service & Produktion gebaut und vertrieben werden. Ein Spezialgebiet der Unternehmensgruppe sind Banderoliermaschinen der Marke Proband. Mit ihnen lässt sich die Schrumpffolie durch Banderolen ersetzen, die nicht zwingend aus Kunststoff bestehen müssen, sondern zunehmend aus einem Papierbasierenden Material hergestellt werden. Im Maschinenkomplex Propac werden die einzelnen Flaschen durch die Banderole zu einem hochfesten und praktischen Gebinde geformt. Ein zusätzlicher Tragegriffapplikator ermöglicht, das Paket aus zwei, vier oder sechs Flaschen mit einem Tragegriff zu versehen. So lässt es sich bequem transportieren.
Taktzahl vervierfacht
EINZELNE
FLASCHEN WERDEN DURCH DIE BANDEROLE ZU EINEM HOCHFESTEN GEBINDE GEFORMT.
„Diese Anlagen ermöglichen es, Getränke oder andere Lebensmittel nachhaltiger zu verpacken“, erklärt Holger Hoffrichter, Head of Electrical & Software Engineering bei Project Automation & Consulting. „Im Vergleich zum Schrumpfen wird weniger Material eingesetzt und der Energieaufwand für die Verkaufsverpackung ist erheblich
Bilder: SEW/Project
niedriger.“ Schon seit einigen Jahren hat das Unternehmen Banderoliermaschinen im Programm. Dabei handelt es sich um 1-LinienAnlagen, die zunächst Zweier-Gebinde herstellen, die dann in einem nächsten Schritt zu einem Quattro- oder Sixpack verbunden werden. Die Taktzahl liegt bei 15 Gebinden pro Minute und kann modular hochskaliert werden. Doch die Getränkeindustrie fordert einen hohen Durchsatz für vielfältige, häufig wechselnde Produkte. „Dafür haben wir jetzt eine Anlage entwickelt, die gleich aus mehreren Banderolierern besteht und durch eine verbesserte Prozesstechnik eine höhere Taktzahl erreicht wird“, berichtet Hoffrichter.
Generationswechsel bei den Antrieben
Die neue Anlage erfordert jedoch ein Antriebssystem, das bis zu 16 Achsen einer Linie koordinieren und synchronisieren kann. Zudem sollte das Anlagenkonzept modular aufgebaut werden, um flexibel je nach Kundenanforderung Banderolierstationen wegzulassen oder zu ergänzen. „Bisher haben wir erfolgreich das Antriebssystem Movidrive B von SEW-Eurodrive eingesetzt“, so Hoffrichter. Ein bewährtes und zuverlässiges System, wie er betont – teilweise arbeiten die Antriebe bereits seit 24 Jahren in Kundenanlagen, ohne dass auch nur einmal eine Achse ausgetauscht werden musste. Daher ließ sich Hoffrichter auch für die neue Anlage ein Angebot für eine Antriebslösung mit Movidrive B erstellen.

Weniger Geräte im Schaltschrank
Parallel dazu kalkulierte der Bruchsaler Antriebstechnikspezialist auch die Realisierung der Anlage mit dem aktuellen Automatisierungsbaukasten Movi-C. Holger Hoffrichter war sofort überzeugt: „Die reine Hardware, die wir für unser Antriebskonzept benötigen, ist mit den neuen Komponenten sogar 15 bis 20 Prozent günstiger.“ Als Multi-AchsSystem benötigt der Baukasten nämlich nur eine Einspeisung für maximal 32 Achsen. Das heißt auch, dass es nur noch einen Bremswiderstand, ein Schütz oder einen Motorschutzschalter gibt – und nicht für jede Achse separate Komponenten (wie bei konventionellen Systemen).
Minimierter
SCHRUMPFVERPACKUNGEN ERFORDERN VIEL KUNSTSTOFF UND ENERGIE.
Verdrahtungsaufwand Hinzu kommt, dass der Arbeitsaufwand bei der Installation erheblich reduziert wird: Denn die „Reglerscheiben“ für die einzelnen Achsen werden einfach über ein Schienensystem mit der Einspeisung verbunden. „Ich muss also nicht mehr jeden Eingangskreis verdrahten“, betont Hoffrichter. Daraus resultieren dann weitere Vorteile wie ein geringeres Fehlerrisiko bei der Verdrahtung und deutlich weniger Platzbedarf im Schaltschrank. Zudem kann in diesem Multi-Achs-System Bremsenergie direkt in den Zwischenkreis fließen und von einer anderen Achse genutzt werden, statt über einen Bremswiderstand verlustreich in Wärme umgewandelt zu werden.

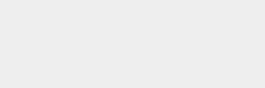
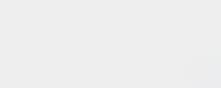


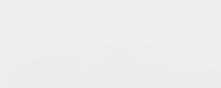


Die Flaschen werden einzeln der Anlage zugeführt. Die Formate können dabei flexibel eingestellt werden.
komplett zuverlässig ökonomisch
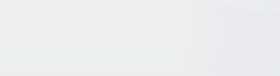









Verschlussschrauben, Entlüftungsventile und Ölschaugläser – EIN Abdichtungssystem für alle Einschraub- und konstruktionsbedingten Bohrungen im Getriebegehäuse. Komplett montiert und einsatzbereit.







HN | DREHTEILE Unser Paket für die Antriebstechnik


Noch wichtiger für Holger Hoffrichter waren aber die funktionellen Vorteile, die das System bietet. „Wir haben in der Anlage mehrere Gantrys, deren Achsen alle parallel fahren müssen.“ Ein Gantry ist im Prinzip ein Portal mit einem Greifer – es nimmt die Flaschen oder Primärgebinde von einer Fächerkette auf, hebt sie an, verfährt über die Banderolierstation und setzt die Flaschen ab. Nach dem Banderolieren werden die Flaschen nicht aus der Station gehoben, sondern schneller über eine Absenkeinheit nach unten „gefahren“ und von einer Ausschubeinheit auf eine Förderstrecke geschoben. „Alle Achsen, die parallel fahren, hängen an einem Master“, so Hoffrichter. Sie werden über eine Kurvenscheibenfunktion im Antriebssystem synchronisiert.
Diese Funktion mussten die Softwareexperten von Project Automation & Consulting aber nicht selbst programmieren, sondern konnten fertige Movikit-Softwaremodule verwenden. Sie sind wichtiger Bestandteil
IM AUTOMATISIERUNGSBAUKASTEN SIND SCHNITTSTELLEN ZU ÜBERGEORDNETEN STEUERUNGEN ENTHALTEN.

Auch der Lagenpalettierer, der am Ende der Anlage die banderolierten Einheiten stapelt, wird über MOVI-C angetrieben.

des Automatisierungsbaukastens Movi-C. SEW-Eurodrive entwickelte Module für eine Vielzahl typischer Antriebsfunktionen, zum Beispiel Movikit Velocity Drive für Anwendungen mit Drehzahlvorgabe oder Movikit MultiMotion Camming. Es ermöglicht die Erstellung anwenderspezifischer Kurvenprofile, um komplexe Bewegungsabläufe mehrerer Achsen zu synchronisieren. „Die erforderlichen Bausteine werden per Drag&Drop in das Programm geschoben und dann nur noch parametriert – wir mussten für die Kurvenscheibenfunktion also gar nichts in Codesys selbst programmieren“, erläutert Wilhelm Berns, Mitarbeiter im Bereich Softwareengineering von Project Automation & Consulting. „Mit Movidrive B hätten wir alles manuell programmieren müssen. Das wäre deutlich mehr Arbeitsaufwand gewesen.“
Kundenforderungen umgesetzt
Im Automatisierungsbaukasten Movi-C sind auch Schnittstellen zu übergeordneten Steuerungen enthalten, die sich ebenfalls einfach per Drag&Drop integrieren lassen. „Selbstverständlich passen wir die Softwaremodule auch auf spezifische Kundenanforderungen an, wenn es erforderlich ist“, betont Frank Peifer, der als Vertriebsingenieur Automatisierungstechnik seitens SEW-Eurodrive das Team von Holger Hoffrichter unterstützt hat. Zum Beispiel wurde eine spezielle Funktion entwickelt, bei der für eine präzise Ventilsteuerung bei hohen Taktzahlen die Funktionen eines Nockenschaltwerks und einer Kurvenscheibe miteinander „verheiratet“ wurden. „Das war auch für SEW neu“, meint Hoffrichter, „wurde aber mit viel persönlichem Engagement der Softwareexperten gelöst. Die für uns entwickelte Lösung ist heute in der neuen Firmwareversion enthalten.“
Auch den gewünschten modularen Aufbau der Anlage unterstützt der Baukasten, wie Hoffrichter weitererzählt: „Das Achssystem spiegelt die Modularität der Anlage. Zum
Eine Einspeisung (links) versorgt die Doppel- und Einachsmodule der Anlage. Das reduziert die Zahl der Geräte im Schaltschrank und den Verkabelungsaufwand.
Beispiel können wir problemlos ein Gantry entfernen. Dazu müssen wir in dem einmal erstellten Programm lediglich die entsprechenden Antriebe über die Parameter abschalten und die Hardware herausnehmen.“
So wichtig gerade bei der neuen Anlage die technischen Fähigkeiten des Baukastens sind – wichtigstes Argument, die Anlage mit diesem Antriebshersteller zu realisieren, ist der Support. „Gerade bei der Einführung einer neuen Lösung braucht man Unterstützung. Die erhielten wir schon bei dem Entwurf des Anlagenkonzeptes. Hilfe vor Ort ist auch kein Problem. Durch Anrufe bei der Hotline hat man sofort Fachleute aus der Praxis an der Leitung. Und sollten mal Probleme mit Anlagen bei unseren Kunden auftreten, kann man sich auch dann auf schnelle Hilfe verlassen – ganz gleich, wo die Maschine steht.“
Erfolgsrezept Modularität
Mit praxisorientierten Technologien, die die Projektierung und Inbetriebnahme deutlich vereinfachen, und den umfassenden Support passen die Antriebe perfekt zum Kunden. „Mit über 30 Jahren Erfahrung im Maschinenbau können wir flexibel auf verschiedene Anforderungen reagieren – wie jetzt mit der neuen Propac-Anlage, mit der wir eine nachhaltigere Verpackung für Getränke ermöglichen“, so Geschäftsführer Ingo Rathmann. „Das Erfolgsrezept ist die modulare Konzeption unserer Anlagen. Sie erlaubt es, die Maschinen präzise auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen zuzuschneiden.“ Genau diese Flexibilität bietet der Automatisierungsbaukasten. Mit der erfolgreichen Implementierung der neuen Antriebsgeneration dürfte sich auch in den nächsten Jahren die produktive Zusammenarbeit weiter festigen. « KIS
Hans-Joachim Müller ist Marktmanager für Antriebselektronik bei SEW-Eurodrive in Bruchsal.
AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT
Die Distanzkupplung „Simple-Flex“ lässt sich bis sechs Meter Baulänge fertigen und kommt ohne zusätzliche Zwischenlagerung aus. Ein ausgeklügeltes CompositeRohr mit einer mehrlagigen, winkelspezifischen Faserkonfiguration ermöglicht das einfache Design. Kupplungs-Ausgleichselemente und die interne Abstützung an beiden Rohrenden können entfallen. » VON JAN MÖLLER
Mithilfe von Simulationsberechnungen und Testreihen wurde ein Composite-Rohr entwickelt, das sowohl eine hohe Biegeflexibilität als auch eine herausragende Torsionssteifigkeit aufweist. Das geringe Gewicht und die dadurch reduzierten Massenträgheitsmomente ermöglichen sehr hohe Betriebsdrehzahlen und Drehmomente bei ausgezeichneter Laufruhe, ohne dabei den Ausgleich von Wellenversätzen zu beeinträchtigen.
Die Distanzkupplung überträgt Drehmomente absolut spielfrei über große Distanzen. Das Design konzentriert sich auf das Wesentliche und besteht aus zwei Naben sowie einem dazwischen liegenden Rohr zur Überbrückung der Distanz. Der entscheidende Aspekt ist das Rohr, das aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigt ist. Es kombiniert hohe Torsionssteifigkeit mit einer auslegungsabhängigen Biegeflexibilität, um auch bei hohen Betriebsdrehzahlen und großen Drehmomenten einen zulässigen Wellenversatz auszugleichen. Dadurch entfällt der Einsatz zusätzlicher Ausgleichselemente wie Stahllamellen oder Wellenbälge an den Naben von An- und Abtrieb.
Jan Möller arbeitet im Marketing bei Jakob Antriebstechnik. Distanzkupplung ohne zusätzliche Zwischenlagerung

für Safety-Anwendung mit hohen Drehzahlen und hohen Übertragungsraten auch bei Einkabellösungen (Single Cable)
Geringe Bautiefe und sehr hohe Genauigkeit
Hohe Robustheit, sehr gute thermische Beständigkeit


Schwingungsamplituden im Antriebsstrang reduziert
Dank Leichtbauweise und niedrigem Massenträgheitsmoment konnten die Eigenfrequenzen der Distanzkupplung in höhere Drehzahlbereiche verschoben werden. Dies ermöglicht höhere Nenndrehzahlen bei gleichzeitig hoher Laufruhe. Außerdem lassen sich größere Torsionsmomente übertragen als mit herkömmlichen Bauweisen, und dies bei kleineren Rohrdurchmessern. Die Dämpfungseigenschaften des CFK-Rohrs reduzieren Schwingungsamplituden im Antriebsstrang, wodurch kleinere Rohrdurchmesser und geringere Rohrmassen bei größeren Baulängen ohne zusätzliche Lagerabstützung realisierbar sind.
Darüber hinaus zeichnet sich das Carbonrohr durch eine sehr geringe Wärmedehnung und Korrosionsbeständigkeit aus. In Kombination mit Naben aus rostfreiem Edelstahl kann es auch unter korrosiven Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Rohre mit Längen von bis zu sechs Metern können fertigungstechnisch hergestellt und mit der neuen Distanzkupplung überbrückt werden.
Verschiedene Nabenvarianten zur Auswahl
Die neue Kupplungslösung bietet eine innovative Halbschalenkonstruktion, die den Ein- und Ausbau vereinfacht. Die Halbschalennabe verfügt über zwei radiale Klemmschrauben, minimales Gewicht und geringe Massenträgheitsmomente, wodurch sie eine kostengünstigere Option darstellt. Für Anwendungen mit hohen Drehzahlen ist die Konusnabe dank ihrer starken Klemmkräfte die richtige Wahl. « KF





HENGSTLER GMBH | Uhlandstr. 49 | 78554 Aldingen | info@hengstler.com | www.hengstler.com


Varianten der Simple-Flex Distanzkupplung. Bild: Jakob Antriebstechnik
ANTRIEBSTECHNIK

Nabtesco bietet ein breites Portfolio an hochperformanten Zykloidgetrieben.
TAKTGEBER DER INDUSTRIE
Immer schneller, präziser und wirtschaftlicher: Das ist der Takt der Fertigungsindustrie. Da kann nicht jedes Getriebe mithalten. Zykloidgetrieben von Nabtesco gelingt dies. Die innovativen Getriebesysteme zeichnen sich durch ihre Performance, Anwenderfreundlichkeit sowie Wirtschaftlichkeit aus und ermöglichen erhebliche Effizienzvorteile.
» VON JENNIFER HAGMEYER
Noch nie musste die Fertigungsindustrie so viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen wie heute: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, Individualisierung, steigende Energiepreise, Rohstoffknappheit, Lieferkettenprobleme und vieles mehr. Hinzu kommen der wachsende Kostendruck sowie steigende Ansprüche an die Produktqualität. Viele Unternehmen setzen daher zunehmend auf automatisierte Prozesse. Welche Getriebetechnologie dabei zum Einsatz kommt, ist von entscheidender Bedeutung. Zykloidgetriebe machen hier den Unterschied. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion sind sie deutlich präziser, dynamischer und steifer als herkömmliche Planetengetriebe, Schneckengetriebe oder Drehtische – und tragen so maßgeblich zu Leistungssteigerungen und Kostenreduzierungen bei.
Gefragter Partner der Automatisierung
Ein großer und anerkannter Hersteller von Präzisionsgetrieben in zykloider Bauart ist Nabtesco. Seit über 35 Jahren versorgt der Getriebespezialist mit Europazentrale in Düsseldorf und Weltmarktführer im Bereich Robotergetriebe (Marktanteil von über 60 Prozent) die Industrie mit richtungsweisenden Antriebslösungen und gilt als wichtiger Wegbereiter für Innovationen. Dank ihrer hohen Präzision (Hystereseverlust 0,5 bis maximal 1
arc.min) und Steifigkeit stellen die Getriebe exakt ausgeführte Bewegungen sicher und gewährleisten so ein punktgenaues Positionieren von Bauteilen, Werkstücken und Werkzeugen – auch bei hohen Beschleunigungsmomenten, großen Lasten oder in hygienekritischen Umgebungen. Von Vorteil sind außerdem die hohe Schockbelastbarkeit
EIN TREND GEHT KLAR IN RICHTUNG MODULARITÄT. MODULAR AUFGEBAUTE GETRIEBESYSTEME BRINGEN DIE VORTEILE VON STANDARDISIERUNG UND INDIVIDUALISIERUNG ZUSAMMEN.
(bis zu 500 Prozent des Nenndrehmoments), die kompakte Bauweise sowie die lange Lebensdauer der Getriebe. Für den Anwender ergeben sich dadurch nennenswerte Vorteile wie schnellere Prozesse, höhere Produktivität, bessere Produktqualität und geringere Kosten.
Zykloidgetriebe für alle Anwendungen
Das Produktportfolio von Nabtesco ist breit gefächert und reicht von effizienten Readyto-use-Lösungen für den Maschinenbau über vollintegrierte, dezentrale Antriebskonzepte für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) bis hin zu hochintegrierbaren Einbausätzen für die
Robotik. „Damit bieten wir bereits jetzt für viele Applikationen eine Lösung. Um die Vorteile von Zykloidgetrieben weiteren Anwendungen zugänglich zu machen, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter. Dabei setzen wir uns auch intensiv mit Themen wie Energieeffizienz, Downsizing, Hybridisierung und Usability auseinander“, macht Daniel Obladen, Head of Sales General Industries bei Nabtesco Precision Europe, deutlich.
Kundenindividuelle Massenproduktion
Ein Trend geht dabei klar in Richtung Modularität. Modular aufgebaute Getriebesysteme wie die Servogetriebe Neco und die HighTorque-Getriebe NecoHT bringen die Vorteile von Standardisierung und Individualisierung zusammen. Durch Kombinationen standardisierter Elemente entsteht ohne viel Aufwand eine Vielzahl an definierten Interfaces, die ein breites Spektrum an Anforderungen abdecken. Das Ergebnis ist eine kundenindividuelle Massenproduktion (Mass Customization). Innerhalb kürzester Zeit erhält der Kunde ein individuelles Getriebe, das passgenau auf seine Applikation abgestimmt ist.
Neco: Performance
trifft Anwenderfreundlichkeit
Insbesondere die Getriebe der Baureihen Neco (Servogetriebe) und NecoHT (HighTorque-Getriebe) definieren einen neuen Standard. Die modularen Getriebesysteme
setzen Maßstäbe in puncto Präzision, Wiederhol- und Gleichlaufgenauigkeit, Design, Korrosionsschutz, Motoranbindung sowie Anwenderfreundlichkeit und sorgen für hohe Performancesprünge. „Vor allem kleine und mittlere Unternehmen benötigen flexible, einfach zu handhabende Lösungen. Mit Neco und NecoHT geben wir ihnen eine Technologie an die Hand, die seit mehr als 35 Jahren in der Robotik erfolgreich eingesetzt wird und eine Automatisierung mit wenig Aufwand und ohne spezielles Expertenwissen ermöglicht“, so Obladen.
Hohlwellengetriebe mit Power
Auch die Hohlwellengetriebe der RD-C-Serie lassen sich dank Plugand-Play-Technologie schnell und einfach in den Antriebsstrang integrieren. Die kompakten Servogetriebe sind als Koaxial- (RDS-C), Parallelwellen- (RDP-C) oder Winkelgetriebe (RDR-C) erhältlich und damit sehr vielseitig einsetzbar. Die Hohlwelle ist großzügig dimensioniert und bietet ausreichend Platz, Kabel und Schläuche, zum Beispiel Daten- und Versorgungsleitungen sowie Antriebswellen, einfach und platzsparend durch die Mitte des Zykloidgetriebes hindurchzuführen. Die robusten Präzisionsgetriebe der RS-Serie verfügen ebenfalls über eine Hohlwelle. Sie sind für Axiallasten bis zu neun Tonnen ausgelegt und punkten mit einer kompakten Bauform, hervorragenden Drehmomentleistungen sowie einer hohen Positioniergenauigkeit. Damit eignen sich die RS-Getriebe nicht nur optimal für den Einsatz in Drehtischen und Positionierern, sondern stellen auch eine Alternative zu herkömmlichen Drehtischen dar.
Robotergetriebe par excellence Inzwischen sind weltweit mehr als zwölf Millionen Zykloidgetriebe im Einsatz, Tendenz stark steigend. Bereits jetzt verlassen jährlich über eine Million Getriebe die Produktionsstätten. Mit dem Bau eines dritten Fertigungsstandort in Hamamatsu (Japan) verdoppelt sich die Produktionskraft bis 2030 auf zwei Millionen Präzisionsgetriebe – optimale Vorrausetzungen, um der wachsenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen gerecht zu werden. Diese hohe Produktionskapazität wird vor allem in der Robotik mit ihren großen Stückzahlen sehr geschätzt.
Geräteserie SD4S

Die Antriebseinheit mit Mecanum-Rad erlaubt hohe Drehmomentleistungen auch auf kleinstem Raum. Bilder: Nabtesco Precision Europe
Ob mit Vollwelle (RV-N) oder mit Hohlwelle (RV-C): Robotergetriebe von Nabtesco stehen für hohe Präzision, sehr geringe Vibrationen und niedrige Massenträgheit. Das ausgeklügelte zweistufige Zykloidkonstruktion macht die Getriebe unempfindlich gegen Schockbelastungen und erlaubt hohe Drehmomente. Dank einer starken, integrierten Hauptlagerung kann auf externe Lagerungen verzichtet werden. Das ermöglicht kompaktere Konstruktionen und eine bessere Performance. Mobile Roboter profitieren von der vollintegrierten, dezentralen Antriebseinheit mit MecanumRad. Die verwendeten RV-W-Mecanum-Radantriebe erlauben auch auf kleinstem Raum hohe Drehmomentleistungen. Dank der Zykloidgetriebe arbeitet das kompakte und äußerst robuste Antriebskonzept zudem völlig wartungsfrei. « RT
Jennifer Hagmeyer ist Team Lead Marketing bei Nabtesco Precision Europe. High-Speed Drive Controller
Extrem kompakte Baugröße
Bis 360.000 1/min
Feldbus on board
Regelung von IPM-Motoren
Umfangreiche

Parametrierung über drivemaster4 SPS | Nürnberg 12.–14.11.2024 Halle 4 | Stand 230
KÖNIGLICHE ZÄHNE
2015 stellte Wittenstein seine Getriebegattung Galaxie vor. Seitdem hat das Unternehmen die Präzisionsgetriebe weiterentwickelt. Das miniaturisierte Galaxie ist ein hochsteifes Präzisionsgetriebe in kleinen Baugrößen, das eine bauraumkompatible Alternative zu Wellgetrieben darstellt – etwa für die Medizin- und die Industrierobotik. »
VON THOMAS BAYER

Im Zahnring des miniaturisierten Getriebes kommen sogenannte Königszähne zum Einsatz, die vielfach höhere Übersetzungsverhältnisse als Dachzähne ermöglichen.
Das neue Galaxie bietet im Vergleich zu anderen marktgängigen Wellgetrieben einige Vorteile: Bei den marktkompatiblen Getriebebaugrößen von derzeit 90 und 110 Millimetern bestehen eine um 40 Prozent höhere Kompaktheit und Drehmomentdichte, eine um den Faktor drei bessere Verdrehsteifigkeit, ein doppelt so großes Not-Aus-Moment, absolutes Nullspiel über die gesamte Lebensdauer und eine um fast 50 Prozent größere Hohlwelle. Verantwortlich dafür sind vor allem eine innovative axiale Kinematik zur Kraftübertragung sowie eine neu gedachte Planrad-Helixverzahnung mit Polygonscheibe. Zudem kommen im Zahnring sogenannte Königszähne zum Einsatz, die jetzt vielfach höhere Übersetzungsverhältnisse als Dachzähne ermöglichen. Der „genetische Code“ des radialen und des axialen Funktionsprinzips stimmt also im Grunde überein – das neue Getriebe kann somit zu Recht als kleiner Bruder beziehungsweise kleine Schwester des Galaxie von 2015 bezeichnet werden. „Die gesamte Gattung bietet heute Baugrößen von 90 bis 300 Millimetern Außendurchmesser
bei maximalen Beschleunigungsmomenten von 150 bis über 7500 Newtonmetern“, fasst Nadine Hehn, Business Pionier Manager bei Wittenstein, das Potenzial für die Anwender zusammen.
Highlights: bewährt und ausgezeichnet Mit dem Konzept dynamischer Einzelzähne, dem hydrodynamischen Vollflächenkontakt bei zugleich vielfachem Zahneingriff sowie der Einführung der logarithmischen Spirale in die Getriebetechnik ist das Getriebe mit radialem Funktionsprinzip der Benchmark hinsichtlich Tragfähigkeit, Verdrehsteifigkeit, Positionier- und Gleichlaufgenauigkeit sowie absoluter Spielfreiheit über die gesamte Lebensdauer. Die Erkenntnisse und Aussagen zu den Leistungsmerkmalen haben sich bewahrheitet, die Produktfamilie hat sich als Servoaktuator wie auch als Getriebe in der Praxis bewährt. Der Lohn – neben vielen zufriedenen Anwendern beispielsweise
GETRIEBE PUNKTET MIT ABSOLUTEM NULLSPIEL ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER.
im Werkzeugmaschinenbau, in der Handhabungstechnik oder der Robotik – waren zahlreiche Auszeichnungen, etwa der Hermes Award 2015, der Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft 2016 oder die Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis 2018, bei dem das Unternehmen zum Kreis der Besten zählte. Zudem wurde mit dem Getriebe eine auch wissenschaftlich anerkannte neue Getriebegattung begründet.
Kosten- und Marktanalysen agil berücksichtigt Begleitet wurde die Entwicklung der neuen, axialen Kinematik vom Blick auf die Gesamtkosten von Getrieben, denn kleiner bedeutet nicht zwangsläufig kostengünstiger – im Gegenteil, da beispielsweise in der mechanischen Fertigung von filigranen Teilen Toleranzen schwieriger einzuhalten sind als bei großen. „Das ist ein Dilemma, mit dem Anbieter von Präzisionsgetrieben zu kämpfen haben“, erläutert Nadine Hehn. „Anbieter, die auf große Präzisionsgetriebe spezialisiert sind, schaffen es kaum, kleine Getriebe zu bauen, die technische und wirtschaftliche Alleinstellungsmerkmale mit sich bringen.“ Diese Ausgangslage hatte zwei

Im miniaturisierten Galaxie-Getriebe greifen die als Zahnring verbundenen Einzelzähne innerhalb des Zahnträgers axial in die PlanradHelixverzahnung ein.
Konsequenzen: technologisch brauchte es eine (r)evolutionär neue Idee innerhalb der Getriebegattung – und organisatorisch war die Aufgabenstellung nur durch eine ganzheitliche Betrachtung der Herausforderungen im Rahmen eines Simultaneous Engineering zu lösen. Daher arbeiteten schon in der frühen Projektphase die Vor- und Konzeptentwicklung, die Fertigungs- und Montagespezialisten sowie das Markt- und Vertriebsmanagement Hand in Hand.
Konzeptsprung von radialer zu axialer Kraftübertragung
All die Merkmale, die den Erfolg des Getriebes mit Radial-Kinematik ausmachen, in kleinere Baugrößen mit Übersetzung i=60/61 zu überführen und damit einhergehend eine optimale Prozessfähigkeit der neuen Getriebeserie für die automatisierte Fertigung zu gewährleisten, hatte zu Beginn der Vorentwicklung so etwas wie die „Quadratur des Kreises“ an sich. Klar war zudem von Anfang an: Galaxie muss Galaxie bleiben – also keine Kompromisse hinsichtlich grundsätzlichem Funktionsprinzip sowie hoher Präzision und Performance. Die Lösung war der Konzeptsprung von der radial zur axial wirkenden Kraftübertragung – quasi ein „kinematischer Salto“ um 90 Grad. Angetrieben von einer Polygonscheibe mit zwei Hochpunkten greifen die als Zahnring verbundenen Einzelzähne innerhalb des Zahnträgers wie in einer Schraubbewegung axial in die Planrad-Helixverzahnung ein. „Dieser kinematische Aufbau eröffnet Vorteile für kleine Baugrößen“, erklärt Dr. Karoline Scheuermann, Business Developer im Business Pionier bei Wittenstein. „Das neue Galaxie erreicht kompaktere Außenmaße und damit platzsparendere Bauformen, bietet gleichzeitig eine größere Hohlwelle und größere Übersetzung, was durch den Einsatz
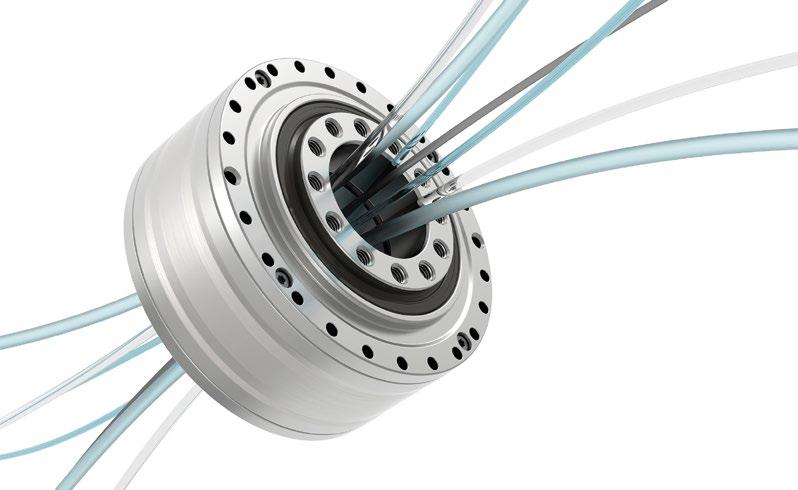
KÖNIGSZÄHNE IM ZAHNRING
ERMÖGLICHEN
HÖHERE ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISSE ALS DACHZÄHNE.
von Königszähnen statt Dachzähnen erreicht wird.“ Ausgelegt auf maximale Beschleunigungsmomente von 150 und 250 Newtonmetern bietet das miniaturisierte Galaxie eine hohe Drehmomentdichte – mit allen Vorteilen für zusätzliche Performance in einer gewählten Baugröße oder ein mögliches Downsizing der Getriebegröße bei Vorgabe definierter Leistungsmerkmale.
Auf hohe Prozessfähigkeit in der Fertigung und Montage ausgelegt Bei der Entwicklung der axialen Kinematik des miniaturisierten Getriebes hat das Unternehmen konsequent auf die Prozessfähigkeit in den ausgewählten Fertigungsprozessen und der Montage geachtet. Die Hauptfertigungsteile für Antrieb, Kraftübertragung, Abtrieb und Gehäuse können mit etablierten Fertigungsprozessen hergestellt und von einer Seite axial montiert werden. Hierzu wurden sowohl der eigentliche Montage -
Machen die Sicht frei
Aus harteloxiertem Aluminium
Wenn Werkzeugmaschinen in Betrieb sind, ist die Sicht in den Innenraum durch Späneflug und umherspritzendes Kühlschmiermittel stark eingeschränkt. Das SPINVISTA rotiert mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass Flüssigkeiten und Verschmutzungen von der Scheibe ferngehalten werden. Das Ergebnis ist ein klarer Blick auf den Fertigungsprozess.
HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH
Am Klinggraben 2 | 63500 Seligenstadt Tel.: +49 6182 773-0 | info@hema-group.com www.hema-group.com
Reaktionsschnell und überspüldicht
Die Hohlwelle hat einen Durchmesser von 31 Millimetern (Baugröße 90). So können mehr Kabel, Schläuche und andere Verbindungen im Inneren des Roboters verlegt werden.
Bilder: Wittenstein
prozess als auch die Teileversorgung und Materialbereitstellung in ihrer Prozessfähigkeit analysiert und angepasst. Damit ist die hohe Qualität nicht nur über das Produktdesign, sondern auch über die Herstellung des Produkts gewährleistet.
Mini-Galaxie und Cyber Kit Line als Motor-Getriebe-Kombination Hohe Verdrehsteifigkeit auch im Nulldurchgang, höhere Beschleunigungsraten bei reduzierten Vibrationen, hohe Drehmomentdichte und Überlastfähigkeit, große Hohlwelle, absolutes Nullspiel – das sind die zentralen Vorteile des Modells gegenüber konventionellen Wellgetriebe entsprechender Baugrößen. Damit eröffnet es unter anderem in der Medizin- und Präzisionsrobotik neue konstruktive und applikationstechnische Perspektiven. Zusammen mit den Servomotoren der Cyber Kit Line von Wittenstein Cyber Motor bildet das miniaturisierte Getriebe zudem die ideale MotorGetriebe-Kombination – wobei grundsätzlich auch Hohlwellenmotoren anderer Hersteller integriert werden können. « KIS
Thomas Bayer ist Leiter Innovation Lab bei Wittenstein.
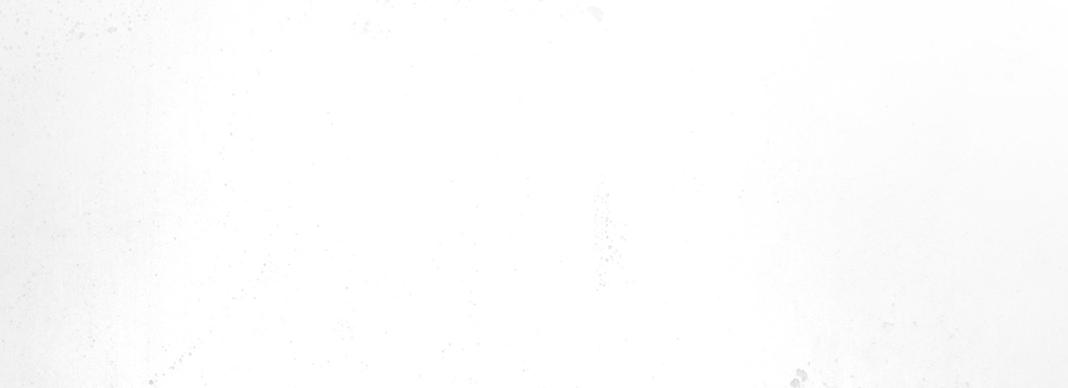
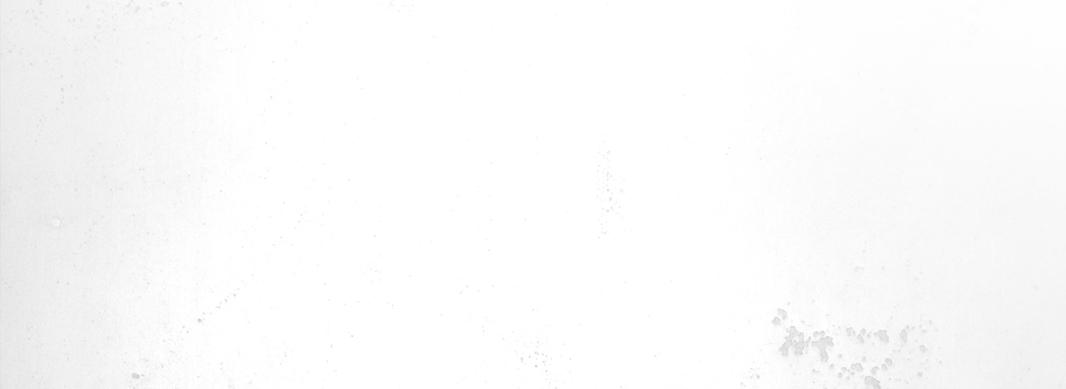



Geringe Aufbauhöhe

FREIE AUSWAHL FÜR GETRIEBEBAUER
Für die Anbindung eines Getriebes an die Motorwelle gibt es eine Reihe von Optionen. Viele Komponenten-Hersteller bieten aber nur eine begrenzte Auswahl an Antriebselementen an. Bei KBK finden Getriebebauer hingegen die gesamte Bandbreite an spielfreien Welle-Nabe-Verbindungen. » VON SVEN KARPSTEIN

KBK hat auch eine Metallbalgkupplung für Roboter im Programm, die mit einem speziellen Adapterflansch ausgestattet ist. Bild: Andrey Armyagov /stock.adobe.com
Das Antriebstechnik-Produktprogramm der Unterfranken umfasst nicht nur unzählige Kupplungsvarianten, sondern auch Schrumpfscheiben und Klemmringe. Da Getriebe-Hersteller bei KBK vielfältige Lösungen für die spielfreie, drehmomentstarke Anbindung ihres Produktes an die Motorwelle bekommen, reduziert sich ihr Beschaffungsaufwand enorm.
Passfeder-Verbindungen sind störanfällig
KBK bietet sowohl für Vollwellen- als auch für Hohlwellengetriebe die passende WelleNabe-Verbindung an. Für die Anbindung von Hohlwellen-Getrieben an die Antriebswelle wird meist eine spielfreie Lösung wie zum Beispiel eine Schrumpfscheibe gewählt. Eine
Passfeder-Verbindung wäre zwar theoretisch auch möglich, aber die schlägt im Reversierbetrieb früher oder später aus. Außerdem entsteht mit der Zeit Passungsrost, der zum Ausfall der Passfeder-Verbindung führen kann und eine Demontage sehr schwierig macht. Schrumpfscheiben sind deshalb in diesen Anwendungen eindeutig die bessere Wahl.
Schrumpfscheiben für hohe Drehmomente
KBK hat zwei verschiedene Schrumpfscheiben-Varianten im Programm – eine dreiteilige (KBS19) und eine zweiteilige (KBS19/1). Während die KBS19 für Hohlwellen-Durchmesser von 14 bis 280 Millimeter und Drehmomentbereiche von 40 bis 327.000 Newtonmeter ausgelegt ist, kann die KBS19/1 auf Hohlwellen mit Durchmessern von 14 bis 240 ANTRIEBSTECHNIK
Millimeter verwendet werden und überträgt Drehmomente zwischen 29 Newtonmeter und 164.000 Newtonmeter.
Die Schrumpfscheiben werden zunächst über den Außendurchmesser der GetriebeHohlwelle geschoben. Danach steckt der Anwender die Motorwelle in die Hohlwelle und zieht die Schrauben an. Da die axialen Schraubenkräfte über den Kegel umgelenkt werden, presst sich der Innenring der Schrumpfscheibe auf den Außendurchmesser der Hohlwelle. So entsteht eine spielfreie Verbindung zwischen der Hohlwelle des Getriebes und der Antriebswelle. Dadurch wird die höchstmögliche Drehmomentübertragung erreicht.
Individuell ausgelegte Klemmringe
In vielen Anwendungen müssen Hohlwellengetriebe allerdings gar nicht so hohe Drehmomente übertragen, wie es mit Schrumpfscheiben möglich ist. Wenn das Getriebe über eine geschlitzte Hohlwelle verfügt, sind in solchen Fällen Klemmringe eine gute Alternative – diese Welle-Nabe-Verbindung baut zudem etwas kompakter und lässt sich noch leichter montieren als Schrumpfscheiben. KBK bietet seinen Kunden die individuelle Kalkulation und Auslegung von Klemmringen an. Der Service stößt auf reges Interesse bei den Kunden, denn viele Anwender finden am Markt nicht die Klemmringe, die ihren Anforderungen entsprechen. KBK kann dank seiner schlanken, effizienten Strukturen flexibel auf jeden Wunsch bei der Bauteilgestaltung eingehen.
So hat KBK hat Pionierarbeit geleistet Um den Service anbieten zu können, war einiges an Vorarbeit nötig. Zusammen mit einem Getriebe-Hersteller haben die Antriebstechnik-Spezialisten erst einmal die Drehmomente definiert, die von einem Klemmring auf eine Hohlwelle übertragen werden können. Das war Pionierarbeit, denn bis dahin hatte sich noch niemand diese Mühe gemacht. Die berechneten Drehmomente wurden anschließend in der Praxis überprüft und bilden seither die Grundlage für die individuelle Auslegung der Klemmringe. Neben der kundenspezifischen Kalkulation bietet KBK zudem Modifikationen an: So werden die Klemmringe auf Wunsch mit Passfedernuten oder individuellen Bohrungen versehen oder in verschiedenen Verhältnissen von Außen- zu Innendurchmesser geliefert. Auch die Verwendung spezieller Materialien, die Integration eines Verdrehschutzes oder die Auslegung mit niedrigen Massenträgheitsmomenten ist möglich.

Antriebstechnik-Anbieter individuell ausgelegte Klemmringe.
KBK hat Klemmringe in den Ausführungen KR-G (geteilt) und KR (geschlitzt) im Programm – beide gibt es sowohl aus Edelstahl als auch aus brüniertem Stahl. Die geschlitzte Version eignet sich für die Herstellung einer Verbindung zwischen Getriebehohlwelle und Motorwelle ebenso wie zur axialen Fixierung von Bauteilen auf der Welle. Klemmringe der Baureihe KR übertragen Axialkräfte von 867 Newton bis 8135 Newton und können auf Hohlwellen mit Durchmessern von 4 bis 50 Millimeter montiert werden.
Kupplungen mit Spreiznabe
Eine andere Variante, Hohlwellengetriebe und Motorwelle spielfrei miteinander zu verbinden, sind Metallbalgkupplungen mit Spreiznabe beziehungsweise Elastomerkupplungen mit Spreiznabe von KBK. Das Funktionsprinzip ist einfach: Man steckt die Kupplungen in die Hohlwelle, geht mit dem Schraubschlüssel durch die Kupplung hindurch und zieht die Schraube an, sodass sich die Kupplung mit der Hohlwelle des Getriebes verspannt. Die Metallbalgkupplung mit Spreiznabe (KB8) eignet sich für Wellen mit Durchmessern von 10 bis 60 Millimeter und überträgt Drehmomente zwischen 18 und 500 Newtonmeter, die Elastomerkupplung mit Spreiznabe (KBE4) ist für Wellen mit Durchmessern von 4 bis 62 Millimeter geeignet und kann Drehmomente zwischen 4 und 655 Newtonmeter übertragen.
Bei Vollwellen-Getrieben sind viele Hersteller dazu übergegangen, die Kupplung über eine MontageGlocke direkt in das Getriebe zu integrieren. Der Anwender muss hier also gar nicht mehr entscheiden, über welches Antriebselement er seine Motorwelle mit dem Getriebe verbindet. Die Antriebswelle wird einfach in die Kupplung des Getriebes eingeführt und mittels einer Schraube in der Montage-Öffnung fest mit dieser verspannt.
Kupplungen für Roboter
KBK bietet für diese Vollwellen-Getriebe eine große Bandbreite spielfreier Kupplungen an. Die Metallbalg-, Elastomer- und Schlitzkupplungen übertragen
Drehmomente zwischen 0,05 und 5.000 Newtonmeter und eignen sich für Wellendurchmesser von 1 bis 100 Millimeter.
Für hochpräzise beziehungsweise hochdynamische Anwendungen empfiehlt sich der Einsatz von Metallbalgkupplungen, denn sie weisen eine sehr hohe Verdrehsteifigkeit auf. Ein gutes Beispiel sind die Metallbalgkupplungen der Serie KB4K, die ursprünglich

für Hersteller von Drehmoment-Messwellen entwickelt wurden. Die KB4K können hohe Drehmomente übertragen, bauen zugleich aber mit Längen von 35 bis 96 Millimeter und Außendurchmessern von 32,5 bis 122 Millimeter sehr kompakt. Ebenfalls beliebt bei Getriebebauern ist die KB4LV. Die Kupplung lässt sich in der Länge verstellen und kann deshalb aus der Montage-Glocke herausgezogen werden, um die Klemmschraube frei zugänglich zu haben. Montagebohrungen oder -öffnungen sind nicht erforderlich. Eine weitere Besonderheit ist die Metallbalgkupplung der Serie KB4FA für Roboter: Hier liefert KBK einen Adapterflansch als Standardteil, der genau auf die genormte Schnittstelle passt.
Schnelle Montage
Optimal geeignet für die Anbindung von Servomotoren ist die Metallbalgkupplung KB4P. Diese Kupplung überträgt Drehmomente zwischen 18 und 500 Newtonmeter und eignet sich für Wellendurchmesser von 10 bis 70 Millimeter. Die KB4P lässt sich durch axiales Stecken ganz einfach montieren und demontieren –aufwändige Bohrungen sind dafür nicht erforderlich. Die KB4P wird aus hochfestem Aluminium gefertigt und mit einer speziellen Beschichtung versehen. Sie besitzt eine hohe Torsionssteifigkeit, gleicht Wellenversatz aus und erzeugt nur minimale Rückstellkräfte.
Einfache Lagerhaltung
In Applikationen, in denen geringer Wellenversatz nicht kritisch ist, können auch die etwas günstigeren Elastomerkupplungen (Klauenkupplungen) verwendet werden. Diese Kupplungen lassen sich ebenfalls ganz einfach durch axiales Stecken montieren. Der Anwender muss die Motorwelle hier nicht in die Getriebe-Kupplung einfädeln: Stattdessen kann er eine Kupplungshälfte vormontieren und dann mit der mit der anderen, im Getriebe befindlichen Hälfte zusammenstecken. Darüber hinaus ermöglichen Elastomerkupplungen eine relativ einfache Lagerhaltung, denn sie können modular bevorratet werden. Schlitzkupplungen wiederum sind etwas präziser als Elastomerkupplungen und bieten höhere Drehmomente als Metallbalgkupplungen vergleichbarer Baugröße. Alle Antriebselemente sind auch in einer EdelstahlAusführung erhältlich. « KF
Sven Karpstein ist Geschäftsführer von KBK Antriebstechnik.
NEU: RK Easymount
Ergonomisches Einrichten und Transportieren von Schaltschränken

Ergonomisch – Höhen- und neigungsverstellbare (0-90°) Arbeitsfläche für eine komfortable und körperlich entlastende Arbeitsposition
Produktivitätssteigerung –Optimierung der Arbeitsabläufe und Reduzierung von Ausfallzeiten durch ergonomisches Arbeiten
Flexibilität – Mobil durch Rollen und kabellose Akkusteuerung, ideal für den Einsatz an verschiedenen Standorten
Robust – Stabil und belastbar, geeignet für Lasten bis zu 3000 N (Auslegung für höhere Lasten auf Anfrage möglich)
Anpassbar – Individuell einstellbar für spezifische Kundenanforderungen, unterstützt maßgeschneiderte Arbeitsprozesse
Kompatibel – Verwendung handelsüblicher Akkusysteme, keine spezielle Energieversorgungen notwendig
Service – Technische Beratung vor Ort, Workshops/Schulungen, Reparaturservice/Ersatzteile
Jetzt mehr erfahren:
KBK liefert als einziger
Bild: KBK
Die Metallbalgkupplungen der Serie KB4LV sind sowohl längenverstellbar als auch spielfrei. Bild: KBK
Die Verzahnung ist das Herzstück eines Getriebes –und bestimmt damit ganz entscheidend über dessen Qualität.

GEBÜNDELTES KNOW-HOW FÜR DAS GETRIEBE-HERZSTÜCK
Die Verzahnung bildet das Herzstück des Getriebes und bestimmt entscheidend über dessen Qualität. Vor allem gilt das für Planetengetriebe, wo konstruktionsbedingt mehrere Zahneingriffe gleichzeitig in ein und dasselbe Zahnrad erfolgen. Entwicklung und Fertigung entsprechender Komponenten setzen dann besondere Kompetenzen voraus. » VON MARCEL GEURTS
Auch wenn das Funktionsprinzip von Planetengetrieben auf den ersten Blick einfach erscheint, stellt sich die Konstruktion im Detail doch außerordentlich komplex dar. So ist beispielsweise die optimale Positioniergenauigkeit das Ergebnis eines möglichst geringen Verdrehspiels einerseits und einer möglichst hohen Verdrehsteifigkeit andererseits. Damit also ein Getriebe auch nach vielen tausend Betriebsstunden noch die gewünschte Leistung bringt, müssen viele Komponenten exakt aufeinander abgestimmt sein.
Hohe Gleichlaufgüte als Ergebnis präziser Verzahnung
Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Verzahnung der Planetenräder, des zentralen Ritzels (Sonnenrad) und des Hohlrades. Für den optimalen Gleichlauf des Getriebes ist es beispielsweise notwendig, dass die Zähne dieser Bauteile sehr präzise ineinandergreifen. Um das zu erreichen, wird die Verzahnung besonders genau gefertigt und zum Beispiel erst nach dem Härtevorgang geschliffen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Verdrehspiel auf ein Minimum zu reduzieren, indem die Verzahnungsteile zueinander gepaart werden. Das heißt, jedes Bauteil wird hochgenau im µ-Bereich vermessen und mit exakt passenden Gegenstücken kombiniert. Je geringer das Verdrehspiel des Getriebes ist, desto genauer lässt sich ein Gegenstand positionieren, was zum Beispiel bei Bearbeitungsmaschinen oder in der Robotik wichtig ist. Das bedeutet: Der erforderliche Freiraum zwischen den Zahnflanken, das Zahnspiel, muss so eng bemessen sein, dass einerseits der Leerlauf beim Anlaufen oder bei Richtungswechseln (Reversierbetrieb) so gering wie möglich ist und andererseits ein Abwälzen der Zahnflanken möglich bleibt.
Gerad- und schrägverzahnte Getriebe
Bei der Ausführung der Verzahnung bestehen generell zwei Möglichkeiten: Bei einer geraden Verzahnung erfolgt der Zahneingriff auf der kompletten Zahnbreite. Schrägverzahnte Getriebe zeichnen sich hingegen durch einen ansteigenden, stetigen Zahneingriff aus. Beide Verzahnungsarten bieten
damit charakteristische Vorteile, die sich anwendungsspezifisch nutzen lassen.
So können geradverzahnte Getriebe – bei gleicher Baugröße – höhere Drehmomente übertragen als schrägverzahnte, weil aufgrund der geraden Verzahnung keine Axialkräfte auf die Planeten und deren Lagerung wirken. Allerdings verursacht der geradlinige Zahneingriff eine höhere Geräuschemission und auch der Gleichlauf hat einen vergleichsweise unstetigen, wellenförmigen Verlauf. Im Gegenzug gewährleisten schrägverzahnte Getriebe einen sehr homogenen Vorschub und einen ruhigen, geräuscharmen Lauf unter Last. Ist für eine Anwendung also ein maximales Drehmoment entscheidend, ist häufig ein Getriebe mit Geradeverzahnung empfehlenswert. Geht es aber um hohe Gleichlaufgüte oder geringe Geräuschentwicklung ist ein Getriebe mit Schrägverzahnung ideal.
Schrägverzahnte Getriebe werden deshalb beispielsweise in Vorschüben von Holzbearbeitungsmaschinen eingesetzt. Diese Getriebe müssen besonders gleichmäßig und ruhig laufen, da sonst feinste so genannte Rattermarken auf der Oberfläche des Werkstücks auftreten. Eine beispielhafte Anwendung
für geradverzahnte Getriebe wäre hingegen ein großer Schwenkarm-Antrieb, der mehrere Tonnen schwere Bauteile bewegt. Hier kommt es vor allem auf ein hohes Drehmoment an, während die Geräuschemission nur eine unterordnete Rolle spielt.
Gebündeltes Spezial-Know-how erforderlich
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Verzahnung allerhöchste technische Anforderungen zu erfüllen hat, die letztlich über die Qualität des gesamten Getriebes entscheiden. Das dafür erforderliche Spezial-Know-how umfasst sowohl die Fertigung der entsprechenden Bauteile als auch deren Auslegung und Entwicklung.
ALLEIN DIE ENTSCHEIDUNG, OB EIN GERADE- ODER SCHRÄGVERZAHNTES GETRIEBE EINGESETZT WERDEN SOLL, IST HÄUFIG SCHON SCHWER ZU TREFFEN.
Bei Neugart arbeitet eine eigene Abteilung daran, die Leistungsfähigkeit der NeugartGetriebe immer noch weiter zu steigern, um auch zukünftigen Marktanforderungen gerecht zu werden. Im Neugart Verzahnungskompetenzzentrum (kurz VKZ) ergänzen sich dabei unterschiedliche Kompetenzen rund um Getriebekonzeption, Simulation, Verzahnungsuntersuchung und Zahnradfertigung. Ansatzpunkte für neue Optimierungen bieten Werk- und Schmierstoffe, die Wärmebehandlung, die Verzahnungsgeometrie oder die Lastverteilung. Eine Fragestellung des VKZ lautet zum Beispiel: Wie müssen Bauteile beschaffen sein, damit sie einerseits eine hohe Lebensdauer erreichen und sich andererseits wirtschaftlich herstellen lassen? Mögliche Antworten betreffen die metallografische Auswahl des optimalen Werkstoffs ebenso wie den späteren Fertigungsprozess bis hin zur Qualitätssicherung.
Effizient automatisierte Maschinen und Anlagen minimieren Fertigungskosten, sichern die Produktqualität und gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit in der Produktion. Diese Vorteile gilt es bei der Verzahnungsherstellung zu erhalten und gleichzeitig die Qualität der Bauteile, die Oberflächenqualität und Oberflächentopografie zu optimieren.
Der Einsatz eines speziellen Prüffelds für dynamisch ablaufende Lastzyklen ermöglicht es, die Einflüsse der Makro- und Mikrogeometrie von Ritzel und Zahnrad sowie deren lastspezifische Relativlage zu erfassen. Auf dieser Grundlage lassen sich dann die komplexen Zusammenhänge einer sich unter Last befindlichen Verzahnung abbilden und ihre Eigenschaften, besonders hinsichtlich Tragfähigkeit und Geräuschentwicklung weiter optimieren.
Komplexer Auswahlprozess
Über diese technischen Aspekte hinaus zeigt die Gestaltung der Verzahnung aber auch beispielhaft, welche komplexen Entscheidungen auf dem Weg zum optimalen Planetengetriebe zu treffen sind – vom Hersteller ebenso wie vom Anwender. Allein die Entscheidung, ob ein gerade- oder schrägverzahntes Getriebe eingesetzt werden soll, ist häufig schon schwer zu treffen.
Einen einfachen Überblick über die Leistungsdaten gibt der Online-Konfigurator Tec Data Finder (TDF). So lassen sich Getriebe schnell und einfach vergleichen und mit wenigen Klicks Maßblätter sowie 3D-Modelle anfordern. Die Berechnungssoftware Neugart Calculation Program (NCP) hilft bei der Überprüfung der applikationsbedingten Kennwerte und somit bei der spezifischen Dimensionierung des Getriebes. « KF
Marcel Geurts arbeitet im Produktmanagement bei Neugart.
Im Neugart Verzahnungskompetenzzentrum (kurz VKZ) ergänzen sich unterschiedliche Kompetenzen rund um Getriebekonzeption, Simulation, Verzahnungsuntersuchung und Zahnradfertigung. Bilder: Neugart GmbH
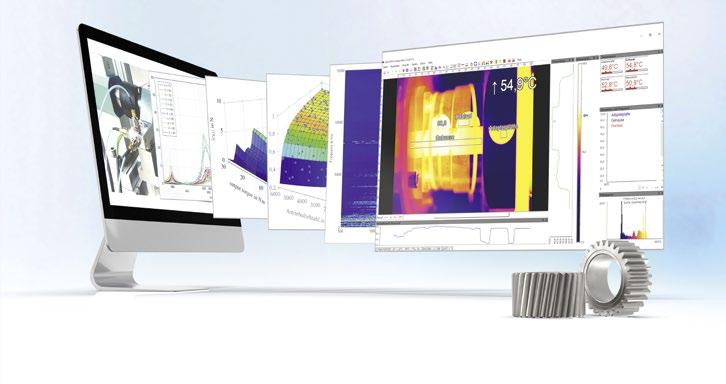
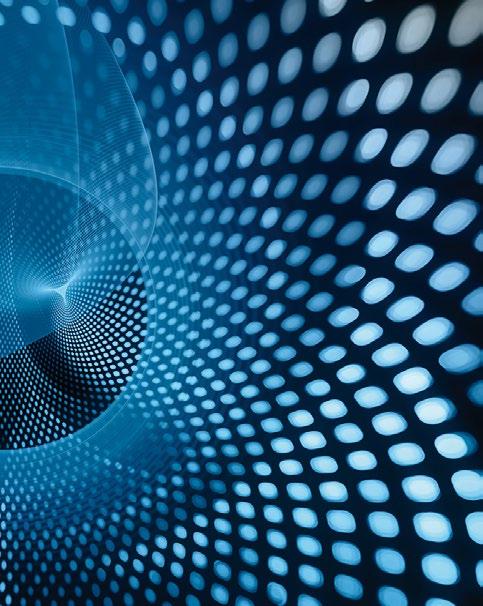

Motoren und Antriebsreglern sind modular aufgebaut und frei skalierbar.
Für passgenaue, kompakte und leistungsstarke Maschinenkonzepte.

Besuchen Sie uns: Halle 3A│Stand 446
Jetzt mehr erfahren

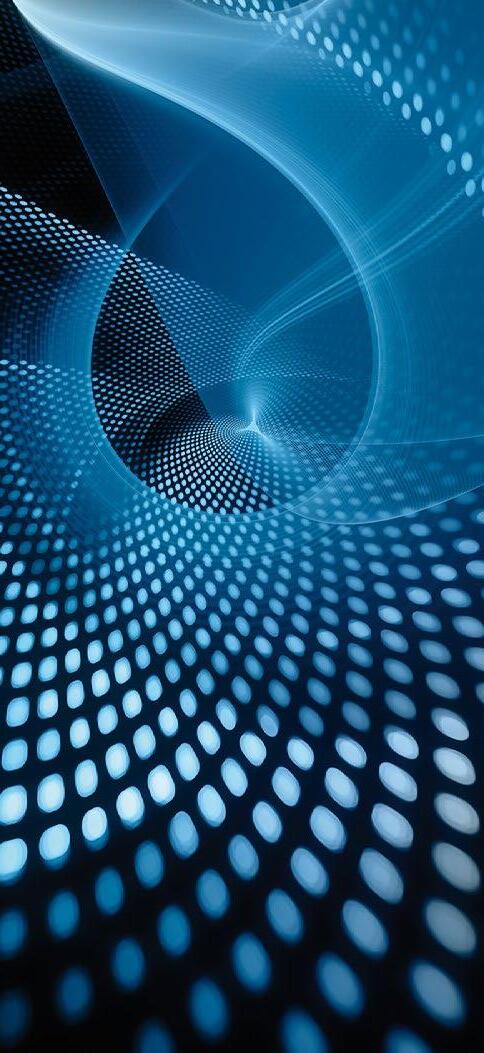
FÜR FTF MIT HOHEN ANSPRÜCHEN
Von fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) können unterschiedlichste Branchen profitieren. Entsprechend stark variieren die Fahrzeugkonzepte. Bei hohen Ansprüchen an Beweglichkeit, Flexibilität, Positioniergenauigkeit oder Dynamik eignen sich Fahr-Lenk-Systeme, mit denen sich FTF aus dem Stand omnidirektional bewegen können. » VON PATRICK SCHUMACHER UND ELLEN-CHRISTINE REIFF
Wie bei so vielem gibt es auch bei fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) keine eierlegende Wollmilchsau. Vielmehr muss das passende Fahrzeugkonzept zu den Gegebenheiten der jeweiligen Anwendung gefunden werden. Während bei neuen Lösungen (Greenfield) die Fahrzeuge meist genügend Platz zum Rangieren bekommen, geht es beim Nachrüsten bestehender Anlagen (Brownfield) meist deutlich enger zu, und die Fahrzeuge müssen entsprechend wendiger sein. Auch die Möglichkeit zur Feinpositionierung gilt es zu berücksichtigen, zum Beispiel wenn das Fahrzeug Übergabestellen sehr präzise anfahren und dazu rangieren muss. Weitere Punkte sind die geforderte Dynamik beim Beschleunigen und Bremsen sowie das Gewicht der zu transportierenden Lasten. Geklärt sein muss außerdem, wie schnell sich die Fahrzeuge bewegen müssen, damit der Logistik- oder Produktionsprozess optimal abläuft. Sind solche Fragen rund um die Anwendung beantwortet, wird sich der Her-
steller für ein Konzept entscheiden. Neben Fahrzeuggröße und Batteriekapazität liegen die wesentlichen Unterschiede dann in der Anzahl der benötigten Antriebs- und Bockräder sowie ihrer Traglast.
Mit Fahr-Lenk-Systemen wendig unterwegs
Für Fahrzeugkonzepte, bei denen es auf Wendigkeit, Traglast, Dynamik oder die Möglichkeit der Feinpositionierung ankommt, hat ebm-papst mit dem ArgoDrive das passende Fahr-Lenk-System inklusive Rad entwickelt. In den Ausführungen Light, Standard und Heavy kann es entsprechend Lasten bis 100, 300 beziehungsweise 500 Kilogramm pro Antriebseinheit bewegen. Die Einbaumaße sowie die elektrischen, mechanischen und steuerungstechnischen Schnittstellen sind bei allen Ausführungen identisch. Raddurchmesser, Geschwindigkeit und Beschleunigung variieren, und auch die mögliche Traglast sowie die Bodenfreiheit unterscheiden sich. Jede Antriebseinheit besteht aus zwei bürstenlosen DC-Motoren, Getriebe, Sensorik und allen erforderlichen Anschluss-Steckern. ANTRIEBSTECHNIK
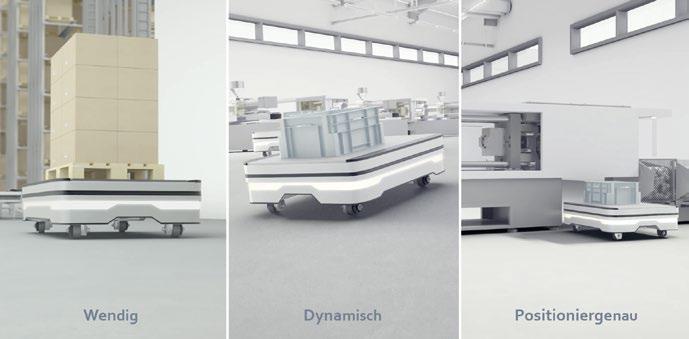
Fahr-Lenk-System für fahrerlose Transportfahrzeuge, bei denen es auf Wendigkeit, Traglast, Dynamik oder Positioniergenauigkeit ankommt.
Die zwei Motoren tragen durch das Überlagerungsgetriebe je nach Anforderung zum Lenken, Beschleunigen, Fahren oder Bremsen bei. Ist das Rad ausgerichtet beziehungsweise findet keine Lenkbewegung statt, kann die komplette Leistung beider Motoren für das Fahren genutzt werden – das ist ein einzigartiges Konzept. Der unendliche Lenkwinkel ermöglicht die Flächenbeweglichkeit des Fahrzeugs, auch aus dem Stand. Der Fahrzeugkonstruktion erschließen sich dadurch viele Möglichkeiten.
Wenn hohe Dynamik und Präzision gefordert sind, lässt sich im einfachsten Fall ein dreirädriges Konzept für einen Gabelstapler oder ein Schleppfahrzeug mit einem ArgoDrive und zwei Bockrollen realisieren. Solche Fahrzeuge können sich dann zwar nicht vollständig omnidirektional bewegen, dabei aber je nach Radauslegung trotzdem große Lasten sehr flexibel transportieren, und das bei einer vergleichsweise einfachen Regelung. Zudem ist eine flache Bauweise möglich, da das Fahr-Lenk-System an der angetriebenen Achse deutlich kompakter ist als ein klassischer Staplerantrieb.
Sind omnidirektionales Fahren und höhere Lasten gefordert, helfen zwei oder drei FahrLenk-Systeme weiter. Mit zwei einander gegenüber angeordneten Fahr-Lenk-Systemen und zwei Bockrollen sind besonders schmale
MIT DEN AUSFÜHRUNGEN
LIGHT, STANDARD UND HEAVY FINDET JEDER ANWENDER DAS RICHTIGE FAHR-LENK-SYSTEM.
und wendige Fahrzeuge realisierbar. Basierend auf dem omnidirektionalen Fahrkonzept können sie sich autonom und frei navigierend in der Produktion oder im Lager bewegen, quer in Regalgassen einfahren sowie auf der Stelle wenden, und damit auf engstem Raum manövrieren, zum Beispiel um Übergabestationen präzise anzufahren.
Die Anzahl der an den Fahrzeugen eingesetzten Fahr-Lenk-Systeme lässt sich im Prinzip beliebig erhöhen. Möglich ist zum Beispiel der Einsatz von zwei, vier und sechs ArgoDrives, immer ergänzbar durch Bockrollen, um gegebenenfalls die Traglast des Fahrzeugs zu erhöhen. Mit vier Fahr-LenkSystemen und vier Bockrollen lassen sich dann beispielsweise beladene Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von vier Tonnen omnidirektional und mit hoher Positioniergenauigkeit dynamisch bewegen.
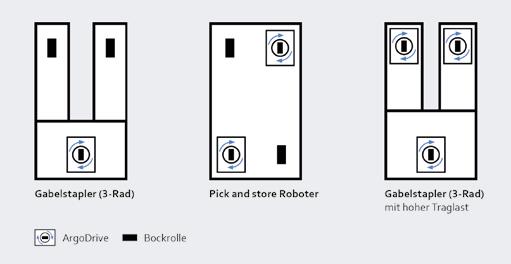
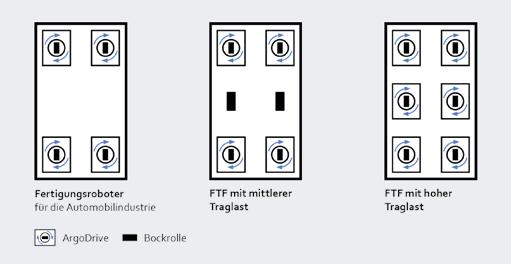
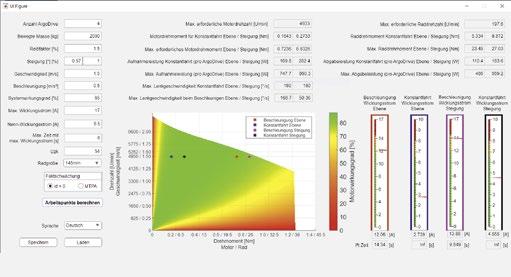
Kompromiss aus Leistung und Wirtschaftlichkeit
Die Möglichkeiten sind damit nahezu unbegrenzt. Aber auch die Wirtschaftlichkeit gilt es im Blick zu behalten, und Hersteller fahrerloser Transportfahrzeuge müssen den richtigen Kompromiss aus Leistung und Kosten finden. Dazu gilt es zu überprüfen, wie hoch die Anforderungen an die Performance in der Applikation sind. Manchmal ist es doch sinnvoll, statt vier nur zwei ArgoDrives einzusetzen. Dadurch halbiert sich zwar die Dynamik, aber vielleicht ist der Durchsatz dem Endkunden trotzdem ausreichend, weil vom FTF bediente Bereiche ohnehin langsamer arbeiten würden. Auch die Leistungsaufnahme der Antriebe kann im Zusammenhang mit der Batteriekapazität bei diesen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Auf der sicheren Seite ist in solchen Fällen, wer sich von Spezialisten beraten lässt. Bei ebm-papst helfen praxisgerechte Simulationstools, die individuelle Aufgabenstellung zu analysieren und unterschiedliche Lösungsvorschläge zu bewerten. In die Berechnung fließen alle relevanten Parameter von der gewünschten Geschwindigkeit und Beschleunigung, der notwendigen Traglast, dem Raddurchmesser sowie der maximalen
Fahrzeugtypologien mit einem, zwei und drei FahrLenk-Systemen.
Spindelhubgetriebe
Mehr Fahr-LenkSysteme bedeuten auch mehr Performance.

• Wahlweise mit Trapezoder Kugelgewindetriebe
Simulationen helfen bei der optimalen Fahrzeugauslegung.
Bilder: ebm-papst
Leistungsaufnahme bis hin zur Effizienz des Gesamtsystems ein. Die Ergebnisse helfen, die für die konkreten Anforderungen passende Lösung und damit den optimalen Kompromiss im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Performance zu finden.
Einfach integrierbar
Für den Fahrzeughersteller ist es unkompliziert, das Fahr-Lenk-System in sein Fahrzeug zu integrieren – nicht nur mechanisch, sondern auch im Hinblick auf die Steuerungstechnik. Sicherheitskonzept und Verkabelung sind bei allen ArgoDrive-Varianten völlig identisch. All-in-one-Kabel mit industrietauglichen Steckern erleichtern den elektrischen Anschluss. Damit steht eine sichere, flexible und einfach integrierbare Antriebslösung für die verschiedenen Typologien der fahrerlosen Transportfahrzeuge zur Verfügung, die in Bezug auf Flächenbeweglichkeit und Kompaktheit keine Kompromisse erfordert und sich für den Einsatz in unterschiedlichsten Branchen eignet. « KIS
Patrick Schumacher ist Director Productmanagement Division IDT bei ebm-papst in St. Georgen. Ellen-Christine Reiff, M.A., arbeitet im Redaktionsbüro Stutensee.
• Hubkräfte von 2,5 bis 500 kN realisierbar
• Einsatzmöglichkeit für alle Einbaulagen
• großes Zubehörprogramm

SPS Nürnberg
Halle 3 Stand 230 12.11.-14.11.2024
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

NEFF Gewindetriebe GmbH Karl-Benz-Str. 24
71093 Weil im Schönbuch
www.neff-gewindetriebe.de
BEKANNTER EFFEKT KLUG GENUTZT
Spezielle Anwendungen verlangen nach speziellen Lösungen. Servotecnica hat für diese Fälle innovative Sensortechnologie aus Österreich im Portfolio: Die Encoder von Flux nutzen zur Positionsbestimmung die patentierte GMI-Technologie, mit der sich Anwendungen realisieren lassen, die bislang ausgeschlossen schienen.
» VON CHRISTIAN BECKER
Seit 2021 ist Servotecnica exklusiver Vertriebspartner für die Encoder von Flux. Die Experten aus Braunau am Inn in Österreich sind ausgemachte Spezialisten für Sensorik, mit jahrzehntelanger Erfahrung und großem Know-how im Bereich magnetischer, induktiver und optischer Technologien. Ab einem gewissen Punkt zeigte sich allerdings, dass es vor allem beim Erfassen von Rotations- und linearen Bewegungsabläufen Zeit für neue Entwicklungen war. Gründe dafür waren weitreichende Innovationen bei Automatisierung und Robotik, die noch dazu immer schneller erfolgten. Gefragt waren ultraschnelle, ultraleichte und -flache Sensoren und Encoder, die mit der raschen Weiterentwicklung der Industrie 4.0 Schritt halten konnten.
GMI-Effekt zur Positionsbestimmung
Die klugen Köpfe von Flux antworteten auf diese Entwicklung mit der patentierten GMITechnologie (für Giant Magneto Impedance). Das Prinzip dahinter ist bekannt: Der GMIEffekt besteht darin, dass bestimmte Materialien ihre Impedanz, also ihren Wechselstromwiderstand, ändern, sobald sie einem externen Magnetfeld ausgesetzt sind. Das hat wiederum Auswirkungen auf den sogenannten Skin-Effekt, der durch Anlegen eines

Wechselstroms im GMI-Material hervorgerufen wird. Auf diese Weise kann ein Signal in Abhängigkeit von der Position zwischen Sensor (GMI-Folie) und Maßband (externem Magnetfeld) generiert werden. Ein Novum, denn der GMI-Effekt war bis dahin noch nie zur Positionsbestimmung genutzt worden. Überträgt man dieses Wissen auf die Herstellung eines Encoders, so wie es Flux gelungen ist, ergibt sich ein enormer Mehrwert: Es sind Anwendungen denkbar, die bislang ausgeschlossen schienen, weil übliche Sensoren und Encoder wegen ihrer Größe oder Trägheit schlichtweg nicht geeignet waren. Flux GMI-Encoder kombinieren die hochgenaue Leistung eines optischen Drehgebers mit der Robustheit eines induktiven Drehgebers und der großen Montagetoleranz sowie Arbeitsbereich eines magnetischen Drehgebers. Darüber hinaus arbeiten die GMI-Encoder hysteresefrei und bieten eine real-time Positionserfassung; das heißt, die aktuelle Position steht zu jeder Zeit ohne Verzögerung bereit. Sie vereinen Eigenschaften und Funktionen bisheriger Encoder-Systeme in einem einzigen Gerät – das spart Kosten für Energie, Einbau, Integration, Betrieb und Wartung.
Paul Tutzu, Flux-Gründer und CEO, bringt es so auf den Punkt: „Der rasante technische Fortschritt und die sich ständig ändernden ANTRIEBSTECHNIK

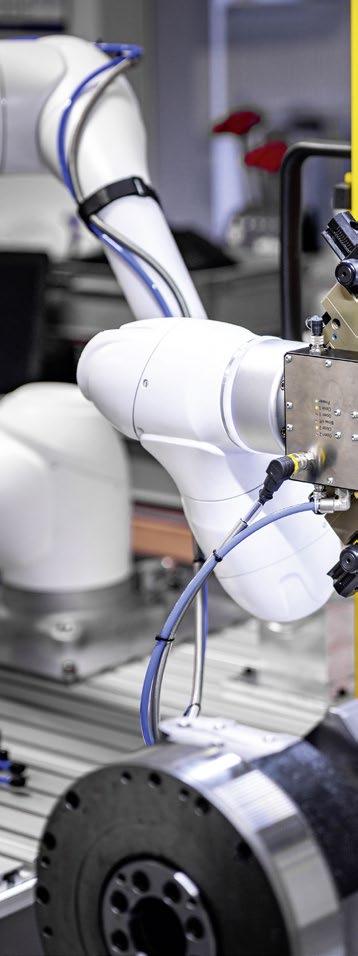
Rahmenbedingungen erfordern eine hohe Flexibilität. Mit dem Einsatz von FLux Drehgebern garantieren wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit und bieten gleichzeitig einen Mehrwert durch überlegene technische Leistung.“
Vertriebs- und Kooperationspartner
Von diesem bahnbrechenden Know-how profitiert Servotecnica seit 2021, zum einen als exklusiver Vertriebspartner für die Produkte von Flux für Deutschland und Italien, zum anderen als Kooperationspartner für weitere Entwicklungen im Bereich der Drehgeber-

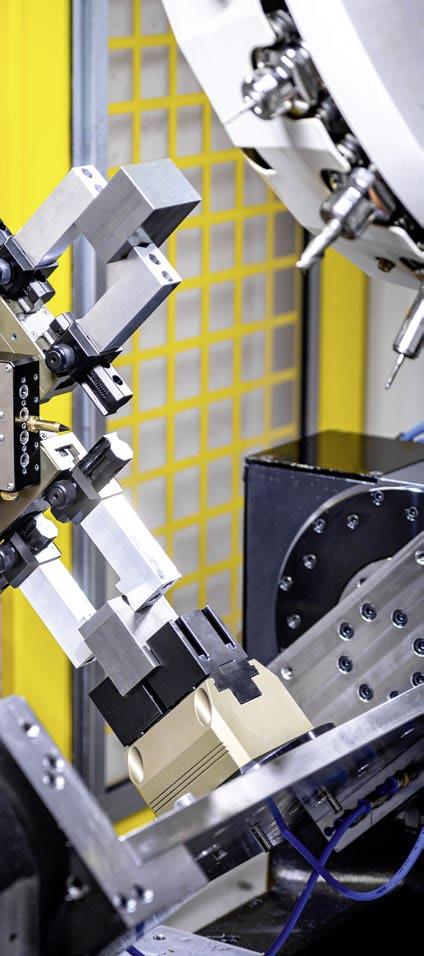
Zum Einsatz kommen Flux-Encoder beispielsweise als Last- und Motor-Encoder in Gelenken von Industrierobotern. Bild: Uwe/AdobeStock
technologie und Schleifringe. Zum aktuellen Produktportfolio der von Servotecnica vertriebenen Flux-Encoder mit GMI-Technologie gehören GMI-Winkelcodierer (GMI-Angle Serie) sowie GMI Drehgeber (GMI-Rotary Serie) in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Serie besonders kompakter und leichter Drehgeber, die auf Induktion basieren.
Vorteile zu konventionellen Drehgebern GMI-Encoder von Flux haben zusätzlich zu den bereits genannten Vorteilen zahlreiche weitere gegenüber herkömmlichen Absolutwert-Drehgebern. So funktioniert ihr Messprinzip in einem größeren Arbeitsbereich und bietet ein ausgezeichnetes SignalRausch-Verhältnis. Im Ergebnis führt das zu vergleichsweise großen Montagetoleranzen in Kombination mit einer hohen Auflösung und Genauigkeit im gesamten Arbeitsbereich. Die rahmenlose Ausführung der GMI-
Drehgeber verhindert, dass zusätzliche, parasitäre Reibung ins System eingebracht wird, wie es bei gekapselten Systemen geschieht, die in die Drehachse zusätzlich Haft- und Rollreibung einbringen.
GMI-Drehgeber arbeiten darüber hinaus holistisch: Der Sensor tastet das Maßband nicht punktuell, sondern über die gesamten 360 Grad einer Umdrehung ab. Dadurch ist er weitgehend unempfindlich gegenüber Ungenauigkeiten wie Exzentrizitäten oder einem Versatz zwischen Sensor und Maßband. Als Echtzeit-Encoder liefert er zudem eine Ausgangsposition, die unabhängig von einer Berechnungszeit ist: Er kann die aktuelle Position bei jeder Abfrage unmittelbar und ohne Zeitunsicherheit (Jitter) an die Steuerung übertragen. Damit bieten GMIEncoder sowohl bei niedrigen als auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten eine gleichbleibend hohe Präzision und eignen sich besonders gut für Anwendungen, die eine Geschwindigkeits- oder Drehmomentregelung benötigen.
Zum Einsatz kommen Flux-Encoder beispielsweise als Last- und Motor-Encoder in Gelenken von Industrierobotern und Cobots, außerdem in Werkzeugmaschinen der neuesten Generation oder in Torquemotoren. Mit ihrer überragenden Genauigkeit und Wiederholbarkeit spielen sie auch in anspruchsvollen Fertigungsprozessen eine große Rolle, etwa bei der Herstellung von Halbleitern. Mit ihrer geringen Masse eignen sie sich ebenfalls für Anwendungen in kreiselstabilisierten, kardanischen Halterungen für Kameras oder Messinstrumente, sogenannten Gimbals, die an Drohnen oder bemannten Luftfahrzeugen montiert werden können.
Ansprechpartner
für individuelle Lösungen
Ein Plus an Performance:
Kleinservoantriebssystem weitergedacht.

tauglichen Kleinservoantriebssystems setzt wieder einmal Maßstäbe:
+ Multi-Ethernet-Schnittstelle für maximale Konnektivität
+ Um 30 % kompaktere Servoregler
+ Kompakt-Antriebssystem für die Feldebene
+ Dezentrale Intelligenz
+ Miniaturisierter Multiturn Encoder
+ Optional: Haltebremse, Getriebe, Spindeltrieb u.v.m.
Dies eröffnet Ihnen neue Freiheiten bei der Maschinenkonzeption.
« KF
Um die jeweils passende Lösung für Antriebe, Sensorik und Automatisierung zu finden, ist Servotecnica ein kompetenter Ansprechpartner. Mit den GMI- und induktionsbasierten Encodern von Flux eröffnet sich Kunden und Partnern ein weiteres Feld mit zahlreichen, teils bahnbrechenden neuen Möglichkeiten. Für Servotecnica hat sich schon nach so kurzer Zeit gezeigt, dass die Kooperation als Vertriebs- und Entwicklungspartner für Flux ein richtiger und wertvoller Schritt ist, um auch in Zukunft zu den Top-Unternehmen der Branche zu gehören.
Christian Becker ist Geschäftsführer der Servotecnica GmbH.
WITTENSTEIN – eins sein mit der Zukunft www.wittenstein-cyber-motor.de

Wegen seiner hohen Genauigkeit eignet sich der Acuro AD37 für den Einsatz an Werkzeugmaschinen. Bild: Parilov/AdobeStock

PLATZWUNDER MIT HOHER DATENÜBERTRAGUNGSRATE
Der Absolutwertgeber Acuro AD37 von Hengstler erfasst Positionsdaten selbst bei hohen Drehzahlen zuverlässig und präzise. Jetzt gibt es den Encoder in einer Ausführung mit 1:3-Konus. Diese Version lässt sich auch ohne Umbauten an Standard-Servomotoren montieren. » VON LESLIE WENZLER
Der Absolutwertgeber Acuro AD37 eignet sich aus mehreren Gründen für hochdynamische, sicherheitskritische Anwendungen. Da ist zum einen seine sehr hohe Präzision: Der Encoder arbeitet bei Drehzahlen von bis zu 12.000 min-1 mit einer absoluten Genauigkeit von ±36 Winkelsekunden und einer Wiederholgenauigkeit von kleiner als ±10 Winkelsekunden.
Bemerkenswert sind dabei die Zertifizierung nach SIL 3 (PLe, Kategorie 3) sowie die hohe Auflösung von 20 Bit im Singleturn- und 12 Bit im Multiturn-Betrieb. Diese Eigenschaften sowie seine zweikanalige redundante Ausführung prädestinieren den Encoder für Anwendungen mit hohen Safety- und Genauigkeitsanforderungen.
Kompaktester seiner Klasse
Darüber hinaus ist der Absolutwertgeber mit einer Bautiefe von nur 29 Millimeter der kompakteste Multiturn-Motorfeedback-Encoder seiner Klasse. Die geringen Abmessungen waren für die Hengstler-Konstrukteure neben der hohen Präzision ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung des Encoders. Das hängt mit dem knappen Bauraum zusammen, der Motor-Herstellern für die Integration zusätzlicher Komponenten zur Verfügung steht. Viele Kunden bevorzugen deshalb kürzere Motoren.
Vibrationsfreie Regelung ermöglicht energieeffizienten Betrieb
Neben der Präzision und Funktionalen Sicherheit zeichnet sich der Acuro AD37 auch durch eine hohe Signalgüte bei der Daten-
übertragung aus. Servomotoren können deshalb „glatter“ als mit vergleichbaren Encodern geregelt und somit sehr energieeffizient betrieben werden. Die hohe Signalgüte verdankt er einer neuartigen Sensorik mit Signalkonditionierung. Mittels des Acuro link-Protokolls von Hengstler werden nicht nur Informationen zur Position, sondern auch zur Temperatur des Motors und des Encoders an die übergeordnete Steuerung gesendet – mit einer Übertragungsrate von 10 MBaud ohne Qualitätsverlust über eine Distanz von bis zu 100 Metern.
Quasi in Echtzeit
Der Encoder überträgt die Daten innerhalb eines einzigen Zyklus‘ mit einem Reglertakt von bis zu 32 kHz, quasi in Echtzeit. „Dadurch
kann das Daten-Handling gegenüber herkömmlichen Schnittstellen‘ deutlich vereinfacht werden“, erklärt Johann Bücher, Director Encoder Strategy bei Hengstler. Da der Acuro AD37 die Daten sehr viel schneller überträgt als andere Encoder, kann die Steuerung im Fehlerfall auch sofort reagieren. Um die Produktivität bei sehr hoher Präzision weiter zu steigern, lassen sich Servomotoren deshalb mit dem Acuro AD37 sehr dynamisch betreiben.
Nur ein Datenkabel
Das Acuro link-Protokoll hat aber noch einen weiteren Vorteil: Alle Daten werden über ein einziges Kabel gesendet. Anwender sparen so wertvollen Bauraum und die Gesamtsystemkosten sinken. Für eine einfache Integration des Motors mit Encoder in die Applikation sorgt auch sein integrierter Speicher für antriebsspezifische Daten. Dadurch wird es den Maschinenbauern und -betreibern ermöglicht, wichtige Kennzahlen in einem Electronic Data Sheet (EDS) direkt auf dem Encoder abzulegen. So kann im Bedarfsfall schnell darauf zugegriffen werden. Der Encoder stellt bei Inbetriebnahme die spezifischen Daten für Encoder, Motor und Antriebsregler bereit.
Mit Bosch-Steuerungen kompatibel

denn diese setzen ebenfalls auf das Acuro link-Protokoll.
Ausführung für
Standard-Servomotoren
Manche Antriebstechnik-Hersteller konnten die Vorteile des Acuro AD37 bisher nur mit erhöhtem Konstruktionsaufwand nutzen, da sich der Encoder bisher nur über die integrierte Countex-Kupplungsnabe oder eine Stator-Kupplung an die Motorwelle anbinden ließ.
VIELE HERSTELLER HABEN UNS ERKLÄRT, DASS SIE
Den Acuro AD37 mit 1:3-Konus gibt es mit unterschiedlichen Statorkupplungen. Bild: Hengstler
Durch diese mechanische Erweiterung können die Vorteile des Gebers nun auch für bestehende Servomotor Produktreihen genutzt werden. Neben der hohen Genauigkeit und Regelgüte zählt dazu auch die hohe Robustheit des Absolutwertgebers in mechanischer und in thermischer Hinsicht. Der AD37 hält im Dauerbetrieb nicht nur Temperaturen von bis zu 120 °C, sondern auch Vibrationen von bis zu 300 m/s2 (10...2.000 Hz) zuverlässig stand.
So sparen Maschinenbauer
Geld
Hengstler hat den Absolutwertgeber speziell für den Einsatz an Servomotoren konzipiert. Er wurde deshalb exakt an die Anforderungen dieser Zielgruppe angepasst. Maschinenbauer können nicht nur Temperatur-, sondern auch Kabelbruch- oder Vibrationssensoren an den Encoder anschließen. Der AD37 ist auch mit den weitverbreiteten Steuerungen von Bosch Rexroth kombinierbar,
ZWAR GERNE UNSEREN GEBER NUTZEN WÜRDEN, ABER DEN AUFWAND FÜR EINE KONSTRUKTIVE ERWEITERUNG IHRES MOTORS SCHEUEN.«
JOHANN BÜCHER

Gerade Standard-Servomotoren verfügen oft über eine Wellenanbindung mit 1:3-Konus –Hersteller mussten sie daher modifizieren, um den AD37 in ihren Antrieb integrieren zu können. „Viele von ihnen haben uns erklärt, dass sie zwar gerne unseren Geber nutzen würden, aber den Aufwand für eine konstruktive Erweiterung ihres Motors scheuen“, berichtet Johann Bücher. Hengstler hat sich daher entschieden, den Encoder auch in einer Ausführung mit 1:3-Konus auf den Markt zu bringen.
Der Acuro AD37 lässt sich dank des neuen 1:3-Konus jetzt auch ohne aufwändige Umbauten an Standard-Servomotoren anbinden. Bild: Hengstler
Seine enorme Stabilität macht den Absolutwertgeber zum idealen Positionsmesser an Antrieben von Applikationen in rauen Umgebungen wie zum Beispiel in Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Textilmaschinen und Verpackungsanlagen. Zur mechanischen Robustheit des Encoders kommt noch der hohe Sicherheitsintegrationslevel (SIL3) von Acuro link hinzu: Er macht Maschinenbauern die Konstruktionsarbeit wesentlich leichter. Da das Protokoll bereits SIL3-zertifiziert ist, können sie für den Rest ihrer Maschine weniger sichere Standard-Komponenten verwenden. Das spart sowohl Zeit als auch Kosten.
Bereit für die Digitale Fabrik
Der Acuro AD37 bietet dank seiner hohen Funktionalen Sicherheit zudem beste Voraussetzungen für künftige Industrie 4.0-Anwendungen an Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Textilmaschinen und Verpackungsanlagen. Wenn Maschinenbauer den AD37 verwenden, können sie für die Datenübertragung dank Acuro link-Protokoll weiterhin die etablierten Übertragungswege nutzen und zusätzlich Daten aus dem Elektronischen Datenblatt sowie Condition Monitoring-Daten übertragen. « KF
Leslie Wenzler ist Marketing & Communications Manager bei Hengstler.
ANTRIEBSTECHNIK
LINEARACHSEN FÜR ALLE FÄLLE
Lineartechnische Komponenten und Konstruktionen sind die Basis für automatisierte Fertigungsprozesse. RK Rose+Krieger bietet anwendungsspezifische Automatisierungslösungen und Schutzsysteme aus einer Hand. » VON BERND KLÖPPER
Pick-und-Place-Vorrichtungen, Beund Entladeeinrichtungen oder Handling- und Bearbeitungssysteme benötigen lineare Bewegungsachsen zum präzisen Platzieren und Positionieren oder als Momentenstütze. Lineartechnik erweitert ebenfalls auf einfache Weise den Aktionsradius von kollaborierenden Robotern (Cobots).
Um dabei Schutz und Sicherheit von Mensch Maschine und Prozess zu gewährleisten, ist in der Regel der Einsatz von Schutzgittern und Maschineneinhausungen erforderlich. Mit ihrem umfassenden und stetig wachsenden Lineartechnik-Portfolio sowie dem normkonformen, modularen Schutz- und Abtrennsystem bietet RK Rose+Krieger Automatisierungskomponenten für diese sehr hohen Ansprüche.
Das Portfolio des Mindener Spezialisten für kundenspezifische lineartechnische Konstruktionen bietet für jede Anwendung die passende Linearachse → als mitlaufende Momentenstütze, → zur gelegentlichen Verstellung bei niedriger Einschaltdauer und Geschwindigkeit,
→ für hohe Taktraten und Wiederholgenauigkeiten, → für hohe Positioniergenauigkeiten und gleichförmige Bewegungsabläufe. Dabei erfüllen insbesondere die Aluminiumprofil-Lineareinheiten der Baureihen RK DuoLine und RK MonoLine präzise die Anforderungen der Industrie: Sie sind leicht, dennoch äußerst stabil und energieeffizient sowie – dank variablem Anbaukonzept für fast alle Motoren – flexibel einsetzbar und auf Wunsch in der Schutzart IP40 erhältlich. Zudem bietet RK Rose+Krieger mit der Achsfamilie RK DuoLine Clean zertifizierte Lineareinheiten für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 1 an.
Linearachsen mit Omega-Antrieb … Für den Einsatz als Vertikalachse in einem Mehrachsensystem mit verfahrendem Grundprofil und stillstehendem Schlitten, als GantryAntrieb mit zwei Vertikalachsen oder als Horizontalachse eines Handlingportals mit einer hohen Nutzlast auf dem verfahrenden Schlitten entwickelte RK Rose+Krieger die Baureihe RK MonoLine MT mit Omega-Antrieb.

Das patentierte Haltesystem RK Safelock (links) verhindert ungebremstes Absinken von Führungsschlitten an schwerkraftbelasteten Lineareinheiten – rechts der eingebaute Zustand.
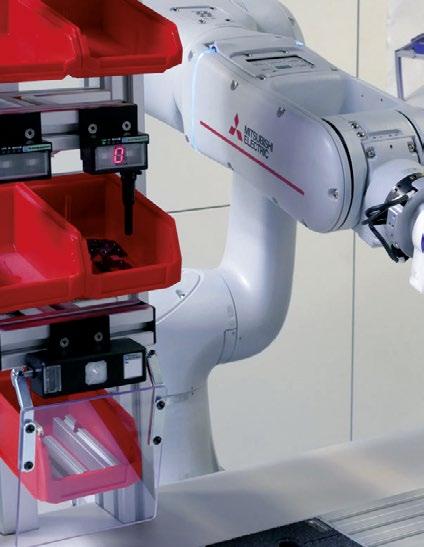
… und mit Lastensicherung
Speziell für den vertikalen Einsatz, die häufigste Nutzungsform der RK MonoLine MT, kombiniert RK Rose+Krieger die Achse mit dem bewährten RK Safelock-Sicherungselement. Die geprüfte Absturzsicherung steht seit längerem ebenfalls für die Achsen der RK DuoLine Baureihe zur Verfügung. Sie erfüllt die Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, nach der schwerkraftbelastete Achsen vor einem ungewollten Absinken bewahrt werden müssen, und passt perfekt zu den Achsen.
Mehr Spielraum für Roboter
Kollaborierende Roboter sind für die Automatisierung von Fertigungsprozessen unverzichtbar. Sie übernehmen körperlich belastende oder monotone Tätigkeiten, wie das Handling schwerer Lasten oder das wiederholgenaue Anreichen von Teilen. Auch, wenn dauerhafte Präzision und Schnelligkeit oder die ununterbrochene Durchführung bestimmter Arbeitsschritte nötig sind, wie bei bahngesteuerten Arbeitsschritten, bietet sich der Einsatz von Robotern an. Dabei lässt sich ihr Aktionsradius durch eine intelligente Verknüpfung mit Linearachsen und elektrischen Hubsäulen deutlich vergrößern. Typische Anwendungen für die Kombination aus Lineartechnik und Cobots sind Schweißarbeiten und Montagearbeitsplätze. Für ein robotergestütztes Handling- und Bearbeitungssystem zum Schweißen zylindrischer Stahltanks entwickelte RK Rose+Krieger ein Raumportal zur kugelförmigen Vergrößerung des Bewegungsradius des Cobots.
Baukasten bildet Grundgerüst
Das Grundgerüst des Portals besteht aus Blocan-Aluminiumprofilen unterschiedlicher Baugrößen. Es kann auf zwei parallel
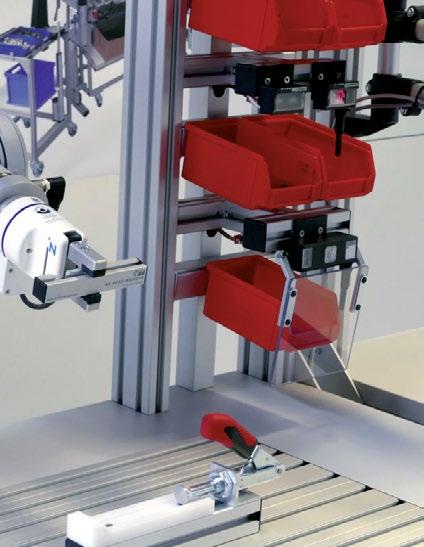
Kollaborative Roboter entlasten den Werker am Montagearbeitsplatz.
Die Profil-Lineareinheiten RK DuoLine und RK MonoLine eignen sich für das obere und mittlere Belastungssegment.
Bilder: RK Rose+Krieger

angeordneten, zahnriemengetriebenen Linearachsen vom Typ RK DuoLine Z 80 Protect über eine Strecke von 1500 Millimetern horizontal verfahren werden. Zwei weitere, ebenfalls parallel verlaufende Achsen des gleichen Typs bilden die Z-Achse des Raumportals. Sie bewegen eine rollengeführte Linearachse (RK MonoLine Z120) vertikal über eine Distanz von 1500 Millimetern. An dieser Lineareinheit ist der Cobot mit der Bearbeitungseinheit montiert.
Raumportal individuell anpassbar
Das Raumportal erweitert den Arbeitsbereich des kollaborierenden Roboters (Durchmesser max. 2650 Millimeter) um den ansonsten nicht erreichbaren zylinderförmigen Bereich über- und unterhalb seiner Basis. Damit kann der Cobot innerhalb der gesamten Portalstruktur ohne jegliche Einschränkung agieren. Die Baugröße von Portal und Achsen lässt sich individuell an die Größe des Cobots und die Anforderungen der jeweiligen Anwendung anpassen.
Linearachsen optimieren Aktionsradius und Materialfluss
Linearmodule aus dem Portfolio von RK Rose+Krieger können die sechs Antriebsachsen des Cobots ergänzen und seinen Bewe -
gungsradius erweitern: Hubsäulen wie beispielsweise der Powerlift Z dienen der elektrischen Höhenverstellung. Beliebig lange Linearachsen aus der RK MonoLine- oder RK DuoLine-Baureihe verfahren den Cobot (zusätzlich) in X- und Z-Achse. Auf diese Weise lassen sich bei Bedarf mehrere Montagearbeitsplätze über Linearachsen miteinander verknüpfen und beispielsweise Werkstücke von einer Bearbeitungsstation zur nächsten transportieren.
Schutz und Sicherheit garantiert
Voll- oder teilautomatisierte Produktionsprozesse und der Einsatz von Robotern bzw. Cobots erfordern gemäß Maschinenrichtlinie DIN EN ISO 14120 wirksame Maßnahmen zum Schutz von Mensch, Maschine und Prozess. Mit seinem modularen Schutz- und Abtrennsystem RK Click & Safe – kombiniert mit Notaus- und Endschaltern, Lichtschranken, Berührungs- und Manipulationsschutz – bietet RK Rose+Krieger anwendungsspezifische Schutzgitter und Maschineneinhausungen, die den Anforderungen der Norm entsprechen. Für maximale Flexibilität bei minimalem Planungs-, Konstruktions- und Montageaufwand sorgen der zugrundeliegende Modulbaukasten und die Rasterbauweise des Systems. « KF
Bernd Klöpper ist Marketingleiter bei RK Rose+Krieger.
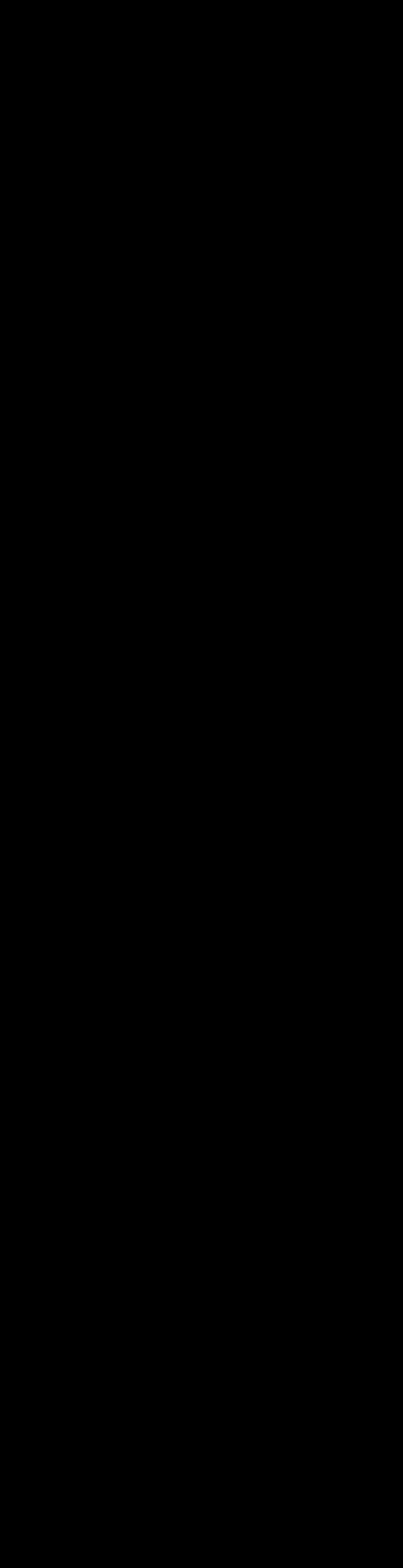

ANTRIEBSTECHNIK
Drei-Level-Frequenzumrichter für einen neuen
DIESER ANTRIEB LÄSST MOTOREN KALT
In den neuen Turbokompressoren von Boge kann die Drei-Level-Technologie des Frequenzumrichters SD2M von Sieb & Meyer ihre Vorteile voll ausspielen: Sie gewährleistet geringe Rotorverluste und vermeidet somit eine zu hohe Motorerwärmung, die bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen problematisch ist. » VON TORSTEN BLANKENBURG

In den neuen dreistufigen Turbokompressoren setzt Boge MultilevelUmrichter von Sieb & Meyer ein – konkret die Baureihe SD2M mit 150 und 75 Kilowatt. Bild: Sieb & Meyer
Boge ist Anbieter von Kompressoren und Druckluftanlagen. Sei es in der Lebensmittel- und der Kunststoffbranche oder auch in der Stahl- oder Pharmaindustrie: Zahlreiche Unternehmen schätzen die hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der vielfältigen Druckluftlösungen. Das Angebot reicht von einzelnen Kompressoren oder Druckluft-Komponenten bis zu kompletten System- und Servicelösungen. In letzterem Fall übernimmt der Hersteller nicht nur die gesamte Installation, sondern auch die Kontrolle und Wartung der Anlage.
Verdichtung in drei Stufen
Das Sortiment der Turbokompressoren wird demnächst um ein Gerät mit 230 Kilowatt ergänzt. „Unsere Turbokompressoren sparen Ressourcen und Energie, kommen ohne einen Tropfen Öl aus und senken, den hohen Drehzahlen zum Trotz, das Geräuschniveau auf ein Minimum“, schildert Peter Boldt, Leiter Turboentwicklung bei Boge. „Die verschleißarme Turbotechnologie setzt neue Maßstäbe bei Effizienz und Kosteneinsparung.“
In den neuen dreistufigen Turbokompressoren setzt das Unternehmen Multilevel-Umrichter von Sieb & Meyer ein – konkret die Baureihe SD2M mit 150 und 75 Kilowatt. Die Frequenzumrichter trei-
ben in den Kompressoren ein oder zwei permanenterregte Gleichstrommotoren an. Umrichter Nummer eins ist für die Verdichterstufe 1 und 2 zuständig, Umrichter Nummer zwei für die Verdichterstufe 3. „Die Motoren arbeiten jeweils mit unterschiedlichen Drehzahlen von rund 35.000 beziehungsweise 55.000 Umdrehungen“, so Peter Boldt. „Durch die Schnittstelle zur Kompressorsteuerung werden die Drehzahlen der beiden Motoren zueinander passend synchronisiert.“
Effizient und kostensparend
Aber auch sonst ist diese Antriebstechnik sehr effizient. Dank der Frequenzumrichter lassen sich die Turbokompressoren kompakt aufbauen. Im Gegensatz zu Wettbewerbsprodukten entfallen hier etwaige Motor-LC-Filter oder Motordrosseln, die groß und schwer, sehr teuer und verdrahtungsaufwändig sind. Der Footprint kann für das Gesamtaggregat somit verringert werden. Zudem wurde auf Kundenwunsch eine Wasserkühlung in die Geräte integriert. Besonders wichtig: Dank der fortschrittlichen Umrichtertechnik ließ sich der Gesamtwirkungsgrad der Turbokompressoren verbessern, was konkret in niedrigeren Energiekosten resultiert. „Wir sprechen hier von einer Einsparung von circa drei bis fünf Prozent“, bestätigt Peter Boldt. „Das klingt erst einmal nach nicht viel – aber wenn man berücksichtigt, dass der Turbokompressor bei Volllast etwa 230 Kilowatt elektrische Leistung pro Stunde aufnimmt, sparen unsere Anwender über die Zeit sehr viel Geld.“
DER UMRICHTER WURDE SPEZIELL FÜR HOHE DREHZAHLEN ENTWICKELT.
Das Sortiment der Turbokompressoren von Boge wurde um ein Gerät mit 230 Kilowatt ergänzt, das mit dem Frequenzumrichter SD2M von Sieb & Meyer ausgestattet ist. Bild: Boge

Der größte Vorteil ist jedoch, dass die Frequenzumrichter speziell für hohe Drehzahlen entwickelt wurden. „Geräte von Wettbewerbern können einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad aufweisen, und es ist mehr Peripherie-Aufwand wie Motor-LC-Filter nötig“, betont Peter Boldt. Beim SD2M hat er sehr gute Erfahrungen mit der Effizienz gemacht, „gerade bezüglich der Vermeidung von Rotorverlusten, die bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen entscheidend sind.“
Motorverluste reduzieren
Rolf Gerhardt, Leiter Vertrieb Antriebselektronik bei Sieb & Meyer, bestätigt: „Genau darauf sind unsere Lösungen zugeschnitten. Bei ihrem Einsatz werden die umrichterbedingten Motorverluste im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten signifikant reduziert. Neben der geringeren Motorerwärmung führt dies zu einem höheren Systemwirkungsgrad und somit auch einem reduzierten Energieverbrauch. Das wiederum spart Kosten – ein Win-Win für den Anwender.“ Der Hintergrund:
Die Frequenzumrichter treiben in den Kompressoren ein oder zwei permanenterregte Gleichstrommotoren an, die für die unterschiedlichen Verdichterstufen zuständig sind. Bild: Boge
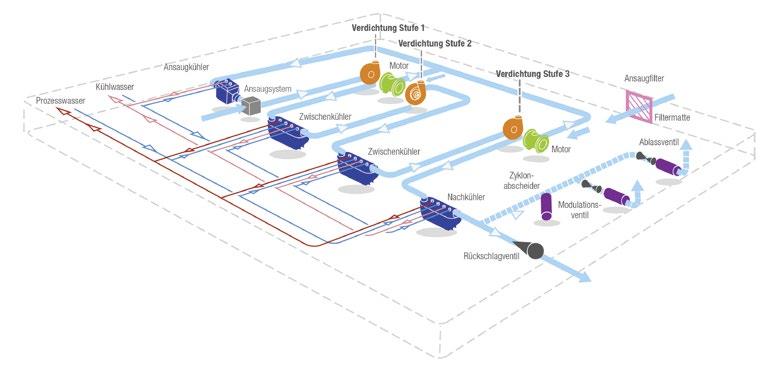
MOTOR-LCFILTER ODER MOTORDROSSELN SIND NICHT ERFORDERLICH.
Circa 90 Prozent aller durch den Umrichter verursachten Verluste treten im Rotor auf und können für den Motor schädliche Erwärmung erzeugen. Hinzu kommt, dass das typbedingt geringe Rotorvolumen eines Hochgeschwindigkeitsmotors zusätzliche Temperaturprobleme erzeugt. Die Regelungsverfahren der SD2x-Frequenzumrichter führen zu einem wesentlich geringeren Anteil an harmonischen Frequenzen im Motorstrom.
Gegenüber herkömmlicher Umrichtertechnologien mit zwei Leveln geht die DreiLevel-Technologie, auf der der Frequenzumrichter SD2M basiert, noch einen Schritt weiter: Bei dieser Technologie werden die Leistungshalbleiter der Endstufen nur mit der Hälfte der Spannung beaufschlagt, wie sie bei der Zwei-Level-Technologie vorkommen. Somit ist es möglich, mit Leistungshalbleitern zu arbeiten, die für wesentlich geringere Spannungen ausgelegt sind und damit noch schneller schalten. Das Resultat: In der Endstufe entstehen weniger Schaltverluste, und die Schaltfrequenz lässt sich deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird der Motor im Vergleich zur Zwei-Level-Technologie nur mit 50 Prozent der Spannungssprünge belastet. Allein durch den Einsatz der DreiLevel-Technologie lassen sich die im Rotor entstehenden Verluste um circa 75 Prozent reduzieren. Nutzt man zusätzlich eine Verdopplung der Schaltfrequenz, lassen sich
Deine Zukunft in Europa oder Villingen-Schwenningen!
Ein starkes europäisches Netzwerk mit ganz unterschiedlichen Kernkompetenzen. Wir sind vertreten in Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie sowie im Gesundheitswesen oder der Medizintechnik.
Bei uns hast du die Möglichkeit deine Zukunft in unserem einzigartigen Unternehmensnetzwerk in Europa zu gestalten. Gemeinsam wachsen, Ideen teilen und Chancen nutzen. Hier. Dort. Überall.
die im Rotor entstehenden Verluste um bis zu 90 Prozent senken. LC-Filter können dann häufig komplett entfallen – wie auch in dieser Anwendung.
Neue Technologie am Horizont
Perspektivisch wird der Kunde weitere Turbokompressoren in das Sortiment aufnehmen, für die Geräte der neuen SD4x Produktfamilie in Frage kommen. Letztere erlauben es, hochdrehende Motoren mit noch weniger Verlustleistung antreiben. Sie unterstützen nun auch PWM-Schaltfrequenzen von 24 und 32 Kilohertz. Für eine noch feinere Modulierung des sinusförmigen Signals ist eine Kommutierungswinkel-Steuerung nun auch für 32, 48 und 64 Kilohertz integriert. Dadurch ergibt sich ein nahezu optimaler Sinus, es treten so gut wie keine harmonischen Ströme mehr auf. Die durch die PWM verursachte Verlustleistung kann noch weiter minimiert werden.
Torsten Blankenburg ist Vorstand Technik bei Sieb & Meyer.
« KIS


ANTRIEBSTECHNIK
HIGH-END-ANTRIEB FÜR HIGH-SPEED-EINSÄTZE
In Hochgeschwindigkeitsapplikationen müssen Motoren 100.000 Umdrehungen pro Minute oder mehr erbringen. Dafür bietet KEB eine neue Antriebslösung. Ausgangsfrequenzen bis 2.000 Hertz und die passende Sinusfiltertechnik sorgen dafür, dass Bearbeitungsspindeln, Turbogebläse, Gasturbinen, Expander und vieles mehr effizient betrieben werden.
» VON TIM SCHÖLLMANN

High-Speed-Umrichter sind überall dort gefordert, wo Motoren mit besonders hohen Drehzahlen laufen – ob in Kläranlagen, der Pharmazie oder in der Lebensmittelherstellung. Mit den Combivert F6 High-Speed Drives hat KEB Automation einen Umrichter für die Regelung sämtlicher Motorenarten vorgestellt.
„Unsere neuen High-Speed Drives sind mit einer Leistung bis 450 Kilowatt, Ausgangsfrequenzen bis 2.000 Hertz und Schaltfrequenzen bis 16 Kilohertz State-of-the-Art im Bereich der Hochgeschwindigkeitsanwendungen“, sagt Fabian Fischer, Teamleiter Applikationsvertrieb bei KEB. Auf welche Leistungsmerkmale im individuellen Fall besonderer Wert gelegt werden sollte und wie Maschinen und Anlagen reibungslos in Betrieb genommen werden, erörtern Kunden gemeinsam mit dem Team von KEB. Außerdem werden
Anwender, die bereits die Vorgängerversion im Einsatz haben, beim Umstieg auf die neue Umrichtergeneration unterstützt.
HIGH-SPEED DRIVE UND SINUSFILTER INDIVIDUELL ANPASSBAR.
Die Kombination von F6 Drives und den Combiline-Z2-Sinusfiltern schafft leistungsfähige Systemlösungen mit aufeinander abgestimmten Komponenten. Die Ausgangsfilter bestehen dabei aus einer Motordrossel und einem Kondensator und sind durch das Baukastenprinzip flexibel an verschiedene Anwendungen anpassbar. Für Motoren, die weniger empfindlich sind, ist die Motordrossel separat erhältlich. Auch bei der Montage der Filter im Schaltschrank haben Maschinen- und Anlagenbauer viele Freiheiten.
„Die High-Speed-Filter der Z2-Serie weisen einen hohen Wirkungsgrad von mehr als 99,9 Prozent auf und verringern die oberwellenbehafteten Verluste im Motor in erheblichem Maße. Nicht zuletzt wird das EMV-Verhalten des Gesamtantriebs durch die Filter verbessert,
Für verschiedene Hochgeschwindigkeitsapplikationen stellt KEB Automation eine effiziente Systemlösung zur Verfügung.
Bild: Jäger
und Leitungslängen von über 100 Metern werden ermöglicht“, ergänzt Fischer.
Im Vergleich zu Multilevel-Umrichtern erreichen Anwender mit diesem System bestehend aus Drive Controller und Sinusfilter einen höheren Systemwirkungsgrad bei vergleichbaren oder sogar niedrigeren Kosten und einer höheren Performance im Feldschwächebereich. Das individuell anpassbare Zusammenspiel von High-Speed Drive und Sinusfilter sorgt in der Praxis nicht nur für eine präzise Antriebsregelung und eine hohe Energieeffizienz, sondern erhöht auch spürbar die Lebensdauer von Turboblowern, Radialverdichtern und vielen weiteren Anwendungen.
Einsatz in Turboblowern oder Spindeln Zu den klassischen Einsatzbereichen der Drives zählen Turboblower – und dafür gibt es gute Gründe. Da Turboblower nicht selten unter rauen Umgebungsbedingungen operieren, werden die Leiterplatten in den kompakten Drives optional mit einer 3C3-
Aufeinander abgestimmt: Combivert
F6 High-Speed Drives und Sinusfiltertechnologie.
Bild: KEB Automation

Schutzlackierung versehen. Durch eine spezielle Softwarefunktion wird das Magnetlager auch nach einem Netzausfall aktiv gehalten. Die hohen Schaltfrequenzen der High-Speed-Umrichter gepaart mit den Sinusfiltern stellen sicher, dass sich der Rotor nur minimal erwärmt und Verluste drastisch reduziert werden. Kosteneinsparungen lassen sich darüber hinaus durch die integrierte und geberlose maximale Drehzahlüberwachung (SMS) und sicher begrenzte Drehzahl (SLS) erzielen. „Praktisch ist zudem das Multi-Feldbus-Interface, das eine einfache Einbindung in Prozessleitsysteme ermöglicht“, sagt Fischer. Auch der Antrieb von Spindeln mit verschiedenen Werkzeugen ist ein Fall für die High-Speed-Antriebe, da sie ein hohes Drehmoment über die ganze Drehzahlbandbreite realisieren. Auch bei dieser Anwendung sind die geberlose Positionierung sowie die Drehzahlsteifigkeit bis 120.000 Umdrehungen pro Minute gute Argumente für den Einsatz der neuen High-Speed-Lösung aus dem ostwestfälischen Barntrup. Daneben wird die Ausnutzung des Reluktanzmoments bei Synchronmaschinen mit asymmetrischer Reaktanz (zum Beispiel IPM-Motoren) ermöglicht, und durch die Multi-Geber-Schnittstelle sowie alle Betriebsarten im Standardbaukasten profitieren Betreiber von High-Speed-Spindeln von einem Höchstmaß an Flexibilität.
Inbetriebnahme wird vorab simuliert
Für alle Hochgeschwindigkeitsapplikationen bietet der Hersteller Simulationsmöglichkeiten und virtuelle Inbetriebnahmen mithilfe des digitalen Zwillings an, wodurch sich Zeit und Kosten bei der späteren realen Inbetriebnahme sparen lassen. Unter anderem wird für das optimale Zusammenspiel aller High-Speed-Komponenten auf Matlab/Simulink gesetzt. Die Software ist ein etablierter Standard zur Modellierung und Simulation komplexer, dynamischer Systeme. So lassen sich anhand der vorliegenden Motordaten zuverlässige Vorhersagen unter anderem zum statischen und
ÜBER KEB AUTOMATION
Als Anbieter von Antriebstechnik bietet KEB Automation alle Lösungsmöglichkeiten für die Automatisierung. Ob Kunststoffmaschinen, Holzverarbeitung, Prozesstechnik und Intralogistik oder auch Windenergie und E-Mobilität – das Unternehmen ist die Quelle für eine Komplettlösung von HMIs über Steuerungen und Antriebe bis hin zu Motoren, Getrieben und Bremsen. Seit 1972 familiengeführt, ist die KEB Automation Gruppe mit über 1.550 Mitarbeitenden in neun Tochtergesellschaften und mehr als 50 Partnern weltweit aktiv.
zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeit oder der Spannung treffen. Kostspielige Praxistests entfallen durch die umfangreichen Simulationsmöglichkeiten. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen die virtuelle Antriebsauslegung mittels Hardware-in-the-Loop (HIL). Auf Grundlage der Motor-, Sinusfilter- und Umrichterdaten wird die Inbetriebnahme vorab simuliert, ohne dass reale Komponenten dafür benötig werden. Variationen der systembezogenen Parameter sind so ohne Risiken jederzeit möglich, und die fertige Parametrierung steht bei der nachfolgenden realen Inbetriebnahme bereits zur Verfügung.
KEB NUTZT DIE VIRTUELLE ANTRIEBSAUSLEGUNG MITTELS HARDWAREIN-THE-LOOP.
Heute sind flüssigkeits- und luftgekühlte Versionen der High-SpeedUmrichter bis 450 Kilowatt serienreif verfügbar. Der Weg dorthin war kein einfacher, weiß Fischer: „Speziell die vom Markt geforderten hohen Umgebungstemperaturen mit 55 Grad Celsius Vorlauftemperatur bei den flüssigkeitsgekühlten Geräten haben uns vor Herausforderungen gestellt, da wir eine hohe und sichere Verfügbarkeit der Geräte durch die Verwendung von Standardbauteilen gewährleisten wollten. Am Ende hat sich die Arbeit gelohnt, da wir eine leistungsund strapazierfähige Lösung anbieten können, die unseren Kunden echte Mehrwerte bietet.“ « KIS
Tim Schöllmann arbeitet im Marketing bei KEB Automation.
Bei uns dreht sich alles um Ihren Antrieb.
Bei uns bekommen Sie die optimale Präzisionskupplung für Ihre Anwendung.
Metallbalgkupplungen
Schlitzkupplungen
Elastomerkupplungen
Gelenkkupplungen
Kreuzschieberkupplungen
Nürnberg, 12. – 14.11.2024 Halle 1 Stand 522

ANTRIEBSTECHNIK
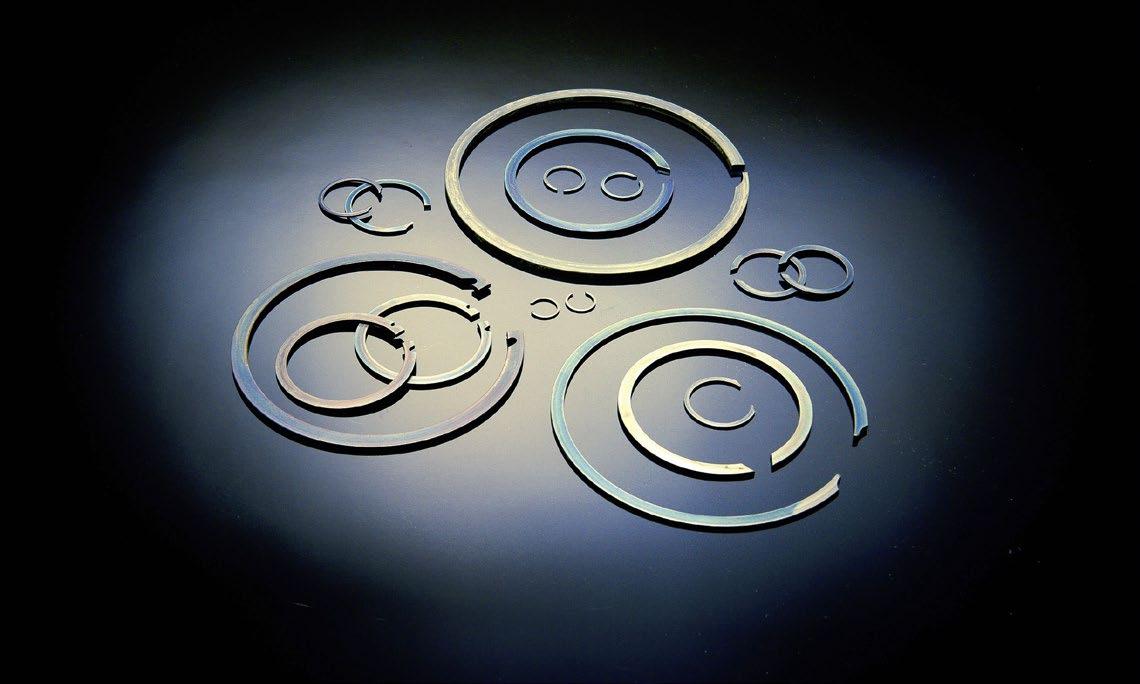
Schnappringe mit verschiedenen Enden.
BESTE LAGESICHERUNG BEI HOHEN DREHZAHLEN
Die Flachdraht-Sicherungsringe von TFC bewähren sich in vielen Bereichen der Antriebstechnik. Insbesondere bei schwierigen Einbauszenarien und bei der Realisierung innovativer Konstruktionskonzepte bieten sie Vorteile gegenüber traditionellen Spreng- und Seegerringen. » VON JULIUS MOSELWEISS
Zu den Einsatzgebieten für Sicherungsringe nach DIN 471 und DIN 472 gehören die axiale Lagesicherung von rotierenden Maschinenelementen – zum Beispiel von Wälzlagern auf Wellen – und die Lagesicherung von Bolzen in Bohrungen. Dabei ist es in kinematisch-dynamischen Anwendungen insbesondere die Zentrifugalkraft (Fz) drehender Wellen, die die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Sicherungsringen limitiert. Wird sie nämlich zu groß, so vermag diese nach außen „fliehende“ Kraft den Ring aus seiner Nut zu heben. Das kann zu Unwuchten und Vibrationen führen oder sogar – falls der Ring aus der Fassung rutscht und von der Welle wandert – zum Totalausfall des Antriebsstrangs. Oft lässt sich dieses Risiko mit herkömmlichen Sprengund Seegerringen aus gestanztem Blech eindämmen. Das gilt aber nur so lange, wie sich die Anwendung hinsichtlich der Beschleunigung, der Umdrehungsgeschwindigkeit oder anderer Faktoren im Bereich üblicher Standards bewegt. Steigen aber die physikalischen Anforderungen der Anwendung und ihrer Umgebung, treten konstruktive
Probleme auf oder sind besonders innovative Lösungen gefragt, schneiden andere Typen von Sicherungsringen wesentlich besser ab. Viele Konstrukteure und Ingenieure greifen in solchen Fällen beispielsweise zu den Sicherungsringen des US-amerikanischen Herstellers Smalley, die hierzulande von TFC angeboten werden. Das hat mehrere Gründe: Erstens handelt es sich hierbei um Produkte aus gewalztem Flachdraht, die in zahlreichen Werkstoffen abrufbar sind – in Edelstahl (zum Beispiel für die Lebensmitteltechnik), in Titan (Medizintechnik), in Kupferlegierungen (Elektrotechnik) und vielen anderen Materialien. Zweitens weisen sie konstruktive Details auf, die die üblichen Probleme mit traditionellen Sicherungsringen vergessen lassen. Und drittens offeriert TFC diese Sicherungsringe inzwischen in einer technischen Bandbreite, die für fast jede Branche und jede Anwendung eine Lösung bietet.
Klassische Lösung für Standardapplikationen
Als einfache, klassische Lösung für viele Standardapplikationen bietet TFC bereits seit geraumer Zeit den einlagigen Smalley-
Schnappring an. Er ist in über 1.000 Größen bestellbar und eignet sich für den Einsatz in kinematischen Baugruppen, die im Betrieb stoßartigen Belastungen ausgesetzt sind. Ein wichtiger Vorteil: Je nach Einbausituation können Konstrukteure und Einkäufer in diesem Fall zwischen verschiedenen Enden-Varianten wählen – beispielsweise U-förmigen Kerben, Bohrungen, Enden mit abgewinkelten Stirnflächen und anderen Ausführungen.

Eine klassische Lösung für Standardapplikationen der Antriebstechnik ist der einlagige Smalley-Schnappring.
Sicherheit ohne Nasen und Ösen
Ebenfalls fast schon als Klassiker etabliert haben sich auch die Sicherungsringe der Serie Spirolox, die es in ein- und zweilagigen Ausführungen, mit Durchmessern von 6,0 bis 400 Millimeter und in mehreren Belastungsklassen gibt. Von gewöhnlichen Sicherungsringen unterscheiden sie sich durch den vollständigen Verzicht auf Nasen, Ösen und Bohrungen und – je nach Version – auch Spalte. Da sie also über ihre eigenen Abmessungen hinaus keinen zusätzlichen Platz beanspruchen, erweisen sie sich als Ideallösung bei knapp bemessenen Einbausituationen oder für die Realisierung raumoptimierter Baugruppen. Spirolox-Sicherungsringe liefert TFC serienmäßig für Drehzahlen von bis zu 8.000 U/min. Allerdings: Für High-Speed-Applikationen in der E-Mobility wurden jüngst auch Varianten für Drehzahlen von bis zu 17.000 U/min mit Ablösesicherung entwickelt.
Eigensicherung als Mehrwert
Besonders gut geeignet als Lagesicherung für Anwendungen mit schnell drehenden Wellen wie man sie in vielen Antriebsträngen von Automations-, Automotive- oder Aerospace-Systemen findet, ist auch der Sicherungsring Typ Revolox. Er besteht ebenfalls aus mehrlagigem, gewalztem Flachdraht und ist rundum bündig, hat aber zusätzlich eine Eigensperrung. Diese im angelsächsischen Sprachraum als Dimple- and Slot-Design bezeichnete Lösung besteht aus kleinen, in den Sicherungsring eingearbeiteten Erhebungen, die bei der Montage in wenige Millimeter breite Öffnungen in den oberen und unteren Ringwindungen einrasten. Bei präziser Auslegung verleiht diese integrierte Eigensperrung dem RevoloxRing einen sehr sicheren Sitz in der Nut einer Welle oder eines Bolzens. TFC empfiehlt ihn daher insbesondere für Anwendungen, bei denen sehr hohe Drehzahlen auftreten oder betriebsbedingt mit Vibrationen zu rechnen ist.
Die Drehzahlkapazität eines Revolox-Sicherungsrings liegt signifikant höher als die eines gleichwertigen Sicherungsrings ohne Eigensperrung. Da er laut Hersteller außerdem präziser gewuchtet ist als übliche Spreng- oder Seegerringe, unterstützt er die Rundlaufgenauigkeit einer Welle. Damit lässt sich also der Wunsch nach geringeren Unwuchten der rotierenden Massen umsetzen, der in vielen antriebstechnischen Anwendungen eine Voraussetzung für eine verbesserte Energieeffizienz, eine bessere Performance und längere Standzeiten ist. Insbesondere für High-Speed-Applikationen im Triebwerk- und Motorenbau ist der Revolox-Ring eine gute Wahl.
Integrierte Vorspannung
Ein- oder mehrfach gewunden, spiralförmig und zusätzlich in Wellenform gestaltet ist der Sicherungsring vom Typ Wavering. Über seine Sicherungsfunktion hinaus kann er bidirektionale Vorspannkräfte bereitstellen. Einmal in der Nut platziert, entfaltet er Vorspannkräfte gegen die Wandung der Nut und gegen das vorzuspannende Bauteil. Der Wavering dient unter Beibehaltung seiner Funktion als Lagesicherung und als Element des Toleranzausgleichs. Er kann das freie Spiel in der Baugruppe kompensieren und Vibrationen reduzieren. Außerdem lässt er sich zur Realisierung schwimmender Lagerungen (Stützlagerungen) heranziehen, die immer dann relevant werden, wenn ein kinematisches System mechanisch oder thermisch bedingte Lageänderungen tolerieren soll, die rotierenden Wellen aber nicht verspannen dürfen. Wellen oder Bolzen werden hierbei nicht fixiert, sondern erhalten mit dem Wavering ein definiertes Axialspiel.

Der Sicherungsring vom Typ Wavering kann über seine Sicherungsfunktion hinaus bidirektionale Vorspannkräfte bereitstellen
Prototypen und Sonderwünsche
TFC bietet alle Sicherungsringe in metrischen und zölligen Maßen an. Da ihre Herstellung auf dem No-Tooling-Cost-Verfahren von Smalley beruht – einer Variante der Kantenwindungstechnik – lassen sich konstruktive Anpassungen und Optimierungen an den Sicherungsringen ohne zusätzliche Tools oder Werkzeug-Modifikationen vornehmen. Zudem erlaubt das Verfahren die rasche PrototypenFertigung und die wirtschaftliche Realisierung von Kleinserien und Sonderlösungen.
Julius Moselweiß ist freier Fachjournalist aus Darmstadt.
« KF

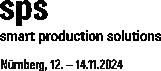
Halle 4 Stand 220
Präzise Achsenpositionierung mit kompakten Direktantrieben
Maße bereits ab 63,5 x 63 x 42 mm bei einem Gewicht von 0,55 kg
• Produktbaukasten mit Nenndrehmomenten von 2 Nm bis 8 Nm
• PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CANopen oder IO-Link
• Galvanische Trennung von Motor und Steuerung
• Flexible Bauform mit einfacher und kostengünstiger Montage
• Präzise Positions-Rückmeldung durch absolutes Messsystem
Entdecken Sie die vielfältigen Varianten unserer Produkte oder fragen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung an.
ENERGIEEFFIZIENTER ANTRIEB AUF DEM PRÜFSTAND
Die aktuell höchste vorgeschriebene Energieeffizienzklasse IE4 für E-Motoren ist für Hersteller in Sachen Wirkungsgrad eine Herausforderung. BEN Buchele entwickelt derzeit für ein Forschungsprojekt im Automobilbereich eine energieeffiziente Alternative: eine Synchronreluktanzmaschine für einen Automobilprüfstand. » VON DETLEF KOSLOWSKY

Beim ersten Prototypen der Synchronreluktanzmaschine wurde unter anderem geprüft, ob Wirkungsgrad, Bemessungspunkt, Drehmoment und Drehzahl, wie vorher ausgelegt, erreicht werden können.
Die Aufgabe: Für ein Querstromfahrtwindgebläse für Fahrtwindsimulationen innerhalb eines Automobilprüfstands sollte ein Antrieb gefunden werden, der die bisherige Ausblasgeschwindigkeit von 160 auf 180 Stundenkilometer steigert – und dies bei gleicher kompakter Baugröße (160) und mit der Auslegung auf Energieeffizienzklasse IE4. Für den robusten Alleskönner Asynchronmotor bedeutete dies einen zu hohen Entwicklungs- und Investitionsaufwand, sodass BEN Buchele die Synchronreluktanzmaschine ins Spiel brachte. Die Technologie ist nicht neu, aber aufgrund ihrer mangelnden Netzanlauffähigkeit und der Notwendigkeit eines Umrichterbetriebs war sie bisher oft nicht erste Wahl. In diesem Projekt spielt sie ihre Vorteile aus.
Spezielle geometrische Strukturen im Rotor Asynchronmotor und Synchronreluktanzmaschine ähneln sich äußerlich, jedoch verfügt der Rotor der Synchronreluktanzmaschine über andere geometrische Strukturen als die Asynchronmaschine. Der Synchronreluktanzmaschine liegt die Reluktanzkraft zugrunde, während das Drehmoment beim Asynchronmotor von der Lorentzkraft erzeugt wird. Das sich drehende Statormagnetfeld induziert eine Spannung im Rotor, ein Strom fließt im Kurzschlusskäfig und verursacht ein Magnetfeld im Rotor, das dem Magnetfeld des Stators folgen möchte, woraus die Drehbewegung entsteht. Im Vergleich ANTRIEBSTECHNIK
zu anderen Maschinentopologien entstehen beim Asynchronmotor größere Verluste, die einen geringeren Wirkungsgrad zur Folge haben. Das System der Synchronreluktanzmaschine strebt immer nach dem geringsten magnetischen Widerstand (Reluktanz) und löst so die Drehbewegung aus. Hier kommen die speziellen geometrischen Strukturen ins Spiel (siehe Grafik): Die Strecken, über die das Magnetfeld verläuft, sind die aus Elektroblech bestehenden Flussführungen, die nur einen geringen magnetischen Widerstand bieten. Die Strecken mit hohem magnetischen Widerstand sind die Flusssperren, die aus einem Material mit einer niedrigen magnetischen Permeabilität bestehen müssen, wie etwa Luft. Bei dieser Strukturanordnung legen sich die Feldlinien des Stators durch die Flussführungen des Rotors, wo sie den geringsten magnetischen Widerstand erfahren. Da sich das Magnetfeld im Stator weiterdreht, verändert sich die Lage in den Flussführungen, sodass sich der magnetische Widerstand erhöht. Um jedoch stets den geringsten rotorlageabhängigen magnetischen Widerstand zu erzielen, wird eine Drehbewegung auch des Rotors erzeugt, der dem Statormagnetfeld folgt. Während der Rotor der Asynchronmaschine asynchron zum Drehfeld des Stators läuft, dreht sich der Rotor bei der Synchronreluktanzmaschine synchron zum Statormagnetfeld. Dadurch treten im Rotor kaum Ummagnetisierungverluste auf, was für die Erreichung der IE4 sehr vorteilhaft ist.
Geringe Verluste, geringe Wärmeerzeugung
Den besseren Wirkungsgrad erzielt die Synchronreluktanzmaschine auch im Teillastbetrieb, was für zahlreiche Anwendungen interessant ist, bei denen die Maschine nicht permanent im Bemessungspunkt, sondern beispielsweise nur bei halber Leistung fährt. Zusätzlich kommt es durch die geringeren Verluste im Rotor auch zu einer geringeren Wärmeerzeugung. Dadurch werden Bauteile weniger erwärmt, wie etwa die Lager, was zu einer längeren Haltbarkeit der Bauteile führt.

Schnittansicht des Synchronreluktanzmotors.
Vorteile gegenüber einer permanenterregten Synchronmaschine
Wenn es um einen hohen Wirkungsgrad bei kompakter Größe geht, erzielt ein permanenterregter Synchronmotor die besten Ergebnisse. Im Vergleich zum Synchronreluktanzmotor ist sein Wirkungsgrad noch einmal höher und zahlt auf Energieeffizienzanforderungen ein. Nachteilig sind hier jedoch zum einen die höheren Kosten, die die enthaltenen Neodym-Magnete verursachen, und zum anderen die mangelnde Verfügbarkeit der den Magneten zugrundeliegenden Seltenen Erden, die zudem Abhängigkeiten von bestimmten Staaten bedeuten. Auch einen technischen Vorteil bietet die Synchronreluktanzmaschine gegenüber der permanenterregten Synchronmaschine: Es tritt kein Rastmoment auf, das bei der permanenterregten Synchronmaschine durch die Magnete entsteht. Dies kann zum Beispiel hinderlich sein, wenn ein solcher Motor als Zweitmotor unterstützend hinzugeschaltet wird, im ausgeschalteten Zustand aufgrund des Rastmoments aber eher bremst und nicht mitdreht. Als Unterstützungsmotor eignet sich hier die Synchronreluktanzmaschine besser. Auch ist ihr Wartungsaufwand deutlich geringer als bei einer permanenterregten Synchronmaschine. Aufgrund der starken Magnete lässt sich der Rotor nur schwer oder mit Spezialwerkzeug ausbauen. Kundenfreundlicher ist es, wenn Motoren auch eigenständig vor Ort gewartet werden können.
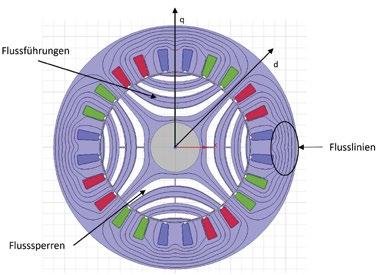
Prototyp im Automobilprüfstand überzeugt
Exemplarischer Flusslinienverlauf bei der Synchronreluktanzmaschine.
Bastian Kohlmann (rechts), Forschung & Entwicklung bei BEN Buchele, erläutert den geometrischen Aufbau der Rotorbleche aus Flussführungen und Flusssperren.
Bilder: BEN Buchele
Elektromotorenwerke

um die Abwägung von Kompromissen zwischen Anforderungen, Machbarkeit und Invest. Wenn es sich beispielsweise nur um einen Kurzzeitbetrieb handelt, etwa bei Ankerwinden oder Kranantrieben, ist ein hoher Wirkungsgrad nicht zielführend, da sich die Kosten nicht amortisieren würden. Eine Asynchronmaschine bliebe hier die effizienteste Lösung. Bei Dauerbetrieb, etwa bei Pumpen, Kompressoren, Turbinen oder Lüftern, geringem Platzangebot und hohen Energieeffizienzanforderungen dagegen ist der Einsatz einer Synchronreluktanzmaschine nach den aktuellen Prüfergebnissen vielversprechend. « KIS
Detlef Koslowsky ist Vertriebsleiter bei Ben Buchele.
Für das Forschungsprojekt Fahrtwindgebläse, das gemeinsam mit dem Institut für leistungselektronische Systeme ELSYS der Technischen Hochschule Nürnberg durchgeführt wird, entpuppte sich die entwickelte Synchronreluktanzmaschine als energieeffiziente, kompakte und leistungsstarke Antriebslösung, die gleichzeitig den hohen Belastungen standhält. Der erste Prototyp, für den das Unternehmen individuelle Rotorbleche lasern ließ, befindet sich auf dem Prüfstand und wird elektrisch vermessen. So wird geprüft, ob Wirkungsgrad und Bemessungspunkt, Drehmoment und Drehzahl, wie vorher ausgelegt, erreicht werden können. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend und bilden die Basis für weitere Antriebsprojekte mit Synchronreluktanzmaschinen.
Gefragt sind Synchronreluktanzmaschinen überall dort, wo es im S1-Betrieb auf einen hohen Wirkungsgrad bei kleiner, kompakter Baugröße ankommt. Einstige Hemmschuhe wie der Umrichterbetrieb sind zu vernachlässigen, da sich die Umrichtertechnik ebenso wie die Regelungstechnik für den Betrieb der Synchronreluktanzmaschine weiterentwickelt haben.
Zielkonflikte abwägen
Um einen passenden Antrieb für die jeweilige Anwendung zu finden, geht es in der Beratungspraxis des Unternehmens immer


ANTRIEBSTECHNIK
Die neuentwickelte Prothese D-Ankle von Design Pro Technology verhilft unterschenkelamputierten Menschen wieder zu einem natürlichen Gang.
Bild: Design Pro Technology Ankle prothetics
NATÜRLICHER GANG TROTZ BEINPROTHESE
Steife Beinprothesen, wie das aus Piratenfilmen bekannte Steckbein, gehören glücklicherweise der Vergangenheit an. Heutzutage ermöglichen moderne Unterschenkel-Prothesen biomechanisch korrekte Bewegungen bei jedem Schritt und in jedem Gelände. Eine intelligente Steuerung findet dabei den passenden Rhythmus. Für den Antrieb sorgt ein kleiner, aber kräftiger DC-Servomotor. » VON ELLEN-CHRISTINE REIFF UND ALEX HOMBURG
Moderne Prothesen verfügen über Gelenke, Steuerungsalgorithmen und federnde Elemente aus HightechMaterialien. Das Gangbild kommt mit ihrer Hilfe dem natürlichen oft schon recht nahe. Manche sind sogar für Höchstleistungen ausgelegt: Unterschenkelamputierte Athleten mit Karbonprothesen erzielen auf der Kurzstrecke hervorragende Laufzeiten. Solche Sportprothesen sind aber für schnelles Laufen konzipiert, dagegen ist das Stillstehen und die Ausübung normaler Tätigkeiten mit ihnen schwierig oder sogar unmöglich. Knöchelgelenksprothesen für den Alltagsgebrauch sind daher völlig anders konstruiert und entsprechen eher der natürlichen Anatomie: Sie bestehen aus einer Unterschenkel- und einer Fußkomponente, die über ein Gelenk miteinander verbunden sind. Das passive künstliche Knöchelgelenk hält die Prothese immer in einer vorhersehbaren Position, bietet aber nur einen sehr begrenzten Bewegungsspielraum bei der Fortbewegung.
„Beim Abrollen des Fußes in der Vorwärtsbewegung wird der Fuß in Richtung Unterschenkel gedrückt; beim Abstoßen wird der Fuß durch die elastische Kraft wieder in eine nahezu senkrechte, feste Ausgangsposition gebracht“, erklärt Marcin Dziemianowicz, der 2016 im polnischen Białystok die Firma Design Pro Technology gegründet hat. Mit einem interdisziplinären Team aus Ingenieuren, Orthopädietechnikern, Ärzten und Designern entwickelt und fertigt das Medizintechnikunternehmen individuelle orthopädische Hilfsmittel auf dem neuesten Stand der verfügbaren Technologie. Dziemianowicz fährt fort: „Diese feste Ausgangsposition konventioneller Knöchelgelenksprothesen entspricht aber nicht der natürlichen Stellung des Fußes während der Transferphase, also wenn der Fuß vom Boden abhebt. Es besteht also die Gefahr, dass die Prothesenfußspitze am Boden oder an kleineren Hindernissen hängenbleibt“. Mit dem neuen Produkt D-
Ankle hat Design Pro Technology eine Knöchelgelenksprothese entwickelt, die den Fuß beim Gehen mit einem Motor aktiv bewegt und im Verlauf jedes Schrittes in einer anatomisch natürlichen Position hält.
Unterstützung in der Schwung- und Stützphase Entscheidend dabei ist die sogenannte Dorsalflexion, also das Anwinkeln des Fußes in Richtung Schienbein während der Schwungphase. „So ist der Abstand zwischen Zehenspitzen und Boden größer, und die Stolpergefahr sinkt“, erklärt Dziemianowicz. „Bei einer passiven Prothese macht der Träger eine kreisende Bewegung mit der Hüfte oder hebt das Bein höher an, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Ausweichbewegungen sind mit unserer Prothese überflüssig; das Gehen wird natürlicher und weniger anstrengend.“
Wird der Prothesenfuß aufgesetzt, ändert sich für die Stützphase der Winkel ebenfalls; das Gelenk wird durch Motorkraft entsprechend gestreckt (Plantarflexion). Auch das trägt zu einem harmonischen Gangbild bei und spart Kraft. Lediglich die seitlichen Bewegungen, die ein natürliches Sprunggelenk zulässt, kann das künstliche nicht ausführen. Sie werden stattdessen als passive Verformung durch das elastische Kohlefaser-Material des Prothesenfußes ermöglicht. So hat der Fuß auch bei unebenem Boden vollen Sohlenkontakt.
Der bürstenloser DCMotor BP4 erlaubt eine Betriebszeit von 12 Stunden mit einer Batterieladung.
Bild: Faulhaber

Immer die optimale Fußstellung
Damit das funktioniert, verarbeitet die in der Prothese integrierte Steuerung die Signale mehrerer Sensoren, um die verschiedenen Phasen eines Schrittzyklus zu unterscheiden. Ein Potenziometer misst den Winkel zwischen Fuß und Unterschenkel; ein bilateraler Drucksensor erfasst die Belastung beim Auftreten des Fußes sowie die Entlastung in der Transferphase. Ein Beschleunigungsmesser erfasst die Gesamtbewegung einschließlich Geschwindigkeit, Fußneigung und Steigung des Weges. „Ein Algorithmus führt die Signale der jeweils letzten Schritte zusammen und wertet sie aus“, erläutert Dziemianowicz die Funktionsweise. „Aus diesen Daten wird dann der Gangrhythmus und für jede Schrittphase die optimale Stellung des Fußes abgeleitet. Zum Beispiel wird das Sprunggelenk beim Bergaufgehen stärker angewinkelt als auf

Dorsal- und Plantarflexion sorgen für ein natürliches Gangbild.
Bild: Design Pro Technology Ankle prothetics
ebenem Boden und auch die Abstoßkraft wird größer, damit man den Anstieg leichter bewältigt. Beim Bergabgehen ist es andersherum, um einen möglichst guten Kontakt zwischen Sohle und Boden zu erreichen. Außerdem lassen sich mit einer Smartphone-App Parameter wie die Abstoßkraft, die Empfindlichkeit des Drucksensors oder die Länge einer Schrittzyklusphase individuell anpassen.“
DC-Servomotor als treibende Kraft Ein integrierter Elektroantrieb sorgt für die Umsetzung der Steuerungssignale in die entsprechende Bewegung. Sein Kernstück ist ein bürstenloser Motor der Serie BP4 von Faulhaber, dessen Kraft auf eine Spindel übertragen wird. Motor und Spindel drehen in beide Richtungen und erzielen so die aktive Dorsal- und Plantarflexion des Fußes. Die hohe Energieeffizienz des Antriebs erlaubt eine Betriebszeit von 12 Stunden mit einer Batterieladung. Der Motor toleriert auch
die erhebliche Wärmeentwicklung, die im Alltagsbetrieb auftreten kann.
„Unsere Vorgaben waren insgesamt ziemlich sportlich“, erinnert sich Marcin Dziemianowicz. „Der Motor sollte in der Lage sein, eine Jogging-Bewegung mitzumachen, bei drei Schritten pro Sekunde also dreimal den kompletten Ablauf mit Dorsal- und Plantarflexion. Außerdem sollten schnelle Tempo- und Richtungswechsel möglich sein. Die Anwendung erfordert also eine sehr hohe Geschwindigkeit und hohes Drehmoment und das bei möglichst geringem Volumen und Gewicht.“ Und hier konnte der BP4-Motor punkten. Der kleine DC-Servomotor bringt weniger als die Hälfte an Gewicht auf die Waage als herkömmliche Motoren mit vergleichbarem Leistungsvermögen. Der Grund für die hohe Leistungsdichte und zugleich das Herzstück des Motors ist die Segment-Wicklung der Spule: Einzeln gewickelte Segmente werden überlappend ineinandergesteckt. Dadurch lässt sich in der Spule eine besonders große Menge Kupfer unterbringen. Der hohe Kupferanteil steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Weitere erwünschte Nebeneffekte dieses Spulenaufbaus sind eine hohe Wicklungssymmetrie mit minimalen Stromverlusten und ein entsprechend hoher Wirkungsgrad. „Wir haben verschiedene Antriebslösungen von führenden Motorherstellern ausprobiert. Bei Faulhaber haben wir dann nicht nur das am besten passende Produkt, sondern auch kompetente technische Unterstützung bekommen,“ ergänzt Marcin Dziemianowicz.
Auch mit Damenschuh tragbar
Nach ausgiebigen und erfolgreichen Versuchsreihen mit zahlreichen Probanden wurde die Fußprothese Ende 2023 auf den Markt gebracht. Sie kann mit ihrem Standardadapter an jedem modularen Prothesenschaft befestigt werden und wird individuell vom Orthopädietechniker angepasst. Die Höhe der Ferse lässt sich variieren, sodass D-Ankle auch in einem Damenschuh mit Absatz getragen werden kann. Sollte die Batterieladung nach einem sehr langen Tag einmal nicht reichen, kann der Träger trotzdem wie auf einer passiven Prothese weiter gehen. „Nach den positiven Erfahrungen mit dem kompakten DC-Motor und der guten Zusammenarbeit mit Faulhaber haben wir einige Ideen, diese oder ähnliche Antriebslösungen auch in anderen Prothesen zu nutzen“, erklärt Dziemianowicz abschließend. « KF
Ellen-Christine Reiff und Alex Homburg, Redaktionsbüro Stutensee.
IMPRESSUM
Herausgeber und Geschäftsführer: Matthias Bauer, Günter Schürger
Das Sonderheft Antriebstechnik wird herausgegeben vom DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN: http://www.digital-engineering-magazin.de
So erreichen Sie die Redaktion: Chefredaktion: Rainer Trummer (v.i.S.d.P.), (089-3866617-10, rainer.trummer@win-verlag.de)
Redaktion: Karin Faulstroh (karin.faulstroh@win-verlag.de), Tino M. Böhler (tino.boehler@win-verlag.de), Kirsten Seegmüller (externe Mitarbeiterin, kirsten.seegmueller@extern.win-verlag.de)
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Thomas Bayer, Christian Becker, Torsten Blankenburg, Marcel Geurts, Claudia Grotzfeld, Jennifer Hagmeyer, Alex Homburg, Sven Karpstein, Bernd Klöpper, Detlef Koslowsky, Martin Leahy, Jan Möller, Julius Moselweiß, Hans-Joachim Müller, Ellen-Christine Reiff, Anja Schaber, Tim Schöllmann, Patrick Schumacher, Leslie Wenzler
So erreichen Sie die Anzeigenabteilung: Anzeigengesamtleitung: Martina Summer (089-3866617-31, martina.summer@win-verlag.de), Anzeigen verantwortlich
Mediaberatung: Michael Nerke (Anzeigenverkaufsleiter, Tel.: 089-3866617-20, michael.nercke@win-verlag.de), Andrea Lippmann (Tel.: 089-3866617-22, andrea.lippmann@win-verlag.de), Matthias Hofmann (Tel.: 089-3866617-21, michael.hofmann@win-verlag.de) Anzeigendisposition: Chris Kerler (089/3866617-32, dispo@win-verlag.de), Sabine Immerfall (089/3866617-33, dispo@win-verlag.de)
So erreichen Sie den Abonnentenservice: WIN-Verlag GmbH & Co. KG, Max-Planck-Str. 7/9, 97070 Würzburg
Tel: +49 89 3866617 46
Fax: +49 89 3866617 47
E-Mail: abovertrieb@win-verlag.de
Vertrieb: Sabine Immerfall (089/3866617-33, sabine.immerfall@win-verlag.de)
Artdirection und Titelgestaltung: Saskia Kölliker Grafik, München Bildnachweis/Fotos: falls nicht gekennzeichnet: Werkfotos, AdobeStock, aboutpixel.de, pixelio.de, shutterstock.com, fotolia.de
Titelbild: Maxon Group Germany Druck: Holzmann Druck GmbH & Co KG, Bad Wörishofen Produktion und Herstellung: Jens Einloft (089/3866617-36, jens.einloft@win-verlag.de) Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle Verantwortlichen: WIN-Verlag GmbH & Co. KG, Balanstraße 73, Gebäude 21A 81541 München, Tel.: 089-3866617-0
Verlagsleitung: Martina Summer (089/3866617-31, martina.summer@win-verlag.de) Objektleitung: Rainer Trummer (089/3866617-10, rainer.trummer@win-verlag.de) Bezugspreise: Einzelverkaufspreis: 14,40 Euro in D, A, CH und 16,60 Euro in den weiteren EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Jahresabonnement (8 Ausgaben): 115,20 Euro in D, A, CH und 132,80 Euro in den weiteren EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Vorzugspreis für Studenten, Schüler, Auszubildende und Wehrdienstleistende gegen Vorlage eines Nachweises auf Anfrage. Bezugspreise außerhalb der EU auf Anfrage.
26. Jahrgang
Erscheinungsweise: achtmal jährlich
Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden gerne von der Redaktion entgegen genommen. Die Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der Verfasser, dass die Einsendungen frei von Rechten Dritter sind und nicht bereits an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblicher Nutzung angeboten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der Erfüllung der Honorarvereinbarung ist die gesamte, technisch mögliche Verwertung der umfassenden Nutzungsrechte durch den Verlag – auch wiederholt und in Zusammenfassungen – abgegolten. Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann trotz Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden.
Copyright © 2024 für alle Beiträge bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere der Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen elektronischen Datenträgern.
ISSN 1618-002X, VKZ B 47697
Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
Außerdem erscheinen bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG: AUTOCAD Magazin, BAUEN AKTUELL, DIGITAL BUSINESS CLOUD, DIGITAL MANUFACTURING, DIGITAL PROCESS INDUSTRY, e-commerce Magazin, r.energy, DIGITAL HEALTH INDUSTRY
ÜBER QR-CODE SCHNELL ZU DIGITALEN SERVICES
Wie kommen Kunden schnell und einfach an die Handover-Dokumentation eines Antriebsreglers, Motors oder Getriebes?
Dazu stattet Stöber die Typenschilder seiner Komponenten mit einem QR-Code aus, den die Nutzer scannen können.
Im Anschluss laden sie die gewünschten Dokumente direkt herunter. Ein weiterer digitaler Service ist der Configurator:
Mit wenigen Klicks ist der Kunde in der Lage, die passende Antriebslösung aus dem Produktprogramm online zusammenzustellen. » VON CLAUDIA GROTZFELD
Stöber geht konsequent den Weg in Richtung digitaler Zwilling und bietet jetzt schon einen umfangreichen digitalen Service: Über einen QR-Code am Typenschild des jeweiligen Produkts ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, schnell auf relevante Informationen zugreifen zu können. Damit vereinfacht der Antriebsspezialist die Suche nach Betriebsund Montageanleitungen, Ersatzteillisten oder Hinweisen zu technischen Merkmalen eines bestimmten Systems oder einer Komponente. Nach dem Scannen des QRCodes werden die Nutzer zum Produktausweis weitergeleitet, der all diese Informationen bündelt. Möglich ist – neben der Eingabe der Serialnummer – auch die Suche über Lieferschein- oder Rechnungsnummer. Alternativ ist der Produktausweis auf der Website verfügbar.
STÖBER GEHT KONSEQUENT
DEN WEG IN RICHTUNG DIGITALER ZWILLING UND BIETET JETZT SCHON EINEN UMFANGREICHEN DIGITALEN SERVICE.
JEDE KONFIGURATION
WIRD DURCH VIRTUELL DREHBARE CAD-MODELLE VISUALISIERT. MASCHINENBAUER KÖNNEN SO IM VORFELD BEISPIELSWEISE DIE EINBAULAGE IHRES GETRIEBEMOTORS KONTROLLIEREN.
Produktauswahl wird zum Kinderspiel Ein weiterer Service, den der Pforzheimer Antriebsspezialist anbietet, ist der Configurator. Mit diesem Online-Tool stellen Anwender intuitiv mit wenigen Klicks die passende Antriebslösung aus dem umfangreichen Produktprogramm zusammen. Dafür stehen ihnen zahlreiche Filter und Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können die Baureihen nach dem günstigsten Preis, der Leistung oder Baugröße sortieren. Je nach Filtereinstellungen zeigt das Programm automatisch den besten Treffer an, der sich anschließend passgenau konfigurieren lässt. Komfortabel: Jede Konfiguration wird durch virtuell drehbare CAD-Modelle visualisiert. Maschinenbauer können so im Vorfeld

Mit dem Stöber-Configurator kann der Anwender in Echtzeit seine passende Antriebslösung mit wenigen Klicks zusammenstellen.
Stöber


Über einen QR-Code am Typenschild können Kunden schnell auf relevante Informationen zugreifen.
beispielsweise die Einbaulage ihres Getriebemotors kontrollieren. Sie erhalten zudem unmittelbaren Zugang zu den zugehörigen technischen Datenblättern sowie zu entsprechenden Maßzeichnungen. Sie können sich registrieren und ein Angebot anfordern, die fertige Auswahl speichern oder mit anderen Personen teilen. Damit wird die optimale Produktauswahl zum Kinderspiel. « TB
Claudia Grotzfeld ist Abteilungsleiterin Technische Redaktion bei Stöber Antriebstechnik.
MIT DEM STÖBER-CONFIGURATOR STELLEN ANWENDER INTUITIV MIT WENIGEN KLICKS DIE PASSENDE ANTRIEBSLÖSUNG AUS DEM UMFANGREICHEN PRODUKTPROGRAMM ZUSAMMEN.
Abonnieren Sie den WIN-verlagsübergreifenden
KI Newsletter!

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt der Künstlichen Intelligenz. Unser kostenfreier Newsletter vom WIN-Verlag wird monatlich an 15.000 Empfänger versendet und bietet Ihnen spannende Einblicke, exklusive Inhalte und Expertenmeinungen der verschiedenen Branchen.

Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie keine Ausgabe!

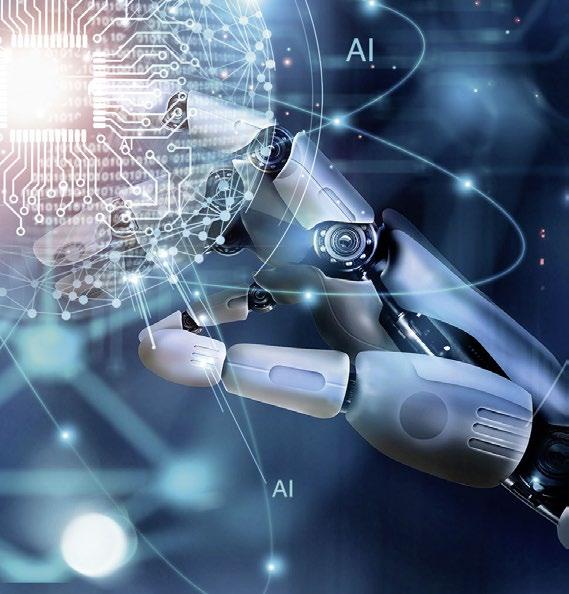


SONDERHEFT
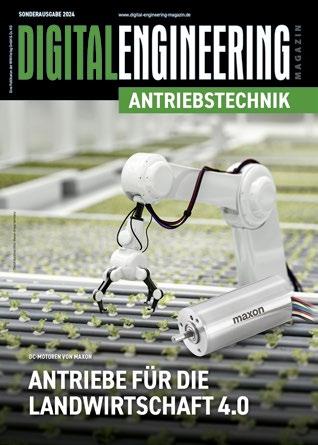
SichernSiesich jetztschoneinenPlatz fürdieAusgabe in2025!
Kennen Sie schon unser Sonderheft
Antriebstechnik vom DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN?
Systeme und Komponenten
• Erscheinungstermin: 27. Oktober 2025
• Redaktionsschluss: 29. September 2025
• Anzeigenschluss: 09. September 2025
• Verteilung: Heftauslage auf Veranstaltungen und als digitale Ausgabe. Beilage in der Ausgabe 7/25 vom DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN, ePaper-Vollversion auf www.digital-engineering-magazin.de, Abonnenten, Heftauslage auf Veranstaltungen und als digitale Ausgabe (ePaper)
Die Mediadaten unseres Sonderhefts Antriebstechnik finden Sie hier:
