

Mit SAP Digital Manufacturing zur digitalen Fabrik
Abonnieren Sie den WIN-verlagsübergreifenden
KI Newsletter!

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt der Künstlichen Intelligenz. Unser kostenfreier Newsletter vom WIN-Verlag wird monatlich versendet und bietet Ihnen spannende Einblicke, exklusive Inhalte und Expertenmeinungen der verschiedenen Branchen.

Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie keine Ausgabe!

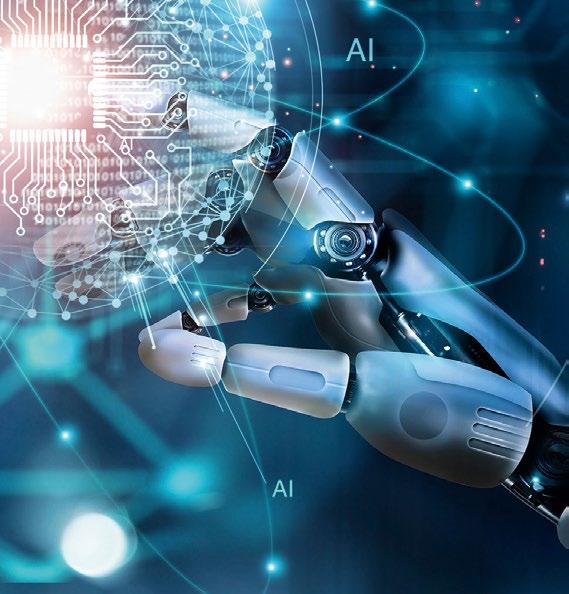
win-verlag.de

Weichenstellung für die digitale Fertigung
Liebe Leserinnen und Leser,
die Fertigungsindustrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, Automatisierung und datenbasierte Prozesse sind längst keine Zukunftsmusik mehr – sie sind Realität. SAP spielt dabei eine wichtige Rolle. Beispielsweise stehen mit SAP S/4HANA, SAP Digital Manufacturing (DM) und SAP Extended Warehouse Management (EWM) leistungsstarke Werkzeuge bereit, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten.
Doch der Weg zur digitalen Produktion ist komplex. Im Zentrum steht die Datenqualität: Ohne verlässliche, konsistente Stammdaten bleibt das Potenzial von SAP S/4HANA unerreicht. Unternehmen, die ihre Datenlandschaft jetzt systematisch bereinigen und harmonisieren, schaffen die Grundlage für reibungslose Abläufe und automatisierte Entscheidungen.
Aber es zeigt sich auch: Die Einführung von SAP Digital Manufacturing ist mehr als nur ein IT-Projekt. Sie erfordert ein tiefes Verständnis der Fertigungsprozesse, enge Abstimmung zwischen IT und Produktion – und einen klaren Fahrplan. Wer hier vorausschauend plant, kann von Echtzeittransparenz, Effizienzgewinnen und höherer Flexibilität profitieren.
Auch in der Intralogistik verändert sich vieles. Automatisierung mit SAP EWM steigert nicht nur die Geschwindigkeit und Präzision, sondern sorgt für nahtlose Integration zwischen Lager und Produktion.
Dieses Sonderheft beleuchtet die wichtigsten Handlungsfelder und liefert praxisnahe Einblicke, wie der Umstieg auf SAP S/4HANA oder die Implementierung von SAP Digital Manufacturing (SAP DM) gelingen kann.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!
Rainer Trummer Chefredakteur



Produktion und ERP lückenlos vernetzen.




Datenqualität für die digitale Transformation.
Systematisch und umfassend: simus classmate analysiert und strukturiert Daten aus ERP-, PLM- und CAD-Systemen und bereitet sie bestmöglich für weiterführende Prozesse auf. www.simus-systems.com/ produkte


BESUCHEN SIE DIGITAL MANUFACTURING
AUCH AUF FACEBOOK, X, XING UND LINKEDIN. Entwicklung,




16
EXPERTENUMFRAGE:
SAP-LÖSUNGEN FÜR DIE PRODUKTION
Das Lösungsportfolio von SAP umfasst alle Bereiche der Lieferkette und schließt dabei die Produktion als wesentlichen Teil der Wertschöpfung ein. Die Nutzung in der Cloud erleichtert die Integration der verschiedenen Segmente, doch speziell im Fertigungsbereich kann der Wechsel in die Cloud aufgrund spezifischer Anforderungen oder Schnittstellen herausfordernd sein. Was die aktuellen Herausforderungen sind und was besonders KMU bei der Umstellung auf SAP beachten sollten, erklären uns elf SAP-Experten.
Bild: © Gorodenkoff/stock.adobe.com
News
Aktuelles aus der Branche 5
Titelstory: IGZ-Branchenlösungen auf Basis von Best Practices
Mit SAP Digital Manufacturing zur digitalen Fabrik 6
Die Rolle von SAP in der digitalen Produktion Zwischen Kosten und Innovationsdruck 9
Optimierung der Datenqualität für SAP S4/HANA
S/4HANA: Mit neuer StammdatenStruktur sicher in die Migration 12
Expertenumfrage: SAP-Lösungen in der Fertigungsindustrie „Realistisch planen und schrittweise vorgehen“ 16
Digitale Transformation Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation im Shopfloor 22
SAP DM-Implementierung Sieben Herausforderungen und Erfolgsfaktoren 26
Effiziente Produktionsplanung
Face Value: KI optimiert Vorgabezeiten automatisch 30
Vorteile einer hybriden Strategie mit einem Subsystem S/4HANA-Migration und Digitalisierung im Gleichschritt 34
Wie SAP und DMS/QMS industrielle Workflows optimieren Erfolgsduo für die Industrie 36

SAP DM-IMPLEMENTIERUNG: SIEBEN HERAUSFORDERUNGEN UND ERFOLGSFAKTOREN
Die sieben Hauptherausforderungen bei der Implementierung von SAP DM umfassen strategische Abstimmung zwischen IT und OT, Überwindung der ITKomplexität, Ausbau von Kompetenzen, realistische Planung, agile Umsetzung, Post-Go-Live-Betreuung und ChangeManagement. Die erfolgreiche Einführung erfordert eine strategische Planung und den Einbezug technischer, organisatorischer und personeller Faktoren.
Bild: © canva.com

Lagerautomatisierung mit SAP EWM Schlüsseltechnologie für die Logistik der Zukunft 38
Kreislaufwirtschaft in der Industrie Wie SAP die digitale Fertigung zirkulär macht 40
SAP Security in der Praxis SAP Security –in vier Schritten zum Erfolg 43 Transition der SAP-Systeme Wie der Umstieg auf SAP S/4HANA gelingt 45
REDAKTIONELL ERWÄHNTE INSTITUTIONEN, ANBIETER UND VERANSTALTER
Abat S. 45, Arvato Systems S. 43, CBS S. 30, Consilio S. 16, DSAG S. 5, 9, 17, Fabasoft Approve S. 17, 36, Flexus S. 38, Forcam Enisco S. 17, 26, IDAP S. 18, IGZ S. 6, Membrain S. 22, MHP S. 19, NTT Data Business Solutions S. 19, Quality Miners S. 20, 34, SAP S. 40, Simus Systems S. 12, Swan S. 20, T.CON S. 21, Trebing + Himstedt S. 18, 30
3
TITELSTORY: MIT SAP DM ZUR DIGITALEN FABRIK
Hersteller aus der Prozessindustrie stehen vor der großen Aufgabe, ihre Produktion noch stärker auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz auszurichten, um den wachsenden Regularien und Marktanforderungen gerecht zu werden. SAP Digital Manufacturing (SAP DM) bietet eine durchgängige, intelligente Produktionsumgebung. IGZ ergänzt dies mit vorgefertigten Branchenlösungen, um neue digitale Standards schneller einzuführen. SEITE 6
TITELANZEIGE: IGZ
MIT SAP DIGITAL MANUFACTURING ZUR DIGITALEN FABRIK
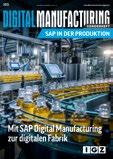
Hersteller aus der Prozessindustrie stehen vor der großen Aufgabe, ihre Produktion noch stärker auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz auszurichten, um den wachsenden Regularien und Marktanforderungen gerecht zu werden. SAP Digital Manufacturing (SAP DM) bietet eine durchgängige, intelligente Produktionsumgebung. IGZ ergänzt dies mit vorgefertigten Branchenlösungen, um neue digitale Standards schneller einzuführen.
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH Logistikweg 1
95685 Falkenberg, Deutschland Telefon: +49 (0) 96 37 / 92 92 - 0
E-Mail: info@igz.com www.igz.com
DSAG-INVESTITIONSREPORT 2025
Investitionsbereitschaft wächst
Auch in diesem Jahr hat die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) wieder nach den Investitionsplanungen der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt. Zentrale Ergebnisse: Die generelle Investitionsbereitschaft in IT-Lösungen und auch in SAP-Lösungen steigt weiter. Bezogen auf die SAP-Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Lösungen SAP Business Suite, SAP S/4HANA On-Premises und S/4HANA Cloud zeigt sich, dass S/4HANA weiterhin an Bedeutung gewinnt. Gleiches gilt für RISE und GROW with SAP.
Die Ergebnisse des diesjährigen DSAG-Investitionsreports zeigen eine zunehmende Bereitschaft der Unternehmen, in zukunftsweisende Technologien und SAP-Lösungen zu investieren. Besonders hervorzuheben ist der signifikante Trend zur Cloud. Auch die steigende Bedeutung von KI und Cybersecurity unterstreicht die aktuellen Herausforderungen und Chancen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind. Die Verschiebung hin zu einer verstärkten Cloud-Nutzung, die positive Ent-
Würzburger Pioniergeist trifft auf globale Intralogistik
30 Jahre Flexus AG
Dreißig Jahre Unternehmensgeschichte in der schnelllebigen ITund Logistikwelt sind selten. Wer so lange Bestand hat, braucht mehr als Software – Haltung, Ausdauer und die Fähigkeit, sich stetig neu zu erfinden. Die Flexus AG aus Würzburg verkörpert genau das. 1995 von Stefan Popp, damals Ingenieur bei Siemens, gegründet, startete das Unternehmen als Spezialist für SAP-Add-ons und ist heute ein international gefragter Enabler für digitale und automatisierte Intralogistiklösungen – von SAP-Systemen über eigene mobile Anwendungen bis hin zu Cloud-Lösungen und hybriden Flottensteuerungen.

ter und nachhaltiger zu gestalten. Daraus entstand eine Kultur, die Innovation direkt aus der Praxis entwickelt. Lösungen greifen nahtlos in SAP-Umgebungen und sprechen die Sprache der Intralogistik – von SAP Warehouse Management (EWM) über Yard Management bis zu komplexen Flottensteuerungen für autonome Fahrzeuge.
Technologische Exzellenz und soziale Verantwortung

Laut dem DSAG-Investitionsreport 2025 steigt die generelle Investitionsbereitschaft in IT-Lösungen und insbesondere in SAP-Lösungen weiter.
wicklung der S/4HANA-Cloud-Strategie sowie die wachsende Bedeutung von KI spiegeln die Dringlichkeit wider, sich technologisch weiterzuentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig zeigt sich ein zunehmend differenziertes Bild zwischen großen und kleinen Unternehmen, was die Ressourcen für digitale Transformation betrifft.
Popp brachte Pioniergeist, Durchhaltevermögen und den Willen mit, Lager- und Transportprozesse effizienter, transparen-
Trotz Internationalisierung ist Flexus ein Familienunternehmen geblieben. Entscheidungen werden langfristig getroffen, Mitarbeitende als Menschen gesehen. Die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich beweist: Produktivität bemisst sich an Motivation, Kreativität und Effizienz,
nicht an Präsenz. Technologische Exzellenz und soziale Verantwortung bilden die Grundlage nachhaltigen Erfolgs.
Kunden wie KNOLL Maschinenbau, Swiss Krono Group, Mann + Hummel, Brose, Kautex, Coca-Cola, Daimler oder Heraeus – nur ein kleiner Ausschnitt aus der nationalen und internationalen Kundenliste – vertrauen auf Flexus.

Besonders sichtbar wird die Kompetenz beim hybriden Flottenmanagement: Mit der preisgekrönten Lösung FlexGuide4, Gewinner des SAP Innovation Award 2025, orchestrieren Unternehmen autonome Roboter, klassische Stapler und fahrerlose Transportsysteme zu einer flexiblen Flotte. Themen der Zukunft – KI-gestützte Logistik, autonome Lagerprozesse, CO₂neutrale Lieferketten – werden genau dort entwickelt, wo Flexus zu Hause ist: im Spannungsfeld zwischen SAP-System, Lagerhalle und Mensch.
Mehr Informationen: www.flexus.de
Bild: © Angelov/stock.adobe.com
ANZEIGE
Stefan Popp ist CEO der Flexus AG. Bild: Flexus AG
Mit SAP Digital Manufacturing zur digitalen Fabrik

Hersteller aus der Prozessindustrie stehen vor der großen Aufgabe, ihre Produktion noch stärker auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz auszurichten, um den wachsenden Regularien und Marktanforderungen gerecht zu werden. SAP Digital Manufacturing (SAP DM) bietet eine durchgängige, intelligente Produktionsumgebung. IGZ ergänzt dies mit vorgefertigten Branchenlösungen, um neue digitale Standards schneller einzuführen. VON SEBASTIAN KLASZKA
SAP Digital Manufacturing (SAP DM) ist das Herzstück des „Design-toOperate“-Lösungsportfolios der SAP und bietet eine durchgängige, intelligente Produktionsumgebung. Durch Echtzeit-Transparenz und nahtlose Integration mit SAP S/4HANA und SAP Extended Warehouse Management (EWM) ermöglicht SAP DM eine zentrale Datennutzung, Prozesssicherheit und Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. IGZ ergänzt dies mit vorgefertigten Branchenlösungen wie FILL+PACK für Abfüll- und Verpackungsprozesse, zum Beispiel für die Getränkeund Chemieindustrie, und FLOW+PACK für kontinuierliche Prozesse, beispielsweise für die Süßwarenindustrie, um neue digitale Standards schneller einzuführen.
SAP DM sorgt für Effizienz, Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit
SAP Digital Manufacturing bietet Unternehmen der Prozessindustrie zahlreiche Vorteile, die über Effizienzsteigerungen hinausgehen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen:
1.
Echtzeit-Transparenz und Prozesssicherheit: SAP Digital Manufacturing bietet Produktions- und Werksleitern über konfigurierbare Dashboards Echtzeit-Transparenz zu KPIs über den aktuellen Produktionsfortschritt und zu Maschinenzuständen, wodurch fundierte Entscheidungen und schnelle, datenbasierte Reaktionen ermöglicht werden.
SAP DIGITAL MANUFACTURING BIETET UNTERNEHMEN DER PROZESSINDUSTRIE ZAHLREICHE VORTEILE, DIE ÜBER EFFIZIENZSTEIGERUNGEN HINAUSGEHEN.
Schichtleiter profitieren vom REO-Modul (Resource Orchestration), das ein flexibles Ein- beziehungsweise Umplanen von Aufträgen erlaubt und so eine optimale Auslastung hochautomatisierter Anlagen sicherstellt.
Produktionsmitarbeiter an der Linie profitieren von benutzerfreundlichen Werker-
Terminals, die Rezepturen und Arbeitsanweisungen digital anzeigen und durch Plausibilisierungsmaßnahmen, kombiniert mit vorkonfigurierten Verriegelungsmechanismen, absolute Prozesssicherheit gewährleisten.
2.Rückverfolgbarkeit: Gerade in sensiblen Branchen wie der Lebensmitteloder Chemieindustrie ist die Rückverfolgbarkeit von Produkten und eingesetzten Rohstoffen ein wesentliches Kriterium, das erfüllt werden muss. SAP DM bietet hierfür die notwendigen Funktionen, um eine durchgängige und vollständige SAP-Endto-End-Rückverfolgbarkeit von eingesetzten Produktionschargen und Rohstoffen sicherzustellen.
3.Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung: SAP DM optimiert Energie- und Materialverbräuche, reduziert Abfälle und Ausschuss durch integrierte Qualitätssicherung und OEE-Analysen. Dies senkt Kosten und ermöglicht die Umsetzung nachhaltiger Produktionsziele, wodurch Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck verringern können.
Titelstory: IGZ-Branchenlösungen auf Basis von Best
IGZ Best Practices: Produktion und Qualität auf ein neues Level heben
IGZ bietet basierend auf SAP DM mehrere vorkonfigurierte Branchenlösungen für verschiedene Prozesse und Anforderungen der Prozessindustrie. Dies verkürzt die Realisierungszeit der SAP DM-Einführung und sorgt für eine sichere Projektumsetzung.
IGZ BIETET BASIEREND AUF SAP DM MEHRERE VORKONFIGURIERTE BRANCHENLÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENE PROZESSE UND ANFORDERUNGEN DER PROZESSINDUSTRIE.
FILL+PACK – die Lösung für automatische Abfüll- und Verpackungsprozesse: Diese Lösung hat ihren Schwerpunkt in der Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgüterindustrie und ist auf die besonderen Anforderungen von automatischen Abfüllund Verpackungsprozessen zugeschnitten. FILL+PACK ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und unterstützt die Erfassung zentraler Leistungskennzahlen wie OEE (Overall Equipment Effectiveness), bietet die Möglichkeit einer Auftragsfeinsteuerung sowie erweiterte Leitstandsfunktionalitäten. Dadurch lässt sich der gesamte Produktionsprozess in Echtzeit überwachen und optimieren.
FLOW+PACK – die Lösung für kontinuierliche Fließprozesse: FLOW+PACK ist ideal für die Automatisierung von verketteten Produktionslinien, wie sie zum Beispiel in der Süßwarenherstellung zu finden sind. Mit Funktionen wie einem vorkonfigurierten Leitstand und Echtzeit-Qualitätsprüfungen sorgt diese Best Practice dafür, dass
Kraiburg TPE: SAP DM ermöglicht ein digitales Auftragsmanagement, verkürzte Rüstzeiten und eine optimale Auslastung.
Bild: IGZ

Produktionsfortschritt und Produktqualität jederzeit transparent und kontrollierbar bleiben. Notwendige papierbasierte Prozesse zur Qualitätsdatenrückmeldung entfallen, und die papierlose Fertigung wird Realität.
Electronic Work Instruction (EWI) – die Lösung für Bulk-/ Herstellprozesse: EWI bietet eine dynamische Online-Werkerführung mittels detaillierten Prozessvorgaben und Phasen auf Basis des Prozessauftrages, die die Produktionsmitarbeiter strukturiert und sicher durch komplexe Herstellprozesse leitet. Integrierte Qualitätsprüfungen sorgen für höchste Produktqualität. Automatisierte Prozessdatenerfassung und Auswertung stellen eine hundertprozentige Rückverfolgbarkeit sicher. Die digitale Bereitstellung stets aktueller produktionsbegleitender Dokumente und Sicherheitshinweise sorgt für sichere Prozesse.
Kraiburg TPE: Echtzeittransparenz durch bidirektionale Maschinenanbindung.
Bild: IGZ

Weighing & Dispensing – die Lösung für Misch- und Dosierprozesse: Für präzise Wiege- und Dosierprozesse hat IGZ mit der Best Practice Weighing & Dispensing eine Lösung entwickelt, die eine exakte Einhaltung von Rezepturvorgaben und Toleranzen gewährleistet. Die direkte Anbindung von Waagen und Dosiersystemen sorgt für Prozesssicherheit und Transparenz. Damit wird eine nachhaltigere Produktion durch Schonung von Ressourcen aufgrund optimalen Materialeinsatzes unterstützt.
SAP DM BASIERT AUF MODERNSTER CLOUDTECHNOLOGIE UND ERFASST ALLE RELEVANTEN PRODUKTIONSDATEN IM UNTERNEHMEN.
Praxisbeispiele:
Mit SAP und IGZ zur digitalen Fabrik IGZ hat bereits zahlreiche Unternehmen erfolgreich bei der Einführung von SAP Digital Manufacturing-Lösungen unterstützt und dabei bewährte, branchenspezifische Best Practices angewendet. Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie diese Projekte den Unternehmen dabei geholfen haben, ihre Produktionen zu optimieren.
Kraiburg TPE: Technologischer Sprung zur Harmonisierung der Produktion Der globale Hersteller von thermoplastischen Elastomeren, Kraiburg TPE, gilt in seiner Branche durch die weltweite Einführung der MES-Lösung SAP DM als „digitaler Vorreiter“. Aufgrund eines unternehmensweiten Templates und der flexiblen Skalierbarkeit eignet sich die SAP-Architektur ideal für den gruppenweiten Roll-out und sichert so das zukünftige Wachstum des Unternehmens auf Basis standortübergreifender, einheitlicher Prozesse langfristig ab.

Die bestehende IT-Systemlandschaft wird harmonisiert, und die Aufgabenverteilung zwischen ERP, MES und PLS ist klar geregelt. Zwischen den Systemen herrscht ein durchgängiger Informationsfluss, um konsistente Daten und einen „Single Point of Truth“ jederzeit sicherzustellen. Die Entscheidung für das Projekt resümiert Herr Meier wie folgt: „SAP DM passt sehr gut
KRAIBURG TPE GILT IN SEINER BRANCHE DURCH DIE WELTWEITE EINFÜHRUNG DER MES-LÖSUNG
SAP DM ALS „DIGITALER VORREITER“.
zu einem modernen Unternehmen wie Kraiburg TPE, das sich im Zuge der Digitalisierung nachhaltig für die Zukunft aufstellen möchte. Wir sind überzeugt, mit unserer neuen Lösung auch künftige Herausforderungen im Produktionsumfeld zu meistern.“
Griesson – de Beukelaer: Digitale Vernetzung für höchste Qualität
Qualität schmeckt besser: Mit Prinzen-Rolle, Griesson Soft Cake oder Leicht & Cross-Knusperbrot produziert Griesson – de Beukelaer, eines der führenden Unternehmen im europäischen Markt für Süß- und Salzgebäck, beliebte Kekse und Snacks und nutzt dafür vollintegrierte IT-Systeme. In einem konstruktiven und ergebnisorientierten Austausch wurde IGZ Best Practice FLOW+PACK von prozessbegleitenden Qualitätsprüfungen zu ereignisgesteuerten Prüfungen weiterentwickelt: Die durchgehende
Griesson – de Beukelaer: Die digitale Prozesssteuerung mit der IGZ Best Practice FLOW+PACK sorgt für erhebliche Effizienzsteigerung.
Bild: Griesson – de Beukelaer
Chargen-Rückverfolgbarkeit, integrierte Leitstandfunktionen sowie In-Process-Kontrollen unterstützen die Qualitätssicherung in einem Lebensmittelbetrieb. Dies führte zu einer erheblichen Effizienzsteigerung durch gezielte Reduktion von Prüfaufwänden und schafft eine papierlose Produktion mit hoher Flexibilität und Transparenz.
BASF: Effiziente Produktionssteuerung und OEE-Reporting mit FILL+PACK
Der Chemiekonzern BASF setzt die IGZ Best Practice FILL+PACK ein, um seine Produktionsprozesse im Segment Agricultural Solutions zu optimieren. Eric Fritsche, Prozessmanagement BASF Agricultural Solutions, hebt die Vorteile hervor: „Durch die vertikale Integration von FILL+PACK haben wir unsere gesamte Produktionssteuerung optimiert. Die digitalisierte Dokumentation spart uns händische
„DURCH
DIE VERTIKALE INTEGRATION VON FILL+PACK HABEN WIR UNSERE GESAMTE PRODUKTIONSSTEUERUNG OPTIMIERT.“
ERIC FRITSCHE, PROZESSMANAGEMENT BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS
Arbeitsschritte, wodurch weniger Korrekturaufwand notwendig ist. Zudem hilft uns die Echtzeit-Rückmeldung der Abfüllung dabei, adäquat zu planen. Die gesammelten Informationen bilden die Basis für das OEE-Reporting und die Instandhaltung der Anlagen; somit können wir mögliche Schwachstellen frühzeitig identifizieren und die Abfüllleistung entsprechend optimieren.“
Den Wandel gestalten: Mit SAP DM in eine innovative Zukunft SAP Digital Manufacturing ermöglicht Unternehmen der Prozessindustrie, ihre Produktionsprozesse digital abzubilden und zentral zu steuern. Die MES-Lösung von SAP basiert auf modernster Cloud-Technologie und erfasst alle relevanten Produktionsdaten, bindet Maschinen und Anlagen an und schafft so Transparenz und vielfältige Steuerungsmöglichkeiten in Echtzeit. Dies fördert die Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse und bildet die Basis für neue KI-Technologien. Die IGZ-Branchenlösungen auf Basis von Best Practices sorgen zudem für eine schnelle und sichere Realisierung der Projekte. RT
SEBASTIAN KLASZKA ist stellvertretender Verkaufsleiter SAP Manufacturing bei IGZ.
BASF: Optimierte Produktionssteuerung und OEE-Reporting mit der IGZ Best Practice FILL+PACK.
Bild: BASF


Der Einsatz einer modularen Software-Architektur, um die es sich bei der SAP Business Suite handelt, geht in die richtige Richtung. So lassen sich bestehende SAP-Landschaften schrittweise erneuern, ohne dass dabei das gesamte Unternehmen auf einen Schlag auf eine neue Software migriert werden muss. Bild: © Yingyaipumi/stock.adobe.com
Zwischen Kosten und Innovationsdruck
Technologische Innovationen und Trends wie künstliche Intelligenz (KI) haben einen zunehmenden Einfluss auf die Auswahl und Implementierung von Software und beschleunigen die Cloud-Transformation in der Produktion. Trotz teils angespannter wirtschaftlicher Lage kommt mittelfristig kaum ein Unternehmen darum herum, sich mit diesen Themen aktiv auseinanderzusetzen. Damit stehen viele Produktionsunternehmen vor vielfältigen Herausforderungen, auch im Umgang mit SAP-Systemen. VON THOMAS HENZLER
Die Anforderungen an hochverfügbare IT-Lösungen, die an 365 Tagen im Jahr möglichst ohne Unterbrechung laufen müssen, haben sich auch im Zeitalter von Cloud-Lösungen nicht gewandelt. Die technologischen Veränderungen in Richtung Cloud brachten in der Vergangenheit allerdings selten einen wirklichen Mehrwert, sondern sorgten lediglich dafür, dass eine Software-Wartung sichergestellt war. Das ändert sich nun sukzessive durch Themen wie KI, die erst auf Cloud-basierten Architekturen sinnvoll und vor allem skalierbar sind. Künstliche Intelligenz kann
Anwendern und Unternehmen zunehmend Vorteile liefern, indem sie die Art und Weise, wie mit Systemen interagiert wird, verändert – von datenbasierten Empfehlungen bis hin zu autonomen Entscheidungen und Prozessen durch KI-Agenten. Industrie 4.0 nimmt so komplett neue Formen an. Klar ist aber auch: Eine schnelle, vollständige Systemumstellung in die Cloud, um das volle Potenzial von KI ausschöpfen zu können, ist allein aus technischer Sicht für die meisten Unternehmen eine große Herausforderung und nur über Jahre möglich. Vielmehr geht es darum, moderne, Cloud-
basierte Lösungen schrittweise in die bestehenden Landschaften zu adaptieren. Das führt allerdings häufig zu komplexen modularen und hybriden IT-Landschaften und damit verbunden zu den nächsten Herausforderungen.
„Suite-first“-Strategie als Antwort SAPs ganzheitlicher Plattformansatz mit der „Suite-first“-Strategie – eine modulare, Cloud-basierte Softwarelandschaft mit beispielsweise SAP S/4HANA (Private, Public oder On-Premises), SAP Business Technology Platform (BTP) – wird von der DSAG
begrüßt. Denn die Lösungen sollen dabei hochgradig miteinander verzahnt werden. Heißt: Anwender sollen sich künftig nicht mit der komplexen Integration von Systemen befassen müssen. Stattdessen sollen sie sich den wichtigen Dingen widmen können wie der Prozesstransformation, die SAP damit stärker in den Fokus stellt. In den letzten Jahren mussten sich viele Anwender aufgrund der unterschiedlichen modularen SAP-Lösungen wie der SAP Service Cloud, dem SAP Field Service Management oder auch der SAP Digital Manufacturing Cloud (DMC) mit Integrationen, Monitoring, Lizenzen etc. beschäftigen. Mit dem „Suite First“-Ansatz möchte SAP die Stärken der Vergangenheit einer starken, hochintegrierten Plattform in eine modulare Cloud-Welt überführen, um so die Vorteile aus beiden Welten zusammenzubringen.
Der Einsatz einer modularen SoftwareArchitektur, um die es sich bei der SAP Business Suite handelt, geht dabei in die richtige Richtung. So lassen sich bestehende SAP-Landschaften schrittweise erneuern, ohne dass dabei das gesamte Unternehmen auf einen Schlag auf eine neue Software migriert werden muss. Dies setzt allerdings eine entsprechende Strategie mit dazugehörigem Fahrplan
MIT DEM „SUITE FIRST“-ANSATZ
MÖCHTE SAP DIE STÄRKEN EINER HOCHINTEGRIERTEN PLATTFORM IN EINE MODULARE CLOUD-WELT ÜBERFÜHREN.
voraus. Denn ein limitierender Faktor ist stets das Wartungsende diverser Software-Produkte wie SAP Manufacturing Execution System (MES).
Modulare Lösungen in der Produktion
Im Kontext der Produktion ist SAP DMC ein Beispiel für eine modulare Lösung. Als Nachfolger des klassischen On-PremisesProdukts SAP MES, das Ende 2030 aus der Wartung läuft, kann DMC modular an bestehende ERP-Systeme angebunden werden. Vorteil: So lässt sich unter anderem der Shopfloor in den Produktionen weiter digitalisieren – auch mithilfe von KI.
Gleichzeitig können Unternehmen weiter auf ihren ERP-Kern setzen und parallel damit beginnen, einzelne Bereiche zu moder-
nisieren. Damit werden die Kosten für die Implementierung nicht auf einmal, sondern planbar nach und nach fällig.
Datengrundlage, KI-Nutzung und Datenplattform Moderne SAP-Lösungen, aber auch andere Nicht-SAP-Lösungen entfalten ihren Mehrwert meist dann, wenn Daten nahtlos fließen, KI flexibel nutzbar ist und technische Standards eingehalten werden. Beim Stichwort Datenfluss spielt die
MODERNE LÖSUNGEN ENTFALTEN IHREN MEHRWERT MEIST DANN, WENN DATEN NAHTLOS FLIESSEN, KI FLEXIBEL NUTZBAR IST UND TECHNISCHE STANDARDS EINGEHALTEN WERDEN.
neue SAP Business Data Cloud (BDC) eine zentrale Rolle. Sie soll die Unternehmen bei der Harmonisierung und Nutzung ihrer Daten unterstützen und so eine Basis für KI-getriebene Prozesse schaffen. Ein wichtiger Bestandteil dabei sind sogenannte Datenprodukte. Vereinfacht gesprochen zielt SAP damit darauf ab, aus verschiedenen Systemen unterschiedliche Datenobjekte zu harmonisieren wie ein Equipment. So soll eine einheitliche Sicht auf ein Datenobjekt entstehen, um damit beispielsweise KI-Anwendungen oder auch klassische Reports zu erzeugen. Diese werden zum Beispiel in Form der Insight-Apps durch SAP bereitgestellt.
Technische Standardisierung
Auch konsistente technische Standards für Berechtigungsmanagement, Monitoring, Zertifikatsverwaltung und Schnittstellen sind aus DSAG-Sicht essenziell, um eine sichere, effiziente und wartbare Produktions-IT über Systemgrenzen hinweg zu gewährleisten – sei es zwischen S/4HANA und der Service Cloud oder zwischen S/4HANA und der DMC. Dazu gehört ebenfalls eine starke prozessuale Integration wie bei der Produktrückverfolgbarkeit mittels Chargen- und Serialnummern. Dazu zählt aber genauso Grundlegendes wie eine durchgängige Verwaltung von Dokumenten, die nicht an den jeweiligen Systemgrenzen endet. Denn auch wenn die Lösungen modular sind, muss es möglich sein, auf elementare Dinge wie
CAD-Zeichnungen von allen relevanten Systemen aus zuzugreifen.
Innovation praktisch nutzbar machen Gerade produzierende Unternehmen benötigen nicht nur stabile und sichere Systeme, sondern auch die Fähigkeit, neue Technologien schnell zu adaptieren – etwa für vorausschauende Instandhaltung, Qualitätsüberwachung oder adaptive Fertigungsprozesse. Entscheidend dafür ist eine Plattform, die sich für Innovationen öffnet: durch Schnittstellen, Partnerschaften und flexible Datenarchitekturen. Die DSAG begrüßt Partnerschaften von SAP, etwa mit Anbietern wie Databricks, die es ermöglichen, SAP-Daten auch für externe Analytics- und KI-Anwendungen zu nutzen. Zusätzlich wird es zukünftig interessant sein zu sehen, in welche Richtung sich Initiativen wie Factory-X entwickeln und welche Auswirkungen sie auf das SAP-Portfolio haben. Ebenso erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind die SAP-BusinessNetwork-Lösungen, die unter anderem die Brücke schlagen sollen zwischen internen Prozessen und Partnern, zum Beispiel in Instandhaltungsprozessen. Auch im Kontext des Produktpasses wird dies zunehmend wichtiger für Unternehmen sein.
Zusammenfassend ist SAP aus DSAGSicht im Bereich der Produktion und Fertigung auf einem guten Weg. Vor allem der Ansatz hin zu einer modularen, Cloudbasierten Softwarelandschaft führt in die richtige Richtung. Knackpunkt sind allerdings die Cloud-Lösungen, die bisherige On-Premises-Produkte ablösen sollen, teilweise aber noch nicht die funktionalen Anforderungen erfüllen. Das darf nicht dazu führen, dass Anwender in ein ProzessVakuum geschickt werden. Hier gilt es für SAP, weiterhin zu liefern und damit die Lücken zu schließen, damit Anwender ihre Prozesse – auch in hybriden Landschaften – durchgängig abbilden können. RT
THOMAS HENZLER ist DSAG-Fachvorstand Vertrieb, Produktion & Logistik.

Bemusterung neu gedacht
Den gesamten PPAP-/PPF-Prozess direkt in SAP abbilden
Kämpfen auch Sie noch mit zeitaufwändigen, manuellen Bemusterungsprozessen? Verteilte Dokumente, Medienbrüche und fehlende Transparenz führen häufig zu Verzögerungen bei Entwicklungszeiten (time-to-market), zu Fehlern und erhöhtem Aufwand. Gerade bei der Bemusterung ist eine lückenlose, effiziente Dokumentation entscheidend, um Ihre Qualitätsstandards einzuhalten.
Die Anforderungen an die Produktionsfreigabe von Bauteilen sind anspruchsvoll und durch Standards wie PPAP (Production Part Approval Process) und PPF (Produktprozess- und Produktionsfreigabe) klar definiert. In der Praxis sind diese Prozesse häufig komplex und zeitaufwändig.
Dabei geht es auch einfacher
Die Lösung: XFT PPAP File 4S4 . Diese Software ermöglicht eine durchgängige, systemgestützte Abwicklung des gesamten Bemusterungsprozesses in SAP – vom Anlegen der Bemusterung über die Erstellung und Verwaltung der Unterlagen bis hin zur finalen Freigabe.
Die vollständige Integration in SAP erstreckt sich über alle relevanten Prozessschritte: von der Bestellung über die Wareneingangsprüfung bis zur Freigabe des Q-Infosatzes bei Kaufteilen. Auch die beteiligten Abteilungen werden aktiv unterstützt – durch automatisch generierte und terminierte Aufgaben behalten alle Beteiligten den Überblick und können ihre Schritte fristgerecht durchführen.
Alles digital, alles automatisiert, alles im SAP-System
Darüber hinaus unterstützt die Lösung hybride Kollaborationsszenarien durch die Integration der SAP BTP (Cloud): Der sichere Austausch von Daten und Dokumenten mit Lieferanten wird dadurch deutlich vereinfacht.
Das Ergebnis: Weniger administrativer Aufwand, mehr Transparenz und eine spürbar gesteigerte Prozesseffizienz. Die moderne Fiori-Oberfläche sorgt zudem

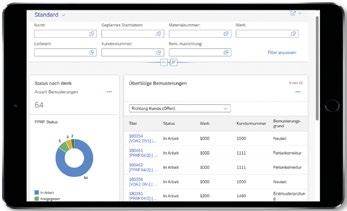
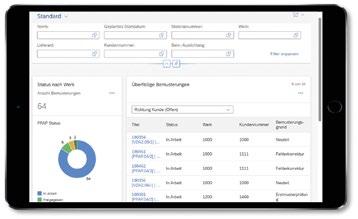
für eine intuitive und anwenderfreundliche Benutzererfahrung.
Fazit: Mit XFT PPAP File 4S4 steht Ihnen eine leistungsstarke und zukunftsfähige Lösung für die Bemusterung im SAP-Umfeld zur Verfügung – standardnah, effizient und durchgängig digitalisiert
XFT PPAP File 4S4 –Ihre Vorteile auf einen Blick
SAP-Integration: Verwalten Sie alle Bemusterungsvorgänge zentral – effizient, durchgängig und systemgestützt.
SAP BTP-Anbindung: Kollaborieren Sie sicher und unkompliziert mit Lieferanten – direkt über die SAP Business Technology Platform.
Moderne Fiori-Oberfläche: Profitieren Sie von intuitiver Bedienung und verbesserter Nutzerfreundlichkeit.
Integrierte Freigabe-Workflows: Reagieren Sie schneller bei Abweichungen – dank klarer Aufgabenund Verantwortungszuweisung.
Detaillierte Analytics: Behalten Sie KPIs und Prozessstände jederzeit im Blick – übersichtlich und visuell.
XFT GmbH - Wer wir sind Wir sind Ihr erfahrener Experte für Enterprise Information Management im SAPUmfeld – für alle Branchen. Mit unseren Produkten erweitern Sie Ihr SAP-System und führen alle Informationen, die in Ihren Prozessen anfallen, an einer Stelle zusammen.
Mehr Informationen und eine Auswahl unserer Referenzen finden Sie hier:

Altrottstraße 31, D-69190 Walldorf
TEL.: +49 (0) 62 27 / 54 55 50
E-MAIL: tobias.bender@xft.com Tobias Bender

S/4HANA: Mit neuer StammdatenStruktur sicher in die Migration
Die Einführung von SAP S4/HANA ist für viele Unternehmen ein strategischer Meilenstein auf dem Weg zur Digitalisierung.
Eine zentrale Herausforderung stellen dabei Qualität und Struktur der Stammdaten dar. Simus Systems bietet Software und Services, um eine solide Datenbasis für die neue ERP-Umgebung zu schaffen. VON DR. THOMAS TOSSE
Bei jeder Migration gefährden unvollständige, veraltete oder inkonsistente Daten nicht nur den Go-Live, sondern auch die langfristige Nutzung der neuen Systemumgebung. Doch im Vergleich zu anderen ERP-Systemen und älteren SAP-Versionen gilt dies für SAP S/4HANA umso mehr. In SAP S/4HANA sind Stammdaten enger in Prozesse, Auswertungen und User Interfaces eingebunden als je zuvor. Die Plattform verfolgt das Ziel eines vereinfachten, zentralisierten Datenmodells, das Echtzeitverarbeitung, Automatisierung und Analyse unterstützt. Dies erfordert ein besonders hohes Maß an Datenqualität – vor allem bei den zentralen Stammdatenobjekten, wie etwa von Geschäftspartnern, Materialien und Dokumenten.
Neue Stammdaten-Struktur für Business-Partner
Einige tiefgreifende strukturelle Änderungen, die mit S/4HANA eingeführt wurden, verstärken dies. So wurde der Bereich Business-Partner (BP) als alleinige Quelle für Kunden- und Lieferantenstammdaten geschaffen, um die Datenintegrität zu verbessern und Redundanzen zu beseitigen.
IT-VERANTWORTLICHE MÜSSEN FRÜHZEITIG IN DER MIGRATIONSSTRATEGIE DEFINIEREN, WELCHE DATENOBJEKTE IN DAS ZIELSYSTEM ÜBERNOMMEN WERDEN SOLLEN.

In anderen ERP-Systemen werden Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren) als getrennte Stammdaten gehandhabt. Vor einer Migration reicht es nicht aus, diese als SAP-Business-Partner-Gruppen anzulegen. Denn einem SAP-Business-Partner können noch im Verlauf der Geschäftsbeziehung Rollen wie Debitor, Kreditor, Lieferant, Auftraggeber oder Warenempfänger mehrstufig über Gruppen und Rollen flexibel zugeordnet werden.
Grundlegende Optimierung der Datenqualität
Deshalb müssen IT-Verantwortliche frühzeitig in der Migrationsstrategie definieren, welche Datenobjekte in das Zielsystem übernommen werden sollen. Dabei geht es nicht nur um Materialstämme und Geschäftspartner, sondern auch um weitere technische Objekte wie Equipment, Stücklisten oder Klassifizierungen. Parallel sollten die vorhandenen Daten nach Qualitätskriterien analysiert werden, um unvollständige Felder, Dubletten und inkonsistente Werte zu eliminieren.
Bereits in dieser Phase sollte man einen erfahrenen Dienstleister ins Boot zu holen, der die Zielstruktur in S/4HANA versteht. Wenn zum Beispiel SAP-Business-Partner Debitoren und Kreditoren ersetzen, hat das Auswirkungen auf Rollen, Pflichtfelder und Prozesse. Es spart viel Aufwand, wenn man derartige Auswirkungen bereits im Vorfeld berücksichtigt. Simus Systems bringt
Im Rahmen der Migrationsstrategie müssen sich IT-Verantwortliche mit der Struktur und Qualität der Stammdaten auseinandersetzen.
dazu ausgereifte Methoden, Werkzeuge und Erfahrungen mit. „Wir haben einen Stammdaten-Spezialisten mit tiefgehendem SAP-Know-how gesucht“, berichtet Paul Lung, der als Teamleiter Stammdatenmanagement SAP bei dem KühlanlagenSpezialisten Hauser in Linz für die Materialstamm- und Geschäftspartnerdaten verantwortlich ist. „Im Nachhinein betrachtet war dies sicher eine gute Entscheidung.“
Externe Unterstützung essenziell
Die Zusammenarbeit mit Simus Systems beginnt mit einem Vorprojekt, das Klarheit über die Potenziale und die dahinterstehenden internen und externen Aufwände schafft. Dazu wird zunächst eine überschaubare Datenmenge vom Kunden bereitgestellt und extern bearbeitet. Anhand der Ergebnisse werden in Workshops und Gesprächen die Ziele für das eigentliche Projekt definiert. Sie beginnen mit einer funktionalen Neuordnung der Stamm daten und umfassen oft die Klassifikation der Norm- und Kaufteile sowie den Aufbau weiterer, kundenspezifischer Funktionsklassen, welche die Wiederverwendungsrate von Materialien signifikant erhöhen.
Regeln verändern statt Daten bearbeiten
Mit Projektbeginn werden alle relevanten Daten aus den betroffenen Quellen ausgelesen und bearbeitet. Nach zunächst neutralen Regeln für die Aufbereitung und Optimierung werden die Daten sortiert, angereichert und in einer Ergebnisdatenbank abgelegt. Die Ergebnisse lassen sich nun mit der Suchmaschine Classmate Finder filtern und betrachten, um even-
„WIR HABEN EINEN STAMMDATENSPEZIALISTEN MIT TIEFGEHENDEM
SAP-KNOW-HOW
GESUCHT.“
PAUL LUNG, TEAMLEITER STAMMDATENMANAGEMENT
SAP BEI HAUSER IN LINZ
tuelle Fehler, Dubletten oder Ungenauigkeiten aufzufinden. In Workshops oder Teams-Konferenzen mit den betroffenen Fachabteilungen des Kunden lassen sich die Ergebnisse verfeinern. Änderungen werden jedoch nicht über einzelne Datensätze, sondern über Aufbereitungsregeln korrigiert. „Dies war ein iterativer Prozess mit Änderungen, um viele Abhängigkei-
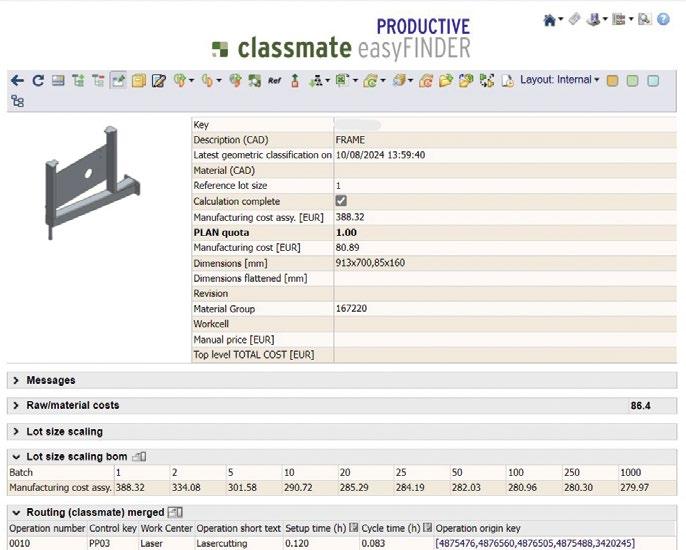
ten berücksichtigen zu können“, berichtet Paul Lung.
Es folgt eine automatische Strukturierung der Daten in die entsprechenden Klassen. Dazu bringt Simus ystems eine Standard-Struktur mit. „Manchmal hat der mitgebrachte Standard von Simus Systems sofort gepasst – manchmal mussten wir die Klassifizierung an unsere Vorgaben anpassen“, sagt Paul Lung. „Auf jeden Fall war es gut, von einem mitgebrachten Grundstock ausgehen zu können.“
Dank dieser Methodik lassen sich bis zu 80 Prozent des Aufwands für die Datenbearbeitung einsparen. Anschließend gelangen die Daten samt neuer Struktur über eine flexible Schnittstelle in das neue System.
Nachhaltige Sicherung der Datenqualität
Um die einmal erreichte Qualität der Stammdaten zu erhalten, werden mit Classmate Finder die Regeln der Master Data Governance in Prozesse überführt. So können Anwender beispielsweise einen Materialantrag stellen, wenn sie ein gewünschtes Teil nicht finden. Eine Stammdatenstelle begutachtet die Materialanträge. Nach positiver Entscheidung wird das neue Material über die Schnittstelle automatisch in SAP S4/HANA angelegt. „In das Master Data Management haben wir viel Zeit und Überlegung investiert, aber es lohnt sich sofort“, sagt Paul Lung. „Die hervorragende Zusammenarbeit mit den kompetenten und freundlichen Beratern von Simus Systems hat viel zu dem erfolgreichen Projektverlauf beigetragen.“
Classmate EasyFinder von Simus Systems macht die Suche in großen Datenbeständen komfortabel und effektiv.
Bilder: Simus Systems
Unternehmensübergreifender Pflegeprozess
Auch die Datenpflege für Business-Partner, Equipments oder Materialstämme lässt sich über mehrere Fachabteilungen hinweg in anpassbaren Prozessen automatisieren. Für Sicherheit sorgt ein Berechtigungskonzept; intelligente Voreinstellungen reduzieren den Aufwand und verhindern Fehleingaben. Die intelligente Unterstützung bei Routineaufgaben beschleunigt die Durchlaufzeit, der Datenbestand bleibt aktuell und hochwertig.
Hohe Benutzerfreundlichkeit, geringer Aufwand
Die Datenaufbereitung vor einer Migration auf SAP S4/HANA ist eine Notwendigkeit. Die anschließende Datenpflege mit Simus Classmate führt zu hoher Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Transparenz. Die Workflows lassen sich unabhängig von SAP kostengünstiger definieren und anpassen – ohne die Datenhoheit des ERP-Systems aufzugeben. RT
DR. THOMAS TOSSE ist Inhaber der Agentur Hightech Marketing.
SAP DM und SAP PEO: Die ganzheitliche Fertigung wird real
SAP Digital Manufacturing (DM) und SAP Production Engineering and Operations (PEO) optimieren Fertigungsprozesse.
PEO verwaltet Stammdaten und Änderungen, während DM die Echtzeit-Ausführung und Überwachung auf dem Shopfloor steuert.
VON MARKUS ALISKIEWITZ, PRINCIPAL CONSULTANT, BERND KOTULLA, SENIOR MANAGING CONSULTANT UND CHRISTIAN SCHWICKERT, ANALYST, ALLE CONSILIO
Komplexe Fertigungsstrukturen und kurze Entwicklungszyklen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Deshalb muss die Lücke zwischen Engineering, Produktionsplanung und Ausführung geschlossen werden, um effizient zu wirtschaften. Mit SAP Digital Manufacturing (DM) und SAP Production Engineering and Operations (PEO) sowie dem Planungstool PP/DS bietet SAP drei Module an, die eine ganzheitliche Lösung für diese Herausforderungen bieten. DM und PEO sind eingebettet in die SAP-S/4HANA-Planungsszenarien. Dieses Tandem ermöglicht es Unternehmen, ihre Fertigungsprozesse zu optimieren, Echtzeit-Transparenz zu schaffen und flexibel auf Änderungen zu reagieren. Während SAP PEO die „Blaupause“ für die Produktion erstellt, setzt SAP DM diese Pläne auf dem Shopfloor in die Tat um und überwacht Prozesse. Gemeinsam schaffen sie eine durchgängige, datengetriebene Fertigungskette – ein Paradebeispiel für die Industrie 4.0.
Was verbirgt sich hinter den Modulen?
SAP PEO fokussiert sich auf Engineering und das ganzheitliche Änderungsmanagement. Es ermöglicht die Umwandlung von Engineering Bill of Materials (EBOM) in Manufacturing Bill of Materials (MBOM). Über entsprechende Schnittstellen (APIs) lässt sich PEO an CAD- und PLM-Systeme wie Siemens Teamcenter andocken, damit man die Daten der EBOMs übertragen kann. Tools wie das Team Data Management Interface (TDMI) und Change Record Workflows sorgen für eine reibungslose Übergabe von Konstruktionsdaten in die Produktion und verwalten Änderungen transparent. Zudem unterstützt PEO die Rückverfolgbarkeit durch Tracking & Genealogy, was besonders im Automobilsektor, dem Maschinenbau oder in regulierten Branchen wie der Luftfahrt essenziell ist. SAP DM hingegen ist ein cloud-basiertes Manufacturing-Execution-System (MES), das die Produktionsausführung steuert. Mit dem Production Operator Dashboard (POD) erhalten Shopfloor-Mitarbeiter Echt-

SAP PEO und SAP DM im Team: schematischer Aufbau der durchgängigen, datengetriebenen Fertigungskette
zeitzugriff auf Arbeitsanweisungen, Auftragsstatus und Qualitätsdaten. Features wie Resource Orchestration (REO) optimieren die Zuweisung von Mitarbeitern und Maschinen, während der Production Connector die Maschinenintegration ermöglicht und SAP DM Insights KPIs wie die Overall Equipment Effectiveness (OEE) visualisiert. KI-gestützte visuelle Inspektionen und die Edge-Komponente erhöhen die Qualität und Robustheit der Produktion.
Die Vorteile der Kombination
PEO liefert strukturierte Pläne, die DM in Echtzeit umsetzt, während SAP Digital Manufacturing Daten wie Produktionsfehler oder Termine in den Fertigungsauftrag (FeAuf) zurückspielt, um Prozesse in PEO zu optimieren. Diese bidirektionale Verbindung, unterstützt durch SAP S/4HANA und Schnittstellen wie OData APIs, sorgt künftig für einen nahtlosen Datenfluss. Beispielsweise könnte ein Automobilzulieferer PEO nutzen, um die Montage eines Armaturenbretts zu planen, inklusive 3D-Visualisierungen, Werkzeug- und Mitarbeiter-Zuweisungen. Hier können auch ad hoc noch kurzfristige Änderungen in vorhandene Fertigungsaufträge eingesteuert werden. DM führt diese Pläne aus, überwacht Zykluszeiten und meldet Abweichungen, die PEO für Anpassungen nutzt. Diese Zusammenarbeit steigert in der Fertigung die Effizienz, Transparenz und Flexibilität.
Für wen eignet sich die Kombination, und wann passt welches Modul?
Die Kombination aus SAP DM und PEO ist ideal für Unternehmen, die eine durchgängige digitale Transformation ihrer Fertigungsprozesse anstreben. Große und mittelgroße Unternehmen mit komplexen
Änderungsanalyse: Mit der App lassen sich die Auswirkungen der Änderungen am Prozessplan und der Fertigungsstückliste grafisch erkennen.
Bilder: CONSILIO

Produktionsabläufen profitieren besonders, da sie die volle Integration beider Module nutzen können. Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Elektronik und Maschinenbau sind prädestiniert, da sie strenge Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, Qualität, Sicherheit und Effizienz haben.
Beispielsweise können Automobilzulieferer die Kombination einsetzen, um MBOMs und Arbeitsanweisungen (PEO) mit Echtzeit-Shopfloor-Steuerung (DM) zu verbinden.
TEAM SAP DM UND PEO: DIE HIGHLIGHTS
Effizienz: PEO stellt präzise Stammdaten zur Verfügung, die DM anschließend in Echtzeit aus einem Fertigungsauftrag extrahiert und verwendet. Das reduziert die Aufwände für Produktänderungen und Erstellung von MBOMs.
Transparenz: Echtzeit-KPIs wie OEE via DM Insights und Rückverfolgbarkeit (PEO Tracking & Genealogy, Change Record) machen Prozesse sichtbar und sicherer.
Flexibilität: Änderungen in PEO fließen über den Fertigungsauftrag direkt in SAP DM ein, was schnelle Anpassungen ermöglicht.
Industrie 4.0: IoT-Integration, KI (zum Beispiel visuelle Inspektion) und CloudArchitektur schaffen eine smarte Fabrik.
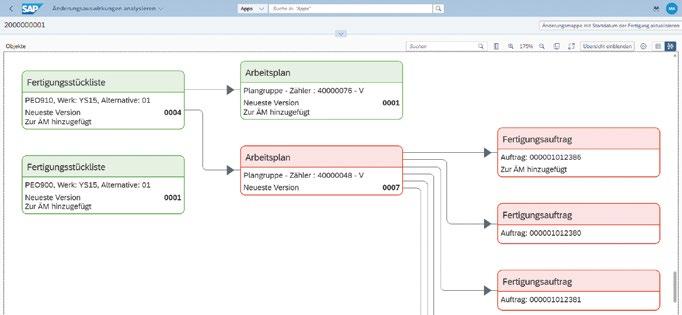
Änderungsmappe: Mit der App lassen sich Änderungsprozesse überwachen, analysieren und zurückverfolgen.
Was bedeutet das konkret?
Nicht in jeder Situation ist die Kombination aus SAP PEO und SAP DM wirtschaftlich sinnvoll. Drei Szenarien sprechen jedoch dafür, beide Module zu verbinden, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken:
Komplexe Produktionen: Unternehmen mit mehrstufigen Fertigungsprozessen benötigen PEO für die Koordination der Stammdaten und DM für die Ausführung, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie mit Hunderten Komponenten und einer Vielzahl an Dispostufen.
Regulierte Branchen: In der Luftfahrt-, der Automobil- und Rüstungsindustrie ist Rückverfolgbarkeit und Dokumentation entscheidend, beispielsweise via PEO Tracking & Genealogy und DMProtokollierung.
Globale Unternehmen: Werke in verschiedenen Regionen profitieren von DM Insights für KPI-Vergleiche und PEO für standardisierte Prozesse.
Ein Beispiel: Der japanische Mischkonzern Kawasaki Heavy Industries (KHI), der in verschiedenen Sektoren tätig ist wie Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeuge, Schiffbau, Maschinenbau und Motorräder, nutzt PEO, um etwa Triebwerksdesigns mit CAD-Daten zu synchronisieren, und SAP DM, um die Montage in Echtzeit zu überwachen.
Wie sieht es mit mittelständischen Unternehmen aus?
SAP PEO und SAP DM sind Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen in
der Fertigung. Diese Eckpunkte können Hinweise darauf sein, welches Tool am besten zum eigenen Tagesgeschäft passt:
Nur SAP PEO:
• Unternehmen oder Entwicklungsteams: Firmen mit Fokus auf Produktentwicklung, aber ohne Shopfloor-Ausführung, zum Beispiel Ingenieurbüros, nutzen PEO für BOM-Management und Arbeitsanweisungen.
• Beispiel: Ein Maschinenbau-Startup, das Prototypen plant, braucht PEO für die BoP-Erstellung, aber kein DM, da die Produktion extern erfolgt.
Nur SAP DM:
• Fertigungsunternehmen: Betriebe mit hohem Bedarf an Shopfloor-Transparenz nutzen DM für Echtzeitsteuerung und KPI-Analyse.
• Beispiel: Ein mittelständischer Konsumgüterhersteller, der Verpackungen produziert, nutzt DM für die Überwachung von Produktionslinien, ohne PEO, da die Fertigungsstrukturen simpel sind.
Fazit: Die Kombination von SAP DM und PEO ist die beste Lösung für große, komplexe oder regulierte Fertigungsunternehmen, die eine smarte, durchgängige Produktionskette realisieren wollen. Kleinere Unternehmen oder solche mit spezifischem Fokus auf die Engineering/ Shopfloor-Transparenz können mit einem Modul starten und später skalieren.
Mehr Informationen: www.consilio-gmbh.de

„Realistisch
planen und schrittweise vorgehen“
Das Produktportfolio von SAP umfasst alle Bereiche der Lieferkette und schließt dabei die Produktion als wesentlichen Teil der Wertschöpfung ein. Die Nutzung in der Cloud erleichtert die Integration der verschiedenen Segmente, doch speziell im Fertigungsbereich kann der Wechsel in die Cloud aufgrund spezifischer Anforderungen oder Schnittstellen herausfordernd sein. Was die aktuellen Herausforderungen sind und was besonders mittelständische Fertigungsunternehmen bei der Umstellung auf SAP beachten sollten, erklären uns elf SAP-Experten. VON RAINER TRUMMER
FRAGEN AN DIE EXPERTEN
1 Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie beim Einsatz von SAP-Lösungen in der Fertigungsindustrie?
2 Was sollten insbesondere mittelständische Fertigungsbetriebe beachten, die ihre Produktionsprozesse mit SAP-Anwendungen steuern wollen?
3 Welche Innovationen, die den digitalen Wandel in der Fertigungsindustrie vorantreiben werden, erwarten Sie in den kommenden Jahren?

1.Markus Aliskiewitz
Principal Consultant bei Consilio
Bild: Consilio
Einerseits setzen Anwender auf neue Technologien, wie sich beim Umstieg von R/3 auf S/4 zeigt, aber gleichzeitig verharren sie oft noch in ihren alten Mustern. Grund: Möglicherweise fehlt der Mut, oder es schrecken die zusätzlichen Investitionen ab, sich mit aktuellen Innovationen zu befassen. Stichworte sind hier die Cloud, PEO als Stammdatenmanagement-Tool inklusive EBOM/MBOM oder SAP DM als Shopfloor-Tool. Beispielsweise schließt PEO die Lücke zwischen der Produktentwicklung und der Fertigungssteuerung und öffnet so den Weg in Richtung Industrie 4.0. Ähnliches gilt für die Kapazitätsplanung: Die alten CM*-Transaktionen sind laut SAP bald Geschichte; daher sollten Anwender zügig auf PP/DS setzen.
2. Das A und O ist eine gute Beratung, die transparent aufzeigt, welche Fertigungssteuerungsprozesse essenziell sind beziehungsweise die Kundenanforderungen befriedigen. Wenn dieser Punkt geklärt ist, sollte man sich überlegen, wie man den aktuellen Fertigungsprozess im SAP-Standard abbildet – mit möglichst wenigen Eigenentwicklungen. Grund: Wer möglichst nah am Standard bleibt, spart bei Release-Wechseln nicht nur Zeit und Kosten, sondern bleibt durchgehend lieferfähig.
3. In der Fertigung spielt der digitale Zwilling – also das digitale Pendant des Produkts – eine immer größere Rolle. Mit ihm lassen sich Fertigungsprozesse optimieren, Innovationen vorantreiben und Wettbewerbsvorteile erlangen. SAP PEO unterstützt die Entwicklung zum digitalen Zwilling durch die Verknüpfung von technischen Stücklisten (EBOM) und Fertigungsstücklisten (MBOM) – inklusive 3D-Zeichnungen. Das vollständig in S/4HANA integrierte Tool deckt mit zahlreichen Funktionen und Submodulen den gesamten Fertigungsprozess ab und hilft Anwendern, ihre Prozesse zu verbessern und effizienter zu gestalten.

1.
Thomas Henzler
DSAG-Fachvorstand Vertrieb, Produktion & Logistik Bild: DSAG
Die Herausforderung liegt in der Kombination vieler Themen, die es im Kontext von SAP zu bewältigen gilt. Neben dem Wartungsende von SAP ECC laufen auch Produkte wie SAP Manufacturing Execution System (SAP MES) aus der Wartung. Während es zum Beispiel für ECC durchaus die Möglichkeiten einer zunächst reinen technischen Umstellung auf S/4HANA gibt, müssen bei SAP MES Prozesse überdacht und eine komplett neue Software auf Basis der Digital Manufacturing Cloud (SAP DM) eingeführt werden – was wiederum Einfluss auf die S/4HANATransformation hat. Die Abhängigkeit der Projekte zueinander führt besonders bei großen Firmen zu enormem Planungsaufwand. Ein Thema sind auch kundeneigene Erweiterungen in ‚alten‘ Systemen, die sich bei einer Umstellung nicht mehr weiter betreiben lassen und somit komplett überdacht werden müssen.
2. Es braucht einen Plan, vor allem aber eine Strategie, und damit verbunden ein durchgängiges Architektur-Management: angefangen mit der Bedarfs- und Absatzplanung, zum Beispiel mit SAP IBP, über den Einsatz von Planungssystemen wie PP/DS bis zur Anbindung von MES-Systemen wie SAP DM. Die Bandbreite möglicher Lösungen ist beachtlich. Unternehmen müssen auswählen, welche für sie strategisch Sinn machen und eine echte Verbesserung bringen – und in welcher Reihenfolge sie diese einführen. Alles auf einmal ist kaum möglich.
3.
Mit Produkten wie SAP DM hat SAP eine neue Generation von MES-Systemen auf den Markt gebracht. Dabei hält KI zunehmend Einzug in Prozesse – und wird mit Blick in die Zukunft sicherlich noch großes Potenzial entfalten. Gleichzeitig werden aber auch die Herausforderungen wachsen, beispielsweise beim Sourcing von direkten Materialen.
Expertenumfrage: SAP-Lösungen in der Fertigungsindustrie

1.
Andreas Dangl
Entrepreneur und Geschäftsführer von Fabasoft Approve Bild: Fabasoft Approve
SAP deckt im industriellen Umfeld vor allem unternehmensinterne Prozesse ab, stößt jedoch bei technischen Dokumentationen, revisionssicherer Archivierung oder unternehmensübergreifenden Freigabe-Workflows an seine Grenzen. Viele Unternehmen versuchen, diese Lücken durch umfangreiches Customizing zu schließen. Gerade bei der Umstellung auf SAP S/4HANA hat es sich bei unseren Kunden bewährt, komplexe Qualitäts- und Dokumentationsprozesse in spezialisierten Lösungen abzubilden. So lassen sich Altlasten vermeiden, der Customizing-Aufwand und die damit verbundenen Kosten reduzieren sowie Prozesse effizienter gestalten.
2.
Wichtig ist dabei, bestehende Prozesse kritisch zu prüfen und gegebenenfalls neu zu denken. Eine Fit-Gap-Analyse zeigt, welche Abläufe sich mit SAP-Anwendungen abbilden lassen und wo spezialisierte Systeme – etwa ein Industrial DMS oder QMS – echten Mehrwert bieten. Meine Empfehlung ist, mit einem Proof-of-Concept in einem klar abgegrenzten Bereich zu starten. So lassen sich erste Erfahrungen sammeln und potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren. Nach einer erfolgreichen Pilotphase kann die Lösung schrittweise auf weitere Bereiche und Standorte ausgerollt werden.
3. KI-Agenten werden industrielle Prozesse auf ein neues Niveau heben, indem sie Aufgaben autonom optimieren und direkt dort ausführen, wo Daten entstehen. Parallel dazu setzen sich Predictive-Quality- und Predictive-Maintenance-Verfahren durch, die Qualitätsprobleme oder Ausfälle erkennen, bevor sie entstehen, und dadurch Kosten sowie Stillstände reduzieren können. Gleichzeitig rückt Industrie 5.0 den Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt, sodass sich technologische Präzision mit menschlicher Flexibilität, Nachhaltigkeit und Resilienz verbindet.

Oliver Hoffmann
Geschäftsführer von Forcam Enisco
Bild: Forcam Enisco
1. Ich sehe drei Herausforderungen. Erstens: das saubere Aufbereiten von Signalen aus heterogenen Maschinen in einem einheitlichen Datenmodell. In der Produktion gilt es, Echtzeitdaten aus Maschinen in SAP-Anwendungen effizient zu nutzen. Es braucht offene Schnittstellen und spezialisierte MES-Lösungen, die reibungslos mit SAP ERP zusammenarbeiten. Zweitens: die Integration von SAP-Lösungen in heterogener IT-Landschaften, also in historisch gewachsene Architekturen. Und drittens: Besonders wichtig ist es, die Komplexität zu beherrschen. Eine Integration, ein Upgrade oder ein Wechsel zu SAP erfordert nicht nur technologische, sondern vor allem auch prozessuale Umstellungen.
FRAGEN AN DIE EXPERTEN
1 Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie beim Einsatz von SAP-Lösungen in der Fertigungsindustrie?
2 Was sollten insbesondere mittelständische Fertigungsbetriebe beachten, die ihre Produktionsprozesse mit SAP-Anwendungen steuern wollen?
3 Welche Innovationen, die den digitalen Wandel in der Fertigungsindustrie vorantreiben werden, erwarten Sie in den kommenden Jahren?
2.
Mittelständler sollten realistisch planen und schrittweise vorgehen. Wichtig ist eine klare Digitalisierungsstrategie, die auf den individuellen Bedarf abgestimmt ist. Statt eines ‚Big Bang‘ begleiten wir unsere Kunden durch einen systematischen Prozess mit acht für die Organisation verdaubaren Schritten, inklusive Change-Management. Technologisch sollten Mittelständler auf eine modulare und skalierbare MES-Lösung wie SAP Digital Manufacturing setzen. Erfolgskritisch ist, die Mitarbeitenden zu motivieren – durch frühzeitige Kommunikation, durch Teilhabe und Vorschlagswesen sowie durch Schulungen.
3.
Wir erwarten die weitere Verschmelzung von IT und OT. KI-Apps werden viel Neues ermöglichen, zum Beispiel, Vorhersagen oder alternative Szenarien in Sekundenschnelle zu liefern. Dafür sind valide Daten nötig, sonst bleibt KI ein stumpfes Schwert. Die Zukunft gehört offenen, cloud-fähigen Lösungen sowie praxistauglichen Apps, die Fabrikteams einfach integrieren können und die standortübergreifend für mehr Transparenz und Effizienz sorgen.

Dela-Aline Dauner
Field Lead MES bei Trebing+Himstedt Bild: Trebing+Himstedt
1. In vielen Werken fehlt die durchgängige Integration von ERP, MES und Shopfloor-Ebene. Statt eines homogenen Datenmodells dominieren heterogene Schnittstellen, Schatten-IT und inkonsistente Stammdaten. Das erschwert die Synchronisierung von Auftrags-, Material- und Maschinendaten und hemmt jede datenbasierte Steuerung. SAP bietet mit der Digital Manufacturing Suite einen integrierten Ansatz, doch der Wandel erfordert technisches Know-how, klare Zielbilder und die Fähigkeit, bestehende Systeme schrittweise in moderne, cloud-fähige Architekturen zu überführen. Ohne diese Grundlage bleiben Echtzeittransparenz und OEE-Optimierung oft Wunschdenken.
2.
Nicht die Technologie steht am Anfang, sondern das Zielbild. Mittelständler sollten klar definieren, welche Prozesse sie digitalisieren wollen – und welchen konkreten Mehrwert sie davon erwarten. MES ist kein Selbstzweck, sondern muss als integraler Bestandteil von Logistik, Qualitätsmanagement und Instandhaltung gedacht und umgesetzt werden. Mittelständische Fertigungsbetriebe sollten SAP nicht als starres, monolithisches System verstehen.
Vielmehr bietet das SAP-Portfolio mit der Digital Manufacturing Suite moderne, cloud-basierte Lösungen, um gezielt Teilprozesse zu digitalisieren – skalierbar und nahtlos in bestehende SAP-Prozesse eingebunden. So können auch Mittelständler pragmatisch starten, erste Quick Wins realisieren und schrittweise wachsen.
3.
KI wird zur treibenden Kraft im Manufacturing Operations Management-Umfeld (MOM) – vor allem, wenn sie intelligent mit Echtzeitdaten verknüpft wird. Ein Beispiel: KI-Modelle analysieren live die Fertigungsdaten, erkennen Muster, optimieren automatisch Stammdaten und verbessern so die Produktionsplanung um bis zu 20 Prozent. Das erhöht nicht nur die Effizienz, sondern auch die Liefertermintreue (OTIF). Künftig gewinnen selbstoptimierende Produktionssysteme an Bedeutung, also Systeme, die sich dynamisch an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen und Ende-zu-Ende-gedacht sind: vom Produktdesign über die Fertigung bis zur Auslieferung. Eine zentrale Rolle spielen dabei digitale Zwillinge, die als virtuelle Abbilder von Produkten und Prozessen Simulationen, Optimierungen und datenbasierte Entscheidungen ermöglichen.

1.
Mario Hermeling
Geschäftsführer bei IDAP
Bild: IDAP
Eine aktuelle Herausforderung ist die wachsende Komplexität der Produktionsprozesse. Viele Unternehmen kämpfen damit, ihre SAP-Systeme an cloud-basierte Architekturen anzupassen, ohne den laufenden Betrieb zu stören. Zudem müssen SAPLösungen oft in eine heterogene IT-Landschaft integriert werden, in der auch Altsysteme weiterlaufen. Schließlich erfordert die zunehmende Nutzung von Echtzeitdaten eine leistungsfähige Infrastruktur, die in vielen Werken erst noch aufgebaut werden muss.
2.
Mittelständische Fertigungsbetriebe sollten vor allem darauf achten, ihre SAP-Lösungen an den eigenen Geschäftsprozessen auszurichten, anstatt Standardfunktionen einfach zu übernehmen. Eine frühzeitige Einbindung und Schulung der Mitarbeitenden ist entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg der digitalen Transformation. Bei begrenztem Budget empfiehlt sich ein schrittweiser Roll-out mit klar priorisierten Projekten. Eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen SAP-Partnern wie der IDAP hilft, typische Implementierungsfehler zu vermeiden. Ebenso sollten Betriebe bei ihrer Lösung auf Skalierbarkeit achten, um zukünftige Anforderungen ohne teure Systemwechsel abdecken zu können.
3.
In den kommenden Jahren wird die Fertigungsindustrie von digitalen Innovationen geprägt sein. Technologien wie KI und IIoT ermöglichen eine intelligentere, vernetzte und vorausschauende Produktion. Cloud-Technologien und modulare SAP-Architekturen mit Echtzeitverarbeitung sorgen für mehr Flexibilität und Geschwindigkeit. Zudem erwarten wir Fortschritte in der Visualisierung und Steuerung über mobile Endgeräte und AR. Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und digitale Weiterbildung werden zunehmend zu strategischen Erfolgsfaktoren.
Expertenumfrage: SAP-Lösungen in der Fertigungsindustrie

1.
Kai Roßnagel
Senior Manager SAP Production & Logistics bei MHP
Bild: MHP
Ein häufiges Thema ist die Akzeptanz von Cloud-Lösungen. Viele Unternehmen haben Sicherheitsbedenken und zweifeln an der Cloud-Verfügbarkeit im Produktionsprozess. Dabei sind diese Vorurteile meist unbegründet, da moderne Cloud-Lösungen hohe Standards in puncto Sicherheit und Ausfallschutz bieten. Eine weitere Herausforderung ist die Datenqualität. Viele Firmen unterschätzen, wie stark eine schlechte oder inkonsistente Datenbasis die Effektivität von SAP-Anwendungen einschränken kann. Fehlerhafte Daten führen zu ineffizienten Prozessen und verhindern, dass die Systeme ihr volles Potenzial ausschöpfen.
2. Eine erfolgreiche Implementierung basiert auf einheitlichen Prozessen und Abläufen sowie der Nutzung von SAP-Standards. Dadurch reduzieren Unternehmen den Aufwand, vermeiden teure Individuallösungen und schaffen eine solide Grundlage für die Digitalisierung. Ebenso wichtig ist die Beteiligung der Mitarbeitenden. Die Einbindung der Belegschaft
in den Digitalisierungsprozess stärkt nicht nur die Akzeptanz neuer Systeme, sondern erhöht auch die Motivation, aktiv an der Transformation mitzuwirken. Das sorgt langfristig für eine reibungslose Einführung und Nutzung der SAP-Anwendungen.
3.
Künstliche Intelligenz (KI) wird auch in der Fertigungsindustrie eine zentrale Rolle spielen. Sie ermöglicht eine automatisierte Entscheidungsfindung und die Optimierung von Prozessen, sei es in der Produktion oder in der vorausschauenden Wartung. Ein weiterer Gamechanger sind digitale Zwillinge. Diese virtuellen Abbilder von Produktionssystemen erlauben Simulationen und Optimierungen in Echtzeit, was die Effizienz und Flexibilität erheblich steigert.

1.
Leon Reich
Senior Consultant Digital Supply Chain bei NTT DATA Business Solutions Bild: NTT DATA Business Solutions
Der Einsatz von SAP in der Fertigungsindustrie bietet klare Vorteile, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Die Umstellung auf moderne Systeme wie S/4HANA erfordert eine gut durchdachte Strategie und eine gezielte Nutzung vorhandener Ressourcen. Mit einer strukturierten Roadmap lässt sich
Wie Weltmarktführer effizient, flexibel und KI-gestützt produzieren
Vom Legacy-MES zur Smart Factory in der Cloud & synchronisierter Supply Chain
Trebing + Himstedt ist Berater für die digitale Transformation von produzierenden Weltmarktführern zur Sustainable Supply Chain mit dem Kern einer intelligenten Fabrik. Durch agiles Vorgehen und Pioniergeist schaffen wir seit über 30 Jahren gemeinsam Innovationen, die begeistern und frühzeitig Mehrwerte generieren. Wir nennen es Wow + Now.
Innovationen powered by SAP
Um intelligente Fabriken in einer vernetzten, synchronisierten Wertschöpfungskette zu realisieren, nutzen wir das Cloud-Innovations-Portfolio von SAP für die Digital Supply Chain auf Grundlage der SAP Business Technology Platform, zum Beispiel SAP Digital Manufacturing (SAP DM) sowie die Process-MiningTechnologie von Celonis. Mit lang-
jähriger Expertise begleiten wir Sie auf dem Weg vom Legacy-MES zur zukunftssicheren Produktions-IT und in die Cloud.
Der Weg zum Next-Gen Manufacturing

Eine integrierte, datengetriebene Fertigung ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit industrieller Unternehmen. Sie ist Bestandteil einer vernetzten Wertschöpfungskette – mit durchgängiger Transparenz vom Produktdesign bis zum Shopfloor, Echtzeitsteuerung, vernetzter Produktionsplanung und KI-gestützter Optimierung. So lassen sich Durchsatz und Ressourceneinsatz gezielt optimieren mit bis zu -10 Prozent Produktionskosten pro Einheit und 18 Prozent höherer Werksauslastung. Als Tochter von cbs – Corporate Business Solutions –begleiten wir Sie entlang der gesamten Supply Chain: von der Strategie

bis zur Umsetzung von Design to Operate. Entwickeln und realisieren Sie gemeinsam mit uns diese Zukunfts-Perspektive. Erhalten Sie über den QR-Code Insights, Updates und Einladungen rund um die digitale Transformation zu intelligenten Fabriken.
Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG
Wilhelm-Hennemann-Straße 13, D-19061 Schwerin
TEL.: +49 (0)3 85 / 3 95 72-0
E-MAIL: hallo@t-h.de
www.t-h.de
Bild:
Trebing + Himstedt
ANZEIGE
FRAGEN AN DIE EXPERTEN
1 Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie beim Einsatz von SAP-Lösungen in der Fertigungsindustrie?
2 Was sollten insbesondere mittelständische Fertigungsbetriebe beachten, die ihre Produktionsprozesse mit SAP-Anwendungen steuern wollen?
3 Welche Innovationen, die den digitalen Wandel in der Fertigungsindustrie vorantreiben werden, erwarten Sie in den kommenden Jahren?
dieser Wandel effizient gestalten und als Chance für nachhaltige Verbesserungen nutzen. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Qualität der Daten. Nur mit konsistenten und gepflegten Stammdaten können Fertigungsaufträge zuverlässig im Produktionssystem abgebildet werden. Frühzeitige Datenanalysen und Bereinigungen helfen, spätere Fehler zu vermeiden.
2.
Mittelständische Fertigungsbetriebe sollten bei der Einführung von SAP-Anwendungen eine klare Roadmap mit definiertem Projektumfang erstellen. Eine strukturierte Bewertung der Aufwände zum Beispiel durch T-Shirt-Sizing hilft bei der Planung. Der Zugriff auf bewährte Best Practices erleichtert die Umsetzung und reduziert Risiken. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wie NTT DATA Business Solution unterstützt dabei, die passenden Lösungen effizient zu implementieren.
3.
Der digitale Wandel in der Fertigung wird zunehmend durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), und Low-Code-Plattformen geprägt. Ergänzend gewinnen IoT- und Edge-Technologien an Bedeutung, da sie Echtzeitdaten direkt aus der Produktion liefern und fundierte Entscheidungen ermöglichen. Auch der digitale Zwilling entwickelt sich weiter: Statt wie früher nur ein einfaches Abbild zu sein, wächst er zu einem umfassenden Modell, das Stammdaten, Echtzeitinformationen und Simulationen vereint und dadurch Optimierungen vorausschauend ermöglicht.

1.
Jonas Voss
Prokurist von Quality Miners Bild: Quality Miners
Die größte Herausforderung liegt in der Überführung historisch gewachsener, häufig stark angepasster SAPSysteme in eine zukunftsgerichtete, standardisierte Architektur. Gerade in QM & QS fehlt es vielen Unternehmen an flexiblen, praxisnahen Lösungen zur Anbindung des Shopfloors. Die Kluft zwischen SAP-Logik und realen Produktionsprozessen erschwert eine durchgängige Digitalisierung.
2.
Wichtig ist eine klare Trennung zwischen transaktionaler ERP-Logik und operativen Anforderungen im Shopfloor. Mittelständische Unternehmen sollten konsequent auf SAP-Standards setzen, diese jedoch gezielt durch modulare Subsysteme beziehungsweise Composables ergänzen – um Prozesse flexibel und effizient abzubilden, ohne den SAP-
Standard zu verändern. Entscheidend ist, dass keine parallelen IT-Welten entstehen, sondern eine konsistente, erweiterbare Systemlandschaft.
3.
Wir erwarten eine zunehmende Automatisierung repetitiver Aufgaben durch KI-gestützte Assistenzsysteme. Das zeigt sich beispielsweise schon heute bei der Prüfplanerstellung oder der Merkmalsextraktion aus Zeichnungen. Parallel dazu wird die Integration von Sensorik, Fertigungshilfsmitteln, Mess einrichtungen und weiteren Datenquellen aus der Fertigung zum neuen Standard: Qualität entsteht im Prozess, nicht erst bei der Endkontrolle. Systeme, die Daten kontextbasiert dokumentieren, intelligent aggregieren und vollständig rückverfolgbare Ergebnisse in SAP bereitstellen, werden den Unterschied machen. Entscheidend ist, dass diese Technologien für den Mittelstand wirtschaftlich tragfähig und administrierbar bleiben.

1.
Detlef Helms
Business Development Manager SAP Supply Chain bei SWAN Bild: SWAN
In der Produktionssteuerung auf Shopfloor-Ebene setzen Unternehmen bislang selten auf SAP. Wer jedoch Prozesse vom Lager bis zum Endprodukt durchgehend steuern möchte, benötigt eine Integration der verschiedenen Lösungsbausteine mit SAP S/4HANA als ERP-Kern, SAP Digital Manufacturing (SAP DM) für die Produktionssteuerung und Embedded EWM für die Logistik. Dieses enge Zusammenspiel erfordert eine präzise Vorbereitung – technologisch wie organisatorisch. Etwa bei der Migration bestehender MES/BDE Systeme und der Anpassung an SAP-Standardprozesse zur materialflussorientierten WIP-Steuerung. Neben einem tiefen fachlichen und technologischen Know-how braucht es auch viel Fingerspitzengefühl beim Change-Management, um eine hohe Akzeptanz der Belegschaft für neue Abläufe zu sichern.
2.
Durchgängige End-to-End-Prozesse, saubere Datenflüsse und benutzerfreundliche Oberflächen sichern effiziente Prozesse und Arbeitsabläufe. Besonders mittelständische Unternehmen profitieren oftmals bereits von SAP-Standards. Daher sollten sie unbedingt vorab prüfen, ob und für welche Prozesse diese Standards tatsächlich angepasst werden müssen, um messbaren Mehrwert zu liefern.
3.
SAP setzt heute auf eine cloud-basierte modulare Architektur, die den Einsatz von KI durch die entsprechende Datenqualität ermöglicht. Durch die Verbindung der SAPDatenbasis mit marktverfügbaren KI-Modellen lassen sich Unternehmens- und globale Daten verknüpfen, in Echtzeit auswerten und für präzisere Prognosen nutzen. Das führt zu besseren Entscheidungen, unterstützt eine proaktive Prozesssteuerung sowie kürzere Innovationszyklen. Wichtige Treiber sind dabei auch die IoT-gestützte Erfassung von Maschinen- und Sensordaten, Echtzeitprognosen für Lieferungen und Absätze sowie die flexible Skalierbarkeit der Cloud-Lösungen.
Expertenumfrage: SAP-Lösungen in der Fertigungsindustrie SAP

1.
Andreas Zollner
Business Lead Produktion und MES bei T.CON Bild: T.CON
SAP ist grundsätzlich stark bei Lösungen für die Fertigungsindustrie. Der entscheidende Faktor liegt jedoch darin, branchenspezifische Anforderungen präzise in SAPProzesse, -Objekte und Best Practices zu übersetzen. Bei diskreten Prozessen, also wenn aus vielen Teilen ein Endprodukt entsteht, funktioniert das hervorragend mit SAP-Standardtools. Herausfordernd wird es, wenn aus wenigen großen Ausgangsteilen viele kleine Endprodukte entstehen – etwa in der Rollen- und Formatfertigung. Hier bestehen Lücken in Flexibilität und Prozessabbildung. Gefragt sind passendes Tooling und das richtige Know-how über branchenspezifische Fertigungsund SAP-Prozesse.
2.
Viele Unternehmen haben bei SAP die Erwartung, dass eine Lösung ‚von der Stange‘ alle Anforderungen automatisch abdeckt. Doch ein Unternehmensstandard ist nicht automatisch ein Industriestandard. Wer nur einen generischen
Ansatz übernimmt, riskiert später hohe Aufwandsanpassungen. Mittelständische Fertiger sollten daher prüfen, wie weit Standardprozesse tragen – und an welchen Stellen spezifische Ausprägungen unverzichtbar sind. Ziel ist eine Balance: so viel Standard wie möglich, so viel Individualisierung wie nötig. Die Kunst besteht darin, seine Kernprozesse präzise zu analysieren und bewusst zu entscheiden, wo eine Standardlösung reicht und wo Ergänzungen notwendig sind. So lässt sich Customizing auf ein Minimum begrenzen und dennoch sicherstellen, dass die SAP-Lösung den Unternehmensalltag realistisch abbildet.
3. Der digitale Wandel ist längst Realität – vor allem im ERP. In den kommenden Jahren wird dieser Schub verstärkt in die Fertigungssysteme wirken. ‚MES-to-Cloud Journeys‘ gewinnen an Bedeutung: Produktionsdaten wandern in die Cloud, wo sie flexibel verarbeitet und für Entscheidungen genutzt werden. Ein klarer Trend ist die stärkere Datenorientierung. Das heißt, Produktionssteuerung erfolgt künftig faktenbasiert, in Echtzeit und mit KI-gestützter Transparenz über den gesamten Shopfloor. Getrieben wird diese Entwicklung von Themen wie Nachhaltigkeit mit Zero-Waste-Ansätzen und CO₂-Reporting, Predictive Maintenance, digitalen Produktpässen oder Hyperpersonalisierung. Innovationen, die ohne moderne Technologien nicht denkbar sind.
Der Kompass für Ihren Erfolg mit SAP Digital Manufacturing
Die Lösung SAP Digital Manufacturing (SAP DM) bringt messbaren Mehrwert –wenn der Technologie-Wandel als systematischer Prozess mit 360-Grad-Blick organisiert ist.
Scheitern ist der Normalfall“, lautet eine Stammtischweisheit. Das können sich Unternehmen nicht leisten. Doch schätzen Experten, dass bis zu 70 Prozent der Projekte für eine digitale Transformation nicht zufriedenstellen oder gar scheitern. Hauptgrund: einseitiger Fokus auf Technologien. Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften –acatech – rät, auch organisatorische und kulturelle Bereiche eines Unternehmens zu transformieren, „um ein Höchstmaß an Flexibilität und Wandlungsfähigkeit zu erreichen“.

Konstantin Lackmann ist Vice President SAP Digital Manufacturing bei FORCAM ENISCO.
Bilder: FORCAM ENISCO ANZEIGE
Entscheidend ist der Prozess
Diesen Ansatz bietet FORCAM ENISCO. Die Smart-Factory-Experten begleiten die Einführung eines Manufacturing-ExecutionSystems (MES) wie SAP Digital Manufacturing (SAP DM) mit 360-Grad-Blick in acht systematischen Schritten.
In Workshops, Sprints und Erfolgskontrollen geht es vor allem um einen gemeinsamen klaren Kurs: passende Strategie und Technologie, adäquate Maßnahmen, machbare Roadmap.
Auch für begleitendes Change-Management durch interne oder externe Teams wird gesorgt.
„Ein modernes MES wie SAP DM bringt enorme Vorteile“, erklärt Konstantin Lackmann, Vice President SAP Digital Manufacturing bei FORCAM ENISCO. „So lassen

sich zum Beispiel Lieferketten resilienter organisieren, Energiekosten senken oder die Termintreue erhöhen.“
Namhafte Kunden bestätigen den Erfolg der Methode von FORCAM ENISCO.
E-MAIL: customerrelations@forcam-enisco.net www.forcam-enisco.net Mehr erfahren?


Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation im Shopfloor
Die Marktdynamik und die zunehmende Bedeutung der digitalen Transformation stellt produzierende Unternehmen vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig steigt die damit einhergehende Komplexität und digitale Prozesse sind alternativlos. Folglich muss auch die dafür benötigte IT-Infrastruktur wachsen. Die Fachabteilungen sind demnach gefordert, sich konsequent mit der Digitalisierung im Shopfloor auseinandersetzen, denn diese sind mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil jeder modernen Produktionsstrategie.
VON CHRISTIAN JESKE
Um den Ansatz der Digitalisierung effizient umzusetzen, bedarf es idealerweise einer herstellerneutralen Integration von Systemen und Maschinen, um die ERP-Welt (SAP) mit der Maschinen-Welt als auch IoT-Komponenten flexibel zu vernetzen. Hierbei verspricht ein ganzheitlicher Ansatz mit einer Industrie-4.0-Plattform wie Membrain-IoT eine erfolgreiche Umsetzung. Damit lassen sich Datensilos auflösen und relevante Informationen in Echtzeit für reibungslose Prozesse im Shopfloor bereitstellen.
Shopfloor benötigt Echtzeit-Daten
Oftmals scheitern Digitalisierungsprojekte bereits im Vorfeld aufgrund nicht abschätzbarer IT-Ressourcen. Meist ist es auch ein zentrales Problem, zu wenig Fokus auf die tatsächlichen Anwender zu legen, denn diese sind im Shopfloor oft keine Core User von SAP. Und gerade hier zeigen sich die Grenzen traditioneller IT-Lösungen: Es geht um Echtzeitfähigkeit, Robustheit und die Möglichkeit, Daten aus Maschinensteuerungen, Sensorik oder Bedienoberflächen zuverlässig zu erfassen und weiterzuverarbeiten.
In der Praxis erweist sich daher ein integrativer und produktionsnaher Digitalisierungsansatz mit einer modularen Industrie-4.0-Plattform als zielführend. Dieser berücksichtigt neben der klassischen ERPIntegration auch die direkte Anbindung von Maschinen und Anlagen – unabhängig vom Hersteller oder Steuerungssystem. So bieten zum Beispiel Live-Daten von Maschinen die automatische Betriebsstunden-Erfassung und ermöglichen bedarfsgerechte Wartungsmaßnahmen ohne zusätzliche Bedieninteraktion. Über die Steuerung

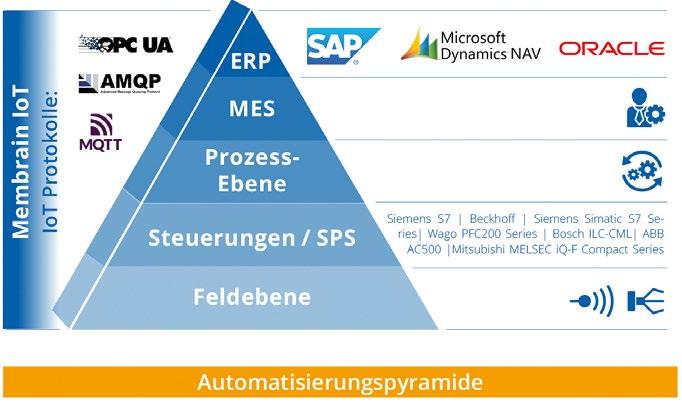
Instandhaltungsprozesse können mit einer mobilen Anwendung deutlich effizienter gestaltet werden.
(Schnittstelle) werden relevante Informationen kommuniziert und dem führenden System bereitgestellt. Dank der Echtzeitfähigkeit der Industrie-4.0-Plattform wird der Shopfloor „IoT-ready“ und das einfach, schnell und flexibel. So lassen sich diverse Prozesse wie Betriebszeitenverfassen, Störmeldungen anlegen oder Materialbewegungen buchen, autonom im führenden System (SAP) abbilden. Außerdem ist ein
Technische Zeichnung rein –
SAP-Prüfplan raus
Bis zu 90 Prozent schnellere Prüfplanung mit QPilot.
Mit dem QPilot wird Prüfplanung neu gedacht: Aus technischen Zeichnungen – egal ob PDF, Scan oder Vektorformat – generiert das System vollautomatisch normkonforme Prüfpläne für SAP QM. Möglich macht das eine KI-gestützte Merkmalsextraktion, die qualitätsrelevante Informationen erkennt, strukturiert und in die SAP-Prüfplanlogik überführt.
Das Ergebnis: Prüfpläne aller Zeichnungsformate inkl. Merkmale, Symbole, Toleranzen direkt in SAP
Keine manuelle Nacherfassung, kein Medienbruch
Standardisierte SAP-Integration via BAPI
Plangruppe, Plangruppenzähler und Vorgang über Weboberfläche bearbeiten
Steuerungsschlüssel bestimmen Verarbeitung und Verwendung Nutzungsbasierte Abrechnung –kein Projektaufwand notwendig
Die Automatisierungspyramide wird um IoTProtokolle und Membrain-IoT erweitert. Bilder: Membrain
nahtloser Übergang in mobile Prozesse gewährleistet, um Folgeprozesse zu starten oder Verantwortliche unmittelbar per Push-Meldung zu informieren.
Systemoffene Architektur statt starrer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen Skalierbarkeit spielt häufig bei Digitalisierungsprojekten eine zentrale Rolle. Denn eine IT-Architektur, basierend auf Punkt-

Einsatzbereiche: Die Software ist ideal für Unternehmen geeignet, die ihre Prozesse gezielt automatisieren und gleichzeitig flexibel in der Digitalisierung bleiben möchten. Ob Wareneingang, Fertigung oder Lieferantenqualifizierung – QPilot kann die Planungszeit um bis zu 90 Prozent reduzieren und erhöht im selben Zuge die Prozesssicherheit Die genaue Planart und Prüfherkunftsart, zum Beispiel SAP-Prüfplan, Arbeitsplan oder Instandhaltungsplan, richten sich nach Ihrer SAP-Konfiguration und dem jeweiligen Anwendungsfall.
Quality Miners unterstützt Sie gerne bei der Integration! In Verbindung mit einem
Technische Zeichnungen automatisch in SAPPrüfpläne überführen mit SQM360.
Bild: Quality Miners
Subsystem wie SQM360 wird daraus ein durchgängiger, digitaler QS-Prozess: von der Zeichnung über die Anbindung von Fertigungshilfsmitteln bis zur Datenerfassung und Prüflosbewertung.
Lassen Sie sich zeigen, wie einfach digitale Prüfplanung heute funktioniert. Infos: www.quality-miners.de/qpilot
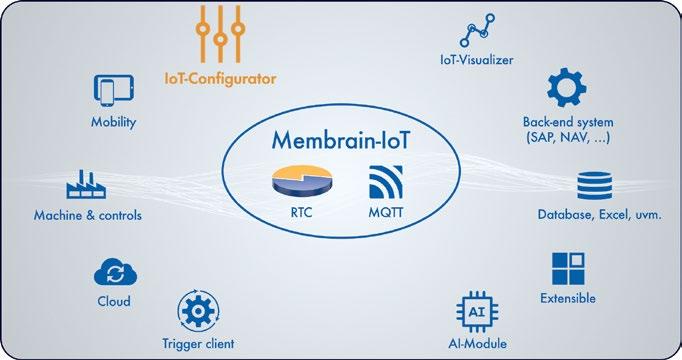
Bestandteile einer produktionsnahen Digitalisierung mit einer Industrie-4.0Plattform wie Membrain-IoT.
zu-Punkt-Verbindungen, gerät in komplexeren Umgebungen mit vielen Maschinen, Sensoren und Softwarekomponenten schnell an ihre Grenzen. Hier überzeugt eine Industrie-4.0-Plattform mit ihrer Leistungsfähigkeit. Dank sogenannten Publish/ Subscribe-Mustern, wie sie unter anderem über das MQTT-Protokoll realisierbar sind, werden Daten zentral gesammelt, verarbeitet und bedarfsgerecht verteilt –ohne dass Daten-Produzenten und -Konsumenten direkt miteinander kommunizieren müssen. Dies fördert nicht nur eine flexiblere Erweiterung, sondern reduziert auch die Fehleranfälligkeit im laufenden Betrieb. Plattformen, die diesen Ansatz unterstützen, können damit als zentrale Datendrehscheibe fungieren und sowohl ERP-Systeme als auch Edge-Devices oder IoT-Anwendungen bidirektional einbinden.
Mobile Anwendungen im Shopfloor: praktikabel statt komplex Mobility ist ein wesentlicher Baustein, wenn es um erfolgreiche Digitalisierung im Shopfloor geht. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Usability der Anwendung inklusive benutzerfreundlicher Funktionen für reibungslose Prozesse direkt vor Ort: ob Lagerverwaltung, Fertigungsdokumentation oder Instandhaltungsprozesse. Viele dieser Tätigkeiten lassen sich mit mobilen Anwendungen deutlich effizienter gestalten. Entscheidendes Kriterium dabei ist die Benutzerfreundlichkeit sowie Schnelligkeit gegenüber Papierprozessen: Anwendungen müssen intuitiv bedienbar sein, auch ohne spezielle IT-Vorkenntnisse, und gleichzeitig über transaktionssichere
Anbindungen an diverse Systeme (ERP, Steuerungen, Fileserver, usw.) verfügen.
Durch den Einsatz von Tablets, Smartphones oder Industriescannern können papierbasierte Prozesse vollständig ersetzt werden. Gleichzeitig bietet die Integration mobiler Apps die Möglichkeit, Daten in Echtzeit zu erfassen und Prozesse direkt vor Ort abzuschließen – ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Prozesssicherheit, Transparenz und Erhöhung der systemischen Datenqualität.
EINE „STATE OF THE ART“-IOT-PLATTFORM INTEGRIERT PROBLEMLOS EINE BESTEHENDE INFRASTRUKTUR, UNABHÄNGIG DAVON, WELCHES
ERP-SYSTEM IM EINSATZ IST.
Eigene Anwendung – schneller verfügbar dank No-Code-Tools
Mit zunehmenden Digitalisierungsbedarf steigt auch die Belastung in IT-Abteilungen. Da diese Ressourcen aber rar sind und um den daraus resultierenden Projektstau zu entschärfen, gewinnen sogenannte NoCode- oder Low-Code-Werkzeuge immer mehr an Bedeutung. Diese ermöglichen es, Prozesse über grafische Oberflächen (Browser-Applikationen) zu konfigurieren. So lässt sich beispielsweise eine produktionsbegleitende Checkliste per Mausklick selbst zusammenstellen. Ebenfalls kann für die Instandhaltung ein Live-Monitoring von kritischen Maschinen selbst eingerichtet werden. Dabei lassen sich mit einer Lösung wie Membrain-IoT Maschinen mit ERP-Strukturen verknüpfen. Daten werden dann kontinuierlich erfasst und bei vordefinierten Ereignissen autonom gemeldet.
Solche Werkzeuge befähigen Fachabteilungen, einfache Automatisierungsaufgaben selbstständig und ohne zeitlichen Verzug umzusetzen, ohne auf externe Unterstützung angewiesen zu sein. Und gerade bei häufig wechselnden Anforderungen im Shopfloor – etwa bei neuen Produkten oder Maschinen – ist diese Flexibilität ein entscheidender Vorteil. Voraussetzung ist jedoch, dass die eingesetzten Systeme offen, modular und skalierbar aufgebaut sind.
Digitalisierung erfordert
eine modulare IT-Architektur
Dabei gilt es bei einer produktionsnahen Digitalisierungsstrategie, mehrere entscheidende Aspekte zu berücksichtigen: Erstens ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, denn Digitalisierung macht nicht an Zuständigkeitsgrenzen halt. Zweitens muss die Lösung herstellerneutral ausgelegt sein, denn in der Regel findet man im Shopfloor ein Wildwuchs an Maschinen, Sensoren oder Edge-Geräten, die alle miteinander kommunizieren müssen. Drittens ist eine konsequente Nähe zum Shopfloor entscheidend: Denn gerade die Anwender vor Ort wissen, worauf es ankommt und können Prozesse und Abläufe definieren und automatisieren, aber nicht in übergeordneten Systemen.
Auch mit Blick auf die eingesetzten Werkzeuge ist Pragmatismus gefragt. Eine „State of the Art“-IoT-Plattform integriert problemlos eine bestehende Infrastruktur, unabhängig davon, welches ERP-System im Einsatz ist. Darüber hinaus bedarf es einer modularen Erweiterbarkeit wie Mobility, Maschinen, IoT-Komponenten sowie basierten Analysemethoden.
Dabei ist Digitalisierung im Shopfloor keine Vision mehr, sondern nimmt bereits Einzug in viele Unternehmen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Technologie, sondern vor allem die richtige Herangehensweise. Wer Digitalisierung ganzheitlich denkt, systemoffen plant und produktionsnah umsetzt, schafft die Grundlage für robuste, skalierbare und zukunftsfähige Produktionsprozesse, unabhängig davon, ob SAP oder ein anderes ERP-System zum Einsatz kommt. Der Einsatz von IoT, KI und mobilen Anwendungen bietet zahlreiche Chancen, vorausgesetzt, sie werden sinnvoll und praxisnah integriert. SG
CHRISTIAN
JESKE ist Director Marketing bei Membrain.
SAP Digital Manufacturing: Echtzeit-Transparenz und Automatisierung
In der modernen Fertigung ist Work-in-Process-Excellence (WIP-Excellence) ein entscheidender Hebel. Unternehmen benötigen ein hohes Maß an Effizienz und Flexibilität, um langfristig auf globalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit der richtigen Software gelingt es ihnen, ihre Bestände und Warenströme optimal zu steuern, Engpässe zu vermeiden und Produktivität sowie Qualität nachhaltig zu steigern. VON
DETLEF HELMS
Die moderne, cloud-basierte MESLösung SAP Digital Manufacturing (SAP DM) wurde gezielt zur Optimierung und Steuerung von Fertigungsprozessen entwickelt. Sie erlaubt die lückenlose Erfassung und Überwachung sämtlicher Fertigungsaufträge, Materialbewegungen und Maschinenzustände in Echtzeit. Dank nahtloser Integration von Shopfloor, Lager- und Logistiksystemen – etwa (embedded) SAP Extended Warehouse Management (EWM) – stellt SAP DM im Zusammenspiel mit der SAP Business Suite den durchgängigen Informationsfluss vom Auftrag über das Lager bis zur Produktion und dem termingerechten Versand sicher. Dadurch werden Engpässe, Verzögerungen oder Qualitätsabweichungen sofort sichtbar und lassen sich gezielt adressieren. Diese enge Verzahnung ist die Voraussetzung für eine Echtzeit-Steuerung der Produktion.
Zukunftssicher aufgestellt mit S/4 HANA und SAP Digital Supply Chain SAP DM lässt sich standardisiert in bestehende SAP-Systeme auf der S/4HANA-Plattform oder älteren SAP ECC-Systemen integrieren und skaliert mit den Anforderungen der jeweiligen Produktionsstätte. Unabhängig davon, ob eine SAP DM-Einführung vor, während oder nach der S/4HANA-Conversion stattfindet, profitieren Unternehmen schnell von der Implementierung – dank standardisierter Schnittstellen, harmonisierter Stammdaten, einer optimierten Prozessintegration zwischen ERP, SAP DM und SAP EWM sowie der zu Grunde liegenden konsistenten Datenbasis. Dies ermöglicht es ihnen, von Innovationen wie EchtzeitAnalysen, KI-gestützter Optimierung und durchgängigen End-to-End-Prozessen zu profitieren. Echtzeit-Überwachung und

SAP DM erlaubt die lückenlose Erfassung und Überwachung sämtlicher Fertigungsaufträge, Materialbewegungen und Maschinenzustände in Echtzeit.
-Analysen erlauben es, die Supply-ChainProzesse just in time effizienter zu gestalten und automatisiert auf Veränderungen im Tagesgeschäft zu reagieren.
Mit Implementierungspartner zur optimalen SAP DM-Prozess-Konfiguration Viele Unternehmen, die bereits ein MESSystem zur Betriebsdatenerfassung und/ oder Produktionssteuerung nutzen, stehen vor der Herausforderung, dieses abzulösen, damit SAP DM im Zusammenspiel mit der SAP Business Suite seine volle Leistungsfähigkeit im Bereich WIP-Excellence ausspielen kann. Bei der Implementierung von SAP DM ist es sinnvoll, auf einen erfahrenen SAPPartner zu setzen, der die End-to-End-Prozesse der operativen Supply Chain kennt und über SAP-Modulgrenzen hinaus vollständig abbilden kann. Die SWAN GmbH bietet diese breite Expertise für Ihre Supply Chain, bei der Anbindung von automatischen und manuellen ANZEIGE
Gewerken in den Bereichen SAP Logistics und Production.
Wettbewerbsfähig dank WIP-Excellence WIP-Excellence ist ein zentrales Element moderner Produktionslogistik. Das Zusammenspiel in der vollintegrierten SAP Digital Supply Chain von SAP DM, mit SAP EWM und SAP TM schafft eine transparente Datenbasis ohne Redundanzen für echtzeitoptimierte operative Produktionsprozesse. Gemeinsam mit einem erfahrenen Beratungs- und Implementierungspartner schaffen Unternehmen die Grundlage für durchgängige Transparenz, optimierte Prozesse und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Wer heute in die cloud-orientierte Digitalisierung und Integration seiner Wertschöpfungskette investiert, schafft die Basis für den Einsatz von KI und sichert sich entscheidende Vorteile für die Herausforderungen der industriellen Zukunft.
DETLEF HELMS ist Business Development Manager SAP Supply Chain bei der SWAN GmbH.
Bild: SWAN
Sieben Herausforderungen und Erfolgsfaktoren
Die sieben Hauptherausforderungen bei der Implementierung der Steuerungssoftware SAP DM umfassen strategische Abstimmung zwischen IT und OT, Überwindung der IT-Komplexität, Ausbau von Kompetenzen, realistische Planung, agile Umsetzung, Post-Go-LiveBetreuung und Change-Management. Die erfolgreiche Einführung erfordert eine strategische Planung und den Einbezug technischer, organisatorischer und personeller Faktoren.
Sie tauchen bei fast jedem digitalen Transformationsprojekt auf: Sieben zentrale Herausforderungen sind es, die es auf der Reise hin zu höherer Effizienz, Qualität und Kundenzufriedenheit zu bewältigen gilt. Wer die Herausforderungen kennt und richtig adressiert, legt das Fundament dafür, dass die Einführung des Manufacturing Execution Systems SAP DM zum Erfolg wird.
1. Strategie: IT und OT an einen Tisch bringen
In vielen Unternehmen verfolgen IT und OT unterschiedliche Zielsetzungen: Während OT auf reibungslose Produktionsprozesse fokussiert ist, liegt der Schwerpunkt der IT
auf Datenerfassung und -integration. Das führt nicht selten zu Missverständnissen.
Lösungsansatz: Das gemeinsame Verständnis zu Strategie, Zielen und Roadmap ist essenziell. Unternehmen sollten frühzeitig Workshops einplanen, in denen unter anderem IT- und OT-Verantwortliche gemeinsam die tatsächlichen Anforderungen definieren. Es gilt, ein klares Bild zu entwickeln, was machbar und sinnvoll ist – inklusive der Erkenntnis, dass möglicherweise nicht alles automatisiert werden muss. Praxisbeispiel: Das bereichsübergreifende Change-Team eines mittelständischen Maschinenbauers entschied nach einem gemeinsamen Scoping-Workshop, Handarbeitsplätze für bestimmte Qualitätsprü-

Wie ein Hürdenlauf: Bei jedem digitalen Transformationsprojekt wie der Einführung von SAP Digital Manufacturing gibt es zentrale Herausforderungen: Hürden. Sie lassen sich durch systematische Planung und Prozesse meistern. Bild: © canva.com
fungen zu erhalten. Der Automatisierungsaufwand wäre unverhältnismäßig hoch und nicht zielführend gewesen.
2. IT-Komplexität: Zwei Welten zusammenbringen
SAP DM bewegt sich im Spannungsfeld zweier komplexer Systeme: den IT-gestützten Softwarelandschaften und den meist historisch längerfristig gewachsenen OTStrukturen. Die Herausforderung besteht darin, beide Welten zusammenzuführen – technisch und prozessual.
DIE EINFÜHRUNG EINER MODERNEN STEUERUNGSSOFTWARE WIE SAP DIGITAL MANUFACTURING (SAP DM) VERSPRICHT UNTERNEHMEN ERHEBLICHE EFFIZIENZSTEIGERUNGEN –VORAUSGESETZT, DIE IMPLEMENTIERUNG GELINGT.
Lösungsansatz: In einem sogenannten Discovery-Workshop wird zunächst ein umfassendes Prozess-Zielbild erstellt. Dieses wird anschließend mit den funktionalen Möglichkeiten von SAP DM abgeglichen. Es gilt, zwei Perspektiven zusammenzuführen: Was wird benötigt – was bietet das System? So lassen sich systemkompatible Anforderungen ableiten. Unternehmen identifizieren und eliminieren überflüssige Anforderungen bereits in der Konzeptionsphase. Das spart Zeit und Budget.
3. Bereitschaft und Kompetenzen: Wissen gezielt aufbauen
Oft ist das Wissen über bestehende Systeme in einzelnen Köpfen konzentriert – das sogenannte „Herrschaftswissen“. Für die er-
VON OLIVER HOFFMANN

Anhand der Checkliste von Forcam Enisco können die zentralen Herausforderungen einer digitalen Transformation in der Produktion gemeistert werden. Grafik: Forcam Enisco/canva.com
folgreiche Einführung von SAP DM braucht es jedoch ein breit verteiltes Know-how.
Lösungsansatz: Zielgerichtete Schulungen sind Pflicht. Parallel sollte ein ChangeManagement-Team etabliert werden, das den Wissensaufbau systematisch begleitet.
Best Practice: In dem Pilotprojekt eines Herstellers aus der Kunststoffbranche wurden gezielt Key-User in interaktiven Schulungen zu Multiplikatoren entwickelt („Train the Trainer“). Zudem durften WerkerTeams das neue System in einem Testlabor spielerisch selbst entdecken – mit positiver Wirkung auf Motivation und Knowhow.
4. Realistische Planung statt Selbst-Überschätzung
Bei der Einführung von SAP DM handelt es sich nicht um Update, sondern um einen tiefgreifenden Wandel. Die Komplexität eines solchen Projekts wird jedoch oft unterschätzt. Das führt schnell zu überambitionierten Zeit- und Ressourcenplänen.
Lösungsansatz: Zwei initiale Workshops für Scoping und Definition helfen, das Projekt richtig zu dimensionieren. Dabei wird der Gesamtumfang analysiert und in verdaubare Teilpakete zerlegt. Ratsam ist es, das Gesamtprojekt in sechs bis acht unabhängige Phasen aufzuteilen. Das bringt einfachere Kontrolle, höhere Qualität und Motivation der Teams durch Teilerfolge. Motto: Lieber in kleinen Schritten vorangehen als groß zu scheitern.
5. Besser agil statt stur nach Plan
Ein häufiger Fehler ist die starre Umsetzung nach dem initialen Plan – ohne Raum für neue Erkenntnisse und Bedarfe. Beliebtes
Vorgehen: „Das Problem parken wir mal.“ Die Gefahr dabei: Es baut sich ein schwerfälliger IT-System-Koloss auf, der nur noch mit Mühe – oder gar nicht mehr - angepasst werden kann.
Lösungsansatz: Agiles Vorgehen in kurzen Sprints mit iterativen Zwischenergebnissen verhindert Überfrachtung. Im Projektalltag bedeutet das: Priorisierung der Funktionen, stufenweise Implementierung und regelmäßige Reviews.
Praxisbeispiel: Bei einem produzierenden Mittelständler wurde bei der gewünschten Funktion „Personalzeiterfassung“ die ursprüngliche Anforderung unvollständig formuliert. Dank agiler Methodik konnte die Funktion erweitert werden – inklusive automatischer Pausenerfassung und Integration in die Personaleinsatzplanung.

Für Autor Oliver Hoffmann ist ein häufiger Fehler bei der Implementierung die starre Umsetzung nach dem initialen Plan – ohne Raum für neue Erkenntnisse und Bedarfe. Bild: Forcam Enisco
6. Nach dem Go-live: Betreuung sicherstellen
Im Zuge eines Rollouts zieht das Projektteam nach erfolgreicher Implementierung in einem Bereich erwartungsgemäß zur nächsten Abteilung weiter. Herausforde -
rung: Der Bereich mit dem neu installierten System darf nicht ohne Begleitung allein gelassen werden. Wenn das Knowhow auch für den laufenden Betrieb nicht mehr vorhanden, wird das System möglicherweise nicht im Sinne der ursprünglichen Ziele genutzt.
Lösungsansatz: Ein interner Supportbereich stellt sicher, dass Rückfragen und Probleme auch nach einem Go-Live zeitnah gelöst werden können. Zudem ist es ratsam, eine zentrale Wissensplattform einzurichten, die als Anlaufstelle für alle Fachbereiche und Mitarbeitende fungiert. Beispiele sind ein „Unternehmens-Wiki“ und ein „Campus Digital Manufacturing“.
7. Change-Management: Akzeptanz als Schlüssel zum Erfolg Widerstände in der Belegschaft sind in den meisten Fällen die Folge mangelnder Kommunikation. Werden betroffene Teams nicht frühzeitig und aktiv einbezogen, kann das Projekt ins Stocken geraten oder sogar scheitern.
Lösungsansatz: Ein frühzeitig etabliertes Change-Management-Team fungiert als Schnittstelle zwischen Projekt- und Linienorganisation. Die Aufgabe: Stakeholder aktiv einbinden, Ängste adressieren, Nutzen aufzeigen.
Erfahrung aus der Praxis: Mit einem allseits anerkannten Change-ManagementTeam steigt die Akzeptanz für das Gesamtprojekt. Widerstände können früh erkannt und entschärft werden.
Fazit: Digitale Transformation ist ein Mannschaftssport
Die MES-Lösung SAP Digital Manufacturing bietet großes Potenzial – aber der Weg will klug geplant und gemeinschaftlich gegangen werden. Um den Mehrwert durch die Einführung eines MES zu erzielen, wird ein ganzheitlicher Implementierungsprozess benötigt, der technische, organisatorische und personelle Faktoren berücksichtigt.
Unsere Teams beraten nach einem systematischen Ansatz mit acht Dimensionen – von Strategie über Scoping bis Datenanalyse, begleitet von einem Change-Management. Dieser Ansatz hat sich bewährt, um den Erfolg einer neuen MES-Lösung in großen wie mittleren Unternehmen sicherzustellen. TB
OLIVER HOFFMANN ist Geschäftsführer des MES-Anbieters Forcam Enisco.
Prozesse brauchen Brücken(bauer)
– nicht nur Systeme
Software wird vielfach eingesetzt, doch nur selten entsteht daraus echte Wertschöpfung. Systeme allein reichen nicht –es braucht integrierte Prozesse und ein Supply Chain Management, das Planung, Fertigung und Logistik intelligent verbindet. Erst vernetzte Abläufe schaffen Transparenz, Effizienz und Zukunftssicherheit.
Alles hängt zusammen – aber nichts ist wirklich verbunden. Klingt vertraut? Willkommen in der Realität vieler mittelständischer Fertigungsunternehmen. SAP ERP ist eingeführt, Module für Logistik und Instandhaltung sind im Einsatz, das MES liefert Daten – irgendwie. Doch die Systeme reden nicht miteinander, die Prozesse sind lückenhaft, der Shopfloor hinkt hinterher.
Die digitale Transformation gleicht oft einem Puzzle mit hochwertigen Einzelteilen – aber ohne verbindendes Bild. Alle reden von durchgängigen Prozessen – doch was in der Theorie gut klingt, verliert in der Praxis schnell an Zugkraft: weil Planungsdaten veraltet sind, das MES isoliert arbeitet oder Lager- und Transportprozesse nicht integriert wurden.
Das Ziel: eine intelligente, reaktionsfähige Supply Chain – von der Produktidee über die Fertigung bis zur Auslieferung. SAP liefert dafür eine starke technologische Basis. Doch Standardsoftware allein reicht nicht. Wer echte Durchgängigkeit will, braucht mehr – vor allem jemanden, der die Sprache der Fertigung spricht.
Das Nervensystem moderner Produktion
Supply Chain Management wird oft mit Transport und Lagerhaltung gleichgesetzt. Doch für produzierende Unternehmen ist es längst viel mehr: Es ist die Fähigkeit, entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu planen, zu steuern und flexibel zu reagieren. Vom Einkauf über Produktionsplanung, Fertigungsausführung und Lagerlogistik bis zur Wartungsstrategie – alles ist Teil der Supply Chain. Alles beeinflusst sich gegenseitig.
Und genau hier liegt die Herausforderung: Diese Prozesse sind oft organisatorisch getrennt, technologisch fragmentiert und historisch gewachsen. Die Folgen:
Eine Vertriebsplanung, die nicht weiß, was realistisch produzierbar ist.
Planungsprozesse, die nicht wissen, ob Material oder Personal verfügbar sind.
Einkauf von Rohstoffen, der nicht optimal auf Bedarfe, Lieferzeiten und Lagerbestände abgestimmt ist.
Logistik, die mehr reagiert als agiert.
Zu viel schadensorientierte, schlecht planbare Instandhaltung anstatt vorbeugender Arbeiten.
Das Ergebnis: Mehr Aufwand. Weniger Produktivität. Und das permanente Gefühl, den tatsächlichen Hebel noch nicht gefunden zu haben.

DER T.CON SCM-DAY AM 29. OKTOBER 2025 Vertiefen. Vernetzen. Verstehen.
Erleben Sie live, wie integrierte SupplyChain-Prozesse aussehen – und welchen Unterschied sie machen. Fachvorträge, Praxisbeispiele, S.FACTORY-Führung, Networking. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Mehr Infos erhalten Sie über den QR-Code oder unter: https://www.tcon.com/tcon-scm-day-2025 Bild:

Zusammen unschlagbar: Beispiele aus der Praxis
Vier Praxisfelder zeigen, wie integrierte Prozesse im Alltag wirken:
1.Planung, die in der Realität ankommt
Mit SAP IBP und PP/DS sowie branchenspezifischen Erweiterungen, zum Beispiel TRIM SUITE für die Papier- und Folienindustrie, bringt T.CON eine Produktionsplanung auf den Weg, die tatsächlich steuerbar ist. In die Lösungen lassen sich kurzfristige Bedarfe, Maschinenausfälle und Verfügbarkeiten intelligent einfügen. Dies ermöglicht mehr Planungskontrolle.
2.Fertigung, die digital mitarbeitet
T.CONs MES CAT ist SAP-nativ (On-Premise, Private & Public Cloud fähig), modular aufgebaut und für echte Fertigungsbedingungen entwickelt – inklusive mobiler Anwendungen, smarter Werkerführung und Echtzeit-Rückmeldungen. Mit SMART IOT werden Maschinen- und Prozessdaten integriert, analysiert und für Entscheidungen nutzbar gemacht.
3.Logistik, die sich nicht im System verirrt
Die Integration von SAP EWM, TM und YardLösungen wird ergänzt durch eigene Apps wie ADVANCED LOADING. So entstehen vollständig digitale Prozesse von der Anlieferung, über die Produktionsversorgung bis zur Auflieferung an der Verladerampe – inklusive automatischer Warenausgangsbuchung, LKW-Identifikation und mobiler Beladedokumentation.
4.Instandhaltung, die mitdenkt
Ob klassisch via SAP PM oder als mobile Lösung mit Maintenance Apps – T.CON integriert Instandhaltung nahtlos in die Produktions- und Logistikprozesse. So werden Wartungen planbar, Informationen verfügbar und Maschinenverfügbarkeit messbar.
All das ist kein Zukunftsszenario. Es ist bei T.CON längst Realität – in unzähligen erfolgreichen Projekten quer durch die fertigende Industrie.
Standard kann viel, aber nicht alles SAP hat mit S/4HANA, IBP, EWM, TM, DM oder APM leistungsfähige Module auf den Markt gebracht. Doch wie bei einem modularen Baukasten gilt: Erst das passende Verbindungskonzept macht daraus ein funktionierendes System. Genau das liefert T.CON – mit seinen ergänzenden Lösungen, Templates, Schnittstellen, Integrationen und einem strategischem Gesamtblick.
Dabei bleibt T.CON immer SAP-nativ. Die Daten bleiben im SAP-Kern, die Oberfläche ist vertraut, die Prozesse sind upgradefähig. Kein Systembruch, keine zusätzliche Middleware, keine neue Insel.
Das Ergebnis: Ein digitales Rückgrat für Ihre Supply Chain – abgestimmt auf Ihre Branche, Ihre Abläufe, Ihre Ziele.
SAP und Fertigung zusammen unschlagbar machen Als SAP-Gold-Partner mit über 20 Jahren Erfahrung in der Fertigungsindustrie verbindet T.CON die Architektur der SAP-Systeme mit der Realität im Werk. Der entscheidende Unterschied liegt im Denken in durchgängigen End-to-End-Prozessen statt isolierter Module. Dieses verbindende Konzept ergänzt den SAP-Standard und macht die Supply Chain steuerbar und zukunftssicher.
Genau darin liegt die Stärke von T.CON: Unternehmen profitieren von durchdachten Lösungen, fundiertem Prozesswissen und zuverlässigem Service. Von der Roadmap über die Implementierung bis zum Application Management begleitet T.CON den digitalen Umbau mittelständischer Fertigungsunternehmen – pragmatisch, Hands-on und mit Blick auf den tatsächlichen Mehrwert.
Fazit: Die Zukunft der Fertigung ist vernetzt
Ob Lieferengpässe, Variantenvielfalt oder Maschinenstillstände: In der Supply Chain entscheidet sich, ob eine Fertigung effizient, flexibel und resilient bleibt. Wer seine Prozesse dort zusammenführt, wo heute noch Systemgrenzen verlaufen, gewinnt Klarheit, Tempo und Steuerbarkeit.
SAP liefert dafür das Fundament. T.CON baut die Brücken.
T.CON GmbH & Co. KG

Straubinger Straße 2, 94447 Plattling, Deutschland TEL.: +49 (0) 99 31 / 9 81-1 00 www.tcon.com
Face Value: KI optimiert Vorgabezeiten automatisch
Veraltete Vorgabezeiten können Produktionsplanung und Liefertreue beeinträchtigen. KI-gestützte Systeme nutzen vorhandene ERP- und MES-Daten, um Vorgabezeiten automatisch abzugleichen und zu optimieren, ohne auf manuelle Zeitstudien zurückzugreifen. Dies verbessert KPIs wie OEE und Stückkosten, hält Prozesse stabil und verlässlich. Der CBS Fast Value-Ansatz ermöglicht eine schrittweise Umsetzung zur Effizienzsteigerung in der Fertigung. VON FELIX DIECKMANN
Vorgabezeiten werden in vielen Fertigungsunternehmen einmal definiert und dann über Jahre hinweg nicht mehr hinterfragt. Mit der Zeit entstehen dadurch immer mehr Abweichungen zwischen geplanten Vorgabezeiten und tatsächlichen Bearbeitungszeiten. Die Folge: Veraltete Vorgabezeiten beeinträchtigen sowohl die Produktionsplanung als auch die Produktkostenkalkulation. Unnötige Wartezeiten, verlängerte Durchlaufzeiten oder eingeschränkte Liefertreue sind direkte Auswirkungen.
Die Ursachen liegen oft im Tagesgeschäft: Zeitaufnahmen sind aufwendig, binden wertvolle Ressourcen und lassen sich bei hoher Variantenvielfalt kaum wirtschaftlich umsetzen. Das Thema bleibt ungelöst. Vorgabezeiten werden übernommen, weiterverwendet oder geschätzt – selbst, wenn sie längst nicht mehr zur Realität passen. Dabei gibt es heute deutlich effizientere Wege, um Vorgabezeiten zu optimieren, ganz ohne klassische Zeitstudien mit der Stoppuhr.
Warum herkömmliche Methoden nicht ausreichen
In der Arbeitsvorbereitung ist die Problematik seit Langem bekannt: Die Erhebung und Pflege von Vorgabezeiten ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Besonders in der diskreten Fertigung, wo unterschiedlichste Produktvarianten und Fertigungstypen parallel laufen, ist eine systematische Zeitaufnahme kaum umsetzbar.
Die Folge: Vorgabezeiten veralten schleichend, Abweichungen zwischen Soll und Ist bleiben unbemerkt und führen zu fehlerhaften Planungen. Produktionsengpässe, unnötige Bestände und ungenaue Kalkulationen entstehen, weil die zugrunde liegenden Daten ihre Gültigkeit verloren haben. Dennoch wird das Thema oft aufgeschoben, nicht aus Desinteresse, sondern weil der Aufwand mit klassischen Methoden abschreckend wirkt.
Viele in der Arbeitsvorbereitung wissen, dass ihre Vorgabezeiten nicht mehr der Realität entsprechen. Auch das Bauchgefühl verrät, an welchen Arbeitsplätzen die größten Diskrepanzen auftreten. Doch eine
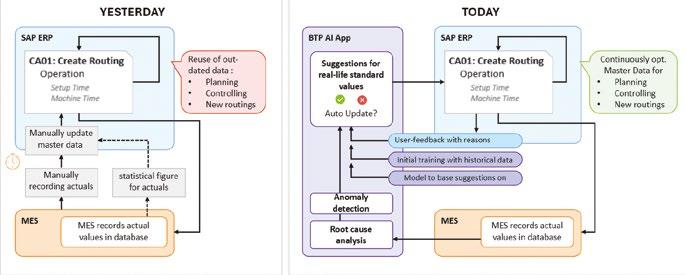
Die Grafik zeigt den Vergleich zwischen traditionellen und modernen Prozessen zur Erstellung von Routing-Operationen in SAP ERP. Links wird manuelle Datenverwaltung beschrieben, rechts die Integration einer BTP AI App, die mit Anomalieerkennung und Nutzerfeedback arbeitet.

praxistaugliche, kontinuierliche Lösung fehlt, der Satz „Eigentlich müssten wir das mal angehen, aber …“ steht sinnbildlich für das Problem. Und so bleiben wertvolle Potenziale ungenutzt. Zeit, die eigenen Vorgabezeiten zu optimieren – mit einem neuen Ansatz.
Der neue Weg: Systematisch die kritischsten Bereiche identfizieren Genau hier setzt ein moderner, KI-gestützter Ansatz an: Statt auf manuelle Zeitaufnahmen zurückzugreifen, nutzt die Lösung vorhandene Daten aus ERP-, MES-, MDEund BDE-Systemen. Diese Produktionsdaten sind in vielen Unternehmen bereits in guter Qualität verfügbar – insbesondere dann, wenn moderne Cloud-MES-Lösungen wie SAP Digital Manufacturing im Einsatz sind. Sie bieten eine verlässliche Datenbasis, auf der ein kontinuierliches Optimierungssystem aufbauen kann.
Der Abgleich von Vorgabezeiten und IstZeiten erfolgt automatisiert. Abweichungen werden systemgestützt erkannt, ohne dass die Arbeitsvorbereitung manuell analysieren muss. Die Lösung berücksichtigt dabei die realen Gegebenheiten im Shopfloor. Auch wenn Rückmeldedaten nicht immer vollständig oder perfekt sind, liefert das System wertvolle Hinweise zur Optimierung von Vorgabezeiten und identifiziert systematisch die kritischsten Bereiche.
Ein zentraler Baustein ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die KI erkennt Muster in den Abweichungen und generiert konkrete Vorschläge für realistische, optimierte Vorgabezeiten. Der Arbeitsvorbereiter behält dabei jederzeit die Kontrolle: Die Vorschläge können geprüft, angepasst und freigegeben werden. Zudem lassen sich die

Optimierungsvorschläge nutzen: Die KI schlägt realistische, datenbasierte Vorgabezeiten vor. Die Arbeitsvorbereitung entscheidet, welche Vorschläge übernommen werden oder wo gezielte Zeitaufnahmen erforderlich sind, etwa bei neuen, komplexen oder seltenen Prozessen. Zeitaufnahmen werden dadurch fokussierter und effizienter.
Dauerhafte Aktualisierung: In der finalen Phase wird der kontinuierliche Abgleich automatisiert. Vorgabezeiten werden dauerhaft aktuell gehalten, manuelle Pflegeaufwände reduziert.
Für mehr Effizienz im Shopfloor sorgen neben KI und auch valide Zeitdaten. So sieht der Pfad zu KI-optimierten Vorgabezeiten mit dem CBS Fast ValueAnsatz aus. Bilder: CBS
Ergebnisse gezielt in den KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) einbringen, für strukturierte und nachhaltige Prozessoptimierung.
Wertschöpfung durch valide Vorgabezeiten: Warum sich die Optimierung rechnet Realistische, aktuelle Vorgabezeiten sind ein zentraler Hebel für die Effizienz in der Fertigung. Sie bilden die Basis für belastbare Kapazitäts- und Terminplanung, für präzise Kalkulationen und für eine wirtschaftliche Steuerung des Shopfloors. Wer hier systematisch optimiert und automatisiert, schafft Freiräume für produktive Arbeit in der Arbeitsvorbereitung und eine valide Datengrundlage zur Planung von Ressourcen, Kundenterminen und Kosten.
VORTEILE DER KI-GESTÜTZTEN OPTIMIERUNG VON VORGABEZEITEN
Verlässliche Plan- und Kalkulationsdaten Wegfall manueller Zeitstudien – Fokus auf wertschöpfende Tätigkeiten Mehr Transparenz bei hoher Produktvielfalt
Reduzierte Wartezeiten, Puffer und Durchlaufzeiten
Stabilere Prozesse und bessere Ressourcennutzung
Direkte Wirkung auf OEE, Termintreue und Stückkosten
Skalierbare Prozessverbesserung ohne Systemwechsel

In Summe trägt die Optimierung von Vorgabezeiten direkt zur Verbesserung zentraler KPIs bei: OEE, Termintreue und Stückkosten lassen sich messbar beeinflussen, ohne ständige Zeitaufnahmen oder aufwendige Prozessänderungen, ausschließlich durch den fortlaufenden, automatisierten Abgleich von Stamm- und tatsächlicher Produktionsdaten.
Der Fast Value-Ansatz von CBS
Der Einstieg in diesen neuen Weg ist einfacher als gedacht. Der Fast Value-Ansatz von CBS ermöglicht eine schrittweise, zielgerichtete Umsetzung. In mehreren Etappen – sogenannten Plateaus – wird messbarer Mehrwert geschaffen: Abweichungen sichtbar machen: Im ersten Schritt erfolgt der systematische Abgleich zwischen Vorgabezeiten und tatsächlichen Rückmeldedaten. Dadurch entsteht ein belastbares Bild, an welchen Stellen signifikante Abweichungen auftreten und somit eine fundierte Grundlage für den nächsten Schritt. Ursachen analysieren: Im Anschluss werden die Gründe für die Abweichungen untersucht: veraltete Arbeitspläne, veränderte Abläufe oder neue Varianten, all das kann Einfluss auf die Gültigkeit der Vorgabezeiten haben.
Bereits nach wenigen Wochen sind erste Effekte im Tagesgeschäft sichtbar. Die Lösung ist flexibel und skalierbar – weitere Fertigungsbereiche lassen sich Schritt für Schritt integrieren.
Fazit: Vorgabezeiten neu denken und gezielt optimieren
Vorgabezeiten optimieren muss kein ungelöstes Dauerproblem bleiben. Mit einem KI-gestützten Ansatz und einem strukturierten Fast Value-Vorgehen lassen sich Vorgabezeiten effizient, verlässlich und nachhaltig verbessern. Die Stoppuhr hat dabei ausgedient, stattdessen wird die Optimierung Teil des digitalen ShopfloorManagements.
Der Weg ist praxisnah, effizient und zeigt schnell Wirkung, auch dann, wenn Rückmeldungen im Alltag nicht immer perfekt sind. Die Lösung schafft Transparenz, erleichtert die Arbeit der Arbeitsvorbereitung und unterstützt den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So wird die Optimierung von Vorgabezeiten zum Erfolgsfaktor für stabile, effiziente Fertigungsprozesse. TB
FELIX DIECKMANN ist Senior Consultant bei CBS – Corporate Business Solutions.
Mit top MES das gesamte Potenzial der Produktion erschließen
Mit dem Manufacturing-Execution-System top MES lassen sich sämtliche Abläufe der Produktion in Echtzeit abbilden.
Die digitalen Prozesse erzeugen höchste Transparenz und Effizienz – und sind von SAP zertifiziert.
Vielen Unternehmen fällt es schwer, die Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse voranzubringen. Dafür gibt es vielfältige Gründe: Die Komplexität der Prozesse nimmt zu, beispielsweise durch stetig wachsende Produktvielfalt, mehr und technologisch anspruchsvollere Produktionstechnologie, und vor allem durch das Einbinden und Orchestrieren von immer mehr involvierten Personen und Unternehmensbereichen. Heterogene Applikationen, die bestenfalls mit Schnittstellen verbunden sind, lassen Systeme nur rudimentär miteinander kommunizieren. Uneinheitliche Datenstrukturen und unüberwindbare Systemgrenzen machen eine echte Digitalisierung der Produktionsprozesse und deren Integration in den Gesamtkontext des Unternehmens unmöglich.
Integration schaffen und Schnittstellen abschaffen
Wer MES „stand-alone“ denkt, isoliert Fertigung, Produktion oder Montage schon grundsätzlich vom Rest des Unternehmens. Bei besonders gut funktionierenden Systemen dagegen fließen die Daten und Funktionen entlang der gesamten Prozesskette übergangslos und bidirektional durchs ganze Unternehmen.
top MES ist zu 100 Prozent in SAP integriert. Es benötigt deswegen kein separates oder eigenständiges System, und arbeitet direkt mit den Daten und Funktionen des ERP-Systems. top MES ist integraler Bestandteil von SAP ERP und S/4HANA.
Keine Redundanzen, sondern Single Source of Truth
Um eine Produktion zu digitalisieren, braucht es eine Vielzahl von Funktionalität, wie sie in einem klassischen ERP-System nicht verfügbar ist. top MES liefert diesen Funktionsumfang direkt ins SAP-System – mit einem entscheidenden Zusatz-Aspekt: Die Lösung setzt ihre Funktionen und Prozesse nicht nur direkt auf den SAP-Stamm- und -Bewegungsdaten auf, sie liefert sämtliche Ergebnisse auch sofort wieder in die Original-SAP-Belegwelt zurück.
Nur einige wenige Beispiele dazu:
Stammdaten werden nur an einer Stelle im SAP-Standard gepflegt.
Der Fertigungsfortschritt schlägt sich konsistent in den SAP-Produktionsdaten nieder.
Ist-Kosten der Herstellung werden differenziert im SAP-Controlling gebucht.
Materialbestände, -verbräuche und -zugänge sind synchron zur SAP-Bestandsführung. Messergebnisse finden sich im SAP-QM wieder. Die Maschinen- und Werkzeugnutzung triggert die SAP-Instandhaltung. etc.

top MES: Manufacturing Execution mitten im SAP-System integriert.
Bild: top flow
/ S/4HANA

Mehr Funktionalität bei entscheidend weniger Komplexität
Manufacturing Execution ist die zentrale Daten- und Funktionsdrehscheibe in der vernetzten Produktion. Eine Herausforderung dabei ist, die Technologien im Shopfloor mit dem ERP-System zu verbinden. top MES wurde ausschließlich für SAP und mit SAP-Technologie entwickelt. Es eliminiert damit eine komplette Kommunikationsebene und vereinfacht den Systemaufbau sowie den System-Betrieb entscheidend.

Weil top MES auf den Objekten und Funktionalitäten von SAP ERP beziehungsweise SAP S/4HANA aufsetzt und diese gezielt erweitert, passt es perfekt zum bestehenden Know-how Ihrer Mitarbeiter: Anwender finden ihre MES-Funktionen im SAP UI eingebettet, Key User die Parametrisierung in SAP-Tabellen abgelegt, und der Systembetrieb wird von der SAP-Basis automatisch miterledigt.

Maschinen und Anlagen
einfach einbinden
top MES setzt bei der Anbindung von Maschinen und Anlagen konsequent auf die anerkannten Industriestandards – allen voran auf OPC UA. Damit ist es Ihnen möglich, nahezu alle Assets in einen durchgängigen digitalen Prozess in Ihr SAP-System einzubinden.
Wissen, was passiert: Analysieren und Visualisieren
Umfassende Analysemöglichkeiten und einfache intuitive Bedieneroberflächen zeichnen top MES besonders aus. Dashboards



und Berichte basieren auf Echtzeitdaten und liefern eine fundierte Entscheidungsbasis für die Produktionsverantwortlichen. So stellt top MES beispielsweise die Overall Equipment Effectiveness von Ihren Maschinen und Anlagen standardmäßig bereit und bietet vielfältige Möglichkeiten zu deren Analyse und Visualisierung.
Zusätzlich zu den Standardanalysen stellt top MES eine flexible Analytik-Lösung zur Verfügung, mit der Dashboards und Reports völlig flexibel gestaltet und aufgebaut werden können – auch ohne Programmierkenntnisse. Ziel ist es, den einzelnen Zielgruppen, vom Werker bis zum Manager, sämtliche Informationen individualisiert zur Verfügung stellen zu können. Von den Kennzahlen an der einzelnen Maschine über den digitalen Info-Punkt zur Abteilungsbesprechung bis zur mobilen Analyse auf dem Smartphone.
Maßgeschneidert anstatt nur Durchschnittsmaß
Mit top MES erhalten Sie ein vollständig in SAP integriertes Manufacturing-Execution-System, das für Sie zur Basis einer vollständigen Digitalisierung der Produktion wird. Es bringt um-
fassende Standardfunktionalität mit, die sich in kürzester Zeit aktivieren und direkt nutzbar machen lassen.
Ist damit alles erledigt? Unter Umständen nicht! Was, wenn Ihr Prozess an einigen Stellen „besonders“ ist? Wenn Sie erfolgreich sind, weil Sie Dinge anders machen als andere? Müssen Sie diese Aspekte dann aussparen, weil sie nicht zum Standard passen?
Die Funktionen von top MES sind in hohem Maße erweiterbar. Bei Bedarf können Prozesse genau dort angepasst werden, wo dies entscheidend zur Zielerreichung beiträgt. Umfang und Detaillierung von Erweiterungen liegen dabei völlig in Kundenhand – nicht nur im Sinne der Definition, sondern auch bei der Umsetzung.
Open Source gegen technologische Blackbox
top MES wurde mit den Entwicklungswerkzeugen ABAP und UI5 realisiert, denselben Standards wie ein S/4HANA-System. Offene Technologie also, die global zum Standard für Unternehmenssoftware zählt. Die Architektur von top MES ist dabei so entwickelt, dass nahezu beliebige Erweiterungen implementiert werden können, OHNE dass der von top flow ausgelieferte Standard modifiziert wird. Besser noch: Erweiterungen kann jeder vornehmen, der diese offenen SAP-Technologien beherrscht, also auch direkt von Know-howTrägern des Kunden.
top MES-Lösungen sind jederzeit releasefähig, auch wenn Erweiterungen implementiert wurden, und das ist im dynamischen S/4HANAUmfeld besonders wichtig.
SAP Certified: Integration with RISE with SAP S/4HANA Cloud
Qualität nur zu prüfen, bringt nichts, sie muss hergestellt werden! Diese Binsenweisheit gilt nicht nur für das produzierende Gewerbe, sondern auch für die Software-Entwicklung. Wer allerdings Qualität produziert, tut gut daran, dies immer wieder zu überprüfen. Je nach Einsatzzweck ist Qualität auch völlig unterschiedlich zu bewerten. Wenn ein Produkt gut für die Elektronik-Branche ist, passt es noch lange nicht in die Medizintechnik.
top MES passt genau zu SAP! Das lassen wir permanent überprüfen und von SAP bestätigen. Die Lösung ist immer für die neuesten SAP-on-premise- und Private-Cloud-Versionen zertifiziert.
flow GmbH

Hauptstraße 100, 88348 Bad Saulgau
TEL.: +49 (0) 75 81 / 20 29 5-0
E-MAIL: info@top-flow.de

S/4HANA-Migration und Digitalisierung im Gleichschritt
Viele Industrieunternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung: Die SAP-ERP-Landschaft muss auf S/4HANA migriert werden, während gleichzeitig Qualitätssicherung (QS) und Produktion digitalisiert werden. Eine hybride Strategie – etwa der parallele Einsatz eines QM-Subsystems – ermöglicht eine zukunftssichere QS und reduziert Migrationsrisiken. VON JONAS VOSS

Subsysteme verbinden QS-Prozesse mit SAP-Standards.
Noch immer setzen viele Unternehmen auf SAP ECC. Laut DSAG nutzten 2024 rund 68 Prozent der Unternehmen dieses System. Die langjährige Nutzung und starke Individualisierung erschweren die Umstellung. SAP selbst bestätigte 2023, dass 98 Prozent der Systeme modifiziert sind.
Für die Migration haben sich drei Ansätze etabliert: Greenfield (Neuimplementierung, flexibel, aber aufwendig), Brownfield (schneller, übernimmt jedoch Altlasten) und Hybrid (Selective Data Transition, kombiniert beide Methoden, erfordert präzise Planung).
Herausforderungen für Unternehmen
Der zögerliche Umstieg hat mehrere Gründe. Unternehmen fürchten hohe Kosten, Risiken und Produktionsunterbrechungen, zudem erfordert die Migration Schulungen, neue Schnittstellen und die IT muss erneuert werden. Zwar wurde der ECC-Support bis 2027/2030 verlängert. Dennoch drängt die Zeit – auch wegen regulatorischer Anforderungen und zunehmender Notwendigkeit zur Standardisierung.
Auf der anderen Seite stehen die Ziele der S/4HANA-Migration: IT-Modernisierung, Standardisierung historisch gewachsener Prozesse, bessere Reaktionsfähigkeit und Integration neuer Technologien wie KI oder IIoT.
Qualitätsmanagement & Digitalisierung im Shopfloor
Die Ablösung papierbasierter Checklisten und die Vernetzung ermöglichen proaktives Eingreifen im Shopfloor. Digitale Erfassung verbessert Normerfüllung, Rückverfolgbarkeit und Reaktionszeit.
MES- oder CAQ-Systeme können diese Anforderungen zwar abdecken, doch ihre Anbindung wird durch laufende SAP-Migrationen erschwert oder als zusätzliche Last empfunden. Eigenentwicklungen schaffen kurzfristig Abhilfe, bleiben aber oft risikobehaftete Insellösungen.
Cloud-Technologien für dezentrale QS
Unternehmen setzen verstärkt auf CloudLösungen, um das Qualitätsmanagement standortübergreifend und in Echtzeit zu
steuern. Zentral verwaltete Prüfpläne, Werkerführung und digitale QS ersetzen lokale Insellösungen. Browserbasierte, mobile Apps ermöglichen die direkte Datenerfassung im Shopfloor, Wareneingang oder Labor, während alle Verantwortlichen stets aktuelle Qualitätsdaten abrufen können. Voraussetzung ist die strikte Einbettung in die SAP-ERP-Strategie.
Hybride Strategie mit Subsystem
In der Praxis dominiert der Brownfield-Ansatz (44 Prozent) knapp vor Hybrid (42 Prozent). In beiden Fällen kann ein Subsystem die Digitalisierung unterstützen. Das geschieht durch die parallele Nutzung eines Subsystems zum bestehenden SAP-System. Darin werden moderne Funktionen bereitstellt, während die ERP-Migration parallel und sukzessive erfolgen kann.
SAP-Kompatibilität durch Standards
Um maximale Kompatibilität sicherzustellen, muss das Subsystem konsequent auf SAP-Standards aufbauen. Praktisch heißt das: Das QS-System nutzt möglichst ausschließlich die standardisierten Integrationspunkte wie BAPI oder IDoc und bildet SAP-Objekte wie Prüflose, Prüfarten oder Qualitätsmeldungen nach, anstatt proprietäre Datenstrukturen zu verwenden. Dies ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb – unabhängig davon, ob gerade ECC oder S/4HANA führt. Zudem ermöglichen Subsysteme flexible Workflows, skalierbare Strukturen und mandantenspezifische Auslegungen. Neue Produktionslinien oder Werke können schnell per Zuordnung des Erfassungssystems digital angebunden werden, ohne das zentrale ERP tiefgreifend zu verändern. Diese Kombination aus Standardisierung und Flexibilität unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitalen QM-Prozesse effektiv und zukunftssicher zu gestalten.
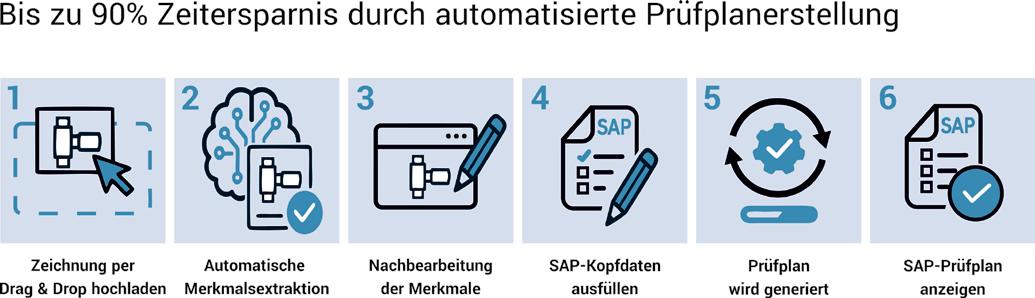
Neben klassischen Eingabegeräten an Messplätzen oder Tablets rückt zunehmend die Anbindung von Fertigungshilfsmitteln und Prüfmitteln in den Fokus. Digitale Handmessmittel, Prüfeinrichtungen und fertigungsnahe Sensorik sollen sich direkt in den Prüfprozess integrieren lassen. Auch strukturierte Messdaten aus Messmaschinen, Laborgeräten oder optischen Systemen können je nach System semi-automatisch bis vollautomatisch importiert werden.
Diese erweiterte Integration physischer Prüfmittel schafft die Voraussetzung für eine durchgängige, standardkonforme und auditierbare Qualitätssicherung – von der Erfassung bis zur Auswertung – und fördert zugleich eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.
Von der Zeichnung zum SAP-Prüfplan
Die manuelle Erstellung von Prüfplänen aus technischen Zeichnungen ist aufwendig. Das Subsystem SQM360, kombiniert mit der KI-Plattform CERPRO, wandelt Zeichnungen unterschiedlicher Formate (auch gescannte PDFs) automatisiert in SAPkonforme Prüfpläne um. Merkmale werden erkannt, klassifiziert und über Schnittstellen wie BAPI_INSPECTIONPLAN_CREATE in SAP überführt. Der gesamte Ablauf ist SAP-standardkonform: Kataloge, Merkmalsarten und Stammdaten werden exakt abgebildet. Die Funktionalität ist sowohl in ECC- als auch S/4HANA-Systemen nutzbar. Die Anwendung erfolgt über ein Pay-perUse-Modell ohne großen Implementierungsaufwand. Die Zeitersparnis in der Prüfplanung liegt bei bis zu 90 Prozent.

SQM360: Webbasierte CAQ-Erweiterung für SAP.
Qualitätsdaten im Takt der Produktion In vernetzten Fertigungsumgebungen übernehmen MES-Systeme zunehmend die Rolle der Taktgeber für qualitätsrelevante Prozesse. Prüfungen werden kontextbezogen, ereignis- oder stückzahlbasiert ausgelöst. SAP fungiert dabei als zentrale Integrationsplattform – Subsysteme erweitern die SAP-Landschaft gezielt, um Qualität systemgestützt im Prozess sicherzustellen. Ein solches Subsystem unterstützt die strukturierte Übertragung prozess- und qualitätsrelevanter Daten aus SAP MES über bewährte Schnittstellen. Die relevanten Prüfmerkmale werden dem Werker kontextbezogen bereitgestellt, Ergebnisse digital rückgemeldet, Seriennummern und Zeitstempel automatisch dokumentiert.
Hybride Strategie als Königsweg Zusammengefasst ermöglicht die hybride Strategie mit einem Subsystem eine zweigleisige Vorgehensweise. Für viele Industrieunternehmen hat sich die hybride Strategie als Königsweg erwiesen, um sowohl die S/4HANA-Migration zu meistern als auch die Qualitätsprozesse im Shopfloor zu optimieren. Anstatt den „Big Bang“ zu wagen und gleichzeitig die Migration zu vollenden und ein CAQ-System einzuführen, wird mit einem parallelen QM-Subsystem die Komplexität beherrschbar gemacht und Risiken verteilt. Weil ein elementarer Teil der Funktionalität bereits ausgelagert und zukunftssicher etabliert ist, minimiert diese Strategie die Gefahr von Betriebsunterbrechungen während der ERP-Umstellung und erlaubt schnelle Verbesserungen in der Qualitätssicherung bereits vor Abschluss der Migration. KF
JONAS VOSS ist Prokurist bei Quality Miners.
In 6 Schritten zum fertigen SAP-Prüfplan
Bilder: Quality Miners
Erfolgsduo für die Industrie
SAP steuert im industriellen Umfeld kaufmännische Prozesse von Einkauf bis Auslieferung, stößt jedoch bei Dokumentationen, revisionssicheren Ablagen oder Qualitätsmanagement an Grenzen. Hier ergänzt ein spezialisiertes Industrial DMS/QMS wie Fabasoft
Approve: Durch das Zusammenspiel beider Systeme entstehen nahtlose Ende-zu-Ende-Prozesse entlang der Supply-Chain.
Integrierte KI-Funktionen erhöhen Effizienz und Transparenz in der Projektabwicklung. VON ANDREAS DANGL
Ein wesentlicher Vorteil dieser Systemkombination liegt in der Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Das Dokumentenund Qualitätsmanagementsystem (DMS/QMS) übernimmt kaufmännische Daten wie Bestellnummern, Materialstämme oder Lieferanteninformationen automatisch aus SAP. Diese Informationen verknüpft die Software intelligent mit technischen Dokumenten, beispielsweise bei der Erstellung von Handbüchern, Spezifikationen oder Zertifikaten. Auf diese Weise entsteht eine konsolidierte Informationsbasis, auf die alle Beteiligten standort- und unternehmensübergreifend entlang der Supply-Chain zugreifen können. Vor allem in kritischen Projektphasen wie der Inbetriebnahme oder bei Änderungsprozessen verbessert dies nicht nur die Datenqualität, sondern auch die Geschwindigkeit der Informationsbereitstellung. Da Daten strukturiert und kontextbezogen vorliegen, gelingen Entscheidungen fundierter und schneller. Zudem werden Partnerunternehmen nahtlos in die Prozesse eingebunden, etwa für die Kommentierung von Dokumenten, die Abarbeitung von Prüfschritten oder die Einhaltung branchenspezifischer Standards.
Flexible Schnittstellen dank DMS
Entscheidend ist dabei die einfache Modellierung von Schnittstellen via No-Code/ Low-Code. Dank der projektspezifischen Integration stehen im Industrial DMS/QMS alle notwendigen Webservice-Schnittstellen für eine einfache Anbindung an SAP bereit (über REST oder SOAP bzw. auf Basis SAP Archive Link oder CMIS). So lassen sich Standard-SAP-Objekte (z. B. Aufträge, Bestellungen etc.) per XML-IDOC an das DMS/ QMS übertragen. Die Software übernimmt die Bestell- und Metadaten direkt aus SAP und ordnet sie den jeweiligen Dokumenten

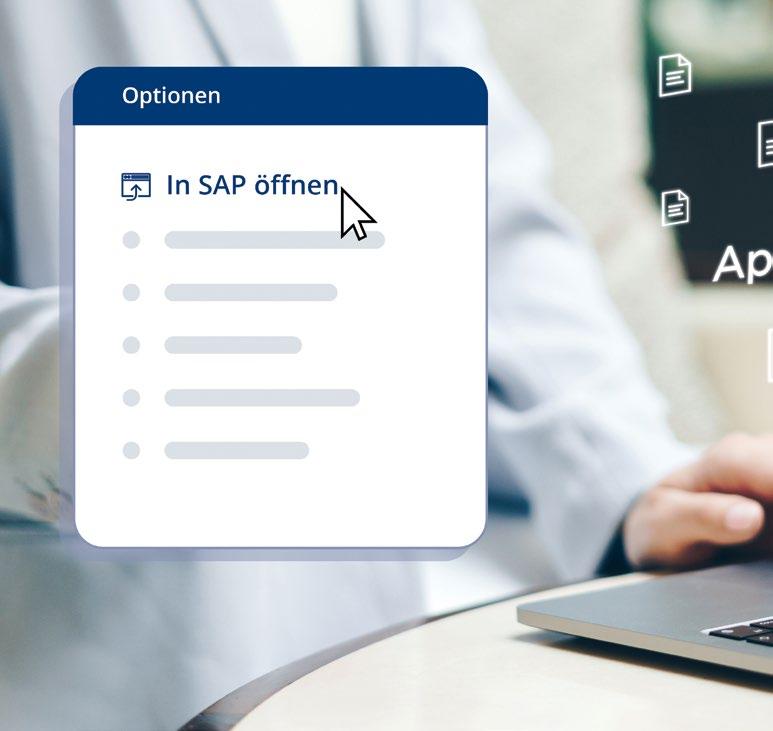
DA DATEN STRUKTURIERT UND KONTEXTBEZOGEN VORLIEGEN, GELINGEN ENTSCHEIDUNGEN FUNDIERTER UND SCHNELLER.
zu. Auf diese Weise integriert und synchronisiert die Anwendung laufend sämtliche relevanten Daten aus SAP.
360-Grad-Sichten mit KI
Mehr Überblick, weniger Suchaufwand: KI unterstützt die Verantwortlichen sowohl in SAP als auch im Industrial DMS/QMS:
Via 360-Grad-Sicht erhalten Nutzer einen Gesamtüberblick über Projekte, Produkte oder Bauteile. Die KI erkennt automatisch relevante Metadaten wie Materialnummern und gleicht diese mit vorhandenem Wissen aus Bestellinformationen oder Abweichungen (beispielsweise aus Non-ConformanceReports) aus der Vergangenheit ab. Die Daten sind in einem übersichtlichen Dashboard aufbereitet und ermöglichen einfaches Navigieren durch alle Informationen.
Qualitätsmanagement auf neuem Niveau
Das DMS/QMS extrahiert automatisch Prüflose und Bestelldaten aus SAP, erstellt eigenständig Prüfpläne und steuert deren Verteilung über ein rollenbasiertes


Rechtesystem. Die Software ermöglicht die unternehmensübergreifende Bearbeitung von Qualitätsprozessen – vom CAPA-Verfahren bis zur 8D-Report. Auch bei Abweichungen stellt die KI Zusammenhänge zu früheren Vorkommnissen her und vermeidet das Wiederauftreten. Die Effizienzgewinne bei der Wareneingangsprüfung, Nachverfolgung und Dokumentation sind enorm und messbar in Zeit und Kosten.
Compliance und Nachvollziehbarkeit im Fokus
Das DMS/QMS erfüllt höchste Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Revisionssicherheit. Dokumente werden
Das werksübergreifende Zusammenspiel von SAP und Fabasoft Approve schafft nahtlose Ende-zu-Ende-Prozesse.
Bild: © Xsandra via Gettyimages
GoB-konform archiviert, inklusive automatischer Versionierung, Audit-Logs sowie Fristen- und Löschmanagement gemäß DSGVO. Jede Änderung wird protokolliert und ist anhand einer „Zeitreise“-Funktion jederzeit nachvollziehbar. So bleibt der gesamte Projektverlauf transparent und prüfbar, was einen entscheidenden Vorteil in regulierten Branchen darstellt.
Nahtlose Integration in bestehende Office- und CAD-Anwendungen
Neben SAP ist das DMS/QMS auch tief in die gängigen Office- und CAD-Umgebungen integriert. Dokumente lassen sich direkt in Microsoft Office öffnen, bearbeiten und zurückspeichern. Auch Outlook ist
optimal an das System angebunden. Die KI unterstützt bei der automatischen Klassifizierung von E-Mails und der Extraktion von Informationen – etwa im Reklamationsmanagement. Die tiefgehende CADPMI-Integration ermöglicht beispielsweise die nahtlose Synchronisierung von Stücklisten direkt aus dem SAP-Materialstamm. Das reduziert Medienbrüche und erhöht die Datenqualität erheblich.
DIE KI VERKNÜPFT WISSEN AUS SAP
UND DEM DMS/QMS UND BEREITET ES KONTEXTBASIERT AUF.
KI als Effizienztreiber
Innovation trifft Präzision: Herzstück der Solution ist eine leistungsstarke KI, die semantische Suchfunktionen, automatische Klassifizierungen und Ähnlichkeitserkennungen ermöglicht. Dabei verknüpft sie Wissen aus SAP und dem DMS/QMS intelligent und bereitet es kontextbasiert auf. So erhalten Anwender ohne langes Suchen exakt die Informationen, die sie für ihre Aufgaben benötigen.
Fazit: Zwei Systeme, ein Ziel
Das Zusammenspiel von SAP und einem spezialisierten, cloudbasierten Industrial DMS/QMS bringt Ordnung, Geschwindigkeit und Transparenz in komplexe industrielle Projekte. Besonders im Maschinen- und Anlagenbau mit seinem hohen Dokumentations- und Qualitätsanspruch eröffnet diese Kombination enorme Potenziale – von der Angebotsphase über die Produktion bis zur Abnahme. Unternehmen profitieren von beschleunigten Prozessen, besserer Zusammenarbeit und einer digitalen Infrastruktur, die zukunftssicher aufgestellt ist.
In Kombination mit einem cloudbasierten DMS/QMS entfaltet SAP sein volles Potenzial im industriellen Projektgeschäft. Die daraus entstehende Systemlandschaft stärkt Effizienz, Compliance und Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette und unterstützt damit zentrale Ziele der Industrie 4.0. KF
ANDREAS DANGL ist Geschäftsführer von Fabasoft Approve.
Bei der Integration eines Hochregallagers mit komplexer Fördertechnik ermöglicht das SAP EWM MFS eine dynamische Steuerung der Materialflüsse, indem es in Echtzeit Daten über den Materialstatus und die Maschinenverfügbarkeit verarbeitet.
Bild: © romaset/stock.adobe.com

Schlüsseltechnologie für die Logistik der Zukunft
Automatisierte Lagertechnologien sind bereits seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil moderner Logistikstrategien. In Zeiten steigender Anforderungen an Effizienz, Geschwindigkeit und Kostensenkung in der Logistik gewinnt die Automatisierung von Lagerprozessen zunehmend an Bedeutung. Das Materialflusssystem (MFS) innerhalb von SAP Extended Warehouse Management (EWM) ist dabei ein zentrales Werkzeug. VON JENS GUTERMANN
Das SAP EWM Materialflusssystem ist ein wesentlicher Bestandteil der Lagerverwaltungssoftware SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Es übernimmt die Steuerung und Überwachung aller Materialbewegungen innerhalb des Lagers und stellt sicher, dass diese effizient und fehlerfrei ablaufen. Das MFS kommuniziert direkt mit der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) der Automatisierungstechnik – beispielsweise Förderbänder, Regalbediengeräte oder Sortieranlagen – und sorgt so für eine reibungslose Verbindung zwischen Software und Hardware.
Ein weiteres Beispiel aus der Praxis zeigt die Integration eines Hochregallagers mit komplexer Fördertechnik: Hier ermöglicht das SAP EWM MFS eine dynamische Steue-
DAS SAP EWM MATERIALFLUSSSYSTEM IST EIN SCHLÜSSEL ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG, KOSTENSENKUNG UND ZUKUNFTSSICHERUNG IN DER LOGISTIK.
rung der Materialflüsse, indem es in Echtzeit Daten über den Materialstatus und die Maschinenverfügbarkeit verarbeitet. Unterneh-
Ein Schüsselaspekt des MFS ist seine Echtzeitfähigkeit. Während traditionelle Lagerverwaltungssoftware lediglich Auftragsdaten verwaltet, ermöglicht das MFS die sofortige Umsetzung von Materialbewegungen, die direkte Reaktion auf Störungen und die dynamische Anpassung von Prozessen. Dadurch können Unternehmen nicht nur Kapazitäten optimal nutzen, sondern auch die Fehlerquote minimieren und die Betriebskosten senken.
men wie Flexus bieten Ergänzungen zum Standard, wie mobile Dashboards, um diese Prozesse noch transparenter zu gestalten.
Bessere Transparenz, bessere Entscheidungsfindung
Die Integration des Materialflusssystems in SAP EWM bietet eine Reihe von Vorteilen: Reduzierte Systemkomplexität: Durch die Integration in das SAP-System entfällt die Notwendigkeit eines separaten Materialflussrechners. Dies bedeutet weniger Schnittstellen, geringere Implementierungskosten und eine einfachere Wartung. Höhere Datenverfügbarkeit: Da das MFS direkt auf die Daten des SAP EWM zugreifen kann, stehen alle relevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung. Dies verbessert die Transparenz und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung.
Kostenersparnis: Die Reduktion von Schnittstellen und Systemen führt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Flexibilität und Skalierbarkeit: Das SAP EWM MFS ist flexibel genug, um an verschiedene Lagerlayouts und Automatisierungstechnologien angepasst zu werden. Zudem kann es problemlos skaliert werden, um wachsende Anforderungen zu bewältigen.
Flexus bietet ergänzende Module an, die diese Vorteile erweitern, beispielsweise durch flexible Visualisierungen und Dashboards, die speziell für intralogistische Prozesse entwickelt wurden.
Echtzeit-Kommunikation für maximale Effizienz
Eine der größten Stärken des SAP EWM MFS liegt in seiner vielseitigen Kommunikationsfähigkeit mit der Automatisierungstechnik. Standardmäßig erfolgt die Kommunikation über das TCP/IP-Protokoll, das eine robuste und schnelle Datenübertragung zwischen dem MFS und der SPS ermöglicht.
Die Kommunikation erfolgt in Echtzeit und ermöglicht es, Prozesse wie das Einlagern, Auslagern oder die Kommissionierung von Waren in einer automatisierten Umgebung zu koordinieren. Das MFS sendet Steuerbefehle an die Automatisierungseinrichtungen und erhält gleichzeitig Statusinformationen zurück, die eine präzise Überwachung und Steuerung der Abläufe ermöglichen. Diese Echtzeit-Daten sind entscheidend, um Verzögerungen zu vermeiden und eine kontinuierliche Prozessoptimierung zu gewährleisten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Optimierung durch Flexus-Lösungen wie die FlexMobile-Apps, die eine benutzerfreundliche Bedienung und Statusüberwachung von automatisierten Lagergeräten direkt über mobile Endgeräte ermöglichen.
Flexible Optionen für unterschiedliche Lageranforderungen
Mit der Einführung von SAP S/4HANA hat SAP eine neue Embedded-EWM-Variante eingeführt. Diese ist insbesondere für kleinere und weniger komplexe Lager geeignet. Sie bietet eine kostengünstige Lösung, da sie auf derselben Plattform wie S/4HANA läuft und somit keine separate
DIE ZUKUNFT DES SAP EWM
MATERIALFLUSSSYSTEMS IST ENG
MIT INNOVATIVEN TECHNOLOGIEN
WIE KI UND IOT VERBUNDEN.
Installation erfordert. Für komplexere Automatiklager bleibt jedoch die dezentrale SAP EWM-Variante die bevorzugte Wahl. Diese bietet einige Vorteile:
Höhere Performance: Dezentrale Systeme sind besser geeignet, um die hohen Anforderungen von automatisierten Lagern mit komplexer Fördertechnik zu bewältigen.
Größere Flexibilität: Die dezentrale Variante erlaubt eine umfangreichere Anpassung an spezifische Anforderungen. Bessere Fehlertoleranz: Da ein dezentrales EWM unabhängig vom zentralen ERP-System läuft, ist das Lager- und Materialflusssystem weniger anfällig für Systemausfälle oder Verzögerungen im ERP-System. Ein Fehler im zentralen System beeinflusst also nicht direkt die Lagerlogistik und das Materialflusssystem.
Durch den Einsatz von KI können Materialflüsse in Echtzeit analysiert und optimiert werden. Dies ermöglicht es, Engpässe oder Störungen frühzeitig zu erkennen und proaktiv darauf zu reagieren. Bild: © Ari/stock.adobe.com

Flexus unterstützt bei der Migration und Optimierung dieser Systeme und bietet zusätzliche Module, um den Umstieg effizient zu gestalten.
Automatisierung, Effizienz und intelligente Logistik
Ein Beispiel ist die Integration eines bestehenden Tablar-Liftsystems. Vor der Integration mussten Lagermitarbeiter Tablare manuell anfordern, was zeitaufwändig und fehleranfällig war. Nach der Integration des MFS wurden die Prozesse automatisiert. Aus- und Einlagerungen können nun direkt über eine App angesteuert und visualisiert werden, was die Effizienz erheblich steigert.
Die Zukunft des SAP EWM Materialflusssystems ist eng mit innovativen Technologien wie KI und dem Internet der Dinge (IoT) verbunden. Diese Technologien werden das MFS in den kommenden Jahren erheblich erweitern und verbessern. Durch den Einsatz von KI können Materialflüsse in Echtzeit analysiert und optimiert werden. Dies ermöglicht es, Engpässe oder Störungen frühzeitig zu erkennen und proaktiv darauf zu reagieren.
Zukunftssichere und nachhaltige Logistik mit SAP EWM MFS
Mit IoT-Sensoren ausgestattete Anlagen können ihren Zustand in Echtzeit überwachen. So lassen sich Wartungszyklen optimieren und unvorhergesehene Ausfälle vermeiden. Durch eine effizientere Nutzung von Ressourcen und Energie trägt das MFS zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.
Das SAP EWM Materialflusssystem ist weit mehr als nur ein Werkzeug zur Steuerung von Lagerprozessen. Es ist ein Schlüssel zur Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Zukunftssicherung in der Logistik. Mit seinen umfangreichen Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten bleibt es ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen, die ihre Lagerprozesse optimieren und für die Anforderungen von morgen rüsten wollen. Die Integration von KI und IoT sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems durch SAP stellen sicher, dass das MFS auch in den kommenden Jahren eine führende Rolle in der Logistik spielen wird. TB
JENS GUTERMANN ist Head of Marketing & Company Communications bei Flexus.
Kreislaufwirtschaft: Unternehmen sind gefordert, ihre Abhängigkeit von Primärrohstoffen zu verringern und sowohl Produkte als auch Materialien wieder in das System zu integrieren, nachdem sie es verlassen haben. Bild: © spyrakot/stock.adobe.com

Wie SAP die digitale Fertigung zirkulär macht
Gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel, strenge Regulierung – die Herausforderungen in der Fertigungsindustrie sind vielfältig.
Gleichzeitig ergeben sich aber Chancen für die Kreislaufwirtschaft. VON DARREN WEST
Was bedeutet nun der Weg von einer linearen zur Kreislaufwirtschaft? Unternehmen sind gefordert, ihre Abhängigkeit von Primärrohstoffen zu verringern und sowohl Produkte als auch Materialien wieder in das System zu integrieren, nachdem sie es verlassen haben. Dafür brauchen sie Software, die es ermöglicht, die verwendeten Materialien zu identifizieren, zu verfolgen und zu verzeichnen. Darüber hinaus müssen sie Rücknahmeverfahren etablieren, Qualitätsbewertungen durchführen und Reparaturprozesse einbeziehen.
Für viele Hersteller heißt das: Mit einer Umstellung der Prozesse ist es möglicherweise nicht getan. In vielen Fällen ist eine grundlegende Überarbeitung des Geschäftsmodells erforderlich. Seit Jahrzehnten verfolgen Hersteller großer Industriegüter — darunter Produzenten von Röntgengeräten, Düsentriebwerken und
Erdbaumaschinen — ein zirkuläres Geschäftsmodell und verkaufen Betriebszeit an ihre Kunden.
Diese Strategie fördert sowohl ein modulares Design als auch eine längere Lebensdauer der Komponenten, denn defekte Teile können durch ein Reparaturnetzwerk schnell ersetzt und überholt werden. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Ansatz in den nächsten drei bis fünf Jahren bei weiteren Herstellern durchsetzen wird, da die wachsenden regulatorischen Anforderungen auf den Märkten der EU und den USA eine Berichterstattung über Kreislaufwirtschaft und Materialnachverfolgbarkeit zunehmend erforderlich machen.“
Wie EU-Verordnungen den Wandel vorantreiben
Wie groß die Rolle ist, die Regulierungen beim Übergang von der linearen zur Kreislaufwirtschaft spielen, zeigt sich am EU
Green Deal: Im Juli 2024 trat die Verordnung „Ecodesign for Sustainable Products Regulation“ (ESPR) im Rahmen des Circular Economy Action Plan des EU Green Deals in Kraft. Gemäß der neuen Regelung müssen Unternehmen die Lebensdauer, Wiederverwendbarkeit, Erweiterbarkeit und Reparierbarkeit ihrer Produkte verbessern, den Anteil recycelter Materialien erhöhen, ihre Produkte energie- und ressourceneffizienter machen, kreislaufhemmende Stoffe vermeiden und die Abfallproduktion minimieren.
Als Teil der Verordnung spielt die Einführung eines Digital Product Passports (DPP) eine wichtige Rolle. Er enthält Informationen über die Umweltbelastung, einschließlich des CO2-Fußabdrucks, Recyclinganteil und anderer relevanter Messdaten. Strafen für die Nichteinhaltung, darunter Geldbußen und temporäre Ausschlüsse von WEITER AUF SEITE 42
Effizienz trotz steigender Komplexität und Fachkräftemangel
Intelligente Materialnachschubsteuerung und Automatisierung mit eKanban, RTLS und SAP
Die Digitalisierung liefert starke Antworten auf die täglichen Herausforderungen der Intralogistik. Eine Lösung, die zahlreiche Problemstellungen beseitigt, ist der kombinierte Einsatz von eKanban und RTLS mit einem ERP wie SAP. Diese intelligent vernetzten Systeme ermöglichen eine wachsende Produktvielfalt sowie kürzere Lieferzyklen und fangen außerdem den Mangel an geeigneten
Fachkräften auf. Das Ergebnis: eine höhere Effizienz und weniger Fehler.
Die Kombination aus eKanban, RTLS und SAP bietet eine starke Basis für zahlreiche Automatisierungsvorhaben sowie die Ausweitung KIgestützter Prozesse. Hierbei verschmelzen die einzelnen Bestandteile über gängige Schnittstellentechnologien.
eKanban mit SAP:
60 Prozent weniger Stillstand
Das digitale Kanban-Prinzip „eKanban“ beseitigt die Risiken manueller Materialnachschubprozesse und ermöglicht gleichzeitig Echtzeitüberwachung. Die Folge: bis zu 60 Prozent weniger Bandstillstand. Anstelle physischer Kanban-Karten kommen Sensoren wie Waagen oder Call-Buttons zum Einsatz. Wird ein definiertes Behältergewicht erreicht oder ein bereitgestellter Knopf betätigt, erhält das angebundene SAP-System eine Nachschubmeldung. Die Information wird direkt verarbeitet und je nach Prozess in einen Transportauftrag, eine Bestellung oder Lageraufgabe umgewandelt.
In Umgebungen mit wechselndem Personal bietet dies einen enormen Vorteil: Es wird kein System- oder Materialverständnis benötigt. Dadurch sinkt die Gefahr menschlicher Fehler deutlich, der Schulungsaufwand wird reduziert und Prozessstörungen durch beispielsweise fehlendes Material vermieden. Weitere wirtschaftliche Benefits machen sich schnell durch Stapler- und Routenzugreduktionen sowie einen geringeren Personalbedarf bemerkbar. Gleichzeitig ist der ROI bereits nach einem verhinderten Produktionsstopp erreicht. Entsprechende Test-Piloten lassen sich an einem Tag umsetzen und produktiv nutzen.
RTLS mit SAP: Transparenz schafft Sicherheit und Planbarkeit
Mit einem RTLS (Real-Time Locating System) können Positionsdaten für automatische Buchungen, Geofencing-Logiken oder Plausibilitätsprüfungen genutzt werden. Viele Systeme sind einfach über eine einheitliche Schnittstelle zur Kommunikation mit ERP-Systemen wie SAP anbindbar. Über UWB-, RFID- oder BLE-Technologien lassen sich zentimetergenau Standorte von Behältern, Komponenten oder Fahrzeugen erfassen. Wird beispielsweise ein Ladungsträger am falschen Ort abgestellt oder zur falschen Fertigungslinie gefahren, schlägt das System Alarm und macht auf sich aufmerksam. Auch hier profitieren Unternehmen von wirtschaftlichen Vorteilen wie der Stapler- und Routenzugreduktion, geringerem Personalbedarf, einem ROI unter einem Jahr, dem intelligenten Doppelspiel sowie Suchzeitenreduzierung auf Freiflächen und im Yard.
Erfolgreicher als der Wettbewerb dank solider Automatisierungsbasis Prozess-Störungen sind teuer. Die Optionen, die hinter den einzelnen Bestandteilen von eKanban und RTLS mit SAP stecken, ermöglichen eine verlässliche und sichere Basis für Automatisierungen, die den Fachkräftemangel entschärfen, Effizienz steigern, Steuerung trotz steigender Fertigungskomplexität vereinfachen, echte Prozessinformationen für KI bereitstellen und sich in kurzer Zeit amortisieren. Die Anwendungsszenarien sind vielfältig! Eine intelligente Vernetzung sowie schnelle physische Prozessintegration der Sensoren ist jedoch Voraussetzung für den Erfolg. Daten aus den Systemen müssen zuverlässig und
sicher in die zentralen ERP-Prozesse von SAP integriert sein.
Inwerken AG: Ihr Umsetzungspartner für eine digitale Zukunft
Zur Umsetzung ist eine modulare und skalierbare Integrationslösung erforderlich, die unabhängig von der eingesetzten SAPVersion ist (ECC oder S/4HANA). Das SAPBeratungshaus Inwerken berät seit über 25 Jahren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der Prozessdigitalisierung und bietet ein einzigartiges Komplettpaket: von der Konzeption über die Implementierung bis hin zum langfristigen Support. Hierfür setzt Inwerken auf ein bewährtes Vorgehensmodell und wird bereichert durch die Hardware-Expertise der Tochterfirma WSN Technologies AG. Neben Standardprodukten sind auch maßgeschneiderte IIoT- und Sensortechnologien beliebt, die sich an alle relevanten Systeme anbinden lassen. Sie haben Fragen? Melden Sie sich! Weitere Informationen oder mögliche Anwendungsszenarien von eKanban, RTLS mit SAP finden Sie unter: https://digitalisierung.inwerken.de

DENNIS GOERKE ist Solution Architect for SAP Manufacturing bei Inwerken. Kontakt: sapberatung@inwerken.de
Als Teil der Verordnung spielt die Einführung eines Digital Product Passports eine wichtige Rolle. Er enthält Informationen über die Umweltbelastung, einschließlich des CO2-Fußabdrucks, Recyclinganteil und anderer relevanter Messdaten. Bild: SAP
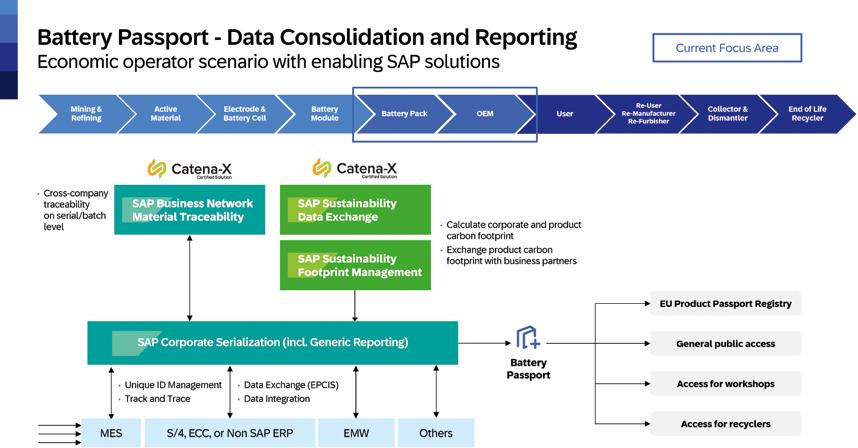
öffentlichen Ausschreibungen, werden von den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten festgelegt. Ähnliche Regeln für kritische Rohstoffe gibt es bereits in Nordamerika, einschließlich einer Nachweispflicht der ethischen Beschaffung. Die ESPR ist in ein Netzwerk miteinander verbundener Meldepflichten eingebettet. SAP-Software ermöglicht es Unternehmen diese Komplexität zu bewältigen.
SAP Digital Manufacturing verbindet Produktions- und Führungsebene
Doch wie können Hersteller die Umsetzung der Regelungen bewerkstelligen und ihr Geschäftsmodell anpassen? An dieser Stelle kommt SAP ins Spiel. SAPs Kernsysteme stellen Kunden die erforderlichen Daten bereit, die sie für den DPP benötigen. Der Vorteil der SAP-Software liegt jedoch nicht in der Erstellung des Passes, sondern in der Befähigung der Kunden, diese Daten zu nutzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, ihre Ziele zu erreichen und neue Vorschriften einzuhalten. Angenommen, ein Kunde möchte eine Komponente mit einem deutlich höheren Anteil an recycelten Materialien herstellen. SAPs integrierte Produktentwicklung ermöglicht es, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, Vorgaben zu vereinbaren und ein Produkt zu entwerfen, das Nachhaltigkeitsparameter erfüllt. SAPs Nachhaltigkeitssoftware führt anschließend das Design in die Produktion über. Von dort aus verbindet SAP Digital Manufacturing die Produktionsebene mit der Führungsebene. Erweiterungen umfassen KI-gesteuerte KPIs und Analysen. Dies ermöglicht auch eine flexible Ausführung, die mit Planung und Logistik abgestimmt
ist und direkt in SAPs Personalmanagement-Software integriert ist, wo Fähigkeiten und Zertifizierungsverfolgung bereitgestellt werden. Einer der Vorteile von SAP ist die große Präsenz von Fertigungsunternehmen in verschiedenen Ländern, die rund um die Uhr zahlreiche Merkmale zu Rohstoffen und Prozessen in unserem Kernsystem zusammentragen.
SAP BEFÄHIGT HERSTELLER DURCH
ERP- UND NACHHALTIGKEITSLÖSUNGEN VON LINEAREN PROZESSEN ZU EINER KREISLAUFWIRTSCHAFT ÜBERZUGEHEN.
So können SAPs KI-Systeme – unter Zustimmung – mit anonymisierten, aggregierten Daten trainiert werden, um unseren Kunden sowohl Benchmarking als auch Vorschläge zur Verbesserung der Prozesseffizienz und Nachhaltigkeitsleistung bereitzustellen. SAP unterstützt Kunden zudem bei der Berichterstattung und kann Verbesserungen anregen, beispielsweise durch das Bereitstellen von bewährten Verfahren.
Gesetzliche Vorschriften zur Kreislaufwirtschaft stemmen Das lässt sich gut am Beispiel der Batterieindustrie verdeutlichen. Sie ist die erste Branche, der aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, den wertvollen Rohstoffen und den Risiken, die mit der Entsorgung von Batterien verbunden sind, gesetzliche Vorschriften zur Kreislaufwirtschaft auferlegt wurden.
Die EU-Batterieverordnung, ein Gesetz, das sicherstellen soll, dass Batterien in-
nerhalb von Europa ordnungsgemäß gesammelt, wiederverwendet und recycelt werden, trat im August 2023 in Kraft, wobei die Berichtspflicht ab 2025 gilt. Sie schreibt vor, dass digitale Produktpässe (DPP) für Batterien zwei Arten von Informationen enthalten müssen: Zum einen statische Daten über das Batteriemodell (CO2-Fußabdruck, Materialzusammensetzung, Chemie und Beschaffung, Leistungsund Haltbarkeitswerte, Sicherheitsmaßnahmen und Testberichte, Herkunftsland und Hersteller). Zum anderen dynamische Daten, die Nutzungsdaten, Batteriestatus und Gesundheitsinformationen abdecken.
SAP-Systeme können Unternehmen helfen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Dies umfasst die Fähigkeit, Daten zur Einhaltung der EU-Vorschriften und zur Zusammenarbeit mit Industrieallianzen wie das Automobilnetzwerk Catena-X entlang der Lieferkette zu exportieren. Durch Werkzeuge wie die DPPs und KI-gesteuerte Nachhaltigkeitsverwaltung ermöglicht SAP Unternehmen, die Vorschriften zu erfüllen, den Ressourcenverbrauch zu optimieren und recycelte Materialien einzubinden.
Da Branchen wie die Batterieherstellung strengen Vorschriften hinsichtlich des Produktlebenszyklus unterliegen, unterstützen SAPs skalierbare, cloudbasierte Systeme Kunden dabei, sich den Herausforderungen zu stellen, während sie gleichzeitig Innovation fördern und nachhaltigkeitsorientiertes Wachstum entlang der Wertschöpfungskette vorantreiben. RT
DARREN WEST ist Global Head of Circularity Solutions bei SAP.

SAP Security ist als BusinessProzess zu verstehen, der mit passenden Tools zu überwachen ist.
Bild: Freepik
SAP Security – in vier Schritten zum Erfolg
Heute, wo moderne Technologien eine zentrale Rolle spielen, haben Unternehmen längst erkannt, dass sie passgenaue Security-Konzepte benötigen. Doch je weiter die technologischen Innovationen voranschreiten, desto ausgefeilter werden auch die Cyberangriffe. Im folgenden Beitrag wird gezeigt, welche praktischen Schritte in der SAP Security zu gehen sind und welche Rolle ein externes Security Operations Center (SOC) dabei spielt.
VON TIMO SCHLÜTER
Was früher nur als Advanced Persistent Threats (APT) bekannt war, findet sich heute bereits bei Cyberkriminellen mit durchschnittlichen Kwieder. Die Bedrohungslage verschärft sich seit Jahren kontinuierlich, die Zahl der Cyber-Angriffe steigt unaufhaltsam. Viele Unternehmen haben daher bereits IT-Krisenprozesse definiert. Doch die einmalige Auseinandersetzung mit dem Thema SAP-Sicherheit reicht nicht aus. Um langfristig SAP Security zu erreichen, genügt es nicht, Software anzuschaffen. IT-Sicherheit ist als Business-Prozess zu verstehen, der sorgfältig zu modellieren, mit Metriken
zu steuern, mit Tools zu überwachen und kontinuierlich zu optimieren ist. Dabei empfiehlt sich die Vorgehensweise in folgenden vier Schritten.






UNTERNEHMEN SOLLTEN ZUNÄCHST ERMITTELN, WO SIE AM VERWUNDBARSTEN SIND.
Schritt 1: Verwundbarkeit erkennen Unternehmen sollten zunächst eruieren, wo sie am verwundbarsten sind. Mit dem „Mitre Att&ck Framework“ finden sie heraus, wie sie am wahrscheinlichsten angegriffen werden. Diese Knowledge Base listet alle bekannten Angriffstechniken tagesaktuell auf und erklärt, wie man sie erkennt und mögliche Angriffe abwehrt. Wich-



Sichern Sie sich jetzt Ihr exklusives Abonnement!
wwww.digital-manufacturing-magazin.de/ abonnement
tig ist auch, sich mit der Bedrohungslage in der eigenen Branche zu beschäftigen. Hacker sind oft auf bestimmte Industrien und Angriffstechniken spezialisiert. Dank einer Heatmap, die zeigt, welche Technologie wo besonders oft angewendet wird, können Firmen ihre kritischsten Infrastrukturen, Daten und Systeme gezielt schützen.
Schritt 2:
IT-Infrastruktur kennenlernen
Daneben gilt es, messbare Kennzahlen (KPIs) zu definieren, um Prozesse und Maßnahmen im Hinblick auf das angestrebte Ziel zu bewerten und valide Ergebnisse zu erzielen. Manches Unternehmen bemerkt dann, dass es das Thema IT-Sicherheit bisher falsch angegangen ist. So wissen einige Firmen nicht, mit welchen Lösungen und Systemen ihre Abteilungen arbeiten. Um einen belastbaren Prozess zu modellieren, müssen sich Unternehmen einen Überblick über ihre IT-Landschaft verschaffen. Nur so können sie in das richtige Personal, die richtigen Prozesse und die richtige Software investieren – mit dem Ziel, Schwachstellen und etwaige Angriffe fortlaufend zu erkennen und adäquat zu reagieren.
Schritt 3:
Security-Roadmap aufsetzen
Eine Security-Roadmap aufzusetzen, erfordert eine gründliche Analyse und Planung. Zunächst muss man sich mit grundlegenden Fragestellungen auseinandersetzen, wie zum Beispiel: Wohin wollen wir in Bezug auf die Sicherheit unserer Systeme und Daten? Wo stehen wir momentan? Und schließlich, in welcher Reihenfolge bearbeiten wir welche Themen, um unsere Sicherheitsziele zu erreichen? Die Beant-
wortung dieser Fragen bildet die Grundlage für eine fundierte und zielführende Security Roadmap.
Schritt 4:
Monitoring professionalisieren
Unternehmen sind gut beraten, auf die Unterstützung eines externen Security Operation Centers (SOC) zurückzugreifen. Die Fachleute des entsprechenden Managed Security Service Providers (MSSP) überwachen zum Beispiel in einem System für
ZU DEN KERNAUFGABEN EINES
SECURITY OPERATIONS CENTER
ZÄHLT NEBEN DER ANALYSE AUCH
DIE BEDARFSGERECHTE REAKTION
AUF ALERTS.
Security Information and Event Management (SIEM) alle eingehenden Alerts und bewerten, ob es sich um Security Incidents oder False Positives handelt. Denn ein eigenes, kompetentes Security-Team, das diese Anforderungen erfüllt, können sich in der Regel nur große Konzerne leisten.
SAP Security erfordert ein Security Operations Center
Das SOC gilt vielerorts als organisatorisches Herzstück der IT Security – es erfüllt eine zentrale Rolle bei der Absicherung von SAP-Systemen. Doch SAP-Sicherheit ist ein Portfolioelement, das den meisten MSSPs fehlt. Umso wichtiger ist es, die Wahl des passenden SOC nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Fachleute im SOC integrieren die erforderlichen Security-Tools
in die IT-Infrastruktur eines Unternehmens und verknüpfen die Sensorik der Sicherheitslösungen mit den relevanten SAPSystemen. So sind die Experten im SOC in der Lage, die unternehmensspezifische IT-Landschaft zu überwachen – um neben der SAP-Infrastruktur auch Systeme, Endgeräte und Daten bestmöglich zu schützen. Zu den Kernaufgaben eines SOC zählt neben der Analyse auch die bedarfsgerechte Reaktion auf Alerts. Allerdings bedeutet nicht jeder Alarm einen Angriff: Es gibt eine beträchtliche Anzahl an False Positives. Aufgabe der Security-Experten im SOC ist es darum, zu analysieren, bei welchen Alerts es sich um echte Security Incidents handelt. Zudem müssen die Fachleute im Angriffsfall entscheiden, ob vorab definierte Ad-hoc-Maßnahmen sinnvoll sind oder ob eine individuelle Reaktion erforderlich ist. Je nach Situation braucht es unterschiedliche Maßnahmenpakete.
Auf erfahrenen Dienstleister setzen
SAP Security ist ein fortlaufender Prozess, der einer strukturierten Vorgehensweise und professioneller Unterstützung bedarf. Die Zusammenarbeit mit einem kompetenten SOC ist von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, sowohl die SAPInfrastruktur als auch die gesamte IT-Landschaft eines Unternehmens wirksam zu schützen. Da-rum sollte ein Dienstleister gewählt werden, der die Expertise, Erfahrung und maßgeschneiderten Lösungen bietet, die nötig sind, um in der heutigen Bedrohungslandschaft zu bestehen. RT
TIMO SCHLÜTER ist Business Owner
Cyber Security bei Arvato Systems.

Mit der Umstellung auf SAP S/4HANA können Unternehmen ihre Prozesse modernisieren. Bild: © AD/stock.adobe.com

Wie der Umstieg auf SAP S/4HANA gelingt
Die Digitalisierung fordert Unternehmen auf vielen Ebenen heraus. Diejenigen, die sich nicht mit Trends wie Robotic Process Automation (RPA), Process Mining, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen befassen, riskieren, langfristig an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Mit SAP S/4HANA lassen sich bestehende Prozesse modernisieren und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle entwickeln. Der Weg zur erfolgreichen Implementierung verlangt eine umfassende Planung und Strategie. VON TOBIAS PLAHA
Der erste Schritt auf dem Weg zu S/4HANA ist eine sorgfältige Vorstudie. Diese analysiert die aktuelle Situation des Unternehmens, bewertet bestehende Systeme und erarbeitet eine Roadmap für die anstehende Transformation. Eine solide Vorstudie legt die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt. In dieser Phase ist die Wahl der passenden Transitionsstrategie entscheidend. Unter anderem stehen zwei gängige Ansätze zur Verfügung: der Brownfield- und der Greenfield-Ansatz.
Beim Brownfield-Ansatz wird das bestehende System mit all seinen Prozessen und Daten in die neue S/4HANA-Umgebung überführt. Diese Methode eignet sich besonders für Unternehmen, die ihre etablierten Prozesse nicht grundlegend ändern möchten. Der Greenfield-Ansatz hingegen bietet die Möglichkeit, ein neues System von Grund auf zu erstellen und dabei alle Prozesse neu zu gestalten. Die Wahl der Strategie sollte sorgfältig getroffen werden, da sie einen erheblichen Einfluss auf den Projektverlauf und die Ergebnisse hat.
Die richtige Strategie finden
Der Brownfield-Ansatz erscheint auf den ersten Blick verlockend, da er eine schnelle
technische Umstellung ermöglicht. Hierbei wird das bestehende SAP-System nahezu unverändert auf die neue Plattform migriert, was Zeit und Kosten spart. Allerdings birgt dieser Ansatz die Gefahr, dass Unternehmen die Gelegenheit verpassen, ihre Prozesse zu optimieren und an moderne Anforderungen anzupassen.
DIE UMSTELLUNG AUF SAP S/4HANA ERMÖGLICHT NICHT NUR DIE UMSETZUNG TECHNOLOGISCHER VERBESSERUNGEN, SONDERN AUCH EIN ÜBERDENKEN DER STRATEGISCHEN AUSRICHTUNG.
Der Greenfield-Ansatz hingegen erlaubt eine vollständige Neugestaltung der Systemlandschaft. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn bestehende Prozesse nicht mehr zeitgemäß sind oder das System durch zahlreiche individuelle Anpassungen unübersichtlich geworden ist. Obwohl dieser Ansatz aufwendiger ist und intensives ChangeManagement erfordert, bietet er größere Flexibilität und Innovationspotenzial.
Herausforderungen
bei der Umstellung auf S/4HANA Im Laufe vieler Projekte haben sich einige typische Herausforderungen bei der Umstellung auf S/4HANA gezeigt. Ein häufiger Fehler ist, das Vorhaben als rein technisches Projekt zu betrachten. Zwar ist die technische Implementierung ein wesentlicher Bestandteil, doch der Fokus sollte auf den Geschäftsprozessen und den Fachbereichen liegen. Ohne deren Einbindung bleibt der Mehrwert der neuen Plattform oft ungenutzt.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die mangelnde Projektstrukturierung. Viele Unternehmen starten die Umstellung ohne eine klare Roadmap, was zu Verzögerungen und ineffizienten Abläufen führt. Eine strukturierte Planung und ein detaillierter Zeitplan sind jedoch essenziell, um die Komplexität der Transformation zu bewältigen und Abhängigkeiten effektiv zu managen.
Erfolgsfaktoren für die Transformation Für eine erfolgreiche Transition zu S/4HANA hat Abat eine Reihe bewährter Vorgehensweisen entwickelt. Beispielsweise sollte die Vorstudie in den Übergang zur Umsetzung integriert werden, um Verzögerungen zu
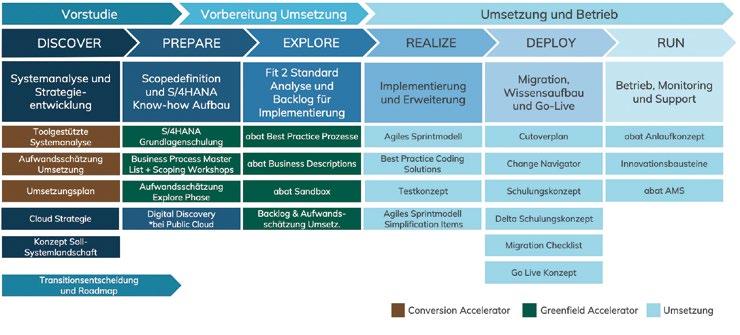
Ob Brownfield oder Greenfield: Der ideale Ansatz hängt von den individuellen Anforderungen ab. Bild: Abat
vermeiden. Zu oft geht wertvolle Zeit verloren, wenn zwischen der Analysephase und der eigentlichen Implementierung eine zu große Lücke entsteht.
Die Ergebnisse der Vorstudie sollten in einer hinreichend detaillierten Form vorliegen, um eine nahtlose Weiterarbeit zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Ansatz ist die Anwendung agiler Methoden. Agile Projektstrukturen erlauben es, flexibel auf Änderungen und Herausforderungen zu reagieren. So kann die Transition in kleineren, besser handhabbaren Schritten erfolgen, wodurch das Risiko unerwarteter Probleme reduziert wird.
Umfassendes Transformationsprojekt bei Desma
Beispiel für eine erfolgreiche Transition mittels des Tools ist die Umstellung von R/3 auf S/4HANA bei Desma, einem Maschinenhersteller für die Schuhindustrie. Dies war nicht nur eine technische Migration, sondern ein umfassendes Transformationsprojekt, das alle Unternehmensbereiche betraf und einbezog. Im Vordergrund standen die Harmonisierung und die Standardisierung der Prozesse. Die alte ERP-Landschaft war durch zahlreiche Modifikationen und Eigenentwicklungen geprägt, die die Wartung und Erweiterung erschwerten. Mit der neuen S/4HANA-Umgebung wurden viele dieser Modifikationen überflüssig, da jetzt moderne und erweiterte Standardfunktionen zur Verfügung stehen. Die Zusammenführung von Debitoren und Kreditoren zu BusinessPartnern ermöglicht eine einheitliche und konsistente Datenbasis und erleichtert nicht nur die Datenpflege, sondern auch das Reporting und die Analyse. Und durch die Automatisierung sowie Standardisierung von Routineaufgaben können sich die Mitarbeitenden nun zudem auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren.
Der Einsatz von Tools
Bei der Umstellung auf S/4HANA spielen passende Werkzeuge eine zentrale Rolle. Der SAP-Readiness-Check beispielsweise bietet einen Überblick über notwendige Systemanpassungen. Ergänzend dazu hat Abat eine eigene Toolbox entwickelt, die auf Erfahrungswerten aus zahlreichen Projekten basiert. Diese Werkzeuge helfen, die einzelnen Aktivitäten gezielt zu planen und umzusetzen, unabhängig davon, ob es sich um eine System-Conversion oder den Aufbau eines neuen Systems handelt.
Ein Beispiel ist der Value Check oder ein System-Deep-Dive auf Basis vorkonfigurierter Prozesse. Diese Tools ermöglichen es, spezifische Anforderungen und mögliche Problemfelder frühzeitig zu identifizieren. Für die Bewertung von Alternativen bietet sich zudem eine Bewertungsmatrix an, mit der Vor- und Nachteile systematisch erfasst und gewichtet werden können.
Chancen durch Umstellung nutzen
Die Umstellung auf SAP S/4HANA ist ohne Frage eine große Herausforderung. Sie bietet jedoch die Möglichkeit, nicht nur technologische Verbesserungen umzusetzen, sondern auch die strategische Ausrichtung eines Unternehmens grundlegend zu überdenken. Eine strukturierte Planung, die frühzeitige Einbindung aller relevanten Akteure und der Einsatz geeigneter Tools sind entscheidend, um die Transition erfolgreich zu gestalten. Unternehmen, die diesen Weg konsequent verfolgen, schaffen die Grundlage für eine zukunftssichere und wettbewerbsfähige Positionierung am Markt. RT
IMPRESSUM
Herausgeber und Geschäftsführer: Matthias Bauer, Günter Schürger
Das Sonderheft SAP in der Produktion wird herausgegeben von DIGITAL MANUFACTURING: http://www.digital-manufacturing-magazin.de
So erreichen Sie die Redaktion: Chefredaktion: Rainer Trummer (v.i.S.d.P.), (089-3866617-10, rainer.trummer@win-verlag.de)
Redaktion: Karin Faulstroh (karin.faulstroh@win-verlag.de), Tino M. Böhler (tino.boehler@win-verlag.de), Stefan Girschner (stefan.girschner@win-verlag.de)
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Andreas Dangl, Felix Dieckmann, Jens Gutermann, Thomas Henzler, Oliver Hoffmann, Christian Jeske, Sebastian Klaszka, Tobias Plaha, Timo Schlüter, Dr. Thomas Tosse, Jonas Voss, Darren West
So erreichen Sie die Anzeigenabteilung: Anzeigengesamtleitung: Martina Summer (089-3866617-31, martina.summer@win-verlag.de), Anzeigen verantwortlich Mediaberatung: Michael Nerke (Anzeigenverkaufsleiter, Tel.: 089-3866617-20, michael.nercke@win-verlag.de), Andrea Lippmann (Tel.: 089-3866617-22, andrea.lippmann@win-verlag.de), Matthias Hofmann (Tel.: 089-3866617-21, michael.hofmann@win-verlag.de)
Anzeigendisposition: Auftragsmanagement@win-verlag.de
Chris Kerler (089/3866617-32, Chris.Kerler@win-verlag.de)
Abonnentenservice und Vertrieb: Tel: +49 89 3866617 46 www.digital-manufacturing-magazin.de/hilfe oder eMail an abovertrieb@win-verlag.de mit Betreff „DIGITAL MANUFACTURING“
Gerne mit Angabe Ihrer Kundennummer vom Adressetikett Artdirection und Titelgestaltung: Saskia Kölliker Grafik, München Bildnachweis/Fotos: falls nicht gekennzeichnet: Werkfotos, AdobeStock, shutterstock.com, fotolia.de
Titelbild: IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH
Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg
Produktion und Herstellung: Jens Einloft (089/3866617-36, jens.einloft@win-verlag.de) Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle Verantwortlichen: WIN-Verlag GmbH & Co. KG Chiemgaustr. 148 81549 München, Tel.: 089-3866617-0
Verlagsleitung: Martina Summer (089/3866617-31, martina.summer@win-verlag.de)
Objektleitung: Rainer Trummer (089/3866617-10, rainer.trummer@win-verlag.de) Zentrale Anlaufstelle für Fragen zur Produktsicherheit: Martina Summer (martina.summer@win-verlag.de, 089/3866617-31)
Bezugspreise:
Einzelverkaufspreis: 14,40 Euro in D, A, CH und 16,60 Euro in den weiteren EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Jahresabonnement (8 Ausgaben): 115,20 Euro in D, A, CH und 132,80 Euro in den weiteren EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Vorzugspreis für Studenten, Schüler, Auszubildende und Wehrdienstleistende gegen Vorlage eines Nachweises auf Anfrage. Bezugspreise außerhalb der EU auf Anfrage. 17. Jahrgang
Erscheinungsweise: achtmal jährlich
Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden gerne von der Redaktion entgegen genommen. Die Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der Verfasser, dass die Einsendungen frei von Rechten Dritter sind und nicht bereits an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblicher Nutzung angeboten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der Erfüllung der Honorarvereinbarung ist die gesamte, technisch mögliche Verwertung der umfassenden Nutzungsrechte durch den Verlag – auch wiederholt und in Zusammenfassungen – abgegolten. Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann trotz Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden. Copyright © 2025 für alle Beiträge bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere der Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen elektronischen Datenträgern.
ISSN 1867-9781 - Ausgabe 2025-04
Unsere Papiere sind PEFC zertifiziert Wir drucken mit mineralölfreien Druckfarben
TOBIAS PLAHA ist Senior Consultant, Standortleitung Bayern bei Abat.
Außerdem erscheinen bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG: AUTOCAD Magazin, BAUEN AKTUELL, DIGITAL ENGINEERING Magazin, DIGITAL BUSINESS, e-commerce Magazin, PlastXnow, Plastverarbeiter, r.energy, KGK Rubberpoint
Branchenwissen. Digital. Kompakt. Bequem.
Willkommen bei der Podcast-Plattform des Digital Manufacturing Magazins –Ihrer Quelle für intelligente Expertise! Lernen Sie von Branchenexperten, Vordenkern und Innovatoren. Wir liefern präzise Insights, aktuelle Trends und praxisnahe Strategien direkt in Ihre Ohren. Ob Führungskraft, Professional oder ewig Lernender: Verpassen Sie keine Episode und bleiben Sie an der Spitze des digitalen Wandels. Ihr Wissensvorsprung startet hier!


















