BUXTEHUDE
Sämtliche Orgelwerke
Band III/1
Choralbearbeitungen A–L
Complete Organ Works
Volume III/1
Organ Chorales A–L
BuxWV 177–178, 180–202, 210, 218
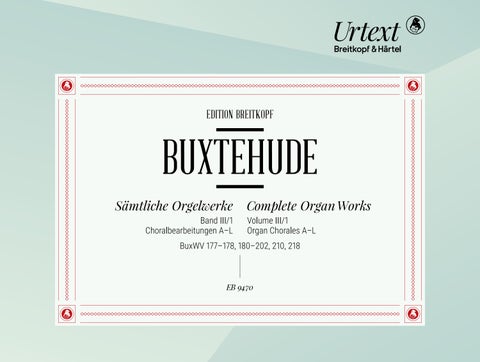
Sämtliche Orgelwerke
Band III/1
Choralbearbeitungen A–L
Complete Organ Works
Volume III/1
Organ Chorales A–L
BuxWV 177–178, 180–202, 210, 218
1637–1707
Choralbearbeitungen A–L Organ Chorales A–L
herausgegeben von | edited by Harald Vogel
Band I/1: Freie Orgelwerke (pedaliter)
Band I/2: Freie Orgelwerke (pedaliter)
Band II: Freie Orgel- und Clavierwerke (manualiter)
Band III/1: Choralbearbeitungen A–L
Band III/2: Choralbearbeitungen M–W
Volume I/1: Free Organ Works (pedaliter)
Volume I/2: Free Organ Works (pedaliter)
Volume II: Free Organ and Keyboard Works (manualiter)
Volume III/1: Organ Chorales A–L
Volume III/2: Organ Chorales M–W
BuxWV 136–153, 158
EB 9304
BuxWV 154–157, 159–161, Anh. 5 EB 9305
BuxWV 162–176, 225 EB 9306
BuxWV 177–178, 180–202, 210, 218 EB 9470
BuxWV 76, 179, 203–209, 211–217, 219–224 EB 9471
BuxWV 136–153, 158 EB 9304
BuxWV 154–157, 159–161, Anh. 5 EB 9305
BuxWV 162–176, 225 EB 9306
BuxWV 177–178, 180–202, 210, 218 EB 9470
BuxWV 76, 179, 203–209, 211–217, 219–224 EB 9471
Edition Breitkopf 9470 Printed in Germany
Choralbearbeitungen A–L, Band III/1 EB 9470
Vorwort
Preface VI
Große Choralfantasien
1 Gelobet seist du, Jesu Christ . . . . . . . BuxWV 188 2 (Choralfantasie)
2 Nun freut euch, lieben Christen gmein BuxWV 210 10 (Choralfantasie)
3 Te Deum laudamus . . .
BuxWV 218
Praeludium 21
Te Deum laudamus. Vers 1 22
Pleni sunt coeli et terra (Vers 2) 26
Te Martyrum 30
Tu devicto cum 3 subjectis . . . . 31
Choralbearbeitungen
4 Ach Gott und Herr Versus 1–2 BuxWV 177 34
(Choralvariationen)
5 Ach Herr, mich armen Sünder BuxWV 178 36 (Choralvorspiel)
6 Christ, unser Herr, zum Jordan kam BuxWV 180 38 (Choralvorspiel)
7 Danket dem Herren Versus 1–3 BuxWV 181 40
(Choralvariationen)
8 Der Tag, der ist so freudenreich BuxWV 182 42 (Choralvorspiel)
9 Durch Adams Fall ist ganz verderbt BuxWV 183 46
(Choralvorspiel)
10 Ein feste Burg ist unser Gott BuxWV 184 48 (Choralvorspiel)
11 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BuxWV 185 51 (Choralvorspiel)
12 Es ist das Heil uns kommen her BuxWV 186 52 (Choralvorspiel)
13 Es spricht der Unweisen Mund wohl
BuxWV 187 54 (Choralvorspiel)
14 Gelobet seist du, Jesu Christ
BuxWV 189 56 (Choralvorspiel)
15 Gott der Vater wohn uns bei BuxWV 190 58 (Choralvorspiel)
16 Herr Christ, der einig Gottes Sohn BuxWV 191 60 (Choralvorspiel)
17 Herr Christ, der einig Gottes Sohn BuxWV 192 62 (Choralvorspiel)
18 Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl BuxWV 193 64 (Choralvorspiel)
19 Ich dank dir, lieber Herre BuxWV 194 66 (Choralfantasie)
20 Ich dank dir schon durch deinen Sohn BuxWV 195 70 (Choralricercar)
21 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BuxWV 196 75 (Choralfantasie)
22 In dulci jubilo BuxWV 197 78 (Choralvorspiel)
23 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand BuxWV 198 80 (Choralvorspiel)
24 Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BuxWV 199 81 (Choralvorspiel)
25 Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BuxWV 200 84 (Choralvorspiel)
26 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn BuxWV 201 86 (Choralvorspiel)
27 Lobt Gott ihr Christen allzugleich BuxWV 202 88 (Choralvorspiel)
Choraltoccaten
28 Magnificat primi toni
BuxWV 203 1 (Choraltoccata)
29 Magnificat primi toni
BuxWV 204 7 (Choraltoccata)
Choralbearbeitungen
30 Magnificat noni toni
BuxWV 205 10 Versus 5 alla duodecima 10
31 Mensch, willt du leben seliglich
(Choralvorspiel)
32 Mit Fried und Freud ich fahr dahin
(aus: Trauermusik für Johannes Buxtehude)
BuxWV 206 12
BuxWV 76
Contrapunctus 1, Evolutio 14
Contrapunctus 2, Evolutio 16
33 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
(Choralvariationen)
Versus 1 .
BuxWV 207
Versus 2 20 Versus 3 21
Versus 4 23
34 Nun bitten wir den Heiligen Geist
(Choralvorspiel)
35 Nun bitten wir den Heiligen Geist
(Choralvorspiel)
BuxWV 208 24
BuxWV 209 26
36 Nun komm, der Heiden Heiland BuxWV 211 28
(Choralvorspiel)
37 Nun lob, mein Seel, den Herren BuxWV 212 29 (Choralfantasie)
38 Nun lob, mein Seel, den Herren BuxWV 213 (Choralvariationen) Versus 1 32 Versus 2 34 Versus 3 36
39 Nun lob, mein Seel, den Herren . . BuxWV 214 38 (Choralricercar)
40 Nun lob, mein Seel, den Herren
(Choralvorspiel)
BuxWV 215 40
41 Puer natus in Bethlehem
BuxWV 217 42 (Choralvorspiel)
42 Vater unser im Himmelreich BuxWV 219 43 (Choralvorspiel)
43 Von Gott will ich nicht lassen BusWV 220 45 (Choralvorspiel)
44 Von Gott will ich nicht lassen BuxWV 221 46 (Choraltoccata)
45 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit BuxWV 222 48 (Choralvorspiel)
46 Wie schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223 50 (Choralfantasie)
47 Wir danken dir, Herr Jesu Christ BuxWV 224 57 (Choralvorspiel)
Anhang I
48 Auf meinen lieben Gott BuxWV 179 Allemande, Double 58 Sarabande, Courante, Gigue 60
49 O lux beata Trinitas BuxWV 216 62 (Fragment)
50 Klag-Lied
(aus: Trauermusik für Johannes Buxtehude)
Anhang II (alternative Versionen)
51 Nun lob, mein Seel, den Herren
BuxWV 76 63
BuxWV 213 64 (Dröbs Ms/1, Versus 1)
52 Vater unser im Himmelreich
BuxWV 219 66 (Walther Ms F)
Kritischer Bericht zu Band III/1 und III/2
Zur Edition 68
Notation und Chronologie 69
Zum Ornamentstil 71
Quellenbeschreibungen 72
Einzelanmerkungen
78
Die Orgeln an den Wirkungsstätten Buxtehudes in Dänemark, Schweden und Lübeck 93
Stimmung und Tonartengebrauch 100
Die choralgebundenen Orgelwerke Buxtehudes sind in dieser Edition in zwei Bände aufgeteilt, um eine praktische Größe zu erreichen, die den Gebrauch erleichtert. Band III/1 enthält die beiden großen Choralfantasien (BuxWV 188 und 210), das Te Deum (BuxWV 218) und die übrigen Werke in alphabetischer Reihenfolge mit den Textanfängen von A bis L. In Band III/2 folgen die Werke mit den Textanfängen von M bis W, die beiden Anhänge und der Textteil mit dem Kritischen Bericht.
In den handschriftlichen Quellen gibt es nur vereinzelt Überschneidungen mit den freien Kompositionen Buxtehudes. Während die freien Orgelwerke eine breite Überlieferung von Skandinavien über Nord- nach Mitteldeutschland zeigen, sind die meisten choralgebundenen Werke durch die Notenbestände einer Person bekannt: Johann Gottfried Walther.1 Seine Manuskripte, die Werke von Buxtehude enthalten, lassen die Vermutung zu, dass in der Zeit des gemeinsamen Wirkens mit Johann Sebastian Bach in Weimar vor 1717 ein abgestimmtes Interesse an den Orgelwerken Buxtehudes bestand. Dabei finden wir in den Handschriften, die auf Bach und seinen Kreis zurückgehen, fast ausschließlich freie Werke und in den Walther-Handschriften dagegen ohne Ausnahme choralgebundene Werke. Die Abschriften Walthers enthalten den größten Teil der insgesamt 50 Titel in dieser Edition. Durch den Verlust der Rein- und Kompositionsschriften Buxtehudes ist die Überlieferung durch Johann Gottfried Walther ein Glücksfall.
Die meisten Vorlagen der Werke in den Walther-Handschriften waren wahrscheinlich bereits in Liniennotation aufgezeichnet, da hier die typischen Übertragungsfehler von einer in die andere Notation weitgehend fehlen. Die großen Choralfantasien wurden dagegen aus der Buchstabentabulatur, Buxtehudes Kompositionsnotation, übertragen. Walther benutzte für die meisten choralgebundenen Werke eine Form der Liniennotation, die nicht – wie um 1700 und davor üblich – auf zwei Systemen, sondern überwiegend auf drei Systemen, mit der Pedalstimme im unteren System, aufgezeichnet ist. Es handelt sich um eine relativ geringfügige Umformung der Tabulaturnotation mit den einzelnen Stimmen in übersichtlichen Buchstabenreihen (siehe Faksimile Band I/1, S. 30). Die wechselnde Notation mit zwei und drei Liniensystemen ist in den Choralfantasien und im Te Deum als historische Quellennotation zu finden. Eine Schwierigkeit bildet die Interpretation der Verzierungszeichen bei Walther, die nicht mehr die Form der norddeutschen Tradition aufweisen.
Die wichtigsten quellenorientierten Aspekte in dieser Edition, die auf der Grundlage moderner Notation eine Annäherung an die ursprüngliche Notationsweise erlauben, sind:
• die Wiedergabe der originalen Notenwerte, Balkungen und Taktvorzeichnungen,
• die Notation von Pausen nach dem Vorbild der Quellen ohne eine systematische Vervollständigung,
• die Wiedergabe der metrischen Strukturen,
• die Verwendung von drei oder zwei Systemen,
• der Verzicht auf melodische und rhythmische Angleichungen und
• das Notationsbild der deutschen Claviernotation mit nicht durchgezogenen Taktstrichen.
Die praktischen Aspekte, die von den historischen Notationskonventionen abweichen, sind:
• die Geltung der Vorzeichen für einen ganzen Takt,
• moderne Schlüssel für die jeweils oberen Systeme,
• hinzugefügte Pausen und Noten in Kleinstich,
• in seltenen Fällen hinzugefügte Vorzeichen über oder unter den Noten und
• zusätzliche Bindebögen in gestrichelter Form.
Die erklärenden Texte befinden sich im Band III/2. Die Abweichungen von den Quellen werden bei den Einzelanmerkungen in Korrekturlisten mit systematischen Fehleranalysen vorgestellt. Die Textbeiträge enthalten Informationen zur Notation und Chronologie, zum Ornamentstil, zu den Quellen, zu den Orgeln an den Wirkungsstätten Buxtehudes in Dänemark, Schweden und Lübeck sowie zur Stimmung und dem Tonartengebrauch
Der Typus der expressiven monodischen Choralbearbeitung kann durch die Quellenlage zum Spätstil gerechnet werden. Hilfreich ist der Hinweis, dass bei allen Buxtehudewerken die Überschreitungen des Rahmens der mitteltönigen Stimmung einen bewussten Gebrauch starker Dissonanzen (wie H/Dis) voraussetzen. Mit dieser Interpretation wird das Problem einer vermeintlichen Unvereinbarkeit von Tonartengebrauch und mitteltöniger Stimmung gelöst.2 Es kann davon ausgegangen werden, dass alle choralgebundenen Orgelwerke Buxtehudes auf den Orgeln der Lübecker Marienkirche gespielt werden konnten.3 Es ist ein Anliegen dieser Edition, die Informationen wiederzugeben, die sich aus der Notation der uns zugänglichen Quellen ergeben. Es handelt sich um eine praktische Quellenedition Die erste Gesamtausgabe der Orgelwerke Buxtehudes wurde ab 1875 von Philipp Spitta im Verlag von Breitkopf & Härtel publiziert. Spitta legte eine quellenorientierte Edition vor, wobei ihm zustattenkam, dass die wichtigsten Manuskripte sich in Berlin befanden. Auf der Grundlage seines Notentextes und einer Revision von Max Seiffert (1904) erschienen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Ausgaben mit Hinzufügungen im Sinne der damals üblichen spätromantischen oder auch nachromantischen Interpretationsstile. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts entstand ein neuer Trend mit Editionen, die den überlieferten Notentext in melodischen Details umformten: Dabei wurde die Detaildiversität durch eine Detailvereinheitlichung im Sinne von Analogien und Angleichungen ersetzt.4 Ein weiteres editorisches Bearbeitungsfeld ergab sich durch die Möglichkeit, in der modernen Notation grafische Eigenarten der ursprünglichen Buchstabentabulatur abzubilden.5 Von bleibendem Wert ist die umfassende Quellendokumentation in der wissenschaftlichen Edition von Michael Belotti.6
Mit der Diskussion des Verhältnisses der verwendeten Tonarten zur mitteltönigen Temperatur wird in dieser Edition ein bisher wenig beachteter Aspekt berücksichtigt, der durch die Präsenz von verschiedenen Stimmungssystemen in alten und neuen Orgeln immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Ein besonderer Dank gilt Konrad Brandt aus Halle, der die Notationsvorlagen erstellte und auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Hochschulerfahrung Anregungen zu wichtigen Editionsfragen gegeben hat.
Ottersberg, Frühjahr 2025 Harald Vogel
1 Johann Gottfried Walther (1684–1748) wirkte von 1707 bis zu seinem Tode 1748 in Weimar als Organist der Stadtkirche und Musiklehrer der Prinzen am herzoglichen Hof. Neben seiner Musik- und Kompositionslehre Praecepta der Musicalischen Composition (1708) verfasste er das weitverbreitete Musicalische Lexicon (1732). Der vorbildlich kommentierte Nachdruck der Briefe Walthers ist eine Fundgrube für die Kenntnis der nord- und mitteldeutschen Musikszene im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts; vgl. Johann Gottfried Walther, Briefe, hrsg. von Klaus Beckmann und Hans-Joachim Schulze, Leipzig 1987.
2 Vgl. Band I/2, S. 79f. und Harald Vogel, Der Codex E. B. 1688 und die Buxtehudewerke im Zusammenhang der Musica sub communione, in: Buxtehude-Studien, Bd. 4, Bonn 2021, S. 33–50.
3 Für die Interpretation der Orgelwerke Buxtehudes ist die hier erstmalig vorgelegte Analyse der klanglichen Proportionen und der technischen Struktur der großen Orgel in der Marienkirche bedeutsam (siehe Band III/2, S. 96).
4 Das Verfahren der sogenannten „inneren Textkritik“ mit dem Ziel der Übereinstimmung von Fugenthemen und vergleichbaren melodischen und rhythmischen Figuren war mit der Erwartung einer Annäherung an die verlorenen Autographe verbunden.
5 Das Konzept der „tabulaturkonformen“ Notation führt zu einem neuartigen Notenbild, das auf einen Teil der seit dem 17. Jahrhundert üblichen Balkungen verzichtet und mit einer legatofernen Artikulation in Verbindung gebracht werden kann. Die historischen Notationsformen bilden aber den Artikulationsstil nicht unmittelbar ab. Das erklärt die Verwendung von völlig verschiedenartigen Notationsformen im Werk eines einzelnen Komponisten, im Falle von Buxtehude die Buchstabentabulatur und die Liniennotation.
6 Dieterich Buxtehude, The Collected Works, Vol. 15B und 16B, herausgegeben von Michael Belotti, New York 1998 bzw. 2010.
In this edition, Buxtehude’s chorale-based organ works are divided into two volumes in order to achieve a practical size and to facilitate usage. Volume III/1 contains the two large chorale fantasias (BuxWV 188 and 210), the Te Deum (BuxWV 218), and the other works with the text incipits in alphabetical order from A to L. Following in volume III/2 are the works with text incipits from M to W, the two appendices, and the text section with the Critical Report.
Only occasionally included within the manuscript sources are a few of Buxtehude’s free compositions. While the free organ works reveal a broad transmission from Scandinavia to northern and central Germany, most of the chorale-based works are known from the collection of one person: Johann Gottfried Walther.1 His manuscripts, including Buxtehude works, suggest that there was a mutual interest in Buxtehude’s organ works during the time Walther worked with Johann Sebastian Bach in Weimar before 1717. In the manuscripts going back to Bach and his circle, we find almost exclusively free works, but the Walther manuscripts, on the other hand, contain chorale-based works without exception. His copies comprise the majority of this edition’s 50 titles. Due to the loss of Buxtehude’s fair-copy and composing manuscripts, the transmission by Johann Gottfried Walther is a stroke of luck.
Most of the models for the works in the Walther manuscripts were probably already recorded in staff notation, as missing here are the typical transcription errors from one notation to the other. The large chorale fantasias were, though, transcribed from letter tablature, Buxtehude’s compositional notation. For most of the chorale-based works, Walther used a form of staff notation that is not recorded on two staves – as was usual around 1700 and before – but predominantly on three staves, with the pedal part on the lower staff. This is a relatively minor transformation of the tablature notation with the individual voices in clear rows of letters (see facsimile volume I/1, p. 30). The alternating notation with two and three staves can be found in the chorale fantasias and in the Te Deum as historical source notation. One difficulty lies in interpreting Walther’s ornamentation signs, which no longer feature the North-German traditional form.
This edition’s most important source-oriented aspects, approximating the original notation via modern notation, are
• the reproduction of the original note values, beaming, and time signatures,
• the notation of rests according to the sources without a systematic completion,
• the reproduction of all metrical structures,
• the omission of melodic and rhythmic adjustments, and
• the appearance of the German keyboard notation with divided bar lines.
The practical aspects differing from the historical notation conventions are
• accidentals valid for an entire measure,
• modern clefs for the upper staves,
• added rests and notes in small print,
• in rare cases added accidentals above or below the notes, and
• ties added in dashed form.
The explanatory texts can be found in volume III/2. Differences from the sources are presented in the Einzelanmerkungen in correction lists with systematic error analyses. The text contributions contain information on the sources, the ornament style, the notation and chronology, as well as on the organs at Buxtehude’s work locations in Denmark, Sweden and Lübeck.
The type of the expressive monodic chorale can be classified from the sources as a late style. It is helpful to observe that in all of Buxtehude’s works, exceeding the meantone-tuning limitations presupposes a deliberate use of strong dissonances (such as B/D sharp). This interpretation solves the problem of a supposed incompatibility between the use of keys and meantone tuning.2 It can be assumed that all of Buxtehude’s chorale-based organ works could be played on the organs of the Marienkirche in Lübeck.3
This edition aims to reproduce the information resulting from the notation of the sources available to us. It is a practical source edition The first complete edition of Buxtehude’s organ works was published as of 1875 by Philipp Spitta at the Breitkopf & Härtel publishing house. Spitta presented a source-oriented edition, benefitting from the fact that the most important manuscripts were in Berlin. Based on this music text and on a revision by Max Seiffert (1904), editions were published in the first half of the 20th century with additions in line with the then-common late Romantic or even post-Romantic styles of interpretation. In the last third of the 20th century, a new trend emerged with editions transforming the source text in terms of melodic details: the diversity of detail was replaced by a unification
of detail.4 A further field of editorial work arose from the possibility of reproducing some graphic peculiarities of the original letter tablature in the modern notation.5 The comprehensive source documentation in the Michael Belotti’s scholarly edition is of lasting value.6
With the discussion of the relationship between the keys used and the meantone temperament, this edition considers an aspect that has hitherto received little attention and is becoming increasingly important owing to the presence of different tuning systems in old and new organs.
Special thanks are due to Konrad Brandt from Halle, who prepared the notation models and provided suggestions on important editorial questions based on his decades of academic teaching.
Spring 2025
Harald Vogel
1 Johann Gottfried Walther (1684–1748) was organist of the Weimar Stadtkirche and music tutor to the princes at the Saxe-Weimar ducal court from 1707 until his death in 1748. Besides his music- and compositional theory manual Praecepta der Musicalischen Composition (1708), he also wrote the widely-used Musicalisches Lexicon (1732). The exemplary annotated reprint of Walther’s letters is a treasure trove for knowledge of the northern and central German music scene in the first third of the 18th century; see Johann Gottfried Walther, Briefe, ed. by Klaus Beckmann and Hans-Joachim Schulze, Leipzig, 1987.
2 Cf. volume I/2, pp. 79f., and Harald Vogel, Der Codex E. B. 1688 und die Buxtehudewerke im Zusammenhang der Musica sub communione, in: Buxtehude-Studien vol. 4, Bonn, 2021, pp. 33–50.
3 The analysis of the sound proportion and the technical structure of the large organ in the Marienkirche, presented here for the first time, is important for the interpretation of Buxtehude’s organ works (see volume III/2, p. 96).
4 The procedure of the so-called “inner textual criticism” with the aim of matching fugue themes and comparable melodic and rhythmic figures was associated with the expectation of a more authentic musical text.
5 The concept of “tablature-conforming” notation leading to a new type of notation that dispenses with some of the beaming customary since the 17th century, can be associated with an articulation far removed from legato However, historical notation forms do not directly reflect the articulation style. This explains the use of completely different forms of notation in the work of a single composer, letter tablature and staff notation in Buxtehude’s case.
6 Dieterich Buxtehude, The Collected Works, vol. 15B and 16B, ed. by Michael Belotti, New York, 1998, and, respectively, 2010.
Dieterich Buxtehude herausgegeben von Harald Vogel
BuxWV 188
Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalienund Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.
This is an excerpt.
Not all pages are displayed.
Have we sparked your interest?
We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com.