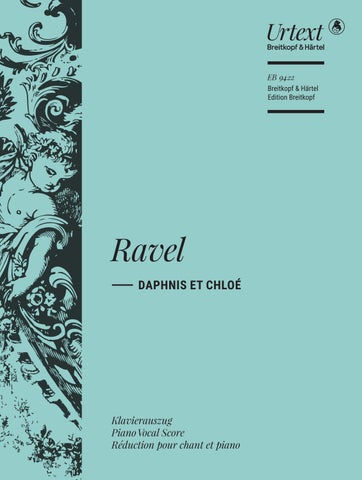Ravel
– DAPHNIS ET CHLOÉ
Breitkopf & Härtel Edition Breitkopf
Klavierauszug
Piano Vocal Score
Réduction pour chant et piano
Besetzung Scoring Distribution
vierstimmiger gemischter Chor four-part Mixed Choir
3 Flöten (II, III auch Piccolo)
Altflöte
2 Oboen
Englischhorn
Kleine Klarinette in Es
2 Klarinetten in A, B
Bassklarinette in B
3 Fagotte
Kontrafagott
4 Hörner in F
4 Trompeten in C
3 Posaunen
3 Flutes (II, III also Piccolo)
Alto Flute
2 Oboes
English Horn
Soprano Clarinet in Ej
2 Clarinets in A, Bj
Bass Clarinet in Bj
3 Bassoons
Double Bassoon
4 Horns in F
4 Trumpets in C
3 Trombones
Chœur mixte à quatre voix
3 Flûtes (II, III aussi Petite Flûte)
Flûte en Sol
2 Hautbois
Cor anglais
Petite Clarinette en Mij
2 Clarinettes en La, Sij
Clarinette basse en Sij
3 Bassons
Contrebasson
4 Cors en Fa
4 Trompettes en Do
3 Trombones Tuba Tuba Tuba
Pauken
Timpani
Timbales
Schlagzeug Percussion Percussion
2 Harfen
2 Harps
2 Harpes Celesta Celesta Célesta
Streicher
Auf der Bühne
Piccolo
Kleine Klarinette in Es
Hinter der Bühne
Strings
On stage
Piccolo
Soprano Clarinet in Ej
Off stage
Cordes
Sur la Scène
Petite Flûte
Petite Clarinette en Mij
Derrière la Scène
Horn Horn Cor Trompete Trumpet Trompette
Aufführungsdauer
etwa 50 Minuten
Performing Time
approx. 50 minutes
Durée
environ 50 minutes
Suite Nr. 1: T. 448–857
Suite Nr. 2: T. 1037–Ende
Suite No. 1: mm. 448–857
Suite No. 2: mm. 1037–end
Suite No 1 : mes. 448–857
Suite No 2 : mes. 1037–fin
Partitur PB 5650 käuflich lieferbar
Orchestermaterial mietweise
Score PB 5650 available for sale
Orchestral material on hire
Partition PB 5650 disponible en vente
Matériel d’orchestre en location
Historischer Kontext und erste Aufführungen
Vorwort
Selten wurde eine Ballettmusik so oft bearbeitet wie diejenige zu Daphnis et Chloé. Bekanntermaßen war Michel Fokine bereits 1904 versucht, ein Ballett nach dem berühmten Roman Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [Die pastorale Liebe von Daphnis und Chloé] von Longus aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus zu erschaffen. Zu dieser Zeit war er noch Mitglied des kaiserlichen Balletts von Sankt Petersburg. Als er zum ständigen Choreographen der Ballets russes in Paris ernannt worden war, schien er dieses Projekt nach dem Erfolg der Danses du Prince Igor von Alexandr Borodin (19. Mai 1909) wieder zur Sprache gebracht und Sergej Diaghilew davon überzeugt zu haben, den Stoff für eine neue Choreographie in der anstehenden Saison 1910 zu nutzen. Dank der Vermittlung durch MichelDmitrij Calvocoressi gelang es Diaghilew, Ravel, dem das Sujet zusagte, für das Projekt zu gewinnen. In seiner Autobiographischen Skizze1 behauptet Ravel, im Jahr 1907 mit der Arbeit an dem Werk begonnen zu haben. Alles weist darauf hin, dass es sich dabei um einen Irrtum handelt, da die eigentlichen Ballets russes erst 1909 in Erscheinung traten. 1907 hingegen wurden nur fünf „Concerts historiques russes“ aufgeführt. Serge Lifar versichert seinerseits, dass sich Diaghilew und Ravel bereits 1906 begegnet seien; daher besteht die Möglichkeit, dass die Arbeiten zu Daphnis bereits vor 1909 begonnen wurden – ohne dass das Werk zwingend schon als Ballett konzipiert war.2 Wie dem auch sei, die ersten Probleme tauchen sehr schnell auf. Die Saison 1909 endet für die Ballets russes mit einem Schuldenberg, und Misstrauen macht sich zwischen dem Komponisten und dem berühmten Impresario breit. Ravel, der nichts lieber möchte, als eine Ballettmusik für die Russen zu komponieren, empfindet Fokines mythologisches Geschichtchen als zu schwach und verlangt nachdrücklich danach, das Libretto zu ändern. Als ihm schließlich das Recht eingeräumt wird, Korrekturen anzubringen, die er für notwendig hält, macht er sich nur langsam an die Arbeit. Am 27. Juni 1909 schreibt er an Marguerite de SaintMarceaux: „Ich muss Ihnen sagen, dass ich eine irre Woche hinter mir habe: Vorbereitung eines Ballettlibrettos, das für die kommende Saison russe bestimmt ist. Fast jede Nacht Arbeit bis drei Uhr früh. Was die Dinge kompliziert macht, ist, dass Fokine kein Wort Französisch kann. Ich aber kann auf Russisch nur fluchen. Sie können sich vorstellen, in welcher Atmosphäre die Zusammenkünfte stattfinden, trotz der Dolmetscher.“3 Selbst im freiwilligen Rückzug ins Landhaus seiner Freunde Cipa und Ida Godebski in der Nähe von Fontainebleau erweist sich die Ausarbeitung als schwieriger als erwartet. Im März 1910 ist die Partitur kaum gewachsen. „Nun haben wir uns [in Valvins, wo die Godebskis Ravel ihr Haus zur Verfügung gestellt haben] eingerichtet. Die Arbeit geht mir schnell von der Hand. Ma mère l’Oye [Mutter Gans] ist bereits zum Kopisten geschickt. Heute habe ich eine Szene für das Ballett geschaffen, die in Paris nicht gelingen wollte.“4 Einen Monat später gesteht Ravel Ida Godebska: „Daphnis geht nur langsam voran (gemessen an dem, was die Russen daraus machen werden). Nicht, dass ich nicht daran arbeiten würde. Ich zwinge mich vom Morgen an dazu.“5 Aber „diese verdammten kleinen Vögel“ halten ihn von der Arbeit ab. Ravel setzt alles daran, die größte Zeitnot abzuwenden. Davon zeugt eine frühe Fassung für Klavier, bestehend aus 47 signierten Seiten, datiert auf den 1. Mai 1910, die er sogar bei Durand herauszugeben gedenkt. Doch seine Bemühungen reichen nicht aus, um die Partitur rechtzeitig zu Ende zu bringen. Darüber hinaus beginnt er, sich Sorgen um seine Rechte zu machen, sollte das Ballett nicht im Rahmen der Saison russe aufgeführt werden. „Wenn Daphnis in der Oper aufgeführt
würde,“ schreibt er an Calvocoressi am 3. Mai 1910, „erhielte Madame Stichel (die Ballettmeisterin der Oper) ein Drittel, Fokine ein weiteres Drittel, und ich müsste mich mit dem Rest zufriedengeben. Unter keinen Umständen würde ich aber mein Werk zu diesen Bedingungen aufführen lassen. Wir (ich sage wir, da auch ich daran gearbeitet habe) haben einige schlaflose Nächte damit verbracht, das Libretto zu schreiben, an dem ich seitdem Verbesserungen vorgenommen habe, und nun schufte ich schon monatelang an der Musik. Ich fände es höchst ungerecht, nur ein Drittel zu erhalten... […] Es ist mir unangenehm, Sie mit dieser Geschichte zu belästigen, aber es ist nicht angenehm, einen Briefwechsel mit Typen zu führen, die kein Wort dieser Sprache beherrschen, um die uns Europa beneidet...“6
Unterdessen ersetzt Diaghilew verärgert Daphnis durch Igor Strawinskys Oiseau de feu [Feuervogel] (25. Juni 1910), der viel Beifall erhält. Selbst Ravel ist davon begeistert, wie folgende Worte an seinen Schüler Maurice Delage bezeugen: „Mein Bester! Sie müssen sich augenblicklich auf die Socken machen: der Oiseau de feu geht weit über RimskijKorsakow hinaus.“7
In der Folgezeit wird es für geraume Zeit still um das Projekt. „Am 13. Juni 1911 weckt Pétrouchka in Ravel den Enthusiasmus und die Lust, mit Daphnis abzuschließen. Einige orchestrierte Ausschnitte seiner Skizze hatte er bereits im Konzert getestet. Diese sind heutzutage als Erste Suite bekannt, deren Uraufführung separat am 2. April 1911 stattfand, dirigiert von Gabriel Pierné, der auch L’Oiseau de feu uraufgeführt hatte. Die Rezeption war eher desaströs, und Ravel sah sich erneut mit Debussy verglichen, wo er doch den Vergleich mit dem jüngeren russischen Kollegen vorgezogen hätte.“8
Nach einer Überarbeitung der „Danse générale“ (Ziffer 194), deren Taktart er ändert (5/4 statt 3/4), wird die endgültige Ausarbeitung laut Manuskript am 5. April 1912 vollendet. Diaghilews Verzweiflung hingegen erreicht ihren Höhepunkt, da er nun, nach dem Erdulden der ravelschen Langsamkeit, dem Stil des Werkes wenig abgewinnen kann und ihm die lyrischen Aspekte der Choreographie altmodisch erscheinen. Obwohl „alles bereit war, um mit den Proben des Stücks im Châtelet zu beginnen“, schreibt Jaques Durand, der Verleger der Komposition, „ließ mir Herr von Diaghilew ausrichten, dass ihn das Werk nicht zur Gänze befriedigte und er zögerte, das Projekt fortzusetzen. Ich setzte meine Überzeugungskunst ein, um Herrn von Diaghilew dazu zu bringen, seinen ersten Eindruck zu überdenken ...Nach einigen Überlegungen antwortete mir Herr von Diaghilew schlicht: ‚Ich werde Daphnis aufführen…‘ “9 Noch ist allerdings nichts gewonnen. Der Mangel an Proben und die unablässigen Streitereien unter den Tänzern, vor allem zwischen Nijinsky und Fokine betreffs der Choreographie, lassen das Schlimmste erahnen. Hinzu kommen die Schwierigkeiten des Corps de ballet, bestimmte Passagen einzustudieren, vor allem den 5/4Takt der „Danse générale“. Man stelle sich die Atmosphäre hinter den Kulissen vor! Unter diesen Umständen ist es kaum verwunderlich, dass die Uraufführung vom 5. auf den 8. Juni 1912 verschoben wird und sich zudem, mangels Generalprobe, die Anzahl der Aufführungen auf zwei reduziert. Dirigent ist Pierre Monteux, die Kritiker preisen die „rührende Anmut“ der Karsawina in der Rolle der Chloé und die „unvergleichliche Jugendhaftigkeit“ Nijinskys als Daphnis. „Baksts Bühnenbild erscheint in verblüffenden Farben. Man sieht eine Art blaues Meer hinter roten Felsen, dessen Effekt erstaunlich ist“, notiert Marguerite de SaintMarceaux in ihrem Tagebuch.10 Neben Daphnis et Chloé enthält das Programm dieses Abends L’Aprés-midi d’un faune [Nachmittag eines Fauns] von
Harmonische Sprache
In seiner Autobiographischen Skizze bestätigt Ravel, dass „das Werk symphonisch gebaut ist, einem strengen tonalen Plan folgend und mit einer kleinen Anzahl von Motiven, deren Verarbeitung die Homogenität der Komposition sicherstellt.“23 Die beiden Hauptmotive treten von Anfang an in Erscheinung: das der Nymphen im siebten Takt in Form einer Arabeske mit einer für Ravel typischen absteigenden Linie und das von Daphnis und Chloé, das im 12. Takt vom Horn vorgetragen wird und sich um zwei Quinten herum aufbaut. Schon Christian Goubault hat deutlich auf dessen symbolischen Wert hingewiesen: der zweite Teil (aufsteigende Quinte G–D) ist das Spiegelbild des ersten Teils (absteigende Quinte G–C), „wodurch die Identität und die Gegenseitigkeit der Liebe zwischen den beiden Wesen ausgedrückt wird.“24 Auf Anhieb ist der Hörer eingenommen von der Inszenierung des Klangs im Vorspiel: sechs aufsteigende reine Quinten, langsam vorgetragen von Harfe und gedämpften Streichern über einem Paukentremolo. Alles ist bewusst im kaum wahrnehmbaren pianissimo gehalten und mündet in einem vom Chor vorgetragenen schwingenden QuartMotiv. Um die Formulierung von RolandManuel aufzugreifen, handelt es sich darum, „das Unvorhersehbare der klanglichen Substanz zu dosieren.“25 Das Aufschichten von Quarten und Quinten als Kompositionstechnik ist einer der zentralen Aspekte der harmonischen Sprache Ravels. Im Verlauf des Werkes erscheinen weitere Motive wie jener Kriegsschrei beim Überfall der Räuberbande (T. 435), der in der „Danse guerrière“ verarbeitet wird. Ein weiteres, durch Klarinetten und Bratschen vorgetragenes Motiv (Z. 196), scheint direkt dem zweiten Satz von Rimskij-Korsakows Schéhérazade zu entspringen.
Ravels ganze Kunst besteht darin, diese Motive mit dem Fortschreiten der Handlung nach und nach neu zu erfinden, indem er ihre Melodie oder ihre Struktur leicht verändert. Beispiele hierfür sind das Motiv der drei Nymphen, das Ravel im „Nocturne“ (Z. 70) anklingen lässt, um es dreifach zu variieren, sowie das Thema von Daphnis und Chloé, welches zahlreiche metrische und rhythmische Veränderungen erfährt (Z. 53, 63, 79). Im „Lever du jour“ [Sonnenaufgang] (Z. 155) komponiert Ravel eines der wunderbarsten jemals in Musik gefassten Naturbildnisse. Das SchlussBacchanal (Z. 199) hat stets Bewunderung hervorgerufen: „ein klanglicher Rausch ... Ein immenses Crescendo, das nie nachlässt und schließlich in einen frenetischen und dionysischen Rhythmus ausbricht.“26 Tatsächlich erzeugt die in den Tiefen des Orchesters entstandene melodische Linie H-Fis-E-A-H (Z. 158), die unaufhaltsam anschwillt und zu dem von den Streichern verklärten Motiv von Daphnis und Chloé (Z. 165) zurückführt, einen außergewöhnlichen Effekt. Während die „Danse guerrière“ (Z. 92) durch ihren Rhythmus und ihren Charakter an Strawinsky anknüpft, erinnert die Bacchanale unausweichlich an die „Polowetzer Tänze“ aus Borodins Prince Igor Im Gegensatz zur Einheit des melodischen Materials, welches das Ballett in seiner ganzen Länge durchdringt, sind Ravels Harmonien vielschichtig, da es keine räumlichen Grenzen in den von ihm verwendeten Akkorden gibt. Häufig greift er auf die Undezime und die Tredezime zurück. „In Ravels Musik und speziell in Daphnis kann eine Harmonie eine Vielzahl anderer verdecken.“27 Die subtile Vermittlung ausgefallener Harmonien ist eine Fähigkeit, für die der Komponist auf ihm liebgewonnene Mittel zurückgreift: Pedaltöne, Vorausnahmen, Verzögerungen, Verzierungsnoten sowie unaufgelöste Vorhalte (oder solche, die sich nur aufzulösen scheinen). An dieser Stelle sollte auch auf eine Form von EigenReminiszenzen in der Harmonik hingewiesen werden, die sich in der Mehrzahl seiner Kompositionen findet, beispielsweise durch Vergleich der Sequenz bei Z. 184 mit der aus Nummer sieben der Valses nobles et sentimentales (Z. 53).
Ein weiteres Element, an dem Ravel sehr liegt, ist der Rückgriff auf altertümliche Modi wie dem hypodorischen (dem zweiten gregorianischen Modus) im Flötensolo der „Danse de Lyceion“ (Z. 57). Der Ausspruch „Ravel, dieser spanische Grieche“28, der von André Suarès stammt und von LéonPaul Fargue aufgegriffen wurde, verdeutlicht perfekt die ästhetische Ausrichtung der Musik zu Daphnis: Die iberische Inspiration bestimmter Flötenpassagen ist unbestreitbar.
Nicht zuletzt sollte die Aufmerksamkeit auf die dynamische Kraft der Rhythmen gelenkt werden, die eine zentrale Rolle im ravelschen Universum spielen. „Im Allgemeinen nimmt der Rhythmus bei Ravel eine konstruktive Rolle in der klanglichen Entwicklung und der Organisation des musikalischen Gerüsts ein.“29 Ravel hat eine Vorliebe für ungerade Taktarten: 7/4 in der „Danse des jeunes filles“ (Z. 17), 5/4 in der „Danse générale“ (Z. 194). Manchmal bevorzugt er die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Rhythmen. Jules van Ackere nennt als Beispiel die zweideutige Wiegenbewegung des 6/8Rhythmus, die sich aus der Überlagerung von drei Achteln mit zwei punktierten Achteln ergibt (Z. 43).30 Die Entführungsszene zeigt ebenfalls die Verwendung rhythmischer Dualität, besonders in der Überlagerung von 2/4- und 6/8-Takten (Z. 105).
Merkmale der Instrumentierung
Der Komponist von Daphnis et Chloé war ein Bewunderer vom Orchesterklang der großen Symphoniker seines Jahrhunderts, nicht nur von dem von SaintSäens, sondern auch dem der russischen Schule im Allgemeinen. Dennoch ist „der Einfluss des Russischen selbst kaum bei ihm wahrnehmbar, und es gibt wenig Gemeinsamkeiten zwischen einer derartigen Meisterschaft und der brillanten, oft protzigen Virtuosität eines RimskijKorsakow. Man stellt viel mehr fest, dass es zwischen diesen beiden Stilen eine essentielle Gegensätzlichkeit gibt, die sich darin äußert, dass Ravels Instrumentierung im Gegensatz zu der des russischen Musikers nie auf einen Effekt purer Virtuosität abzielt...“31 Eine der wichtigsten Eigenschaften der ravelschen Instrumentierungstechnik besteht darin, dass der Komponist das Orchester nur selten in Gruppen behandelt. Das phasenweise Dominieren von Streichern, von Holz oder von Blechbläsern, wie es bei Strawinsky häufig vorkommt, findet sich bei Ravel kaum. Die Aufteilung der Instrumente geschieht gleichermaßen aus praktischen Gründen wie für die klangliche Ausgewogenheit. Jedes Instrument wird auf die wirkungsvollste Weise behandelt. Ravel hat zugegebenermaßen einen Hang zu Schlaginstrumenten. Vincent d’Indy wirft ihm sogar einen „wahrlich ermüdenden Missbrauch“32 derselben vor. Einfache Effekte jedoch vermeidet er. Es gibt keine Paukenglissandi wie bei Bartók. Er scheint hingegen mit Richard Strauss einer der ersten zu sein, der das Éoliphone verwendet, jene Windmaschine, die in L’Enfant et les Sortilèges [Das Kind und der Zauberspuk] zu finden ist. Die Art und Weise, mit der er diese einsetzt, gibt Aufschluss über die Sorgfalt in der Notation von Feinheiten wie diese subtile Nuancierung in der Intensität (5. Takt nach Z. 152): ein Anschwellen zum fff, dann ein Abschwellen zum p im nächsten Takt, danach wieder Crescendo zum f, auf das ein erneutes Abschwellen folgt.
Augenscheinlich sind die extreme Aufteilung der Streicher, die Glissandi auf Flageoletttönen (zweite Violinen und Celli bei Z. 70) und die vergleichsweise häufige Verwendung des Portato (Z. 42). Das SoloCello muss die GSaite um einen Halbton nach oben stimmen (Z. 56). In einem Brief an den Komponisten und Musikwissenschaftler Henry Woollett33 nennt Ravel einige Beispiele „orchestraler Effekte“ mit einem gewissen Stolz: Akkordtriller sul tasto mit Dämpfer (Z. 70) „hier wird der mysteriöse Effekt ebenso durch das Divisi wie durch das TamTam und die Harmonik hervorgerufen“, Legato-Pizzicati (Z. 104) und etwas später „die brillante
Wirkung im p“ der Alt-Flöte (Z. 114). Des Weiteren unterstreicht er eine zugleich raffinierte und poetische „Vermählung der Klangfarben“, die ihm sehr am Herzen liegt (Z. 49). Dynamische Variationen wie das minutiös angegebene taktweise Anschwellen von ppp subito zu f bei Z. 38 sind mit besonderer Sorgfalt notiert. Die Verwendung eines Chores ohne Worte schließlich ist ein Beispiel für eine „kontinuierliche Orgel aus Stimmen“, eine vokale Kompositionstechnik, die man bereits im dritten Satz der Nocturnes von Debussy antrifft.34
Wäre das Ballett Daphnis ohne L’Oiseau de feu und Pétrouchka das, was es ist? Kann man sich umgekehrt L’Oiseau de feu und Pétrouchka ohne die Rapsodie espagnole vorstellen? Strawinsky wird 1910 des Öfteren verdächtigt, die beiden Schlusstakte der Rapsodie espagnole für das Ende der „Danse infernale“ des Oiseau de feu imitiert zu haben. Dabei ist es eben gerade das Wesen von Strawinskys Neuerungen und Einflüssen selbst, die Ravel dazu bringen, über seine eigene Entwicklung nachzudenken. Man kennt die Haltung der Nostalgiker der „guten alten Zeit“, die der Musik im Ballett nur eine zweitrangige Rolle zugestehen. War nicht auch der Vorwurf laut geworden, La Belle au bois dormant [Dornröschen] von Pjotr Ilijtsch Tschaikowsky sei nicht tänzerisch genug und zu symphonisch? Ravel ist sich seinerseits bewusst, dass er es vermeiden muss, müden Klischees des klassischen Tanzspektakels in die Falle zu gehen. Dieser Gedanke beschäftigt ihn dermaßen, dass er zögert, ein Werk „Ballett“ zu nennen, das diese Bezeichnung unter allen Aspekten verdient. Ein gegenseitiger Einfluss war also vorhanden, und als Strawinsky 1935 seine Erinnerungen veröffentlicht, entdeckt Ravel, dass dieser Daphnis eine besondere Wertschätzung entgegenbrachte: „In Paris, wohin ich mich zur Saison von Diaghilew begab, hörte ich unter anderem Maurice Ravels brillante Komposition Daphnis et Chloé, in die mich der Urheber bereits zuvor am Klavier eingeführt hatte. Dies ist mit Sicherheit nicht nur eines der besten Werke Ravels, sondern auch eines der schönsten Erzeugnisse der französischen Musik.“35
Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle den Bibliotheken des Orchestre Les Siècles, des Orchestre de l’Opéra national de Paris und des Orchestre de la Suisse Romande, die mir erlaubt haben, in das Orchestermaterial Einsicht zu nehmen. Des Weiteren gilt mein Dank Charles Dutoit für seine unaufdringlichen und immer wertvollen Ratschläge sowie dem Verlag Breitkopf & Härtel und seiner Mitarbeiterin Alexandra Krämer, die meine Arbeit mit besonderer Sorgfalt begleitet haben.
Epalinges, Frühjahr 2021
Anmerkungen zum Klavierauszug
JeanFrançois Monnard
Die vorliegende Ausgabe behält den originalen Klavierauszug von Ravel im Wesentlichen bei, ergänzt ihn jedoch durch die Tempound Metrumangaben sowie durch das Libretto aus der Dirigierpartitur PB 5650. Abweichungen des Auszugs von der Partitur bei den dynamischen Bezeichnungen sind dem Umstand geschuldet, dass sich diese nicht ohne weiteres vom Orchester auf das Klavier übertragen lassen und umgekehrt. Ravel nahm daher einige Retuschen vor, die dem Hörbarmachen des musikalischen Aufbaus, einer größeren klanglichen Transparenz sowie einer differenzierten dynamischen Abstufung dienen und die unverändert übernommen wurden. Der besseren Lesbarkeit wegen sind originale runde Klammern getilgt, der Notensatz, z. B. bei der Bogenführung und der enharmonischen Verwechslung von Doppelkreuzen, behutsam modernisiert. Der Chor singt die Vokalisen
stets auf „A“. Dies wurde der Einfachheit halber nur auf den ersten Seiten notiert.
Einige Abweichungen zwischen dem Klavierauszug von 1910 und der Orchesterfassung wurden in der späteren Auflage von 1948 korrigiert bzw. an die Orchesterfassung angepasst. Die wichtigsten Differenzen zur Orchesterfassung sind im Kritischen Bericht der Dirigierpartitur PB 5650 aufgelistet. Hier sei lediglich auf die in der Klavierfassung fehlenden Takte 1 und 438 hingewiesen. Diese wurden editorisch ergänzt.
Der vorliegende Klavierauszug kann ebenfalls für die Einstudierung der beiden Suiten (Nr. 1 T. 448–857, Nr. 2 T. 1037–Ende) verwendet werden. Die Taktzähler der Suiten sind in runden Klammern angegeben.
Wiesbaden, Frühjahr 2022
Breitkopf & Härtel
1 RolandManuel, Une Esquisse autobiographique de Maurice Ravel, in: La Revue musicale, Dezember 1938 [= RolandManuel, Esquisse autobiographique], S. 17–23.
2 Serge Lifar, Maurice Ravel et le ballet, in: La Revue musicale, Dezember 1938, S. 75.
3 Brief von Ravel an Marguerite de SaintMarceaux vom 27. Juni 1909, siehe Arbie Orenstein, Maurice Ravel. Lettres, Ecrits, Entretiens, Paris 1989 [= Orenstein, Lettres], S. 105.
4 Brief von Ravel an Cipa Godebski vom 10. April 1910, siehe René Chalupt, Ravel au miroir de ses lettres, Paris 1956 [= Chalupt, Lettres], S. 83.
5 Brief von Ravel an Mme Godebska vom 10. Mai 1910, Chalupt, Lettres, S. 88.
6 Brief von Ravel an Michel D. Calvocoressi vom 3. Mai 1910, Orenstein, Lettres, S. 111f.
7 Zitiert nach Marcel Marnat, in: Cahiers Maurice Ravel, Fondation Maurice Ravel [= CMR], Nr. 5 (1990–1992), S. 36.
8 Marcel Marnat, Ravel et Stravinsky, in: CMR, Nr. 5 (1990–1992), S. 44.
9 Jacques Durand, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique, 2e série: 1910–1924, Paris 1925, S. 16.
10 Marguerite de SaintMarceaux, Journal 1894–1927, hrsg. von Myriam Chimènes, Paris 2007, S. 707.
11 Brief von Ravel an Ralph Vaughan Williams vom 5. August 1912, Orenstein, Lettres, S. 124.
12 Brief von Ravel an Jacques Rouché vom 7. Oktober 1912, Orenstein, Lettres, S. 125.
13 Zitiert nach Vera Strawinsky und Robert Craft, in: Stravinsky in Pictures and Documents, New York 1978, S. 73.
14 Comoedia, 18. Juni 1914.
15 Offener Brief, veröffentlicht in diversen Londoner Zeitschriften (z. B. The Times, Morning Post, Daily Mail), 7. Juni 1914.
16 Brief von Ravel an den Direktor von Comoedia, Gaston de Pawlowski, Anfang Juni 1914, siehe Maurice Ravel, L’intégrale: Correspondance (1895–1937), écrits et entretiens, hrsg. von Manuel Cornejo, Paris 2018, S. 1371.
17 Robert Brussel, in: Le Figaro, 9. Juni 1912.
18 Arthur Pougin, in: Le Ménestrel, 15. Juni 1912.
19 Henri Ghéon, in: La Nouvelle Revue française, August 1913.
20 Christian Goubault, Maurice Ravel. Le jardin féerique, Paris 2004 [= Goubault, Ravel], S. 79.
21 Jean Marnold, in: Mercure de France, 16. August 1917 [= Marnold, Mercure].
22 Danielle CohenLévinas, in: Musical Nr. 4, Juni 1987 [= CohenLévinas, Musical].
23 RolandManuel, Esquisse autobiographique, S. 22.
24 Goubault, Ravel, S. 115.
25 RolandManuel, A la gloire de Ravel, Paris 1938, S. 76.
26 Hélène JourdanMorhange, Ravel et nous. L’homme – l’ami – le musicien, Genf 1945, S. 115. Jourdan-Morhange zitiert Charles Koechlin, ohne ihn zu nennen.
27 CohenLévinas, Musical
28 André Suarès, Ravel, Esquisse, in: La Revue musicale, Dezember 1938, S. 50.
29 Jules van Ackere, Maurice Ravel, Brüssel 1957, S. 192.
30 Ebd., S. 194.
31 Marnold, Mercure
32 Vincent d’Indy, À propos de Daphnis et Chloé, in: S.I.M. 1. Mai 1914, zitiert nach: Goubault, Ravel, S. 124.
33 Brief von Ravel an Henry Woollett vom 29. Juni 1914, in: CMR, Nr. 15 (2012), S. 53–57. Henry Woollett (1864–1936), englischstämmiger
Historical Background and First Performances
Komponist und Musikwissenschaftler aus Le Havre, befreundet mit George JeanAubry, zunächst Lehrer, später Leiter der Société Philharmonique SainteCécile und der Schola Cantorum von Le Havre. Schüler von Raoul Pugno (Klavier) und Jules Massenet (Komposition), Lehrer von André Caplet, Arthur Honegger und Raymond Loucheur.
34 Interessierte Leser seien auf den sehr fundierten Artikel von JeanDavid JumeauLafond zu diesem Thema hingewiesen: Le chœur sans paroles ou les voix du sublime, in: Revue de musicologie, Bd. 83, 1997, Nr. 2, S. 263–279.
35 Igor Strawinsky, Chroniques de ma vie, Neuausgabe, Paris 2000, S. 51.
Preface
Never has a ballet score been subjected in the making to more adjustments than Daphnis et Chloé. We know that Michel Fokine had already in 1904 considered the idea of creating a ballet based on Longus’ wellknown romance Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [The Pastoral Loves of Daphnis and Chloe], written in the late second century. At the time, Fokine was still a member of the Imperial Ballet in St. Petersburg. Later, having assumed the position of choreographer at the Ballets russes in Paris, it appears that, following the success of Aleksandr Borodin’s Danses du Prince Igor (premiered on 19 May 1909), he returned to the idea and convinced Serge Diaghilev, founding artistic director of the Ballets russes, that it would serve as a new choreography for the 1910 season. With MichelDimitri Calvocoressi acting as intermediary, Diaghilev requested the collaboration of Ravel, who was not averse to the idea.
In his Autobiographical Sketch , 1 Ravel contends that work began in 1907. All evidence indicates he was in error here, as the Ballets russes was founded only in 1909. In 1907, Diaghilev had presented a series of five Concerts historiques russes. Yet Serge Lifar affirmed that Diaghilev had met with Ravel in 1906, so it is possible that work on Daphnis – which was perhaps still not thought of in terms of a ballet – had begun prior to 1909. 2 In any case, problems quickly arose. The 1909 season of the Ballets russes ended with a mountain of debt and distrust between composer and the renowned impresario Diaghilev. Ravel, who was happy to be involved with the Ballets russes, found Fokine’s reworking of the mythological tale weak, and insisted on revising the storyline. He was allowed to make whatever alterations he felt necessary, and at length got to work. On 27 June 1909, he wrote to Marguerite de SaintMarceaux: “I must tell you that I have just spent a crazy week. I’ve been preparing a ballet scenario for the next Russian season. Almost every night I work until 3 a.m. What complicates matters is that Fokine doesn’t know a word of French, and I know only how to swear in Russian. Despite the interpreter, you can imagine the tone of these meetings.”3
For Ravel, cloistered in the country home of his friends Cipa and Ida Godebski near Fontainebleau, the undertaking turned out to be more difficult than expected. By March 1910, little had been accomplished. “We are cooped up here … [at Valvins, where the Godebskis had put their home at Ravel’s disposal] I have already set to work. Ma Mère l’Oye [Mother Goose] has already been sent to the copyist. Today I put together a ballet scene that I was not able to compose in Paris.”4 One month later, Ravel declared to Ida Godebska: “Daphnis is not coming along very well (and anyway, who knows what the Russians will do with it). It’s not for lack of trying. In the morning I really apply myself”5 But “those noisy birds”
are a distraction. Ravel did attend to the most urgent matters, as proven by an initial piano version of Daphnis consisting of 47 signed and dated pages (1 May 1910). He even considered having Durand publish it. Nevertheless, despite his efforts, Ravel was unable to complete the score on time. In addition, Ravel began worrying about rights in case the ballet wasn’t given during the Russian season. “If the Opéra were to present Daphnis,” he wrote to Calvocoressi (3 May 1910), “Madame Stichel [the Opéra’s ballet mistress] would get a third, Fokine a third, and I would have to be content with the remainder. No way will I allow my work to be played under such terms. During the evenings, we (I say we because I have been involved too) worked on the scenario, which I have since touched up, incidentally, and I have slaved long months on the music. I think it would be supremely unfair if I were to receive only a third.… […] I am sorry to be bothering you with this business, but it is not very practical to correspond with people who do not know one word of the language that all Europe is jealous of.”6
Meanwhile, the disappointed Diaghilev replaced Daphnis with Igor Stravinsky’s Oiseau de feu [The Firebird] (premiered on 25 June 1910), which was warmly received. It won over even Ravel, who wrote to his student Maurice Delage: “My dear fellow! You need to get moving. Oiseau de feu goes way beyond RimskyKorsakov.”7
Nothing much happened for quite some time. “It was the premiere of Pétrouchka, on 13 June 1911, that fired up Ravel to finish Daphnis. A concert on 2 April 1911 conducted by the man who premiered L’Oiseau de feu, Gabriel Pierné, had served as a test run for the orchestration of the music we now call the First Suite. It was poorly received, and Ravel found himself again compared to Debussy while he would have preferred comparison with his younger Russian colleague.”8
After Ravel had reworked the concluding Danse générale (figure 194), which among other things involved changing the meter from 3/4 to 5/4, the final version of the score was completed on 5 April 1912, as noted in the manuscript. Nevertheless, Diaghilev’s exasperation reached its peak when, after having put up with Ravel’s leisurely pace, he had little appreciation for the musical style, and found the choreographer’s lyricism dated.
“With everything ready for rehearsals at the Châtelet,” wrote Jacques Durand, who would publish the work, “Diaghilev gave me to understand that he was not entirely satisfied with the project, and was hesitant about continuing. I used my powers of persuasion to remind Diaghilev of his initial impression… After some thought, he said simply, ‘I’ll do Daphnis...’ ”9
But there were still challenges ahead. The lack of rehearsals and incessant squabbling, both among the dancers and especially between Nijinsky and Fokine over the choreography, heralded the worst. Added to this are the difficulties the corps de ballet would
however, the very element in Stravinsky that led Ravel to reflect on his own artistic development. We know the mindset of the “old subscriber” to the Belle époque who regards ballet music as only of secondary importance. Was Tchaikovsky’s Belle au bois dormant [Sleeping Beauty] not criticized for being insufficiently danceable and too symphonic? Ravel in turn was aware that he had to avoid falling into the trap of timeworn clichés of classical dance. So preoccupied was he with this thought that he hesitated calling his work a ballet, even though it was one in every respect. The influences therefore cross, and when Stravinsky published his Chronicles in 1935, Ravel discovered that Stravinsky had held Daphnis in particular esteem: “In Paris, where I went for the season with Diaghilev, I heard, among other things, the splendid score by Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, which its composer had already introduced to me at the piano. This is surely not only one of Ravel’s best works, but one of the finest creations of French music.”35
We wish to thank sincerely the libraries of the Orchestre Les Siècles, the Orchestre de l’Opéra national de Paris, and the Orchestre de la Suisse Romande, which kindly allowed us to consult their orchestral material. Our gratitude goes also to Charles Dutoit, a discreet but always attentive advisor, as well as to the publisher Breitkopf & Härtel and their editor Alexandra Krämer, who supported our work with special care.
Epalinges, spring 2021 JeanFrançois Monnard
Annotations on the piano vocal score
The present edition gives Ravel’s original piano reduction and adopts libretto, tempo and meter indications from the full score PB 5650. Differences regarding dynamics are due to the fact that they cannot automatically be transferred from the orchestra to the piano or vice versa. In most cases, these were retouched by Ravel to facilitate a more audible musical structure, to achieve greater transparency, and to nuance the sound. The original piano dynamics were therefore retained. Original parentheses have been deleted for better readability, the notation carefully modernized, and where necessary, bowings and accidentals have been made easier to read (for example, enharmonic change in the case of double sharps). The choir always sings the vocalises on “A,” though this has been noted only on the first few pages for the sake of convenience.
Several differences between the first edition of the piano reduction of 1910 and the orchestral version were corrected and adapted to the orchestral version in the later edition of the reduction of 1948. The most important differences to the orchestral version are listed in the “Kritischer Bericht” [Critical Report] of the full score PB 5650. Mentioned here are only the editorially added measures 1 and 438, originally lacking in the piano version. The present piano reduction can also be used in rehearsing the two suites (no. 1, mm. 448–857, no. 2, from m. 1037–to the end). The suites’ measure numbers are given in parentheses.
Wiesbaden, spring 2022
Breitkopf & Härtel
1 RolandManuel, Une Esquisse autobiographique de Maurice Ravel, in La Revue musicale, December 1938 [= RolandManuel, Esquisse autobiographique], pp. 17–23.
2 Serge Lifar, Maurice Ravel et le ballet, in La Revue musicale, December 1938, p. 75.
3 Letter of 27 June 1909 from Ravel to Marguerite de SaintMarceaux. See Arbie Orenstein, Maurice Ravel, Lettres, Ecrits, Entretiens, Paris, 1989 [= Orenstein, Lettres], p. 105.
4 Letter of 10 April 1910 from Ravel to Cipa Godebski. See René Chalupt, Ravel au miroir de ses lettres, Paris, 1956 [= Chalupt, Lettres], p. 83.
5 Letter of 10 May 1910 from Ravel to Ida Godebska, Chalupt, Lettres, p. 88.
6 Letter of 3 May 1910 from Ravel to Michel D. Calvocoressi, Orenstein, Lettres, pp. 111f.
7 Quoted by Marcel Marnat in Cahiers Maurice Ravel, Fondation Maurice Ravel [= CMR], No. 5 (1990–1992), p. 36.
8 Maurice Marnat, Ravel et Stravinski, in CMR, No. 5 (1990–1992), p. 44.
9 Jacques Durand, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique, 2e série: 1910–1924, Paris, 1925, p. 16.
10 Marguerite de SaintMarceaux, Journal 1894–1927, ed. under the direction of Myriam Chimènes, Paris, 2007, p. 707.
11 Letter of 5 August 1912 from Ravel to Ralph Vaughan Williams, Orenstein, Lettres, p. 124.
12 Letter of 7 October 1912 from Ravel to Jacques Rouché, Orenstein, Lettres, p. 125.
13 Quoted by Vera Stravinsky and Robert Craft in Stravinsky in Pictures and Documents, New York, 1978, p. 73.
14 Comoedia, 18 June 1914.
15 Open letter of 7 June 1914 published in the London newspapers (e.g. The Times, Morning Post, Daily Mail).
16 Letter of early June 1914 from Ravel to the director of Comoedia, Gaston de Pawlowski. See Ravel, L’Intégrale: Correspondance (1895–1937), écrits et entretiens, ed. under the direction of Manuel Cornejo, Paris, 2018, p. 1371.
17 Robert Brussel, in Le Figaro, 9 June 1912.
18 Arthur Pougin, in Le Ménestrel, 15 June 1912.
19 Henri Ghéon, in La Nouvelle Revue française, August 1913.
20 Christian Goubault, Maurice Ravel. Le Jardin féerique, Paris, 2004 [= Goubault, Ravel], p. 79.
21 Jean Marnold, in Mercure de France, 16 August 1917 [= Marnold, Mercure].
22 Danielle CohenLévinas, in Musical No. 4, June 1987 [= CohenLévinas, Musical].
23 RolandManuel, Esquisse autobiographique, p. 22.
24 Goubault, Ravel, p. 115.
25 RolandManuel, A la gloire de…Ravel, Paris, 1938, p. 76.
26 Hélène JourdanMorhange, Ravel et nous. L’homme – l’ami – le musicien, Geneva, 1945, p. 115. Jourdan-Morhange quotes Charles Koechlin without naming him.
27 CohenLévinas, Musical
28 André Suarès, Ravel, Esquisse, in: La Revue musicale, December 1938, p. 50.
29 Jules van Ackere, Maurice Ravel, Brussels, 1957, p. 192.
30 Ibid., p. 194.
31 Marnold, Mercure
32 Vincent d’Indy, À propos de Daphnis et Chloé, in: S.I.M., 1 May 1914, quoted in Goubault, Ravel, p. 124.
33 Letter of 29 June 1914 from Ravel to Henry Woollett, in CMR No. 15 (2012), pp. 53–57. Born in The Hague to English parents, the composer and musicologist Henry Woollett (1864–1936) was a friend of Georges JeanAubry, professor and later director of the Société Philharmonique SainteCécile and of the Schola Cantorum in The Hague. A student of Raoul Pugno (piano) and Jules Massenet (composition), he was the teacher of André Caplet, Arthur Honegger, and Raymond Loucheur.
34 The reader interested in pursuing this subject may consult the wellsupported article by JeanDavid JumeauLafond, Le Choeur sans paroles ou les voix du sublime, in: Revue de musicologie, Vol. 83 (1997), No. 2, pp. 263–279.
35 Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, new Edition, Paris, 2000, p. 51.
encore fini avec les épreuves de Daphnis – j’y trouve des choses qui feraient dresser les cheveux d’Astruc sur sa tête. »13 En avril 1914, le ballet sera à l’affiche de l’Opéra de Monte-Carlo, privé des chœurs, et sans que Ravel s’en étonne. Diaghilev avait toujours estimé que la partie chorale était « non … inutile, mais nuisible »14 et Ravel avait accepté de fournir « un arrangement de fortune », remplaçant les chœurs, « afin de faciliter les représentations de l’œuvre dans certains centres secondaires ».15 Mais lorsque Diaghilev s’avise de présenter en juin Daphnis et Chloé sans les chœurs au Drury Lane à Londres, le compositeur se fâche –« Sans doute M. Diaghilev considère-t-il Londres comme un de ‹ces centres de moindre importance› » – et publie dans les journaux londoniens une lettre de protestation.16 Malgré ces désaccords, Ravel acceptera la proposition de Diaghilev en 1918 d’orchestrer le Menuet pompeux de Chabrier et sa propre Alborada del gracioso pour un spectacle des Ballets russes à Londres intitulé « Les Ménines ». Rien n’ira plus entre les deux hommes à partir de La Valse. La seconde suite d’orchestre que le compositeur tire de sa partition en 1913 va largement contribuer à lui assurer sa pérennité. Sous-titrée « Lever du jour – Pantomime – Danse générale », elle reprend le troisième et dernier tableau du ballet mettant en scène Chloé, sauvée par le dieu Pan, et sa réunion avec Daphnis. Le ballet va cependant s’imposer le 20 juin 1921 à l’Opéra de Paris, avec Fokine et son épouse dans les rôles de Daphnis et Chloé, et Philippe Gaubert au pupitre. Plus tard, c’est Claude Bessy qui incarnera le rôle de Chloé dans une nouvelle chorégraphie de George Skibine et les décors et costumes de Marc Chagall. Le succès de cette production sera décisif.
Réception
La création parisienne en 1912 connut un succès mitigé auprès du public et de la presse. Robert Brussel estime que Ravel a réussi « jusqu’ici son œuvre la plus pénétrante, la plus complète, celle dont le sentiment est à la fois le plus exquis et le plus expressif … A la légèreté, à la grâce et à l’imprévu du rythme, à la saveur d’une instrumentation toujours significative, se joignent ici des éléments d’une qualité plus exceptionnelle que nous nommerons ‹sentiment› ou ‹poésie› et dont les vertus ont infiniment plus de prix que les pires joliesses d’écriture ou les plus étonnants paradoxes d’orchestration. »17 Pour Arthur Pougin dans le Ménestrel, il y a « beaucoup de talent dans cette musique, c’est incontestable, beaucoup de volonté, surtout beaucoup d’audace ; mais, il faut l’avouer, bien peu de grâce, bien peu de charme, et surtout bien peu d’inspiration … de l’étrangeté pour l’étrangeté, de la complication pour la complication, et, pour de la musique de danse, pas assez de franchise dans les rythmes. » À la fin de la critique, l’auteur arrive à la conclusion que ce ballet, « sans être un chef d’œuvre, nous a tout de même vengé de l’ennui que nous avait causé L’Aprèsmidi d’un Faune ».18 Appréciation plus favorable de la part d’Henri Ghéon : « Nulle part M. Ravel n’a donné une preuve plus ample, plus variée, plus frappante de son talent. De cette sécheresse qu’on lui reprochait, il ne demeure plus ici la moindre trace : le même élargissement dont le Martyre de Saint Sébastien a montré M. Debussy capable, la même grande vague mélodique porte la symphonie de Daphnis et Chloé ; M. Ravel n’y renonce à aucune de ses subtilités, de ses ingéniosités, de ses pointes, mais il nous les dispense avec une telle générosité, il s’attarde si peu sur elles, quand l’emporte l’ivresse lyrique, que nous voici moins frappés cette fois par le raffinement des moyens que par l’élan de l’inspiration : dans ce sens, le prélude du IIIe Tableau est un des plus beaux morceaux symphoniques qu’ait produits la musique française moderne. »19
La chorégraphie de Fokine ne fait pas non plus l’unanimité. On lui reproche des redites après les Danses du Prince Igor qui restent ce qu’il a créé de plus fort et de plus inattendu.
Forme
« La Grèce de Daphnis et Chloé n’est pas celle de Longus, mais plutôt celle que transmettent à Ravel le filtre et l’interprétation de la peinture française du XVIIIe siècle. »20 C’est dire, en passant, à quel point sa conception du sujet contraste avec celle du décorateur Léon Bakst. « Daphnis et Chloé constitue en réalité un véritable ‹drame musical› dont la trame sonore offre la cohérence et l’unité d’une vaste symphonie. Toute cette musique se tient et vit par soimême, autonome, au point que la connaissance préalable des leitmotifs permettrait quasiment à un aveugle de comprendre et de suivre l’action scénique … »21 En qualifiant sa partition de symphonie chorégraphique, Ravel refuse en quelque sorte de se faire « l’héritier de Gisèle ». « Daphnis et Chloé n’exprime pas l’idée d’un programme, peinture sonore, dans lequel le ballet vient se greffer comme un ‹plus›. La partition est un programme à elle seule, traduisant des virtualités inhérentes à la matière sonore plutôt que des concepts ... Narration sans texte, peinture acoustique sans représentation, poétique du geste instrumental dans le prolongement du geste corporel … »22 Le tissu narratif se trouve intégré dans la matière sonore. On assiste à l’adéquation parfaite entre la forme et le fonds. Ce qui autorise la musique à revêtir parfois, en rapport avec les événements chorégraphiques, un caractère nettement descriptif. Citons les accords secs et sautillants (avec appogiature) des instruments à vent dans la Danse grotesque de Dorcon (chiffre 41) qui suggèrent les rires bruyants des paysans, ou les glissandi de harpe dans la Danse suppliante de Chloé (chiffre 135 et 139) qui illustrent à deux reprises le moment où elle essaie de fuir. Le geste de Lyceion qui laisse tomber un de ses voiles, à la manière d’une Salomé hellénique, est « visible » à l’orchestre (mes. 382, 396). Et la Danse suppliante de Chloé ne le serait pas sans l’esthétique du rythme ravélien qui cède toutes les deux mesures (chiffre 133), un procédé qui en fait le corollaire de la donnée chorégraphique. Cette mise en adéquation du mouvement du corps se retrouve au chiffre 176 lorsque Chloé « figure, par sa danse, les accents de la flûte ».
Langage harmonique
Dans son Esquisse Autobiographique, Ravel affirme que « l’œuvre est construite symphoniquement selon un plan tonal très rigoureux, au moyen d’un petit nombre de motifs dont les développements assurent l’homogénéité de l’ouvrage ».23 Les deux motifs principaux apparaissent dès le début : celui des nymphes à la septième mesure en forme d’arabesque, avec sa ligne descendante typiquement ravélienne, et celui de Daphnis et Chloé à la 12e mesure, exposé au cor et construit autour de deux quintes, dont Christian Goubault a très bien démontré la valeur symbolique : la seconde partie (quinte montante sol–ré) est le miroir de la première (quinte descendante sol–do), « exprimant ainsi l’identité et la réciprocité de l’amour entre les deux êtres ».24 On est d’emblée frappé par la mise en scène du son dans l’introduction qui énonce lentement six quintes justes ascendantes à la harpe et aux cordes en sourdines, sur un trémolo de timbales dans une nuance volontairement imperceptible de pianissimo, et qui débouche sur un balancement de trois quartes confié aux chœurs. Cela s’appelle « doser les impondérables de la substance sonore » comme le souligne RolandManuel.25 Cette technique qui consiste à l’étagement de quartes et de quintes forme d’ailleurs l’un des aspects les plus importants du langage harmonique ravélien. D’autres motifs surgissent au cours de l’œuvre comme ce cri de guerre (mes. 435) à l’irruption du groupe des brigands qui sera exploité dans la Danse guerrière. Ou le motif énoncé par la clarinette et les altos (chiffre 196) qui semble venir tout droit du deuxième mouvement de la Schéhérazade
naissance s’adresse également à Charles Dutoit, conseiller discret, mais toujours attentif, ainsi qu’aux Editions Breitkopf & Härtel et leur collaboratrice Alexandra Krämer, qui ont accompagné notre travail avec un soin tout particulier.
Epalinges, Printemps 2021
JeanFrançois Monnard
Annotations sur la réduction pour chant et piano
La présente édition conserve en grande partie la transcription originale pour piano de Ravel, mais la complète en reprenant les indications de tempo et de mouvements métronomiques ainsi que le texte du livret de la partition PB 5650. Concernant les indications dynamiques, certaines différences entre la réduction et la partition sont dues au fait que ces dernières ne se laissent pas aisément transposer de l’orchestre au piano et vice versa. Ravel a effectué plusieurs retouches qui visent à rendre audible la structure musicale, à obtenir une plus grande transparence et une gradation dynamique plus différenciée. Elles ont été reprises telles quelles. Par souci de lisibilité, les parenthèses d’origine ont été supprimées. La notation a été prudemment modernisée, notamment en ce qui concerne les liaisons d’expression et les notes enharmoniques dans le cas de double dièses. Le chœur vocalise toujours sur « a ». Mais pour simplifier, il n’en est fait mention que sur les premières pages.
Certaines différences entre la première édition de la réduction pour piano de 1910 et la version orchestrale ont été corrigées ou adaptées dans l’édition de 1948. Les différences les plus importantes par rapport à la version orchestrale sont notées dans le « Kritischer Bericht » [le rapport critique] de la partition PB 5650. Ici, il convient de noter que les mesures 1 et 438 manquent dans la version pour piano. Cellesci ont été ajoutées par l’éditeur. La présente réduction pour piano peut également être utilisée pour la répétition des deux suites (no. 1 mes. 448–857, no. 2 mes. 1037–fin). La numérotation des mesures des suites est indiquée entre parenthèses.
Wiesbaden, Printemps 2022
Breitkopf & Härtel
1 RolandManuel, Une Esquisse autobiographique de Maurice Ravel, dans : La Revue musicale, décembre 1938 [= RolandManuel, Esquisse autobiographique], pp. 17–23.
2 Serge Lifar, Maurice Ravel et le ballet, dans : La Revue musicale, décembre 1938, p. 75.
3 Lettre de Ravel à Marguerite de SaintMarceaux du 27 juin 1909, voir Arbie Orenstein, Maurice Ravel. Lettres, Ecrits, Entretiens, Paris 1989 [= Orenstein, Lettres], p. 105.
4 Lettre de Ravel à Cipa Godebski du 10 avril 1910, voir René Chalupt, Ravel au miroir de ses lettres, Paris 1956 [= Chalupt, Lettres], p. 83.
5 Lettre de Ravel à Mme Godebska du 10 mai 1910, Chalupt, Lettres, p. 88.
6 Lettre de Ravel à Michel D. Calvocoressi du 3 mai 1910, Orenstein, Lettres, pp. 111 s.
7 Cité par Marcel Marnat dans : Cahiers Maurice Ravel, Fondation Maurice Ravel [= CMR], no 5 (1990–1992), p. 36.
8 Marcel Marnat, Ravel et Stravinsky, dans : CMR, no 5 (1990–1992), p. 44.
9 Jacques Durand, Quelques souvenirs d’un éditeur de musique, 2e série : 1910–1924, Paris 1925, p. 16.
10 Marguerite de SaintMarceaux, Journal 1894–1927, édité sous la direction de Myriam Chimènes, Paris 2007, p. 707.
11 Lettre de Ravel à Ralph Vaughan Williams du 5 août 1912, Orenstein, Lettres, p. 124.
12 Lettre de Ravel à Jacques Rouché du 7 octobre 1912, Orenstein, Lettres, p. 125.
13 Cité par Vera Stravinsky et Robert Craft, dans : Stravinsky in Pictures and Documents, New York 1978, p. 73.
14 Comoedia, 18 juin 1914.
15 Lettre ouverte, publiée dans les journaux londoniens (par exemple The Times, Morning Post, Daily Mail), 7 juin 1914.
16 Lettre de Ravel au directeur de Comoedia, Gaston de Pawlowski, début juin 1914, voir Maurice Ravel, L’intégrale : Correspondance (1895–1937), écrits et entretiens, édité sous la direction de Manuel Cornejo, Paris 2018, p. 1371.
17 Robert Brussel, dans : Le Figaro, 9 juin 1912.
18 Arthur Pougin, dans : Le Ménestrel, 15 juin 1912.
19 Henri Ghéon, dans : La Nouvelle Revue française, août 1913.
20 Christian Goubault, Maurice Ravel. Le jardin féerique, Paris 2004 [= Goubault, Ravel], p. 79.
21 Jean Marnold, dans : Mercure de France, 16 août 1917 [= Marnold, Mercure].
22 Danielle Cohen-Lévinas, dans : Musical n° 4, juin 1987 [= CohenLévinas, Musical].
23 RolandManuel, Esquisse autobiographique, p. 22.
24 Goubault, Ravel, p. 115.
25 RolandManuel, A la gloire de…Ravel, Paris 1938, p. 76.
26 Hélène JourdanMorhange, Ravel et nous. L’homme – l’ami – le musicien, Genève 1945, p. 115. Jourdan-Morhange emprunte une citation de Charles Koechlin sans le nommer.
27 CohenLévinas, Musical
28 André Suarès, Ravel, Esquisse, dans : La Revue musicale, décembre 1938, p. 50.
29 Jules van Ackere, Maurice Ravel, Bruxelles 1957, p. 192.
30 Ibid., p. 194.
31 Marnold, Mercure
32 Vincent d’Indy, À propos de Daphnis et Chloé, dans: S.I.M. 1er mai 1914, cité dans : Goubault, Ravel, p. 124.
33 Lettre de Ravel à Henry Woollett du 29 juin 1914, dans : CMR no 15 (2012), pp. 53–57. D’origine anglaise, Henry Woollett (1864–1936), compositeur et musicographe, ami de Georges JeanAubry, fut professeur puis Directeur de la Société Philharmonique SainteCécile et de la Schola Cantorum du Havre. Elève de Raoul Pugno (piano) et de Jules Massenet (composition), il forma André Caplet, Arthur Honegger et Raymond Loucheur.
34 Le lecteur intéressé consultera à ce sujet l’article très étayé de JeanDavid JumeauLafond, Le chœur sans paroles ou les voix du sublime, dans : Revue de musicologie, tome 83, 1997, n° 2, pp. 263–279.
35 Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, nouvelle édition, Paris 2000, p. 51.
Animez progressivement jusqu au très modéré ,
portant des corbeilles de présents destinés
Entrent des jeunes gens et des jeunes filles, aux Nymphes.