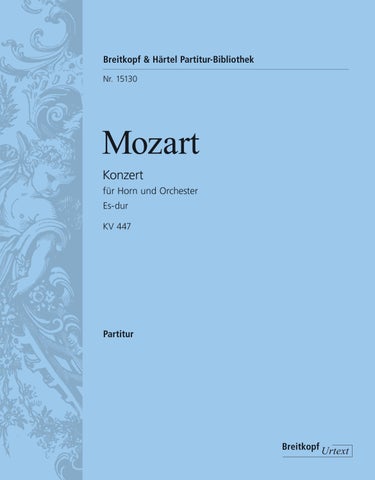WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756–1791)
Konzert
für Horn und Orchester
Es-dur
Concerto for Horn and Orchestra in E flat major
KV 447
herausgegeben von/edited by Henrik Wiese
BREITKOPF & HÄRTEL
Partitur-Bibliothek 15130
G. Henle Verlag
OrchesterbesetzungOrchestral Scoring
2 Klarinetten2 Clarinets
2 Fagotte2 Bassoons
StreicherStrings
AufführungsdauerPerforming Time
etwa 15 Minutenapprox. 15 minutes
Orchesterstimmen/Orchestral parts: Breitkopf & HärtelOB15130
Ausgabe für Horn und Klavier von Henrik Wiese und Jan Philip Schulze mit Kadenzen und Eingängen von Robert D. Levin Edition for horn and piano by Henrik Wiese and Jan Philip Schulze with cadenzas and lead-ins by Robert D. Levin
Breitkopf & HärtelEB10703 oder/or G. Henle Verlag HN 703
Studienpartitur/Study score: Breitkopf & Härtel PB 15142
Eine Gemeinschaftsproduktion von Breitkopf & Härtel, Wiesbaden und G. Henle Verlag, München
A Coproduction of Breitkopf & Härtel, Wiesbaden and G. Henle Verlag, Munich
Printed in Germany
Vorwort
Das Hornkonzert in Es-dur KV 447 entstand nach Untersuchungen von Alan Tyson (Papier) und Wolfgang Plath (Handschrift) vermutlich im Don Giovanni-Jahr 1787 und nicht, wie lange angenommen, um 1783. Es bleibt auch in der neuen Chronologie das dritte vollendete Hornkonzert, das Mozart schrieb. Warum Mozart vergaß, dieses Konzert in sein eigenhändiges Werkverzeichnüß einzutragen, ist ungeklärt. Wenn er es nicht schlicht und einfach vergessen hatte aufzulisten, mag es vielleicht daran liegen, dass er es als Freundschaftsdienst für den Hornisten Joseph Leutgeb (1732–1811) schrieb und dem Werk vielleicht keine große Bedeutung beimaß. Mozart trieb mit dem befreundeten Leutgeb gern seine Späße. Vergleichsweise moderat finden sich Andeutungen davon im letzten Satz dieses Konzerts, wo er ihn zweimal namentlich in der Partitur erwähnt: Hier steht „Leitgeb“ statt „Solo“. Auch die Tuttistellen des Solohorns im ersten Satz könnte man dazurechnen. Sie sind musikalisch gesehen eher überflüssig und wohl zum Einblasen gedacht. Die vier Hornkonzerte dokumentieren das altersbedingte technische Nachlassen Leutgebs auf seinem Instrument. Während die ersten beiden Konzerte (KV 417 und KV 495) noch einen Tonumfang bis zum notierten c3 nutzen, beschränkt Mozart den Tonvorrat im dritten Konzert auf gut zwei Oktaven von g bis a2 In seinem letzten Hornkonzert (KV 412) ist der Tonumfang sogar auf die None g1 bis a2 reduziert. Der heutige Interpret tut gut daran, in seinen Kadenzen den von Mozart vorgegebenen Tonumfang nicht zu überschreiten. Vorbildlich sind hier die Kadenzvorschläge von Robert D. Levin, die in der zur vorliegenden Partitur gehörenden Ausgabe für Horn und Klavier (HN 703 bzw. EB 10703) abgedruckt sind. Interessanterweise ist die Romance auch in einer anderen Fassung für Horn und Streicher unter dem Namen Michael Haydns überliefert und 1802 im Druck erschienen.1 Während die Begleitstimmen mit dem Original nichts gemeinsam haben, zitiert die Hornstimme das Romancenthema, entfernt sich aber allmählich von Mozarts Fassung. Karsten Nottelmann hat jüngst die Vermutung geäußert, dass Leutgeb eigene Werke von anderen Komponisten instrumentieren, ergänzen und korrigieren ließ. Auf diese Weise ließen sich nicht nur die beiden Fassungen der Romance, sondern auch die zwei Fassungen des Rondos KV 412 und 514 – als Mozart’sches Fragment und als Komposition Franz Xaver Süßmayrs – erklären.2
Die Quellenlage dieses Konzerts ist als optimal zu beurteilen. Das im Allgemeinen gut leserliche Autograph, bestehend aus 11 Blättern mit 22 beschriebenen Seiten im Querformat, ist vollständig erhalten und liegt in der British Library in London (Signatur Zweig MS. 55). Mozarts Foliierung beginnt ab der Romance neu, was die Vermutung nahe legt, er habe zunächst den Mittel- und den Schlusssatz und erst später den ersten Satz komponiert. Bemerkenswert ist dabei, dass Mozart im ersten Satz ursprünglich zwei Hörner in Es statt der Fagotte vorsah. Die vorliegende Partitur basiert ebenso wie die erwähnte Ausgabe für Horn und Klavier auf dem Autograph als alleiniger Quelle. Auf die oft nicht eindeutig mögliche Unterscheidung der dort in einem Kontinuum zwischen (Staccato-)Punkten und -Strichen notierten Zeichen wurde verzichtet, stattdessen werden einheitlich Striche gesetzt.3 Da Mozart Hornstimmen ungeachtet der Verwendung des Horns als Solo- oder Tutti-Instrument in der Regel fast unbezeichnet lässt, beschränkt sich die Ausgabe auf wenige, behutsame Ergänzungen des Herausgebers in der Hornstimme an Parallelstellen in gleicher Tonart. Editorische Ergänzungen sind durch Klammerung, bei Bögen durch Strichelung gekennzeichnet.
Der British Library London sei an dieser Stelle für die Bereitstellung der Quelle im Original und als Mikrofilm ganz herzlich gedankt. Mein Dank gilt aber auch Ernst-Günter Heinemann, Christian Rudolf Riedel und Ab Koster, die mir bei der Herausgabe zur Seite standen.
München, Herbst 2013Henrik Wiese
1MH 806, siehe Charles H. Sherman/T. Donley Thomas, Johann MichaelHaydn (1737–1806), a chronological thematic catalogue of his works, Stuyvesant NY 1993.
2Karsten Nottelmann, Die Solo gab Leitgeb dazu Neues zu Mozarts Hornkonzerten, in: Acta Mozartiana. Bd. 59 (2012), Nr. 2, S. 123–136.
3Vgl. dazu: Clive Brown, Dots and Strokes in Late 18th- and 19thCentury Music, in: Early Music. Bd. 21 (1993), Nr. 4, S. 593–610 und Robert Riggs, Mozart’s Notation of Staccato Articulation: A New Appraisal, in: The Journal of Musicology. Bd. 15 (1997), Nr. 2, S. 230–277. In der 2000 im Henle Verlag München erschienenen 1. Auflage der Ausgabe für Horn und Klavier von HN 703 wurde noch zwischen (Staccato-)Punkten und -Strichen unterschieden.
Preface
Recent studies by Alan Tyson (paper) and Wolfgang Plath (handwriting) reveal that Mozart’s E-major Horn Concerto, K. 447, probably originated in 1787, the year that witnessed the composition of Don Giovanni, and not in 1783 as was long thought to be the case. Even in its new chronology it remains the third of Mozart’s completed horn concertos. It is uncertain why he failed to enter it in his autograph catalogue of works. Assuming that this was not a simple oversight, the reason may be that he wrote the piece as a gesture of friendship for the horn player Joseph Leutgeb (1732–1811) and perhaps did not consider it especially significant. Mozart was fond of pulling pranks on his friend Leutgeb. A relatively harmless instance can be found in the finale, where Leutgeb is twice mentioned by name in the score, with “Leutgeb” appearing instead of “Solo.” The passages in the first movement where the soloist plays along with the tutti may be a similar prank. Musically, they are quite superfluous and were probably intended as warming-up exercises.
The four horn concertos register Leutgeb’s declining command of his instrument as he grew older. While the first two (K. 417 and K. 495) have an ambitus extending to written c3, Mozart restricted the compass of the third to some two octaves, from g to a2. In the final concerto (K. 412) the ambitus is even reduced to a ninth, from g1 to a2. Today’s performers would do well not to go beyond Mozart’s prescribed ambitus when playing their cadenzas. Those suggested by Robert D. Levin in the appendix of the horn part are exemplary in this respect; they can be found in the edition for horn and piano (HN 703 and EB 10703) that belongs to the present score.
Interestingly, the Romance has also come down to us in a different version for horn and strings attributed to Michael Haydn and published in 1802.1 While the accompaniment parts have nothing in common with the original, the horn part quotes the Romance theme only to depart gradually from Mozart’s original.
Karsten Nottelmann recently speculated that Leutgeb had other composers orchestrate, supplement and correct his own works. This would explain not only the two versions of the Romance, but also the two versions of the Rondo K. 412 and 514 – as a Mozart fragment and as a work by Franz Xaver Süssmayr.2
The source tradition of this concerto is virtually ideal. The generally clearly legible autograph score has survived fully intact and
is preserved in the British Library in London (shelf mark Zweig MS. 55). It consists of eleven leaves containing twenty-two written pages in oblong format. Mozart began his foliation afresh at the Romance, which suggests that he initially composed the middle and the final movements and only added the opening movement later. Particularly noteworthy is the fact that Mozart had originally intended to set two horns in E flat instead of the bassoons in the first movement.
The present score, just as the aforementioned edition for horn and piano, is based on the autograph, which is the sole source. We have refrained from making the distinction – often not unequivocal – among the signs notated in a continuum between (staccato) dots and dashes; instead, dashes have been uniformly set.3 Since Mozart generally leaves the horn parts nearly unmarked, regardless whether the horn is used as a solo or tutti instrument, our edition limits itself to a few careful additions made by the editor in the horn part at parallel passages in the same key. Editorial additions are signalized by parentheses, slurs by broken lines.
The editor wishes to extend his warm thanks to the British Library in London for allowing him to consult the source both in the original and in microfilm. I also thank Ernst-Günter Heinemann, Christian Rudolf Riedel and Ab Koster for helping me with the publication of this volume.
Munich, Autumn 2013Henrik Wiese
1MH 806, see Charles H. Sherman/T. Donley Thomas, Johann Michael Haydn (1737–1806), a chronological thematic catalogue of his works, Stuyvesant, NY 1993.
2Karsten Nottelmann, Die Solo gab Leitgeb dazu Neues zu Mozarts Hornkonzerten, in: Acta Mozartiana. vol. 59 (2012), no. 2, pp. 123–136.
3See: Clive Brown, Dots and Strokes in Late 18th- and 19th-Century Music, in: Early Music. vol. 21 (1993), no. 4, pp. 593–610 and Robert Riggs, Mozart’s Notation of Staccato Articulation: A New Appraisal, in: The Journal of Musicology. vol. 15 (1997), no. 2, pp. 230–277. The distinction between (staccato) dots and dashes had been kept in the first printing of the edition for horn and piano of HN 703 published by Henle Verlag in Munich in 2000.
Clarinetto in BII I [Allegro]
Fagotto II I
Corno principale in E
für Horn und Orchester Konzert
Wolfgang Amadeus Mozart KV 447 herausgegeben von Henrik Wiese
II Cl. (B) II I 6 e Contrabbasso
Cor. princ.
)
Vl. II I
e Cb. Va.
Cor. princ. Fg. II I Cl. (B) II I 11
Vc. e Cb.
) and G. Henle Verlag, München
Partitur Bibliothek 15130©2013 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
Vc.
Vc.
Cl.
Vc.
Fg.
Cl.
Leseprobe
Sample page
Vc.
Leseprobe
Sample page
Leseprobe
Sample page
Leseprobe
Sample page
Leseprobe
Sample page
Leseprobe
Sample page
Vc.
Leseprobe
Sample page
Vc.
Leseprobe Sample
This is an excerpt. Not all pages are displayed. Have we sparked your interest? We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com. Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.