E DI t I o N
Edition
B REI tkopf
Br E itkopf
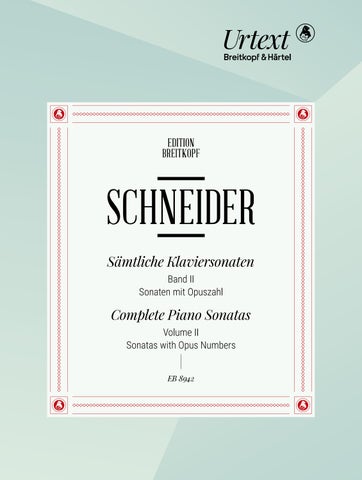
E DI t I o N
Edition
B REI tkopf
Br E itkopf
Band II
Sonaten mit Opuszahl
Complete Piano Sonatas
Volume II
Sonatas with Opus Numbers
EB 8942
1786–1853
Band II
Sonaten mit Opuszahl
Volume II
Sonatas with Opus Numbers
herausgegeben von | edited by Ulrich Urban
Edition Breitkopf 8942
Printed in Germany
Zu Friedrich Schneiders Klaviersonaten
Bei näherer Betrachtung von Friedrich Schneiders umfangreichem Schaffen sollte die Bedeutung der Klaviermusik, zumindest in seinen frühen Jahren, nicht unterschätzt werden Obwohl es zur Entwicklung der Klaviersonate ab etwa 1760, ausgehend von der barocken Suite, zahllose Spezialuntersuchungen gibt, blieben die Beiträge von Friedrich Schneider zu dieser Gattung bisher völlig unbeachtet Schneiders Ruf, ein hervorragender Pianist zu sein, wurde bereits in jungen Jahren begründet und er gehörte bald zu den angesehensten Klaviervirtuosen seiner Zeit Es verwundert daher ein wenig, dass musikwissenschaftliche Arbeiten den Namen Friedrich Schneider zwar immer wieder im Zusammenhang mit der Uraufführung von Beethovens op 73 (5 Klavierkonzert Es-dur) am 28 November 1811 im Leipziger Gewandhaus zutage fördern, seine Kompositionen für das Klavier hingegen, zumindest bisher, nicht von Interesse waren Schneiders pianistische Fähigkeiten müssen beachtlich gewesen sein, denn bereits kurz nach seiner Ankunft in Leipzig hatte er zahlreiche prestigeträchtige musikalische Positionen der Stadt inne – die des Universitätsmusikdirektors und des Organisten an der Thomaskirche eingeschlossen
Bereits seit seinen ersten Kompositionsversuchen am Zittauer Gymnasium hatte das Tasteninstrument im Vordergrund gestanden Es diente ihm zur Komposition, Improvisation und nicht zuletzt als Dirigierinstrument Das intensive Studium der Klavierwerke der Klassiker (Haydns, Mozarts, Clementis und anderer Größen dieser Zeit) spiegelt sich deutlich in diesen frühen Werken wider Die schier unüberschaubare Zahl von Kompositionsversuchen, die sich in seinem persönlichen Werkverzeichnis finden und von denen kaum etwas erhalten ist, macht deutlich, wie intensiv seine Beschäftigung mit dem Klavier gewesen sein muss Außer etlichen Tänzen, Ländlern, Ecossaisen, Walzern und Variationen war bis dahin jedoch noch kein Werk größeren Umfangs für das Klavier entstanden. In seiner Selbstbiografie erläutert Schneider diesen Umstand so:
„Für das Pianoforte eine Sonate zu schreiben, faßte ich oft an, aber es wollte nie etwas Rechtes werden. Im Jahre 1803 wurde ‚Hermann von Unna‘ mit Musik von Abt Vogler aufgeführt. Die Musik ergriff mich wunderbar, besonders die Ouvertüre. Die Ideen verließen mich nicht und so bildete sich meine erste Klaviersonate in d-moll. Auf einmal ging es leicht. Die Gedanken ordneten sich, der Faden riß nicht, ich war vergnügt. Die beiden anderen Sätze waren auch bald fertig, und ich fand den Mut, nachdem sie mein Bruder und einige andere Mitschüler gesehen hatten, sie Flaschner vorzuspielen.1 Auch dieser war überrascht und teilte seine Freude anderen auch mit. Dies machte mir Lust zu neuen Werken dieser Art, und bald brachte ich Freund Flaschner andere Sonaten; so ging es nun fort.“
Über Gotthelf Benjamin Flaschner gelangten Schneiders erste Klaviersonaten in die Hände des amtierenden Thomaskantors August Eberhard Müller in Leipzig, der seinerseits hervorragende Kontakte zum Verlag Breitkopf & Härtel pflegte und die Sonaten dort zum Druck empfahl Die ersten Rezensionen folgten umge-
1 Gotthelf Benjamin Flaschner (1761–1836) war Theologe, Schriftsteller und Lieddichter
hend und legten den Grundstein für Schneiders späteren Erfolg bei Publikum und Kritikern:
„Es kann schwerlich ein angenehmeres Geschäft für einen Rec. geben, als das ist, welches so eben mir obliegt: die erste, und eine so verzüglich wohlgeratene Arbeit eines jungen Mannes – und mit dieser ihn selbst in der größeren Welt einzuführen.“
Diese Worte aus der Feder von Friedrich Rochlitz, dem Begründer der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, stellten den in der Öffentlichkeit als musikalischen Handwerker bekannten Friedrich Schneider erstmals als Komponisten vor Rochlitz eröffnete mit diesen Worten seine Rezension der 1803 komponierten und im Folgejahr als Opus 1 erschienenen Trois Sonates pour le Pianoforte.2 Das Füllhorn, das Schneider in den folgenden Leipziger Jahren für das Klavier ausschüttete, brachte nicht weniger als 42 Klaviersonaten, 7 Klavierkonzerte, eine schier unüberschaubare Masse an kleineren Klavierstücken und etliche klavierbegleitete Kammermusikwerke hervor, die teils schon viel früher entstanden waren
Die intensive Beschäftigung mit dem Klavier als universellem musikalischem Werkzeug tritt ab ca 1815 schlagartig in den Hintergrund Die Vokalmusik rückte nahezu vollständig in Schneiders kompositorischen Fokus, was mit der kurz zuvor übernommenen Leitung der Seconda’schen Operngesellschaft sowie der des Stadttheaters zusammenhängen mag In dieser Zeit, bis ca 1819, entstanden allerdings wiederum kaum nennenswerte Werke In der Gesamtschau kann man also durchaus feststellen, dass sich Schneiders gesamtes Klavierschaffen auf den kurzen Zeitraum von 1802 bis 1814 beschränkt Während andere Komponisten, allen voran Ludwig van Beethoven, dessen Einfluss auf Schneider (gerade in seinen Klavierwerken) deutlich anklingt, zeitlebens vom Klavier begleitet und beeinflusst wurden, scheint Schneider das Instrument als reines Werkzeug, womöglich sogar als notwendiges Übel betrachtet zu haben Seine musikalische Bestimmung sah er jedoch ohne Zweifel in der Vokalmusik, worin er durch den immensen Erfolg seines 1819 uraufgeführten zweiten Oratoriums Das Weltgericht Bestätigung fand Immerhin 24 seiner Klaviersonaten erschienen im Druck, etliche andere sind als Manuskript überliefert
Im Februar 1829 kündigte der Halberstädter Verleger Carl Brüggemann in der AMZ die Herausgabe von Friedrich Schneiders sämtlichen Werken für das Pianoforte an Er plante, „20 Sonaten sowie 10 Rondos, Variationen und kleinere Sachen“ in 10 Heften bis Ostern 1830 zu veröffentlichen Aus nicht näher bekannten Gründen wurde dieses Unternehmen jedoch nach Erscheinen von Heft 4 eingestellt und später auch nicht erneut aufgegriffen Die in dieser „Gesamtausgabe“ erneut abgedruckten Sonaten (op 1 Nr 1 und 3, op 20 Nr 2 sowie op 40) enthalten teilweise recht umfangreiche Korrekturen und Revisionen
Helmut Lomnitzer3 beschreibt in seiner Dissertation von 1961 die generellen Charakteristika von Friedrich Schneiders Klaviersonaten, wobei er u. a. konstatiert: „[…] die in den Monaten Mai bis Juli
2 Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ) Nr 31, Bl Nr 3
3 Helmut Lomnitzer: „Das musikalische Werk Friedrich Schneiders, insbesondere die Oratorien“ (Marburg 1961)
[1803] entstandene d-moll-Sonate [1. Sonate4] (op. 1 Nr. 1) ist demgegenüber nur dreisätzig [angelegt], wie es bis Mitte 1806 für alle Sonaten ausnahmslos Regel bleibt Einem schnellen Anfangssatz in Sonatenform mit kurzer, lediglich modulierend-transponierender Durchführung folgt meist ein einfaches, liedmäßiges Andante in zwei- oder dreiteiliger Form Ein Presto in Sonaten- oder Rondoform bildet den Abschluss “ Weiterhin bemerkt er, dass sich die Bekanntschaft und das Studium der Sonaten Beethovens ab etwa 1807 in seinen Werken widerspiegelt: „[…] so macht sich beispielsweise die 1807 entstandene 31 Sonate f-moll op 21, ein in allen vier Sätzen breit ausladendes Werk, gegenüber bisherigen Kompositionen ein neues, leidenschaftliches Pathos sowie eine bewusstere Ausnutzung der verschiedensten Klangregister und Lagen zu eigen, kostet verminderte Septakkorde und den Reiz der Dominantnone
4 Die Nummerierung der Sonaten erfolgt chronologisch nach dem Datum ihrer Entstehung, nicht des Erstdrucks (vgl Lomnitzer)
aus, lässt (im ersten Satz) nach einer Fermate auf der Dominante die kurze Prestocoda im abstürzenden Sechzehntellauf erreichen, um dann mit nachschlagenden Akkorden mächtige Schlusswirkungen zu erzielen “
In diesem Zusammenhang sind auch die Sonaten Nr 32 e-moll (op 14 „Grande Sonate Pathétique“) aus dem Jahre 1809 und Nr 35 f-moll (op 27) aus dem Jahre 1810 zu nennen Die 1813 entstandene Sonate Nr 39 f-moll (op 37) ragt besonders wegen ihrer eigentümlichen, zweisätzigen Anlage heraus und verbindet schon im ersten Satz, einem überaus breiten Scherzo, den brillanten Stil von op 26 und op 40 mit dem leidenschaftlichen Pathos der großen Mollsonaten Schneiders Sonatenschaffen fand bereits 1814 mit der Sonate Nr 42 B-dur (op 78, gedruckt 1829) seinen Abschluss
Nick Pfefferkorn
Chronologische Übersicht über Schneiders Klaviersonaten5 Nummer Tonart Jahr (Entstehung) Jahr (Druck) gedruckt als
E-dur 1803 1804 op 1 Nr 3
E-dur 1803 1805 op 3 Nr
1806 1807 op 6
1806
1807 1807 op 8
f-moll 1807 1810 op 21
e-moll 1809 1809 op 14
1809
c-moll 1809 1814 op 30
f-moll 1810 1813 op 27
C-dur 1810 1812 op 26
A-dur 1810
D-dur 1813 1813 op 29
f-moll 1813 1815 op 37
1814 1829 op 78
5 nach Lomnitzer
Diese Urtext-Ausgabe von Friedrich Schneiders Klaviersonaten erscheint als vierbändige Sammelausgabe Die Werke sind chronologisch nach ihrer Entstehung geordnet, wobei die Bände I und II die mit Opuszahlen gedruckten Sonaten für zwei Hände, Band III die mit Opuszahlen gedruckten Sonaten für vier Hände oder zwei Klaviere und Band IV die im Manuskript überlieferten Sonaten enthalten
Wann immer möglich, berücksichtigt diese Ausgabe alle erhaltenen Quellen, wobei wir in der Regel lediglich von Autograph und Erstdruck sprechen Entgegen der sonst als hervorragend zu bezeichnenden Quellenlage bei Schneiders Werken sind von den Klaviersonaten nur in wenigen Fällen authentische handschriftliche Quellen überliefert Bei einer nicht unwesentlichen Anzahl von Werken kann daher nur auf den Erstdruck und ggf auf eine TitelAuflage als Quelle zurückgegriffen werden. Abweichungen der vorliegenden Urtext-Ausgabe vom Text der Hauptquellen sind in den Einzelanmerkungen verzeichnet Plausible Ergänzungen aus den Frühdrucken sind im Notentext nicht gekennzeichnet, werden jedoch ebenfalls in den Einzelanmerkungen mitgeteilt Zusätze des Herausgebers werden im Notentext in eckigen Klammern angezeigt
Spezielle Editionsprobleme
Wo immer es möglich und sinnvoll erschien, versucht der Herausgeber auf die Eigenheiten der Hauptquelle in Bezug auf Nomenklatur, Schreibweise von Dynamik und Tempobezeichnungen sowie von Notengruppen einzugehen und diese möglichst nahe dem Original wiederzugeben Offensichtlich falsche Noten sowie fehlende oder verrutsche Akzidenzien und Schlüssel wurden stillschweigend korrigiert bzw ergänzt In anderen Fällen, in denen Eingriffe lediglich rein kosmetischer Natur waren (altertümliche Schreibweise von cres. statt cresc., for. statt forte u v m ), wurde ebenfalls ohne besondere Kennzeichnungen in die heute gebräuchliche, moderne Form übertragen
Bögen
Wie für diese Zeit üblich, wird in den Quellen selten eine einheitliche bzw musikalisch sinnvolle Bogensetzung erreicht und wahrscheinlich auch nicht angestrebt Moderne Regeln verlangen heute z. B. bei Akkorden nur einen Legatobogen, Haltebögen werden jedoch so viele gesetzt, wie der entsprechende Akkord Töne aufweist Der Herausgeber folgt den modernen Regeln und verzichtet in diesen Fällen auf eine entsprechende Kennzeichnung im Notentext Das Fehlen von Bögen ist in der Klaviermusik dieser Zeit ebenfalls nicht ungewöhnlich, oftmals wird auch nicht zwischen Halte- und Legatobögen unterschieden; vielmehr wird gerne das jeweils Eine oder Andere weggelassen Auch sind Parallelstellen oft unterschiedlich (oder gar nicht) phrasiert Der Herausgeber macht Emendationen durch Strichelung kenntlich Insbesondere Schneiders „Schreibfaulheit“ von wiederkehrenden Bögen ist problematisch Oftmals wird für offensichtlich gleich zu phrasierende Stellen, auch innerhalb ein und desselben Taktes, der Bogen nur einmal geschrieben und gilt dann sinngemäß weiter Um nicht den Anschein von Authentizität zu erwecken, gibt der Herausgeber solche Ergänzungen ebenfalls in Form von Strichelung wieder
Appoggiaturen
Schneider verwendet in seinen Werken Vorschläge in unterschiedlichsten Schreibweisen (H, J, K etc ), wobei auch schon modernere Formen auftauchen Letztere entsprechen auch der heute gebräuchlichen Notation für einen kurzen Vorschlag Es lässt sich eine gewisse Systematik ableiten, dass ein Querstrich durch eine Vorschlagsnote diese um die Hälfte ihres Wertes verkürzt Um jedoch die größtmögliche Authentizität dieser Ausgabe zu erreichen, gibt der Herausgeber Vorschläge generell wie im Original wieder
Akzidenzien
Die Setzung von Akzidenzien wurde ebenfalls der heute gebräuchlichen Form angepasst Fehlende Vorzeichen werden nicht einzeln vermerkt Warnakzidenzien erscheinen nur sehr spärlich und unsystematisch Eine Besonderheit bildet, wie für diese Zeit üblich, die generelle Abwesenheit von Vorzeichen nach Modulationen: Diese gelten sinngemäß entsprechend weiter; gleiches gilt für die Wiederholung von Vorzeichen nach Haltebögen und Taktwechseln Auch hier folgt der Herausgeber den heute üblichen, modernen Regeln Vereinzelt zusätzlich ergänzte Vorzeichen werden in eckigen Klammern wiedergegeben
Artikulation
Insbesondere die Setzung und Fortführung von Staccato-Punkten und -Keilen ist in den Quellen unklar und teilweise problematisch Schneiders Eigenheiten in Bezug darauf sind – auch vor dem Hintergrund handschriftlicher Quellen – wie folgt zu verstehen: Bei längeren Passagen, die mit Staccato-Punkten versehen sein sollen, setzt Schneider die Punkte jeweils nur im ersten Takt und dann wieder zum Ende der entsprechenden Figur oder Passage Die vorliegende Ausgabe ergänzt sinngemäß Oft werden, bei sich wiederholenden Figuren oder Phrasen, in der Quelle die Artikulationen und Bögen nur einmal gesetzt Ein Hauptproblem bildet vor allem die Unterscheidung von Akzent > und decresc - Gabeln Für einige Stellen konnte keine eindeutige und zufriedenstellende Lösung gefunden werden, so dass sich der Herausgeber für eine der beiden Varianten entschieden hat
Dynamik
Grundsätzlich ist in allen handschriftlichen Quellen Schneiders festzustellen, dass nach cresc., dim. und ähnlichen Anweisungen keinerlei Verlängerungsstriche (- - - -) zu finden sind. Es wird auch nicht zwischen der Schreibweise cresc und der Verwendung von Gabeln oder unterschieden Der Herausgeber versucht eine stimmige Unterscheidung herbeizuführen; es ist somit unabdingbar geworden, einige wörtliche Anweisungen wie cresc., decresc., dim. u. ä. in die gebräuchliche Form von Gabeln umzuwandeln. Der Herausgeber folgt im Übrigen (abgesehen von einigen wenigen Ergänzungen) den Vorgaben der Hauptquelle
Eine weitere Besonderheit stellt Schneiders Bedeutung der Vortragsbezeichnung dolce dar Diese fordert nicht nur den entsprechenden Vortrag, sondern auch die Dynamikvorschrift p bzw pp Fast durchgängig fehlt bei der Verwendung von dolce eine entsprechende Dynamik, die in Relation zur Begleitung steht Der Herausgeber ergänzt entsprechend in eckigen Klammern
Bögen bei Ziernoten
Entgegen der musikalischen Aufführungspraxis versieht Friedrich Schneider Ziernoten (kurze Vorschläge, Vorhaltnoten etc ) generell nicht mit Bögen zur Hauptnote, obwohl diese in der Praxis durchgängig vorausgesetzt werden Der Herausgeber folgt der Schreibweise Schneiders und gibt Ziernoten ohne Bogen zur Hauptnote wieder
Fingersätze
Fingersätze im Notentext stammen von Schneider selbst
Dank
Ich danke insbesondere den Verantwortlichen in den zahlreichen Bibliotheken, die mich beim Zusammentragen der relevanten Quellen unterstützt haben und in den meisten Fällen auch unkom-
plizierte Reproduktionen ermöglichten Besonders danken möchte ich den Leipziger Städtischen Bibliotheken, hier namentlich Frau Brigitte Geyer, Leiterin der Musikbibliothek / Sondersammlungen, der Anhaltischen Landesbücherei Dessau, Frau Martine Kreißler, Wissenschaftliche Bibliothek und Sondersammlungen, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliothek der Musikhochschule Köln Ebenfalls gilt mein Dank dem niederländischen Musikwissenschaftler Dr Frank Lioni, der über Jahrzehnte hinweg nahezu alle Klaviersonaten Friedrich Schneiders zusammengetragen und ausgewertet hat Er konnte aus mancher Klemme bei der mitunter komplizierten Quellenbeschaffung für die SonatenEdition aushelfen!
On Friedrich Schneider’s Piano Sonatas
In more closely examining Friedrich Schneider’s extensive work, the importance of piano music, at least in his early years, should not be underestimated Although there are countless special investigations into the development of the piano sonata from around 1760, starting with the Baroque suite, Schneider’s contributions to this genre have so far gone completely unnoticed His reputation as an outstanding pianist was established at a young age, and he soon became one of the most distinguished piano virtuosos of his time It is therefore somewhat surprising that in musicological studies the name Friedrich Schneider repeatedly emerges, in fact, in conjunction with the premiere of Beethoven’s op 73 (5th piano concerto in E flat major) on 28 November 1811 in the Leipzig Gewandhaus, while his own piano compositions are at least so far not of interest Schneider’s pianistic abilities must have been substantial, for shortly after his arrival in Leipzig, he held numerous prestigious musical positions within the city – including that of university music director and organist at the St Thomas Church
Ever since his first compositional efforts at the Zittau grammar school, the keyboard instrument had been paramount It served him for composition, improvisation, and not least, as an instrument from which to conduct The intensive study of classical piano works (Haydn, Mozart, Clementi, and other greats of this period) is clearly reflected in these early works. The virtually inestimable number of compositional attempts to be found in his personal works’ catalogue, of which hardly anything is extant, makes clear how intensively he must have been involved with the piano Aside from a number of dances, ländler, ecossaises, waltzes, and variations, though, no larger works had yet been composed for the piano In his autobiography, Schneider explains this circumstance as follows:
“I often tackled writing a sonata for the pianoforte, but it was never any good. Performed in 1803 was ‘Hermann von Unna’ with music by Abbé Vogler. The music moved me wonderfully, especially
the overture. The ideas did not leave me and thus arose my first piano sonata, in d minor. All at once it was easy. I organized my ideas, my train of thought did not snap, I was pleased. The other two movements were soon finished, and I found the courage, after showing them to my brother and other classmates, to play them to Flaschner.1 He too was surprised and shared his pleasure with others. This made me want to do new works of this kind, and I soon brought my friend Flaschner other sonatas; so it went on.”
Through Gotthelf Benjamin Flaschner, Schneider’s first piano sonatas ended up in the hands of August Eberhard Müller, incumbent St Thomas’s cantor in Leipzig, who in turn maintained excellent contacts with the Breitkopf & Härtel publishing house and recommended the sonatas there for printing. The first reviews promptly followed and laid the foundation for Schneider’s later success with audiences and critics:
“There can hardly be a more agreeable business for a reviewer than that which is my duty here: the first work, and such a superbly accomplished work by a young man – and to launch him with this in the larger world ”
These words penned by Friedrich Rochlitz, the founder of the Allgemeine Musikalische Zeitung, first introduced as composer Friedrich Schneider who had been known to the public as a musical craftsman With this, Rochlitz opened his review of Schneider’s opus 1, composed in 1803 and published the following year as the first of Trois Sonates pour le Pianoforte 2 The cornucopia for piano that Schneider poured out in the following Leipzig years yielded no less than 42 piano sonatas, 7 piano concertos, an overwhelmingly large volume of smaller piano pieces, and quite a few pieces of chamber music with piano, composed in part already much earlier
1 Gotthelf Benjamin Flaschner (1761–1836) was a theologist, composer, and song writer
2 Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ) no 31, Bl no 3
His intensive engagement with the piano as a universal musical tool abruptly receded into the background from ca 1815 Vocal music moved almost completely into the forefront of Schneider’s compositional focus, related perhaps to his having recently become director of the Seconda opera society, together with the city theater Composed in this period, though, up to ca 1819, were hardly any noteworthy works In the overall picture, it is therefore quite easy to conclude that Schneider’s entire range of piano works is limited to the short period from 1802 to 1814 Whereas other composers, notably Ludwig van Beethoven, whose influence on Schneider (especially in his piano works) is blatantly self-evident, were attended and influenced lifelong by the piano, the instrument seems in Schneider’s case to have been considered a mere tool, if not a necessary evil His musical destiny, however, he no doubt viewed as being in vocal music, confirmed even more by the immense success of his second oratorio Das Weltgericht, premiered in 1819 Still and all, 24 of his piano sonatas appeared in print, a number of others are extant in manuscript
In February 1829, the Halberstadt publisher Carl Brüggemann announced in the AMZ publication of Friedrich Schneider’s complete works for piano, planning to publish in 10 volumes, “20 sonatas, together with 10 rondos, variations and smaller things,” by Easter 1830 For unknown reasons this enterprise was, however, discontinued after 4 volumes appeared and no longer later taken up again The sonatas reprinted in this “Complete Edition” (op 1, nos 1 and 3, op 20, no 2, as well as op 40) contain some quite extensive corrections and revisions
Helmut Lomnitzer3 describes in his 1961 dissertation the general characteristics of Friedrich Schneider’s piano sonatas, stating,
3 Helmut Lomnitzer: “Das musikalische Werk Friedrich Schneiders, insbesondere die Oratorien“ (Marburg, 1961)
among other things, about the 1st sonata4: “[…] the d-minor sonata (op.1, no. 1), composed in the months from May to July [1803] has, by contrast, only three movements, as remains the case for all sonatas without exception composed up to mid-1806 A fast opening movement in sonata form with a brief, simply modulating transposed development, is usually followed by a simple, lied-like Andante in a two or three-part form A Presto in sonata or rondo form constitutes the close ” He also notes that the acquaintance and study of the Beethoven sonatas from about 1807 is reflected in Schneider’s works: “[…] for example, unlike previous compositions, the 31st sonata in f minor op 21, composed in 1807, a work broadly laid out in all four movements, appropriates as its own a new passionate pathos as well as a more conscious exploitation of the most varied sound registers and layers, savoring diminished-seventh chords and the charm of dominant ninths, can (in the first movement) after the fermata on the dominant, arrive in the falling sixteenth run at the brief Presto coda, in order then to attain powerful effects with off-the-beat chords ”
Also to be mentioned are the sonatas no 32 in e minor (op 14 “Grande Sonate Pathétique” of 1809, and no 35 in f minor (op 27) of 1810 The sonata no 39 in f minor (op 37) composed in 1813, stands out especially because of its peculiar, two-movement structure, and in the first movement already combines an extremely broad scherzo in the brilliant style of opp 26 and 40 with the passionate pathos of the great sonatas set in the minor Schneider’s sonatas came to an end as early as 1814 with sonata no. 42 in B flat major (op 78, printed in 1829)
Nick Pfefferkorn
4 The numbering of the sonatas is in chronological order according to the date of their genesis, not the date of the first print (cf. Lomnitzer).
This Urtext edition of Friedrich Schneider’s piano sonatas appears as a four-volume collected edition The works are in chronological order according to genesis, with volumes I and II containing the sonatas for two hands with opus number; volume III containing the sonatas for four hands or two pianos with opus number; and volume IV containing the sonatas extant in manuscript
Whenever possible, this edition will take into account all extant sources, usually including only the autograph and first print. Contrary to the otherwise excellent source situation for Schneider’s works, only a handful of authentic piano manuscript sources are extant. Relied on as sources in a not insignificant number of works can therefore be only the first print and possibly a title issue of it. Differences in the present Urtext edition from the text of the main sources are listed in the individual annotations Plausible emendations from the early prints are not identified in the music text, but are likewise disclosed in the individual annotations Editorial addenda in the music are given in brackets
Whenever possible and meaningful, the editor seeks to address the idiosyncrasies of the main source in terms of nomenclature, notation, of dynamics and tempo markings, as well as of note groups, and to reproduce these as closely as possible to the original Obvious wrong notes as well as lacking or misplaced accidentals and keys are tacitly corrected or supplemented In other cases where interventions were merely cosmetic (earlier notation of cres instead of cresc , for instead of forte, and many others), these were also tacitly transmitted in the modern form used today
As customary for this period, attained in the sources is seldom a unified and musically meaningful slur placement and was probably not even sought Modern rules require today, e g , only one legato slur for chords, but there are as many ties as relevant chordal tones The editor follows the modern rules and in these cases dispenses with identifying these in the music text The lack of slurs in piano music at this time is likewise not unusual, and there is often no distinction between ties and legato slurs; rather, the one or the other is often readily omitted Parallel pas-
sages are also often phrased differently (or not at all) The editor marks emendations by broken lines Especially problematic is Schneider’s “laziness in writing” recurring slurs Often, for passages obviously to be phrased the same way even within one and the same measure, slurs are written only once and further apply analogously In order not to give the impression that editorial emendations are authentically original, such emendations are presented within broken lines
In his works, Schneider notates appoggiaturas most diversely (H, J, K etc ), even though already showing modern forms corresponding to today’s common notation for a short appoggiatura A certain systematic methodology can be deduced in that a slash through a grace note shortens this by half its value In order to maximize the authenticity of this edition, however, the editor generally reproduces appoggiaturas as in the original
The placement of accidentals was also adapted to today’s customary form Lacking accidentals are not individually noted Cautionary accidentals appear only very sparingly and unsystematically Characteristically, as usual for this period, is the general absence of accidentals after modulations: This applies analogously for the repetition of accidentals after ties and change of measure Here also the editor follows today’s normal modern rules Occasional accidentals added later are shown in square brackets
The placement and continuation of staccato dots and wedges is unclear in the sources and sometimes problematic Schneider’s idiosyncrasies relative to this are to be understood as follows –even given the fact of manuscript sources: To show staccato dots in longer passages, Schneider places the dots only in the first measure and then again at the end of the corresponding figure or passage The present edition supplements analogously Often, with repetitive figures or phrases, the articulation and slurs are placed in the source only once When distinguishing between accent and
decresc hairpins is especially problematic, and no unambiguous and satisfactory solution could be found for some passages, the editor opted for one variant
Ascertained, basically, in all of Schneider’s manuscript sources is that there aren’t any kinds of prolongation markings (- - - -) after the terms cresc , dim or similar directives Instead, there is no distinction between the notation of cresc and the use of hairpins The editor tries to arrive at a coherent distinction by using several literal instructions such as cresc , decresc , dim and translating these into the usual form of such hairpins, incidentally following (apart from a few additions), the stipulations of the main source
Another special feature is Schneider’s meaning of the performance indication dolce This requires not only the appropriate performance, but also the dynamic marking p or pp Almost throughout, Schneider’s use of dolce lacks appropriate dynamics relative to the accompanying term The editor supplements accordingly in square brackets
Contrary to musical performance practice, Friedrich Schneider does not generally slur ornaments (short appoggiaturas, suspen-
sions, etc ) to the main note, although this is generally assumed in practice The editor follows Schneider’s notation and reproduces ornaments without slurs to the main note
Fingerings in the music text come from Schneider himself
My special thanks go to those responsible in the numerous libraries who have assisted me in collecting the relevant sources and in most cases also facilitated uncomplicated reproductions In particular, I would like to thank the Leipzig Städtische Bibliotheken, here, especially, Ms Brigitte Geyer, director of the music library / special collections; the Anhaltische Landesbücherei Dessau, Ms Martine Kreissler, scholarly library and special collections; as well as the colleagues of the library of the Musikhochschule Cologne Likewise, my thanks go to the Dutch musicologist, Dr Frank Lioni, who over decades compiled and evaluated almost all of Friedrich Schneider’s piano sonatas He was able to help us out of many a bind in the at times complicated acquisition of sources for the sonata edition!

*)EmpfehlungdesHerausgebers:/ Suggestion of th







This is an excerpt. Not all pages are displayed. Have we sparked your interest? We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com. Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.