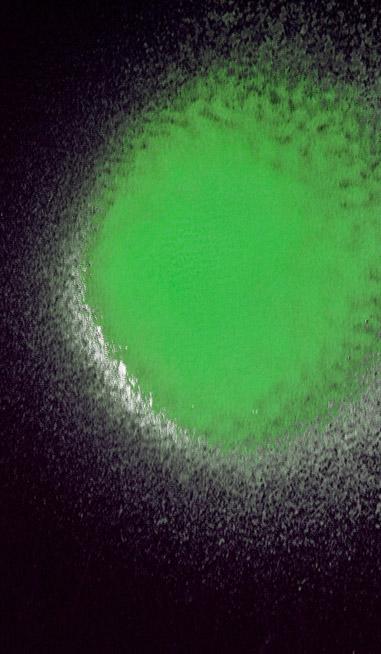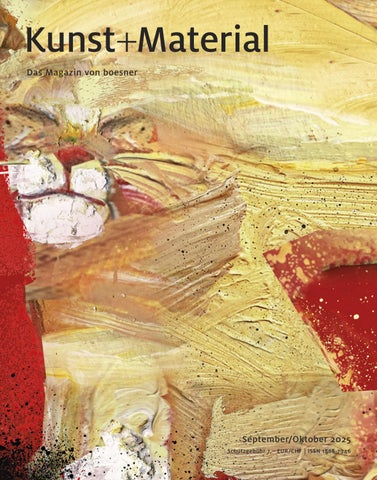Kunst+Material
Das Magazin von boesner


Idee, Malerei, Gestaltung, Fotogra
Ina Riepe
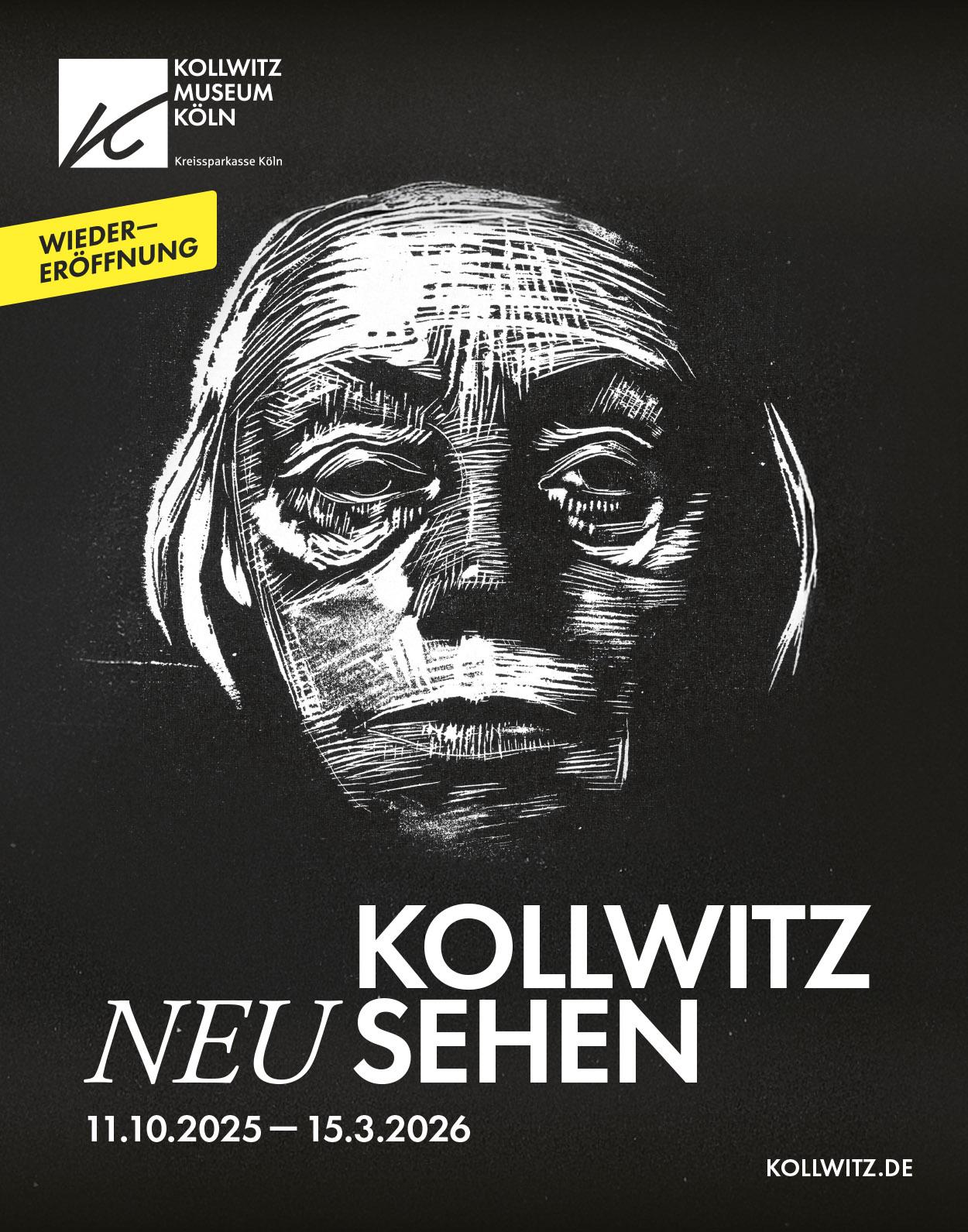
Ein Hoch auf die Fantasie!

Liebe Leserin, lieber Leser, „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“, sagte Albert Einstein, der als einer der bedeutendsten Physiker der Wissenschaftsgeschichte gilt. Die Fähigkeit, Gedanken, Ideen und Impulse zu neuen Vorstellungen zu verknüpfen und sich diese en détail auszumalen, ist eine besondere Gabe, die keinerlei Grenzen kennt.
Ihre Wirkungen werden vor allem in der Kunst spürbar. So speist sich die Imaginationskraft von Ulrike Möltgen aus erzählten Geschichten, die unter ihren Händen neues Leben entwickeln. Die Illustratorin hat während ihres künstlerischen Werdegangs unterschiedliche Wege beschritten, von denen bisher rund 60 Bücher zeugen. Ulrike Möltgen collagiert, zeichnet und malt, arbeitet mit Tuschen, Stiften, Papieren und Stoffen, damit die Erzählungen für Kinder und Erwachsene von eindrucksvollen Illustrationen begleitet werden. Dabei möchte sie sich selbst stets aufs Neue überraschen und herausfordern, damit ihre Arbeit spannend bleibt – Susanna Partsch hat die Wuppertaler Künstlerin für diese Ausgabe porträtiert.
In Tivoli nahe Rom gibt es viel zu sehen und noch mehr zu erforschen: Wer die Villa des Kaisers Hadrian besucht, ist erstaunt über die beredte Sprache der Ruinen. Dabei muss vieles erst in Gedanken vervollständigt werden, denn die in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus erbaute Palaststadt ist zwar archäologisch untersucht, aber bei Weitem nicht ganz erschlossen. Und trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb? – sind die von der Villa Adriana ausgehenden Impulse bis heute ungeheuer wirkmächtig. Seit die Anlage im 15. Jahrhundert wiederentdeckt wurde, hat sie Künstler, Architekten und Schriftsteller inspiriert. Der Spaziergang, zu dem Dieter Begemann in seinem Sonderthema einlädt, lässt vor dem inneren Auge ein atemberaubendes Gesamtkunstwerk aus Landschaftsgestaltung, Architektur und Kunstwerken entstehen (und mancher mag sich dabei lebhaft vorstellen, wie eine kaiserliche Festgesellschaft im Freien zu speisen pflegte).
Dass ein Ganzes mehr sein kann als die Summe seiner Teile zeigt Ina Riepe in ihrem Inspirationsthema. Geteilt durch separate Rahmung und gemeinsam gehängt, kann etwa eine vormals durchgehende Bilderzählung gedanklich ergänzt und weiterformuliert werden. Und als weitere, anregende Impulse für die Fantasie finden Sie auch in dieser Ausgabe von Kunst+Material wieder anregende Lektüretipps, spannende Ausstellungen und viel Wissenswertes rund um die Kraft der Kunst.
Einen schönen Herbstanfang wünscht
Dr. Sabine Burbaum-Machert









Porträt
6–19 „Ich arbeite jetzt so, wie es mir gefällt“
Die Malerin und Illustratorin Ulrike Möltgen
Thema
20–31 Prunk und Melancholie
Die Villa des Kaisers Hadrian
Inspiration
32–39 Mehr als die Summe aller Teile …
Persönlich
40–41 Vom Auflösen und Zusammenfügen
Barbara Howe schafft Collagen
Hintergrund
42–45 Selbstbespiegelungen
Der Spiegel und das Selbstbildnis
Technik
46–51 Black
Schwarze Mal- und Zeichengründe
Bücher
52–61 Bücher, Buchtipps 89 Kunst+Material im Abonnement
Labor
62–63 Unter härtesten Bedingungen
Ausstellungen
66–71 Gelebte Geschichten
„Sean Scully. Stories“ im Bucerius Kunst Forum
72–73 Schattenwelten
„From Dawn Till Dusk“ im Kunstmuseum Bonn
76–81 Mit Talent gegen den Strom „Künstlerinnen!“ in Düsseldorf
82–88 Termine
90–91 Kurz notiert Im Gespräch
92–93 20 Jahre Kunstkosmos Spinnerei Leipzig Vom Industrieareal zum Zentrum zeitgenössischer Kunst
94 Marcel fragt Ulrike
96 Vorschau, Impressum
Titel: Ulrike Möltgen, Der Löwe Trinidad (Ausschnitt) aus: „Ich war die ganze Welt“, Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2025, © Peter Hammer Verlag.

„Ich arbeite jetzt so, wie es mir gefällt“
Die Malerin und Illustratorin Ulrike Möltgen
Eine Manege mit einem Clown. Links daneben ein großer Kopf, geschlossene Augen, aufgerissener Mund, alles verschattet. [2] Was brüllt der Mund? Oder gähnt er? Hinter der Manege das Publikum: Es besteht aus lauter Köpfen, großen und kleinen, wild durcheinander, Erwachsenen und Kindern. Und sie alle kommen einem irgendwie bekannt vor. Erich Kästner (1899–1974) ist sicher zu identifizieren. Und könnte der Junge mit der Schiebermütze Emil sein? Oder Anton? Dann wäre das Mädchen daneben vielleicht Pünktchen? Weiter rechts, die Dame mit Hut, ist die Lyrikerin Hilde Domin (1909–2006). Da war sie noch jung. Man findet sie noch einmal, diesmal älter, neben Kästner. Über ihr, der kleine Kopf, ist der Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1857), der auf dem Zehnmarkschein abgebildet war. Ganz links hinten schaut eine andere Dichterin zu, Else Lasker-Schüler (1869–1945). Die Herren mit Hut und Schnurrbart könnten Dick und Doof sein, also Stan Laurel (1890–1965) und Oliver Hardy (1892–1957). Aber Stan Laurel hatte keinen Schnurrbart. Vielleicht handelt es sich ja auch um Charlie Chaplin? Auf der anderen Seite von Kästner erinnert der Mann mit den geschlossenen Augen an den Sänger Franz Josef Degenhardt (1931–2011), der mit den Schmuddelkindern, der stammte aus Schwelm und das liegt ganz in der Nähe von Wuppertal.
In Wuppertal lebt auch Ulrike Möltgen, von der dieses Bild stammt, das Teil eines Buches ist. Eines von vielen Büchern, die Ulrike Möltgen illustriert hat.
Um noch einmal auf das Bild zurückzukommen mit den Menschen, die zum Teil Porträts sind von Menschen, die gelebt haben und anderen, die noch leben, bekannten Persönlichkeiten und Menschen aus dem Umfeld der Illustratorin. Es erinnert an ein anderes Bild, an das Plattencover von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“1, dem Album der Beatles, das im Mai 1967 erschien und das von mehreren Künstlern, darunter Peter Blake (*1932), gestaltet wurde. Auch hier findet sich eine Menschenansammlung. Die 70 Personen können alle identifiziert werden. Das ist bei dem Bild von Möltgen nicht der Fall. Doch auch das Cover von Sgt. Pepper hatte Vorbilder, wie das Freundschaftsbild von Max Ernst (1891–1976) mit dem Titel Au rendez-vous des amis2 von 1922, das wiederum auf Raffaels (1483–1520) Fresko der Schule von Athen3 Bezug nimmt, das 1509/10 als Wandgemälde im Vatikanpalast entstand.
Auch wenn diese Zusammenhänge der Illustratorin vielleicht nicht bewusst waren, hat sie eine solche Ansammlung von Men-
[1] Ulrike Möltgen, Foto: © Uwe Becker.
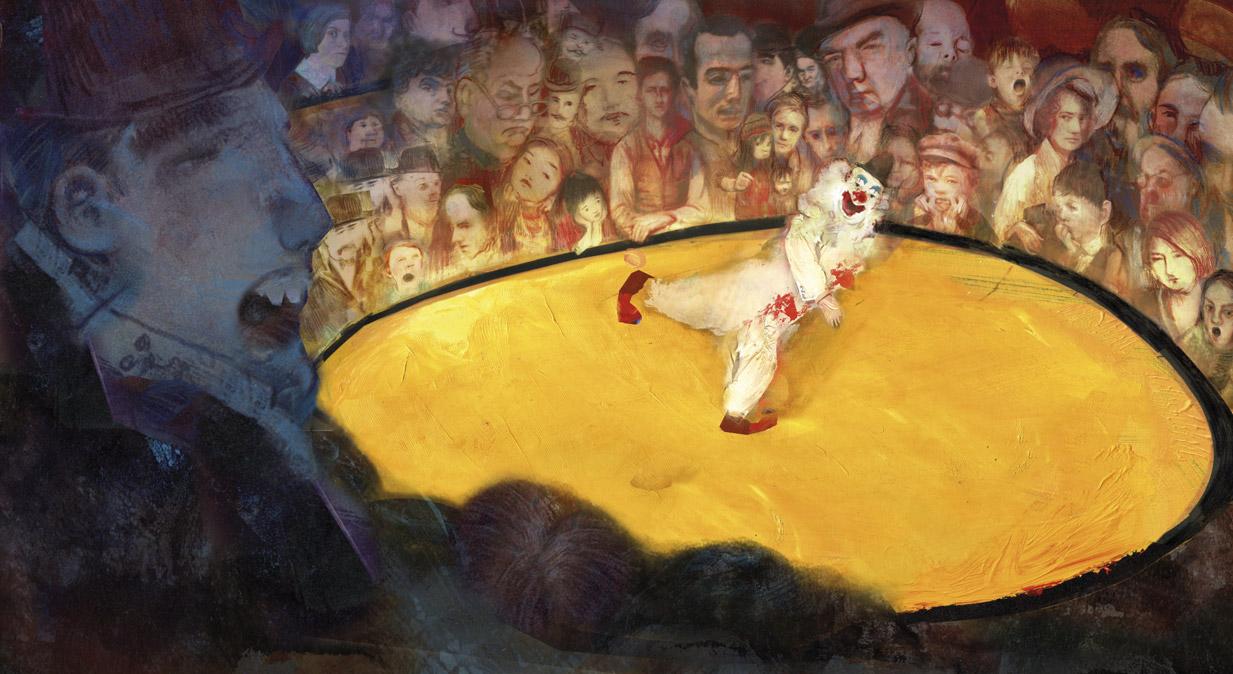
schen bereits in Das Märchen von der Vernunft von Erich Kästner, das nur ein Jahr zuvor erschienen ist, ins Bild gesetzt. Zum Teil finden sich dort dieselben Porträts [3]
Das Bild mit der Manege befindet sich in dem Buch Ich war die ganze Welt und wendet sich an Menschen ab etwa vier Jahren. Es ist ein Traumbuch, in dem ein kleines Mädchen zur ganzen Welt wird [4]. Ihre Körperteile beherbergen den Dschungel, Felder, arbeitende Menschen und auf einem Bein das Zirkuszelt, dem wir bereits begegnet sind. Doch der Clown in der Arena [2] ist langweilig, der Zirkusdirektor Zampano unzufrieden. Eigenmächtig angelt er sich den Löwen Trinidad [s. Inhaltsverzeichnis S. 4], der im Haar des Mädchens wohnt und nun im Zirkus durch einen Reifen springen muss. Das aber geht dem träumenden Mädchen zu weit. Ein Erdbeben beendet die Vorstellung, der Löwe kann wieder ins Haar zurück und der Traum ist aus.
Das Buch von Ulrike Möltgen, Ich war die ganze Welt, ist im Frühjahr 2025 in Wuppertal erschienen, das erste mit eigenem Text. Es ist das vorläufig letzte (die nächsten sind bereits in Vorbereitung) von inzwischen um die 60 Büchern.
Aber der Reihe nach: 1973 in Wuppertal geboren, fingen die Probleme in der Grundschule an. Die kleine Ulrike kämpfte mit Buchstaben und Zahlen. Aus einer ein-und-zwanzig zum Beispiel wurde eine 12, ein Phänomen, das auch viele Ausländer kennen, die Deutsch lernen, weil in den meisten Sprachen, wie zum Beispiel englisch oder italienisch, die Ziffernfolge andersherum gesprochen wird, also twenty-one, vent-uno und so weiter. Noch schlimmer war es mit den Buchstaben, denn sie schrieb in Spiegelschrift. Ihre Texte konnte man nur lesen, wenn man einen Spiegel benutzte. Doch statt sich über diese enorme Transferleistung Gedanken zu machen – so schrieb Leonardo da Vinci (1452–
[2] „Ich war die ganze Welt“: Zirkusmanege mit Zuschauern, Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2025, © Peter Hammer Verlag.
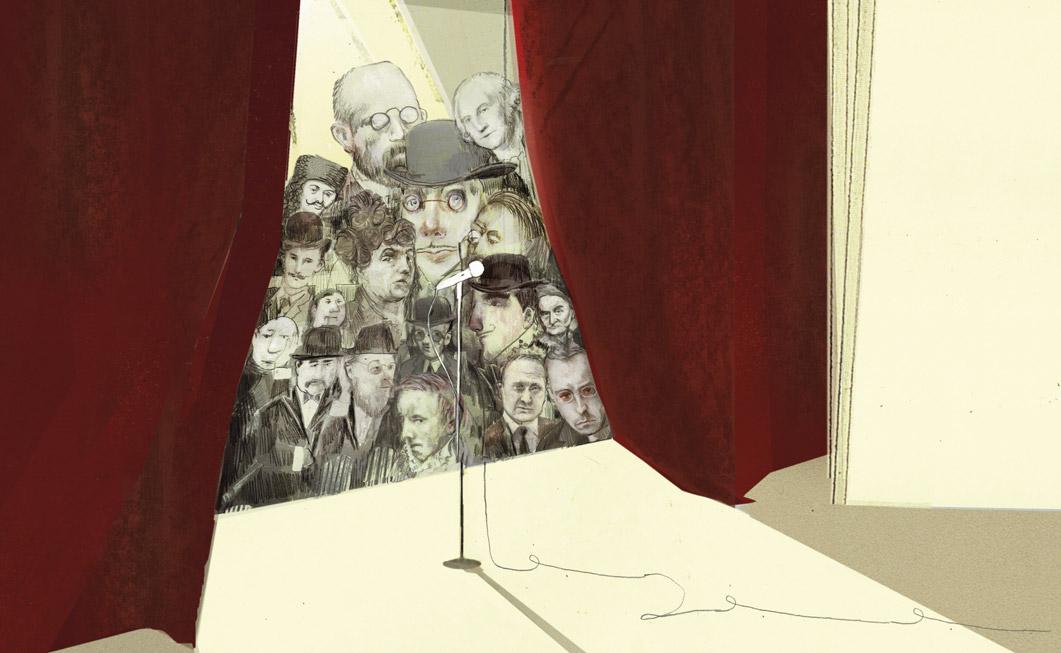
1519) alle seine Abhandlungen in Spiegelschrift –, beschlossen die Lehrkräfte, sie auf eine Sonderschule zu schicken, wie das damals noch hieß. Das konnte die Mutter verhindern und nach der Wiederholung der dritten Klasse tat sich Ulrike Möltgen dann leichter. Gut wurde sie aber nie und das einzige, was ihr Spaß machte, war, Bilder zu malen. Es war damals wie heute „ein zeitloser, sorgenfreier Raum, in dem man ganz versinkt.“4
Im Abschlusszeugnis der Grundschule wurde ihre außerordentliche „musische Begabung im Bereich der Kunsterziehung“ hervorgehoben. Da wusste sie bereits, dass sie Illustratorin werden wollte. Daran waren die beiden Illustrator*innen, John Burningham (1936–2019) und Lilo Fromm (1928–2023), deren Bilderbücher sie besaß, nicht ganz unschuldig. Fromm war damals vor allem durch die Illustration von Märchenbüchern bekannt, Burnigham hatte mit Borka die Geschichte einer Außenseiterin be-
schrieben und 1983 Der Wind in den Weiden neu illustriert. Ulrike Möltgen erinnert sich noch an Simp, der Hund, den niemand wollte, 1966 erstmals erschienen. Diese Bücher entführten Ulrike Möltgen nicht nur in eine fremde Welt, sie stellte auch fest, dass die Illustrator*innen auf den Fotos auf der hinteren Umschlagklappe glücklich aussahen. Und so glücklich wollte sie auch werden.
Das Ende der Schulzeit bedeutete sicher Glück. Davor musste sie allerdings noch die Realschule vollenden. Es folgten 1992 das Fachabitur und eine Ausbildung zur Medienassistentin. 1993 begann sie dann an der Bergischen Universität – Gesamthochschule Wuppertal mit dem Studium des Kommunikationsdesigns. Zu Grundstudium und Brückenkursen kam die Suche nach einem Job. Den fand sie im Trickfilmstudio von Rolf Fänger (1950–2009), der damals für verschiedene Kindersendungen arbeitete, darunter „Janoschs Traumstunde“, „Die Sendung mit der Maus“ oder
[3] Erich Kästner, „Das Märchen von der Vernunft“, Pastellkreide, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Zeichnung mit Fettstift, © Atrium Verlag AG, Zürich, 2024.

„Siebenstein“. Gemeinsam begannen sie, Bilderbücher zu entwickeln. 1997 erschien das erste Buch der Mondbär-Serie. Zu den Bilderbüchern kamen Fernsehsendungen und sogar ein Kinofilm. 1997 war aber auch das Jahr, als Wolf Erlbruch (1948–2022) Professor in Wuppertal wurde und Ulrike Möltgen seine Schülerin, die dann 2001 ihr Diplom machte. Erst wollte sie gar nicht zu Erlbruch gehen, weil er viel zu streng war, später hat sie es nicht bereut und sich mit ihm auch sehr gut verstanden.
Parallel zum Studium und danach entstanden vor allem die Mondbär-Bücher. Rolf Fänger und Ulrike Möltgen waren inzwischen ein Paar geworden, 2004 kam der gemeinsame Sohn Konrad [14] auf die Welt. Mit dem viel zu frühen Tod von Fänger, der einen harten Einschnitt in ihrem Leben bedeutete, endete aber auch die Mondbären-Phase. Ulrike Möltgen begann, andere Wege zu suchen und einzuschlagen. Diese waren nicht geradlinig, son-
dern verschlungen – und das sind sie bis heute geblieben. „Ich arbeite jetzt so, wie es mir gefällt, auf die Gefahr hin, dass man mich nicht wiedererkennt und vor allem auf die Gefahr hin, dass das, was ich mache, kein Mensch kaufen will“, schrieb sie am 28. Juni 2025 an die Autorin. Diese Sorge ist im Moment wahrscheinlich unbegründet, denn allein 2025 sind bereits drei Bücher erschienen, zwei, in denen sie Texte anderer Autor*innen illustriert hat (E.T.A. Hoffmann, Wie aus tiefstem Traum, Hamburg 2025; Selma Lagerlöf, Das Mädchen vom Moorhof, Berlin 2025) und das bereits beschriebene Buch Ich war die ganze Welt. Doch trotz der Erfolge hat sie die Angst zu scheitern nie ganz verlassen.
Eines ihrer ersten Bücher ohne Rolf Fänger war das 2010 bei Sauerländer erschienene Bilderbuch Bei drei auf den Bäumen mit einem Text von Saskia Hula. Schon hier zeigt sich die Tendenz zu kraftvollen Farben, zur Verbindung von Malerei und Collage.
[4] „Ich war die ganze Welt“: Ich lag im Bett und träumte …, Ölfarbe, Acrylfarbe, echte Haare, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2025, © Peter Hammer Verlag.
Doch sieht man auch noch Wolf Erlbruch durchscheinen, der ihr, wie sie es selbst 2017 in einem Interview mit Ute Wegmann für den Deutschlandfunk formulierte, immer noch auf der Schulter sitzt. Das allerdings ist nun auch schon wieder acht Jahre her.
Wolf Erlbruchs Kinderbücher erschienen im Wuppertaler Peter Hammer Verlag. Dort illustrierte Ulrike Möltgen 2014 die Geschichte Die Entstehung der Gürteltiere von Rudyard Kipling (1865–1936) aus dem Sammelband, der in deutscher Übersetzung erst Das kommt davon und später dann Geschichten für den allerliebsten Liebling hieß. Darin überlisten Igel und Schildkröte den kleinen Jaguar, indem sie sich in ein neues Tier verwandeln, das Gürteltier. Auf dem einen Bild sind die Tiere alle wunderbar zu erkennen, dann aber folgen Seiten, die schon fast abstrakt wirken wie diejenige, auf der der Igel beginnt zu schwimmen und die Schild-
kröte, sich zusammenzurollen [5]. Erst allmählich schält sich aus einem Wirrwarr von Papierschnipseln, Farbflecken und Wollfäden der schwimmende Igel heraus.
Bereits 2011 betrat Möltgen allerdings ganz andere Wege, als sie Rolf-Bernhard Essigs Buch Alles für die Katz über die Geschichten hinter Redensarten illustrierte. Hier finden sich zu den einzelnen kurzen Kapiteln Buntstiftzeichnungen in Rot und Blau, die von wenigen eingeklebten Schablonen begleitet werden. Und so sitzt zur Illustration von „Ein Fiasko erleben“ auf Seite 53 ein Opernsänger in einer venezianischen Gondel, die durch einen an beiden Seiten von Palästen gesäumten Kanal fährt, umgeben von Flaschen, die in der Luft zu schweben scheinen. Boot und Himmel sind aus Papier ausgeschnitten, der Rest ganz dünn gezeichnet.5

[5] Rudyard Kipling, „Die Entstehung der Gürteltiere“, Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2014, © Peter Hammer Verlag.

Ähnlich verhält es sich mit Bluma oder das Gummischlangengeheimnis von 2017. Die Illustrationen zu diesem Jugendroman von Silke Schlichtmann sind wieder ganz anders gehalten. Hier fehlen die Schablonen vollkommen, zu den Buntstiftzeichnungen in Rot, nicht zart, wie bei Alles für die Katz, sondern mit einem kräftigen Strich, kommt schwarze Tusche hinzu, mit der größere Flächen mit dem Pinsel gemalt sind. Doch ist auch hier eine Reduktion zu beobachten, die den farbenfrohen Bilderbüchern fehlt [6].
Wenn man jetzt meint, dass das dem Genre Jugendbuch geschuldet sein mag, so täuscht man sich, zieht man die illustrierten „Erwachsenenbücher“ zum Vergleich hinzu, die unter der Rubrik „Literatur“ auf der Website von Ulrike Möltgen zu finden sind.
2018 erschien im Insel Verlag die Kurzgeschichte Das Geschenk der Weisen von O. Henry (1862–1910), die er 1905 erstmals pu-
bliziert hatte, in der Übersetzung von Eva Demski und mit den Illustrationen von Möltgen. Kleine marginale Ausschnitte wechseln sich mit opulenten Doppelseiten ab und begleiten die Geschichte eines armen Liebespaars, das sich zu Weihnachten wundervoll beschenken will. Die Frau, Della, verkauft dafür ihr wundervolles, blondes, langes Haar. Auf dem dazugehörigen Bild sieht man das Gesicht einer Frau, ihr Körper ist von ihren blonden, in großen Locken fallenden Haaren verhüllt [7]. Diese werden von einer riesigen Schere abgeschnitten, geführt von einer von oben in das Bild hereinragenden Hand, während eine zweite das Haar festhält. Die Raumsituation ist durch verschiedenfarbige, eckig zugeschnittene eingeklebte Papiere verunklärt, das ebenfalls zugeschnittene Gesicht wirkt wie eine Mas ke. Passend dazu bestehen die blonden Locken aus Echthaar, die Arme der Schneidenden sind mit Ärmeln aus einem Spitzenstoff bekleidet.
[6] Silke Schlichtmann, „Bluma oder das Gummischlangengeheimnis“, schwarze Tusche, roter Buntstift, Carl Hanser Verlag, München 2017, S. 63, © Ulrike Möltgen. [7] O. Henry, „Das Geschenk der Weisen“, aus dem Amerikanischen von Eva Demski, Acrylfarbe, echte Haare, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Insel Bücherei Nr. 1453, Berlin 2018, S. 29/30, © Insel Verlag, Berlin
[6]
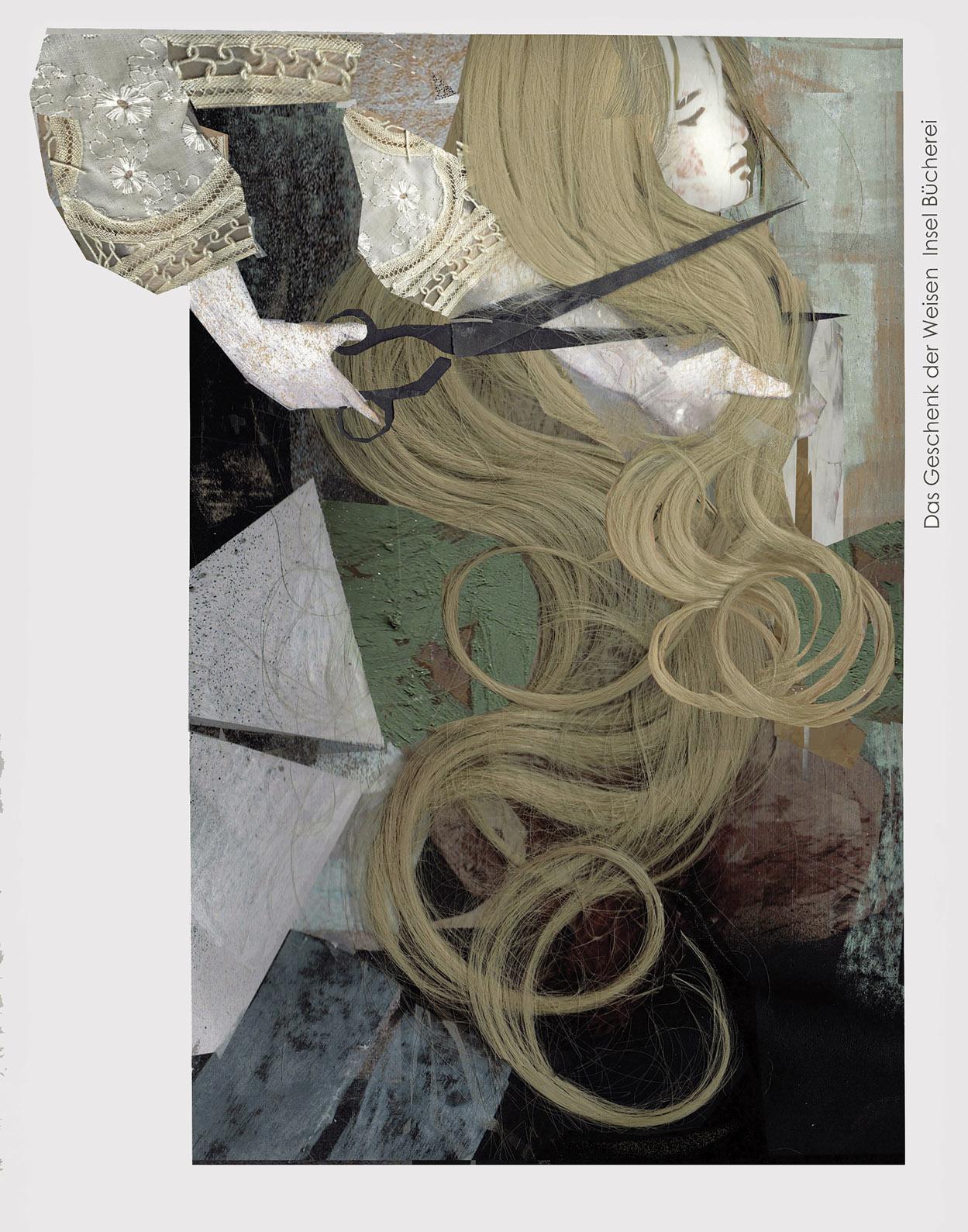


Für das Buch erhielt Ulrike Möltgen 2019 den Troisdorfer Bilderbuchpreis mit der Begründung, sie habe zeitlose Illustrationen geschaffen, die „Brillanz vor allem dadurch gewinnen, dass hier eine ausgewogene Balance zwischen (Material)Fülle und Farbigkeit erreicht wurde.“ Und in der Laudatio schloss Karin Gruß mit den Worten „Ulrike Möltgen hat nicht nur einen Klassiker neu interpretiert. Sie schafft es, Illustration als ‚erhellendes Moment‘ in der Literatur auch für erwachsene Leser bedeutsam zu machen, indem sie die Komplexität zwischenmenschlicher Gefühle subtil auslotet und mit den für sie charakteristischen ästhetischen Mitteln zum Vorschein bringt.“7
Im nächsten Jugendroman, den sie illustriert, findet Möltgen dann zu vollkommen anderen Ausdrucksmöglichkeiten: Es sind Schwarzweiß-Illustrationen, in denen Grau und Schwarz domi-
nieren, passend zu der teils düsteren Geschichte, die in dem Roman Der Vogelschorsch von Hannes Willinger erzählt wird. Diese Illustrationsweise setzt sie nicht nur im nächsten Roman von Willinger, Die Fürstin der Raben fort, sondern auch in dem 2020 erschienenen Buch Das kostbarste aller Güter von Jean-Claude Grumberg, das vom Überleben im Holocaust erzählt, vom Gerettetwerden, aber natürlich auch von der anderen Seite, dem schrecklichen Sterben. 2021 wurde dieses Buch von der Jugendjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Winzige Vignetten an den Kapitelanfängen [8] stehen den ganzseitigen Bildern gegenüber, die den Fortgang der Geschichte begleiten, die von dem kleinen, aus dem Zug geworfenen und gefundenen kleinen Mädchen erzählen, ebenso wie von den Gaskammern in Auschwitz [9][10]
[8] Jean-Claude Grumberg, „Das kostbarste aller Güter“, Pastellkreiden, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, schwarzer Fettstift, Jacoby & Stuart, Berlin 2020, S. 25, © Jacoby & Stuart. [9] Jean-Claude Grumberg, „Das kostbarste aller Güter“, Pastellkreiden, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, schwarzer Fettstift, Jacoby & Stuart, Berlin 2020, S. 38, © Jacoby & Stuart. [10] Jean-Claude Grumberg, „Das kostbarste aller Güter“, Pastellkreiden, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, schwarzer Fettstift, Jacoby & Stuart, Berlin 2020, S. 42, © Jacoby & Stuart.
[8]
[9]
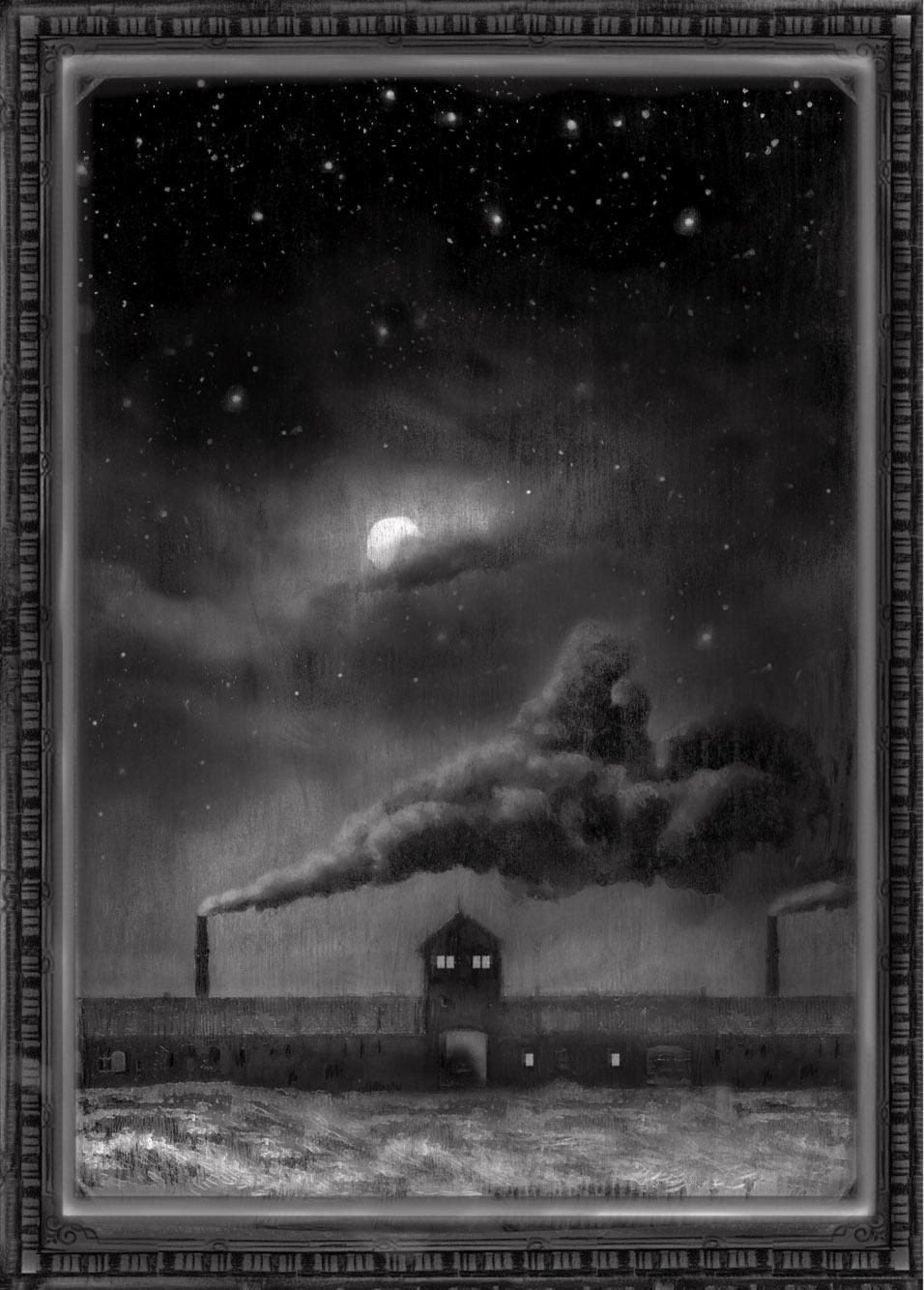
[10]
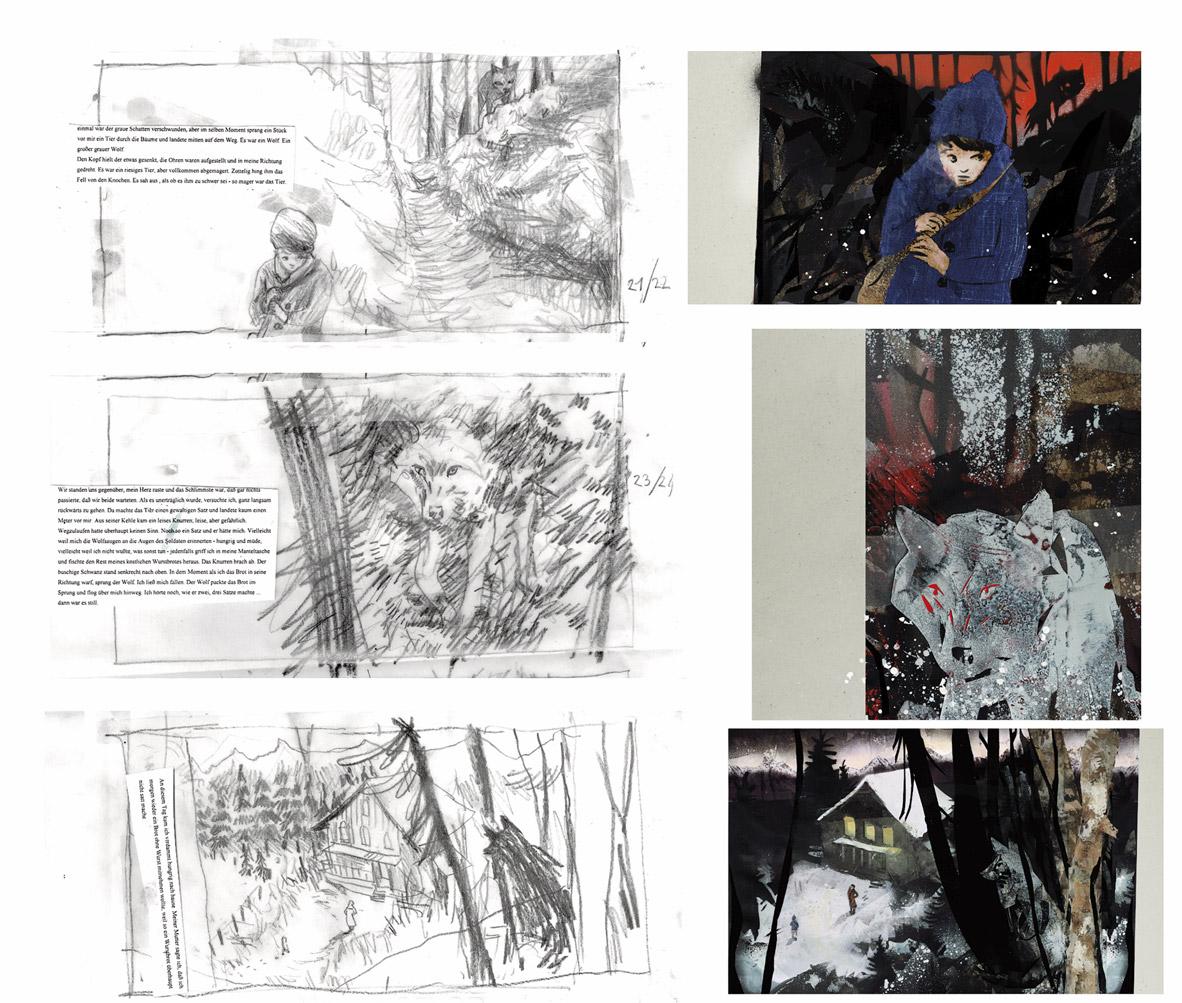
[11] Entwurf und Ausführung für Illustrationen zu Kilian Leypold, „Wolfsbrot“, Bleistift / Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Kunstanstifter, Mannheim 2017, © „Wolfsbrot“ von Ulrike Möltgen und Kilian Leypold / Kunstanstifter, Mannheim 2017 © Kunstanstifter.
Diese in den letzten 15 Jahren entwickelte Bandbreite an unterschiedlichen Illustrationsformen ist eine bewusste Entscheidung gegen die Monotonie einer einmal gefundenen Technik oder eines Stils. Denn sie möchte sich selbst überraschen, sich herausfordern, damit ihre Arbeit spannend bleibt. Oder, in ihren eigenen Worten formuliert: „Wenn ich gerade ein Buch mit komplexen Collagen gemacht habe, dann hab ich keine Lust mehr auf Collage. Ich hab fünf Jahre lang mit Tusche jeden Abend um zehn Uhr ein Bild gemalt. Egal, wo ich war. Da hab ich gedacht, das war ein schönes Arbeiten, ist aber schon länger her und ich möchte mal wieder zur Tusche greifen. Deshalb hab ich Tusche genommen.“8
Und wie sie arbeitet? Stets auf dem Fußboden. Im eben zitierten Interview beschreibt sie das selbst folgendermaßen: „Das Meiste liegt auf dem Boden. Das ist natürlich das Problem, ich muss mich in dem Material befinden, um auf Ideen zu kommen. Ich hab natürlich eine Vorstellung, wie das neue Buch sein könnte. Und das wird meistens nicht so, wie das letzte war. Und dann sehe ich das ganze Material um mich herum. Es ist nach einem abgeschlossenen Buchprojekt auch besonders anstrengend, die kleinen Schnipsel alle wieder zu sortieren. Ich hab eine schwarz-graue Ecke, dann folgt die Blau-bis-Grün-Ecke, unten liegen die großen Papiere und oben die ganz kleinen. Das ist auch nicht so eine tolle Aufgabe, das alles wieder zu sortieren. Und dann sitze ich in der Mitte von diesem Chaos und lasse mich inspirieren von Resten und leg dann eine Farbfamilie fest.“9
Doch vor der Suche nach den Schnipseln kommt das Storyboard, das sie ganz sorgfältig in Bleistift ausführt. Ein Beispiel dafür ist der Entwurf für die Geschichte Wolfsbrot von Kilian Leypold [11]. Ein kleiner Junge muss allein durch den Wald in die Schule gehen. Als Proviant hat er ein Wurstbrot dabei, das er erst mit einem Soldaten teilen muss, um dann den Rest einem Wolf zu geben. In der Gegenüberstellung sieht man die am Text orientierten Kompositionen in Bleistift und dann die Ergebnisse, nachdem sie auf dem Fußboden die Schnipsel zusammengesammelt und die Farben bestimmt hat.
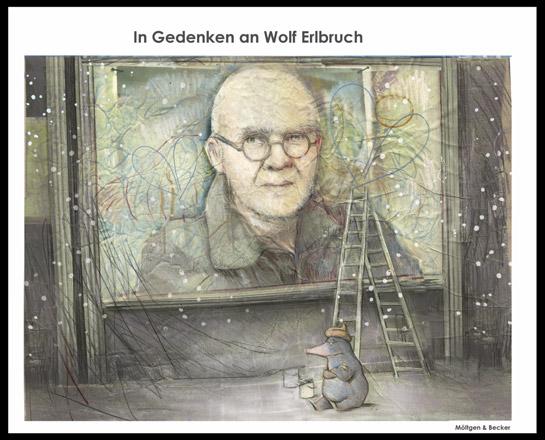
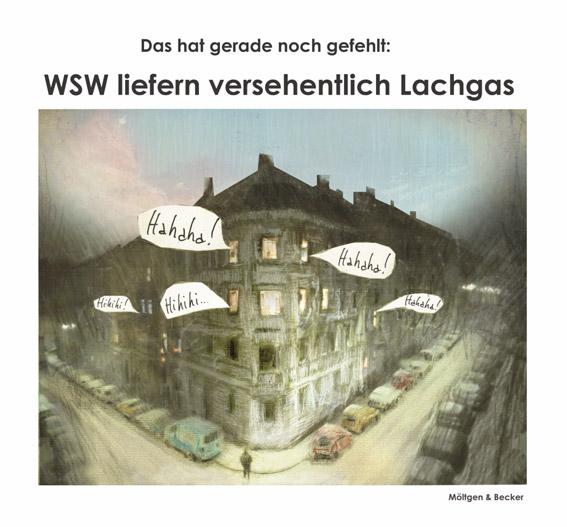
[12] „In Gedenken an Wolf Erlbruch“, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, WZ vom 13.12.2022, © Ulrike Möltgen. [13] „WSW liefern versehentlich Lachgas“, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, WZ September 2022, © Ulrike Möltgen.
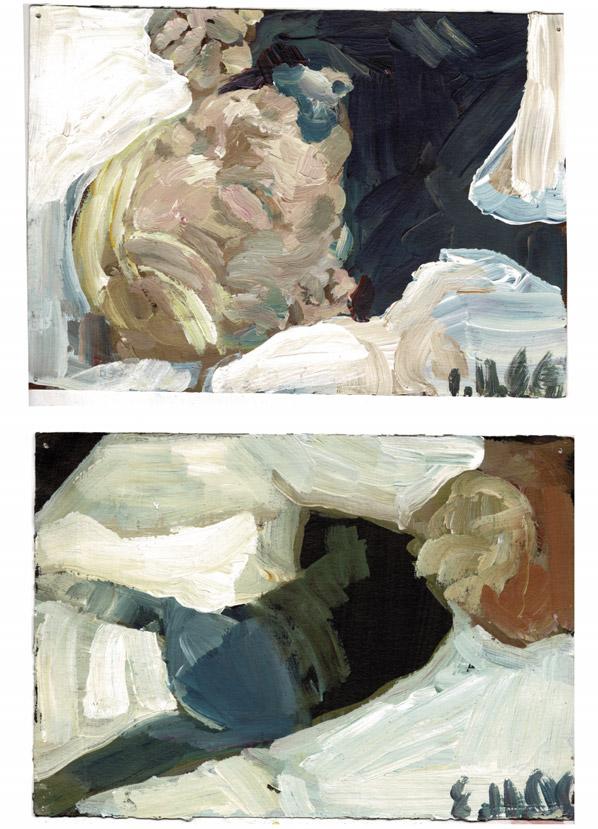
Diese Schnipsel oder auch größere Farbflächen scannt sie ein, schneidet sie am Computer zu und fügt die Teile dann mithilfe von Photoshop in die Komposition ein. Doch das meiste der Arbeit an den Bildern entsteht auf dem Papier und eben auf dem Fußboden.
Auch wenn sich Möltgen inzwischen weit von ihrem Vorbild Erlbruch entfernt hatte, so blieb er doch ein väterlicher Freund, was sich dann auch nach seinem Tod zeigte, als sie im Dezember 2022 einen bildlichen Nachruf für die Westdeutsche Zeitung
(WZ) schuf: Eine Plakatwand mit seinem Konterfei, davor der kleine Maulwurf, dem jemand auf den Kopf gemacht hat, mit Farbtöpfen und Pinseln nach getaner Arbeit [12].
Für die WZ zeichnet sie seit April 2022 regelmäßig Cartoons, die Ideen liefert der Satiriker Uwe Becker. Als im September 2022 keine Gaslieferungen mehr aus Russland kamen, titelte sie WSW liefern versehentlich Lachgas 10 [13]
Dann aber entstehen auch freie Arbeiten wie die zahlreichen Kinderbilder von ihrem Sohn Konrad [14]
Ihre nächsten Bücher sind in Arbeit und man darf gespannt sein, ob es wieder Collagen sein werden, Buntstift und Tinte oder vielleicht etwas ganz anders, aber sicher etwas, das ihr gefällt.#
Susanna Partsch
1 Abb. siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Sgt._ Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club_Band#/media/ File:Sgt._Pepper's_Lonely_Hearts_Club_Band.jpg.
2 Abb. siehe: https://museum-ludwig. kulturelles-erbe-koeln.de/documents/ obj/05010296/rba_d048553_01.
3 Abb. siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/ Die_Schule_von_Athen#/ media/Datei: La_scuola_di_Atene.jpg.
4 Ulrike Möltgen am 27.6.2025 an die Autorin.
5 Das Bild ist auf der Website von Ulrike Möltgen zu sehen: https://www.ulrikemoeltgen.de/.
6 Pauline Liesen (Hrsg.), Troisdorfer Bilderbuch Preis 2019, Troisdorf 2019, S. 6.
7 Ebenda, S. 37.
8 Ulrike Möltgen im Interview mit Ute Wegmann am 8.7.2017. https://www.deutschlandfunk.de/ kinderbuchillustratorin-ulrike-moeltgen-daswesentliche-100.html.
9 Ebenda.
10 WSW ist die Abkürzung für Wuppertaler Stadtwerke.
o.T. (Sohn Konrad im Alter von einem Jahr), Acryl, 2005, © Ulrike Möltgen.
Ulrike Möltgen
1973 in Wuppertal geboren
1992 Fachabitur und Ausbildung zur Medienassistentin
1993 Studium an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal, Kommunikationsdesign und Beginn der Arbeit im Trickflmstudio von Rolf Fänger ab 1997 Bilderbuchserie Der Mondbär (Coppenrath Verlag/Kino/TV)
2001 Diplom in Kommunikationsdesign bei Wolf Erlbruch
2004 Geburt des Sohnes Konrad
2009 Tod von Rolf Fänger ab 2009 Bilder- und Kinderbücher in verschiedenen Verlagen
2010–2012 Lehrtätigkeit an der Folkwang Universität der Künste ab 2016 Coverdesign, Plakate, Editorial und Literatur für Erwachsene
Publikationen (Auswahl)

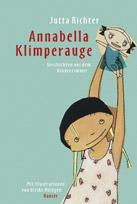
Annabella Klimperauge
Jutta Richter, Hardcover, 152 S., farbige Abb., 16,6 x 24,4 cm,
Carl Hanser Verlag, München 2002, ISBN 9783446201866

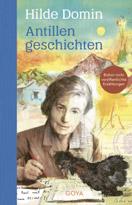
Antillengeschichten
Hilde Domin, geb., 144 S., farbige Abb., 13,8 x 21,5 cm, Goya: Jumbo neue Medien, Hamburg 2022, ISBN 9783833745270

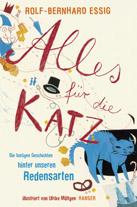
Alles für die Katz
Rolf-Bernhard Essig, Hardcover, 176 S., zweifarbige Abb., 14,5 x 22 cm, Carl Hanser Verlag, München 2011, ISBN 9783446237858
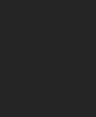
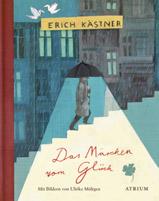
Das Märchen vom Glück
Erich Kästner, geb., 48 S., farbige Abb., 14,2 x 18,4 cm, geb., Atrium-Verlag, Zürich 2022, ISBN 9783855351299
Auszeichnungen
2011 Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur für Bei drei auf den Bäumen
2018 German Design Award Gold für Milli Hasenfuss
Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis für ich #wasimmerdasauchheißenmag
Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis mit Bluma und das Gummischlangengeheimnis
2020 Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis für Der Vogelschorsch
White Raven-Auswahlliste
2021 Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis mit Das kostbarste aller Güter

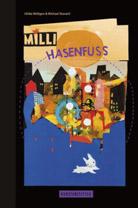
Milli Hasenfuss
Michael Stavari č , geb., 24 S., farbige Abb., 23,5 x 29,5 cm, Kunstanstifter, Mannheim 2016, ISBN 9783942795401

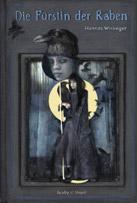
Die Fürstin der Raben
Hannes Wirlinger, geb., 272 S., schwarzweiße Abb., 14,2 x 21 cm, Jacoby & Stuart, Berlin 2024, ISBN 9783964282279

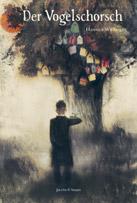
Der Vogelschorsch
Hannes Wirlinger, geb., 304 S., schwarzweiß Abb., 14,2 x 21 cm, Jacoby & Stuart, Berlin 2019, ISBN 9783964280312


Wie aus tiefstem Traum: Der Sandmann & Der Magnetiseur. Zwei fantastische Geschichten
E. T. A. Hoffmann, geb., 144 S., farbige Abb., 13,8 x 21,5 cm, Goya: Jumbo neue Medien, Hamburg 2025, ISBN 9783833749032
Prunk und Melancholie
Die Villa des Kaisers Hadrian
Rom ist manchmal voll, öfters heiß und immer laut: Nichts kommt da so gelegen wie ein Ausflug aufs Land. 30 Kilometer östlich der Tiberstadt beginnen die Ausläufer des Apennins, schon in der Höhe thront das Städtchen Tivoli. Am Übergang von der Ebene der römischen Campagna zu den Monti Tiburtini liegt unser faszinierendes Ziel, die Villa des Kaisers Hadrian.
Der Kaiser baut
Eine von Zypressen gesäumte Allee führt vom Eingang zum Gelände hinauf, ein Pavillon mit einer Rekonstruktion der Gesamtanlage als Modell und dann überfällt einen die schiere Großartigkeit: hundertmetrige Mauern von enormer Höhe, den latinischen Himmel spiegelnde Wasserbecken, gewaltige Substruktionen, Säulen einzeln oder in kleinen Gruppen, in Reihe oder in Bogenstellungen als Exedra, Kuppeln und wieder Kuppeln, manche noch ziemlich vollständig, andere, ein Scherenschnitt gegen die ziehenden Wolken, nur noch in der Höhe balancierende Reste. Gewölbe, die noch den stuckierten und farbig gefassten Schmuck der einstigen, prächtigen Ausstattung ahnen lassen,
von Oberlichtern schummrig beleuchtete Tunnel, bröckelnde Mauerreste, die aus Nischen quellen. Zahnstarrende, steinerne Krokodile (oder sind sie versteinert?), Karyatiden, die versonnen auf moosgrüne Kanäle schauen, wieder Zypressen, Schirmpinien und silbriggrün schimmernde Olivenbäume. Und als Finale Grande schließlich im Zentrum (ist es wirklich das Zentrum?) eine Ringmauer, die einen Säulenring umfasst, der wiederum konzentrisch einen Wassergraben umgibt, der ein fragmentiertes, noch einmal kreisrundes Gebäude in sich schließt: Das Teatro marittimo… So viel zu sehen, so viel zu laufen, so viel in Gedanken wieder aufzubauen – und doch so wenig, das sich dem unmittelbaren Verständnis erschließt. Die Villa Adriana, wie es im heutigen Italienisch heißt, ist ein riesiger Komplex, der sich in NordSüd-Richtung über etwa drei Kilometer und in Ost-West-Richtung anderthalb Kilometer ausdehnt. Teils bebaut, teils als Garten angelegt, ist die gigantische Villa – man sollte besser sagen: die Palaststadt – ein bis heute archäologisch noch nicht ganz erschlossenes und kaum ausdeutbares Objekt. Dessen ungeachtet aber (oder wohl manchmal gerade aus diesem Grund) sind die von hier ausgehenden Impulse ungeheuer wirkmächtig. Und das besonders in der letzten Phase ihrer Geschichte, in der Neuzeit,
[1] Villa Adriana, Tivoli, Canopus, Foto: iStock / AZemdega.


denn nach dem Ende des Römischen Reichs wird die Villa aufgegeben. Sie verfällt in einen Dornröschenschlaf von eintausend Jahren (anders als etwa das Kolosseum, das durch die Zeiten hinweg kontinuierlich „sichtbar“ bleibt). Die kaiserliche Villa wird erst wiederentdeckt im 15. Jahrhundert und damit beginnt eine Wirkungsgeschichte, die ununterbrochen bis heute reicht.
Doch nun der Reihe nach: Als Hadrian 117 n.Chr. den römischen Kaiserthron besteigt, kann er selbstverständlich auf von den Vorgängern übernommene Bauten für Repräsentation wie privates
Wohnen zurückgreifen, beschließt aber unverzüglich, eine eigene Residenz zu errichten. Die Standortwahl ist aufschlussreich: Wohl weil in Rom die Erinnerung der Öffentlichkeit an die bombastische, mitten in der Stadt liegende Domus Aurea, das goldene Haus, des verhassten Nero noch allzu lebendig ist, weicht Hadrian aus in die Umgebung. Das passt aber auch sonst: Tibur, das heutige Tivoli, die Stadt am Berg, ist bei der römischen Upper Class seit langem schon beliebt als brisenfrischer Sommeraufenthalt, um der fieberträchtigen Stadtluft zu entgehen. Der neue Mann am Ruder des mächtigsten Staates der damals bekannten
Welt ist aber auch ganz persönlich eine ungewöhnliche Erscheinung: Das beginnt mit der von ihm favorisierten griechischen Bartmode, die ihn als „Philosophen“ ausweist. Und als solcher braucht er keinen Protzpalast à la Nero, sondern fühlt sich wohler in einem Ambiente, das man als ultimative Ausführung einer römischen Villa rustica, einer ländlichen Villa, auffassen kann. Hier ist noch der lateinische (und bis heute im Italienischen) gültige Begriff der „Villa“ zu klären, der, anders als im Deutschen, nicht unbedingt ein (prächtiges) Bauwerk meint, sondern ein herrschaftliches Landgut, in dem sich Wirtschaftszwecke (und -bauten) mit solchen des privaten Wohnens verbinden. Tätige Muße ist für die landed gentry des antiken Rom das Motto, otium – im Gegensatz zum lästigen negotium des städtischen Getriebes. Otium ist kein Abhängen am Pool! Nein, ein Philosoph ergeht sich im Schatten oder der Sonne, je nach Jahreszeit, und denkt dabei nach, im Dialog mit Freunden oder Beratern. Die Bewegung des Körpers befördert die des Geistes, ganz wie es die griechischen Denker praktizieren.
Hadrian ist ein Mann mit weitem Horizont. Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich der kaiserliche Bauherr von Vorgängern (und Nachfolgern): Kaum einer kennt persönlich einen so großen Teil des Riesenreiches. Nach zahlreichen Kommandos und Statthalterschaften – in diversen Provinzen in der Zeit vor der Thronbesteigung – absolviert Hadrian als neu gekrönter Kaiser zwei jeweils mehrjährige Reisen, die ihn ins gesamte nördliche Europa, sodann aber auch nach Afrika, Kleinasien, Judäa, Arabien, Ägypten führen. Und immer wieder nach Griechenland. Eindrücke aus all diesen Weltteilen, Begegnungen mit Politikern, Denkern und Literaten dort formen die Planungen für die entstehende Villa entscheidend mit. Sie führen zu einem überraschenden Ergebnis, nämlich den Verzicht auf einen „Palast“ im eigentlichen Sinne. Anstelle eines einzigen mehr oder weniger geschlossenen Baukörpers entsteht auf den sorgfältig modellierten (und eben keineswegs durchgängig planierten!) Baugrund bei Tivoli eine Ansammlung einzelner Bauten, pavillonartig verstreut. An die Stelle der sonst von den Römern geschätzten Frontalität tritt eine nur schwer überblickbare Vielgestaltigkeit. Zwar halten gelegentlich einzelne, zum Komplex gehörige Bauten definierte Achsen ein: Spannend aber, wie die „formellen“ und die „informellen“ Elemente miteinander verschränkt sind. Hier spielt eine Rolle, dass sich in der Hadriansvilla staatliche und private Funktionen begegnen. Sie war einerseits (zeitweiliger) Regierungssitz, der entsprechende Räumlichkeiten vorhalten musste für Offizielle, Besucher, Verwaltung etc., andererseits aber soll sie den sehr speziellen Raumbedürfnissen eines Herrschers genügen, der offenbar – und mit den Jahren zunehmend – einen Ausschluss der Öffentlichkeit aus seinem Leben wünscht. Der Anteil des Bauherrn bei der Planung ist nicht klar auszumachen, doch offenbar bringt Hadrian explizite architektonische
Vorstellungen ein, wozu vor allem die zahlreichen Varianten des Kuppelmotives zählen. Diese tauchen auf als Rund- oder Halbkuppel, auch unterschiedlich segmentierte Formen gibt es. Allesamt sind sie im innovativen Betonguss realisiert, ähnlich wie auch beim (gleichzeitg renovierten) Pantheon in Rom. Andere Teile führen die klassische römische, von griechischen Vorbildern abgeleitete Steinbaukunst fort. Hadrian hat, so sieht es aus, auf seinen Reisen mit intensiver Aufmerksamkeit die jeweiligen örtlichen Bauformen studiert. Spuren davon finden sich in den Bauten in Tivoli: Die Villa Hadriana ruft Erinnerungs- und Stimmungswerte auf.

[3] Kaiser Hadrian, Rom, Kapitolinische Museen, Foto: Wikimedia Commons.

Was soll das nur bedeuten?
Die Villa ist Assoziations-Generator: Besonders deutlich bei einem der spektakulärsten Teilbereiche, dem Canopus. Der Name bezieht sich auf eine Stadt in Ägypten, zu deren Charakteristiken ein langgezogener Kanal gehört. In der Villa findet sich in einem sekludierten kleinen Tal eben ein solcher Kanal, der axial zuläuft auf eine aufwändige Baulichkeit über halbrundem Grundriss. Im vorderen Teil von einer Halbkuppel überwölbt, führen tonnengewölbte Gänge, über Schächte von oben belichtet, in die Tiefe des Hügels. Aber, was ist denn nur das Ganze? Ein allgegenwärtiges Problem bei der Untersuchung der Villa! Denn, wirklich verblüffend bei der so inschrifts- und dokumentationsfreudigen römischen Kultur, vom gigantischen Bauprojekt der Hadriansvilla sind so gut wie keine schriftlichen
Spuren überliefert. Das wenige, was es gibt, ist eine Klitterung mannigfacher Quellen. So findet sich die Erwähnung der ägyptischen Stadt in der Historia Augusta, einer notorisch unzuverlässigen späteren Quelle: Flugs macht das 15. Jahrhundert aus einem vorfindlichen Bauteil und einer möglicherweise gar nicht darauf bezüglichen Textstelle ein Serapeum, ein SerapisHeiligtum. Es ist schwer, sich von so bildmächtigen Zuschreibungen freizumachen; heutige Forscher allerdings halten den Canopus, diese raffinierte, geradezu theatralische Inszenierung, für ein Sommer-Triclinium, einen von unsichtbar zugeführten Wasserläufen angenehm gekühlten und von gestuften Blumenbeeten flankierten Freiluft-Speisesaal. Hier wie überall auf dem Areal muss man sich Bauten und Gartenanlagen geschmückt denken mit Skulpturen aus Stein und Bronze, hunderten und aberhunderten, für deren Beschaffung Agenten im ganzen Reich unterwegs sind.
[4] Villa Adriana, Tivoli, Teatro Marittimo, Foto: iStock / alessandro0770.

Dies ist ein Ort des äußersten Luxus, soviel ist klar. Dazu gehört Personal: Allein die Cento Camerelle (wieder so ein Fantasiename, der sich durchgesetzt hat) – bieten Platz für etwa 1500 Menschen. Wie viele sonst noch dazugehören, die zur Bewachung notwendigen Soldaten etwa, bleibt nur zu vermuten. Jedenfalls ist für den reibungslosen Betrieb einer solchen Anlage eine ausgefeilte Logistik vonnöten – von deren Arbeit aber man als Hausherr tunlichst nicht gestört werden möchte. Die Lösung ist, die Service-Sklaven, die in Rom nun einmal dazugehörten, unter die Erdoberfläche zu verbannen: Ein mehrere Kilometer messendes System von Tunneln verbindet die einzelnen Bereiche der Villa. Was sich allerdings merkwürdigerweise nicht einmal als kleinste Spur erhalten hat, sind Küchenbereiche. Oder ließ Hadrian etwa den Pizza-Service aus Tibur herunterkommen? Ergiebiger die Hinterlassenschaften einer anderen, für einen gepflegten Alltag im römischen Verständnis absolut un-
verzichtbaren Er rungenschaft, der Badekultur. Die Thermen, die sich gleich mehrfach im Villenareal finden, müssen geheizt, das Wasser dafür, wie auch das Trinkwasser, herangeführt werden. Eigene, von Hauptleitungen höher im Gebirge abgezweigte Aquädukte, teils über-, teils unterirdisch geführt, werden dafür errichtet. Stichwort Logistik: Allein für die vorbereitenden Erdarbeiten und Unterkonstruktionen beim Bau der Villa gehen Archäologen heute von mehreren 10.000 Arbeitskräften aus. Der Materialbedarf: Er lässt sich decken, weil der Travertinabbau in der Nähe von Tibur ohnehin schon in vollem Schwunge ist für den stadtrömischen Bedarf und zum anderen, weil die Gewinnung von Marmor in größtem Stil reichsweit organisiert ist. Und die großen kaiserlichen Bauvorhaben anderswo haben zum Ausbau der Ziegelindustrie geführt, wie sich gut ablesen lässt an Herkunfts- und Datumstempeln, die sich auf vielen Ziegeln in der Villa finden.
[5] Villa Adriana, Tivoli, Canopus, Foto: Alamy / robertharding.


Ein atemberaubendes Gesamtkunstwerk also aus Landschaftsgestaltung, formalen Gärten, Architektur, Innenausstattung und Kunstwerken. Hadrian hat nicht mehr allzu viel davon, er stirbt schon im Jahre 138 n.Chr. (in Baiae an der Bucht von Neapel).
Seine unmittelbaren Nachfolger nutzen den Bau wohl noch in gewissem Umfang, aber dann, zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt, verlaufen sich Kaiser und Kurtisanen, suchen Kärrner, Gärtner und Bademeister andere Beschäftigungen und im Jahr 476 ist es sowieso vorbei mit dem Römischen Reich. Der lange Schlaf der Villa Hadriana beginnt, die geplünderten Bauten verfallen, Dornengestrüpp, Eidechsen und Schlangen nisten sich ein in den vormals kaiserlichen Raumfluchten. Die Stille dauert, wie gesagt, fast ein Jahrtausend, bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.
Neuanfang
Da findet sich dann die Villa beschrieben in Flavio Biondos Italia illustrata. Der Humanist und Altertumsforscher geht freilich
nicht quellenkritisch vor, was der Wirkung aber keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil, die Epoche der Renaissance sucht in der Antike und ihren Werken unmittelbare Vorbilder: Direkte Anleihen sind umso leichter, wenn man eigene Befindlichkeiten und Problemstellungen auf die Altertümer projizieren kann. Alexander VI, der berüchtigte Borgia-Papst, veranlasst um 1500 erste Grabungen auf dem Gelände. Raffael kommt mit einem Assistenten, um die antike Stucktechnik an den erhaltenen Gewölben zu studieren; die produktiven Folgen sind in der römischen Villa Madama zu besichtigen. Und wenig später tut sich mächtig was in Tivoli: Kardinal Ippolito d’Este und sein Planer, der Künstlerarchitekt Pirro Ligorio, legen am Berghang die Villa d’Este an, ein Glanzstück der Integration von Bau- und Gartenkunst, Bildhauerei und Wasserspielen. Die sechs Kilometer entfernte antike Trümmerstätte wird Vorbild und Kunst-Bergwerk. Hunderte von Skulpturen und ungezählte architektonische Fragmente werden ausgegraben und in die Villa d’Este transferiert. Das ist keine Archäologie im modernen Sinne, die den historischen Kontext zu verstehen sucht, sondern die reinste Beschaffungskriminalität ...
[6] Villa Adriana, Tivoli, Poikile mit Cento Camerelle, Foto: iStock / silviacrisman.
[6]

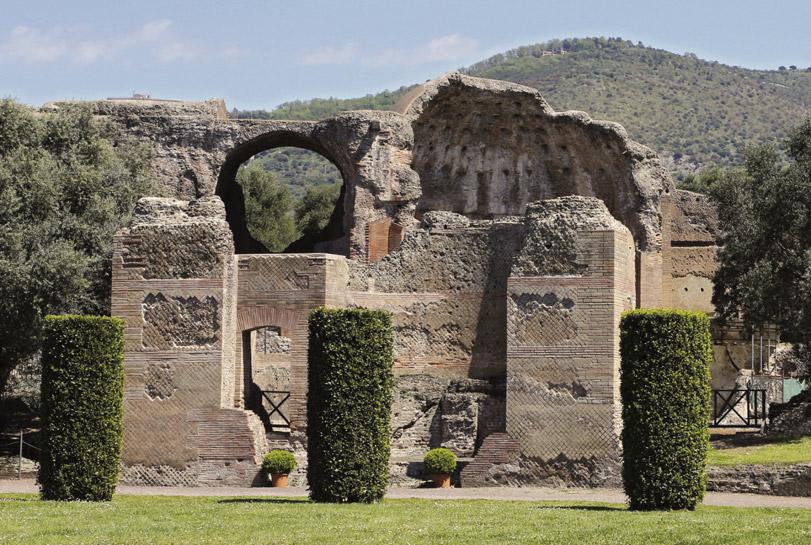
Bevor man das aber nach heutigen moralisch-wissenschaftlichen Begriffen (ver-)urteilt, sollte man den Reichtum der Inspiration würdigen, die von der Villa des Hadrian ausstrahlt, nicht nur nach Tivoli, sondern nach ganz Europa. Ligorios entzückend intime Casina Pio IV. in den Vatikanischen Gärten ist eine Art idealtypischer Verdichtung der Eindrücke aus der Villa: Auch hier geht es um die Vereinigung von Architektur, plastischem Schmuck und Gartengestaltung zu einem stimmungsvollen Ensemble – durchdrungen von philosophischer und philologischer Gelehrsamkeit. Was bei den erfindungsfreudigen Zuschreibungen in der Villa Hadriana reine Fiktion ist, etwa die Lateinische Bibliothek, die Griechische Bibliothek, das wird hier Realität: Eine unbekannte (oder falsch verstandene) Wirklichkeit entfaltet Wirkmacht, wird zur neuen wirklichen Wirklichkeit … Was für die Renaissance gilt, trifft auch später zu. Verschiedene Schichten legen sich übereinander. Ein Beispiel: Das Kentauren-Mosaik, im 18. Jahrhundert in einem Speisesaal des Kleinen Palastes in situ (also an der ursprünglichen Stelle) gefunden, kam nach Berlin (es ist heute noch ein Glanzstück des Alten Museums) und fungiert dort als Katalysator für die Kunst des preußischen Klassizismus.
Und man liegt sicher nicht falsch, wenn man bei Schinkels Schlösschen Charlottenhof in den Potsdamer Gärten, das klassische Architektur und den üppigen Park drum herum in schwingendes Equilibrium bringt, wenn man hier den Zauber der Villa des römischen Kaisers herüberklingen hört über die Zeiten …
Bleiben wir noch einen Moment in Berlin: Auf der obersten Ebene der Eingangstreppe des Alten Museums prunkt eine mächtige, figürlich dekorierte Vase, ein Krater mit geschlungenen Griffen. Das Objekt ist Zeugnis preußischer Eisengusstechnik aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und trotz der Größe doch nur eine radikale Verkleinerung: Das Original zierte einmal, aus edelstem Marmor, die Gärten der Villa Hadriana und maß mehr als 2 Meter im Durchmesser. Die Vermittlung zwischen Tivoli und Berlin? Da ist ein Mann verantwortlich, der wie kein zweiter zwischen Klassizismus und Romantik steht, zwischen Gelehrtheit und fantastischer Erfindung: Giovanni Battista Piranesi (1720–1778). Er zeichnet die Ruinen der Villa als überschwängliches Szenebild, sorgt mit seinen erfolgreichen Radierungen für Verbreitung und Beliebtheit der Motive – und ist bei Grabungen selbst aktiv.
[7] Villa Adriana, Tivoli, Große Thermen, Foto: iStock / irisphoto2. [8] Villa Adriana, Tivoli, Kleine Thermen mit Heliocaminus, Foto: iStock / trotalo.
[7]
[8]


Die dabei aufgefundenen, nicht unbedingt kompletten Objekte montiert und ergänzt er zu sozusagen dreidimensionalen Capricci, mit denen er Sammler, besonders in England, fasziniert. So publiziert er auch die (von einem anderen, nämlich dem britischen Konsul in Neapel, Sir William Hamilton, geborgene und restaurierte) Vase aus der Hadriansvilla. Die hunderte Kilo schwere Vase gelangt so von Tivoli nach England und bekommt dort, nach einem Zwischenbesitzer, dem Earl of Warwick, ihren bis heute gebliebenen Namen Warwick Vase . Von Warwick Cast le, wo sie im Park einen eigenen Pavillon innehatte, ist sie inzwischen nach Glasgow in die Burnell Collection gekommen. Für ihre unzähligen Varianten aber, wie beispielsweise die vor dem Berliner Museum, sind wohl Piranesis weit verbreitete Stiche Anregung. Ein schönes Beispiel für die Metamorphose von Bildformeln: Die schöpferische Anverwandlung, die kreative kulturelle Aneignung ist ein Prozess, in dem das Objekt mit jeder Phase angereichert wird! Und wer die noch bis zum Aufkommen der Moderne beliebten, weiter im Maßstab reduzierten Versio-
nen, als silberner Tafelaufsatz etwa, eine Profanation der heiligen Antike findet, sollte sich einmal in Glasgow auf der Wandung der Warwick Vase den Kopf der Ariadne genauer anschauen: Unverkennbar sind es die hübschen Züge der Liebsten des Gesandten Hamilton, der vielbesungenen Emma. Re-Konstruktion und Konstruktion, sie lassen sich nicht immer zweifelsfrei unterscheiden … Oder auch: Die Antike ist nicht vergangen, sie erzählt von uns!
Bilder, Bauten und Texte
Ein weit gespanntes kulturelles Bewusstsein lässt die britischen Parkbesitzer im 18. Jahrhundert zurückgreifen auf Hadrians Konzeption seiner Villa als assoziationsträchtige Sammlung idealer Architekturen aus verschiedenen Zusammenhängen. Ähnlich dann die Gärten von Wörlitz aus der Zeit um 1800. Auch für den Fürsten Franz von Anhalt-Dessau nehmen kulturelle Bezugnahmen die Gestalt von Bauten an: Tempel, Kirche und Synagoge
[9]
[10]
[9] Villa d'Este, Tivoli, Peschiere, Foto: iStock / vladacanon. [10] Villa d'Este, Tivoli, Wasserspiele, Foto: iStock / boggy22
werden dem strahlenartig aufgefächerten Blick gleichzeitig sichtbar. Und selbstredend mag er nicht verzichten auf ein kleines Pantheon, das die Erhabenheit Roms in die Elbauen bringt.
Und dann wird natürlich im Zeichen der Ruinenromantik die Villa Adriana ein begehrtes Ziel für die Maler. Eine andere Art von künstlerisch schöpferischer Rückprojektion, bei der Hadrian und seine Villa eine Rolle spielen, ist der 1951 erschienene Roman von Marguerite Jourcenar, eine fiktive Autobiographie des Kaisers.1 Hier geht es auch um die homoerotische Liebesbeziehung Hadrians zu dem jungen Antinoos, zu dessen Gedächtnis (nach seinem tragischen Tod im Nil im Jahr 130 n.Chr.) Hadrian die Stadt Antinoupolis gründet. In dieser Beziehung freilich sind die antiken Quellen sparsam, umso erstaunlicher dann, dass bei jüngsten Ausgrabungen, dem Eingangsbereich der Villa vorgelagert, Reste eines ausgedehnten Antinoeion gefunden wurden, mit dem Hadrian möglicherweise auf den gemeinsamen Urgrund der griechischen und der vorderasiatischen Kultur einstimmen wollte. Die Geschichte geht noch weiter: 2018 erscheint die Oper Hadrian, in der der amerikanische Musiker und Komponist Rufus Wainwright genau dieser Nähe auf der Spur ist.
Zurück zur Literatur: Von sprachlicher Schönheit und atmosphärischer Sensibilität (wenn auch stellenweise etwas prätentiös …) wäre hier noch zu nennen: „Rome and a Villa“ (1953, dt. 1955 „Rom und die Villa Hadrian“) der US-Amerikanerin Eleanor Clark (bitte nicht verwechseln mit unserer britischen Zeitgenossin Susanne Clarke, die 2021 mit dem Roman Piranesi etlichen Erfolg hatte, der ja auch in unser Thema schlüge!). Eingehend widmet Clark sich einem Teil der Villa, der tatsächlich wie kein zweiter Historiker und mehr noch Künstler ins Forschen oder vielmehr ins Phantasieren gebracht hat ob seiner schieren Rätselhaftigkeit: Das Teatro marittimo, das Seetheater. Dieser in der Renaissance erfundenen Bezeichnung fehlt nun wirklich jede reale Grundlage, heute figuriert der merkwürdige Kreis-in-Kreis-in-Kreis-Bau zumeist nüchterner als Inselpavillon. Aber was ist nur sein Zweck? Ein privater Rückzugsort? Kaum anzunehmen, dass der Kaiser mit seiner
Im ihrem Spiel zwischen Vegetation und Architektur setzte die Villa Adriana Maßstäbe für die Renaissance.

[11] Rom, Vatikanische Gärten, Casina Pio IV., Foto: iStock / Martin Leber.

absoluten Befehlsgewalt in dem gigantischen Komplex nirgendwo anders seine Ruhe haben konnte … Oder sollte er im Wassergraben geschwommen sein? Auch eine ziemlich alberne Vorstellung, den Herrn der Welt im ringförmigen Becken Runde um Runde vor sich hin paddelnd zu denken … Ein kosmologisches Symbol vielleicht, eine Art begehbares Astrolabium? Dieser „winzige, enge, theatralische Kern des Ganzen; die Unmöglichkeit aufzuhören: dies alles sind intimste Aussagen eines Geistes, einer wahren Tollheit, und das glatte Gegenteil des harmlosen Versailles. Bist du erst einmal bis dahin vorgedrungen, so ist die Villa nicht mehr traurig, nicht einmal besonders ironisch; sie ist, was man Unterhaltung nennt.“2 Mag sein, aber der kapriziöse Überschwang ihrer Formerfindungen bleibt doch verblüffend und beschäftigt nicht nur Architekten, sondern auch Philosophen wie Ernst Bloch, der erstaunt konstatiert, dass Hadrians Villa das „bizarre Wesen“ des „ausgeschweiften Gebälks“, der „abgeschnittenen Giebelecken“, der „turbanartigen Rundbauten“ handgreiflich ausgeführt habe, was man in Pompeji (ein Jahrhundert früher) nur als blühende Phantasien bei der Wandmalerei zu träumen gewagt.3 Oder ist die Villa des Hadrian gar nicht traumverworren, sondern eher Inbegriff mediterraner Klarheit? Es gibt immerhin ein bemerkenswertes Foto des jungen Architekten Le Corbusier, der auf seiner großen Bildungsreise nach Italien 1911 lässig an der Mauer der Poikile lehnt und, wer weiß, an seiner späterhin so berühmten Formulierung drechselt, der zufolge Architektur das „kunstvolle Spiel der Baukörper unter dem Licht“ sei …
Im typischen Piranesi-Stich ist die so genannte „Warwick Vase“ ein leuchtendes Vorbild des europäischen Klassizismus.
Wie auch immer, die riesige Villa Adriana, seit 1871 in italienischen Staatsbesitz, seit 1999 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörig und heute mit einer nicht erschlossenen „Pufferzone“ von 500 Hektar umgeben, ist ein Forschungs- und Assoziations(t)raum, den man kaum ausschöpfen kann. Die Villa mit ihren Bauten, in ihrer Landschaft, ist auch und gerade in ihrem Verfall (etwas pathetisch formuliert, aber zutreffend) so etwas wie eine Urszene der europäischen Seele – der Philosophie, der Architektur und nicht zuletzt der Gartenkunst!
Dieter Begemann
1 Mémoires d’Hadrien (Die Erinnerungen des Hadrian), deutsch 1953 unter dem Titel: Ich zähmte die Wölfin. Die Erinnerungen des Kaisers Hadrian.
2 Zit. n. Eleanor Clark: Rom und die Villa Hadrian, München, Winkler 1955, S. 168.
3 Zit. n. Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Werkausgabe Edition Suhrkamp, Bd. 5, S. 821.
Piranesi, Warwick Vase, Large vase found at the Pantanello, Hadrian's Villa, Tivoli, in 1770 (The 'Warwick Vase'), Radierung, 1778–80, 55 x 80 cm, aus: "Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti antichi disegnati ed incisi dal Cav. Gio. Batt. Piranesi, Vol. I, Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, transferred from the Librar, Object Number: 41.71.1.12(2). [13] Grenzmauer der Poikile, Villa Adriana, Tivoli, Foto: Wikimedia Commens.
[12]


Mehr als die Summe aller Teile …
Kann ein Ganzes mehr sein als die Summe seiner Teile? Unbedingt, denn auch die individuelle Wahrnehmung spielt eine entscheidende Rolle: Wenn bewusst geteilte Szenen durch das Auge unmittelbar wieder zusammengefügt werden, gehen ihre besonderen Geschichten auch gern über die Bildgrenzen hinaus. Durch separate Rahmung und anschließende gemeinsame Hängung kann die Bilderzählung gedanklich ergänzt, verstärkt und weiterformuliert werden.
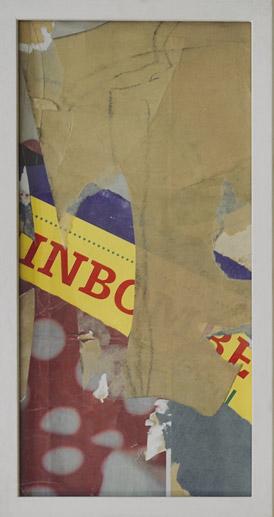
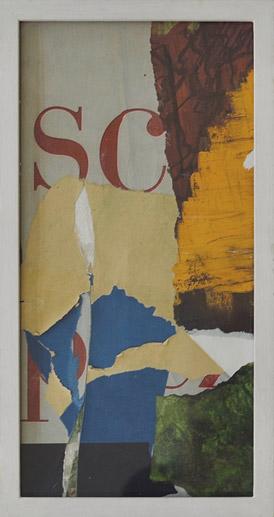

Eine Gliederung durch zwei, drei unkonventionelle Schnitte, gerahmt mit einer attraktiven Leiste, wirkt dekorativ und frisch. Ein exakt geteiltes Bild, dessen speziell abstrakte Elemente neu zusammengefügt werden können, sorgt für einen höheren Spannungswert. Zudem bietet ein variierender Austausch stets neue Ansichten.


Mehrteilige Bilder – ob Diptychen, Triptychen oder gleich Polyptychen, deren Anzahl von Elementen fast beliebig sein kann –stehen in einer langen Tradition. Spontan kommen mittelalterliche Altartwerke in den Sinn, mit denen mehr Inhalte erzählt und mehr Nebenfiguren eingeführt werden konnten als mit einem einzelnen Altarbild (und die im klappbaren Kleinformat auch mit auf Reisen gehen konnten).
In der Emanzipierung von religiösen Zusammenhängen beweisen mehrteilige Bildwerke bis heute besonderen Charakter: Herausragendes Beispiel ist etwa der dreiteilige „Große Zoologische Garten“ des eifrigen Tierpark-Besuchers August Macke, und Francis Bacon gelang etwa mit seinen eindringlichen Diptychen und Triptychen der endgültige Durchbruch.
Ganz anders als die vorangegangenen Beispiele etwa diese Konzeption: In einem einzigen malerischen Prozess wurden auf großformatigem Zeichenpapier (von der Rolle, Höhe 1,96 m) vier Arbeiten erstellt, die trotz aller Unterschiede inhaltlich miteinander verbunden sind: Ausgehend von einem Stillleben wurden auf vier vormarkierten Feldern Einzelbilder gemalt, z. T. mit Wiederholungen in veränderter Weise, die das ursprüngliche Vorbild aus Tisch, Stühlen und einer Lampe aufgreifen.



Während das große, sechsteilige Wandensemble rechts den Prinzipien des Suchens und Zusammenfügens folgt, entsteht im linken Triptychon hingegen eine vergleichsweise surreale Wirkung: Sie wird durch die Verdoppelung des dargestellten, gebeugt malenden Mannes in zwei Größen und die Teilung des Bildes nochmals verstärkt, da der Fuß der größeren Figur über die Bildgrenzen hinaus einen Schritt ins rechte Bild unternimmt.#
Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe
Text: Sabine Burbaum-Machert


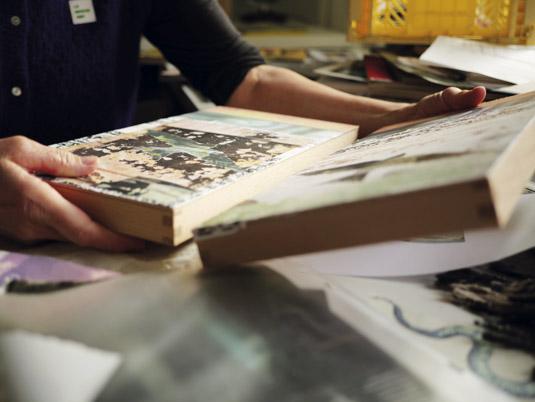
Vom Auflösen und Zusammenfügen
Barbara Howe schafft Collagen

geboren in Münster, lebt und arbeitet wieder in Münster. www.barbarahowecollagen.jimdofree.com
Instagram: @barbarahowe_collagen
In meinen Collagen erzähle ich Geschichten, erschaffe Atmosphären und eröffne neue Perspektiven. Mit Schere und Cutter bearbeite ich Bildsplitter und Papierfragmente, löse sie aus ihrem ursprünglichen Kontext und setze sie neu zusammen. Mein Ausgangsmaterial stammt aus einem über Jahre gewachsenen Fundus: Zeitschriften, Tapetenbücher, Bildbände – gesammelt und im Atelier nach Farben oder Motiven sortiert. Schon als Kind habe ich Architektur- und Modezeitschriften mit der Schere durchstöbert; heute bewahre ich alles auf, was mich anspricht und eines Tages Teil einer Arbeit werden könnte.
Während meines Architekturstudiums entdeckte ich das Collagieren. Anders als in der Architektur bin ich hier frei von Normen und kann mit Formen und Räumen experimentieren – ein inspirierendes Gefühl kreativer Leichtigkeit. Oft ist es ein einzelner Ausschnitt, der den Anfang markiert. Bevor ich collagiere, gestalte ich den Hintergrund: Ich grundiere oder beklebe den Träger, z. B. mit Tapete. Für große Flächen verwende ich gerne den Kleber Planatol Elasta, bei filigranen Details einen Sprühkleber, zum Beispiel von Guardi.
Alle Fotos: Ralf Howe. [1] better fly, butterfly, 2024, Collage, Epoxidharz, 30 x 30 x 3,5 cm.
Ohne feste Bildidee entwickelt sich die Collage Schicht für Schicht. Der Prozess ist offen, intuitiv – geprägt vom Finden, Kombinieren und Verwerfen. Als Bildträger nutze ich gern CasaniHolzkörper in verschiedenen Formaten und Tiefen. Teilweise arbeite ich die Seitenteile mit ein, wodurch die Werke einen objekthaften Charakter erhalten. Reihungen entstehen, wenn sich die Bildidee weiterentwickelt. Auch der Fondo-MDFBlock mit integrierter Aufhängung bietet mir eine praktische Grundlage für meine Arbeiten. Die Papierfragmente ergänze ich gelegentlich mit Acrylfarben, Ölpastellen oder Buntstiften. Lange habe ich nach einer passenden Versiegelung gesucht – bis ich Epoxidharz für mich entdeckte. Nach einem Workshop vor einigen Jahren bei Stefanie Etter arbeite ich zurzeit mit dem Etter Art Topcoat 2–1, meist in mehreren Schichten aufgetragen.
So entstehen Werke mit Glanz und Tiefe – Bilder, die den Betrachter einladen, die Geschichten weiterzudenken.#
Barbara Howe
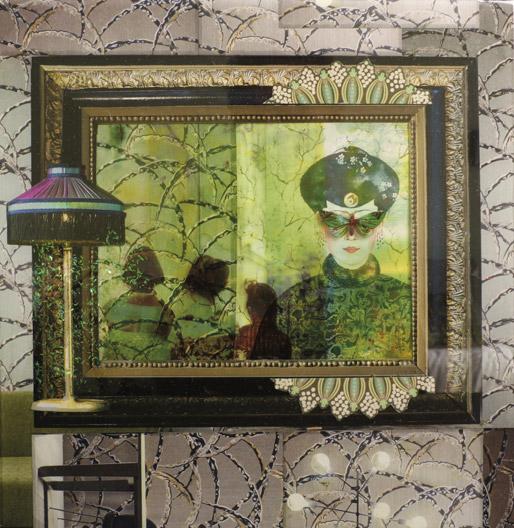
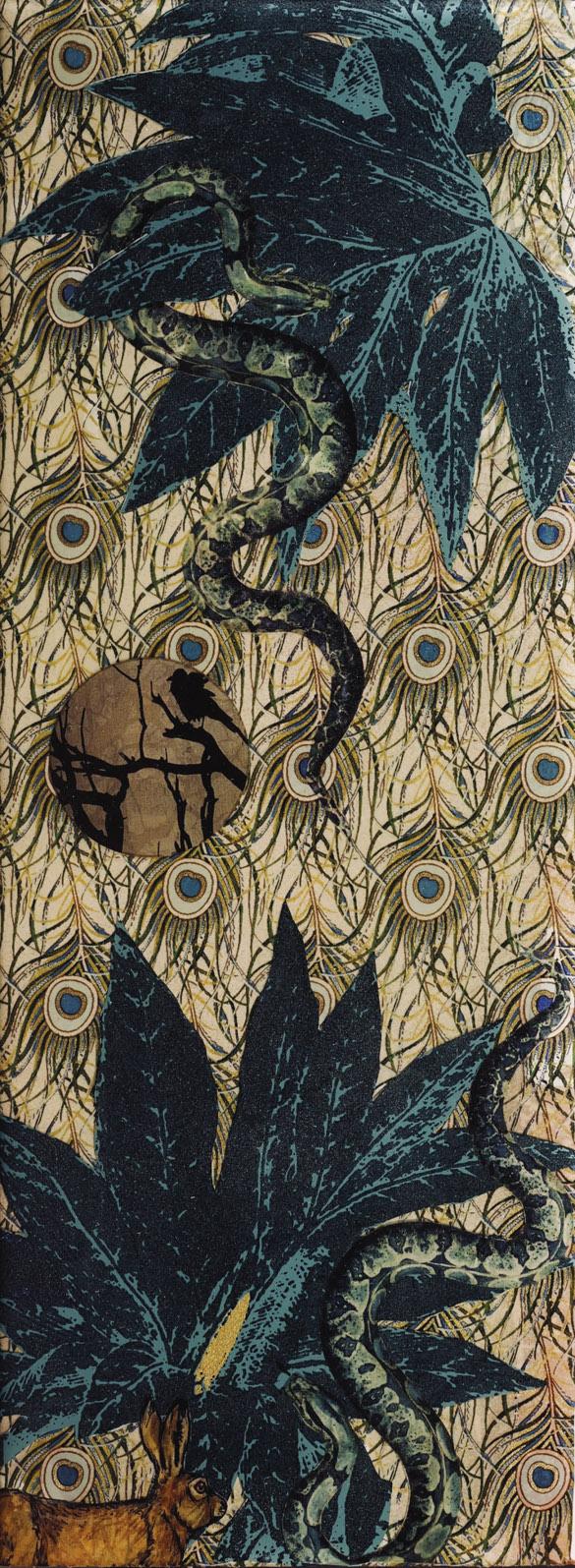
[2] little rabbit, 2025, Collage, Epoxidharz, 15 x 40 x 5 cm.
[2] [1]
Selbstbespiegelungen
Der Spiegel und das Selbstbildnis
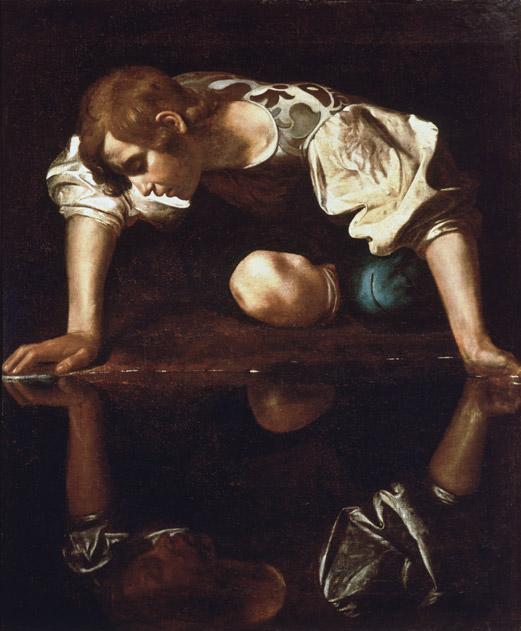
„Wie oft naht er umsonst mit Küssen dem trügenden Borne! [...] taucht' er die Arm' in die Flut und fasst sich nicht in den Wellen!“
Ovid
„… denn im Trinken vom Schein des gesehenen Bildes bezaubert, liebet er nichtigen Wahn.“ So beschreibt der römische Dichter Ovid (43 v.u.Z.–um 17 u.Z.) in seinen um die Zeitenwende entstandenen Metamorphosen den Moment, als der wunderschöne Jüngling Narcissus sein Spiegelbild in einem Gewässer entdeckt und sich unsterblich darin verliebt. Für Narziss endet diese unerwiderte Liebe tödlich, sein Name ist heute das Synonym für Selbstverliebtheit und die Geschichte aus der antiken Mythologie, die es in mehreren Varianten gibt, hat etliche Künstler*innen animiert, sie darzustellen.
Ein Beispiel ist das Bild von Caravaggio (1571–1610), das wohl um 1597/99 entstand, also in seiner römischen Zeit kurz vor den großen öffentlichen Aufträgen [1]. Es zeigt den jungen hübschen Knaben am Rand des Gewässers kniend und sich mit beiden Händen aufstützend. Sein Gesicht schwebt über dem Wasser, das er trinken will, jedoch zögert, nachdem er auf der spiegelglatten Fläche sein Antlitz erblickt. Auch die Arme und das eine, etwas vorragende Knie sind im Wasser sichtbar. Narziss spiegelt sich im Wasser, sein Abbild wird Teil des vom Maler gemalten Bildes, das Bild und Abbild zeigt und selbst Abbild der Szene des sich spiegelnden Jünglings ist.
Eine glatte Wasseroberfläche war wahrscheinlich der erste Spiegel, den Menschen benutzten, bevor sie zu polierten Steinen und Metallen griffen. Erst sehr viel später, im 14. Jahrhundert, begann die Entwicklung des Spiegelglases.
In der Kunst besitzt der Spiegel verschiedene Funktionen. Eine von ihnen ist dienender Art, denn der Spiegel ist notwendiges
[1] Caravaggio (1571–1610), Narziss, 1597/99, Leinwand, 113 x 94 cm, Rom, Galleria Nazionale d‘Arte Antica, Palazzo Barberini, Foto: Wikimedia Commens.
Hilfsmittel beim Selbstbildnis. Das war bereits in der Antike der Fall. Und so beschreibt der römische Schriftgelehrte Plinius (23/24–79) in seiner 37 Bände umfassenden „Naturalis historia“ auch die Bildhauerin und Malerin Iaia aus Kyzikos, wie sie ihr Selbstporträt vor einem Spiegel malt. Diese Iaia soll um 100 v.u.Z. in Rom gelebt haben. Plinius charakterisiert sie folgendermaßen: „Iaia aus Kyzikos, die unverheiratet geblieben ist, malte, als M. Varro noch jung war, zu Rom sowohl mit dem Pinsel als auch mit dem Brenngriffel auf Elfenbein Bilder vor allem von Frauen und zu Neapolis eine alte Frau auf einer großen Tafel, sowie auch ihr Selbstporträt vor einem Spiegel. Niemand besaß in der Malerei eine schnellere Hand, und ihr Können war so groß, dass sie weit höhere Bezahlung erhielt als Sopolis und Dionysios, die zeitgenössischen berühmtesten Porträtmaler, deren Bilder die Galerien füllen.“1 Viel mehr wissen wir nicht von ihr.
Bilder aus der Zeit haben sich nicht erhalten. In der christlich geprägten, europäischen Kunst spielte dann das individuelle Aussehen der Menschen über viele Jahrhunderte nur eine untergeordnete Rolle.
Im 14. Jahrhundert wurde der Wunsch nach Darstellung erkennbarer Gesichtszüge immer größer, erste Stifterporträts trugen individuelle Züge. Bald darauf experimentierten Künstler*innen mit Selbstbildnissen, die mithilfe eines Spiegels entstanden. Sie sind immer daran erkennbar, dass die Figuren aus dem Bild hinausschauen. Ein frühes Beispiel findet sich auf dem Hauptaltarbild im Dom von Montepulciano, das von Taddeo di Bartolo (1362/63–1422) stammt und 1401 datiert ist [2]. Dargestellt ist die Himmelfahrt Mariens. Während die Muttergottes in den Himmel entschwebt, starren elf der Jünger entsetzt und verwundert in den leeren Sarg. Der zwölfte jedoch, der Heilige Thaddäus, schaut auf. Wir sehen ihn im Dreiviertelprofil, wobei seine Augen die Betrachter*innen zu fixieren scheinen. Tatsächlich aber schaute der Maler natürlich in den Spiegel, während er sich als den Heiligen malte, dessen Namen er trug.
Um dieselbe Zeit wurde das Buch des italienischen Dichters Giovanni Boccaccio (1313–1375) über berühmte Frauen (De mulieribus claris) von 1360/62 ins Französische übersetzt. Eine Prachtausgabe mit über hundert Miniaturen für Philipp den Kühnen von Burgund (1342–1404) entstand 1402/03. Darin wird auch eine Malerin namens Marcia geschildert und abgebildet [3]. Es handelt sich dabei um die bei Plinius Iaia genannte Künstlerin, die ihr Selbstbildnis malte, was Boccaccio folgendermaßen schilderte: „… unter diesen war auch ein Selbstporträt, das sie unter Zuhilfenahme eines Spiegels gemalt hatte. Ihre Züge, ihre Farben und ihren Gesichtsausdruck bildete sie so getreu in dem Gemälde ab, dass keiner ihrer Zeitgenossen, der dies sah, daran zweifeln konnten, um wen es sich hier handelte.“2
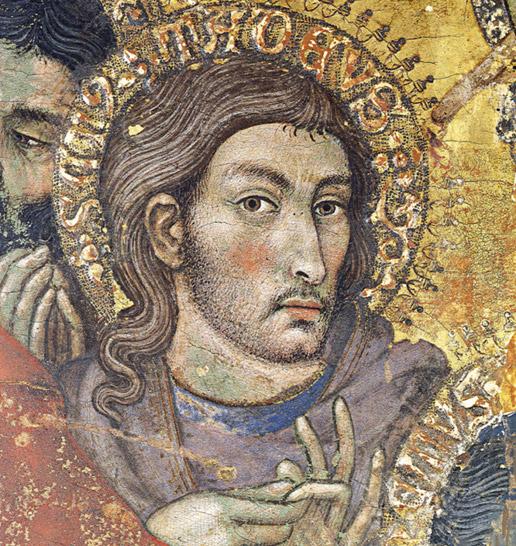
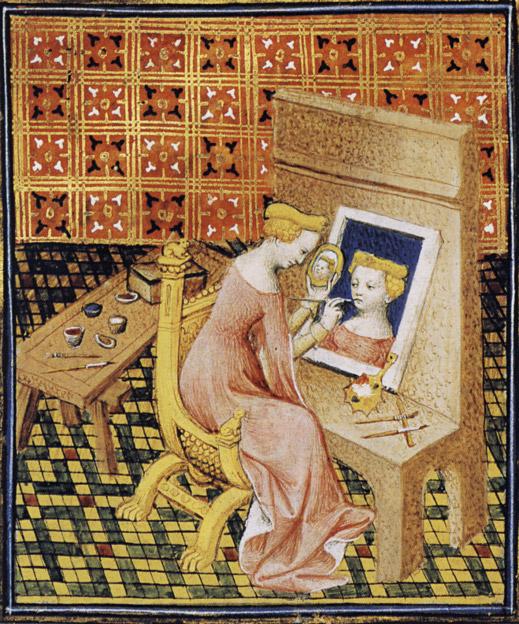
[2] Taddeo di Bartolo (1362/63–1422), Der Jünger Thaddäus, 1401, Detail aus der Altartafel mit der Himmelfahrt Mariens, Holz, Montepulciano, Dom, Foto: Wikimedia Commens. [3] Marcia malt ihr Selbstbildnis, um 1403, in: Boccaccio, De claris mulieribus, Paris, Bibliothèque national, Fr.12420, fol. 101v, Foto: Wikimedia Commens.
[2] [3]
„Da nun in dem Spiegel alle naheliegenden Gegenstände sich vergrößern [...] malte er eine Hand, welche zeichnet, ein wenig groß, wie sie im Spiegel erschien, so schön, als ob man sie in der Wirklichkeit schaue.“
Giorgio Vasari
Auf dem Blatt sieht man eine Frau auf einem Stuhl vor einer Art Schreibpult. An dessen rückwärtiger Wand lehnt eine Tafel, auf der das fast vollendete Porträt der Malerin zu sehen ist. In der Hand hält sie einen kleinen Spiegel, in der ihr Gesicht ebenfalls zu erkennen ist. Auf dem Pult liegen zwei Pinsel und eine Palette, auf einem Tisch daneben befinden sich weitere Malutensilien. Der Fußboden besteht aus verschiedenfarbigen quadratischen Kacheln, ein Wandvorhang im Hintergrund dient vielleicht als Raumteiler.
Die Miniaturen werden einem unbekannten französischen Buchmaler mit dem Notnamen Meister der Marienkrönung zugeschrieben, der um 1402 bis 1404 gewirkt haben soll. Zu der Zeit erschien auch Das Buch von der Stadt der Frauen von Christine de Pizan (1364–nach 1429), die, Boccaccio zitierend, das Selbstbildnis von Marcia als äußerst kunstvolles Gemälde bezeichnete. „Es zeigte sie beim Blick in einen Spiegel und war so naturgetreu, dass jeder, der sie sah, sie für lebendig hielt. Noch lange Zeit später wurde dieses Bild mit höchster Sorgfalt aufbewahrt und den Künstlern als berühmtes Kleinod gezeigt.“3

Als ein Kleinod gilt auch das Bild, das Parmigianino (1503–1540) von sich selbst gut hundert Jahre später auf einen runden gewölbten Bildträger malte [4]. Die Gesichtszüge des etwa zwanzigjährigen Malers wirken dabei so verzerrt, als würde er sich in einem damals in Venedig üblichen Konvexspiegel betrachten. Der junge, elegant gekleidete Mann befindet sich in einem Raum, vermutlich seinem Atelier. Links fällt durch ein Fenster Licht. Bei dem angeschnittenen runden Rahmen am rechten Bildrand dürfte es sich um den eigentlichen Spiegel handeln, in den er aber nicht schaut. Dort befindet sich auch noch eine leere Staffelei. Die Hand des Künstlers im Bildvordergrund wirkt durch den angeblichen Konvexspiegel überdimensioniert. Die langen, schmalen Finger halten ein Malwerkzeug und damit das ausführende Mittel der Kreativität.
Doch die Art der Darstellung verunsichert die Betrachter*innen. Ist hier der wirkliche Parmigianino dargestellt oder
[4] Parmigianino (1503–1540), Selbstbildnis im konvexen Spiegel, um 1523/24, Pappelholz,
Durchmesser 24,4 cm, Rahmenmaße 32,5, x 6 cm, Wien, Kunsthistorisches Museum, Foto: Wikimedia Commens.
nur sein flüchtiges Spiegelbild? Die Fragen nach Wirklichkeit, nach Wahrheit und Lüge verbinden sich in diesem Bild, dessen Schöpfer die Möglichkeiten der Malerei auslotet.
Was der Spiegel als Hilfsmittel noch zu leisten vermag, wird in dem Freundschaftsbild deutlich, das der venezianische Maler Bernardino Licinio (1485–um 1549/vor 1565) von sich und dem Architekten Sebastiano Serlio (1475–um 1554) anfertigte.4 Im Vordergrund sitzt der Architekt an einem Schreibpult und hält einen Zirkel in der rechten Hand, die linke hat er zum Redegestus erhoben. Er schaut in einen viereckigen Flachspiegel. Wir sehen ihn also doppelt. Einmal von hinten und einmal von vorne. Im Spiegel ist aber noch der Maler zu sehen, der sich hinter Serlio befindet und diese Szene in einem Bild festhält, wie man an dem Pinsel erkennen kann, den er in seiner Hand hält. Da er Serlio ja sowohl im Raum als auch im Spiegel malt, sehen wir auch ihn im Spiegel. Ähnlich wie Parmigianino spielt Licinio hier mit der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit und der Rolle, die man der Malerei dabei zuweisen kann.#
Susanna
Partsch
Seriell, singulär, skulptural ...
1 Zitiert nach: Anna Frasca-Rath, Antike Künstlerinnen bei Boccaccio und Pizan oder die Geburt einer Bildhauerin namens Marcia, in: Antonietta Terzoli/Sebastian Schütze (Hrsg.), Boccaccio und die bildenden Künste, Berlin 2024, S. 239.
2 Giovanni Boccaccio, Von berühmten Frauen. Ausgewählt und neu übersetzt von Martin Hallmannsecker, München 2021, S. 84.
3 Christine de Pizan, Das Buch von der Stadt der Frauen, hrsg., übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Margarete Zimmermann, Berlin 2023, S. 100.
4 https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/ einblick/single/news/vor-und-nachbild-vereintein-kunsthistorischer-gluecksfall/; das Gemälde befindet sich im Martin-Wagner-Museum der Universität Würzburg und wird um 1530 datiert. Erst 2018 konnte mit der Entdeckung eines weiteren Porträts von Serlio dessen Identität festgestellt werden. Es wurde etwa vierzig Jahre später von Bartolomeo Passarotti (1529–1592) gemalt und 2019 vom Martin-Wagner-Museum erworben.

Der fondo-Malkörper besteht aus 30 mm starkem, naturbelassenem MDF. Er erlaubt alle üblichen Techniken der Malerei, eignet sich aber auch hervorragend für die Bearbeitung mit Schnitzwerkzeugen oder für Assemblagen. Ob einzeln oder in Serie: Die rückwärtig eingelassene Aufhängung ermöglicht eine flexible Platzierung an der Wand.

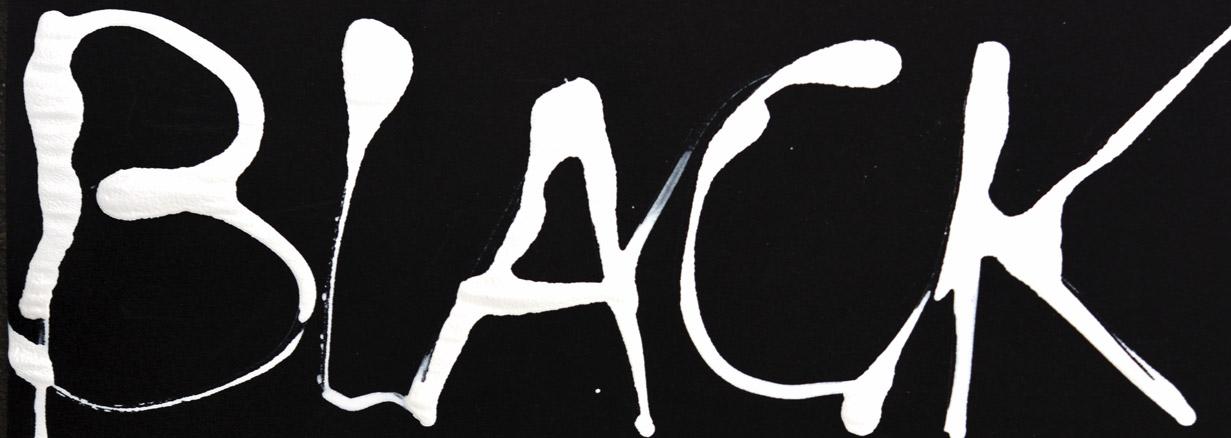
Die Farbe Schwarz hat viele Gesichter: Sie gilt als Synonym für Rätselhaftes, für die Nacht und pessimistische Gefühlswelten. Gleichzeitig erscheint sie in der Mode als Quintessenz der Eleganz und allgemein als Zeichen von Macht. Dunkle bis schwarze Malgründe wurden einst bevorzugt in der Chiaroscuro-Malerei verwendet, und schwarz eingefärbten Papiergründen kommt in der Zeichenkunst seit jeher eine besondere Bedeutung zu: Der Mal- und Zeichengrund bietet Tiefe und Schatten und erfordert Höhungen für Licht und Plastizität.
Im Layout, in der Modezeichnung und in der grafischen Gestaltung sind schwarze Malgründe nie aus dem künstlerischen Einsatz verschwunden. Schwarz reflektiert wenig bis gar kein Licht und beeinflusst maßgeblich die Farbqualität anderer Töne.
Ein auf hellem Grund gemaltes Bild wirkt in der Regel heiterer und wärmer – für das klare, gleißende Licht eines strahlenden Tages wäre ein weißer Kreidegrund der Malgrund der Wahl. Doch mitunter geht dies zu Lasten einer gewissen Farbdramatik, der Kontraste und der Leuchtkraft. Dabei sind sowohl die Farbe selbst als auch die Wirkung eines speziellen Farbtons auf hellem oder dunklem Grund entscheidend.
Das weiße Gesicht links wirkt auffällig verfremdet und maskenhaft – eine Zeichnung auf weißem Grund würde im Gegensatz dazu nicht weiter ungewöhnlich erscheinen. Doch durch die Umkehr bekommt es einen dramatisch-theatralischen Ausdruck, der mit der kostümartigen Skizzierung des blau gemusterten Mantels korrespondiert – das Muster steht gewissermaßen für sich.

Das Großformat links setzt auf eine fast monumentale Scherenschnitt-Wirkung. Die Figuren stehen plan und ohne innere Struktur auf dem schwarzen Malgrund und wurden zunächst zeichnerisch mit Pinsel und weißer Farbe umrissen. Die komplette restliche, die Figuren umgebende Fläche wurde in mehreren Zügen weiß übermalt.
Die Entwurfszeichnungen rechts setzen den Fokus auf modische Akzente: Form und Fall eines Kragens samt Tuch, die ungewöhnliche, farbstarke Musterung einer Jacke, die leuchtende Neonfarbe des Outfits.

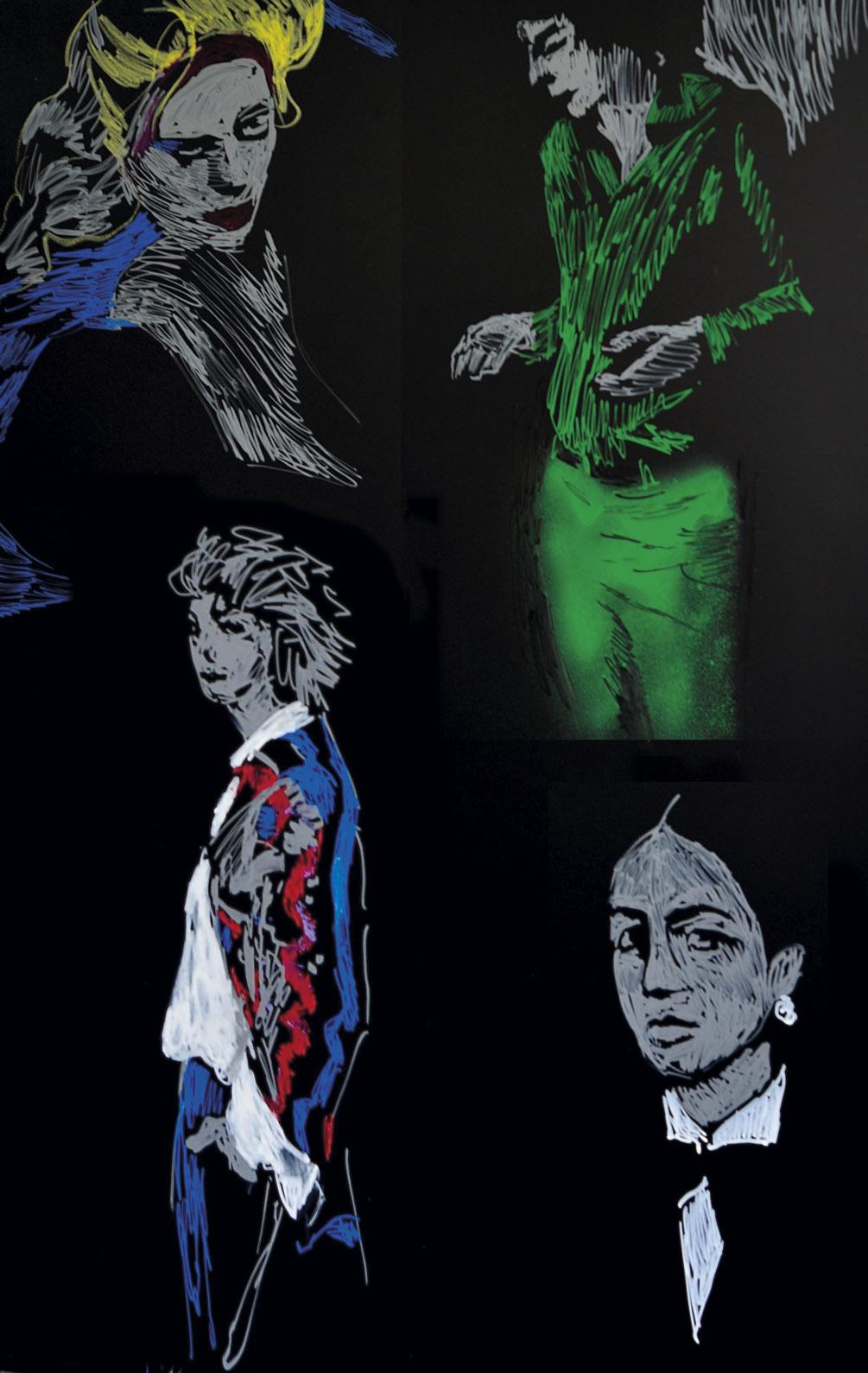

In dieser abstrakten Komposition wird die dramatische Farbsteigerung durch den Farb-Schwarz-Kontrast greifbar: Diese Variante der Farbflächenmalerei wurde mit hoch pigmentierter Acrylfarbe auf schwarzem Grund ausgeführt. Die Streifen stehen nicht bunt nebeneinander auf hellem Grund, sondern leuchten vielmehr mit farbiger Strahlkraft aus dem Dunkel.
Auch die mit Farbspray und Schablone ausgeführten kleinen Bildausschnitte wirken als tanzende Blätter in punktuell beleuchteter Nacht. Im Gegensatz zu einer eher typischen Ausführung auf weißem Grund wirken sie hier verspielt und leicht, fast geheimnisvoll.
Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert

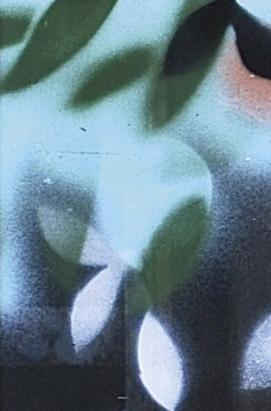
Mit Charme und Scheppness
Ramona Zirks Krummtiere ermuntern Kinder und Eltern zum Zeichnen und Malen

Porträtfoto: © Lieblingsbilder Fotografie.
In den an Kinder und ihre Eltern gerichteten Büchern von Ramona Zirk gibt es keine Norm, gibt es kein Richtig oder Falsch. Hier ist alles schief, unproportional und eine Portion zu dick – schepp eben. Unterstützt von den krumm und unproportioniert gemalten Tieren folgen sie keiner Norm, sondern regen zum Machen an. Ohne viel Blabla. „Kopf aus, Stift an!“, lautet das Motto von Ramona Zirk. Was zählt, ist der Spaß, wenn sich der Kopf von den Fingern löst und die Kinder ohne Zögern mit dem Malen beginnen.
Mit ihren beim Halfbird-Verlag erschienenen „Wegefinderbüchern“ weckt die Illustratorin bei Groß und Klein die Freude am Zeichnen und Aquarellieren. Als 2022 mit „Mal mit mir ein Krummtier“ der erste Band der Krummtier-Bücher erschien, brauchte es nicht mehr als einen Stift. Denn hier wird in das Buch gezeichnet, um die Angst vor dem „Nicht-Können“ zu zerstreuen und den Weg zu einem eigenen Stil zu eröffnen.
„Aquarellier mit mir ein Krummtier“ ist eine Weiterführung des ersten Buches. Es erweitert die Möglichkeiten des Illustrierens um den Faktor Wasserfarben. Dafür werden Pinsel, Papier, Bleistift und Aquarellfarben benötigt. Das Buch möchte Mut machen, sich in das Abenteuer Farbe zu stürzen und sich daran auszuprobieren. 32 Krummtier-Motive zeigen, wie Tiefe entstehen kann und warum Buntstifte Wasserfarben perfekt ergänzen.
Dem Charme der Zirk’schen Krummtiere und dem einfachen, mutmachenden Konzept ihrer Bücher kann man sich kaum entziehen. Es wirkt bei Kindern und Erwachsenen, die unbeschwert und entspannt malen wollen, auch wenn sie meinen, das nicht zu können. Damit ist es geeignet für Kinder, die Zeichenhemmungen haben. Und für Erwachsene, die dazulernen wollen sowie für alle, die gemeinsam Spaß am Malen erleben möchten. Das Ganze gibt es nachhaltig und auf 100% Altpapier in Deutschland gedruckt.
Was es mit den Krummtieren und mit ihren Büchern auf sich hat, erklärt Ramona Zirk in unserem Interview.
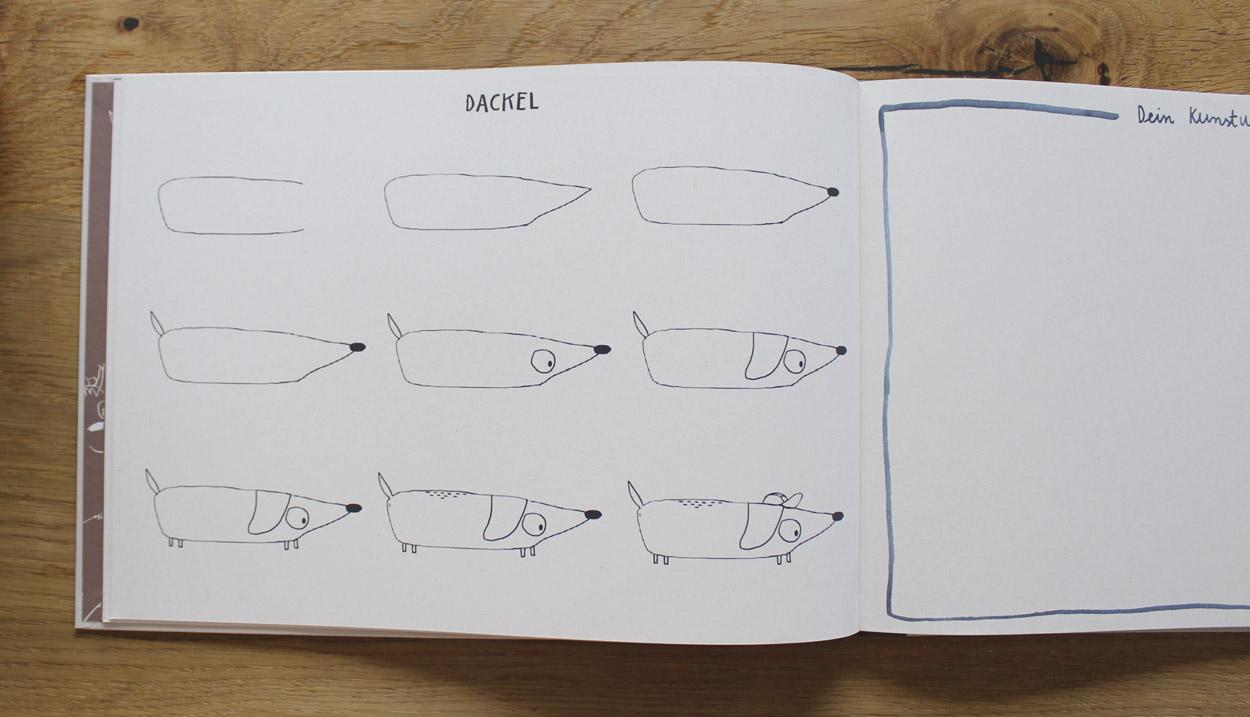
Kunst+Material: Ramona, du hast ein ganzes Repertoire schepper Tierfiguren. Wann hast du die ersten dieser charmanten Wesen zu Papier gebracht? Und wann hast du bemerkt, dass sie Herzen öffnen?
Ramona Zirk: Wann genau die ersten scheppen Tierchen aus mir herauskamen, kann ich gar nicht so genau sagen, aber es müsste vor etwa zehn Jahren gewesen sein. Dass diese krummen Kerle aber die Herzen von wirklich vielen Kids und Eltern erobern, das habe ich erst so richtig im November 2021 gemerkt. Wir waren damals auf Familienwochenende mit unseren und den Kindern meiner Schwester. Und ehe alle Erwachsenen am Frühstückstisch ankamen und entspannt frühstücken wollten, waren die Kids natürlich bereits vollgefuttert, starteten damit, dass sie doch bitte jetzt beschäftigt werden wollen und wurden ausgesprochen quengelig. Ein entspanntes Essen stand also in weiter Ferne und so beschloss ich, mit Ihnen einfach gemeinsam Tiere auf den Hotelblock zu malen, bis alle Erwachsenen entspannt gefrühstückt hatten.
Aus vier begeisterten Kids neben mir wurden bald zehn, weil sich noch einige vom Nachbartisch dazugesellt hatten. Wir malten bis kurz vor dem Mittagessen ;D.
K+M: Wer oder was hat dich auf die Idee gebracht, Bücher zu veröffentlichen, die mithilfe deiner scheppen Tierfiguren zum Zeichnen und Aquarellieren anregen?
R.Z.: An diesem Morgen im Hotel entstand die Idee zu einem Buch, denn wir hatten Kids von 3–11 Jahren am Tisch und ALLE haben mitgemalt. Auch die, die der Meinung waren, dass sie nicht malen könnten. Ich war so beeindruckt von den charakterstarken Wesen, die entstanden – allen voran the one and only „Dackel Detlef“ –, dass ich fand, es sei an der Zeit ein Buch dazu zu machen, um den Kids die Angst beziehungsweise den Druck vom „Losmalen“ zu nehmen und zu zeigen,
Abbildung aus dem Inhalt der Bücher: © Ramona Zirk/halfbird Verlag 2022/2024.
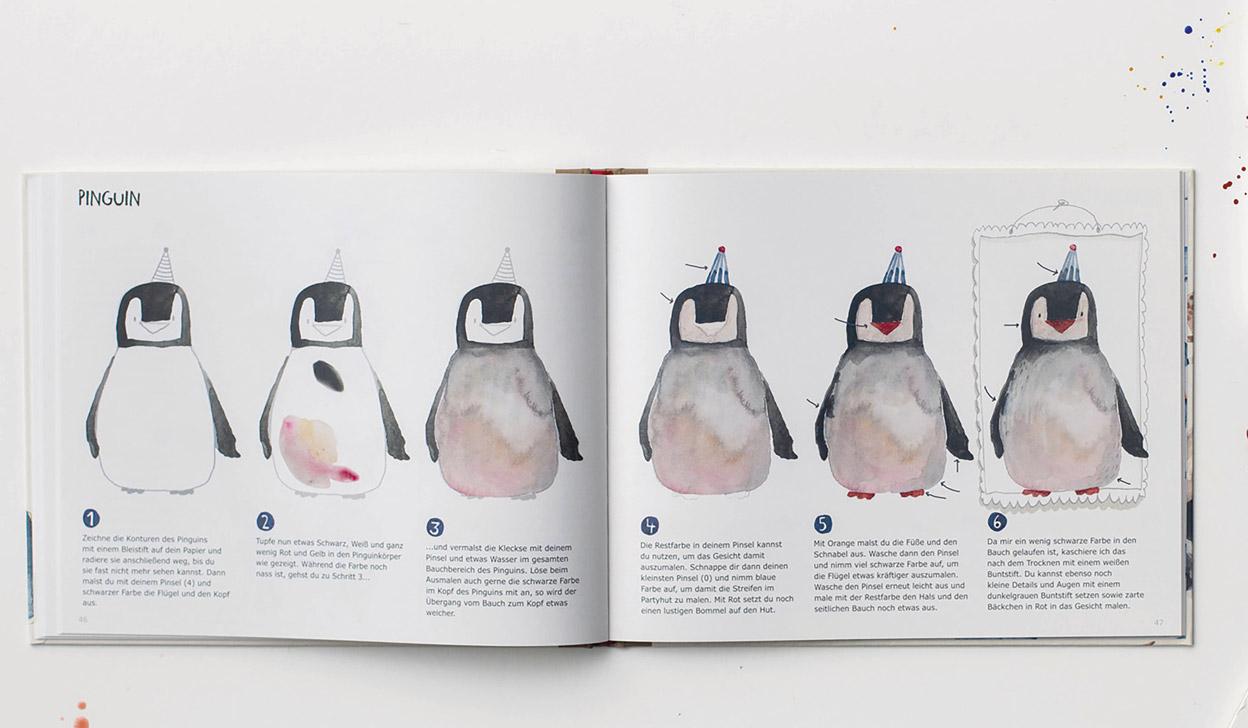
dass zu große Bäuche oder zu kurze Beine absolut salonfähig sind und dass Perfektion keinen Charakter hat – Scheppness aber schon.
Am Nachmittag bei der Wanderung durch den Wald grübelte ich über einen Titel (meine Familie hat mich verflucht, weil ich ständig laut vor mich hinbrabbbelte) bis es endlich rauskam: Mal mit mir ein Krummtier.
Die Geburtsstunde!
Das Buch schlug ein und hat so manch einem Kind und Erwachsenen gezeigt, dass es kein „Ich kann nicht malen“ gibt. Es gibt nur ein „ich weiß noch nicht wie“. Und weil ich einfach schon sehr lange mit Wasserfarben illustriere und es liebe, jedem Tier so Leben einzuhauchen und es zu Charakteren mit Namen zu machen, entschied ich, das ebenfalls an andere weiterzugeben. Und so entstand zwei Jahre später die „Aquarellier mit mir ein Krummtier“-Version.
K+M: Wie lautet dein pädagogischer Ansatz? An wen richtest du dich mit den Büchern?
R.Z.: Haha! Ich muss lachen! Denn wenn ich eines NICHT bin, dann pädagogisch. Ich habe einfach einen argen innerlichen Antrieb, andere Menschen anzustecken mit Dingen, die mich wirklich glücklich machen. Und das sind Dinge, die durch meine Hände entstehen. Allem voraus
das Malen. Durch meine Follower*innen auf Instagram und auch durch meine eigenen Kinder habe ich festgestellt, dass es für viele Menschen nicht selbstverständlich ist, etwas selbst mit den Händen zu machen. Da stecken häufig starke Selbstzweifel in vielen. Sei es aus Angst vor Perfektion, dem Versagen, dem Nicht-Wissen-wo-anfangen … Ich weiß gar nicht, warum es diesen Menschen so geht, aber das spielt eigentlich auch gar keine große Rolle, denn ich weiß, wie man so etwas überwindet – nämlich durch Machen! Durch Scheitern, Dazulernen und Wiederholen.
Um die erste Hürde dieses Anfangens zu nehmen, habe ich begonnen, unkonventionelle Bücher zu machen. Sie richten sich an alle, die Dinge nicht mit dem Kopf, sondern mit den Fingern angehen wollen. Frei von Perfektion und frei von irgendwelchen Normen. Dafür aber mit einer verdammt großen Portion Charakter, Scheppness, Freude und Mut.
K+M: Abgesehen von der Technik selbst: Inwiefern unterscheiden beziehungsweise ergänzen sich die beiden Bücher? Und was hat es mit den unterschiedlichen Formaten auf sich?
R.Z.: Die Bücher unterscheiden sich abgesehen von der Technik durch den Schwierigkeitsgrad voneinander. „Mal mit mir ein Krummtier“ ist sozusagen das Einsteigerbuch. Sobald du einen Stift halten kannst und
etwas damit anzufangen weißt, ist das Buch geeignet (wir haben mit 3 Jahren begonnen). Es startet ganz am Anfang, ganz vorne. Es macht sozusagen Mut. Und hat man dadurch dann entdeckt, dass man ein kleiner Picasso oder eine kleine Picassine ist, kann man zu „Aquarellier mit mir ein Krummtier“ übergehen und die Tiere mit Wasserfarben so richtig zum Leben erwecken, sie weiterdenken. Das ist kein Muss, aber vielen macht es Freude, ihre Krummtiere weiterzuentwickeln.
Im ersten Band ist das Format relativ lang, da ich wollte, dass die ersten wundervollen Kreationen, die entstehen, wie in einer Art Erinnerungsbuch für die Ewigkeit festgehalten sind. Man malt deshalb direkt ins Buch auf der rechten Seite. Ich weiß, das finden viele befremdlich, aber ich kann aus Erfahrung sagen: „Wenn man in ein paar Jahren reinschaut, ist das unglaublich toll – und kein loses Blattwerk dieser Welt würde man so lange aufheben wie die „Krummtier-Bibel“ ;).
Die Aquarell-Version ist dahingehend etwas kürzer, da man nicht direkt ins Buch malt. Dafür kann man es ausgeklappt gut vor sich auf den Tisch legen um nachzumalen.
K+M: Am Anfang war welches Krummtier?
R.Z.: Man ahnt es ja fast: Dackel Detlef. Er war der erste und er ist das meistgemalte Motiv seit jeher. Er ist einfach zum Knutschen in seiner Wurstform, egal ob dick oder dünn, den nimmt jeder mit nach Hause.
K+M: Dackel Detlef ist ikonisch, heißt es im Buch „Mal mit mir ein Krummtier“. Wie kam es dazu? Und gibt es noch andere bemerkenswerte Tierfiguren?
R.Z.: Ich weiß gar nicht mehr, wann der erste Dackel entstand, aber er begleitet mich seit Jahren. Ob als Kuscheltier, Rassel, Bettwurst, Patch, Brettchen, Bügelbild, Sticker … Dackel Detlef hat im Sturm die Herzen erobert und er ist von halfbird nicht wegzudenken. Wir haben aber auch noch andere Best Buddies für Detlef kreiert, es gibt Gans Gerda, Maik den Marienkäfer, Helge das Eichhörnchen, die Neintagsfliege, Fred Fuchs, Krokodil Kordula, Erdmännchen Schorsch, Spacehorn Sibill …
K+M: Was bedeutet eigentlich der Verlagsname halfbird? Er erzeugt ja eine Vorstellung, aber ...
R.Z.: Seit etwas mehr als 20 Jahren male ich. Und es gab mal eine Phase – ich nennen sie liebevoll „die Zwangsneurose“ (bitte nicht wörtlich zu nehmen ;-)), da habe ich monatelang Halbvögel gemalt. Runder Körper, lange Stummelbeinchen, kleiner Schnabel. Ich konnte nichts anderes malen. Es war grotesk :D und damals schwor ich mir, sollte ich jemals ein Unternehmen gründen, ich werde es „halfbird“ nennen. 2014 war es dann soweit.
K+M: Liebe Ramona, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Wir wünschen dir und uns noch viele schöne Krummtier-Bücher!#
Sie sind anrührend, bezaubernd, charakterstark, lustig, aus der Form geraten und immer wiedererkennbar: Krummtiere. So nennt Ramona Zirk ihre charmanten Tierzeichnungen und -aquarelle. Mit ihrer Hilfe ermuntert die Illustratorin Kinder und Eltern dazu, einfach draufoszumalen.
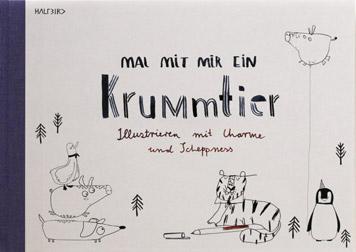

Mal mit mir ein Krummtier
Ramona Zirk, 84 S., zahlr. Abb., 30 x 21,5 cm, Halbleinen, dt., Halfbird 2022, ISBN 9783000714702, EUR 29,90 (D), EUR 29,90 (A)
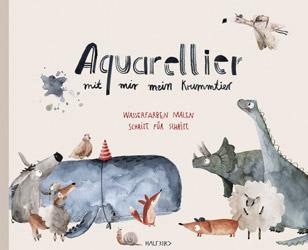

Aquarellier mit mir mein Krummtier
Ramona Zirk, 76 S., zahlr. farb. Abb., 26,5 x 21,5 cm, Halbleinen, dt., Halfbird 2024, ISBN 9783000759598, EUR 29 ,90 (D), EUR 29,90 (A)
Das Who’s Who der Collage-Technik
Ein Überblick über die aktuelle Praxis
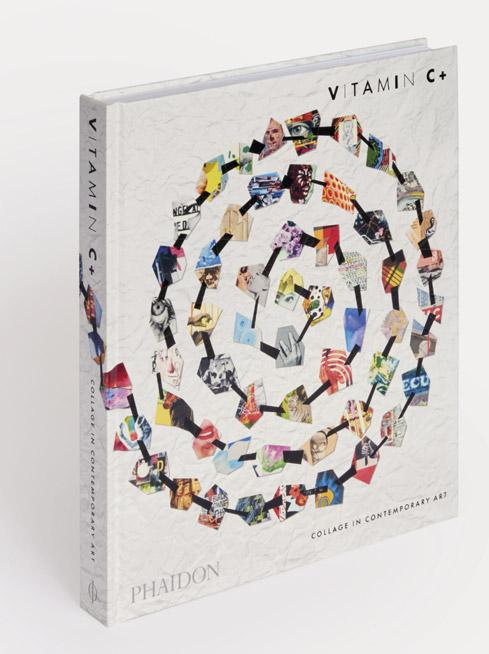
Vitamin C+. Collage in Contemporary Art
304 S., 560 Farbabb., 25 x 29 cm, geb., engl., Phaidon Verlag 2023, ISBN 9781838665579, EUR 59,95 (D), EUR 59,95 (A)
Die Collage ist eine experimentelle künstlerische Ausdrucksform. Seit ihren Anfängen bis zur heutigen digitalen Zeit steht die facettenreiche Kunst für kreative Freiheit. Aus vorgefundenen Bildern entstehen durch Schneiden, Reißen und Kleben fragmentarische Formen. Seit einiger Zeit hat diese Technik das Spektrum ihrer Möglichkeiten um textile Materialien und digitale Manipulation erweitert. Die Collage ist beliebt und erlebt weltweit ein Revival. „Vitamin C+. Collage in Contemporary Art“ schaut über den Tellerrand und stellt 108 Kunstschaffende aus 40 Ländern vor, die diesen dynamischen und experimentellen Ansatz der Bildgestaltung neu entdecken. Eine wertvolle Quelle der Inspiration.
Für Yuval Etgar, Experte für die Kunst der Collage, ist diese Technik, die seit der Erfindung des Papiers in vielen Kulturen traditionell vornehmlich im Handwerk angewendet wurde, „ein Synonym für Ärger“, denn sie ist von einer langen Geschichte von Handlungen geprägt, die Grenzen überschreiten: Schneiden, zerreißen, stehlen, vertuschen, vortäuschen … bei der Collage bedienen sich die Kunstschaffenden mit großer Selbstverständlichkeit der Arbeit anderer und fügen die Versatzstücke zu eigenen Werken zusammen. Das ist bis heute nicht unumstritten. Sicher hingegen ist: Die Collage bricht mit der Erwartung, dass Dinge vollständig und perfekt in einem Stück sein müssen.
Diese Eigenschaft nutzten erstmals die Künstler*innen des Kubismus, Dadaismus und Surrealismus, als sie im Europa des frühen 20. Jahrhunderts mit Medien wie Fotografie und Druckerzeugnissen zu experimentieren begannen und damit die traditionellen Bildherstellungstechniken erweiterten. Picasso, Georges Braque, Hannah Höch und Kurt Schwitters schufen dynamische und experimentelle visuelle Formen, die den Geist des modernen Lebens einfingen, indem sie buchstäblich Elemente des realen Lebens in sie einbauten.

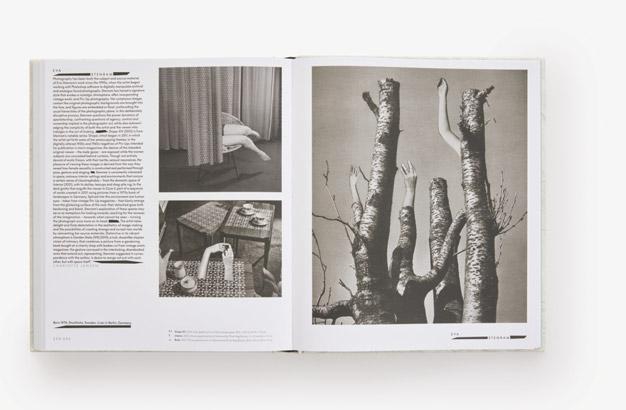
Im 21. Jahrhundert arbeiten zahlreiche Collagenkünstler*innen nach wie vor mit den Techniken und Werkzeugen, die ein Jahrhundert zuvor zum Einsatz gekommen sind: Sie sammeln Elemente aus gefundenen, gedruckten Bildern und Ephemera, die dann physisch ausgeschnitten und zusammengeklebt werden, um etwas Neues zu schaffen. Das zeigen Künstler*innen wie Linder, Christian Marclay, Wangechi Mutu, John Stezaker, Mickalene Thomas oder Kara Walker.
Sie werden allesamt in „Vitamin C+. Collage in Contemporary Art“ als führende Pioniere der Collage vorgestellt. Die englischsprachige Publikation aus dem Phaidon-Verlag stellt 108 zeitgenössische Kunstschaffende aus 40 Ländern vor, die die Collage als zentralen Bestandteil ihrer visuellen Kunstpraxis einsetzen. Die Auswahl erfolgte durch eine vielköpfige internationale Jury nach weit gefassten Kriterien, die von analogen Cut-and-PasteKompositionen und Fotomontagen bis hin zu digital komponierten Bildern und Animationen reichen. Daraus ist ein umfassender Überblick über die aktuelle Praxis der Collagetechnik entstanden, der von einem aufschlussreichen Text des Kurators und Kunsthistorikers Yuval Etgar eingeführt wird.
Neben namhaften Kunstschaffenden, die mit innovativen Arbeiten bereits Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, werden in dem Buch auch Werke weniger bekannter Künstler*innen vorgestellt, die größeres Augenmerk verdienen. Einige der Kunst-
schaffenden, die in „Vitamin C+“ in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt werden, haben die Collage zu politischen Zwecken eingesetzt, um auf soziale Missstände wie Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern oder Rassen, Klimawandel und Krieg hinzuweisen, so etwa Peter Kennard, Justine Kurland und Deborah Roberts. Andere interessieren sich mehr für das ästhetische Potenzial der Collage, indem sie Materialien mit unterschiedlichen Texturen, Mustern und Tiefen nebeneinanderstellen, um abstrakte und taktile Kompositionen zu schaffen, wie Njideka Akunyili Crosby, Dexter Davis und Georgie Hopton.
Heutzutage können Kunstschaffende wie Lorna Mills, Heather Phillipson und Tabita Rezaire auch digital arbeiten. Sie erzeugen am Computer Standbilder aus Fragmenten, die zunächst am Bildschirm arrangiert und anschließend gedruckt werden – oder sie fügen einzelne Elemente zu bewegten Bildern zusammen, die dann als Video oder Animation ausgegeben werden.
„Vitamin C+“ zeigt, dass die Collage mehr ist als eine einfache Technik des Ausschneidens und Einfügens von Papier, sondern vielmehr ein Ansatz zur Bedeutungsfindung. Die Praxis ist durch einen kontinuierlichen Prozess definiert, der die Grenzen des künstlerischen Spektrums und des visuellen Feldes herausfordert. Mit fragmentarischen Formen und unerwarteten Gegenüberstellungen ist „Vitamin C+“ eine frische, dynamische und sehr zeitgemäße Übersicht.#
Abbildungen mit Seiten zu den Künstlerinnen Deborah Roberts (links) und Eva Stenram (rechts) aus dem Innenteil des Buches, © Phaidon Verlag 2023.
Yōkai – Geistwesen in japanischen Farbholzschnitten
Yōkai-Geister sind ein wichtiger Aspekt der japanischen Kultur. Furchterregend, grausam, verspielt oder schelmisch können sie verschiedene Formen annehmen: So manifestieren sie sich beispielsweise als verzweifelte Gespenster, die einen Platz im Jenseits suchen, oder als Gestaltwandler, die die Menschen mit List und Grausamkeit austricksen.
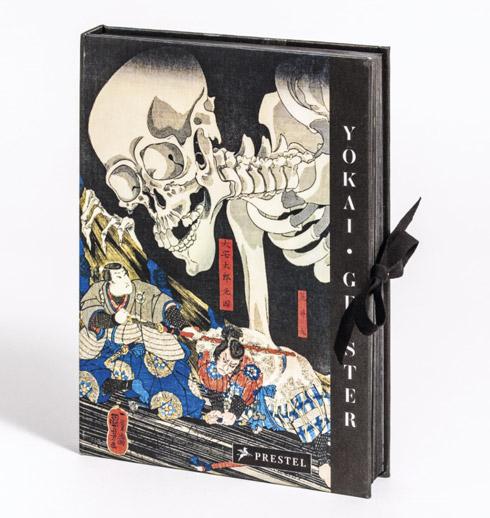
Yokai – Geister
Philippe Charlier, 192 S., durch. farb. Abb., 16,1 x 22,6 cm, geb. m. Verschlussbändchen, dt., Prestel 2025, ISBN 9783791377933, EUR 32,0 0 (D), EUR 32,90 (A)
Abbildungen aus dem Innenteil des Buches, © Penguin Random House 2025
Unter dem Titel „Yōkai – Geister“ ist im Frühjahr dieses Jahres im Prestel Verlag ein außergewöhnlich schön aufgemachtes Buch erschienen, das sich diesem Aspekt der japanischen Kultur widmet. In 150 Farbholzschnitten von namhaften Künstlern wie Hokusai, Hiroshige oder Utamarō, fängt es die Essenz der YōkaiVorstellungen mit verblüffenden Details und in stimmungsvollen Bildern ein.
Die Vorstellung von einer Anderswelt variiert je nach Kultur. In der japanischen Volkskultur ist es das Reich der Geister, Monster und Dämonen, das besonders vielfältig in Erscheinung tritt. Hier tummeln sich Yōkai, Kreaturen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Sie werden mit unerklärlichen Geschehnissen und Phänomenen assoziiert und nehmen unheimliche oder geradezu skurrile Formen an.
Manche haben tierische Züge, andere ähneln Menschen. Manche sind scheu und leben an abgelegenen Orten, andere sind in menschlichen Siedlungen zu Hause. Es gibt Yōkai, die gerne Streiche spielen und andere, die Unheil und Tod bringen. Menschliche Waffen können ihnen nichts anhaben, nur buddhistische Mönche oder shintoistische Exorzisten können sie vertreiben.
Geister von Verstorbenen gehören innerhalb der Yōkai zur Kategorie der Totenseelen (Yūrei). Sie zeigen sich nur selten. Und sie haben keine Beine. Ihr Körper endet meist auf Höhe der Knie, „vielleicht als Indiz für ihre ätherische Erscheinung als fliegender
Geist“, vermutet der Autor der Publikation, Philippe Charlier. „Manchmal schweben rings um die Yūrei fahle Flammen. Diese kärglichen Fackeln oder Irrlichter künden vom Erscheinen des Geistes und von seinem Rachedurst“, stellt der Autor fest.
Es war der Maler Maruyama Oyuki (geb. 1722), der eine Möglichkeit fand, solch „körperlose Wesen im Bild festzuhalten und mit der Welt der Lebenden zu verbinden“, erklärt Charlier und fährt fort: „Mit Abbildern japanischer Geister, die er akribisch als le bensgroße Rollbilder darstellte, öffnete er die Pforten zu einer übernatürlichen Welt, durch die Lebende und Tote nun miteinander in Kontakt treten können, und löste damit eine regelrechte Modewelle aus.“
Andere Gestalten mit unheimlichen Kräften und paranormale Phänomene gehören ebenfalls zu den Dämonen, Fabel- und Spukwesen (Yōkai). Sie können bösartig, doch auch hilfsbereit, glücksbringend oder beschützend sein. In seiner Publikation verweist Philippe Charlier auf 15 unterschiedliche Yōkai-Wesen, von der Schneefrau, „Yuki-Onna“, über „Fliegende Köpfe“ und das „Lächeln des Todes“ bis hin zu den „Dämonen der Schlachtfelder“.
Schon immer haben Erfahrungen wie Angst, Ehrfurcht oder Überraschung Menschen zu Geschichten animiert. Solche Erzählungen waren ab dem 16. Jahrhundert in Japan ein beliebtes Motiv von Bildergeschichten. Diese waren so beliebt, dass sie in Massen produziert wurden und somit auch für Bauern und einfache Stadtbewohner*innen erschwinglich waren. Vor allem die Künstler der Edo-Zeit (1600–1868), die bei der bildlichen
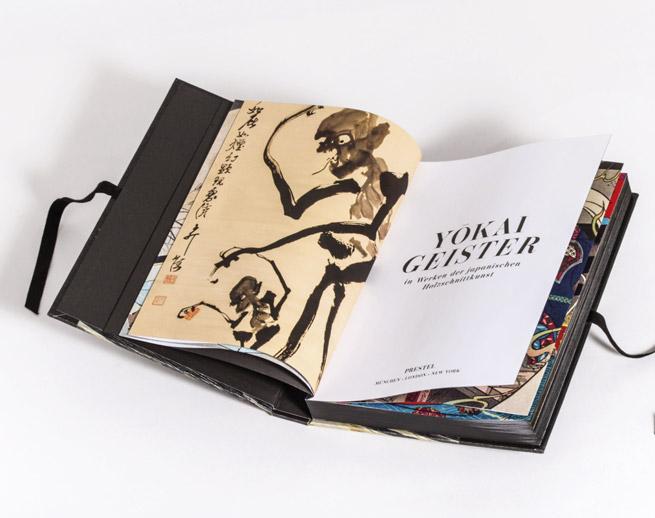
Gestaltung der Monster ihrer Fantasie freien Lauf ließen, prägen die Vorstellungen von Yōkai bis heute.
Nach der Edo-Zeit erlebten Yō kai in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen erneuten Popularitätsschub, der bis heute anhält. Ob in Anime-Klassikern wie „Prinzessin Mononoke“ (1997) und „Chihiros Reise ins Zauberland“ (2000), in J-HorrorFilmen wie „Ringu“ (1998) oder „Ju-On: The Grudge“ (2002): Überall findet man Spuren der übernatürlichen Wesen.
Yōkai sind ein Spiegel der menschlichen Existenz und werden ständig neu erfunden, stellt der Japanologe Michael Foster fest. Schon der Zeichner Toriyama Seki‘en, der während der Edo-Zeit Bildbände mit „Yōkai-Paraden“ erschuf, beschränkte sich dabei nicht auf die bereits bekannten, sondern fügte dem unheimlichen Reigen eigene Kreationen hinzu.
Der Autor und Gerichtsmediziner Philippe Charlier erzählt profund und unterhaltsam in jedem Kapitel seines Buches die dramatischen Geschichten der verschiedenen Geistwesen und ordnet sie in den kulturhistorischen Kontext ein – inklusive der anschaulichen Beschreibung einer Geisterbeschwörung.
Das abbildungsreiche Buch zeigt beeindruckende Holzschnitte und ist mit einer besonderen Bindung, unbeschnittenen Seiten mit schwarzem Farbschnitt und einem Verschlussbändchen liebevoll ausgestattet. Es wird Japanfans, Anime- und MangaEnthusiasten sowie Liebhaber des japanischen Holzschnitts gleichermaßen begeistern.#
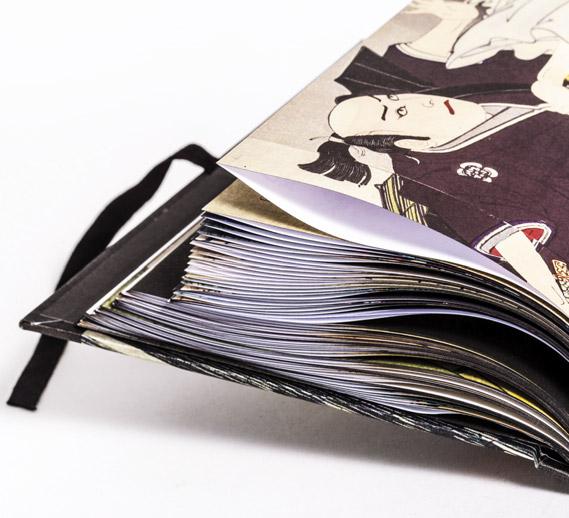
Die Farben der Kunst
Eine Farbe je Buch – anhand unterschiedlicher Kunstwerke vielfältig beleuchtet.
Unterhaltsam und kenntnisreich lädt die Kunsthistorikerin und Autorin Hayley Edwards-Dujardin dazu ein, unterschiedliche Farben zu entdecken. Eine präzise Auswahl an zahlreichen bekannten und unerwarteten Werken aus der Kunst lassen Leserinnen und Leser mithilfe fundierter Texte in einen Dialog mit den Epochen treten. Chronologien, Karten und Grafiken sowie zahlreiche Infoboxen mit Anekdoten und Hintergrundinfos decken die Bedeutung und den Facettenreichtum der jeweiligen Farbe auf.#
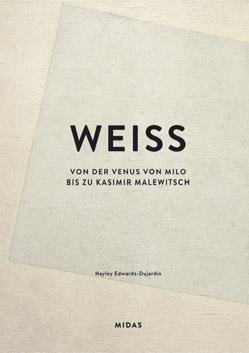

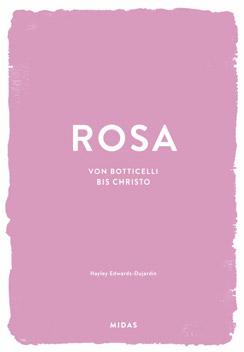
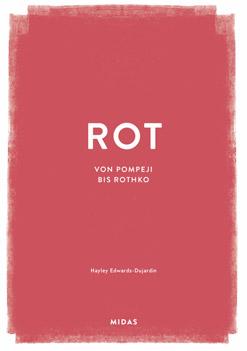
Rosa
Von Botticelli bis Christo
Hayley Edwards-Dujardin, 112 S., durchg. farb. bebildert, 17 x 24 cm, geb., dt., Midas 2023, ISBN 9783038762423, EUR 22,00 (D), EUR 22,70 (A) , CHF 28,00 (CH)

Rot
Von Pompeji bis Rothko
Hayley Edwards-Dujardin, 112 S., durchg. farb. bebildert, 17 x 24 cm , geb., dt., Midas 2024, ISBN 9783038762874, EUR 22,00 (D), EUR 22,70 (A) , CHF 30,00 (CH)

Weiss
Von der Venus von Milo bis zu Kasimir Malewitsch
Hayley Edwards-Dujardin, 112 S., zahlr. farb. Abb., 17,3 x 24,5 cm, geb., dt., Midas 2024, ISBN 9783038763048, EUR 22,00 (D), EUR 22,70 (A) , CHF 30,00 (CH)
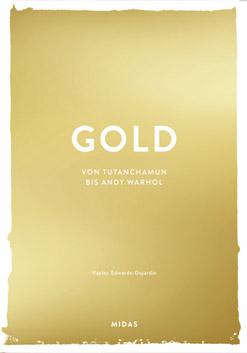

Gold
Von Tutanchamun bis Andy Warhol
Hayley Edwards-Dujardin, 108 S., durchg. farb. bebildert, 17 x 24 cm, geb., dt., Midas 2023, ISBN 9783038762652, EUR 22,00 (D), EUR 22,70 (A) , CHF 28,00 (CH)
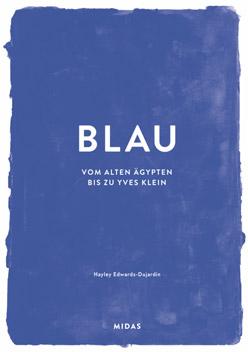

Blau
Vom alten Ägypten bis zu Yves Klein
Hayley Edwards-Dujardin, 112 S., durchg. farb. bebildert, 17 x 24 cm, geb., dt., Midas 2022, ISBN 9783038762294, EUR 22,00 (D), EUR 22,70 (A) , CHF 30,00 (CH)
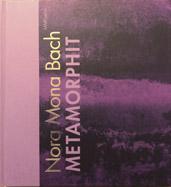

Nora Mona Bach Metamorphit
120 S., 50 Abb., 24 x 26 cm, geb., dt./engl., MMKoehn Verlag 2024, ISBN 9783910640009, EUR 32,00 (D), EUR 32,90 (A)
„Kohle ist eines der ältesten Mal- und Zeichenmittel der Menschheit, diente dann aber lange nur als billiges Arbeitsmittel, um Malereien vorzubereiten, weil man das Material leicht korrigieren kann. Das, was Nora Mona Bach macht, habe ich noch nie gesehen.“ (Kristina Bake)
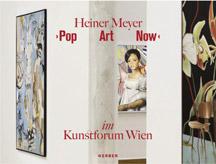

Heiner Meyer Pop Art Now
Studio 66 (Hrsg.), 120 S., 198 Abb., 30,5 x 23 cm, geb. m. SU, dt./engl., Kerber Verlag 2024, ISBN 9783735609724, EUR 45,00 (D), EUR46,40 (A)
Heiner Meyer verwendet die Strategien der Pop-Art und kombiniert Bildmaterial aus den unterschiedlichsten Kontexten. In seinen Gemälden verdichten sich Comicfiguren, Kompositionen von Picasso oder Hockney und Werbung für Luxusmarken zu einem neuen Bildganzen mit vielfältigen Reflexionsangeboten.

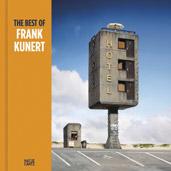
The Best of Frank Kuhnert
120 S. , zahlr. farb. Abb., 22,6 x 22,7 cm, geb., dt./engl., Hatje Cantz 2025, ISBN 9783775759274, EUR 24,00 (D), EUR 25,00 (A)
Das Hinterfragen der Conditio humana dient dem Künstler als ständige Antriebsfeder, um seine ganz eigenen Interpretationen der Welt in Miniaturmodelle zu übersetzen und diese fotografisch festzuhalten. Kunerts Konstruktionen enthalten intelligente Beobachtungen über die Balanceakte des Lebens und das Skurrile im Alltäglichen.

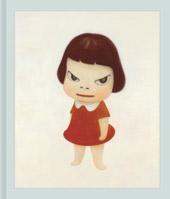
Yoshitomo Nara
Daniel Zamani (Hrsg.), 224 S., 21,5 x 24,7 cm, geb., dt., Hatje Cantz 2024, ISBN 9783775759298, EUR 44,00 (D), EUR 46,00 (A)
Der Katalog zeigt Werke von Yoshitomo Nara aus vier Jahrzehnten. Mit seinen „Angry Girls“ erlangte er internationale Bekanntheit: Die stark stilisierten Mädchendarstellungen, die mit großen Köpfen und fesselnden Augen oftmals bedrohlich, trotzig und wütend oder auch melancholisch wirken, sind zu Ikonen der zeitgenössischen Malerei geworden.
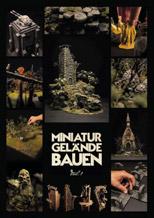

Miniaturgelände bauen – Vol. 1
Philipp Preiser, Marina Preiser, 230 S., zahlr. farb. Abb., 21 x 29,7 cm, geb., dt., Preiser 2023, ISBN 9783000758980, EUR 49,00 (D), EUR 50,40 (A)
Dieses Buch handelt von etwas Großartigem: dem Erschaffen von Miniaturwelten. Es soll begleiten, inspirieren und motivieren. Es möchte helfen, Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Anhand ausgewählter Projekte und mithilfe von Templates werden Techniken erläutert, mit denen man faszinierende Gelände für Tabletop-Spiele basteln kann.


Frauen in der Kunst
Flavia Frigeri, 176 S., 100 Abb., 13,8 x 21,6 cm, Klappenbroschur, dt., Midas 2019, ISBN 9783038761495, EUR 17,90 (D) , EUR 18,50 (A), CHF 25,00 (CH)
In diesem Buch untersucht Flavia Frigeri Leben und Werk von über 50 herausragenden Künstlerinnen in unterschiedlichen Kunstbereichen vom 16. Jh. bis heute. Dazu gehören Persönlichkeiten wie Artemisia Gentileschi, Georgia O’Keefe, Louise Bourgeois u.v.a.
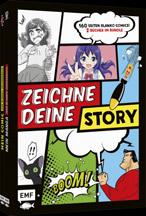

Zeichne deine Story
160 S., 2 Bücher im Bundle, 21 x 29,7 cm, geb., dt., Edition Michael Fischer 2023, ISBN 9783745919592, EUR 5,99 (D), EUR 6,20 (A)
Endlich einen eigenen Comic oder Manga zeichnen?
Diese beiden genialen BlankoZeichenbücher bieten den perfekten Rahmen dafür!

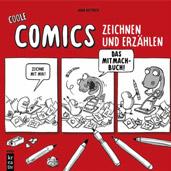
Coole Comics zeichnen und erzählen
Nina Dietrich, 120 S., zweifarb., 19 x 19 cm, geb., dt., mitp Verlag 2024, ISBN 9783747507100, EUR 14,99 (D), EUR 15,50 (A)
Du liebst Comics und möchtest gerne eigene Geschichten zeichnen und erzählen? Mit diesem Buch startest du damit durch! Viele praktische Tipps und hilfreiche Anregungen helfen beim Umsetzen deiner Ideen. Zusätzlich gibt es viele Seiten zum Üben und Platz für eigene Comics.

Unter härtesten Bedingungen
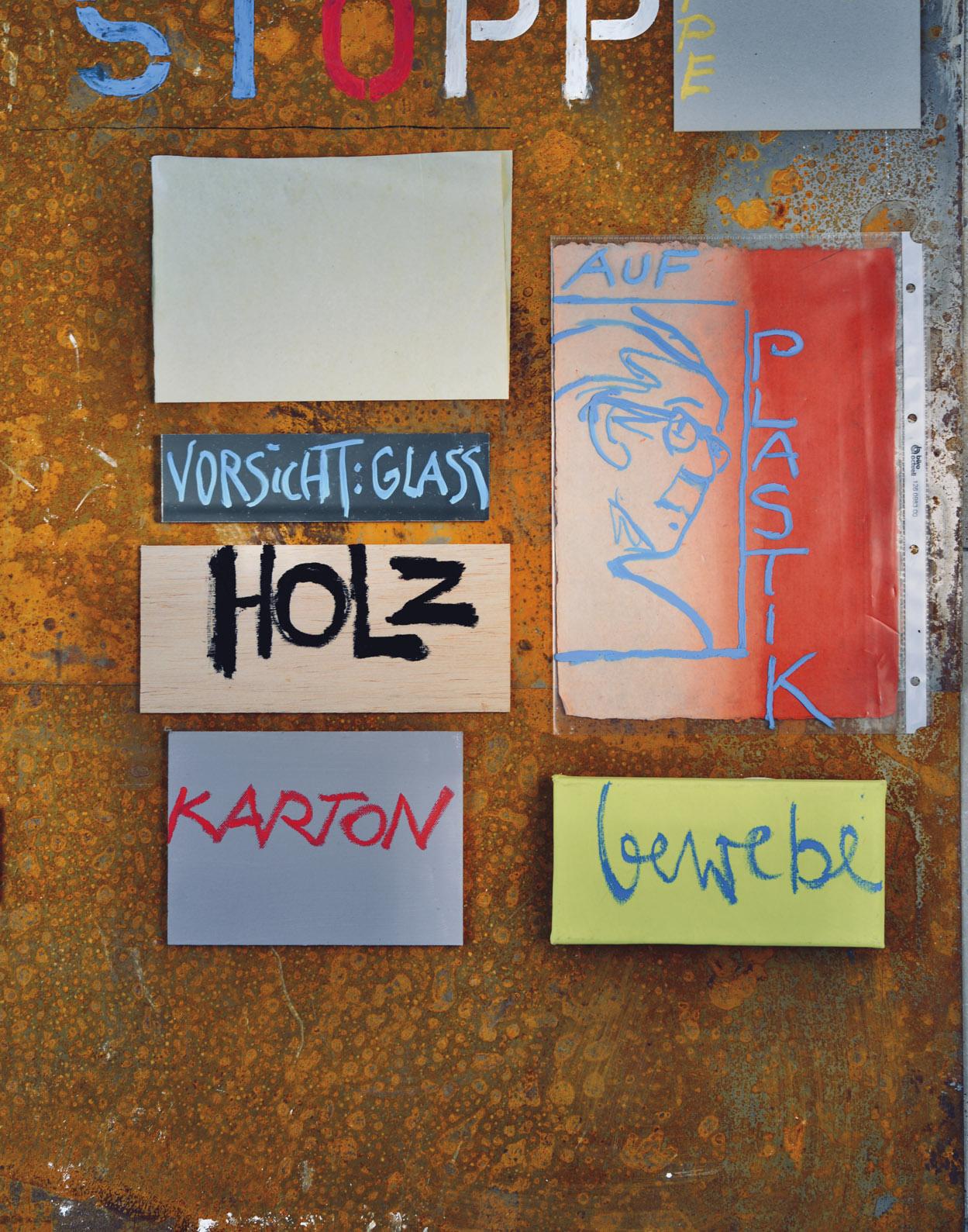

Auf rauen Oberfächen, rostigen Metallen, verschmutzten Oberfächen, sogar unter Wasser tut er noch seinen Dienst: Ursprünglich konzipiert für dauerhafte Beschriftungen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen, zeigt der Industry Painter von edding bei der künstlerischen Arbeit bisher kaum entdeckte Talente. Er gleitet glatt und zügig über nahezu alle Materialien und ist damit ideal zum Vorzeichnen oder für schnelle Skizzen geeignet. Die stark deckende Farbpaste mit wachsartiger Spitze und ca. 10 mm Strichbreite trocknet in kurzer Zeit fast überall wasserfest auf und schlägt auch bei Papier nicht durch. Ein perfekter Stift für alle Untergründe und Gelegenheiten.
Idee, Malerei, Gestaltung, Fotogra
Riepe

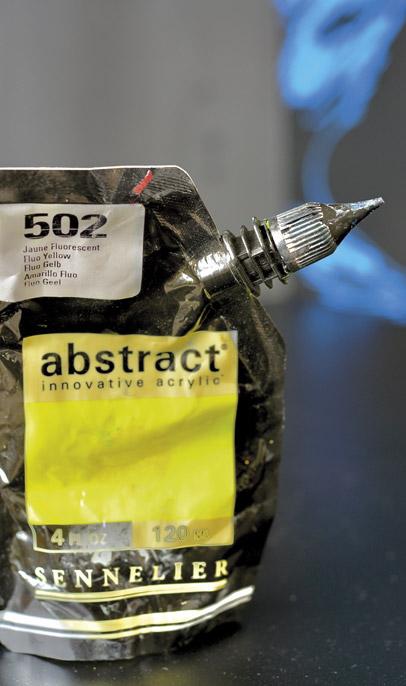



Linke Seite: boesner Henry Nero: Mischgewebe mit schwarzer Universalgrundierung, ca. 330 g/m², Rolle (2,10 x 10 m); Kapa graph Leichtstoffplatte: verfügbar in 3 Formaten. Rechte Seite (oben links): Sennelier abstract Acrylfarbe: in 60 Farbtönen erhältlich; (oben Mitte): Lascaux Acryl Studio KünstlerAcrylfarbe: in 4 Gebindegrößen und 57 Farbtönen verfügbar; (unten links): boesner Acryl Studio Marker: erhältlich in 28 Farbtönen, farblich auf das gesamte boesner Acryl Studio-Sortiment abgestimmt; Royal Talens Amsterdam Acrylic Marke: 30 Farben in Markern mit Ø 1–2 mm Strichbreite, 46 Farben in Markern mit Ø 3–4 mm Strichbreite und 20 Farben in Markern mit 15 mm Strichbreite verfügbar; (rechts): boesner Pears AluminiumWechselrahmen: verfügbar in den Ausführungen Schwarz seidenmatt, Silber matt, Weiß glanz und Platin.
Gelebte Geschichten
„Sean
Scully. Stories“ im Bucerius Kunst Forum

Markante Textur und große Formate: Charakteristisch für die Werke von Sean Scully sind der mehrschichtige, starke Auftrag von Ölfarbe, grobe Pinselstriche und vor allem ihre Dimensionen und die Schachbrett-Muster. Anlässlich des achtzigsten Geburtstags widmet das Bucerius Kunst Forum dem Künstler derzeit eine umfassende Retrospektive, die Werke aus sechs Jahrzehnten seines Schaffens präsentiert. In der Ausstellung werden seine ikonischen Gemälde zusammen mit Entdeckungen und Experimenten, zum Beispiel in der Fotografie Scullys seit den 1960er-Jahren, gezeigt. Die Besuchenden erwartet eine Zeitreise durch die Jahrzehnte, die verdeutlicht, wie sich der Werdegang eines Künstlers durch persönliche Schicksalsschläge, politische Entwicklungen und künstlerische Strömungen verändert. Der Charakter einer Retrospektive macht sichtbar, wie Scully stets neue Ausdrucksformen nutzt: Während er in den 1960er-Jahren noch figurativ, sprich erkennbare Gegenstände, Orte und Personen malte, entwickelte er sich über die Hard-Edge-Bewegung mit scharf abgegrenzten Farbflächen zu einem der bedeutendsten ungegenständlichen Künstler*innen der Gegenwart. Die Ausstellung präsentiert neben bekannten Gemälden Scullys einige Wiederentdeckungen, vor allem aus seinem bislang selten ausgestellten Frühwerk.
[1] Sean Scully in Sean Scully. Stories, Bucerius Kunst Forum, Foto: Ulrich Perrey.

Sean Scully wurde 1945 in Dublin geboren und ist im Süden von London aufgewachsen. 1960 beginnt er dort eine Ausbildung zum Setzer in einer Druckerei. Schon zwei Jahre später besucht er Abendkurse an der Central School of Art and Design in London, wobei sein Interesse zunächst der figürlichen Malerei gilt. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit verschiedenen Tätigkeiten, zeitweise unterhält er einen eigenen Musikclub. Im Jahr 1965, dem Geburtsjahr seines Sohnes Paul, nimmt Scully ein Studium der Malerei am Croydon College in London auf. Aufgrund des gestiegenen Interesses an gegenstandsloser Malerei und der Auseinandersetzung mit der Op-Art wechselt er 1968 zur Newcastle University in Newcastle upon Tyne, die er 1972 mit dem Bachelor of Arts verlässt.
Eine erste Reise nach Marokko 1969 gilt mit ihren Inspirationen aus Licht, Farben und Mustern in Textilien als Wendepunkt in seinem Schaffen. Während eines ersten längeren Aufenthalts in den USA beginnt Sean Scully 1973/73, mit Tape und Sprühfarbe zu experimentieren. Schon in jenen Jahren sind seine Werke von horizontalen und vertikalen Streifen geprägt. 1973 folgt die erste große Einzelausstellung in der Rovan Gallery, bei der alle Werke verkauft werden. 1975 zieht er als Harkness Fellow nach New York City – und die Auseinandersetzung mit der Minimal Art ermutigt ihn zu einer Vereinfachung seiner Formensprache. Doch seit 1981 wendet er sich zunehmend davon ab – statt mit Klebestreifen arbeitet er nun frei Hand mit breiten Pinselstrichen und nutzt zunehmend wärmere Farben. In einem ausführlichen
Ausstellungsansicht:
[2]
Sean Scully. Stories, Bucerius Kunst Forum, Foto: Ulrich Perrey.
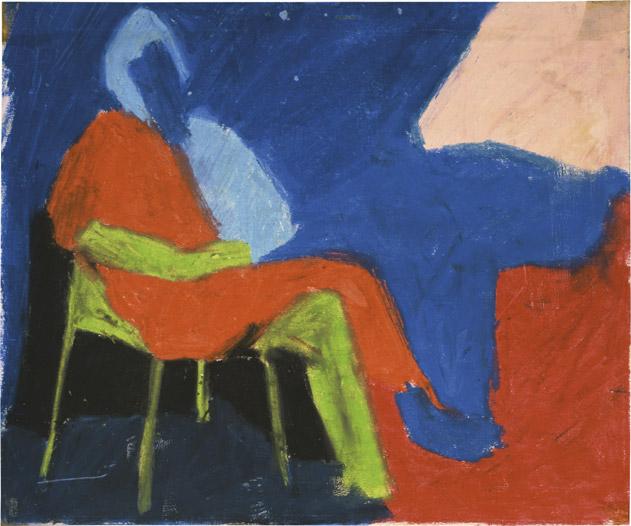
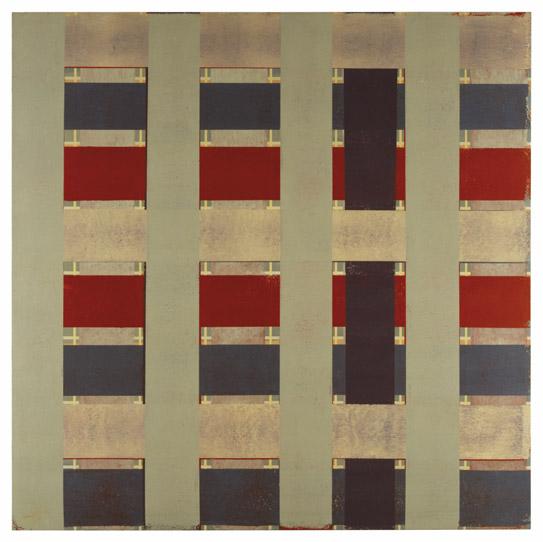
Interview, das Ausstellungskuratorin Kathrin Baumstark mit Sean Scully führte und das in voller Länge im Ausstellungskatalog abgedruckt ist, erinnert sich der Künstler an jene Jahre des Wandels: „Also dachte ich: Entweder ich lasse die Abstraktion zugunsten der Figuration fallen – was ich konnte, weil ich ja ein konvertierter figurativer Maler bin. Oder ich male abstrakte Bil der, wie ich früher figurative Bilder gemalt habe. Und das war’s. Es war überhaupt nicht kompliziert. Es war ganz einfach und direkt. Ich begann also, meine Bilder mit Bezügen zu füllen, in Farben zu schwelgen, schwierige Farben in Beziehung zu setzen, dazu eine sehr kraftvolle Pinselführung und emotionale Titel. Im Grunde habe ich meine abstrakte Malerei in einen sehr emotionalen Bereich verschoben.“
1983 stirbt sein 19-jähriger Sohn Paul bei einem Autounfall in London. Im gleichen Jahr erhält Scully das Guggenheim- und das National Endowment for the Arts-Stipendium und wird amerikanischer Staatsbürger. Das Jahr 1984 gilt als internationaler Durchbruch – seinem Werk werden viele Ausstellungen gewidmet und zahlreiche Arbeiten werden durch renommierte Museen angekauft.
Ende der 1980er-Jahre führen ihn mehrere Reisen nach Mexiko. Es entstehen Aquarelle und Grafiken, und ein neuer thematischer Schwerpunkt werden Malereien zu Architektur und Licht, erstmals auch auf Aluminium als Malgrund. Mitte der 1990er-Jahre richtet sich Scully ein Atelier in Barcelona ein. Seit 2013 Mitglied der Royal Academy of Arts (London) und mit verschiedenen Ehrendoktorwürden ausgezeichnet, lebt und arbeitet er zwischen New York, London und Mooseurach. Seine Verbindung mit Deutschland prägte vor allem seine Lehrtätigkeit an der Akademie der Bildenden Künste München von 2002 bis 2007. 2014 war er der erste westliche, ungegenständlich arbeitende Künstler, dem in China eine Retrospektive gewidmet wurde.
Verbunden mit Geschichten und Anekdoten zu seinen Werken zeigt nun die Ausstellung im Bucerius Kunst Forum, dass die Kunst Scullys trotz ihres ungegenständlichen Charakters nicht unnahbar ist, sondern Geschichten erzählt und bei den Betrachtenden Emotionen und Erinnerungen weckt. So begegnen die Besuchenden in der Ausstellung Kindheitserinnerungen, dem Erleben von zentralen politischen Ereignissen und Reiseeindrücken des Künstlers. Die Themen Scullys sind geprägt von einer tiefen
[3] Man in Chair I, 1966, Privatsammlung, © Sean Scully. Foto: courtesy of the artist.
[4] Crossover Painting #1, 1974, Privatsammlung, © Sean Scully. Foto: courtesy of the artist.
[3]
[4]

[5] Now, 1986, Sammlung Klein, Eberdingen-Nussdorf, © Sean Scully. Foto: courtesy of the artist.



Melancholie, großer Freude sowie dem poetischen und philosophischen Nachdenken über das Menschsein, über Verlusterfahrungen und Sehnsüchte. Die Verbindung aus Kunst, von ihm verfassten Texte, zahlreichen Erläuterungen und Ton eröffnen in der Ausstellung die Möglichkeit, die ungegenständliche Malerei über individuelle Geschichten und emotionale Verbindungen zu erfahren.
Vertikale und horizontale Farbbahnen bilden seit Jahrzehnten die wiederkehrende Grundstruktur seiner Arbeiten, die er mit verschiedenen Techniken und Materialien stets neu aufgreift. Scully interpretiert die Abstraktion neu, denn für ihn ist nichts abstrakt. Für den Künstler sind die Werke Ausdruck einer Selbstwahrnehmung, sie bebildern einen inneren Zustand. Deshalb übermalt Scully bis heute einzelne Arbeiten und versieht sie mit neuer Bedeutung – auch diese sind in der Ausstellung zu sehen. Seine Fotografien von Hausfassaden, Landschaften und architektonischen Strukturen verdeutlichen die visuelle Inspirationsquelle des Künstlers. Das Abstrakte der überdimensionalen Werke wird in der Ausstellung mit Darstellungen von realen Orten kombiniert, die so als Assoziationshilfe für die Betrachtenden dienen.
[6] Untitled (Morocco), 1995, Privatsammlung, © Sean Scully. Foto: courtesy of the artist. [7] Mexico One Window Green, 2001, Privatsammlung, © Sean Scully. Foto: courtesy of the artist. [8] Blue Boy, 2019, Privatsammlung © Sean Scully. Foto: courtesy of the artist.
[6]
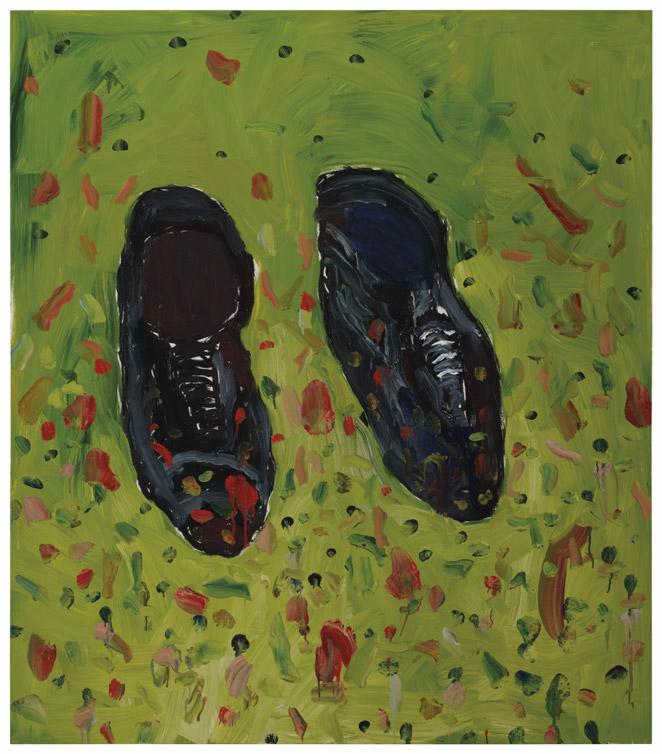
Neben zwei frei zugänglichen Skulpturen im Lichthof wird vor dem Ausstellungshaus am Alten Wall die Skulptur Air Cage des Künstlers aufgestellt. Die Bespielung der Fläche macht nicht nur die Kunst Scullys sichtbar, sondern lädt mit einer Belebung der Hamburger Innenstadt zum Verweilen ein. Die Skulptur im Freien wird als Pilotprojekt im Rahmen des Hamburger Pro gramms „Verborgene Potenziale – Gemeinschaftliche Entwicklung der Nutzungsvielfalt für eine lebendige und resiliente Innenstadt“ umgesetzt, gefördert durch das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Der Ausstellungskatalog, der im Hirmer Verlag erschienen ist, umfasst – neben dem ausführlichen Interview mit Sean Scully und einem Essay von Armin Zweite – auch sehr persönliche Betrachtungen des Künstlers zu seinen eigenen Werken.#
Sean Scullys Werk ist geprägt von tiefer Melancholie, großer Freude sowie poetischem und philosophischem Nachdenken über das Menschsein.
Ausstellung
Bis 2. November 2025 Sean Scully. Stories
Katalog
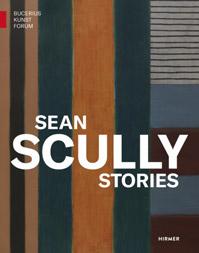

Sean Scully. Stories Kathrin Baumstark (Hrsg.), geb., 160 S. mit 100 Abb., 22,5 x 28 cm, Hirmer, ISBN 9783777444994
Kontakt
Bucerius Kunst Forum Alter Wall 12, 20457 Hamburg Tel. +49-(0)40-360996-0 www.buceriuskunstforum.de
[9] Sean‘s Shoes, 2024, Privatbesitz, © Sean Scully. Foto: courtesy of the artist.
Schattenwelten
„From Dawn Till Dusk“ im Kunstmuseum Bonn
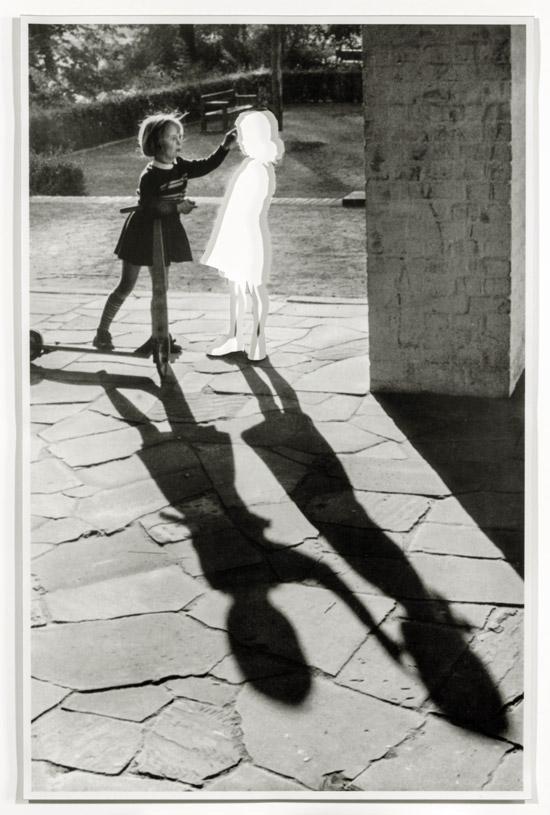
Der Schatten steht gewissermaßen am Beginn der Kunstgeschichte: In der antiken Überlieferung Plinius des Älteren ist es die Tochter des Töpfers Butades, die den Schattenumriss des Kopfes ihres Geliebten mit einem Kohlestift nachzeichnet und damit das erste Bild erschafft. Das berühmte Höhlengleichnis des griechischen Philosophen Platon wiederum grenzt die wirklichkeits-verschleiernden Schattenbilder in der dunklen Höhle vom hellen Licht der Erkenntnis ab und damit die buchstäblich schattenhafte Existenz von der wahrhaftig erleuchteten. Das Dubiose, potenziell Unheimliche begleitet den Schatten über Jahrhunderte, bevor die Romantik seine positive Dimension entdeckt und den Schatten mit der Psyche verbindet. So wird in Adelbert von Chamissos Kunstmärchen „Peter Schlemihl“ der Verlust des Schattens mit dem Verlust der Seele gleichgesetzt. Auch wenn der Schatten seit der frühen Neuzeit im Repertoire der Malerei durchaus eine Rolle spielt, wird er erst seit dem 19. Jahrhundert und der Erfindung der Fotografie sowie des Films zu einem wesentlichen Bildelement. Das Kunstmuseum Bonn zeichnet nun mit der Ausstellung „From Dawn Till Dusk. Der Schatten in der Kunst der Gegenwart“ anhand von rund 40 internationalen Positionen die Emanzipation des Schattens zu einem bildgebenden, dabei immer medienreflexiven Thema innerhalb der aktuellen Kunst nach.
[1] Hans-Peter Feldmann, Zwei Mädchen mit Schatten, 1999, Dauerleihgabe der Stiftung Kunst in Landesbesitz im Kunsthaus NRW Kornelimünster, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Hans-Peter Feldmann, Foto: Anne Gold.

„Über Jahrhunderte stand der Schatten buchstäblich im Schatten der Wahrnehmung. Die gesamte Aufmerksamkeit galt dem Licht, das spätestens seit der Aufklärung mit dem Anspruch auf umfassende Erkenntnis gleichgesetzt wurde. Insofern kann die Entwicklung zumindest unserer westlichen Gesellschaften im Großen und Ganzen als eine Geschichte gelesen werden, in der ein Mehr an Beleuchtung gleichzeitig auch zu einem Mehr an Erleuchtung führt“, so Ausstellungskurator und Intendant des Kunstmuseums Bonn Stephan Berg im Ausstellungskatalog. „Spätestens die elektrifizierte Moderne hat effizient daran gearbeitet, noch das letzte Dunkel zu vertreiben und das Leben in das gleißende Licht industriellen Fortschritts zu rücken. In den Hintergrund trat dabei, dass erst der Schatten dafür sorgt, dass die Welt um uns herum aus ihm heraus in Erscheinung tritt und durch ihn an Kontur gewinnt: Nimmt man den Gegenständen ihren Schatten, werden sie flach, verlieren an Volumen und lösen
sich gewissermaßen auf. Das Faszinierende des Schattens besteht insofern nicht zuletzt darin, dass er ‚in die physikalische Welt gehört, ohne materiell zu sein‘ und doch gerade in seiner Zwitterhaftigkeit die physische Wirklichkeit beglaubigt und visuell erfahrbar macht. Die moderne Psychologie weiß zu berichten, dass unsere heutigen Gesellschaften den Schatten nicht etwa ignorieren, sondern als selbstverständliche Erweiterung des eigenen Körpers betrachten. Indem die Wahrnehmung des Schattens die Distanz zwischen dem eigenen Körperraum und dem Raum außerhalb überbrückt, fungiert er als Brücke zwischen Körper und Welt.“
Die Bonner Intendanz von Stephan Berg endet nach 17 Jahren am Kunstmuseum Bonn im November 2025. Seine Abschiedsausstellung „From Dawn Till Dusk“ untersucht das vom Existenziellen über das Bedrohliche bis hin zum Politischen reichende
[2] Vadim Fishkin (Fiškin), Coffee and Ink, 2012, courtesy of Vadim Fishkin & Gregor Podnar, Vienna, Produktion: Association DUM / Ljubljana, Foto: courtesy of Vadim Fishkin & Gregor Podnar, Vienna.
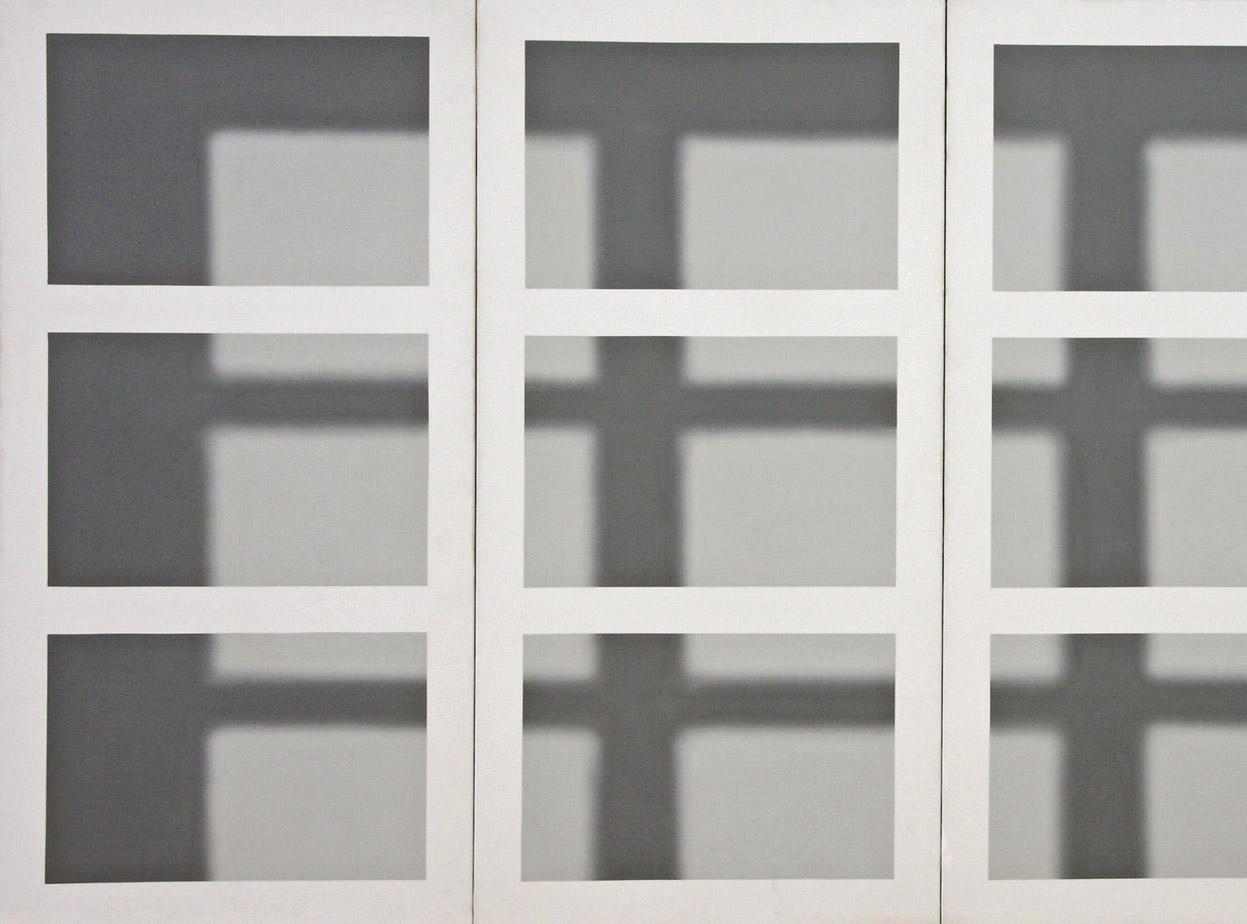
Spektrum der Schattenwelten. Im Schatten berühren sich das Abwesende und das Anwesende, er verweist zeichenhaft immateriell auf die Existenz der materiellen Welt und enthält gleichzeitig auch ihr Verlöschen. Er gehört zum Körper, von dem er sich gleichzeitig auch stets ein Stück entfernt. Er ist eine Spur, die wie die Fotografie als Index funktioniert und zugleich eine Projektionsfläche ist, die mit dem Anspruch einer eigenen Rea-
lität auftritt. In diesem Kontext kann der Schatten einerseits als Metapher für die Krise des Subjekts gelesen werden, aber auch als wichtiger Indikator für eine Wirklichkeit jenseits des vordergründig Sichtbaren.
Die Ausstellung, die bis zum 2. November 2025 im Kunstmuseum Bonn zu sehen ist, wurde gefördert durch die Art Mentor Founda-
[3] Gerhard Richter, Fenster, 1968, Kunstmuseum Bonn, © Gerhard Richter 2025 (15042025) Foto: Reni Hansen.

tion Lucerne, die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der SpardaBank und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Zu sehen sind Werke u.a. von Vito Acconci, David Claerbout, Marlene Dumas, Hans-Peter Feldmann, Jenna Gribbon, Nadia Kaabi-Linke, William Kentridge, Astrid Klein, Farideh Lashai, Tim Noble/Sue Webster, Gerhard Richter, Regina Silveira, Javier Telléz, Kara Walker und Jeff Wall.#
„Indem die Wahrnehmung des Schattens die Distanz zwischen dem eigenen Körperraum und dem Raum außerhalb überbrückt, fungiert er als Brücke zwischen Körper und Welt.“
Stephan Berg
Ausstellung
Bis 2. November 2025
From Dawn Till Dusk. Der Schatten in der Kunst der Gegenwart
Katalog
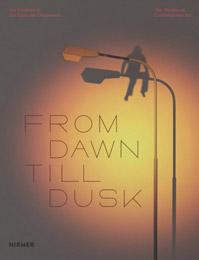

From Dawn Till Dusk. Der Schatten in der Kunst der Gegenwart
Stephan Berg (Hrsg.), Beiträge von S. Berg, M. Booms, J. – J. Müller, geb., dt./engl., 192 S. m. 185 Abb., 22 x 29 cm, Hirmer, ISBN 9783777445441
Kontakt
Kunstmuseum Bonn
Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn Tel. +49-(0)228-77-6260 www.kunstmuseum-bonn.de
Mit Talent gegen den Strom
„Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter“ in Düsseldorf
Starke Frauen für die Kunst: Was sie einte, war Talent und Willensstärke, denn genau das verlangte eine berufliche Laufbahn als Künstlerin des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Natürlich benötigten sie auch finanzielle Mittel für privaten Unterricht, denn sie wurden erst spät zur Aufnahme in die Akademie zugelassen. Nichtsdestotrotz wurden viele von ihnen übersehen oder wieder vergessen. Diese Lücke zu schließen, hat sich die Sonderausstellung „Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter“ im Kunstpalast Düsseldorf vorgenommen. Sie widmet sich vom 25. September 2025 an umfassend den Lebenswegen, Werken und Herausforderungen jener Frauen, die in dieser Zeit in Düsseldorf künstlerisch tätig waren. Ein mehrjähriges Forschungsprojekt brachte rund 500 Namen zutage, viele davon heute nahezu unbekannt. Anhand von über 100 Exponaten erzählt die Schau
die Geschichte weiblicher Kunstproduktion an einem Ort, der für Generationen künstlerischer Ausbildung und Vernetzung stand, und wirft neues Licht auf ein bislang weithin vernachlässigtes Kapitel der Kunstgeschichte.
Im 19. Jahrhundert war Düsseldorf ein Magnet für Kunstschaffende aus ganz Europa. Auch zahlreiche Frauen kamen in die Stadt – obwohl sie bis in die 1920er-Jahre hinein nicht an der Kunstakademie studieren durften. Sie organisierten privaten Unterricht, bauten Netzwerke auf, entwickelten individuelle Strategien, um künstlerisch arbeiten und öffentlich ausstellen zu können. Einige setzten sich gegen große Widerstände durch, andere verschwanden aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit oder wurden nie wirklich wahrgenommen.
[1] Paula Monjé, Frau in altdeutschem
Kostüm, 1878, Öl auf Leinwand, 110 x 73 cm, Kunstpalast, Düsseldorf, Foto: Kunstpalast – LVR-ZMB, Annette Hiller – ARTOTHEK.


Neben den heute bekannten Namen wie Gabriele Münter, die in vielen Museen präsent ist, rückt die Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast vor allem vergessene Protagonistinnen wie Amalie Bensinger, Minna Heeren oder Magda Kröner in den Fokus. Zahlreiche Werke der insgesamt 31 vorgestellten Künstlerinnen werden erstmals seit dem 19. Jahrhundert öffentlich gezeigt. Dabei ist die Schau auch eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Sammlungsgeschichte, denn bis heute sind Künstlerinnen in fast allen historischen Sammlungen – so auch im Kunstpalast – wenig vertreten. Gezielt arbeitet das Haus nun daran, diese Lücken zu schließen. Obwohl die Mittel und die Angebote auf dem Kunstmarkt begrenzt sind, konnten in den letzten Jahren allein 15 Gemälde von Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts für die Sammlung der Stadt Düsseldorf erworben werden.
„Künstlerinnen!“ ermöglicht also einen längst überfälligen „zwei ten Blick“ auf weibliches Kunstschaffen und erweitert grundlegend das Verständnis für die Kunst des frühen 19. und 20. Jahrhunderts. Am Beispiel der Akademie Düsseldorf, die sich von einem attraktiven Sehnsuchtsort für Künstlerinnen zu einer Durchgangsstation zu besseren Ausbildungsmöglichkeiten entwickelte, werden in elf chronologisch angelegten Räumen 100 Jahre Künstlerinnen-Geschichte aufgefächert.
Die Ausstellung skizziert die Lebensbedingungen der Frau im frühen 19. Jahrhundert. In den 1830er- und 40er-Jahren waren nur wenige Künstlerinnen in Düsseldorf tätig. Sie standen mit ihren männlichen Kollegen in engem Austausch und beschäftigten sich grundsätzlich mit ähnlichen Motiven. Da Kunst neben
[2] Amalie Bensinger, Margarethas Sehnsucht aus Joseph Victor von Scheffels „Trompeter von Säcklingen“, 1856, Öl auf Leinwand, 122 x 155 cm, Privatbesitz, Foto: Grisebach GmbH.

[3] Gertrud von Kunowski, Die Malschule, Atelier der Künstlerin in Düsseldorf, 1912, Öl auf Leinwand, 195 x 185 cm, Bauhaus-Archiv Berlin.

[4]
den sozialen Bereichen zu den wenigen als angemessen empfundenen Tätigkeiten für Frauen des Bürgertums zählte, wuchs die Zahl der Künstlerinnen mit der verstärkten Berufstätigkeit im 19. Jahrhundert.
Ab den 1850er-Jahren kamen mehr und mehr Künstlerinnen in die Stadt, der Privatunterricht professionalisierte sich und es gab schon einige Vorbilder für die nachrückende Generation. Mit dem wirtschaftlichen Boom der 1870er-Jahre und dem Wunsch nach prunkvoll ausgestatteten Wohnräumen wuchs auch der

[5]
Kunstmarkt. Gleichzeitig gab es immer mehr Künstler*innen und der Kampf um Anerkennung und Sichtbarkeit wuchs. Ab den 1890er-Jahren lebten einige Künstlerinnen in Düsseldorf, die später in die „Klassische Moderne“ eingeordnet wurden.
Für viele war Düsseldorf um 1900 jedoch nur noch eine Durchgangsstation, da sie in Berlin, München oder Paris bessere Ausbildungsorte fanden. Die Kunstgewerbeschulen nahmen früher Frauen auf als die meisten Kunstakademien, da angewandte Kunst den Frauen eher zugetraut wurde als freie Kunst. In Düsseldorf
[4] Mathilde Dietrichson, Selbstporträt, 1865, Öl auf Leinwand, 49,6 x 37,2 cm, Oslo Museum, Foto: Rune Aakvik, Oslo Museum.
[5] Martel Schwichtenberg, Selbstporträt, 1924,Öl auf Leinwand, 45 x 36 cm, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Foto: Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Museum für Kunst und Kulturgeschichte.
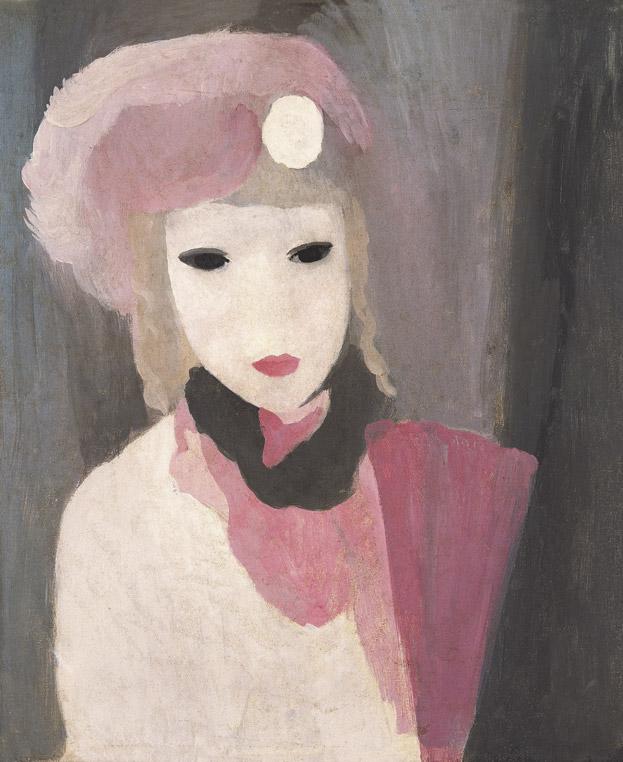
[6]
wurde 1904 unter dem neuen Direktor Peter Behrens die Kunstgewerbeschule für Frauen eröffnet. Mit der Weimarer Verfassung wurden Frauen 1919 dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten wie Männern zugesprochen und fast alle Akademien wurden für angehende Künstlerinnen zugänglich.
Die Ausstellung im Kunstpalast erzählt nun von ihren vergessenen Biografien und dem langen Weg zur Anerkennung. Das Publikum ist eingeladen, Kunstgeschichte vielfältiger und vollständiger zu betrachten.#
[6] Marie Laurencin, Tillya ou Jeune fille à l’éventail, um 1925, Öl auf Leinwand, 50,1 x 43,2 cm, Stiftung Sammlung Ziegler im Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Foto: Stiftung Sammlung Ziegler.
Die Ausstellung im Kunstpalast fächert anhand zahlreicher Beispiele 100 Jahre Künstlerinnen-Geschichte am Beispiel der Düsseldorfer Akademie auf.
Ausstellung
25. September 2025 bis 1. Februar 2026 Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter
Katalog
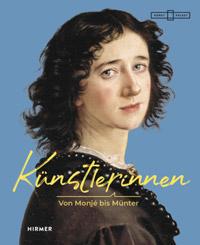

Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter. Kathrin DuBois (Hrsg.), Beiträge von K. DuBois, N. Köppert, S. Krogh, A. Pennonen, geb., 200 S. mit 250 Abb., 23,5 x 28,5 cm, Hirmer, ISBN 978377445984
Kontakt
Kunstpalast Ehrenhof 4–5, 40479 Düsseldorf info@kunstpalast.de, www.kunstpalast.de

Max Liebermann, Der Nutzgarten in Wannsee nach Südosten, 1923, Öl auf Holz, 55 × 76 cm, Privatsammlung
3. Oktober 2025 bis 8. Februar 2026 Impressionismus in Deutschland. Max Liebermann und seine Zeit.
Museum Frieder Burda www.museum-frieder-burda.de
Deutschland
Baden-Baden
Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8b, 76530 Baden-Baden
Tel. +49-(0)7221-398980
www.museum-frieder-burda.de
Bis 14. September 2025: Poesie des Lichts. Richard Pousette-Dart. 3. Oktober 2025 bis 8. Februar 2026: Impressionismus in Deutschland. Max Liebermann und seine Zeit.
Berlin
Alte Nationalgalerie
Bodestraße, 10178 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242
www.smb.museum
Bis 28. September 2025: Camille Claudel und Bernhard Hoetger. Emanzipation von Rodin. Bis 2. November 2025: Im Visier! Lovis Corinth, die Nationalgalerie und die Aktion „Entartete Kunst“. 24. Oktober 2025 bis 15. Februar 2026: The Scharf Collection. Goya –Monet – Cézanne – Bonnard – Grosse.
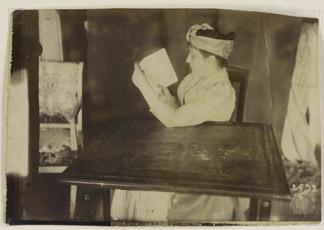
Porträt von Camille Claudel, bei sich zu Hause, lesend, um 1900, Silberabzug, 12 x 18 cm Ville de Paris / Bibliothèque Marguerite Durand
Bis 28. September 2025
Camille Claudel und Bernhard Hoetger. Emanzipation von Rodin.
Alte Nationalgalerie www.smb.museum
Hamburger Bahnhof –Nationalgalerie der Gegenwart
Invalidenstraße 50–51, 10557 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242
www.smb.museum
Bis 14. September 2025: 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. Bis 26. Oktober 2025: Chanel Commission. Klára Hosnedlovà: Embrace. Bis 4. Januar 2026: Toyin Ojih Odutola. U22 – Adijatu Straße. Bis 25. Januar 2026: Delcy Morelos. Madre. 11. September 2025 bis 31. Mai 2026: Petrit Halilaj. Syrigana. 14. November 2025 bis 3. Mai 2026: Annika Kahrs.
Humboldt Forum
Schloßplatz, 10178 Berlin Tel. +49-30-992118989 www.humboldtforum.org
Bis 15. September 2025: Jinshixue: Das Studium antiker Artefakte und materieller Überreste der Vergangenheit, Teil 2. Bis Oktober 2025: Durch die Hölle gehen. Jenseitsvorstellungen der Goryeo-Zeit (918–1392) in Korea. Bis 12. Oktober 2025: Takehito Koganezawa. Eins auf Zwei, Zwei aus Eins. Bis 31. Dezember
2025: Manatunga. Künstlerische Interventionen von George Nuku. Bis 23. Februar 2026: Ts’uu – Zeder. Von Bäumen und Menschen. Bis 1. Juni 2026: Restaurierung im Dialog. Blick hinter die Kulissen. 10. September 2025 bis 1. Dezember 2025: Gemeinsam gemacht. Netzwerke der Kreativität in Kunst aus Japan.
Kunstgewerbemuseum
Matthäikirchplatz, 19785 Berlin Tel. +49-(0)30-266424242 29 www.smb.museum
Bis 14. September 2025: Virtual Couture. Mode 3D – digitalisiert, animiert und interpretiert. Bis 21. September 2025: Symbiotic Wood. Bis 14. Dezember 2025: Mode aus Paris. Schenkung Erika Hofmann. Bis 30. Dezember 2025: Respiration. Atelier le balto im Kunstgewerbemuseum.
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin Tel. +49-(0)30-25486-0 www.berlinerfestspiele.de
Bis 14. September 2025: Vaginal Davis: Fabelhaftes Produkt. 16. Oktober 2025 bis 18. Januar 2026: Diane Arbus. Konstellationen. 16. Oktober 2025 bis 18. Januar 2026: Ligia Lewis: I’m not here forrrr …
Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50, 10785 Berlin Tel. +49-(0)30-266424242
www.smb.museum
Bis 14. September 2025: Fujiko Nakaya. Nebelskulptur im Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie. Bis 14. September 2025: Yoko Ono: Dream Together. Bis 12. Oktober 2025: Lygia Clark. Retrospektive. Bis auf Weiteres: Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft. Sammlung der Nationalgalerie 1945–2000. Bis September 2026: Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin.
Bonn
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 2, 53113 Bonn Tel. +49-(0)228-776260 www.kunstmuseum-bonn.de
Bis 7. September 2025: Heimweh nach neuen Dingen. Reisen für die Kunst. Bis 2. November 2025: From Dawn till Dusk. Der Schatten in
der Kunst der Gegenwart Bis 17. Mai 2026: Rune Mields. Zum 90. Geburtstag. 9. September 2025 bis 19. September 2027: Menschen und Geschichten. Die Sammlung der Klassischen Moderne – August Macke und die Rheinischen Expressionisten. 21. September bis 23. November 2025: Human AI Awarrd 2025. 9. Oktober 2026 bis 22. Februar 2026: Gregory Crewdson. Retrospektive.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Museumsmeile Bonn Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn Tel. +49-(0)228-9171-0 www.bundeskunsthalle.de
Bis 28. September 2025: Susan Sontag. Sehen und gesehen werden. Bis 26. Oktober 2025: Interactions x Wetransform. Bis 11. Januar 2026: W.I.M. Die Kunst des Sehens. Bis 25. Januar 2026: Wetransform. Zur Zukunft des Bauens. 2. Oktober 2025 bis 6. April 2026: Expedition Weltmeere. 7. November 2025 bis 4. Januar 2026: 27. Bundespreis für Kunststudierende.
Bremen
Kunsthalle Bremen
Am Wall 207, 28195 Bremen
Tel. +49-421-32908-0 www.kunsthalle-bremen.de
Bis 7. September 2025: Kunst fühlen. Wir. Alle. Zusammen. Bis 26. Oktober 2025: Spuren der Zeit. Druckgraphik des 16. bis 19. Jahrhunderts aus dem Museum für westliche und östliche Kunst Odesa. Bis 11. Januar 2026: Sibylle Springer. Ferne Spiegel. 11. Oktober bis 15. Februar 2026: Alberto Giacometti. 12. November 2025 bis 1. März 2026: Flirt und Fantasie. Grifelkunst von Max Klinger bis Peter Doig.
Neues Museum Weserburg Bremen
Teerhof 20, 28199 Bremen
Tel. +49-(0)421-59839-0 www.weserburg.de
6. September 2025 bis 10. Mai 2026: Julika Rudelius. The Emperor’s New Mall. 20. September 2025 bis 15. März 2026: Cold as Ice. Kälte in Kunst und Gesellschaft.
Düsseldorf
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K 20
Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8381130
www.kunstsammlung.de
Bis auf Weiteres: Raus ins Museum! Rein in Deine Sammlung. Meisterwerke von Etel Adnan bis Andy Warhol. 27. September 2025 bis 15. Februar 2026: Queere Moderne.
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K 21
Ständehausstraße 1, 40217 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8381204 www.kunstsammlung.de
Bis 12. Oktober 2025: Julie Mehretu. 9. Oktober 2025 bis 30. August 2026: Tadáskía. Preisträgerin K21 Global Art Award.
Kunstpalast
Ehrenhof 4–5, 40479 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8996260 www.kunstpalast.de
Bis 5. Oktober 2025: Mythos Murano. 18. September 2025 bis 11. Januar 2026: Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung. 25. September 2025 bis 1. Februar 2026: Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter. 29. Oktober 2025 bis 8. März 2026: Die geheime Macht der Düfte.
Duisburg
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum
Friedrich-Wilhelm-Straße 40 47049 Duisburg, Tel. +49-(0)203-2832630 www.lehmbruckmuseum.de
Bis 7. September 2025: Hans-Jürgen Vorsatz zum 80. Geburtstag. Bis 19. Oktober 2025: Sculpture 21st: Peter Kogler.
Emden
Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden
Tel. +49-(0)4921-97500 www.kunsthalle-emden.de
Bis 2. November 2025: Dem Himmel so nah. Wolken in der Kunst. Bis 2. November 2025: Ostfriesland Biennale.
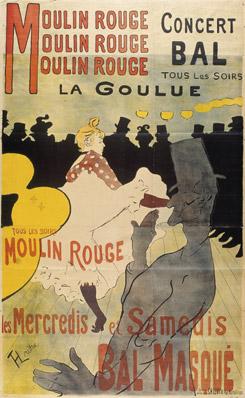
Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge – La Goulue/ Plakat für Auftritte der Tänzerin „La Goulue“ im Variété-Theater Moulin Rouge in Paris, 1891, Farblithographie in zwei Teilen zinnober, gelb, blau, schwarz auf graubraunem Papier, 193,5 x 120 cm, Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen
Bis 7. September 2025 Kunst fühlen. Wir. Alle. Zusammen.
Kunsthalle Bremen www.kunsthalle-bremen.de

Julie Mehretu, KAIROS / Hauntological Variations, Ausstellungsansicht, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 2025, Foto: Linda Inconi-Jansen
Bis 12. Oktober 2025
Julie Mehretu
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K 21 www.kunstsammlung.de

Lea Greub, No Georgian Dream, 2023, © Lea Greub
6. September bis 9. November 2025
Double Feature:
Gute Aussichten 2023/24/25.
Deichtorhallen Hamburg www.deichtorhallen.de
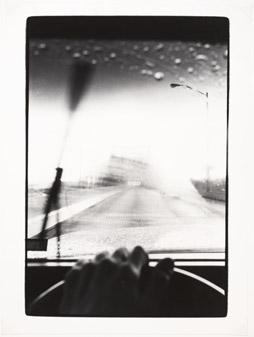
Joseph Rodriguez
Pulaski Skyway, New Jersey, 1984, Gelatinesilberpapier, Abzug 1988, 25,2 x 37,2 cm, © Joseph Rodriguez, Courtesy Galerie Bene Taschen Repro: Rheinisches Bildarchiv Köln
Bis 12. Oktober 2025 Street Photography. Lee Friedlander. Garry Winogrand, Joseph Rodríguez.
Museum Ludwig www.museum-ludwig.de
Frankfurt
Liebieghaus Skulpturensammlung
Schaumainkai 71, 60536 Frankfurt
Tel. +49-(0)69-6500490, www.liebieghaus.de
Bis 26. Oktober 2025: Isa Genzken meets Liebieghaus.
Städel Museum
Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt
Tel. +49-(0)69-6050980
www.staedelmuseum.de
Bis 28. September 2025: Werner Tübke. Metamorphosen. Bis 23. November 2025: Gesichter der Zeit. Fotografen von Hugo Erfurth. Bis 18. Januar 2026: Bilderwelten der USA. Fotografe zwischen Stadt, Subkultur und Mythos. Bis 12. April 2026: Asta Gröting. Ein Wolf, Primaten und eine Atemkurve. 24. September 2025 bis 1. Februar 2026: Carl Schuch und Frankreich.
Hagen
Emil Schumacher Museum
Kunstquartier Hagen
Museumsplatz 1, 58095 Hagen
Tel. +49-(0)2331–2073138, www.esmh.de
Bis 11. Januar 2026: Informelle Künstlerinnen der 1950er/1960er-Jahre.
Hamburg
Bucerius Kunstforum
Alter Wall 12, 20457 Hamburg
Tel. +49-(0)403609960
www.buceriuskunstforum.de
Bis 2. November 2025: Sean Scully. Stories.
Deichtorhallen Hamburg
Deichtorstraße 1–2, 20095 Hamburg
Tel. +49-(0)40-32103-200 www.deichtorhallen.de
Bis 14. September 2025: Katharina Grosse. Wunderbild. 6. September bis 9. November 2025: Double Feature: Gute Aussichten 2023/24/25. 27. September 2025 bis 26. April 2026: Daniel Spoerri. Ich liebe Widersprüche (Sammlung Falckenberg). 24. Oktober 2025 bis 26. April 2026: Huguette Caland. A Life in a few lines. 24. Oktober 2025 bis 26. April 2026: Into the unseen. The Walther Collection.
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall, 20095 Hamburg
Tel. +49-(0)40-428131-200
www.hamburger-kunsthalle.de
Bis 7. September 2025: Fedele Maura Friede. Der Saum löst sich. Bis 14. September 2025: Truong Cong Tùng. Bis 5. Oktober 2025: Edi Hila | Thea Djordjadze. Bis 12. Oktober 2025: Rendezvous der Träume. Surrealismus und deutsche Romantik. Bis 18. Oktober 2026: Isa Mona Lisa. Bis 11. Januar 2026: Impressionismus. Deutsch-Französische Begegnungen. 26. September 2025 bis 25. Januar 2026: Anders Zorn. Schwedens Superstar. 1. Oktober 2025 bis 4. Januar 2026: Das Gespenst in der Kurve. Schenkung: Kunstwerke von Hilka Nordhausen.
Hannover
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover
Tel. +49-(0)511-168-43875
www.sprengel-museum.de
Bis 28. September 2025: Peter Heber. Über das Sterben. Bis 28. September 2025: Stand Up! Feministische Avantgarde. Werke aus der Sammlung Verbund, Wien. 6. September 2025 bis 14. Februar 2026: Niki. Kusama. Murakami. Love you for infnity. 22. Oktober 2025 bis 25. Januar 2026: Käte Steinitz. Von Hannover nach Los Angeles.
Köln
Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln Tel. +49-(0)221-221-26165
www.museum-ludwig.de
Bis 12. Oktober 2025: Street Photography. Lee Friedlander. Garry Winogrand, Joseph Rodríguez. Bis 9. November 2025: Pauline Hafsia M’barek. Entropic Records. 3. Oktober 2025 bis 11. Januar 2026: Fünf Freunde: John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Obenmarspforten (am Kölner Rathaus) 50667 Köln, Tel. +49-(0)221-221-21119
www.wallraf.museum
Bis 26. Oktober 2025: Mezzotinto: Die schwarze Kunst. Bis 31. Mai 2026: B{l}ooming. Barocke
Blütenpracht. 14. November 2025 bis 15. März 2026: Expedition Zeichnung. Niederländische Meister unter der Lupe.
Mannheim
Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4, 68165 Mannheim
Tel. +49-(0)621-2936423, www.kuma.art
Bis 5. Oktober 2025: Berlin, Paris und anderswo. Bis 26. Oktober 2026: Joachim Bandau. Bis 31. Dezember 2025: Fokus Sammlung. Neue Sachlichkeit. Bis 23. November 2025: Studio: Shimpei Yoshida. 26. September 2025 bis 11. Januar 2026: Kirchner, Lehmbruck, Nolde.
München
Alte Pinakothek
Barer Straße 27, 80333 München
Tel. +49-(0)89-23805216, www.pinakothek.de
Bis 31. Dezember 2026: Von Turner bis van Gogh. Meisterwerke der Neuen Pinakothek in der Alten Pinakothek. Bis 11. Januar 2026: Rahmen machen Bilder.
Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1, 80538 München
Tel. +49-(0)89-21127-113 www.hausderkunst.de
Bis 21. September 2025: ars viva 2025. Where will we land? Bis 22. Februar 2026: Gülbin Ünlü. Nostralgia. Bis 1. Februar 2026: Archives in Residence: KEKS. Bis 1. Februar 2026: Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968. Bis 1. Februar 2026: Koo Jeon A. Haus der Magnet. 17. Oktober 2025 bis 22. März 2026: Cyprien Gaillard. Wassermusik. 23. Oktober bis 24. Oktober 2025: Nora Chipaumire. Dambudzo.
Pinakothek der Moderne
Barer Straße 40, 80333 München
Tel. +49-(0)89-23805-360 www.pinakothek.de
Bis 28. September 2025: 4 Museen – 1 Moderne. Gemeinschaftsausstellung aller vier Museen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der neuen Sammlung. Bis 12. Oktober 2025: On View. Begegnungen mit dem Fotografschen. Bis 9. November 2025: Rotundenprojekt 2025: Rupert Huber. Begegnungsmusik. Bis 31. Dezember 2025: Mix & Match. Die Sammlung neu entdecken.


Alexej von Jawlensky, Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff, 1909, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München
Bis Winter 2025/2026 Der Blaue Reiter.
Eine neue Sprache.
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München www.lenbachhaus.de

Karl Sigrist, Ernte Filderebene, 1938, Kunstmuseum Stuttgart Künstler:in und Nachfolge.
Bis 14. September 2025 Grafik für die Diktatur.
Kunstmuseum Stuttgart www.kunstmuseum-stuttgart.de
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München
Luisenstraße 33, 80333 München
Tel. +49-(0)89-23396933 www.lenbachhaus.de
Bis 19. Oktober 2025: Auguste Herbin. Bis 30. November 2025: Dan Flavin. Untitled (For Ksenija). Bis Winter 2025/2026: Der Blaue Reiter. Eine neue Sprache. Bis Frühjahr 2027: Was zu verschwinden droht, wird Bild. Mensch – Natur – Kunst. Ab 14. Oktober 2025: Shifting the Silence. Die Stille verschieben. Gegenwartskunst im Lenbachhaus.
Stuttgart
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1, 70173 Stuttgart
Tel. +49-(0)711-2162188
www.kunstmuseum-stuttgart.de
Bis 14. September 2025: Grafk für die Diktatur. Bis 21. September 2025: Frischzelle_31: Suah Im. Bis 12. Oktober 2025: Doppelkäseplatte. 100 Jahre Sammlung. 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart. Bis 12. April 2026: Joseph Kosuth. „Non autem memoria“. Bis 12. April 2026: Hans-Molfenter-Preis 2025. Bis 12. April 2026: Vom Werk zum Display. Bis 12. April 2026: Anita Berber. „Orchideen“.
Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30–32 70173 Stuttgart, Tel. +49-(0)711-47040-0 www.staatsgalerie.de
Bis 31. Dezember 2025: This is tomorrow. Neupräsentation der Sammlung des 20./21. Jahrhunderts. Bis 4. Januar 2026: Überfuss. Klingendes Papier von Clemens Schneider. Bis 11. Januar 2026: Katharina Grosse. The Sprayed Dear. 18. Oktober 2025 bis 11. Januar 2026: Playlist. 17. Bis 26. Oktober 2025: A–Z. Mapping the Future.
Weil am Rhein
Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 1, 79576 Weil am Rhein
Tel. +49-(0)7621-7023200 www.design-museum.de
Bis 28. September 2025: Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter. 18. Oktober 2025 bis 15. Februar 2026: Catwalk: The Art oft he Fashion Show.
Frankreich
Paris
Musée du Louvre
Rue de Rivoli, 75001 Paris
Tel. +33-(0)1-40205050, www.louvre.fr
Bis 28. September 2025: The Met au Louvre. Near Eastern Antiquities in Dialogue. Bis 16. November 2025: Africa Rising II – Barbara Chase-Riboud.
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries
Place de la Concorde, 75001 Paris
Tel. +33-(0)1-44504300 www.musee-orangerie.fr
Oktober 2025 bis 26. Januar 2026: Michel Payant. See Monet. 8. Oktober 2025 bis 26. Januar 2026: Berthe Weill. Avant-garde gallery owner.
Italien
Florenz
Fondazione Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi, 50123 Firenze Tel. +39-055-2645155 www.palazzostrozzi.org
26. September 2025 bis 25. Januar 2026: Beato Angelico.
Rom
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
Viale delle Belle Arti, 131, 00197 Roma Tel. +39-06-322981 www.gnamc.cultura.gov.it
Bis 14. September 2025: East and West. Bis 21. September 2025: Andrea Lelario. A Journey’s Tale.
Palazzo delle Esposizioni Roma
Via Nazionale 194, 00184 Roma
Tel. +39-06696271 www.palazzoesposizioniroma.it
Bis 21. September 2025: Carlo d’Orta. Architectural abstractions. Oktober 2025 bis Januar 2026: 18th Quadriennal of Fantastic Art.
Venedig
Peggy Guggenheim Collection
Palazzo Venier die Leoni Dorsoduro 701, 30123 Venezia Tel. +39-041-2405411 www.guggenheim-venice.it
Bis 15. September 2025: Maria Helena Vieira da Silva: Anatomy of Space.
Österreich
Bregenz
Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz, 6900 Bregenz
Tel. +43-(0)5574-485-94-0 www.kunsthaus-bregenz.at
Bis 28. September 2025: Malgorzata Mirga-Tas. Bis 28. September 2025: Michael Armitage, Maria Lassnig, Chelenge Van Rampelberg.
Wien
Albertina
Albertinaplatz 1, A–1010 Wien
Tel. +43-(0)1-53483-0, www.albertina.at
Bis 2. November 2025: Jitka Hanzlová. Identities. Bis 9. November 2025: Brigitte Kowanz. Licht ist was man sieht. Bis 12. Oktober 2025: Die Wiener Bohème. Werke der Hagengesellschaft. 19. September 2025 bis 11. Januar 2026: Gothic Modern. Munch, Beckmann, Kollwitz. 30. Oktober 2025 bis 22. Februar 2026: Lisette Model. Retrospektive. 14. November 2025 bis 6. April 2026: Leiko Ikemura. Motherscapes.
Albertina Modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Tel. +43-(0)1-534830, www.albertina.at
Bis 7. September 2025: Remix. Von Gerhard Richter bis Katharina Grosse. Bis 8. Oktober 2025: Damien Hirst. Zeichnungen. 10. Oktober 2025 bis 1. März 2026: Marina Abramović.
MUMOK – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
MuseumsQuartier, Museumsplatz 1 A-1070 Wien, Tel. +43-(0)1-525 00 www.mumok.at
Bis 7. September 2025: Park McArthur. Contact M.
Bis auf Weiteres: Jongsuk Yoon. Kumgangsan. Bis 16. November 2025: Kazuna Taguchi. I’ll never ask you. Bis 6. April 2026: Die Welt von morgen wird eine weitere Gegenwart gewesen sein. Bis 12. April 2026: Nie endgültig! Das Museum im Wandel. Bis 10. Mai 2026: Mapping the 60s. Kunst-Geschichten aus den Sammlungen des mumok. 27. September 2025 bis 12. April 2026: Tobias Pils. Shh.
Kunsthistorisches Museum Wien
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien Tel. +43-(0)1-52524-0, www.khm.at
Bis 5. Oktober 2025: Die Prinzessin von Neapel. Mengs und Velázquez. Bis 26. Oktober 2025: Prunk & Prägung. Die Kaiser und ihre Hofünstler. Bis 15. März 2026: Pieter Claesz: Stillleben. 5. September 2025 bis 26. Januar 2026: Kurznachrichten aus der Antike. 30. September 2025 bis 22. Februar 2026: Michaelina Wautier, Malerin. 11. November 2025 bis 6. September 2026: Kopf & Kragen. Münzen machen Mode.
Schweiz Basel
Kunsthalle Basel
Steinenberg 7, 4051 Basel Tel +41-(0)61-2069900 www.kunsthallebasel.ch
Bis 21. September 2025: Ser Serpas. Of my life. Bis 16. November 2025: Bagus Pandega. Sumber Alam. 19. September 2025 bis 23. August 2026: Coumba Samba.
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16, 4010 Basel Tel. +41-(0)61-2066262 www.kunstmuseumbasel.ch
Bis 21. September 2025: Ofene Fragen. Zur Herkunft von Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett. Die Sammlungen Julius Schottländer und Julius Freund. Bis 4. Januar 2026: Verso. Geschichten von Rückseiten. Bis 4. Januar 2026: Ofene Beziehung. Sammlung Gegenwart. Bis 11. Januar 2026: Cassidy Toner. Besides the Point. 20. September 2025 bis 8. März 2026: Geister. Dem Übernatürlichen auf der Spur.

Chelenge Van Rampelberg, 2024, Foto: Kaniz Sheikh © Nairobi Contemporary Art Institute
Bis 28. September 2025
Michael Armitage, Maria Lassnig, Chelenge Van Rampelberg.
Kunsthaus Bregenz www.kunsthaus-bregenz.at

Jongsuk Yoon, Kumgangsan, 2024 Gouache auf Wand , 300 × 1440 cm Foto: Klaus Pichler / mumok, Courtesy the artist and Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien
Bis 16. November 2025
Kazuna Taguchi. I’ll never ask you.
MUMOK – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien www.mumok.at

Lucas Cranach d. Ä., Bildnis einer betenden Frau (Vorderseite); Hl. Katharina (Rückseite), um 1508, Öl auf Eichenholz, 43 x 33 cm, Inv. Dep 24, Objekt-ID: 1051, Kunstmuseum Basel, Depositum Kunsthaus Zürich, Geschenk August Abegg, 1925, Foto: Julian Salinas
Bis 4. Januar 2026 Verso.
Geschichten von Rückseiten.
Kunstmuseum Basel www.kunstmuseumbasel.ch

Jean Jacques Balzac, A living room with wooden windows, 2024. Image: Jean Jacques Balzac
Bis 23. November 2025 Vers une architecture: Reflexionen.
Museum für Gestaltung Zürich www.museum-gestaltung.ch
Basel/Riehen
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101, 4125 Riehen/Basel
Tel. +41-(0)61-6459700
www.fondationbeyeler.ch
Bis 21. September 2025: Vija Celmins. 12. Oktober 2025 bis 25. Januar 2026: Yayoi Kusama.
Zürich
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1, 8001 Zürich
Tel. +41-(0)44-2538484, www.kunsthaus.ch
Bis 7. September 2025: Suzanne Duchamp. Retrospektive. Bis 28. September 2025: Eine Zukunft für die Vergangenheit. Sammlung Bührle: Kunst, Kontext, Krieg und Konfikt.
Bis 30. November 2025: Yto Barrada. Bis Sommer 2026: Wu Tsang. „La montaña invertida“.
Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zürich
Tel. +41-43-4466767
www.museum-gestaltung.ch
Bis 7. September 2025: Fotoatelier Wolgensinger – Mit vier Augen. Bis 23. November 2025: Vers une architecture: Refexionen. Bis 7. Dezember 2025: Susanne Bartsch – Transformation! Bis 18. Januar 2026: Museum of the Future – 17 digitale Experimente. 24. Oktober 2025 bis 6. April 2026: Junge Grafk Schweiz!
Spanien
Barcelona
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona Tel. +34-934-439470, www.fmirobcn.org
Bis 5. Oktober 2025: Anti-Portrait. Bis 2. November 2025: Opening the Archive 06. Tribute to Joan Prats. Bis 2. November 2025: Builders of worlds very similar to ours. Bis 9. November 2025: Prats Is Quality. Bis 18. Januar 2026: How from here. Bis 6. April 2026: Poetry has just begun. 50 Years of the Miró. Bis 2. November 2025: Ludovica Carbotta. 10. Oktober 2025 bis 22. Februar 2026: Miró and the United States. 14. November bis 18. Januar 2026: Who is Afraid of Ideology? Part 5 DayDream.
Madrid
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23, 28014 Madrid Tel. +34-(0)91-3302800 www.museodelprado.es
Bis 14. September 2025: So far, so close. Guadalupe of Mexico in Spain. Bis 21. September 2025: Paolo Veronese (1528–1588). Bis 11. Januar 2026: The Painter Antonio Muñoz Degrain (1840–1924).
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofa
Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid Tel. +34-(0)91-7741000
www.museoreinasofa.es
Bis 8. September 2025: Néstor reunited. Bis 22. September 2025: Marisa González. A Generative. Bis 17. Oktober 2025: Something is happening in Redor. Inhabiting, traveling, reclaiming the city (1970–1975). Bis 20. Oktober 2025: Naufus Ramírez-Figuera. Light Spectra. Bis 16. Januar 2026: Miguel Àngel Tornero. Great Frieze.
Museo Thyssen-Bornemisza
Palacio de Villahermosa
Paseo del Prado 8, 28014 Madrid
Tel. +34-(0)91-690151 www.museothyssen.org
Bis 7. September 2025: Ayako Rokkaku. For those moments when you feel like paradise. Bis 14. September 2025: Isabel Coixet. Collages. Learning in disobedience. Bis 28. September 2025: Terraphilia. Beyond the Human in the Thyssen-Bornemisza Collections. Bis 12. Oktober 2025: Anna Weyant. 21. Oktober 2025 bis 25. Januar 2026: Warhol, Pollock and other American spaces.
Málaga
Museo Jorge Rando
Calle Cruz del Molinillo, 12, 29013 Málaga
Tel. +34-(0)95-2210991 www.muesojorgerando.org
Bis 30. November 2025: Apocalipsis.
Die Angaben beruhen auf den Informationen der Aussteller. Änderungen nach Redaktionsschluss vorbehalten.


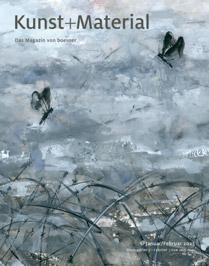



Kunst+Material auch im Abonnement!
Kunst+Material erscheint zweimonatlich in einer Auflage von 30.000 Exemplaren und bietet Einblicke in Ateliers und Arbeitsweisen von porträtierten Künstler*innen, stellt interessante Inhalte im Sonderthema vor, präsentiert aktuelle Ausstellungen und gibt neben News aus der Kunstwelt viele spannende Buchempfehlungen an die Hand. Neu und exklusiv gibt es inspirierende Bildstrecken zu Materialien und künstlerischen Techniken. Hintergrundstories aus der Feder von Expert*innen informieren über die unterschiedlichsten Materialien und ihre Geschichte, und auch Künstlerinnen und Künstler selbst kommen zu Wort und stellen ihr Lieblingsmaterial vor.#
Bestellungen
boesner GmbH holding + innovations „Kunst+Material“ – Abonnement
Gewerkenstraße 2, D-58456 Witten oder abo@kunst-und-material.de Fax +49-(0)2302-97311-33
Bestellungen aus der Schweiz
boesner GmbH
Surenmattstrasse 31, CH-5035 Unterentfelden oder marketing@boesner.ch

Abonnement
[ ] Ja, ich bestelle das Kunst+Material-Abonnement mit jährlich sechs Ausgaben zum Abo-Preis inkl. Versand von 49,50 EUR bzw. 49,50 CHF (Schweiz). Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn es nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Bezugsjahres gekündigt wird.
[ ] Ja, ich bestelle das Probe-Abonnement und beziehe die nächsten drei Ausgaben von Kunst+Material zum einmaligen Kennenlern-Preis von 14,50 EUR bzw. 14,50 CHF (Schweiz). Danach bekomme ich Kunst+Material bequem nach Hause – zum Jahresbezugspreis von 49,50 EUR/CHF für sechs Ausgaben. Dazu brauche ich nichts weiter zu veranlassen. Wenn ich Kunst+Material nicht weiterlesen möchte, kündige ich das Probe-Abo schriftlich bis spätestens eine Woche nach Erhalt des 2. Heftes. Dieses Angebot gilt in Deutschland und der Schweiz.
Rechnungsadresse
Vorname
Nachname
Straße
PLZ, Ort
Land
Telefon
Lieferadresse (falls abweichend)
Vorname
Nachname
Straße
PLZ, Ort
Land
Telefon
Widerrufsrecht: Diese Vertragserklärung kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) schriftlich gekündigt werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist an die jeweilige Bestelladresse zu richten.
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift
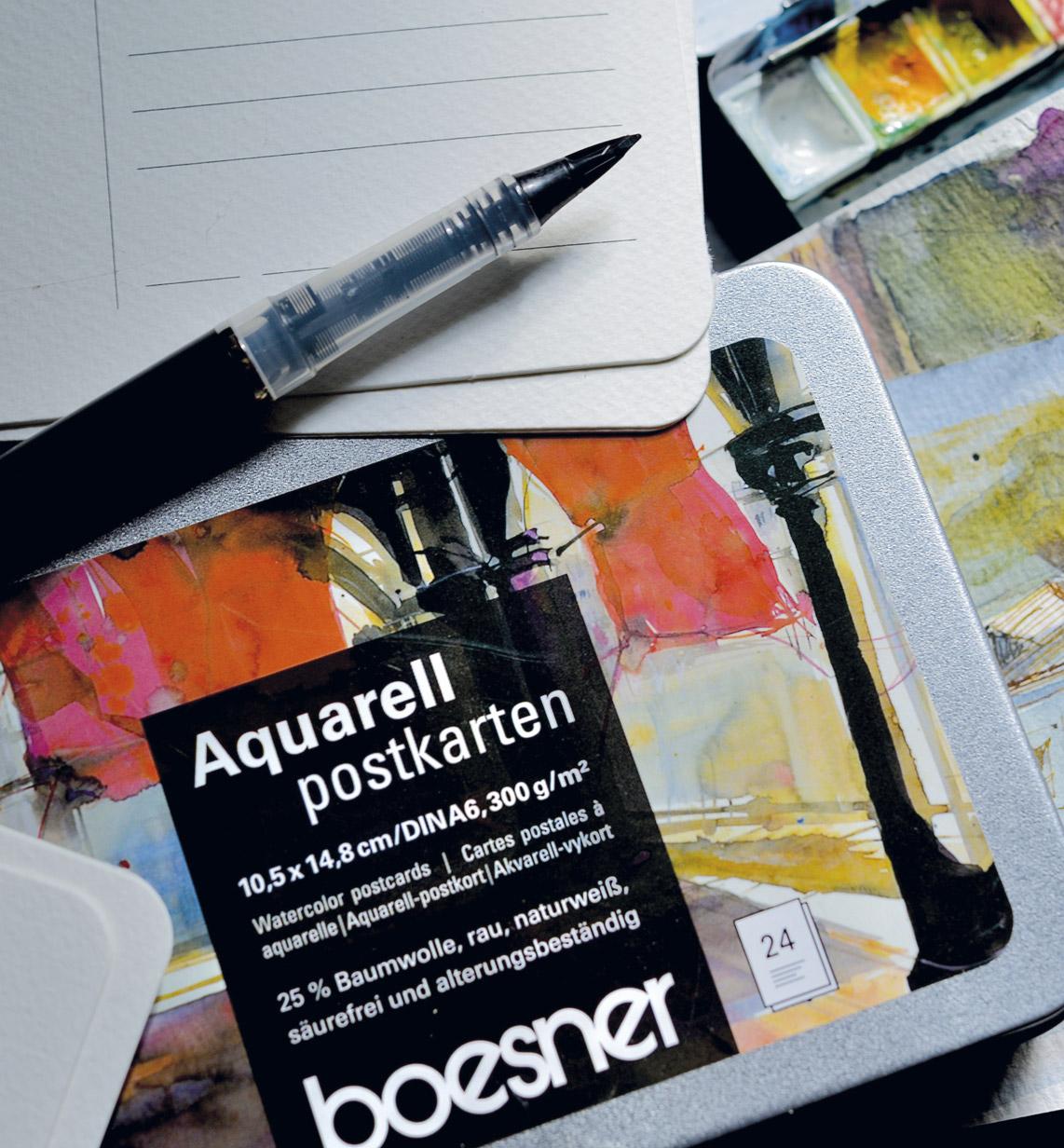
Beste Grüße
Bildnerische Ideen festhalten, gestalterische Experimente ausführen oder komprimierte kleine Geschichten einfangen … schon bei der Künstlergruppe „Brücke“ wurden selbst gestaltete Postkarten für Kurzmitteilungen in Wort und Bild gern und einfallsreich genutzt. Dabei zwang das kleine Format zur erfrischenden Konzentration auf das Wesentliche. Künstlerpostkarten sind eine Tradition, die es sich unbedingt lohnt, fortzuführen. Die perfekte Grundlage dafür sind AquarellPostkarten von boesner. Sie bestehen aus naturweißem 300 g/m²-Aquarellpapier mit abgerundeten Ecken und rückseitig aufgedrucktem Adressfeld, sicher verstaut in einer dekorativen Metallbox. Einfach gestalten und verschicken …#

Diego Velázquez, Las Meninas (Ausschnitt), 1656, Öl auf Leinand, 318 x 276 cm, Madrid, Museo del Prado.
FilmTipp
Das Geheimnis von Velázquez
Édouard Manet pries ihn als „Maler aller Maler“, Salvador Dalí nannte ihn den „Ruhm Spaniens“ und Pablo Picasso widmete seinem „großen Idol“ eine eigene Gemäldereihe – aber wer war Diego Velázquez (1599–1660) wirklich? Mit Las meninas (Die Hoffräulein) schuf der Hofmaler des spanischen Königs eines der einflussreichsten Gemälde aller Zeiten, malte Porträts der royalen Familie, des Papstes, aber auch des einfachen Volkes und hinterließ ein über 200 Gemälde umfassendes Lebenswerk.
Trotz dieser Prominenz bereits zu Lebzeiten bleibt vieles um Velázquez bis heute nebulös. Woher stammt seine unerreichte Beherrschung von Licht und Schatten, die seinen barocken Porträts subtile Töne und eine lebendige Atmosphäre gibt, und die erst ein Jahrhundert später im Impressionismus salonfähig wurde? Wie verlieh er seinen Porträts diesen beispiellosen Realismus? Der Dokumentarfilm „Das Geheimnis von Velázquez“ von Stéphane Sorlat, der ab Ende November im Kino zu sehen ist, spürt den Echos eines genialen Malers nach, die in unzähligen Werken weltberühmter Künstler widerhallen und bis heute Rätsel aufgeben. Veláquez Gemälde im Prado, so Stéphane Sorlat, „lösten Staunen aus und eine unverständliche Faszination. Das ist ebenfalls eine Facette des Rätsels um ihn: Seine Kunst ist komplex und bleibt ohne Erklärung unbegreiflich, übt aber trotzdem eine fast magische Anziehungskraft aus. Diese Tiefe ist zwar unendlich fesselnd, aber auch sehr schwer, ins Kino zu übertragen. Die Herausforderung bestand also darin, diesem intellektuellen Universum Gestalt zu verleihen und gleichzeitig das Geheimnis und die Kraft seines Werkes zu bewahren.“#

Raffael, Die Heilige Familie aus dem Hause Canigiani, um 1505/1506, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München, Foto: Elisabeth Greil.
Rahmen machen Bilder
Kleider machen Leute – Rahmen machen Bilder: Ein guter Rahmen ist wie ein perfekt passendes Kleid oder ein tadellos sitzender Anzug. Er hebt die Ausstrahlung des Kunstwerks und unterstützt im besten Fall die Wirkung der Malerei. Dies zeigt eine kleine, aber feine Ausstellung der Reihe „All Eyes On“ in der Alten Pinakothek München. Da viele Werke der Alten Meister im Laufe ihrer Geschichte zumeist von ihren Originalrahmen getrennt wurden, bleibt nur selten die ursprüngliche Einheit von Bild und Rahmen erhalten. Viele Originalrahmen sind etwa durch Verkauf und Transporte verloren, und auch historische Rahmen – also Neurahmungen vergangener Jahrhunderte – wurden etwa in Kriegen zerstört. Die Ausstellung „Rahmen machen Bilder“ zeigt nun anhand von sechs Beispielen, dass es zu den vornehmsten kuratorischen Aufgaben gehört, einem Gemälde den richtigen Rahmen zu geben: Nur mit einer passenden Rahmung gelingt es, die von der Künstlerin intendierte Wirkung des Bildes wesentlich zu unterstützen. Die Präsentation, die bis zum 11. Januar 2026 zu sehen ist, stellt am Beispiel einiger Werke der italienischen Renaissance vor, wie in der Alten Pinakothek Gemälde von historischen Rahmen oder von kunstvollen Nachschöpfungen geschmückt werden. #
Der kurze Weg zur Kunst

Ab 20. November 2025 im Kino!
www.neuevisionen.de

www.instagram.com/ boesner_deutschland/ www.facebook.com/ boesner/
www.boesner.com/ kunstportal
33 x in Deutschland und 1 x Versandservice
3 x in Österreich
4 x in der Schweiz
5 x in Frankreich
20 Jahre Kunstkosmos Spinnerei Leipzig
Vom Industrieareal zum Zentrum zeitgenössischer Kunst

© SPINNEREI 2025 | Foto: Stefan Schacher.
Im Jahr 2025 feiert die Leipziger Baumwollspinnerei ihr 20-jähriges Bestehen – ein Meilenstein für einen Ort, der sich in zwei Jahrzehnten vom Industrieareal zu einem pulsierenden Zentrum zeitgenössischer Kunst entwickelt hat. Die ehemals größte Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas ist heute ein europaweit beachteter Mikrokosmos für Kunstschaffende, Galerien und kulturelle Initiativen.
From Cotton to Culture
Bedeutende Künstler aus Leipzig wie Neo Rauch, Christiane Baumgartner, Rosa Loy oder Tilo Baumgärtel u.v.m. zogen parallel zur auslaufenden Produktion Ende der 90er-Jahre in die Spinnerei. Mit dem Einzug der ersten Galerien im Mai 2005 – darunter EIGEN + ART, die Galerie Kleindienst und die heutige Galerie Jochen Hempel – begann die inspirierende Transformation des Areals und Kunst wurde zum identitätsstiftenden Merkmal.
Parallel zu diesem Aufbruch öffnete auch die boesner-Filiale Leipzig ihre Türen auf dem Gelände und wurde so von Beginn an Teil des Spinnerei-Ökosystems. Als Materialpartner und Inspirationsort versorgt boesner nicht nur Profis und Kunststudierende mit hochwertigen Materialien, sondern bietet auch Raum für Workshops, Vorträge und Begegnungen.

Ein Kosmos der Kunst
Heute umfasst die Spinnerei 14 Galerien, einen Kunstverein, rund 120 Ateliers, Werkstätten, Projekträume, Theater, ein Kino sowie zahlreiche Kunst- und Kulturinitiativen. Der industrielle Charme des Ortes trifft auf ein vielfältiges Kunstgeschehen, das international ausstrahlt.
Ein fester Bestandteil der Entwicklung sind die Spinnerei-Rundgänge. Dreimal jährlich öffnen Galerien und Ateliers ihre Türen für ein kunstinteressiertes Publikum. Besucher erleben aktuelle Facetten zeitgenössischer Kunst in unmittelbarer Nähe zu den Arbeitsplätzen der Künstler, ein Format mit besonderer Authentizität. Die Spinnerei bleibt ein Ort, an dem Kunst nicht nur gezeigt, sondern gelebt wird.#
Herbst-Rundgang
Samstag, den 13. September: 11.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag, den 14. September 2025: 11.00 bis 16.00 Uhr Zum Herbst-Rundgang erwartet das Publikum ein besonders vielfältiges Programm. Neben den Galerien und Ateliers, die besichtigt werden können, gibt es auch Führungen über das Gelände, die einen Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Spinnerei geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
www.spinnerei.de © boesner GmbH holding + innovations, Foto: Carolin Windloff.
Marcel fragt Ulrike
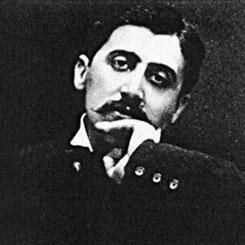

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, (1871–1922), französischer Schriftsteller, Kritiker und Intellektueller
Ulrike Möltgen (*1973), Künstlerin aus Wuppertal
Streng genommen fragt hier gar nicht Marcel Proust selbst – vielmehr hat der berühmte Schriftsteller, dessen Werk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ als einer der größten Romane der Weltliteratur gilt, dem berühmt gewordenen Fragebogen seinen Namen gegeben. Proust hat einen solchen Fragebogen wohl mindestens zweimal selbst beantwortet – um die Wende zum 20. Jahrhundert galt das Ausfüllen als beliebtes Gesellschaftsspiel in gehobenen Kreisen. Der erste Bogen, ausgefüllt vom heranwachsenden Proust während eines Festes, wurde posthum 1924 veröffentlicht. Den zweiten Fragebogen betitelte Proust mit „Marcel Proust par lui-même“ („Marcel Proust über sich selbst“). Die ursprünglich 33 Fragen wurden für Kunst+Material auf 29 reduziert – und bieten spannende und nachdenkliche Einblicke in die Gedankenund Gefühlswelt unserer Befragten.
Wo möchten Sie leben? Anscheinend in Wuppertal. Was ist für sie das vollkommene irdische Glück? Gelassenheit, Selbstzufriedenheit (kommt beides nicht so oft vor, aber so ist es ja mit dem Glück). Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Unpünktlichkeit. Was ist für Sie das größte Unglück? Meine Fantasie geht durch – mein Sohn liegt auf einer seiner vielen Reisen im Schatten eines Mangobaums und wurde von einer der dort beheimateten Vipern gebissen. Klar, 30 Jahre lang habe ich mein Hirn trainiert, um aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Mein Kopf tut mir nicht den Gefallen, einen Unterschied zu machen. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Leider keine schlaue Antwort parat. Ihr Lieblingsmaler? David Hockney, Peter Doig, japanische Holzschnitte, die Zeichnungen von Klimt, Gauguin, Daniel Richter, die „Rosa Periode“ von Picasso und so weiter. Ihr Lieblingsautor? Knut Hamsun, Jon Fosse, Esther Kinski, Toni Morrison, William Faulkner. Ihr Lieblingskomponist? Nein, keine Musik. Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Menschen am meisten? Über eigene Fehler lachen können / mich daran zu erinnern, über meine Fehler zu lachen. Ihre Lieblingstugend? Ich bin eh furchtbar fleißig, ehrlich und bescheiden, also Lieblingstugend: Faulheit, Gelassenheit. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Mit meinem Hund in der Natur spazieren. Wer oder was hätten Sie gern sein mögen? Eine Tänzerin von Pina Bausch und mich nach einer rauschend-perfekten Darbietung verschwitzt und glücklich verbeugen. Wer mich kennt, weiß, dass es dazu nicht kommen wird (lacht). Ich kann mir keinen einzigen Schritt merken. Ihr Hauptcharakterzug? Uff. Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? Über eigene Fehler lachen können / mich daran zu erinnern, über meine Fehler zu lachen. Ihr größter Fehler? Grübeln (Mangobaum). Ihr Traum vom
Glück? Schopenhauer hat mal gesagt: „Glück ist die Abwesenheit von Schmerzen“… So ist das doch mit dem Glück, wenn man Schmerzen hat. – Glück: Keine Schmerzen – und wenn man dann keine Schmerzen mehr hat, dann ist es wieder woanders, das Glück. Ihre Lieblingsfarbe? Immer anders. Ihre Lieblingsblume? Pusteblume. Ihr Lieblingsvogel? Einer der auf meiner Schulter sitzt, sprechen kann und mir sagt, dass mein Sohn sich unter dem Mangobaum nur von den heldenhaften, ruhmreichen Taten des Tages erholt (keine Schlange). Ihre Helden der Wirklichkeit? Eine einflussreiche Größe, groß genug, um ein Ruder herumzureißen …Demokratie zu verteilen, Frieden zu schaffen, Gerechtigkeit auch und Liebe. Meine Vermutung: Es ist eine Frau, sie ist nicht besonders religiös und gehört bestimmt nicht der AfD an. Ihre Lieblingsnamen? Konrad. Was verabscheuen Sie am meisten? Im Moment? Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum so eine Viper in dieser langen, langen Evolutionsgeschichte noch nicht mitbekommen hat, dass mein Sohn weder Feind noch Nahrung ist. Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie am meisten? Oh weia, was soll ich sagen? Hitler? Welche Reform bewundern Sie am meisten? Reformen zur Gleichstellung der Geschlechter/Rassen ... Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Klavier spielen können möchte ich. Wie möchten Sie gern sterben? Der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören…. (Bazon Brock) … übrigens auch Wuppertaler, und – wenn er sich durchsetzt, was ich hoffe, hat sich die Frage erübrigt. Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? Ich google gerade gefährliche Schlangen in Andalusien. Ihr Motto? „Wer die Gefahr meidet, kommt darin um“ (Ernst Bloch), räumlich habe ich da noch Luft nach oben, bei der Arbeit setze ich das möglichst um.
Wer’s weiß, gewinnt!
dt. Maler (Gerhard von)
Schreib-, Zeichenutensil
dt. Keramiker: Anton van … ital. Maler (Domenico) brasil. Fotograf (Sebastião)
chinesischer Künstler (Ai)
it. Barockmaler (Sebastiano) chines. Künstler: … Minjun besondere Arbeit eines Künstlers
wirklichkeitsnah
Zeichnerin, Künstlerin schweiz. Maler (Karl)
jap.amerik. Künstlerin (Yoko)
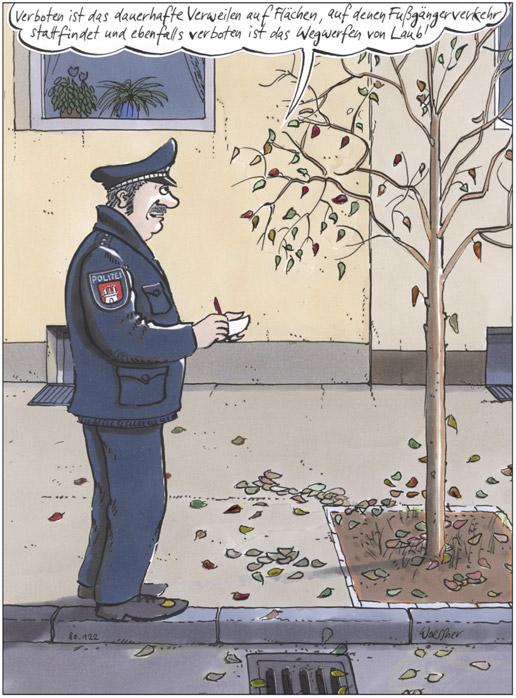
Fremdwortteil: neu (griech.)
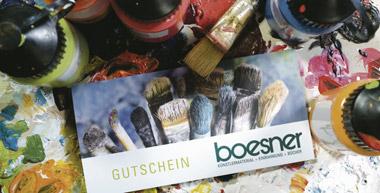
1. Preis boesner-Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro
2. Preis boesner-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro
3. Preis
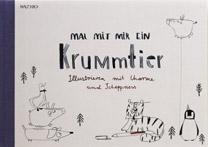

Ein Buch „Mal mit mir ein Krummtier“, siehe S. 55.
So nehmen Sie teil: Bitte senden Sie das Lösungswort per E-Mail an: raetsel.zeitung@boesner.com oder per Postkarte an: boesner holding GmbH holding + innovations, Gewerkenstr. 2, 58456 Witten. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2025.
Mitarbeiter von boesner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.
C M V
Das Lösungswort des Preisrätsels aus Kunst+Material Juli/August 2025 ist: EMPFINDEN
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Herausgeber
boesner GmbH holding + innovations Gewerkenstr. 2, 58456 Witten
Tel. +49-(0)2302-97311-10
Fax +49-(0)2302-97311-48 info@boesner.com
V.i.S.d.P.: Jörg Vester
Redaktion
Dr. Sabine Burbaum-Machert redaktion@kunst-und-material.de
Satz und Grafische Gestaltung
Birgit Boesner, Hattingen mail@bboes.de
Anzeigen
Dr. Sabine Burbaum-Machert anzeigen@kunst-und-material.de Anzeigenpreisliste Nr. 18 vom 01.02.2025
Herstellung
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg
Erscheinungsweise
zweimonatlich
© 2025 bei der boesner GmbH holding + innovations. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art, Aufnahmen in OnlineDienste und die Vervielfältigung auf Datenträgern wie CD-Rom, DVD-Rom etc. bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Unverlangte Manuskripte, Fotos und Dateien usw. sind nicht honorarfähig. Sie werden nicht zurückgesandt und für sie wird keine Haftung übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Eine Veröffentlichung von Daten, insbesondere Terminen, erfolgt trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Redaktionsund Anzeigenschluss ist immer der 15. des jeweiligen Vormonats. Seiten 3, 45, 64–65, U4: Malerei, Realisation und Fotografie: Ina Riepe. Seite 4: (6) Ulrike Möltgen, Der Löwe Trinidad (Ausschnitt) aus: „Ich war die ganze Welt“, Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2025, © Peter Hammer Verlag; (20) iStock / TontoRuga; (32), (46) Malerei, Realisation und Fotografie: Ina Riepe; (66) Ausstellungsansicht: „Sean Scully. Stories“, Bucerius Kunst Forum, Foto: Ulrich Perrey; (92) © SPINNEREI 2025, Foto: Stefan Schacher. Seite 94 unten: Foto: © Uwe Becker.
Verlag und Redaktion danken den Rechteinhabern für die Reproduktionsgenehmigungen. Nicht nachgewiesene Abbildungen entstammen dem Archiv des Verlags. Konnten trotz sorgfältigster Recherche Inhaber von Rechten nicht ermittelt werden, wird freundlich um Meldung gebeten.
ISSN 1868-7946
Die nächste Kunst+Material erscheint im November 2025
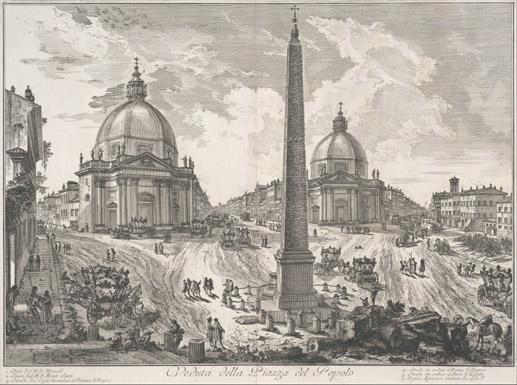
Thema
Piranesis Vedute di Roma
Giovanni Battista Piranesi, Veduta della Piazza del Popolo, um 1750, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. Nr. 37.45.3(49)
Der in Venedig geborene Architekt Zeichner und Radierer Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) begab sich 1740 zum ersten Mal nach Rom, wo er augenblicklich der Faszination der Stadt erlag. In den folgenden Jahrzehnten wurde er zu einem der einflussreichsten Künstler in der Ewigen Stadt. Obwohl Piranesi über tausend Radierungen schuf, darunter Werke zu archäologischen Themen oder solchen der ‚interior decoration‘, wird sein Name heute vor allem mit den fulminanten Vedute di Roma in Verbindung gebracht. Diese Ansichten, auf denen er in großem Format und mit spektakulären Perspektiven die antiken Monumente, die Kirchen, Plätze und Straßen Roms darstellte, waren bei Romreisenden seit dem 18. Jahrhundert stark nachgefragt. Die Veduten Piranesis prägten und prägen bis heute die Vorstellung von der Ewigen Stadt und sind tief im kollektiven Bildgedächtnis verwurzelt. Doch was machte die Stadtansichten Piranesis so einzigartig und welche anderen Werke schuf er noch? Wie realisierte er in wenigen Jahrzehnten eine so umfangreiche grafische Produktion und wie vermarktete er sie? Stefan Morét gibt in seinem Sonderthema einen Einblick in die Werkstatt Piranesis und den römischen Kunstbetrieb im 18. Jahrhundert. Weitere Themen: Porträt | Inspiration | Technik | Bücher | Ausstellungen