

Kunst+Material
Das Magazin von boesner
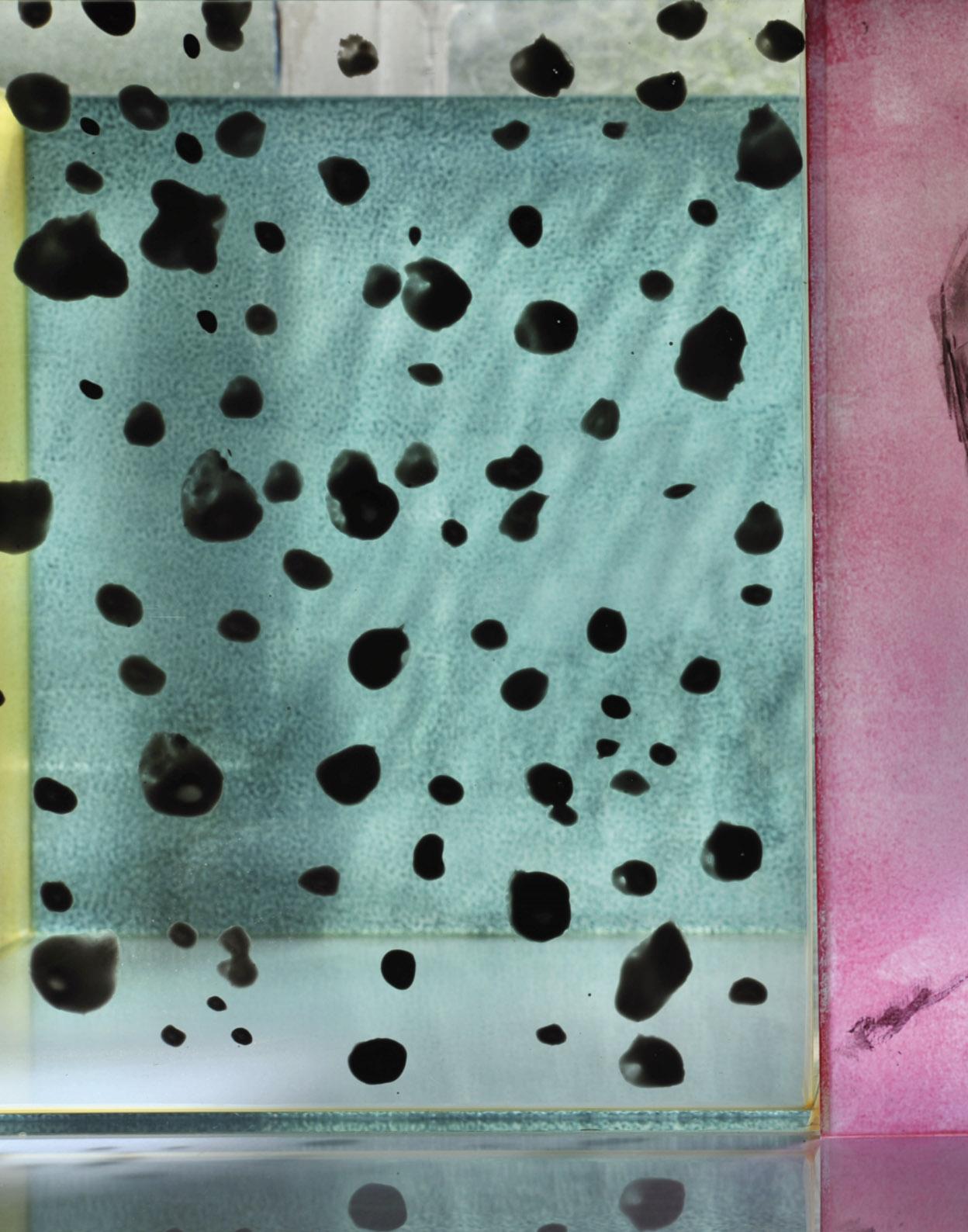
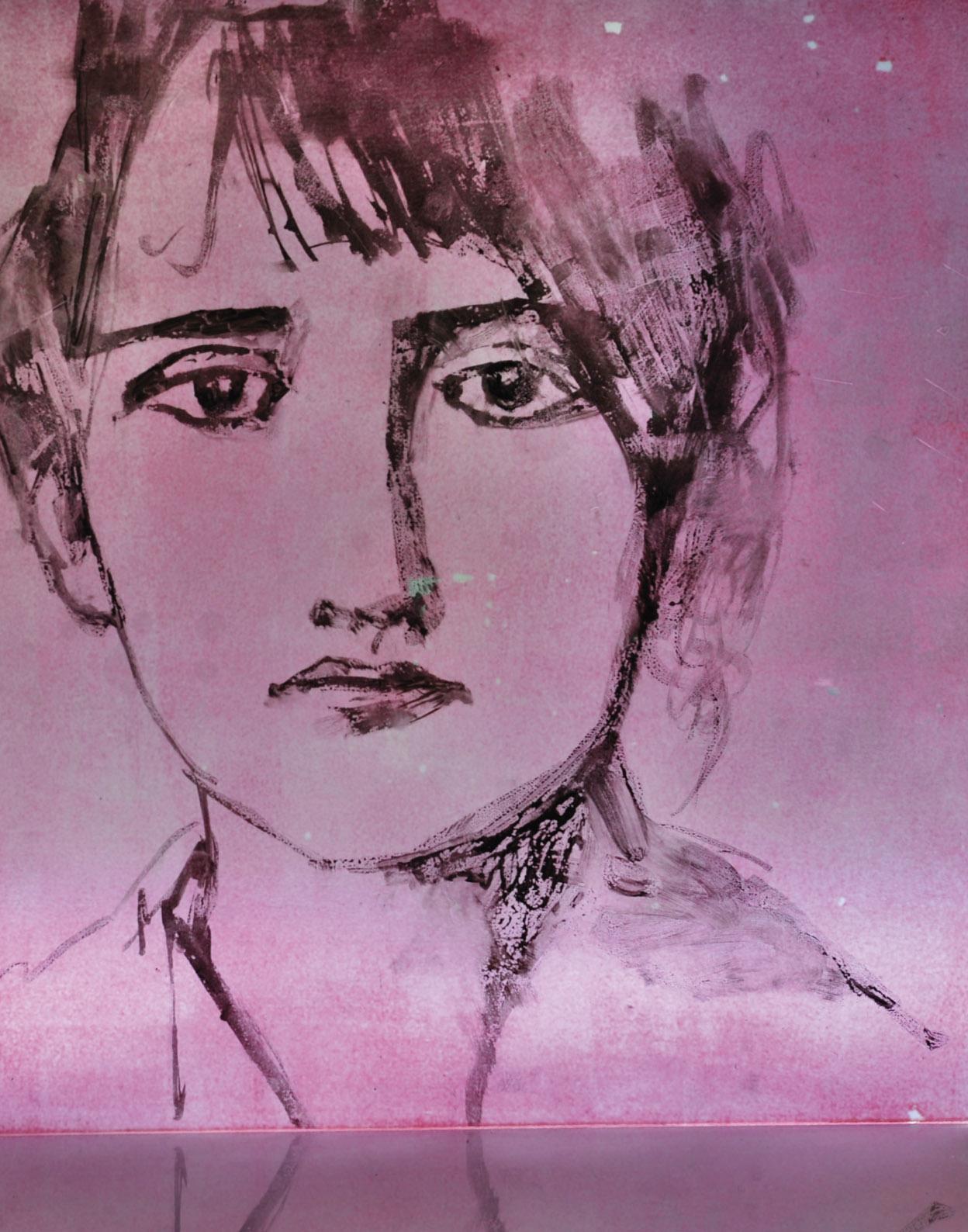
Idee, Malerei, Gestaltung, Fotogra
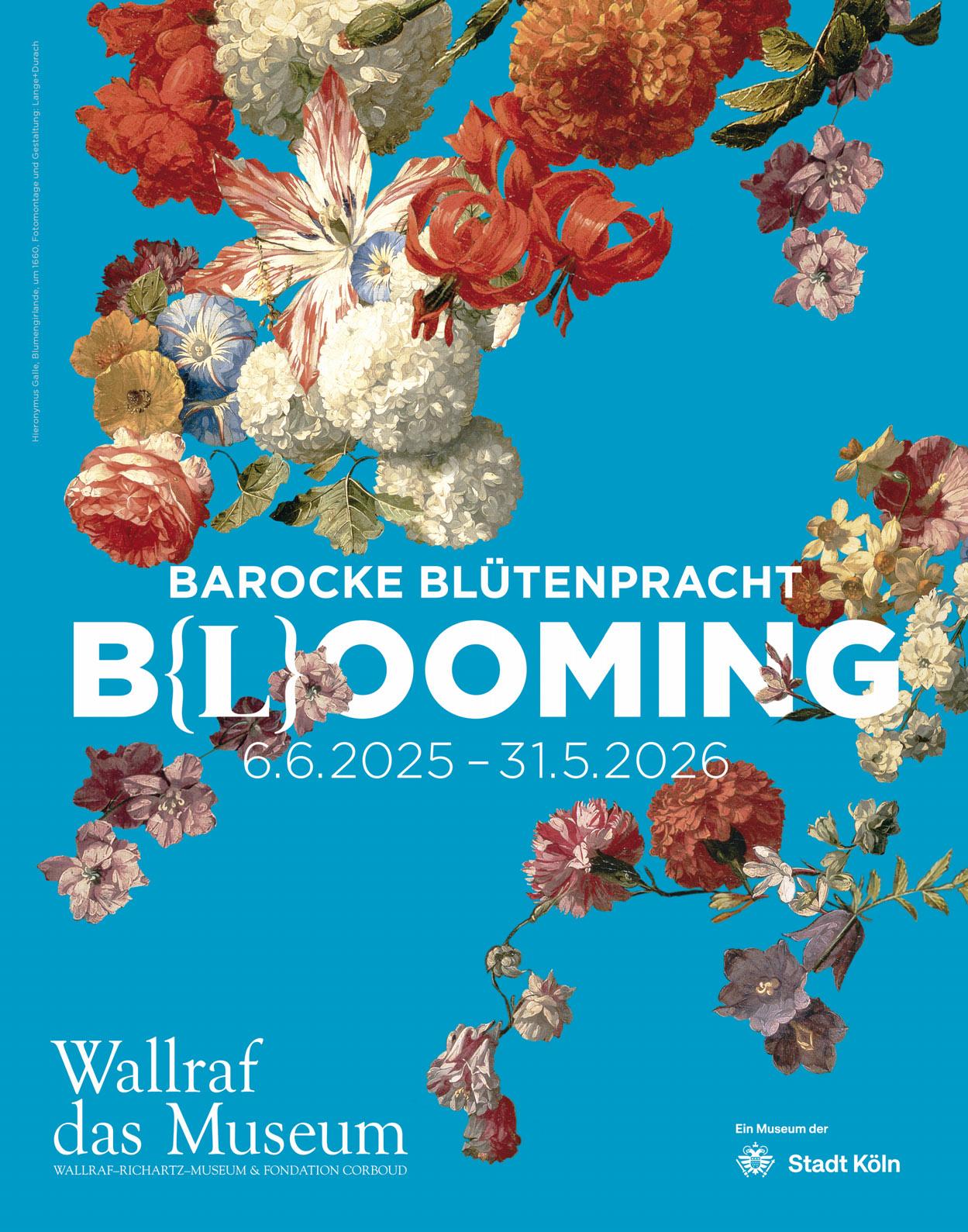

Liebe Leserin, lieber Leser,
manchmal ist das Geräusch der Stille unüberhörbar. Wer an Sommertagen Ruhe sucht und sich in die Natur zurückzieht, spitzt schnell die Ohren. Ob im schattigen Winkel des Gartens, unter einem Baum im Gras oder auf einem zurückgezogenen Fleckchen am Ufer: Es brummt, summt und zwitschert, ein Rascheln und Zirpen ist zu vernehmen, ein Blätterflüstern oder leises Plätschern vielleicht ... Hören Sie unbedingt hin, denn eine natürliche Geräuschkulisse verhilft zu innerem Gleichgewicht, so die Hirnforschung: Biologische Töne dienen der Entspannung und helfen, das Denken neu zu organisieren und dabei die Gedanken fließen zu lassen – also die besten Voraussetzungen für kreative Ideen.
Eine ganz andere Seite der Natur offenbart sich in den Werken von Alexia Krauthäuser. Die Protagonisten der Düsseldorferin ringen mit atmosphärischen Zuständen, die Spannungen zwischen Mensch und Schöpfung sind förmlich mit Händen zu greifen. Thomas Hirsch hat die Künstlerin in ihrem Atelier besucht und stellt fest: Alexia Krauthäusers Malerei zeigt sich als Handlung zwischen Geheimnis und Abenteuer, in der sich auch Farbgewitter über der Leinwand entladen.
Der sanfte Blick Camille Pissarros richtete sich auf Gärten und Szenen des bäuerlichen Lebens, auf Stadtlandschaften oder die Häfen der Normandie. Wie sehr er die Schönheit des Alltäglichen schätzte, zeigt in Potsdam die große Ausstellung „Mit offenem Blick. Der Impressionist Pissarro“. Zu sehen sind über einhundert Werke des Künstlers, der in Frankreich lebte und arbeitete, mit französisch-portugiesischen Wurzeln in der Karibik aufgewachsen war und zeitlebens die dänische Staatsbürgerschaft behielt.
Wer die lichterfüllten Monate liebt, kann sich auf die Inspirationsseiten freuen: In „Lichtblicke“ zeigt Ina Riepe, wie sehr sich Malerei auf Acrylglas das Spiel von Transparenz und Opazität zunutze macht. Susanna Partsch erläutert die Herkunft und den Gebrauch von Ultramarinblau, dem einst mühsam aus Lapislazuli gewonnenen Pigment. Und natürlich bietet die aktuelle Ausgabe von Kunst+Material noch viele weitere spannende Themen: Jörg Restorff stellt in seinem großen Special die Lackkunst vor, die in China seit Jahrtausenden mit dem Harz des Lackbaumes Oberflächen veredelt und sie fast unverwundbar macht. Selbstverständlich gibt es auch wieder Materialtipps, Anregungen und Buchempfehlungen für entspannte Momente – ob in der Hängematte, am Strand oder unterwegs.
Einen schönen Sommer wünscht
Dr. Sabine Burbaum-Machert









Porträt
6–17 Im Strudel der Erzählungen
Die Düsseldorfer Malerin Alexia Krauthäuser
Thema
18–31 Exotisch, hauchdünn und praktisch unverwundbar Lackkunst überbrückt Kontinente, dient unterschiedlichsten Zwecken und macht das Leben schöner
Inspiration
32–39 Lichtblicke
Persönlich
40–41 Ungeplante Zufallsformen Bernhard Krug arbeitet auf Gesso-Malplatten
Hintergrund
42–45 „Azzurro oltramarino ist wahrlich eine edle Farbe“
Technik
46–51 Mustergültig
Bücher
52–61 Bücher, Buchtipps 91 Kunst+Material im Abonnement
Labor
62–63 Mit unbegrenzter Haftung
Ausstellungen
66–71 Wegbereiter moderner Gestaltung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“ in Weil am Rhein
72–73 Das Geheimnis des Kosmos Vija Celmins in Riehen/Basel
74–77 Zeichnen als offene Denkbewegung Damien Hirst in Wien
78–83 Die Schönheit des Alltäglichen Camille Pissarro in Potsdam
84–90 Termine
92–93 Kurz notiert
94–95 Im Gespräch
96 Vorschau, Impressum
Titel: Alexia Krauthäuser, Siblings, 2024, Mischtechnik auf Nessel, 165 x 180 cm, Foto: Alexia Krauthäuser.

Im Strudel der Erzählungen
Die Düsseldorfer Malerin Alexia Krauthäuser
Das Bildformat von Vergebung (2023) ist ausgewogen und gut überschaubar. Vis-à-vis und für sich allein im Atelier gehängt, ermöglicht es das aufmerksame Schweifen des Blicks über die Ereignisse und Details, die sich auf der Bildfläche abspielen, aufeinander verweisen und miteinander verzahnen: Vergebung ist ein Schlüsselwerk in der Malerei von Alexia Krauthäuser. Im Zentrum der Darstellung knien drei Männer nebeneinander und wischen die Intarsien, als gelte es, sie für einen besonderen Anlass zu reinigen. Zur Synchronie ihrer Handlung trägt bei, dass die Männer gleich gekleidet sind und gleichsam in Kabinen eingefasst sind. Jeder „bespielt“ ein eigenes Fußbodensegment, welches in schrägen Schnitten begrenzt ist, sodass das simultane Geschehen an ein Kaleidoskop erinnert. Inmitten der verschiedenen Holzkonstruktionen stellt sich ein nostalgischer Ton ein. Rechts schiebt sich ein Balken wie ein Deckensturz in das Bild hinein. Dazu windet sich eine Treppe wie zum Dachboden in die Höhe. Daneben wischen die Männer die Dielen und nehmen so Kontakt mit dem Boden auf. Aber das Wasser, welches sie verteilen und vorwärtstreiben, ist viel zu viel, es schäumt auf und schlägt Wellen. Dramatisch jedoch sind die von oben einbrechenden Wassermassen, vor denen sich der linke Mann mit einer seitlichen Wendung schützt.
In diesem absurden und bedrohlichen, wie längst vergangenen und nurmehr erinnerten, aber doch auch konkret vorstellbaren Bildgeschehen veranschaulicht sich buchstäblich, wie das Gemälde selbst „gemacht“ ist: dass es auf der Verteilung von Farben auf einer planen Fläche beruht und dazu mit Wasser angereichert
ist. Mit den Mitteln der Malerei zeigt Alexia Krauthäuser Szenen, welche gänzlich in die Fantasie abschweifen und wieder hart in der Wirklichkeit landen. Sie konfrontiert unterschiedliche Ereignisse zwischen drastischer Realität und nicht-greifbarer Räumlichkeit aus hauchfeinen Schleiern. Die gegenständliche Erzählung geht mit Strukturen der geometrischen Abstraktion einher, nicht nur in den Intarsien, sondern mehr noch im Oval links davon. Das gilt auch für die Wendeltreppe, die, je höher man aufblickt, umso mehr aus Fächern in schattierenden Grün-, Blau- und Gelbtönen besteht und in sich verschoben ist. In der Vertikale kippend und gefaltet, kehrt eine verwandte Konstruktion in der linken Bildhälfte horizontal, gewunden um eine Stange, wieder. Alles wirkt gleichermaßen luxuriös und eng und verschachtelt – und umso aussichtsloser. Unterhalb des ausfransenden Farbrasters öffnet sich eine bodenlose Tiefe, die mit ihrem matten zarten Blau und Grün das Geschehen beruhigt und vielleicht wie unter Wasser wirkt, gar wie die Tiefsee und jedenfalls eine andere Sphäre beschreibt. – Alexia Krauthäuser nickt: Der Titel versteht sich symbolisch. „Vergebung“ spricht das SichReinwaschen von Schuld an und hofft („mit sich im Reinen“, wie es gemeinhin heißt) auf einen Neubeginn in der Gegenwart und für die Zukunft.
Mit solchen Bildern gehört Alexia Krauthäuser zu den interessantesten figürlichen Malerinnen ihrer Generation. In ihren Gemälden ist der Mensch unserer Zivilisation mit den Elementen der Natur konfrontiert. Seine Errungenschaften und seine Einrichtung in der Welt treffen auf eine kosmische Zuständlichkeit, vor-
Foto: Katja Illner.
[1] Alexia Krauthäuser in ihrem Atelier mit der Arbeit Tanz (in der Entstehung), 2025, Mischtechnik auf Nessel, 175 x 165 cm,

Eine solche Dynamik des Geschehens, bei dem alles in Veränderung ist, kennzeichnet bereits die Malereien Anfang der 2000erJahre, mit denen Alexia Krauthäuser nach ihrem Kunststudium in die Öffentlichkeit trat. Auf Figuren verzichten diese Bilder noch. Sie thematisieren das Sehen und Empfinden mit allen Sinnen und überschreiten dabei die Grenzen der Abstraktion gewaltig. Dafür war die Situation einer „Vorbei-Fahrt“ geeignet, wie bei dem unbetitelten Gemälde von 2002, welches auf der fotografischen Ansicht der Landschaft durch die Fensterscheibe eines schnell fahrenden Zuges beruht. Das weiche, leuchtende und tiefe Grün nimmt in teils fetzenartigen, teils langgezogenen Streifen
die Horizontale der Fahrt auf. Das Tempo raubt den dunklen Bäumen, die sich in der Vertikalen halten, geradezu ihren Halt, auch wenn sie, durchschossen von weißen Flecken aus Natur und gleißendem, aufblitzendem Gegenlicht, auf dem Waldboden aufsitzen. In der räumlichen Staffelung der Ferne wirken die Stämme dünn, zerbrechlich, schließlich vereinzelt und einzeln. Auf dem Glasfenster zeichnet sich die Spiegelung der Sonne als verschobene gelb-grüne Erscheinung gerade noch ab. In der idealen Ruhe des Zugabteils scheint es, als wäre man selbst unbewegt und die Landschaft rase an einem vorbei und löse sich dabei allmählich auf. Die Fensterscheibe, deren Begrenzung unsichtbar bleibt, wird zum Bildschirm. Bereits in diesem Gemälde ist die Malerei als Handlung – ausgeführt mit breiten faserigen Pinselstrichen auf der Leinwand – präsent, auch als Verdeutlichung der Illusion auf der ebenen Fläche, die als Fensterscheibe das „Draußen“ wiedergibt. Auch künftig greift Alexia Krauthäuser immer wieder auf ein saftiges Grün zurück, das aus der Natur abgeleitet ist, und experimentiert mit Distanz und Teilhabe und mit dem Betrachter-Standpunkt. Sie verwendet das große Format, welches den Panoramablick ermöglicht und den Betrachter umfängt und in dem er sich verliert. Vor allem aber zeigt sich in ihren Schilderungen der Konflikt zwischen dem Menschen und der Schöpfung, zwischen Zivilisation und Natur.
Alexia Krauthäuser wurde 1971 in Bergisch Gladbach nahe bei Köln geboren. Sie hat an den Kunstakademien in Münster und Düsseldorf studiert. Die Werke der Professoren ihrer Malklassen – Udo Scheel und Jan Dibbets – unterscheiden sich komplett, getragen in Versatzstücken, mitunter wie eine Collage. Der Realismus interagiert mit einer Abstraktion, die atmosphärische Temperierungen auslöst und ebenso präzise in Form gesetzt wie malerisch zugelassen ist. Dabei sprüht und fließt es, bilden sich Schlieren, kristalline Risse und transparente Schichten, in denen sich über der partiell durchscheinenden Leinwand Farbgewitter entladen. Die Menschen wirken inmitten oder am Rand der mit geometrischen Feldern und trennenden Flächen angelegten oder doch gänzlich gegenstandsfreien Darstellungen verlassen und wie in eine fremde Welt versetzt. Den Naturkräften ausgesetzt, müssen sie sich ihre physische Stabilität und ihre Selbstbehauptung buchstäblich erarbeiten. Sie stehen mit den Füßen fest auf dem Boden oder sichern sich auf allen Vieren ab. Sie sind in einem Hochstand geschützt und in wärmende Kleidung gehüllt –oder sie verlassen eben die Schwerkraft und springen durch den Raum.
[2] Vergebung, 2023, Mischtechnik auf Nessel, 140 x 100 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić
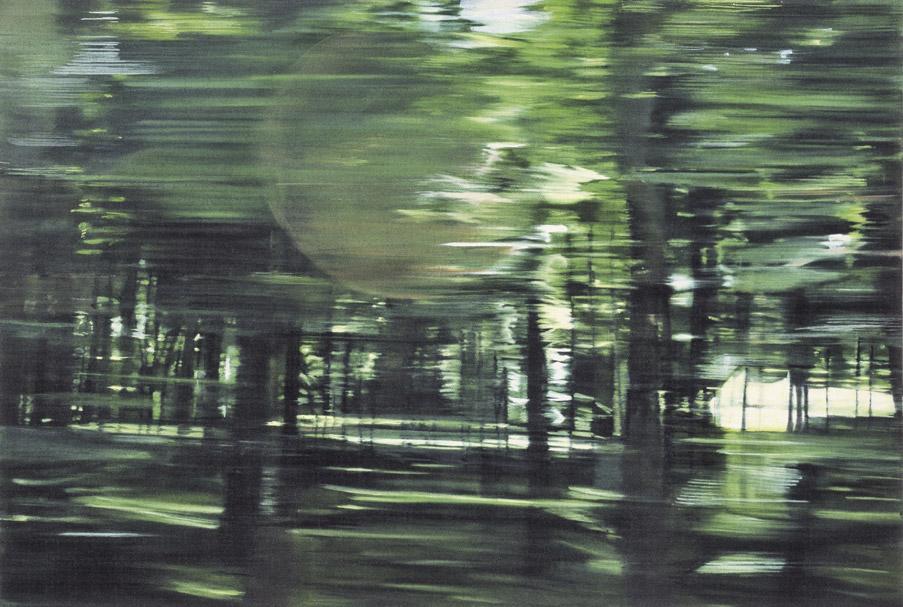
und irgendwie scheint es, dass in ihrer Malerei Aspekte und Präferenzen von beiden unter neuen Gesichtspunkten vorkommen und zusammenfinden. Udo Scheel, der in Münster unterrichtet hat, platziert fragmentarisch abstrahierte Figuren im weiten Raum, welcher durch die Füllung mit perspektivisch verzerrten Gegenständen als Interieur zu verstehen ist. Dabei stellt sich ein erzählerischer Klang mit unterschwellig psychischen Spannungen ein. Jan Dibbets, bei dem sie in Düsseldorf nach Anfängen bei Rissa studiert hat, nimmt eine tragende Rolle in der Concept Art ein und hat dazu Beiträge zur Land Art geliefert. Seine Beschäftigung mit Fragen der Perspektive und den Erscheinungen der Natur hat ihn als Teil seines multimedialen Schaffens auch zu Malerei geführt, die anhand architektonischer Situationen das Sehen untersucht. Alexia Krauthäuser nun malt weite Räume, die zwischen natürlicher und architektonischer Landschaft wechseln und oft in einer Unruhe verfangen sind, welche die verschiedenen Zonen der Bildfläche auflöst und sie als Zustände im All-Over verknüpft: Sicher ist am Schluss nichts mehr. Dazu passt der Name der Künstlerinnengruppe „Terrain Vague“, die sie
2014 gemeinsam mit drei Kolleginnen als Ausstellungsgemeinschaft gegründet hat. Verbindend ist, dass alle Malerei betreiben, in Düsseldorf studiert haben und dort leben und sich Phänomenen der gegenständlichen Welt zuwenden. Für alle ist Malerei ein Geheimnis und eine Herausforderung, die im Prozess oft unabsehbar ist.
Krauthäusers Bilder sind von einer expressiv vorgetragenen Theatralik bestimmt. Im Querformat Sturm (2007) ist die Natur die Bühne. Der Titel spielt auf Shakespeares Stück „Tempest“ an. „Tempest“ ist aber auch eine Segelboot-Klasse. Mit der Winzigkeit des Schiffes im Bildgeschehen klingt noch die Metapher vom Sturm im Wasserglas an und verlegt die Szenerie ganz auf eine emotionale Ebene. Ein kahlköpfiger Mann in Badehose und weißem Hemd beugt sich wie Gulliver zum Strand hinab und bewegt das Schiffchen in dem flachen Wasser zu seinen Füßen. Mit seiner Geste lädt er die Leere der freien Umgebung auf, als würde sich die Erschütterung auf die Natur zu beiden Seiten übertragen. Eine geradezu kosmische Steigerung kennzeichnet die rechte
[3] Ohne Titel, 2002, Acryl auf Nessel, 150 x 200 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

Bildhälfte, die mit Verfahren, die an die Batik und das tachistische Schleudern von Farbmaterie erinnern, die Schatten von Gestrüpp über und auf der Erde und Assoziationen an Höhlenmalerei, den Schaum von Wasser oder Reste von Schnee evoziert. Das Chaos ist höchst strukturiert. Die linke Hälfte entwickelt – ganz anders – eine brodelnde Dreidimensionalität, hier türmt sich die Brandung des Meeres wie in einem Gemälde von Courbet auf. In erweitertem Sinne ist der Mensch der Strippenzieher, der in die Natur eingreift und sie verändert und sie doch nicht kontrollieren kann. Sie entgleitet ihm.
Die Menschen in den Gemälden von Alexia Krauthäuser sind oft vereinzelt, manchmal auch isoliert. Sie sind von viel freiem Raum umgeben, aber sie wissen, was sie tun und sind immer Handelnde, dabei Schauende. Ihre Blicke sind zielgerichtet. Sie machen sich alleine auf die Reise, sammeln Erkenntnisse, treten Expeditionen an oder sind Zuschauer im Kino in einer Vorführung, die nur für sie stattzufinden scheint. Oder sie bilden doch eine kleine Gruppe, stecken die Köpfe zusammen und forschen
gemeinsam, miteinander vertraut. Ein Aspekt dahinter ist das Abenteuer der Malerei mit seiner Illusion und seiner Desillusionierung. In der vermeintlichen Entleerung tritt der Bildraum mit den Nuancen der Farbe in den Vordergrund. Was Alexia Krauthäuser an Malschlachten auf der Leinwand zelebriert, ist in dieser Form und Intensität beeindruckend. In mehreren Schichten aufgetragen und dann partiell wieder abgenommen, holt sie Motive und Farbverläufe aus der Tiefe hervor und lädt sie mit Bedeutung auf. Sie lässt Farbnasen fließen oder trägt die Farbe vollends flüssig auf und kippt die zunächst plan liegende Leinwand leicht schräg, sodass sich die Substanz kontrolliert zufällig verteilt und gegen jede Vorstellung von Ornament anordnet. Dazu arbeitet sie mit Acryl, Aquacryl, Tusche, Gouache, Aquarell und Acrylspray, auch mit Abklebungen, die nach ihrer Abnahme für scharfe Kanten, aber auch punktuelle Farbverdichtungen sorgen. Farbe fließt und rinnt, tropft und spritzt auf der Fläche der Leinwand wie das Wasser in den Bildern von Sturm bis hin zu Vergebung: Müsste da nicht das Atelier mit seinem Boden komplett mit Farbspuren übersät sein?
[4]
,
Sturm
2007, Mischtechnik auf Nessel, 75 x 180 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

Überhaupt nicht. Vielmehr sind die Ordnung und die weißen Wände im Atelier Voraussetzung für die Übersicht während der malerischen Prozesse. Und Alexia Krauthäuser ist die Ruhe selbst, zurückhaltend und geduldig. Das Atelier befindet sich in Flingern, einem der vitalsten Stadtteile von Düsseldorf. Hier haben alternative Läden, Mode- und Feinkost-Geschäfte, Eisdielen und Cafés und gleich mehrere Galerien eröffnet, darunter hochkarätige Ausstellungsräume. Hier veranstaltet die Philara Collection in einer ehemaligen Glaserei ein Programm zur jungen Kunst. In den Hinterhöfen sind etliche Ateliers angesiedelt und
hier merkt man am deutlichsten, dass Düsseldorf mit seiner Kunstakademie eben auch eine Künstler*innenstadt ist. Der Straßenverkehr mit den Autos in Konkurrenz zur Straßenbahn sorgt für ständige Unruhe. Die Baustellen versprechen eine Verbesserung der Wohnqualität, lassen aber auch Tendenzen der Gentrifizierung ahnen. Das Atelier von Alexia Krauthäuser liegt nicht direkt hier, an den Achsen von Ackerstraße und Birkenstraße. Der Weg führt einige wenige Meter weiter durch eine Eisenbahnunterführung, und dann landet man plötzlich in einer anderen Welt, auf einer ruhigen Wohnstraße mit breitem Bür-
Nessel, 110 x 180 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić
gersteig. In einem dieser Häuser befindet sich das Atelier im dritten Stockwerk. Es besteht aus zwei langgezogenen Räumen, sehr funktional, nichts lenkt von der konzentrierten Arbeit ab. Der eine Raum dient als Teeküche, zur Besprechung und in Teilen als Lager, um Gemälde und Zeichnungen bereitzuhalten und Ausstellungen vorzubereiten. Im anderen malt sie. Jetzt hängen hier für den Besuch die jüngsten Gemälde, dazu die kleinformatigen Malereien auf Papier, in denen oftmals Figuren aus privaten Fotos oder Zeitschriften collagiert sind. Erst recht bei diesen umgibt ein kreiselnder Farbstrom die Menschen. Das gesamte Format ist nun wie aus einer malerischen Bewegung heraus aktiviert und auch hier können sich kleinere Szenen neben dem großen Geschehen abspielen. Mitunter beziehen sich die Papierarbeiten und die großen Leinwände aufeinander, die Motive und Themen werden auf diesen weiterverfolgt und gewinnen an narrativer Vielschichtigkeit. Sowieso entstehen immer mehrere Bilder gleichzeitig, schon infolge der Trocknungsphasen und weil es hilfreich ist, zwischendurch Abstand zu gewinnen. Die Bilder würden zunächst aber lange im Kopf reifen, ehe es an die Malerei gehe, sagt Alexia Krauthäuser. Und erst dann „denkt“ sich das Bild zu Ende, ergänzen sich die Ereignisse und die malerischen Verfahren. Mit der gedämpften Tonalität verlagert sich das Geschehen weiter in die Innenwelt, und schließlich taucht sie selbst als Figur oder Porträt in einigen der Bilder auf Leinwand und Papier auf.
So wie die Darstellung des Wischens des Bodens (und vielleicht ja auch schon des Spielens mit den Fingern im Wasser) ein Hinweis auf das eigene malerische Handeln zum Bild hin ist, so wird der Einbezug von Zitaten aus der Kunstgeschichte zur Malerei über Malerei. Dann fällt etwa auf, dass in Vergebung exemplarisch Etappen der Geschichte der geometrischen Abstraktion aufeinander folgen. Der Realismus scheint sich dagegen zu formieren, indem er die geometrischen Intarsien abzuwaschen versucht, und läuft dabei selbst Gefahr, in einem Wasserfall weggespült zu werden. Das ist nur eine der Thesen und Seitenwege, die sich in diesen Bildern finden können.
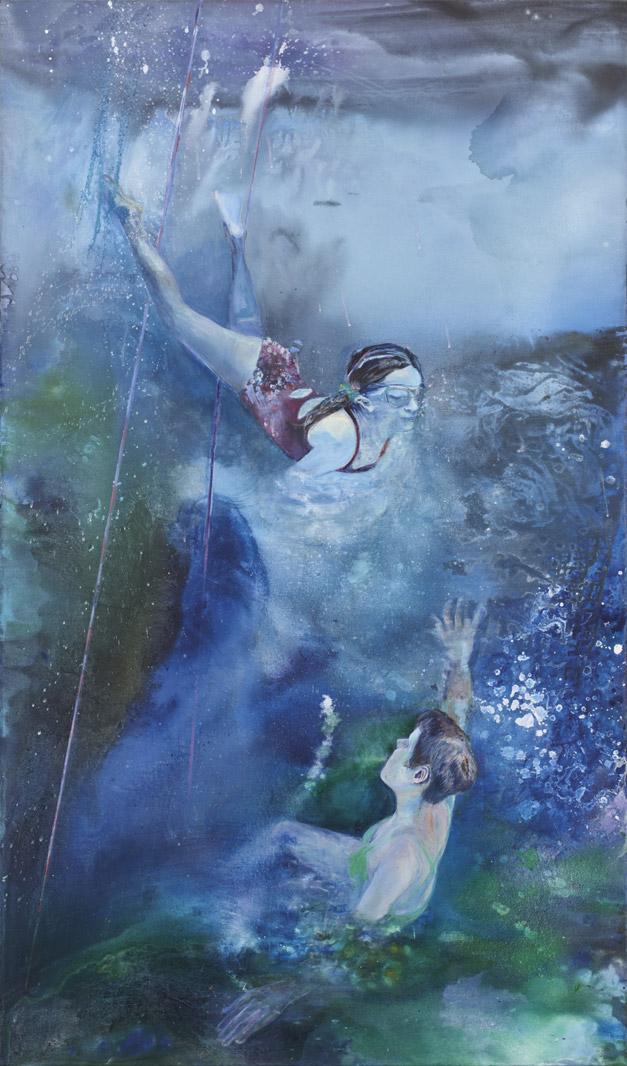
[6] Unter Wasser, 2022, Mischtechnik auf Nessel, 170 x 100 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

Um wie viel mehr liegt diese zugelassene und ausgearbeitete Multiperspektivität dann in der Symbolik der Expedition vor, die in ungesichertem, unerforschtem Gelände stattfindet – auch das ein Querverweis auf die Malerei, die ihr Ziel noch nicht kennt, aber einer Spur folgt. Einflüsse auf dem Weg zur Bildentstehung sind das Theater und der Film mit den Verfahren der Simultaneität, des Berichtes auf dem Off (der noch durch die Anwesenheit des Erzählers gestärkt wird), des Kippens der Perspektive, der Kamerafahrt hin zur räumlichen Distanznahme und damit zur vermeintlichen Übersicht. Oder denken wir an die Schilderung eines
kreiselnden, aufschäumenden Nebels, der körperhafte Präsenz und undurchdringliche Substanz besitzt, in Andrej Tarkowskijs „Stalker“. Der japanische Fotograf Hiroshi Sugimoto hat in seiner berühmten Werkgruppe der Kinosäle in den grandiosen Filmkunsttheatern eine eigene Essenz für das bewegte Bild und sein Licht gefunden, indem er Filme, die auf den Projektionswänden von Anfang bis Ende abliefen, in einem einzigen fotografischen Bild als Langzeitbelichtung aufgenommen hat. Was auf seinen Fotografien schließlich auf der Kinoleinwand zu sehen ist, ist ein durchgehendes lichtes Weiß. Ausgehend von ihrem Respekt
[7] Siblings, 2024, Mischtechnik auf Nessel, 165 x 180 cm, Foto: Alexia Krauthäuser.

für Sugimoto übernimmt Krauthäuser nun die Architektur dieser Filmpaläste und seinen Bildaufbau. In einem Bild aus zwei unterschiedlich großen Malereien zeigt sie zentriert auf der Kinoleinwand, auf einer Bühne etwas zurückgesetzt, einen Tiger bzw. ein Lamm, welche sie Werken von Adolf von Menzel und Francisco de Zurbarán entnommen hat (Tiger and Lamb, 2021 bzw. 2020). So präsent, ja aggressiv-schläfrig sich der Tiger in seiner exotischen Kreatürlichkeit schier aus der Leinwand heraus aufrichtet, so abwesend und in sich versinkend wirkt das Lamm, bei dem es sich in der Kunstgeschichte um das Agnus Dei handelt. Hier ist
der Innenraum leer, dämmerig zwar, aber in seiner ganzen großzügigen Pracht des Vergangenen ausformuliert und als Erinnerung an einstige Zeiten gegeben. Ganz anders der Kinosaal mit dem Raubtier in seiner Mitte. Er zieht sich fast klaustrophobisch wie eine geschlossene Kammer mit hoher Decke zusammen, die mit ihren Leuchtkugeln fast in ein Himmelszelt überzugehen scheint. Er beherbergt, an die Seite gerückt, nur einen gewöhnlichen Stuhl. Auf diesem sitzt, in Rückenansicht beobachtet von der Galerie, eine Frau mit Brille und Kurzhaarschnitt in geringeltem Pullover und hellen Turnschuhen, die mit der linken Hand auf einen Block
[8] Crash, 2024, Mischtechnik auf Nessel, 160 x 180 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sari

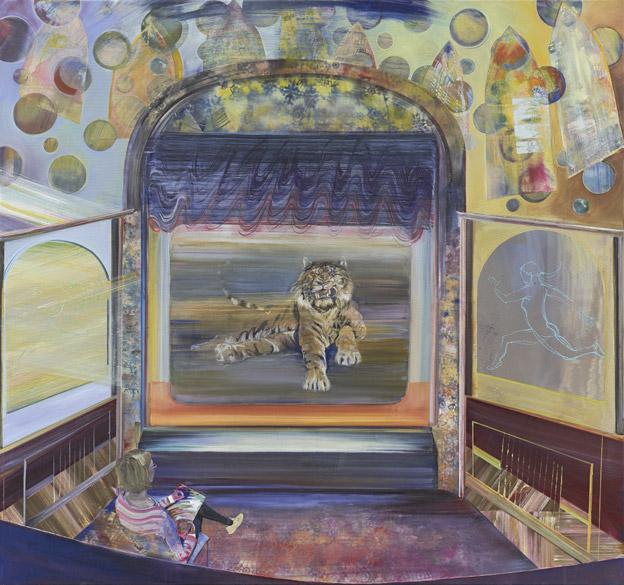
zu zeichnen scheint. In der Vereinzelung und Konzentration ist sie ganz bei sich. Wie schon bei dem frühen Blick aus dem Zugfenster, trifft der Mensch auf eine von ihm getrennte Natur. Nun aber ist die erfassende, malende Person selbst sichtbar, ihr Resonanzraum ist erfasst und das Bild des Tigers selbst wird von oben durch einen Vorhang definiert. Sind die freilebenden Tiere real und direkt der Anschauung in der Landschaft entnommen oder doch nur Teil der Kunstgeschichte oder hier nun Szenen eines Filmes – oder ist nicht überhaupt alles eine Fiktion, wie es in „Mullholland Drive“ von David Lynch heißt? Alexia Krauthäuser ist Augenzeugin und macht uns zu Komplizen. Und dann wird deutlich, wie sehr es ihr bei ihren rätselhaften Bildern vor allem um das Bewusstwerden des Elementaren unserer Welt geht. Wie sich der Mensch als Teil der Erde zurechtfindet und in dieser unerschöpflichen Vielfalt seinen Ort und seine Berufung sucht. Wie er im besten Fall Verantwortung übernimmt. Damit verbunden ist hier die Frage, was die Malerei zu leisten vermag: Was kann man tun, wenn man, mit dem Blick von außen, bereits mittendrin ist.#
Thomas Hirsch
[9] Tiger and Lamb, 2020, Mischtechnik auf Nessel, 100 x 100 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić
[10] Tiger and Lamb, 2021, Mischtechnik auf Nessel, 145 x 155 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić
Alexia Krauthäuser
1971 in Bergisch Gladbach geboren, lebt und arbeitet in Düsseldorf
1993–1995 Studium an der Kunstakademie Münster
1995–2001 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf
2000 Meisterschülerin von Professor Jan Dibbets
2001 Förderpreis für Malerei der Kunstakademie Düsseldorf
Akademiebrief
2003 Publikumspreis des EMPRISE Art Award, NRW-Forum, Düsseldorf und Kunstmuseum Baden, Solingen
2012–2014 Lehrauftrag für Zeichnung an der Universität Siegen
2014 Gründungsmitglied der Künstlerinnengruppe Terrain Vague
2020/21 MKW Stipendium des Landes NRW
2021 Stipendium Neustart Kultur des BBK Berlin 2. MKW Stipendium des Landes NRW
2025 Eigenart Kunstpreis, Bremervörde
Einzelausstellungen (Auswahl)
2025 onomato künstlerverein, Düsseldorf (mit Christian Heilig, Oktober) Fünfzehnwochen, Düsseldorf (Oktober)
2024 Siblings, SITTart, Raum für Kunst, Düsseldorf (mit Christian Heilig)
2023 Crash, Städtische Galerie Lehrte As if, Suitberga, Düsseldorf
2022 … und Du lächelst zurück, Versöhnungskirche, Diakonie Düsseldorf
2018 Soloexhibition, produzentengalerie plan.d., Düsseldorf (mit Christian Heilig)
2016 Kunst im Rathaus, Rathaus Korschenbroich
2015 Life is dreaming me, HWL Galerie und Edition, Düsseldorf (mit Maren Klemmer)
2013 Unternehmen Kunst, Firma Tünkers, Ratingen Behind my back, Kaiserswerther Diakonie – Mutterhaus, Düsseldorf (K)
2011 Recent works, McKinsey & Company, Düsseldorf (mit Florian Fausch) Rauschen, Stiftung Burg Kniphausen, Wilhelmshaven
2009 Naturimpressionen, Galerie Alte Lateinschule, Viersen (mit Simi Larisch)
Malerei 2006–2009, Dot and Line 1, Düsseldorf Fluten, Baustelle-Schaustelle, Essen
2007 Kanzlei Taylor Wessing, Düsseldorf
2006 Im Grünen – im Blauen, Duetart Gallery, Varese (mit Katrin Roeber, K)
Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2025 …und wir fangen gerade erst an, Künstlerinnen und Künstler des VdDK 1844, Kunsthalle Düsseldorf
2024 Eigenart Kunstpreis, Bremervörde Dix, Terrain Vague, Geburtstagszimmer, Stadtmuseum Düsseldorf (K)
2022 Das letzte Hemd hat keine Taschen, Galerie Peter Tedden, Oberhausen (K)
Wer will was von wem woraus oder: Wenn’s der Wahrheitsfndung dient, Galerie Peter Tedden, Düsseldorf (K)
2021 Auf Spurensuche im verregneten Himmelblau, CABINETT, Düsseldorf
Paradiesmomente, onomato künstlerverein, Düsseldorf
2020 Blickdicht, onomato künstlerverein und MHKBG des Landes NRW, Düsseldorf (K)
Zeitzeugen, CABINETT, Düsseldorf
2016 Schafen und Vergessen, Terrain Vague, Galerie SK, Solingen
2015 It‘s so beautiful, but it‘s not true, Terrain Vague, Amts- und Landgericht Düsseldorf
2014 Verfechtungen, Terrain Vague, Kunstdepot Brühl (K)
2013 Nordwestkunst – Die Nominierten, Kunsthalle Wilhelmshaven (K)
2012 Doppelbrand, Dujardinhallen, Krefeld
2010 Schwerelose Zeiten, Städtische Galerie – Der Turm, Schwalmtal
2009 La route, Fondation Colas, Boulogne-Billancourt
2008/2007/2006/2005 Auktion, Neuer Aachener Kunstverein, Aachen
2008 Afternoon of a Düsseldorf Faun, Galerie Andreas Brüning, Düsseldorf
2007 Der Sommer kommt bestimmt, Wissenschaftspark Gelsenkirchen Chris and friends, montanaberlin, Berlin
2004/2003/2002 Große Kunstausstellung NRW, Museum Kunstpalast, Düsseldorf (K)
Publikationen (Auswahl)
2024 Terrain Vague. Dix mit einem Text von Dr. Annette Krapp
2021 Alexia Krauthäuser. Changing my Stripes mit einem Text von Dr. Maria Müller-Schareck, Verlag Peter Tedden
2014 Terrain Vague. Verfechtungen mit einem Text von Erik Schönenberg
2013 Alexia Krauthäuser. Behind my back mit einem Text von Dr. Thomas Hirsch
2006 senza spazio, 3 cm di arte contemporanea, Duet editore, Duetart Gallery, Varese
Exotisch, hauchdünn und praktisch unverwundbar

Lackkunst überbrückt Kontinente, dient unterschiedlichsten Zwecken und macht das Leben schöner
Seit Jahrtausenden wird in China das Harz des Lackbaums genutzt, um Oberfächen zu veredeln und Gegenstände ornamental zu verzieren. Somit zählt die Lackkunst zu den ältesten Kunsthandwerkstraditionen der Welt. Nicht nur wegen seiner vielseitigen Materialeigenschaften ist getrockneter Lack ein idealer Bildträger der Dekorationskunst – sowohl in Asien als auch in Europa. Nahezu unbegrenzt ist auch sein Anwendungsbereich. Weshalb die „Faszination Lack“ bis heute nachwirkt, kann man in einer Ausstellung des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster erfahren.
Wenn der Satz „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ (zugeschrieben Karl Valentin) eine Berechtigung hat, dann für die Lackkunst. In China, dem Mutterland der später in viele Länder exportierten Technik, zählt sie seit mindestens 5000 Jahren zu den Spitzenerzeugnissen des Kunsthandwerks. Ursprünglich als Schutz vor Feuchtigkeit oder Korrosion zum Einsatz gebracht, entwickelte sich der Chinalack zur „Allzweckwaffe“ der Dekorationskunst. Er verschönerte Geräte und Gefäße, Möbel und Bilder. Doch woher rührt der enorme Arbeitsaufwand? Bis zu 200 Schichten der harzhaltigen flüssigen Substanz müssen aufgetragen und unermüdlich poliert werden, um den charakteristischen Glanz zu erzielen und die Oberfläche (nahezu jedes Materials) praktisch unverwundbar zu machen. Nach dem Aufbringen einer hauchdünnen Lackschicht folgt eine Trockenphase, bevor die Arbeit fortgesetzt werden kann.
Am Anfang steht der Lackbaum
Ein mühsames Prozedere. Das gilt auch für den Aufwand, der betrieben werden musste, um den Rohstoff zu gewinnen. Was bei diesem ungewöhnlichen Akt der Forstwirtschaft alles zu beachten ist, erfährt man gleich am Eingang der Sonderausstellung „Faszination Lack – Kunst aus Asien und Europa“, die das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster bis Ende Juli zeigt. Chinesische oder japanische Lackbäume, die das Alter von 15 Jahren erreicht haben, liefern den besten Ertrag. Um den grauweißen UrushiSaft aufzufangen, wird die Rinde eingeschnitten. Allerdings mutet die Ausbeute kümmerlich an: Pro Baum können maximal 250 Milliliter Lack geerntet werden. Nachdem dieser – zudem giftige – Saft gesiebt und gefiltert wurde, kann man ihn entweder ohne weitere Zusätze als Transparentlack verwenden oder ihn durch das Mischen mit bestimmten Pigmenten einfärben.
[1] Kutschenpaneele: Vor erdfarbenem Braunlack heben sich zwei Chinesenfiguren in blauer Camaieu-Malerei ab, Frankreich, um 1750, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.


Kein Fun-Fact für Baumliebhaber: Die Prozedur setzt dem Lackbaum derart zu, dass er nur wenige Male angezapft werden kann. Bei der ertragreichsten Methode namens „Koroshi-gaki“ („Tötungs-Anzapfung“) erleidet der Baum infolge der Ernte gar einen mortalen Kollaps. Der Beliebtheit der Lackkunst tat das freilich keinen Abbruch. Von China aus verbreitete sie sich nach Japan, in andere asiatische Länder, dann in den arabischen Raum und seit dem 16. Jahrhundert nach Europa – im Schlossbau des Barock und Rokoko erfreuten sich Lackkabinette mit Chinoiserien größter Beliebtheit.
Beim Umschlag der Exportlacke, einem frühen Beispiel für Globalisierung, nimmt die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) eine Schlüsselposition ein: Aufgrund eines über zwei Jahrhunderte währenden Handelsmonopols mit Japan konnte die niederländische Ostindien-Kompanie (gegründet 1602) auch lackmäßig aus dem Vollen schöpfen. Die wichtigsten Stationen
und gängigsten Seerouten des Handels mit fernöstlichen Lackarbeiten sind in der Münsteraner Ausstellung auf einer Weltkarte festgehalten.
Hochwertig versiegelt
Wenn Herrscher, Fürstenhöfe und wohlhabende Kunstliebhaber weder Kosten noch Mühe scheuten, um an Lackobjekte zu gelangen, lag dies an den unvergleichlichen Merkmalen des Materials. Glatt, glänzend, gleichmäßig und als hochwertige Versiegelung für beinahe jede Fläche geeignet – diese Eigenschaften zeichnen getrockneten Lack besonders aus. Ein weiterer Vorteil: Chinalack lässt sich nicht nur als Bindemittel für Farben (insbesondere Zinnober für Rot) nutzen; zudem eignen sich die lackierten Oberflächen hervorragend als Basis für Schnitzarbeiten. Das vielleicht größte Plus besteht jedoch in der außergewöhnlichen Flexibilität: Möbel, Kästen und Kästchen, Schatullen und Etuis, Vasen und
[2] Tabatiere, Wirbelrosette, Frankreich, um 1750, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek. [3] Picknickset, Japan, 1869–1912, Linden-Museum Stuttgart, © Linden-Museum Stuttgart, Foto: A. Dreyer.
[2]
[3]

Geschirr, Bonbonnieren und Tabatieren [2], Kämme, Operngläser, Fächer, ja sogar ein praktisches Picknickset [3], wie es etwa im Linden-Museum Stuttgart zu entdecken ist – Lackkunst kommt in unterschiedlichsten Zusammenhängen zur Anwendung und veredelt Kunst und Alltag.
gend sind unter anderem das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster (dazu mehr unten), das Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Linden-Museum Stuttgart.
Von China träumen
Wer heutzutage nach Museen Ausschau hält, die über exquisite Lackkunst-Bestände verfügen, wird schnell fündig. Das Palastmuseum Peking, das Nationalmuseum Tokio, das Metropolitan Museum in New York und das Victoria and Albert Museum in London gehören zu den besten Adressen. Hierzulande herausra[4] Reisweinflasche in Gestalt des Glücksgottes Hotei, Japan, 17. Jahrhundert, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, Foto: Claus Cordes.
Die meisten der ungefähr 150 japanischen und knapp 60 chinesischen Lackarbeiten, die das Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig besitzt, erwarb Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714). Der gesamte Bestand wurde
1990 in einem Katalog publiziert. „Fernöstliches“, heißt es dort im Vorwort über die Sammlermotivation und den geistesgeschichtlichen Hintergrund des aufgeklärt-absolutistischen Herrschers, „ermöglichte dem Herzog – spezifisch eigenen Vorstellungen folgend – über China zu ‚träumen‘; es war für ihn ein Anreiz, über Bindungen von Ost und West nachzudenken.
Anton Ulrich schwebte wohl eine Symbiose des Denkens vor, wie es sich auch im Bau verschiedener Gartenarchitekturen in Salzdahlum offenbarte, im Nebeneinander einer Pagode und eines christlichen Sakralbaus. Für die Ausbildung des Gedankengutes, das dieser Kombination zugrunde lag, spielte wohl Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), der berühmte Philosoph, Mathematiker und Bibliotheksdirektor Anton Ulrichs, eine besondere Rolle. Dieser stellte chinesische und europäische Kultur im Vergleich gegenüber, um aus der Erkenntnis von Unterschieden heraus einen Austausch geistiger Errungenschaften anzuregen. Als solche erkannte Leibniz etwa die Tiefe des Gedanklichen im Westen und die Schärfe des Beobachtens und Abfassens im Osten.“ Von Hotei [4], einem der Sieben Glücksgötter Japans, erhoffte sich Anton Ulrich vielleicht eine glückliche Fügung der Regierungsgeschäfte und des privaten Lebens.
Bis vor Kurzem besaß Deutschland sogar das einzige Spezialmuseum, das sich ausschließlich dieser Kunsttechnik widmet: Das Museum für Lackkunst, betrieben von der in Münster ansässigen BASF-Sparte Coatings, vereinte rund 1200 Objekte. Weil der Unternehmensbereich Lack der BASF-Gruppe seine Sponsoring-Aktivitäten auf den Bereich Bildung konzentrierte, passte ein Museum nicht mehr ins Portfolio. Im Januar 2024 war der Lack ab und das Haus an der Windthorststraße wurde geschlossen.
Münster, Mekka der Lackkunst
Zum Glück wurde die Kollektion nicht über den Kunsthandel veräußert – dies hätte vermutlich zur Zerschlagung der Sammlung geführt. Weil BASF Coatings (der Unternehmensbereich des Chemie-Giganten, der auf Fahrzeug-, Autorepa-

ratur- und Industrielacke spezialisiert ist) dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) den kompletten Fundus für den symbolischen Preis von einem Euro übereignete, gelangten die kostbaren Objekte samt und sonders in das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. „Es gibt weltweit keine vergleichbare Sammlung mit dieser Breite und Tiefe“, sagt Patricia Frick, Kuratorin für Lackkunst am Museum. „Andere Sammlungen sind zum Beispiel auf asiatische oder europäische Lackkunst spezialisiert, zeigen aber nicht die Entwicklungen in Asien, der islamischen Welt und Europa über die Jahrhunderte auf.“
[5]
Weinbecher mit Deckel, China, 3. Jahrhundert v. Chr., LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.

Aus diesem opulenten Fundus hat Patricia Frick eine Auswahl für die aktuelle Sonderschau zusammengestellt. Das älteste Objekt, ein Weinbecher mit Deckel [5] , stammt aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert und wurde bei Ausgrabungen in einer chinesischen Grabanlage entdeckt. Obwohl das archaische Behältnis auf dreibeinigem Standring kaum eine Gemeinsamkeit mit den späteren filigran-eleganten Lackobjekten aufweist, vermittelt die äußere Beschichtung mit bräunlich verfärbtem schwarzen Lack und drei Dekorbändern in leuchtendem Rot einen Eindruck von der höfischen Eleganz der damals herr-
schenden Qin-Dynastie. Die jüngsten Exponate schufen Heri Gahbler, einer der wenigen europäischen Spezialisten für japanische Lackkunst (Urushi), und der japanische Künstler Noguchi Ken [6]
Lack-Lesestof
Zur faktischen BASF-Schenkung gesellte sich reichlich Lesestoff: eine Bibliothek mit historischen Rezept- und Vorlagenbüchern zum Thema Lack. Erstaunlich, wie umfangreich und vielfältig die Literatur zum Thema im 18. und 19. Jahrhundert war; oft finden die lackspezifischen Aspekte Berücksichtigung im Zusammenhang von Gesamtdarstellungen, in denen beispielsweise die Zubereitung von Farben, das Firnissen und das Vergolden behandelt werden. So veröffentlichte Johann Conrad Gütle („Privatlehrer der Mathematik, Naturlehre und Mechanik“) 1793 die Anleitung „Gruendlicher Unterricht zur Verfertigung guter Firnisse nebst der Kunst zu Lakiren und zu Vergolden nach richtigen Grundsaetzen und eigener Erfahrung fuer Kuenstler, Fabrikanten und Handwerker“. Wenige Jahre später, 1798, versprach Johann Ludwig Schreck („Chyrurous der Chymie und Medicin“) Aufschluss über „allerley erdenckliche geheime Lackier- und Firneis-Künste“.
Mitunter sind die praktischen Hinweise bei den Lackrezepturen gepaart mit alchemistischem Insiderwissen. Das war bei der Lackkunst besonders gefragt: Weil der Saft des asiatischen Lackbaumes den Transport nach Europa nicht unbeschadet überstand und die Bäume selbst für die Anpflanzung auf artfremdem Terrain nicht geeignet waren, mussten die europäischen Lack-Pioniere auf Ersatzmaterialien ausweichen. Mit hierzulande gebräuchlichen Ölen, Harzen und Bindemitteln versuchten sie, sich den asiatischen Originalen möglichst weit anzugleichen. Was Härte und Widerstandsfähigkeit angeht, blieben die europäischen Erzeugnisse jedoch trotz aller Bemühungen hinter echtem Urushi-Lack zurück.
Takuya.
Noguchi Ken, Objekt „Swaying Vessel 17“, Trockenlack, Japan, 2019, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Asakura

Garten in Gefäßform:
Jede Zone der zinnoberroten
Lackbeschichtung der Vase aus China ist mit foralen Motiven geschmückt.
Armer Lack für reiche Leute
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist das Lacca-Povera-Kabinett von Schloss Augustusburg in Brühl (bei Köln). Dieses Anwendungsbeispiel für ‚armen Lack‘ war Teil des Gelben Appartements, das 1944 durch einen Bombenangriff zerstört wurde. Glücklicherweise konnten Teile der Ausstattung gerettet werden. Bei der Lacca-Povera-Technik, die in Norditalien entwickelt wurde, verwendete man ausgeschnittene farbige Kupferstiche, klebte sie auf Holz und überzog dieses mit mehreren Schichten Lack, um mit der ostasiatischen Optik gleichzuziehen.
Vergleichbar ist der Vorgang mit der Anverwandlung eines anderen fremden, in seiner Zusammensetzung lange unergründlichen Materials – des Porzellans. Es wurde ebenfalls aus Ostasien nach Europa importiert und war nicht zuletzt deshalb so begehrt, weil das Wissen um die Verfertigung des „weißen Goldes“ in China so sorgsam gehütet wurde wie ein Staatsgeheimnis. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts gelang es in Dresden, dem Mysterium der Porzellanherstellung auf die Spur zu kommen.
Einige Beispiele der Lack-Literatur sind nun im LWL-Museum für Kunst und Kultur zu sehen. Patricia Frick, die ihre Kenntnisse der Materie als langjährige Kuratorin am Museum für Lackkunst erworben und als unverzichtbare Zugabe ins Landesmuseum mitgebracht hat, entschied sich für eine dreiteilige Untergliederung der Sonderausstellung. Im ersten Teil geht es um frühe Beispiele chinesischer Lackkunst, flankiert von Perlmutt- und Goldstreulacken Koreas und Japans sowie von den Exportlacken, die für den Westen gefertigt wurde.
Der zweite, womöglich noch spannendere Part der Schau (die sich in einem dritten Teil der zeitgenössischen Lackkunst widmet) befasst sich mit den sogenannten Exportlacken: „Diese Arbeiten“, erläutert Patricia Frick, „wurden seit dem späten 16. Jahrhundert in Asien für den westlichen Markt geschaffen und unterscheiden sich wesentlich von Objekten, die für eine
[7]
Vase, roter Schnitzlack, China, 15. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.
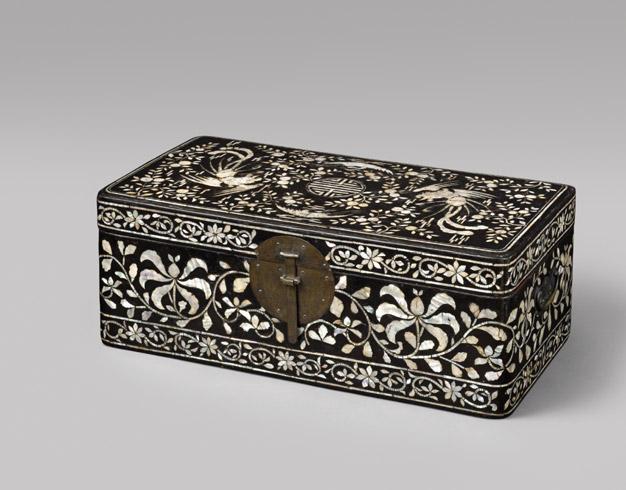

[8] [9]
asiatische Käuferschaft gefertigt wurden. Sie schlagen eine Brücke zwischen den Welten und sind Zeugnis frühester Verbindungen zwischen Ost und West.“ Zum anderen findet man in Raum 2 jene Lackarbeiten, die von europäischen Kunsthandwerkern geschaffen wurden. Faszination für das exotische Medium und kreatives Experimentieren mit dem fremden Werkstoff, hier gehen sie eine bemerkenswerte Allianz ein. Lackkunst erwies sich auch in kunsttopografischer Hinsicht als Schmelztiegel.
Malerei im chinesischen Stil
Bereits im 17. Jahrhundert wurde die asiatische Lackmalerei in Europa nachgeahmt; vorzugsweise firmierte sie damals unter dem Etikett „Malerei im chinesischen Stil“. Holland und England waren die ersten Zentren der europäischen Lackproduktion. Um 1700 gesellte sich Deutschland hinzu. Hervorzuheben sind vor allem Berlin und Dresden, wo der Hoflackierer Martin Schnell unter August dem Starken zu den gefragtesten Kunsthandwerkern gehörte. Das Zentrum der deutschen Lackkunst lag jedoch in Braunschweig, wo die Stobwasser-Manufaktur (gegründet 1763) ansässig war. Ihre Tabakdosen, Tabletts und Kleinmöbel, von denen jetzt in Münster etliche Beispiele zu bewundern sind, zielten vor allem auf das gehobene Bürgertum.
In Frankreich wurde die Lackkunst im 18. Jahrhundert maßgeblich durch die Brüder Martin geprägt – ihre Luxusprodukte konnte sich nur leisten, wer zur Haute volée gehörte. Mit ihrem besonders glänzenden, zudem widerstandsfähigen „Vernis Martin“ gelang Guillaume und Robert Martin ein derart hochwertiges Imitat, dass ihr Name bald als Gattungsbegriff für französische Lackkunst schlechthin gebräuchlich war. Möbel, Wandvertäfelungen, Kutschen, Sänften, Dosen oder Galanteriewaren – überall sorgte „Vernis Martin“ für perfekten Oberflächenglanz. Auch in Münster stößt man auf zahlreiche delikate Lackobjekte aus der Werkstatt der Gebrüder Martin – beliebt waren vor allem ihre Bonbonnieren, Tabatieren und Nadeletuis.
Furioses Schnitzwerk auf engstem Raum
Dass Lack nicht gleich Lack ist, lernt man rasch beim Gang durch die Ausstellung. Die gebräuchlichste Technik in China war der Schnitzlack: In den Lackgrund, aufgebaut aus unzähligen millimeterdünnen Schichten, wird der Dekor eingeschnitten. Eine Vase aus rotem Schnitzlack [7] (China, 15. Jahrhundert), bloß rund 15 Zentimeter hoch, führt den Furor des Schnitzwerks besonders eindrucksvoll vor Augen: Bauch, Hals und Mündung, jede Zone der leuchtend zinnoberroten Lackbeschichtung ist mit floralen Motiven geschmückt. Ein Garten in Vasenform.
[8] Kleiderkasten, Schwarzlack mit Perlmutteinlage, Korea, 18. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek. [9] Behältnis in Form eines Kleeblatts mit Dekoration aus Chrysanthemen, Korea, wohl 12. Jahrhundert, Metropolitan Museum, New York, Public Domain.
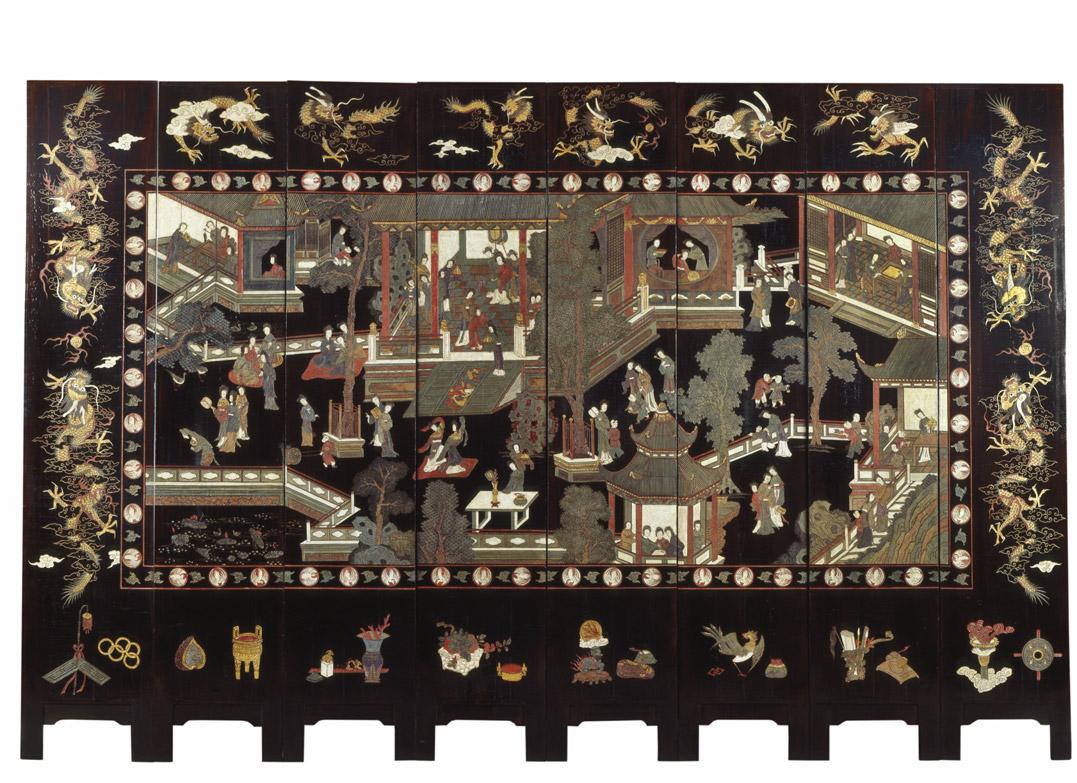
Bei Lackobjekten mit Perlmutteinlagen dient der meist schwarz glänzende Lackgrund als Basis für Schmuckelemente, die aus Perlmutt ausgeschnitten und in die passgenauen Vertiefungen des Untergrundes geklebt werden. Mit Transparentlack überfangen und sorgsam poliert, erscheint die Oberfläche wie aus einem Guss. Eine auf Hell-Dunkel-Kontrast beruhende Material-Verschmelzung, die in Münster unter anderem in Gestalt eines Tabletts mit blühendem Pflaumenzweig (China, 14. Jahrhundert) und eines Kleiderkastens aus Korea [8] (18. Jahrhundert) Gestalt annimmt. Keine Überraschung, dass das Metropolitan Museum in New York, dessen Sammlung asiatischer Kunst mit über 35 000 Objekten zu den weltweit größten gehört, auch in Sachen Lackkunst mit Perl-
muttintarsien aus dem Vollen schöpfen kann. Zu den schönsten Exemplaren zählt eine kleeblattförmige Dose mit ChrysanthemenSchmuck [9], die wohl im 12. Jahrhundert in Korea entstanden ist.
Eine weitere, der japanischen Lacktechnik zugehörige Spielart ist das Streubild – auch hierfür bietet die Ausstellung in Münster kostbares Anschauungsmaterial, darunter einen Kabinettschrank mit gestreutem und eingelegtem Dekor, der um 1620 in Japan entstanden ist. Die Vorgehensweise: Fein gemahlenes Goldpulver (seltener auch Silber- oder Kupferpulver) wird durch ein Röhrchen auf den noch feuchten, meist schwarzen Lackgrund gestreut, um so den Dekor zu gestalten.
[10] Achtteiliger Stellschirm mit dem
Dekor „Palastszenen“, China, 18. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Foto: Tomasz Samek.
Nahezu alles war möglich
Nicht nur, was Einsatzfelder und Motive angeht, weist die Lackkunst eine weite Streuung auf. Auch bei den Dimensionen der mit Lack verzierten Objekte ist nahezu alles möglich. Raumfüllend beispielsweise ein achtteiliger Stellschirm [10] (China, 18. Jahrhundert), der ein ganzes Palastszenario vor unseren Augen entfaltet. Ein Hortus conclusus mit Pavillons und anderen Gebäuden, bevölkert von einer vornehmen Hofgesellschaft, die sich von den Unbilden des gemeinen Lebens abgeschirmt hat. Umgrenzt wird die Spanische Wand fernöstlicher Prägung von goldenen Drachen (anders als hierzulande dient das Fabelwesen in China als Sinnbild für Leben, Reichtum, Macht und Glück), einer Vogelmedaillon-Bordüre und einer Fülle von umlaufend eingeschnittenen Ziermotiven.
Virtuosität in der Gürtelzone
Das andere Ende der Größenskala besetzen die Inro [11]. Das japanische Wort bedeutet wörtlich „Siegelkorb“. Weil die traditionelle japanische Kleidung keine Taschen hat, fanden kleine persönliche Gegenstände (beispielsweise Münzen, Medikamente oder Tabak) Aufnahme in den Inro-Behältnissen. Seit dem 17. Jahrhundert befestigte sie der wohlhabende Japaner am Gürtel seines Kimonos. Vervollständigt wurde die Ausstattung mit dem Ojime (zum Straffziehen der Schnur) und dem Netsuke, das als Gegengewicht des Inro für die Balance sorgte.
Das Miniaturformat der Lackdöschen nebst ihrer Accessoires bot den japanischen Meistern Gelegenheit, ihre handwerkliche Virtuosität auf kleinem Raum zu demonstrieren. Bei der Verzierung der Oberflächen kam häufig die MakieTechnik zum Einsatz. Hierbei werden Goldoder Silberstaub in den Lack eingearbeitet. So abwechslungsreich die Gestaltung, so unerschöpflich die Motive: Das Repertoire der Inro und Netsuke reicht von Pflanzen und Tieren bis hin zu literarischen und historischen Themen. Drollig, allemal bizarr ein japanisches Netsuke [12], das einen kleinen Jungen mit Maske zeigt (19. Jahrhundert, Metropolitan Museum, New York). Ein clownesker Gürtelschmuck.

[11] Inro mit Jagdfalken, Japan, 1. Hälfte 19. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster. Foto: Tomasz Samek.

Chinoiserien –Bühne für eine Märchenwelt
Die Faszination für das Fremde zieht sich seit der Renaissance als Kontinuum durch die Kultur- und Kunstgeschichte. Flankiert wurde diese Faszination von einem Hang zur Nachahmung, der meist eher freie Variation als akkurates Nachbuchstabieren war. Das gilt für Orientalismus, Ägyptomanie, Primitivismus und Japonismus. Und es gilt für die Chinoiserien, die sich im 17. und 18. Jahrhundert als extravagante Elemente höfischer und bürgerlicher Wohnkultur größter Beliebtheit erfreuten. Und zwar sowohl in Architektur und Raumgestaltung als auch in Malerei, Skulptur und Kunsthandwerk. Auf der Bühne der Chinoiserien erscheint eine Märchenwelt: Sie besteht aus Pagoden und Pavillons, Landschaften mit spitzen Bergen, krummen Bäumen und Brücken, Drachen, Phönixen und exotischen Vögeln, Mandarinen, Teezeremonien und Musikanten.
Eine wunderlich-wunderbare Gemengelage, zudem spielerisch kombiniert mit Versatzstücken, die auf indische, persische und osmanische Einflüsse zurückgehen. Lackobjekte europäischer
Provenienz gehörten zu den bevorzugten Tummelplätzen dieser Chinoiserien. Die Ausstellung in Münster zeigt eine Reihe von Nadeletuis [13] französischer Provenienz, deren Ikonografie von einem legeren Crossover zeugt: Eine chinesische Parforcejagd zählte ebenfalls zu den „sujets à la mode“ wie Gemälde des hochgeschätzten Rokoko-Malers François Boucher. Außerordentlich beliebt als Etui-Zierrat: Amoretten und spärlich bekleidete Schönheiten, die der griechischen Mythologie entlehnt sind. Auch einer Bonbonniere (diente zur Aufbewahrung von Süßigkeiten), deren vergoldetes Punktmuster mit Klarlack gefüllt ist, hat Boucher auf dem Deckel den gestalterischen Stempel aufgedrückt.
Die Chinoiserien erstreckten sich sogar auf die Paneele einer Kutsche [1], wie die Ausstellung mit einem um 1750 datierten französischen Beispiel demonstriert. Als Sendboten der fernöstlichen Kultur erscheinen hier eine Frau mit Schirm und ein kniender Mann, der eine Trommel schlägt. Diese beiden Figuren, die sich in blauer Camaieu-Malerei von dem Braunlack-Hintergrund abheben, umrahmen Bordüren aus glimmerndem Aventurinlack, umschlungen von einer Girlande aus zartblauen Blü-
[12]
Netsuke mit einem Jungen mit Maske, Japan, 19. Jahrhundert, Metropolitan Museum, New York, Public Domain.
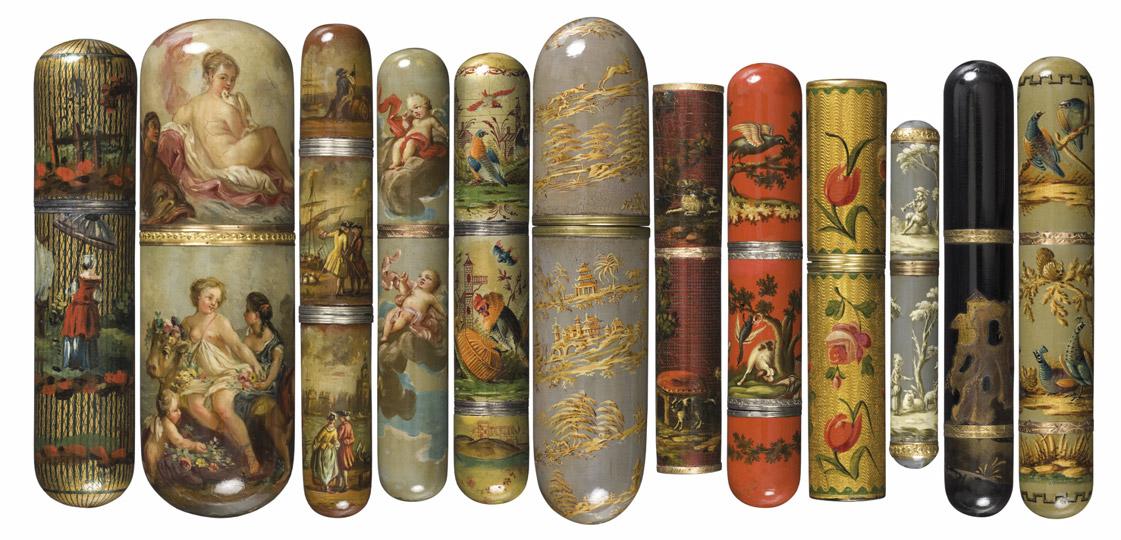
ten. Ursprünglich gehörten die Paneele zum mittleren Kastenfeld einer Berline, also einer (vergleichsweise) komfortablen Kutsche. Ein passendes Sinnbild für die weitgereiste Lackkunst.
Kleinode der Innenausstattung
Der Dekorationsreichtum kulminierte in den Lackkabinetten der barocken Schlossarchitektur. Dieses Kleinod der Innenausstattung befand sich meist im Herzen der Raumfolge. „Je näher die Vorgemächer den Herrschaftlichen Gemächern kommen, je mehr nehmen die Meublen an Kostbarkeit zu“, schreibt Julius Bernhard von Rohr in seinem Knigge für das korrekte Verhalten bei Hofe. Die Lackkunst trug ihren Teil zu dieser Prachtentfaltung bei.
wigsburg, Schloss Nymphenburg in München, Schloss Charlottenburg in Berlin oder Schloss Schönbrunn in Wien – dort und anderswo war ein Lackkabinett die Bühne für das KammerSchauspiel der Chinoiserien.
Galant lackiert
Zu den schönsten Beispielen im deutschsprachigen Raum zählt das chinesische Lackkabinett, das Herzog Eberhard Ludwig 1714–1722 in Schloss Ludwigsburg [14] einrichten ließ. Den Zuschlag dafür erhielt der Nürnberger Künstler Johann Jakob Sänger; er hatte angeboten, „ein galantlackiertes Zimmer" zu entwerfen und „in dauerhafter Lacq- und Kunstminiatur Mahlerey Arbeit“ auszuführen. Fabelwesen, Löwen und Vögel in Fantasielandschaften, hinterfangen von einer schwarzgrundigen Lackierung, bezaubern bis heute als exotische, in sich stimmige Parallelwelt.
Keine Überraschung, dass Ludwig XIV., dessen im 17. Jahrhundert errichtetes Schloss von Versailles zur Richtschnur für königliche und fürstliche Bauherren in ganz Europa wurde, auch mit seinem Lackkabinett Maßstäbe setzte; entworfen wurde es von Bernard Palissy und seinen Hofkünstlern. Das Dresdner Residenzschloss, das schon erwähnte Schloss Augustusburg in Brühl, Schloss Lud[13] Nadeletuis, Frankreich, 18. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.
Wenige Jahre später bereicherte Schloss Augustusburg den LackKosmos. Hier gesellt sich ein historisches Ereignis, das sich am 8. Juli jährt, als aktueller Aufhänger hinzu: 1725, also vor 300 Jahren,


legte der Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August von Bayern den Grundstein zum Bau seines sommerlichen „Lustund Jagdschlosses“ in Brühl. Seit 1984 zählt das Ensemble, das aus Schloss Augustusburg, dem nahegelegenen Jagdschloss Falkenlust und dem Garten im französischen Stil besteht, zum UNESCO-Welterbe. Anlässlich des 300. Geburtstags läuft dort bis Ende November 2025 die Sonderpräsentation „Über Stuck & Stein. 11 Objekte erzählen“.
„Faszination
Lack –Kunst aus Asien und Europa“, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, bis 27. Juli 2025.
Auch in Falkenlust, 1729–1737 von François de Cuvilliés d. Ä. errichtet und ausgestattet, wollte Clemens August nicht auf ein Lackkabinett verzichten. Wenn sich die Hofgesellschaft nach der Jagd zu Souper und Spiel in das intime Schloss zurückzog, lud das Kabinett mit seiner goldenen und polychromen Lackmalerei auf schwarzem Grund zum Verweilen in diesem ganz speziellen Chambre séparée ein [15]. 1725 wurde Cuvilliés zum Hofarchitekten in München ernannt. Doch der bedeutendste Gesamtkunstwerk-Schöpfer des deutschen Rokoko war ein Virtuose mit weitreichendem Radius. Daheim in München, genauer in Schloss Nymphenburg, gestaltete er 1763/64 ein Appartement im Mittelbau zum Lackkabinett um. Dabei ging man nicht zimperlich vor: Ein chinesischer Koromandel-Paravent des 17. Jahrhunderts wurde kurzerhand zerschnitten und mit Lacktafeln kombiniert, die der Porzellanmaler Johann Härringer bemalte.
[14] Lackkabinett in Schloss Ludwigsburg, 1714–1722, Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Arnim Weischer.
[15] Lackkabinett in Schloss Falkenlust, Brühl, 1729–1737, Foto: Schlösser Brühl, Verena Meier.
[15]
Labor der Moderne:
Das Wuppertaler „Lacktechnikum“
Von den Lackkabinetten [16] des Rokoko zum Bauhaus-Künstler Oskar Schlemmer (1888–1943) ist es ein harter Sprung. Der jedoch Sinn ergibt, weil Schlemmer, von den Nationalsozialisten als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt und finanziell gebeutelt, beim Wuppertaler Lackfabrikanten und Kunstsammler Kurt Herberts Zuflucht fand. Im sogenannten „Lacktechnikum“ auf dem Wuppertaler Döppersberg erforschte Schlemmer das künstlerische Potenzial des industriellen Lacks. Dabei entstanden etliche Skizzen und Entwürfe für Lackmöbel – und für ein „Lackballett“: Mensch, Raum und Bewegung, die drei Grundpfeiler seines Schaffens, hier sollten sie in Einklang gebracht werden. Das Von der Heydt-Museum Wuppertal, das zahlreiche seiner vorbereitenden Lack-Arbeiten bewahrt, hat ihnen 2019/2020 eine eigene Ausstellung gewidmet („Oskar Schlemmer. Komposition und Experiment: Das Wuppertaler Maltechnikum“).
Als Krönung seiner Experimente mit Industrielack schwebte Schlemmer ein Lackkabinett vor, zu dem er 1941/42 erhebliche Vorarbeiten leistete. Monochrome, gemusterte, ornamentale, aber auch figurative Tafeln verkleiden Wände und Decken. „Alles soll Maß und Proportion sein und von jener Feinheit, die einen zwingt, sich darin so gut zu benehmen, wie man es sich von einer fernöstlichen Gesellschaft vorstellt“, so umriss der Künstler sein Konzept, das letztlich nicht zur Ausführung kam.
Bedenkenswert bis heute seine grundsätzlichen Reflexionen über das Material: „Was ist Lack? Was ist sein Ursprung? Was ist sein Wesen?“, fragt Schlemmer. Seine Antwort: „Lack glänzt und fließt, um zuletzt hart wie Stein zu werden. […] Lassen wir ihn glänzen und fließen, lassen wir ihn Formen bilden und Form werden, wozu ihn sein Wesen drängt, wozu ihn das Gesetz des Fließens zwingt! Greifen wir ein, um seinen Lauf zu lenken, so entsteht ein Neues aus Lackgesetz und menschlichem Willen.“ Lackkunst als Sinnbild des Lebens – umfassender und tiefgründiger ist eine kunsthandwerkliche Technik wohl selten definiert worden.#
Jörg Restorf
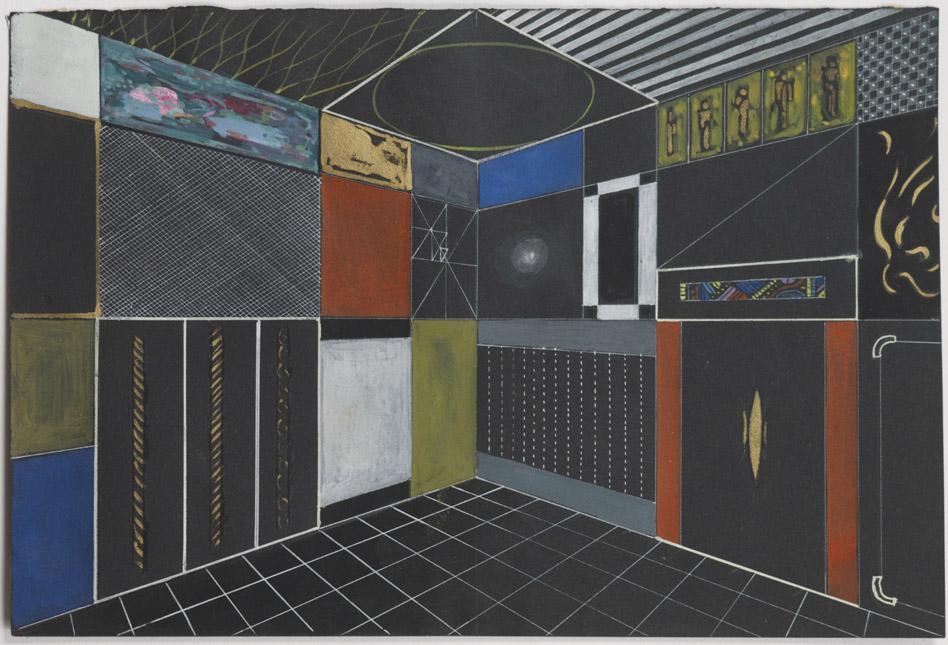
[16] Oskar Schlemmer, Entwurf für ein Lackkabinett, 1941/42, Von der Heydt-Museum Wuppertal, Foto: Museum.
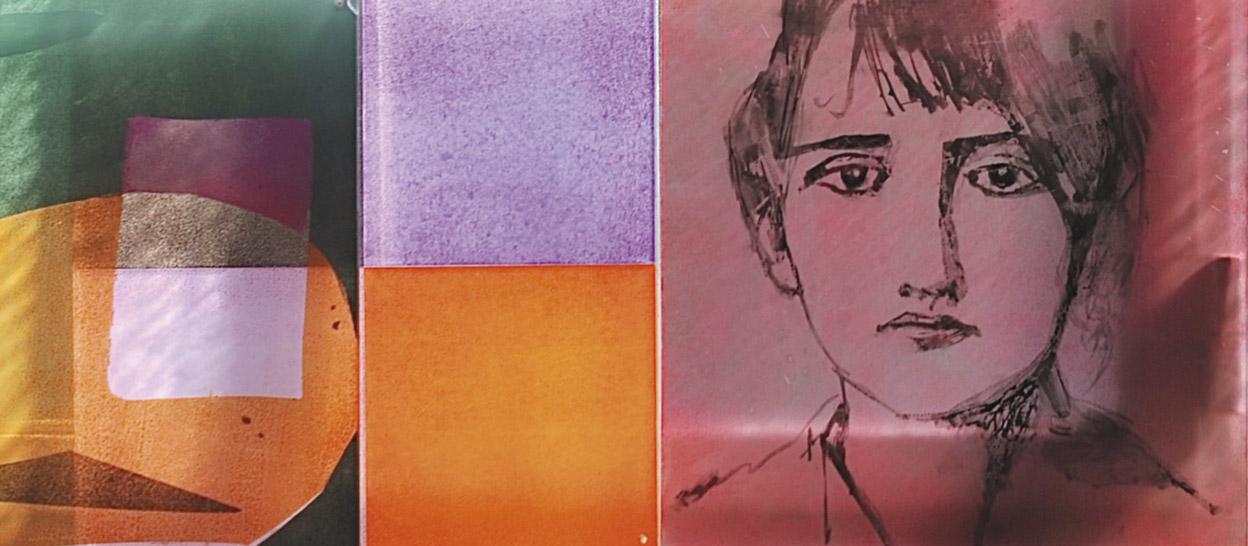
Lichtblicke

„Licht kommt in der Palette des Malers nicht vor, er muss es durch Farben ausdrücken“, sagte Paul Cézanne, dessen bevorzugte Malgründe Leinwand oder Holztafel waren. Eigenständiger Protagonist ist das Licht hingegen in der Glasmalerei – im Spiel von Transparenz und Opazität machen sich die Farben die besonderen Eigenschaften des Bildträgers zunutze. Kaum eine andere Technik erzeugt eine so hohe Leuchtkraft der Farben und so große Unterschiede in der Helligkeit wie ein Glasbild. Das Licht verändert alles – ob bei grauem Wetter oder in intensivster Form bei strahlendem Sonnenschein: Die Außenwelt wirft Schatten, die unterschiedlichen Tageszeiten und die Wanderung des Lichts begründen Dynamik und Wandel. So verändert sich etwa eine zitronengelbe Fläche in eine abstrakte Bildkomposition mit dunkelgelben, gelbgrünen oder grauen Bildelementen – ja nachdem, was draußen vor sich geht.
„Die Künste sind die Dolmetscher, deren Aufgabe es ist, die Wirkungen des Lichtes festzuhalten und wiederzugeben“
Marie Bracquemond (1840–1916)
War die Glasmalerei ursprünglich im sakralen Bereich beheimatet, so beschreibt der Begriff der Hinterglasmalerei Bilder auf Glas, die auf der Rückseite bemalt sind und deren Farben erst in der Durchsicht ihre volle Leuchtkraft entfalten. In der Moderne rezipierten etwa Paul Klee, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky die zu jener Zeit eher volkstümlichen Techniken der Hinterglasmalerei.
Die Wirkung der Glasmalerei wird maßgeblich vom Lichteinfall bestimmt, sodass ihr idealer Standort ein Fenster ist. Dabei ist Acrylglas als Bildträger wesentlich unkomplizierter in der Handhabung als Echtglas: Es ist leichter und bruchsicher, steht für die unterschiedlichsten Techniken zur Verfügung und eröffnet neue Perspektiven und Durchblicke mit reizvoller Wirkung.
Die Acrylglasplatte selbst kann problemlos mit einem kleinen Holzbohrer angebohrt werden, um sie mit Schrauben oder Nägeln direkt an der Wand oder zur Hängung im Raum an Nylon- oder Drahtseilen zu befestigen. Auf glatten, fettfreien Untergründen – etwa einer Wand oder melaminoder kunststoffbeschichteten, sauberen Fläche – können die Platten auch mit transparenter, doppelseitiger Klebefolie angebracht werden.
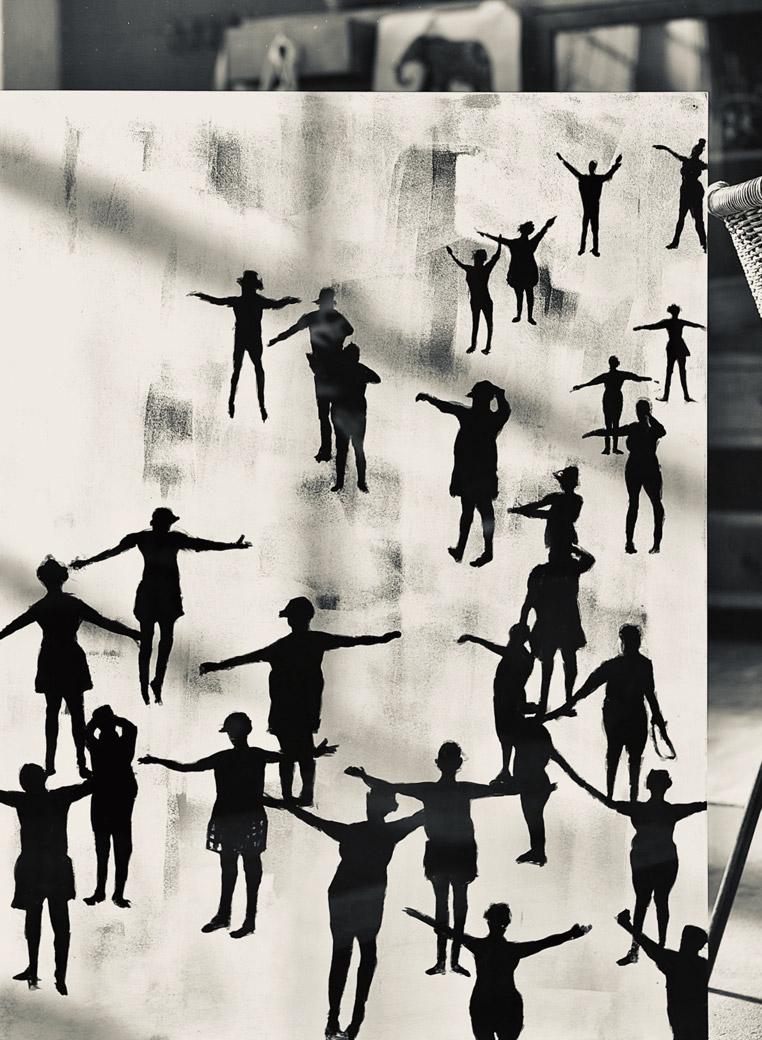
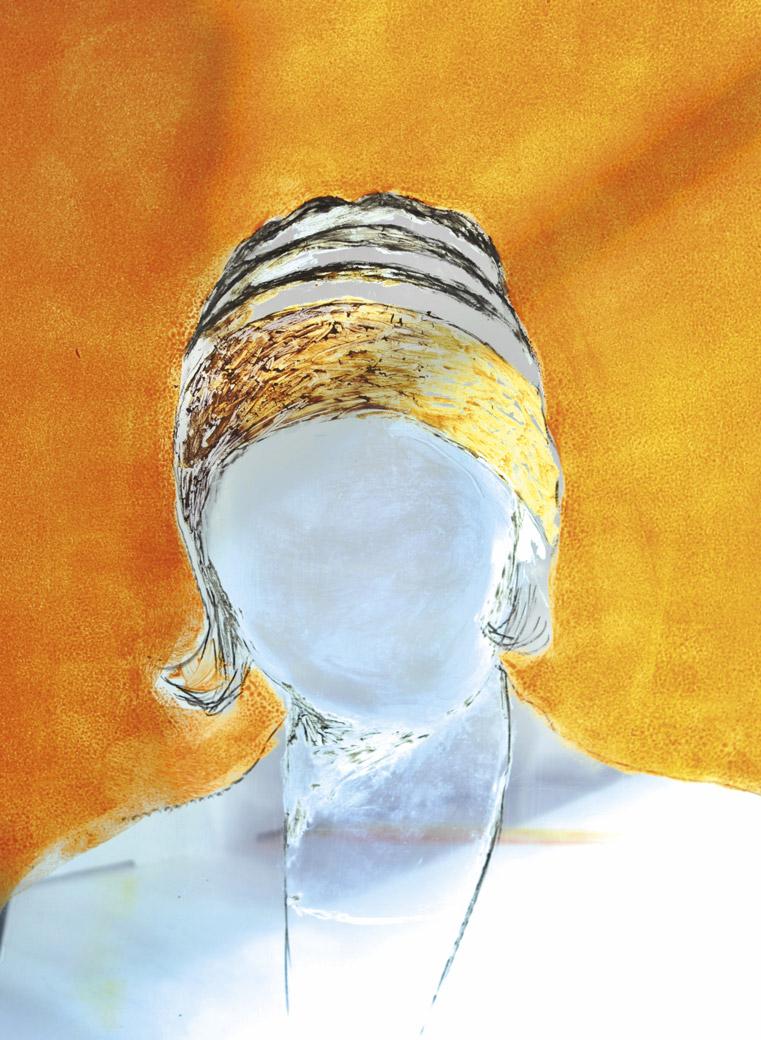
In der Regel wird Acrylglas in kleinen bis mittleren Formaten angeboten. Sind größere Formate gewünscht, empfiehlt sich eine Nachfrage im Rahmenbereich: Hier gibt es verschiedene Standardformate von Acrylglas, und es können auch individuelle Formate zugschnitten werden. Der besondere Reiz: Solche dünneren Acrylglas-Qualitäten können in Schichtungen übereinandergelegt werden.
Für die Malerei empfehlen sich spezielle Glasund Porzellanmalfarben, die schnell wasserfest auftrocknen und glänzend-glatt sowie lichtecht sind. Solche Spezialfarben gibt es in transparenter oder deckender Qualität und auch in kreidiger Optik in vielen Einzelfarbtönen und als Sets. Für Zeichnungen und Konturen, aber auch für Schriften, Ornamente und Verzierungen sind Glas- und Porzellanmalstifte ideal.
Wenn der direkte Auftrag auf die Platte – z.B. bei Schriftgestaltungen – zu riskant erscheint, hilft ein Trick: Von auf Plattenmaß zugeschnittener, doppelseitiger Klebefolie eine Schutzfolie abziehen, die offene Klebeseite seitenverkehrt bezeichnen oder beschriften und die Folie gleichmäßig auf die Platte kleben.
Eine glatte, homogene Wirkung in der Ansicht wird erzielt, wenn die Platte von hinten bemalt wird – dickere Farbaufträge verschwinden optisch und das Bild erscheint fast wie gedruckt.
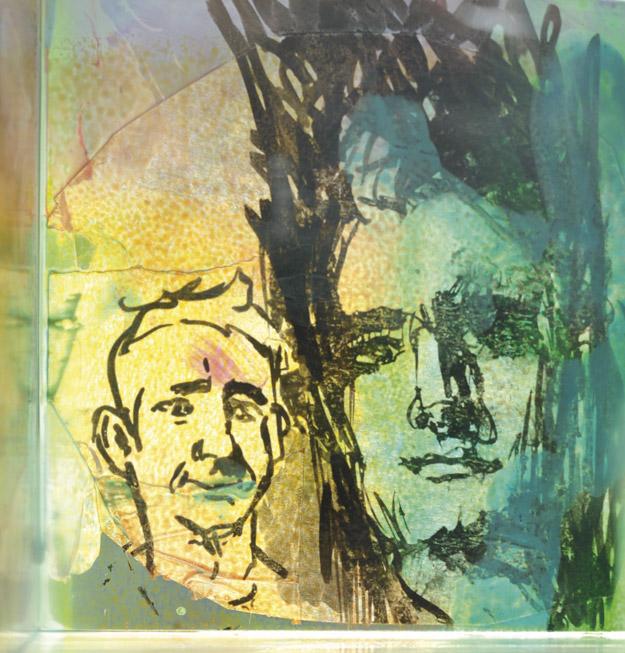

Der Farbauftrag erfolgt in erster Linie direkt mit Pinsel und/oder Stift. Soll eine größere Farbfläche möglichst homogen erscheinen, bietet sich der Auftrag mit einer schmalen Schaumstoffrolle an: Die Farbe auf die glatte Oberfläche gießen und mit der Rolle gleichmäßig verteilen, eventuell in beide Richtungen und auch diagonal. Ist der Farbton intensiver gewünscht, kann der Vorgang nach dem gleichmäßigen Auftrocknen wiederholt werden.
Man kann natürlich eine Einzelplatte direkt bemalen bzw. bezeichnen, aber auch mehrere (vor allem dünnere) Platten bearbeiten und sie anschließend auf- bzw. hintereinander schichten: So staffeln sich Farben, Formen und Figuren wie in einem Schattenspiel und erschaffen Bildtiefen und Kompositionen, die auf einer Einzelplatte nur schwerlich zu erzielen sind. Einfach betrachtet: Was geschieht, wenn man eine gelbe Platte hin-

ter eine blau getönte stellt? Eine grüne Platte entsteht. Wenn man aber hinter die blaue Platte eine Platte mit gelben Streifen stellt, so entstehen grüne Streifen auf blauem Grund. Ist die Gestaltung anspruchsvoller, wird der Sinn dieser Möglichkeiten deutlich: Ohne Farben auf ein- und derselben Platte zu mischen, entstehen Farbveränderungen durch die Addition mehrerer Platten.
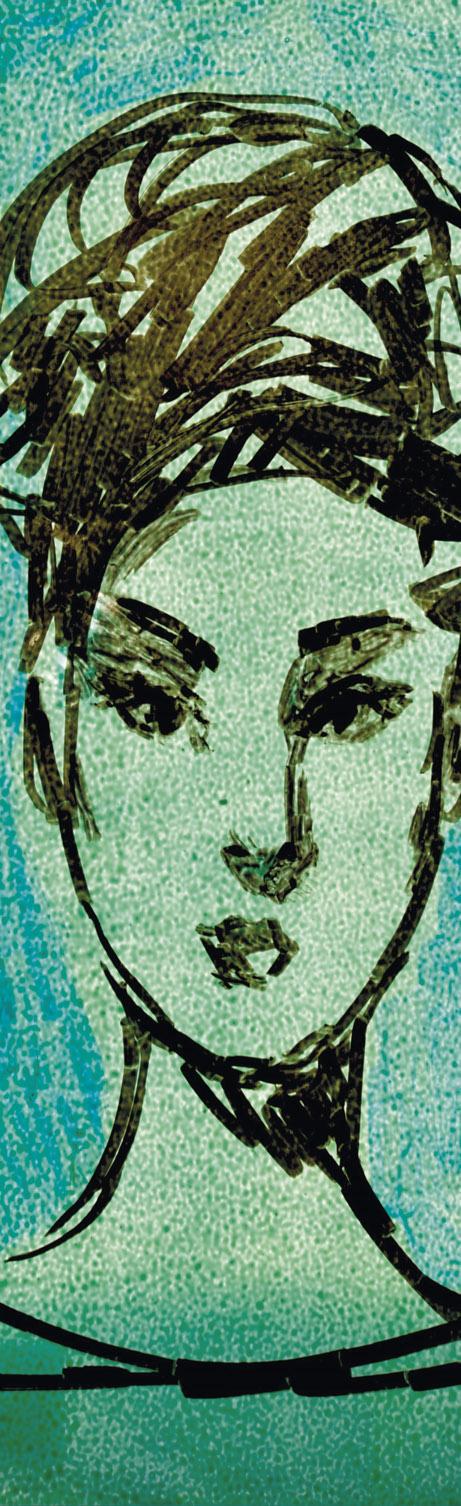

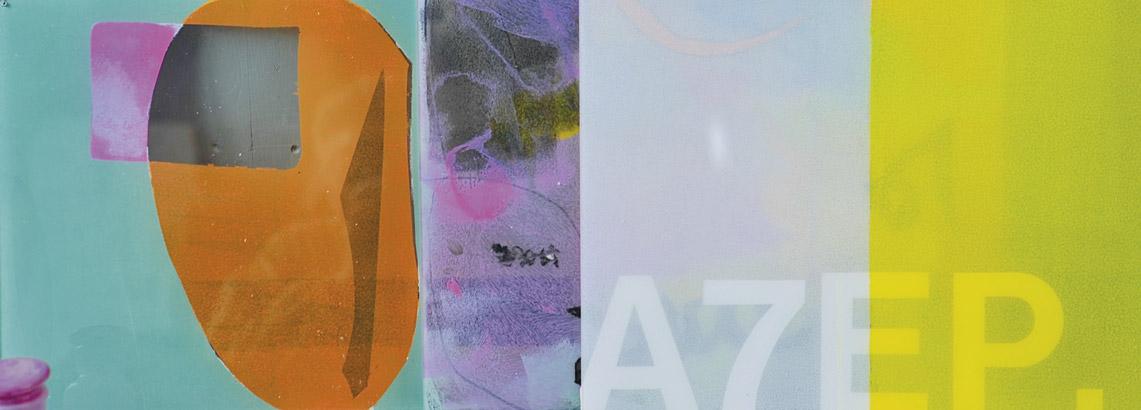
Einen besonderen Reiz haben modulare Arrangements von Acrylglasplatten. Im Beispiel links wurden vier Acrylglasplatten im Format 15 x 15 cm rückseitig bemalt und mit transparenter, doppel seitiger Klebefolie auf eine 30 x 30 cm große Platte geklebt, die das Tiefenlicht wiederum verstärkt.
Andere Möglichkeiten bieten sich durch collagenartige Reihung von bemalten Acrylglasplatten: Durch ihre glatten, geraden Kanten lassen sie sich exakt aneinanderfügen. Ergebnis sind grafische, dekorative Lösungen mit sehr moderner Wirkung. #
Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert



Ungeplante Zufallsformen
Bernhard Krug arbeitet auf Gesso-Malplatten

Bernhard Krug, geboren 1949 in Berlin-Weißensee, lebt und arbeitet in Marl und Dülmen. www.bkrug.de, Fotos: Bernhard Krug
Ich arbeite an dem aktuellen Werkblock Gesso seit 2021 und es sind seitdem rund 90 Bilder entstanden. Alle Bilder sind im selben Querformat 30 x 40 cm auf Gesso-Malplatten gemalt. Die grundierten Holzkörper geben den Bildern einen dreidimensionalen Objekt-Charakter und kommen prinzipiell auch ohne zusätzliche Rahmung aus. Ich verwende bei allen Bildern dieses Werkblocks das identische Format: Es soll den formalen, seriellen Zusammenhang der sonst inhaltlich unterschiedlichen Bildmotive zeigen, die aber allesamt landschaftliche Themen, entweder im Makro- oder Mikrobereich, behandeln.
Für mich bieten die Arbeiten auf Holzkörpern wichtige Erkenntnisse, weil sie spontane, direkte Ideen-Fixierungen ermöglichen, ohne große materielle Vorbereitungen. Das relativ kleine Format schafft einen optimalen Raum für rasche malerische Versuche, die für meine großformatigen Bilder eine wichtige Voraussetzung
[2]


Ein Großteil des Werkblocks „Gesso“ wird vom 10. August bis zum 7. September 2025 in der Hagenring-Galerie, Hagen, präsentiert, www.hagenring.com
sind. Es sind sozusagen „Skizzen“ für weitere Bildanlässe. Ich verwende vorwiegend schnell trocknende Acrylfarben und Mischtechniken mit Kreiden, Sand und Spachtelmassen. Aber auch alle anderen Techniken (z. B. Gouache, Öl, Lack, Zeichnungen, Collagen, Montagen) sind möglich. Der stabile Malkörper sorgt dafür, dass sich die Bilder auch bei starkem pastosem Materialeinsatz nicht verformen.
Mein Bildfindungsprozess findet im Austausch von Sehen, Denken und Imagination statt. Es handelt sich also um bildhaft gewordene Suchbewegungen bzw. Denk-Bilder, die zwar Landschaftliches zeigen bzw. assoziieren lassen, aber grundsätzlich das malerische Experiment an sich priorisieren. Die nachträgliche Titelgebung dient lediglich der stichwortartigen Bewusstmachung meiner gedanklichen Prozesse während des Schaffensprozesses und sind nicht gedacht für eine eindimensionale Rezeption des Betrachters.
Der werkblockgebende Name Gesso (lateinisch: Gips) bezieht sich auf das gleichnamige Material für die Grundierung der Holzkörper. Das Gesso sorgt dafür, dass das Ergebnis kreidig seidenmatt und extrem deckend wird und bei der Benutzung verschiedener Materialien besonders saugfähig ist. Die Farbe trocknet auf der feinen Oberflächenstruktur schnell und gleichmäßig, zudem lassen sich auch mit transparenten Farben effektive Ergebnisse erzielen.
Im aleatorischen Wechselspiel von dünner, lasierender Acrylfarbe mit dem schnell trocknenden Kreidegrund und dem Einsatz von Plastikfolie, die die noch nicht getrockneten Farbteile auf der Fläche verteilt, ergeben sich ungeplante Zufallsformen, die mit Malspachteln sowie zum Schluss mit Farbstiften akzentuiert werden und manchmal Gegenständliches evozieren lassen. #
[1] Gesso 38 (Landschafts-Fresko)
, 2022, Acryl, Quarzsand, Spachtelmasse auf Holz, 30 x 40 cm. [2] Gesso 5 (Seestück), 2021, Acryl, Farbstift auf Holz, 30 x 40 cm. [3] Gesso 59 (Schilfgras-Fragment), 2022, Acryl auf Holz, 30 x 40 cm. [4] Gesso 13 (Blätter-Verwehung), 2021, Acryl, Farbstift auf Holz, 30 x 40 cm.
[3] [4]
„Azzurro oltramarino ist wahrlich eine edle Farbe“
Über Herkunft und Gebrauch des Ultramarinblau

Cennino Cennini (1398–1403 dokumentiert) begann mit den oben zitierten Worten das Kapitel über die Bereitung des Ultramarinblau in seinem um 1400 verfassten Traktat „Buch von der Kunst“1 und beschrieb anschließend über mehrere Seiten hinweg die komplizierte Herstellung aus dem Stein, den er Lapis lazzari nannte. Kurz vor Ende des Kapitels lesen wir dann: „Und merke dir, dass es eine besondere Kunst ist, es gut zu bereiten. Und wisse, dass die jungen Schönen es besser zu machen verstehen, als die Männer, weil sie beständig daheim bleiben, geduldiger sind und zartere Hände haben.“2 Mit „es“ war das notwendige Kneten des gewonnenen Extrakts gemeint.
Als Cennini sein Traktat schrieb, war das Ultramarinblau wohl auch schon länger in der westlichen Welt bekannt. Den Namen hatte es erhalten, weil der dafür notwendige Lapislazuli über das Meer kam (oltre mare). Doch auch bis zu seiner Verschiffung hatte er schon einen langen Weg hinter sich – von der Provinz Badachschan in Nordafghanistan bis nach Syrien ans Meer. Die Vorkommen des blauen Steins in dem im westlichen Hindukusch gelegenen Gebiet sind schon seit Tausenden von Jahren bekannt und finden Erwähnung in einer der ersten aufgeschriebenen Dichtungen der Geschichte, dem „Gilgamesch-Epos“, das in schriftlicher Form wohl seit über 4500 Jahren existiert.
Dort wird er als Stein genannt, auf dem die Geschichte niedergeschrieben wurde – und Gründungssteine aus Lapislazuli sind aus dieser Zeit bekannt, in der Erzählung bestehen dann aber auch die Hörner des Himmelsstiers, den Gilgamesch gemeinsam
[1] Stierkopf am Schallgehäuse einer Leier aus Ur, um 2450 v.u.Z., Gold, Muschel, Lapislazuli, Bitumen, Silber, 40 x 25 x 19 cm, Philadelphia, University Museum, Foto: Wikimedia Commens. [2] Très Riches heures du duc de Berry, Folio 4 verso: April, 1412–1416, Buchmalerei, 22,5 x 13,6 cm, Chantilly, Musée Condé, Foto: Wikimedia Commens.
mit seinem Freund Enkidu tötet, aus dem blauen Stein. „Die Dicke seiner Hörner preisen die Söhne der Handwerkergilde. Dreißig Minen Lapislazuli (betrug) ihre Masse“3, das waren umgerechnet etwa 16 Kilogramm Lapislazuli.
Mehrere Leiern aus sumerischer Zeit, die in Gräbern gefunden wurden, besitzen Stierköpfe aus Gold und Lapislazuli wie derjenige, der sich heute in Philadelphia befindet. Er trägt einen mächtigen blauen Bart, allerdings sind nur die Hörnerspitzen blau, der Rest golden [1].
Damals wurde der Stein noch nicht zu einem Pigment vermahlen. Wann genau die erste Rezeptur hergestellt wurde, ist nicht bekannt. Doch schon etwa 1500 v. u. Z. sind Wandmalereien auf Kreta nachgewiesen, in denen dem Blau Ultramarin beigemischt wurde und in Ägypten soll die Farbe erstmals etwa 500 Jahre später in Gebrauch gewesen sein. Einer der Buddhas aus dem afghanischen Bamiyan-Tal, der um 540 u. Z. entstand, wurde damals farbig gefasst – mit eben dem Blau, das aus dem Lapislazuli gewonnen wurde. Nur wenig später –wenn wir in größeren Zeiträumen denken – findet sich das Ultramarin auch in der römischen Kirche San Saba aus dem 8. Jahrhundert.
Wieder ein paar hundert Jahre später soll Marco Polo (um 1254–1324) auf einer seiner Reisen die Lapislazuli-Vorkommen im Hindukusch besucht haben. Damals brachten Kamelkarawanen die Steine nach Syrien ans Meer. Dort wurden sie auf Schiffe verladen, deren Ziel der Hafen von Venedig war.
Auf den langwierigen und gefährlichen Transportweg folgte die mühsame Herstellung des Pigments. Erst musste der harte Stein vermahlen werden, um dann das in ihm enthaltene Lasurit in einem aufwendigen Verfahren zu extrahieren, zu dem bis zu 49 einzelne Schritte notwendig waren, was natürlich auch einen beträchtlichen Zeitaufwand bedeutete. Für die Verarbeitung von einem halben Kilo Stein benötigte ein Mensch etwa ein halbes Jahr. Und so gehörte Ultramarin nicht nur aufgrund des Transports, sondern auch wegen der Herstellung neben Gold und Purpur zu den teuersten Farben.
Es waren also Gottesfurcht und Prachtentfaltung gleichermaßen, die die Verwendung von Ultramarinblau beförderten. Ein Beispiel der Buchmalerei ist eines der Stundenbücher, das der Herzog von Berry (1340–1416) bei den Brüdern Limburg4 in Auftrag gab: die Très Riches Heures, um 1410–16 entstanden, die sich heute im Musée Condé von Chantilly befinden und unter anderem berühmt sind für die zwölf großformatigen Kalenderdarstellungen. Die einzelnen Blätter zeigen in einer himmlischen blau-goldenen Sphäre die jeweiligen Tierkreiszeichen und Kalendarien, darunter typische Verrichtungen in den einzelnen Monaten, wobei dem Herzog meistens ein gebührender Platz eingeräumt wird oder zumindest mit einem Schloss im Hintergrund seine Anwesenheit präsent ist. Und so ist auch im Monat April ein Schloss zu sehen, das dem Herzog gehörte, davor findet ein Verlöbnis statt, bei dem der Bräutigam einen kostbaren blauen Mantel trägt. Dasselbe Blau findet sich in dem Blumen pflückenden jungen Mädchen und in der Himmelssphäre [2]



Zwei Ledersäcke mit diesen blauen Steinen aus dem Orient befanden sich im Besitz des Herzogs, wie einer Inventarliste zu entnehmen ist. Von wem die Steine zum Pigment verarbeitet wurden, ob durch die Künstler selbst oder durch einen Spezialisten, ist nicht bekannt.
Umso besser ist die Verteilung von Ultramarin am Florentiner Hof dokumentiert. Als Agnolo Bronzino (1503–1573) Eleonora von Toledo (1522–1562), die Frau des Großherzogs Cosimo I. de' Medici (1519–1574), mit ihrem Sohn Giovanni (1543–1562) malte, erhielt er das fertige Pigment vom Hof gestellt, wie durch einen Brief dokumentiert ist, den der Hofmaler 1545 einem Freund schrieb. Es muss sich um eine größere Menge Ultramarin gehandelt haben, wie auf dem Bild zu sehen ist. Denn Bronzino malte nicht
etwa Teile der Kleidung der beiden Porträtierten in Blau, sondern den rein blauen Hintergrund, vor dem sich die beiden Figuren abheben [3].
Fertige Pigmente konnten in Apotheken erworben werden. Und so war es natürlich besonders schlau, wenn ein Maler gleichzeitig eine Apotheke besaß, wie dies bei Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) der Fall war. Er war in Wittenberg der einzige Apotheker am Ort, belieferte also auch seine Malerkollegen mit Pigmenten. Er selbst konnte sie im Großhandel billiger erwerben und hatte außerdem die Kontrolle, dass es sich um reine Pigmente handelte. Denn besonders um die wertvolleren Pigmente gab es immer wieder Auseinandersetzungen, wenn die Auftraggeber das Gefühl hatten, dass sie von den Malern hintergangen worden waren,
Wikimedia Commens. [4] Giotto, Himmel, Fresken, 1304–1306, Padua, Cappella degli Scrovegni, Foto: Wikimedia Commens.
[3] [4]
[3] Agnolo Bronzino, Eleonora von Toledo und ihr Sohn Giovanni, 1544/45, Öl auf Holz, 115 x 96 cm, Florenz, Uffizien, Foto:
dass zum Beispiel nicht das teurere Ultramarin, sondern das sehr viel billigere Azurit verwendet worden war. Zunftregeln versuchten, solche Betrügereien zu verhindern.
So wertvoll das Ultramarin war – weshalb es wohl auch als Medizin gegen Melancholie eingesetzt wurde – in etlichen Fällen veränderte sich die Farbe über die Jahrhunderte. Diese „Ultramarinkrankheit“ war inzwischen Stoff mehrerer Abhandlungen mit dem Ergebnis, dass es sich dabei vor allem um eine Veränderung des Bindemittels handelt. Die „Krankheit“ ist vor allem bei Tafelbildern wie der Sixtinischen Madonna5 von Raffael (1483–1520) zu beobachten, nicht bei Fresken wie dem von Giotto (um 1270–1337) gemalten Himmel in der Scrovegni-Kapelle in Padua [4]
Anfang des 19. Jahrhunderts, genauer 1824, wurde ein Preis ausgesetzt, um künstliches Ultramarin herzustellen. Dies gelang zwei Jahre später unabhängig voneinander drei Forschern. Seitdem ist das Pigment nicht mehr so teuer, besitzt aber auch nicht in allen Zusammensetzungen dieselbe Leuchtkraft, weshalb Yves Klein (1928–1962) so lange herumexperimentierte, bis es ihm gelang, ein Ultramarin herzustellen, das ihn zufriedenstellte und das er sich 1957 patentieren ließ: das International Klein Blue, kurz IKB, mit dem er sehr viel freizügiger umgehen konnte als die Maler*innen früherer Jahrhunderte.#
Susanna Partsch
Der Grund für (fast) alles
Perfekte Haftung für Öl- und Acrylfarbe, Lack oder Marker, genug Stabilität für Spachtelarbeiten oder Collagen und sogar als Zeichengrund verwendbar: Die zweifach grundierte Gesso-Malplatte ist ein echtes Multitalent. Sie hat klar definierte Kanten, besteht aus 5 mm starkem, planlagigem MDF und ist rückseitig mit Leisten aus Kiefernholz unterlegt, die für eine Tiefe von 1,9 bzw. 3,8 cm sorgen.
Die Suche nach Gründen hat endlich ein Ende …
1 Cennino Cennini, Das Buch von der Kunst, Wien 1871, S. 37 (das Buch in der deutschen Übersetzung von Albert Ilg ist digitalisiert).
2 ebenda, S. 40.
3 Das Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt und kommentiert von Stefan M. Maul, München 2005, S. 98 (VI. Tafel, 161/162).
4 Hermann (um 1385–1416), Paul (um 1387–1416), Jan (1388–1416).
5 Raffael, Sixtinische Madonna, 1512/13, Leinwand, 269,5 x 201 cm, Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, https://skd-online-collection.skd.museum/ Details/Index/372144.

Mustergültig
Muster zu sammeln und in Büchern zu ordnen hat eine jahrhundertelange Tradition: Musterbücher im ursprünglichen Sinne dienten in der Geschichte von Malerei und Architektur insbesondere als Vorbild und Vorlage in der künstlerischen Ausbildung und zur Abstimmung mit den Auftraggebern. Musterbücher können aber genauso gut privaten künstlerischen Zwecken vorbehalten sein und eine ganz persönliche Handschrift tragen – dazu braucht es nicht mehr als ein Skizzenbuch, Farben und Stifte, Klebstof, viele Ideen und vielleicht ein wenig Sammelleidenschaft.
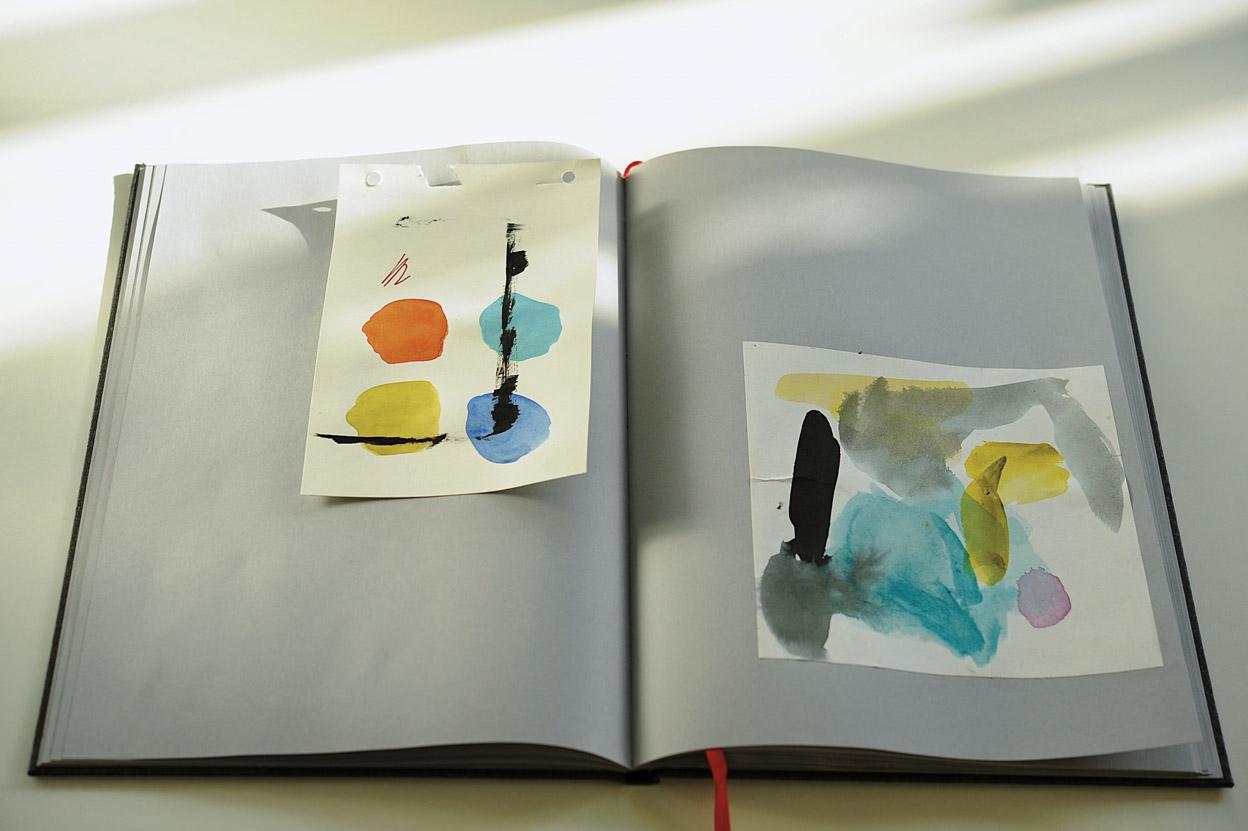
Der Begriff „Muster“ hat viele Facetten. Einerseits charakterisiert er etwas in seiner Art Beispielhaftes, aber in der geläufigen Bedeutung bezeichnet „Muster“ insbesondere eine sich regelmäßig wiederholende Struktur, einen Rapport oder die farbige Gestaltung in Textilien zum Beispiel oder ein künstlerisches Ornament. Ein Muster benennt andererseits auch eine Probe eines Materials, einer Farbe oder eines Stoffs.
Gezeichnete Muster zu sammeln und in einem Buch zu vereinen ist seit Jahrhunderten überliefert: Zu den ältesten bekannten Musterbüchern zählt das sogenannte Reiner Musterbuch aus dem 13. Jahrhundert: Es enthält Grafiken, Initialen, Federzeichnungen, Musteralphabete und vieles mehr, die als Vorlagen dienten. Seither haben Musterbücher ihre Spuren hinterlassen: So illustrierten etwa die Händler im niederländischen Tulpenhandel des 17. Jahrhunderts ihr Blumenangebot mit Stichen, Aquarellen und Gouachen in sogenannten „Tulpenbüchern“. Bis heute sind Musterbücher vielgestaltig und können Vorlagen für Malerei und Kunstdruck enthalten, für Zierelemente oder für Modellbau, Kunst- und Gebrauchshandwerk.
Ein aktuelles Beispiel ist eine Ideensammlung von Mustern, die zu einem späteren Zeitpunkt zu Papier- oder Stoffentwürfen inspirieren können. Für solch ein individuelles Musterbuch bietet sich ein Skizzenbuch im Hoch- oder Querformat an, dessen Seiten direkt bezeichnet und bemalt werden, aber auch als Träger für eingeklebte Papiere dienen können.

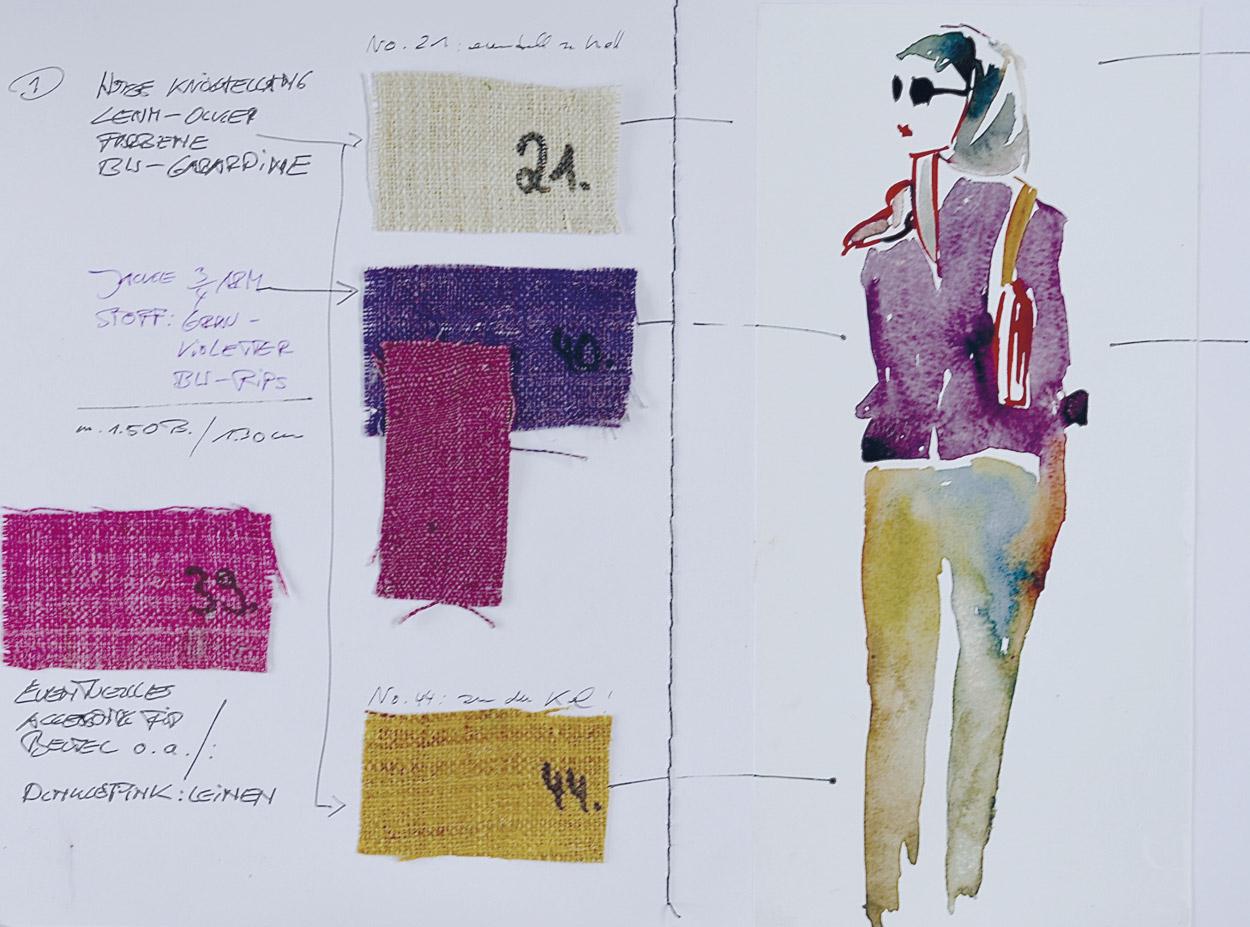

Gerade im Bereich der Mode sind Musterbücher ein willkommenes Medium für alle notwendigen Informationen auf einen Blick. Dieses großformatige, fadengeheftete Skizzenbuch nimmt gezeichnete und aquarellierte Entwürfe ebenso auf wie weiterführende Ideen, Notizen zur Umsetzung und nähere Spezifikationen. Eingeklebte Stoffmuster finden ihren Platz wie Notizen zu Stoffen, Kombinationsmöglichkeiten und Hinweise auf eventuelle Accessoires.
Bei der Anlage eines solchen Ideen-Buchs sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Stoffpatches in verschiedenen Qualitäten, Farben und Texturen, Probestücke zu Handarbeitsmustern oder zum Stoffdruck präsentieren sich übersichtlich geordnet und sind schnell zu Rate zu ziehen – Raum für neue Impulse inbegriffen.
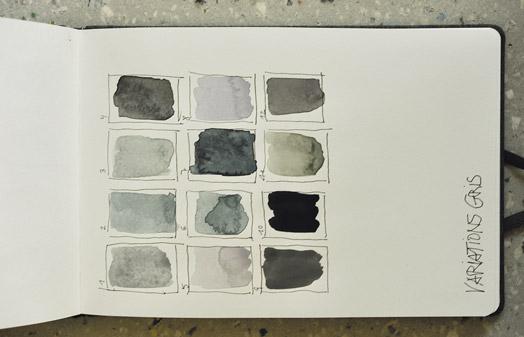
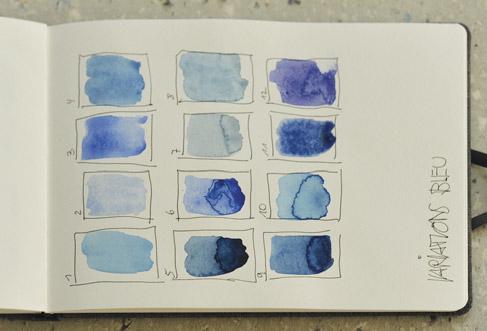
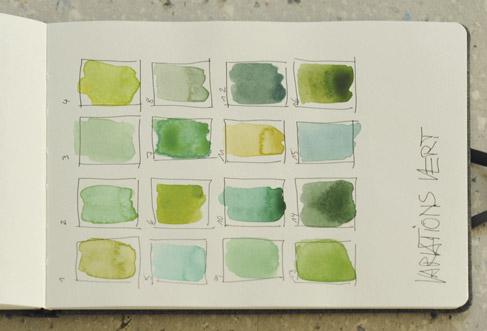

Jedes Papier bringt seine spezifischen Eigenschaften mit und bietet sich für Muster und Ideen an, die mit verschiedenen Stiften realisiert und sortiert gesammelt werden.
Variationen in Gelb, Grün, Blau, Grau und mehr … Aquarellfarben stehen in Näpfchen und Tuben in unzähligen Farbtönen zur Verfügung. Aber auch mit wenigen Tönen lassen sich verschiedene Nuancen erzielen, die sich in der Farbmischung und – je nach Wasserzugabe –auch in der Deckkraft variantenreich präsentieren. Um seine Farben im Experiment kennenzulernen, ihre Leuchtkraft und Intensität auszuloten und die einzelnen Töne miteinander zu vergleichen, bietet sich die Anlage von Farbmustern an. Natürlich lassen ich Farbmuster auch z.B. mit Ausmischungen von Gouacheoder anderen Farben anlegen.
Ob handgeschöpfte Naturpapiere, Büttenpapiere, Japanpapier oder farbiges Zeichenpapier, glatte oder raue Papiere oder Spezialpapier –Musterzeichnungen auf strukturierten Papieren bieten eine schier unerschöpfliche Palette an Kombinationsmöglichkeiten.
Natürlich hat ein persönlich gestaltetes Musterbuch noch viele weitere Seiten, und insbesondere macht es fliegenden Blättern und Zetteln schnell ein Ende: Ob Schriftproben oder ganze Alphabete beim Handlettering, Layout-Scribbles für Scrapbooking-Projekte, Zentangle-Arbeiten in wiederkehrendem Format, spontane Kugelschreiber-Doodles oder verschiedene OrigamiPapiere: In Buchform gesammelt schaffen sie in jedem Fall einen mustergültigen Überblick.#
Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe
Text: Sabine Burbaum-Machert

Ein Fest der Farben
Eine Hommage an die Welt der Blumen und Blüten
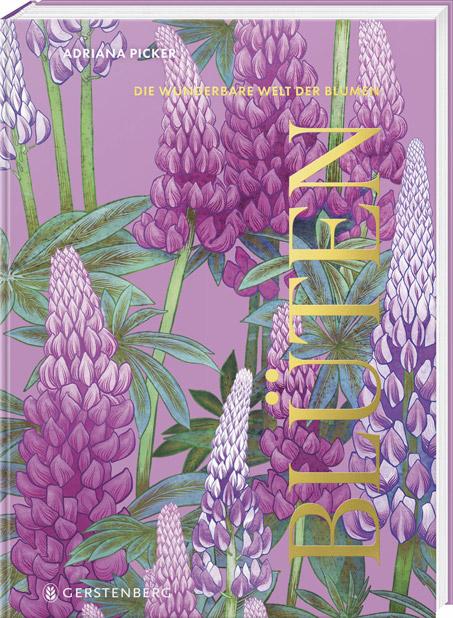

Blüten. Die wunderbare Welt der Blumen
Adriana Picker, 256 S., durchg. farb. Abb., 17 x 23,5 cm, geb., dt., Gerstenberg Verlag 2025, ISBN 9783836922081, EUR 28,00 (D), EUR 28,80 (A), CHF 38,50 (CH)
Blumenblüten gehören zu den schönsten Dingen, die die Natur hervorbringt. Jede für sich ist ein Wunder an Farbe, Form und Gestalt. In dem Buch „Blüten. Die wunderbare Welt der Blumen“, das gerade beim Gerstenberg Verlag erschienen ist, hat die botanische Malerin Adriana Picker über 200 Blumen aus der ganzen Welt zusammengetragen, geordnet nach 27 Pflanzenfamilien. Mit ihren Bildern präsentiert sie auch deren unvergleichliche Pracht.
Das Buch enthält Illustrationen spektakulärer Blüten von Begonien, Hahnenfußgewächsen, Hartriegel, Heidekrautgewächsen, Hortensien, Kamelien, Korbblütlern, Leguminosen, Liliengewächsen, Magnolien, Malvengewächsen, Mohn, Nachtschattengewächsen, Narzissengewächsen, Ölbaumgewächsen, Orchideen, Passionsblumen, Pelargonien, Pfingstrosen, Primeln, Rosen, Schwertlilien, Seerosen, Silberbaumgewächsen, Spargelgewächsen, Wegerichgewächsen ...
Adriana Picker hat diese reizvollen Pflanzen aber nicht nur zusammengetragen. Sie „interpretiert darin die traditionsreiche Kunst der botanischen Illustration auf moderne Weise. Sie lenkt unseren Blick von den Buchseiten auf die Welt um uns herum und macht uns aufmerksam auf die wechselnden Farben und Texturen der Jahreszeiten, auf die Düfte unserer Lieblingsblumen und auf die Freude, die die Natur in uns weckt“, schreibt Gemma O’Brien im Vorwort zum Buch.
Alle Abbildungen: © Adriana Picker (Illus.), aus: Blüten, Gerstenberg Verlag 2025.
„Wenn du eine Blume in die Hand nimmst und sie bewusst betrachtest, wird sie für einen Moment zu deiner Welt. Ich möchte diese Welt auch mit anderen Menschen teilen.“
Georgia O’Keefe
Die Illustratorin selbst versteht ihr Buch als eine Liebeserklärung und als eine Hommage an die Blumenwelt, mit der sie nicht nur „einige der beliebtesten Blütenpflanzen würdigen, sondern auch ein neues Licht auf jene Pflanzenfamilien werfen (möchte), die heutzutage als altmodisch gelten und weniger geschätzt werden.“
Begleitet werden die farbenfroh illustrierten Abbildungen dieses prachtvollen Bildbands von den informativen und kurzweiligen Texten der Autorin Nina Rousseau zur traditionellen Bedeutung einzelner Blumen. Ein Fest für Blumenliebhaber und Kunstinteressierte – und ein ideales Geschenk!
Über die Illustratorin
Adriana Picker, geb. in Sydney, begann ihre Karriere als Illustratorin für Kostüme beim Spielfilm, u.a. entwarf sie die Kleidung für „Der große Gatsby“ (2013). Sie arbeitet heute als Illustratorin, Künstlerin und Designerin in unterschiedlichen Bereichen des Verlagswesens, des Films und der Werbung. Picker hat sich auf Motive aus dem Reich der Botanik spezialisiert. Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt in New York.#
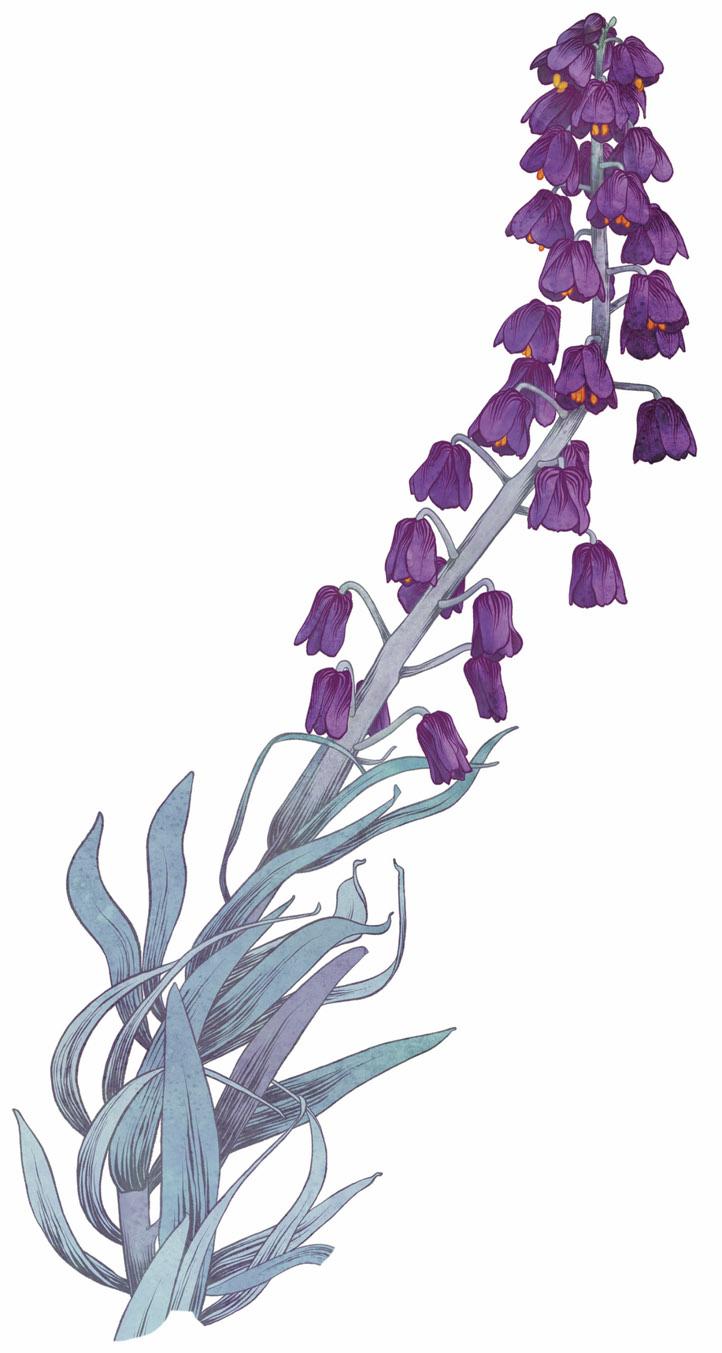
Der Garten von Emil Nolde
Der Künstlergarten in Seebüll und seine Pfanzen im Jahreslauf
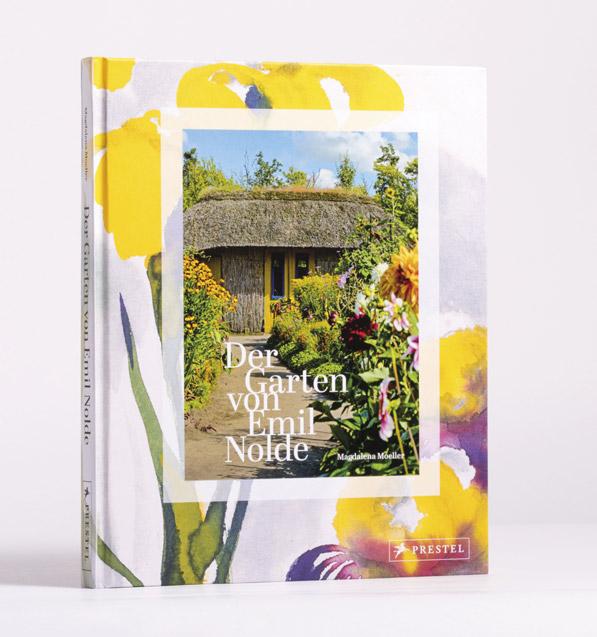
Der Garten von Emil Nolde
Magdalena Moeller, 176 S., durchg. farb. Abb., 21 x 26 cm, geb., dt., Prestel Verlag 2025, ISBN 9783791377773, EUR 29,00 (D), EUR 29,90 (A)
„Die Blumen im Garten leuchteten rein und schön mir jubelnd entgegen ...“
Vor fast hundert Jahren, ab 1926, schufen der Künstler Emil Nolde und seine Frau Ada ein kleines Paradies. Im nordfriesischen Seebüll kauften sie eine Warft, ließen nach eigenen Vorstellungen Wohnhaus und Atelier erbauen und legten einen Garten an. Der Nolde-Garten besitzt eine Farbenpracht und Blütenfülle, die im Sommer ihren Höhepunkt erreicht und die den Künstler immer wieder zu zahlreichen Blumengemälden und Aquarellen inspiriert hat. Ein wichtiger Teil seines Spätwerks ist hier entstanden. Heute ist der Garten Teil des Nolde-Museums und zieht jährlich zehntausende Besucher an.
„Der Garten von Emil Nolde“ ist die erste Publikation, die sich ausschließlich diesem malerischen Ort widmet. Mit zahlreichen brillanten Fotografien schildert sie den Jahreslauf im Künstlergarten, präsentiert die schönsten Blumen und Stauden und gibt wertvolle Tipps für das eigene Gärtnern. Die Kunsthistorikerin und Fotografin Magdalena M. Moeller stellt neben einem reich bebilderten Essay zur Geschichte des Gartens ausgewählte Werke von Emil Nolde ihren eigenen Pflanzenaufnahmen gegenüber und schafft so eine Symbiose aus Malerei und Fotografie, Kunst und Natur.
Abbildung aus dem Innenteil des Buches, © Prestel/Penguin Random House 2024.
Emil Nolde
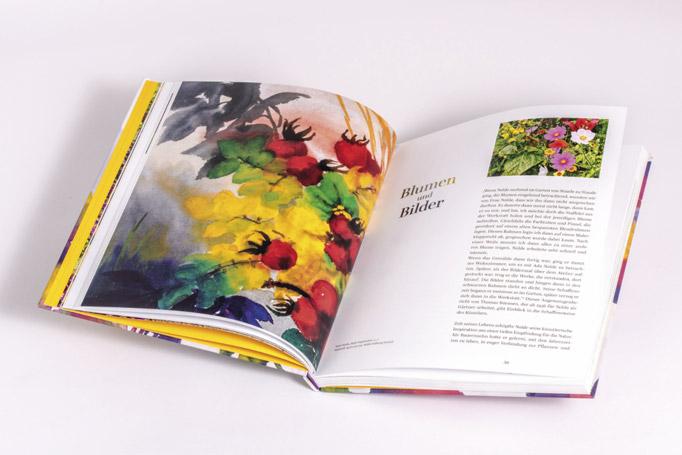
Natur und Kunst vereinen sich im Garten von Emil Nolde in Seebüll zu einem Fest für Augen und Seele. Das mit dem Deutschen Gartenbuchpreis 2025 ausgezeichnete Buch „Der Garten von Emil Nolde“ aus dem Prestel Verlag ist mit vielen Ideen für die Gartengestaltung auch eine Quelle der Inspiration.
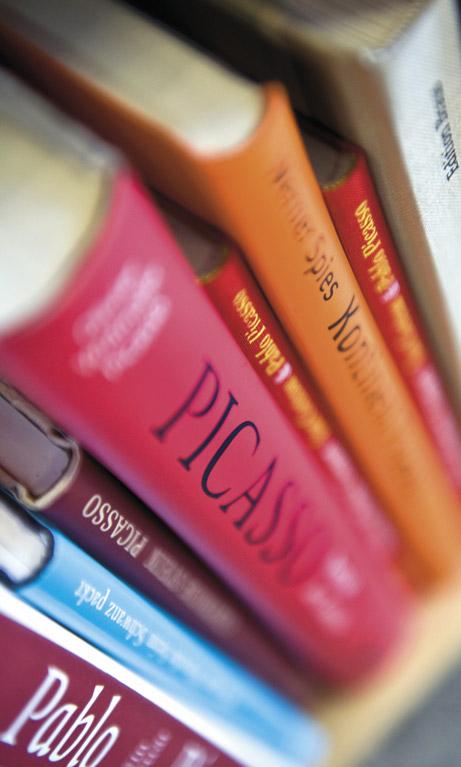
Die boesner-Bücherwelt ist online
die boesner Bücherwelt –seitenweise Inspiration und Leidenschaft.
Im Kapitel „Emil Noldes Garten im Jahreslauf“ zeigt Magdalena Moeller nicht nur die schönsten Blüten und prächtigsten Stauden der Monate März bis Oktober. Sie wirft auch einen Blick hinter die farbenprächtigen Kulissen, begleitet die Gärtner bei ihrer Arbeit und gibt wertvolle Tipps, wie sich Leserinnen und Leser selbst ein wenig „Seebüll“ verwirklichen können. „Der Garten von Emil Nolde“ lädt nicht nur zum Schwelgen in Bildern ein und inspiriert das Gärtnern im heimischen Garten, die Blütenpracht in diesem Buch regt auch dazu an, sie in eigenen Kunstwerken umzusetzen.#
Hier finden Sie unser Buch des Monats, regelmäßige Empfehlungen zu Fachbüchern und News aus der Buchbranche – mit Blick auf die Interessen von Kunstschafenden für Sie ausgewählt.
Schauen Sie doch mal vorbei!

www.boesner.com/buecherwelt
Sommer –zum Lesen schön!
Ob zu Hause im Garten oder im Park, ob im Urlaub am Meer oder in den Bergen – die langen und warmen Tage des Sommers mit ihren entspannten Stunden laden zum Lesen ein.
Eine gute Gelegenheit, über die Kunst nachzudenken. Warum nicht zusammen mit dem großen Philosophen Gilles Deleuze? In seinen legendären Vorlesungen stellt er sich Fragen wie: Welche Beziehung hat die Malerei zur Katastrophe, zum Chaos? Was ist eine Linie, eine Ebene, ein optischer Raum? Gibt es so etwas wie Farbregime? Von 1970 bis 1987 hielt Gilles Deleuze eine wöchentliche Vorlesung an der legendären Experimentaluniversität Vincennes, die immer wieder in die Schlagzeilen und in Konflikt mit der Staatsmacht geriet. Die acht Vorlesungen von 1981, die in dem Buch „Über die Malerei“ erstmals veröffentlicht werden, zeigen Deleuze in action. Sie sind ganz der Frage der Malerei und der schöpferischen Kraft gewidmet. Das Nachdenken über Werke von Cézanne, van Gogh, Michelangelo, Turner, Klee, Pollock, Mondrian, Bacon, Delacroix, Gauguin oder Caravaggio sind für Deleuze der willkommene Anlass, wichtige philosophische Konzepte aufzurufen und zu durchdenken: Diagramm, Code, digital und analog, Modulation und andere mehr. Gemeinsam mit seinen Studierenden erneuert er diese Begriffe und stellt unser Verständnis der kreativen Tätigkeit der Kunstschaffenden auf den Kopf. Konkret und fröhlich wird Deleuzes' Denken hier in seiner Bewegung nachvollziehbar und lebendig.
Ein ebenfalls vergnüglich zu lesendes Kunstbuch hat die Künstlerin Rachel Lumsden während der Pandemie geschrieben. In „Ritt auf der Wildsau – Manifest für die Malerei“ vermittelt sie in einer klugen Kombination aus Satire, Analyse und Gebrauchsanleitung zur Malerei der Gegenwart viel Wissenswertes über die Karriere einer Malerin, den Kunstmarkt und die Kunst selbst. In sehr eigenwilligem Stil beschreibt die figurativ arbeitende ,painters’s painter‘ aus erster Hand ihre Erfahrungen mit Galerien und dem Kunstbetrieb als ein „Bestiarium der Kunstmächtigen“
und kategorisiert die „Fabelwesen“ der Kunst. Neben Kunstlehre und Geschlechterrollen im Kunstbetrieb taucht die Künstlerin auch tief in das Wesen der Kunst ein. So etwa untersucht sie, was ein fertiges Bild bewirkt und entwickelt aus der Kunstbetrachtung heraus ihre These, „dass wir uns weder ganz bei der Materialität noch ganz beim Dargestellten, weder ganz in unserer eigenen Innenwelt noch ganz im Außen,“ befinden, sondern im Dazwischen schweben, in der ,time out of time‘. Es macht Spaß, sich auf die Gedankenwelt von Rachel Lumsden einzulassen und sie bei ihren Überlegungen zu begleiten.
Neben solchen tiefgreifenden Gedanken ist auch die Kunstgeschichte ein inspirierendes und spannendes Themenfeld, das viel über den sozialen und gesellschaftlichen Kontext verrät, in dem Kunst entsteht. Wenn Katja Behling und Anke Manigold in „Ich will alles malen" von dem faszinierenden und anstrengenden Leben und Schaffen von Frauen erzählen, die sich um die Jahrhundertwende gegen gesellschaftliche Widerstände behaupteten, um als Künstlerinnen anerkannt zu werden, dann führen die in dem Buch versammelten Lebenspfade und Werke der Künstlerinnen zu einer kunsthistorischen Entdeckungsreise. Sie lässt uns auch in ein beeindruckendes Kapitel der Emanzipationsgeschichte eintauchen, das den Leserinnen und Lesern die Welt dieser unerschrockenen Künstlerinnen vor Augen führt. Die Wiederauflage des Buches zum 20. Jubiläum des Elisabeth Sandmann Verlags enthält auch neue Porträts über Bertha Schilling und Martha Schrag.
Eine ganz andere Perspektive auf Kunst wirft die Publikation „Was Kunst über Liebe erzählen kann“. Autor Nick Trend wendet sich an kunstinteressierte Leser*innen, die gerne Biografien le-
sen. Der Titel deckt die Liebesbeziehungen auf, die die größten Meisterwerke der Kunst inspiriert haben. Ob im Rausch der Leidenschaft, im Schmerz einer unerwiderten Liebe oder in der Freude über eine tiefe Freundschaft – anhand von 80 Kunstwerken erfahren die Leser*innen, wie die Liebe Künstler*innen und ihr Schaffen beeinflusst hat beziehungsweise wie das Thema Liebe in eine Reihe von Themen eingeflossen ist – von Landschaften über Stillleben bis hin zu Selbstporträts. Zu den Künstler*innen gehören: Caravaggio, Georgia O'Keefe, Sarah Bernhardt, Picasso, Rembrandt, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, Clifford Prince-King, Chagall, Lotte Laserstein und Niki de Saint Phalle.
Kunstwerke wecken Begehrlichkeiten – mal wegen der Geschichten, die sie umranken, mal aufgrund der Wirkung, die ein Kunstwerk auf seine Betrachter ausübt, mal wegen des Wertes, den eine Arbeit am Kunstmarkt erzielt. Seit jeher sind Kunstwerke daher auch Ziel von Verbrechen. Und egal ob filmreifer Raubüberfall, unverfrorene Fälschung oder sozialkritischer Vandalismus: Kunstverbrechen faszinieren. Der geografisch gegliederte „Atlas der Kunstverbrechen“ erzählt die Geschichten von Gier, Rache, Macht und – mitunter sogar – Liebe anhand von 75 großen Coups. Laura Evans berichtet von Meisterwerken aus aller Welt, von Kriminellen, die sie schändeten, von Helden, die Werke wiederfanden oder restaurierten. Neben weltberühmten Verbrechen wie dem Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre im Jahr 1911, dem Angriff auf Michelangelos Skulptur im Petersdom im Jahr 1972 sowie einem Porträt des Meisterfälschers Elmyr de Hory enthält dieses Buch auch weniger bekannte Vorfälle. Reiches Bildmaterial, darunter oft Schnappschüsse von der Tat selbst, sowie spannende Texte machen das Buch zu einem fesselnden Lesevergnügen.
Zu den glücklichen Kunsträubern gehört auch Baron Dominique Vivant Denon, Kunstberater von Napoleon und Louis XVI., der als Schöpfer des Weltkanons der Bildenden Kunst gilt. Vivant Denon war auch Direktor des Louvre in seiner allerersten Glanzzeit und eine der schillerndsten Figuren Europas im Zeitalter der Französischen Revolution. Für seine große Liebe, die Kunst, tat er alles und war sich für nichts zu schade. Reinhard Kaiser erzählt hier zum ersten Mal Denons staunenswerte Lebensgeschichte – so lebendig und glänzend geschrieben, dass die Lektüre zu einer großen Verführung wird. Denons Lebens-



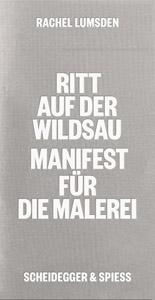

Über die Malerei
Gilles Deleuze, 432 S., 4 Abb., 13 x 20,5 cm, geb., dt., Suhrkamp Verlag 2025, ISBN 9783518588253, EUR 38,00 (D), EUR 39,10 (A)
Ritt auf der Wildsau Manifest für die Malerei
Rachel Lumsden, 208 S., 10,8 x 21 cm, geb., dt., Verlag Scheidegger& Spiess 2023, ISBN 9783039421459 EUR 29,00 (D), EUR 29,90 (A)
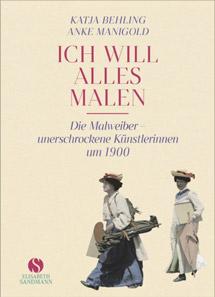
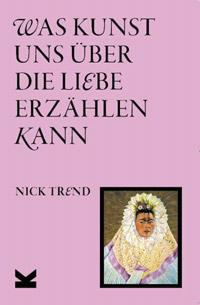

Ich will alles malen Die Malweiber – unerschrockene Künstlerinnen um 1900
Katja Behling, Anke Manigold, 152 S., zahlr. farb. Abb., 18 x 24,8 cm, geb., dt., Elisabeth Sandmann Verlag 2024, ISBN 9783949582295, EUR 30,00 (D), EUR 30,90 (A)
Was Kunst uns über die Liebe erzählen kann
Nick Trend, 208 S., 80 farb. Abb., 15 x 21 cm, geb., dt., Laurence King Verlag 2025, ISBN 9783962444204, EUR 22,00 (D), EUR 22,00 (A), CHF 30,50 (CH)

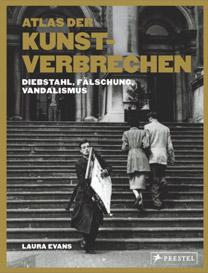
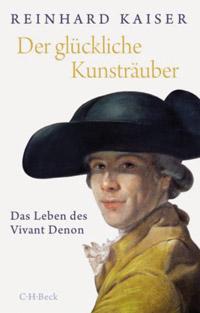


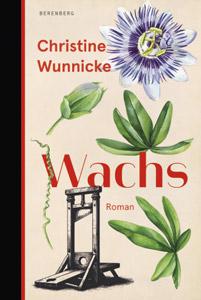
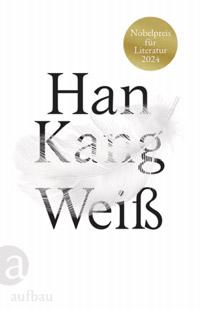
Atlas der Kunstverbrechen. Diebstahl, Vandalismus, Fälschung
Laura Evans, 224 S., 200 farb. Abb., 19 x 24,6 cm, geb., dt., Prestel Verlag 2025, ISBN 9783791377100, EUR 34,00 (D), EUR 35,00 (A)
Der glückliche Kunsträuber. Das Leben des Vivant Denon Reinhard Kaiser, 400 S., 22 Abb., geb., dt., C.H. Beck Verlag 2016, ISBN 9783406688782, EUR 12,95 (D), EUR 13,40 (A)
Wachs
Christine Wunnicke, 176 S., 13,4 x 20 cm, Halbleinen, dt., Berenberg Verlag 2025, ISBN 9783406688782, EUR 24,00 (D), EUR 24,70 (A)

Weiß
Han Kang, 152 S., 14 x 21 cm, geb., dt., Aufbau Verlag 2020, ISBN 9783351037222, EUR 20,00 (D), EUR 20,60 (A)
geschichte ist eine Geschichte der Kunst und der Epoche, in der er lebte, sie führt durch halb Europa und nach Ägypten, auf die Schlachtfelder der Napoleonischen Kriege und in die großen Kunstsammlungen der Zeit, nach Berlin, Kassel, Braunschweig, München, Wien und Schwerin, sowie immer wieder nach Venedig und Paris. „Ich habe nicht studiert. Ich habe viel gesehen“, meinte Denon, von dessen Leben und Verdienste in Frankreich bereits Schulkinder erfahren, der in Deutschland aber immer noch kaum bekannt ist. Die unterhaltsame und kulturgeschichtlich aufschlussreiche wissenschaftliche Biografie aus dem C.H. Beck Verlag zeigt den Baron in seiner ganzen Vielseitigkeit, als Reisenden in Sachen Kunst. Ein Leben wie ein Roman.
„Wachs“ lautet der Titel des Buches, das die Autorin Christine Wunnicke im Frankreich des 18. Jahrhundert ansiedelt. Die fiktive Handlung des Romans thematisiert die Liebe zweier Frauen, die verschiedener nicht sein könnten: Marie Biheron, die schon im zarten Alter Leichen seziert, um deren Innenleben aus Wachs zu modellieren, und Madeleine Basseporte, die zeichnend die Anatomie von Blumen aufs Papier zaubert. Männer kommen auch vor, in schönen Nebenrollen – ein nervöser Bestseller-Autor, ein junger Nichtsnutz und Diderot, der Kaffee trinkt und viel redet. Ein hinreißender Liebesroman, der hin und her schwingt zwischen der Zeit, als Küchenschellen friedlich am Wegesrand wachsen und jenen Schreckenstagen, als nicht allein der Königin wie einer schönen Blume der Kopf abgeschlagen wurde.
Südkoreas bedeutendste Literatin der Gegenwart und Nobelpreisträgerin Han Kang führt uns mit einer Meditation über die Farbe „Weiß“ wieder zurück ins Hier und Jetzt. Sie beginnt ihren Text mit einer Auflistung weißer Dinge und entwickelt daraus ein Buch über Trauer, Wiedergeburt und die Widerstandskraft des menschlichen Daseins. Aus einer zutiefst persönlichen Erinnerung erschafft sie eine große literarische Erzählung: Während eines Aufenthalts in einer europäischen Stadt, die im weißen Winterschlaf liegt, überfällt die Erzählerin plötzlich die Erinnerung an ihre Schwester, die als Neugeborenes in den Armen der Mutter starb. Sie ringt mit dieser Tragödie, die das Leben ihrer Familie bestimmt hat, ein Ereignis, das in Bildern von Weiß wieder und wieder aufscheint. Eine faszinierende Erkundung von Vergänglichkeit, Schönheit und der Eigentümlichkeit des Lebens.#
100 Jahre Jean Tinguely
Neuaufage der reich bebilderten Biografe über einen der innovativsten Künstler der Schweiz
„Jean Tinguely liebte die Bewegung, und er setzte die Kunst in Bewegung. Das wird in diesem Buch aufs Schönste gewürdigt.“
Gerhard Mack, NZZ am Sonntag
Auf Knopfdruck schnurrt der Motor, rotieren Räder, es scheppert und wackelt: et voilà, eine Skulptur von Jean Tinguely. Dass hinter seinen verblüffenden Apparaten so viel mehr steckt als nur originell konzipierte Kinetik und Klamauk, zeigt Dominik Müller in „Jean Tinguely – Motor der Kunst“ aus dem Christoph Merian Verlag, das anlässlich des 100. Geburtstag des Künstlers kürzlich erschienen ist.
Jean Tinguely (1925–1991) war einer der innovativsten und wichtigsten Schweizer Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine beweglichen, maschinenähnlichen Skulpturen machten ihn zu einem Hauptvertreter der kinetischen Kunst und des Nouveau Réalisme, der sich zum Ziel gesetzt hatte, den erhabenen Status der bildenden Kunst zu sprengen und mit neuen Techniken und Materialien die Realität des Alltags in die Kunst zu integrieren. Tinguelys oft riesige Apparate, die Kindern spielend den Einstieg in die Kunst erleichtern und Erwachsene zum Staunen oder Schmunzeln anregen, sind an vielen Orten der Welt präsent. Dahinter steckt ein pralles Künstlerleben, das in dieser Biografie umfassend beschrieben wird. Von dem bekannten „Fasnachtsbrunnen“ über die riesige Expo-Skulptur „Heureka“ und die Feldherrenmaschine „Hannibal“ bis zum faszinierenden „Mengele Totentanz“ führt Dominik Müller durch Tinguelys Leben, seine Werkphasen und seinen kometenhaften Aufstieg.
Umfassend und mit frischem Blick rollt die Biografie Leben und Werk des Künstlers entlang von 16 exemplarischen Werken auf. Der Autor erzählt von Stationen und Motivationen Jean Tinguelys. Ist er ein unbekannter Bekannter und unterschätzter Künstler, wie der Kunsthistoriker Heinz Stahlhut einleitend formuliert? Tinguelys scheinbar wild zusammengeschraubte Skulpturen lösen Staunen und Begeisterung, aber auch Kritik und offene Empörung aus. Sein Werk hatte – und hat! – das Zeug zum Wachund Aufrütteln. Das entsprach Tinguelys Selbstverständnis als
wichtigstem Vertreter der kinetischen Kunst und des Nouveau Réalisme. Tinguely wollte eine sinnlich erfahrbare, fesselnde Kunst, die Spaß machen sollte.
Dahinter steht eine radikale Kunstauffassung, die er zeit seines Lebens nie aufgab. Dieser Maxime entsprechend hat Jean Tinguely Leben und Kunst nie getrennt. Schon als junger Dekorateurlehrling war Anpassung nicht seine Sache. In Basel startete er immer wieder Protestaktionen mit seiner anarchistisch angehauchten Fasnachtsclique. Schon früh international vernetzt, arbeitete er häufig mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern zusammen und tauschte sich mit Freunden wie Marcel Duchamp oder Yves Klein aus. Auch mit seiner zweiten Frau Niki de Saint Phalle setzte er viele künstlerische Projekte um.
Aus Anlass des 100. Geburtstags von Jean Tinguely im Mai 2025 liegt nun die reich bebilderte Biografie in einer überarbeiteten Neuauflage endlich wieder vor. Sie zeigt den Menschen hinter der radikalen Kunstauffassung und lässt Jean Tinguelys Leben, seinen kometenhaften Aufstieg, seine Werkphasen lebendig werden.#
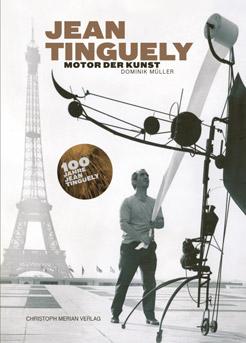

Jean Tinguely – Motor der Kunst Dominik Müller, 208 S. m. 134 teils farb. Abb., 16 x 22,5 cm, geb., dt., Christoph Merian Verlag 2024 (2., überarbeitete Auflage), ISBN 9783039690428, EUR 29,00 (D), EUR 29,90 (A), CHF 29,00 (CH)


Praxisbuch für Künstler Geräte, Materialien, Techniken
Ray Smith, 384 S., über 1000 farb. Abb., 18 x 26 cm, geb., dt., boesner GmbH holding + innovations 2019 (aktualisierte Neuausgabe), ISBN 9783928003254, EUR 29,95 (D), EUR 30,80 (A)
Umfassendes Hintergrundwissen und anschauliche Schrittfür-Schritt-Anleitungen begleiten Hobby- und Profikünstler in die spannende Welt der klassischen Techniken des Zeichnens, Malens und Druckens. Leicht verständlich und teils neu interpretiert werden Themen wie Materialien, digitale Bildbearbeitung und Fotografie, Wandmalerei, Rahmung, Konservierung und Restauration ausführlich beleuchtet. Als bildender Künstler und ehemaliger Kunstdozent an den renommiertesten britischen Universitäten und Kunstakademien verbindet Ray Smith auch in dieser Neuausgabe praktische Tipps aus seiner eigenen langjährigen künstlerischen Praxis mit einer genauen Analyse der wichtigsten Techniken der bildenden Künste.
Kreativität, Technik & Wissen in einem Buch –die perfekte Basis für alle angehenden Künstler!


Kreuzschraffur mit Feder, Stift und Tusche Eine altmeisterliche Technik neu entdeckt
August Lamm, 176 S., durchg. illustriert, 19 x 24,5 cm, kart., dt., boesner GmbH holding + innovations 2023, ISBN 9783928003469, EUR 24,95 (D), EUR 25,60 (A), CHF 29,30 (CH)
Die altmeisterliche Technik der Kreuzschraffur hat in den letzten Jahren ein kreatives Revival erlebt. Durch ihre zeitgemäße Vermittlungsmethode verleiht die renommierte Künstlerin und Illustratorin August Lamm ihrem umfassenden Handbuch Workshop-Charakter. Es führt mit leicht zugänglichen Anleitungen Schritt für Schritt durch jede Phase des Zeichenprozesses, von der Konzeption bis zur Ausführung. Auch jedes Thema lässt sich so angehen: vom einfachen Stillleben bis zu komplexen Porträts und Landschaften. Reichlich Inspiration bieten Beispiele für Kreuzschraffuren aus der Kunstgeschichte und den eigenen Arbeiten der Autorin.

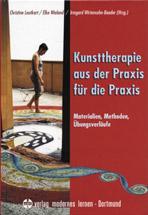
Kunsttherapie –aus der Praxis für die Praxis
Christine Leutkart (Hrsg.), 328 S., farb. Abb., 16 x 23 cm, geb., dt., überarb. Neuaufl., Verlag Modernes Lernen, ISBN 9783808006634, EUR 29,80 (D), EUR 30,70 (A)
Die Neuauflage des Standardwerks zur Kunsttherapie stellt Übungen für die tägliche Praxis vor, die ein breites Spektrum hinsichtlich Alters- und Zielgruppe abdecken, sowie u.a. die Bereiche Malerei/ Zeichnen, Druckverfahren, Sand/ Collage, Filzen, dreidimensionales Gestalten mit verschiedenen Werkstoffen und Maskenbau.


Praxisbuch kunsttherapeutische Biografiearbeit
Sandra Deistler, 132 S. m. Abb., 15 x 23 cm, kart., dt., Beltz Juventa 2023, ISBN 9783779972242 , EUR 24,00 (D), EUR 24,70 (A)
Künstlerisch-kreatives Gestalten schafft Raum für alles, was gesehen werden möchte. Das Praxisbuch zeigt neue, verspielte Möglichkeiten im Umgang mit Krise und Erkrankung auf und unterstützt Wandel und Veränderung.

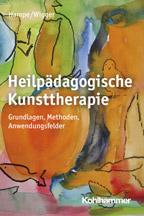
Heilpädagogische Kunsttherapie
Ruth Hampe, Monika Wigger, 184 S., 15,5 x 23,2 cm, brosch., dt., Kohlhammer Verlag 2020, ISBN 9783170320772, EUR 34,00 (D), EUR 35,00 (A)
Diese profunde Einführung in die Grundlagen Heilpädagogischer Kunsttherapie legt dabei das Augenmerk auf die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Es besticht durch viele Fall- und Projektbeispiele sowie durch im kunsttherapeutischen Setting entstandenes Bildmaterial, das die Umsetzung in die Praxis sicherstellt.

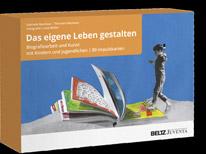
Das eigene Leben gestalten Biografiearbeit und Kunst mit Kindern und Jugendlichen. 80 Impulskarten
Atelier Neuhaus, 80 Karten in Box mit Booklet, 16,5 x 24 x 3,5 cm, dt., Beltz Juventa 2023, EAN 4019172400118, EUR 58,00 (D), EUR 59,70 (A)
Das Kartenset bietet eine Vielfalt an einfachen künstlerischen Ideen für das an Ressourcen orientierte biografische Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Zur alleinigen Nutzung oder in Begleitung, in Schulen, Ganztagsbetreuung, Heimen und in der Jugendarbeit.
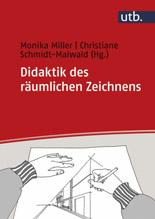

Didaktik des räumlichen Zeichnens
Monika Miller, Christiane SchmidtMaiwald (Hrsg.), 312 S., 60 s/w Abb., 17 x 24 cm, Softcover, dt., UTB 2022, ISBN 9783825257996, EUR 39,90 (D), EUR 41,10 (A)
Das Buch stellt ein nachhaltiges Lehrkonzept für räumliches Zeichnen im Unterricht vor. Die Herausgeberinnen vermitteln didaktische und künstlerische Methoden, Darstellungsabsichten für den Unterricht und schärfen den Blick auf Probleme in der Umsetzung.


Porträt zeichnen leicht gemacht
SinArty, 144 S., zahlr. farb. Abb., 21 x 27,3 cm, kart., dt., Dorling Kindersley 2025, ISBN 9783831050161, EUR 19,95 (D), EUR 20,60 (A)
Das Zeichnen von Gesichtern empfinden viele Zeichner*innen als schwierig – doch das muss nicht sein! Dieser umfassende Leitfaden nimmt die Unsicherheit beim Porträtzeichnen.


Kunstpädagogik
Eine systematische Einführung
Jochen Krautz, 184 S., 12 farb. Abb., 24 s/w Abb., 15 x 21,5 cm, brosch., dt., UTB 2020, ISBN 9783825254278, EUR 25,00 (D), EUR 25,70 (A), CHF 32,50 (CH)
Was macht Kunstpädagogik aus? Warum gehört Kunstunterricht zur schulischen Bildung? Und was soll und kann er leisten?
Diese Einführung in die Kunstpädagogik bietet anhand vieler Beispiele eine strukturierte, schulformübergreifende Übersicht und erläutert zusammenhängend alle wichtigen Begriffe, Theorien und Fragen.


Figur im Raum entdecken und zeichnen
Peter Boerboom, 176 S., durchg. farb. illustr., 17 x 24 cm, kart., dt., Haupt Verlag 2025, ISBN 9783258602950, EUR 29,90 (D), EUR 30,80 (A), CHF 32,00 (CH)
Wie wirkt die Figur im Raum, wie interagiert sie mit dem Raum und wie erzeugt sie selbst Raum? Der Raum und der Mensch darin sind die beiden zentralen Themen dieses Buches, die mit vielen Zeichnungen, Fotos und Collagen dargestellt werden.

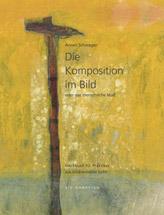
Solange der Vorrat reicht.

Die Komposition im Bild oder das menschliche Maß
Annelie Schwager, 212 S., m. zahlr. Abb., 22 x 28 cm, brosch., dt., ars momentum Kunstverlag 2012, ISBN 9783938193693, EUR 29,80 (D), EUR 30,70 (A), CHF 40,30 (CH)
Reich bebildert beleuchtet das Nachschlagewerk alle Aspekte der Bildkomposition aus bildnerischer Sicht: Bildanalyse, -raum und -psychologie, Proportion, Goldener Schnitt, Meisterformeln, Formeln der Moderne, das magische Dreieck, Urformen, Zentralperspektive, Abstraktion u.v.m. Im Anhang runden kompositorische Erläuterungen zu abgebildeten Werken das Buch ab.


Malen macht glücklich
Terry Runyan, 160 S., durchg. farb. Abb., 17 x 24 cm, dt., geb., Midas 2023 (2. Auflage), ISBN 9783038762249, EUR 20,00 (D), EUR 20,70 (A), CHF 30,00 (CH)
Aus den Grundfarben Farbtöne mischen, zunächst scheinbar formlose Flecken zu Tieren, Pflanzen oder Alltagsgegenständen umgestalten – in diesem Malbuch geht es nicht um das perfekte Gemälde. Der Fokus liegt auf der Wirkung, die kreative Tätigkeiten auf uns haben. Aquarellmalerei macht glücklich, entspannt und lässt die Gedanken zur Ruhe kommen.

Das Handbuch der Farbmischtechniken
144 S., zahlr. farb. Abb., 23 x 23 cm, geb., dt., boesner GmbH holding + innovations 2023, ISBN 9783928003452, EUR 19,95 (D), EUR 20,60 (A), CHF 26,20 (CH)
Das umfassende Grundlagenwerk zu Farbwirkung und Farbmischtechniken. Die Bandbreite der gängigen Malmedien wird anhand übersichtlicher Farbtabellen dar gestellt. Mit über 10.000 Farbmischungen für perfekte Nuancen und zahlreichen Tipps zum Verhalten unterschiedlicher Medien und Farben verschiedener Hersteller.
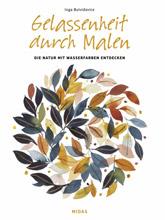

Gelassenheit durch Malen
Inga Buividavice, 160 S., 100 Abb. 17 x 23, kart., dt., Midas 2024, ISBN 9783038762867, EUR 20,00 (D), EUR 20,70 (A), CHF 30,00 (CH)
Finden Sie innere Ruhe und Glück in diesem wunderschönen, meditativen und erdigen Aquarell-Anleitungsbuch der Naturliebhaberin, Lehrerin und Künstlerin Inga Buivadavice. Kunsttherapie und der Akt des Malens sind weithin bekannt für ihre positiven Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.

Mit unbegrenzter Haftung
Sie kommen mit wenig Bindemittel aus, bestehen aus den besten Pigmenten in höchster Konzentration, sind farbstark auf dem Malgrund und können mit den Fingern verblendet werden. Von feinster Detailgenauigkeit bis zu breiten, körnigen Linien und malerischen Verwischungen bieten Pastelle ein vielseitiges künstlerisches Ausdruckspotenzial – für all das benötigen sie allerdings einen strukturierten Untergrund, der ausreichend Haftung bietet. Die Auswahl an Pastellpapieren ist umfangreich: Ungestrichenes

Papier hat eine raue, natürliche Oberfäche und hält mehrere Schichten Pastellkreide. Bei Sandpapier ist die Oberfäche eher körnig, die Farbe wird vom Stift abgeschlifen und haftet in einem eher matten Auftrag am Papier. Strukturpapier weist eine Oberfäche mit klar sichtbaren Fasern auf, die auch nach dem Farbauftrag sichtbar sein können. In unserem Beispiel wurde Pastellkarton von Sennelier verwendet, dessen Oberfäche mit einer feinen pfanzlichen Beschichtung versehen ist. Durch die weiche, leicht gekörnte Oberfächenstruktur werden Abrieb und Haftung der Farbpartikel optimiert, dadurch kann weniger Fixativ verwendet werden. Es gibt den Pastel Card-Karton in unterschiedlichen Farben. Anhand der Farbaufträge wird hier sichtbar, wie Struktur und Farbe des Untergrundes die Wirkung der weichen boesner Künstler-Pastellkreiden in Premium-Qualität unterstreichen.#

Linke Seite: (unten liegend) ars nova Skizzenheft in 4 Formaten und 5 Farben erhältlich ; boesner Nostalgiehefte mit Aktenstich erhältlich in 2 Formaten in 11 Farben. Rechte Seite (oben): boesner Künstler-Softpastell in 48 Farben erhältlich. Rechte Seite (unten links): Kreul Glass & Porcelain Pen in verschiedenen Strichbreiten, Spitzen und Farben erhältlich. Rechte Seite (unten Mitte): linea Acrylglasscheiben in 6 mm Stärke in 5 Formaten erhältlich. Rechte Seite (unten rechts): Kreul Glas-/Porzellanmalfarbe in den Varianten Classic, Clear und Chalky in verschiedenen Farben erhältlich.





Wegbereiter moderner Gestaltung
„Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“ im Vitra Design Museum
Wie konnte eine amerikanische Freikirche aus dem 18. Jahrhundert Generationen von Künstler*innen, Architekt*innen und Designer*innen weltweit inspirieren? Die Shaker waren eine religiöse Gruppe, die auf Grundlage ihres Wertesystems eine einzigartige Gestaltungskultur entwickelten. Ihre berühmten, zeitlosen und funktionalen Objekte, Bauten und Interieurs waren für die Shaker selbst Ausdruck religiöser Werte rund um Gemeinschaft, Arbeit und soziale Gleichheit. Die Ausstellung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“, die bis zum 28. September 2025 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zu sehen ist, präsentiert derzeit das ganze Gestaltungsspektrum der Shaker – von Möbeln und Bauten bis hin zu Werkzeugen und Textilien – und zeigt, wie die reduzierte Ästhetik bis heute nachwirkt. Historische Shaker-Objekte werden den Werken zeitgenössischer Künstler*innen und Designer*innen gegenübergestellt, die die heutige Relevanz der Shaker untersuchen.
Die Shaker formierten sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England und emigrierten 1774 in die amerikanischen Kolonien, wo sie 18 eigenständige Gemeinden gründeten. Innerhalb dieser Siedlungen kreierten sie Möbel, Haushaltsgegenstände und Bauten, die bald für ihre Schlichtheit, Funktionalität und Standardisierung geschätzt wurden. Obwohl die Shaker als Wegbereiter moderner Gestaltung gelten, werden sie bis heute oft auf eine Ästhetik reduziert, die auch als „Shaker-Stil“ bezeichnet wird. Die Ausstellung in Weil am Rhein geht darüber hinaus und betrachtet das Shaker-Design im Kontext ihrer Entstehungszeit und des religiösen Weltbildes der Shaker. Die vom Mailänder Studio Formafantasma gestaltete Schau zeigt über 150 Originalexponate, die mehrheitlich aus der Sammlung des Shaker Museums in Chatham, New York stammen.
[1] Verschiedene Spanschachteln, Foto: © Vitra Design Museum / Alex Lesage, mit freundlicher Genehmigung des Shaker Museums, Chatham, New York.

Die Ausstellung entstand als Kooperation des Vitra Design Museums, der Wüstenrot Stiftung, des Milwaukee Art Museums, des Institute of Contemporary Art Philadelphia und des Shaker Museums. Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums: „Unser Museum war schon immer an Designströmungen interessiert, die abseits ausgetretener Pfade liegen und den kulturellen, philosophischen, ja spirituellen Kontext von Design veranschaulichen. In unserer Möbelsammlung befinden sich mehrere Stücke der Shaker, die uns die Bedeutung der Shaker immer wieder in Erinnerung riefen. Die Ausstellung selbst ist das Ergebnis einer transatlantischen Kooperation, die angesichts der aktuellen politischen Verschiebungen wichtiger denn je scheint.“
Neben historischen Objekten präsentiert die Ausstellung Auftragsarbeiten von sieben zeitgenössischen Designer*innen und Künstler*innen, die die Shaker aus einer persönlichen und oft
auch kritischen Perspektive betrachten. Neue Forschungsergebnisse zur Shaker-Kultur, etwa zu Themen wie Gleichberechtigung, Inklusion und Nachhaltigkeit, erweitern gängige Narrative zum Shaker-Design und eröffnen dem Publikum neue Zugänge zu einem faszinierenden sozialutopischen Experiment der Moderne.
Die Schau ist in vier thematische Abschnitte unterteilt, die nach Zitaten von Mitgliedern der Shaker-Gemeinschaft benannt sind. Die erste Sektion „The Place Just Right“ stellt die Weltanschauungen und räumlichen Strukturen vor, die das Shaker-Leben prägten. Fotografien von Shaker-Bauten werden mit besonders symbolträchtigen Objekten kombiniert, etwa der Treppe eines Wohnhauses oder einer vier Meter langen Sitzbank, die das gemeinschaftliche Leben und seine strenge Gliederung veranschaulichen. Ein Radio aus der Shaker-Gemeinde Canterbury veranschaulicht, wie aufgeschlossen die Gemeinschaft externen In-
[2] Shaker Village of Pleasant Hill, Kentucky, Foto: Florian Holzherr. [3] Modifizierter Webstuhl, Sabbathday Lake, Maine, ca. 1875–99, Foto: © Vitra Design Museum / Alex Lesage, mit freundlicher Genehmigung des Shaker Museums, Chatham, New York.
[2]


novationen trotz ihres Rückzugs aus der weltlichen Gesellschaft gegenüberstand. Dies lenkt den Blick auf die Bedeutung von Musik und Ritualen für die Shaker: Einen zentralen Stellenwert nahmen etwa die ausdrucksstarken Tanzrituale während des Gottesdienstes ein, nach denen die Shaker ihren Namen erhielten („Schütteltanz“). Die Videoinstallation Power, ein Tanzstück von Reggie Wilson, vertieft dieses Thema, indem sie das Erbe des Shaker-Tanzes sowie dessen Überschneidungen mit afroamerikanischen Tanzpraktiken und Musiktraditionen untersucht.
Der zweite Raum „When We Find a Good Thing, We Stick To It“ rückt das Design der Shaker in den Mittelpunkt. Zum Inbegriff des Shaker-Designs wurden einfache, standardisierte Stühle, die höchste handwerkliche Qualität mit einer reduzierten, zeitlosen Formensprache verbinden. Auch Schränke, Kommoden und Tische beeindrucken durch ihre Schlichtheit und illustrieren das
Streben nach Ordnung und Struktur, das die Shaker auch in ihren „Millenial Laws“ (Jahrtausendgesetzen) von 1821 und 1845 festschrieben. Die eigenwillige Verbindung aus festen Regeln und Offenheit für Interpretation untersucht die zeitgenössische Künstlerin Kameelah Jahan Rasheed, die sich auf die Schriften von Mother Rebecca Cox Jackson, einer schwarzen Shaker-Älstesten und Gründerin der einzigen städtischen Shaker-Gemeinde bezieht.
Der dritte Abschnitt der Ausstellung heißt „Every Force Evolves a Form“ und betrachtet die Shaker als findige Unternehmer und Geschäftsleute. Zu ihren Bestsellern zählten ovale Spanschachteln und sogenannte „Fancy Goods“ (Handarbeitsutensilien), über deren Verkauf die Shaker ihre Gemeinden finanzierten. Werkzeuge und einfache Maschinen zeigen, wie offen die Shaker gegenüber technischen Neuerungen waren, die sie oft auf un-
[4]
[4]
[3]


konventionelle Weise an eigene Bedürfnisse anpassten. Bis heute entziehen sich die Shaker jeder Einordnung, da sie an der Grenze zwischen traditionellem Handwerk, aufkommender Industrialisierung und modernem Design arbeiteten. Ihre Form ethischer Gestaltung im heutigen Kontext untersucht die niederländische Designerin Christien Meindertsma, indem sie die Shaker-Tradition der Korbflechterei aufgreift und damit einen aus Weidenzweigen geflochtenen, biologisch abbaubaren Sarg entwickelt hat. Finnegan Shannon wiederum untersucht die Shaker als Pioniere der Inklusion, die ihre Umgebungen an körperliche Bedürfnisse anpassten, während der Künstler David Hartt sich in seiner filmischen Arbeit The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Tree of Light) mit der Spiritualität und Geschichte der Gemeinschaft auseinandersetzt.
Werkzeuge und Maschinen zeigen, wie ofen die Shaker gegenüber technischen Neuerungen waren.
Der letzte Abschnitt der Ausstellung mit dem Titel „I don’t want to be remembered as a chair“ betrachtet das spirituelle Vermächtnis der Shaker und die heutige Relevanz ihrer gemeinschaftlich geprägten Gestaltung. Im Zentrum stehen hier die so genannten Gift Drawings (1830–1850) der Shaker – ornamental-abstrakte Zeichnungen, in denen Shaker-Schwestern ihre göttlichen Visionen festhielten. Die Verbindung von Spiritualität, Arbeit und Gestaltung untersucht der Ausstellungsbeitrag von Chris Holstrøm, ein großformatiges Stickwerk, auf dem jeder Faden ein Gebet repräsentiert. Den Abschluss der Ausstellung bildet die In-
[5]
[6]
[5] Polierbesen, New Lebanon, New York, 2024, Foto: © Vitra Design Museum / Alex Lesage, mit freundlicher Genehmigung des Shaker Museums, Chatham, New York. [6] Sitzbank, Canterbury oder Enfield, New Hampshire, ca. 1855, Foto: © Vitra Design Museum / Alex Lesage, mit freundlicher Genehmigung des Shaker Museums, Chatham, New York.

Ausstellung
Bis 28. September 2025
Die Shaker Weltenbauer und Gestalter
Katalog
stallation Meetinghouse 2 der Künstlerin Amie Cunat. Die maßstabsgetreue Neuinterpretation eines Shaker-Gemeindehauses, in dem Gottesdienste abgehalten wurden, ist für das Publikum zugänglich und lädt zur Reflexion über Gemeinschaft ein. In der heutigen, von Konflikten geprägten Zeit zeigen die Shaker mit ihrer eigenwilligen Verbindung aus Utopie und Pragmatismus: Eine andere Welt ist möglich.
„‚Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter‘ beleuchtet das Vermächtnis der Shaker und ihre Weltanschauung aus zeitgenössischer Perspektive. Die Ausstellung lädt dazu ein zu erkunden, welche Impulse die Welt der Shaker für uns in der heutigen Zeit bereithält“, so Mea Hoffmann, Mitkuratorin der Ausstellung. „Durch die vereinte Expertise der beteiligten Institutionen ist eine bereichernde Zusammenarbeit entstanden, die einen lebendigen Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst, Design und Geschichte ermöglicht und die anhaltende Faszination für die Shaker widerspiegelt.“
Die Ausstellung wird von einem vielfältigen Programm aus Vorträgen, Diskussionen und Workshops begleitet. Nach der Premiere im Vitra Design Museum wird sie im Institute of Contemporary Art in Philadelphia (31. Januar bis 9. August 2026), im Milwaukee Museum of Art (25. September 2026 bis 31. Januar 2027) und in weiteren internationalen Museen zu sehen sein.#

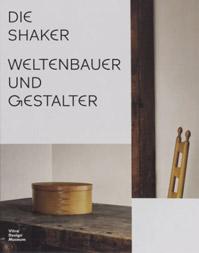
Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter
Vitra Design Museum, Wüstenrot Stiftung (Hrsg.), Hardcover mit Folienprägung, 286 S. mit 190 Abb., ISBN 9783945852651
[7] Meetinghouse (1793), Hancock Shaker, Village, Hancock, Massachusetts, 2024, Foto: © Vitra Design Museum / Alex Lesage, mit freundlicher Genehmigung des Hancock Shaker Village.
Kontakt
Vitra Design Museum
Charles-Eames-Straße 2 79576 Weil am Rhein Tel. +49-(0)7621-7023200 www.design-museum.de
[7]

Das Geheimnis des Kosmos
Vija Celmins in der Fondation Beyeler
Ihre Arbeiten laden ein, innezuhalten und sich in die faszinierenden Oberflächen zu vertiefen: Vija Celmins (*1938) ist eine Meisterin der subtilen Bildgewalt und vor allem für ihre Gemälde und Zeichnungen von Galaxien, Mondoberflächen, Wüsten und Ozeanen bekannt. Ihre Werke sind nicht monumental, entziehen sich aber dem schnellen Blick, ihre Palette ist zurückhaltend –und trotzdem fesseln die Arbeiten die Betrachtenden in der Er-
kundung der Spannungen zwischen Fläche und Raum, Nähe und Distanz, Stille und Bewegung. In diesem Sommer bietet die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel die seltene Gelegenheit, das Werk der amerikanischen Künstlerin zu entdecken. Die in Zusammenarbeit mit der Künstlerin realisierte Ausstellung präsentiert rund 90 Werke, darunter vor allem Gemälde und Zeichnungen sowie einige Skulpturen und Druckgrafiken.
Schneefall, 2022–2024, Öl und Alkyd auf Leinwand, 132 x 184 cm, Sammlung Glenn und Amanda Fuhrman NY, Courtesy der FLAG
Art Foundation, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Aaron Wax, Courtesy Matthew Marks Gallery.
1938 in Riga (Lettland) geboren, war Vija Celmins 1944 mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet, von wo sie 1948 in die Vereinigten Staaten auswanderte. Sie wuchs in Indianapolis auf, studierte Kunst in Los Angeles und zog später nach New Mexiko, New York und Long Island, wo sie heute lebt und arbeitet. Nur selten bietet sich die Gelegenheit, ihre Arbeiten zu sehen: Dies ist nicht zuletzt darin begründet, dass Celmins‘ Schaffen einem ganz eigenen Tempo unterliegt und sie im Laufe ihrer sechs Jahrzehnte währenden Karriere nur etwa 220 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen geschaffen hat.
Die Ausstellung in der Fondation Beyeler präsentiert bis zum 21. September 2025 eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Werken, die sich von einer Auswahl bedeutender früher Gemälde von Alltagsgegenständen aus den 1960er-Jahren bis hin zu ihren jüngsten Bildern von Schneeflocken im Nachthimmel erstreckt, die das Geheimnis des Kosmos heraufbeschwören.
Bei sämtlichen Bildern von Celmins dienten Fotografien als Vorlagen, während die seltenen Skulpturen hingegen auf Objekte zurückgehen. Die Vorlage ist für Celmins eine Art Werkzeug, das es ihr gestattet, sich keine Gedanken um Komposition und Ausschnitt machen zu müssen. Allerdings fertigt sie kein Abbild der Vorlage, ist nicht der fotorealistischen Darstellung verpflichtet: Die Bilder sind aus zahllosen Schichten von Grafit oder Kohle auf Papier und Ölfarbe auf Leinwand aufgebaut –als ob die Künstlerin von Hand eine unfassbare Weite zu erfassen und festzuhalten suchte. Dies lässt sich besonders eindrücklich an den Bildern des nächtlichen Sternenhimmels nachvollziehen, ein Motiv, das Celmins seit ihren Anfängen in seinen Bann zieht.
Ergänzend zur Ausstellung zeigt die Fondation Beyeler den Kurzfilm „Vija“. In 30 Miuten zeichnet der Film ein aus dem Moment der Begegnung entstandenes Porträt der Künstlerin, die über ihre lebenslange Praxis nachdenkt und sowohl die Türen ihres Ateliers als auch die Schubladen ihres Archivs öffnet. Das Porträt nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine Reise durch die Formen, Bilder und Gedanken, die die unverwechselbare Sensibilität von Vija Celmins prägen.#
Ausstellung
Bis 21. September 2025
Vija Celmins
Katalog


Vija Celmins
Theodora Vischer, James Lingwood (Hrsg.), Texte von Julian Bell, Jimena Canales, Teju Cole, Rachel Cusk, Marlene Dumas, Katie Farris, Robert Gober, Ilya Kaminsky, Glenn Ligon, James Lingwood, Andrew Winer, Hardcover, dt., 208 S. m. 114 Abb., 24 x 29,5 cm, Hatje Cantz 2025, ISBN 9783775760300
Kontakt
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 4125 Riehen/Basel
Tel. +41-61-6459700 www.fondationbeyeler.ch
Zeichnen als ofene Denkbewegung
Damien Hirst in der Albertina Modern

Damien Hirst gilt als einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, der mit seinen Gemälden, Skulpturen und Installationen internationale Anerkennung gefunden hat. Weniger bekannt sind die Zeichnungen des britischen Künstlers, die derzeit erstmals in einem Museum präsentiert werden: Die Albertina Modern in Wien zeigt bis zum 12. Oktober 2025 die Ausstellung „Damien Hirst. Drawings“, die einen faszinierenden Einblick in Hirsts kreative Prozesse bietet. Viele von ihnen entstanden in Vorbereitung seiner Werke und werden zusammen mit einer Auswahl verwandter Skulpturen und Gemälde gezeigt.
Damien Hirst wurde 1965 in Bristol geboren und studierte am Goldsmiths College in London. 1988 organisierte er die Ausstellung „Freeze“, an der er auch teilnahm und die als Geburtsstunde der Bewegung der Young British Artists (YBA) gilt. Internationale Bekanntheit erlangte er ab den frühen 1990er-Jahren als zentrale Figur dieser neuen Generation britischer Künstlerinnen und Künstler. 1995 wurde er mit dem renommierten Turner Prize ausgezeichnet. Seither hat er zahlreiche groß angelegte Projekte realisiert, darunter die monumentale Schau Treasures from the Wreck of the Unbelievable (2017) in Venedig. Mit seinen ikonischen Werken – darunter die Medicine Cabinets, die Spot Paintings, seine in Formaldehyd konservierten Tiere und die mit Diamanten besetzten Totenköpfe – hat Hirst die Kunstwelt geprägt. Einige seiner berühmtesten Arbeiten wurden zunächst als Zeichnungen entworfen, bevor sie als Gemälde, Skulpturen und Installationen Gestalt annahmen.
Manche von Hirsts Entwürfen entstehen spontan und schnell – oft mit kurzen Notizen, Materiallisten oder Berechnungen. Andere Zeichnungen sind dagegen wesentlich detaillierter ausgearbeitet. Hirst betrachtet das Zeichnen als wichtigen Teil seiner künstlerischen Praxis. Es hilft ihm, Ideen festzuhalten, sie sich ins Gedächtnis zu rufen und Konzepte zu entwickeln. Außerdem nutzt er es, um Raum und Proportionen auf dem Papier zu testen, bevor er ein Werk realisiert. Zeichnungen dienen auch dazu, Visualisierungen fur sein Team zu erstellen, damit dieses seine Vorstellungen besser umsetzen kann, oder
Vienna, 7 May – 12 October 2025.
reserved,
2025,
[1] Installation view, „Damien Hirst: Drawings at Albertina Modern“,
Photographed by Rainer Iglar, © Damien Hirst and Science Ltd. All rights
DACS
© VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Damien Hirst.
um Details und Veränderungen im Entstehungsprozess zu dokumentieren. Hirst selbst beschreibt das Zeichnen als Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und seine Sicht auf die Welt mitzuteilen. Für ihn ist es ein fortlaufender Prozess, der schon in seiner Kindheit begann. Seine Mutter gab ihm seinerzeit Papier und Stifte, um ihn zu beschäftigen. Sie fügte kontinuierlich neue Blätter an seine Zeichnungen an, sodass sie immer größer wurden – und so begann er, über die Grenzen des Papiers hinauszudenken.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Hirsts konzeptioneller Herangehensweise an die Zeichnung, die er auf unterschiedliche Weise einsetzt – manchmal als erste Studie für eine größere Arbeit, manchmal als autonomes Werk, das für sich allein steht, und manchmal als retrospektive Erkundung von Ideen nach der Fertigstellung eines Kunstwerks. Für viele seiner bekanntesten Serien verwendete er Zeichnungen, um Ideen zu artikulieren, die er für ebenso bedeutsam hält wie die fertigen Kunstwerke selbst. Dabei reicht die Bandbreite von der eigenhändigen Studie über die automatisch erstellte Zeichnung, die vom Zufall beeinflusst ist, bis hin zu Arbeiten auf Papier, die er durch sein Studio anfertigen lässt.
Ein wichtiges Highlight der Ausstellung ist Hirsts ehrgeiziges Projekt Treasures from the Wreck of the Unbelievable, das die Grenze zwischen Realität und Fiktion verwischt und die Glaubwurdigkeit von Kunst und historischen Erzählungen in Frage stellt. Die Ausstellung umfasst eine Sammlung von Zeichnungen aus diesem Projekt, die die Bildsprache klassischer Studien und archäologischer Dokumentationen aufgreifen.
Treasures from the Wreck of the Unbelievable erzählt die Geschichte des legendären Schiffs Apistos (altgriechisch fur „unglaublich“ oder „ungläubig“), das vor rund 2000 Jahren mit einer Sammlung unschätzbarer Kunstwerke an Bord sank. Der Besitzer, Cif Amotan II., soll seine Reichtümer auf dem Schiff versammelt haben –eine außergewöhnliche Mischung aus mythologischen Figuren, Götterdarstellungen und kulturellen Artefakten. Erst in unserer Zeit wurden diese Schätze entdeckt und durch Tauchexpeditionen geborgen, finanziert von Damien Hirst selbst. Doch letztlich ist nichts, wie es scheint. Hirst entwirft eine ebenso faszinierende wie trügerische Welt, in der archäologische Sensation, museale Inszenierung und künstlerische Fiktion nicht voneinander zu unterscheiden sind. Die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion verschwimmen – bis Details auftauchen, die Zweifel aufkommen lassen. Ist dies wirklich eine antike Skulptur oder doch eine popkulturelle Anspielung? Ist die Geschichte echt oder eine kunstvoll konstruierte Illusion? Mit diesem monumentalen Projekt, an dem Hirst und sein Team rund zehn Jahre arbeiteten und in das in der Albertina Modern ein Einblick geboten wird, spielt der Künstler mit Vorstellungen von Authentizität, von historischer Wahrheit und von dem, was wir glauben wollen.
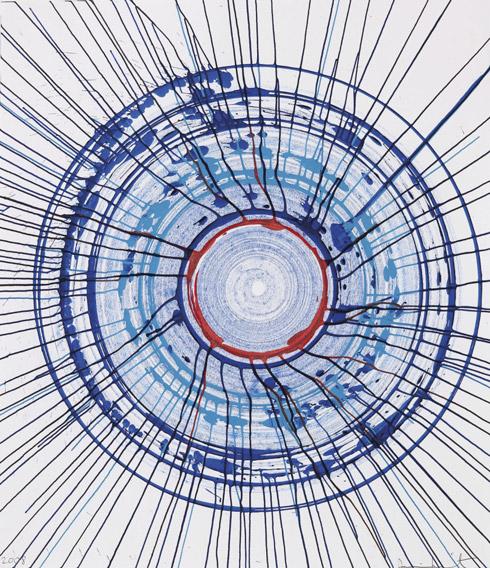
Auch die Zeichnungen zu Treasures from the Wreck of the Unbelievable sind Teil dieser Inszenierung. Hirst betont, dass er diese nicht als geborgene Kunstwerke aus der Epoche Cif Amotans II. versteht: „Die Zeichnungen konnten sich natürlich nicht auf dem Schiff befinden, da sie nach all den Jahren im Meer verrottet wären. Also stellte ich mir eine Sammlung von Zeichnungen vor, die auf Augenzeugenberichten und Erinnerungen von Menschen basieren, die die Geschichte gehört hatten, und dass die Existenz dieser Zeichnungen das Erste war, was die Fantasie der Schatzjäger beflügelte und die Entdeckung des Schiffswracks Wirklichkeit werden ließ.“ Diese Zeichnungen sind also Teil der künstlerischen Erzählung, die diese Ästhetik aufgreift. Um historische Authentizität vorzutäuschen, verwendete Hirst Pergament aus Ziegenhaut und künstlich gealtertes Papier, experimentierte mit alten Zeichentechniken und ließ eigens für das Projekt Tinten herstellen. Restaurator*innen wurden hinzugezogen, um den Blättern mit Vergilbungen, Flecken und Gebrauchsspuren ein jahrhundertealtes Aussehen zu verleihen. Doch auch hier bricht Hirst die Illusion: Da die Zeichnungen auf Basis von Fotografien der Skulpturen entstanden, erhielten sie eine moderne Anmutung – beeinflusst durch Kameraeinstellung und Perspektive.
Photographed by Prudence Cuming Associates Ltd. © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Damien Hirst.
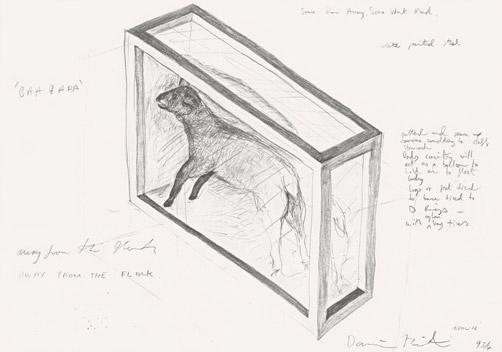
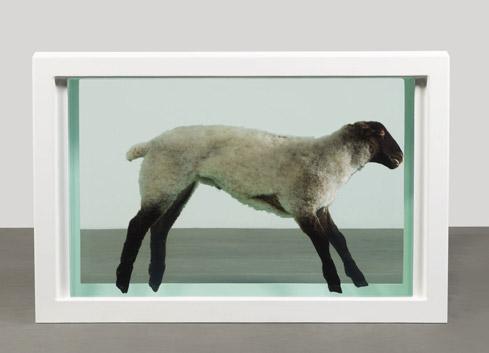
Ebenso gibt Hirst durch das Einfügen der Logos von Automarken Hinweise darauf, dass die Zeichnungen aus unserer Zeit stammen müssen. Solche bewussten Brüche lenken den Blick auf die Kernfrage seines Projekts: Wie wird Geschichte konstruiert und wie leicht lassen wir uns von Erzählungen leiten?
Darüber hinaus präsentiert die Ausstellung Hirsts Installation Making Beautiful Drawings, die ursprünglich 1994 entwickelt wurde. Bei diesem Werk handelt es sich um eine Zeichenmaschine, die mithilfe einer sich drehenden Scheibe, auf die Farben aufgetragen werden, Kunstwerke schafft. Die Besucher*innen der Albertina Modern haben die Möglichkeit, mit dieser Maschine zu interagieren, um den Geist der ursprünglichen Präsentation widerzuspiegeln und sich direkt mit Hirsts Erforschung von Zufall und Prozess in der Kunst auseinanderzusetzen.
Mit Making Beautiful Drawings ruckt Hirst den Prozess des Zeichnens selbst in den Mittelpunkt. Das Zeichnen, das doch gemeinhin als persönlichste und individuellste künstlerische Ausdrucksform gilt, da sie die direkte und unmittelbare Verbindung von Kopf und Hand sichtbar macht, wird an eine Maschine übergeben. Gleichzeitig ermöglicht der Künstler auch uns als Publikum, diese Maschine zu bedienen, um eigene Spin Drawings zu erzeugen. So schafft Hirst einen partizipativen Zugang und hinterfragt zugleich gängige Vorstellungen von künstlerischer Handschrift und Authentizität.
Unter Hirsts Tiermotiven nimmt der Hai eine besondere Stellung ein. Seine Zeichnungen hierzu geben Einblick in die Entwicklung seiner ikonischen Hai-Installationen und zeigen, wie unterschiedlich er das Motiv des Raubfisches einsetzt. Bereits 1989 skizziert Hirst erste Ideen zu The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991) – jenem Werk, das später zu seinem Durchbruch werden sollte – auf Papier, das ihm gerade in die Hände fiel: einer herausgerissenen Buchseite oder ein gebrauchtes Kuvert. Die Zeichnungen zeigen, wie Hirst unterschiedliche konzeptuelle Dimensionen des Haimotivs auslotet. Besonders aufschlussreich sind jene Entwürfe, die nie verwirklichte Projekte dokumentieren. Sie zeigen die ganze Bandbreite von Hirsts Auseinandersetzung mit dem Motiv und verdeutlichen, wie er durch das Medium der Zeichnung verschiedene Möglichkeiten durchspielt – von der monumentalen Einzelfigur bis hin zu komplexen Ensembles mit mehreren Tieren. Die Haistudien illustrieren exemplarisch, wie Hirst in der Tradition klassischer Bildhauerzeichnungen arbeitet: Er setzt sie als konzeptionelles Werkzeug, als Dokumentation eines Denkprozesses und als Mittel ein, um jene existenziellen Fragen zu erkunden, die sein gesamtes Schaffen durchziehen.
In vielen seiner Blätter zeigt sich Hirsts Auseinandersetzung mit Zyklen und Wiederholungen – mit der Frage, was bleibt, wenn alles vergänglich ist. Zeichnen bedeutet hier, Möglichkeit zu erzeugen, ein zukünftiges Werk zu erahnen, einen Gedanken zu speichern, der vielleicht erst Jahre später seine Form findet. Die Zeichnung wird zum Vehikel, mit dem Hirst in die Zukunft greifen kann. Es ist gerade diese zeitliche Flexibilität, die den Zeichnungen eine besondere Position in Hirsts Œuvre verleiht. Anders als seine sonstigen Werke – ob fixiert in Formaldehyd oder präzise angeordnet in Schränken oder auf Leinwänden – bewahren die Zeichnungen eine Offenheit und Unabgeschlossenheit. Sie existieren in einem permanenten Zustand des Werdens und verbinden so die Vergangenheit seiner Ideen mit möglichen zukünftigen Manifestationen.
Indem Hirst mit seinen Zeichnungen uber Vergangenes und Bestehendes reflektiert und sie gleichzeitig in die Zukunft denkt,
[3] Away from the Flock, 1994, 50 × 73 cm, Bleistift auf Papier, Photographed by Stephen White © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Damien Hirst. [4] Away from the Flock, 1994, 96 × 149 × 51 cm, Glas, lackierter Stahl, Silikon, Acryl, Kunststoffkabelbinder, Lamm und Formaldehydlösung, Photographed by Prudence Cuming Associates Ltd © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Damien Hirst.
unterstreicht er die Auffassung von seiner Kunst als einem dynamischen, fortlaufenden Spiel mit Möglichkeiten und Illusionen. Zeichnungen fungieren dabei nicht als starre Vorstufen, sondern als offene Denkbewegungen: Sie erkunden Konzepte, machen Zweifel sichtbar und nehmen kunftige Veränderungen vorweg. Die Ausstellung in der Albertina Modern bietet eine neue Perspektive auf Hirsts kunstlerische Vision und wirft ein neues Licht auf die grundlegende Rolle der Zeichnung in seinem Werk.
„Alle Kinder malen und zeichnen, aber aus verschiedenen Gründen hören die meisten damit auf und werden Bankmanager, Polizisten oder etwas anderes. Ich habe, solange ich mich erinnern kann, immer gezeichnet. Ich habe das Zeichnen als den Beginn der Kreativität gesehen. Es ist roh, es ist persönlich, es ist der Ort, an dem Ideen zuerst Gestalt annehmen können. Diese Werke jetzt zu zeigen, fühlt sich an, als würde ich die chaotischen Vorgänge in meinem Kopf offenbaren“, so Damien Hirst. „Und wenn ich die Leute einlade, mit der von mir entwickelten Spin-Maschine ihre eigenen Zeichnungen zu erstellen, beobachten sie nicht nur die Kunst – sie tun mehr als das: Sie werden Teil des Prozesses, fühlen sich wieder wie Künstler und erleben den kreativen Prozess mit all seiner rohen, heilenden Energie und Kraft.“#
Zeichnen bedeutet für Damien Hirst, Möglichkeiten zu erkunden und Gedanken zu speichern, die vielleicht erst Jahre später ihre Form fnden.
Ausstellung
Bis 12. Oktober 2025 Damien Hirst. Drawings

[5] Kali Confronts Hydra, 2015, 587
Katalog
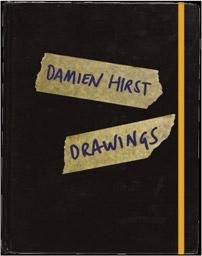

Kontakt
Albertina Modern Karlsplatz 5 1010 Wien Tel. +43-(0)1-534830 www.albertina.at
Damien Hirst Drawings
Ralph Gleis, Elsy Lahner (Hrsg.), Interview mit Damien Hirst von Ralph Gleis, Text von Elsy Lahner, geb., dt./engl., 20. S. m. 140 Abb., 19 x 25 cm, Hirmer, ISBN 9783777446127
x 719 mm, Bleistift, Tusche und Blattsilber auf Velin, Photographed by Prudence Cuming Associates Ltd. © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved / © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Damien Hirst.

Die Schönheit des Alltäglichen
Camille Pissarro im Museum Barberini in Potsdam
Camille Pissarro gilt als Gründungsfigur der impressionistischen Bewegung in Frankreich, dabei lagen seine künstlerischen Anfänge in der Karibik und in Südamerika. Diese Wurzeln verbanden sich mit einem malerischen Interesse an ländlichen Alltagsszenen und Sympathien fur den Anarchismus. Pissarros Motive sind oft schlicht, ihr Ton leise. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich der Reiz ihrer aufmerksam beobachteten Details und sorgsam abgestimmten Harmonien, der aus der respektvollen, von Idealismus geprägten Haltung des Künstlers, seiner Offen-
heit und Experimentierfreude erwächst. Die Themenvielfalt seiner Bilder umfasst Landschaften und Gärten, Familienporträts, Szenen des bäuerlichen Lebens oder urbane Motive wie die Häfen der Normandie oder die belebten Straßen von Paris. Die Ausstellung „Mit offenem Blick. Der Impressionist Pissarro“ im Museum Barberini in Potsdam gibt nun anhand von 108 Werken mit Leihgaben aus 53 internationalen Sammlungen einen fundierten Überblick über Pissarros gesamtes Schaffen und zeigt zugleich die sozialutopischen Ideen seiner Kunst.
[1] Blühende Pflaumenbäume, Éragny, 1894, Öl auf Leinwand, 60 x 73 cm, Ordrupgaard, Kopenhagen, © Heritage Images / Fine Art Images / akg-images.
Mit Camille Pissarro wird ein Außenstehender zur zentralen Figur der Impressionisten. Er, dessen erste Studien unter freiem Himmel in der Karibik und in Venezuela stattfanden, bringt eine von akademischen Normen unabhängige Perspektive in den Kreis der Pariser Künstler, für den er die Rolle eines entscheidenden Vernetzers einnimmt: Er arbeitet mit Claude Monet im Pariser Umland, bringt die Gruppe mit Paul Cézanne zusammen, setzt sich für das Werk von Mary Cassatt ein. Er öffnet sich fur die Anliegen der Neoimpressionisten und stellt – anders als Monet und Renoir – auch mit den Jüngeren aus.
Geboren 1830 in Charlotte Amalie auf den damaligen Dänischen Antillen, verbringt Pissarro seine Kindheit in einem multikulturellen Umfeld. Als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie mit französisch-portugiesischen Wurzeln, der zeitlebens die dänische Staatsbürgerschaft behält, gehört er zur europäischen Minderheit aus Kolonialbeamten und Plantagenbesitzern und erlebte als junger Mann die Abschaffung der Sklaverei mit. Nach Ende seiner schulischen Ausbildung in Frankreich reist Pissarro mit dem dänischen Maler Fritz Melbye zwei Jahre lang durch Venezuela. Eine Vorliebe fur Darstellungen ländlicher Natur und einfacher Lebensformen schlägt sich bereits in den frühen, auf dieser Reise entstehenden Werken nieder.
1855 siedelt Camille Pissarro nach Frankreich über. Auf der Suche nach einer neuen, zeitgemäßen Ästhetik schreibt er sich an der privaten Académie Suisse in Paris ein, wo er Gleichgesinnte trifft, darunter Claude Monet und Paul Cézanne. In Pissarros Gemälden aus seinen frühen Pariser Jahren macht sich ein neuartiges Interesse am unmittelbaren Erleben alltäglicher Umwelt bemerkbar. Oft malte er die Nutzgärten, Felder und Straßen in seinen Wohnorten Pontoise und Louveciennes. Camille Corot erweist sich als wichtiger Mentor für den jungen Künstler. In den 1860er-Jahren arbeitet Pissarro in der Tradition der Schule von Barbizon, malt en plein air im Wald von Fontainebleau.
Seine große Familie spielt in Camille Pissarros Leben eine wichtige Rolle. Gegen den elterlichen Willen heiratet er eine katholische fran-
[2] Landschaft
Pissarros Motive entwickeln ihren Reiz oft erst auf den zweiten Blick – mit aufmerksamen Details und sorgsam abgestimmten Harmonien.

auf Saint Thomas, 1856, Öl auf Leinwand, 47,63 x 38,1 cm, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon, © Sydney Collins, Virginia Museum of Fine Arts.


zösische Winzertochter, Julie Vellay, die er als Bedienstete in seinem Elternhaus kennengelernt hatte. Das Paar hatte acht Kinder, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichten. 1870 flieht die Familie vor dem Deutsch-Französischen Krieg aus Paris. In London begegnet Pissarro seinem späteren Kunsthändler Paul Durand-Ruel und studiert die Werke von John Constable und William Turner – eine entscheidende Erfahrung auf seiner Suche nach einer einerseits wirklichkeitsnahen, andererseits atmosphärischen Landschaftsmalerei.
Bei der Rückkehr der Familie nach Frankreich erfährt Pissarro von der Zerstörung eines Großteils seiner Werke durch Soldaten. Trotz des Verlustes von wohl über 1000 Arbeiten und der lediglich vereinzelten Anerkennung durch den Pariser Salon hält Pissarro an seiner künstlerischen Tätigkeit fest. Seit den frühen 1870erJahren verwendet er zunehmend eine hellere Farbpalette und einen gebrochenen Pinselstrich. Er schließt sich mit Malerkollegen
wie Monet, Renoir und Sisley zusammen und initiiert mit ihnen 1874 die erste Impressionisten-Ausstellung. Bis 1884 folgen sieben weitere Ausstellungen; als einziger ist Pissarro bei allen acht Schauen vertreten, für die er als aktiver Netzwerker eine wichtige Rolle einnimmt, die locker verbundene Gruppe zusammenhält, Kontakte pflegt, neue Teilnehmer vorschlägt.
Von 1880 an verschob sich das Interesse des Künstlers auf bäuerliche Figurenbilder, mit denen er in unterschiedlichen Medien sein Ideal des ländlichen Lebens zum Ausdruck brachte. Das Übertragen einer Sinnesempfindung auf die Leinwand, charakteristisch für den Impressionismus, ist für Pissarro nur ein Teil seiner künstlerischen Herangehensweise. Vielmehr verändert und bearbeitet der Künstler seine Landschaftsmotive häufig im Einklang mit seiner sozialen Agenda. Alltägliche Szenen aus Industrievorstädten und der französischen Provinz zeugen von der Sensibilität des Malers fur die Umbrüche in der Moder -
[4]
[3] Jeanne Pissarro (Minette) mit Fächer, 1873, Öl auf Leinwand, 55 x 46 cm, The Ashmolean Museum, University of Oxford, Vermächtnis Esther Pissarro, 1952. [4] Raureif, eine junge Bäuerin macht Feuer, 1888, Öl auf Leinwand, 92,8 x 92,5 cm, Sammlung Hasso Plattner, Museum Barberini, Potsdam.
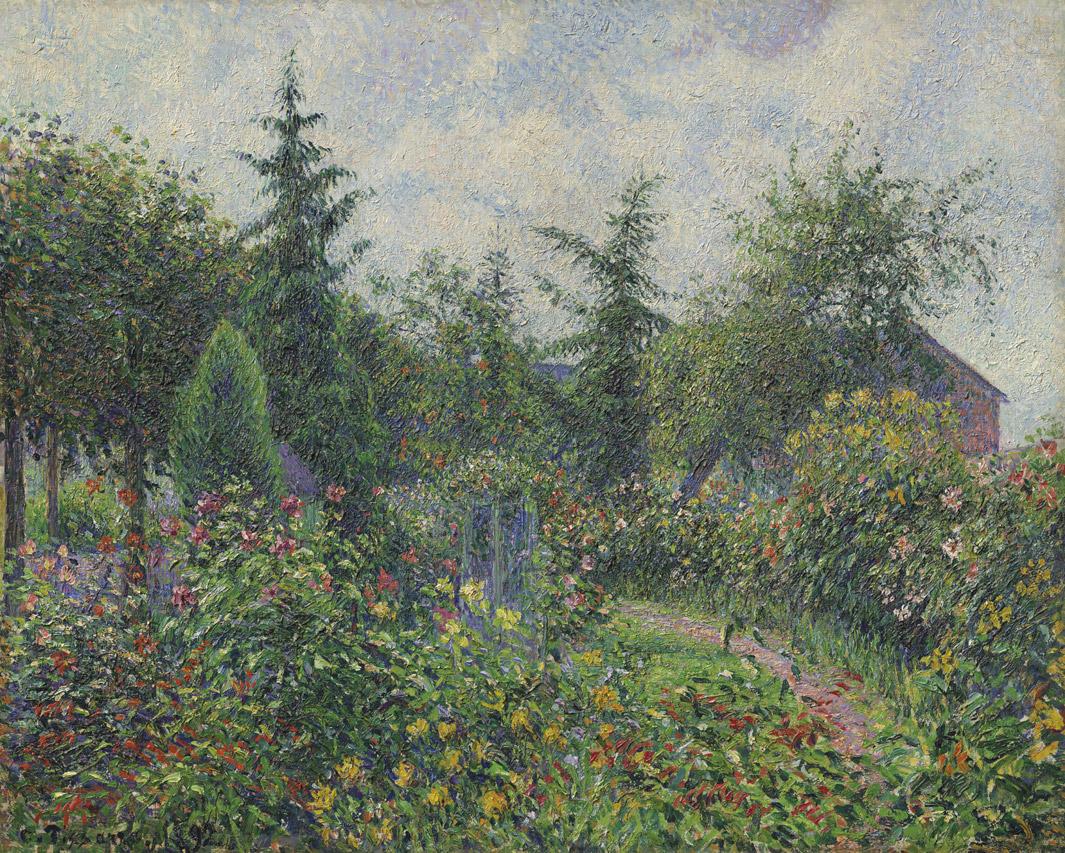
ne. Pissarro arbeitet an einem neuen Landschaftsbild und strebt in jedem Gemälde kompositorische Ausgewogenheit und Harmonie an.
Auch politisch zielt Pissarro auf eine Gesellschaft der Gleichberechtigung aller Menschen. Er liest Schriften der Anarchisten Pierre-Joseph Proudhon und Pjotr Alexejewitsch Kropotkin, diskutiert darüber mit seinen Kindern. In der freien Selbstorganisation der Menschen innerhalb der Gesellschaft sehen sie die Chance auf ein besseres Leben für alle. Eine Schlüsselrolle dabei
soll den selbstständig arbeitenden Bauern zukommen, die Pissarro, selbst auf dem Land und nicht in der Metropole Paris lebend, immer wieder abbildet: Würdevoll und mit Respekt, eingebunden in den Rhythmus und Kreislauf der Jahreszeiten, inszeniert er Bäuerinnen und Bauern beim Heumachen, Ernten, Pflanzen und Säen. In diesen Bildern liegt auch eine gesellschaftliche Utopie: der Traum vom selbstbestimmten Leben und der gemeinschaftlichen Arbeit im Einklang mit der Natur. Tatsächlich war der von seiner Frau Julie bewirtschaftete eigene Nutzgarten in Éragny-sur-Epte jahrelang Existenzgrundlage der
[5] Garten und Hühnerstall von Octave Mirbeau, Les Damps, 1892, Öl auf Leinwand, 73,3 x 92 cm, Sammlung Hasso Plattner, Museum Barberini, Potsdam.

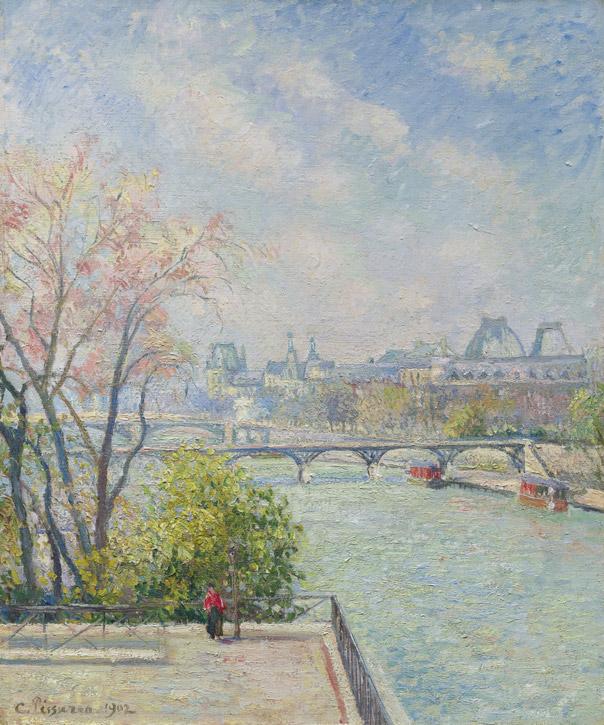
[6] [7]
Familie Pissarro, bis diese von den Gemäldeverkäufen des Künstlers leben konnte. In den Bildern, die der Künstler ab dem 1893 erfolgten Umbau der Scheune zum Atelier vom Fenster aus malte, ist vielfach Julie Pissarro bei der Gartenarbeit zu sehen.
1885 nimmt Camille Pissarros künstlerische Entwicklung eine neue Wendung, als er den jüngeren Malerkollegen Paul Signac und Georges Seurat begegnet. Begeistert öffnet er sich fur die neue, wissenschaftsbasierte Technik des Divisionismus, dessen starres und zeitraubendes System der Farbzerlegung er allerdings nach vier Jahren zugunsten freierer Gestaltungsweisen wieder ablegt. Der Übergang war jedoch fließend – ein Farbauftrag in kurzen Strichen findet sich auch in seinen späteren Werken.
Erst spät in seinem Schaffen widmet sich Pissarro dem Thema der Stadtlandschaft. In mehreren Serien hält er das geschäftige Treiben an den Häfen von Rouen, Dieppe und Le Havre in der Normandie fest und wendet sich ebenso der Metropole Paris zu. Die Straßen, Plätze und Brücken in seinen insgesamt 125 Ansichten der Hauptstadt bilden eine Projektionsfläche für alles Atmosphärische – bevölkert, gestaltet, belebt von unzähligen Menschen, der aktiven Kraft, die Pissarro Zeit seines Lebens mit seinem leisen, zurückgenommenen Humanismus dokumentierte.
In seinen letzten Lebensjahren schuf Pissarro mehrere Bilderserien von Hafenstädten in der Normandie. In Rouen, Dieppe und Le Havre mietete er sich in Hotels am Hafen ein, um vom Fenster aus das geschäftige Treiben der Reisenden und Schaulustigen
[6] Morgensonne in der Rue Saint-Honoré, Place du Théâtre Français, 1898, Öl auf Leinwand, 65,6 x 54 cm, Ordrupgaard, Kopenhagen.
[7] Der Louvre, Morgen, Frühling, 1902, Öl auf Leinwand, 64,8 x 54 cm, Sammlung Hasso Plattner, Museum Barberini, Potsdam.
sowie der Arbeiter beim Be- und Entladen der Schiffe festzuhalten. Unter wechselnden Wetterbedingungen fing Pissarro die lebhafte Atmosphäre und die durchaus poetischen Qualitäten der modernen Industrielandschaften ein. Dabei zielte er darauf, das Verhältnis von Himmel, Boden und Wasser in einer harmonischen Form zu erfassen. Mit diesen Szenen, in denen das Thema des internationalen Handels anklingt, schließt sich der Kreis zu Pissarros künstlerischen Anfängen auf Saint Thomas, wo die doppelte Perspektive des Kaufmannssohns und des angehenden Malers seinen spezifischen Blick auf den Ort des Hafens formte.
Lange wurde Camille Pissarro unter den Impressionisten weit weniger Beachtung zuteil als anderen Künstlern des Kreises. „Camille Pissarro war für viele der impressionistischen Künstler wie eine Vaterfigur, sein eigenes Schaffen wurde aber erst in der jüngeren Vergangenheit ausgiebiger betrachtet und gewürdigt. Ausstellungen wie in Williamstown und San Francisco, in Ordrupgaard bei Kopenhagen, in Basel und Oxford rückten Pissarro in den letzten Jahren stärker in den Fokus“, so Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini. „Die Retrospektive in Potsdam und Denver baut auf diesen wichtigen Stationen der Pissarro-Forschung auf. Mit den sieben Werken Pissarros in der Sammlung Hasso Plattner als Ausgangspunkt und ermöglicht durch die großartige Zusammenarbeit mit dem Denver Art Museum zeigen wir, wie Pissarros Impressionismus zwar eng mit der Gruppe verbunden, aber gleichzeitig einzigartig ist.”
„Vor allem Pissarros Landschaftsauffassung ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den Impressionisten“, erklärt auch Nerina Santorius, Kuratorin der Ausstellung und Sammlungsleiterin am Museum Barberini. „Während Kollegen wie Monet oder Renoir Stadt und Land meist als Freizeitraum des Bürgertums darstellen, richtet Pissarro den Blick darauf, wie die einfache Bevölkerung unterschiedliche Alltagslandschaften gestaltet und prägt: durch das Leben und Arbeiten des Einzelnen im Einklang mit der Natur ebenso wie durch die Bewegung der Menschenströme in den großen Städten. Er zeigt, wie seine Frau Julie den Garten kultiviert, eine erfahrene Bäuerin auch mit nassem Holz ein Feuer anzündet oder auf einem Pariser Boulevard Kutschen im Feierabendstau stecken. Den kleinen Dingen des Alltags Schönheit abzugewinnen, war für Pissarro ein zentrales Anliegen seiner künstlerischen Arbeit. “
Die Ausstellung ist die zweite Kooperation zwischen dem Museum Barberini und dem Denver Art Museum, wo die Schau vom 26. Oktober 2025 bis zum 8. Februar 2026 gezeigt wird. „Mit offenem Blick. Der Impressionist Pissarro“ betont die tiefe Humanität, mit der Pissarros Werke die Gegenwart in all ihren unscheinbaren Aspekten würdigen, und lädt dazu ein, sein Werk mit derselben genauen Beobachtungsgabe zu entdecken, mit der Pissarro seinen unmittelbar erlebten Alltag auf die Leinwand brachte.#
Pissaros Werke zeugen von der großen Sensibilität des Malers für die Umbrüche der Moderne.
Ausstellung
Bis 28. September 2025
Mit offenem Blick
Der Impressionist Pissarro
Katalog
Mit offenem Blick
Der Impressionist Pissarro
Angelica Daneo, Clarisse Fauve-Piz, Christoph Heinrich, Michael Philipp, Nerina Santorius, Ortrud Westheider (Hrsg.), mit Beiträgen von Claire Durand-Ruel Snollaerts, Clarisse Fava-Piz, Nerina Santorius, Emily Willkom, Daniel Zamani, Hardcover m. SU, 256 S., 24 x 30 cm, Prestel, ISBN 9783791377889
Kontakt
Museum Barberini
Alter Markt, Humboldtstraße 5–6 14467 Potsdam Tel. +49-(0)331-236014-499 www.museum-barberini.de

Lovis Corinth, Frau mit Rosenhut, 1912, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Foto: Reinhard Saczewski.
18. Juli bis 2. November 2025
Im Visier! Lovis Corinth, die Nationalgalerie und die Aktion „Entartete Kunst“.
Alte Nationalgalerie www.smb.museum

Fujiko Nakaya in ihrer Nebelskulptur im Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie,2025, © Neue Nationalgalerie – Stiftung Preußischer Kulturbesitz / David von Becker.
Bis 14. September 2025
Fujiko Nakaya. Nebelskulptur im Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie.
Neue Nationalgalerie www.smb.museum
Deutschland
Berlin
Alte Nationalgalerie
Bodestraße, 10178 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242
www.smb.museum
Bis 28. September 2025: Camille Claudel und Bernhard Hoetger. Emanzipation von Rodin 18. Juli bis 2. November 2025: Im Visier! Lovis Corinth, die Nationalgalerie und die Aktion „Entartete Kunst“.
Bode-Museum
Am Kupfergraben (Eingang über die Monbijoubrücke), 10117 Berlin, Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis 13. Juli 2025: Der Engel der Geschichte. Walter Benjamin, Paul Klee und die Berliner Engel 80 Jahre nach Kriegsende. Bis 21. September 2025: Lange Finger – Falsche Münzen. Die dunkle Seite der Numismatik. Bis auf Weiteres: Das Tau f ecken von Siena. Geschichte, Restaurierung und Wiederaufstellung eines Gipsmodells. Bis auf Weiteres: Das heilende Museum. Achtsamkeit und Meditation im Kunstraum.
Hamburger Bahnhof –
Nationalgalerie der Gegenwart
Invalidenstraße 50–51, 10557 Berlin Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis 20. Juli 2025: Ayoung Kim. Many Worlds Over. Bis 14. September 2025: 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. Bis 26. Oktober 2025: Chanel Commission. Klára Hosnedlovà: Embrace. Bis 4. Januar 2026: Toyin Ojih Odutola. U22 – Adijatu Straße. 11. Juli 2025 bis 25. Januar 2026: Delcy Morelos. Madre.
Humboldt Forum
Schloßplatz, 10178 Berlin
Tel. +49-30-992118989 www.humboldtforum.org
Bis 31. August 2026: Die Ziguangge: Halle des Purpurglanzes. Veranstaltungsort, Heldengalerie und Kriegsschauplatz. Bis 15. September 2025: Jinshixue: Das Studium antiker
Artefakte und materieller Überreste der Vergangenheit, Teil 2. Bis Oktober 2025: Durch die Hölle gehen. Jenseitsvorstellungen der Goryeo-Zeit (918–1392) in Korea. Bis 12. Oktober 2025: Takehito Koganezawa. Eins auf Zwei, Zwei aus Eins. Bis 31. Dezember 2025: Manatunga. Künstlerische Interventionen von George Nuku. Bis 23. Februar 2026: Ts’uu – Zeder. Von Bäumen und Menschen.
Kunstbibliothek
Matthäikirchplatz, 10785 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242 29 www.smb.museum
Bis 31. Dezember 2028: Leidenschaft für die Kunst. Eine Zeitreise ins alte Tiergartenviertel.
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin
Tel. +49-(0)30-25486-0 www.berlinerfestspiele.de
Bis 31. August 2025: Yoko Ono: Music of the Mind. Bis 14. September 2025: Vaginal Davis: Fabelhaftes Produkt.
Museum für Fotografe
Jebensstraße 2, 10623 Berlin Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis 17. August 2025: Polaroids. Bis 15. Februar 2026: Rico Puhlmann. Fashion Photography 50s–90s.6. September 2025 bis 15. Februar 2026: Newton’s Riviera & Dialogues. Collection Photographs x Helmut Newton.
Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50, 10785 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242
www.smb.museum
Bis 14. September 2025: Fujiko Nakaya. Nebelskulptur im Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie. Bis 14. September 2025: Yoko Ono: Dream Together. Bis September 2026: Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin. Bis 12. Oktober 2025: Lygia Clark. Retrospektive. Bis auf Weiteres: Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft. Sammlung der Nationalgalerie 1945–2000.
Bochum
Kunstmuseum Bochum
Kortumstraße 147, 44787 Bochum
Tel. +49-(0)234-9104230
www.kunstmuseumbochum.de
Bis 31. August 2025: Valentina Karga. Well Beings. Bis 21. September 2025: Maya Deren – Stano Filko. Truth has, in reality, never been ours. Mit künstlerischen Beiträgen von Ibon Aranberri und Martin Vongrej. Bis 31. Dezember 2025: Sichtbar. Die eigene Sammlung.
Bonn
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 2, 53113 Bonn
Tel. +49-(0)228-776260
www.kunstmuseum-bonn.de
Bis 31. August 2025: Aufruch in die Moderne. Sammlungspräsentation August Macke und die Rheinischen Expressionisten. Bis 7. September 2025: Heimweh nach neuen Dingen. Reisen für die Kunst. 3. Juli bis 2. November 2025: From Dawn till Dusk. Der Schatten in der Kunst der Gegenwart. 15. September 2025 bis 19. September 2027: Menschen und Geschichten. Die Sammlung der Klassischen Moderne – August Macke und die Rheinischen Expressionisten.
Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn
Tel. +49-(0)228-9171-0 www.bundeskunsthalle.de
Bis 10. August 2025: Para-Moderne. Lebensreformen ab 1900. Bis 28. September 2025: Susan Sontag. Sehen und gesehen werden. Bis 26. Oktober 2025: Interactions x Wetransform. Bis 25. Januar 2026: Wetransform. Zur Zukunft des Bauens.
Bremen
Kunsthalle Bremen
Am Wall 207, 28195 Bremen Tel. +49-421-32908-0 www.kunsthalle-bremen.de
Bis 27. Juli 2025: Corot bis Watteau? Französischen Zeichnungen auf der Spur. Bis 3. August 2025: Mis(s)treated. Mehr als Deine
Muse! Bis 7. September 2025: Kunst fühlen. Wir. Alle. Zusammen. 13. August bis 26. Oktober 2025: Spuren der Zeit. Druckgraphik des 16. bis 19. Jahrhunderts aus dem Museum für westliche und östliche Kunst Odesa. 30. August 2025 bis 11. Januar 2026: Sibylle Springer. Ferne Spiegel.
Neues
Museum Weserburg Bremen
Teerhof 20, 28199 Bremen Tel. +49-421-598390 www.weserburg.de
Bis 10. August 2025: What is that invisibile thing your arm is resting on. Meisterschüler*innen der Hochschule für Künste 2025. 6. September 2025 bis 19. April 2026: Julika Rudelius. The Emperor’s New Mall.
Dortmund
Museum Ostwall im Dortmunder U Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund
Tel. +49-(0)231-5024723 www.dortmunder-u.de/museum-ostwall/ Bis 20. Juli 2025: Am Tisch. Essen und Trinken in der zeitgenössischen Kunst. Bis 27. Juli 2025: Holding Pattern – Warteschleifen und andere Loops. Bis 1. Februar 2026: Kunst > Leben > Kunst. 3. Juli bis 5. Oktober 2025: Roots in Motion. 3. August 2025 bis 29. März 2026: dérive – der Große Zoologische Garten.
Düsseldorf
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K 20
Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8381130 www.kunstsammlung.de
Bis 10. August 2025: Chagall. Bis auf Weiteres: Raus ins Museum! Rein in Deine Sammlung. Meisterwerke von Etel Adnan bis Andy Warhol.
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K 21
Ständehausstraße 1, 40217 Düsseldorf
www.kunstsammlung.de
Tel. +49-(0)211-8381204
Bis 31. August 2025: Bracha Lichtenberg Ettinger. Bis 12. Oktober 2025: Julie Mehretu. Bis 31. August 2025: Wang Tuo. Preisträger K21 Global Art Award 2024.
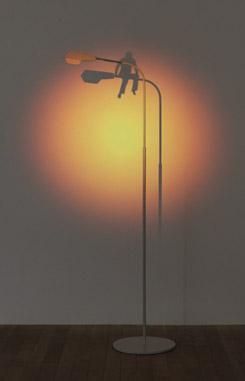
Zilla Leutenegger, Sunset Neighbourhood, 2009/2021, Videoinstallation mit 1 Objekt, 1 Projektion, Farbe, kein Ton, Loop, Objekt 220 x 72 x 47 cm, AP 1/1 (Ed. von 3) (LEUTE26002), Courtesy of the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich / Paris, © Zilla Leutenegger, Foto: Sebastian Schaub.
3. Juli bis 2. November 2025 From Dawn till Dusk. Der Schatten in der Kunst der Gegenwart.
Kunstmuseum Bonn www.kunstmuseum-bonn.de

Ngozi Ajah Schommers, Self-Portrait (the trim), 2021, Perforiertes Papier, Konfetti, Aquarell auf Papier, 100 x 150 cm, © Ngozi Ajah Schommers, Foto: Tobias Hübel.
Bis 3. August 2025 Mis(s)treated. Mehr als Deine Muse!
Kunsthalle Bremen www.kunsthalle-bremen.de

Einblick in die Ausstellung MAMA.
Von Maria bis Merkel, Foto: © Lars Heidrich
Bis 3. August 2025
Mama.
Von Maria bis Merkel.
Kunstpalast www.kunstpalast.de
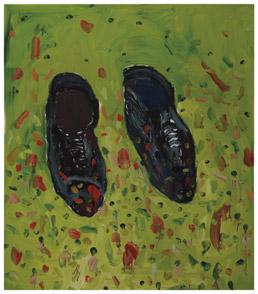
Sean Scully, Sean's Shoes, 2024, Privatsammlung © Sean Scully. Foto: courtesy the artist.
Bis 2. November 2025 Sean Scully. Stories.
Bucerius Kunstforum www.buceriuskunstforum.de
Kunstpalast
Ehrenhof 4–5, 40479 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8996260
www.kunstpalast.de
Bis 3. August 2025: Mama. Von Maria bis Merkel. Bis 5. Oktober 2025: Mythos Murano. Bis 3. August 2025: Die Grosse. Kunstausstellung NRW Düsseldorf. 18. September 2025 bis 11. Januar 2026: Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung.
Duisburg
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum
Friedrich-Wilhelm-Straße 40, 47049 Duisburg
Tel. +49-(0)203-2832630
www.lehmbruckmuseum.de
Bis 24. August 2025: Mechanik und Menschlichkeit. Eva Aeppli und Jean Tinguely. Zum 100. Geburtstag. Bis 7. September 2025: HansJürgen Vorsatz zum 80. Geburtstag. Bis 19. Oktober 2025: Sculpture 21st: Peter Kogler.
Emden
Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden
Tel. +49-(0)4921-97500
www.kunsthalle-emden.de
Bis 2. November 2025: Dem Himmel so nah. Wolken in der Kunst.
Frankfurt
Liebieghaus Skulpturensammlung
Schaumainkai 71, 60536 Frankfurt
Tel. +49-(0)69-6500490, www.liebieghaus.de
Bis 31. August 2025: Isa Genzken meets Liebieghaus.
Städel Museum
Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt Tel. +49-(0)69-6050980 www.staedelmuseum.de
Bis 27. Juli 2025: Rineke Dijkstra. Beach Portraits. Bis 17. August 2025: Unzensiert. Annegret Soltau – Eine Retrospektive. Bis 28. September 2025: Werner Tübke. Metamorphosen. Bis 23. November 2025: Gesichter der Zeit. Fotografen von Hugo Erfurth. Bis 18. Januar 2026: Bilderwelten der USA. Fotografe zwi-
schen Stadt, Subkultur und Mythos. 5. September 2025 bis 12. April 2026: Asta Gröting.
Hamburg
Bucerius Kunstforum
Alter Wall 12, 20457 Hamburg
Tel. +49-(0)403609960 www.buceriuskunstforum.de
Bis 2. November 2025: Sean Scully. Stories.
Deichtorhallen Hamburg
Deichtorstraße 1–2, 20095 Hamburg www.deichtorhallen.de
Tel. +49-(0)40-32103-0
Bis 17. August 2025: States of Rebirth. Körperbilder in Bewegung. (Phoxxi). Bis 7. September 2025: How’s my Painting? Malerei aus der Sammlung Falckenberg. (Sammlung Falckenberg). Bis 14. September 2025: Katharina Grosse. Wunderbild. 6. September bis 9. November 2025: Double Feature: Gute Aussichten 2023/24/25.
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall, 20095 Hamburg
Tel. +49-(0)40-428131-200
www.hamburger-kunsthalle.de
Bis 24. August 2025: Bas Jan Ader. I’m searching. Bis 7. September 2025: Fedele Maura Friede. Der Saum löst sich. Bis 14. September 2025: Truong Cong Tùng. Bis 5. Oktober 2025: Edi Hila | Thea Djordjadze. Bis 12. Oktober 2025: Rendezvous der Träume. Surrealismus und deutsche Romantik. Bis 18. Oktober 2026: Isa Mona Lisa.
Hannover
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover
Tel. +49-(0)511-168-43875 www.sprengel-museum.de
Bis 13. Juli 2025: Das Atelier als Gemeinschaft. #Wilderers. Bis 20. Juli 2025: Frida Orupabo. Spectrum Internationaler Preis für Fotografe der Stiftung Niedersachsen. Bis 27. Juli 2025: Niki Backstage. Bis 28. September 2025: Peter Heber. Über das Sterben. Bis 28. September 2025: Stand Up! Feministische Avantgarde. Werke aus der Sammlung Verbund, Wien. 6. September 2025 bis 14. Februar 2026: Niki. Kusama. Murakami. Love you for infnity.
Köln
Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln
Tel. +49-(0)221-221-26165 www.museenkoeln.de
Bis 3. August 2025: Francis Alÿs – Kids take over. Bis 31. August 2025: Über den Wert der Zeit. Neupräsentation der Sammlung zeitgenössischer Kunst. Bis 12. Oktober 2025: Street Photography. Lee Friedlander. Garry Winogrand, Joseph Rodríguez. Bis 9. November 2025: Pauline Hafsia M’barek. Entropic Records.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Obenmarspforten (am Kölner Rathaus) 50667 Köln, Tel. +49-(0)221-221-21119 www.wallraf.museum
Bis 27. Juli 2025: Schweizer Schätze. Impressionistische Meisterwerke aus dem Museum Langmatt. Bis 26. Oktober 2025: Mezzotinto: Die schwarze Kunst. Bis 31. Mai 2026: B{l}ooming. Barocke Blütenpracht.
Mannheim
Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4, 68165 Mannheim Tel. +49-(0)621-2936423 www.kuma.art
Bis 20. Juli 2025: Joachim Bandau. Bis 24. August 2025: Tavares Strachan. Bis 24. August 2025: Studio: Ju Young Kim. Bis 5. Oktober 2025: Berlin, Paris und anderswo. Bis 31. Dezember 2025: Fokus Sammlung. Neue Sachlichkeit.
München
Alte Pinakothek
Barer Straße 27, 80333 München Tel. +49-(0)89-23805-216 www.pinakothek.de
Bis 6. Juli 2025: François Bouchers „Ruhendes Mädchen“. Bis 31. Dezember 2026: Von Turner bis van Gogh. Meisterwerke der Neuen Pinakothek in der Alten Pinakothek. 29. Juli 2025 bis 11. Januar 2026: Rahmen machen Bilder.
Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1, 80538 München
Tel. +49-(0)89-21127-113 www.hausderkunst.de
Bis 3. August 2025: Shu Lea Cheang. Kiss Kiss Kill Kill. Bis 21. September 2025: ars viva 2025. Where will we land? Bis 22. Februar 2026: Gülbin Ünlü. Nostralgia. 18. Juli 2025 bis 1. Februar 2026: Archives in Residence: KEKS.
Pinakothek der Moderne
Barer Straße 40, 80333 München
Tel. +49-(0)89-23805-360 www.pinakothek.de
Bis 28. September 2025: 4 Museen – 1 Moderne. Gemeinschaftsausstellung aller vier Museen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der neuen Sammlung. Bis 9. November 2025: Rotundenprojekt 2025: Robert Huber. Begegnungsmusik. Bis 31. Dezember 2025: Mix & Match. Die Sammlung neu entdecken. 4. Juli bis 12. Oktober 2025: On View. Begegnungen mit dem Fotografschen.
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München
Luisenstraße 33, 80333 München Tel. +49-(0)89-23332029
www.lenbachhaus.de
Bis 31. August 2025: Fragment of an infnite discourse. Gegenwartskunst aus dem Lenbachhaus, die Schenkung Jörg Johnen und die Kico Stiftung. Bis Winter 2025/2026: Der Blaue Reiter. Eine neue Sprache. Bis 19. Oktober 2025: Auguste Herbin. Bis Frühjahr 2027: Was zu verschwinden droht, wird Bild. Mensch – Natur – Kunst. 15. August bis 30. November 2025: Dan Flavin. Untitled (For Ksenija).
Stuttgart
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1, 70173 Stuttgart Tel. +49-(0)711-2162188 www.kunstmuseum-stuttgart.de
Bis 14. September 2025: Grafk für die Diktatur. Bis 21. September 2025: Frischzelle_31: Suah Im. Bis 12. Oktober 2025: Doppelkäseplatte. 100 Jahre Sammlung. 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart. Bis 12. April 2026: Joseph Kosuth. „Non autem memoria“. Bis 12. April 2026: Hans-Molfenter-Preis 2025.

Haegue Yang, Mountains of Encounter, [Berge der Begegnung], 2008, Installation; Aluminiumjalousien, pulverbeschichtete Aluminiumhängestruktur, Stahlseil, bewegliche Scheinwerfer, Flutlichtstrahler, und Kabel, Installationsmaße variabel, © Haegue Yang, Foto: Museum Ludwig, Šaša Fuis, Köln
Bis 31. August 2025 Über den Wert der Zeit. Neupräsentation der Sammlung zeitgenössischer Kunst.
Museum Ludwig www.museenkoeln.de

Rupert Huber, Skizze zur „Walking Music“, Ton, Raum und Obertonverhältnis, Wien 2019 © Rupert Huber.
Bis 9. November 2025 Rotundenprojekt 2025: Robert Huber. Begegnungsmusik.
Pinakothek der Moderne www.pinakothek.de

Jeff Koons, Hulk (Jungle), 2005, Leihgabe der Freunde der Staatsgalerie Stuttgart e. V., © Jeff Koons
Bis 31. Dezember 2025 This is tomorrow. Neupräsentation der Sammlung des 20./21. Jahrhunderts.
Staatsgalerie Stuttgart www.staatsgalerie.de

KONSORTIUM, „Nachstellung“, (v.l. Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch) vor der ehemaligen Galerie Parnass in Wuppertal, Foto: KONSORTIUM, Wuppertal, 2025
Bis 6. Juli 2025 Nachstellung. Man sollte eine Gruppe gründen. Konsortium (Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch).
Von der Heydt-Museum ww.von-der-heydt-museum.de
Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30–32, 70173
Stuttgart, Tel. +49-(0)711-47040-0 www.staatsgalerie.de
Bis 31. Dezember 2025: This is tomorrow. Neupräsentation der Sammlung des 20./21. Jahrhunderts. Bis 4. Januar 2026: Überfuss. Klingendes Papier von Clemens Schneider. Bis 11. Januar 2026: Katharina Grosse. The Sprayed Dear.
Weil am Rhein
Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 1, 79576 Weil am Rhein
Tel. +49-(0)7621-7023200
www.design-museum.de
Bis 28. September 2025: Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter.
Wuppertal
Skulpturenpark Waldfrieden
Hirschstraße 12, 42258 Wuppertal
Tel. +49-(0)202-47898120
www.skulpturenpark-waldfrieden.de
Bis 10. August 2025: Peter Buggenhout. Umleitung. 20. August 2025 bis 1. Januar 2026: Tony Cragg – Line of Thought.
Von der Heydt-Museum
Turmhof 8, 42103 Wuppertal
Tel.+49-(0)202-563-6231
www.von-der-heydt-museum.de
Bis 6. Juli 2025: Nachstellung. Man sollte eine Gruppe gründen. Konsortium (Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch).
Frankreich
Paris
Musée du Louvre
Rue de Rivoli, 75001 Paris
Tel. +33-(0)1-40205050, www.louvre.fr
Bis 21. Juli 2025: Louvre Couture. Art and fashion: statement pieces. Bis 28. Juli 2025: Mamluks. Bis 25. August 2025: A Passion for China. The Adolphe Thiers Collection. Bis 28. September 2025: The Met au Louvre. Near Eastern Antiquities in Dialogue.
Italien
Florenz
Galleria degli Ufzi
Piazzale degli Ufzi 6, 50122 Florenz Tel. +39-055-294883
www.ufzi.it
Bis 28. November 2025: Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Ufzi.
Fondazione Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi, 50123 Firenze Tel. +39-055-2645155
www.palazzostrozzi.org
Bis 20. Juli 2025: Tracey Emin. Sex and Solitude. Bis 31. August 2025: Time for Women. Empowering Visions in 20 years of the Max Mara Art Prize for Women. Bis 31. August 2025: Giulia Cenci. The Hollow Men. 26. September 2025 bis 25. Januar 2026: Beato Angelico.
Rom
Galleria d’Arte Moderna
Via Francesco Crispi 24, 00187 Roma www.galleriaartemodernaroma.it
Bis 14. September 2025: L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno. Bis 14. September 2025: Nino Bertoletti 1889–1971. Bis 14. September 2025: Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e I sentieri del collezonismo. Bis 14. September 2025: StenLex. Rinascita – Intervento artistico site specifc e stendardo urbano.
Palazzo delle Esposizioni Roma
Via Nazionale 194, 00184 Roma Tel. +39-06696271
www.palazzoesposizioniroma.it
Bis 3. August 2025: Mario Giacomelli. The photographer and the artist. Bis 3. August 2025: Albert Watson. Roma Codex. Bis 13. August 2025: From Heart to Hands. Dolce& Gabbana.
Scuderie del Quirinale
Via 24 Maggio, 16, 00186 Roma Tel. +39-02-92897722
www.scuderiequirinale.it
Bis 13. Juli 2025: Barocco globale. Il mondo a Roma nel secolo di Bernini.
Venedig
Peggy Guggenheim Collection
Palazzo Venier die Leoni, Dorsoduro 701 30123 Venezia, Tel. +39-041-2405411 www.guggenheim-venice.it
Bis 15. September 2025: Maria Helena Vieira da Silva: Anatomy of Space.
Österreich
Bregenz
Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz, 6900 Bregenz
Tel. +43-(0)5574-485-94-0 www.kunsthaus-bregenz.at
Bis 28. September 2025: Malgorzata MirgaTas. 12. Juli bis 28. September 2025: Michael Armitage, Maria Lassnig, Chelenge Van Rampelberg.
Wien
Albertina
Albertinaplatz 1, A–1010 Wien
Tel. +43-(0)-1-534830 www.albertina.at
Bis 6. Juli 2025: Francesca Woodman. Werke der Sammlung Verbund, Wien. Bis 24. August 2025: Fernweh – Künstler auf Reisen. 11. Juli bis 2. November 2025: Jitka Hanzlová. 18. Juli bis 9. November 2025: Brigitte Kowanz. Licht ist was man sieht. 25. Juli bis 12. Oktober 2025: Die Wiener Bohème. Werke der Hagengesellschaft. 19. September 2025 bis 11. Januar 2026: Gothic Modern. Munch, Beckmann, Kollwitz.
Albertina Modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Tel. +43-(0)1-534830 www.albertina.at
Bis 14. September 2025: Remix. Von Gerhard Richter bis Katharina Grosse. Bis 12. Oktober 2025: Damien Hirst. Zeichnungen.
MUMOK – Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien
MuseumsQuartier, Museumsplatz 1 A-1070 Wien, Tel. +43-(0)1-525 00 www.mumok.at
Bis 7. September 2025: Park McArthur. Contact M. Bis auf Weiteres: Jongsuk Yoon. Kumgangsan. Bis 16. November 2025: Kazuna Taguchi. I’ll never ask you. Bis 6. April 2026: Die Welt von morgen wird eine weitere Gegenwart gewesen sein. Bis 12. April 2026: Nie endgültig! Das Museum im Wandel.
Kunsthistorisches Museum Wien
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Tel. +43-(0)1-52524-0, www.khm.at
Bis 31. August 2025: Rabenschwarz –Farbenfroh? Aktuelle Forschungen zur Polychromie der Antike. Bis 5. Oktober 2025: Die Prinzessin von Neapel. Mengs und Velázquez. Bis 26. Oktober 2025: Prunk & Prägung. Die Kaiser und ihre Hofünstler.
Schweiz
Basel
Kunsthalle Basel
Steinenberg 7, 4051 Basel Tel +41-(0)61-2069900 www.kunsthallebasel.ch
Bis 10. August 2025: Dala Nasser. Xiloma. MCCCLXXXVI. Bis 17. August 2025: Marie Matusz. Canons and Continents. Bis 21. September 2025: Ser Serpas. Of my life. 29. August bis 16. November 2025: Bagus Pandega. 19. September 2025 bis 23. August 2026: Coumba Samba.
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16, 4010 Basel Tel. +41-(0)61-2066262 www.kunstmuseumbasel.ch
Bis 27. Juli 2025: Paarlauf. Bis 10. August 2025: Medardo Rosso. Die Erfndung der modernen Skulptur. Bis 4. Januar 2026: Verso. Geschichten von Rückseiten. Bis 4. Januar 2026: Ofene Beziehung. Sammlung Gegenwart. 22. August 2025 bis 11. Januar 2026: Cassidy Toner. Besides the Point. 20. September 2025 bis 8. März 2026: Geister. Dem Übernatürlichen auf der Spur.

Małgorzata Mirga-Tas, Tełe Ćerhenia Jekh Jag, Ausstellungsansicht 2. Obergeschoss Kunsthaus Bregenz, 2025, Foto: Markus Tretter © Małgorzata Mirga-Tas, Kunsthaus Bregenz, Courtesy of the artist, Foksal Gallery Foundation, Warschau, Frith Street Gallery, London, Karma International, Zürich
Bis 28. September 2025 Malgorzata Mirga-Tas.
Kunsthaus Bregenz www.kunsthaus-bregenz.at

Park McArthur, Contact M at Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Is this an investment, pied-à-terre, or primary residence?, 2018, Farbe auf Wand, Modifiziertes Logo des Projekts im Museum of Modern Art, skaliert auf die Galeriemaße 9,8 x 59 m, installiert im Museum Abteiberg, Courtesy of the artist.
Bis 7. September 2025 Park McArthur. Contact M. MUMOK – Museum Moderner Kunst www.mumok.at

Jordan Wolfson, Little Room, 2025 3D scanning booth, VR headset, high-definition video, Dimensions variable, © Jordan Wolfson, Courtesy Gagosian, Sadie Coles HQ, and David Zwirner.
Bis 3.August 2025
Jordan Wolfson: Little Room I.
Fondation Beyeler www.fondationbeyeler.ch

Ausstellung Fotoatelier Wolgensinger – Mit vier Augen, 2025, Museum für Gestaltung Zürich, Toni -Areal. Foto: Umberto Romito & Ivan Šuta, Museum für Gestaltung Zürich/ZHdK
Bis 7. September 2025
Fotoatelier Wolgensinger –Mit vier Augen.
Museum für Gestaltung Zürich www.museum-gestaltung.ch
Basel/Riehen
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101, 4125 Riehen/Basel
Tel. +41-(0)61-6459700
www.fondationbeyeler.ch
Bis 3.August 2025: Jordan Wolfson: Little Room I. Bis 21. September 2025: Vija Celmins.
Zürich
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1, 8001 Zürich
Tel. +41-(0)44-2538484
www.kunsthaus.ch
Bis 17. August 2025: Roman Signer. Bis 31. August 2025: Monster Chetwynd. The Trompe l’œil Cleavage. Bis 7. September 2025: Suzanne Duchamp. Retrospektive. Bis 28. September 2025: Eine Zukunft für die Vergangenheit. Sammlung Bührle: Kunst, Kontext, Krieg und Konfikt.
Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zürich
Tel. +41-43-4466767
www.museum-gestaltung.ch
Bis 13. Juli 2025: Textile Manifeste – Von Bauhaus bis Soft Sculpture. Bis 7. September 2025: Fotoatelier Wolgensinger – Mit vier Augen. Bis 23. November 2025: Vers une architecture: Refexionen. Bis 7. Dezember 2025: Susanne Bartsch – Transformation! 29. August 2025 bis 18. Januar 2026: Museum oft he Future –17 digitale Experimente.
Spanien
Barcelona
Fundaciò Joan Miró
Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona Tel. +34-934-439470 www.fmirobcn.org
Bis 28. September 2025: Joan Miró Anti-Portrait Gallery. Bis 9. November 2025: Prats Is Quality. Bis 18. Januar 2026: How from here. Bis 6. April 2026: Poetry has just begun. 50 Years of the Miró. 10. Juli bis 2. November 2025: Ludovica Carbotta.
Museu Picasso
Carrer de Montcada, 15-23, 08003 Barcelona www.museupicasso.bcn.cat
25. Juli bis 26. Oktober 2025: Growing up between two artists. Tribute to Claude Picasso.
Madrid
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23, 28014 Madrid Tel. +34-(0)91-3302800 www.museodelprado.es
Bis 14. September 2025: So far, so close. Guadalupe of Mexico in Spain. Bis 21. September 2025: Paolo Veronese (1528–1588).
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa
Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Tel. +34-(0)91-7741000 www.museoreinasofa.es
Bis 25. August 2025: Huguette Caland. A Life in a Few Lines. Bis 1. September 2025: Laia Estruch. Hello Everyone. Bis 8. September 2025: Néstor Reencountered. Bis 22. September 2025: Marisa González. A Generative. Bis 20. Oktober 2025: Naufus Ramírez-Figuera. Light Spectra. Bis 16. Januar 2026: Miguel Àngel Tornero. Big Frieze.
Museo Thyssen-Bornemisza
Palacio de Villahermosa
Paseo del Prado 8, 28014 Madrid
Tel. +34-(0)91-690151 www.museothyssen.org
Bis 7. September 2025: Ayako Rokkaku. For those moments when you feel like paradise. Bis 14. September 2025: Isabel Coixet. Collages. Learning in disobedience. Bis 28. September 2025: Terraflia. Beyond the Human in the Thyssen-Bornemisza Collections. 15. Juli bis 12. Oktober 2025: Anna Weyant.
Die Angaben beruhen auf den Informationen der Aussteller. Änderungen nach Redaktionsschluss vorbehalten.
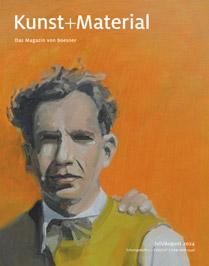


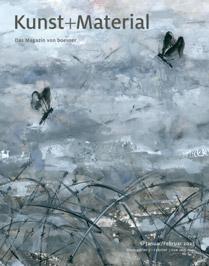


Kunst+Material auch im Abonnement!
Kunst+Material erscheint zweimonatlich in einer Auflage von 30.000 Exemplaren und bietet Einblicke in Ateliers und Arbeitsweisen von porträtierten Künstler*innen, stellt interessante Inhalte im Sonderthema vor, präsentiert aktuelle Ausstellungen und gibt neben News aus der Kunstwelt viele spannende Buchempfehlungen an die Hand. Neu und exklusiv gibt es inspirierende Bildstrecken zu Materialien und künstlerischen Techniken. Hintergrundstories aus der Feder von Expert*innen informieren über die unterschiedlichsten Materialien und ihre Geschichte, und auch Künstlerinnen und Künstler selbst kommen zu Wort und stellen ihr Lieblingsmaterial vor.#
Bestellungen
boesner GmbH holding + innovations „Kunst+Material“ – Abonnement
Gewerkenstraße 2, D-58456 Witten oder abo@kunst-und-material.de Fax +49-(0)2302-97311-33
Bestellungen aus der Schweiz
boesner GmbH
Surenmattstrasse 31, CH-5035 Unterentfelden oder marketing@boesner.ch

Abonnement
[ ] Ja, ich bestelle das Kunst+Material-Abonnement mit jährlich sechs Ausgaben zum Abo-Preis inkl. Versand von 49,50 EUR bzw. 49,50 CHF (Schweiz). Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn es nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Bezugsjahres gekündigt wird.
[ ] Ja, ich bestelle das Probe-Abonnement und beziehe die nächsten drei Ausgaben von Kunst+Material zum einmaligen Kennenlern-Preis von 14,50 EUR bzw. 14,50 CHF (Schweiz). Danach bekomme ich Kunst+Material bequem nach Hause – zum Jahresbezugspreis von 49,50 EUR/CHF für sechs Ausgaben. Dazu brauche ich nichts weiter zu veranlassen. Wenn ich Kunst+Material nicht weiterlesen möchte, kündige ich das Probe-Abo schriftlich bis spätestens eine Woche nach Erhalt des 2. Heftes. Dieses Angebot gilt in Deutschland und der Schweiz.
Rechnungsadresse
Vorname
Nachname
Straße
PLZ, Ort
Land
Telefon
Lieferadresse (falls abweichend)
Vorname
Nachname
Straße
PLZ, Ort
Land
Telefon
Widerrufsrecht: Diese Vertragserklärung kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) schriftlich gekündigt werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist an die jeweilige Bestelladresse zu richten.
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Nanne Meyer, leicht bewölkt, 2000, Mischtechnik auf Japanpapier, Leihgabe der Künstlerin,© die Künstlerin.
Über kurz oder lang …
Dem Himmel so nah
Wolken faszinieren durch ihre Flüchtigkeit und ihre fragile Anmut, und seit Jahrhunderten inspirieren Wolken die Kunst: Sie stehen für Göttliches, erhabene Naturschönheit und Atmosphäre, für Vergänglichkeit und Sehnsucht – und heute auch für Klimawandel, Umweltzerstörung und Krieg. Die Kunsthalle Emden widmet dem vielschichtigen Thema die umfangreiche Ausstellung „Dem Himmel so nah. Wolken in der Kunst“, die bis zum 2. November 2025 zu sehen ist. Gezeigt werden Werke aus verschiedenen Epochen und Gattungen, von der klassischen Landschaft bis zur zeitgenössischen Installation. Der Himmel lässt sich so in seiner poetischen wie politischen Dimension neu entdecken – aber auch als Spiegel des Inneren und als Zeichen unserer Zeit verstehen.#
www.kunsthalle-emden.de

Er ist einer der großen Konstanten unserer Kulturgeschichte und wurde selbst von Goethe der Schreibfeder vorgezogen, weil diese ihn durch „Scharren und Spritzen" aus seinem „nachtwandlerischen Dichten und Denken aufschreckte“. Was aber passiert, wenn der Bleistift in zahlreichen Anspitzvorgängen an Länge verloren hat und einfach nicht mehr gut in der Hand liegt? Zeit, sich zu trennen? Nein, denn jetzt schlägt die Stunde des Bleistiftverlängerers: In klassischer Formensprache, mit Holzstiel, Hülse und verstellbarem Klemmring hält er zu kurz gewordene Blei- und Farbstifte sicher fest und verlängert sowohl den Stiel als auch die Nutzungsdauer liebgewonnener Schreib- und Zeichengeräte.#

„Leonora
FilmTipp
Leonora im Morgenlicht
In den 1930er-Jahren bricht Leonora Carrington (Olivia Vinall) mit den gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit und tritt der surrealistischen Bewegung bei. In Paris trifft sie auf Künstlergrößen wie Salvador Dalí und André Breton, doch es ist ihre stürmische Liebesaffäre mit dem Maler Max Ernst (Alexander Scheer), die sie auf eine Reise zu sich selbst führt. Zwischen Kunst, Leidenschaft und inneren Dämonen muss sich Leonora in einer Welt voller Umbrüche behaupten. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs flieht sie nach Mexiko, wo sie ihre Freiheit und ihre eigene Stimme als Künstlerin findet. Der Kinofilm „Leonora im Morgenlicht“ wirft einen einzigartigen Blick auf die faszinierende Lebensgeschichte der britischen Künstlerin Leonora Carrington (1917–2011). Als bedeutende Künstlerin des Surrealismus zählt sie zu den populärsten Malerinnen Mexikos, doch in ihrer Heimat Großbritannien und der internationalen Kunstwelt blieb ihr Lebenswerk lange Zeit weitgehend unbeachtet. Heute gehört Leonora Carrington zu den weltweit höchstverkauften Künstlerinnen, neben Frida Kahlo und Georgia O’Keeffe. Der Film von RegieDuo Thor Klein und Lena Vurma basiert auf dem Roman „Leonora“ von Elena Poniatowska, der 2012 in Deutschland unter dem Titel „Frau des Windes“ erschienen ist.#

Ab 17. Juli 2025 im Kino!
Der kurze Weg zur Kunst


www.instagram.com/ boesner_deutschland/ www.facebook.com/ boesner/

In Sicherheit
www.boesner.com/ kunstportal
33 x in Deutschland und 1 x Versandservice
3 x in Österreich
4 x in der Schweiz
5 x in Frankreich
Fragile Materialien für die Umsetzung künstlerischer Ideen verdienen besonderen Schutz. Damit unter den Künstlerfarb- oder Bleistiften kein Durcheinander herrscht und sie im Atelier, unterwegs oder auf Reisen immer sicher und griffbereit untergebracht sind, wurde dieser stilvolle und funktionale boesner-Holzkoffer aus Ulmenholz gefertigt. In seinem Inneren liegen bis zu 35 Stifte jeweils einzeln und bruchsicher im vorgeformten Einsatz und werden zuverlässig fixiert und geschützt.#
Szene aus
im Morgenlicht“, © Alamode Film.
Marcel fragt Alexia
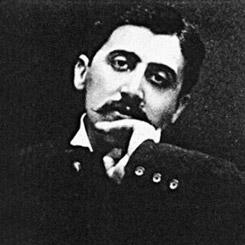

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, (1871–1922), französischer Schriftsteller, Kritiker und Intellektueller
Alexia Krauthäuser (*1971), Künstlerin aus Düsseldorf
Streng genommen fragt hier gar nicht Marcel Proust selbst – vielmehr hat der berühmte Schriftsteller, dessen Werk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ als einer der größten Romane der Weltliteratur gilt, dem berühmt gewordenen Fragebogen seinen Namen gegeben. Proust hat einen solchen Fragebogen wohl mindestens zweimal selbst beantwortet – um die Wende zum 20. Jahrhundert galt das Ausfüllen als beliebtes Gesellschaftsspiel in gehobenen Kreisen. Der erste Bogen, ausgefüllt vom heranwachsenden Proust während eines Festes, wurde posthum 1924 veröffentlicht. Den zweiten Fragebogen betitelte Proust mit „Marcel Proust par lui-même“ („Marcel Proust über sich selbst“). Die ursprünglich 33 Fragen wurden für Kunst+Material auf 29 reduziert – und bieten spannende und nachdenkliche Einblicke in die Gedankenund Gefühlswelt unserer Befragten.
Wo möchten Sie leben? Mit meinen mir lieben Menschen und Hund am Meer. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Ohne Zeitdruck malen zu können, mit meiner Hündin Hummel im Arm zu entspannen. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Die, die ich verstehen kann und über die wir später gemeinsam lachen können. Was ist für Sie das größte Unglück? Manipulative Lügner, wenn ein Kind schwer erkrankt. Ihre liebsten Romanhelden?
Ara und die Ich-Erzählerin Kit aus dem Roman „Die Freundschaft“ von Connie Palmen, Stephen Dedalus in „Ein Porträt des Künstlers als junger Mann“ von James Joyce. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Dietrich Bonhoeffer. Ihre Lieblingsmaler? Jan Vermeer van Delft , Henri Matisse, Edvard Munch, Joan Mitchell, Helen Frankenthaler, Marlene Dumas, Rene Daniëls, aber auch Francis Alÿs , William Kentridge, Roni Horn, Eija Liisa Ahtila … Ihr Lieblingsautor? Connie Palmen, Albert Camus. Ihr Lieblingskomponist? Johann Sebastian Bach, John Cage, Meredith Monk, Wim Mertens, Steve Reich, Laurie Anderson ... Welche Eigenschaft schätzen Sie bei einem Menschen am meisten? Empathie, Humor, Lebensfreude. Ihre Lieblingstugend? Gerechtigkeit. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Musik hören und malen. Wer oder was hätten Sie gern sein mögen? Jemand, der viele verschiedene Sprachen versteht und spricht. Ihr
Hauptcharakterzug? Gute Beobachterin, Großzügigkeit. Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? Dass sie mich annehmen, so wie ich bin, aber mir auch klar und kritisch ihre Meinung sagen. Ihr größter Fehler? Dass ich zu lange nachdenke und abwäge. Ihr Traum vom Glück? Frei sein von innerer Unruhe und Zeitdruck. Ihre Lieblingsfarbe? Grün, aber in der Malerei habe ich keine Lieblingsfarbe. Ihre Lieblingsblume? Mohnblume, Anemone, Iris. Ihr Lieblingsvogel? Zaunkönig, Rotkehlchen, Uhu. Ihre Helden der Wirklichkeit? Künstler*innen (die arbeiten müssen, um arbeiten zu können), aber auch Kreativund Psychotherapeut*innen. Ihre Lieblingsnamen? Irma, Josefine. Was verabscheuen Sie am meisten? Hass und Gewalt. Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie am meisten? Machthaber und Demagogen, die Angst und Hass schüren, um Menschen zu manipulieren. Welche Reform bewundern Sie am meisten? Einführung des Frauenwahlrechts und der Ausstieg aus Flurchlorkohlenwasserstoffen, eingeleitet durch das Montrealer Protokoll. Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Gesangstalent. Wie möchten Sie sterben? Wenn ich wählen darf: gesund, alt und zufrieden. Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? Nachdenklich und mit Zuversicht. Ihr Motto? Ein Zitat von Hilde Domin passt ganz gut: „Ich setzte einen Fuß in die Luft und sie trug.“
Wer’s weiß, gewinnt!
Künstlerbedarf
italienischer Maler
nigerianischer Kurator (Okwui)
dt. Bildhauerin (Nelli)
dt. Genremaler (Emil)
dt.schwed. Malerin (Lotte)
Name zweier schweiz. Maler (Hans)
dän. Bildhauer (Bertel)
französischer Maler (Édouard)
angesagt, up to date
amerik. Künstler (George)
deutscher Maler (Karl)
dt. Maler und Grafiker (Georg)
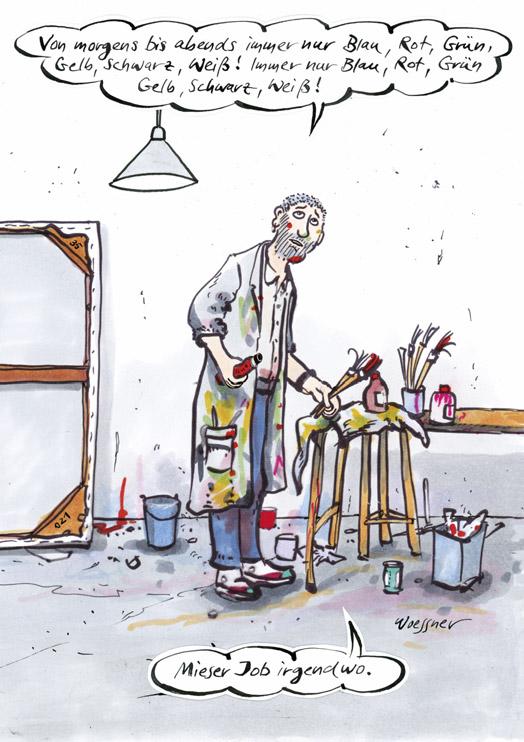
nischer Maler (Paolo)
Barockmaler (Bartolomé)
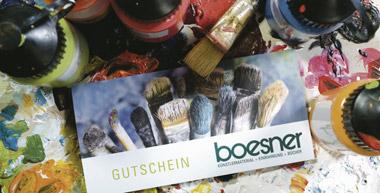
1. Preis boesner-Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro
2. Preis boesner-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro
3. Preis
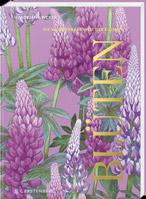
Ein Buch „Blüten. Die wunderbare Welt der Blumen“, siehe S. 54

So nehmen Sie teil: Bitte senden Sie das Lösungswort per E-Mail an: raetsel.zeitung@boesner.com oder per Postkarte an: boesner holding GmbH holding + innovations, Gewerkenstr. 2, 58456 Witten. Einsendeschluss ist der 31. August 2025.
Mitarbeiter von boesner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.
Das Lösungswort des Preisrätsels aus Kunst+Material Mai/Juni 2025 ist: FIXIERBAD
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Herausgeber
boesner GmbH holding + innovations Gewerkenstr. 2, 58456 Witten
Tel. +49-(0)2302-97311-10
Fax +49-(0)2302-97311-48 info@boesner.com
V.i.S.d.P.: Jörg Vester
Redaktion
Dr. Sabine Burbaum-Machert redaktion@kunst-und-material.de
Satz und Grafische Gestaltung
Birgit Boesner, Hattingen mail@bboes.de
Anzeigen
Dr. Sabine Burbaum-Machert anzeigen@kunst-und-material.de Anzeigenpreisliste Nr. 18 vom 01.02.2025
Herstellung
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg
Erscheinungsweise
zweimonatlich
© 2025 bei der boesner GmbH holding + innovations. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art, Aufnahmen in OnlineDienste und die Vervielfältigung auf Datenträgern wie CD-Rom, DVD-Rom etc. bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Unverlangte Manuskripte, Fotos und Dateien usw. sind nicht honorarfähig. Sie werden nicht zurückgesandt und für sie wird keine Haftung übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Eine Veröffentlichung von Daten, insbesondere Terminen, erfolgt trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Redaktionsund Anzeigenschluss ist immer der 15. des jeweiligen Vormonats. Seiten 3, 45, 64–65, 92 unten, 93 rechts, U4: Malerei, Realisation und Fotografie: Ina Riepe. Seite 4: (6) Alexia Krauthäuser, Foto: Katja Illner; (18) Netsuke mit einem Jungen mit Maske, Japan, 19. Jahrhundert, Metropolitan Museum, New York, Public Domain; (32), (46) Malerei, Realisation und Fotografie: Ina Riepe; (66) Installationsansicht „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“, © Vitra Design Museum, Foto: Bernhard Strauss; (78) Installationsansicht „Mit offenem Blick. Der Impressionist Pissarro“, 2025, Museum Barberini Potsdam, © David von Becker, Seite 94 unten: Foto: Katja Illner.
Verlag und Redaktion danken den Rechteinhabern für die Reproduktionsgenehmigungen. Nicht nachgewiesene Abbildungen entstammen dem Archiv des Verlags. Konnten trotz sorgfältigster Recherche Inhaber von Rechten nicht ermittelt werden, wird freundlich um Meldung gebeten.
ISSN 1868-7946
Die nächste Kunst+Material erscheint im September 2025
Thema
Villa Adriana
Die Villa des römischen Kaiser Hadrian, östlich von Rom in Tivoli gelegen, gehört zu den wichtigsten Monumenten der Antike. Seit der Wiederentdeckung im 15. Jahrhundert war sie Fundort, Quelle von Erkenntnissen über altrömische Baukunst und ebenso Inspiration für ungezählte Maler, Gartengestalter und Architekten. Dieter Begemann geht auf Spurensuche in der geheimnisvollen Welt der Villa Adriana.
Ausstellung
„Sean Scully. Stories“ in Hamburg
Die bekanntesten Arbeiten von Sean Scully (*1945) sind großformatige Gemälde, auf die er mehrschichtig Ölfarbe aufträgt, wodurch eine markante, deutlich sichtbare Textur entsteht. Neben dem starken Farbauftrag und groben Pinselstrichen sind vor allem die Dimension und die Schachbrett-Muster charakteristisch für seine Werke. Anlässlich seines 80. Geburtstags widmet das Bucerius Kunst Forum in Hamburg dem Künstler die große Retrospektive „Sean Scully. Stories“: Die Besuchenden erwartet eine Zeitreise durch die Jahrzehnte, die verdeutlicht, wie sich der Werdegang eines Künstlers durch persönliche Schicksalsschläge, politische Entwicklungen und künstlerische Strömungen verändern kann. Die Ausstellung zeigt, dass Scullys Kunst nicht unnahbar ist, sondern Geschichten erzählt und Emotionen und Erinnerungen weckt.

Sean Scully, Migration, 2021, Privatsammlung © Sean Scully, Foto: courtesy the artist.
Weitere Themen: Porträt | Inspiration | Persönlich | Technik | Bücher | Im Gespräch



