




Die Bertelsmann Stiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn errichtet und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie ist eine operative Stiftung, die alle Projekte eigenständig konzipiert, initiiert und sie bis zur Umsetzung begleitet.
Die Geschäftsführung der Stiftung durch ihre Organe muss mit dem Ziel erfolgen, den Stifterwillen zu erfüllen.
Dr. Hannes Ametsreiter, Dr. Brigitte Mohn, Prof. Dr. Daniela Schwarzer
bildung und next generation
demokratie und zusammenhalt
digitalisierung und gemeinwohl
europas zukunft
gesundheit nachhaltige soziale marktwirtschaft
zentrum für nachhaltige kommunen
Für lebenswerte und zukunftsfähige Städte, Kreise und Gemeinden
www . bertelsmann - stiftung . de
www.bertelsmannstiftung.de/podcast
www.linkedin.com/company/ bertelsmann-stiftung
bsky.app/profile/ bertelsmannst.bsky.social
www.xing.com/companies/ bertelsmannstiftung
zentrum für datenmanagement
Für ein wachsendes und offenes Datenökosystem in Deutschland
www.facebook.com/ BertelsmannStiftung
www.youtube.com/user/ BertelsmannStiftung
www.instagram.com/ bertelsmannstiftung

Liebe Leser:innen, wo ist die Mitte? Das fragt man sich beim Aufhängen eines Bildes, wenn man etwas teilen möchte, wenn Orientierung gesucht wird. Mitte ist oft Ausgangspunkt und sorgt für Stabilität, Ausgewogenheit und Kompromisse – Demokratie braucht Mitte. In der Mitte bündeln sich alle Farben und Facetten.
Für eine stabile pluralistische Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt setzen sich die diesjährigen Träger:innen des Reinhard Mohn Preises, die moldauische Staatspräsidentin Maia Sandu und der Unternehmer Michael Otto, ein. In dieser Ausgabe schauen wir auf die Höhepunkte des bewegenden Festakts und die beiden beeindruckenden Persönlichkeiten.
Wir haben uns auch dorthin begeben, wo die Mitte unterwegs ist: zum Beispiel ins brandenburgische Grünheide, wo sich junge Menschen für ihren Ort und ihre Nachbarschaft einsetzen. 400 Kilometer weiter westlich haben wir die Bielefelder Metal-Band Soulbound getroffen, die sich auf ihren deutschlandweiten Konzerten zunehmend mit politischen Anfeindungen auseinandersetzen muss. „Ich kann niemanden bekehren. Aber anderen helfen, stabil zu
bleiben“, sagt ihr Sänger. Da ist sie wieder, die Mitte. Kulturschaffende und -orte wie auch die Vancouver Opera in Kanada verstehen sich als Treffpunkte für den sozialen Zusammenhalt und stärken so die Mitte.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass Kompetenzen wie Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein am Arbeitsmarkt immer mehr nachgefragt werden. Fachkompetenzen allein reichen nicht aus. Es braucht auch hier die Balance. Das hat der Jobmonitor der Bertelsmann Stiftung analysiert. Ideal ist es, wenn diese Kompetenzen schon in der Schule gefördert werden wie im Evangelisch Stiftischen Gymnasium in Gütersloh.
Eine inspirierende Lektüre und den Mut zur Mitte wünscht Ihnen
Ihre Malva Sucker

Vancouver
Vancouver Opera Seite 41

02 UNSER PROFIL
03 EDITORIAL
Mut zur Mitte
06 AUSBLICK
Youth Empowerment auf dem KOSMOS Festival
08 INTERVIEW: DR. HANNES AMETSREITER
Shaping the Future
10 GESELLSCHAFT
„Demokratie stärken!“ – Reinhard Mohn Preis 2025
20 BILDUNG
Mit Bildung der Zeit voraus
28 MOTIVATION: DR. BRIGITTE MOHN
Die mentale Gesundheit junger Menschen geht uns alle an
30 ESSAY: EVA SCHULTE-AUSTUM
Wie kann ich wieder vertrauen?


Münster Wie kann ich wieder vertrauen?
Seite 30
Jamel
Jamel rockt den Förster Seite 41

Gütersloh
Mit Bildung der Zeit voraus Seite 20

Gütersloh
Brückenbauer für junge Gründer:innen Seite 60
32 DEMOKRATIE
Mitte, bitte!

Aalen
Sauber sortiert mit KI
Seite 44
42 KOMMENTAR: DR. DANIELA SCHWARZER
Nach der Bundestagswahl 2025: Lehren für unsere liberale Demokratie
44 WIRTSCHAFT
Sauber sortiert mit KI
54 VERLAG DER BERTELSMANN STIFTUNG
Von Arbeit bis Zusammenleben – Wie Flüchtlingsintegration in Kommunen gelingen kann
56 BLICK ÜBER DEN ZAUN
Turning the Key to Maltese Identity
60 DER LETZTE MACHT DAS LICHT AUS
61 PDF-AUSGABE IM ABONNEMENT

Grünheide & Bielefeld Mitte, bitte! Seite 32


Augsburg
Staatstheater Augsburg Seite 41

Gütersloh
„Demokratie stärken!“ Reinhard Mohn Preis 2025 Seite 10

Um die Vorteile des Online-Magazins richtig auszunutzen, achten Sie auf unsere Links. Diese helfen innerhalb der Ausgabe zu navigieren, beispielsweise über das Haussymbol oben auf jeder Seite sowie über Fotos und Seitenverweise im Inhaltsverzeichnis. Verlinkungen zu weiterführenden Informationen oder zum Weiterempfehlen von Inhalten erreichen Sie über die entsprechenden Icons: Download, Kontakt, Podcast, Teilen, Video, Weblink. Lesen Sie am Laptop oder am PC, ändert sich an solchen Positionen der Cursor vom Pfeil zur Hand. Einfach draufklicken!
Chemnitz Youth Empowerment auf dem KOSMOS Festival Seite 06


Inhaltsverzeichnis Download
Autor:in
Kontakt
Podcast
Fotograf:in
Standort
Wetter Datum
Teilen
Video
Weblink










GenNow, die junge Initiative der Bertelsmann Stiftung, bildet auf dem diesjährigen KOSMOS Festival in Chemnitz einen einzigartigen Raum für junge Menschen, um sich zu begegnen, auszutauschen und gegenseitig zu empowern. Durch innovative Formate und interaktive Angebote werden sie ermutigt, sich aktiv für gesellschaftliche Themen einzusetzen. In der Kulturhauptstadt Europas 2025 wird Engagement nicht nur thematisiert, sondern gemeinsam gestaltet und erlebt.
NextGen und die GenNow-Venue: Ein Ort für junge Stimmen
Am 14. Juni 2025 wird die Schlossteichinsel zum Zentrum für junge Menschen auf dem Festival. Die „GenNow-Venue“ bietet Raum für Begegnung, Austausch und Inspiration. In Workshops, Panels und Konzerten geht es um gesellschaftliches Engagement, Demokratie und politische Bildung. Kunst und Kultur spielen dabei eine besondere Rolle: Sie ermöglichen emotionale Zugänge zu komplexen Themen und eröffnen kreative Wege, um gesellschaftliche Herausforderungen greifbar zu machen. Unter dem Motto „Youth Empowerment“ entsteht ein Raum, in dem junge Menschen ihre Ideen teilen, voneinander lernen und gemeinsam neue Perspektiven entwickeln können.
Das KOSMOS Festival: Ein Festival für Demokratie und gesellschaftlichen Wandel Das KOSMOS Festival ist mehr als ein kulturelles Event – es ist eine Plattform für Austausch, Diskussion und Mitgestaltung. Vom 13. bis 15. Juni 2025 kommen hier Menschen zusammen, um gemeinsam über die Zukunft von Chemnitz, Deutschland und Europa nachzudenken. Mit 70.000 Teilnehmenden im Jahr 2024 setzt das Festival ein starkes Zeichen für demokratische Werte und Offenheit. Besonders die

Region Chemnitz bietet eine Chance, junge Menschen im Osten Deutschlands zu erreichen und sie für gesellschaftliche Themen zu begeistern.
Empowerment statt Stillstand:
Die Rolle der Bertelsmann Stiftung Die Bertelsmann Stiftung zeigt mit ihrem Engagement auf dem KOSMOS Festival 2025, dass JugendEmpowerment aufsuchende Formate braucht – es bedeutet Inspiration, Motivation und aktives Mitgestalten. Die GenNow-Venue schafft eine interaktive und inklusive Plattform, auf der junge Menschen ihre Stimme finden und gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten können.
PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG
GenNow ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung, die junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren dazu befähigt, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. Unter dem Motto „Empowering youth for a sustainable future“ agiert GenNow als Netzwerkpartner, Innovationsförderer, Wissensbasis, Cheerleader und Sprachrohr in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Youth Empowerment Hub www.gennow.de
GenNow
Dr. Hannes Ametsreiter
David Bärwald

DR. HANNES AMETSREITER
Vorsitzender des Vorstands der Bertelsmann Stiftung
Dr. Hannes Ametsreiter ist seit dem 1. Januar 2025 neuer Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung. Er blickt auf eine über 21-jährige Vorstandserfahrung in verschiedenen Ländern zurück. Seine berufliche Laufbahn begann Ametsreiter bei Procter & Gamble. Es folgten langjährige Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche. Ab 2009 war er Vorstandsvorsitzender der Telekom Austria Group. 2015 wechselte er zur Vodafone Gruppe. Dort war er Mitglied im weltweiten Group Executive Team und im Beirat der Vodafone Stiftung tätig. Zugleich leitete er als CEO das Geschäft von Vodafone Deutschland.
Hannes Ametsreiter
change | Herr Dr. Ametsreiter, Sie sind seit einigen Monaten Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung. Wie haben Sie die Stiftung und ihre Rolle in der Gesellschaft bisher wahrgenommen?
dr . hannes ametsreiter | Stiftungen spielen eine wesentliche Rolle als Impulsgeber und Brückenbauer. Die Bertelsmann Stiftung ist eine der bedeutendsten gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und Europa. Ihre Stärke liegt darin, unabhängig, evidenzbasiert und wirkungsorientiert Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu erarbeiten. Besonders beeindruckt mich das breite Themenspektrum unserer Stiftungsarbeit – von Bildung und Digitalisierung über Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit bis hin zu wirtschaftlicher Transformation. Als Grenzgänger zwischen Österreich und Deutschland und überzeugter Europäer sehe ich die Chance, mit unserer Arbeit auch europäische Entwicklungen positiv zu gestalten.
„Besonders beeindruckt mich das breite Themenspektrum unserer Stiftungsarbeit.“
Sie kommen aus der Wirtschaft, insbesondere aus der Technologiebranche. Was fasziniert Sie an Ihrer neuen Aufgabe in einer Stiftung?
Technologie hat unsere Welt in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend verändert. In meinen früheren Positionen habe ich erlebt, wie Innovationen, manchmal auch auf disruptive Art und Weise, Unternehmen und ganze Branchen transformieren, ja sogar die Gesellschaft. In der Bertelsmann Stiftung können wir diese Dynamik nutzen, um diesen gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestalten. Mich reizt es, mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen an Lösungen für drängende Herausforderungen zu arbeiten – und das mit einem klaren gemeinnützigen Auftrag.
Was treibt Sie in Ihrer täglichen Arbeit an?
Was motiviert Sie?
Ich bin jemand, der gerne schnell etwas bewegt. Mich begeistert der Austausch mit engagierten Menschen, die eine positive Veränderung bewirken wollen. Die Bertelsmann Stiftung bietet genau das: Wir erarbeiten innovative Ideen und setzen uns dafür ein, dass diese auch in der Praxis umgesetzt werden. Besonders motivierend finde ich, dass unsere Arbeit konkrete Wirkung entfalten kann – sei es in politischen Entscheidungsprozessen, in Bildungsprojekten oder in der Stärkung demokratischer Werte.
Die Bertelsmann Stiftung hat ihrer Arbeit seit 2024 ein Motto gegeben: „Demokratie stärken!“ Was bedeutet es für Sie persönlich?
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit – das sehen wir in der aktuellen Weltlage immer wieder. Entwicklungen in den USA, geopolitische Spannungen oder auch der Aufstieg populistischer Bewegungen in Europa zeigen, dass wir für demokratische Werte aktiv eintreten müssen. Für mich bedeutet das, Haltung zu zeigen und sich für eine offene, faire und inklusive Gesellschaft einzusetzen. Die Bertelsmann Stiftung kann hier als Plattform dienen, um Debatten anzustoßen, Lösungsansätze zu entwickeln und gemeinsam mit Partner:innen Veränderungen zu bewirken.
Im März haben Sie am von der Bertelsmann Stiftung und dem Centrum für Hochschulentwicklung initiierten „Future Skill Summit“ in Berlin teilgenommen. Welche Fähigkeiten werden in Zukunft am wichtigsten sein? Die Welt verändert sich in rasantem Tempo. In dieser Dynamik sind Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz entscheidend. Es geht nicht darum, alles selbst zu können, sondern darum, offen für neue Ansätze zu sein und Zusammenarbeit zu fördern. In der Bildung sehe ich eine zentrale Aufgabe darin, junge Menschen zu befähigen, selbstständig zu denken und Herausforderungen konstruktiv anzugehen. Früher hätte ich gesagt: Jede:r sollte Programmieren lernen. Heute, mit Technologien wie künstlicher Intelligenz, stellt sich die Frage neu. Vielmehr geht es darum, Technologie zu verstehen und sinnvoll einzusetzen. Genau das macht die heutige Zeit so spannend.
„Was hinterlassen wir den kommenden Generationen?“
Wenn Sie sich die Welt von morgen vorstellen – wie wünschen Sie sich, dass Ihre Kinder einmal leben werden? Ich wünsche mir eine Welt, in der meine Kinder in einer offenen, friedlichen und nachhaltigen Gesellschaft aufwachsen können. Eine Welt, in der wirtschaftlicher Fortschritt nicht auf Kosten der Umwelt geht, sondern im Einklang mit ihr steht. Es ist unsere Aufgabe, jetzt die richtigen Weichen zu stellen – durch nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Handeln, den bewussten Umgang mit Ressourcen und die Förderung von Bildung und Innovation. Dabei sollten wir uns immer fragen: Was hinterlassen wir den kommenden Generationen? Ich glaube, dass wir mit mutigen Entscheidungen heute eine lebenswerte Zukunft für morgen gestalten können.

Am 20. Februar wurden die Präsidentin Moldaus Maia Sandu und der Hamburger Unternehmer Michael Otto für ihre herausragenden Beiträge zur Stärkung der Demokratie ausgezeichnet. Die Preisverleihung im Theater Gütersloh unter strich aber auch, wie wichtig der Einsatz aller Bürger:innen für den Fortbestand der Demokratie ist.


Ein Zeichen für die Zukunft der Demokratie: Die Verleihung des Reinhard Mohn Preises im Theater Gütersloh wurde durch bewegende Tanzeinlagen begleitet, die die Bedeutung demokratischer Werte unterstrichen.
Die Preisträger:innen mit den Laudator:innen (v. l.): Michael Otto, Elke Büdenbender, Maia Sandu, Frank-Walter Steinmeier und Liz Mohn.
„Wann, wenn nicht heute, ist der Tag, an dem man Demokratie diskutieren sollte? Wann, wenn nicht heute, der Tag, an dem man Demokratie stärken sollte?“ Mit diesen Fragen eröffnete Hannes Ametsreiter, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, am 20. Februar den Festakt zur Preisverleihung des Reinhard Mohn Preises, der 2025 unter dem Thema „Demokratie stärken!“ stand. Jedem der rund 500 Gäste im Theater Gütersloh war klar: Heute ist dieser Tag. Denn die Notwendigkeit, die Demokratie zu stärken, war zuletzt bedrückend aktuell geworden. Die Demokratie steht unter Druck – von innen wie von außen.
Auszeichnung zweier beeindruckender Persönlichkeiten
Es war also der richtige Tag, um zwei Persönlichkeiten hervorzuheben, die diesem Druck etwas entgegensetzen. Die Bertelsmann Stiftung nutzte ihn, um der Präsidentin von Moldau Maia Sandu und dem Hamburger Unternehmer und Philanthropen Michael Otto für ihre Beiträge zur Stärkung der Demokratie den Reinhard Mohn Preis zu verleihen.
Der Preis wird alle zwei Jahre in Gedenken an den im Oktober 2009 verstorbenen Unternehmer und Gründer der Bertelsmann Stiftung Reinhard Mohn vergeben. Der Preis folgt Mohns Überzeugung, dass die Demokratie als Staatsform nicht abgeschlossen ist, sondern stets weiterentwickelt und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Mit ihm werden daher Menschen ausgezeichnet, die sich um wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen verdient gemacht haben. Oder mit Ametsreiters Worten: „Die Bertelsmann Stiftung sucht nach Menschen und Ideen, die die Welt ein Stückchen besser machen.“
„Die Bertelsmann Stiftung sucht nach Menschen und Ideen, die die Welt ein Stückchen besser machen.“
Preisträgerin Maia Sandu: Mut als Signal für die Demokratie
Maia Sandu hat mehr als das getan, als sie im November 2024 erneut zur Staatspräsidentin Moldaus gewählt wurde. Als Politikerin mit einer klaren proeuropäischen Agenda musste sie im Wahlkampf gegen massive Einmischungen Russlands kämpfen. Moskau wollte das an die Ukraine und Rumänien grenzende Land wieder in seine Einflusssphäre ziehen. Doch Sandu gewann die Wahl trotzdem und setzte damit ein Zeichen, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Laudatio unterstrich: „Maia Sandu zeigt, dass Demokratie nicht nur eine abstrakte Idee ist, sondern täglich gestaltet und verteidigt werden muss, und sendet damit ein starkes Signal an Demokratien weltweit.“
Steinmeier sprach in seiner Laudatio über die Lage in den USA, die ihm „große Sorgen“ bereite, wegen der Konzentration politischer, ökonomischer, digitaler und medialer Macht in wenigen Händen. „Und es macht mir allergrößte Sorgen, wenn diese kleine Elite nicht nur die Spielregeln der Demokratie für das eigene Land neu definiert, sondern auch noch Kräfte in Deutschland unterstützt, die die Werte der Demokratie verachten.“ Umso wichtiger seien Personen wie Sandu, erklärte Steinmeier, die „mit offenem Visier und vollem Risiko“ für demokratische Werte kämpften. „Frau Präsidentin, Sie leben vor, woran wir uns ein Beispiel nehmen sollten. Sie leben Demokratie. Dafür danken wir Ihnen.“
„Der Reinhard Mohn Preis ist nicht nur eine persönliche Ehre“, sagte Sandu, „sondern auch eine Auszeichnung des Muts und des Durchhaltevermögens der Menschen in Moldau.“ Sie warnte davor, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu unterschätzen. Vielmehr gehe es darum, ob ganz Europa ein Kontinent bleiben könne, auf dem Frieden und Freiheit herrschen. Sandu beendete ihre Rede mit einem Appell, den das Publikum mit stehendem Applaus empfing: „Lassen Sie uns schützen, was uns wichtig ist: unsere Freiheit, unsere Zukunft, unser Europa und unseren Frieden!“


Der Reinhard Mohn Preis erinnert an den Gründer der Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn († Oktober 2009). Der Preis zeichnet international renommierte Persönlichkeiten aus, die sich um wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen verdient gemacht haben. Unter den bisherigen Preisträger:innen befinden sich beispielsweise Joachim Gauck, Rita Süssmuth und Kofi Annan. Das Thema des aktuellen Preises lautet „Demokratie stärken!“

„Reinhard Mohn Preis“ Demokratie stärken!


„Der Reinhard Mohn Preis ist nicht nur eine persönliche Ehre, sondern auch eine Auszeichnung des Muts und des Durchhaltevermögens der Menschen in Moldau“, erklärt Maia Sandu in ihrer Dankesrede.
Visionär der unternehmerischen Verantwortung:
Michael Otto
Diesen Weg hat der zweite Preisträger des Reinhard Mohn Preises bereits eingeschlagen: Michael Otto, der von 1981 bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Otto Group war und heute dem Aufsichtsrat vorsteht, engagiert sich seit Jahrzehnten für die Stärkung einer offenen Gesellschaft sowie für den Schutz und die Weiterentwicklung der Demokratie. Er gründete außerdem mehrere Umweltschutz-Stiftungen.
Liz Mohn, Stifterin und Ehrenmitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung, hielt die Laudatio auf Otto und lobte ihn als Beispiel eines Unternehmers, der sich seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst sei: „Sie sind ein Visionär. Sie sind aber auch ein Mensch, der Visionen umsetzt.“ Otto wisse, wie Veränderung funktioniere – nämlich durch gezieltes Handeln. „Wir alle müssen zusammenarbeiten. Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler, Bürgerinnen und Bürger“, sagte Mohn. „Nur wenn wir uns gegenseitig zuhören und Brücken der Verständigung bauen, können wir Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit finden.“
„Nur wenn wir uns gegenseitig zuhören und Brücken der Verständigung bauen, können wir Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit finden.“
Otto dankte für die Auszeichnung und erklärte: „Als Unternehmer habe ich mehr Möglichkeiten und darum auch mehr Verantwortung.“ In seiner Rede warnte er vor der zerstörerischen Kraft von Fake News und der „Flut an Falschnachrichten“, die die Bürger:innen so sehr verwirrten, bis sie nicht mehr wüssten, was sie eigentlich noch glauben könnten. Um die Demokratie vor diesen gefährlichen Tendenzen zu schützen, müssten Toleranz und Respekt im
täglichen Leben gelebt werden, so Otto. Um dazu beizutragen, spendet er sein Preisgeld von 100.000 Euro an kleine, lokale Initiativen in Hamburg, die die liberale Gesellschaft stärken und eine konstruktive Debattenkultur fördern. Damit wolle er die „Vielstimmigkeit im Konzert der Meinungen“ stärken.
Eine Demokratie, auf die „wir stolz sein können“ Den Festakt schloss Daniela Schwarzer ab, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Sie resümierte, dass Sandu und Otto Beispiele dafür seien, dass die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, angegangen werden könnten. Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass Deutschland und Europa ein Demokratie-Modell hätten, „auf das wir stolz sein können“. Die Aufgabe sei nun, „für die eigenen Werte die Stimme zu erheben“. Das könne im ganz kleinen Kreis sein, ebenso wie in der Schule. „Und selbstverständlich gilt das auch in einer großen Stiftung wie der Bertelsmann Stiftung, wo das Einsetzen für die Demokratie zur Gründungsphilosophie gehört.“ Reportage mit anderen teilen
PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG
UPGRADE DEMOCRACY
Im Rahmen des Projekts „Upgrade Democracy“ suchen wir weltweit nach Initiativen, Strategien und innovativen Tools, die digitale Diskurse präventiv stärken, zur Resilienz unserer Demokratien beitragen oder Desinformation erfolgreich begegnen. Wir bauen Brücken zwischen internationalen Akteur:innen und suchen nach Lösungen, die unser digitales Informationsökosystem langfristig stärken. Das Team hat im September zentrale Handlungsempfehlungen aus einer weltweiten Recherche in einem „10-Ideen-Papier“ veröffentlicht.
www.upgradedemocracy.de
„Zeit zu handeln: Desinformation begegnen, um Demokratie zu stärken“
„Diese
Ehrung bestärkt alle Menschen in Moldau in ihrer Anstrengung für die Demokratie und dafür, dass unser Land Teil der freien Welt bleibt.“


Maia Sandu ist seit Ende 2020 Präsidentin der Republik Moldau und wurde im November 2024 eindrucksvoll für eine zweite Amtszeit bestätigt. Als erste Frau an der Staatsspitze steht sie für Erneuerung, demokratische Werte und eine klare proeuropäische Ausrichtung. Trotz externer Einflussversuche stärkt sie konsequent Moldaus Weg in Richtung EU – ein Kurs, den die Bevölkerung 2024 in einem Referendum bekräftigte.
presedinte.md/eng
Stern | Für Ihre Verdienste um die Verteidigung der Demokratie werden Sie mit dem Reinhard Mohn Preis der Bertelsmann Stiftung geehrt. Welche Bedeutung hat die Auszeichnung für Sie?
maia sandu | Diese Ehrung bestärkt alle Menschen in Moldau in ihrer Anstrengung für die Demokratie und dafür, dass unser Land Teil der freien Welt bleibt. Eine solche Ermutigung von anderen, die an die Demokratie glauben, tut uns sehr gut.
Seit 2022 ist die Republik Moldau EU-Beitrittskandidat. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg nach Europa ist die Korruption im Land. Woran liegt das?
Russland versucht ständig, sich bei uns einzumischen. Wir haben das zuletzt bei den Präsidentschaftswahlen und dem EU-Referendum im vergangenen Jahr gesehen. Es ist eine ziemliche Herausforderung, all das Geld zurückzuverfolgen, mit dem Russland versucht hat, Medien und politische Parteien in Moldau zu finanzieren und Wählerstimmen zu kaufen.
Mit dem Referendum wurde das Ziel des EU-Beitritts in Moldaus Verfassung verankert. Das wäre um ein Haar gescheitert. Nur 50,4 Prozent der Wähler stimmten dafür. Warum fiel das Ergebnis so knapp aus?
Die aggressive Anti-EU-Propaganda aus Russland hat die Ängste der Menschen geschürt. Besonders die Angst, der Krieg in der Ukraine könnte sich auf Moldau ausweiten, wenn wir sie weiter unterstützen und Russlands Aggression kritisieren.
Den Ausschlag beim Referendum wie bei Ihrer Wiederwahl zwei Wochen später gaben die Stimmen Ihrer Landsleute im Ausland. Jeder dritte Staatsbürger Moldaus lebt und arbeitet in der EU.
Diese Menschen wissen aus eigener Erfahrung, wie es in der EU aussieht. Und sie tragen diese Eindrücke in unsere Gesellschaft. Fast jede Familie bei uns hat Verwandte in einem oder mehreren EU-Ländern. Sie wissen, welche Chance die Demokratie für uns ist. Und sie wissen auch, dass die EU ein Friedensprojekt ist. Frieden ist für die Menschen in Moldau in diesen Tagen ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Werden die vielen jungen Leute, die ins Ausland gegangen sind, je wieder nach Moldau zurückkehren?
Unsere Diaspora ist mit dem Land eng verbunden. Bei Wahlen nehmen diese Menschen Hunderte Kilometer Anreise und stundenlanges Schlangestehen in Kauf, um in den Wahllokalen im Ausland ihre Stimme abzugeben. Aber wir brauchen eine kritische Masse an Verbesserungen, damit viele dieser Bürger eines Tages zurückkehren – bei Bildung, bei der Gesundheitsversorgung und vor allem im Bereich der Justiz. Daran arbeiten wir hart.
Sie wollen Moldau bis 2030 in die EU führen. Wie viel Sorge macht Ihnen der Aufstieg populistischer, EU-feindlicher Parteien in vielen Staaten der Union?
Die Demokratie ist überall in Gefahr. Umso mehr müssen wir uns anstrengen, sie zu stärken und zu bewahren. Moldau wird dazu einen kleinen Beitrag leisten. Ich glaube an eine starke EU.
Interview aus unserem Podcast „Zukunft gestalten“ Kai Uwe Oesterhelweg
change | Warum ist die Verbindung von unternehmerischem Erfolg und gesellschaftlicher Verantwortung heute besonders wichtig?
michael otto | Die Wirtschaft ist ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft und trägt eine große Verantwortung. Unternehmen sollten ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft reflektieren und aktiv zu ihrem Erhalt beitragen. Das beginnt bereits in der Liefer- und Produktionskette: Umweltverträglichkeit, Sozialstandards und Klimaschutz sind entscheidend. Letztlich ist die Wirtschaft für die Menschen da, nicht umgekehrt. Daher müssen Unternehmen sich auch gesellschaftlich und demokratisch engagieren.
Wie haben Sie den Festakt des Reinhard Mohn Preises 2025 erlebt, und was bedeutet die Auszeichnung für Sie?
Die Veranstaltung war sehr würdevoll. Besonders beeindruckend fand ich die Reden, insbesondere die der moldauischen Präsidentin, die sich trotz Widerständen für Demokratie und Europa eingesetzt hat. Ihre Entschlossenheit ist inspirierend. Die Auszeichnung ehrt mich besonders, da ich weiß, wie sehr sich meine Familie für diese Werte engagiert hat.
In Ihrer Rede betonten Sie die Bedeutung von Vielfalt. Warum ist sie heute so wichtig?
Vielfalt ist essenziell für eine lebendige Demokratie. Sie setzt Toleranz gegenüber anderen Meinungen voraus und erfordert Dialogräume, in denen Menschen einander zuhören und verstehen. Demokratie funktioniert nur, wenn wir uns austauschen – nicht um andere Meinungen zu übernehmen, sondern um sie nachvollziehen zu können. Genau das fördere ich auch mit meiner Stiftung.
Wann haben Sie erkannt, dass Unternehmen eine größere gesellschaftliche Verantwortung tragen? Gab es einen Schlüsselmoment?
1972 mit dem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome. Mein Freund Eduard Pestel war
Mitbegründer, und wir diskutierten intensiv darüber. Mir war schnell klar: Es reicht nicht, Bewusstsein zu schaffen – man muss handeln. 1986 erklärte ich nachhaltiges Wirtschaften zum Unternehmensziel und begann, die gesamte Produktionskette umweltfreundlicher zu gestalten. Man kann negative Auswirkungen reduzieren, auch wenn vollständige Nachhaltigkeit herausfordernd ist.
War dieser nachhaltige Ansatz ein wirtschaftliches Risiko? Ja, zu Beginn gab es Skepsis – auch intern. Manche Mitarbeitende sahen es als zusätzliche Bürde. Doch nachhaltiges Wirtschaften ist ein Prozess. Heute wissen wir, dass es langfristig nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Neben Ihrem Unternehmen haben Sie mehrere Stiftungen gegründet. Sehen Sie bereits eine Wirkung?
Jedes Engagement kann etwas bewirken. Ein Beispiel ist unsere Initiative für afrikanische Kleinbäuer:innen im Baumwollanbau. Seit über 20 Jahren schulen wir sie in nachhaltigen Techniken, um Erträge zu steigern und Umweltstandards einzuhalten. Solche Projekte zeigen, dass man durch gezieltes Handeln positive Veränderungen erzielen kann.
Welchen Rat würden Sie der jungen Generation geben? Sucht euch einen Beruf, der euch begeistert. Engagement und Durchhaltevermögen sind entscheidend. Scheut euch nicht vor Fehlern – sie gehören zum Lernen dazu. Mut zur Selbstständigkeit ist ebenfalls wichtig. Wer scheitert, kann immer wieder aufstehen. Interview mit anderen teilen
Zukunft gestalten – Der Podcast der Bertelsmann Stiftung: „Unternehmer Michael Otto bekommt den Reinhard Mohn Preis – Man kann was bewegen!“

„Vielfalt ist essenziell für eine lebendige Demokratie. Sie setzt Toleranz gegenüber anderen Meinungen voraus und erfordert Dialogräume, in denen Menschen einander zuhören und verstehen.“

Michael Otto, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Otto Group und heutiger Aufsichtsratschef, gilt als Vorreiter unternehmerischer Verantwortung. Früh engagierte sich der Hamburger Unternehmer für Klima-, Sozial- und Bildungsprojekte und gründete mehrere Stiftungen, darunter die Umweltstiftung Michael Otto. Mit seiner 2023 ins Leben gerufenen Stiftung für Nachhaltigkeit setzt er sich eindrucksvoll für Demokratie, Nachhaltigkeit und eine offene Gesellschaft ein.
www.michael-otto.info

Mathe, Englisch, Deutsch und elf weitere Fächer gehören klassisch zur Abiturvorbereitung. Doch ist das alles, was Schüler:innen für ihre Zukunft brauchen? Martin Fugmann, Schulleiter des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums (ESG) in Gütersloh, meint: Nein! Neben den fachlichen Inhalten konzentriert sich sein Kollegium darauf, überfachliche Kompetenzen, sogenannte Future Skills, zu vermitteln. So möchte er die Schüler:innen bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereiten. Ein Schulbesuch.
GÜTERSLOH, DEUTSCHLAND

Beim Glockenklingeln geht’s hinein: Das ist auch am ESG noch genau so wie vor 20 Jahren. Doch was hinter den Türen gelehrt wird, unterscheidet sich. Hier arbeiten die Schüler:innen an eigenen Projekten, um unter anderem Selbstständigkeit zu lernen.
Als Lehrer ist es schwierig, allen Schüler:innen gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken, erklärt Hendrik Haverkamp im grünen Hoodie. Seine Klasse nutzt jetzt KI-Feedback ergänzend zu seinem. „Das Tool zeigt mir dann, wer noch mehr persönliche Hilfe benötigt.“
Ein abgedunkelter Raum im Evangelisch Stiftischen Gymnasium (ESG) Gütersloh. Ein Junge liegt auf dem Boden, das Gesicht von Angst verzerrt. Hinter ihm ein provisorischer Greenscreen, unter ihm ein großes Stück grüner Filzstoff. Ein anderer Junge steht daneben, einen großen Tacker in der Hand – keine Waffe, sondern Werkzeug für die heutige Mission. „Arm höher!“, ruft ein Dritter, den Blick konzentriert auf ein Standbild aus „Die Tribute von Panem“ auf seinem Handy gerichtet. „Und du schaust verschreckt!“ Eine Szene aus dem Blockbuster soll hier, im Filmraum der Schule, nachgestellt werden. Die Schüler:innen der 9. Klasse schlüpfen in der dritten Schulstunde an einem Freitag in die Rollen von Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Kameraleuten.
Doch was hat das Nachstellen einer Filmszene mit der Vorbereitung aufs Abitur zu tun? Auf den ersten Blick wenig. Und doch ist genau das der Ansatz, den das ESG in Gütersloh verfolgt: Schüler:innen nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit überfachlichen Kompetenzen auszustatten – Fähigkeiten, die in einer zunehmend digitalisierten, globalisierten und sich ständig wandelnden Arbeitswelt immer wichtiger werden.
Millionen von Stellenanzeigen weisen den Weg Der „Jobmonitor“ der Bertelsmann Stiftung, der regelmäßig Millionen von Stellenanzeigen analysiert, bestätigt diesen Trend. Er zeigt: Begriffe wie Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein – allesamt überfachliche Kompetenzen – tauchen immer häufiger in Stellenausschreibungen auf.
Doch wie lassen sich diese sogenannten Future Skills – Fähigkeiten, die über das reine Fachwissen hinausgehen und uns helfen, in der stark von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA) beeinflussten Welt zurechtzukommen – überhaupt vermitteln? Und wie bereitet man junge Menschen auf eine Zukunft vor, die sich so rasant verändert, dass viele der Berufe, die sie einmal ergreifen werden, heute noch gar nicht existieren?
Einer, der sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, ist Dr. Martin Noack, Senior Expert für betriebliche
Bildung und Weiterbildung bei der Bertelsmann Stiftung. Er spricht von einem grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt, getrieben durch Digitalisierung, Globalisierung und demografischen Wandel. „Fachkompetenzen allein reichen nicht mehr aus“, betont er.
Noack war an der Entwicklung von ESCO beteiligt, der Kompetenz- und Berufs-Taxonomie der EUKommission, die unter anderem 95 überfachliche Kompetenzen umfasst. Zusammen mit Kollegin Larissa Klemme, Project Managerin für Future Skills am Arbeitsmarkt, hat er in der Studie „Kompetenzen für morgen“ auf Basis von ESCO und einer Analyse der Future-Skills-Literatur 19 Future Skills auf deren Nachfrage am Arbeitsmarkt untersucht. „Team fähigkeit, Einsatzbereitschaft und Selbstständigkeit sind besonders stark nachgefragt – und sie gewinnen weiter an Bedeutung“, so Noack. Er betont: „Aber auch Einfühlungsvermögen, Eigeninitiative und Problemlösefähigkeit sind Kompetenzen, die dynamisch wachsen. Im Jobmonitor analysieren wir monatlich Hunderttausende Stellenausschreibungen deutschlandweit und erkennen deutlich, welche Kompetenzen an Bedeutung gewinnen.“
„Im Jobmonitor analysieren wir, welche Kompetenzen an Bedeutung gewinnen.“
Neue Fächer für die Kompetenzen von morgen Doch wie setzt eine Schule wie das ESG diese Erkenntnisse konkret um? Das Gütersloher Gymnasium baut dafür einerseits auf innovative Unterrichtsmethoden und andererseits auf eine Kombination aus traditionellen und neuen Fächern. Neben den klassischen, für das Abitur relevanten Fächern gibt es spezielle Wahlpflichtfächer wie „Wirtschaft, Medien und Kultur“ (WMK) und MINT-Kurse, die gezielt überfachliche Kompetenzen fördern. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit für Schüler:innen der 10. Klasse, Schülerfirmen zu konzipieren und zu präsentieren. Doch auch in den traditionellen Fächern wird Wert auf die Vermittlung von Future Skills gelegt, wie wir später sehen werden.


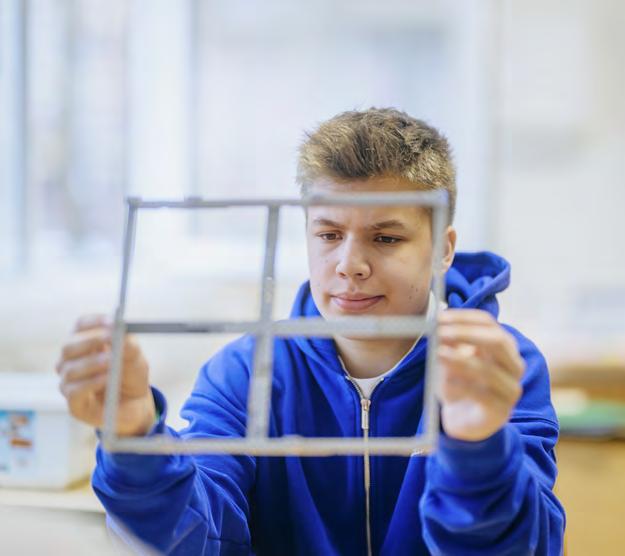

VERANSTALTUNG DER BERTELSMANN STIFTUNG
„Mit Bildung der Zeit voraus“ war das Motto des Future Skills Summits der Bertelsmann Stiftung unter Mitwirkung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung, der am 11. und 12. März 2025 in Berlin stattfand, in Kooperation verschiedener Bildungsbereiche von der frühkindlichen Bildung, über die schulische und nachschulische bis hin zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ziel der Veranstaltung und der zukünftigen Zusammenarbeit ist es, Bildung so zu gestalten, dass Menschen Future Skills nachhaltig und lebenslang lernen und sie in unsicheren Zeiten fit für die Zukunft werden.
www.future-skills-summit.de
Bildung und Next Generation
„ Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Selbstständigkeit sind besonders stark nachgefragt –und sie gewinnen weiter an Bedeutung.“
DR. MARTIN NOACK



Hier ist Scheitern erwünscht: Die Schülerinnen Paulina Peitz (l.) und Anni Dönnecke (r.) bauen eigenständig einen Roboter –ohne vorher je mit Logo-Technik gearbeitet zu haben. „Da bleibt uns nur, viel auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert. Wenn es nicht klappt, versuchen wir es nochmal. So lange, bis es klappt“, erzählt Anni.
Im Informatikkurs, ein paar Räume weiter, liegen bunte Legosteine verstreut auf dem Tisch vor Anni und Paulina. Dazwischen Kabel, Sensoren und kleine Motoren. Neben ihnen steht ein noch etwas wackeliger Prototyp aus Pappe – ihr selbst gebauter Süßigkeitenautomat, dem sie sogar schon einen Namen gegeben haben: „Candy Quests“.
„Wir müssen den Greifarm so programmieren, dass er vorfährt, die Süßigkeit richtig packt und dann zurückfährt“, erklärt Anni, konzentriert Lego-Elemente zusammensetzend. Paulina nickt. „Das ist kniffliger, als es aussieht. Wir haben schon verschiedene Mechanismen ausprobiert, aber irgendwas hakt immer.“ Sie deutet auf einen Ordner neben dem Laptop. „Hier haben wir alles dokumentiert: unsere Ideen, die Baupläne, die Programmiercodes – und unseren Zeitplan.“
Der Zeitdruck ist spürbar. In wenigen Wochen sollen sie ihren Automaten präsentieren. Nicht nur Mitschüler:innen, sondern auch potenzielle Arbeitgeber:innen aus der Region sind eingeladen, Feedback zu geben. „Der Zeitplan ist schon eine Herausforderung“, gibt Anni zu. „Wir müssen uns selbst organisieren, die Aufgaben aufteilen, Prioritäten setzen und immer wieder überprüfen, ob wir im Zeitplan liegen.“ Paulina fügt hinzu: „Und wenn etwas nicht klappt,
dürfen wir nicht aufgeben, eine Lösung zu finden. Manchmal ist das frustrierend, aber am Ende lernt man dadurch viel mehr, als wenn alles glattläuft.
Außerdem ist es unser ganz eigenes Projekt, nicht das von den Lehrer:innen.“
Es ist diese Verbindung von technischem Know-how, Kreativität, Eigenverantwortung und Durchhaltevermögen, die hier, im Kleinen, für die Herausforderungen der großen, weiten Arbeitswelt rüsten soll.
„Durch Fehler lernen wir oft viel mehr, als wenn alles glattläuft.“
Zwischen Schulglocke und digitaler Tafel Ein „Ding-Dang-Dong“ durchbricht die konzentrierte Stille – ein Geräusch, das seit Jahrzehnten unverändert die Schulflure des ESG füllt und fast ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt. Schüler:innen strömen in einen Klassenraum, in dem Deutschunterricht bei Hendrik Haverkamp auf dem Stundenplan steht. „Guten Mooooorgen, Herr Haverkamp“, schallt es im Chor – eine Begrüßung, die, wie das Aufstehen der Schüler:innen, noch der alten Schule entspricht. Ein Ritual, das in starkem Kontrast zu dem steht, was

jetzt folgt. Denn kaum sitzen die Jugendlichen, werden Stühle gerückt und Laptops in Position gebracht. Statt einer klassischen Kreidetafel dominiert ein großes digitales Board die Stirnseite des Raumes und kündigt an: Hier weht ein anderer Wind.
Haverkamp, der heute Besuch von einem Hamburger Lehrer hat, der sich über das digitale Lernkonzept und die Abkehr von traditionellen Lehrmethoden bei den Gütersloher Kolleg:innen informieren möchte, erklärt: „Das ESG hat sich schon 1999 auf den Weg gemacht, alle Schüler:innen mit digitalen Endgeräten auszustatten.“ Ein Laptop-Beirat stellt sicher, dass den Schüler:innen immer die passende Technik zur Verfügung steht.
Moritz, der vorne links sitzt, berichtet, dass die Schüler:innen ab der 5. Klasse iPads bekommen und ab der 7. Klasse eigene Laptops anschaffen. Sein Sitznachbar Luis ergänzt, dass KI hier schon vor ChatGPT im Unterricht eingesetzt wurde, besonders im Deutschunterricht, wo Klausuren oft in Word geschrieben und KI-generierte Texte überarbeitet werden. Und Carla fügt noch hinzu, dass auch für Recherchen und das Zusammenfassen langer Texte häufig KI genutzt wird, wobei manche Lehrer:innen explizit sagen, wenn sie nicht benutzt werden soll. Doch die Technik, so betont Lehrer Haverkamp, sei nur Mittel zum Zweck. „Es geht uns vor allem darum, die Future Skills zu fördern“, erklärt er weiter und
verweist auf die Arbeit von Dr. Martin Noack und die auf diese Weise identifizierten 95 überfachlichen Kompetenzen. Die Schule, die von einer Stiftung getragen wird, hat aus diesen 95 Kompetenzen vier ausgewählt. Die Lehrer:innen nennen sie die vier Ks: Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Es ist ein Spagat zwischen Tradition und Moderne – zwischen Glocke und Algorithmus, zwischen Aufstehen und Einloggen.
Schüler befähigen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen
Auch alternative Prüfungsformate sind ein großes Thema. Die Schüler:innen berichten von Projektarbeiten, Präsentationen und Videos. „Zusammenarbeit in Prüfungssituationen ist eigentlich als Täuschungshandlung ausgewiesen, aber wir versuchen, Prüfungen anders zu organisieren“, erklärt Haverkamp und nennt als Beispiel eine Gruppenarbeit während einer Klausur oder eine benotete Präsentation.
Die innovative Ausrichtung des ESG ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren Vision, wie Schulleiter Martin Fugmann im Gespräch betont. „Wir wollen unsere Schüler:innen nicht nur mit Wissen versorgen, sondern sie zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und kreativen Menschen erziehen“, erklärt er. „Es geht darum, junge Menschen zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und die

Luis freut sich über neue Lernansätze, die die Kollaboration fördern. Es werden zum Beispiel zunehmend auch Präsentationen und Projektarbeiten benotet. Und während der letzten Englischklausur durften die Schüler:innen sich für zehn Minuten in einem Nebenraum ohne Schreibutensilien zur gestellten Aufgabe austauschen.

„ Zukunft mitgestalten braucht mehr als gute Noten – es braucht Persönlichkeit, Engagement und den Mut, neue Wege zu gehen.“
MARTIN FUGMANN

Future Skills werden immer häufiger am Arbeitsmarkt nachgefragt: Anteil an Jobanzeigen 2023 in Prozent.
jobmonitor.de
Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft
Planungsfähigkeit
Selbstständigkeit
Einsatzbereitschaft
kritisches Denken
Teamfähigkeit
Kundenorientierung
kreatives Denken
Verantwortungsbewusstsein
Anpassungsfähigkeit
Probleme lösen

Mathe, Deutsch und jetzt auch noch Future Skills? Auf die Frage, ob man die Schüler:innen nicht überfordere, hat Schulleiter Martin Fugmann eine klare Antwort: „Wenn Neugierde, Motivation und Verantwortungsbereitschaft fehlen, wird auch die Mathe-Aufgabe nicht gelingen.“
Zukunft mitzugestalten. Dafür braucht es mehr als nur gute Noten – es braucht Persönlichkeit, Engagement und den Mut, neue Wege zu gehen.“
Die größte Herausforderung, so Fugmann, sei es, diese Vision im Schulalltag zu verankern. „Das erfordert einen Kulturwandel, der Zeit braucht“, sagt er. „Wir müssen die Lehrer:innen fortbilden, die Eltern mit ins Boot holen und die Schüler:innen für neue Lernformen begeistern.“ Auch die Finanzierung sei ein Thema. Der Schulleiter betont die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Schulen, Politik und Wirtschaft.
Auf die Frage, wie die Schule der Zukunft aussieht, hat Fugmann eine klare Antwort: „Sie ist digital, personalisiert und projektorientiert. Sie ist ein Ort, an dem Schüler:innen ihre individuellen Talente entfalten können, an dem sie lernen, selbstständig zu denken und zu handeln, und an dem sie sich auf eine Zukunft vorbereiten, die wir heute erst in Ansätzen erahnen können. Und sie ist vor allem eins: ein Ort, an dem mit Freude gelernt wird.“
Doch der Einsatz von Robotern, Kamera-Equipment und künstlicher Intelligenz im Klassenzimmer wirft auch Fragen auf. „Es ist ein Lernprozess für uns alle“, räumt Haverkamp ein. „Wir müssen gemeinsam mit den Schüler:innen herausfinden, wie wir diese Hilfsmittel sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen können.“
„Genau diese Fragen treiben uns um“, bestätigt Yvonne Bansmann, die Lehrerin des WMK-Kurses, in dem die Schüler:innen die Szene aus „Die Tribute von Panem“ nachspielten. „Wir wollen den Jugendlichen nicht nur zeigen, was technologisch möglich ist, sondern sie auch dazu anregen, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unser Leben und unsere Gesellschaft hat.“
Ohne Neugierde und Motivation bleibt kein Fachwissen hängen
Doch bevor die Vermittlung der Future Skills Teil des Unterrichts wurden, stand die Frage im Raum: „Welche überfachlichen Kompetenzen möchten wir hier am ESG vermitteln?“ Bansmann berichtet von einem intensiven Diskussionsprozess im Kollegium. „Wir
hatten erst zehn Future Skills, doch das waren zu viele“, sagt sie und lacht. „Das hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir uns auf bestimmte Felder geeinigt und versuchen, diese umzusetzen.“ Die Schwierigkeit liege nun darin, diese Kompetenzen sichtbar und messbar zu machen. Als Beispiel nennt sie einen Prüfungsbogen für Englisch, der gemeinsam mit den Schüler:innen entwickelt wurde.
Schulleiter Fugmanns Überzeugung ist: „Fachwissen kann nur dann verarbeitet werden, wenn die anderen Kompetenzen da sind. Ohne Neugierde, Motivation und Verantwortungsbereitschaft scheitert man.“
Dieser Wandel sei ein echter „Change-Prozess“, so Fugmann – nicht nur im Kopf der Schulleitung, sondern im gesamten Kollegium.
Mit einem Blick auf den Jobmonitor unterstreicht Fugmann seine Aussage. Die Frage sei, inwieweit sich der schulische Fächerkanon in den nächsten Jahren anpasst. „Die Einteilung der Welt in 14 Fächer ist nicht mehr hilfreich. Wir müssen interdisziplinär denken und bedeutungsvolle Lernerfahrungen schaffen.“ Doch jetzt müssten sie erst einmal mit dem arbeiten, was das Land Nordrhein-Westfalen vorgibt.
„Die Einteilung der Welt in 14 Fächer ist nicht mehr hilfreich.“
Zwei Etagen über Fugmanns Büro verlassen die Schüler:innen das provisorische Filmstudio. Im nahe gelegenen Klassenraum präsentieren sie Yvonne Bansmann ihr nachgestelltes Standbild. Die Lehrerin betrachtet es kritisch. „Na, der Arm, der die Waffe hält, ist aber zu weit unten, das passt nicht ganz“, bemerkt sie. Die Jungs schauen sich das Bild noch einmal genau an. Einer sagt zum anderen: „Na, ich sagte doch …!“ Ein anderer erwidert: „Komm, egal, lass es uns noch mal versuchen!“ Mit neuem Elan machen sie sich daran, das Standbild zu perfektionieren – ganz im Sinne der Kritikfähigkeit und Beharrlichkeit, die sie hier, am ESG, nicht nur theoretisch lernen, sondern auch ganz praktisch leben. Reportage mit anderen teilen
Dr. Brigitte Mohn Besim Mazhiqi

DR. BRIGITTE MOHN
Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung
Brigitte Mohn promovierte nach ihrem Studium und absolvierte ein MBA-Studium an der WHU Koblenz und am Kellogg Institute in den USA. Sie ist Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Seit 2005 gehört sie dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung an.
Brigitte Mohn
change | Frau Mohn, viele Studien zeigen, dass junge Menschen zunehmend unter psychischen Herausforderungen leiden. Warum ist gerade diese Zielgruppe so stark betroffen?
dr . brigitte mohn | Junge Menschen stehen heute vor besonderen Herausforderungen, die bis vor wenigen Jahren in diesem Ausmaß nicht existiert haben. Es sind vor allem politische, umweltbedingte, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen, die einen enormen Einfluss ausüben, Ängste schüren und Unsicherheiten hervorrufen über das Jetzt und Morgen. Die Pandemie hat starke Spuren bei den jungen Menschen hinterlassen, und die aktuellen geopolitischen Spannungen, die Angst vorm Krieg und zudem vor den Folgen des Klimawandels, berühren die jungen Menschen.
Hinzu kommen die massive Beeinflussung durch die sozialen Medien und der gefühlte Anspruch einer scheinbar notwendigen ständigen Verfügbarkeit sowie durch die hohe Medienpräsenz eine damit einhergehende gleichzeitige Vereinsamung. Junge Menschen unterliegen durch die sozialen Medien einem Idealisierungsdruck, dem „Perfekt-sein-sollen“.
Für die Bertelsmann Stiftung ist das Thema „Vereinsamung junger Menschen“ deshalb so zentral, weil die mentale Gesundheit junger Menschen untrennbar mit einer stabilen und zukunftsfähigen Gesellschaft verbunden ist. Studien zeigen, dass Einsamkeit beispielsweise die Demokratieeinstellung beeinflusst. Wer sich isoliert fühlt, glaubt häufiger an Verschwörung serzählungen oder entwickelt extremistische Tendenzen. Es geht hierbei also nicht nur um individuelles Wohlbefinden, sondern auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stabilität unserer Demokratie.
Sie sagen, dass die mentale Gesundheit junger Menschen eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, und dennoch fehlt es an Therapieplätzen, Strukturen und einer unterstützenden Finanzierung für Hilfsstrukturen. Was sehen Sie hier als die größten Baustellen, und was kann getan werden?
Es gibt mehrere Ebenen, auf denen wir ansetzen müssen. Der Mangel an Therapieplätzen ist ein drängendes Problem – nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Junge Menschen, die sich in einer psychischen Krise befinden, können oft monatelang keine professionelle Hilfe bekommen. Diese Wartezeit ist für viele eine Qual und verschlimmert die Situation häufig. Wir müssen dringend in den Ausbau
von Kapazitäten investieren und Behandlungsangebote flächendeckend ausbauen. Besonders wichtig wäre es, den Zugang niedrigschwelliger zu gestalten, etwa durch schulbasierte Beratungsstellen oder digitale Angebote, die Jugendliche direkt in ihrer Lebenswelt abholen.
Es fehlt auch eine strukturelle Jugendbeteiligung. Oft werden Präventions- und Hilfsangebote „von oben herab“ entwickelt, ohne diejenigen zu konsultieren, die sie am Ende nutzen sollen: die Jugend selbst. Das führt häufig dazu, dass die Maßnahmen von den Betroffenen nicht angenommen werden oder an ihren Bedürfnissen vorbeigehen. Deshalb fordern wir eine stärkere Einbindung von Jugendlichen –beispielsweise durch Jugendbeiräte, die politische Prozesse aktiv mitgestalten können.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Stigmatisierung. Noch immer werden psychische Erkrankungen bei jungen Menschen oft nicht ernst genug genommen. Viele haben Angst davor, abgestempelt zu werden, und ziehen sich zurück, anstatt Hilfe zu suchen. Hier brauchen wir flächendeckende Aufklärung, sowohl in den Schulen als auch in der breiten Gesellschaft.
„Wir müssen junge Menschen schützen und ihnen Plattformen bieten, auf denen sie ernst genommen werden.“
Zum Abschluss: Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn es um die mentale Gesundheit junger Menschen geht? Jeder junge Mensch hat das Recht, in einer beschützenden und unterstützenden Umgebung aufzuwachsen. Psychische Erkrankungen dürfen weder stigmatisiert noch ignoriert werden, und hier brauchen wir unbedingt einen Kulturwandel, in dem es selbstverständlich ist, Hilfe zu ersuchen und sie zu erhalten, wenn man sie braucht. Ohne monatelange Wartezeiten, ohne Scham.
Wir brauchen mehr Empathie für junge Menschen in unserer Gesellschaft. Sie sind „unsere“ Kinder, „wir“ haben sie in die Welt gesetzt und sind entsprechend für ihr Wohlergehen verantwortlich. Es liegt in unserer unmittelbaren gemeinsamen Verantwortung, sie zu schützen und ihnen auch Plattformen zu bieten, wo sie gehört und ernst genommen werden.
In unruhigen Zeiten sehnen wir uns nach Sicherheit, Orientierung und Vertrauen. Gerade dann wächst das Bedürfnis nach stabilen Beziehungen, denn die Resilienzforschung zeigt: Gute zwischenmenschliche Beziehungen sind der Schlüssel, um stürmische Zeiten zu überstehen. Und der Kern dieser Beziehungen? Vertrauen.
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt: Wann vertraue ich anderen? Und wann fällt es mir schwer? Für unsichere Menschen, die nicht wissen, wo ihr Vertrauen klug investiert ist, gibt es eine gute Nachricht: Die Forschung hat Merkmale identifiziert, die uns helfen, vertrauenswürdige Menschen zu erkennen.
Wie Vertrauen wachsen kann
Unsere Entscheidung für oder gegen Vertrauen basiert meist unbewusst auf drei Fragen: Hat die Person die nötigen Fähigkeiten, um ein Problem zu lösen? Meint die Person es gut mit mir? Und die dritte Frage: Hält die Person ihre Versprechen? Können wir alle drei Fragen mit Ja beantworten, vertrauen wir.
Ist die Antwort „Vielleicht“ oder „Nein“, wird es schwieriger. Besonders Vertrauensbrüche bei der Integrität verzeihen wir seltener als solche, die auf fehlender Kompetenz beruhen. Fehler durch mangelnde Erfahrung können wir leichter entschuldigen als schlechte Absichten.

Eva Schulte-Austum ist Business-Coach, Vortragsrednerin und „Vertrauensexpertin“. Die studierte Wirtschaftspsychologin berät Unternehmen zu den Themen Führung, Change und New Work. Sie hilft ihnen, eine Vertrauenskultur zu etablieren, in der Mitarbeitende motiviert sind, gerne arbeiten, freiwillig Verantwortung übernehmen und Veränderungen aktiv gestalten. www.eva-schulte-austum.de


„Wir können nicht kontrollieren, was passiert, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren.“
EVA SCHULTE-AUSTUM

Beziehungen funktionieren immer in beide Richtungen. Es geht nicht nur darum, anderen zu vertrauen, sondern auch darum, Vertrauen zu gewinnen.
Grundsätzlich gilt dabei: Wer vertraut, bekommt Vertrauen zurück. Dass Sie jemandem vertrauen, können Sie zeigen, indem Sie einen Vertrauensvorschuss gewähren und zum Beispiel in Vorleistung gehen. Außerdem: Wenn Sie etwas tun, tun Sie es glaubwürdig. Halten Sie also Zusagen ein und nehmen Sie sich Bedenkzeit, wenn Sie nicht sicher sind. Und mein persönlicher Lieblingstipp: Übertreffen Sie die Erwartungen. Wenn Sie mehr tun, als von Ihnen erwartet wird, gewinnen Sie Vertrauen.
Misstrauen schützt uns nicht vor Enttäuschung An dieser Stelle möchte ich mit einem Irrtum aufräumen: dem Mythos, dass Misstrauen vor schlechten Erfahrungen schützt. In Deutschland entwerfen wir oft Worst-Case-Szenarien aus Angst vor Enttäuschung oder Betrug. Doch die Forschung zeigt: Worauf wir uns konzentrieren, wird wahrscheinlicher – das ist der sogenannte Golem-Effekt. Erwarten wir Enttäuschung oder Verrat, ziehen wir diese Erlebnisse oft unbewusst an.
Die gute Nachricht: Es gibt auch den PygmalionEffekt. Gehen wir davon aus, dass uns andere wertschätzend begegnen, steigen die Chancen auf positive Erfahrungen.
Ein Fitnessstudio für den Vertrauensmuskel
Um meinen Fokus auf das Positive zu lenken, habe ich ein Ritual: mein Dankbarkeitsglas. Jeden Abend schreibe ich eine Sache auf einen Zettel, für die ich dankbar bin, und lege ihn ins Glas. Das können Kleinigkeiten sein, wie ein Cappuccino in der Sonne, oder größere Erlebnisse, wie ein gutes Gespräch mit einer Freundin. Anfangs mag es ungewohnt sein, diese Dinge aufzuschreiben. Doch mit der Zeit schärft es den Blick für positive Momente – nicht nur abends, sondern auch im Alltag.
Fakt ist: Wir können nicht kontrollieren, was passiert, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren. Stürmische Zeiten lassen sich leichter überstehen, wenn Herz und Hirn voller schöner Erinnerungen sind. Dann fällt es auch leichter zu vertrauen – uns selbst, unseren Mitmenschen und dem Leben. Essay mit anderen teilen
Was haben ein Metal-Musiker aus Ostwestfalen und eine Abiturientin aus Brandenburg gemeinsam? Johnny (links) und Lisa (rechts) werden laut für die Demokratie.
Demokratie braucht Menschen, die sich einbringen, jenseits von Wahlen. Ein Jugendprojekt aus Brandenburg und das Engagement einer ostwestfälischen Metal-Band zeigen, wie das gelingen kann – auch dort, wo nicht vermutet.

März 2025 sonnig, 9 °C
einbringen, auch Brandenburg Metal-Band man es

GRÜNHEIDE UND BIELEFELD, DEUTSCHLAND



Flagge zeigen: Lisa Manns Laptop zeigt linke Statements gegen den Rechtsruck im brandenburgischen Seen-Idyll (oben). Mario, Johnny und Felix von Soulbound nutzen ihre Reichweite, um sich zu positionieren: „Musik ist unser Sprachrohr.“
Wo liegt die Mitte der Gesellschaft? Hier zum Beispiel: rechts der See, links der Skatepark, mittendrin eine hell getünchte, etwas in die Jahre gekommene Villa. Darin der größte Jugendclub von Grünheide, südöstlich von Berlin. Frühlingsluft zieht durch die Fenster im Erdgeschoss, wo sich eine Planungsrunde trifft. Auf der Tagesordnung: die nächsten Wahlen zum Kinder- und Jugendbeirat.
Sprecherin Lisa Mann klappt ihren Laptop auf, dessen Deckel mit Stickern beklebt ist: „Bock auf Brandenburg“, „Your voice can change the world“ – „Deine Stimme kann die Welt verändern“. Gerade einmal 18 Jahre alt ist sie und führt durch die Sitzung, als hätte sie nie etwas anderes getan: Wer bestellt die Merchandise-Artikel für den Wahltag, wie viele vegane Hotdogs brauchen wir? Bei jedem abgehakten Punkt nickt sie zufrieden, ihre Korkenzieherlocken wippen im Takt, und sie sagt: „Traum!“
400 Kilometer weiter westlich, an der Ausfallstraße von Bielefeld nach Herford. Die Metal-Band „Soulbound“ hat einen Raum im ersten Stock eines Firmengebäudes zum Studio ausgebaut, zwischen Baumarkt, Eros-Center und Fast-Food-Ketten. Equipment und Kabeltrommeln stehen herum, Keyboard und Computerbildschirme in der Mitte, gegenüber ein Ledersofa. Drei der fünf Bandmitglieder basteln an ihrem neuen Album: Sänger Johnny, Gitarrist Felix und Schlagzeuger Mario. Ihre Nachnamen möchten sie lieber aus der Presse heraushalten. Sie sind zwischen Anfang 30 und Mitte 40, verdienen ihr Geld in bürgerlichen Berufen, als Therapeut, als Techniker, doch sie sehen genau so aus, wie man sich Metal-Musiker vorstellt: mit schwarzen Klamotten, Nietengürteln und Tattoos.
„Wir sind nicht besonders links, die Gesellschaft ist nach rechts gerückt“ Ländliches Idyll in Brandenburg hier, Großstadt in Nordrhein-Westfalen dort – zwei Welten, doch sie haben etwas gemeinsam. Mit ihrer Stimme die Welt verändern, das wollen – wie der Kinder- und Jugendbeirat – auch die Mitglieder von Soulbound.
Bei jedem Auftritt machen sie eine Ansage für Toleranz, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung. Seit 16 Jahren gehört das zu ihrer Show. In letzter Zeit gibt das manchmal Ärger. Einzelne im Publikum protestieren lautstark. Oder sie drehen sich bei den Worten mit dem Rücken zur Bühne, manchmal in einer geschlossenen Reihe. Eine irritierende Erfahrung. „Wir verstehen uns nicht als politische Band“, sagt Sänger und Bandgründer Johnny, „Menschenrechte und Minderheitenschutz gehören ja zu den Grundlagen der Demokratie, bilden den Rahmen. Aber wenn die Gesellschaft insgesamt nach rechts rückt, wirkt unsere Mitte-Position plötzlich links.“
Ihre Ansage machen sie immer vor demselben Song, der drastische Titel lässt sich auch als Antwort an die sich dagegenstellenden Konzertbesucher:innen verstehen. Er heißt „Fuck you“.
„Menschenrechte und Minderheitenschutz gehören ja zu den Grundlagen der Demokratie, bilden den Rahmen.“
JUNGE MENSCHEN UND GESELLSCHAFT – NACHHALTIG. DIGITAL. ENGAGIERT.
Die Bertelsmann Stiftung setzt sich im Projekt „Junge Menschen und Gesellschaft“ mit dem gesellschaftlichen Engagement junger Menschen auseinander und fördert die Selbstbestimmung der Next Generation. Der Fokus liegt darauf, junge Menschen zu empowern und zu inspirieren, sich noch stärker als bisher für eine nachhaltige Gesellschaft zu engagieren.
PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG www.gennow.de/gesellschaft
GenNow/Politik
Gemeinsam für Grünheide: Der Jugendclub im Ortsteil Kagel (links) entstand auf Initiative des Jugendbeirats. Zwei Sozialarbeiter (im grünen Hoodie) unterstützen die ehrenamtliche Arbeit.
Die Harmonie in der Brandenburger 10.000-SeelenGemeinde Grünheide, zwischen Kanuclub, Waldsiedlung und schickem Neubau, hat ebenfalls ihre Risse. Zwischen der Bundestagswahl 2021 und 2025 hat die AfD dort ihre Wahlergebnisse verdoppelt, von 15 auf 32 Prozent. Bei der U-18-Wahl, einer Art Probelauf für alle, die auf Bundesebene noch nicht mitentscheiden dürfen, kamen die Blauen sogar auf 35 Prozent im Durchschnitt des Bundeslandes. Auch im Jugendbeirat prallen unterschiedliche Weltanschauungen und Positionen aufeinander: etwa zur benachbarten Gigafactory des Tech-Riesen Tesla: Was zählt mehr, neue Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft oder die mögliche Umweltbelastung durch den Wasserverbrauch des Industriegiganten?
Rechtsaußen sei aber keines der Mitglieder, sagt Lisa. Es werde oft hart in der Sache verhandelt, aber immer respektvoll. Im Alltag, auf Dorffesten, da ist das auch mal anders. Manchmal, wenn sich jemand antidemokratisch äußert, sucht sie das Gespräch: „Warum denkst du so, woher kommt das?“ Trifft sie auf ein Gegenüber mit Null-Bock-Haltung, wirbt sie oft für das eigene Gremium: „Wenn jemand glaubt, dass die Politik sich nicht für seine Anliegen interessiert, dann sage ich: ‚Doch, ich zeig dir, wie das geht, du musst es nur wollen.‘“
„Wenn jemand glaubt, dass die Politik sich nicht für seine
Anliegen interessiert, dann sage ich: ‚Doch, ich zeig dir, wie das geht, du musst es nur wollen.‘“


„Ich hatte schon immer Bock, Dinge zu gestalten – auch als Kind“
Eine Gesellschaft braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und Orte, an denen sie diese Verbundenheit erleben. Einen gemeinsamen Anker finden, auch über Differenzen hinweg. Sei es beim Metal-Konzert, sei es bei der „Jugendnacht“ auf dem Grünheider Heimatfest mit Party und DJ, im Sportverein, in politischen Gremien. „Ich hatte schon in




der Grundschule Bock, Dinge zu gestalten“, sagt Lisa. Engagement liegt in der Familie, ihr Vater, Dachdecker- und Tischlermeister, sitzt als sogenannter „Sachkundiger Einwohner“ mit im Bauausschuss und berät bei Entscheidungen. Demokrat:innen werden nicht geboren, sie werden gemacht.
Nur knapp jede:r fünfte 16- bis 30-Jährige glaubt, dass es einen Unterschied macht, ob er/sie sich für ein Thema einsetzt.
Allerdings: Das Vertrauen in die eigenen Einflussmöglichkeiten ist gedämpft, gerade bei den Jüngeren. Deutschlandweit glaubt nur knapp jede:r fünfte 16- bis 30-Jährige, dass es einen Unterschied macht, wenn sie oder er sich für ein Thema einsetzt. 40 Prozent glauben, keinen Einfluss zu haben, so eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Und obwohl eine Mehrheit die Demokratie grundsätzlich für eine gute Sache hält, ist das Misstrauen gegenüber den Institutionen groß. In den ostdeutschen Bundesländern mehr als in den westdeutschen. All das setzt die demokratische Mitte unter Druck.
40 %
glauben, sie hätten keinen Einfluss.
Beteiligungsformate können das Vertrauen stärken –aber dazu braucht es Prozesse und Klarheit. Was kann ein solches Gremium wirklich entscheiden, wo hat es nur Vorschlagsrecht? Erst gefragt und dann doch nicht gehört werden, das produziert am Ende Misstrauen und Frust. Und kann als Nährboden wirken für Radikalisierung. Wo ein Vakuum entsteht, besetzen auch radikale Stimmen diese Räume. Offline wie online.
Das wichtigste Thema? Endlich eine Dönerbude In Grünheide wollen sie es besser machen. Seit 2019 regelt ein eigener Paragraf in der Brandenburger Landesverfassung die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die Gemeinden sind zur Umsetzung verpflichtet. Eine, die diesen Prozess von Anfang an begleitet hat, ist Anne-Kathrin Rochow, heute Amtsleiterin für Soziales, Bildung und Kultur in Grünheide. Sie erinnert sich gut an das Auftakttreffen: rund 50 Kinder und Jugendliche, darunter auch Lisa Mann, damals gerade 13. „Top-Thema war: Grünheide braucht eine Dönerbude.“ Die lässt sich allerdings kaum per Amtsentscheid beschließen, das mussten einige der jungen Teilnehmer:innen erst einmal verstehen. Was geht: Zum Beispiel Wunschlisten für
einen neu gestalteten Spielplatz malen und schreiben, mit dem Bauamt sprechen, Kataloge wälzen und ausrechnen, was zum Budget passt. Eine Lektion in Selbstwirksamkeit.
„Ich brauche das Gefühl, dass die Verwaltung uns ernst nimmt.
Ohne Hauptamt funktioniert Ehrenamt nicht.“
Heute gibt es in jedem der sechs Ortsteile einen eigenen Jugendbeirat. Kommunale Sozialarbeiter:innen unterstützen die Jugendlichen dabei, sich zu organisieren. Einmal pro Quartal sitzen die jeweiligen Sprecher:innen mit in der Ausschusssitzung für Soziales, Kultur und Sport im Rathaus am zentralen Marktplatz, haben aber auch einen direkten Draht zu ihren Ansprechpartner:innen. „Ich brauche das Gefühl, dass die Verwaltung uns ernst nimmt“, sagt Lisa. „Ohne Hauptamt funktioniert Ehrenamt nicht.“
„Es ist ein großes Glück, wenn Jugendliche gerne hierbleiben wollen“
Was ihr Engagement bringt, das haben die Teenager jeden Tag vor Augen: neben Spielplatz und Skate-
park auch neue Treffpunkte in den Ortsteilen. Einen davon in Lisas Ortsteil Kagel, ein Jugendclub in einer ehemaligen Scheune zwischen Kirche und Feuerwehr. Mit Billardtisch, Kicker, Chill-out-Zone im ersten Stock und einem Gärtchen. Ein besonderer Moment für Lisa: „Seitdem ich 18 bin, habe ich meinen eigenen Schlüssel.“ Ganz schön viel Verantwortung für eine junge Frau, die gerade ihr Fachabitur macht und sich nebenbei auch noch im brandenburgischen Dachverband für Kinder- und Jugendbeteiligung engagiert. Die über Verbandsstrukturen und Satzungen ebenso professionell plaudern kann wie über Straßenbeleuchtung, Zuständigkeiten für Fahrradwege und öffentliche Mülleimer.
Berufsziel Bundeskanzlerin? Eher nein: „Ich möchte lieber im sozialen Bereich arbeiten und mich ehrenamtlich kommunalpolitisch engagieren.“ Amtsleiterin Anne-Kathrin Rochow sagt: „Es ist ein großes Glück, dass viele Jugendliche sich vorstellen können, hierzubleiben und sich auch weiter einzubringen. Wir unterstützen diese Zugehörigkeit, indem wir Angebote für alle Generationen schaffen, vom Familienzentrum über den Jugendclub bis zu Projekten gegen Alterseinsamkeit.“
PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG
Um die Teilhabe junger Menschen an demokratischen Prozessen zu stärken, nutzt das Projekt „Junge Menschen und Demokratie“ der Bertelsmann Stiftung zwei Hebel. Es adressiert die Zugangsvoraussetzungen für das Engagement junger Menschen in den Freiwilligendiensten und setzt sich für eine bundesweite Einführung des Wählens ab 16 ein.
Engagement junger Menschen für Demokratie www.bertelsmann-stiftung.de/jugendcommunity
Zukunft gestalten – Der Podcast der Bertelsmann Stiftung: „Junge Menschen und Demokratie – ein Blick auf das Jahr 2024“
„Wenn wir durch unsere Ansagen Fans verlieren, nehmen wir das in Kauf“ Zurück nach Bielefeld. Soulbound-Sänger Johnny glaubt: Dass der Gegenwind rauer wird, das hat auch mit ihrem gewachsenen Radius zu tun. „Wir haben uns lange in einer komfortablen Bubble bewegt, mit einem Publikum und anderen Musiker:innen, bei denen wir mit unseren Statements auf der Bühne offene Türen eingerannt haben.“ Jetzt, da die Zuhörer:innenschaft wächst, die Band landesweit auf Tour geht, zeigt sich: Das ist nur ein Teil von Deutschland. Und manchmal kommt Protest aus einer Ecke, aus der man ihn gar nicht erwartet. „Ausgerechnet beim Konzert in Hamburg gab es ein paar Störer, das hätten wir dort nicht vermutet“, sagt Johnny. Insgesamt seien Diskussionen nach Konzerten in Ostdeutschland aber häufiger. „Einige werfen uns vor, dass wir uns überhaupt politisch positionieren. Oder finden, wir würden die Opfer von islamistischen Anschlägen verhöhnen, wenn wir uns für Toleranz gegenüber Menschen mit nicht deutscher Herkunft aussprechen.“
Auf Social Media macht die Band ähnliche Erfahrungen. „Ich empfinde es als großes Privileg, dass wir
„Freizeit und Mobilität sind die Top-Themen für junge Leute in Grünheide“, sagt Amtsleiterin Anne-Kathrin Rochow. Johnny diskutiert nicht nur bei Konzerten über Politik, auch online per Twitch und Discord.
als Künstler dieses Sprachrohr haben. Dass wir dort auch die eigenen Sorgen um die Demokratie artikulieren können. Wenn wir dadurch auch einige Fans verlieren, nehmen wir das in Kauf“, erklärt Johnny. Dafür rücken die enger zusammen, die den Eindruck haben: Jetzt geht es wirklich um etwas.
Dass er mit Worten Menschen zurückholen kann, die nach rechts gedriftet sind, darüber macht sich Johnny keine Illusionen: „Ich kann niemanden bekehren. Aber anderen helfen, stabil zu bleiben.“ Für andere und für sich selbst. „Mir hat mal ein schwuler Fan erzählt, dass unsere Musik und unsere Ansagen ihm geholfen haben, sich zu outen“, erzählt Schlagzeuger Mario. Eine schöne Bestätigung. Deshalb tritt die Band bewusst auch dort auf, wo es unbequem werden könnte. Zum Beispiel bei einem Festival in Südtirol mit der Band „Frei.Wild“ als Headliner. Frei.Wild sind umstritten, werden von manchen als Rechtsrock-Band eingestuft.
Als Soulbound auf der Bühne für Toleranz und Menschenrechte warben, endete auch das überraschend: kaum Protest, viel Applaus.
„Ich kann niemanden bekehren. Aber anderen helfen, stabil zu bleiben.“
Kultur- und Freizeitorte, an denen ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dienen eben auch als Realitycheck – mit ungewissem Ausgang. Ein Musikfestival genau wie ein Handballverein, ein Jugendclub – oder eine Dönerbude. Denn die hat Grünheide mittlerweile, ganz ohne den Jugendbeirat. Sie steht auf dem Supermarktparkplatz hinter dem Skatepark, auf Google wird sie mit 4,1 von 5 Sternen bewertet. Manche loben die knusprigen Pommes, anderen ist das Rotkraut zu sauer. Man kann es nicht allen recht machen. So ist das eben in der Mitte der Gesellschaft. Reportage mit anderen teilen





„Als Musiker haben wir das Privileg, dass wir eine Bühne haben, um für unsere Werte einzustehen“: Für den Sommer sind Konzerte und Festivals geplant, 2026 erscheint das nächste Studio-Album von Soulbound.
Kulturorte für junge Menschen attraktiv machen – das hilft auch dem sozialen Zusammenhalt. Denn Musik, Theater und Co sind Resonanzräume für Gefühle, Gedanken und Debatten. Drei Ideen, wie es gehen kann:

Breaking Into Contemporary Opera: What You’re Missing
Vancouver Opera: Bei Hochkultur brauchen Jugendliche manchmal jemanden, die oder der sie an die Hand nimmt. Zum Beispiel der coole Tenor Spencer Britten: In einem dreiminütigen Video auf YouTube erklärt er, warum Opernstoffe – zeitgenössische wie traditionelle –so viel mit der eigenen Gefühlswelt zu tun haben.


BrechtBot – frag’ Brecht
Staatstheater Augsburg: Zum jüngsten Brechtfestival machte es ein eigener Chatbot möglich, Augsburgs berühmtestem Dichter Fragen zu stellen – auch knapp 70 Jahre nach seinem Tod. Nicht nur auf Deutsch, sondern auch beispielsweise auf Türkisch.

Musikfestival in Jamel: Seit 2007 lädt das unerschrockene Paar Birgit und Horst Lohmeyer jährlich zu einem Musikfestival in das von Neonazis geprägte Dorf Jamel bei Wismar ein. Das Line-up bei diesem musikalischen Akt des demokratischen Widerstands ist in jedem Jahr geheim – und immer wieder sind die Überraschungs-Acts so bekannt wie Kraftclub, Herbert Grönemeyer und Die Toten Hosen. Jamel rockt den Förster
Die Bundestagswahl hat nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland neu geordnet. Aus dem Ergebnis und den begleitenden Prozessen lassen sich wertvolle Lehren ziehen – über Umbrüche im Parteiensystem, neue Kanäle der politischen Kommunikation, Polarisierung innerhalb und zwischen Wählergruppen sowie sich wandelnde politische Normen.
Eine zentrale Erkenntnis dieser Wahl: Die Kluft zwischen Jung und Alt wächst. Während junge Menschen bevorzugt die Linke und AfD wählten, lag die Union bei den über 60- und 70-Jährigen klar vorn. Diese Unterschiede sind erwartbar, werden jedoch angesichts der Demografie immer problematischer: 2025 waren 42 Prozent der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt, nur 13 Prozent unter 30 – ein Ungleichgewicht mit Auswirkungen auf die politische Agenda.
Polarisierung zeigt sich aber auch innerhalb der jungen Generation. Der Stimmenanteil der AfD war bei jungen Männern 13 Prozentpunkte höher als bei Frauen. Die Linke wiederum war bei jungen Frauen um 19 Prozentpunkte stärker als bei Männern. Beides bestätigt die These des „Modern Gender Gap“, nach der Frauen zunehmend progressiv und Männer immer konservativer wählen, was sich auf die gesellschaftliche Kompromissfindung auswirkt.
Jenseits der Geschlechterunterschiede zeigt sich zudem: Die politische Mitte verliert in der Altersgruppe 18-24 massiv. 2021 kamen Union, SPD, Grüne und FDP hier noch auf 69 Prozent – 2025 sind es nur noch 42 Prozent. AfD, Linke und BSW hingegen erhielten mehr als die Hälfte der Stimmen.


Doch der Vertrauensverlust in die Mitteparteien reicht über die junge Generation hinaus. Die Ampelkoalition büßte in den Mittemilieus rund 30 Prozentpunkte ein, die Union konnte davon jedoch nur 5 Prozentpunkte für sich gewinnen. Sie selbst verlor knapp eine Million Stimmen an die AfD, die FDP 890.000 und die SPD 720.000. Die Grünen büßten 700.000 Stimmen zugunsten der Linken ein.
„Die hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass viele Menschen weiterhin bereit sind, unsere Demokratie mitzugestalten.“
Für ein Bündnis aus CDU und SPD reichte es entsprechend nur knapp. Hätte das BSW die Fünf-Prozent-Hürde genommen, wäre ein dritter Partner nötig gewesen. Umso schwerer wiegt, dass die Ampel kein Vorbild für stabile Mehrparteienbündnisse lieferte, sondern eher deren Schwierigkeiten offenlegte. Dabei könnten genau solche Bündnisse künftig zur Regel werden.
Gravierender noch als die Schwächung der Mitte zeigt das Wahlergebnis eine tiefgreifende Verschiebung politischer Normen: Mit fast 21 Prozent der Stimmen hat die AfD sich verdoppelt und wird als zweitstärkste Kraft künftig eine größere Rolle im Parlament spielen – etwa als erste Antwortrednerin auf Regierungserklärungen.
Für viele Menschen ist die Wahl der AfD längst kein Tabubruch mehr. Die Partei, die sich zurzeit in einem Rechtsstreit mit dem Verfassungsschutz über die zwischenzeitliche Einstufung als „gesichert rechtsextrem“ befindet, bekommt Zustimmung von den Wähler:innen. Damit gerät der Versuch der politischen Mitte, die Partei zu isolieren, unter Druck – auch wenn auf nationaler Ebene weiterhin eine Mehrheit der Wähler:innen sowie alle anderen Parteien im Bundestag an dieser Abgrenzung festhalten.
Ein zentraler Aspekt in der Debatte um den Aufstieg der AfD ist die Bedeutung sozialer Medien. Bereits bei den ostdeutschen Landtagswahlen zeigte sich die Wirkungsmacht der App TikTok, über die die AfD Erstwähler:innen mit durchschnittlich neun Videos pro Woche erreichte. In der Altersgruppe 18–24 wurde sie bei allen drei Wahlen stärkste Kraft – ein Ergebnis, das sich nicht allein durch TikTok erklären lässt, aber unterstreicht: Für viele junge Menschen ist Social Media die wichtigste Informationsquelle.
Auch im Bundestagswahlkampf bespielten diesmal alle Parteien TikTok – im Schnitt mit 1,54 Videos pro
Tag. Besonders erfolgreich waren Die Linke und die AfD. Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek verdoppelte ihre Followerschaft binnen weniger Tage, nachdem sie mit einer Bundestagsrede zur Verteidigung der Brandmauer viral ging. Ihre Partei wurde mit 25 Prozent stärkste Kraft unter den 18- bis 24-Jährigen, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent. Aber auch die Parteien der politischen Mitte erzielten Erfolge – so kamen fünf der zehn meistgesehenen TikTok-Videos von der SPD.
So intensiv der Wahlkampf online geführt wurde, so hoch war auch die Beteiligung analog: Mit 82,5 Prozent erreichte sie den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Das zeigt, dass viele Menschen weiterhin bereit sind, unsere Demokratie mitzugestalten. Mit Robert Habeck und Christian Lindner haben zudem führende Politiker Konsequenzen aus dem Wahlergebnis gezogen und den Weg für Erneuerung und einen möglichen Generationenwechsel freigemacht – ein Ausdruck einer politischen Kultur, die Verantwortung ernst nimmt und Wandel ermöglicht.
PROF. DR. DANIELA SCHWARZER
Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung
Daniela Schwarzer ist eine führende Expertin für europäische und internationale Angelegenheiten und blickt auf eine 20-jährige Karriere bei renommierten Think-Tanks, Stiftungen und Universitäten zurück. Seit Mai 2023 gehört sie dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung an. Zuvor war sie als Executive Director für Europa und Zentralasien bei den Open Society Foundations tätig.
@D_Schwarzer

In der Aufbereitungsanlage des schwäbischen Spezialisten Feeß inspizieren Optocycle- Gründer Max Gerken und Manager Eberhard Fritz ein Gemisch aus Ziegel- und Betonbruch.
Gero Günther Enno Kapitza Februar 2025 sonnig, 4 °C

Wenn KI und Robotik zielgerichtet eingesetzt werden, können sie einen bedeutenden Beitrag beim Recyceln der gigantischen Ströme von Verpackungs- oder Baustoffen leisten. Voraussetzungen dafür: eine enge Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den beteiligten Branchen und die Bereitschaft, im Zeichen des Fortschritts auch dahin zu gehen, wo es schmutzig ist und stinkt.
AALEN, DEUTSCHLAND


Der Inhalt von Abertausenden Gelben Säcken landet jeden Tag in der Sortieranlage des schwäbischen Familienunternehmens Hörger in Sontheim. Die getrennten Plastikstoffe werden in großen Bündeln verpackt. Jedes viele Tonnen schwer.

Über steile Metalltreppen geht es hinauf in die oberen Stockwerke der Sortieranlage, zwischen Förderbändern, Schächten und Röhren hindurch. Kreuz und quer schießt der Abfall vorbei. Zwischen 70 und 80 Tonnen sind es hier bei dem Entsorgungsunternehmen Hörger im schwäbischen Sontheim jeden Tag. Plastik aus den Gelben Säcken, Plastik in allen Farben und Formen. Zerquetscht, zerrissen, zusammengeknüllt. Überall hängen Planen und Folien, die sich verheddert haben, alles ist mit knallbunten Partikeln übersät. Ein dreckiger Dschungel aus Verpackungsmaterial.
In diesen begeben sich heute einige Wissenschaftler:innen, die am Forschungsprojekt „Recyclebot“ an der Hochschule Aalen mitarbeiten und genau wissen, dass es keinen Sinn macht, die Sortierung von Recyclingstoffen unter Laborbedingungen zu studieren. Wer die Abfallwirtschaft verstehen und optimieren will, darf keine Angst haben, sich schmutzig zu machen. Dementsprechend ist die kleine Gruppe komplett mit Arbeitsschuhen und Schutzbekleidung ausgestattet.

Durchgerutscht, aber nicht verloren Ohrenbetäubender Lärm erfüllt die Halle. Die Robotik-Spezialistin Nicole Fangerow und der Materialforscher Lorenz Walter sowie ihr Begleiter Martin Siekiera, Prokurist bei Hörger, müssen einander anschreien, um sich verständlich zu machen. Was die Besucher:innen besonders interessiert, liegt ganz oben, am Ende der Treppe. Hier läuft das übers Band, was im Gelben Sack nichts zu suchen hat. Sogenannte Fehlwürfe, beispielsweise Spielzeuge und Windeln oder „gelegentlich sogar mal eine ganze Forelle“, wie Siekiera schmunzelnd bemerkt. Aber auch Verpackungen, die durchgerutscht, also der Sortierung mittels Trommeln, Magneten, Nahinfrarotkameras und Druckluft entgangen sind.
Was hier ankommt, ist immer noch eine Menge Müll. Wobei – das Erste, was man lernt, wenn man mit der Abfallwirtschaft zu tun hat, ist, dass es nicht Müll heißt. Schon gar nicht das, was im Gelben Sack und später einer Sortieranlage landet. Die Fachleute sprechen von Wertstoffen, Stoffströmen und Recyclaten. Schließlich ist die Wirtschaft in Deutschland per Gesetz dazu verpflichtet, ihre Verpackungen zurückzunehmen und der Verwertung zuzuführen. Denn Kunststoffe drohen in absehbarer Zeit knapp zu werden. Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, dass es derzeit meist noch billiger ist, eine Verpackung aus Rohöl herzustellen, als eine alte zu recyceln.
Ein Job, um den sich keiner reißt
Nicole Fangerow steht am Förderband und filmt mit dem Handy, was an ihr vorüberzieht. Zusammen mit Lorenz Walter befragt sie die beiden Arbeiter, die hier händisch nachsortieren. Allzu viel Zeit haben sie nicht für diese Tätigkeit, schließlich ist es nur eine der vielen Aufgaben der beiden Männer, zum Beispiel Kanister und Heliumflaschen aus dem Strom herauszufischen. „In Zukunft könnte ein Roboterarm diesen Job rund um die Uhr übernehmen“, sagt Fangerow, die sich in ihrer Masterarbeit intensiv mit Greiftechniken beschäftigt hat. „Die Herausforderung“, erklärt sie, „besteht darin, dass die betreffenden Objekte so unterschiedlich aussehen.“ Denn Verpackungen gibt es in Tausenden von Varianten, ganz abgesehen davon, dass sie oft verformt und schmutzig sind. „Aber der Roboter soll ja zum Beispiel auch die mit Shampoo verschmierte Plastikflasche erwischen“, erläutert Fangerow ihren Anspruch.
„Die Handsortierung ist kein Job, um den sich die Leute reißen“, sagt Martin Siekiera. „Heutzutage ist es fast unmöglich, Personal für solche Tätigkeiten zu finden.“ Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist aber nur einer der Gründe, warum sich sein Unternehmen an dem Forschungsprojekt beteiligt. Eine optimierte Trennung der Verpackungsmaterialien sei, so Siekiera, nicht nur wirtschaftlich interessant, sondern komme als Teil der Kreislaufwirtschaft auch der Umwelt zugute.
Genau an diesem Punkt setzten die Aalener Professorinnen Doris Aschenbrenner und Iman Taha an, als sie das Projekt „Recyclebot“ vor zwei Jahren ins Leben riefen, das als KI-Leuchtturmprojekt vom Bundesumweltministerium (BMUV) gefördert wird. Wie, fragten sie sich, könnte die Ausbeute an sortenreinem Plastik erhöht werden? Was könnte KI dazu beitragen? Wie rentabel wäre so eine Hightech-Anlage für die Unternehmen? Und wie würde sich diese optimierte Sortierung auf die CO2-Bilanzierung auswirken? Für ihr Vorhaben holten die beiden Professorinnen neben Studierenden an der Hochschule Aalen und der Firma Hörger noch weitere Unternehmen mit einer speziellen Expertise ins Boot, etwa den mittelständischen Spezialmaschinenbauer HOLZER, GreenDelta,
PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG
INNOVATIONS- UND GRÜNDUNGSDYNAMIK
Unser Projekt entwickelt forschungsbasierte Konzepte und praxisorientierte Lösungen. Im Fokus stehen wirksame Innovationspolitiken, die Innovationsdynamik im Mittelstand, inklusive Gründungen und die Stärkung des Impact-Gründungsökosystems. Wir wollen mit dem Projekt einen Beitrag dazu leisten, dass sich in Deutschland eine neue Innovationsdynamik entfaltet, die auch die Nachhaltigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft voranbringt.
www.bertelsmann-stiftung.de/innovation
www.fosteringinnovation.de
ein Consultant-Büro für Nachhaltigkeit, und das Start-up-Unternehmen WeSort.AI aus Würzburg.
Sortierung auf einem anderen Level Die Versuchsanlage von WeSort.AI ist in einer kahlen Lagerhalle am Stadtrand aufgebaut. Johannes Laier, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Nathanael gegründet hat, kippt Abfall auf ein Fließband. Sobald die Verpackungen unter einem mit unterschiedlichster Sensorik bestückten Analysegerät hindurchgefahren sind, erscheinen die Objekte auf dem Computerbildschirm: Tetrapak, PET-Flasche, Aludose. „Die Sensorik“, sagt Laier, „erfasst verschiedene Differenzierungsmerkmale wie Farbe, Kontur und Materialzusammensetzung, und unsere KI identifiziert aufgrund dieser Eigenschaften, um welches Objekt es sich handelt.“ Die riesigen Datensätze, die dafür nötig sind, hat WeSort.AI im Lauf der vergangenen Jahre selbst aufgebaut. „Wenn neue Verpackungen im Müll landen und unter unseren Geräten hindurchfahren“, erklärt der junge Mann mit den dunklen Locken, „werden sie erfasst, und dann gehen die Daten in die Cloud und werden in unsere KI eintrainiert.“ „Abfallsortierung auf einem anderen Level“ nennen die Gründer das auf ihrer Website.
Über das Müllthema sind Johannes und Nathanael Laier „zufällig gestolpert“, doch ihr Interesse für Ökologie und Nachhaltigkeit war schon lange vorher da. „Wir wollten uns engagieren und haben uns entschieden, das in Form einer Unternehmensgründung zu tun“, erklärt Johannes Laier. Das Besondere an ihrer Abfallsortierung ist, dass nicht nur wertvolle Stoffe, sondern auch gefährliche Batterien zielgenau aus dem Strom gefiltert werden können. Unter anderem auch deshalb ist WeSort.AI auf Erfolgskurs: 2024 wurde die Firma mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet.
„Wir wollten uns engagieren und haben uns entschieden, das in Form einer Unternehmensgründung zu tun.“
Die Professorinnen Iman Taha und Doris Aschenbrenner (remote dazugeschaltet) der Hochschule Aalen im Interview zum Projekt „Recyclebot“.

In der Versuchsanlage von WeSort.Al in Würzburg werden Plastikverpackungen über eine permanent dazulernende KI genau identifiziert. Die von Gründer Johannes Laier mitentwickelte Sensorik hat auch bei verschmutzten und verformten Objekten keine Probleme.


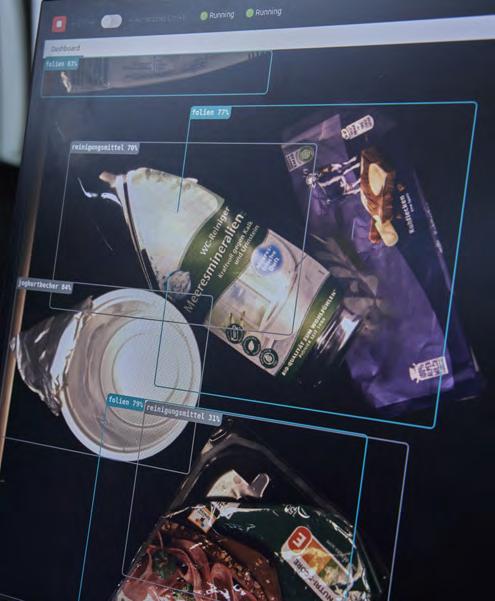
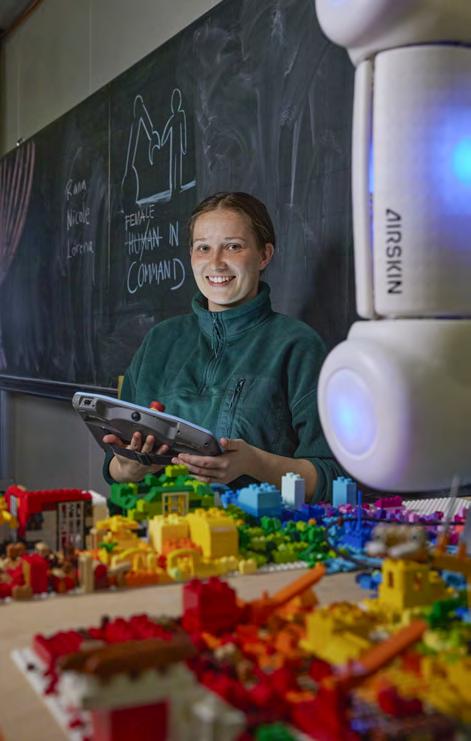
Nicole Fangerow, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Aalen im Labor der „Human in Command“Arbeitsgruppe. Dort werden verschiedene Greifertypen (groß im Bild ein Vakuumgreifer) für den Roboterarm getestet, der in Zukunft die sortenreine Sortierung von Plastik optimieren soll.
Erfolg durch enge Zusammenarbeit
Die Geräte von WeSort.AI sind das Herzstück des Aalener „Recyclebots“. Und für Doris Aschenbrenner, Professorin für „Digitale Methoden in der Produktion“, sind sie ein typisches Beispiel für eine „überraschende Anwendung von KI, die einen großen Hebel haben kann“. Weit entfernt von den hochkomplexen Modellen, die etwa bei ChatGPT zum Einsatz kommen, könne auch und gerade mit dieser Form von relativ einfachem Machine Learning „gutes Geld verdient werden“. Vorausgesetzt, man arbeite eng mit den betreffenden Branchen zusammen, um Anwendungen zu erfinden, „die wirklich gebraucht werden“. Wer einen Roboter für die Abfallwirtschaft entwickeln will, müsse eben auch wirklich „dahin gehen, wo es stinkt“.
Sich eng mit den Anwendern und Unternehmen auszutauschen, hält Aschenbrenner für das A und O einer Entwicklung, die Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz erfolgreich zusammenbringt. „Hybrid


Intelligence“ nennt sie das. Und so steht es auch am Whiteboard ihrer „Human in Command“-Arbeitsgruppe an der Hochschule Aalen: Kollaborativ, adaptiv und verantwortungsvoll soll der Umgang mit den neuen Technologien sein. Menschzentriert.
Doch nicht nur bei Kunststoffabfällen kann optimiert werden. Ein Großteil der weltweit anfallenden Abfallmengen entsteht beim Bau. Es ist, wie sich Max Gerken, Co-Founder und CEO der Tübinger Firma Optocycle, ausdrückt, „der größte Stoffstrom des Planeten“. Allein in Deutschland fallen jährlich 230 Millionen Tonnen Bauschutt an. Und während für Altpapier beträchtliche Mengen bezahlt werden, kostet die Entsorgung von Schutt 15 bis 20 Euro pro Tonne. Immerhin: Je hochwertiger das Material ist, desto weniger muss das Abbruchunternehmen zahlen. Und desto eher lohnt es sich, ein Gebäude Schicht für Schicht abzutragen, statt mit der Abrissbirne alles kurz und klein zu schlagen. „Wenn Urban Mining, also die Weiterverwendung gebrauchter Baumateri-


Die Dimensionen der Aufbereitungsanlage aus der Luft: Mehr als 1.000 Tonnen Bauschutt werden hier in Kirchheim täglich angeliefert. Jeder Lkw passiert am Firmentor Kameras zur KI-Analyse. Recycling-Baustoffe nehmen einen immer höheren Anteil des Angebots ein.
alien, wirklich Realität werden soll“, sagt Gerken, „dann braucht man Informationen über das, was sich in den Lkw der Abrissfirmen verbirgt.“
Wann ist ein Stein ein Stein?
Und genau da kommt Gerkens Unternehmen ins Spiel. Es hat eine Kameratechnologie entwickelt, die mithilfe einer KI die Zusammensetzung des Schutts präzise bestimmen kann. „Anhand welcher Kriterien der Computer einen Stein oder Ziegel wirklich bestimmt, spielt dabei eigentlich keine Rolle“, sagt Gerken. Wichtig sei nur, dass sein System anhand von Tausenden und Abertausenden von Beispielen gelernt habe, was einen Stein ausmacht – und seine Aussagen deshalb immer verlässlicher werden. So können Beton und Ziegel, Steine und Sand voneinander unterschieden werden, und die Recycler wissen, was sie wirklich geliefert bekommen.
Zum Beispiel die Firma Feeß in Kirchheim unter Teck, ein führendes Unternehmen im Bereich des

Gebäudeabbruchs, der Altlastentsorgung und der Aufbereitung von Baustoffen. Gigantische Mengen Bauschutt werden in der riesigen Aufbereitungsanlage sortiert, gesiebt, gewaschen und gebrochen. Ganze Berge an recycelten Stoffen liegen auf dem Gelände parat. Gleisschotter, Kies, Kunstrasengranulate, Beton- und Baustoffsplitt in verschiedenen Qualitätsstufen. Für seine Verdienste um den Recyclingbeton wurde das Familienunternehmen mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.
„Wir wollen das, was auf unseren Hof kommt, bestmöglich verwerten.“
EBERHARD FRITZ
Alle paar Minuten steht ein Lkw auf der Waage am Eingangstor. Mehr als 1.000 Tonnen Material werden angeliefert. Tag für Tag. Und seit ein paar Monaten
wird jeder Truck, der hier hält, automatisch von der unscheinbaren Optocycle-Kamera erfasst. „Wir wollen das, was auf unseren Hof kommt, bestmöglich verwerten“, sagt Eberhard Fritz, Leiter des Stoffstrom-Managements bei Feeß. „Und dabei hilft uns Optocycle durch die genaue Klassifizierung der Materialien.“ Außerdem könnte die Optocycle-Technologie in Zukunft auch bei der präzisen Abmischung der Recycling-Baustoffe weiterhelfen.
Punktgenaue Anwendungen
Über mangelndes Interesse können sich Gerken und sein Optocycle-Mitgründer Lars Wolff nicht beklagen. Das Business-Magazin „Forbes“ listete Max Gerken im November 2024 gar unter den 30 einflussreichsten deutschsprachigen Personen unter 30 Jahren auf. Inzwischen kommen die Optocycle-Kunden aus dem In- und Ausland, und das Team wird in Kürze auf 20 Mitarbeitende anwachsen. Ob das Büro am Tübinger Marktplatz dann noch groß genug ist? Hoffentlich, denn für Gerken ist die Adresse mit Blick auf das Rathaus und den 400 Jahre alten Neptunbrunnen ein Statement. Ein Bekenntnis zu Tradition und Regionalität. „Ich mag es nicht so, wenn man uns Start-up nennt“, sagt er, „ich bin an den Mittelstand angelehnt und will meine Firma eigentlich nicht irgendwann an den Höchstbietenden verhökern.“
Bodenständig, aber nicht konservativ. So sieht sich nicht nur Gerken. Immer mehr junge Firmen wollen heute statt des schnellen Erfolgs einen nachhaltigen Beitrag zur ökologischen Transformation leisten. Oder wie Johannes Laier von WeSort.AI es ausdrückt: „Neueste Technologien müssen zusammengedacht werden, um neue Probleme lösen zu können.“ Entscheidend sei es dabei gerade im KI-Bereich, Anwendungen punktgenau in die Branchen zu bringen. „Und da passiert gerade eine Menge in Deutschland.“
Und auch das zeigen kollaborative Projekte wie der „Recyclebot“: Wer künstliche Intelligenz im realen Alltags- und Wirtschaftsleben zur Anwendung bringen will, muss heraus aus den Büros und Laboren, um mit den Menschen zu sprechen. In diesem demokratischen Ansatz liegt vielleicht das größte Potenzial für eine europäische Variante des Einsatzes künstlicher
Intelligenz. Doris Aschenbrenner von der Hochschule Aalen formuliert es so: „Das volle Potenzial von Innovationen wird erst entfesselt, wenn nicht nur die Technologie, sondern vor allen Dingen deren Zusammenspiel mit Menschen und bestehenden Strukturen optimiert wird.“
Reportage mit anderen teilen
PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG
Unser Projekt unterstützt die Circular Economy durch Analysen, Kompetenzaufbau in Unternehmen und Begleitung eines Netzwerks relevanter Stakeholder. Ziel ist es, ressourcenschonendes Wirtschaften in Politik und Praxis zu stärken.
www.zukunftdernachhaltigkeit.de
Zukunft der Nachhaltigkeit – ein Podcast der Bertelsmann Stiftung: Folge 36 „Kreislaufwirtschaft in Deutschland und der EU“




„Neueste Technologien müssen zusammengedacht werden, um neue Probleme lösen zu können.“
JOHANNES LAIER
Das Büro von Optocycle liegt direkt am Marktplatz der altehrwürdigen schwäbischen Universitätsstadt Tübingen.
Über mangelnden Erfolg können sich Firmengründer
Max Gerken und Lars Wolff nicht beklagen. Optocycle expandiert kräftig.

AlleredenvonMigration.Alleredenvon Flüchtlingen. AberwieGeflüchtetein Deutschlandversuchenklarzukommen, was sie in ihrem früheren Leben zurückgelassenhaben,wiesiesich–trotzvielerRückschläge–einneues Lebenaufbauen,wissendiewenigsten. Denn
Fluchtmigration ist zurzeit ein großes Streitthema in der öffentlichen Diskussion. Einerseits wird sie für Missstände jeglicher Art verantwortlich gemacht – sei es knapper Wohnraum, fehlende Kitaplätze oder Kriminalität. Andererseits erfordert der Fach- und Arbeitskräftemangel, dass die schutzsuchenden Menschen schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden.
Mit diesem Band erweitern wir den Blick, um den Diskurs zu versachlichen, und konzentrieren uns auf die Lösungen der Probleme. Neben einer Analyse von Prof. Dietrich Thränhardt, wie es um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten steht, geht es um Good-Practice-Beispiele vor Ort, die anderen Kommunen als Anregung dienen können. Wir fragen, wie diese sich auch auf künftige Fluchtbewegungen gut vorbereiten können, und stellen dazu erste Erkenntnisse einer Studie des DESI-Instituts (für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration) vor sowie überregionale Ansätze wie die Welcome Alliance und das Aufnahmeprogramm NesT.
Der dazugehörige Fotoband porträtiert Geflüchtete mit Fotos aus ihrem Leben. Diese Reportagen von Thomas Byczkowski zeigen Menschen, die trotz vieler Hürden ihren Weg gehen und in Deutschland ihren Platz in Arbeit, Ausbildung und Studium gefunden haben.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Von Arbeit bis Zusammenleben –Wie Flüchtlingsintegration in Kommunen gelingen kann 2025, 145 Seiten, Broschur Mit separatem Fotoband
€ 18,– (D)
ISBN 978-3-86793-998-0

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Von Arbeit bis Zusammenleben – Wie Flüchtlingsintegration in Kommunen gelingen kann




Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)





















Sara Leming Erstveröffentlichung im Magazin ‚Transponder Nr. 4‘
Malta, a myriad of multiculturalism
The blue waters surrounding the Maltese archipelago run as deep as the nation’s multicultural roots. Located approximately 60 miles from the southern coast of Sicily and 186 miles from the northern coast of Libya, Malta is commonly referred to as the stepping stone between the European and African continents. While it is the smallest member of the European Union in both population and physical size, the island has an intriguing and turbulent history that has impacted its cultural identity.
The archipelago reflects a multicultural aesthetic blend of the nations that have influenced it over its 7,000-year history. Due to its position in the heart of the Mediterranean, Malta was viewed as a strategic location by colonial empires seeking to expand their military and economic powers. This led to the establishment of naval bases and trading seaports on the Maltese islands. Throughout the nation’s history, a long list of conquerors battled for control. The extensive list includes the Phoenicians, Romans, Knights of St. John, French, Arabians, Spanish, Italians, and the British. Although the archipelago gained its independence in 1964, Maltese culture remains heavily impacted through linguistics, food, art, music, religion, and even allegiance in European sporting events.
While walking around the quaint streets of Malta’s capital city, Valletta, the multicultural influence can
be spotted easily. Cars drive on the left side of the road, which was introduced while Malta was a British colony. Delicious Arabic-inspired pastries filled with almonds and spices can be purchased on every street corner. Perhaps most notably, the nation boasts no less than 359 churches, which were heavily influenced by the Roman Catholics — a legacy that lives to this day with 98% of Maltese citizens identifying as Catholic. The Maltese language itself is a prime example of this blend, belonging to the Semitic language family and made up of Arabic, French, and Italian blended together.
An intriguing identity
When asked about their cultural identity, most Maltese agree that in many ways the small nation is still developing and learning to understand its own independent character. Due to its complicated past shaped by outside influences, it can be difficult for citizens to pinpoint what makes them uniquely Maltese. One exception and commonly described attribute among the Maltese is their willingness to be assertive and to identify with a cause — which often sparks a competitive spirit across the archipelago. There is even a designated Maltese term, “pika”, which means friendly neighborhood rivalry. George Cassar, a tourism and culture professor from the University of Malta, describes pika as “the need to outdo one’s rival with an attitude that seems to say this town is not big enough for us both.”
The concept of pika can be seen during political debates between Malta’s two main political groups, the labor and nationalist parties. It is also sparked during international soccer tournaments where citizens will root for either England or Italy. During the 2020 Euro Cup final between the two nations, police were asked to stand by to provide crowd control, and stationed outside of restaurants and pubs broadcasting the game. Perhaps the best example is during the annual summer festival season where local communes compete with one another to light up the sky with the most impressive fireworks display. The celebrations often get rowdy and in 2018 a dispute among rivals even ended in court. The Times of Malta reported that the event got out of hand when a man hit another man from a neighboring town over the head with a flower pot. Another 2018 festival incident included a banner being hung on a street that separated two rival communities. The banner had a picture of the Virgin Mary and read, “Ours it the most beautiful statue. Yours is the ugliest in Malta.”
The origins of “pika” are still widely unknown; it can potentially be traced back to the country’s small geographic size or centuries of colonization with the inability to become independent, or maybe both. What is clear is the intense desire of the Maltese to associate with a cultural group and to identify with its causes. Perhaps it stems from uncertainty around what exactly Maltese identity means.
A local graphic designer and art enthusiast has found a creative way to articulate what being Maltese means to her. Lisa Gwen uses artistic elements found around the islands as a way to showcase Maltese identity.
When a door opens…
While meandering around the curved and narrow streets of Malta, one of the first things visitors will notice are the vibrant front doors. The cobblestoned streets feature a panoply of doors which gives them an inviting character. Gwen explains that a front door is an extension of one’s personality. They are generally painted bright colors such as yellow, red, and green. Some doors are ornate and personalized to match their inhabitants’ character and lifestyle traits. Their conditions vary, as some boast fresh coats of paint, while others have been abandoned to chip away over the years. Each one seems to have its own unique story.
“While the doors are unique to Malta, they feature bits and pieces of the cultures that used to rule the nation.”


On a rainy Sunday afternoon in 2017, Gwen was looking through the pictures on her phone when she realized how many of them were images of Maltese front doors she had captured while walking around. She created an Instagram account and has been documenting Malta door by door ever since. On her aesthetically curated page, @MaltaDoors, Gwen has over 23.6K followers and more than 1,900 posts documenting the unique facades. On a sunny day, Gwen enjoys winding down quaint streets and playing tourist in her own city, always ready to snap a photo. When posting pictures, she purposely leaves out the location of each door because she wants to encourage her followers to be curious and to explore the architectural delights of the country. Gwen’s artistic initiative has not only attracted the interest of travel and art enthusiasts from around the world, it has also popularized Maltese doors as a symbol of identity. While the doors are unique to Malta, they feature bits and pieces of the cultures that used to rule the nation, such as Sicilian tiles, North African style balconies, and lumber brought over from England during British rule.
In Gwen’s eyes, Malta is “door proud”. She explains that Maltese people, and humans in general, pride themselves on surface appearances. To present a facade of what we want the world to see. In Malta it is the same with doors. For example, in the past it was common for Maltese people to customize their doors to make them look similar to important government buildings in color and pattern. Another way that this Maltese tradition allows for identity to be present on one’s front door is through the association of door colors with specific professions. For instance, fishermen often paint their doors blue, as a symbol of long days spent floating on the Mediterranean Sea.
Apart from the vibrant colors, there is another unique feature on the outside of Maltese doors that holds significant meaning. A “habbata” is the Maltese term for a door knocker. While a door knocker typically serves a practical function, a habbata is multifaceted. A large and extravagant habbata signals that the people living inside the home are prosperous. The intricate design of a habbata is another signifier of identity on the archipelago. The more common styles reflect symbols of importance in Maltese culture,



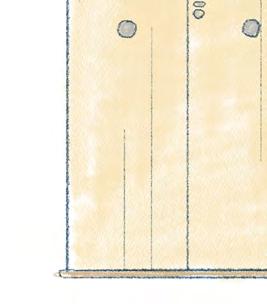




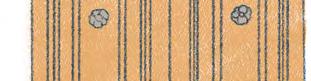



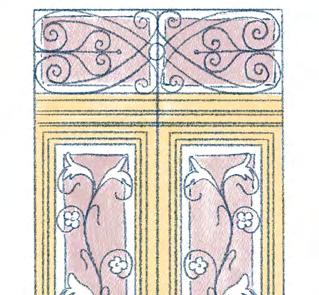

including maritime animals which are a main source of trade and income for the nation, angels which represent the importance of religion, or a lion which is associated with the protection of loved ones and the strength of the Maltese family bond.
Gwen explains that her own front door is a modernist era style door that was inspired by the famous Maltese architect Richard England. She describes it as a contrast of pinks and blues with bright pink ironwork. A mustard yellow terrazzo mosaic shines from the bottom of the door. Amid all this color, Gwen’s habbata is even more intriguing. It is made of two asymmetrical eyes with lashes that represent a traditional “luzzu”, a Maltese fishing boat. A luzzu typically has the eye of Osiris painted or carved on the bow. For Gwen, the eye provides a superstitious effect to complement her brightly colored door. Gwen’s door represents her quirky, bright, and artistic personality.
According to Gwen, the architecture of Malta is quickly changing. With European investments coming to the island — especially in the IT sector — and special permits being offered to entrepreneurs, the population is steadily increasing. As of 2023, Malta’s population is at an all time high of 535,000 people. High-rises are quickly being constructed to accommodate new residents and businesses. Gwen agrees that the European Union has brought many economic opportunities to Malta, such as the construction of new roads, an uptick of tourism, and opportunities for start-up businesses. However, she highlights that the construction has bulldozed homes with historic doors that many consider the cultural jewel of the small nation. While the Instagram account primarily serves as an artistic outlet, posting doors is Gwen’s way of showing people the need to preserve Malta’s unique beauty. It is Gwen’s hope that the national government of Malta will take action to protect the beloved doors.
Like the country, the doors have been created with British, Arabian, and Sicilian characteristics. Together, the Sicilian tiles, North African balconies, and large British door frames — mixed with Malta’s bright colors and ornate designs — create something new.
They are symbolic of Malta’s unique historic and cultural blend and have come to represent the country as a whole, in a way that can be admired and celebrated by locals and visitors alike. One thing is clear, over time Malta’s identity will continue to grow, with its doors as a robust symbol of its cultural evolution.
“Some doors are ornate and personalized to match their inhabitants’ character and lifestyle traits. Each one seems to have its own unique story.”
06/2023

www.bfna.org
„Turning the Key to Maltese Identity“ wurde zuerst im Magazin „Transponder“ der Bertelsmann Foundation North America (BFNA) veröffentlicht.
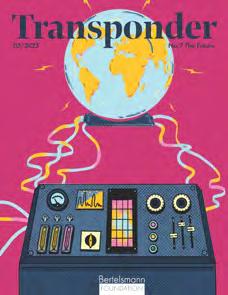
Die BFNA ist ein unabhängiger, unparteiischer und gemeinnütziger Think-Tank in Washington, D. C., der sich mit transatlantischen Perspektiven auf globale Herausforderungen beschäftigt. Sie wurde 2008 als Schwesterstiftung der Bertelsmann Stiftung gegründet. Als Brücke zwischen Europa und Amerika zeigt sie Best-Practice-Beispiele aus der Außen-, Wirtschafts- und Sozialpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks auf. Dahinter steht der Gedanke, dass Europäer:innen und US-Amerikaner:innen früher oder später vor den gleichen Herausforderungen stehen und von den Lösungsansätzen des anderen lernen können.
Ivo Andrade ist Project Manager im Projekt „Junge Menschen und Wirtschaft“ der Bertelsmann Stiftung. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass mit Fleiß und guten Rahmenbedingungen vieles möglich ist – und wie ein Hobby beim Durchatmen helfen kann.
ivo.andrade@bertelsmann-stiftung.de

Wenke Bühlmeyer Antoine Jerji
change | Ivo, wie hast du es geschafft, dich vom Hauptschulabschluss zum Master-Absolventen hochzuarbeiten?
ivo andrade | Mein Weg war alles andere als geradlinig. Ich bin mit einem Hauptschulabschluss von 3,2 gestartet und habe danach ein Jahr in einer berufsvorbereitenden Maßnahme verbracht. Anschließend habe ich eine Ausbildung zum Verkäufer abgeschlossen, aber dieser Beruf erfüllte mich nicht. Um neue Perspektiven zu bekommen, habe ich dann meinen Realschulabschluss und das Abitur nachgeholt und schließlich Sozialökonomie studiert und einen Master in „Public Economics, Law & Politics“ gemacht. Mein Werdegang zeigt: Mit einem unterstützenden Umfeld und guten Rahmenbedingungen kann man vieles schaffen.
Du arbeitest im Projekt „Junge Menschen und Wirtschaft“. Warum gerade dieses Projekt? Ich sehe da viele Schnittmengen mit meinem Lebensweg, obwohl ich selber nicht gegründet habe. Ich kenne allerdings das Gefühl, sich weiterentwickeln und über den Tellerrand blicken zu wollen. Deshalb möchte ich jungen Menschen zeigen, dass sie andere
Wege gehen können – besonders denen mit schwierigen Startbedingungen. Dafür müssen alle denselben Zugang zu Informationen haben, das geht besonders gut mit starken Vorbildern.
Wie würdest du deine Mission in einem Wort beschreiben? Ich sehe mich als Brückenbauer. Ich möchte Aufmerksamkeit auf das Thema Gründung lenken und eine Art Sprachrohr sein. Junge Menschen sollen unternehmerische Fähigkeiten erlernen, die ihnen in allen Lebensbereichen helfen.
Wir hörten, dass du neben der Arbeit in der Bundesliga spielst. Erzähl doch mal.
Ja, ich spiele in der 1. Tischfußball-Bundesliga, manche würden es wohl als professionelles Kickern bezeichnen. Für mich ist das nicht nur ein Sport, sondern auch eine Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen. Ich nehme regelmäßig an Turnieren teil, besonders in Hamburg. Bei der Bertelsmann Stiftung gibt es auch eine eigene Tischfußball-Gruppe. Diese Leidenschaft gibt mir die Energie, die ich für meine Arbeit mit jungen Menschen brauche.
Reif für digitales Lesevergnügen?
Dann wird es Zeit für change –Das Magazin der Bertelsmann Stiftung.
Sichern Sie sich das kostenlose Abonnement im Online-Check-in.

teilenWeiterempfehlen, und verbreiten: Einfach hier klicken!

Herausgeber
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256 33311 Gütersloh
Verantwortlich
Dr. Malva Sucker
Redaktion
Marcel Hellmund
Vivian Vanessa Winzler
Mitarbeit
David Bärwald
Lektorat
Helga Berger
Konzeption und Design wirDesign Berlin Braunschweig
Creative Director
Thorsten Greinus
Design
Neele Bienzeisler
Sarah Lüder
Lithografie rolf neumann, digitale bildbearbeitung, Hamburg
© Bertelsmann Stiftung, Mai 2025
Bildnachweise
Cover © Kai Uwe Oesterhelweg
S. 24 © Envato Elements (Legosteine)
S. 41 © MUS_GRAPHIC - stock.adobe.com (Bühnenbild)
S. 41 © Bilderfolge: Tim Matheson, Adrian Altinger/Staatstheater Augsburg, Jamel rockt den Förster/forstrock.de
S. 54/55 © Envato Elements (Polaroidrahmen), Thomas Byczkowski
S. 57/58 © Eddie Stok, Are We Europe (Illustrationen)
S. 65 © Envato Elements (iPad) U4 © Envato Elements (Sticker-Mockup), Sebastian Mölleken
Kontakt
change Magazin change@bertelsmann-stiftung.de Tel.: 05241/81-81149
Archiv
Alle bereits erschienenen Ausgaben sind kostenfrei erhältlich: www.bertelsmann-stiftung.de/ changemagazin
change online www.change-magazin.de
change Digital-Abo www.b-sti.org/change
Apple, das Apple-Logo und iTunes sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. iPad und iPhone sind Marken der Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Im iTunes Store gekaufte Inhalte sind nur für den rechtmäßigen, persönlichen Gebrauch bestimmt.