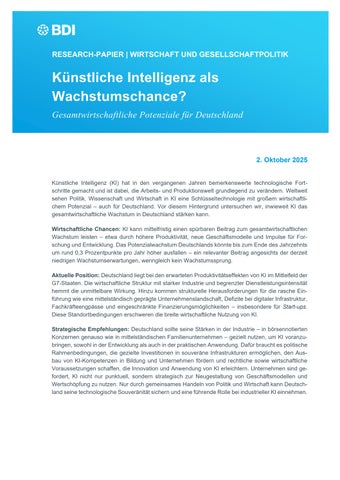RESEARCH-PAPIER | WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFTPOLITIK
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Gesamtwirtschaftliche Potenziale für Deutschland
2. Oktober 2025
Künstliche Intelligenz (KI) hat in den vergangenen Jahren bemerkenswerte technologische Fortschritte gemacht und ist dabei, die Arbeits- und Produktionswelt grundlegend zu verändern. Weltweit sehen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in KI eine Schlüsseltechnologie mit großem wirtschaftlichem Potenzial – auch für Deutschland. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir, inwieweit KI das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Deutschland stärken kann.
Wirtschaftliche Chancen: KI kann mittelfristig einen spürbaren Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum leisten – etwa durch höhere Produktivität, neue Geschäftsmodelle und Impulse für Forschung und Entwicklung. Das Potenzialwachstum Deutschlands könnte bis zum Ende des Jahrzehnts um rund 0,3 Prozentpunkte pro Jahr höher ausfallen – ein relevanter Beitrag angesichts der derzeit niedrigen Wachstumserwartungen, wenngleich kein Wachstumssprung.
Aktuelle Position: Deutschland liegt bei den erwarteten Produktivitätseffekten von KI im Mittelfeld der G7-Staaten. Die wirtschaftliche Struktur mit starker Industrie und begrenzter Dienstleistungsintensität hemmt die unmittelbare Wirkung. Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen für die rasche Einführung wie eine mittelständisch geprägte Unternehmenslandschaft, Defizite bei digitaler Infrastruktur, Fachkräfteengpässe und eingeschränkte Finanzierungsmöglichkeiten – insbesondere für Start-ups Diese Standortbedingungen erschweren die breite wirtschaftliche Nutzung von KI.
Strategische Empfehlungen: Deutschland sollte seine Stärken in der Industrie – in börsennotierten Konzernen genauso wie in mittelständischen Familienunternehmen – gezielt nutzen, um KI voranzubringen, sowohl in der Entwicklung als auch in der praktischen Anwendung. Dafür braucht es politische Rahmenbedingungen, die gezielte Investitionen in souveräne Infrastrukturen ermöglichen, den Ausbau von KI-Kompetenzen in Bildung und Unternehmen fördern und rechtliche sowie wirtschaftliche Voraussetzungen schaffen, die Innovation und Anwendung von KI erleichtern. Unternehmen sind gefordert, KI nicht nur punktuell, sondern strategisch zur Neugestaltung von Geschäftsmodellen und Wertschöpfung zu nutzen. Nur durch gemeinsames Handeln von Politik und Wirtschaft kann Deutschland seine technologische Souveränität sichern und eine führende Rolle bei industrieller KI einnehmen.
Executive Summary
• KI als potenzieller Wachstumstreiber: Künstliche Intelligenz (KI) gilt als General Purpose Technology mit breitem Anwendungsspektrum. Sie kann Prozesse automatisieren, komplexe Tätigkeiten unterstützen, neue Aufgabenfelder schaffen und Forschung beschleunigen. Erste Studien zeigen teils deutliche Effizienzgewinne, insbesondere in wissensintensiven Dienstleistungen. Die wirtschaftlichen Potenziale hängen jedoch stark davon ab, wie gut KI in bestehende Arbeits- und Produktionsprozesse integriert wird.
• Industrielle Anwendung: KI wird zunehmend auch im industriellen Sektor eingesetzt – laut ifo Institut bereits von 46,7 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe. Besonders hohe Nutzungsraten zeigen sich in der Automobilbranche, im Maschinenbau und in der Chemieindustrie. Allerdings dürfte sich die Nutzung bislang vor allem auf administrative Prozesse konzentrieren; über einzelne Vorreiterbetriebe hinaus lässt sich eine flächendeckende Integration in die Produktion derzeit nicht eindeutig feststellen Auch die empirische Evidenz zu messbaren Produktivitätseffekten ist bislang begrenzt. Gleichzeitig zeigen Fallstudien und Potenzialschätzungen, dass KI in einzelnen Industriebranchen durchaus bedeutsame Effizienzgewinne ermöglichen kann. Insgesamt zeichnet sich ab, dass KI auch im industriellen Bereich wirtschaftlich zunehmend relevant wird – auch wenn die breite produktive Nutzung bislang noch am Anfang steht.
• Gesamtwirtschaftliche Potenziale von KI: Studien prognostizieren für Deutschland einen jährlichen Produktivitätszuwachs durch KI von 0,1 bis 0,8 Prozentpunkten (bezogen auf die sogenannte Totale Faktorproduktivität). Unter Berücksichtigung struktureller Effekte – etwa, dass zusätzliche Nachfrage oft in weniger produktiven Bereichen entsteht – sowie KI-bedingter Investitionen ergibt sich ein erwartbarer gesamtwirtschaftlicher Wachstumsimpuls von rund 0,3 Prozentpunkten pro Jahr. Damit könnte KI das Produktionspotenzial Deutschlands – derzeit auf nur 0,2 bis 0,4 Prozent jährlich geschätzt – spürbar erhöhen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei den erwarteten Produktivitätseffekten im Mittelfeld der G7-Staaten, mit begrenzter sektoraler Betroffenheit, aber moderater KI-Einführungsdynamik.
• Standortbedingungen in Deutschland: Die Studienlage berücksichtigt zentrale nationale Rahmenbedingungen teils nur begrenzt. Die überwiegend mittelständische Unternehmensstruktur, Defizite bei digitaler Infrastruktur, Fachkräfteengpässe und eingeschränkte Finanzierungsmöglichkeiten von Start-ups und kleineren Betrieben erschweren die rasche und breite wirtschaftliche Nutzung von KI. Auch der Zugang zu hochwertigen Daten und der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in marktfähige Anwendungen bleiben zentrale Herausforderungen. Diese Faktoren relativieren die modellierten Produktivitätseffekte und zeigen, dass technologische Potenziale allein nicht ausreichen
• Handlungsempfehlungen: Deutschland sollte seine industrielle Stärke gezielt in der Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien ausspielen. Politisch gilt es, die Voraussetzungen für eine breite wirtschaftliche Nutzung zu schaffen – durch Investitionen in souveräne Infrastrukturen, den Ausbau von KI-Kompetenzen und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen. Ergänzend sollten Technologietransfer und Skalierung gezielt gefördert werden. Unternehmen aller Größen sind gefordert, KI nicht nur punktuell einzusetzen, sondern strategisch zur Neugestaltung von Geschäftsmodellen, Wertschöpfung und Arbeitsorganisation. Nur wenn Politik und Wirtschaft gemeinsam handeln, kann Deutschland seine technologische Souveränität sichern und sich als führender Standort für industrielle KI etablieren.
1. Einleitung
Künstliche Intelligenz (KI) hat in den vergangenen Jahren bemerkenswerte technologische Fortschritte gemacht und ist dabei, die Arbeits- und Produktionswelt grundlegend zu verändern. Weltweit sehen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in KI eine Schlüsseltechnologie mit großem wirtschaftlichem Potenzial – auch für Deutschland.
Vor diesem Hintergrund untersuchen wir, inwieweit KI das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Deutschland stärken kann. Wir beleuchten die theoretischen Wirkmechanismen von KI, ziehen mikround makroökonomische Befunde heran und ordnen die Standortbedingungen Deutschlands im internationalen Vergleich ein. Unser Ziel ist es, eine sachlich fundierte Einschätzung der möglichen Wachstumseffekte abzugeben und politische Ansatzpunkte aufzuzeigen, wie sich diese Potenziale am besten nutzen lassen.
Im Fokus steht dabei insbesondere die Frage, unter welchen Bedingungen KI nicht nur in einzelnen Vorreiterbranchen, sondern breit in der deutschen Wirtschaft wirksam werden kann – und welche politischen und strukturellen Voraussetzungen hierfür notwendig sind.
2. Wachstumspotenziale durch Künstliche Intelligenz
2.1 Theoretische Grundlagen und Wirkmechanismen
Künstliche Intelligenz wird in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur zunehmend als sogenannte General Purpose Technology (GPT) verstanden – also als Basistechnologie mit breitem Anwendungsspektrum, deren wirtschaftliche Bedeutung mit historischen Innovationen wie Elektrizität oder dem Internet vergleichbar ist (OECD 2025). Als solche besitzt KI das Potenzial, nicht nur einzelne Prozesse effizienter zu gestalten, sondern ganze Produktions- und Arbeitsstrukturen grundlegend zu transformieren – mit weitreichenden Folgen für Produktivität, Innovation und gesamtwirtschaftliches Wachstum.
Aus theoretischer Perspektive lassen sich mehrere Wirkmechanismen identifizieren, über die KI Wachstum und Produktivität beeinflussen kann. Ein zentraler Kanal ist die Automatisierung: KI kann Aufgaben übernehmen, die bislang von Menschen ausgeführt wurden – insbesondere kognitiv einfache, regelbasierte oder stark standardisierte Tätigkeiten. Dadurch können Kosten gesenkt und Arbeitspotenziale freigesetzt werden. Wie stark sich diese Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Produktivität auswirken, hängt davon ab, wie viele Aufgaben tatsächlich betroffen sind und ob die freigesetzten Arbeitskräfte in andere, produktivere Tätigkeiten übergehen können (Acemoglu, 2024). Gleichzeitig wirkt KI in vielen Bereichen nicht als Ersatz (labour-replacing), sondern als Ergänzung zur menschlichen Arbeit (labour-augmenting). Sie kann Beschäftigte bei bestimmten Aufgaben unterstützen –etwa durch die Automatisierung von Teilprozessen oder die strukturierte Aufbereitung von Informationen – und dadurch ihre Produktivität steigern
Erste Anwendungen zeigen, dass KI bislang vor allem im Dienstleistungssektor zur Verbesserung des Informationszugangs und zur Erstellung digitaler Inhalte eingesetzt wird (Acemoglu 2024, EZB 2025). Auch im Verarbeitenden Gewerbe kommen KI-Technologien zunehmend zum Einsatz – wenn auch bislang vorwiegend in Form einzelner Pilotprojekte. Einige Unternehmen nutzen beispielsweise KIbasierte Bilderkennungssysteme, um Produktionsfehler automatisiert zu identifizieren und dadurch Ausschuss zu verringern (vgl. Fraunhofer ITWM, o. J.). Darüber hinaus arbeiten Industrieunternehmen an Initiativen, um Produktionsprozesse künftig über Cloud-Plattformen zu steuern – einschließlich KI-
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
gestützter Wartung, Prozessoptimierung und Qualitätskontrolle. Ergänzend dazu entwickeln einige Unternehmen sogenannte KI-Agenten, die eigenständig Entscheidungen treffen können, etwa indem sie bei Maschinenausfällen automatisch Ursachen analysieren und passende Lösungsvorschläge unterbreiten
Darüber hinaus könnte KI auch gänzlich neue Tätigkeitsfelder entstehen lassen – etwa durch bislang nicht existierende Aufgaben und die Re-Konfiguration bestehender Arbeitsprozesse. Solche task creation-Effekte gelten als potenziell produktivitätssteigernd und könnten langfristig positive Auswirkungen auf Beschäftigung und Löhne haben, insbesondere wenn sie über einzelne Tätigkeiten hinausgehen und neue Aufgabenfelder oder Geschäftsmodelle ermöglichen (Acemoglu 2024, OECD 2025). Solche Effekte waren bereits in früheren technologischen Umbrüchen ein zentraler Treiber langfristigen Wachstums (OECD 2025). Da sie schwer messbar sind, werden sie in vielen Studien bislang jedoch nicht systematisch berücksichtigt.
Ein zusätzlicher, bislang ebenfalls oft unterbeleuchteter Kanal für Produktivitätssteigerungen durch den Einsatz von KI liegt darin, Forschung und Innovation zu beschleunigen. Mit Hilfe von KI könnten Unternehmen große Datenmengen analysieren, Experimente simulieren und neue Zusammenhänge erkennen – etwa in der Biomedizin oder Materialforschung. Diese Effekte sind schwer zu quantifizieren, könnten langfristig jedoch erheblich zum Produktivitätswachstum beitragen. Das Potenzial von KI als Invention Technology wird sowohl in einem Bericht der OECD (2024), der aufzeigt, wie KI Forschung beschleunigen und neue Innovationspfade eröffnen kann, als auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2024) hervorgehoben, das neben direkten Produktivitätseffekten durch Automatisierung ebenfalls indirekte Effekte über Forschung und Entwicklung betont.
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nicht jede durch KI ermöglichte Tätigkeit zu einer Steigerung der Wohlfahrt beiträgt. Acemoglu (2024) warnt zum Beispiel vor der Entstehung sogenannter bad tasks –etwa Deepfakes, manipulativer Werbesysteme oder automatisierter Desinformation. Solche Anwendungen können zwar ökonomische Aktivität erzeugen, untergraben aber potenziell gesellschaftlichen Nutzen und Wohlstand.
Darüber hinaus können sich auch auf aggregierter Ebene strukturelle Wachstumsgrenzen ergeben. Die OECD (2024, 2025) verweist in diesem Zusammenhang auf den sogenannten Baumol-Effekt Dieser beschreibt, dass gesamtwirtschaftliche Produktivitätsgewinne begrenzt bleiben können, wenn insbesondere jene Sektoren wachsen, in denen Produktivitätsfortschritte schwer zu erzielen sind – etwa Gesundheitswesen, Pflege oder persönliche Dienstleistungen. Der Effekt entsteht, weil technologische Fortschritte in hochproduktiven Sektoren (zum Beispiel in IT und Finanzdienstleistungen) die Preise dort senken und Einkommen steigern. Die dadurch freiwerdende Kaufkraft wird jedoch nicht ausschließlich in diesen Sektoren ausgegeben, sondern zunehmend für Dienstleistungen verwendet, die sich kaum automatisieren lassen und deren Produktivität nur langsam steigt. Diese Bereiche – etwa persönliche Dienstleistungen – werden stärker nachgefragt, weil sie mit steigendem Einkommen typischerweise häufiger konsumiert werden. Gleichzeitig sinkt der Anteil der hochproduktiven Sektoren an der Gesamtwirtschaft relativ, weil ihre Preise fallen und die Nachfrage nicht im gleichen Maße mitwächst. Das führt dazu, dass weniger produktive Sektoren einen größeren Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung einnehmen, was den gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt bremst. In den OECD-Szenarien reduziert der Baumol-Effekt die aggregierten Produktivitätsgewinne durch KI je nach Annahmen um etwa ein Sechstel und im Extremfall bis um ein Drittel.
Zu beachten ist, dass sich nahezu alle aktuellen Analysen auf eine schrittweise Weiterentwicklung bestehender KI-Technologien konzentrieren. Die Möglichkeit einer sogenannten Artificial General
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Intelligence (AGI), also einer domänenübergreifenden, menschenähnlichen Intelligenz, wird in der Regel explizit ausgeschlossen, da sie zu einer erheblichen Beschleunigung des Innovationstempos führen könnte, deren Auswirkungen außerhalb des methodischen Rahmens aktueller Modellierungen liegen und sich nicht belastbar quantifizieren lassen.
Einen kompakten Überblick über die möglichen Produktivitätseffekte bietet die folgende Tabelle.
Tabelle 1: Potenzielle Wirkmechanismen von KI und ihre Auswirkungen auf die Produktivität Wirkmechanismus Wirkung auf Produktivität
Automatisierung → Labour-replacing
Automatisierung
→ Labour-augmenting
Task Creation
Forschung & Innovation
Gesellschaftlich fragwürdige Anwendungen
Baumol-Effekt
AGI (Artificial General Intelligence)
Förderlich: Effizienzsteigerung durch Automatisierung einfacher Tätigkeiten
Weitere Anmerkungen
Wirkung abhängig von Reallokation der Arbeitskräfte
Förderlich: Unterstützung menschlicher Arbeit durch Teilautomatisierung und bessere Informationsaufbereitung –
Förderlich: Neue Aufgaben und Geschäftsmodelle können langfristig Produktivität steigern
Förderlich: Schnellere Analyse, Simulation und Erkenntnisgewinn
Schwer messbar, daher oft nicht in Studien berücksichtigt
Schwer quantifizierbar, indirekte Effekte oft unterbeleuchtet
Dämpfend: Können ökonomische Aktivität erzeugen, aber gesellschaftlichen Nutzen und Wohlfahrt untergraben –
Dämpfend: Bremst Produktivitätsfortschritt durch Nachfrageverlagerung in wenig automatisierbare Sektoren –
Nicht bewertbar: Potenziell stark produktivitätssteigernd, aber in aktuellen Betrachtungen ausgeschlossen –
2.2 Mikroökonomische Evidenz
Unternehmensebene
Während theoretische Überlegungen nahelegen, dass KI grundsätzlich produktivitätssteigernd wirken kann, stellt sich die Frage, ob sich diese Effekte auch empirisch nachweisen lassen. Eine Reihe von mikroökonomischen Studien liefern hierzu erste belastbare Hinweise: Sie zeigen, dass KI in konkreten betrieblichen Kontexten bereits heute zu Effizienzgewinnen führen kann – vor allem in wissensintensiven Dienstleistungen (siehe Box 1).
Auch wenn die bisherige Evidenz stark auf Dienstleistungsbereiche fokussiert ist, zeigen Umfragen wie die des ifo Instituts (2025), dass KI zunehmend auch im industriellen Sektor eingesetzt wird. Laut dem ifo Institut nutzen mittlerweile 46,7 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe KI in ihren Geschäftsprozessen – und damit sogar etwas mehr als im Dienstleistungssektor, wo der Anteil bei 41 Prozent liegt. Besonders hohe Nutzungsraten verzeichnen die Automobilbranche (70,4 Prozent), der Maschinenbau und die Chemische Industrie (jeweils rund 50 Prozent). Damit liegt die Industrie deutlich über Branchen wie Gastronomie (31,3 Prozent) oder Textilproduktion (18,8 Prozent). Insgesamt setzen 40,9 Prozent der deutschen Unternehmen KI bereits ein, weitere 18,9 Prozent planen dies in naher Zukunft.
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Belastbare mikroökonomische Studien mit gemessenen Produktivitätseffekten in industriellen Anwendungen liegen bislang jedoch kaum vor. Gleichzeitig zeigen Fallstudien und Potenzialschätzungen, dass KI in einzelnen Industriebranchen durchaus bedeutsame Effizienzgewinne ermöglichen kann. Bereits heute ist KI in einigen Bereichen bereits tief in industriellen Abläufen integriert – von optimierten Produktionslinien und hochautomatisierten Fahrerassistenzsystemen bis hin zu generativen Anwendungen auf Endgeräten (BDI und BCG 2025). Die zunehmende betriebliche Nutzung und die erwarteten Effizienzpotenziale deuten darauf hin, dass KI allmählich über den experimentellen Einsatz hinauswächst – und damit auch gesamtwirtschaftlich immer relevanter wird
Gleichzeitig zeichnet eine im Juli 2025 veröffentlichte Studie des MIT-NANDA-Projekts ein deutlich ernüchternderes Bild. Der Report The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 kommt zu dem Ergebnis, dass rund 95 Prozent der unternehmerischen GenAI-Pilotprojekte bislang keinen messbaren Einfluss auf Umsatzsteigerung oder Kostensenkung haben. Die Untersuchung basiert auf einer systematischen Analyse von über 300 öffentlich dokumentierten KI-Initiativen, 52 strukturierten Interviews mit Unternehmensvertretern sowie einer Befragung von 153 Führungskräften. Als zentrales Hindernis wird ein sogenannter Learning Gap identifiziert: Viele Systeme sind nicht in der Lage, Feedback zu verarbeiten, sich kontextbezogen weiterzuentwickeln oder sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren. Zwar steigt die Nutzung generativer KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot rasant und diese erhöhen bereits die individuelle Produktivität, doch gelingt es den meisten Unternehmen bislang nicht, diese Potenziale in konkrete Produktivitätsgewinne oder in Effekte mit spürbarem Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung zu überführen
Die wesentlichen Hürden liegen laut der Studie weniger in technischen Limitierungen wie Modellqualität oder regulatorischen Fragen, sondern vielmehr in organisatorischen Defiziten – etwa einer mangelnden Integration in operative Prozesse oder einer Investitionsverzerrung zugunsten sichtbarer, aber weniger ertragreicher Einsatzfelder wie Vertrieb und Marketing. Erfolgreiche Anwendungsfälle finden sich demgegenüber vor allem dort, wo KI eng mit den operativen Abläufen verzahnt ist – insbesondere in Backoffice-Funktionen wie Kundenservice, Finanzen oder Beschaffung. Die Studie zeigt damit deutlich: Die Realisierung von Produktivitätsgewinnen ist weniger eine Frage der Technologie, sondern vor allem von der Fähigkeit, KI-Systeme sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln
Box 1: Empirische Evidenz zur Produktivitätswirkung von KI in Unternehmen
Die nachfolgenden Studien zeigen anhand konkreter Anwendungskontexte, wie der Einsatz von KI die Produktivität auf Unternehmensebene steigern kann. Sie belegen nicht nur positive Effekte auf Output und Effizienz, sondern verdeutlichen auch, unter welchen Bedingungen und in welchen Bereichen KI besonders wirksam sein kann. Die Auswahl umfasst sowohl experimentelle als auch feldbasierte Untersuchungen aus verschiedenen Branchen.
1. Czarnitzki et al. (2023): KI in deutschen Unternehmen – 5,5 bis 13,9 Prozent höherer Umsatz bei gleichen Inputs
- Die Studie basiert auf Daten von 5.851 deutschen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. KI-Nutzer – also Unternehmen, die bis 2018 mindestens eine KI-Methode (zum Beispiel Sprachverarbeitung, Bilderkennung, maschinelles Lernen oder wissensbasierte Systeme) in einem Anwendungsbereich (zum Beispiel Produkte, Prozesse, Kundeninteraktion, Datenanalyse) einsetzten – erzielten 13,9 Prozent höhere Umsätze (einfache OLS-Schätzung). In Modellen mit Kontrollvariablen liegt der Effekt bei 5,5 bis 5,7 Prozent. Die Autoren interpretieren den höheren Umsatz bei gleichen Produktionsfaktoren als Hinweis auf höhere Produktivität. Eine direkte Messung der Produktivität erfolgt jedoch nicht.
2. Ju und Aral (2025): Mensch-KI-Kollaboration – +60 Prozent Produktivität
- In einem kontrollierten Experiment mit 2.310 Teilnehmenden waren KI-unterstützte Teams 60 Prozent produktiver als reine Menschenteams, gemessen an der Anzahl erfolgreich erstellter Werbeanzeigen. Gleichzeitig sank die zwischenmenschliche Kommunikation um 23 Prozent – der emotionale Austausch wich einer stärker auf Effizienz ausgerichteten Zusammenarbeit. Die Textqualität stieg, die Bildqualität nahm leicht ab.
3. Dell’Acqua et al. (2023): KI in der Unternehmensberatung – +25 Prozent Produktivität
- In einem Feldexperiment mit 758 Personen bei einer führenden Unternehmensberatung führte der Einsatz von GPT-4 zu 25 Prozent höherer Bearbeitungsgeschwindigkeit und über 40 Prozent besserer Lösungsqualität bei typischen Beratungsaufgaben. Besonders leistungsschwächere Teilnehmende profitierten stark. Bei Aufgaben außerhalb der KI-Fähigkeiten schnitten KI-Nutzer jedoch schlechter ab.
4. Brynjolfsson et al. (2023): KI im Kundenservice – +14 Prozent Produktivität bei Support-Mitarbeitenden
- Eine Studie mit 5.179 Customer Support Agents zeigt, dass ein KI-gestützter Chat-Assistent die Produktivität – gemessen an der Zahl gelöster Kundenanfragen pro Stunde – im Durchschnitt um 14 Prozent steigert. Besonders profitierten weniger erfahrene Mitarbeitende mit einem Zuwachs von 34 Prozent, während sich bei erfahrenen Kräften kaum Effekte zeigten. Die Autoren sehen Hinweise darauf, dass die KI bewährte Vorgehensweisen verbreitet und so das Lernen unterstützt.
5. Peng et al. (2023): KI in der Softwareentwicklung – +56 Prozent Effizienzsteigerung
- In einem Experiment in der Softwareentwicklung zeigte sich, dass der Einsatz von GitHub Copilot die Bearbeitungszeit für Programmieraufgaben deutlich verkürzt. Entwickler mit KIUnterstützung erledigten ihre Aufgaben im Schnitt 55,8 Prozent schneller als die Kontrollgruppe.
6. vfa & BCG (2024); Dermawan & Alotaiq (2025): KI in Forschung & Entwicklung –+50 Prozent schnellere Entwicklung, +8,9 Prozent Umsatzanteil
- Studien zeigen, dass KI die Produktivität in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung steigert kann. Der Branchenreport von vfa & BCG (2024) dokumentiert anhand von Fallbeispielen, dass KI die Zahl notwendiger Labortests reduziert und Entwicklungsphasen deutlich beschleunigt. So kann KI laut BioNTech bis zu 97 Prozent aller Experimente automatisiert auswerten. Der Umsatzanteil von Biopharmazeutika stieg um 8,9 Prozent. Dermawan & Alotaiq (2025) bestätigen diese Effekte in einer systematischen Analyse: KI verkürzt die Zeit von der präklinischen Forschung bis zur klinischen Anwendung um bis zu 50 Prozent und verbessert die Erfolgsquote bei Wirkstoffkandidaten. Beide Studien verdeutlichen, dass KI besonders in der Frühphase der Arzneimittelentwicklung erhebliche Effizienzgewinne ermöglicht.
7. Kodumuru et al. (2025): KI in der pharmazeutischen Produktion – bis zu 50 Prozent schnellere Entwicklung, -40 Prozent Fehler, -25 Prozent Kosten
- In einer Übersichtsarbeit zeigen die Autoren, dass KI die Entwicklungszeit neuer Medikamente um bis zu 50 Prozent verkürzen kann. In der Herstellung reduziert KI die Fehlerquote um bis zu 40 Prozent und senkt die Produktionskosten durch automatisierte Prozesse um bis zu 25 Prozent. Die Studie hebt hervor, dass KI insbesondere in der Prozessüberwachung, Qualitätskontrolle und vorausschauenden Wartung signifikante Effizienzgewinne ermöglicht.
Branchenebene
Aufbauend auf der betrieblichen Evidenz rückt nun die Branchenebene als analytische Zwischenstufe in den Fokus, um besser zu verstehen, in welchen Teilen der Wirtschaft KI besonders wirksam werden kann und wo sich gesamtwirtschaftliche Effekte voraussichtlich konzentrieren.
Die OECD (2025) zeigt, dass die potenzielle Exposition gegenüber KI je nach Branche stark variiert –also wie stark die typischen Tätigkeiten eines Sektors grundsätzlich durch KI unterstützt oder ersetzt werden können. Wissensintensive Dienstleistungen wie Finanzwesen, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Telekommunikation, Medien sowie professionelle Dienstleistungen weisen laut der Analyse der OECD die höchsten Expositionsraten auf. In diesen Sektoren gelten – je nach Szenario – zwischen 50 und 80 Prozent der Aufgaben als potenziell KI-exponiert. Grundlage dieser Einschätzung ist eine Zuordnung von KI-Exposition auf Aufgabenebene, die über Berufszuschnitte sektoralen Aggregaten zugeordnet wurde.
Demgegenüber sind Sektoren mit einem hohen Anteil manueller oder physischer Tätigkeiten – etwa Landwirtschaft, Bergbau oder Baugewerbe – deutlich weniger betroffen. Hier liegt die geschätzte Exposition lediglich zwischen zehn und 30 Prozent. Diese sektoralen Unterschiede spiegeln die unterschiedliche Aufgabenstruktur wider: Während wissensintensive Dienstleistungen stark auf kognitive Tätigkeiten angewiesen sind, enthalten andere Branchen einen höheren Anteil manueller und physischer Aufgaben, die im Durchschnitt eine geringere KI-Exposition aufweisen.
Neben dem Ausmaß der Exposition ist auch die wirtschaftliche Bedeutung der betroffenen Branchen relevant. Laut OECD (2025) machen die fünf am stärksten KI-exponierten Sektoren – ICT, Telekommunikation, Medien, Finanzdienstleistungen und professionelle Dienstleistungen – in Deutschland rund 15 Prozent der Bruttowertschöpfung aus. Im Vergleich zu anderen G7-Staaten wie den USA oder dem Vereinigten Königreich fällt dieser Anteil deutlich geringer aus.
Die OECD nutzt die zuvor dargestellte sektorale Exponierung gegenüber KI, kombiniert mit mikroökonomischen Produktivitätsschätzungen und prognostizierten Adoptionsraten, um durchschnittliche sektorale Zuwächse der Totalen Faktorproduktivität (Total Factor Productivity, TFP)1 für die G7 insgesamt über die nächsten zehn Jahre zu berechnen (Abbildung 1). Die Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede zwischen Branchen: In manuell geprägten Sektoren wie Landwirtschaft oder Bergbau werden lediglich rund ein Prozent Produktivitätswachstum erwartet, während wissensintensive Dienstleistungen – etwa IT, Finanz- oder technische Services – je nach Szenario auf über zehn Prozent kommen. Für das Verarbeitende Gewerbe – einschließlich Industrieproduktion, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektrotechnik sowie verwandter industrieller Sektoren – liegen die projizierten TFP-Zuwächse je nach Szenario zwischen etwa einem und sieben Prozent. Damit befindet sich dieser Bereich im Mittelfeld: stärker betroffen als manuell geprägte Branchen wie Landwirtschaft oder Bergbau, aber deutlich unterhalb der wissensintensiven Dienstleistungen. Die höchsten Zuwächse ergeben sich im Szenario „hohe Adoption und erweiterte Funktionen“, das von einer schnellen Diffusion und der Entwicklung komplementärer Software ausgeht.
1 Die TFP misst den Wachstumseffekt durch technologisch-organisatorischen Fortschritt und eine effiziente Ressourcenverwendung.
Abbildung 1: Prognostizierte sektorale Produktivitätszuwächse über 10 Jahre*
Hohe Adoption und erweiterte Funktionen
Mittlere Adoption und erweiterte Funktionen
Geringe Adoption
*Zuwächse unter verschiedenen Szenarien. Quelle: OECD (2025)
2.3 Makroökonomische Untersuchungen

Die gesamtwirtschaftlichen Potenziale von KI werden zunehmend durch makroökonomische Studien untersucht. Ziel ist es, die erwarteten Produktivitätseffekte über Länder und Zeiträume hinweg zu quantifizieren. Dabei zeigt sich eine große Spannbreite der Ergebnisse, die auf unterschiedliche methodische Ansätze sowie divergierende Annahmen zur Technologieentwicklung und -adoption zurückzuführen ist.
Die Studien unterscheiden sich insbesondere in folgenden Punkten:
• Zeithorizont: Einige Studien modellieren Effekte über fünf Jahre, andere über zehn oder mehr, je nach Definition des mittelfristigen Horizonts.
• Messgröße: Während viele Studien die Totale Faktorproduktivität (TFP) analysieren, betrachten andere die Arbeitsproduktivität2 oder – insbesondere in unternehmensnahen Studien – direkte BIP-Effekte.
• Modellansatz: Die methodischen Zugänge reichen von Bottom-up-Kalibrierungen bis hin zu makroökonomischen Simulationsmodellen mit sektoraler Differenzierung. Häufig werden
2 Die Arbeitsproduktivität misst, wie effizient Arbeit in einem Produktionsprozess eingesetzt wird. Sie gibt an, wie viel Output (Güter oder Dienstleistungen) pro eingesetzter Arbeitseinheit (zum Beispiel pro Arbeitsstunde oder pro Beschäftigten) erzeugt wird.
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
mikroökonomische Daten zur Aufgabenexposition mit makroökonomischen Strukturmerkmalen (zum Beispiel Lohnkosten oder Branchenstruktur) kombiniert.
• Adoptionsannahmen: Annahmen zur KI-Adoption gehen teilweise über die technische Betroffenheit hinaus und modellieren die wirtschaftliche Umsetzbarkeit, etwa über empirisch geschätzte Adoptionsraten, Kostenannahmen oder länderspezifische Szenarien.
• Länderfokus: Die in den Studien betrachteten Länder und Regionen unterscheiden sich teils erheblich (zum Beispiel USA, Europa, G7), was den jeweiligen Analysekontext und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinflusst.
Internationale Perspektiven
Vor dem Hintergrund methodischer Unterschiede zeigen die Studien teils stark abweichende Ergebnisse. So kommen beispielsweise Acemoglu (2024), der Internationale Währungsfonds (IWF 2025) und die OECD (2024b, 2025) auf vergleichsweise geringe bis moderate Beiträge zum Produktivitätswachstum:
• Acemoglu (2024) entwickelt ein makroökonomisches Modell, das auf der Idee basiert, dass KI einzelne Arbeitsschritte (Tasks) entweder vollständig übernehmen oder die Arbeit von Menschen in diesen Aufgaben unterstützen kann. Die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinne ergeben sich dabei aus zwei Faktoren: dem Anteil der betroffenen Aufgaben und den geschätzten Kosteneinsparungen pro Aufgabe. Auf Basis empirischer Studien zur KI-Exposition und zu Zeit- und Kosteneinsparungen schätzt Acemoglu einen kumulierten TFP-Zuwachs von rund 0,7 Prozent über zehn Jahre für die USA (etwa 0,07 Prozent jährlich). Unter vorsichtigeren Annahmen – etwa zur begrenzten Leistungsfähigkeit von KI bei komplexen, kontextabhängigen Aufgaben – reduziert sich dieser Wert auf maximal 0,55 Prozent.
• Der IWF (2025) prognostiziert für Europa in seinem bevorzugten Szenario (preferred scenario) einen TFP-Zuwachs von rund 1,1 Prozent über fünf Jahre – fast 60 Prozent mehr als Acemoglu. Die höheren Werte erklärt der IWF vor allem mit optimistischeren Annahmen zur Leistungsfähigkeit von KI. Die Studie simuliert Produktivitätsgewinne für 31 europäische Länder auf Basis des Acemoglu-Modells und berücksichtigt in diversen Szenarien auch länderspezifische Unterschiede bei der KI-Adoption sowie die Auswirkungen von Regulierung.
• Die OECD (2024b) schätzt für die USA einen jährlichen Zuwachs der Totalen Faktorproduktivität durch KI auf 0,25 bis 0,6 Prozentpunkte über zehn Jahre. Die Arbeitsproduktivität könnte demnach jährlich um 0,4 bis 0,9 Prozentpunkte steigen. Im historischen Vergleich sind diese Werte durchaus bedeutsam, bleiben aber laut OECD hinter den Produktivitätsschüben früherer Technologiebooms zurück. So wird geschätzt, dass der durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ausgelöste Wachstumsschub jährlich ein bis 1,5 Prozentpunkte zum TFP-Wachstum der USA im Zeitraum 1995-2004 beigetragen hat Dies entspricht umgerechnet einem Beitrag von circa 1,5 bis 2,25 Prozentpunkten zur Arbeitsproduktivität Die Zahlen sind bemerkenswert, wenn man berücksichtigt, dass das Wachstum der Arbeitsproduktivität in den USA in diesem Zeitraum jährlich zwischen 1,5 und 3 Prozent lag und im Durchschnitt 2,5 Prozent betrug (OECD 2025b)
• Die OECD (2025) knüpft direkt an ihre Vorläuferstudie (2024b) an und erweitert die Analyse auf alle G7-Staaten. Methodisch baut sie auf Acemoglu (2024) auf und kombiniert drei zentrale
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Elemente: (1) mikroökonomische Produktivitätsgewinne auf Aufgabenebene, (2) die sektorale Exponierung gegenüber KI und (3) prognostizierte Adoptionspfade unter verschiedenen Szenarien. Im zentralen Szenario – mittlere Adoptionsgeschwindigkeit und erweiterte KI-Fähigkeiten – ergibt sich ein geschätzter jährlicher Zuwachs der Arbeitsproduktivität von 0,5 bis einem Prozentpunkt über zehn Jahre, mit besonders hohen Werten in wissensintensiven Volkswirtschaften wie den USA und dem Vereinigten Königreich.
Demgegenüber stehen marktnahe Studien wie McKinsey (2023) und Goldman Sachs (2023), die unter optimistischen Annahmen deutlich höhere Effekte prognostizieren. McKinsey erwartet durch den kombinierten Einsatz von generativer KI und anderen Automatisierungstechnologien ein jährliches Wachstum der Arbeitsproduktivität von bis zu 3,4 Prozent. Goldman Sachs prognostiziert einen BIPZuwachs von bis zu sieben Prozent über zehn Jahre. Diese Schätzungen beruhen auf einem breiteren Technologieverständnis, verwenden andere Messgrößen und unterstellen eine besonders schnelle Diffusion. Isoliert betrachtet könnte generative KI laut McKinsey das jährliche Wachstum der Arbeitsproduktivität bis 2040 um 0,1 bis 0,6 Prozent erhöhen.
Deutschland im Fokus
Die bisher skizzierten internationalen Studien liefern wertvolle Hinweise auf die gesamtwirtschaftlichen Potenziale von KI. Wie sich diese Entwicklungen konkret auf die deutsche Volkswirtschaft auswirken, hängt jedoch maßgeblich von nationalen Rahmenbedingungen ab. Angesichts spezifischer Faktoren – etwa der Branchenstruktur, der Adoptionsdynamik und der regulatorischen Ausgestaltung – werden im Folgenden ausgewählte Studien betrachtet, die Deutschland gezielt analysieren:
• IW Consult (2025) analysiert die gesamtwirtschaftlichen Effekte von KI auf Basis eines Growth-Accounting-Modells. Für Deutschland wird ein jährliches Wachstum der Arbeitsproduktivität (reales BIP je Erwerbstätigenstunde) von durchschnittlich 0,9 Prozent (2025-2030) und 1,2 Prozent (2030-2040) prognostiziert – gegenüber nur 0,4 Prozent in den bisherigen 2020er Jahren. Die erwarteten Werte liegen damit auf dem Niveau der 2000er Jahre, was keinem „Produktivitätswunder“ entspricht, aber eine klare Verbesserung gegenüber der jüngsten Entwicklung darstellt. Die Produktivitätszuwächse entstehen vor allem durch technischorganisatorischen Fortschritt und höhere Kapitalintensität, wobei letztere nicht primär durch neue Investitionen, sondern durch den demografisch bedingten Rückgang des Arbeitseinsatzes steigt. Der Beitrag der Totalen Faktorproduktivität durch KI wird auf 0,1 bis 0,3 Prozentpunkte jährlich geschätzt – basierend auf Szenarioannahmen.
• Die OECD (2025) prognostiziert für Deutschland im zentralen Szenario – also bei geschätzter mittlerer Adoptionsgeschwindigkeit und erweiterten KI-Fähigkeiten – einen jährlichen Zuwachs der Arbeitsproduktivität von 0,86 Prozentpunkten über einen Zeitraum von zehn Jahren. Im optimistischeren Szenario („schnelle Adoption“) steigt dieser Wert auf 1,16 Prozentpunkte, im konservativen Szenario („langsame Adoption“) liegt er bei 0,34 Prozentpunkten. Damit liegt Deutschland im Mittelfeld der G7-Staaten – gleichauf mit Kanada, hinter den USA und dem Vereinigten Königreich, aber vor Frankreich, Italien und Japan. Diese Position ergibt sich laut OECD aus mehreren Faktoren: Zum einen weist Deutschland ein moderates Ausgangsniveau bei der KI-Adoption auf – die zentrale OECD-Schätzung der hochintensiven KI-Nutzung liegt bei 4,8 Prozent der Unternehmen (USA: 6,1 Prozent, Japan: 1,9 Prozent). Zum anderen ist der Anteil wissensintensiver, stark KI-exponierter Sektoren mit rund 15 Prozent der Wertschöpfung vergleichsweise gering – deutlich weniger als in den USA oder dem Vereinigten Königreich und auf ähnlichem Niveau wie in Japan und Italien, deren Wirtschaftsstruktur stärker auf
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
industrielle Fertigung und weniger wissensintensive Dienstleistungen ausgerichtet ist. Trotz dieser strukturellen Begrenzungen wird Deutschland im Modell durch eine vergleichsweise dynamische Entwicklung der KI-Adoption bis 2034 gestützt – was in Kombination mit den übrigen Faktoren zu einer Prognose im Mittelfeld der G7-Staaten führt.
• Der IWF (2025) prognostiziert für Deutschland im bevorzugten Szenario (preferred scenario) einen kumulierten TFP-Zuwachs von etwa 1,3 Prozent über fünf Jahre (geschätzt auf Basis der Grafik 5) – damit liegt Deutschland auf Rang sieben von 31 europäischen Ländern. Dies dürfte im Modell vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen sein: Erstens liegt Deutschland laut Eurostat (2025) beim Lohnniveau deutlich über dem EU-Durchschnitt, was – sofern man die regressionsbasierten Modelle des IWF zugrunde legt – tendenziell höhere KI-Adoptionsraten begünstigen dürfte. Zweitens spielt die sektorale Struktur Deutschlands eine Rolle. Im IWF-Modell hängt die Höhe der Produktivitätsgewinne wesentlich davon ab, wie stark die nationale Wertschöpfung in KI-exponierten Sektoren erfolgt. Länder mit einem höheren Anteil an wissensintensiven Dienstleistungen – etwa Finanzdienstleistungen – erzielen laut Modell tendenziell höhere Produktivitätsgewinne. Auch wenn das IWF-Papier keine detaillierten sektoralen Daten für Deutschland ausweist, dürfte die sektorale Struktur Deutschlands im Modell einen mittleren Anteil KI-exponierter Wertschöpfung zugrunde legen. Während das hohe Lohnniveau somit tendenziell zu einer überdurchschnittlichen KI-Adoption beiträgt, dürfte hingegen die sektorale Struktur Deutschlands im Modell zu einer mittleren KI-Exponierung führen – was in Kombination einen Produktivitätszuwachs ergibt, der im oberen Mittelfeld der europäischen Länder liegt. Neben den direkten Auswirkungen von KI auf die Produktivität untersucht der IWF auch die Rolle der Regulierung in Europa. Der Fonds schätzt überschlägig, dass nationale und EU-weite Vorschriften zu berufsbezogenen Anforderungen, zur Sicherheit von KI und zum Datenschutz die Nutzung von KI in regulierten Tätigkeiten, Berufen und Sektoren um rund 50 Prozent reduzieren könnten. Dadurch könnten auch die Produktivitätsgewinne in Europa um mehr als 30 Prozent sinken.
• Laut einer Studie der EZB (2024) liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf Rang drei von 18 Euro-Ländern hinsichtlich des geschätzten TFP-Zuwachses durch KI über zehn Jahre (abgeleitet aus Grafik 15). Die Studie nennt keine exakte Zahl für Deutschland, doch die visuelle Einordnung deutet auf einen Zuwachs von über drei Prozent hin – also leicht über dem Eurozonen-Durchschnitt von 2,9 Prozent (entspricht 0,29 Prozentpunkten pro Jahr, mit einer Bandbreite von 1,3-4,5 Prozent). Die Schätzung basiert auf einem angepassten Modellrahmen nach Acemoglu (2024), wobei länderspezifische Unterschiede in Aufgabenstruktur und Arbeitsanteil am BIP berücksichtigt werden; andere Parameter wie Automatisierbarkeit und Effizienzgewinne werden im Modell als konstant angenommen. Detaillierte länderspezifische Parameter für Deutschland werden im Papier jedoch nicht ausgewiesen.
Einordnung der Ergebnisse
Die Ergebnisse der Studien sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden TFP-Effekte in Arbeitsproduktivität umgerechnet und umgekehrt.3 Die Studien zeigen für Deutschland einen geschätzten jährlichen Zuwachs der Arbeitsproduktivität durch den Einsatz von KI zwischen 0,15
3 Grundlage ist ein Kapitalmultiplikator von 1,5: Das bedeutet, dass die Arbeitsproduktivität im Durchschnitt etwa eineinhalbmal so schnell wächst wie die TFP. Anders formuliert: Rund 70 Prozent des Zuwachses an Arbeitsproduktivität lassen sich durch TFP erklären, solange das Kapitalwachstum moderat bleibt. Diese vereinfachte Faustregel findet sich auch in der Literatur (vgl. OECD 2024b).
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
und 1,16 Prozentpunkten (entspricht 0,1 bis 0,77 Prozentpunkten TFP-Zuwachs), abhängig vom Szenario und der zugrunde liegenden Methodik. Im Mittel liegen die vier deutschland-spezifischen Studien bei einem jährlichen Anstieg der Arbeitsproduktivität um 0,51 Prozentpunkte und der TFP um 0,34 Prozentpunkte. Besonders hervorzuheben sind die vergleichsweise optimistischeren Prognosen der OECD (2025), die in ihrem mittleren Szenario einen Anstieg der Arbeitsproduktivität um 0,86 Prozentpunkte sowie einen Zuwachs der TFP um 0,57 Prozentpunkte vorhersagen.
Im internationalen Vergleich bewegen sich die geschätzten Zuwächse der Arbeitsproduktivität durch KI in einem Bereich von 0,1 bis 1,3 Prozentpunkten (0,07 bis 0,87 in Bezug auf die TFP). Deutschland liegt damit insgesamt im mittleren und teils auch oberen Bereich dieser Spannbreite. Die genaue Einordnung hängt jedoch stark von den zugrunde gelegten Annahmen und der Geschwindigkeit der Implementierung ab.
Dabei bleiben die erwarteten Produktivitätseffekte durch KI noch ein gutes Stück hinter dem Wachstumsschub zurück, den die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in den USA zwischen Mitte der 1990er- und Mitte der 2000er-Jahre ausgelöst haben. Wie oben angemerkt, trugen IKT damals schätzungsweise jährlich rund 1 bis 1,5 Prozentpunkte zum Wachstum der Totalen Faktorproduktivität bei – alternativ berechnet entsprach dies einem Beitrag von etwa 1,5 bis 2,25 Prozentpunkten zur jährlichen Steigerung der Arbeitsproduktivität.
Tabelle 2: Studienübersicht zu den gesamtwirtschaftlichen KI-Potenzialen
Quelle Land/Region TFP-Zuwachs p. a. (in Prozentpunkten*) Arbeitsproduktivitätszuwachs p. a. (in Prozentpunkten*)
McKinsey (2023) Global
OECD (2025) G7
0,07-0,4 (2,27 bei kombiniertem Einsatz)
0,13-0,87 (mittleres Szenario: 0,33-0,67)
0,1-0,6 (3,4 bei kombiniertem Einsatz)
0,2-1,3 (mittleres Szenario: 0,51,0)
IWF (2025) Europa 0,22 0,33
Acemoglu (2024) USA 0,07
OECD (2024b) USA 0,25-0,6 0,4-0,9
IW Consult (2025) Deutschland
OECD (2025) Deutschland
0,1-0,3
0,23-0,77 (mittleres Szenario: 0,57)
0,15-0,45
0,34-1,16 (mittleres Szenario: 0,86)
IWF (2025) Deutschland 0,26 0,39
EZB (2024) Deutschland 0,33 0,5
* In den herangezogenen Studien wird bei den Schätzungen zu Produktivitätszuwächsen teils zwischen Prozent und Prozentpunkten nicht klar unterschieden. In Anlehnung an die OECD (2024b) wird im Folgenden davon ausgegangen, dass es sich um Angaben in Prozentpunkten handelt, da diese die zusätzlichen Effekte von KI sachgerechter abbilden.
Die Schätzungen für Deutschland sind insofern bemerkenswert, als die trendmäßige Arbeitsproduktivität in Deutschland zwischen 1986 und 2022 im Durchschnitt lediglich um rund 0,9 Prozent pro Jahr
Intelligenz als Wachstumschance?
zunahm. Auffällig ist dabei, dass das Kapitalwachstum je Erwerbstätigen seit 2009 praktisch keinen nennenswerten Beitrag mehr zum Produktivitätswachstum geleistet hat. Demgegenüber lag der Beitrag der Totalen Faktorproduktivität in den vergangenen 15 Jahren im Schnitt bei 0,4 Prozentpunkten pro Jahr, während er über den gesamten Zeitraum von 1986 bis 2022 bei 0,7 Prozentpunkten lag.
Abbildung 2: Trendmäßiges Wachstum der Arbeitsproduktivität (in Prozent)
Beitrag des trendmäßigen Kapitalwachstums je Erwerbstätigen
Beitrag des trendmäßigen TFP-Wachstums
Quelle: OECD

Grundsätzlich gilt, dass die vorliegenden Studien mit teils erheblichen Unsicherheiten verbunden sind. Neben modellbedingten Annahmen zu Technologieadoption und Effizienzgewinnen bleiben unter anderem auch mögliche Fortschritte in der KI-Forschung, strukturelle Veränderungen und die Anpassungsfähigkeit von Arbeitskräften – inklusive möglicher Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten – sowie die zusätzlichen Effekte von KI-bezogenen Investitionen oft unberücksichtigt (vgl. EZB 2024).
Insbesondere ist bei den betrachteten Studien zu berücksichtigen, dass der gesamtwirtschaftlich produktivitätsmindernde „Baumol-Effekt“ in den zugrunde liegenden Schätzungen häufig nicht explizit berücksichtigt wird. Die ausgewiesenen Produktivitätseffekte könnten daher tendenziell überschätzt sein und im Durchschnitt um etwa ein Sechstel geringer ausfallen (vgl. OECD 2024b und 2025). Während beispielsweise die OECD-Studie (2024b) den Baumol-Effekt in einem zentralen Szenario explizit modelliert und dessen dämpfende Wirkung quantifiziert (Reduktion von 0,93 auf 0,8 Prozentpunkte jährlicher Zuwachs der Arbeitsproduktivität), diskutiert die Nachfolgestudie (2025) den Effekt zwar ausführlich, berücksichtigt ihn jedoch nicht in ihren zentralen Schätzungen. In den übrigen Studien findet der Baumol-Effekt keine explizite Berücksichtigung.
Auf der anderen Seite bleiben wichtige Kapitalinvestitionen im Zuge des KI-Ausbaus unberücksichtigt. Besonders in den USA fließen derzeit erhebliche Mittel in den Ausbau der KI-Infrastruktur. Führende Tech-Konzerne bauen massiv Rechenzentren, modernisieren Hardware und erweitern Cloud-Kapazitäten – häufig verbunden mit erhöhtem Energiebedarf und Investitionen in Stromnetze und Energieversorgung. Laut Goldman Sachs (2025) könnte der weltweite Energiebedarf von Rechenzentren bis 2027 um rund 50 Prozent und bis 2030 um bis zu 165 Prozent steigen (gegenüber 2023; Prognose
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
mit erheblicher Unsicherheit). McKinsey (2025) schätzt das potenzielle globale Investitionsvolumen in Rechenzentren bis 2030 auf etwa 6,7 Billionen US Dollar, wovon rund 5,2 Billionen US Dollar auf KIspezifische Infrastruktur (z.B. GPUs, Speicher, Netzwerk) entfallen. Solche Investitionen erhöhen den Kapitalstock und können langfristig positive Wachstumsimpulse geben. In vielen Produktivitätsstudien werden sie bislang jedoch nicht explizit berücksichtigt, sodass die ausgewiesenen Effekte womöglich unterschätzt werden. Gleichzeitig ist unklar, in welchem Umfang die hohen Investitionen tatsächlich zu gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinnen führen – zumal sie mit erheblichen Kosten und strukturellen Anpassungen verbunden sind, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs.
Überträgt man die globale McKinsey-Schätzung, dass bis 2030 weltweit rund 5,2 Billionen US-Dollar in KI-spezifische Infrastruktur – darunter Rechenzentren, spezialisierte Hardware wie GPUs, Speicherund Netzwerktechnik sowie Cloud- und Edge-Kapazitäten – investiert werden müssen, auf Deutschland, ergibt sich ein jährlicher Investitionsbedarf von etwa 30 Milliarden Euro. Diese Zahl ergibt sich überschlägig, indem der kumulative globale Investitionsbedarf auf die verbleibenden Jahre bis 2030 verteilt wird (≈ 867 Milliarden US-Dollar pro Jahr) und der Anteil Deutschlands an der Weltwirtschaft (≈ 4 Prozent in nominaler Rechnung) zugrunde gelegt wird. Mit dem aktuellen Wechselkurs von 1 USDollar zu 0,85 Euro ergibt sich so der genannte jährliche Betrag.
Auf der einen Seite kann diese Schätzung als konservatives Szenario betrachtet werden Deutschland könnte mit dem Anspruch ein führender Digital- und Industriestandort in Europa zu werden einen überproportionalen Anteil am Ausbau der europäischen KI-Infrastruktur übernehmen. Auch zusätzliche Investitionen in die Energieversorgung und -sicherheit dürften noch nicht vollständig abgebildet sein. Andererseits gibt es bereits jetzt öffentliche Förderung, die in den kommenden Jahren weiter hochgefahren werden soll. Sie lässt sich jedoch nicht einfach abbilden. Zudem könnten bereits geplante private Investitionen in anderen Bereichen durch KI-Investitionen verdrängt werden. Sollte darüber hinaus der KI-induzierte Infrastrukturausbau nicht langfristig produktiv genutzt werden, hätten diese Mittel am Ende nur einen begrenzten Effekt auf das Potenzialwachstum.
Das Risiko von Überinvestitionen ist wie bei jedem großen Technologieschub selbstredend vorhanden, und die Diskussion in den USA über die Bewertungsniveaus der führenden Technologieunternehmen zeigt, dass die Unsicherheit über die erwarteten und vom Kapitalmarkt eingepreisten Umsatz- und Gewinnsteigerungen erheblich ist und sich jedwede kleine Änderung der Nachrichtenlage in massiven Bewertungsänderungen niederschlagen kann.
Überschlägig lässt sich der Beitrag zum langfristigen Potenzialwachstum der notwendigen KI-bezogenen privaten und öffentlichen Infrastrukturinvestitionen folgendermaßen abschätzen: Der jährliche Investitionsbedarf von 30 Milliarden Euro entspricht rund 0,14 Prozent des gesamten Kapitalstocks Deutschlands (circa 20,8 Billionen Euro; Destatis 20194). Unter der Annahme, dass zusätzliche Investitionen typischerweise mit einer Kapitalelastizität von etwa 0,3 zum Potenzialwachstum beitragen (vgl. OECD 2025c), ergibt sich ein marginaler jährlicher Wachstumsimpuls von rund 0,05 Prozentpunkten. Diese Schätzung bezieht sich auf das Potenzialwachstum und berücksichtigt keine kurzfristigen Nachfrageeffekte 5
4 Laut Destatis handelt es sich dabei um das Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen – das heißt: der Neuwert aller Produktionsgüter zum Jahresende, ohne Abzug von Abschreibungen.
5 Diese Überschlagsrechnung ist stark vereinfacht: Sie geht davon aus, dass der gesamte Investitionsbetrag sofort und vollständig produktiv genutzt wird, berücksichtigt keine zeitlichen Verzögerungen oder kurzfristigen Multiplikatoreffekte und basiert auf einer Faustregel für den langfristigen Wachstumsbeitrag. Da das Bruttoanlagevermögen als Bezugsgröße dient, kann der Effekt tendenziell leicht unterschätzt sein.
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Fazit
Zusammenfassend lässt sich der mögliche gesamtwirtschaftliche Wachstumsimpuls durch KI wie folgt abschätzen: Der Anstieg der Totalen Faktorproduktivität wird für Deutschland auf 0,1 bis 0,77 Prozentpunkte geschätzt. Unter Berücksichtigung des Baumol-Effekts reduziert sich diese Spanne auf 0,08 bis 0,64 Prozentpunkte. Hinzu kommt ein zusätzlicher Wachstumsimpuls von rund 0,05 Prozentpunkten durch Kapitalakkumulation infolge KI-bedingter Investitionen, sodass sich ein Gesamteffekt von etwa 0,13 bis 0,69 Prozentpunkten ergibt.
Ausgehend vom durchschnittlichen Wert der vier Deutschland-spezifischen Studien von 0,34 Prozentpunkten ergibt sich nach Abzug des Baumol-Effekts und Hinzurechnung des Investitionsimpulses ein Wert von 0,33 Prozentpunkten. Für die weitere Analyse wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und als leicht konservative Annahme ein Wert von 0,3 Prozentpunkten verwendet.
Dabei ist zu beachten, dass dämpfende Effekte, etwa durch gesellschaftlich problematische Anwendungen (vgl. Acemoglu) oder regulatorische Hürden in Deutschland und Europa (vgl. IWF), nicht berücksichtigt sind. Gleichzeitig bleiben potenziell positive Effekte, wie die Schaffung neuer Aufgaben und Geschäftsmodelle (task creation) sowie eine mögliche Beschleunigung von Forschung und Entwicklung durch KI, ebenfalls weitgehend unberücksichtigt.
Zur Einordnung der Ergebnisse bietet sich im Folgenden ein Blick auf die Projektionen des Produktionspotenzials für Deutschland an. Im Frühjahrsgutachten 2025 schätzt der Sachverständigenrat das Wachstum des Produktionspotenzials für die Jahre 2025 und 2026 auf lediglich 0,3 bis 0,4 Prozent pro Jahr; für den Zeitraum 2027 bis 2030 wird sogar nur ein jährliches Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Dabei wird ein jährlicher Wachstumsbeitrag des Kapitaleinsatzes von 0,3 Prozentpunkten erwartet, während der Beitrag der Totalen Faktorproduktivität zwischen 0,1 und 0,3 Prozentpunkten liegt. Der Faktor Arbeit hingegen wirkt zunehmend wachstumshemmend: Für 2025 und 2026 wird ein negativer Beitrag von jeweils -0,2 Prozentpunkten prognostiziert, der sich bis 2030 weiter verschärft – auf bis zu -0,4 Prozentpunkte jährlich ab 2028. Zusätzliche Investitionen aus dem im März beschlossenen Finanzpaket sowie mögliche KI-Effekte sind in diesen Zahlen nicht explizit ausgewiesen
Im Gegensatz hierzu berücksichtigt das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2025) im deutschen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan die möglichen Effekte des Finanzierungspakets und schätzt das durchschnittliche Wachstumspotenzial Deutschlands bis 2041 auf 0,9 Prozent pro Jahr (technische Annahme, beginnend mit dem Jahr 2025). Künstliche Intelligenz wird zwar als Schlüsseltechnologie genannt, spielt jedoch in der Begründung dieser Schätzung keine explizite Rolle.
Vor diesem Hintergrund könnte ein moderater Wachstumsimpuls durch KI von rund 0,3 Prozentpunkten das Potenzialwachstum im Vergleich zu den niedrigen Zahlen des Sachverständigenrates deutlich erhöhen. Rein rechnerisch würde dies das Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre fast verdoppeln – von etwa 0,3-0,4 Prozent auf rund 0,6-0,7 Prozent pro Jahr – und damit das Produktivitätswachstum substanziell stützen, ohne jedoch ein außergewöhnlich hohes Wachstum zu ermöglichen. In Anbetracht der historischen Produktivitäts- und Wachstumsentwicklung erscheinen die Prognosen der Bundesministerien insgesamt eher optimistisch. Gleichzeitig werden in den Berechnungen des Sachverständigenrates wichtige Impulse, etwa aus dem Finanzpaket, bislang nicht berücksichtigt. Unter Einbeziehung realistischer Effekte von KI dürfte das Potenzialwachstum in Deutschland bis zum
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Ende des Jahrzehnts daher vorsichtig geschätzt bei etwas unter einem Prozent liegen. KI würde zwar einen spürbaren Beitrag leisten, jedoch, wie bereits in anderen Studien angedeutet, kein Produktivitäts- oder Wachstumswunder für Deutschland erwarten lassen (vgl. IW Consult 2025, Stiftung Marktwirtschaft 2025).
3. Standortbedingungen und internationale Einordnung
Die oben vorgestellten Studien zeigen, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei den erwarteten Produktivitätseffekten durch KI durchaus im (oberen) Mittelfeld rangiert – jedoch deutlich hinter Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich. Ursächlich ist unter anderem die sektorale Zusammensetzung: Die deutsche Volkswirtschaft hat einen vergleichsweise geringeren Anteil an wissensintensiven, stark KI-exponierten Dienstleistungssektoren (etwa IT- und Finanzdienstleistungen). In diesen Sektoren lassen sich KI-Lösungen tendenziell leichter skalieren und schneller in produktivitätsrelevante Prozesse integrieren, weshalb Länder mit höherer Dienstleistungsintensität zunächst stärker von KI profitieren könnten.
Um die Position Deutschlands im internationalen KI-Wettbewerb über die Studienergebnisse hinaus fundierter einordnen zu können, empfiehlt sich ein Blick auf zentrale Standortbedingungen, die die Diffusion und wirtschaftliche Wirkung von KI maßgeblich beeinflussen. Diese lassen sich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – grob in die folgenden besonders relevanten Kategorien einteilen: Erstens grundlegende Voraussetzungen wie Infrastruktur, Fachkräfte und Kapital; zweitens Adoptionsbedingungen auf Ebene der Unternehmen; und drittens systemische Umsetzungsbarrieren – insbesondere beim Transfer von Forschungsergebnissen in marktfähige Anwendungen sowie beim Zugang zu und der Nutzung hochwertiger Daten.
Infrastruktur
Zunächst stehen infrastrukturelle Bedingungen im Fokus – darunter die digitale Infrastruktur, die in den oben vorgestellten Studien wenig Beachtung findet. Ein zentraler Aspekt der digitalen Infrastruktur ist der Zugang zu Hochleistungschips, deren Verfügbarkeit maßgeblich über die Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit von KI-Anwendungen entscheidet. Für die EU wird der Bedarf an KI-Chips von Branchenexperten wie Schwarz Digits in den kommenden Jahren auf rund 40 Milliarden Euro geschätzt –für deren Deckung insbesondere Importe aus den USA wesentlich sein dürften Von den Investitionsbedarfen könnten 25-30 Milliarden Euro auf den Aufbau neuer AI-Gigafactories entfallen (mit geschätzten Kosten von drei bis fünf Milliarden Euro pro Standort) und weitere zehn bis 15 Milliarden Euro auf die Nachrüstung bestehender Rechenzentren. Einige Branchenvertreter wie der Digitalverband Bitkom halten diese Schätzung jedoch auch mit Blick auf Deutschland für eher konservativ, da zusätzliche Bedarfe unter anderem für nationale Leuchtturmprojekte, universitäre HPC-Cluster oder Cloud-Infrastrukturen bestehen (Table Media 2025). Zwar verfügt Deutschland laut der OECD (2024c) über eine starke Recheninfrastruktur im Forschungsbereich und rangiert international bei der Anzahl und Leistung wissenschaftlicher Supercomputer weit vorne, doch fehlen industrielle und staatliche Kapazitäten, wie sie etwa in den USA oder China zur Spitzenposition beitragen. Auch bei der digitalen Konnektivität zeigen sich strukturelle Defizite. Deutschland weist im internationalen Vergleich beispielsweise einen geringen Anteil an Hochgeschwindigkeits-Glasfaseranschlüssen auf, der nur langsam ausgebaut wird (OECD 2024c).
Ein weiterer infrastruktureller Engpass betrifft die Energieversorgung. Der Stromverbrauch deutscher Rechenzentren ist seit 2010 kontinuierlich gestiegen und lag bereits 2021 bei rund 17 Milliarden kWh,
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
was 3,3 Prozent der deutschen Stromversorgung entspricht – ein höherer Anteil als in den Niederlanden (2,7 Prozent) oder dem Vereinigten Königreich (2,5 Prozent) (OECD 2024c). Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg auf über 30 Milliarden kWh bis 2030 aus. Die im internationalen Vergleich hohen Strompreise gelten als Standortnachteil (vgl. BDI 2024) und könnten den Ausbau energieintensiver KI-Infrastrukturen bremsen. Für eine zukunftsfähige Entwicklung der KI-Infrastruktur ist daher nicht nur der Ausbau technischer Kapazitäten entscheidend, sondern auch die Verfügbarkeit bezahlbarer und nachhaltiger Energie.
Fachkräfte
Ein weiterer zentraler Standortfaktor betrifft die Verfügbarkeit von Fachkräften (nicht zuletzt im ländlichen Raum) und die Nutzungskompetenz im Umgang mit und der Entwicklung von KI-Technologien. Zwar konnte Deutschland durch gezielte Maßnahmen – etwa die Einrichtung von 150 zusätzlichen KI-Professuren und die Ansiedlung internationaler Talente in Technologiezentren wie Berlin und München – Fortschritte erzielen. Dennoch bleibt der Anteil KI-bezogener Stellenanzeigen hinter Ländern wie den USA oder dem Vereinigten Königreich zurück, und viele Positionen bleiben im Vergleich zu anderen Sektoren überdurchschnittlich lange unbesetzt (OECD 2024). Die OECD sieht fehlende (digitale) Kompetenzen sowie ein begrenztes Verständnis potenzieller Anwendungsfälle als zentrale Hürden für die Umsetzung von KI, insbesondere in KMU. Auch in der BDI-&-BCG-(2025)-Studie wird Talent als eine der wichtigsten Währungen im Wettbewerb um künstliche Intelligenz beschrieben. Insbesondere, da die USA bereits jetzt über den mit fast 60 Prozent der weltweit führenden KI-Forscher größten Talentpool im KI-Bereich verfügen. Es wird betont, dass die Verfügbarkeit qualifizierter KIFachkräfte sich zunehmend zum Engpassfaktor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit entwickelt. Ohne gezielte Investitionen in Ausbildung, Zuwanderung und gesellschaftliche Akzeptanz droht Deutschland im globalen Rennen um KI-Kompetenz weiter zurückzufallen.
Finanzierung
Ergänzend stellen Finanzierungsschwächen eine weitere zentrale Barriere dar. Zwar ist die Zahl der KI-Start-ups in Deutschland in der vergangenen Dekade deutlich gestiegen, doch im internationalen Vergleich ist die Gründungsdynamik ausbaufähig. So gingen zwischen 2013 und 2024 nahezu die Hälfte der Neugründungen von KI-Unternehmen auf die USA zurück, während China bei mehr als 10 Prozent lag. Deutschland rangiert mit fast 400 Neugründungen hinter Frankreich und dem Vereinigten Königreich (Stiftung Marktwirtschaft 2025). Eine zentrale Hürde ist hierbei, dass die Verfügbarkeit von Wagniskapital in Deutschland im internationalen Vergleich deutlich geringer ausfällt. Im Jahr 2022 lagen die Wagniskapital-Investitionen in deutsche KI-Start-ups etwa 14-mal unter denen in den USA und fünfmal unter denen in China; auch Länder wie das Vereinigte Königreich, Indien und Israel verzeichnen höhere Volumina (OECD 2024). Vor dem Hintergrund der rasant steigenden Investitionen in KI insbesondere in den USA – führende Tech-Konzerne wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta planen allein für das Jahr 2025 Kapitalausgaben von über 300 Milliarden US-Dollar, ein erheblicher Teil davon für KI-Infrastruktur (Financial Times 2025) – dürfte die Kluft zu Deutschland seither weiter gewachsen sein. Für eine stärkere wirtschaftliche Wirkung von KI sind daher nicht nur eine leistungsfähige digitale Infrastruktur und ausreichend Fachkräfte erforderlich, sondern auch verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten für technologiegetriebene Start-ups
Zwar bleibt die Finanzierung innovativer Start-ups eine zentrale Herausforderung, doch zeigen aktuelle Entwicklungen, dass zumindest große deutsche Industrieunternehmen zunehmend in KI investieren. So plant zum Beispiel die Robert Bosch GmbH (2025) bis Ende 2027 Investitionen von über 2,5 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz, mit dem Ziel, Prozesse zu beschleunigen und Produkte
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
innovativer zu gestalten. Die die Siemens AG (2025) verfolgt mit Partnern wie Microsoft und NVIDIA die Entwicklung industrieller KI-Lösungen, darunter digitale Zwillinge und softwaredefinierte Automatisierung Auch Schaeffler (2025) setzt auf KI und hat mit NVIDIA eine Technologiekooperation zur Digitalisierung seiner Produktionsprozesse geschlossen Laut dem „BCG AI Radar 2025“ gaben 65 Prozent der in Deutschland befragten Führungskräfte an, ihre KI-Investitionen in den kommenden Monaten erhöhen zu wollen – ein Wert, der jedoch unter dem internationalen Durchschnitt von 73 Prozent liegt Die genannten Beispiele und Befunde verdeutlichen, dass insbesondere größere Unternehmen in Deutschland substanzielle Beiträge zur Entwicklung und Anwendung von KI leisten – sei es durch direkte Investitionen oder durch strategische Kooperationen und Technologieinitiativen. Für kleinere Unternehmen liegen bislang keine systematisch erhobenen Daten zur entsprechenden Aktivität vor.
Adoptionsbedingungen – Unternehmensstruktur, Kultur, regulatorische Aspekte
Neben den infrastrukturellen, wissensbasierten und finanziellen Voraussetzungen beeinflussen auch unternehmensbezogene Rahmenbedingungen, wie stark und schnell KI in der Breite der Wirtschaft ankommt – darunter auch die Unternehmensgrößenstruktur, die in vielen der im vorherigen Kapitel betrachteten Studien bislang wenig Beachtung findet. So zeigt die OECD (2023), dass größere Unternehmen nicht nur häufiger KI einsetzen, sondern auch stärker von deren Produktivitätsvorteilen profitieren – insbesondere, wenn sie über komplementäre digitale Fähigkeiten und Infrastruktur verfügen. Vor diesem Hintergrund könnte die starke Prägung der deutschen Wirtschaft durch den industriellen Mittelstand eine besondere Herausforderung darstellen. In Deutschland zählen 99,3 Prozent der Unternehmen zu den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die 55 Prozent der Beschäftigten und 42 Prozent der Wertschöpfung stellen (Destatis, 2022). Gerade typische Industriebetriebe dürften eigene KI-Expertise und Anwendungen erst ab einer gewissen Größenschwelle wirtschaftlich realisieren können – eine Schwelle, die voraussichtlich höher als KMU und meist auch oberhalb der „Small MidCap Unternehmen“ liegt. Dies unterstreicht die Relevanz, die Diffusion von KI-Technologien in die Breite der Wirtschaft zu fördern und strukturelle Hürden für im weiteren Sinne mittelständische Unternehmen gezielt abzubauen. Für diese Unternehmen wäre entscheidend, dass KI als Dienstleistung kostengünstig und leicht zugänglich angeboten wird
Ergänzend zur Unternehmensgröße können auch kulturelle und organisationale Aspekte die Adoptionsdynamik von KI beeinflussen. In der Literatur wird vereinzelt diskutiert, dass insbesondere in Deutschland kulturelle Faktoren zu einer eher vorsichtigen Einführung neuer Technologien führen könnten, vor allem wenn der kurzfristige Nutzen schwer abschätzbar ist (vgl. Hofstede Insights 2023, OECD 2024). Empirische Studien, die diesen Zusammenhang quantifizieren, sind bislang jedoch kaum vorhanden. Ob und in welchem Umfang solche kulturellen Prägungen die Geschwindigkeit und Tiefe der KI-Diffusion tatsächlich beeinflussen, bleibt daher offen.
Auch das regulatorische Umfeld beeinflusst wie oben angesprochen die Adoptionsdynamik. Unklare oder widersprüchliche Anforderungen – etwa durch den AI Act oder im Zusammenspiel mit europäischen Datenschutzvorgaben – führen zu Rechtsunsicherheit und hemmen Investitionen, insbesondere bei KMU. Ohne praktikable, europaweit einheitliche Regeln droht der Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb an Attraktivität zu verlieren.
Systemische Umsetzungsbarrieren – Forschungstransfer und Datenzugang
Während sich viele Standortfaktoren auf die Voraussetzungen für die Entwicklung und Einführung von KI beziehen, entscheidet sich ihr tatsächlicher wirtschaftlicher Effekt häufig an der letzten Meile – also an der erfolgreichen Übertragung von Forschung in die betriebliche Praxis und am Zugang zu
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
hochwertigen Daten. Genau hier zeigen sich in Deutschland zentrale Schwächen – aber auch ungenutzte Potenziale.
Ein zentrales Hemmnis liegt im begrenzten Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in marktfähige Anwendungen. Trotz einer international starken Forschungsbasis gelingt es bislang nur eingeschränkt, diese in wirtschaftlich relevante Produkte und Prozesse zu überführen – insbesondere im industriellen Mittelstand. Zwar existieren zahlreiche Programme zur Förderung von KI in Unternehmen, doch sind sie oft wenig bekannt, schwer zugänglich oder nicht ausreichend auf die Bedarfe kleinerer Betriebe zugeschnitten (OECD 2024).
Hinzu kommen strukturelle Hemmnisse wie die schleppende Digitalisierung, eingeschränkter Zugang zu hochwertigen Daten und Unsicherheiten im Umgang mit Datenschutz und regulatorischen Anforderungen, die die betriebliche Anwendung von KI erschweren. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind hiervon betroffen. Laut Eurostat (2023) liegt Deutschland beim Digitalisierungsgrad von KMU nur auf Rang sieben innerhalb der EU. Viele Betriebe verfügen weder über strukturierte, interoperable Datenformate noch über die nötigen Kompetenzen zur Integration verschiedener Datenquellen (OECD 2024c). Auch offene Verwaltungsdaten bleiben häufig ungenutzt – obwohl sie für das Training und die Validierung von KI-Modellen von hoher Relevanz wären.
Dabei liegt hier auch eine Chance: Deutschland verfügt über eine Vielzahl an industriellen Datenbeständen, die – bei geeigneten rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen –eine wichtige Grundlage für anwendungsnahe KI-Lösungen bilden könnten.
Fazit
Die im vorherigen Kapitel analysierten Studien liefern wertvolle Hinweise auf die potenziellen Produktivitätseffekte von KI in Deutschland, lassen in der Regel jedoch zentrale Einflussfaktoren außer Acht – etwa die Unternehmensgrößenstruktur, das regulatorische Umfeld oder die begrenzte Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in wirtschaftliche Anwendungen. Während Deutschland in der KI-Forschung international gut positioniert ist, zeigen sich in anderen Bereichen – insbesondere bei der digitalen Infrastruktur, der Fachkräfteverfügbarkeit und der wirtschaftlichen Umsetzung – deutliche Schwächen. Die Studienergebnisse und unsere Einschätzung zum Potenzialwachstum sollten daher mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Position Deutschlands in Teilen zu optimistisch eingeschätzt wird. Um die Chancen von KI zu realisieren und im internationalen Wettbewerb nicht weiter zurückzufallen, müssen diese Defizite gezielt adressiert werden.
4. Handlungsempfehlungen für die Politik
KI bietet Deutschland erhebliche Chancen, Wachstum, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ob diese Potenziale realisiert werden, hängt entscheidend davon ab, wie technologische Entwicklungen in der Praxis umgesetzt und breit nutzbar gemacht werden. Angesichts der Bedeutung des Mittelstands, der leistungsfähigen Wertschöpfungsverbünde von kleinen, mittleren und großen Unternehmen sowie der sektoralen und regionalen Komplexität industrieller Wertschöpfung kommt der Politik eine zentrale Rolle zu: Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit Innovationen wirtschaftlich wirken können.
Die BDI-&-BCG-(2025)-Studie zu Deep Tech, die neben KI auch Robotik, Quantentechnologien, mRNA-Medikamente sowie Gen- und Zelltherapien untersucht, benennt hierfür sechs übergreifende Prioritäten, die als Grundlage für die folgenden Empfehlungen dienen.
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
1. Ziele definieren, rückwärts planen, konsequent umsetzen: Zielbilder je Technologie im Rahmen der Hightech Agenda festlegen und rückwärts in verbindliche Schritte und Deadlines übersetzen
2. Innovationskraft in ausgewählten Technologie-Hubs konzentrieren: Fragmentierte Innovationslandschaft mit über 120 Innovation-Clustern in wenige leistungsfähige TechnologieHubs zusammenführen
3. Förderungen schlagkräftig bündeln statt zerstreuen: Bestehende Förderinstrumente gezielt ausrichten, um das Volumen für die Skalierung europäischer Deep-Tech-Champions zu erhöhen
4. Industrie als Wachstumsmotor für Deep-Tech-Start-ups etablieren: Deep-Tech-Start-ups systematisch mit der Industrie vernetzen, um Innovationskraft, Ressourcen und Skalierungsfähigkeit zu kombinieren
5. Forschungserfolge in wirtschaftlichen Erfolg übersetzen: Tech-Transfer und Kommerzialisierung in Deutschlands großen Forschungseinrichtungen stärken – für mehr wirtschaftliche Wertschöpfung
6. Mit industrieller Stärke Schlüsselpositionen in Wertschöpfung sichern: Frühzeitig Schlüsselrollen in Wertschöpfungsketten identifizieren und besetzen – ergänzt zu ausgewählten Full-Stack-Ansätzen.
Während sich die vorangegangenen Empfehlungen auf Deep Tech insgesamt beziehen, lassen sich für den Bereich der Künstlichen Intelligenz spezifische strategische Prioritäten ableiten. Die BDI-&BCG-Studie (2025) merkt an, dass sich aus der aktuellen Dynamik zwei parallele Rennen im internationalen Wettbewerb ergeben, in die Deutschland eingebunden ist: Das erste betrifft die Entwicklung, Skalierung und Bereitstellung grundlegender KI-Technologien und -Modelle – hier besteht ein deutlicher Rückstand gegenüber Hyperscalern und KI-Pionieren aus den USA und China. Das zweite Rennen betrifft die Entwicklung und Umsetzung von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen auf Basis bestehender KI-Spitzentechnologien. In diesem anwendungsorientierten Wettbewerb liegt Deutschland international auf Augenhöhe und ist in einzelnen Bereichen sogar Vorreiter.
Daraus ergibt sich eine klare strategische Ausrichtung: Im ersten Rennen sollte sich Deutschland auf strategisch relevante Felder wie die „Industrielle KI“ konzentrieren, etwa durch die Entwicklung von „Large Industry Models“ mit spezifischen industriellen Anwendungsfällen. Das größere wirtschaftliche Potenzial liegt jedoch im zweiten Rennen – der Anwendung. Hier bietet sich die Chance, bestehende Stärken auszubauen und neue Kompetenzen zu entwickeln, um eine langfristig führende Position zu sichern.
Die im Juli 2025 verabschiedete Hightech Agenda Deutschland stellt hierfür einen wichtigen ersten Schritt dar. Sie verfolgt das Ziel, bis 2030 zehn Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung durch KITechnologien zu generieren und Deutschland international als führenden KI-Standort zu etablieren. Um diese Ziele zu erreichen, sind jedoch weitere gezielte Maßnahmen erforderlich. Die folgenden drei Handlungsempfehlungen aus der BDI-&-BCG-Studie sind besonders relevant, um KI breitflächig in der deutschen Wirtschaft – insbesondere in der Industrie – zu verankern:
1. Wirtschaft konsequent KI-zentriert neugestalten: Unternehmen aller Größen sollten Produkte, Services und Prozesse nicht nur durch punktuellen KI-Einsatz optimieren, sondern
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
konsequent KI-basiert neu gestalten – mit dem Ziel, neue Geschäftsmodelle, Arbeitsorganisation und Wertschöpfungsketten zu erschließen sowie Effizienz deutlich zu steigern. Nicht zuletzt im industriellen Mittelstand ist es erforderlich eigene Zukunftsszenarien zu entwickeln (vgl. BDI / Z_punkt, 2024)
2. KI-Kompetenz und -Akzeptanz durch nationale Bildungsinitiativen stärken: KI-Kompetenzen sollten in Wirtschaft und Gesellschaft weiter verbreitet werden, etwa durch praxisnahe Programme in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen. Ergänzend trägt die Kommunikation verständlicher und überzeugender Zielbilder (zum Beispiel bis 2030) dazu bei, Orientierung zu bieten und gesellschaftliche Ängste abzubauen.
3. Ausbau souveräner KI-Infrastrukturen: Mit Investitionen in Rechenzentren und Hochleistungsrechner, KI-Gigafabriken, Energieinfrastruktur, Open-Source-Lösungen und die europäische Produktion kritischer Komponenten sollten Deutschland und die EU strategische Abhängigkeiten verringern und langfristig ihre technologische Unabhängigkeit stärken.
Quellenverzeichnis
Acemoglu, D. (2024). The Simple Macroeconomics of AI. April. Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts.
BDI (2024). Transformationspfade für das Industrieland Deutschland. September. Berlin.
BDI und Z_punkt, 2024 Die Zukunft des industriellen Mittelstands in Deutschland 2030. November. Berlin.
Bundesministerium der Finanzen & Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2025). Deutscher mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan für den Zeitraum 2025 bis 2029 Juli. Berlin.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2024). Künstliche Intelligenz: Für mehr Produktivität braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Mai. Berlin.
Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2023). Generative AI at Work. April. National Bureau of Economic Research. Cambridge, Massachusetts.
BCG & BDI (2025). Deep Tech in Deutschland. Strategische Weichenstellungen für ein leistungsstarkes Ökosystem. September. Berlin.
BCG (2025). Zukunftstechnologie KI: 2025 trifft weltweite Dynamik auf deutsche Zurückhaltung. Januar. Köln.
Czarnitzki, D., Fernández, G. and Rammer, C. (2023). Artificial intelligence and firm-level productivity Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 211, pp. 188-205.
Dell’Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. September. Harvard Business School Technology & Operations Management Unit. Boston, Massachusetts.
Destatis (2019). 20,8 Billionen Euro Anlagevermögen in Deutschland Wiesbaden.
Deutscher Bundestag (2025). Finanzplan des Bundes 2025 bis 2029. September. Berlin.
Destatis (2022). Kleine und mittlere Unternehmen. Wiesbaden
Eurostat (2025). Wages and labour costs. Daten extrahiert am 28. März 2025. Luxemburg. (2023). Digitalisation in Europe – 2023 edition. Luxemburg.
EZB (2025). AI can boost productivity – if firms use it. EZB Blog. März. Frankfurt am Main.
---(2024). The Past, Present and Future of European Productivity. Juli. Frankfurt am Main.
Financial Times (2025). Inside the relentless race for AI capacity Juli. London.
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik. (o. J.). Automatisierung von Prüfaufgaben mit KI und Maschinellem Lernen. Abgerufen am 18. August 2025. Kaiserslautern.
Goldman Sachs (2025). AI to drive 165% increase in data center power demand by 2030. Februar. New York City.
(2023). Generative AI could raise global GDP by 7%. April. New York City.
Hofstede Insights (2023). Country comparison: Germany. Hofstede Insights.
IW Consult (2025). Wie wird KI die Produktivität in Deutschland verändern? Gutachten. Auftraggeber: Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft. Februar. Köln.
IWF (2025). Artificial Intelligence and Productivity in Europe. IMF Working Paper WP/25/67. April. Washington DC.
Ju, H., & Aral, S. (2025). Collaborating with AI Agents: Field Experiments on Teamwork, Productivity, and Performance. Massachusetts Institute of Technology. March. Cambridge, Massachusetts.
Kodumuru R., Sarkar S., Parepally V., Chandarana J. (2025). Artificial Intelligence and Internet of Things Integration in Pharmaceutical Manufacturing: A Smart Synergy. Pharmaceutics. Januar. Basel.
McKinsey & Company The cost of compute: A $7 trillion race to scale data centers. April. New York City.
---(2023). The economic potential of generative AI The next productivity frontier. Juni. New York City
MIT NANDA (2025). The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. Juli. Cambridge, Massachusetts
OECD (2025). Macroeconomic productivity gains from Artificial Intelligence in G7 economies. Mai. Paris.
(2025b). Compendium of Productivity Indicators 2025. Paris.
---(2025x). Global long-run economic scenarios 2025 update. Paris
---(2024). The Impact of Artificial Intelligence on Productivity, Distribution and Growth. Key Mechanisms, Initial Evidence and Policy Challenges. OECD Artificial Intelligence Papers. April. Paris.
---(2024b). Miracle or Myth? Assessing the macroeconomic productivity gains from Artificial Intelligence. November. Paris.
---(2024c). OECD-Bericht zu Künstlicher Intelligenz in Deutschland. Juni. Paris.
(2023). A portrait of AI adopters across countries: Firm characteristics, assets’ complementarities and productivity. Februar. Paris.
Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. Februar. Cambridge, Massachusetts.
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance?
Robert Bosch GmbH (2025). KI, die bewegt. Bosch erleichtert mit Algorithmen den Alltag. CEO-Blog. Juni. Gerlingen.
Sachverständigenrat (2025). Frühjahrsgutachten 2025. Mai. Wiesbaden.
Schaeffler AG (2025). Digitale Fertigung: Schaeffler und NVIDIA schließen Technologiekooperation Juni. Herzogenaurach.
Siemens AG (2025). Siemens beschleunigt mit Innovationen und Partnerschaften den Weg zur KIgesteuerten Industrie. März. München.
Stiftung Marktwirtschaft (2025) Künstliche Intelligenz – Wie lassen sich Wachstumspotentiale freisetzen? August. Berlin.
Table Media (2025). KI-Chips aus den USA: Wie groß die Nachfrage in Europa ist. Europe Table #1003. 12. August. Berlin.
vfa & BCG (2024). KI in der Arzneimittelentwicklung. Juni. Berlin.
Impressum
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Breite Straße 29, 10178 Berlin www.bdi.eu
T: +49 30 2028-0
Lobbyregisternummer: R000534
Autor
Frederik Lange
T: +49 30 2028 1734 f.lange@bdi.eu
Redaktion / Grafiken
Dr. Klaus Günter Deutsch T: +49 30 2028 1591 k.Deutsch@bdi.eu
Dr. Thomas Koenen
T: +49 30 2028 1415 t koenen@bdi.eu
Polina Khubbeeva T: +49 30 2028 1586 p.khubbeeva@bdi.eu
BDI Dokumentennummer: D 2162