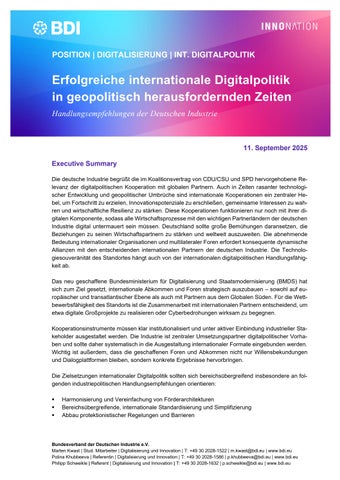POSITION | DIGITALISIERUNG | INT. DIGITALPOLITIK
Erfolgreiche internationale Digitalpolitik in geopolitisch herausfordernden Zeiten
Handlungsempfehlungen der Deutschen Industrie
Executive Summary
11. September 2025
Die deutsche Industrie begrüßt die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD hervorgehobene Relevanz der digitalpolitischen Kooperation mit globalen Partnern Auch in Zeiten rasanter technologischer Entwicklung und geopolitischer Umbrüche sind internationale Kooperationen ein zentraler Hebel, um Fortschritt zu erzielen, Innovationspotenziale zu erschließen, gemeinsame Interessen zu wahren und wirtschaftliche Resilienz zu stärken. Diese Kooperationen funktionieren nur noch mit ihrer digitalen Komponente, sodass alle Wirtschaftsprozesse mit den wichtigen Partnerländern der deutschen Industrie digital untermauert sein müssen. Deutschland sollte große Bemühungen daransetzen, die Beziehungen zu seinen Wirtschaftspartnern zu stärken und weltweit auszuweiten Die abnehmende Bedeutung internationaler Organisationen und multilateraler Foren erfordert konsequente dynamische Allianzen mit den entscheidenden internationalen Partnern der deutschen Industrie. Die Technologiesouveränität des Standortes hängt auch von der internationalen digitalpolitischen Handlungsfähigkeit ab.
Das neu geschaffene Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (BMDS) hat sich zum Ziel gesetzt, internationale Abkommen und Foren strategisch auszubauen – sowohl auf europäischer und transatlantischer Ebene als auch mit Partnern aus dem Globalen Süden. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts ist die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern entscheidend, um etwa digitale Großprojekte zu realisieren oder Cyberbedrohungen wirksam zu begegnen.
Kooperationsinstrumente müssen klar institutionalisiert und unter aktiver Einbindung industrieller Stakeholder ausgestaltet werden Die Industrie ist zentraler Umsetzungspartner digitalpolitischer Vorhaben und sollte daher systematisch in die Ausgestaltung internationaler Formate eingebunden werden. Wichtig ist außerdem, dass die geschaffenen Foren und Abkommen nicht nur Willensbekundungen und Dialogplattformen bleiben, sondern konkrete Ergebnisse hervorbringen
Die Zielsetzungen internationaler Digitalpolitik sollten sich bereichsübergreifend insbesondere an folgenden industriepolitischen Handlungsempfehlungen orientieren:
▪ Harmonisierung und Vereinfachung von Förderarchitekturen
▪ Bereichsübergreifende, internationale Standardisierung und Simplifizierung
▪ Abbau protektionistischer Regelungen und Barrieren
In den Bereichen Künstliche Intelligenz, Datenwirtschaft, Datenschutz, Cybersicherheit und digitale Infrastruktur formuliert der BDI spezifische Handlungsempfehlungen. Dazu zählen unter anderem:
▪ Die internationale Zusammenarbeit im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt zunehmend an Bedeutung, etwa durch Formate wie den AI-Action-Summit oder das KI-Beratungsgremium der Vereinten Nationen. Deutschland engagiert sich über die EU und eigene Expertinnen und Experten aktiv in diesen Prozessen. Der BDI fordert eine strategische Ausweitung der Kooperation mit Fokus auf harmonisierte, technologieoffene und risikobasierte Regulierung, die Innovation fördert und Doppelregulierungen vermeidet. Zudem braucht es eine stärkere Beteiligung deutscher Unternehmen an internationalen Standardisierungsprozessen. Nur durch eine global anschlussfähige KIGovernance kann Europa wettbewerbsfähig bleiben und seiner Verantwortung gerecht werden.
▪ Damit der globale Datentransfer sichergestellt werden kann, müssen Datenlokalisierungsbarrieren in einigen Drittstaaten abgebaut werden. Die Anforderungen an den internationalen Datentransfer müssen rechtssicher gestaltet und fortwährend überprüft werden. Beim Austausch personenbezogener Daten sind Angemessenheitsbeschlüsse nach Art. 45 DSGVO gezielt auszuweiten.
▪ Zur Erhöhung der globalen Cyberresilienz sind internationale Kooperation in Global-GovernanceFormaten sowie bilaterale Kooperationen ein entscheidendes Element. Damit Unternehmen ihre begrenzten Cybersecurity-Kapazitäten möglichst effizient einsetzen zu können, sollte die Bundesregierung auf eine Reduktion der regulatorischen Fragmentierung, standardisierte Meldepflichten für Cybervorfälle und einen effizienteren Austausch von Bedrohungsinformationen hinwirken. Daneben wäre eine enge Einbindung der Wirtschaft in internationale Cyberdialoge wünschenswert.
▪ Um sichere und verlässliche Konnektivität weltweit zu fördern und zugleich die Interessen der deutschen sowie europäischen Industrie zu wahren, sollte digitale Infrastruktur systematisch in internationale Partnerschaften und globale Initiativen eingebunden werden Gleichzeitig muss die strategische Dimension von Standardisierung stärker berücksichtigt und die Entwicklung globaler, verbindlicher Standards, insbesondere in den Bereichen 6G, Wi-Fi und TSN, aktiv vorangetrieben werden Dabei ist die Industrie eng einzubinden und ihre Beteiligung an internationalen Standardisierungs- und Normungsprozessen gezielt zu unterstützen.
Der BDI spricht sich für eine strategisch abgestimmte, innovationsfreundliche und praxisnahe internationale Digitalpolitik aus. Die aktive Einbindung der Industrie in multilaterale Formate ist dabei ebenso zentral wie die gezielte Erweiterung bestehender Dialogformate um weitere wichtige digitalpolitische Partner.
Internationale Kooperationsabkommen
Im aktuellen Koalitionsvertrag hat die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD internationale Kooperation bei digitalpolitischen Themen klar in den Vordergrund gerückt. Vor allem die europäische Zusammenarbeit soll gestärkt werden, indem „Made in Europe“ als globale Marke für digitale Sicherheit, Datensouveränität, Innovation und Fairness etabliert wird. Darüber hinaus sollen Kooperationsabkommen mit globalen Wirtschaftspartnern ausgebaut und Deutschlands Rolle in multilateralen Abkommen zu Normierung und Standardisierung aktiv wahrgenommen werden. Politik und Wirtschaft müssen gemeinsam sicherstellen, dass innerhalb der Prozesse bei Organisationen wie ISO/IEC hier etablierte Sicherheitsanforderungen, Datenschutzprinzipien oder Interoperabilität in globalen Standards berücksichtigt werden
Die strategische Koordination der internationalen Digitalpolitik Deutschlands übernimmt dabei das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (BMDS) Das BMDS versteht sich als zentrale digitale Schnittstelle zu EU, G7, G20, OECD und den Vereinten Nationen. Es ist auch für die Umsetzung der Strategie für Internationale Digitalpolitik verantwortlich. Diese Strategie umfasst neun Grundsätze für Deutschlands digitales Engagement im Ausland, zu denen unter anderem die Förderung sicherer Datenflüsse, der Schutz digitaler Grundrechte und die Stärkung globaler digitaler Infrastrukturen gehören Diese Institutionalisierung der internationalen Kooperation bei Digitalthemen ist ein wichtiger Schritt, sie muss aber auch zu konkreten Ergebnissen und einer starken deutschen Präsenz auf internationaler Bühne führen. Das Ministerium sollte außerdem die Beteiligung industrieller Stakeholder in internationalen Kooperationsabkommen gezielt fördern
Damit Europa in der Triade (Nord-Amerika, EU, Ost-Asien) international wettbewerbsfähig bleibt, ist es unerlässlich, europäische Lösungen zu finden und europäische Produkte zu entwickeln, die auf globalen Märkten skalieren können. Dafür ist beispielsweise der Pakt für Forschung und Innovation in Europa im Rahmen des Planes für die digitale Dekade (Digital Decade Policy Programme 2030, DDPP) vorgesehen. Dabei beteiligen sich die Mitgliedstaaten der EU unter anderem an digitalen Großprojekten, um die europäischen digitalpolitischen Ziele erreichen zu können. Es ist wichtig, solche Instrumente intensiv zu nutzen, um Staaten aneinander anzugleichen und die Kooperation zu fördern. Die Einbindung der Industrie ist dabei essenziell, da sie maßgeblich an der Umsetzung dieser Projekte beteiligt ist und durch die Maßnahmen im internationalen Wettbewerb profitieren muss Zudem können europäische oder bilaterale Beistandserklärungen, beispielsweise mit Frankreich die Resilienz kritischer Infrastrukturen steigern und die digitale Souveränität Europas stärken. Sie sollten weiter institutionalisiert werden und auf existierenden Vereinbarungen und Verträgen aufbauen. Konkrete Maßnahmen könnten eine länderübergreifende technische Unterstützung bei Datenhaltung und digitalen Anwendungen in weitreichenden Krisen- und Notfallszenarien sein
Die Digital Trade Agreements (DTA) der EU bieten Potenzial, um die Zusammenarbeit auch mit Partnern außerhalb der EU zu vertiefen. Aktuell bestehen solche Abkommen mit Singapur und Südkorea. Der BDI spricht sich dafür aus, dieses Format auf weitere Partner auszuweiten, um digitale Handelsbeziehungen zu stärken und gemeinsame Standards zu etablieren. In diesem Zusammenhang sollten auch bilaterale Formate wie die wissenschaftlich-technologischen Kooperationsabkommen (WTZ) stärker auf digitale Themen ausgerichtet werden, beispielsweise in den Bereichen KI, Quantencomputing oder Datenräume.
Im Rahmen internationaler Kooperationen wird die Plattform Industrie 4.0 genutzt, beispielsweise in bilateralen Technologiepartnerschaften mit Ländern wie Japan, Südkorea oder Kanada. Sie ist in mehrere Dialogformate eingebunden und dient als Modell für gemeinsame Projekte, beispielsweise zu
Datenräumen. Dabei ist die Initiierung des International Manufacturing-X Council, um Industrie 4.0 und Datenräume international zu koordinieren, ein wichtiger Schritt In internationalen Abkommen kann die Plattform Industrie 4.0 als Anknüpfungspunkt genutzt werden, um gemeinsame technische Grundlagen und Pilotprojekte zu fördern.
Insbesondere im Wettbewerb und in den Handelsbeziehungen mit Akteuren wie China ist eine enge europäische Zusammenarbeit bei digitalen Großprojekten unerlässlich. Vor diesem Hintergrund sollten bestehende Kooperationen, z. B. transatlantische Abkommen gezielt weiterentwickelt und durch neue Partnerschaften ergänzt werden, um gemeinsame globale Standards zu fördern und die digitale Souveränität Europas zu stärken. Insbesondere die für Deutschland so wichtigen KMU profitieren von der Durchgängigkeit digitaler Standards in ihren globalen Märkten.
Um aktiv von den hier genannten internationalen digitalpolitischen Kooperationen Deutschlands zu profitieren, sind effektive und zugängliche Unterstützungsprogramme für digitalwirtschaftliche Projekte und deren Vermarktung von Unternehmen von zentraler Bedeutung. Auf europäischer Ebene gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Förderinitiativen, die Unternehmen beim Roll-out digitaler Technologien auf globalen Märkten unterstützen sollten. Die Rede ist unter anderem von „Digital Europe“, „Invest AI“, „Invest EU“ oder auch die IPCEIs Der Ansatz, Unternehmen direkt zu unterstützen, ist gut gemeint, in der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele dieser Programme aufgrund hoher Komplexität, mangelnder Transparenz und aufwendiger Antrags- sowie Berichtspflichten ihr Potenzial nicht vollständig entfalten können. Hinzu kommt die große Anzahl an parallelen Programmen mit teils überlappenden Zielsetzungen. Vor allem KMU kommen durch eine komplizierte Antragstellung, Informationsmangel oder Reporting-Pflichten an ihre Grenzen und werden so indirekt ausgeschlossen Dies führt dazu, dass selbst gute konzipierte Programme als Fehlschlag enden können, da die Unternehmen, auf die die jeweiligen Programme abzielen, keine Kenntnis vom Programm haben oder an komplizierter Antragsstellung scheitern. Ein entscheidendes Anliegen muss daher die Vereinfachung und Bündelung bestehender Förderarchitekturen sein. Eine zentrale, leicht zugängliche Anlaufstelle („One-Stop-Shop“), die Unternehmen eine passgenaue Orientierung im Förderdschungel ermöglicht, wäre ein wichtiger Schritt hin zu mehr Wirksamkeit. Dieser „Simplification“-Ansatz muss konsequent umgesetzt werden, um die Teilhabe am nationalen und europäischen Fördersystem zu verbessern.
Die im Rahmen der International Digital Strategy der Europäischen Kommission vorgestellte EU Tech Business Offer zeigt in diesem Kontext Potenzial. Entscheidend ist jedoch, dass auch dieses Instrument nicht in einem übermäßig bürokratischen Rahmen verharrt, sondern durch vereinfachte, praxisnahe Verfahren allen Unternehmen offensteht.
Des Weiteren wurden die Digital for Development (D4D) Hubs als strategische Multi-StakeholderPlattform geschaffen, um die Kooperationen der EU mit Partnerländern in Lateinamerika, Afrika oder Asien zu fördern. Diese bieten die Möglichkeit, europäische Digitalprojekte in der Entwicklungszusammenarbeit zu koordinieren und so die Wirkung europäischer Initiativen zu bündeln und zu verstärken.
Internationale Foren
Ein zentrales Forum der deutschen Digitalaußenpolitik sind die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) initiierten und vom neu geschaffenen BMDS weitergeführten Internationalen Digitaldialoge. Dabei handelt es sich um Dialogformate mit strategisch wichtigen Partnerländern wie beispielsweise Indien, Singapur oder Brasilien. Das Ziel dieser Dialoge ist es, einen strukturierten Austausch zu zentralen digitalpolitischen Themen zu ermöglichen – darunter digitale Regulierung,
Datenpolitik, Internet-Governance, neue Technologien und digitale Geschäftsmodelle. Um das volle Potenzial der Digitaldialoge auszuschöpfen, sollte in Erwägung gezogen werden, die wichtigsten Wirtschaftspartner der deutschen Industrie in das Format aufzunehmen, wie zum Beispiel Kanada und Australien. Zudem muss der Wirtschaftsfokus des Formats geschärft und Industrievertreter künftig stärker eingebunden werden. Zentrales Ziel der Dialoge sollte sein, die Rahmenbedingungen für den Einsatz und die Verbreitung digitaler Technologien in internationalen Wirtschaftsbeziehungen unter Einbeziehung der Industrie zu verbessern.
Die Digitaldialoge sind als Multi-Stakeholder-Initiative konzipiert – ein Format, welches zum Beispiel auch beim Internet Governance Forum (IGF) der Vereinten Nationen Anwendung findet. Diese Formate bieten der deutschen Industrie eine wichtige Plattform, um sich in Drittstaaten industriepolitisch zu positionieren, regulatorische Entwicklungen frühzeitig mitzugestalten und internationale Standards aktiv mitzuprägen. Sowohl die Digitaldialoge als auch das IGF leisten einen Beitrag zur geopolitischen Diversifizierung digitaler Partnerschaften und stärken langfristig die digitale Transformation Europas. Allerdings sollte die Beteiligung von Wirtschaftsvertretern gezielt gefördert werden.
Mit der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) existiert zudem eine Organisation, die exemplarisch zeigt, wie technische Koordination und internationale Zusammenarbeit erfolgreich ineinandergreifen können. ICANN verwaltet als gemeinnützige Organisation die globalen Adressierungsressourcen des Internets – also Domainnamen und IP-Adressen – und sorgt so für Stabilität, Sicherheit und Interoperabilität im Netz. Sie gilt als Blaupause für funktionierende globale Internetverwaltung. Die Aufrechterhaltung dieser Organisation ist von großer Bedeutung, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Zivilgesellschaft, da sie die Grundlage für ein funktionierendes Internet bildet.
Auch neue Formate wie der Japan-EU-Rat für Digitale Partnerschaft sowie Handels- und Technologieräte (TTC), beispielsweise von der EU gemeinsam mit Indien, gewinnen an Bedeutung. Sie bieten strukturierte Plattformen für die Abstimmung digitalpolitischer Agenden mit geopolitisch relevanten Partnern außerhalb der EU und ermöglichen die Entwicklung gemeinsamer Standards in Bereichen wie KI, Datenflüsse oder Cybersicherheit.
Auch wenn TTC-Formate mit Partnern wie Japan oder Indien zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist der transatlantische TTC zuletzt ins Stocken geraten. Für die deutsche Industrie ist es entscheidend, dass insbesondere transatlantische Austauschformate aufrechterhalten werden und auch in geopolitisch schwierigen Zeiten belastbar bleiben. Zudem sollten sie nicht nur politische Willensbekundungen hervorbringen, sondern konkrete, verbindliche Ergebnisse in Form von regulatorischer Kohärenz, gemeinsamen Standards und industriepolitischen Initiativen liefern.
Im Rahmen der G20 Digital Economy Working Group werden globale Herausforderungen der digitalen Transformation adressiert, wie etwa digitale Inklusion, Infrastrukturentwicklung oder digitale Kompetenzen. Deutschland sollte sich hier weiterhin aktiv einbringen, auch um eigene Interessen zu vertreten und globale industrielle Leitlinien mitzugestalten.
Die OECD sollte als Partner für die engere Zusammenarbeit zurate gezogen werden. Beispielsweise entwickelt die seit 2019 bestehende Arbeitsgruppe für „Digital Security“ (WPDS) der OECD politische Analysen, praktische Anleitungen und Empfehlungen, um Vertrauen in die digitale Transformation zu schaffen sowie die Resilienz, Kontinuität und Sicherheit kritischer Aktivitäten zu fördern.
Des Weiteren spielen die NATO und ihre Partner eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Cybersicherheit auf globaler Ebene. Die NATO hat umfangreiche Erfahrungen und Ressourcen im
Bereich Sicherheit und Verteidigung sowie der Cybersicherheit, die durch die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedstaaten und Partnern weiter gestärkt werden können. Durch die Koordination mit den NATO-Partnern können bewährte Praktiken und Technologien ausgetauscht werden, was zu einer verbesserten Abwehr von Cyberbedrohungen führt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, gemeinsame Standards und Protokolle zu entwickeln, die die Resilienz gegenüber Cyberangriffen erhöhen und die Sicherheit kritischer Infrastrukturen gewährleisten.
Insgesamt gilt: Internationale Foren sind essenziell, um die deutsche und europäische Digitalpolitik global anschlussfähig zu gestalten. Sie bieten die Möglichkeit, aktiv bei technologischen Entwicklungen mitzuwirken, Werte wie Datenschutz und digitale Souveränität zu verankern und gleichzeitig wirtschaftliche Interessen zu vertreten. Der BDI spricht sich daher für eine strategische Weiterentwicklung und stärkere Verzahnung dieser Foren aus – unter aktiver Einbindung der Industrie
Künstliche Intelligenz
Bisherige Kooperationen im Bereich Künstliche Intelligenz
Die internationale Zusammenarbeit und auch der Wettbewerb im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) haben in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik gewonnen. Angesichts der zunehmenden Komplexität KI-basierter Systeme und ihrer globalen Auswirkungen ist eine koordinierte Governance über nationale Grenzen hinweg unerlässlich. Deutschland ist über die EU und eigene Initiativen in mehreren relevanten Formaten aktiv.
Wichtige Formate waren der KI-Sicherheitsgipfel in Bletchley Park, der KI-Gipfel in Seoul sowie das Folgeformat der AI-Action-Summit, bei dem erstmals Staaten wie die USA, UK, China, die EU und weitere Partner gemeinsame Prinzipien zur Sicherheit und anschließend zum Innovationspotenzial von KI diskutierten. Allerdings wurden beim letzten AI-Action-Summit nur wenige deutsche Unternehmensvertreter und Verbände eingeladen, was im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit aller relevanten Stakeholder wichtig wäre
Auf Ebene der Vereinten Nationen wurde ein KI-Beratungsgremium eingerichtet, das Empfehlungen für eine globale KI-Governance erarbeiten soll. Auch hier bringt sich Deutschland über die EU und eigene Expertinnen und Experten ein. Ergänzend dazu existieren technische Standardisierungsformate wie die Object Management Group (OMG), die international an der Definition technischer Standards für KI-Systeme arbeitet. Diese Formate sind für die Industrie besonders relevant, da sie die Grundlage für Interoperabilität und Rechtssicherheit schaffen.
BDI-Forderungen zu digitalpolitischen Kooperationsabkommen im Bereich KI
Die Industrie fordert einen deutlichen und strategischen Ausbau der internationalen Zusammenarbeit im Bereich KI. Ziel muss eine harmonisierte, innovationsfreundliche und technologieoffene Regulierung sein, die Unternehmen Planungssicherheit bietet und gleichzeitig ethische Grundsätze wahrt. Der BDI spricht sich für die Schaffung und Weiterentwicklung von Formaten aus, die regulatorische Kohärenz fördern und die wirtschaftliche Skalierbarkeit von KI-Anwendungen ermöglichen. Dafür sollten aus Sicht der Industrie folgende Punkte berücksichtigt und umgesetzt werden:
▪ Harmonisierung regulatorischer Rahmenbedingungen: Es braucht eine international abgestimmte Gesetzgebung mit sich ergänzenden – nicht konkurrierenden – Regulierungsansätzen, um ein konsistentes Level Playing Field zu sichern, Innovation zu ermöglichen und
Risiken marktübergreifend zu minimieren. Der risikobasierte Ansatz des AI-Acts der EU muss konsequent umgesetzt werden, da er das Potenzial hat, über die Grenzen Europas hinaus als Blaupause zu dienen. Indem die EU eine Vorreiterrolle einnimmt, kann sie die globalen Standards für KI mitgestalten, anstatt nur den Weg anderer nachzugehen.
▪ Simplifizierung bestehender Regulierungsansätze wie des AI-Acts: Der AI-Act muss unternehmensfreundlicher und praxisnäher gestaltet werden. Eine rechtssichere und konsistente Regulierung von Produkten mit digitalen Komponenten, die bereits durch sektorale Verordnungen unter dem NLF (wie z. B. Maschinenverordnung, Medizinprodukteverordnung etc.) erfasst sind, muss sichergestellt werden. Doppelregulierungen müssen vermieden werden. Sie führen nicht zu Vertrauen, sondern im Gegenteil zu Rechtsunsicherheit sowie Inkonsistenzen und hemmen dadurch eine praktikable Rechtsanwendung und Innovation.
▪ Technologieoffene und risikobasierte Regulierung: Die Regulierung von KI sollte offen gegenüber verschiedenen Technologien bleiben und sich an einem risikobasierten Ansatz orientieren. Nur so lassen sich gesellschaftliche, sicherheitspolitische und ökologische Risiken minimieren und gleichzeitig innovative KI-Anwendungen fördern. Gesetzgebung muss verhältnismäßig und unbürokratisch bleiben – insbesondere Berichtspflichten und Haftungsregelungen dürfen Unternehmen nicht übermäßig belasten und Innovation und Uptake von KI in Deutschland und der EU verhindern. Der BDI unterstützt daher den Rückzug der geplanten KI-Haftungsrichtlinie durch die EU-Kommission.
▪ Internationale Kohärenz: Definitionen, Kategorien, Terminologien, Ontologien und Taxonomien sollten international abgestimmt und auf bestehenden Standards – etwa der OECD –aufgebaut werden, um regulatorische Kohärenz zu fördern.
▪ Regulatorische Interoperabilität: Regulierungsrahmen sollten sich auf internationale statt auf lokale Standards stützen, um regulatorische Interoperabilität zu ermöglichen. Diese erleichtert nicht nur die Einhaltung von Vorschriften in ausländischen Märkten und schafft Einheitlichkeit für Verbraucher, sondern erlaubt auch Ländern mit unterschiedlichen regulatorischen Reifegraden den Rückgriff auf etablierte Expertise. Beispiele hierfür sind ISO 42001 für KI-Managementsysteme, ISO 22989 für KI-Terminologie sowie das öffentlich zugängliche NIST AI Risk Management Framework. Auch der internationale Verhaltenskodex für fortgeschrittene KI-Systeme im Rahmen des Hiroshima AI Process (HAIP) bietet einen praxisnahen Rahmen. Er definiert elf Maßnahmen, darunter die Identifikation und Minderung von Risiken über den gesamten KI-Lebenszyklus, die Kommunikation von Einsatzgrenzen, das Teilen von Informationen und die Implementierung robuster Sicherheitskontrollen. Diese Ansätze verdeutlichen die Relevanz internationaler Zusammenarbeit und flexibler, risikobasierter Rahmenwerke für die Entwicklung global anschlussfähiger KI-Ökosysteme.
▪ Zusammenspiel von KI und Cybersicherheit: Es braucht ein stärkeres gesetzgeberisches Bewusstsein für die beiden Domänen „Sicherheit“ und „Cybersecurity“. Einerseits unterscheiden diese sich stark in Bezug auf Definitionen, Bedrohungen, Risiken, Ziele und Maßnahmen zur Risikominderung. Hier braucht es an verschiedenen Stellen noch mehr Klarheit und Rechtssicherheit. Dazu gehört auch, dass KI-Verordnung mit sektorspezifischem Recht, wie der RED, CRA, NIS2, abgeglichen werden muss, um ihren Sinn und Zweck verwirklichen zu können. Gleichzeitig ist die Schadenswirkung längst nicht mehr nur auf den digitalen Raum begrenzt, sondern kann ganz reale und physisch messbare Auswirkungen haben, weswegen auch die Wechselwirkungen zwischen Sicherheit und Cybersecurity berücksichtigt werden müssen.
▪ Stärkung des KI-Ökosystems: Die Förderung von KI-Kompetenz, Fachkräften und Infrastruktur ist zentral. Dazu gehören neben verstärkter beruflicher und rollenspezifischer Weiterbildung (im Sinne Artikel 4 AI-Act) insbesondere der Ausbau von Halbleiterlieferketten, Hochleistungsrechenzentren (HPC), ganzheitliche Ansätze zur Stärkung des gesamten KI-Ökosystems sowie die Sicherstellung der zeitnahen Möglichkeit zur Testung und Markteinführung von entwickelten Lösungen unter Einbeziehung industrieller Partner.
▪ Internationale Standards für vertrauenswürdige KI: Es sollten international anschlussfähige, technisch fundierte und leistungsbasierte Standards entwickelt werden, ergänzt durch eine Regulierung, die ethische Prinzipien und demokratische Werte berücksichtigt und gleichzeitig rechtliche Klarheit für Unternehmen schaffen. Das KI-Managementsystem ISO 42001 (AIMS) etwa ermöglicht Organisationen die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung von KI durch technische und organisatorische Maßnahmen. Es ist freiwillig, risikobasiert und baut auf bestehenden Zertifizierungen in Cybersicherheit und Datenschutz auf, wobei es mit dem NIST Risk Management Framework kombinierbar ist. AIMS ist für alle Organisationstypen konzipiert und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie dem EU AI Act durch weltweit anerkannte Zertifizierungen. Die Norm wurde in einem dreijährigen, konsensbasierten Prozess von ISO und IEC unter Beteiligung von 64 Ländern und über hundert Experten und Expertinnen entwickelt. Sie schafft Vertrauen durch unabhängige Prüfungen, erleichtert die Zusammenarbeit in komplexen Lieferketten und hilft bei der Erbringung regulatorisch geforderter Nachweise.
Deutsche Unternehmen und Institutionen sollten sich aktiv in internationalen Standardisierungsgremien wie ISO, IEC, ETSI und OMG einbringen und seine Rolle als Brückenbauer zwischen technischen, ethischen und wirtschaftlichen Anforderungen stärken.
Bilaterale Formate wie der TTC sollten aufrechterhalten und um weitere Partner wie Indien oder Kanada ergänzt werden. Auch die Beteiligung der Industrie muss systematischer erfolgen – etwa durch strukturierte Stakeholder-Formate und Pilotprojekte. Nur durch eine strategisch abgestimmte, international anschlussfähige KI-Governance kann Europa seine Wettbewerbsfähigkeit sichern und gleichzeitig globale Verantwortung übernehmen.
Datenwirtschaft / Datenschutz
Bisherige Kooperationen im Bereich Daten
Die Nutzung und der Austausch von Daten sind zentrale Treiber der digitalen Transformation und Grundlage für neue Geschäftsmodelle, effizientere Produktionsprozesse und internationale Wertschöpfungsketten. Daten gelten zunehmend als strategische Ressource – sowohl für Unternehmen als auch für Staaten. In einer global vernetzten Wirtschaft ist der grenzüberschreitende Datenverkehr daher von entscheidender Bedeutung. Es ist deshalb gut und wichtig, dass sich die EU-Kommission –anknüpfend an die EU-Datenstrategie (2020) – mit der Datenwirtschaft befasst. Die EU-Digitalstrategie sollte dabei eng mit den laufenden Prozessen zur EU-Data Union Strategy, insbesondere mit dem hierin enthaltenen Teil zum internationalen Datentransfer abgestimmt sein.
In einer globalisierten Welt sollte der Grundsatz eines freien Datenflusses (Free-Flow-of Data) weiterhin das Grundprinzip des internationalen Datentransfers sein. Dennoch stellen protektionistische Ansätze in Drittländern die deutsche Industrie weiterhin vor Herausforderungen. Die EU-Kommission sollte deshalb in Handelsabkommen weiterhin darauf hinwirken, protektionistische Aktivitäten
abzubauen. Um die rechtliche Sicherheit beim internationalen Datenaustausch zu erhöhen, sollten Anforderungen aus DSGVO (Kapitel V), Data Act (Art. 32) und Data Governance Act (Art. 31) klarer und besser aufeinander abgestimmt werden. Parallel dazu muss auch innerhalb Europas der bestehende Rechtsrahmen zum Schutz sensibler Daten kritisch überprüft werden. Neben der DSGVO, dem Data Governance Act, der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie und nunmehr auch dem EU-Data Act besteht in Bezug auf den internationalen Datenverkehr eine Vielzahl an gesetzlichen Regelungen, die teilweise einander entgegenstehende Grundrechte und Interessen berühren Es besteht ein Bedarf an Leitlinien für technische und organisatorische Maßnahmen zwischen Data Act, DGA, ODD, GDPR und der Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse, um hier für einheitliche Vorgaben bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Schutzniveaus zu sorgen. Das Verbot von Datenlokalisierungspflichten innerhalb der EU muss aufrechterhalten bleiben. Für international vernetzte Datenräume – etwa im Rahmen von Initiativen wie International Manufacturing-X – braucht es zudem klare rechtliche Rahmenbedingungen. Die EU sollte international anschlussfähige, zugleich aber wertebasierte Datenräume fördern, um digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit Europas zu sichern.
Wir befürworten die Einbindung der G7-Initiative „Data Free Flow with Trust“ sowie eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der OECD, um ein praktikables und verlässliches Rahmenwerk für internationale industrielle Datenflüsse zu schaffen. Solche Datenflüsse sind entscheidend für die grüne Transformation der Industrie und die Umsetzung von Regulierungsvorgaben wie CSDDD, CSRD oder digitalen Produktpässen.
Der transatlantische Datenverkehr ist ein zentrales Beispiel für die Herausforderungen und Chancen internationaler Datenkooperation. Die wiederholte Aufhebung von Angemessenheitsbeschlüssen durch den Europäischen Gerichtshof hat gezeigt, wie sensibel das Gleichgewicht zwischen Datenschutz, wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit und geopolitischer Stabilität ist. Gleichzeitig zeigt das neue EU-U.S. Data Privacy Framework, dass politische Einigungen möglich sind – sofern gemeinsame Werte und Standards zugrunde liegen.
BDI-Forderungen zu digitalpolitischen Kooperationsabkommen im Bereich Daten
Auch in anderen Regionen bestehen Potenziale für datenpolitische Kooperationen. So könnten etwa digitale Partnerschaften mit Ländern des Globalen Südens genutzt werden, um souveräne und sichere Datenräume zu schaffen, die sowohl wirtschaftliche Entwicklung als auch digitale Souveränität fördern. Dabei ist es entscheidend, dass europäische Unternehmen nicht durch protektionistische Maßnahmen benachteiligt werden.
Konkret fordert der BDI:
▪ Abbau protektionistischer Datenbarrieren: In vielen Drittstaaten bestehen gesetzliche Hürden, insbesondere in Form von Datenlokalisierungsvorschriften, die den grenzüberschreitenden Datenfluss einschränken und europäische Unternehmen benachteiligen. Diese Tendenzen müssen durch internationale Abkommen und digitale Partnerschaften gezielt adressiert werden – unter Wahrung des Schutzes industriellen Know-hows.
▪ Stärkung europäischer Interessen in globalen Datenregimen: Die EU sollte sich aktiv in multilaterale Foren zur Datenpolitik einbringen und dabei sowohl Datenschutz als auch wirtschaftliche Interessen vertreten. Ziel muss es sein, einen souveränen, sicheren und innovationsfreundlichen Austausch von Daten auf globaler Ebene in größtmöglichem Umfang sicherzustellen.
▪ Rechtssicherheit beim internationalen Datentransfer: Unternehmen benötigen verlässliche und praktikable Regelungen für den Austausch personenbezogener und nicht-personenbezogener Daten. Die EU sollte daher die Möglichkeit von Angemessenheitsbeschlüssen gemäß Art. 45 DSGVO gezielt ausweiten und den bestehenden Rechtsrahmen im Verhältnis zu nicht-personenbezogenen Daten harmonisieren, um für mehr Rechtsklarheit zu sorgen
▪ Internationale Standards für Datenaustausch und Interoperabilität: Es braucht industriegetriebene, international anschlussfähige Standards – etwa für Datenräume oder die Erfüllung der Vorgaben der neuen EU-Digitalrechtsakte (insb. AI-Act, Data Act) – um die Interoperabilität zwischen Systemen zu gewährleisten und Innovationen zu fördern. Die EU sollte ihre Präsenz und die Mitwirkung von Unternehmen und Institutionen aus der EU in internationalen Standardisierungsgremien gezielt stärken.
Cybersicherheit
Bisherige Kooperationen im Bereich Cybersicherheit
Die zunehmende globale digitale Vernetzung führt zu einer stetig wachsenden Bedrohungslage im Cyberraum Exponierte Individuen, öffentliche Institutionen, Unternehmen und Kritische Infrastrukturen sehen sich immer häufiger gezielten Cyberangriffen ausgesetzt. Allein der deutschen Industrie entstand im vergangenen Jahr durch Cyberkriminalität ein Schaden von rund 179 Milliarden Euro. Für Unternehmen, Behörden und Privatpersonen ist Cybersecurity längst zu einer existenziellen Herausforderung geworden.
Internationale Kooperationen sind daher essenziell, um der globalen Bedrohungslage wirksam zu begegnen. Die US-EU Cyber-Dialoge bilden ein mögliches zentrales Forum für den transatlantischen Austausch zu Fragen der Cybersicherheit. Global fungieren G20 und G7 als übergreifende Plattformen zur Koordination digitalpolitischer Themen, einschließlich Cybersicherheit, Post-Quantum-Kryptografie und Resilienzstrategien. Solche Formate bieten wichtige Foren zum Austausch Best Practices und der Abstimmung von Eckpunkten für regulatorische Ansätze und den Aufbau gemeinsamer Schutzmechanismen.
Gleichzeitig bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen bei der regulatorischen Angleichung. Unterschiedliche nationale und regionale Regelwerke, wie die NIS-2-Richtlinie in der EU und der Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act in den USA, führen zu einer Fragmentierung, die insbesondere für international tätige Unternehmen mit hohem administrativem Aufwand und Unsicherheiten verbunden ist. Auch bestehende Plattformen zum Austausch von Bedrohungsinformationen sind bislang nicht interoperabel, was die Reaktionsfähigkeit auf neue Bedrohungen einschränkt.
Die deutsche Industrie begrüßt ausdrücklich die Bemühungen der EU, mit dem Cyber Resilience Act (CRA) ein Mindestmaß zur Cybersicherheit von Produkten mit digitalen Komponenten zu etablieren. Gleichzeitig ist es entscheidend, dass diese Anforderungen international anschlussfähig sind und nicht zu einer weiteren Fragmentierung führen. Die gegenseitige Anerkennung internationaler Zertifizierungen und Labels muss daher integraler Bestandteil internationaler Abkommen sein, um Fragmentierung zu minimieren. Die aktuellen Aktivitäten der EU, europäische Normen von internationalen Normen zu entkoppeln, gefährden diese notwendigen Maßnahmen.
BDI-Forderungen zu digitalpolitischen Kooperationsabkommen im Bereich Cybersicherheit
Der BDI begrüßt die Einrichtung und Weiterentwicklung europäischer, bilateraler und internationaler Dialogformate im Bereich Cybersicherheit. Um die Wirksamkeit dieser Formate zu erhöhen, ist jedoch eine systematische Einbindung der Wirtschaft unerlässlich.
Konkret fordert der BDI:
▪ Einbindung der Wirtschaft in internationale Cyberdialoge: Formate wie der US-EU-CyberDialog sollten für Unternehmensvertreter geöffnet werden. Unternehmen verfügen über praxisnahe Erfahrungen im Umgang mit Bedrohungslagen und können wertvolle Beiträge zur Ausgestaltung von Resilienzstrategien leisten. Die direkte Beteiligung der Industrie würde dementsprechend die Wirksamkeit internationaler Kooperationen deutlich steigern
▪ Globale Harmonisierung regulatorischer Anforderungen: Die Vielzahl nationaler Cybersecurity-Regelwerke erschwert es international tätigen Unternehmen, einheitliche Sicherheitsstandards umzusetzen. Die EU sollte internationale Partnerschaften – etwa im Rahmen des EU-Indien-TTC – nutzen, um Definitionen (z. B. „kritische Infrastrukturen“, „Sicherheitsvorfälle“) zu vereinheitlichen, internationale Standards wie ISO/IEC 27001, IEC 62443 oder ISO 21434 zu fördern, Best Practices auszutauschen und global ein einheitliches Mindestmaß an Cybersicherheit zu etablieren (z. B Mindestzeitraum zur Versorgung mit Sicherheits-Updates)
▪ Standardisierte Meldepflichten für Cybervorfälle: Unterschiedliche Anforderungen an die Meldung von Sicherheitsvorfällen führen zu erheblichem administrativem Aufwand. Die EU sollte gemeinsam mit internationalen Partnern einheitliche, risikobasierte Meldepflichten entwickeln, um Unternehmen zu entlasten und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit auf Bedrohungen zu verbessern. Dabei sollten jedoch auch legitime Schutzbedürfnisse von Unternehmen und Staaten mitberücksichtigt werden (Stichwort: staatliche Akteure, Industriespionage).
▪ Effizienter Austausch von Bedrohungsinformationen: Der schnelle Zugang zu aktuellen Informationen über neue Angriffsmuster ist entscheidend für die Cyberresilienz. Bestehende Plattformen zum Austausch von Bedrohungsinformationen, insbesondere zwischen vertrauenswürdigen Partnerstaaten sollten unter Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen und unter Berücksichtigung industriepolitischer Sensibilitäten weiterentwickelt werden. Ziel sollte sein, den Informationsfluss für Unternehmen zu verbessern, ohne dabei sicherheitsrelevante oder strategische Bedenken einzelner Mitgliedstaaten zu vernachlässigen Der Austausch von Informationen sollte in beide Richtungen sichergestellt werden: Neben Meldungen über Sicherheitsvorfälle und Cyberangriffe an die staatlich koordinierte Plattform sollten Unternehmen über diese Plattform tagesaktuelle Cybersicherheitslageinformationen erhalten.
▪ Internationale Anerkennung von Sicherheitszertifizierungen: Um den Marktzugang zu erleichtern und Konformitätskosten zu senken, sollten gegenseitige Anerkennungsmechanismen für Sicherheitszertifikate – etwa für hoch kritische Produkte im Rahmen des Cyber Resilience Acts – in internationale Abkommen integriert werden. Eine weitere Fragmentierung von Produktanforderungen und Labels muss vermieden werden.
▪ Stärkung europäischer Präsenz in Normungsgremien: Die Beteiligung in internationalen Standardisierungsorganisationen (z. B. ISO, IEC) von europäischen Expertinnen und Experten muss weiter gefördert und ausgebaut werden, um der wachsenden Einflussnahme autoritärer Akteure entgegenzuwirken und die Interessen der europäischen Industrie zu wahren Dazu sind u. a. finanzielle Anreize unerlässlich. Digitale Gesetzgebung sollte sich konsequent auf europäische oder international anerkannte Standards beziehen, wobei eine Übernahme von
anerkannten internationalen Normen ins europäische Normenwerk berücksichtigt werden sollte
Nur durch eine insgesamt strategisch abgestimmte, international anschlussfähige und wirtschaftsnahe Cybersicherheitsarchitektur kann Europa seine digitale Anschlussfähigkeit langfristig sichern, seine legitimen Interessen wahren und gleichzeitig globale Verantwortung übernehmen.
Digitale Infrastruktur
Bisherige Kooperationen im Bereich digitale Infrastruktur
Digitale Infrastruktur spielt eine wesentliche Rolle bei der Schaffung von Wohlstand für die Menschen und die Gemeinschaften, in denen sie leben und arbeiten. Zum einen erfordern digitale Geschäftsmodelle, die in Verbindung mit dem Internet der Dinge (IoT), autonomen Fahrzeugen, KI sowie dem industriellen Metaverse stehen, leistungsfähige digitale Netze. Zum anderen ist gut funktionierende digitale Infrastruktur Voraussetzung für den effizienten Transport von Gütern und erleichtert den Marktzugang – was letztlich das Wirtschaftswachstum und die internationale Vernetzung fördert. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die die globale digitale Infrastruktur belasten und beeinträchtigen. Dazu gehören: Unzureichende Investitionen, Cyber-Schwachstellen sowie ein Mangel an strategischer Redundanz zur Risikominderung bei einem möglichen Infrastrukturausfall.
Die EU hat mit dem Aktionsplan zur Sicherheit von Unterseekabeln erste Schritte unternommen, um die physische Infrastruktur des Internets zu schützen. Unterseekabel bilden die Grundlage globaler Konnektivität und sind zunehmend Ziel geopolitischer Spannungen. Der Aktionsplan sieht koordinierte Maßnahmen zur Prävention, Detektion und Reaktion vor und fördert die Zusammenarbeit mit Partnern wie der NATO und der G7. Die EU sollte ihre sogenannte „Kabel-Diplomatie“ verstärkt auch auf Partner in Afrika, Lateinamerika und dem Indo-Pazifik ausweiten und dabei die Industrie aktiv einbinden.
Auch die internationale Standardisierung im Informations- und Kommunikationstechnologie-(IKT-)Bereich ist zentral. Besonders relevant ist hier die Arbeit in der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und in Projekten wie dem 3rd Generation Partnership Project (3GPP), das als zentrales Gremium für die Entwicklung globaler Mobilfunkstandards – wie 5G und künftig 6G – fungiert.
BDI-Forderungen zu digitalpolitischen Kooperationsabkommen im Bereich digitale Infrastruktur
Konkret fordert der BDI:
▪ Standardisierung strategisch begreifen: Die hohen Ambitionen autoritärer Staaten offenbaren die politische und strategische Dimension von Standardisierung und stellen Deutschland und die EU vor neue Herausforderungen. Auch in Zeiten schneller Innovationszyklen und hoher Komplexität von resilienten Wertschöpfungsketten bestätigt sich auch weiterhin im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien der Bedarf an Standards. Vor diesem Hintergrund sollten Deutschland und die EU im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit im Interesse der eigenen Industrie globale Standards vorantreiben. Darüber hinaus müssen sich EU-Handelsabkommen auf internationale Standards beziehen. Standardisierung sollte dabei die Ausrichtung an für alle Marktteilnehmer gleichermaßen rechtsverbindlich geltenden Kriterien bedeuten. Die Kriterien sollten klar entlang von Anforderungen wie technologischen Voraussetzungen und verlässlich zu erfüllenden Cybersicherheitsvorkehrungen definiert werden.
▪ Internationale Standardisierung von 6G, TSN und Wi-Fi-Technologien: Deutschland und die EU sollten die Entwicklung von 6G-Technologien aktiv vorantreiben und die globale Zusammenarbeit zur Etablierung von 6G als internationalen Standard im Interesse der europäischen Industrie intensivieren. Auch die Rolle des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) sollte gestärkt werden. Zudem ist eine Kombination von TSN mit drahtlosen Funktechnologien wie 6G und Wi-Fi entscheidend für die globale Interoperabilität industrieller Anwendungen. Auch hier sollten Deutschland und die EU ihre Rolle in der Standardisierung deterministischer Kommunikationsprotokolle ausbauen und diese in internationale Rahmenwerke einbringen.
▪ Einbindung der Industrie in Standardisierungsprozesse: Unternehmen müssen gezielt unterstützt werden, sich an internationalen Normungsaktivitäten zu beteiligen – insbesondere bei Technologien wie 5G und 6G, die oft als Voraussetzung für weitere industriell genutzte Technologien fungieren. Deutschland und die EU sollten hierfür geeignete Fördermechanismen schaffen. In Deutschland wären hier z. B. die Anerkennung von Normungsaufwendungen als förderfähige Aufwendungen wichtig
▪ Konnektivität global wirksam fördern: Globale Konnektivitätsinitiativen können wirtschaftliche Chancen für Unternehmen schaffen. Hierfür müssen jedoch nationale und EU-Förderprogramme effizienter und weniger bürokratisch gestaltet werden, um mit den massiven Investitionsprogrammen globaler Wettbewerber Schritt halten zu können. Im Mittelpunkt sollten hochwertige, transparente, nachhaltige und sichtbare Infrastrukturprojekte in Drittstaaten stehen. Um dort spürbare Wirkung zu entfalten, müssen Deutschland und die EU erhebliche Mittel investieren, um mit vergleichbaren Initiativen anderer Staaten Schritt zu halten. Ein Subventionswettlauf sollte jedoch vermieden werden. Stattdessen sollten Deutschland und die EU ihre Anstrengungen verstärken, um weltweit faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Vorschläge zur Stärkung der Transparenzpflichten von Regierungen und zur Untersagung wettbewerbsverzerrender Subventionen sollten über die WTO umgesetzt werden.
▪ Komponenten digitaler Infrastruktur als strategische Assets anerkennen: Ein ganzheitlicher Ansatz unter Einbeziehung aller Akteure entlang der Wertschöpfungskette ist erforderlich, um die Vielfalt und Resilienz von IKT-Lösungen wirksam zu stärken. Besonders in Zeiten geopolitischer Spannungen sind diversifizierte IKT-Lieferketten notwendig, um den Zugang zu kritischen Technologien sicherzustellen. Zu diesem Zweck müssen Deutschland und die EU erhebliche Ressourcen investieren, um die europäische Produktion und Entwicklung von Technologien sicherzustellen.
▪ Integration digitaler Infrastruktur in internationale Partnerschaften: Digitale Infrastruktur sollte systematisch in internationale Kooperationsformate eingebunden werden – etwa durch gemeinsame Projekte zum Ausbau digitaler Infrastruktur, Unterseekabelsicherheit, Netzresilienz und Standardisierung. Die Industrie muss dabei als aktiver Partner eingebunden werden. Insbesondere in der Kooperation mit Ländern, deren digitale Infrastruktur noch weniger stark entwickelt ist, sollte Deutschland beim Ausbau über Institutionen wie die KFW unterstützten. So kann durch sichere und verlässliche Konnektivität die Grundlage für weitere Aktivitäten der Industrie in den jeweiligen Ländern geschaffen werden. Geschieht dies nicht, erfolgt der Ausbau durch Akteure, bei welchen das Vertrauen in die Sicherheit der aufgebauten Konnektivität infrage gestellt werden kann.
Impressum
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Breite Straße 29, 10178 Berlin www.bdi.eu
T: +49 30 2028-0
EU-Transparenzregister: 1771817758-48
Lobbyregister: R000534
Redaktion
Marten Kwast
Studentischer Mitarbeiter Digitalisierung und Innovation
T: +49 30 2028-1522 m.kwast@bdi.eu
Polina Khubbeeva
Referentin Digitalisierung und Innovation
T: +49 30 2028-1586 p.khubbeeva@bdi.eu
Philipp Schweikle Referent Digitalisierung und Innovation
T: +49 30 2028-1632 p.schweikle@bdi.eu
BDI Dokumentennummer: D2155