


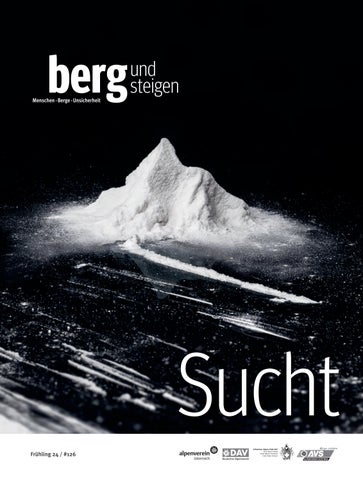





Berge und Wetter sind kompromisslos. Sie verlangen von uns ständige Anpassung – an unsere Fähigkeiten und unsere Bekleidung.

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Leidenschaft ist ein intensives Gefühl der Hingabe, Begeisterung und Engagement für eine bestimmte Aktivität, ein Ziel, eine Person oder ein Interesse … sie ist von einem starken Verlangen begleitet, sich in etwas zu vertiefen oder zu investieren. Menschen, die ihre Leidenschaft finden und verfolgen, erleben oft ein Gefühl von Erfüllung, Sinnhaftigkeit und Freude in ihrem Leben.“ Das schreibt die künstliche Intelligenz ChatGPT.
Alle kennen wir dieses Gefühl und manche auch den schmalen Grat zwischen Passion und Obsession, wo die Leidenschaft, Leiden schafft. In Ausnahmefällen kann sich die Leidenschaft tatsächlich zu einer ernsten psychischen Problematik mit pathologischem Suchtverhalten entwickeln. Sportsucht ist seit einigen Jahrzehnten Forschungsgegenstand der Medizin, besonders im Ausdauersport gibt es dazu viele wissenschaftliche Publikationen. Der Übergang von gesundem zu suchtgefährdetem Sport ist dabei fließend und nicht klar abgegrenzt. Wissenschaftlerin Leonie Habelt, selbst leidenschaftliche Bergsportlerin, hat sich in ihrer Dissertation nun auch dem Thema Sucht beim Bergsteigen gewidmet. Dazu mehr im Schwerpunkt.
Jetzt kann man einwerfen, es gibt Hunderte Studien, die den positiven Einfluss des Bergsports auf die Psyche nachweisen. Angsterkrankungen, Depressionen und selbst Suchterkrankungen werden mit (Berg-)Sport therapiert. Alles richtig. Doch wo Licht, da auch Schatten. Uns als Menschen sowie diesem selbstkritischen Medium tut es manchmal gut, uns und unsere selbstreferentielle Blase nicht nur zu verherrlichen, sondern ihr auch den Spiegel vorzuhalten. Schattenseiten zu beleuchten, kann durchaus Entwicklung fördern.
Apropos Spiegel: In letzter Zeit habe ich mich öfter selbst dabei ertappt, Social-Media(berg)süchtig zu werden. Swipe nach rechts auf Instagram: Was hat Kollegin Anna da wieder in den Dolomiten erstbegangen? Bergfreund Sepp hat eine 8a-Kletterroute in Leonidio geflasht. Ein Wetterfenster in Patagonien. Franz, Hans, Ines stehen auf dem Cerro Torre und winken. Sebastian, Leonie und Pitti warten laut Selfies am Flughafen. Destination Nepal, Ama Dablam. In Norwegen staubt der Powder. Und rund um den Redaktionssitz Innsbruck: sowieso alle 24/7 im bergsportlichen Dauereinsatz. Will auch, will auch, will auch. Oder: Alle getrieben, süchtig, „krankhaft“!? Ich habe keine FOMO (fear of missing out) und bleibe lieber hinter meinem PC und auf meiner Couch. Den Bürohockenden möge dieser Schwerpunkt also auch als Rechtfertigung für Nichtaktivität aufgrund beruflicher und anderer Verpflichtungen oder schierer Trägheit dienen ;-) Viel Freude bei der Lektüre und schöne dosierte Touren – weil ja frei nach Paracelsus die Dosis das Gift macht – im Frühling!
Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen
Besuchen Sie uns auch auf www.bergundsteigen.com
P.S.: Im Herbst traf ich Bergführerkollege Andreas Nothdurfter in Arco. Beim Abendessen sagte er beiläufig, er sei „süchtig“ nach Erstbegehungen. Super, Thema für den Schwerpunkt gefunden. Natürlich meinte Andi damit nicht süchtig im pathologischen Sinn. Wir haben den Beitrag zu exzessivem Routeneinrichten trotzdem oder gerade deshalb in den Schwerpunkt gepackt, weil er eine Hommage an die positive, schöpferische „Bergsucht“/-lust sein soll. Danke an alle rastlosen Routenerschließer für die wunderschönen Erlebnisse beim Wiederholen.

Markus, wann kamst du das erste Mal mit bergundsteigen in Kontakt und was verbindet dich mit dem Magazin? bergundsteigen im Abo habe ich seit 2003. Beeindruckt haben mich schon immer der Umfang und die inhaltliche Tiefe der vielen Artikel mit all dem exzellenten Know-how ihrer Autoren. bergundsteigen als Austauschplattform zwischen den Verbänden, Multiplikatoren und allen ambitionierten Bergsportler:innen sollte unbedingt bestehen bleiben. Ich denke, bergundsteigen trägt durchaus dazu bei, dass Ausbildungsinhalte, „Lehrmeinungen“ etc. verbandsübergreifend viel ähnlicher sind als früher. Das ist nicht selbstverständlich, aber ein enormer Vorteil für die Community.
Wie kamst du zum Bergsport? Erzähl uns ein bisschen von deiner Bergsportbiografie.
Es war mein Opa, der mich als Bub in den 80er-Jahren fürs Klettern im heimatlichen Frankenjura begeisterte. Ich trat dem lokalen Alpenverein bei und war als Jugend/Übungsleiter aktiv. So richtig in Fahrt kam der Alpinismus bei mir aber eigentlich erst mit meinem Wechsel nach München nach dem Abi. Auch hier war ich einige Jahre ehrenamtlicher Gruppenleiter und jobbte als Trainer und Skilehrer. Aber dann wollte ich mehr: mehr und steilere Berge, mehr und professionell Führen, mehr über Schnee und Lawinen wissen.
Ich hängte meinen Beruf in der Elektrotechnikbranche an den Nagel, um die Bergführerausbildung zu absolvieren und doch noch Geografie studieren zu können –mit Schneehydrologie als Kernbereich. 2008/09 war beides fertig und ich arbeitete dann einige Jahre ausschließlich als Berg-
führer. Das waren schon sehr intensive Jahre. Als Bergsteiger war ich schon immer ein Allrounder, wobei sich zusehends ein Faible für den Schneesport und die Lawinenprävention entwickelt hat. Schließlich nahm mich der DAV zusehends in Anspruch: im Lehrteam der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV), im Service (alpine Beratung und Verleih) der Sektion München, als Vortragsreferent, im DAV-Bundeslehrteam Bergsteigen. Seit 2019 bin ich nun sogenannter „Bildungsreferent Bergsport Alpin“.
Bildungsreferent Bergsport Alpin –was macht man da genau?
Oh, vieles! Vor allem Koordination und Fachbetreuung der alpinen Trainer-Ausund -Fortbildung im Sommer und Winter samt Lehrteamsleitung sowie die laufende Weiterentwicklung der Struktur und Konzepte. Nebenbei fällt aber auch einiges an Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit an. Von Seiten der Sektionen und Trainer:innen sind es meist rechtliche Fragen hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche, Tourenausschreibungen, Haftung etc.
Was gefällt dir am besten an der Arbeit beim DAV?
Die Vielfalt interessanter Themen motiviert – genauso wie die vielen netten Menschen um mich herum sowohl im Büro als auch in meinen beiden Lehrteams.
Bist du denn selbst noch als Bergführer in der Trainerausbildung oder mit Gästen aktiv?
Ja, und das ist gut und wichtig.
Danke, Markus!
■ Interview: Gebi Bendler
Schon mal von NEOM gehört?
„NEOM ist keine Stadt. Es ist ein Ort, der aus mehreren Regionen bestehen wird – wie unserer linearen Stadt The Line, unserem Zentrum für fortschrittliche und saubere Industrien Oxagon, unserem Bergziel Trojena und unserem Luxus-Inselresort Sindalah.“ So steht es auf der Website des Projektes www.neom.com.
NEOM ist die Bezeichnung für einen 26.500 Quadratkilometer großen Bereich am westlichen Rand Saudi-Arabiens, der an das Rote Meer und den Golf von Akaba grenzt und eine eigene Welt darstellen wird. Dieses Gebiet, so groß wie Albanien, wird außerhalb des juristischen Systems von Saudi-Arabien liegen – angeblich ohne Todesstrafe. Mit 170 Kilometern Länge, 200 Metern Breite und bis zu 500 Metern Höhe soll sich eine komplett verspiegelte, schnurgerade urbane Struktur namens The Line durch die Wüste von Meer zu Meer erstrecken. Bis zu eine Million Menschen sollen um 2030 hier bereits leben können, 2045 soll die Stadt fertig und komplett CO2-neutral sein. Trojena – die Gebirgsdestination – liegt 50 Kilometer von der Küste entfernt in einer Höhe von 1.500 bis 2.600 Metern und erstreckt sich über eine Fläche von 60 Quadratkilometern. „Trojena wird ein kultiges und weltweit erstklassiges Reiseziel sein, das Natur- und Kulturlandschaften miteinander verbindet und Einwohnern wie Besuchern einzigartige Erfahrungen bietet.“
In der Wintersaison von Dezember bis März stehen Skifahren und Snowboarden auf Kunstschnee auf dem Programm. Auch die asiatischen Winterspiele sollen dort 2029 ausgetragen werden. Im Frühling wird geklettert. Über 100 Sportkletterrouten, wie auf diesem Bild zu sehen, wurden bereits erschlossen. Doch das ist erst der Anfang.


Normalhaken schlagen lernen ist genauso schwer, wie einen Text darüber zu schreiben – wo fängt man bloß an? Versuch einer Anleitung.


Seilklemmen haben scharfe Zähne. Bei welchen Belastungen werden sie dem Seil gefährlich? Wann reißt sogar das Seil?


Gefahrenstufe selbst bestimmt
Abseilen mit Hilfsleinen. Welche Probleme treten dabei auf und was kann man dagegen tun?
Der Nivocheck des Schweizer Bergführerverbandes hilft bei der persönlichen Erstellung eines Lawinenlageberichts.
Kann Bergsport krankhafte Ausmaße annehmen? Forschende sehen klare Hinweise darauf, dass Bergsucht nicht nur ein beliebter Aufdruck auf T-Shirts ist, sondern eine ernstzunehmende psychische Problematik.

Es ist anstrengend, zeitintensiv, kostspielig, oft dreckig und mit Gefahren verbunden – das Erschließen von Kletterrouten. Kann man trotzdem danach „süchtig“ im positiven Sinne werden?

1 „ Ex ante “ –juristischer Fachbegriff, der eine Beurteilung au s früherer Sicht vor einem Ereignis (z. B. Unfall) beschreibt.
Ex ante1
„Nach getaner Tat weiß auch der Dümmste Rat!“ Mir fallen wenige Themenbereiche im Leben ein, wo dieses Sprichwort besser passen würde als im Bergsport. Ob es nun die Analyse eines Unfalls betrifft oder die kritische Selbstreflexion nach einer zweifelhaften Tourenwahl.

Als Teil der Bergsport Community sind wir ständig verleitet, schnelle Urteile zu fällen. Sei es aus Bequemlichkeit oder aus Mangel an Information. Die fehlenden Informationen blenden wir oft unbewusst, manchmal sogar bewusst aus. Inkonsistenz ist etwas, mit dem unser Gehirn nicht gut umgehen kann. Da fällt es wesentlich leichter, eine Behauptung in den Raum zu werfen, die im Groben und Ganzen passen könnte. Das Kopfnicken der Kollegen und Freunde beseitigt die letzten Zweifel und macht die Behauptung, zumindest in unserer kleinen Blase, wahr. Dabei sind der erhobene Zeigefinger und Besserwisserei am Berg generell fehl am Platz, ist man doch nicht davor gefeit, den kürzlich diskutierten Fehler selbst zu begehen. Man wollte doch nur noch schnell eine Trainingstour auf der Piste machen, hat sich auf dem Weg zum Ausgangspunkt dann aber doch umentschieden, eine leichte Tour im Gelände zu machen. LVS bringt eh nix – man ist ja alleine unterwegs. Kurz mal rechts abgebogen, weil der vordere Hang doch besser aussieht als die verspurte Standardvariante und plötzlich findet man sich selbst in der Rolle des Alleingehers ohne Notfallausrüstung. Der Narr, der scheinbar gar nix checkt, der in der jährlichen Unfallstatistik nie fehlen darf. Genauso verlässlich wie der „patscherte“ Wanderer, der im Frühjahr übers Altschneefeld abstürzt. Sicher wieder so ein „patscherter Preiß“ … oder war’s vielleicht doch ein gut trainierter Trailrunner, der auf seiner Trainingstour lieber den Eiertanz übers Altschneefeld wagt, als umzudrehen und die ganze Strecke wieder retourzulaufen. Kommt bekannt vor? Mir jedenfalls schon … Ich habe das Gefühl, dass die Fehler- und Lernkultur am Berg viel besser geworden ist. Man spricht über seine Fehler. Die anderen hören zu, nicken vielleicht zustimmend und alle lernen in der Diskussion. Das nächste Mal befindet man sich allerdings wieder in der „Ex ante“-Situation und stellt zum Schrecken fest, dass man gerade dabei ist, denselben Fehler zu machen, über den man vor ein paar Tagen noch hitzig debattiert hat. Vielleicht könnte uns ein kleines Gedankenexperiment helfen, aus Fehlern anderer besser zu lernen. Anstatt zu urteilen, könnten wir uns vorstellen, was schiefgehen müsste, dass wir uns selbst in der misslichen Situation wiederfinden wie der Alleingeher auf Skitour ohne Ausrüstung oder der Trailrunner am Altschneefeld. Vielleicht wären wir in der Lage, früher zu erkennen, wo das Potential für heikle Situationen liegt, und könnten bereits gegensteuern, bevor sich die Verkettung unglücklicher Umstände fortführt und wir selbst in der Unfallstatistik landen.
Thomas Wanner Abteilung Bergsport, Berg- und SkiführerDer Automat, dein Sicherungspartner?
Die Selbstsicherungsautomaten sind in die Kletterhallen eingezogen, um zu bleiben. In den letzten Jahren wurden immer mehr Automaten montiert und werden von vielen Anlagenbesuchenden, ambitionierten wie untrainierten, jungen wie alten, genutzt. Auch wenn man unter den Kletternden immer wieder spitze Bemerkungen mit dem Tenor „Ohne Seilschaft ist es doch kein echtes Klettern“ hören kann, sobald Automaten angeboten werden, vertreten sie im Dauereinsatz Sicherungspartner:innen. Laut aktueller DAV-Umfrage nutzen 51 % der Hallenkletternden einen Selbstsicherungsautomaten, 31 % verneinen dies und in 18 % der teilnehmenden Hallen gab es keine Automaten.

Der Siegeszug der Automaten hat jedoch auch eine Kehrseite. Es handelt sich eben um einen Automaten und keinen Sicherungspartner: Systembedingt findet kein Partnercheck statt und damit hat eine neue Unfallursache mit den Automaten Einzug in die Kletteranlagen gehalten. Gemäß DAV-Statistik gab es in Deutschland seit 2000 vier Todesfälle beim Klettern mit Selbstsicherungsautomaten durch falsches bzw. vergessenes Einhängen. Allein im letzten Jahr ereigneten sich in DAV-Kletteranlagen vier schwerste Bodenstürze beim Automatenklettern.
Das Einhängen müssen die Kletternden selbst vornehmen und ihr Tun selbst kontrollieren. Einstiegsbarrieren, die im unteren Bereich Griffe und Tritte verdecken, können das Risiko des ungesicherten Loskletterns nur verringern, nicht ausschalten, wie Unfälle und Erfahrungsberichte zu Beinaheunfällen leider zeigen. Überlegungen der Kletterindustrie bzgl. spezieller Ausrüstung oder Warnsysteme haben noch nicht überzeugt bzw. harren noch der Entwicklung bis zur Marktreife.
In Fachkreisen ist das Problem bekannt, doch auch die Automatennutzer:innen müssen davon erfahren. Es braucht eine Einweisung, bei der auch die Hauptunfallursache am Automaten angesprochen wird: Das menschliche Versagen in Form eines Blackouts. Auffällig oft tritt dies nach einer kurzen Trainingspause oder bei der letzten Route auf, wenn die Kletternden fokussiert auf die nächste/letzte Route an die Wand treten – ohne eingehängt zu sein.
Die Tatsache, dass man so etwas Wesentliches wie das Einhängen vergessen kann, wird bei den einzuweisenden Personen Unglauben hervorrufen, trotzdem wird dieser Gedanke die zukünftigen Nutzer:innen auch nach der Einweisung noch beschäftigen. Hoffentlich dann, wenn sie am Selbstsicherungsautomaten losklettern wollen.
Dr. Tanja Ganz Sachgebiet künstliche Kletteranlagen
Wandel

Nach etwas mehr als fünfeinhalb Jahren werde ich den Schweizer Alpen-Club SAC als Geschäftsführer verlassen. Was mir in Erinnerung bleiben wird, ist das große leidenschaftliche Engagement der Menschen in den Alpenvereinen. Es ist ein Privileg, mit Menschen zusammenzuarbeiten, welche einen großen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und ihre Arbeit in den Sektionen und im Zentralverband mit großer Leidenschaft machen. Was mir sicher auch in Erinnerung bleiben wird, ist die Intensität der Arbeit. Einerseits war die Zeit von Krisen wie der Pandemie geprägt, andererseits haben wir auch eine enorme Entwicklung innerhalb, aber auch außerhalb des SAC erlebt.
Diese Krisen und Entwicklungen haben die Grenzen von klassischen Strukturen und Führungsmodellen aufgezeigt und dass es beim SAC einen (Kultur-)Wandel braucht. Der SAC und die Alpenvereine im Allgemeinen sind komplexe Organisationen. Wir haben innerhalb unserer Verbände viele Spannungsfelder wie zum Beispiel zwischen Naturschutz und freiem Zugang oder zwischen Breitensport und Leistungssport mit inzwischen zwei olympischen Disziplinen. Und sind wir nun Sport-, Tourismus- oder Umweltverbände? Alle diese Spannungsfelder und Gegensätze gehören zur DNA der Alpenvereine, sie gehören zu uns wie die Hütten zu den Bergen – das macht es anspruchsvoll, aber auch sehr spannend.
Um dieser Komplexität gerecht zu werden, finde ich es zentral, dass sich der Zentralvorstand des SAC professionalisiert. Als reines Ehrenamt kann das praktisch nicht mehr bewältigt werden. Weiters muss die Komplexität auch auf der operativen Seite unserer Organisation abgebildet werden. Die Verantwortung soll weniger in einer Person konzentriert werden, sondern Ziel ist es, die Aufgaben vermehrt in Rollen zu definieren und auf mehrere Personen zu verteilen. Aus meiner Sicht ist das der richtige Weg. Eine Person allein kann das kaum (mehr) bewältigen. Der SAC hat diesen Weg eingeschlagen und ist in einem Change-Prozess. Ich bin gespannt, wie er sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Es ist noch eine lange Reise für diesen benötigten Wandel. Ich wünsche allen auf diesem Weg viel Zufriedenheit und Ausdauer. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnen wird.
Nun danke ich allen, die mich in den letzten Jahren im SAC und um den SAC begleitet haben. Es gab viele schöne Begegnungen und es war eine spannende, lehrreiche und intensive Zeit – eine Zeit mit Suchtpotenzial.
Daniel Marbacher Geschäftsführer des Schweizer AlpenclubsDas ALPINIST Programm ist längst zu einem festen Bestandteil des Alpenvereins Südtirol geworden. Über die Jahre hinweg wurde das Programm kontinuierlich erweitert und ausgebaut, wobei die einzelnen Aktionen von erfahrenen Bergführern geleitet werden. Nach der erfolgreichen Zukunftswerkstatt im Frühjahr 2023 haben wir im Sommer unsere neuen Ziele definiert.

Ein lang gehegtes Anliegen war es, auch Jugendlichen unter 18 Jahren die Möglichkeit zu bieten, an unseren Aktionen teilzunehmen und sie zu fördern. Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Jugendlichen bereits über familiäre Verbindungen zum Alpinismus verfügen, und möchten daher einen leichten Zugang für diese Altersgruppe schaffen. Zusätzlich motiviert uns der Wunsch, jene Wettkampfathleten, die seit ihrer Kindheit vom Alpenverein gefördert werden, auch im Jugendalter auf neue Wege im Bergsport vorzubereiten. Unser Ziel ist es, den Jugendlichen eine neue Welt im Bergsport zu eröffnen, in der sich abseits von Kletterhallen ein Horizont erweitert, in dem Ziele, Träume und Abenteuer keine Grenzen kennen. Dank ihres Vorwissens und Könnens, das sie bereits beim AVS bezüglich des Umgangs mit Seilen, Sicherungsgeräten und Klettertechniken erlernt haben, haben sie optimale Voraussetzungen, sich sicher im alpinen Gelände zu bewegen. Ihr ausgezeichnetes Kletterkönnen kann nun an großen Wänden weiterentwickelt werden. Durch die Erweiterung unseres Angebots auf 15- bis 17-jährige Teilnehmer können wir ein angepasstes Programm erstellen und individueller mit ihnen arbeiten als bei herkömmlichen alpinen Grundkursen. Gleichzeitig möchten wir bereits in jungen Jahren das gesamte Land Südtirol vereinen und den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Das Programm soll auch dazu beitragen, eine tiefere Verbundenheit unter den Teilnehmer:innen sowie im gesamten Alpenverein Südtirol zu schaffen.
Eine solide Ausbildung in puncto Sicherheit und Wissen bildet das Fundament für ihre zukünftige Bergsteigerkarriere und kann vielleicht sogar als Grundstein für die Teilnahme am ALPINIST Team, in Bergrettungsorganisationen oder einer Bergführerausbildung dienen.
Wir sind zuversichtlich, dass dieses erweiterte ALPINIST Programm nicht nur das individuelle Wachstum der Jugendlichen fördern wird, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung und Erhaltung der Traditionen des Südtiroler Alpinismus leistet und zur Sensibilisierung für Natur und Umwelt beiträgt.
Stefan Plank Koordinator des Förderprogramms ALPINISTbergundsteigen #125 > Per Daumenmethode zur Schneedeckenstabilität
[von oben oder von unten?] Beim Artikel „Per Daumenmethode zur Schneedeckenstabilität“ scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Auf S. 69 wird in Abb. 4 geschrieben, dass KBT mäßig+glatt@28 einen Bruch 28 cm unter der Schneeoberfläche beschreibt (genauso bei Abb. 5 mit dem ECT). Bisher war es immer so, dass KBT…@28 einen Bruch 28 cm oberhalb des Bodens bedeutete. Das ist auch in sämtlichen Profilen auf lawis.at zu sehen (z. B. rechts im Schneeprofil vom Lawinenwarndienst Salzburg und Tirol).
Dietmar Sinnhuber, Berg- und Skiführer
Grundsätzlich hast du Recht, die Konvention beim ECT ist, dass man die Höhe von unten angibt. Bei Schneeprofilen macht das auch Sinn, da die Gesamtschneehöhe bekannt ist. Bei reinen Stabilitätstests ist diese Regel jedoch nicht praktikabel, da die insgesamte Schneehöhe oft gar nicht bekannt ist. Bei der Angabe ECTN15@185 ist ohne Schneeprofil nicht ersichtlich, in welcher Tiefe von oben sich der Bruch befindet. Aber genau dies ist die entscheidende Information. In unserem internen Dokumentationstool (LA.DOK), das in ähnlicher Weise auch in Österreich verwendet wird, gibt es die Möglichkeit, „Bruch von oben“ oder „von unten“ auszuwählen. Dies wird mit einem Pfeil gekennzeichnet (z. B. ECTN15@185 oder KBT mäßig+glatt@28 ). So ist es auch bei den Schneeprofilen auf unserer Internetseite gekennzeichnet. Wir werden deine Anregung in jedem Fall aufnehmen und in Zukunft den Pfeil mitkommunizieren. Vielleicht können wir das auch international etablieren. In jedem Fall danke für den wichtigen Hinweis! Thomas Feistl, Lawinenwarnzentrale Bayern im Bayerischen Landesamt für Umwelt
c[Compression Test] Ergänzend zum Kleinen Blocktest (KBT) mit der angeführten Größe von 40 x 40 cm möchte ich den Compression Test (CT) mit der Größe von 30 x 30 cm anführen. Der Lawinenwarndienst Bayern hat sich für den KBT mit der Größe 40 x 40 cm entschieden, warum auch immer. International wird der CT mit der Größe 30 x 30 cm publiziert, siehe auch die Broschüre Winter Journal vom Verband Deutscher Bergund Skiführer, Herausgeber Chris Semmel und Dr. Benjamin Reuter (ehemaliger Mitarbeiter beim SLF in Davos und Bergführer). Wie gesagt, es scheint, dass sich beim CT und KBT die Experten über die Größe nicht einig sind, Kompetenzgerangel? Ob die 10 cm Unterschied ausschlaggebend sind, ist natürlich fraglich, denn die Trefferquote liegt bei 60–80 % (Quelle: Winter Journal, S. 45). Mir erscheint es aus didaktischen Gründen besser, den CT, dann den Extended Column Test (ECT) und dann den Rutschblock-Test (RB) zu lehren. Warum der Lawinenwarndienst Bayern diesen Sonderweg geht, ist mir unklar. Vielleicht könnte man dies auch thematisieren und ergänzen? Vielen Dank.
Thomas Stephan, Berg- und SkiführerDanke für deine Ergänzungen. Der Kleine Blocktest wird seit den 1990ern im Lawinenwarndienst Bayern als Standardtest verwendet. Der große Unterschied zu allen anderen Tests liegt darin, dass die
Belastung der Säule seitlich und nicht von oben erfolgt. Die Erfahrungen und Auswertungsdaten, die bei der Entwicklung der Daumenmethode zugrunde lagen, basieren alle auf der Säulengröße von 40 x 40 cm. (Bei kleineren Abmessungen ist davon auszugehen, dass ein Bruch bereits bei geringerer Belastung erfolgt. Laut Georg Kronthaler, der beim Lawinenwarndienst Bayern arbeitete, ließen sich jedoch auch mit einer Säulengröße von 30 x 30 cm bei entsprechender Praxiserfahrung brauchbare Ergebnisse erzielen.)
Da viele Kommissionsmitarbeiter gute Erfahrungen mit dem Test gemacht haben und in der Interpretation der Ergebnisse geübt sind, hält man noch am Altbewährten fest (auch an 40 x 40 cm Blockgröße). Inzwischen verwenden die Lawinenkommissionen in Bayern auch den Extended Coloumn Test (ECT), der sich seit der Vorstellung beim ISSW 2006 international mehr und mehr durchsetzt. Beide Tests, der ECT und der KBT, liefern zuverlässige Ergebnisse, sofern man eine gewisse Übung beim Testen hat. Der von dir beschriebene Compression Test (CT) hat leider den Nachteil, dass man im Gegensatz zum ECT die Bruchfortpflanzung nicht erkennen kann, was für die Bewertung der Lawinengefahr jedoch wesentlich ist. Daher verwenden die meisten Lawinenwarndienste den ECT, weil er einfach aussagekräftiger ist. Meiner Erfahrung nach ist auch der KBT aussagekräftiger als der CT, weil man mit dem KBT wegen des seitlichen Klopfens Schwachschichten in großer Tiefe und in weichen, oberflächennahen Schichten zuverlässiger findet als mit dem CT. Ich stimme dir beim didaktischen Argument zu, glaube aber, dass der CT wegen der geringeren Aussagekraft keine große Zukunft in der Ausbildung haben wird. Grundsätzlich wäre die Daumenmethode auf den Rutschblock und den CT erweiterbar, meint der Lawinenwarndienst Bayern.
Diese Anregung nehmen sie gerne auf.
Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen, Berg- und Skiführer
v[Verleiten Lawinenairbags tatsächlich zu riskanterem Verhalten? #125] Liebes DAV-Sicherheitsforschungsteam, als passionierter Skitourengeher (seit dieser Saison auch mit Airbag), habe ich Ihren Artikel „Verleiten Lawinenairbags tatsächlich zu riskanterem Verhalten?“ mit viel Interesse gelesen. Die präsentierte Feldstudie liefert eine Vielzahl neuer und interessanter Ergebnisse, so wie jene zur verbreiteten Fehleinschätzung der Risikoreduktion von Lawinenairbags. Vom Beruf her bin ich Volkswirt und habe einige Jahre als „Systematic Reviewer“ gearbeitet. Dabei versucht man alle Studien zu einer Forschungsfrage zu finden, zu bewerten und zu aggregieren. Dementsprechend habe ich ein besonders scharfes Auge für „Risk of Bias“, also die Robustheit von Studiendesigns. Für die Fragestellung der Studie, die es in die Überschrift geschafft hat, die Risikokompensation, liefert der Artikel zwar interessante neue Indizien, die Frage wird aber meiner Meinung nach nicht schlüssig beantwortet. Das Studiendesign ist zu anfällig für Bias.
Falls Sie vorhaben, diese Forschungsrichtung weiterzuverfolgen, würde ich Sie gerne auf quasi-experimentelle Studiendesigns hinweisen. Da die meisten es nicht sonderlich schätzen, wenn mit ihren Volkswirtschaften experimentiert wird, ähnlich wie mit ihrer Sicherheit, haben sich inzwischen eine Vielzahl von Verfahren etabliert, um mit natürlichen Experimenten stichhaltige Antworten
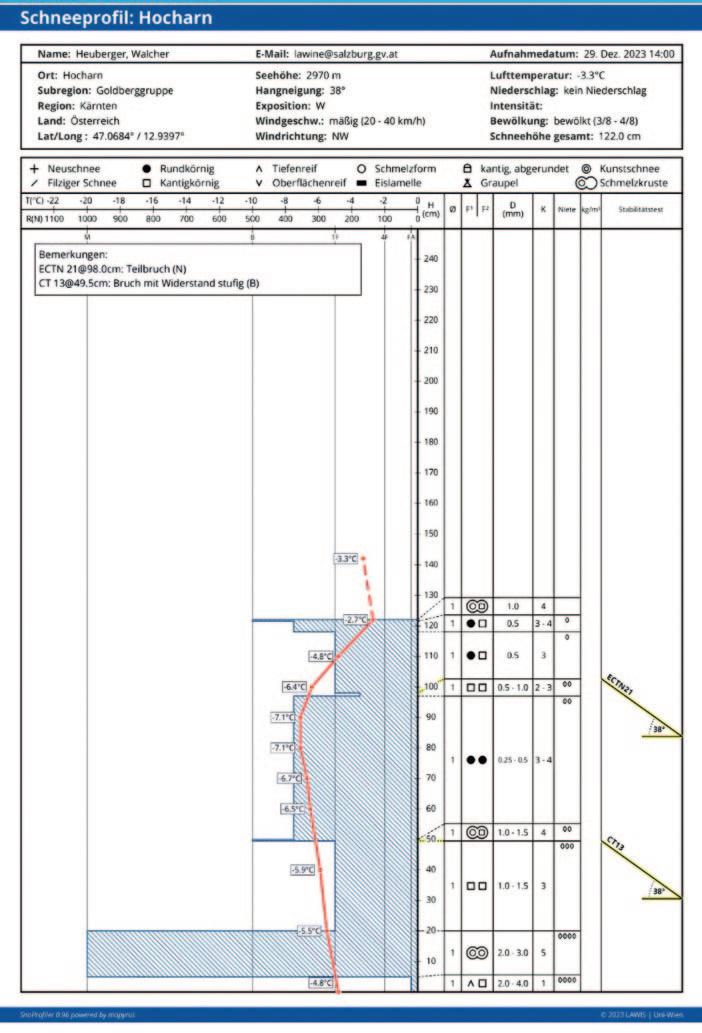
Schneeprofil, aufgenommen vom Lawinenwarndienst Salzburg und Tirol.
auf kausale Fragen zu finden (2021 wurde dieser Ansatz auch mit einem Nobelpreis honoriert und „Mastering Metrics“ von Angrist und Pischke bietet einen guten Einstieg in das Thema). In Verbindung mit dem vorherigen Artikel zur „Lawinenzeit“ drängt sich zum Beispiel ein „Interrupted Time Series Design“ nahezu auf: Man müsste schauen, ob Tourengeher mit Airbag bei einem markanten Anstieg der Gefahr mehr oder weniger gewillt sind, eine Mehrtagestour abzubrechen, als diejenigen ohne Airbag.
Außerdem ist ein „Information Treatment“ denkbar, also randomisiert Skifahrer bezüglich des Nutzens eines Lawinenairbags aufzuklären und die Verhaltensantwort zu studieren. Aufwendigere Studiendesigns könnten die Kooperation mit einem Lawinenairbagverleih oder -hersteller beinhalten, bei denen randomisiert ein Rabatt gewährt wird. Alle diese Designs haben das Potenzial, eindeutigere Antworten zu finden, ob Risikokompensation ein ernstzunehmendes Phänomen ist. Kontaktieren Sie mich gerne, falls Sie weitere Rückfragen haben. Ich freue mich ohnehin, weiterhin interessante, informative, und handlungsrelevante Artikel in der bergundsteigen zu finden.
Hayaan Nur
Als hauptverantwortlicher Autor des Beitrages erlaube ich mir Ihnen im Namen der Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung zu antworten. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Beitrag und Ihre Rückmeldungen bzw. Anmerkungen. Zu Ihrer Anmerkung, dass die Frage der Risikokompensation durch unsere Studie nicht schlüssig beantwortet wurde: Dem würden wir im Hinblick auf ein umfassendes Verständnis der Dynamik möglicher Kompensationseffekte zustimmen (also die Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen es zu Kompensationseffekten kommt und welche Variablen diesen Prozess vermitteln). Dies war aber auch nicht primäres Ziel unserer Feldstudie. Zentrales Anliegen war, im Feld zu untersuchen, wie Wintersportler zu ihren tourenbezogenen Einstellungen kommen und wie sie sich im Gelände verhalten. Hierzu haben wir zahlreiche Variablen vor und nach der durchgeführten Tour erhoben (verschiedene Auswertungsaspekte wurden bereits in bergundsteigen bzw. in DAV-Panorama veröffentlicht). Dies ist insofern besonders, weil es unseres Wissens bisher keine Studie in dieser Form gab.
Auch wenn das Airbagthema in der Gesamtstudie nicht zentral war, haben wir die Variablen zum Airbag mit dem Ziel (und entsprechenden Forschungsfragen) erhoben, etwas Licht in die Spekulationen zur möglichen Risikokompensation durch Lawinenairbags zu bringen. Im Hinblick auf dieses Ziel würden wir argumentieren, dass das Studiendesign ausreichend robust und verzerrungsfrei war. Einerseits hat unsere Studie, wie Sie ja auch feststellen, durchaus methodische Schwächen. So haben wir zwar an drei bei Wintersportlern/Skitourengehern beliebten Standorten erhoben. Aber weder die Auswahl der Gruppen noch der lokalen Verhältnisse sind repräsentativ für den gesamten Alpenraum. Auch haben wir die Gruppen nur an einem Tag befragt und können daher keine Aussage darüber treffen, ob unsere Daten repräsentativ für diese Gruppen an sich sind oder ob sie tagesaktuellen Verzerrungen unterlagen. Wir können auch keine Aussagen darüber machen, welchen Einfluss das (Nicht-)Verwenden eines Lawinenairbags auf die einzelnen Entscheidungsprozesse der untersuchten Gruppen hatte.
Andererseits aber, insbesondere im Hinblick auf den aktuellen Wissensstand, hat unsere Studie durchaus Stärken. Unseres Wissens gibt es bisher keine Studie, die Zusammenhänge zwischen dem (Nicht-)Verwenden eines Lawinenairbags und dem objektiv belastbaren Risikoverhalten im Feld untersucht hat. Dies ist deswegen bedeutsam, weil es bezüglich Risikoverhalten große Unterschiede zwischen der Einstellung zu einem bestimmten Verhalten, dem intendierten (also geplanten) Verhalten und dem tatsächlichen Verhalten geben kann. Die beiden Ersten lassen sich gut in Labor- oder Onlinestudien untersuchen (was auch gemacht wurde), aber sie korrelieren nicht notwendigerweise mit dem tatsächlichen Verhalten (das wir untersucht haben). Die Gültigkeit der Theorie der Risikohomöostase von Wilde, die von einem Risikokompensationseffekt ausgeht, wird in der psychologischen Risikoforschung aufgrund empirischer Studien eher bezweifelt bzw. als eine Ausnahme unter bestimmten Voraussetzungen gesehen. Trotz aller methodischen Einschränkungen unserer Studie hätten wir entsprechende Effekte finden müssen, wenn die Kompensationseffekte stark wären. Wir glauben, dass unsere Daten schon so weit belastbar sind, dass man annehmen kann, dass Risikokompensationseffekte durch Lawinenairbags kein durchgehendes und verbreitetes Phänomen sind. Aber natürlich kann es im Einzelfall solche Effekte geben, die dann auch zu einem unangemessen riskanten Verhalten führen können.
Wir hoffen, dass Ihre Anregungen zu komplexeren Studiendesigns in zukünftigen Studien aufgegriffen werden können. Das größte Problem aus unserer Sicht ist aber, dass man für zuverlässige Aussagen über das Verhalten von Wintersportlern und den Einfluss verschiedener Variablen auf dieses Verhalten (z. B. die Verwendung eines Airbags) ein objektivierbares Maß für das eingegangene Risiko bzw. für die bestehende Gefahr braucht. Die Verwendung der tagesaktuellen Lawinenwarnstufe ist hierfür aus unterschiedlichen Gründen ungeeignet. Vielmehr muss die geplante und durchgeführte Tour der befragten Personen betrachtet werden. In unserer Studie haben wir dieses Problem durch eine genaue Identifikation und Beschreibung aller potenziellen Gefahrenstellen aller möglichen Touren im Erhebungsgebiet gelöst. An den Erhebungstagen wurde durch trainierte Experten in Geländebegehungen bestimmt, welche potenziellen Gefahrenstellen an diesem Tag tatsächlich Gefahrenstellen waren und welche Verhaltensmaßnahmen an den einzelnen Stellen angemessen waren. Dadurch konnten wir sowohl objektivierbare Maße für das Risikopotential einer Tour als auch für das intendierte und tatsächliche Risikoverhalten der befragten Personen berechnen, was die Aussagekraft der Daten im Vergleich zu anderen Herangehensweisen erhöht. Allerdings hat diese Methode auch einen entscheidenden Nachteil: Sie ist außerordentlich aufwendig und ressourcenintensiv, jedoch zurzeit aus unserer Sicht noch alternativlos.
Bernhard Streicher für die Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung
v[Verhauer] Vielen Dank an Guido Unterwurzacher für den Artikel „Auf falscher Fährte“ in #125 auf S. 82. Das ist wunderbar uneitel und ehrlich. Ich persönlich halte es für echten Mut, wenn man offen über peinliche, vermeintlich dumme Fehler spricht. Das ist viel couragierter und vor allem lehrreicher als die Präsentation der jüngsten alpinen Heldentat, denn gerade
aus falschem Ego und falschen Eitelkeiten wird häufig das eigene lebenslange Lernen blockiert, passieren gravierende Unfälle. Gerne mehr von solchen „Fail“-Artikeln! Auch und gerade von erfahrenen Alpinistinnen und Alpinisten!
Maria Goeth, C-Trainerin Bergsteigen
bergundsteigen #125 > Störquellen bei der Lawinenrettung
f[Fragen über Fragen] Vielen Dank für den Beitrag, sehr wichtig, sehr informativ, gefällt mir sehr gut! Trotzdem ein paar Nachfragen:
1. „Die Amplitude der Interferenzwirkung nimmt mit der dritten Potenz des Abstandes zu.“ Passt gut zu den Ergebnissen. Gibt es auch eine einfache Erklärung für die dritte Potenz? Die Störsignale an sich nehmen wohl auch mit dem Quadrat des Abstandes ab, wie die echten Signale?
2. Welche Störung können ein festerer Reißverschluss im Anorak oder eine festere Gürtelschnalle bewirken, wenn sie mehr oder weniger direkt auf dem LVS-Gerät aufliegen?
3. Welche Störung kann ein dickerer Schlüsselbund (oder ein „elektrischer“ Autoschlüssel) bewirken, wenn er in einer Anorakoder Hosentasche sehr nahe am LVS-Gerät ist?
4. Bei der Feinsuche, LVS-Gerät an der Schneeoberfläche: Können da angeschnallte Ski oder auch nur Skischuhe (ggf. mit Heizung!) stören?
5. GPS-Uhr: An anderer Hand tragen ist einfach (wenn man dran denkt!). Manchmal nimmt man aber beide Hände zur Bedienung, z. B. beim Markieren (starkes Signal wegen Nähe, aber schwierig wegen Überlagerung mehrerer Signale!) oder beim Scannen (dann sucht man besonders die schwachen Signale!). Gibt es da Probleme?
6. Person zum Wärmeschutz in Rettungsdecke eingehüllt: Wie stark wird die Sendeleistung eines LVS-Gerätes abgeschwächt?
7. Abdeckung/Störung des LVS-Gerätes durch unglückliche Lage des Verschütteten in der Lawine (z. B. Kauerstellung mit Knie mit Handy in Oberschenkeltasche gegen Brust mit LVS-Gerät gedrückt): Gibt es da reale Erfahrungswerte?
8. Gibt es schon Erfahrungen mit dem neuen Pieps PRO IPS? Kann das bei den Interferenzen wirklich mehr?
9. Themenwechsel, angeregt durch die dargestellte Problematik: Handy als GPS-Gerät hat manchmal auch mit der Empfindlichkeit Probleme. Nun gibt es Handyhüllen mit magnetischem Verschlussknopf. Kann der Probleme verursachen? Haben Sie da eine Meinung dazu? Nochmals vielen Dank für den guten Beitrag!
Eike Roth
Abstand
Illustrationen aus dem Artikel
„Störquellen bei der Lawinenrettung“
bergundsteigen #125, Winter 23-24 > 50cm
Danke für deine Nachricht und deine Fragen.
1. Die Signalstärke im dreidimensionalen Raum fällt mit 1/d3 (d=Abstand) und somit auch die Störwirkung von elektromagnetischen Quellen.
2. Bei einem Reißverschluss oder sehr kleinen metallischen Gegenständen sehe ich das Störpotenzial im Sendemodus als zu vernachlässigen. Es geht hier eher um eine größere, flächige Abschirmung der Sendeantenne(n) in unmittelbarer Nähe.
3. Auch der Autoschlüssel fällt wahrscheinlich in diese Kategorie, auch wenn er ein kleiner aktiver Sender ist.
4. In der Feinsuche ist die Amplitude meist so groß, dass meiner Einschätzung nach moderne Geräte im Nahbereich nur schwer gestört werden können, und wenn nur von starker Elektronik oder Magneten. In unserem Test war der Einfluss nicht merkbar, meines Wissens waren elektronische Heizsocken beim Test der Bergrettung Tirol problematisch, jedoch weniger als Heizhandschuhe.
5. Sei dir des Störpotenzials bewusst, dann kannst du darauf auch reagieren; wenn du beispielsweise einen Sender mit beiden Händen markierst, kann es schon sein, dass ein zweiter Sender kurz fälschlicherweise erscheint oder ein vorhandener unterdrückt wird; sobald du die Hand aber wieder weghältst, sollte es wieder unproblematisch sein. Außerdem sind auch nicht alle Digitaluhren gleichermaßen ein Problem. Es hängt von den emittierten Frequenzen ab und die Bergsportuhr, die wir getestet haben, fiel bei laufendem GPS-Tracking da leider genau rein und war störungsstark.
6. Nicht ideal, die Frage ist, wann dieses Szenario relevant ist.
7. Wie im Test vorgestellt, bei einem Handy in direkter Lage auf einem Sendegerät konnten wir je nach Empfänger-LVS eine Reichweitenreduktion von bis zu 40 % feststellen. Die 20-cm-Abstandsregel im Sendemodus enthält bereits einen Sicherheitspuffer für solche unglücklichen Konstellationen bzw. Lagen. Störquelle (konkret Handy) direkt auf LVS ist problematisch – nur wenige Zentimeter Entfernung entschärfen die Situation jedoch bereits.
8. Für den in 7. genannten Fall hat das IPS eine Sendepegelanpassung, bei Störungen fährt es die Sendeleistung und somit aber auch den Energieverbrauch hoch. Im Suchmodus ist das IPS auch nicht immun gegen externe Störungen und die Maßnahmen (50 cm, ausschalten etc.) sollten demnach durchgeführt werden.
9. Dazu kann ich leider keine qualifizierte Aussage treffen, ich kann mir einen Einfluss aber durchaus vorstellen. Lorenz Berker, DAV-Sicherheitsforschung
Periodendauer
1.000 +/- 300 ms
Signalstärke
[Flugmodus und Metallhülle] Vorneweg erstmal großen Dank für den spannenden Artikel. Es ist das erste Mal, dass ich eine belastbare Untersuchung hierzu lese, obwohl das Thema sicherlich in der Zwischenzeit eine große Brisanz besitzt. Bezüglich der Störanfälligkeit des LVS in der Nähe eines elektrischen Lawinenrucksacks oder Handys habe ich eine generelle und eine technische Frage.
1. Ist die Störwirkung eines Smartphones immer noch signifikant, wenn das Handy im Flugmodus verwendet wird bzw. wie sehr lässt sich die Einwirkung reduzieren?
2. Bei Rucksäcken mit Alpride E2 beispielsweise ist die Elektronik typischerweise im Lawinenrucksack ja in einer separaten Hülle abgekapselt. Hier bestünde von Herstellerseite in Zukunft ohne großen Aufwand die Möglichkeit, entstehende elektromagnetische Strahlung direkt durch eine metallbedampfte Folie oder Metallfolie in der Hülle direkt abzuschirmen.
Gibt es diesbezüglich bereits Bestrebungen?
Moritz Streicher
Danke für deine Nachricht und deine Fragen. Eine Störwirkung kann auch im Flugmodus vorhanden sein, das wird im Text auch kurz angedeutet. Da nicht die Funkverbindung an sich das Problem ist, sondern Schaltvorgänge und Prozesse im Hintergrund. Man kann also sagen: Je größer der Leistungsbedarf, umso stärker ist das elektromagnetische Rauschen und umso größer die potenzielle Störung. Da im Flugmodus immer noch Prozesse im Hintergrund laufen, bleibt das Störpotenzial bestehen. Worst Case wäre demnach Display an und viele Prozesse am Laufen. Ganz so einfach ist es aber auch nicht, da ja nur bestimmte Frequenzen auch wirklich stören. Das bedeutet, es kann auch von Handy zu Handy unterschiedlich sein, wie sich das Ganze auf das LVS auswirkt. Deswegen unsere generischen Vorschläge zum Umgang mit dem Handy, die auf Nummer sicher gehen, um Störungen bei allen auszuschließen. Für Lawinenrucksäcke ist gerade eine Änderung der zugehörigen Norm in Erarbeitung. Es soll auch ein neuer Test beinhaltet sein, der die Störwirkung der elektronischen Lawinenairbags reguliert. Auch die Idee mit der Folie wurde schon diskutiert, aber was die Hersteller in Zukunft gegen die Störwirkung machen, bleibt ihre Sache. Auf jeden Fall ist das Thema jetzt präsent bei allen Anbietern. Lorenz Berker, DAV-Sicherheitsforschung
Pulsdauer > 70 ms
Erhöhtes Rauschen durch Störquelle in der Nähe Positive Flanke
> 400 ms
Umgebungsrauschen (auch Emission des LVS-Geräts)
Zeit
Abb. 1 DAV-Sicherheitsforschung „Beispiel einer Signalmessung unter realen Bedingungen“
Einzelne starke (Stör)Pulse evtl. falsch-positives Signal
i[Signale filtern] Ich bin über euren Artikel „Störquellen bei der Lawinenrettung“ in der letzten bergundsteigen etwas gestolpert und habe dazu ein paar Anregungen/ Kommentare aus meiner beruflichen Erfahrung als Physiker und Produktmanager für Oszilloskope: In eurer Abbildung 1 werden viele verschiedene Störquellen dargestellt, die so auch in der Realität vorkommen. Für die Elektronik eines LVS-Geräts werden jedoch alle höherfrequenten Signale herausgefiltert (oder gar nicht erfasst).
Mobilfunksignale (einige hundert MHz) sind deutlich höherfrequente Signale und sollten deshalb das LVS-Signal nicht stören und die digitale Elektronik dagegen auch immun sein.
Ich habe den Effekt eines normalerweise verwendeten Filters in einer sehr stark gestörten Umgebung (Büro mit WLAN, Handy und mehreren Geräten in der Nähe) veranschaulicht – ungefiltert (Abb. 2) und mit einem 500-kHz-Filter (Abb. 3). Ihr seht deutlich, dass das LVS-Signal ohne Filter sehr verrauscht ist (wie ihr in Abb. 1 darstellt) – mit Filter das Signal aber superclean ist, auch zwischen den Signalen ist das empfangene Signal jetzt auf einer Nulllinie. Im Vergleich dazu ist eure Abbildung 1 etwas angsteinflößend und gibt aus meiner Sicht nicht das korrekte Bild wieder. Störend können jedoch die Emissionen der Leistungselektronik sein, wie ihr dies bei der Garmin Fenix und bei den Airbags gesehen habt. Die Störquellen und auch die Stärke der Störungen muss man nicht vermu-
ten, sondern kann man messen. Als einfache Beispiele habe ich die Fenix (Abb. 4) und Instinct 2 (Abb. 5) jeweils in Betrieb versetzt und das Störspektrum gemessen. Ja, Fenix stört unglücklicherweise rund um 450 kHz, die Instinct 2 nicht. Normalerweise werden diese von den Schaltfrequenzen der DC/DC-Wandler verursacht, die die Batteriespannung in die verschiedenen Spannungen für die Prozessoren/Displays und Sensoren wandeln. Ich habe auch mein iPhone 15 vermessen – völlig unauffällig. Die Störsignale variieren mit dem Wandler bzw. der Schaltgruppe und üblicherweise nicht mit der Leistung. Das kann leider von Modell zu Modell unterschiedlich sein und auch mit den Betriebsmodi variieren (ein iPhone 15 hat sechs Power Converter an Bord und damit mindestens sechs Schaltfrequenzen …). Aus meiner Sicht ist Ausschalten nicht die richtige Empfehlung, da etwas Abstand zwischen LVS und Mobiltelefon ausreichen sollte. Das Telefon in den Rucksack zu geben, reicht wahrscheinlich schon, solange das Telefon nicht verwendet wird. Weder das Aus- noch Einschalten wird in der Praxis beherrscht und kostet zudem kritische Zeit. Der Flugmodus bringt nichts und dass keine Bilder (Display eingeschaltet!) gemacht werden, sollte selbstverständlich sein. Dies sollte aus meiner Sicht genauer verifiziert werden, bevor Empfehlungen ausgesprochen werden.
Ernst Flemming, DAV-Fachübungsleiter/Trainer B Skihochtouren, Physiker
LVS stark gestört durch Mobilfunk


6 GHz Bandbreite
Spektrum des Signals
Abb. 2 LVS-Signal mit vielen Störungen, inklusive Mobilfunk


500-kHz-Filter-Bandbreite




k[Kolumne von Tom Dauer] Ich finde es gut, wenn man sich zu seinem Tun Gedanken macht. Doch schon der 2. Satz im Prolog erzeugt immer wieder Unbehagen in mir: „Nicht in den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für andere und die Natur ganz allgemein.“ Was suggeriert dieser Satz? Der Mensch ist schlecht für die Natur. Meines Erachtens stimmt dies so nicht! Es kommt vielmehr auf die Art und Weise an, wie der Mensch zu den Bergen und der Natur in Beziehung tritt. Hier möchte ich gerne Heinz Grill (bergundsteigen-Bericht 2019) als Erschließer und Geistforscher in seinem Buch „Der Archai und der Weg in die Berge“ zitieren: „Je nachdem, was wir der Natur und den Bergen entgegenbringen, so wird ihre Antwort in einer freudigen Wärme und harmonischen Ökologie uns wieder entgegengehen. Es ist tatsächlich ein tiefes Gesetz, dass all dasjenige, wir an Gedanken, Empfindungen und Werke in die Schöpfung hineinbringen, uns selbst wieder aus der Schöpfung entgegenatmen wird.“ Der einzelne Mensch hat die
LVS-Signal
Zoom
Abb. 3 Mit einem 500-kHz-Tiefpassfilter: supercleanes Signal ohne Störungen!
Elektrische Spannung über die Zeit in Millivolt
Spektrum des Signals
Abb. 4 Garmin Fenix: Störungen in der Nähe von 457 kHz
Elektrische Spannung über die Zeit in Millivolt
Spektrum des Signals
Abb. 5 Garmin Instinct 2: keine Störungen bei 457 kHz
Möglichkeit, die Berge und die Natur zu konsumieren und damit aus ihnen zu „nehmen“. Aber er kann auch aufbauend, förderlich, veredelnd und damit „gebend“ wirken. Dies durch seine Aufmerksamkeit, seine Wahrnehmung und innere Haltung, wie er sich in der Natur bewegt.
Florian Kluckner, Bergführer, Erschließer, Yogalehrer
Vielen Dank für Ihre Gedanken. Tatsächlich hallt in dem von Ihnen zitierten Satz eine über Jahrtausende tradierte Denkweise wider, die von christlichem Seelenglauben über aufklärerische Bewusstseinslehre bis hin zu einer ellbogenbewehrten Ich-AG-Ideologie reicht und die den Menschen als außerhalb der Natur stehend betrachtet. Leider ist dies die gesellschaftlich nach wie vor dominante Sichtweise. In meinen Kolumnentexten habe ich dagegen wiederholt dargelegt (oder das zumindest versucht), dass ich einer anderen, ganzheitlichen, auf Harmonie, Kooperation und Vernetzung
beruhenden Sicht- und Verhaltensweise anhänge, die den Menschen als Teil der Natur betrachtet. Insofern widerspreche ich quasi beständig meiner eigenen Einleitung. Ich fasse Ihre Nachricht als Anregung auf, den Vorspann anders zu texten. Das wäre vielleicht eh nicht schlecht – denn ich verstehe meine Texte nicht als Ausdruck einer zementierten Überzeugung, sondern als Momentaufnahmen in einem andauernden Prozess der Entwicklung und Veränderung. Mit Dank und besten Grüßen
Tom Dauers[Seilverbindungsknoten] Ich habe ein neues imprägniertes Kletterseil mit 9.5 mm Stärke (nutze auch dünnere Seile). Das Seil ist relativ rutschig. Ein festgezogener Sackstich wandert beim Abseilen manchmal ein paar Zentimeter, bevor er sich so richtig festzieht. Deshalb habe ich Bedenken beim Verbinden von zwei Seilen miteinander, gerade bei schlechten Bedingungen wie Nässe. Ich habe zum Thema nur die Seite hier gefunden: https://edelrid.com/ch-de/wissen/knowledge-base/ seilverbindungsknoten-beim-abseilen-vergleich
Getestet wurden Knoten in Tropfenform und der doppelte Spierenstich in Linienform. Kann ich den doppelten Spierenstich auch in Tropfenform zum Seilverbinden beim Abseilen nutzen? Dann ist die Gefahr vom Hängenbleiben geringer (als in Linienform) und der Knoten wandert nicht wie der Sackstich. Ich habe jedoch keine Angaben dazu gefunden, wie sehr dies die Bruchlast vom Seil reduzieren kann oder ob dies andere Nachteile hat. Ich möchte unterschiedliche Seildurchmesser verbinden können, für mich wäre der doppelte Spierenstich in Tropfenform die Alternative zu zwei Sackstichen, da ich mir schwertue diesen voll zu vertrauen. Was ist denn die Lehrmeinung vom ÖAV zum Verbinden von zwei rutschigen Seilen beim Abseilen? Reicht ein Sackstich mit überstehenden Seilenden von circa 50 cm oder lieber ein Sackstich mit zweitem Backup-Sackstich an den Seilenden oder doch der doppelte Spierenstich in Tropfen- oder Linienform?
Jonathan LäppleVerbinde dein Seil zum Abseilen, wie im deutschsprachigen Raum allgemein empfohlen, bitte weiterhin mit dem Sackstich: Den Knoten sauber (= parallel) legen, alle vier Enden festziehen und auf 30 cm lange Seilenden (Überstand) achten. Und – ganz wichtig: AbseilPartnercheck! Der überaus kompetente Florian Hellberg trifft in dem Artikel die leider nicht ganz glückliche Aussage: „Beim Abseilen/ Ablassen im Einzelstrang mit dünnen, glatten Halbseilen macht es Sinn, den Sackstich durch einen zweiten vor dem Herausrollen zu sichern.“ Erstens spricht er hier vom Abseilen/Ablassen am Einzelstrang und nicht am Doppelstrang. Und zweitens ist das eine vorsichtige Interpretation seiner eigenen Testergebnisse. Denn wie er selbst in den Tests feststellt, kommt beim Abseilen nie eine so große Belastung zustande, dass ein einfacher Sackstich – selbst bei unterschiedlichen Seildurchmessern – wirklich als problematisch einzustufen wäre. Viel problematischer wird das Abziehen von Seilen, die mit zwei Sackstichen verbunden sind. Da ist ein Hängenbleiben vorprogrammiert.
Michael Larcher, Berg- und Skiführer, Leiter der Bergsportabteilung des Österreichischen Alpenvereins n


Ihr sucht einen Job in der Bergsport-Welt oder in der Kletterhalle? Ihr habt einen Job in der Outdoor-Branche zu vergeben und sucht Mitarbeitende? KLETTERSZENE.COM betreibt seit einiger Zeit ein kostenfreies Job-Portal, in dem ihr von A wie Außendienst bis Z wie Zweigstellenleitung allerhand findet. Jobangebote könnt ihr an team@kletterszene.com schicken.
Direkt zum Job-Portal der Kletterszene.

Reparaturbonus in Österreich.
Info: https://kletterszene.com/jobs/
Ob E-Bike, Kamera, Smartphone, Sportuhr, Tablet oder Bohrmaschine: Auch am Berg sind Elektronikgeräte unterwegs und gehen kaputt.
Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) fördert mit dem Reparaturbonus die Reparatur von elektrischen und elektronischen Geräten. Der Reparaturbonus wird aus Mitteln des von der Europäischen Union zur Verfügung gestellten Finanzierungs- und Aufbaufonds „Next Generation EU“ im Rahmen des österreichischen Aufbau- und Resilienzplans finanziert und umfasst ein Fördervolumen von insgesamt 130 Millionen Euro bis zum Jahr 2026. Seit April 2022 können Privatpersonen einen Reparatur-Bon beantragen, der bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten und/oder bis zu 30 Euro für die Einholung eines Kostenvor-anschlags (insgesamt maximal 200 Euro) für ihre Elektro- und Elektronikgeräte deckt.
Info und Reparatur-Bons: https://www.reparaturbonus.at/

Rückgerufener Wedze Airbag 30 Rucksack.
Die Marke Wedze hat bei Qualitätskontrollen festgestellt, dass Airbag 30 Rucksäcke dieser Serie, die vor dem 16.08.2023 gekauft wurden, möglicherweise fehlerhaft gefaltete Ballons aufweisen. Die Ballons wurden gerollt anstatt gefaltet, was zu einer längeren Aufblaszeit führen kann. Als Reaktion darauf wird ein freiwilliger Rückruf durchgeführt. Es wird empfohlen, das Produkt vorerst nicht zu verwenden. Der Decathlon Kundenservice steht zur Unterstützung bei der Instandsetzung des Produkts zur Verfügung.
Betroffene Produkte: Decathlon Wedze Airbag 30 (Artikelnummer 4144380), Kaufdatum vor dem 16.8.2023
Kontakt Kundenservice: +49 (0) 6202 97 81 300



Der Hersteller Edelrid ruft Besitzer*innen des MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräts der Charge 04/20 dazu auf, das Gerät auf einen möglichen Defekt zu überprüfen. Ein Gerät mit einem Defekt an der Nachsteigeröse wurde entdeckt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Geräte derselben Charge betroffen sind. Der Defekt ist optisch gut erkennbar, kann unterschiedlich ausgeprägt sein und zu einem Verlust der Festigkeit des Geräts führen. Die Benutzer*innen werden aufgefordert, die Chargennummer zu überprüfen und eine optische Inspektion durchzuführen. Bei festgestellten Defekten soll das Gerät nicht weiterverwendet werden und Kund*innen sollen sich an den Kundenservice wenden. Es wurden keine Unfälle mit dem betroffenen Gerät gemeldet, und andere Modelle sind nicht betroffen. Der Hersteller sichert einen kostenlosen Austausch defekter Geräte zu.
Betroffene Produkte: MEGA JUL mit der Chargennummer 04/20, zu finden am oberen Geräterand Kontakt-E-Mail: service@edelrid.de
Bei einer Sicherheits- und Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass die Crimpverbindung der Nieten am Sicherungsgerät TUBIC ABS der Bergsportmarke Simond möglicherweise unvollständig ist. Dies könnte dazu führen, dass das Sicherungsgerät bei einem Sturz seine Bremswirkung nicht entfalten kann. Um die Sicherheit der Kund*innen zu gewährleisten, wird empfohlen, die Nieten am Sicherungsgerät zu überprüfen. Wenn sie flach sind, kann das Produkt weiterhin verwendet werden. Falls nicht oder bei Unsicherheit sollte das Produkt nicht weiter genutzt werden und der Kundenservice sollte kontaktiert werden.
Betroffene Produkte: Simond TUBIC ABS Artikelnummer 2940026
Kontakt Kundenservice: +49 (0) 6202 97 81 300
Aufgrund von Qualitätskontrollen hat Simond festgestellt, dass die Ummantelung des Seils EDGE 9 mm bei einem Sturz unerwartet verschleißen kann und somit ihre Funktion, den Kern des Seils zu schützen, nicht mehr erfüllt. Obwohl das Seil den Normen entspricht, genügt es nicht den Qualitätsstandards und Sicherheitsanforderungen von Simond. Aus Vorsichtsgründen wird empfohlen, das Produkt nicht weiter zu verwenden. Kund*innen werden gebeten, das betroffene Seil in die nächstgelegene Decathlon-Filiale zu bringen, um eine Rückerstattung zu erhalten.
Betroffene Produkte: Simond Seil EDGE 9 mm, 80 Meter (Modellnummern 8612487, Artikelnummer 4196528) und 100 Meter (Modellnummer: 8612488, Artikelnummer: 4196529), Kaufdatum zwischen 1. Januar 2022 und 17. Oktober 2023 Kontakt Kundenservice: +49 (0) 6202 97 81 300 ■
Geräte, die an dieser Stelle eine Stufe oder Kante wie hier abgebildet aufweisen, können weiterverwendet werden.


Geräte mit vergleichbaren Defekten dürfen nicht weiterverwendet werden.

Überprüfung der Nieten am Simond TUBIC ABS. Geräte mit herausstehenden Nieten dürfen nicht weiterverwendet werden.


Rückgerufene Seile Simond Edge.
In „James Bond 007 – Moonraker“ trifft der britische Geheimagent in Rio de Janeiro auf seinen legendären Antagonisten den „Beißer“ – dieser malträtiert das Drahtseil der Bahn auf den Pão de Açúcar, den „Zuckerhut“, mit seinem Stahlgebiss. Dargestellt wird der Bösewicht vom 2,18 Meter großen Schauspieler Richard Kiel. Die Beißer, um die es im folgenden Text geht, sind dagegen eher winzig, aber auch Seilklemmen haben scharfe Zähne.
Von Chris Semmel und Stefan Blochum


Abb. 1 Der Spoc von Edelrid hat scharfe Zähne wie Piranhas.
Seilklemmen für Faserseile im Bergsport sind zum Aufstieg am fixierten Seil oder für Techniken der behelfsmäßigen Bergrettung konzipiert. Sie entsprechen der Norm EN 567. Beispiele sind: Tibloc, Basic, Ascension oder Croll (Petzl), Ropeman (Wild Country), Hand Cruiser, Uni Cruiser oder Elevator (Edelrid). Seilklemmen mit einer integrierten Rolle erfüllen gleichzeitig die Norm für Seilrollen EN 12278. Sie dienen als Rücklaufsperre für Flaschenzüge in der Arbeitssicherheit und kommen in der behelfsmäßigen Bergrettung zum Einsatz. Beispiele sind: Mini-, Micro- oder Nano-Traxion (Petzl), Spoc (Edelrid) und Rollnlock (Climbing Technology). Da Bergsteiger aber kreative Köpfe sind, ersinnen sie für eigentlich zweckgebundene Ausrüstungsgegenstände immer neue Anwendungsformen, um schneller, leichter, sparsamer oder alternativ unterwegs zu sein. Seilklemmen werden beispielsweise nicht nur zum Aufstieg am fixierten Seil verwendet, sondern auch beim selbstgesicherten Klettern am Fixseil eingesetzt. Dabei kann es je nach Aufhängung zu kleinen Stürzen in die Klemme kommen. Tibloc, Micro-Traxion und Spoc werden auch als Rücklaufsperre beim Klettern am gleitenden Seil genutzt. Hier sind auch weitere Stürze denkbar, wenn der Vorsteiger das Seil nicht permanent einzieht. Weitere kreative Anwendungsmethoden sind das Nachsichern am Stand oder das Klettern an der mobilen Weiche mit Rollenklemme.
Doch wo liegen die Grenzen für den Einsatz von Seilklemmen? Ab wann treten Mantelschäden auf, können Kerneinlagen reißen? Und droht im schlimmsten Fall gar ein Komplettriss des Seils beim Sturz in die gezahnten Beißer (Abb. 1)?
Laut Norm EN 567 für Seilklemmen müssen diese einer Last von 4 kN standhalten. Dabei dürfen sie sich weder funktionseinschränkend verformen noch das Seil durchtrennen. Geprüft werden die Klemmen statisch an der Zerreißmaschine. Seilrollen ohne Klemmmechanismus werden nach EN 12278 mit 15 kN Last statisch geprüft, bei 2 kN muss sich die Rolle drehen können. Die Achsen zertifizierter Rollenklemmen halten also – wie Seilrollen – einer Bruchlast von 15 kN stand. Leider gibt es eine andere Schwachstelle: das Seil. Denn die Zähne der Rollenklemmen bohren sich in das Seilgeflecht und quetschen dieses, um die Last am Seil zu fixieren. Eine Last von 15 kN ist dabei utopisch, dieser Wert gilt nur für die Rollen selbst. Die Klemmfunktion wird, wie beschrieben, entsprechend EN 567 mit 4 kN geprüft und bedeutet dabei bereits enormen Stress für ein Faserseil. Bei diesem Test sind sogar Mantelschäden erlaubt. Ein Komplettriss des Seils oder funktionseinschränkende Deformationen an der Rollenklemme dürfen dagegen nicht auftreten. Dynamische Krafteinträge, wie sie bei Stürzen auftreten, werden bei beiden Normen nicht geprüft (Abb. 2).
In der Praxis lassen sich fünf Einsatzbereiche für Rollenklemmen definieren: der Aufstieg am Fixseil, das Klettern an der mobilen Weiche, das Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre und das Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme. Der ein oder andere Bergführer wendet die Rollenklemme auch zum Fixieren des Seilabbunds am Gurt an.

F = 4 kN
F = 15 kN
Abb. 2 Prüfung Seilklemmen (links) und Seilrollen (rechts).

Abb. 3
Der Beißer. Foto: Eon Productions
Abb. 4 Beim Aufstieg am Fixseil sollte direkt in den Karabiner eingehängt werden oder die Weiche sehr kurz sein.
Abb. 5 Beim Klettern mit mobiler Weiche in der Dreierseilschaft sollte die Weichenlänge so kurz wie möglich sein.
Rollenklemmen – Anwendung in der Praxis außerhalb der Bergrettung
1. Aufstieg am Fixseil
2. Klettern an der mobilen Weiche
3. Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre
4. Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme
5. Fixieren des Seilabbunds am Gurt
Unabhängig von der Anwendung ist entscheidend, welche Kräfte an Seil und Rollenklemme auftreten können. Sturzkräfte beim Klettern und Bergsteigen lassen sich aber schwer berechnen. Einfacher ist es, die Sturzenergie zu berechnen, die bei freiem Fall oder Abrutschen auf Eis und Firn anhand von Masse, Erdbeschleunigung und Sturzhöhe abzüglich Reibung ermittelt wird. Die im System wirkenden Kräfte werden dagegen durch die Bremskraft bzw. den zur Verfügung stehenden Bremsweg bestimmt. Wird statisch gesichert (Rollenklemme am Seil), besteht der Bremsweg ausschließlich aus der Verformung des Seils und des Bergsteigers. Wir haben beim Sturz in eine Rollenklemme also kein dynamisches Bremsgerät, das durch Seildurchlauf Energie abbauen kann, sondern eine statische Sicherung an einem mehr oder weniger elastischen Seil. Die Dehnung und somit der Bremsweg ist im Gegensatz zu den sonst üblichen, dynamischen Sicherungen (HMS, Tuber am Fixpunkt, Körpersicherung mit Halbautomat oder dynamischem Sicherungsgerät) begrenzt. Hierbei sorgen Seildurchlauf und das Hochgezogen-Werden des Sichernden für den nötigen Bremsweg, der die auftretenden Kräfte überschaubar hält. Beim Klettersteiggehen stellt der Bandfalldämpfer die maximale Bremskraft (6 kN) bzw. den maximalen Bremsweg (220 cm) sicher. Mit anderen Worten gilt bei
der Anwendung von Rollenklemmen in der Praxis: Je größer die Sturzhöhe oder Masse und je kürzer das Seilstück, in das gestürzt wird, desto größer werden die Kräfte, die auf Seil und Rollenklemme einwirken.
1. Aufstieg am Fixseil
Beim Aufstieg am Fixseil wird häufig eine Weiche verwendet. Diese hat in der Regel eine Länge von 30–75 cm, abhängig von ihrem Aufbau. Damit sind theoretisch Sturzhöhen von 60–150 cm möglich. Je kürzer die Weiche, desto geringer die mögliche Sturzhöhe – vorausgesetzt, das Seil wird unten einigermaßen straff fixiert, sodass sich oberhalb der Klemme kein Schlappseil bilden kann (Abb. 4). Der zweite entscheidende Faktor ist die Sturzmasse. Gehen wir von einem Bergsteiger mit vollem Rucksack aus, kann sie an die 100 kg reichen. Dritter und weiterer entscheidender Faktor ist, wo sich der Sturz ereignet. Denn der Bremsweg, also die Seildehnung, ändert sich abhängig davon, ob sich die stürzende Person zehn oder einen Meter unter der Seilaufhängung befindet. Zehn Meter Seil dehnen sich mehr als ein Meter Seil. Je weniger Seildehnung zur Verfügung steht, desto größer werden die auftretenden Kräfte.
2. Klettern an der mobilen Weiche
Auch beim Klettern an der mobilen Weiche ist die Sturzhöhe von der Länge der Weiche abhängig. Selbst wenn mit Schlappseil gesichert wird, kann beim Mittelmann an der Rollenklemme eigentlich kein Schlappseil entstehen, da die Rolle fast reibungslos mitläuft (Abb. 5). Der Sichernde müsste aktiv Seil nachlassen, um Schlappseil zu produzieren. Für den hinteren, direkt eingebundenen Nachsteiger kann dagegen Schlappseil entstehen, sollte der Sichernde zu langsam Seil einziehen bzw. der Hintermann zu

schnell klettern. Zwischen Hinter- und Mittelmann entstandenes Schlappseil kann der Sichernde nicht einziehen, da die Rollenklemme bei Zug von oben blockiert. Somit können auch bei dieser Anwendung in der Regel nur Sturzhöhen vom Doppelten der Weichenlänge (60–150 cm) auftreten.
3. Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre
Das Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre ist eine selten zu beobachtende Sicherungsform, doch sie findet sich in dem ein oder anderen Lehrplan. Hierbei wird eine Rücklaufsperre in Form einer Seilklemme (in der Regel Tibloc, Micro-Traxion oder Spoc) mittels Oval- oder HMS-Verschlusskarabiners in einen Fixpunkt eingehängt (Abb. 6). Stürzt der Seilzweite, soll die Rücklaufsperre die Last aufnehmen, sodass der Seilerste nicht mitgerissen werden kann. Auf diese Art und Weise gesichert, kann sich eine Seilschaft gleichzeitig fortbewegen. Stürzt der Seilzweite jedoch nahe an einem Fixpunkt mit Rücklaufsperre und ist dabei Schlappseil im Spiel, können Sturzhöhen von einem bis zu einigen Metern auftreten. Das Schlappseil bildet sich, wenn der Nachsteiger zügig zur Rücklaufsperre klettern möchte, um diese auszuhängen und damit zu vermeiden, dass der Vorsteiger kein Seil mehr erhält. Ein durchaus realistisches Szenario.
4. Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme
Ungewöhnlich, aber immer häufiger zu beobachten, ist das Nachsichern mit Rollenklemme am Fixpunkt (Abb. 7). Hierbei sind durchaus größere Sturzhöhen im Nachstieg möglich, wenn das Seil nachlässig eingeholt wird und der Nachsteigende trotz entstehendem Schlappseil einfach weiterklettert.
5. Fixieren des Seilabbunds am Gurt
Eine Sonderform ist das Absichern des Seilabbunds mittels Rollenklemme (Abb. 8). Stürzt der Bergführer derart „angeseilt“, treten Kräfte wie bei jedem Vorstiegssturz am Anseilpunkt auf.
Die fünf beschriebenen Szenarien haben folgende Faktoren gemeinsam: Eine Masse (Bergsteiger) stürzt wenige Zentimeter bis Meter in eine Seilklemme. Interessant ist nun, wie die Funktion der Seilklemme – beißen und klemmen – sich auf das Seil auswirkt, abhängig davon, wie viel Seil sich zwischen Seilklemme und Fixpunkt dehnen und damit den Bremsweg verlängern kann. Beim Aufstieg am Fixseil und beim Klettern an der mobilen Weiche (Anwendungen 1–2) wird die Sturzhöhe in der Regel durch die Länge der Seilweiche begrenzt. Am wahrscheinlichsten entsteht Schlappseil und damit eine relevante Sturzhöhe beim Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre, beim Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme oder beim Sturz in den Seilabbund mit Rollenklemme am Gurt (Szenarien 3–5).
Folgende Konsequenzen sind zu erwarten, wenn bei der Verwendung von Seilklemmen Sturzkräfte auftreten: leichte und deutliche Mantelschäden, komplette Mantelrisse ohne und mit Teilriss des Seilkerns sowie Totalrisse des Seils. Somit ergeben sich nach einem Sturz in eine Seilklemme sechs mögliche Resultate (Abb. 9):
y kein Schaden (grün)
y leichter Mantelschaden (hellgrün)
y Mantelschaden mit sichtbarem Seilkern (gelb)
Abb. 6 Das simultane Klettern mit Rücklaufsperre birgt Gefahren.
Abb. 7 Bei einigen Bergführern beliebt: das Nachsichern mit Rollenklemme.
Abb. 8 Seilabbund mit Rollenklemme – bloß nicht stürzen!
Stefan Blochum ist Bergführer und Ausbildu ngsleiter der Bergwacht Bayern am Bergwachtz entrum für Sicherheit un d Ausbildung in B ad Tölz.

grün
Keine nennenswerte Mantelbeschädigung.
Masse innerhalb
2 Metern gestoppt

hellgrün
Mantel leicht beschädigt aber Kern nicht sichtbar

gelb
Mantel beschädigt und Kern sichtbar Seil auszusortieren


orange Mantel durchtrennt, keine Kernlitzen durchtrennt rot
Mantel und Kernlitzen durchtrennt

schwarz Komplettriss Seil
Abb. 9 So bewerteten wir die aufgetretenen Seilschäden.
y Komplettriss des Seilmantels ohne Beschädigungen am Seilkern (orange) y Komplettriss des Seilmantels mit Riss einzelner Einlagen des Seilkerns (rot) y Komplettriss (schwarz)
Kommt es infolge eines üblichen Sturzes, etwa beim Sportklettern im Nachstieg, zu einem leichten Mantelschaden (hellgrün) oder ist der Seilkern sichtbar (gelb), ist dies für die meisten Kletterer nicht akzeptabel. Ist der Seilkern sichtbar (gelb), hat der Kletternde aller Wahrscheinlichkeit nach überlebt, das Seil muss aber ausgesondert werden. Handelt es sich um einen SpeedBegehungsversuch, wird man ein kaputtes Seil (gelb/orange) vielleicht riskieren – ein sicheres Weiterklettern ist jedenfalls nicht mehr möglich. Eindeutig zu weit gegangen ist man, wenn der komplette Mantel und Teile des Seilkerns oder gar das komplette Seil reißen (rot/schwarz).

Abb. 10 Getestete Geräte
Ältere Untersuchungen haben gezeigt, dass Rollenklemmen ab einwirkenden Kräften von 4 kN das Seil bis hin zum Riss beschädigen können. Laut Artikel „Rock’n’Roll“ (Max Berger, Robert Kniewasser, bergundsteigen #118, S. 70–73) tritt dies bei Einfachseilen (9 mm) bereits bei Sturzhöhen von 1 m bei 80 kg Masse und 1 m ausgegebenem Seil auf (Sturzfaktor 1). Bei 100 kg Masse reichen 50 cm Sturzhöhe und bei 120 kg bereits 25 cm, jeweils bei Sturzfaktor 1. Bei einem Halbseil reicht bei 80 kg bereits ein halber Meter. Erhöht man die Fallmasse auf 100 bzw. 120 kg, reichen 40 bzw. 10 cm Sturzhöhe mit Sturzfaktor 1. Das heißt, ein kleiner „Rutscher“ direkt am Stand macht das Seil unbrauchbar!
In der genannten Untersuchung werden die möglichen Konsequenzen in drei Kategorien unterteilt: Seilriss, Mantelriss mit Kernschäden und „unbedenkliche Anwendung“. Wir wissen nicht, in welche Kategorie ein leichter Mantelschaden, ein Mantelschaden mit sichtbarem Kern oder ein Komplettriss des Mantels ohne Kernbeschädigung einsortiert wurde. In der Praxis machen diese Wirkungen jedoch einen beträchtlichen Unterschied aus. Anders als bei der in „Rock’n’Roll“ zitierten Untersuchung war unser Ziel herauszufinden, wo bei der Anwendung von Seilklemmen Grenzwerte liegen. Laut genanntem Artikel fanden die Tests stets mit Sturzfaktor 1 statt. Doch was passiert, wenn eine Person drei Meter unterhalb des Stands einen Meter in die Klemme stürzt? Ab welcher Sturzhöhe wird eine derartige Situation problematisch? Wann kann der Sturz in eine Rollenklemme verantwortet werden? Vor diesem Hintergrund berücksichtigte unser Testaufbau auch Sturzfaktoren <1. Um zu untersuchen, ob sich unterschiedliche Geräte wider Erwarten unterschiedlich verhalten würden, erweiterten wir unseren Gerätepool neben Micro-Traxion um Nano-Traxion, Spoc, Rollnlock, Tibloc neu und alt, Lift sowie Ropeman 1 und 2. Zum Vergleich wurden auch Reverso, ATC Guide Alpin und Giga Jul in Plattenfunktion getestet, außerdem ein Rock Grab, da das Gerät in der deutschen Bergführerausbildung für die mobile Weiche verwendet wird (Abb. 10).
Wir wählten einen 100 kg schweren Sandsack als Fallmasse. Mit diesem Gewicht bildeten wir den Worst Case ab, zudem liefert ein Sandsack sehr gut reproduzierbare
Abb. 11 Versuchsaufbau
Aufstieg am Fixseil und Klettern mit mobiler Weiche ohne Masse unten.
Ergebnisse. Laut einer Untersuchung der DAV-Sicherheitsforschung verhält sich ein Reifen (Dummy) bei einem Sportklettersturz zwar eher wie ein menschlicher Körper, der Kraft-Zeit-Verlauf bei Sturzversuchen mit Menschen streut jedoch enorm. Ein Reifen verhält sich ähnlich wie ein Mensch, der entlang einer Parabel stürzt und sich im Moment der Krafteinleitung in Schräglage befindet (Sportklettersturz). Der Sandsack reagiert eher wie jemand, der senkrecht und mit Krafteinwirkung parallel zur Wirbelsäule fällt (Fußsprung). Um auch hier den Worst Case abzubilden, haben wir uns nach ersten Vormessungen mit Reifen für Tests mit Sandsack entschieden.
Um zu variieren, verwendeten wir im Test folgende Seile:
y Einfachseil Canary Pro Dry 8,6 mm
y Einfachseil Swift 48 Pro Dry 8,9 mm
y Hilfsleine Rad Line 6 mm (Petzl)
Szenario 1 (Abb. 11). Zunächst testeten wir die Anwendungen 1–2, also Aufstieg am Fixseil und Klettern an der mobilen Weiche. Die Weichenlänge betrug ca. 50 cm, die Sturzhöhe exakt einen Meter. Die Menge des Seils zwischen Klemme und Fixpunkt variierte (Bremsweg).
Szenario 1a (Abb. 12). Um den Einfluss des zweiten Nachsteigers zu berücksichtigen, wurden die Ergebnisse mit einem zweiten Gewicht (100 kg), das unten am Seil hing, überprüft. So konnten wir eine Situation darstellen, in der der hintere Nachsteiger stürzt, das Seil unter Last steht und der Mittelmann in seinen Weichenarm fällt.
Szenario 2 (Abb.13). In einer zweiten Messreihe bildeten wir die Anwendungen 3–4 ab, also Gehen am gleitenden Seil mit
Rücklaufsperre und Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme. Hier war die Klemme direkt am Fixpunkt aufgehängt und das Gewicht stürzte 1 Meter in die Klemme. Die Länge des Seils unter der Klemme konnten wir variieren.
Ergebnisse Szenario 1. Aufstieg am Fixseil und Klettern an der mobilen Weiche. Stürze in den Weichenarm sind beim Aufstieg am Fixseil oder beim Klettern an der mobilen Weiche möglich. Die maximale Sturzhöhe wird durch die Länge der Weiche bestimmt; sie misst das Doppelte der Weichenlänge. Wir wählten folgenden Versuchsaufbau: Seil: Swift 48 Pro Dry, 100 kg Sturzmasse, Sturzhöhe 1 m bei einer Weichenlänge von 50 cm, Seillänge unterhalb Fixpunkt 1 m bzw. 0,5 m (Sturzfaktor 1 und 2). Bei diesem Test hatte die Verwendung von Micro-Traxion, Spoc und Rollnlock (Rollenklemmen) sowie von Lift (Seilklemme) Mantelschäden mit sichtbarem Kern oder gravierendere Beschädigungen bis hin zum Komplettriss des Seils zur Folge (Abb. 14).
Lediglich die Tests mit dem Rock Grab (Seilklemme) endeten ohne erkennbare Seilbeschädigungen. Allerdings kam es bei Sturzfaktor 1 ab einer Fallhöhe von 1 m zu großen Bremswegen; die Klemme rutschte bis zu 125 cm durch. Während die an den Zahnklemmen wirkenden Kräfte stets über 4 kN lagen, blieben sie beim Rock Grab aufgrund des längeren Bremswegs unter 4 kN. Bei Verwendung des Tibloc (Seilklemme) kam es zwar zu Mantelbeschädigungen mit sichtbarem Kern, anders als bei den Rollenklemmen und dem Lift jedoch nicht zu Kernbeschädigungen. Erst bei Sturzfaktor 2 (Sturzhöhe 1 m, Seillänge 0,5 m) verursachte auch der Tibloc Kernbeschädigungen. Bei diesem Versuchsaufbau verlän-
Abb. 12 Testszenario 1a: mobile Weiche und Aufstieg am Fixseil mit zweiter Masse am Seil unten.
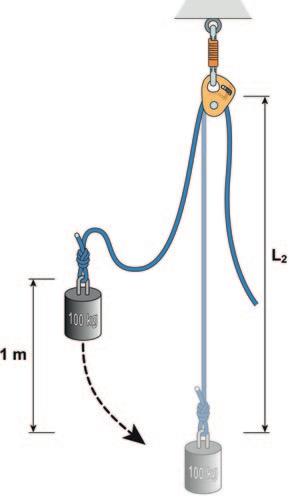
Abb. 13 Testszenario 2: gleitendes Seil und Nachsichern.
Mantel leicht beschädigt
Mantel beschädigt, Kern sichtbar
Mantel getrennt, Kerneinlage intakt
Mantel und Teil der Kerneinlage durchtrennt
So... ...oder... ...so!
Abb. 15 Kurze Weiche, maximal 25 cm!
Abb. 14 Ergebnisse Testszenario 1: Klettern mit mobiler Weiche bzw. Aufstieg am Fixseil.
gerte sich der Bremsweg des Rock Grab auf bis zu 300 cm. Ein zusätzliches Gewicht am unteren Ende des Seils (hinterer Nachsteiger zuerst gestürzt und Seil mit 100 kg vorgespannt) führte zwar zu einer höheren Last am Fixpunkt, hatte aber keinen Effekt auf Schäden am verwendeten Seil.

Abb. 16 Aufbau mit Tibloc beim gleitenden Seil mit Rücklaufsperre.
Wird die Länge der Weiche verkürzt und damit die Sturzhöhe auf 25 bis 50 cm reduziert, treten kaum Seilbeschädigungen auf. Stürzt man mehr als 3 m unterhalb des Fixpunkts, treten auch bei einer Sturzhöhe von 1 m keine Seilbeschädigungen auf. Für den Aufstieg am Fixseil und das Klettern an der mobilen Weiche lässt sich festhalten: Die Weichenlänge (Abstand Gurt bis Seilklemme inkl. Sicherungsring, Schlinge und Karabiner) sollte beim Aufstieg am Fixseil und beim Klettern an der mobilen Weiche maximal 25 cm betragen, um die Sturzhöhe möglichst gering zu halten (Abb. 15).
Bei Verwendung des Rock Grab entstehen keine Seilbeschädigungen. Dennoch sollte die Sturzhöhe möglichst gering gehalten werden, um ein Durchrutschen zum zweiten Nachsteiger zu vermeiden. Wird auf eine geringe Sturzhöhe von maximal 50 cm geachtet, sind Aufstieg am Fixseil und das Klettern an der mobilen Weiche mit Seilklemmen vertretbar. Für das Klettern an der mobilen Weiche erwies sich das Rock Grab mit kurzer Weiche als am besten geeignet.
Ergebnisse Szenario 2. Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre und Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme. Das Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre (Rollenklemme oder Tibloc (Abb. 16)) ist eine Spezialanwendung, die Gefahren birgt. Grundvoraussetzung ist eine kurze Aufhängung der Seilklemme am Fixpunkt mit Oval- oder HMS-Karabiner. Der Oval- bzw. HMS-Karabiner soll sicherstellen, dass sich die Klemme nicht verkantet. Ansonsten könnte das Seil seitlich über die Seitenwand der Klemme laufen und dadurch schwergängig sein oder beim Sturz über eine Kante belastet werden. Ganz wichtig jedoch ist, dass der Nachsteiger nicht nah am Fixpunkt stürzt. In jedem Fall sollte kritisch abgewogen werden, ob eine höhere Geschwindigkeit auf Kosten reduzierter Sicherheit gerechtfertigt ist. Der Nachsteiger muss über große Erfahrung und Problembewusstsein verfügen.
Für die Praxis relevanter erscheint uns die Untersuchung des Nachsicherns am Stand über eine Rollenklemme. Wir wählten folgenden Versuchsaufbau: Seil: Swift 48 Pro Dry, Canary Pro Dry, Apus Pro Dry und Hilfsleine Rapline Pro Dry und Rad Line, 100 kg Sturzmasse, Sturzhöhe 1 m bzw. größere Sturzhöhe mit Sturzfaktor 1, Seillänge unter Stand bzw. Fixpunkt variiert (Sturzfaktor 0,25–2). Abbildung 17 zeigt noch einmal den Versuchsaufbau bei konstanter Sturzhöhe (1 m) und variablem Abstand einer Sturzmasse mit 100 kg Gewicht zum Fixpunkt bei Verwendung
Abb. 17 Ergebnisse beim Nachsichern: Die Sturzhöhe betrug immer 1 m, der Abstand zum Standplatz variierte.
eines Canary Pro Dry mit 8,6 mm Durchmesser. Deutlich wird: Stürzt eine Person nahe am Stand (Abstand 1–2 m), kann die Verwendung von Rollenklemmen zu schweren Seilschäden oder gar zum Seilriss führen (Sturzfaktor 0,5–1). An dynamischen Seilen kam es ab Sturzfaktor 1 zu Komplettrissen (1 m Sturzhöhe bei 1 Meter Abstand zu Fixpunkt). Bei statischen Hilfsleinen verschärft sich das Problem: Komplettrisse sind bereits ab Sturzfaktor 0,25 möglich (1 m Sturzhöhe bei 4 Metern Abstand zum Fixpunkt).
Bei Stürzen mit Abstand zum Fixpunkt von 2–3 m wird das Seil unbrauchbar, weil der Kern sichtbar wird (Sturzfaktor 0,3–0,5). Dies bestätigt die Ergebnisse der im Artikel „Rock’n’Roll“ zitierten Untersuchung und zeigt, dass die Gefahr von schweren Seilbeschädigungen bei einem Abstand von weniger als 3 m zum Fixpunkt droht. Bei 3–4 m Abstand zwischen Stürzendem und Fixpunkt können bei einer Sturzhöhe von 1 m bereits leichte Mantelschäden auftreten, ohne dass der Kern sichtbar wird (Sturzfaktor 0,25–0,3). Unproblematisch sind Stürze mit einer Sturzhöhe von 1 m, wenn sich die stürzende Person mehr als 4 m unterhalb des Stands befindet (Sturzfaktor 0,25). Sie verursachen keine Materialschäden.
Bei Verwendung von Sicherungsplatten (Reverso, ATC-Guide, Giga Jul) traten keine Seilbeschädigungen auf, sofern an den Geräten keine scharfen Grate vorhanden waren. Doch hier ist Vorsicht geboten! Denn scharfe Grate bilden sich oft am
Mittelsteg stark gebrauchter Geräte (Abb. 18). In unserem Test führte dies zum Riss eines Halbseils in einer Sicherungsplatte bei einem Sturz mit Sturzfaktor 1. Scharfe Grate am Mittelsteg der Alpin-Tuber müssen daher unbedingt entgratet werden.
Ebenso kam es bei Verwendung dünner Einfach- und Halbseile sowie der Hilfsleinen zum aneinander Vorbeidrehen der Seilstränge in der Platte, was zum Versagen der Sicherung führte. Allerdings hatten wir bei den Versuchen keine Hand am Bremsseil. Bei früheren Versuchen konnten wir feststellen, dass mit Bremshand am Bremsseil ein Sturz ähnlich wie mit HMS gehalten werden kann. Wird also nur mit Einfachseil (ein Strang in der Platte) nachgesichert und der Seildurchmesser ist für die Platte zu dünn, muss unbedingt die Bremshand am Seil bleiben. Abbildung 19 zeigt unsere Ergebnisse bei Stürzen mit Sturzfaktor 1, aber größerer Sturzhöhe. Dieser Fall kann eintreten, wenn beim Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme Schlappseil entsteht. Auch beim Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre ist ein derartiges Szenario möglich, wenn der Nachsteiger zur Klemme am Fixpunkt klettert, der Vorsteiger sich aber nicht vorwärts bewegt. In diesem Fall drohen bei Verwendung eines Canary Pro Dry mit 8,6 mm Durchmesser bereits bei kleinen Stürzen von 0,25 cm mit einer Sturzmasse von 100 kg sehr nah am Fixpunkt Seilschäden. Ab einer Sturzhöhe von zwei Metern bei Sturzfaktor 1 ist das Seil ab.

Abb. 18 Durch häufiges Belasten entstehen Grate an den Seitenwangen und am Mittelsteg.
Länge Seil L1 = Fallhöhe
Sturzfaktor immer
Abb. 19 Ergebnisse für das gleitende Seil bei Sturzfaktor 1, die Sturzhöhe variierte. Illustrationen: Georg Sojer

Abb. 20 Für Hilfsleinen benötigt man sehr schmale Sicherungsplatten wie das Mago.

Abb. 21 Passt der Seildurchmesser nicht zur Sicherungsplatte, kann beim Nachsichern mit nur einem Strang die Klemmwirkung eingeschränkt funktionieren. Fotos: Chris Semmel
Ergänzend zu den Aussagen der Autoren des Artikels „Rock’n’Roll“ (Max Berger, Robert Kniewasser, bergundsteigen #118, S. 70–73) möchten wir darauf hinweisen, dass beim Nachsichern mit Rollenklemmen oder Tibloc am Stand Seilschäden drohen. Unsere Testergebnisse zeigen, dass bereits bei einem Abstand von unter 3 m zum Stand eine Sturzhöhe von 1 m (Sturzfaktor 0,3) zu schweren Seilbeschädigungen führt. Ein permanent straffes Einziehen wäre daher zwingend notwendig. Unseres Erachtens wiegen die Vorteile dieser Anwendung ihre Nachteile bzw. Gefahren nicht auf. Bei der Verwendung statischer Hilfsleinen darf keinesfalls mit Rollenklemme nachgesichert werden!
Vorsicht ist bei Sicherungsplatten mit scharfem Grat am Mittelsteg geboten. Sie sollten unbedingt mit feinem Schleifpapier entfernt werden. Unbedingt geachtet werden muss auf die Gefahr, sich aneinander vorbeidrehender Seile im Schlitz der Sicherungsplatte. Dies gilt besonders, wenn nur ein Seilstrang benutzt wird (Abb. 21). Die Herstellerangaben zum geeigneten Seildurchmesser sind nicht zielführend! Weichere Seile rutschen auch innerhalb der zugelassenen Durchmesserbereiche aneinander vorbei. Es wäre dringend nötig, schmalere Sicherungsplatten für dünne und weiche Seile auf den Markt zu bringen. Mit Hilfsleinen ist die Plattenfunktion gängiger Sicherungsplatten unbrauchbar. Hier sollte klassisch mit HMS oder mit Spezialgeräten gearbeitet werden.
Zu guter Letzt kommen wir zu dem Ergebnis, dass das Fixieren des Seilabbunds am Gurt mittels Rollenklemme die Gefahr eines Seilrisses bei einem harten oder weiten Sturz mit Sturzfaktor 1 birgt. Wir halten dies daher nicht für eine sinnvolle Methode, den Seilabbund abzusichern. Ein Sturz des Bergführers müsste bei Anwendung dieser Methode ausgeschlossen werden.
Bei dynamischen Belastungen üben Seilklemmen mit Zähnen oder Riffeln einen enormen Stress auf die verwendeten Seile aus. Die Länge des Seils zwischen Aufhängung und Klemme beeinflusst die Problematik enorm. Potenzielle Sturzhöhen sollten daher möglichst gering gehalten werden. Je kürzer das Seil, desto gravierender die Seilbeschädigungen.
y Das Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme ist nach Erachten der Verfasser keine vertretbare Sicherungstechnik.
y Das Fixieren des Seilabbunds am Gurt mittels Rollenklemme ist heikel, die Vorteile rechtfertigen das Risiko nicht.
y Der Aufstieg am Fixseil und das Klettern an der mobilen Weiche (Dreierseilschaft am Einfachseil oder Klettern am Fixseil) mit Rollenklemmen ist vertretbar. Hierbei sollte die mögliche Sturzhöhe auf 30–50 cm begrenzt sein (Weichenlänge maximal 25 cm). y Beim Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre ist abzuwägen, ob der Geschwindigkeitsgewinn dieser Sicherungstechnik die Gefahr von Seilschäden rechtfertigt. In jedem Fall darf der Nachsteiger nahe am Fixpunkt kein Schlappseil entstehen lassen. y Sicherungsplatten sind für dünne und/ oder weiche Seile oft zu breit. Es besteht die Gefahr, dass die Klemmfunktion versagt. Daher ohne Bremshand am Seil das System durch einen Stopp-Knoten absichern, möchte man die Bremshand lösen. Herstellerangaben zu zulässigen Seildurchmessern sind hier nicht zuverlässig und garantieren keine funktionierende Klemmfunktion. Es fehlen schmälere Sicherungsplatten am Markt.
y Vorsicht, wenn am Mittelsteg der Sicherungsplatte scharfe Grate entstanden sind. Dies kann bei einem Nachstiegssturz am Einzelstrang zum Seilriss führen. Mögliche Grate können selbständig mit feinem Schmirgelpapier entfernt werden.
Vom ersten Meter bis zum feierlichen letzten Schritt. Entdecke die Eiger Speed Kollektion – entwickelt, um dich ans Ziel zu bringen.




Klippen oder Cliffs bieten Herausforderung und Risiko.
Foto: Pauli Trenkwalder

Risiken einzugehen, muss nicht gleich eine Sucht sein. Risiko gehört zum Bergsteigen dazu. Manches ist dazu schon geschrieben worden – aber wir denken trotzdem, dass es Sinn macht, darüber nochmals neu nachzudenken und den einen oder anderen Punkt nochmal bewusst zu machen.
No risk – NO FUN, Risiko-FREUDE, Risiko-SCHEU, Risiko-SPORT, REST-Risiko, Risiko-MANAGEMENT: Begriffe, die in unserer Gesellschaft Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben. Die Risiko-EINSCHÄTZUNG in einer konkreten Situation bleibt dabei in den allermeisten Fällen eine sehr individuelle, von verschiedenen persönlichen und situativen Faktoren abhängige und nicht selten „fluide“ Sache. Eine solche Einschätzung mussten schon die antiken und mittelalterlichen Seefahrer treffen, wenn sie eine Klippe (alt-italienisch „risco“) umsegeln mussten (lateinisch „risicare“). Insofern war es im damaligen Sprachgebrauch zumindest schon angelegt, dass der Begriff Risiko mit einer gewählten Entscheidung und dem bewussten Wagnis zu einer Handlung zu tun hat (auch wenn damals die Entscheidungsspielräume generell viel kleiner waren als heute). Das unterscheidet das Risiko von einer Gefahr, die nur eine Sachlage beschreibt, die das Potential einer schädlichen Wirkung hat (z. B. ein loser Felsblock in einer Wand), aber für uns erst durch unser Handeln zum Risiko wird (z. B. wenn wir in der Wand klettern). Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum Menschen überhaupt Risiken eingehen und sich absichtlich in gefährliche Situationen begeben. Warum begibt sich der Mensch ins Hochgebirge, in die überhängende Felswand oder in die lawinengefährdete Steilflanke und setzt sich dadurch Unsicherheiten und Risiken aus? Erklärungen dazu lassen sich in der Soziobiologie, der Psychologie und anderen verwandten Disziplinen finden.
emotional anspruchsvolleren sogenannten Wachstumsbedürfnisse aus: wichtig sein, Macht, Einfluss, Erfolg, Wertschätzung, Prestige, Freiheit und schließlich Selbstverwirklichung als (nie ganz abgeschlossene) Suche nach Entfaltung der eigenen Talente und Potentiale. Im Hochgebirge suchen wir Herausforderung und Flow. Dort konnen wir uns aber auch in gewissermaßen künstliche, nicht an existenzielle Bedürfnisse gebundene Risikosituationen begeben, die wir uns selber aussuchen (Freiheit). Das führt zur Stimulation, einerseits direkt durch Hormonausschüttung, andererseits indirekt durch soziale Anerkennung (Wertschätzung). Held zu sein bedeutet einen hohen sozialen Rang und bringt Ansehen. Es unterstreicht die eigene körperliche Fitness (Entfaltung eigener Talente) und macht attraktiv (Prestige). Damit lässt sich auch der Boom der Risikosportarten begründen, der heutzutage auf weitaus höhere Akzeptanz als noch vor 20, 30 Jahren trifft.
sVon Jan Mersch und Wolfgang Behr Wolfgang Behr, 53, ist DAV-Trainer Skihochtouren und leitet das Kontrahentenrisiko-Controllin g einer Bank. Er ist verheiratet u nd hat zwei Kinder.
mMotivationsforschung: Risiko und Bedürfnisse
Eine sehr nachvollziehbare Deutung liefert die Betrachtung aus der Perspektive unserer menschlichen Bedürfnisse: In unserer modernen westlichen Wohlstandsgesellschaft besteht ein vergleichsweise geringes objektives Lebensrisiko für den Einzelnen. Wir werden derzeit zumindest nicht direkt von Kriegen bedroht, die Kriminalitätsrate ist vergleichsweise gering, Hungersnot ist faktisch nicht vorhanden. Unsere existenziellen Bedürfnisse sind befriedigt. Uns friert nicht und den Kampf auf Leben und Tod kennen wir nicht. Weil unsere existenziellen Bedürfnisse meist befriedigt sind, richtet sich unsere Motivation auf die weiter oben in der Bedürfnishierarchie (nach Abraham Maslow, 1908–1970) stehenden, kognitiv und
In der Soziobiologie sucht man nach dem Sinn von riskantem Verhalten. Es wird versucht, die Notwendigkeit riskanter Situationen zu begründen. Risiko wird dabei als Teilaspekt des elementaren emotionalen Steuermechanismus „Suche und Erkundung“ beschrieben. Dabei kommt dieser emotionalen Steuerung neben anderen die Aufgabe zu, die Fortpflanzung und Lebenserhaltung von Organismen in komplexen Umwelten zu sichern. So dient jene „Suche und Erkundung“ dem Erschließen neuer Lebensräume, ist aber auf der anderen Seite mit großen Risiken verbunden. Gesteuert wird diese Emotion vor allem über den Neurotransmitter Dopamin. Bei Versuchen mit Ratten und Affen sind nicht alle Mitglieder einer Gruppe gleichermaßen an dieser riskanten Erkundungstätigkeit beteiligt. Insbesondere die jungen männlichen Mitglieder, die noch nicht „Chef“ sind, agieren in jenem Bereich und sprechen auf Dopamin stark an. Ähnlich findet man in Extremsportarten unserer Gesellschaft zu einem großen Teil junge Männer, die sich durch das Spiel mit dem Risiko mehr oder weniger bewusst beweisen, bestätigen und sich daran erfreuen. Sich einem Risiko auszusetzen, ermöglicht uns insofern die Rückkehr in unsere evolutionäre Vergangenheit und beschert uns gleichzeitig Lebensfreude.
Klettern im Elbsandstein bedeutet Abenteuer, Risiko und Heldentum. Foto: Jan Mersch

mMathematik: Wahrscheinlichkeitstheorie
Eine andere Bedeutung von Risiko begegnet uns beispielsweise an der Börse. Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker beschreiben das dort anzutreffende Risiko aus dem Blickwinkel der Wahrscheinlichkeitstheorie. Somit ist Risiko die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis mit negativen Auswirkungen während einer festen Zeitperiode eintritt oder aus einer bestimmten Handlung resultiert. Die Entwicklung unserer Fähigkeiten im Umgang mit Risiken wird als entscheidende Komponente der Gesellschaftsentwicklung vom Altertum bis heute beschrieben. Einfach gesprochen, säßen wir noch immer in der steinzeitlichen Höhle, wenn wir nicht unsere Fähigkeit im Umgang mit Risiken verbessert hätten. Der Risikobegriff ist eng mit der Wahrscheinlichkeitstheorie und somit der Entwicklung der Zahlen vor dem jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund verknüpft. Voraussetzung für diese Betrachtungsweise ist aber, dass sich das Risiko an objektiven Variablen wie Eintrittswahrscheinlichkeit – mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt es zur Katastrophe – und Schadenserwartung –welches Ausmaß wird die Katastrophe haben – festmachen lässt. Vor allem im Bereich des Risikomanagements bei Banken, Versicherungen und Industrie haben heute computergestützte Entscheidungssysteme den „fehlerhaften“ Menschen abgelöst, insbesondere wenn die zu berücksichtigende Datenmenge unüberschaubar wird.
In der Psychologie wird der Umgang mit Risiken und Risikosituationen als Entscheidungsproblem aufgefasst. Nicht die Wirkung oder das Ausmaß eines Risikos ist entscheidend, sondern die Herangehensweise, der Umgang damit, das Verhalten vor und in der Risikosituation. So hatte die Entwicklung der Konzepte zur künstlichen Intelligenz seit Ende der 1960er-Jahre die Erschaffung einer fehlerfrei arbeitenden Intelligenz zum Ziel, die nicht von der Tagesverfassung und anderen Unwägbarkeiten in ihrer Leistung und Genauigkeit beeinflusst wird. In der Gegenposition der 1970er-Jahre wurde dann die Fähigkeit des Menschen als denkende und fühlende Intelligenz im Gegensatz zum Computer unterstrichen. In den 1980er-Jahren wurde die Bedeutung von individuellen Vorstellungen und Werten als Grundlage bei Entscheidungen und Risiko zunehmend anerkannt. Unterschiedliche Wahlmöglichkeiten bei verschiedenen Risikosituationen, je nach Zielvorstellungen und Werten des Entscheiders, wurden postuliert. Intuition, sechster Sinn und Erfahrung als wichtige Basis für die Qualität von Entscheidungen und Risikoabschätzung sind zurzeit Forschungsgegenstand. So trifft ein Großmeister im Simultanschach seine Zugentscheidungen quasi „aus dem Bauch“. Er erfasst die Situation, das Bild auf dem Brett in seiner Gesamtheit, vergleicht es unbewusst und ohne große Denkarbeit mit schon gesehenen Bildern und früher erlebten Partien und macht seinen nächsten Zug, ohne lange die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Dopamin: Das Spiel mit dem Risiko erfüllt und erfreut.


Um die beste Linie zu finden, brauchen wir Intuition.
Foto: Jan Mersch

wWidersprüche und Paradoxien im Umgang mit Risiken
y Risiko versus Versicherungsmentalität. Wir haben die Popularität der „Risikosportarten“ (zu denen auch der Bergsport gehört) bereits angesprochen. Es gibt definitiv eine steigende Anzahl von Menschen, die Risikosportarten ausüben und sich für Aktivitäten wie Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, Klettern, Mountainbiken und andere „Adrenalinsportarten“ begeistern. Gleichzeitig gibt es aber auch eine zunehmende Versicherungsmentalität und ein Bestreben, moglichst alle Eigenverantwortung (z. B. durch Nutzung von Technik wie GPS-Navigation, Lawinen-Airbags oder Inanspruchnahme von entsprechenden Dienstleistungen wie z. B. Bergsportanbietern) abzugeben. Das Bewusstsein des eigenverantwortlichen Umgangs mit Risiken nimmt ab. Einerseits ist also das Eingehen von bestimmten Risiken gesellschaftlicher Trend und ein Ausdruck des Bestrebens, das „Freiheitsbedürfnis“ (siehe oben) zu befriedigen. Andererseits können das Mitschwimmen im Risikosportartentrend und die Versicherungsmentalität auch nur eine Scheinbefriedigung sein. Vielleicht sind sie genau das Gegenteil von Freiheit und reduzieren sogar unseren freien Willen und unsere Selbstständigkeit.
y Eingangs- versus Basis- versus Restrisiko. In der Kommunikation über Risiken, zum Beispiel während der Diskussion über eine bestimmte Tour, sind Missverständnisse oft auf die „Widersprüche“ beziehungsweise Unterschiede zwischen Eingangs-, Basis- und Restrisiko zurückzuführen. Das Basisrisiko ist das Risiko aus den unbeeinflussbaren Faktoren einer Tour: Wetter, Lawinenlage oder Gelände. Diese Faktoren können wir nicht beeinflussen und müssen wir akzeptieren. Das Eingangsrisiko kommt zum Basisrisiko dazu und entsteht aus den beeinflussbaren Faktoren: Beispiele sind persönliches Können, Ausrüstung, zeitliche und räumliche Tourenplanung. Je komplexer die Tour, desto höher sind Basis- und Eingangsrisiko (z. B. Weißhorn-Überschreitung versus Hallenklettern). Durch unser Verhalten können wir nun aber das Eingangsrisiko reduzieren. Es verbleibt dann noch das Restrisiko. Dieses ist aber immer höher als das Basisrisiko, das sich nicht reduzieren lässt.
y Glorifizierung versus Schuldsuche. Professionelle Risiko-Protagonisten, Extrembergsteiger und Alpinathleten werden bewundert, gelikt, „ge-followed“ und geklickt. Bei Unfällen bricht aber sofort die Verurteilungswelle auf sie herein – sowohl in der konventionellen Presse als auch in den sozialen Netzwerken. Dabei hat häufig nur das unwahrscheinliche letzte Quäntchen Restrisiko zugeschlagen, wie es das schon immer getan hat.
y Terroranschlag versus Wohnungsbrand. Risikowahrnehmungen können sehr unterschiedlich sein und sind nicht selten ungerechtfertigt, weil sie der tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeit nicht entsprechen. Das Risiko, Opfer eines tödlichen Terroranschlags zu werden, wird beispielsweise laut einer Umfrage um das 30-Fache überschätzt. Das Risiko, von einem Wohnungsbrand überrascht zu werden, wird dagegen um das 350-Fache unterschätzt.
y Wissen versus Verhaltensänderung. Nicht selten wissen wir aber sehr wohl um bestimmte Risiken. Allein unser Verhalten zu ändern, fällt schwer, weil eben Veränderungen immer schwer umzusetzen sind: Wir wissen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, hören aber trotzdem nicht auf. Wir wissen, dass der Hang heute gefährlich ist, fahren ihn aber trotzdem.
y Risikominderungstechnik versus riskanteres Verhalten. Es ist ein bekanntes (und statistisch oft belegtes) Phänomen, dass Technik, die Risiken reduziert, gleichzeitig zu riskanterem Verhalten führen kann: Eltern gestatten ihren Kindern gefährlichere Spiele, wenn sie mit Ellbogen- und Knieschützern ausgestattet sind, Gurt und Airbag führen zu riskanterem (Auto-)Fahrstil, GPS-Geräte führen eher zu Touren bei schlechter Sicht (und ggf. Lawinengefahr, die dann schlechter einschätzbar ist), gesunde Ernährung verleitet dazu, sich gleichzeitig bei anderer Gelegenheit schlechter zu ernähren, und so weiter und so fort. Ein Beispiel aus dem Bergsport können wir als Nebenergebnis unserer langjährigen Lawinenunfallstudie (tödliche Unfälle und die Wirksamkeit der Snowcard, siehe z. B. bergundsteigen #98, „Alles Snowcard, oder was?“) präsentieren: Unsere Daten zeigen, dass die geschätzte Hangsteilheit am Auslösepunkt der Lawine bei tödlich verunfallten Personen, die laut Unfallbericht einen Lawinenairbag dabeihatten, größer war. Sprich, der Airbag führt demnach wohl doch dazu, dass steilere Hänge befahren werden. Der Effekt der Risikoreduzierung durch einen Airbag würde gleichzeitig reduziert oder ganz zunichte gemacht. In der Studie in bergundsteigen #110, „Lawinenairbags & Risikoverhalten“ wurde das nur vermutet.
Gleichzeitig nehmen wir aber auch zur Kenntnis, dass in der Ausgabe #125 im Beitrag „Verleiten Lawinenairbags tatsächlich zu riskanterem Verhalten?“ die Autorengruppe (Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung) nicht zu diesem Ergebnis kam. Und dies ebenso auf der Basis empirischer Daten, die allerdings mit einem ganz anderen Ansatz erhoben und interpretiert wurden. Das Thema „Airbag und Risikoverhalten“ darf also weiter für Diskussionen am Hüttentisch sorgen.
y Risiko versus Verantwortung. Als Leitungspersonen im Bergsport müssen wir uns beim Führen immer mit dem Widerspruch zwischen Risiko und Verantwor tung auseinandersetzen. Einerseits wollen wir unseren anver trauten Gästen etwas bieten (einen Gipfel erreichen) oder unser Team zu einem Ziel führen (z. B. als Leiter eines Bergrettungseinsatzes jemanden retten). Andererseits haben wir Verantwortung und müssen uns mit der Möglichkeit des Scheiterns beziehungsweise mit den Risiken auseinandersetzen.

Risikoparadoxien können uns den Blick vernebeln, irgendwann wird der Blick auch wieder frei.
Foto: Pauli Trenkwalder

Jan Mersch, 52, Psychologe, Bergführer und Alpinsachverst ändiger, lebt mit Familie im C hiemgau, www.menschundberge.com

sEmpfehlungen für den Umgang mit Risikoparadoxien
Im Umgang mit Risiken stehen wir also immer vor bestimmten Widersprüchen und Gegenpolen. Es ist geradezu die Essenz des Risikomanagements, damit ständig umzugehen. Die aufgeführten Widersprüche werden wir nie ganz auflösen können. Und das wiederum (Das ist vielleicht auch ein Paradoxon!) ist auch gut so, denn wir würden sonst die positiven Aspekte von Risiken verlieren: die Chancen, die in ihnen immer (!) liegen, die Möglichkeiten, unsere Selbstentfaltung zu stärken, die Stimulation unserer Suche nach der Entfaltung unserer Persönlichkeit. Ignorieren können wir sie aber auch nicht. Deswegen haben wir nachfolgend einige allgemeine Empfehlungen und Fingerzeige zusammengestellt, um mit den typischen Gegensätzen, Kontrasten, Zwiespalten und Gegensätzlichkeiten im Umgang mit Risiken umzugehen:
1 Objektivierung und Rationalisierung ( Wissen). Unsere Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten ist meist unzureichend. Dies umso mehr, je komplexer die Situation ist. Unsere Erwartungen spielen dabei eine Rolle, aber auch Trends, Moden, Nachrichten und soziale Medien (siehe „Terroranschlag versus Wohnungsbrand“). Helfen kann hier nur eine möglichst rationale Auseinandersetzung mit den „echten“ Risiken, basierend auf möglichst objektiven Fakten und Daten. Bergsport-Beispiele: probabilistische Methoden zur Abschätzung des Lawinenrisikos, tatsächliche Haltekräfte von Schlingen und Schnüren, professioneller Wetterbericht statt nur Bauchgefühl. Ist das immer möglich? Nein, gerade im Bergsport natürlich nicht. Häufig fehlen uns Daten. Aber da, wo wir etwas haben, sollten wir es verwenden. Wissen ist ein essentieller Bestandteil vom guten Umgang mit Risiken (bergundsteigen #66, Es irrt der Mensch, solang er strebt). Oder um es mit Warren Buffet (Großinvestor) auszudrücken: „Risiko entsteht, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun.“
2 Regeln. Gerade im Paradoxon „Risiko versus Verantwortung“ helfen uns Regeln. Zum Beispiel das „Lawinenmantra“ oder Checklisten zum Klettern in der Halle (Partnercheck etc).
3 Sich selber hinterfragen. Die typischen Schuldzuweisungen an andere („Glorifizierung versus Schuldsuche“) geben immer auch Auskunft über diejenigen, die sie äußern. Grund ist unsere angeborene Ignoranz gegenüber unseren eigenen Verhaltensweisen und Widersprüchen. Je mehr wir uns mit unserer eigenen Motivation („Warum gehe ich bergsteigen?“) auseinandersetzen, desto weniger werden wir bei Unfällen die Schuldfrage stellen.
Bergsteigen ist bei allen Risiken die herrlichste Nebensache der Welt.
Foto: Jan Mersch
4 Resilienz und Distanz stärken. Schuldzuweisungen haben oft damit zu tun, dass es schwer auszuhalten sein kann, bestimmten Gefahren, Risiken und Unsicherheiten ausgesetzt zu sein. Helfen kann da die Stärkung der eigenen Resilienz und in der jeweiligen Situation eine gesunde Distanz zum eigenen Tun.
5 Transparenz. Um der Versicherungsmentalität als Tourenführer oder Bergführer etwas entgegenzusetzen, machen wir die Risiken einer geplanten Tour transparent („Eingangs- versus Basis- versus Restrisiko“, „Risiko versus Verantwortung“). Und Transparenz ist in diesem Fall kein Widerspruch zu klarer Führung.
6 Trends hinterfragen. Und schließlich kann es sinnvoll sein, herrschende Trends immer wieder zu hinterfragen – und nicht alles mitzumachen („Wissen versus Verhaltensänderung“). Echte Freiheitssuche verlangt, den eigenen Weg zu suchen und zu gehen. Das kann auch bedeuten, eine bestimmte Tour nicht zu gehen –auch wenn es auf der Hütte andere Gruppen gibt, die die Tour an dem Tag nicht so kritisch sehen. Verzicht ist auch ein „Schaden“, unter Umständen sogar ein sehr persönlicher, der aber in der üblichen Betrachtung des „Schadensausmaßes“ als gewissermaßen objektiver Teilaspekt bei Risikoentscheidungen nicht als solcher gesehen wird. Oder um es noch anders auszudrücken: Es geht darum, die eigene Komfortzone auch einmal zu verlassen und eigenverantwortlich unangenehme, abweichende Wege zu gehen. 7 Schritt-für-Schritt-Lösung. Risiken können uns verunsichern, unter Umständen bis zur Handlungsunfähigkeit und Blockierung aus Angst beziehungsweise Panik. Helfen kann die Konzentration auf das Hier und Jetzt und die Schritt-für-Schritt-Lösung der Situation (statt zu versuchen, die Situation sofort komplett aufzulösen) bzw. die gelassene Akzeptanz der verbleibenden Unsicherheit.
Trotz allem aber: Bergsteigen macht Spaß, und ein gewisses Risiko gehört dazu! Oder um es mit Carl Amery (*1922, †2005; Schriftsteller) zu sagen: „Risiko ist die Bugwelle des Erfolgs.“ ■
ASI Guides aus Deutschland lieben auch Tiroler Gäste. Und die von irgendwo.
Werde Teil unseres weltoffenen Guideteams und übernimm Aufträge als Bergführer:in (bis € 430) oder Wanderführer:in (bis € 215).
Jetzt bewerben:
jobs@asi.at

Martin Perfler, Gewinner des „ Young Snow Professional Award “ 2023, präsentierte beim ISSW 2023 in Bend, USA, den Beitrag: „Assessing avalanche problems for oper ational avalanche forecasting based on different model chains“.


Highlights aus der Schnee- und Lawinenforschung 2023
Warum gräbt jemand bei widrigsten Bedingungen ein Schneeprofil, um es anschließend in ein Computermodell zu stecken? Was verbirgt sich hinter den bunten Flächen einer Lawinengeländekarte? Wieso fährt ein:e Wintersportler:in bei bekannt angespannter Lawinensituation in einen steilen, exponierten und unverspurten Hang ein? Diese Fragen treiben Lawinenforscher:innen, aber auch Praktiker:innen aus aller Welt an. Erkenntnisse werden nicht nur über Fachpublikationen geteilt, sie werden auch auf Tagungen und Konferenzen präsentiert. Vernetzung und Zusammenarbeit stehen im Fokus und die meisten dieser Veranstaltungen sind deutlich weniger trocken und langweilig, als man denkt! Eine kurze Zusammenfassung der Events des vergangenen Jahres und unsere Eindrücke!
Von Martin Perfler, Veronika Hatvan, Michael Binder, Christoph Hesselbach (ÖGSL – Young Snow Professionals)

Abb. 1a Entwicklung der Schichten in der Schneedecke, simuliert mit SNOWPACK, angetrieben mit Daten einer Wetterstation. Die Schichten sind je nach ihrer Kornform unterschiedlich eingefärbt. Markant ist z. B. die Neuschnee-Periode Mitte/Ende Jänner Abb. 1b Mit Post-Processing-Tools können Schneedeckeneigenschaften wie die Stabilität automatisch analysiert und das entsprechende Lawinenproblem abgeleitet werden. Balken zeigen die an diesem Tag relevanten Lawinenprobleme in der Farbe der jeweiligen Schwachschicht in Darstellung a an. Warner:innen steht somit eine zusätzliche „objektive“ Einschätzung der Situation zur Verfügung.


Der International Snow Science Workshop (ISSW) hat seine Ursprünge in den 1960er-Jahren. Damals trafen sich 30 SchneeExperten in New Mexico, um sich über Methoden zum Lawinenschutz auszutauschen. Mittlerweile ist der ISSW die weltweit größte Konferenz zum Thema Schnee und Lawinen – über 1000 begeisterte Schnee-Forscher:innen und -Praktiker:innen treffen sich, um die neuesten Erkenntnisse der Schnee- und Lawinenforschung zu präsentieren und zu diskutieren. Im Zwei-Jahres-Rhythmus rotiert das Event zwischen Kanada, den USA und Europa; in Präsenz hat der ISSW nach 2018 in Innsbruck eine längere Covid-Pause einlegen müssen und meldete sich nach einer Online-Version 2021 erst im vergangenen Herbst 2023 aus Bend, Oregon, zurück.
Was macht den ISSW aus?
Unter dem Motto „A Merging of Theory and Practice“ verschwimmt die Grenze zwischen Forscher:innen und Praktiker:innen. Auch wenn viele Wissenschaftler:innen sich ebenfalls gern ins Pulverschneevergnügen begeben, sind Denkanstöße und Ideen von Vollblutpraktiker:innen oft genauso bahnbrechend wie Erkenntnisse aus renommierten Forschungsinstituten. Es wird diskutiert, gestritten, beim abendlichen Beisammensein wieder versöhnt – stets konstruktiv. Und am Ende haben alle etwas dazuge- lernt, immer die klare gemeinsame Vision vor Augen, die Schnee- und LawinenCommunity weiterzubringen.
Mit dem Young Snow Professional Award (YSP Award) hilft die Österreichische Gesellschaft für Schnee und Lawinen (ÖGSL) jungen Forschenden dabei, ihre Arbeit ins Rampenlicht zu rücken.
Wissenschaftler:innen unter 30 Jahren reichen Beiträge ein, aus denen die besten ausgewählt werden. Die Siegerinnen und Sieger fahren mit finanzieller Unterstützung der ÖGSL zu nationalen und internationalen Tagungen, wo sie ihre Forschung präsentieren.
Im vergangenen Jahr waren das der International Snow Science Workshop (ISSW) in den USA, das Lawinensymposium in Graz, die Fachtagung Katastrophenforschung, sowie das Alpinforum in Innsbruck.
Die Preisträger:innen berichten in bergundsteigen, dem ÖGSL-Partnermagazin, über ihre Eindrücke von den Konferenzen und Tagungen und fassen zusammen, was die Fachwelt bewegt.
Was bewegt die „Schneeolog:innen“ zurzeit?
Das fünftägige Event prägte ein buntes Potpourri an Themen.
Neben der Grundlagenforschung zu Lawinendynamik und Schnee(decken)eigenschaften gewinnen zuletzt unter anderem menschliche Aspekte an Gewicht: Wie trifft ein:e Lawinenwarner:in in kritischen Situationen eine objektive Einschätzung? Was treibt Schneesportler:innen dazu, sich in kritisches Gelände zu begeben? Welche Faktoren spielen bei der Gruppendynamik eine Rolle? Auch der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Schnee- und Lawinenforschung: Bedeuten höhere Temperaturen weniger Schnee und somit geringere Lawinengefahr? Klimamodelle und Analysen geben uns einen Vorgeschmack.
Und natürlich die künstliche Intelligenz. Denn auch diese hält zunehmend Einzug in die Schnee- und Lawinenforschung. Zahlreiche Tools für Expert:innen und Anwender:innen entstehen daraus. Einer der wohl markantesten Paradigmenwechsel findet derzeit beim operativen Einsatz von Schneedeckenmodellen statt, wo auch österreichische Akteure bereits bedeutende Beiträge leisten konnten (https://www.oegsl.at/workshops/). Eine übersichtliche Zusammenfassung der Talks liefern die illustrierten Poster auf https://www.issw2023.com/illustrated-session-summaries.
Mit Schneedeckenmodellen wie dem am SLF entwickelten SNOWPACK (siehe Abb. 1a, 1b) werden basierend auf meteorologischen Inputdaten (Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind, Schneehöhe und Sonneneinstrahlung) die Schichten und deren Mikro-

Die Österreichische Gesellschaft für Schnee und Lawinen widmet sich dem interdiszip linären Wissensaustausch sowie der Förderung von Lehre, Entwicklung, Ausbildung und A nwendung auf dem Gebiet d er angewandten Schneeund Lawinenforschung.

Veronika Hatvan, „ Young Snow Professional Award “ -Gewinnerin 2019, präsentierte beim ISSW 2023 in Bend, US A, ihren Beitrag: „A model-chain approach to assess and predict loc al avalanche risk“. Sie arbeitet inzwischen beim Lawinenwarndien st Steiermark.
Publikationen zu sämtlichen Konferenzbeiträgen sind in den ISSW-Proceedings auf https://arc.lib.montana.edu/ snow-science/ zu finden.
Abb. 2 Das operative Dashboard des kanadischen Warndienstes Avalanche Canada. Aus mehr als 25.000 simulierten Schneeprofilen werden Cluster mit ähnlichem Schneedeckenaufbau generiert. Grafik: Simon Horton, Avalanche Canada

struktur in der Schneedecke simuliert. Nach ersten Entwicklungsschritten in den 1990er-Jahren sind diese Modelle heute für die Forschung unverzichtbar geworden. Die Anwendung im operativen Bereich ist bisher allerdings noch recht überschaubar. Lawinenwarner:innen bevorzugen oft bewährte Vorhersagestrategien, die auf traditionellen Informationsquellen wie Rückmeldungen von Beobachter:innen, Schneeprofilen aus dem Gelände, Wetterstationen und der Wettervorhersage basieren. Neben technischer Infrastruktur, um die Simulationen in die operative Lawinenwarnung zu integrieren, fehlt oft auch die nötige Erfahrung bei der Interpretation der Simulationsergebnisse, welche nicht immer intuitiv ist.
Eine breite Front an lokalen Initiativen hat sich genau dieser Herausforderungen angenommen und stellt Modellergebnisse flächendeckend zur Verfügung, gestaltet intuitive Visualisierungen und generiert Interpretationshilfen für die operative Warnerwelt. Genau wie die Lawine kennt auch diese Bewegung keine Grenzen und wurde durch den Austausch an der Konferenz befeuert.
Der Kanadische Lawinenwarndienst und die Simon Fraser Universität in Vancouver arbeiten an einer Modellkette aus SNOWPACK und Wettermodellen, mit der es möglich ist, ein Schneedeckenmodell auf einem Gitternetz von 2,5 km über alle Warnregionen von Kanada zu simulieren. Um die Fülle an Ergebnissen (mehr als 25.000 simulierte Schneeprofile) für Lawinenwarner:innen nutzbar zu machen, wurden Werkzeuge entwickelt, die automatisiert Tausende Profile anhand ähnlicher Schneedeckeneigenschaften gruppieren und „repräsentative Durchschnittsprofile“ erstellen, welche einen Einblick in den Schneedeckenaufbau in den diversen Regionen erlauben (siehe Abb. 2).

Abb. 3 Beispiel einer Modellkette zur Simulation von Schneeprofilen samt entsprechenden Schnittstellen (LWD Tirol). Die Daten von Schneeprofilen aus dem Gelände, Wetterstationen und Wettermodellen fließen in das Schneedeckenmodell SNOWPACK. Die simulierten Schneeprofile können genutzt werden, um z. B. Informationen zur Entwicklung der Schneedeckenstabilität oder zu Lawinenproblemen zu gewinnen. Grafik: Michael Binder, Lawinenwarndienst Tirol
Entwicklung der Schneedecke

Schneedeckenmodel z. B. SNOWPACK
Parametrisierung der Dichte Monti et al., 2014
Schneeprofil
Wettermodel
Postprocessing
Stabilitätsindizes, Visualisieung
Downscaling und Stacking


AVAPRO



Um Modelle stärker mit herkömmlichen Informationsquellen zu verknüpfen, realisierte das Team des Lawinenwarndienstes Tirol eine lang gehegte Vision: SNOWPACK mit beobachteten Schneeprofilen aus dem Gelände zu initialisieren und in weiterer Folge mit Prognosen aus Wettermodellen anzutreiben. Die Verknüpfung mit einem Algorithmus zur Ableitung der Lawinenprobleme (Neuschnee, Triebschnee, Altschnee, Nassschnee) liefert den Warner:innen einen Vorschlag zur vorherrschenden Situation, ähnlich dem „Sonne & Wolken“-Symbol einer Wetterapp (siehe Abb. 3). Aufgenommene Schneeprofile können somit genutzt werden, um die zukünftige Schneedeckenentwicklung im Gelände zu simulieren und die Warndienste bei der Beurteilung der Lawinengefahr zu unterstützen. Die gesamte Modellkette wird als Open-Source-Projekt unter dem Projektnamen AWSOME (Avalanche Warning Service Operational Meteo Environment; www.gitlab.com/avalanche-warning) entwickelt mit dem Ziel, auch anderen Lawinenwarndiensten einen einfachen Zugang zur Schneedeckenmodellierung zu ermöglichen. Parallel dazu wird auch an Werkzeugen gearbeitet, um die Modellergebnisse weiteren Expert:innengruppen der Community zugänglich zu machen und in bestehende Abläufe zur lokalen Risikobeurteilung zu integrieren (z. B. Lawinenkommissionen). Vor diesem Hintergrund entwickelt die GeoSphere Austria ein Tool, welches die Schneedecke direkt in potenziellen Lawinenanbruchgebieten simuliert, auf Basis von Erfahrungswerten das lokale Lawinenrisiko bewertet und eine Vorhersage für die nächsten 24 h zur Verfügung stellt.
Dies ist ein kurzer Überblick über einige Highlights der Konferenz. Wir können gespannt auf weitere Entwicklungen in der nächsten Zeit – und insbesondere bereits beim nächsten europäischen ISSW 2024 in Tromsö – blicken.
Der ISSW in Oregon war international mit Sicherheit das größte Event für Schnee- und Lawinenforscher:innen im Jahr 2023. Auf nationaler Ebene hatte Österreich aber auch so einiges zu bieten.
Die fünfte Auflage des alle zwei Jahre stattfindenden Lawinensymposiums in Graz war mit über 600 Teilnehmer:innen und 45 Vortragenden wieder ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Gemeinsam für Sicherheit in den Bergen – Erfolgreicher Wissenstransfer und Zukunftsimpulse“ diskutierte man über neue technologische Innovationen, wie zum Beispiel die elektronischen Airbag-Systeme, aber auch über präventive Maßnahmen und aktuelle Fortschritte in der Wissenschaft. Kombiniert mit Erfahrungsberichten aus der Praxis war es ein abwechslungsreiches Programm, mit dem das Organisationsteam sein Ziel, Schnee-Expert:innen und Skitourengeher:innen zusammenzubringen, voll und ganz erreichte. Highlights waren sicher die Visualisierung von Lawinengefahrenkarten mit leistungsstarken Computern oder zu erfahren, wie automotive Sensorik für die Schneedecke und Lawinendetektion genutzt werden kann.
Während das Event die Vernetzung der Schnee-Community in den letzten Jahren besonders auf nationaler Ebene vorangetrieben hat, sollen in Zukunft auch vermehrt internationale Gäste an der Programmgestaltung mitwirken. Mark Diggins gab den Teilnehmer:innen in einem grandiosen Vortrag schon dieses Jahr eindrückliche Einblicke in die Arbeit des schottischen Lawinenwarndienstes.
Christoph Hesselbach, „ Young Snow Professional Award “ -Gewinner 2023, präsentierte bei der Fach tagung K atastrophenforschung und beim Alpinforum den Beitr ag: „Lawinengelände, eh klar? Eine Pilotstudie zur autom atisierten Lawinengel ändeklassifikation im Sellrain“.

2023, präsentierte beim Lawinensymposium in Graz den Beitrag: „Schneed eckenmodellierung: Ein Blick in die Zukunft von Schneeprofilen“.

Man darf also gespannt sein, was die Organisator:innen der GeoSphere Austria und der Naturfreunde Österreich in den kommenden Jahren für uns auf die Beine stellen. Alle, die es nicht nach Graz zum Lawinensymposium geschafft haben, finden detaillierte Beiträge zu allen Vorträgen frei verfügbar im aktuellen Tagungsband unter https://lawinensymposium.naturfreunde.at/.
fFachtagung Katastrophenforschung in Leoben
Während der ISSW und das Lawinensymposium ihren Fokus klar auf Schnee- und Lawinenthemen legten, stand die Fachtagung Katastrophenforschung in Leoben im Zeichen der Verknüpfung von Bildung, Praxis, Technik und Forschung als Instrumente zur Katastrophenprävention und Bewältigung von diversen Naturgefahren, z. B. von Lawinen. Veranstalter der Tagung war die Kooperationsplattform Disaster Competence Network Austria (DCNA). Die Fachbeiträge zur thematisch breit gefächerten Tagung können im Tagungsband unter https://www.dcna.at nachgelesen werden. Es wurden unter anderem zwei lawinenrelevante Themen behandelt: automatisierte Lawinengeländeklassifikation sowie sozialpsychologische Einflussfaktoren und technische Hilfestellungen bei Skitourenunfällen. Begleitet wurden die Fachbeiträge von zwei Podiumsdiskussionen, bei denen die Herausforderungen im Katastrophenmanagement thematisiert wurden. Weiteres Highlight der Fachtagung war die Premiere eines mobilen Forschungslabors, welches künftig in Katastrophen- und Risikogebieten zum Einsatz kommen soll.
Beim diesjährigen Alpinforum, organisiert vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit, stand „Eigenverantwortung“ als Leitthema im Fokus. Durch fundierte Vorträge, Interviews und Podiumsdiskussionen wurden nicht nur für Profis und Multiplikator:innen der Alpinszene, sondern auch für ambitionierte Bergsportler:innen und die interessierte Öffentlichkeit neue Erkenntnisse präsentiert, diskutiert sowie Erfahrungen ausgetauscht. Teil des Programms war auch der Launch des Snow Institutes (https://www. snow.institute/), welches aus dem Arge-Alp-Projekt SnowKids hervorgegangen ist. Gemeinsam mit unzähligen Jugendinitiativen vermittelt es präventives Verhalten im Umgang mit Schnee, Eis und Lawinengefahren. Die Vision dabei ist klar: Die Zahl jugendlicher Lawinenopfer im Alpenraum soll möglichst auf null reduziert werden. Weitere Informationen zum Alpinforum sind auf https:// alpinesicherheit.at/ zu finden.
Auch die nationalen Veranstaltungen waren also ein voller Erfolg und wir freuen uns schon auf die nächsten Ausgaben in den kommenden Jahren!
Danke an die Veranstaltungsleiter:innen des ISSW, des DCNA, des Lawinensymposiums, des Alpinforums, der ÖGSL und deren Mitgliedern für ihre Unterstützung. Wie du YSP wirst, erfährst du auf www.oegsl.at. ■


y Gipfelbesteigungen insgesamt: 11997
y Tote insgesamt: 332 (davon Kunden: 202, Sherpas: 130)
y Dauer der Standard-Expedition: 6–9 Wochen
y Dauer einer Flash-Expedition: 3 Wochen
y 6664 unterschiedliche Menschen waren bereits am Gipfel, etliche von ihnen mehrfach.
Mount Everest in Zahlen
Es war das tödlichste Jahr aller Zeiten am Everest. Ein Blick in Statistiken zeigt: Nach einhundert Jahren Bergsteigergeschichte am höchsten Berg der Welt häufen sich die Unfälle. Doch langfristig sinkt das Risiko. Und vielleicht bald auch das Interesse.
Von Hilmar Schmundt
Die Everest-Saison 2023 begann mit einem Donnerschlag, noch bevor die meisten zahlenden Gäste aus aller Welt überhaupt im Basecamp angekommen waren: Am 12. April um vier Uhr nachts krachte am oberen Teil des gefürchteten Khumbugletschers ein Sérac zu Tal und begrub drei Sherpas unter Tonnen von Eis. Sie waren 45, 31 und 24 Jahre alt. Die drei waren dabei, Fixseile und andere Ausrüstungsgegenstände durch den Eisfall zu tragen. Ihre Körper konnten bislang nicht geborgen werden. Das Unglück war der Auftakt zu einer desaströsen Saison. Insgesamt starben 2023 am Everest (8850 m) 18 Menschen. Das ist die höchste Zahl in der 100-jährigen Alpinismusgeschichte des Berges. Im Schnitt kostet er 4,5 Menschenleben pro Jahr. Die hohen Todeszahlen traten 2023 auf, obwohl nur die nepalesische Südostroute geöffnet war. China hielt die tibetische Nordostroute immer noch im Zuge der Pandemiebekämpfung geschlossen, mit wenigen Ausnahmen: Eine sechzehnköpfige Seilschaft durfte vom Norden aus zum Gipfel, zur Wartung einer Wetterstation. Von tibetischer Seite waren die letzten Ausländer 2019 zum Gipfel aufgestiegen. Für 2024 wird diese Route wieder geöffnet. Wie kam es zur tödlichsten Everest-Saison aller Zeiten, gerechnet in absoluten Zahlen? Ganz ein-
Gipfelfieber: Neuseeland eifert Hillary nach Gipfelfieberindex: (Gipfel pro Mio. Einwohner:innen); ausgewählte Nationen.
Dachmarke: Die größten Märkte für das Dach der Welt
Gipfelzahl Kunden nach Nation, dazu Frauenanteil in Prozent.
Gipfel (m)
Gipfel (w)
Gipfelerfolge nach Ländern seit 1954.
Gipfelerfolg (männliche Kunden)
Gipfelerfolg (weibliche Kunden)
fach: Das Dach der Welt ist beliebter denn je, fast 480 Besteigungspermits stellte das nepalesische Tourismusministerium aus, ein neuer Rekord. Der Preis pro Kopf liegt für Ausländer bei 11 000 USDollar. Eine Menge Geld in einem der ärmsten Länder der Welt. Der Permit-Preis könnte ab 2025 um 35 Prozent auf 15 000 Dollar angehoben werden. Unterstützt wurden die Kunden durch rund 700 Sherpas – statistisch kamen auf 10 Kunden also 15 Sherpas, auch das rekordverdächtig. Doch das Gipfelgedränge selbst scheint nicht der Haupttreiber der Todeszahlen zu sein. Im Gegensatz zum Jahr 2019 bildeten sich diesmal keine langen Warteschlangen am Hillary Step, einem 12 Meter hohen Felsriegel kurz vor dem Gipfel, der viele Gäste trotz der Fixseile überfordert. Eine andere Hypothese: Der Klimawandel sei schuld, sagte der Direktor der nepalesischen Tourismusbehörde der Nachrichtenagentur „Bloomberg News“. Doch auch diese Begründung erscheint nicht stichhaltig. Langfristig wurde am Gipfel zwar seit 1979 eine leichte Erwärmung um 1,5 Grad auf -6 Grad Celsius im Jahresmittel gemessen, begleitet von einer leichten Zunahme der Niederschläge, doch 2023 zeigte keine auffälligen Wetteranomalien.
„Der Grund für das Chaos lag bei den vielen unerfahrenen Kunden, begleitet von schlecht qualifizierten Bergführern, organisiert von Billiganbietern“, kommentiert dagegen Alan Arnette, ein US-amerikanischer Berg-Chronist, der das Höhenbergsteigerbusiness genau beobachtet. 2011 bestieg er als zahlender Kunde den Everest, drei Jahre später auch den K2, damals der amerikanische Altersrekord mit 58 Jahren. Seitdem wertet er regelmäßig die „Himalayan Database“ aus, ein Archiv, das einen Überblick der Besteigungsversuche seit 1921 umfasst, betrieben von Freiwilligen (www.himalayandatabase.com/). Die Online-Datenbank bietet mehr als nur trockene Zahlen. Sie erlaubt einen Blick hinter die Gipfelkulisse, wie eine Art numerisches Risikoradar. Nicht nur Seile und Steigeisen, sondern auch Statistiken können als Sicherheitsausrüstung dienen. Die Datenbank zeigt: Seit Beginn des kommerziellen Everest-Tourismus Mitte der 1990er-Jahre verbesserte sich das zahlenmäßige Betreuungsverhältnis von Sherpas zu Kunden. Bald könnten auf jeden Kunden statistisch sogar zwei Sherpas kommen, sagt Arnette. Das erhöht die Sicherheit.
Doch diese Sicherheit ist ungleich verteilt, denn der Markt ist polarisiert, die Angebote driften auseinander. Da sind einerseits die hochpreisigen Angebote von über 70 000 oder sogar 120 000 USDollar auf der einen Seite. Es gibt sogar „VVIP“-Luxusangebote, welche Fernsehgeräte im Basecamp bieten, sowie Helikopterausflüge in ein 5-Sterne-Hotel in Kathmandu als Urlaub vom Bergurlaub. Auf der anderen Seite wird der Everest verramscht, mittlerweile dominieren Billigangebote mit Preisen unter 50 000 Dollar den Markt, teils sogar unter 30 000. Einige Billiganbieter sparen unter anderem beim Sauerstoff, immer wieder werden am Südsattel Zelte geplündert und Flaschen geklaut. Und mehrfach „verloren“ Bergführer 2023 am schmalen Gipfelgrat ihre Kunden – monatelang galten einige als verschollen, bevor ihr Tod bestätigt wurde. Das Everestbusiness erlebt eine Kontinentalverschiebung: Nepalesische Expeditionsanbieter dominieren mittlerweile das Angebot, die USA wurden von China als größter Nachfragemarkt verdrängt und mehr Inder als Briten erreichen den Gipfel. Die meisten Kunden-Gipfelsiege pro Einwohner hat das winzige Neuseeland, gefolgt von Nepal und UK (siehe Infografik „Gipfelfieberindex“).
Klimawandel am Gipfel: wärmer und mehr Niederschlag. Das erklärt aber die Katastrophensaison 2023 nicht.

Dieses Diagramm zeigt eine Schätzung der mittleren Jahrestemperatur für die größere Region des Everest-Nordgipfels als Temperaturtrend von 1979–2022. Im unteren Teil sind die entsprechenden Erwärmungsstreifen dargestellt. Grafik: meteoblue.com
Immer älter.
Kunden älter als 40 Jahre (mit Gipfelerfolg)
Kunden älter als 50 Jahre (mit Gipfelerfolg)
Frauenanteil: Nepal, China und Indien führen Frauenanteil auf Gipfel (nur Gäste, nur Nationen mit über 100 Gipfelbesteigungen).
Ansturm der Älteren – je oller, desto doller die relative Gefahr.
Frauenanteil nach Dekade (Anteil an Kundenerfolgen 1980–2023).
Die Preise sinken, das Alter steigt und mit ihm das Risiko: Jeder dritte Kunde ist mittlerweile über 40 Jahre alt, jeder zehnte über 50, jeder hundertste über 60. Aus dem älteren Kundensegment starben 2023 auffällig viele, darunter der Kanadier Pieter Swart (63) auf dem Abstieg, der Malaysier Ag Yaacub (56) am Südsattel, der Chinese Xuebin Chen (52) am Südgipfel, außerdem der Amerikaner Jonathan Sugarman (69) im Hochlager 2 und die Inderin Suzanne Jesus (59) im Basecamp (siehe Infografik „ Ansturm der Älteren“).
Immer mehr Frauen erreichen den Gipfel, seit die japanische Klavierlehrerin Junko Tabei 1975 als erste Frau auf dem Gipfel stand. Ihr Anteil lag in den 2010er-Jahren bei 17 Prozent der erfolgreichen Kunden, seitdem bei über 20 Prozent (siehe Infografik „Frauenanteil nach Dekade“). Besonders hoch ist unter den großen Everestnationen der Frauenanteil in Nepal (26 %), China (20 %) und Indien (19 %). Auffällig ist dabei, dass die Todesrate für Frauen nur etwa halb so hoch ist wie für Männer. Das liegt wohl einfach daran, dass sie vor allem in den letzten Jahrzehnten stark aufholen, wo alles sicherer ist.
Nicht nur die Preise klaffen weit auseinander, auch die Todesursachen: Bei den Kunden nennt die Datenbank besonders oft Sturz, Höhenkrankheit und Ermüdung. Bei den Sherpas dagegen sind Lawinen, Sturz und Eisbruch die größten Killer.
Das vielleicht größte Risiko jedoch gehen Puristen ein, die am Gipfel auf künstlichen Sauerstoff verzichten, eine Leistung, die viele für unmöglich hielten, bis sie 1978 Reinhold Messner und Peter Habeler gelang. Seit 1990 wagten dies nur 141 Kunden, das Sterberisiko erhöht sich dadurch rund um das Zehnfache. Genügend Flaschensauerstoff und gute Bergführer seien entscheidend für den Erfolg, sagt Lukas Furtenbach. „Insgesamt wurden 2023 rund 3000 Sauerstoffflaschen am Everest verbraucht.“
„Bei 13 Kunden war es 2023 grob gesagt so, dass sie allein gelassen wurden am Berg oder ihnen der Sauerstoff ausgegangen ist“, sagt Furtenbach: „Das ist ein Skandal.“ Seine Firma bietet ein hochpreisiges Angebot, für knapp 100 000 Euro bekommen die Kunden des
Everestrisiko: Kunden sterben an Höhenkrankheit und Erschöpfung, Sherpas an Lawinen und Eisschlag.
Tiroler Expeditionsanbieters so viel Sauerstoff, wie sie wollen. Gut möglich, dass sich in der Datenbank hinter Todesursachen wie „Erschöpfung“ oder „Sturz“ oft eigentlich Sauerstoffmangel verbirgt. Furtenbachs Eindruck der Billigkonkurrenz vor Ort: „Die gehen teils mit 20 oder mehr Gästen los, nicht jeder Gast hat einen Sherpa, nicht jeder Gast hat ein Funkgerät und niemand hat einen Überblick. So merken die dann teils erst beim Abstieg, dass ein Gast fehlt.“
In den ersten 60 Jahren Bergsteigergeschichte am Everest sei der Fortschritt schleppend gewesen, sagt er: „Bis in die 1980er veränderte sich gar nicht so viel, vor allem wurde die Ausrüstung leichter.« Dann begann in den 1990ern die Kommerzialisierung, die Zahlen explodierten, das Risiko sank dramatisch (siehe Statistik „Tote pro Gipfel“). Schließlich setzte vor etwa zehn Jahren eine „Turbo-Kommerzialisierung“ ein, so Furtenbach, mit Satellitentelefon, Internet, ultrapräzisen Wetterberichten, einem brutalen Preiskampf. Furtenbachs Fazit: „Dass trotz dieser Verbesserungen so viele Menschen am Everest umkommen, liegt nicht am Berg, sondern an Verantwortungslosigkeit und Gier. Die meisten Todesfälle wären vermeidbar.“ Dennoch: Trotz Massenandrang fällt das Risiko seit dem Jahr 2000 weiter, die Toten pro Gipfelbesteigung machen „nur“ noch rund 1,5 % aus.
Viele Verbesserungen findet er denkbar. Auf der chinesischen Nordseite zum Beispiel sind an Steilstücken Leitern installiert – derlei könnte auch die Staus am Hillary Step lindern. Eine weitere Stellschraube: „Wer sich die Statistiken anschaut, erkennt, dass der Khumbu-Eisfall ein extrem großes Risiko darstellt, vor allem für die Träger, die ihn teils 20 Mal oder öfter durchqueren“, so Furtenbach. Der Purismus, den Khumbu zu Fuß zu durchqueren, wird auf den blutigen Schultern der Sherpas ausgetragen, rund 12 Prozent ihrer tödlichen Unfälle gehen auf derlei Risiken zurück, für Gäste sind es nur 1,5 Prozent (siehe Infografik „Gestorbene Sherpas, Prozent“).
Schon heute knattern mehrere Helikopter pro Tag ins Hochlager 2, um dort Leute abzuholen, die entweder verletzt sind oder den gefährlichen Weg durch den Eisbruch vermeiden wollen. In der Daten-
Gestorbene Sherpas (“Hired”) 1921–2023, Todesursachen.
2,3% andere Uraschen:
0,8% Unterkühlung/Erfrierung:

Tote pro Gipfelbesteigung, Everest.
Frauen leben länger.
Tote pro Gipfelerfolg ab 1975.
bank bekommen sie den Eintrag: „Aviation Assisted“. Furtenbach fordert: Seile, Sauerstoff und Material sollten mit elektrischen Transportdrohnen bis zum Hochlager 2 geflogen werden, „das würde viele Menschenleben retten“. Wird der Andrang am Everest weiter zunehmen? „Rein technisch wäre das gut möglich“, sagt Furtenbach: „In den Alpen klappt das doch auch. Am Mont Blanc haben wir über 30 000 Besteigungen pro Jahr, am Matterhorn immerhin 3000.“ Sein Fazit: „Der Everest verträgt locker 1000 oder sogar 10 000 Bergsteiger pro Saison. Aber das müsste Nepal viel besser organisieren.“
Überraschende Einsicht aus der Datenschau: Der Everest wird immer sicherer. Der traurige Rekord von 18 Toten taugt zwar für Schlagzeilen, aber nicht für eine sinnvolle Risikobewertung. Denn dafür sind die Fallzahlen zu klein, das Zufallsrauschen von Jahr zu Jahr zu groß, warnt Arnette. Wer zum Beispiel nur das fatale Jahr 1996 mit seinen 15 Toten auswertet, berühmt geworden durch den Bestseller „In eisige Höhen“, käme auf eine Todesrate von über 15 Prozent. Auch das Lawinenjahr 2014 war überschattet von 16 Toten, was eine Todesrate von fast 12 Prozent ergeben würde. Das wäre irreführend. Denn die Sicherheit nimmt zu, im Dekadenmittel lag in den 1980ern die Zahl der Toten pro Gipfelbesteigung bei über 30 Prozent, sank in den 1990ern auf 7 % und liegt heute bei rund 1,5 % (siehe Infografik „Tote pro Gipfelbesteigung“).
Anders ausgedrückt: Eine Everestbesteigung bedeutet heute nur noch ein Risiko von etwa 15 000 Micromorts. Dieser „Winzige Tod“ ist eine Maßeinheit, die von Statistikern und Versicherungen verwendet wird. Nach dieser Definition bringt jeder einzelne Tag ein Sterberisiko von einem Millionstel mit sich (wenn man eine Million Micromorts angesammelt hat, läge das Sterberisiko bei 100 Prozent). Klarer wird das durch konkrete Vergleiche: Eine Motorradfahrt von 10 Kilometern schlägt mit einem Micromort zu Buche, eine Geburt mit Kaiserschnitt mit 170, ein Basejump mit über 400. Anders gesagt: Ähnlich tödlich wie eine Everest-Besteigung war eine CovidInfektion für Menschen im Rentenalter, bevor es Impfungen gab.
Tote pro Gipfel, Annapurna versus Everest.
Derlei Zahlenspielereien mögen weltfremd oder zynisch wirken, helfen aber beim Denken. Manchmal hört man zum Beispiel einen coolen Spruch wie „Das Gefährlichste am Everest war die Autofahrt zum Flughafen.“ Das ist Unsinn. Eine Autofahrt über 200 Kilometer schlägt mit etwa einem Micromort zu Buche. Um also im Auto das Everestrisiko zu übertreffen, müsste man über 75 Mal um die Erde tuckern (und würde womöglich vorher an Altersschwäche sterben).
Zwischenfazit: Die Qualität von Ausrüstung, Wettervorhersagen und Betreuungsverhältnis steigt, das Risiko sinkt. Aber eben nur, wenn man nicht am falschen Ende spart. Mittlerweile schwappe der Riesenansturm vom Everest auch auf alle 14 Achttausender über, sogar auf Annapurna und K2, analysiert Billi Bierling. Die Bergsteigerin und Journalistin stand 2009 auf dem Gipfel des Everest und arbeitet seit zwanzig Jahren ehrenamtlich an der Himalayan Database mit. Sechzig Jahre lang war es Brauch, dass Bergsteiger:innen ihre Achttausender durch ein Gespräch mit den Datenbankern erläutern mussten. Das ist seit dem Sommer vorbei, es machte zu viel Arbeit. Bierlings Team verlässt sich zunehmend auf Informationen vom nepalesischen Tourismusministerium. Viele Details stammen auch einfach von Social Media-Accounts.
Dankt ihre Datenbank damit ab? Im Gegenteil, so Bierling, endlich habe sie wieder den Kopf frei für das Wesentliche: „Die wirklich aufsehenerregenden Besteigungen fanden 2023 nicht an den überlaufenen 14 Achttausendern statt, sondern an niedrigeren Bergen.“ Sie nennt den Jannu (7710 m) den Cho Polu (6700 m) oder den Jugal Spire (6563 m). „Eigenartigerweise bekommen die zahlenden Kunden in ihrer Heimat immer noch eine Menge Anerkennung für ihre Everest-Besteigungen“, wundert sich Bierling. Doch möglicherweise sei Peak Everest bald erreicht: „Ich habe das Gefühl, das geht vielleicht noch ein paar Jahre, dann verlieren die Leute das Interesse. Wer Bewunderung und Anerkennung will, fliegt dann vielleicht zum Mond.“
Fotos: Furtenbach Adventures ■

Sollen wir uns auf das Lawinenbulletin und dort insbesondere auf die Gefahrenstufe verlassen, im vollen Wissen, dass diese manchmal falsch ist? Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung des Österreichischen Alpenvereins, meinte dazu lakonisch, dass es immer noch besser sei, „blind aufs Lawinenbulletin zu vertrauen, als blind auf gar nichts zu vertrauen“. Letztendlich hat er recht, denn Berechnungen aus Unfall- und Begehungszahlen zeigen, dass das auf Skitouren eingegangene Lawinenrisiko sich von Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe vervierfacht (Winkler et al., 2022). Wir sind also gut beraten, unser Verhalten stark an die Gefahrenstufe anzupassen. Aber darum geht es hier nur am Rande. In diesem Artikel zeigen wir, wie Geübte aus Beobachtungen im Gelände selbst eine Gefahrenstufe herleiten oder eine unzutreffende Gefahrenstufe korrigieren können.
Von Kurt Winkler, Lukas Dürr und Reto Schild
Der Nivocheck ist hilfreich in Gebieten ohne Lawinenlagebericht.
Anfänger werden sich mit oder ohne dieses Tool schwertun, die Situation vor Ort selbständig einzuschätzen. Deshalb empfehlen wir ihnen weiterhin, den Bewegungsspielraum z. B. der Reduktionsmethode nicht voll auszureizen, sondern im „grünen“ Bereich zu bleiben. Auf dass ein Fehler in der Lawinenprognose möglichst keine gravierenden Folgen habe. Fortgeschrittenen dagegen wird standardmäßig geraten, nach erfolgter Tourenplanung (1. Filter in Munters 3x3) die Verhältnisse vor Ort eigenständig zu beurteilen und die Prognose nach Bedarf zu korrigieren (2. Filter). Als 3. Filter kommt dann noch die Einzelhangbeurteilung dazu, bei der wir uns über die Besonderheiten des vor uns liegenden Hanges Gedanken machen.
Damit der 2. Filter, also die Überprüfung der lokalen Verhältnisse, nicht zum Voodoo verkommt, hat der Schweizer Bergführerverband (SBV) mit Unterstützung von Lawinenwarnern des SLF den Nivocheck 2 entwickelt. Damit können Fortgeschrittene und insbesondere Bergführer anhand eigener Beobachtungen die lokale Gefahrenstufe selbst einschätzen. Der Nivocheck wird in der Schweizer Bergführerausbildung unterrichtet und ist Bestandteil sowohl des Lawinen-Handbuchs des SBV als auch des Schweizer Standardlehrbuchs „Bergsport Winter“. In diesem Artikel stellen wir ihn über die Landesgrenzen hinaus vor.
Heute dient der Nivocheck vor allem der Kontrolle und gegebenenfalls Korrektur der zur Planung verwendeten Gefahrenstufe aus dem Lawinenlagebericht. Seinen Namen hat er aus dem Lateinischen
(nix, nivis = Schnee) und er blickt auf eine lange, teils emotionale Geschichte zurück. Wer hat ihn erfunden? Vielleicht tatsächlich die Schweizer, genauer gesagt Ruedi Schütz und Res Fuhrer mit ihrer „Alpine Travel Checkliste“. Sie waren beim Heliskiing im Kaukasus, wo es schlicht und einfach keinen Lawinenlagebericht gab. Also haben sie ein Tool entwickelt, mit dem sie die Gefahrenstufe selbst bestimmten. Den Namen gab erst später Werner Munter in seiner 2009 im bergundsteigen vorgestellten Version. Schwachpunkt dieser ursprünglichen Checks war, dass sie stark zur Mitte tendierten. Meistens waren einige Faktoren positiv, andere negativ. Gemittelt gab das sehr oft Stufe 2 bis 3. Etwa zur gleichen Zeit entwickelte Stephan Harvey am SLF nicht nur die inzwischen allgegenwärtigen Lawinenprobleme (damals noch „Muster“), sondern auch den „Analyser“, bei dem zu jedem Lawinenproblem angepasste Fragen gestellt werden. Obwohl sich Ariane Stäubli schon 2012 in ihrer Masterarbeit an der ETH der Weiterentwicklung des Nivochecks gewidmet hatte, sollte es noch Jahre dauern, bis der Schweizer Bergführerverband (SBV) 2018 den Nivocheck 2.0 publizierte. Er ist eine Weiterentwicklung, welche die älteren Nivochecks mit dem Musteranalyser kombiniert. Heute aktuell ist Version 2.1.

Es gibt keine Formel zur Berechnung der Lawinengefahr, und entsprechend wurde der Nivocheck vor allem anhand von Expertenwissen entwickelt. Persönlich sind wir überzeugt, dass er recht zuverlässig ist. Grobe Fehleinschätzungen dürften kaum vorkommen. In gewissen Fällen kann Kurt Winkler ist promovierter Bauingenieur, Bergführer und Autor der Schweizer Lehrbüc her „Bergsport Winter“ und „Bergsport Som mer “
Als Lawinenwarner am SLF ist er zust ändig für die Weiterentwick lung des Lawinenbulletins. Berg sönlichkeit in Heft 1/15. er aber ziemlich unscharf werden. Dann nämlich, wenn die Natur mit Informationen geizt, wie zum Beispiel bei einem latenten Altschneeproblem mit schwachem Schneedeckenaufbau, bei dem aber seit Tagen kein relevanter Niederschlag fiel und inzwischen kaum noch Alarmzeichen auftreten. In solchen Fällen ist wohl auch für Experten der beste Wert der Gefahrenstufe derjenige aus dem Lawinenlagebericht. Oder am Anfang der Tour, wenn wir noch nicht weit gespurt und erst wenig Gelände gesehen haben. Das bedeutet für uns eine gewisse Vorsicht walten lassen und unterwegs weiter beobachten, bis wir genügend Informationen für eine solide Einschätzung haben.
Mit dem Nivocheck können Bergsteiger mit breitem lawinenkundlichem Wissen und Erfahrung in der Entscheidungsfindung im unverspurten winterlichen Gelände die Gefahrenstufe vor Ort selbst bestimmen und so das Lawinenbulletin überprüfen (Abb. 1). Dazu sind Beobachtungen aus den für die Tour relevanten Höhen und Expositionen nötig. Waren wir also zum Beispiel nur in Südhängen unterwegs, können wir die Verhältnisse in der Nordabfahrt oft nur schlecht beurteilen. Halten wir kein Lawinenproblem für relevant, füllen wir nebst der Frage nach den Alarmzeichen zumindest den Block „Altschneeproblem“ aus. Landen wir bei allen ausgefüllten Blöcken in der linken Hälfte, können wir zusätzlich den Block „Günstige Situation“ ausfüllen. Einzelne Fragen, die wir nicht beantworten können, lassen wir unbeantwortet. Damit sinkt aber in aller Regel die Zuverlässigkeit des Tests.
Abb. 1 Vorderseite des Nivochecks 2.1, ausgefüllt mit dem Beispiel am Schluss des Artikels.
Die Frage nach den Alarmzeichen füllen wir immer aus. Frische Lawinenabgänge und Wummgeräusche sind die einfachste und oft zuverlässigste Möglichkeit, Schwachstellen in der Schneedecke zu finden und daraus die lokale Gefahrenstufe herzuleiten (Abb. 2). Ein Problem haben aber auch bei den Alarmzeichen: Wir müssen die schlechten Nachrichten aktiv suchen. Normalerweise hört das „Wumm“ nämlich nur, wer selbst spurt. Und auch die Lawinen sieht nur, wer aufmerksam herumschaut. Sind Alarmzeichen vorhanden, sollten wir die Situation nicht mit irgendwelchen Argumenten schönreden. Alarmzeichen sind im Nivocheck deshalb ein „Killerkriterium“. Das bedeutet, dass die Gesamtgefahr nicht tiefer sein kann, als aus den Alarmzeichen bestimmt.
Die weiteren Fragen des Nivochecks sind nach Lawinenproblemen sortiert und in Blöcke gegliedert. Wir füllen nur die in der aktuellen Situation (möglicherweise) relevanten Blöcke aus. Beim Neuschneeproblem werden z. B. nur Fragen gestellt, die bei Neuschnee wichtig sind, sodass wir uns nicht mit in der aktuellen Situation irrelevanten Fragen herumschlagen müssen. Gleichzeitig entfällt so die bei früheren Varianten festgestellte Tendenz, immer in der Mitte, bei Gefahrenstufe 2 bis 3 zu landen. Nebst den Alarmzeichen gibt es in den situationsabhängigen Blöcken noch zwei weitere „Killerkriterien“: beim Neuschneeblock die kritische Neuschneemenge und beim Nassschneeblock die erste Durchnässung der Schneedecke.

01 Lassen Sicht und Informationen überhaupt eine Beurteilung
31 Expositionen und Höhenlagen, für welche die Gefahrenstufe gilt:

viel Schnee / offene Hänge
33 Verbreitung der Gefahrenstellen: vereinzelt / ziemlich weit verbreitet / weit verbreitet
34 Tendenz: gleichbleibend / langsame – schnelle Verbesserung / langsame – schnelle Verschlechterung
Nivocheck ausfüllen
Der Nivocheck wird mit Beobachtungen aus den für die Tour relevanten Höhenbereichen und Expositionen erstellt.

Abb. 2 Rückseite des Nivochecks 2.1, ausgefüllt mit dem Beispiel am Schluss des Artikels. Lukas Dürr ist Forstingenieur, Bergführer un d Fachreferent Lawinen in der Schweizer Berg führerausbildung. Er arbeitet als Lawin enwarner am SLF.
Resultat Nivocheck
Wenn Killerkriterium erfüllt (Fragen 2, 3, 20) = Gefahr erheblich oder höher
Ansonsten gilt das Resultat des am negativsten beurteilten Blocks der typischen Lawinenprobleme
Bei einergünstigen Situation (25 – 28) zählt das Mittel dieser Fragen und aller anderen ausgefüllten Blöcke
InterpretationAlarmzeichen (Nivocheck, Frage 2)
Die ungünstigste Beobachtung ist entscheidend, nicht ein Mittelwert. Es gilt: je moderaterdas Gelände / je kleiner die Zusatzlast desto kritischer die Lawinensituation.
Alarmzeichen**gering mässig erheblich gross spontan keine oft keine wenige bis einigeviele oder grosse Fernauslösung keine keine einzelne, über kurze Distanzen mehrere, über längere Distanzen
Personenauslösung keine, obwohl oft keine, obwohl diverse Steilhänge verspurt wenige bis einigeviele oder grosse viele extrem steile Hänge verspurt
Sprengung negativ einzelne positiv, kleineinige positiv, klein bis mittel meist positiv, mittel bis gross Risse keine* meist keine* einige bis viele viele Wumm keine* kleine möglich, v.a. in einige bis viele oder Ebenen
*keine Risse und Wummgeräusche nur berücksichtigen, wenn länger gespurt wurde **ErläuterungAlarmzeichen, siehe Lawinen-Handbuch SBV, Seiten 10-12

Die Lehrmeinungen sind sich recht einig, dass Erfahrene mit guten Argumenten die im Lawinenlagebericht beschriebene Gefahr auch nach unten korrigieren dürfen –aber sie lassen in der Regel offen, was wir unter „guten Argumenten“ zu verstehen haben. Zum Schließen dieser Lücke hat der SBV den Nivocheck 2 entwickelt und unterrichtet ihn auch in seinen Kursen. Konnten wir genügend Informationen sammeln und auswerten, so halten wir das Resultat des Nivochecks für ein sehr gutes und zudem nachvollziehbares Argument. Damit steht unserer Meinung nach auch einer allfälligen Anpassung der Gefahrenstufe nach unten nichts im Weg.
/ Entscheiden im Einzelhang tscheidgrundlage.



Gefahr Wie wahrscheinlich ist eine Lawinenauslösung?
--> StichhaltigeArgumente für dieAuslösewahrscheinlichkeit im Einzelhang
Konsequenzen Was wären die Folgen einer Lawinenauslösung?

--> Hanggrösse, Geländefallen,Anzahl der betroffenen Personen




Massnahmen Lassen sich mit wirkungsvollen Massnahmen Gefahr und/oder Konsequenzen verringern? -->Massnahmen berücksichtigen & kombinieren!
Zum Sammeln der Informationen sollten wir vor dem Ausfüllen des Nivochecks in der Regel eine längere Strecke selbst gespurt haben. Die Anwendung des Nivochecks macht damit vor allem im wenig verspurten oder unverspurten Gelände Sinn. Konnten wir keine relevanten Informationen sammeln, sehen wir von einer Anpassung nach unten ab.
Wann lohnt sich der Nivocheck (ganz besonders)?
Der Nivocheck ist zu aufwändig, um ihn auf jeder Tour auszufüllen. In Situationen, in denen kaum brauchbare Informationen aufzutreiben sind, werden wir auch mit dem Nivocheck nicht schlauer. Dann hilft nur eine Extraportion Vorsicht. Dies gilt insbesondere bei latenten, lange anhaltenden Altschneeproblemen. In anderen Fällen reicht schon die Beantwortung weniger Schlüsselfragen (z. B. der „Killerkriterien“)

Abb. 3 Blick in die Nordflanke der Zenjiflue, 2685 m, bei Davos.
und die Situation ist klar. Dies geschieht bei erfahrenen Tourengeherinnen meist sehr rasch und während des Gehens. Es gibt aber auch Situationen, in denen der Nivocheck unserer Meinung nach ein hervorragendes Instrument ist, das seinen Aufwand lohnt:
y wenn keine verlässlichen Informationen zur Lawinensituation vorhanden sind (kein Netz, exotische Destination)
y wenn wir vor Ort eine Abweichung von der in der Planung angenommenen Situation vermuten oder möglichst ausschließen wollen y wenn wir die Gefahrenstufe nach unten korrigieren
y als didaktisches Werkzeug in der Ausbildung. Mit seinen strukturierten Fragen hilft uns der Nivocheck zu verstehen, welche Beobachtungen beim jeweiligen Lawinenproblem wichtig sind. Mit dem Nivocheck können wir also lernen, systematisch und zielgerichtet die relevanten Informationen zu sammeln und sie zu gewichten.
Die Schneedecke ist so vielseitig wie die Menschen, die sie beurteilen. Trotzdem möchten wir unsere persönliche Einschätzung einer Beispieltour zeigen.
Frage 1: Lassen Sicht und Informationen überhaupt eine Beurteilung zu? Das Können haben wir. Aber haben wir auch genügend Informationen? Wir fassen unsere Beobachtungen zusammen: y Vor drei Tagen endete ein zweitägiger Schneefall, welcher dem Gebiet 50 bis 70 cm Neuschnee brachte. Seither war es trocken mit nur wenig Wind.
y Wir haben eine gute Stunde selbst gespurt und dabei ein kleinflächiges Wummgeräusch wahrgenommen.
y Weil neu im Gebiet, haben wir einen ECT gemacht. Dieser brach beim 5. Schlag aus dem Ellenbogen ganz durch (ECT 15/15). Der Bruch erfolgte im Altschnee in einer weichen Schicht aus kantigen Kristallen etwa 40 cm unterhalb der Schneeoberfläche.
y Dank dem super Wetter haben wir einen guten Einblick ins Gelände (Abb. 3).
y Mit wiederholten Stocktests und Beobachtung der Einsinktiefen mit und ohne Ski konnten wir feststellen, dass die Dicke der oberflächennahen Schichten deutlich variiert, darunter aber verbreitet eine schwächere Schicht liegt.
Wir schätzen unsere Informationslage als gut ein und erwarten eine solide Bewertung.
Frage 2: Alarmzeichen Normalerweise bedeuten Wummgeräusche mind. Stufe 3 (erheblich). Je nach Länge, die wir gespurt haben, kann ein einzelnes, kleines Wumm aber noch mit Stufe 2 (mäßig) durchgehen. Wir bewerten es mit 2 bis 3 (Abb. 2).
Die vielen, teils mittelgroßen Schneebrettlawinen gingen spontan ab. Eine oder zwei könnten fernausgelöst sein, was die Sache auch nicht besser macht. Aber sind sie frisch? Das Alter der Lawinen abzuschätzen ist oft schwierig. Mit unserem Wissen zum Wetterverlauf ist es hier eindeutig: Die Lawinen sind allesamt leicht eingeschneit. Sie sind also gegen Ende der Niederschläge abgegangen. Somit sind sie gut drei Tage alt und wir berücksichtigen sie nicht mehr als Alarmzeichen. Wir übertragen das Resul-
Erheblich, Stufe 3
Altschnee, Triebschnee
Gefahrenstellen
Gefahrenbeschrieb
2200m
Neu- und Triebschnee der letzten Woche überlagern eine schwache Altschneedecke. Lawinen können von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Sie können in tiefe Schichten durchreißen und groß werden. Fernauslösungen sind möglich. Touren und Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr.
tat auf die Vorderseite (Abb. 1). Weil Alarmzeichen ein Killerkriterium sind, fallen gering und ein tiefes Mäßig schon mal raus.
Fragen 3–10: Neu- und Triebschnee
Seit dem letzten Schneefall sind 3 Tage vergangen und der Wind blies seither nur noch schwach bis mäßig. Schwachschichten innerhalb des Neu- und Triebschnees sind nach dieser Zeit kaum mehr zu erwarten. Wir füllen den Block nicht aus.
Fragen 12–18: Altschnee
y Frage 12: Es liegt eher viel Schnee, also eher günstig.
y Frage 13: Beim Graben für den ECT haben wir eine weiche Schicht aus kantigen Kristallen festgestellt. Dort brach auch der ECT. Weil die Kristalle nicht sonderlich groß sind, nehmen wir nicht das schlechteste, sondern das zweitschlechteste Feld.
y Frage 14: Die Überdeckung der Schwachschicht ist ziemlich variabel, aber doch recht oft im Bereich von 20 bis 50 cm, also recht ungünstig.
y Frage 15: Der ECT hat es gezeigt, Stocktests und die Beobachtung der Einsinktiefen haben es bestätigt: Unter der härteren Schicht an der Oberfläche liegt eine lockere Schicht. Diese Schichtung besteht schon seit mehreren Tagen und dürfte inzwischen etwas von ihrer „Spritzigkeit“ verloren haben, d. h., das Brett könnte sich schon etwas aufgelöst und gleichzeitig die Schwachschicht etwas verfestigt haben. Trotzdem klar ungünstig bis sehr ungünstig.
y Frage 16: Die Variabilität des Schneedeckenaufbaus ist oft schwierig zu beurteilen. Heute aber ergibt sich ein klares Bild: Wir sehen abgeblasene Kuppen und Rippen und diverse bereits abgegangene Lawinen.
Eine Auslösung der ganzen zusammenhängenden Flächen über 30° Neigung in einer einzigen Lawine scheint unwahrscheinlich. Zwischen den Rippen ist die Schneedecke aber offensichtlich so gleichmäßig aufgebaut, dass Lawinen gefährlich groß werden. Bewertung: ungünstig.
y Frage 17: Es gibt nichts zu beschönigen: sehr ungünstig
y Frage 18: Einzelne Spuren sind vorhanden, aber zu wenig steile Hänge, um sie als günstig zu werten. Wir lassen die Frage unbeantwortet.
y Unterm Strich resultiert für das Altschneeproblem ein Erheblich, Stufe 3=.
Fragen 20–24: Nassschnee
Weil schlicht keine Gefahr für nasse Lawinen besteht, füllen wir diesen Block nicht aus.
Fragen 25–30: günstige Situation
Die Frage, ob Stufe 1, stellt sich nicht. Das Killerkriterium „Alarmzeichen“ passt nicht dazu und das Altschneeproblem zeigt Stufe 3. Wir können also auch diesen Block getrost beiseite lassen.
Frage 29: Gefahrenstufe gemäß Nivocheck
Maßgebend ist der schwächste Block. Hier also das Altschneeproblem mit Gefahrenstufe 3=.
Frage 31: Expositionen und Höhenlagen Unsere Beurteilung gilt sicher für Hänge der Höhe und Exposition von Bild 3 (Nord, über 2100 m) und vermutlich auch an unserem Profilort. Ob die anderen Höhen und Expositionen günstiger sind, können wir mit den vorliegenden Informationen nicht beurteilen.
Abb. 4 Lawinenbulletin vom 13.3.2017, 8 Uhr, für die Region Davos/Prättigau.

Reto Schild, Hasliberg, B ergführer, einer von drei technischen Leitern der Schweizer Bergführerausbildung, Verfasser der Lehrunterlagen fü r die Schweizer Bergführerausbildung.

Frage 32: Gefahrenstellen
In Mulden mit viel Schnee wird unser Gewicht kaum für eine Auslösung reichen, an den Kuppen liegt kaum Schnee. Am gefährlichsten sind deshalb wohl offene Hänge und Übergänge von wenig zu viel Schnee.
Frage 33: Verbreitung der Gefahrenstellen
Dieser Parameter ist oft schwierig abzuschätzen. Nur ein einzelnes Wumm deutet auf eher wenige Gefahrenstellen, die vielen spontanen Lawinen auf viele. Wir nehmen die Mitte.
Frage 34: Tendenz
Bei ruhigem Wetter nimmt die Lawinengefahr ab. Dies aber nur langsam, weil es sich um ein Altschneeproblem mit einer typischen Schwachschicht aus kantigen Kristallen handelt.
Frage 30: Vergleich mit Planung
Bei der Planung sind wir vom aktuellen Lawinenbulletin ausgegangen: Gefahrenstufe 3 innerhalb der Kernzone (Abb. 4).
Die Tour fand am 13. März 2017 statt, damals noch ohne Zwischenstufen. Der Gefahrenbeschreibung nach würde das heute vermutlich mit 3= angegeben, evtl. sogar mit 3+. Mit 3= hat der Nivocheck die in der Planung angenommene
Lawinengefahr bestätigt. Wir haben also weder ein Argument, die Gefahr nach unten zu korrigieren, noch müssen wir unser Tourenziel wegen unerwartet schlechter Verhältnisse ändern. Also weiter wie geplant.
Routenwahl und Einzelhang
Über diese Flanke auf den Gipfel war hoffentlich nicht unser Ziel. In den
obersten 80 Höhenmetern ist sie mit über 40° nämlich extrem steil und damit bereits bei der Planung mit der Reduktionsmethode (und wohl auch mit jeder anderen statistischen Methode) hochkant durchgefallen. Nach Munter handelt es sich beim Gipfelhang sogar um einen „Todgeilen Dreier“ (erheblich + extrem steil + Nord). Und unverspurt. Vielleicht war unser Ziel, bis unter den Gipfelhang hochzusteigen, so weit das möglich ist, ohne in den roten Bereich der Reduktionsmethode zu kommen.
Selbstverständlich machen wir bis dorthin für jeden Hang jeweils eine Einzelhangbeurteilung. Dabei lassen uns die gute Sicht, die bereits abgegangenen Lawinenflächen sowie das im unteren Bereich insgesamt nicht allzu steile, kupierte Gelände mit abgeblasenen Rücken und sichtbaren Spuren einigen Spielraum. Das schwer einzuschätzende Altschneeproblem und die Möglichkeit von Fernauslösungen machen die Sache aber auch für uns Experten unberechenbar. Und im Falle einer Auslösung müssen wir mit einer mindestens „mittleren“ Lawine und damit mit ernsten Konsequenzen rechnen. Ein defensives Verhalten und die Umkehr bereits in gebührendem Abstand vom Gipfelhang scheinen deshalb sinnvoll. ■
Seit Herbst 2022 sind die Bergführerverbände der Schweiz, von Österreich, Deutschland und Südtirol als Redaktionsbeiräte bei bergundsteigen mit an Bord. Daher erscheint seither in jeder Ausgabe ein Beitrag dieser Verbände. Die Serie soll informieren und zugleich zu einem konstruktiven Austausch zwischen den Verbänden anregen und dadurch auch indirekt die Bergführerausbildung weiterentwickeln.
y Harvey, S. (2012): Musteranalyser. In M. Wicky, D. Marbacher, M. Müller, & E. Wassermann, Lawinen und Risikomanagement (S. 91). Worb: bergpunkt ag.
y Harvey, S., Rhyner, H., & Schweizer, J. (2012): Unterwegs beobachten und beurteilen. In S. Harvey, H. Rhyner, & J. Schweizer, Praxiswissen für Einsteiger und Profis zu Gefahr, Risiken und Strategien (S. 110). München: Buckmann.
y Munter, Werner (2009): Nivocheck, bergundsteigen 4/09, S. 62–65.
y Stäubli, A. (2012): Der Nivocheck –Ein Instrument zur selbständigen Einschätzung der Lawinengefahr im Gelände. Masterprojektarbeit ETH Zürich und SLF
y Winkler K., Techel F., & Schmudlach G. (2022): Lawinenrisiko auf Skitouren, bergundsteigen #118, S. 26–33.
y Winkler K., Brehm H.P, & Haltmeier J. (2023): Bergsport Winter –Technik, Taktik, Sicherheit, 6. Auflage. Bern: SAC-Verlag
Hier kannst du den Nivocheck 2.1 als pdf herunterladen:











































Die Capanna Regina Margherita ist nicht nur die höchstgelegene Hütte in den Alpen, sondern auch die höchste Forschungsstation in Europa. Anhand ihrer Geschichte lässt sich die Entwicklung der Höhenmedizin nachzeichnen.
Von Peter BärtschDie Capanna Regina Margherita ist das höchstgelegene Haus in Europa und thront auf dem 4554 Meter hohen Gipfel der Signalkuppe (Punta Gnifetti) im Monte-RosaMassiv. Sie ist von Süden her via Alagna oder Gressoney einfach zu erreichen. Seilbahnen führen bis eine Stunde unter die Gnifettihütte (3600 m), von dort gelangt man in einer vier- bis fünfstündigen einfachen Gletscherwanderung über einen wenig zerklüfteten Gletscher zur Hütte. Lediglich die letzten 100 Höhenmeter vom Col Gnifetti zur Hütte können bei schwierigen Verhältnissen etwas mehr Erfahrung im Gehen mit Steigeisen in steilem Gelände erfordern.
Der gut akklimatisierte Bergsteiger kann sich auf der Punta Gnifetti bei schönem Wetter über eine atemberaubende Aussicht freuen. Nach Osten reicht der Blick über das Anzascatal und Centovalli bis zum Berninamassiv und nach Norden über das Strahlhorn zum Aletschgletscher und die Berner Alpen. Vor der Haustüre liegen die Walliser Alpen mit Dent Blanche, Matterhorn und Dent d’Herens und im Westen über dem Lyskamm Grand Combin und Mt. Blanc. Gegen Süden sieht man vom Gran Paradiso bis zum Monte Viso und zu Füßen liegen die Poebene, der Langensee und der See von Varese. An klaren Tagen reicht die Sicht bis zum Apennin. Wer über Nacht bleibt und nicht unter Höhenkrankheit leidet, kann das Spiel von Farben, Licht und Schatten bei untergehender und aufgehender Sonne genießen und in klaren Nächten das Lichtermeer von Mailand und Turin erkennen.
Bau von Hütten auf der Punta Gnifetti und auf dem Mt. Blanc
Man mag sich fragen, warum vor 130 Jahren eine Hütte auf einem der höchsten Gipfel der Alpen errichtet wurde, wenn doch dem Bergsteiger die letzte Hütte eine Tagesetappe unterhalb des Gipfels genügen würde. Nicht so dem Sohn und den Neffen von Quintino Sella, dem Gründer des Italienischen Alpenclubs (CAI). Sie regten 1887 den Bau einer Hütte auf der Punta Gnifetti mit folgender Begründung an: „Wer eine echte Leidenschaft für die Berge hat, begnügt sich nicht damit, einen Gipfel zu erreichen und dann möglichst schnell wieder abzusteigen. Er möchte oben verweilen, bewundern und sich erfreuen. Im Übrigen ergeben sich die schönsten Aussichten und die wundervollsten Lichteffekte beim Morgenrot und Sonnenuntergang“ (aus Bolletino, Zeitschrift des CAI, Übersetzung in den ALPEN, August 2023, Marco Volken).
Die Sella-Initiative wurde in einer Revista Mensile des CAI 1889 unterstützt von Wissenschaftlern, die an Meteorologie und Astronomie interessiert waren. Das Projekt, eine Hütte auf der Punta Gnifetti zu erstellen, wurde im Januar 1890 mit ihrer Unterstützung von der Delegiertenversammlung des CAI gutgeheißen. Es ist möglich, dass Kompetition zwischen italienischen und französischen Forschern zur Annahme des Vorschlages beigetragen hat, da wohl bekannt war, dass der französische Forscher Jules Janssen eine Hütte für Forschungs-
Sonnenuntergang vor der höchsten medizinischen Forschungsstation Europas. Von der Margherita-Hütte auf der Punta Gnifetti oder auf Deutsch Signalkuppe im Monte-Rosa-Massiv hat man einen atemberaubenden Rundblick vom Mont Blanc übers Matterhorn bis zum Bernina-Massiv. Foto: Sylvain Mauroux


Die Einweihung der Capanna Regina Margherita unter anderen mit der Namensgeberin Königin Margherita von Italien höchstpersönlich.
zwecke auf dem höchsten Punkt der Alpen plante, auf der Eiskuppe des Mont Blanc mit 4807 Metern. Die Planungen dazu waren wohl bereits 1889 im Gange. Bei Sondierungen auf dem Mont Blanc starb dabei der begleitende Arzt, Dr. Jacottet, Dorfarzt von Chamonix, 1891 an einem Höhenlungenödem, das damals für eine Lungenentzündung gehalten wurde, worüber auch in der Neuen Zürcher Zeitung berichtet wurde (Separat-Abdruck 1892). Das Observatorium Janssen wurde schließlich 1893 errichtet und nach wenigen Jahren – wie zu erwarten war – von Schnee und Eis verschluckt. 1898 wurde dann als dauerhafte Einrichtung das bis heute existierende, auf Felsen gebaute Observatoire Vallot am Mont Blanc in 4350 Metern Höhe gebaut.
Ab 1890 wurde in Italien innerhalb von zwei Jahren die Finanzierung der geplanten Hütte auf der Punta Gnifetti realisiert. Sie war breit abgestützt, die Liste der Spender umfasste nebst Königin Margherita und König Umberto von Savoyen staatliche Institutionen, Sektionen und einzelne Mitglieder des CAI sowie wissenschaftliche Gesellschaften und auch berühmte Alpinisten wie Eduard Whymper. Am 18. August 1893 wurde die drei Räume umfassende Hütte auf der Punta Gnifetti eingeweiht. Königin Margherita von Savoyen, die selbst Bergsteigerin war, ließ es sich nicht nehmen, zur Einweihung der nach ihr benannten Hütte die Punta Gnifetti zu besteigen.
Interessanterweise waren es nicht die Meteorologen und Astronomen, welche den Bau der Hütte unterstützt hatten, sondern der Physiologe Angelo Mosso, Professor an der Universität Turin, der im Sommer 1894 als Erster eine Forschungsexpedition zur Capanna Regina Margherita unternahm. Er führte grundlegende Untersuchungen zur Einwirkung großer Höhen auf Kreislauf, Atmung und körperliche Leistungsfähigkeit sowie zur akuten Bergkrankheit durch. Angelo Mosso hat als Erster, die periodische Atmung im Schlaf in dieser Höhe auf RußTrommeln nachgewiesen. Seine Probanden waren zehn gesunde, junge, sorgfältig ausgesuchte Soldaten, von denen sieben langsam (1000 Höhenmeter pro Woche) und drei schnell (in zwei Tagen) zur Margherita-Hütte aufstiegen. In der schnellen Gruppe erlitt ein Proband am zweiten Tag in der Hütte eine „Lungenentzündung“, die nach viertägiger Behandlung mit Bettruhe, Eigelb und warmem Marsala Wein abheilte. Hier handelte es sich mit Sicherheit um die Beschreibung des zweiten Falles eines Höhenlungenödems nach schnellem Aufstieg in den Alpen, das – im Gegensatz zu jenem von Dr. Jacottet am Mont Blanc –glücklicherweise nicht zum Tod führte.
Beeindruckt von den Ergebnissen der wissenschaftlichen Arbeiten von Mosso regte die Königin Margherita an, die Hütte um drei Räume zu erweitern, die nur wissen-

schaftlichen Untersuchungen dienen sollten. Mit ihrer finanziellen Unterstützung wurde der Anbau zwischen 1899 und 1901 realisiert. Angelo Mosso betonte in seinen Aufzeichnungen auffällig eindringlich, dass die Initiative zur Erweiterung von Königin Margherita stamme, was den Verdacht aufkommen lässt, dass er als gehorsamer Untertan seine Rolle als Mitinitiant herunterspielte. Durch die Arbeiten von Angelo Mosso und den Anbau der Hütte wurden Turin und die Margherita-Hütte zum Zentrum für Forschung in Höhenphysiologie und -medizin. Die weltweit führenden Physiologen aus den umliegenden Ländern suchten ab 1895 in Feldstudien die Capanna Margherita auf. Der fünfte internationale Kongress für Physiologie fand 1901 in Turin statt und die National Academy of Science in Washington anerkannte die Margherita-Hütte als internationale, unterstützungswürdige Forschungsstation.
Margherita-Hütte in der Zeit der Weltkriege
Leider kam diese internationale Zusammenarbeit durch den Ersten Weltkrieg zum Erliegen und die Forschung wurde in der Margherita-Hütte nachher nicht wieder aufgenommen. Maßgeblich dazu beigetragen hat wahrscheinlich der von Angelo Mosso initiierte Bau eines großen Forschungsgebäudes in 2901 Metern Höhe auf dem Col d’Olen, das nach ihm benannt wurde. Neun Räume boten eine optimale Infrastruktur für Forschung und 16 Zimmer mit fließend war-
mem Wasser ermöglichten einen komfortablen Aufenthalt für Forscher und Probanden. Das Instituto Angelo Mosso wurde bis 1938 rege benutzt für Untersuchungen zur Physiologie der Anpassung an mittlere Höhen, war jedoch zu niedrig für Untersuchungen über Höhenkrankheiten. Einzig eine Gruppe aus der Universität Nimwegen unter der Leitung des Physiologen Ferdinand Kreutzer ließ sich von den primitiven Verhältnissen in der Capanna Margherita nicht abhalten und untersuchte 1963 dort den Gasaustausch in der Lunge. Da es damals noch keine Hubschrauber gab, die schwere Lasten in diese Höhen fliegen konnten, wurde das Material – darunter ein Stromgenerator, Gasflaschen und modernste Geräte zur Untersuchung des Gasaustausches – vom bekannten Gletscherpiloten Hermann Geiger mit einem Pilatusporter auf den Col Gnifetti transportiert. Der Landeplatz lag 100 Höhenmeter unterhalb der Hütte. Von dort aus musste alles Material mittels einer improvisierten Seilbahn in die Hütte gehievt werden. Die unentwegten Forscher zeigten, dass die Diffusion für die Atemgase O2 und CO2 in der Lunge nicht beeinträchtigt ist und ließen erahnen, welche Erkenntnisse mit dem Einsatz modernster Untersuchungsmethoden in der Margherita-Hütte erschlossen werden könnten. Die Voraussetzungen dazu wurden geschaffen mit dem Neubau der Margherita-Hütte 1979/80 und mit leistungsfähigen Helikoptern und erfahrenen Piloten, die 400 Kilogramm schwere Netze auf dem Grat vor der Hütte absetzen konnten.
Frühe medizinische Forschung auf der Margherita-Hütte: Apparatur zur Messung der Atemgase in der Ausatmungsluft.

Blick über die Zumsteinspitze zur Margherita-Hütte auf dem Gipfel der Signalkuppe mit Wolkenmeer über der Poebene.
Foto: Christine Brandmaier
Diese Serie organisieren und betreuen Dr. Nicole Slupetzky (Vizepräsidentin des ÖAV und Präsidentin des Clubs Arc Alpin) und Prof. Dr. Marc Moritz Berger (Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Essen, Deutschland; Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin). Der Experte für Prävention und Therapie der akuten Höhenkrankheiten und für alpine Notfallmedizin ist Mitinitiator des Symposiums für Alpin- und Höhenmedizin Salzburg, das gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein organisiert wird.
Der Neubau umfasste im untersten Stock eine Küche, einen großen Aufenthaltsraum, einen Winterraum sowie eine Werkstatt und einen Generator, der 20 Kilowatt Strom lieferte. Im zweiten und dritten Stock befinden sich 80 Schlafplätze in Zimmern mit zwei bis zehn Kajütenbetten. Beim Neubau wurde nicht mehr an die ursprüngliche Bestimmung der alten Hütte gedacht, in der 50 Prozent der Räume nur für die Forschung reserviert waren. Glücklicherweise war sich aber die Leitung der Sektion des CAI Varallo – Besitzer und Betreiber der Hütte – der ursprünglichen Bestimmung der Hütte bewusst und stellte den Platz für Forscher und Probanden von wissenschaftlichen Studien gerne zu Verfügung. Allerdings gab es keine permanenten Einrichtungen mehr für die Forschung, so dass Schlafräume nur für die Dauer von Studien in Forschungslabors umgewandelt werden durften.
Ohne die großzügige Unterstützung durch Mario Soster und Guido Fuselli, Präsidenten des CAI Varallo, wäre die Margherita-Hütte nicht noch einmal zu einem weltweit anerkannten Zentrum der höhenmedizinischen Forschung geworden, weshalb wir ihnen und den vielen Teams von Hüttenwirten zu großem Dank verpflichtet sind. 1983 führten Oswald Oelz und Marco Maggiorini aus dem Universitätsspital Zürich eine erste Untersuchung zur Häufigkeit der Höhenkrankheiten durch. Ab 1984 stieß der Autor aus dem Inselspital Bern zu diesem Team und
führte Laboruntersuchungen und Blutgasanalysen durch, 1986 kamen Röntgenaufnahmen der Lungen dazu, ab 1987 wurde der Herzultraschall zur Bestimmung des Druckes in den Lungenarterien eingesetzt. Später kamen Großgeräte hinzu, die differenzierte Untersuchungen der Lungenzirkulation und der Lungenmechanik erlaubten. Blut wurde gekühlt zentrifugiert und die Blutflüssigkeit bei –180 Grad im flüssigen Stickstoff gelagert. Damit waren moderne Laboruntersuchungen nach Rückkehr ins Tiefland ohne Qualitätsverlust möglich. Die kontinuierliche stabile Stromversorgung erlaubte auch den Betrieb der meisten Geräte, die zur Forschung im Tiefland eingesetzt werden, sofern sie transportabel waren. Das Spektrum der Untersuchungen wurde durch Zusammenarbeit mit vielen Spezialisten in den Universitätskliniken in Zürich, Bern, Lausanne, Heidelberg und Seattle –um die wichtigsten zu nennen – erweitert.
Studien zur Behandlung und zur Epidemiologie der akuten Bergkrankheit (ABK, siehe Kasten) wurden an den Personen durchgeführt, die in der Hütte übernachteten. In Studien zu Ursachen und Prävention von ABK und Höhenlungenödem (HLÖ, siehe Kasten) wurden Probandinnen und Probanden vor und nach einem schnellen Aufstieg mit einer Übernachtung in der Gnifettihütte (3610 m) mehrmals nach Ankunft in der Margherita-Hütte untersucht. Die zuständigen Ethikkommissionen hatten diese Studien mit einem Aufstieg, der ABK und HLÖ provozieren kann, genehmigt, weil die frühe
Risiko für ABK
langsam ja Aufstieg Vorakklimatisation
Behandlung von akuten Höhenkrankheiten mit Medikamenten und zusätzlichem Sauerstoff schnell wirkt, sicher ist und keine Folgeschäden hinterlässt.
Die wichtigsten Erkenntnisse für Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die aus diesen Studien resultierten, sind:
1. Die wichtigsten Risikofaktoren für ABK sind ein zu schneller Aufstieg, eine ABK bei früheren vergleichbaren Touren und wenig Höhenexposition in den vorangegangenen Wochen. Diese Faktoren wirken zusammen, wie Diagramm 1 zeigt.
2. Die schwere ABK kann erfolgreich mit Dexamethason behandelt werden, was den Abstieg in niedrigere Höhen ermöglichen soll.
3. Die ABK kann vorübergehend durch Behandlung im Überdrucksack gebessert werden, was ebenfalls einen anschließenden Abstieg in niedrigere Höhen ermöglicht.
4. Wer einmal ein HLÖ erlitten hat, erkrankt mit großer Wahrscheinlichkeit unter vergleichbaren Bedingungen wieder daran.
5. Das HLÖ kann durch Medikamente, die den Druck in den Lungenarterien senken (zum Beispiel Nifedipin oder Viagra) verhindert und behandelt werden.
6. Ein langsamer Aufstieg von etwa 350 Metern pro Tag (auf Schlafhöhe bezogen) ab 2500 Metern kann das HLÖ bei anfälligen Personen verhindern. Des Weiteren wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die Aufschluss geben über zugrunde liegende Mechanismen, auf die hier nicht eingegangen werden kann.
Wichtigste Risikofaktoren für akute Bergkrankheit
nicht anfällig
langsam nein schnell ja schnell nein anfällig
Die Ergebnisse der ersten Studien zwischen 1983 und 1990 fanden große Beachtung und wiesen interessierte Gruppen auf die Möglichkeiten zur Forschung in der neuen Margherita-Hütte hin, so dass die Punta Gnifetti erneut zu einem international renommierten Zentrum der Höhenmedizin und Höhenphysiologie wurde. In der größten medizinischen Datenbank (Medline) finden sich von 1983 bis 2022 mindestens 137 Publikationen mit Originaldaten aus der Margherita-Hütte, von denen 52 in den führenden Journalen der Medizin und Physiologie erschienen sind, publiziert von Wissenschaftlern aus elf verschiedenen Ländern.
Professor Jack Reeves, ein führender Forscher aus Denver, konstatierte 1997, dass sich das Zentrum der innovativsten Forschung in Höhenmedizin von Colorado nach Europa auf die Margherita-Hütte verschoben hatte.
Eine genauere Analyse der Publikationen zeigt aber auch, dass die wissenschaftliche Aktivität in der Margherita-Hütte in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Dies mag viele Gründe haben. Einerseits sind die wichtigsten Fragen, die sich in Feldstudien beantworten lassen, weniger geworden, andererseits haben die administrativen Hürden insbesondere für Medikamentenstudien massiv zugenommen. Es ist kaum mehr möglich, solche Studien ohne Unterstützung durch Pharmafirmen durchzuführen. Leider sind diese an Höhenstudien nicht interessiert, weil kein lukrativer
Diagramm 1.Die Abbildung zeigt das Risiko für akute Bergkrankheit in 4554 Metern Höhe in Abhängigkeit von Aufstiegsgeschwindigkeit, Vorakklimatisation und Anfälligkeit für ABK. Langsamer Aufstieg heißt in mehr als drei Tagen ab 2000 Metern, Vorakklimatisation heißt an mehr als vier Tagen auf über 3000 in den letzten zwei Monaten und anfällig ist, wer bei früheren Touren häufig bergkrank war. Grafik: Schneider, Med. Sci. Sports Exerc. 2002
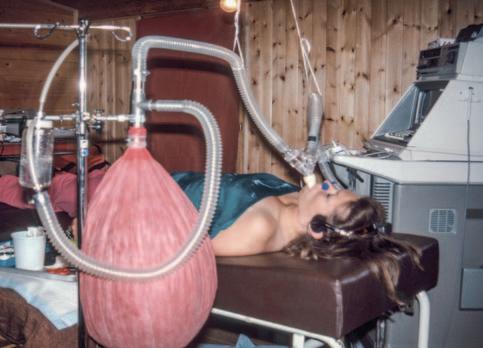
Messung des Atemantriebs in den 1980ern.
Der Autor mit einem Röntgenbild einer Lunge, das ein Höhenlungenödem zeigt. Foto: Urs Möckli


Markt für Medikamente gegen Höhenkrankheiten besteht, geschweige denn für Medikamente, die lediglich Hinweise geben können auf Mechanismen, die zu Höhenkrankheiten führen.
Andererseits haben sich auch das Verständnis und die Unterstützung für die höhenmedizinische Forschung von Seiten des Hüttenbetreibers geändert.
Die CAI-Sektion Varallo hat den Betrieb seiner Hütten ausgelagert, dieser unterliegt nun rein kommerziellen Kriterien, so dass man nur noch mit Mühe Zugang zu den verbrieften drei Räumen für Forschung erhalten kann – zu Preisen, welche den finanziellen Verlust durch die Belegung kompensieren und zu Zeiten mit geringer Belegung, die oft für Studien ungeeignet sind.
Wenn man auf die Gründungszeit der Margherita-Hütte zurückblickt, scheinen damals die Interessen der Bergsteiger die Errichtung angestoßen zu haben, während die Forschung für die Realisierung und die Bedeutung der Hütte entscheidend war.
Aus Sicht des Betreibers der MargheritaHütte hat sich heute die Gewichtung zugunsten der Bergsteigerinnen und Bergsteiger verschoben.
Per Helikopter auf die Signalkuppe transportierter Body-Plethysmograph, der eine umfassende Beurteilung der Lungenfunktion erlaubt.

Symptome: manifestiert sich nach frühestens vier Stunden oberhalb von 2500 m. Leitsymptom ist der Kopfschmerz, daneben kommen weitere unspezifische Symptome wie Krankheitsgefühl, Schwindel, Inappetenz und Übelkeit vor.
Behandlung: leichte Formen mit Ruhetag und einfachem Schmerzmittel; Abstieg, wenn damit keine Besserung erzielt wird; primärer Abstieg bei schweren Symptomen.
Risikofaktoren: individuelle Anfälligkeit und zu schneller Aufstieg in Relation zum Grad der Akklimatisation und Endhöhe.
Prophylaxe: ab 2500 m die Schlafhöhe nur um 500 m pro Tag steigern. Bei erhöhtem Risiko Diamox empfohlen, 125–250 mg pro Tag. Gefahr: Übergang in Höhenhirnödem, wenn Aufstieg trotz ABK fortgesetzt wird. Symptome sind Bewusstseinstrübung und Gleichgewichtsstörungen, schnelle Verschlechterung möglich, kann unbehandelt in 24 Stunden zum Tod führen.
Höhenlungenödem (HLÖ)
Symptome: bedingt durch beeinträchtigte Sauerstoffaufnahme in der Lunge wegen des Austritts von Blutflüssigkeit in die Lungenbläschen; übermäßiger Leistungsabfall bei Atemnot und Husten, bei Verschlechterung Atemnot in Ruhe, brodelndes Atemgeräusch und leicht blutiger Auswurf.
Behandlung: bei ersten Symptomen sofortiger Abstieg, wenn vorhanden Nifedipin oder Viagra und zusätzlicher Sauerstoff.
Risikofaktoren: individuelle Anfälligkeit und zu schneller Aufstieg in Relation zum Grad der Akklimatisation und zur Endhöhe.
Prophylaxe: wie für ABK, bei erhöhtem Risiko (früheres HLÖ) Schlafhöhe ab 2500 m nur um 350 - 400 m pro Tag steigern. Wenn dies nicht möglich ist, Nifedipin oder Tadalafil empfohlen.
Gefahr: 50 % Sterblichkeit, wenn keine adäquate Therapie. Bei schwerer Beeinträchtigung der Sauerstoffversorgung tritt auch Höhenhirnödem auf, siehe unter ABK.
Beim Bergsteigen passieren ständig Fehler, die beinahe zu Unfällen führen. Niemand spricht gerne darüber. Wir schon!
Bernhard von Menthon, der Schutzpatron der Bergsteiger, war an diesem 2. April 2023 offensichtlich auf unserer Seite. Michael Larcher über einen Wechtenbruch.
Die Vorgeschichte ist rasch erzählt: Extrem schlechte Verhältnisse rund um den Mont Blanc gaben den Ausschlag, die Karwoche 2023 in der südlichen Ortlergruppe zu verbringen. Wir waren sechs – Familie, Freunde, privat und kennen uns gut von gemeinsamen Touren. Start in Sulden, mit der Bergbahn zur Schaubachhütte, Aufstieg zur Suldenspitze. Das Ziel an diesem ersten Tag war das Rifugio Pizzini. Kurz vor der Suldenspitze, auf der Janinger Scharte (3323 m), machte ich den Vorschlag, noch zu Fuß einen Ausflug aufs Schrötterhorn (3386 m) zu machen. Eine unschwierige Gratwanderung, 60 Höhenmeter, knapp 400 Meter horizontal. Das Wetter war gut, kein Zeitdruck und eine gute Gelegenheit, uns an die Steigeisen zu gewöhnen.
Da war eine Spur! Die frische Skispur eines Einzelnen, die sich über den Grat zog (nur ein Teil des Gratverlaufs ist von dem Joch einsehbar). Also – Skidepot, Steigeisen an und los ging’s. Ich ging als Letzter – auch um Tipps zur Steigeisentechnik zu geben (Motto: Steigeisen sind auch Stolperfallen).
Eine erste Grathöhe war erreicht, dann ging’s leicht abfallend weiter, ein Vorgipfel war markant, links dahinter der Hauptgipfel. Ich war noch immer an letzter Position, machte Fotos. Der immer wieder nach vorne über den Gratverlauf schweifende Blick ließ mich keine Gefahr erkennen. Am Vorgipfel, von dem wir das erste Mal das letzte Gratstück einsehen konnten, warteten alle zusammen. Als ich aufschließe, ist es mucksmäuschenstill. Wir sahen nun den Einzelgänger oben am Gipfel. Und wir
sahen die gebrochene Wechte, die Kante zum Abgrund messerscharf, wie von einem Riesen abgeschnitten. Das allein wäre schon eindrucksvoll gewesen, aber sicher noch kein Grund, dankbar an Schutzheilige zu denken.
Doch da war diese Skispur, die unten an der Abbruchkante endete und sich erst oben – ca. 15 Meter entfernt – wieder fortsetzte. Dazwischen gähnender Abgrund. Erleichterung und Staunen, dass ein Mensch so viel Glück haben kann. „Der feiert gerade seinen zweiten Geburtstag“ –hat das jemand gesagt oder ging mir das nur durch den Kopf? Nicht nur die Interpretation des Spurverlaufs machte klar, dass hier jemand unglaubliches Glück gehabt hatte, wir sahen den Einzelgänger auch am Gipfel stehen. Zu einem Zusammentreffen –wir stiegen dann noch in einem weiten Linksbogen zum Gipfel auf – sollte es nicht kommen, da er den Grat noch ein Stück weiterverfolgte, um dann nordseitig nach Sulden abzufahren.
Das war’s. Vorerst. Für mich heute erstaunlich ist, wie lange es gedauert hat, bis mir dieser Beinaheunfall in seiner ganzen Bedeutung bewusst geworden ist: Hätten wir die Gefahr erkannt? Was, wenn der Einzelgänger die Wechte nicht ausgelöst hätte? Wären wir der Spur weiterhin gefolgt? Vielleicht sogar dicht aufgeschlossen? Nicht viel Fantasie ist notwendig, um sich den Worstcase vorzustellen: Wir sechs stapfen sorglos und gut gelaunt der Spur entlang, nicht ahnend, dass es unsere letzten Meter sein werden (mit dabei sind auch mein Sohn und mein Bruder).


Unterwegs am Schneegrat zum Schrötterhorn (ganz hinten die Königspitze). Kurz unterhalb des Gipfels ist der Einzelgänger Christian zu erkennen und ein Stück der Abbruchkante der Wechte (Bild oben). Foto: Michael Larcher
Am Vorgipfel wird das letzte Gratstück zum ersten Mal einsehbar (Bild unten). Foto: Michael Larcher

Am Schrötterhorn: Sechsmal Gipfelglück der besonderen Art (hinten die Königspitze). Foto: Michael Larcher
„Glaubt ihr, dass – wenn die Wechte durch den Einzelgänger gerade noch nicht gebrochen wäre – glaubt ihr, dass wir die Gefahr erkannt und einen ausreichend großen Abstand gehalten hätten oder wären wir der Spur gefolgt? Diese Frage stelle ich uns allen acht Monate später.
y Elisabeth (32):
Vermutlich wären wir der Spur nachgegangen. Allerdings, wenn ich mir jetzt das Foto noch einmal anschaue und mir überlege jetzt auf der Kuppe zu stehen, würde ich zu meinen Tourenpartnern sagen, dass die Spur gefühlt zu weit am Grat führt und dass es mir recht wäre weiter links davon eine neue Spur anzulegen. Da wir aber Abstand zueinander hielten ist fraglich, ob Josef überhaupt auf der Kuppe gewartet hätte und es zu einer Absprache gekommen wäre. Aber ja, im Nachhinein ist man immer klüger.
y Josef (35):
Ich hätte die Gefahr nicht erkannt. Ich bin der Spur bis zu diesem Moment gefolgt und habe diese zuvor schon als konservativ und sicher (auch gegen Wechten) eingeschätzt. Hätte ich selbst gespurt, wäre ich kaum anders gegangen, auch im Bereich der dann gebrochenen Wechte nicht. Danke für deine Fragen, sehr anregend, sich zu hinterfragen.
y Martin (55):
Ich bin mir eigentlich zu 100 Prozent sicher, dass ich ohne diese Erfahrung der Skispur gefolgt wäre. Vielleicht wäre ich doch etwas weiter links gespurt, wenn ich die erste Spur gezogen hätte? Trotz dieser Erfahrung kann ich mir nicht sicher sein, mich so einer Gefahr zu entziehen. Fällt wohl auch in die Kategorie Schicksal oder so?
y David (32):
Ich war an diesem Tag durch Corona angeschlagen und deshalb nicht sehr aufmerksam. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Gefahr gesehen hätte. Vielleicht hätte ich –wenn noch keine andere Spur vorhanden gewesen wäre – die Spur etwas tiefer angelegt, aber dass ich sie so tief angelegt hätte, wie es tatsächlich nötig gewesen wäre und wie wir es dann auch gemacht haben, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Als Vierter der Gruppe hätte ich wahrscheinlich nichts bemerkt, sondern wäre den anderen der Spur entlang gefolgt. Ich denke, dass ich in Zukunft in ähnlichen Situationen vorsichtiger sein werde, wie z. B. heuer auf der Marchreisenscharte – dort dürfte auch eine größere Wechte in Richtung Schlick gewesen sein. Ich bin dort bewusst sehr weit vom Rand weggeblieben.
y Fabian (34):
Erst zurück am Skidepot oder sogar erst über die nächsten Tage und Wochen wurde mir bewusst, dass wir genau gleich viele Schutzengel hatten wie dieser Mann. Denn ich bin mir sehr sicher, dass wir dieser Spur bis zum Gipfel gefolgt wären. Es war meiner Meinung nicht einzusehen, dass diese Wechte so weit hinausragte. Die Spur des Mannes war nicht fahrlässig, extranah am Abgrund, sondern geschätzt ca. drei Meter weiter hineingesetzt.
y Michael (ich, 64):
Die Frage, ob ich die Gefahr erkannt hätte, provoziert meinen Bergführerstolz: Selbstverständlich (!) hätte ich rechtzeitig – spätestens am Vorgipfel – erkannt, dass uns an dieser einen Stelle, auf wenigen Metern, der Grat mit einer hinterfotzigen Falle herausfordern will. Breit hätte ich allen erklärt, was zu tun ist: Ganz weit links bleiben, zumal Wechten überraschend weit innen brechen – wesentlich weiter, als es Hausverstand und Bauchgefühl erwarten lassen.


Der Pfeil markiert die Stelle, an der Christian die Skier ausgezogen hat (Bild links). Foto: Josef Rauch
Der Blick vom Gipfel zurück auf das letzte Gratstück und die Abbruchkante (Bild rechts). Foto: Michael Larcher

Michael Larcher, 63, wurde 2002 die Leitung der Abteilung Bergspor t im ÖAV übertragen. Sein Vorgänger, Robert Renzler, wurde Generalsekretär. Larcher ist Bergführer , Gerichtssachverst ändiger und Gründer von bergundsteigen (1992).

Bernhard von Menthon (auch: von Aosta), 1008 (?) bis 1081 (?), Patron der Alpenbewohner, Bergsteiger und Skifahrer (Reliquiar, 13. Jahrhundert, heute in der Schatzkammer des Hospizes der Augustiner-Chorherren auf der Passhöhe des Großen St. Bernhard).
Auch für ein wenig Alpingeschichte hätte ich den Anlass genützt: Damals, 1957, Hermann Buhl an der Chogolisa und in den 1930er-Jahren war es Willo Welzenbach, vulgo „Eispapst“, der in seiner Dissertation Statik und Bruchverhalten von Wechten erforschte.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt – so einfach ist das, wenn man Bergführer ist, staatlich geprüft.
Ganz ehrlich: Ich tendiere eher zu einem „Nein“: Gefahr nicht erkannt, der Spur nachgelatscht! Recht genau zu wissen glaube ich, was ich in diesen Stunden nicht optimal, sondern falsch gemacht habe:
y Ich ging ganz am Ende, fotografierte und ließ zu, dass unsere Gruppe auf eine Länge von 40, 50 Meter auseinandergezogen wurde. So hatte ich immer erst verspätet Einsicht in sich neu eröffnende Gratabschnitte. Dass die Gruppe am Vorgipfel zusammenwartet, war nicht ausgemacht!
y Auf die alpine Gefahr „Wechte“ gab es von mir keinen Hinweis an die Gruppe. Ein Ansprechen am Skidepot hätte bei allen die innere Einstellung aktiviert, die Augen offen zu halten.
y Die vorhandene Skispur und der optische Eindruck des ersten Gratstückes brachten mich vorschnell zu dem Urteil „einfach und sicher“. Dieses Urteil übertrug ich blitzschnell auf den gesamten Grat bis zum Gipfel, obwohl große Teile gar nicht einsehbar waren.
y Es war windstill, gemütlich, blauer Himmel, gute Stimmung, kein Zeitdruck – das alles schläferte mein Gefahrenbewusstsein ein. So kann ich mich nicht erinnern, dass mir der Gedanke „Wechte“ gekommen wäre. Ich glaube, das Wort „Wechte“ als Gedanke blitzte nie in meinem Kopf auf.
y Es war der erste Tourentag nach einer Bürowoche. War ich noch nicht richtig in der Natur angekommen, noch nicht ganz bei der Sache?
y Kein Fehler, aber ganz offensichtlich falsch war meine bisherige Annahme, dass Wechten genau dann brechen, wenn sie belastet werden. Nicht zeitverzögert oder fernausgelöst – wie z. B. ein Schneebrett bei einem Altschneeproblem. Wurde der Einzelgänger durch das Ausziehen der Skier und die größere Einsinktiefe zur „großen Zusatzbelastung“?
y Noch eine Erfahrung erstaunt mich: die Wirkung der Verschriftlichung, jetzt da ich diesen Beitrag für bergundsteigen schreibe. Wie viele Details mir erst jetzt bewusst werden, wie sehr das Schreiben das Erlebte vertieft und verarbeitbar macht. Könnten das zwei gute Tipps sein, um Lernen zu fördern: niederschreiben und reden mit allen, die dabei waren, offen und ohne Angst, Fehler zu entdecken und zu benennen.
Conclusio
O heiliger Bernhard von Menthon, bitte für uns. Bewahre uns vor Hochmut und Überheblichkeit. Lass uns immer in Respekt und Demut über Bergsportunfälle sprechen, niemals als Richter oder Klugscheißer. Möge unsere Neugier auf Unfallhergang und Unfallursachen allein dem Ziel dienen, etwas zu lernen und mich selbst und andere vor Schaden zu bewahren.
Dank an alle Beteiligten für ihre Offenheit und Bereitschaft, unser Erlebnis selbstkritisch zu reflektieren!
Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung des Österreichischen Alpenvereins ■
y Christian (57)
Wie hat Christian die Situation erlebt? Christian ist jener Einzelgänger, der mit den Skiern unterwegs war. Über mehrere Ecken konnten wir seinen Namen ausforschen und mit ihm in Kontakt treten. Christian ist ein Alpinist aus Sulden, der seine Berge kennt, wie seine Westentasche: „Skitouren mache ich seit mehr als 40 Jahren. Hab hier in Sulden eigentlich alles gemacht –268 Mal den Ortler über alle Routen, Königspitze von allen Seiten usw. Oft auch schwierigere Skitouren, wie Königspitz-Ostrinne, Ortler-Minigerode, Ortler-Schückrinne. Habe bereits zweimal die Zebru-Nordwand mit Skiern befahren und im Mai bin ich viel unterwegs Richtung Montblanc und Monte Rosa.“
Wie hast du den Wechtenbruch erlebt? Mir ist eigentlich erst richtig klar geworden, wie viel Glück ich hatte, als ich deinen Vortrag [Lawinenupdate 23/24; Anm. des Autors] gesehen habe. Ich habe diese Strecke sicherlich schon 50-mal gemacht, meistens fahre ich früher rechts weg und mache die Abfahrt durch diese Nordflanke, wo immer super Verhältnisse herrschen. Ich selber weiß natürlich sehr gut über die Wechte Bescheid, weil ich ja immer drunter durchfahre, deshalb bleibe ich ja auch immer sehr links davon. An diesem Tag wollte ich definitiv über das Schrötterhorn drüber und über den Nordgrat abfahren. Bin ganz normal links von der Wechte durchgegangen und musste dann die Skier ausziehen, weil es zu Fuß bes-
ser ging. Als ich knapp unter dem Gipfel war, hörte ich einen Ruck und sah, dass die Wechte ca. 20 m hinter mir in die Tiefe gebrochen ist.
Der Bruch passierte in dem Moment, als du die Skier ausgezogen hast und das erste Mal mit den Skischuhen in den Schnee reingetreten bist? Ich glaube tatsächlich, dass die Wechte in dem Moment abgebrochen ist, als ich die Skier ausgezogen habe, oder ganz kurz danach, als ich zu Fuß weiter gegangen bin.Und dann?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich eigentlich gar nicht erschreckt habe. Meine größte Sorge war, dass hoffentlich keiner in der Nordflanke mit Skiern unterwegs war. Der hätte definitiv keine Chance gehabt. Am Gipfel machte ich dann noch einige Fotos, kletterte hinten den Grat wieder ab und fuhr wieder abwärts.
War das „Risiko Wechtenbruch“ an diesem Tag in deinem Kopf präsent? Das Risiko Wechtenbruch war natürlich präsent, deshalb bin ich ja ziemlich links gegangen, ich denke sicher ca. fünf Meter links von der Kante. Aber anscheinend doch zwei Meter zu wenig.
Deine Spur war die erste am Grat, alte Spuren waren nicht sichtbar? Meine Spur war die erste. Ich bin eigentlich immer der, der diese Wand als Erster und am öftesten fährt.
Warst du mit Wechtenbruch schon einmal konfrontiert?
... Nein, direkt nie, mit Lawinen auch nicht direkt, oft aber durch meine Arbeit bei der Bergrettung.

Christian, am Beginn der Abfahrt, blickt zurück zum Schrötterhorn.
„Ich habe diese Strecke sicherlich schon 50-mal gemacht ...“
Foto: Archiv Christian
bergsönlichkeit Mensch, der beruflich oder ehrenamtlich mit Risiko im Bergsport in Verbindung steht.

Hillary und Norgay beim Anstieg in einer Höhe von etwa 8500 Metern einen Tag vor dem Gipfelerfolg. Foto: Royal Geographical Society
Kanchha Sherpa, der letzte noch lebende Teilnehmer der Expedition zur Erstbesteigung des Mount Everest, im Interview.
Von Nadine Regel
Am 29. Mai 1953 standen sie auf dem Gipfel des Mount Everest, das ungleiche Paar Edmund Hillary, ein 1,92 Meter großer Imker aus Neuseeland, und Tenzing Norgay, nepalesisch-indischer Bergsteiger, aufgewachsen am Fuße des Everest. Als die Erfolgsmeldung wenige Tage später in London eintraf, feierten sie dort gerade die Krönung von Elizabeth II. Die Besteigung des Everest war von nationaler Bedeutung, nachdem die Briten schon die Eroberung des Nordund Südpols verpasst hatten.
Zum 70. Jubiläum zeichnen wir die Ereignisse nach, lassen mit Kanchha Sherpa, dem letzten noch lebenden Mitglied dieser Expedition, einen Zeitzeugen zu Wort kommen. Wir beleuchten aber auch die Perspektiven von Tenzing Norgay und die des Expeditionsteams unter der Leitung von James Hunt. Kanchha Sherpa selbst stand nie auf dem mit 8848 Metern höchsten Berg der Welt, aber er bereitete zusammen mit vielen anderen Nepalesen den Weg dorthin. Heute betreibt der 91-Jährige mit seiner Familie in Namche Bazar, der wichtigsten Stadt im Khumbu-Tal, die Nirvana Home Lodge. Das Interview findet im Austausch von Sprachnachrichten statt, ein Telefongespräch ist aufgrund der schlechten Internetverbindung nicht möglich.

Kanchha Sherpa, der letzte noch lebende Expeditionsteilnehmer von 1953, in seinem Zuhause in Namche Bazar.

Die Journalistin Nadine Re gel reiste im letzten Jahr nach Nepal und trekkte zum Bas islager des Mount Everest, um die aktuellen und hist orischen Entwick lungen im Höhenbergsteigen nachzuempfinden.

Gruppenfoto Expedition 1953: Kanchha Sherpa ist der Zweite von rechts in der letzten Reihe sitzend.
Wie kam es dazu, dass Sie 1953 an der Everest-Expedition teilnahmen? Kanchha Sherpa: Ich hatte Tenzing Norgay das erste Mal 1952 in Namche Bazar gesehen. Er war mit einer Schweizer Expedition am Everest unterwegs. Tenzing war Ende 30 und lebte in Darjeeling im indischen Bundesstaat Sikkim. Er war wie ein König, genoss viel Ansehen. Ich war sehr beeindruckt von ihm, er war gut gekleidet und hatte Geld. Ich beschloss, zu ihm nach Indien zu gehen. Ich wollte für ihn arbeiten.
Tenzing wurde 1914 im Kharta-Tal in Tibet nordöstlich des Everest geboren und zog als Kind mit seiner Familie in das Khumbu-Gebiet in Nepal. Als Junge trieb Tenzing Yak-Herden hinauf zu den Almweiden in 5000 Metern Höhe. Er hörte Geschichten von Männern aus fremden Ländern, die versuchten, den Chomolungma, die Muttergöttin der Erde, wie die Sherpas und Tibeter den Berg nennen, zu besteigen. Das war in den Zwanzigern, als die Briten vergeblich versuchten, von der tibetischen Nordseite auf den Gipfel zu gelangen.
Die Einreise nach Nepal war damals verboten, das Königreich für Ausländer tabu. Zumal sich die Menschen im Tal wunderten, warum überhaupt jemand sein Leben riskierte, um auf den Chomolungma zu steigen. Vielen war gar nicht bewusst, dass dieser Berg, den sie als heilig ansahen, der höchste der Welt ist.
Tenzing Norgay wusste es, und in ihm wuchs ein Traum: Er wollte mehr sein als ein Träger der Sahibs, der weißen Herrschaften, er wollte eines Tages auf dem Gipfel des Everest stehen. Mit 18 zog Norgay nach Darjeeling, um sich dort für Expeditionen anheuern zu lassen, im Jahr 1935 war er das erste Mal auf einer Erkundungstour am Everest unter der Leitung von Eric Shipton dabei.
Wie gelangten Sie nach Indien? Kanchha Sherpa: Ein paar Monate vor der Expedition machten zwei Freunde und ich uns von Namche Bazar auf den Weg nach Darjeeling. Ich war 19 Jahre alt. Meine Freunde hatten etwas Geld dabei, ich besaß nichts. Ich stopfte mir nur ein paar Maiskör-
ner in die Taschen, damit ich unterwegs etwas zu essen hatte. Meinen Eltern sagte ich nicht, was ich vorhatte. Am Anfang drehten wir uns ständig um, um zu sehen, ob uns jemand folgte. Wir brauchten vier Tage, um über die Berge nach Indien zu gelangen.
Damit hatten Sie bewiesen, dass Sie in den Bergen gut zurechtkommen. Der Job bei Tenzing Norgay war Ihnen sicher?
Kanchha Sherpa: Na ja, so schnell ging das nicht. Aber ich hatte viel Glück. In Darjeeling trafen wir zufällig eine Frau aus unserem Tal in Nepal, die uns zu Tenzing führte. Er fragte uns nach den Namen unserer Väter. Meinen Vater kannte er und er gab mir sofort Arbeit. Meine Freunde mussten weiterziehen. Ich putzte das Haus, wusch Wäsche und sammelte Feuerholz. Tenzing war sehr zufrieden mit meiner Arbeit und er sah meine Ehrlichkeit und Loyalität. Nach etwa drei Monaten fragte er mich, ob ich mit zur Everest-Expedition kommen wolle. Ich war so glücklich.
1953 ist Tenzing Norgay bereits das siebte Mal am Mount Everest. Schon mit der Schweizer Expedition im Frühjahr 1952 gelangte er bis auf eine Höhe von 8600 Metern, der erste ernsthafte Versuch von der Südseite. Für James Hunt war Tenzings Erfahrungsschatz ein entscheidender Vorteil für den Erfolg der Expedition. 1953 arbeitet Norgay als Sirdar, er leitet die Träger und ist Verbindungsglied zwischen ihnen und den Briten. Die gesamte Expeditionsmannschaft trifft sich zu Beginn der Expedition in Kathmandu, die britische Botschaft hatte eingeladen. Die westlichen Bergsteiger bringt man im Gebäude unter, die Nepalesen schlafen in einem früheren Stall ohne Sanitäranlagen. Das führt zu Unmut, Tenzing Norgay setzt sich für seine Träger ein, kann aber nichts ausrichten. Aus Protest erleichtern sich die Träger am nächsten Morgen auf der Straße vor dem Haus.
Insgesamt schleppten mehr als 350 Träger 13 Tonnen Gepäck zum Basislager. Einige waren nur dafür abgestellt, Geldmünzen zu tragen. Eine Gruppe von Sherpas war auch in den Höhenlagern unterwegs, Sie gehörten dazu. Woran können Sie sich noch erinnern?
Kanchha Sherpa: Eigentlich an alles. Am wichtigsten war mir damals, dass ich einen Job hatte, Geld verdiente und gute Kleidung

Wenn wir einen Berg wie den Everest besteigen, machen wir eine spezielle Puja-Zeremonie und entschuldigen uns dafür, dass wir ihn betreten.
Nepalesische Träger schleppen Ausrüstung durch den gefährlichen Khumbu-Eisfall in höhere Lager.

Sonniges März-Wetter in Lager zwei. Im Hintergrund sieht man den 7161 Meter hohen Pumori durchblitzen.
bekam. Es war eine schwierige Zeit. Ich bekam acht Rupien pro Tag, die in Münzen ausgezahlt wurden. Gerechnet auf die etwa 90 Tage dauernde Expedition war das ein gutes Gehalt. Das war mehr, als ich in niedrigeren Lagen verdiente.
Wie lief die Arbeit am Berg ab?
Kanchha Sherpa: Am Everest zeigten mir die erfahreneren Sherpas, wie man mit Steigeisen geht und einen Eispickel benutzt. Der Eisfall war beängstigend, aber wir hatten Holzstämme dabei, um die großen Gletscherspalten zu überqueren. Wir hatten die Aufgabe, einen gangbaren Weg zu finden und ihn für die Nachsteigenden vorzubereiten. Im Schnitt trugen wir bestimmt 25 Kilogramm auf unseren Rücken. Sauerstoff nutzte ich aber nicht, obwohl sie mir welchen anboten. Zuvor hatte ich als Träger auf Trekkingtouren gearbeitet und hatte Erfahrung mit der Höhe.
Wie haben Sie damals Tenzing Norgay wahrgenommen?
Kanchha Sherpa: Er war ein guter Führer, ein starker Mann und er ging sehr gut mit seinen Arbeitern um. Ich erinnere mich,
dass wir im letzten Hochlager vor dem Südsattel sehr müde und erschöpft waren. Dann kam Tenzing zu uns, brachte uns Tee und Süßigkeiten und motivierte uns weiterzugehen. Er wärmte sogar unsere Füße mit seinen Händen, weil uns sehr kalt war. Am nächsten Tag gingen wir zum Südsattel auf 7900 Metern, errichteten das achte Hochlager und deponierten die Sauerstoffflaschen und das ganze Material dort. Dafür erhielten wir eine Prämie von 300 Rupien.
Das vorgeschobene Basislager errichten die Träger auf einer Höhe von 6400 Metern, von hier aus lenkt James Hunt seine Geschicke. Aus strategischen Gründen entscheidet der Brite, gleich zwei potenzielle Gipfelteams zu bestimmen: Zunächst sollen die Briten Charles Evans und Tom Bourdillon ihr Glück versuchen, sie scheitern aber am Südgipfel auf 8751 Metern. Um die Gipfelchancen von Team zwei, Hillary und Norgay, zu erhöhen, lässt Hunt ein neuntes Lager auf 8420 Metern errichten, damit die Männer nach ihrem Start am Südsattel auf 7900 Metern unterwegs noch mal Kräfte sammeln können.
Nur ein Zelt findet hier Platz, der Wind rüttelt an dessen Wänden, für Tenzing Norgay „der kälteste und einsamste Ort der Welt“, sie frieren, obwohl sie zur damaligen Zeit bestmöglich mit Bekleidung aus Wolle und Daunen ausgestattet waren. Um vier Uhr morgens öffnen sie das Zelt, am Gipfeltag erwartet sie bei minus 27 Grad und klarem Himmel ideales Wetter. Sie stapfen los, ihre Sauerstoffvorräte erlauben ihnen eine Versorgung von drei Litern die Minute, um 9 Uhr erreichen sie den Südgipfel, wenig später betreten sie den Gipfelgrat, auf dem sie festen Trittschnee vorfinden. Vom Gipfel trennt sie nur noch ein Hindernis, eine senkrechte, mehrere Meter hohe Felsstufe, die später nach Hillary benannt wird, der Hillary-Step. Um 11.30 Uhr stehen sie oben, Tenzing Norgay legt überschwänglich seinen Arm um Hillarys Schultern, klopft ihm freudig auf den Rücken. Nun liegt alles unter ihnen, das Tal, in dem Tenzing aufgewachsen ist, die beiden wichtigsten Klöster seines Volkes, links Tengboche in Nepal und rechts Rongbuk in Tibet, die Almen, von denen er hinaufgeblickt hat zu seinem Traumberg, dem Chomolungma. Er hat sein Ziel erreicht. Edmund Hillary macht ein Gipfelfoto von seinem Kletterpartner, Tenzing hält seinen Eispickel in die Luft. Wer zuerst am Gipfel stand? Das zählt für die beiden in diesem Moment und auch später nicht.
Das Erreichen des Gipfels war für Tenzing Norgay keine „Eroberung“, wie es die Briten formulierten, sondern eine Pilgerreise: „Ich habe das Gefühl, auf den Gipfel zu klettern und dem Buddha-Gott näherzukommen“, sagte er nach der Besteigung. Als er den Gipfel erreichte, sprach Norgay ein Gebet, brachte eine Opfergabe dar und brachte Flaggen an. Ein weiteres Mal wollte er aber nicht nach oben.
Wie haben Sie den Gipfeltag erlebt?
Kanchha Sherpa: Ich befand mich im Lager zwei. Es gab kein Funkgerät, also haben wir gewartet und gewartet. Als sie herunterkamen, haben sich alle umarmt und gejubelt. Dann war die Expedition vorbei und wir sind abgestiegen. Woran ich mich noch erinnere, sind die Mengen an Lebensmitteln, die die Expedition einfach auf dem Berg zurückließ, Kekse, Dosenfleisch, Tee und Süßigkeiten.
Wie denken Sie jetzt an die Expedition zurück?
Kanchha Sherpa: Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, diese Expedition durchzuziehen. Es war ein magisches Ereignis, das ich nicht erklären kann. Wir Sherpas haben entscheidend zum Erfolg beigetragen, weil wir den Weg bereitet haben. Aber ich frage mich immer noch, wie Hillary und Tenzing den Rest des Weges bis zum Gipfel geschafft haben. Für mich sah es vom Südsattel, wo ich zuletzt gestanden hatte, unmöglich aus.
Hillary erhielt 1995 die höchste Auszeichnung des britischen Commonwealth, den Ritterorden, während Norgay mit der George-Medaille, der zweithöchsten zivilen Auszeichnung, honoriert wurde. Der damalige indische Premierminister Jawaharlal Nehru ernannte Tenzing Norgay zum Direktor des neu eingerichteten Himalayan Mountaineering Institute in Darjeeling, wo er bis 1976 als Ausbilder tätig war.
Gingen Sie danach noch auf Expeditionen?
Kanchha Sherpa: Ja, ich arbeitete noch 20 Jahre lang mit amerikanischen, schweizerischen und indischen Expeditionen, aber ich hatte nie die Erlaubnis, auf den Gipfel zu gehen. Das durften nur die Kunden und die Guides. Meine Frau wollte nie, dass ich an den hohen Bergen arbeite, weil sie Angst um mich hatte. Viele meiner Freunde sind in den Bergen gestorben. Von 1973 an habe ich dann auf Trekkingtouren gearbeitet. Ich konnte weder lesen noch schreiben, deswegen musste ich unterwegs mit Perlen rechnen. Notizen hat jemand anderes für mich gemacht. Dann eröffneten wir eine Lodge in Namche Bazar. Keines meiner vier Kinder und acht Enkelkinder musste je in den Bergen arbeiten. Ich schätze, das gilt auch für meine Urenkelin.
Welche Veränderungen haben Sie im Khumbu-Tal seit 1953 festgestellt?
Kanchha Sherpa: Seit der ersten erfolgreichen Everest-Besteigung boomt der Tourismus bei uns, die Menschen haben Arbeit gefunden und selbst Lodges und Trekkingagenturen eröffnet. Erst dieses Jahr haben wir eine Rekordsaison erlebt. Grundsätzlich sind wir dankbar, dass die Expedition so viel Aufmerksamkeit in unser Tal gebracht hat. Hillary hat viel Gutes getan, hat Schu-
Ein Expeditionsmitglied schaut durch die Filmkamera des Chefkameramanns Tom Stobart in Lager vier.


Heute überwindet man Spalten im Khumbu-Eisfall mit Leitern, damals noch mit schweren Baumstämmen.
len und Krankenhäuser bauen lassen. Was das Klima angeht, so ist es in den letzten Jahren definitiv wärmer geworden. Es schneit weniger und nicht mehr rechtzeitig, und selbst wenn es schneit, schmilzt der Schnee sehr schnell. Der Hubschraubertransport nimmt auch von Jahr zu Jahr zu. Und es gibt immer mehr Leute, die Gipfel wie Briefmarken sammeln.
Sie sagten einmal, dass der Tourismus gut für die Sherpas sei, aber nicht für die Götter. Was meinten Sie damit? Kanchha Sherpa: In der Sherpa-Kultur respektieren wir die Berge als Götter. Wenn wir einen Berg wie den Everest besteigen, machen wir eine spezielle Puja-Zeremonie und entschuldigen uns dafür, dass wir ihn betreten. Durch den zunehmenden Tourismus wird viel Müll auf den Bergen hinterlassen, das ist eine Respektlosigkeit gegenüber den Berggöttern. Das macht sie zornig. Und wenn die Götter zornig sind, kommt es in den Bergen zu Katastrophen.
Nepal tat sich lange schwer damit, Tenzing Norgays Entscheidung anzuerkennen, nach seinem Erfolg wieder zurück nach Indien zu gehen. Bereits seit 1932 lebte Tenzing ununterbrochen in Darjeeling. Zum 25. Everest-Jubiläum 1978 kehrte er zu Feierlichkeiten vorübergehend zurück nach Nepal. Ob er seine Entscheidung damals bereut hat, Nepal den Rücken zu kehren? Ein Freund sagte jedenfalls: „Tenzing hätte in Nepal ein König werden können.“ Der Trauerzug nach seinem Tod 1986 war mehr als einen Kilometer lang.
Edmund Hillary bezeichnete Tenzing in einem Interview als „eine charmante, eher ruhige Person, jemanden, der zuhören konnte, der nicht dogmatisch war, eine fast zurückhaltende Persönlichkeit, die nicht zu dem großen Bergsteiger zu passen schien, der er offensichtlich geworden war“. Die beiden verband eine lebenslange Freundschaft. ■

Abseits vom Trubel der großen Tourismuszentren liegen meist ein wenig versteckt die Bergsteigerdörfer der Alpenvereine. Das Prädikat Bergsteigerdörfer wird selektiv vergeben und steht für eine sanfte Art von Tourismus. Von Genusswanderungen bis schwerer Alpinkletterei, von Schneeschuhtour bis Eisklettern: die Bergsteigerdörfer bieten naturnahen Bergsport in allen Facetten vor atemberaubender Kulisse!
Als Leuchtturmprojekt sind die Bergsteigerdörfer über Partnerschaften der Alpinen Vereine in Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und in der Schweiz vertreten. Egal ob privat, mit Gästen oder Ihrer Sektion – hier finden Sie Ihre Destination in den Alpen. Unsere Gastgeberinnen und Gastgeber freuen sich auf Sie! www.bergsteigerdoerfer.org
Balme · Crissolo · Dovje-Mojstrana · Ginzling im Zillertal · Göriach · Großes Walsertal · Grünau im Almtal · Gschnitztal · Hüttschlag im Großarltal · Jezersko · Johnsbach im Gesäuse · Kreuth · Lavin, Guarda & Ardez · Lesachtal · Luče · Lungiarü · Lunz am See · Mallnitz · Malta · Matsch · Mauthen · Paularo · Ramsau bei Berchtesgaden · Region Sellraintal · Sachrang - Schleching · St. Antönien · St. Jodok, Schmirn- & Valsertal · Steinbach am Attersee · Steinberg am Rofan · Steirische Krakau · Tiroler Gailtal · Triora · Val di Zoldo · Valle di Lozio · Valle Onsernone · Vent im Ötztal · Villgratental · Weißbach bei Lofer · Zell-Sele

 Sportklettern im Bergsteigerdorf Ginzling
Sportklettern im Bergsteigerdorf Ginzling




Das Eigentor des Eskapismus Nicht alles, was Menschen leidenschaftlich gerne und oft tun, ist eine Sucht. Wo verlaufen die Grenzen zwischen Leidenschaft und Sucht?
Wenn Berglust zur Bergsucht wird Kann Bergsport krankhafte Ausmaße annehmen? Diese Frage hat sich Leonie Habelt in ihrer Dissertation auf dem Fachgebiet Psychiatrie gestellt.
Die Bohr-Maschinen Macht das Einbohren von Klettertouren „süchtig“ im positiven Sinne? Die fünf portraitierten Routenerschließer sagen eindeutig: „Ja!“
„Ich habe das nie so wahnsinnig ernst betrieben“ Richard Obendorfer schaffte zwischen 2021 und 2023 pro Jahr rekordverdächtige eine Million Höhenmeter. Ist der Mann süchtig?
Hungern zum Erfolg Geringes Gewicht ist beim Klettern ein Baustein des Erfolgs. Doch das Streben nach Leichtigkeit kann irgendwann zur Sucht werden: Essstörungen im Klettersport.
Kilian Fischhuber beim Bouldern in Zimbabwe.
Foto: Heiko Wilhelm

Nicht alles, was Menschen leidenschaftlich gerne und oft tun, ist eine Sucht. Individuelle ebenso wie soziale Konstellationen können aber zur Abhängigkeit von Verhaltensmustern führen. Sich dessen bewusst zu sein, ist die beste Voraussetzung, Suchtgefahren erkennen und entgehen zu können.
Von Tom Dauer
„Fußball ist eine Droge, hört man immer wieder. Ich sage: Fußball ist eine Passion, eine Leidenschaft. Ich bin nicht abhängig vom Fußball.
Aber: Ich liebe den Fußball.“ Franz Beckenbauer
Zwei Buchstaben unterscheiden die „Sucht“ von der „Suche“. Etymologisch besteht zwischen den beiden Begriffen kein Zusammenhang, denn die „Sucht“ hat ihren Ursprung im althochdeutschen „Suht“, das so viel wie Krankheit, Siechtum und Seuche meinte und dessen Bedeutung sich bis in die Neuzeit in Bezeichnungen wie Gelbsucht, Fallsucht oder Schwindsucht spiegelt. Betrachtet man den Zusammenhang dagegen inhaltlich, kann die Suche, das „Suohhen“, also das FindenWollen, Verlangen und Erstreben durchaus in einen Zustand führen, in dem man alles andere um sich herum vergisst, begierig, vielleicht auch gierig wird und die Suche nach in die Sucht nach etwas mündet. Wie ist das also am Berg, wo alle zu suchen scheinen: sich selbst, die Freiheit, das Glück, manchmal auch nur den richtigen Weg? Kann diese Suche zur Sucht werden, und welche Formen nähme diese dann an? Ist es gerechtfertigt, wenn man das, was einen in die Berge treibt, als „Sucht“ bezeichnet? Und das Bergsteigen als „Droge“?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterscheidet in der International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) zwischen substanzgebundenen und -ungebundenen Suchterkrankungen. Bei ersteren handelt es sich per Definition um einen „Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge“. Welche Kriterien erfüllt sein müssen, um von Abhängigkeit zu sprechen, ist unter Medizinern allerdings umstritten. Der kleinste gemeinsame Nenner für die Diagnose einer behandlungsbedürftigen Suchterkrankung besteht darin, dass Betroffene Dinge tun, die für ihre Gesundheit sowie ihr soziales und berufliches Umfeld schädlich sind. Ebenso weich ist die Unterscheidung zwischen psychischer und physischer Abhängigkeit, denn letztlich finden die zugrundeliegenden Prozesse – molekulare Veränderungen einerseits, körperliche Entzugssymptome andererseits – auch alle im Gehirn statt. Noch etwas schwieriger wird die Diagnose bei substanzungebundenen, also Verhaltenssüchten. Die WHO erkennt Glücksspielsucht und seit 2019 auch „gaming disorder“ (Computerspielsucht) als psychische Störung an. Betroffene schaffen es trotz negativer seelischer, körperlicher, finanzieller und sozialer Folgen nicht,
aus Verhaltensmustern auszubrechen. Andere, von Medizinern und Suchtforschern beschriebene Verhaltenssüchte werden von der WHO nicht gelistet. Darunter fallen zum Beispiel Kauf-, Sex- oder Sportsucht – also das exzessive oder pathologische Sporttreiben –, zu der man auch die „Bergsucht“ zählen könnte (siehe dazu den Beitrag „Wenn Berglust zur Bergsucht wird“, S. 92–97).
Es ist kein Zufall, dass der Großteil aller (populär-)wissenschaftlichen und journalistischen Beiträge zum Thema Sucht, so auch dieser, mit dem Versuch einer Definition derselben beginnen. Der US-amerikanische Psychologe Bruce Alexander, der auf eine vier Jahrzehnte lange Forschungsarbeit zurückblickt, schreibt in seinem Aufsatz „My Final Academic Article on Addiction“1: „Keine der zahllosen, oft widersprüchlichen Definitionen (…) kann schlüssig bewiesen oder widerlegt werden. Im Laufe der Zeit generieren wir mehr Daten (…), aber wir haben diese hauptsächlich dazu benutzt, uns mehr als ein Jahrhundert lang mit denselben unlösbaren Problemen herumzuschlagen.“ Alexanders Ansicht nach ist die Crux, dass sich die Suchtforschung zu lange und ausschließlich auf die neurobiologischen Aspekte konzentriert und dabei soziopsychologische außer Acht gelassen habe. Das Brain Disease Model of Addiction (BDMA) habe den „Mythos der Dämonendroge“ entstehen lassen, der bis heute glauben mache, „dass das wesentliche Problem der einzelne Drogenabhängige ist“, dem die Fähigkeit abgesprochen werde, „einem chronischen, unangepassten Drogenkonsum zu widerstehen“. Sucht aber „ist keine individuelle Schwäche, kein genetischer Mangel, keine psychologische oder körperliche Fehlfunktion. Man kann Sucht nur als soziales Phänomen verstehen.“
Tatsächlich scheint sich die Suchtforschung aktuell in zwei Fraktionen zu gliedern, wobei es zwischen diesen überlappende Ansichten gibt. Die eine Seite betrachtet Suchtverhalten vornehmlich aus neurowissenschaftlicher, deterministischer Perspektive und sieht den Einzelnen seinen körpereigenen, unwillentlichen Prozessen hilflos ausgesetzt. Die andere Seite argumentiert kulturkritisch und sieht gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungen als hauptursächlich für Suchtproblematik und Drogenmissbrauch an. Vermutlich liegt Verhaltenssüchten, bei denen keine stoffliche Substanz im Spiel ist, ein komplexer Ursachenmix zugrunde.

Tom Dauer ist Buchautor und Filmemacher. Er ist nicht bergsüchtig , aber der Berge bedürftig.

Belohnungsvorhersagefehler
Tatsächlich gibt es zwischen substanzgebundenen und -ungebundenen Süchten neurobiologische Gemeinsamkeiten; in beiden Fällen gerät der Neurotransmitterhaushalt ins Ungleichgewicht. Gehirnareale, die Einfluss auf das Suchtverhalten haben, verändern sich bei Drogensüchtigen auf ähnliche Art und Weise wie bei Menschen, die von Sportwetten oder dem Koop-Survival-Spiel „Fortnite“ abhängig sind. Hier wie dort spielt das Belohnungssystem des Gehirns –verschiedene Strukturen, die über Nervenbahnen miteinander in Verbindung stehen – eine entscheidende Rolle. Dieser neuronale Schaltkreis ist evolutionär von großer Bedeutung, denn er treibt die Menschen an, die eigene Art zu erhalten und weiterzuentwickeln. Basale Vorgänge wie Nahrungsaufnahme und Geschlechtsverkehr, aber auch spielerisches und sportliches Verhalten werden sowohl durch Vorfreude angeregt als auch durch anschließende Glücksgefühle belohnt. Schließlich sollen sie zum Zwecke des Überlebens möglichst oft stattfinden. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Neurotransmitter Dopamin, der am Anfang der Belohnungskaskade steht, während für das Wohlbefinden nach dem Essen, dem Sex oder der Bergtour andere Stoffe wie etwa Endorphine sorgen.
„Ein Hormon regiert die Welt – Wie Dopamin unser Verhalten steuert und das Schicksal der Menschheit bestimmt“2 lautet der etwas reißerische Titel eines Buches, in dem Daniel Z. Lieberman, Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der George Washington University in Washington, D. C., den Botenstoff als Schuldigen dafür entlar vt, dass wir von manchen Dingen und Zuständen „immer mehr“ wollen. Entgegen der landläufigen Vorstellung ist es nämlich nicht richtig, Dopamin als „Glückshormon“ (8b+, Markus Haid, Niederthai) zu bezeichnen. Treffender wäre laut Lieberman, den Botenstoff „Molekül der Erwartung, Besessenheit und Sehnsucht“ zu nennen. Will man der Frage auf den Grund gehen, ob sich neurobiologisch ausgelöste Belohnungs- und Glücksgefühle auch in den Bergen einstellen können, lohnt es womöglich, ein entsprechendes Szenario durchzuspielen. An dessen Anfang könnte der intensive Wunsch stehen, ebenjene „Glückshormon“ rotpunkt zu klettern: 15 hammerharte, technisch anspruchsvolle Meter an einem überhängenden Granitblock am Ötztaler Tauferberg. Allein die Vorstellung,
diese Herausforderung zu bewältigen, schüttet Dopamin aus, das mesocortikolimbische dopaminerge System springt an. Lieberman nennt es das „System des Verlangens“, das die „Jagd nach Befriedigung“ in Gang setze und dabei Energie, Begeisterung und Hoffnung auslöse.
Nehmen wir an, die Begehung gelingt bereits nach wenigen Versuchen oder gar onsight (wobei dies wohl nur einem auserwählten Kreis an Kletterern vorbehalten wäre): Der sogenannte Belohnungsvorhersagefehler (reward prediction error) wird wirksam und die Freude darüber, wider Erwarten etwas geschafft zu haben, kurbelt die Dopaminausschüttung weiter an. Weil sich das gut anfühlt, jagen manche Menschen diesem Zustand ein Leben lang nach. Dopamin sorgt damit für ewige Unruhe. Nicht ausgeschlossen ist, dass der Kletterer während des Ablassens, beim Abklatschen mit dem Sichernden, in den Momenten nach dem Erfolg tatsächlich auch das Hier und Jetzt genießt. Für dieses Wohlgefühl, für die Momente der Entspannung, des Zufriedenseins sorgt im vielfältigen Cocktail der Neurotransmitter vor allem der Botenstoff Endorphin. Leider jedoch ist der Zustand der Glückseligkeit meist nur von kurzer Dauer. Wenn eine Erwartung erfüllt, ein Wunsch zur Realität wurde, wenn der Gipfel erreicht, die Route durchstiegen, das Projekt geklettert, die Steilabfahrt gemeistert wurde, steht meist schon die Frage nach der nächsten Herausforderung im Raum. Das „System des Verlangens“ hält sein Versprechen auf Befriedigung nicht ein, weil die Hier-undJetzt-Erfahrung die von Dopamin ausgelöste Erregung nicht kompensieren kann.
Womöglich verhalten sich manche Bergsteiger aus diesem Grund so, als wären sie von irgendeiner unbekannten Macht getrieben. Statt das zu genießen, was sie erreicht haben, streben sie nach dem, was sie vermeintlich genießen können werden. Das aber ist vergeblich, denn Dopamin ist nie zufrieden. Fällt eine erwartete Belohnung aus, weil das Ziel nicht oder mühelos erreicht wurde, bleibt sein System inaktiv. Die Folge sind Gereiztheit, schlechte Laune und Zorn. „Stimuliert man das Dopamin aber zu heftig und über einen zu langen Zeitraum hinweg“, schreibt Lieberman, „entwickelt es eine unbändige Kraft. Hat es einmal die Zügel in die Hand genommen, ist es nur noch schwer zu zähmen.“ So wird die Suche nach dem nächsten Kick immerwährend.

Dass man dabei auch Lust an etwas empfinden kann, was offensichtlich unlustig ist – brüchiger Fels, Spindrift, Eiseskälte, Notbiwak, niedriger Sauerstoffpartialdruck –, ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Über stoffliche Drogen schreibt Lieberman: „Unser Verlangen kann uns dazu bringen, Dinge zu tun, die unser Leben zerstören können.“ Im übertragenen Sinne gilt das auch für das Bergsteigen. Steinschlag, Lawinen, Spaltensturz, Erschöpfung oder die latente Gefahr, irgendeinen Fehler zu machen: Im schlimmsten Fall kann ein Unfall in den Bergen tödlich enden, und dennoch nehmen wir dieses Risiko in Kauf, weil die Befriedigung eines Verlangens neues Verlangen entstehen lässt. Ein Süchtiger, folgert Lieberman, gleicht „einem Mann, der den ganzen Tag einen schweren Stein mit sich herumschleppt, weil es so angenehm ist, ihn abzusetzen“. Albert Camus’ glücklicher Sisyphos lässt grüßen.
Der Nobelpreisträger für Physik Didier Queloz, der an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich das „Zentrum für den Ursprung und die Verbreitung von Leben“ leitet, ist davon überzeugt, dass alles Leben „letztlich nichts als ein chemischer Prozess ist“. Natürlich vermag der Astronom mit dieser steilen These nicht die Fragen danach zu lösen, was Bewusstsein ist, ob es einen freien Willen gibt oder wie sich Körper und Geist zueinander verhalten. Doch selbst wenn man die Theorie von der Vorbestimmtheit menschlicher Handlungen durch unveränderliche Naturgesetze für eine grobe Vereinfachung hält, lässt es sich nicht von der Hand weisen, dass die körpereigene Chemie eine große Rolle in unserem Denken und Tun spielt. Und mitverantwortlich dafür ist, wenn eine Suche zur Sucht wird.
Fatal ist, dass eine Sucht auch nicht durch noch so starke Willenskraft allein zu bewältigen ist. Zwar hat der Weg in die Abhängigkeit stets mit einem Verlust von Kontrolle zu tun, dabei können aber alle möglichen Faktoren eine Rolle spielen. So kann eine Verhaltenssucht zum Beispiel entstehen, wenn die Verarbeitungsstrategie nach Erleiden eines Traumas aus dem Ruder läuft. Ebenso lässt sich beobachten, dass Hochrisikoverhalten dem Versuch geschuldet ist, psychische Probleme mit intensiven Emotionen zu betäuben. Es geht dann darum,
die Traurigkeit, den Schmerz, die Angst, das Elend, das man spürt, erträglicher zu machen. Eine Strategie, die kippt, wenn die Suche nach Heilung zur Sucht ohne Heilung wird. Unter depressiven Störungen leidende Männer sind dabei besonders gefährdet: Neben dem Abstreiten von Problemen, sozialem Rückzug, Ablehnung von Hilfe, zunehmender Aggressivität und Feindseligkeit drückt sich ihr Krankheitsbild häufig in einem gesteigerten Sucht- und Risikoverhalten aus (siehe zu dieser Thematik auch das Interview mit Jorg Verhoeven, in dem der Alpinist und Sportkletterer offen über seine als „Anpassungsstörung“ diagnostizierte Depression spricht: „Social Media ist ein Roman“, bergundsteigen #120, Herbst 2022, S. 104–109).
Der limbische Kapitalismus
Sucht und Abhängigkeit werden in unserer Gesellschaft gemeinhin als individuelle Probleme betrachtet. Wer süchtig ist, trägt selbst Schuld, und wer sich nicht aus der Umklammerung seiner Sucht befreien kann, gilt als schwach, willenlos und leicht zu verleiten. Tatsächlich spiegelt sich in dieser Sichtweise ein Weltbild wider, das das Individuum zum sprichwörtlichen Schmied seines Glücks respektive Unglücks erklärt und dabei außer Acht lässt, dass auch ein freier Geist in historische, gesellschaftliche, politische, familiäre und sonstige Strukturen verstrickt ist. Rahel Jaeggi, Professorin für Praktische Philosophie an der Berliner Humboldt-Universität, drückt dieses Verhältnis so aus: „Bedürfnisse sind immer schon gesellschaftlich vermittelt. Es gibt kein Bedürfnis, das nicht durchdrungen wäre von Gesellschaftlichkeit.“
Ersetzt man das Wort „Bedürfnis“ durch „Sucht“, wird die Perspektive einer Reihe von Wissenschaftlern verständlich, die Sucht als Systemeigenschaft des Kapitalismus betrachten und damit das Private in die gesellschaftliche Auseinandersetzung holen. So vertritt der eingangs zitierte Suchtforscher Bruce Alexander in seinem 2010 erschienenen Werk „The Globalization of Addiction“3 die These, dass Erklärungsversuche, die sich auf Gehirnfunktionen einerseits, auf den Aspekt der Traumabewältigung andererseits stützen, soziale Aspekte vernachlässigen. Er sieht die zentrale Ursache des Suchtproblems in „dislocation“, also in Entwurzelung und Entfremdung
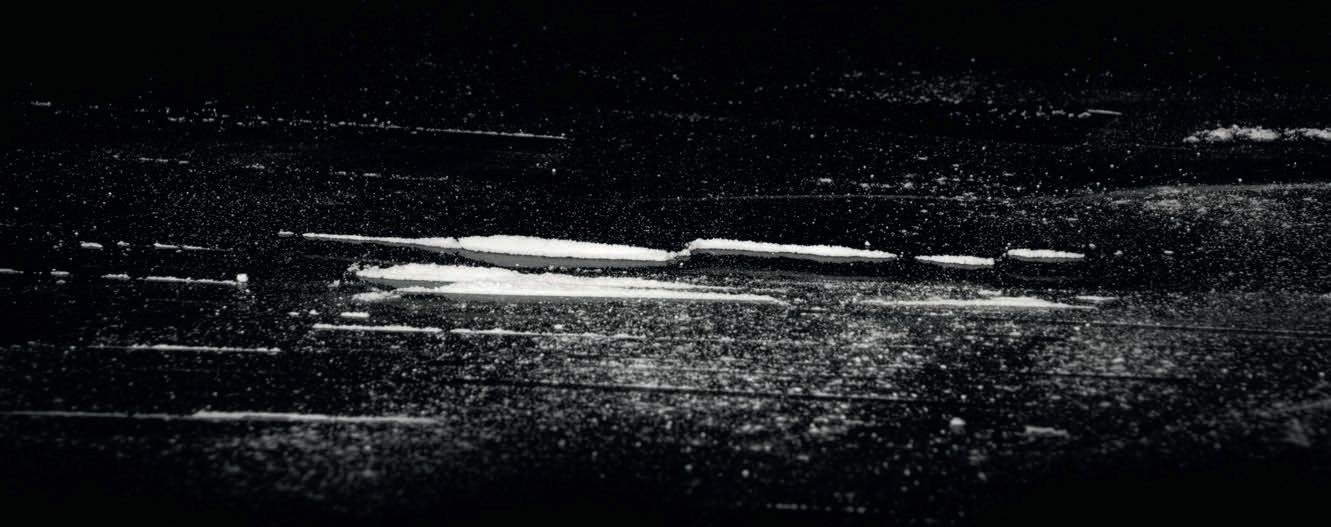
aufgrund sozialer Umwälzungen, die der „Turbokapitalismus“ mit sich bringe. Bruce Alexander: „Selbst die gefährlichsten Formen der Sucht werden am besten nicht als maladaptive Krankheiten, Störungen, Verhaltensweisen oder Entscheidungen verstanden, sondern als verzweifelte (…) Versuche, sich an unerträgliche Lebenssituationen in einer chaotischen und fragmentierten Gesellschaft anzupassen. Die Ursache der Sucht liegt nicht in Suchtmitteln oder in rücksichtslosem Hedonismus, sondern im tragischen Versagen der modernen Gesellschaft, einige der tiefsten menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, und in den verzweifelten Maßnahmen, mit denen die Menschen versuchen, ihre unerfüllten Bedürfnisse zu kompensieren.“4
In dieselbe Kerbe schlägt der US-amerikanische Historiker David Courtwright, der 2019 das „Zeitalter der Sucht“5 beschrieb und ihm „limbischen Kapitalismus“6 diagnostizierte. Dieser ziele mit seinen erfolgreichen Geschäftsmodellen – insbesondere dem Verkauf der legalen Drogen Alkohol und Nikotin – direkt auf das Belohnungssystem des Menschen. Wie inzwischen vielfach beschrieben, machen sich auch soziale Medien diesen Schaltkreis zunutze, indem sie optische und akustische Reize in Form leicht konsumierbarer Häppchen und Belohnung in Form schnell verteilter Herzchen servieren.Interessant wäre in diesem Zusammenhang zu untersuchen, welche Player im ökonomischen System Outdoorsport vom Reiz-Reaktionsmuster des limbischen Kapitalismus profitieren. So ist sich die Werbeindustrie durchaus bewusst, dass der Suchtbegriff eine gewisse Attraktivität entfalten kann. Süchtig zu sein nach Bergen, Reisen, Aben-teuern, Kalk oder Granit, Neuschnee und frischer Luft bekommt in entsprechender Verpackung einen positiven Beiklang. Dies machen sich Ausrüstungshersteller und Tourismusdestinationen ebenso zunutze wie Medien und Verlage, die die „Sucht nach …“ gedankenlos in Überschriften und Buchtitel7 packen.
Am anderen Ende der Skala stehen dagegen jene Menschen, die das von einer ganzen Industrie mantrahaft wiederholte Versprechen auf individuelle Glückserfahrung in den Bergen suchen und dabei nicht merken, dass sie mit einem zwanghaften Drang zur Leistungssteigerung und Selbstoptimierung genau jenes System aufrechterhalten, dem sie eigentlich
entfliehen wollen. Indem er den Spielregeln des Kapitalismus folgt, schießt sich der Eskapismus ein Eigentor. Manifest wird dies in verschiedenen Formen, in denen Bergsteiger nach Aufmerksamkeit heischen, der wichtigsten Währung des 21. Jahrhunderts. Stets betonend, dass man nur für sich selbst auf Berge steige, konterkariert man diese Aussage, indem man über sein Tun auf Instagram postet, Bücher schreibt, sich von Filmteams begleiten lässt und Vorträge hält.
Zwischen der Suche nach Anerkennung und der Sucht nach Geltung verläuft ein schmaler Grat. Womit wir wieder bei Bruce Alexander wären, für den Suchtverhalten die Folge einer „inneren Leere“ ist: „Haltlose Menschen müssen nach etwas greifen, das größer ist als sie selbst, um ihrem Leben eine Bedeutung, einen Sinn zu verleihen.“8 Bergsucht könnte demnach der Versuch sein, den eigentlichen Problemen des Daseins kurzzeitig zu entkommen. Ein derartiges Verhalten ist laut Alexander in milder Form sogar notwendig, weil solche Bewältigungsstrategien die Gesellschaft zusammenhielten: Bergsteigen als individuelle Praxis der Sinnsuche, die gleichzeitig das Gefühl vermittelt, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Vermutlich geht es auch beim Bergsteigen darum, zwischen Neurotransmittergewittern, der eigenen Lebensgeschichte, individuellen Wünschen und Träumen sowie gesellschaftlichen An- und Überforderungen das richtige Maß zu finden, damit eine bereichernde Suche nicht zur selbstzerstörerischen Sucht wird. Freilich liegt dieses Maß bei jedem Menschen woanders. Wer gerade so stark entwurzelt oder, positiv formuliert, wer gerade so frei ist, dass er die Lust und Kraft verspürt, sich in den Bergen zu entfalten, wird vielleicht bergbegierig, aber nicht bergsüchtig werden. Wer dagegen ständig das Gefühl hat, in die Berge zu müssen, sollte sich vielleicht fragen, ob es ihm nicht an anderen Lebensinhalten mangelt. Bruce Alexander: „Menschen, denen es nicht gelingt, die Art von Sucht zu entwickeln, die uns ganz macht und die Zugehörigkeit zu unserer Gesellschaft schafft, können sich in ihrer Verzweiflung nur anpassen, indem sie alternative Formen der Sucht kultivieren, die gefährlich und gesellschaftlich inakzeptabel sind. Liegt der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung schädlicher in der Kultivierung gesunder Süchte?“9 Und könnte die Bergsucht in milder Form tatsächlich gut für uns sein?
„Wer
gerade so stark entwurzelt oder, positiv formuliert, wer gerade so frei ist, dass er die Lust und Kraft verspürt, sich in den Bergen zu entfalten, wird vielleicht bergbegierig, aber nicht bergsüchtig werden.“
„Eine Pädagogik, die Risiko reflexartig bekämpft, hilft uns nicht weiter“, schreibt Gerald Koller10, der das Konzept der Rausch- und Risikopädagogik entwickelte und unter dem Label „riscflecting“ international etablierte. Dabei geht es darum, das jungen Menschen eigene Bedürfnis nach Rauschzuständen und Risikosituationen als Entwicklungspotenzial zu erkennen und ihnen die Werkzeuge für einen entsprechenden Umgang damit in die Hand zu geben. Kollers Ansatz wird in pädagogischen Einrichtungen, im Dienst der Sucht- und Gewaltprävention sowie in der Jugendausbildung des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) angewandt.
Grundlage des Konzepts „risflecting“ – eine Wortneubildung aus risk und reflecting – ist, Rausch und Risiko wertfrei als menschliches Bedürfnis zu betrachten. Um derartige Situationen, die uns nicht nur, aber auch in den Bergen begegnen, meistern zu können, benötige man keine Vermeidungs-, sondern Optimierungsstrategien. Dafür müssen persönliche Kompetenzen gestärkt, der Rahmen für eine offene Kommunikation geschaffen sowie eine Gesprächskultur zum Thema etabliert werden. Statt Rauschund Risikosituationen zu tabuisieren, sollten sie für den Alltag und die Lebenswelt genutzt werden.
Vor allem – aber nicht nur – Jugendliche benötigen dazu Möglichkeiten zur Vor- und Nachbereitung entsprechender Erfahrungen. Die Entwicklung stabiler sozialer Netze, die Fähigkeit und das Selbstvertrauen, mündige Entscheidungen zu treffen, sowie die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Geschehen(d)en sind für Koller die wichtigsten Handlungsressourcen – durch „risflecting“ sollen sie gestärkt werden.
1 Bruce Alexander, My Final Academic Article on Addiction, veröffentlicht auf www.brucekalexander.com, abgerufen am 15. Januar 2024
2 Daniel Z. Lieberman. The Molecule of More. How a Single Chemical in Your Brain Drives Love, Sex, and Creativity – and Will Determine the Fate of the Human Race. BenBella Books, 2018. Der englische Originaltitel ist aussagekräftiger.
3 Bruce K. Alexander. The Globalization of Addiction: A Study in Poverty of the Spirit. Oxford University Press, 2010
4 Bruce Alexander, My Final Academic Article on Addiction, veröffentlicht auf www.brucekalexander.com, abgerufen am 15. Januar 2024
5 David Courtwright. The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business. Belknap Press, 2019
6 Am limbischen System sind verschiedene Gehirnstrukturen beteiligt, die funktional miteinander in Verbindung stehen und u.a. Emotionen verarbeiten und Gedächtnisprozesse steuern.
7 Hans Kammerlander. Bergsüchtig: Klettern und Abfahren in der Todeszone. Piper Verlag, 2009. Trotz allem lesenswert.
8 Bruce Alexander, My Final Academic Article on Addiction, veröffentlicht auf www.brucekalexander.com, abgerufen am 15. Januar 2024
9 Bruce Alexander, My Final Academic Article on Addiction, veröffentl-icht auf www.brucekalexander.com, abgerufen am 15. Januar 2024
10 Gerald Koller, … Und führe uns in der Versuchung“, veröffentlicht unter https://www.berlin-suchtpraevention.de/wp-content/uploads/2016/12/Vortrag1_Koller.pdf, abgerufen am 15. Januar 2024
Fotos: grafische auseinandersetzung – Julian Rappold, Anna Höllrigl ■

Kann Bergsport krankhafte Ausmaße annehmen? Forschende sehen klare Hinweise darauf, dass Bergsucht nicht nur ein beliebter Aufdruck auf T-Shirts ist, sondern eine ernstzunehmende psychische Problematik sein kann.
Von Stefan NestlerMark Twight war ein Bergjunkie. „Ich trainierte. Ich bestrafte mich. Wenn ich mich Tag für Tag leiden ließ, würde mich das auf eine schwierige Tour in großer Höhe vorbereiten, glaubte ich. Ich schlief auf dem Boden. Ich schleppte Eis mit bloßen Händen. Ich hämmerte mit ihnen auf Betonwände ein, nur um zu sehen, ob ich das aushielt. Ich ließ keine Gelegenheit zum Training aus. Ich rannte Treppen hinauf und hinunter, bis ich mich übergab, und lief dann wieder weiter“, schrieb der Bergsteiger aus den USA in seinem Buch „Kiss or Kill“: „Ich zerstörte Beziehungen, um mich an das Gefühl des Scheiterns und Opferns zu gewöhnen (was viel leichter war, als sie zu pflegen).“ Twight, heute 62 Jahre alt, gehörte in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu den besten Bergsteigern der Welt – und zu den exzentrischsten. Selbst seine Seilpartner – wie Kletterlegende Jeff Lowe 1986 bei zwei gescheiterten Versuchen am Südpfeiler des 7861 Meter hohen Nuptse, unweit des Mount Everest – zeigten sich irritiert über die provokanten Artikel des „Bergsteiger-Punks“: „Es kommt mir vor, als wären wir nicht mal auf derselben Route gewesen“, sagte Lowe, der 2018 an einer seltenen Nervenkrankheit starb. Twight zeichnete von sich das Bild eines Berggetriebenen: „Ich kann meine Gier nicht abschalten. Ich verlange mir immer mehr ab. Jede erfolgreiche Klettertour ist Wasser auf einen kleinen Samen der Unzufriedenheit. Es hätte zu viel sein können, aber es kann nie genug sein.“
Das Suchtverhalten am Berg wurde inzwischen auch wissenschaftlich untersucht. „Für Personen, die in diesem Bereich Suchtcharakteristika aufweisen, ist das Bergsteigen das einzig Wichtige im Leben. Alles andere wird vernachlässigt, auch das soziale Umfeld“, sagt Katharina Hüfner, Professorin für Sportpsychiatrie an der Medizinischen Universität Innsbruck. „Obwohl man die Intensität des Bergsteigens reduzieren will, schafft man es nicht, sondern macht weiter, selbst wenn man verletzt ist. Und pausiert man doch einmal, empfindet man das als Entzug. Man wird reizbar und unruhig.“ Das seien eindeutig Merkmale, wie man sie auch bei anderen sogenannten stoffungebundenen Süchten wie etwa der Spiel-, Kauf- oder Sexsucht vorfinde, so die 47 Jahre alte Wissenschaftlerin. Hüfner hatte eine Studie ihrer Doktorandin Leonie Habelt betreut. Das Ergebnis war im August 2022 veröffentlicht worden und hatte über die Bergszene hinaus für viel Aufsehen gesorgt. Der Grund: „Bergsucht“ wurde als medizinisches Phänomen definiert. „Die wichtigste Erkenntnis unserer Studie ist, dass regelmäßiges und extremes Bergsteigen charakteristische Eigenschaften von Verhaltenssüchten aufweisen kann“, heißt es in der Publikation der Forschenden um Leonie Habelt.
„Die wichtigste Erkenntnis unserer Studie ist, dass regelmäßiges und extremes Bergsteigen charakteristische Eigenschaften von Verhaltenssüchten aufweisen kann.“

Leonie Habelt hat im Rahmen ihrer Dissertation untersucht, ob auch beim Bergsteigen negatives Suchtverhalten entstehen kann. Titel des Papers: Why do we climb mountains? An exploration of features of behavioural addiction in mountaineering and the association with stress-related psychiatric disorders.
„Unser Ansatz war, dass man durch das Erreichen eines Gipfels ebenso Belohnungs- und Glücksgefühle erleben kann wie etwa beim Spielen.“

Psychiatrie-Professorin Katharina Hüfner entspannt sich beim Skitouren-Gehen. Foto: Archiv Katharina Hüfner
Bergsucht tauchte bereits vor über 450 Jahren in einer medizinischen Abhandlung auf, allerdings in anderem Zusammenhang. Der Schweizer Arzt Theophrastus von Hohenheim, bekannter unter dem Namen Paracelsus, beschrieb damit im Jahr 1567 eine der ältesten, bekanntesten Berufskrankheiten: die bei Bergleuten damals häufig auftretende Staublunge. Auch in den nächsten beiden Jahrhunderten hielt sich diese Bedeutung von Bergsucht. So findet sich auch noch im ersten Großwörterbuch der deutschen Sprache, dem 1774 erschienenen „Grammatisch-kritischen Wörterbuch der hochdeutschen Mundart“, direkt hinter dem Punkt Bergsturz der Eintrag Bergsucht: „eine Art Lungensucht, welche die Bergleute von der ungesunden Luft oder dem metallischen Staube in den Bergwerken sehr häufig bekommen“. Es ging also nicht ums Bergsteigen, wenn man damals über die Bergsucht sprach. Das änderte sich spätestens, als Hans Kammerlander 1999 sein Buch „Bergsüchtig“ veröffentlichte. Der Südtiroler Bergsteiger bestieg zwölf der 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff, sieben davon mit Reinhold Messner. In seinem Buch beschreibt Kammerlander das „berauschende“ Gefühl nach einem Gipfelerfolg: „Man sagt, das sei die Ausschüttung von Endorphinen, von körpereigenen Eiweißstoffen mit schmerzstillender Wirkung, die Glücksgefühle hervorrufen. Davon kann man, so heißt es, süchtig werden. Wenn dem so ist, dann bin ich irgendwann in diesen Jahren zwischen den Alpen und den Himalaya-Gipfeln süchtig geworden – bergsüchtig.“ Heute ist das Internet voll mit Berichten von „Bergfexen“, die sich selbst als bergsüchtig bezeichnen und damit vor allem ihre Leidenschaft für die Berge meinen. Als Aufdruck findet sich das Adjektiv auf T-Shirts, Tragetaschen, Kissen oder Kaffeetassen. Die deutschsprachige Facebook-Gruppe „Bergsüchtig“, in der Bergsteiger und Bergwanderer ihre Erlebnisse unter Gleichgesinnten teilen, zählt mehr als 100.000 Mitglieder.
Weil der Begriff bislang umgangssprachlich positiv besetzt sei, hätten viele die Studie zur Bergsucht „möglicherweise falsch interpretiert“, sagt Sportpsychiaterin Hüfner. Für die Mehrheit stehe bergsüchtig für etwas, was sie gerne mögen, „etwa wie süchtig nach Schokolade“. Was daran schlecht sein soll, habe sich diesen Menschen nicht erschlossen, so die Wissenschaftlerin. Ziel der Studie war es herauszufinden, ob „Bergsucht“ nur ein geflügeltes Wort oder auch ein reales medizinisches Phänomen ist. „Unser Ansatz war, dass man durch das Erreichen eines Gipfels ebenso Belohnungsund Glücksgefühle erleben kann wie etwa beim Spielen. Wir haben uns gefragt, wie groß das Suchtpotential im medizinischen Sinne beim Bergsport ist“, erklärt Hüfner. Leonie Habelt, die Erstautorin der Studie, startete eine Umfrage: in Alpenvereinen, BergführerOrganisationen, Fachmedien und bergsportaffinen Facebook-Gruppen. Eingeladen waren Personen, die sich selbst als regelmäßige oder sogar extreme Bergsteigerinnen und Bergsteiger bezeichnen. „Regelmäßig“ stand dafür, dass jemand einen oder mehrere Gipfel pro Woche erreichte. „Extrem“ bedeutete Aktivitäten außerhalb
gekennzeichneter oder gesicherter Bergzonen sowie Expeditionen mit höherem Risiko und größeren technischen Anforderungen. Es wurde nicht zwischen Profis und Breitensportlern unterschieden. In die Studie gingen die Antworten von 335 Personen ein, 88 von ihnen wiesen medizinische Suchtkriterien in Bezug auf Bergsport auf. Das bedeute jedoch nicht, dass nun jeder vierte Bergsteiger süchtig sei, stellt Katharina Hüfner klar: „Die Frage war, ob es überhaupt eine Bergsucht gibt, nicht wie häufig sie auftritt. Unsere Umfrage war nicht repräsentativ, und sie beruhte auf einer Selbsteinschätzung der Teilnehmenden.“ Um diese als Bergsüchtige einzustufen, orientierten sich die Forschenden weitgehend an den Faktoren, mit denen allgemein Sportsüchtige identifiziert werden: Man wendet immer mehr Zeit für den Sport auf, steigert kontinuierlich die Intensität, auch über das Maß hinaus, das man eigentlich selbst angestrebt hatte. Man verliert die Kontrolle: Der Sport wird wichtiger als Beruf oder auch soziale Bindungen. Man macht immer weiter, obwohl einem eigentlich bewusst ist, dass man sich schadet, sowohl körperlich als auch psychisch.
sSportsucht noch nicht offiziell als krankhafte Störung anerkannt
Das Phänomen der Sportsucht wurde 1970 eher beiläufig entdeckt. Der New Yorker Arzt Frederick Baekeland hatte untersuchen wollen, ob viel Sport den Tiefschlaf fördert. Er bot passionierten Läufern, die täglich trainierten, Geld an. Als Gegenleistung sollten sie einen Monat lang auf ihren Sport verzichten. Die meisten lehnten ab, selbst wenn der Wissenschaftler ihnen hohe Beträge bot. Baekeland prägte den Begriff „exercise addiction“, Bewegungssucht. Inzwischen gibt es mehr als 1000 wissenschaftliche Artikel zu dem Phänomen. In den letzten Jahren nahm die Forschung dazu immer mehr an Fahrt auf. Dennoch ist sie eine eher junge Disziplin. „Wir sind noch so früh im Stadium der Forschung, dass wir nicht einmal Therapieformen testen konnten“, sagt Flora Colledge, Sportwissenschaftlerin an der Universität Luzern. „Es gibt noch keine klinische Studie zur Sportsucht-Therapie.“ Das sei ein Grund, warum die Sportsucht – im Gegensatz zur Spielsucht und Wettsucht – noch nicht offiziell als psychiatrische Krankheit anerkannt sei. Es gebe jedoch Hinweise, dass eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie hilf-
reich sein könne, erklärt die Wissenschaftlerin, die sich seit Jahren mit Sportsucht beschäftigt: „Dabei lernt man mit seinen Gefühlen rund um den Sport anders umzugehen. Man versucht, das Pensum langsam zu reduzieren, um mit den damit verbundenen Gefühlen klarzukommen.“ Ein völliger Sportentzug wie etwa bei einer Alkoholsucht mache keinen Sinn: „Menschen brauchen Sport, komplette Abstinenz geht also gar nicht.“

Mit der Zahl der Studien wuchs auch die Zahl der möglichen Erklärungen für Sportsucht. Die einen können nicht mehr ohne die „Glückshormone“ leben, die beim Ausdauersport ausgestoßen werden und etwa beim Laufen zum sogenannten „Runners High“ führen. Andere rutschen in die Sportsucht, weil sie einschneidende biographische Ereignisse wie Schicksalsschläge kompensieren wollen. Wieder andere werden als „Eskapisten“ eingestuft, die sich auf der Flucht vor dem Alltag in den Sport stürzen. Auch ein Zusammenhang mit Persönlichkeitsmerkmalen wurde nachgewiesen. So finden sich unter Sportsüchtigen überproportioniert Narzissten und Perfektionisten. Und dann gibt es auch noch die vielen Fälle, in denen die Sportsucht zusammen mit anderen Krankheiten auftritt, wie Essstörungen oder einer teilweise bis ins Wahnhafte gesteigerten Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper.
Einzelsportler seien gefährdeter, „weil sie im Gegensatz zu Mannschaftssportlern die Kontrolle darüber haben, wie viel sie machen und wie häufig“, sagt Expertin Colledge. „Bei bestimmten Bergsportarten ist das Suchtpotential definitiv gegeben. Man kann sie allein ausüben, sie sind mit vielen Stunden mittlerer Anstrengung verbunden, ohne dass lange Pausen nötig sind.“ Colledge ist selbst als Extremsportlerin mit einer Profilizenz in den Bergen unterwegs. Die 37 Jahre alte Britin gewann im vergangenen August in Norwegen den „Norseman“ und darf sich seitdem XTri-Weltmeisterin nennen. XTri steht für Extrem-Triathlon. Neben der Ironman-Distanz –
Der Arzt Frederick Baekeland prägte den Begriff „exercise addiction“, Bewegungssucht, die er zuerst bei passionierten Läufer:innen feststellte. Foto: Alex Gorham
„Sport darf eine zentrale Rolle im Leben spielen, aber nicht die einzige Priorität sein.“

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen – kommt als zusätzliche Herausforderung das bergige Profil der Strecke hinzu: Beim Norseman sind auf dem Rad rund 3000 Höhenmeter zu bewältigen, der Wettbewerb endet mit dem Zieleinlauf des Marathons auf dem 1883 Meter hohen Gipfel des Gaustatoppen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sportsuchtgefährdet wäre“, sagt Colledge. Dabei trainiert sie im Schnitt 25 Stunden in der Woche. In ihren Studien hat die Wissenschaftlerin einen Schwellenwert von sieben Trainingsstunden pro Woche ermittelt, ab dem es zu Sportsucht kommen kann. Wie geht das zusammen? „Sport darf eine zentrale Rolle im Leben spielen, aber nicht die einzige Priorität sein“, erklärt Colledge. Menschen mit einer Sportbindung wie sie selbst hätten klare Ziele, kämen im Gegensatz zu Süchtigen aber auch mit Trainingspausen gut klar. „Dann für einen Tag auszusetzen ist in Ordnung und führt nicht zu Entzugserscheinungen. Sportsüchtige dagegen berichten von heftiger Angst und schweren depressiven Symptomen bis hin zu Suizidgedanken, wenn sie nicht regelmäßig trainieren können.“
Einen starken Zusammenhang mit anderen psychiatrischen Störungen fanden auch die Innsbrucker Forschenden um Leonie Habelt in ihrer Bergsucht-Studie. 22,1 Prozent der Befragten, die der Gruppe der Bergsüchtigen zugeordnet wurden, berichteten über Essstörungen. Der Wert lag fast viermal höher als jener in der Kontrollgruppe (5,7 Prozent). Ebenfalls sehr hoch waren die Unterschiede bei depressiven Symptomen (21,6 Prozent der Bergsüchtigen vs. 7,7 Prozent der übrigen) und Angstsymptomen (20,5 Prozent vs. 8,5 Prozent)
„Am meisten überrascht hat mich, wie viele der Befragten ihre psychiatrischen Erkrankungen selbst benannt haben. Man geht ja eigentlich davon aus, dass die Leute, die in die Berge gehen, wahnsinnig gesund sind“, sagt Professorin Hüfner, die die Studie betreute. Nachdem die Studie veröffentlicht worden war, hätten sich auch besorgte Menschen aus dem Umfeld von Bergsportlern gemeldet. „Sie sagten, ihre Verwandten oder Freunde trieben den Bergsport so exzessiv, dass es ihnen nicht mehr guttue. Sie nähmen psychisch und körperlich Schaden.“ Neben den psychiatrischen Störungen traten bei den Bergsüchtigen auch stoffgebundene Abhängigkeiten deutlich häufiger auf. So erwähnten 26,1 Prozent der Befragten Alkoholmissbrauch (11,7 Prozent in der Kontrollgruppe), 10,2 Prozent (4,5 Prozent) den Konsum illegaler Drogen, meist Marihuana.
Weniger überraschend war das Ergebnis, dass Bergsüchtige eine erhöhte Risikobereitschaft zeigten und eher zu „Sensation Seeking“ neigten, der Suche nach immer wieder neuen Erfahrungen mit intensiven Eindrücken. „Viele gaben an, dass sie sich bewusst in Gefahr begeben“, berichtet Hüfner, schränkt jedoch ein: „Leute, die sehr viel am Berg machen, gehen häufiger Risiken ein. Aber was für den einen als Ausnahme erscheinen mag, ist für den anderen Alltag.“
Die Wissenschaftlerin Dr. Flora Colledge nach dem Sieg beim Norseman in Norwegen. Sie ist Weltmeisterin im Extrem-Triathlon. Foto: Pauline MonasterskaEine Anfang 2023 veröffentlichte Studie der walisischen Universität Bangor über die Motive von Bergsteigern und traditionellen Kletterern sieht sogar einen positiven Effekt des Sensation Seeking –wenn auch nur einen vorübergehenden. „Menschen, die das Gefühl haben, wenig Kontrolle über ihr tägliches Leben zu haben, die sich als ,Bauer im Schachspiel‘ fühlen“, so Sportpsychologe Marley Willegers, „können von Risikosportarten angezogen werden, bei denen sie in der Lage sind, starke Emotionen wie Angst zu kontrollieren und bei denen sie Handlungen ausführen können, die über Erfolg oder Tod entscheiden.“ Diese emotionale Kontrolle nähmen die Berg-Risikosportler dann auch zunächst mit in ihren Alltag. Dies gestalte sich jedoch schwieriger, „je länger sie sich von ihrer Bergaktivität fernhalten“. Die Folge: Sie kehren zum extremen Bergsport zurück und folgen ihrer Sucht: immer höher, immer schwieriger, immer schneller.

Grund zur Panik sieht Katharina Hüfner trotz der Ergebnisse der Innsbrucker Bergsucht-Studie nicht. „Es ist ein Randproblem. Unsere Gesellschaft hat das Problem, dass sich die Menschen zu wenig bewegen, nicht zu viel“, sagt die Wissenschaftlerin. „Das Problem Sportsucht und erst recht das Unterproblem Bergsucht sind vor diesem Hintergrund absolut zu vernachlässigen. Es gilt weiterhin: Bewegung ist gesund für Körper und Psyche, und Bewegung in der Natur ist wahrscheinlich noch gesünder.“ Betroffene Bergsportlerinnen und -sportler dürften ihre Verhaltensstörung jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen, findet Hüfner:
„Wenn jemand Zeichen einer Sucht aufweist, fühlt er oder sie sich meistens nicht gut, sondern schlecht. Und immer wenn es Leuten schlecht geht, muss man es auch behandeln. Eine Sucht im medizinischen Sinne ist niemals etwas Positives.“ ■
Literatur
y Leonie Habelt, Georg Kemmler, Michaele Defrancesco, Bianca Spanier, Peter Henningsen, Martin Halle, Barbara Sperner-Unterweger, Katharina Hüfner: Why do we climb mountains? An exploration of features of behavioural addiction in mountaineering and the association with stress-related psychiatric disorders; link.springer.com/article/10.1007/s00406-022-01476-8
y Marley Willegers, Tim Woodman, Flo Tilley: Agentic emotion regulation in high-risk sport: An in-depth analysis across climbing disciplines; research. bangor.ac.uk/portal/en/researchoutputs/agentic-emotion-regulation-inhighrisk-sport-an-indepth-analysis-across-climbing-disciplines (186ddc73-2d29-4a49-be8a-d3aa1a62b344).html

„Ich liebe die Berge. Das Abenteuer. Das Unterwegssein mit ungewissem Ausgang“, sagt der Sportjou rnalist und Bergsteiger Stefan Nestler über sich. Der 61-Jährige schreibt den Blog „Abenteuer Berg“ (abenteuer -berg.de), in dem es um das Bergsteigen an den höchsten Bergen d er Welt in allen s einen F acetten geht.

Es ist riskant. Anstrengend. Laut. Kostspielig. Und überhaupt eine ziemliche Sauarbeit.
Das Einbohren von Kletterrouten ist vieles, aber nicht angenehm –kann man trotzdem „süchtig“ danach sein?
Von Simon Schöpf, Dominik Osswald und Gebi Bendler
„Der
Nachgefragt bei einem, der es wissen muss: Reinhold „Reini“ Scherer, der so etwas ist wie das personifizierte Klettern in Tirol. Geschäftsführer des Kletterzentrums Innsbruck, erfolgreicher Nationaltrainer und passionierter Erstbegeher von mehr als 1500 Seillängen im jungfräulichen Fels.
Simon Schöpf: Reini, in einem Video von dir fällt der Satz: „Einen Bohrhaken zu setzen ist für mich so etwas wie mein täglicher Schuss.“ In einem anderen Interview sagst du, das Einbohren ist für dich „wie eine Droge“. Bist du süchtig nach Erstbegehungen?
Reinhold Scherer: (lacht) Das war natürlich etwas übertrieben. Ich konsumiere schon auch gerne Kletterrouten. Aber letztendlich gestalte ich viel lieber. Da bin ich schon ein bisschen besessen, aber es macht mir halt einen tierischen Spaß. Wenn ich eine Weile nicht gebohrt habe und mal wieder eine schöne Wand für eine Erstbegehung entdecke, dann bin ich plötzlich total unter Strom. Und dann werde ich auch direkt nervös, wenn ich keine Haken mehr auf Lager habe. Von daher ist das schon mit einer gewissen Abhängigkeit zu vergleichen. Aber ich empfinde das nicht als Krankheit oder lebensmedizinisches Problem, sondern positiv. Insofern ist die Analogie mit dem „Schuss“ vielleicht nicht ganz passend, mir tut jeder leid, der Probleme mit Alkohol oder Drogen hat. Aber Einbohren ist etwas Positives, ähnlich dem ‚Runners High‘ beim Laufen vielleicht. Es hält einen gesund und fit. Aber gut, vielleicht kann es auch pathologisch werden, wer weiß (lacht).
Eine Sucht wird definiert als „das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet.“ Wo eine Sucht, da auch ein Entzug: Wirst du nervös, wenn du zu lange nichts einbohrst?
Ja, dann habe ich schon das Gefühl, dass es jetzt gut wäre, mal wieder was zu machen, was Neues zu finden. Aber das geht jedem Spitzensportler so. Wenn man gerne Rad fährt und lange nicht gefahren ist, dann muss man irgendwann einfach wieder aufs Rad steigen. Oder der Skitourengeher, der beim ersten Schnee schon nervös wird, das ist ein ähnliches Verhalten.
Deine erste Tour hast du 1983 erschlossen, vor mehr als 40 Jahren. Seitdem bist du kontinuierlich drangeblieben. Wie hältst du deine Begeisterung so lange Zeit so hoch?

Das legendäre „Tourenheftl“ von Reini Scherer. Tatsächlich sind in diesem alle ab dem Jahr 1983 gekletterten Routen akribisch aufgelistet, irgendwann hat Reini dann nur mehr die Erstbegehungen eingetragen, aus Platzgründen. Das Foto auf dem Heft zeigt Reini in der Route „No Man's Land“ in Buoux. Foto: Robert Renzler (ehem. Generalsekreträr des ÖAV und Kletternationalteam-Trainer)
Ich denke mir schon seit ein paar Jahren, wenn ich diese Wand oder jenes Projekt noch machen will, dann heuer, denn wer weiß, ob es danach noch was wird. Ich habe immer Angst, dass ich nicht mehr fit genug sein werde. Und das treibt mich immer mehr an. Das Bohren geht nämlich schon ziemlich auf die Substanz. Aber durch das häufige Tun werde ich schneller, erfahrener. Und dadurch fällt es mir auch immer leichter. Aber vielleicht auch, weil ich mittlerweile leichteres Gelände suche und nicht mehr nur die ganz schweren Sachen.
Ist das eine Alterserscheinung, ein wachsendes Bewusstsein für das natürliche Ablaufdatum?
Ja, vielleicht sogar so eine Art Torschlusspanik. Ich denke mir, das muss ich jetzt noch machen, bevor ich die Motivation verliere. Aber irgendwie finde ich sie immer wieder. Die Leute, mit denen ich letzten Sommer unterwegs war, die waren ganz hin und weg von der Motivation und dem Arbeitseifer, den ich da an den Tag lege. Mit einem 30-Kilo-Rucksack zu klettern, das musst du erst mal packen, von der Substanz her.
Jedenfalls war ich immer motiviert, das Klettern in den Gebieten zu entwickeln, in denen ich zu Hause bin. Zum Beispiel im Osttiro-
ler Lesachtal, wo ich aufgewachsen bin, da war überhaupt nichts, null. Außer ein paar Normalhakentouren, die in Vergessenheit geraten waren. Oder auch in der Mieminger Kette, wo ich jetzt wohne, da war auch mal wenig erschlossen. Und wenn man dann zu den Felsen geht und merkt, das ist schön, da ist noch nichts drin ... dann kann ich einfach nicht anders. Dann muss ich da hinauf.
Kennst du die Panik, dass dir wer eine Linie wegschnappt?
Ich tät’ lügen, wenn es nicht so wäre. Bei den ganz lässigen Linien finde ich das dann schon schade, wenn ich da nicht selbst reinkann. Auf der anderen Seite ist man dann auch irgendwie froh drum, dass man die ganze Arbeit nicht selber machen muss.
Ist Einbohren für dich mehr Egoismus oder Altruismus?
Ich bohre schon mehr für die Szene ein, das traue ich mich zu behaupten. Oft eröffne ich Routen, weil sie cool sind und weil ich glaube, dass die Leute Spaß daran haben. Und nicht, weil ich mich damit unbedingt verewigen muss.
Oft gehe ich im Nachhinein her und bohre zusätzliche Haken, damit die Absicherung dem Grad entspricht. Manche Normalhakentouren können nicht die schöne, gerade Linie wählen, sondern queren viel hin und her, da wird dann auch die eine oder andere schöne Linie blockiert. Wenn die Normalhakentouren viel geklettert werden, ist das eh gut, aber wenn das keiner nachklettert, ist das doch schade um den Fels.
Lieber von unten oder von oben?
Für mich persönlich gilt: nur mehr von unten. Und zwar so, dass du die Kletterstelle klettern musst. Aber das habe ich mir selbst auferlegt. Denn meine Generation hat schon auch viel Dreck am Stecken, dass es anmaßend wäre, anderen vorzuschreiben, wie sie zu bohren haben. Wir haben in den 90ern auch von oben gebohrt oder eine schwierige Stelle A0, das war damals ganz normal. Aber dann kam die Tirol-Deklaration, in der es dann hieß, von oben gebohrte Routen sind keine Erstbegehungen, sondern Erschließungen. Das hat mich schon nachdenklich gemacht, dass dann plötzlich Routen von mir keine Erstbegehungen mehr sein sollen.
Deshalb gehe ich grundsätzlich von unten nach oben. Aber jeder soll seine Erfahrungen machen. Als erfahrener Alpinist weiß man ohnehin sofort, ob die Haken von oben oder von unten gebohrt wurden.
Woher nimmst du eigentlich die ganze Zeit für deine Projekte? Ich lasse halt andere Dinge liegen, das ist klar. Andere gehen feiern oder fahren in Urlaub, aber für mich ist Erstbegehen wie Urlaub. Während andere im Schrebergarten rumwurschteln, bohre ich eine neue Linie ein. Im Sommer fahre ich um vier Uhr nachmittags noch mit dem E-Bike auf den Berg und erschließe neue Sachen, bis es dunkel wird. Da erreicht mich auch niemand, weil ich so oft wie möglich dahin bin, um unbekanntes Gelände zu erkunden.
Gehen dir nach 1500 Seillängen irgendwann die Ideen, die Motivation aus?
Ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass es jetzt genug ist. Aber das Gefühl habe ich halt schon lange (lacht). Aber immer wieder finde ich dann zufällig was, wo ich denke, das muss ich mir genauer anschauen. Und dann bohre ich das halt ein.ren. Und

Über 1500 Routen stehen im „Tourenheftl“ von Reini Scherer, akribisch aufgelistet mit Datum, Name, Schwierigkeit. Und ganz, ganz oft steht eben das Wort „Erstbegehung“ als Kommentar dabei, in Rot. Wenn man die Längen überschlägt, kommt man auf rund 40 Kilometer –Reini Scherer hat in seinem Leben fast schon einen ganzen Marathon gebohrt.
Wer so viel mit der Bohrmaschine hantiert, der hat zwangsläufig eine solide Routine. Und eine beeindruckende Schnelligkeit. „In 95 % aller Fälle bohre ich den Haken aus der Kletterstellung. Weil ich so einfach schneller bin. 17 Sekunden muss ich mich mit einer Hand an einem Griff halten können, um aus der Kletterstellung einen Haken zu setzen“, weiß Reini. 17 Sekunden für das Bohrloch, Haken ansetzen, reinhämmern, festziehen, belasten. Wie ist er nur so effizient geworden?
„Im Grunde ist das Hakensetzen eine Handwerkstätigkeit. Je öfter man das macht, desto schneller wird man, genauso wie ein Tischler, der ein Leben lang Stühle herstellt. Aber richtig schnell wird man erst, wenn man schnell im Kopf wird. Wenn man wegsteigt vom Haken, dann geht die meiste Zeit mit Überlegen, Angsthaben, Liniesuchen drauf. Das Denken zwischen den Haken kostet die meiste Zeit. Da musst du dich treiben lassen, und das gelingt halt umso besser, je mehr Erfahrung man hat.“
Welches Material hast du immer dabei?
a) Grobsortiment an Normalhaken (Diagonalhaken, Normalhaken, V-Profil-Haken)
b) ein kleines Sortiment Friends (0.4, 0.75, 1, 2) und Klemmkeile
c) Black Diamond Pecker („die sind Gold wert, das ist das wichtigste Werkzeug“)
d) Cliff („wobei ich den selten brauche, je nach Gelände“)
e) Seilrolle
f) Tuber
g) Standplatzschlinge (Petzl Adjust)
h) Schraubenschlüssel
i) Expansionsbohrhaken (Lasche in Expressschlinge)
j) Hammer
k) Prusikschlinge





1) Welche Bohrmaschine?
„Die klassische, alte Hilti TE-4, die gibt’s gar nicht mehr. Mit einer Bohrmaschine mit weniger Schlagleistung brauche ich mehr Zeit oder mehr Druck, um ein Loch fertigzubringen.
Die Hilti ist zwar nicht leicht, aber die muss ich nur hinhalten, dann fährt die schon rein. Da schleppe ich lieber etwas mehr Gewicht, dafür geht’s dann schneller. Wichtig ist immer ein frischer, sauberer Bohrer, da habe ich zwei oder drei dabei. Die Maschine hängt mit einem Fifi-Haken am Gurt.“
2) Organisation am Gurt?
„Das ist das Um und Auf, dass am Gurt alles genau da ist, wo du es brauchst. Vorne das, was man oft braucht (Hammer, Haken, Bohrmaschine), hinten in der zweiten Materialschlaufe der Rest (Friends, Normalhaken, Seilrolle).“
3) Standplatzschlinge
„Ich hänge mir den Karabiner der Selbstsicherungsschlinge immer in den T-Shirt-Ausschnitt, damit ist der griffbereit.“
4) Bohrhaken
„Expansionsbohrhaken (Expressanker FBNII M10/85 und Lasche 10 mm), dabei hänge ich immer schon einen Haken an eine Expressschlinge. Wobei man darauf achten muss, dass die Mutter weit zurückgedreht ist, sonst dreht sich die eventuell beim Klettern raus.“
5) Hammer
„Modifiziert durch einen Draht-Haken aus dem Baumarkt, mit dem er am Gurt hängt. Und mit einer Reepschnur, genau abgestimmt auf meine Armlänge, zusätzlich an meiner Brustschlinge, damit ich ihn sofort finde. Einfach daran ziehen und tschagg – schon habe ich den Hammer in der Hand, ohne jemals am Gurt rumfummeln zu müssen.“
6) Schraubenschlüssel
„Da werde ich oft ausgelacht, weil ich so einen großen Schlüssel mithabe, aber damit bekomme ich beim Festschrauben mehr Abstand zur Wand. Und so deutlich weniger oft blutige Fingerkuppen!“
7) Reinis Spezialtipp
„In ganz heiklen Fällen, wo ich nicht weiß, ob ich wegrutsche, setze ich die Bohrmaschine etwas steiler an und fädle den Karabiner der Standplatzschlinge durch den Bohrer. Sobald ich einen oder zwei Zentimeter im Fels bin, kann ich dann schon leicht entlasten und kurz Pause machen, indem ich mich an den Bohrer hänge.“
8) Seile
„Immer Doppelseile. Zwei Mal hat es mir fast das Seil abgeschlagen. Es gibt Leute, die klettern mit Einfachseil und seilen dann mit der Reepschnurmethode ab, aber das ist mir zu heiß.“
9) Die größte Gefahr beim Einbohren?
„Dass man auf einen Fels trifft, den man nicht richtig eingeschätzt hat. Oft sieht man die Risse und weiß, das darf man jetzt nicht angreifen und muss drumherum klettern. Aber das Schlimmste sind so Linsen, so komische Schuppen, bei denen man erst von oben sieht, dass sie nur auf dem Fels liegen und leicht abrutschen. Deshalb ist es für mich immer wichtig, den Stand dort zu machen, wo er aus der Schusslinie der nächsten Seillänge ist.“
10) Wie hältst du es mit dem Putzen?
„Ich habe das Gefühl, dass die Leute mittlerweile eine gewisse Qualität von meinen Routen erwarten. Deshalb traue ich mich gar nicht mehr, nicht zu säubern. Wobei ich auch gemerkt habe, dass es oft nichts bringt, alle Grasbüschel zu entfernen. Im Gegenteil, es ist mir schon passiert, dass nach einer motivierten Putzaktion das Wasser dann an Stellen kommt, wo es vorher nicht war, und durch Frostsprengung ganze Teile meiner Routen zerstört werden. Also lose Steine ja, Gras nein.“
11) Anfängertipp?
„Am meisten bekommt man sicher mit, wenn man mit einem mitgeht, der schon viel Routine hat. Sonst zahlt man ganz viel Lehrgeld.“
12) Die Moralpredigt zum Schluss?
„Ich erhoffe mir schon einen Respekt und ein Gefühl für Linienwahl von Erstbegehern, damit sie andere Linien nicht zerstören. Und den Egoismus ablegen, einfach überall quer reinzubohren ohne Rücksicht auf Verluste. Eigenständige Linien sollte man bewahren.“ [Interview: Simon Schöpf]




Claude und Yves Rémy

Am groß gewachsenen, stets gut gelaunten Blondschopf kommt man in der Schweiz nicht vorbei, wenn es ums Thema Erschließen geht. In den 80ern wiederholt Pesche viele der damals schwierigsten Routen oder macht gar die erste Rotpunktbegehung. Mit seiner langen, blonden Mähne und seinem athletischen Körper ziert er regelmäßig die Klettermagazine und kann sich dank einer Teilzeitanstellung voll und ganz dem Klettern widmen.
„Wenn du damals hart klettern wolltest, dann musstest du auch selber bohren. All die schwierigen Routen waren ja noch nicht entdeckt“, erinnert er sich heute. Im Routenbohren erkennt er aber bald mehr als bloß das Erschließen neuer Klettergrade. „Es ist das Entdecken von etwas Neuem, das mich auch heute noch mit größter Freude losziehen lässt. Während es am Anfang noch darum ging, möglichst schwierige Routen zu finden, geht es bei mir längst nicht mehr um den Grad, sondern um das Ganze: einen Felsen finden, die ideale Linie finden, die Bolts am richtigen Ort platzieren.“
Inzwischen hat Pesche rund 1500 Routen vornehmlich in der Schweiz eröffnet. Sein Name wird vor allem mit dem Tessin verbunden. Als Pesche 1998 in die Südschweiz zieht, wo die Sonne oft scheint und die rauen Gneis-Felsen von Palmen und Kastanienwäldern gesäumt sind, setzt er sofort neue Impulse. Zwar sind die lokalen Kletterer um Locarno nicht untätig, widmen sich aber vor allem der Reibungskletterei auf den großen Gneisplatten. Senkrechte oder gar überhängende Routen gibt es nur vereinzelt. Pesche bringt genau diesen Spirit mit. „Ich konnte einfach loslegen, das Potenzial war unendlich.“
Er richtet eigenhändig ganze Klettergärten ein, von denen viele zu den beliebtesten im Tessin (wenn nicht sogar schweizweit) gehören. Dass seine Klettergärten dereinst so viele Menschen begeistern, ahnt er damals nicht. „Wenn heute jemand zu mir kommt und sich bedankt, ist das natürlich auch eine Bestätigung und ein Antrieb.“ Inzwischen lebt er wieder nördlich des Gotthards im Kanton Bern. Und auch wenn die Felsen dort schon länger im Fokus der Kletterer stehen, gibt es für einen wie Pesche noch viel zu entdecken. [Text: Dominik Osswald]
Foto: Archiv Wüthrich


Wie viele Seillängen das Brüderpaar
Claude und Yves Rémy erstbegangen hat, ist nicht so ganz genau bekannt. Fest steht: Es sind sehr viele. Mit zwischen 12 000 und 14 000 Seillängen sind sie weltweit die Rekordhalter unter den Erschließern. Im Schweizer Waadtland groß geworden, gehen die Brüder schon früh mit dem Vater Marcel auf Bergtouren. Die Herangehensweise des Vater-Söhne-Trios ist stets unerschrocken und pragmatisch, Ausrüstung kaum vorhanden. So sollen sie am Wochenende mit demselben Seil geklettert sein, mit dem Vater Marcel unter der Woche das getrocknete Gras zum Vieh schleppte. Mit dem Minimum an Ausrüstung und Zeit stets das Maximum rauszuholen, war das Motto. Die Felswände, derer sie sich annehmen, sind entweder Neuland oder aber es gibt kein Topo. Dass Claude und Yves insofern die perfekte „Erstbegeherschule” durchliefen, versteht sich von selbst. In ihren ersten Routen lassen sie kaum Metall zurück, zu kostbar sind die Schlaghaken. Das ändert sich, als sie in den 70ern eine Partnerschaft mit dem Ausrüster Mammut eingehen, der Deal: Ausrüstung gegen Feedback. Zwischen 1975 und 1985 hinterlassen sie 6000 Bohrhaken, allesamt von Hand gesetzt. Im Kalkfels dauert es 15 Minuten, ein Loch von Hand zu schlagen. Im Granit sind es 45 Minuten – oft müssen zwei Haken pro Seillänge ausreichen. Ab 1986 besitzen sie eine Bohrmaschine, jetzt setzen sie über 2000 Haken im Jahr. Das Routenerschließen steht bei den Brüdern stets an vorderster Stelle. Sie machen zwar Lehren als Mechaniker und Klempner, doch die sind nur Mittel zum Zweck. Die zwei machen nie ein Geheimnis daraus, dass ihre Zeit primär der Vertikalen gehört. In der Schweiz ist bald jede größere Wand mit dem Namen Rémy verbunden. Ganze Gebiete, wie etwa das Eldorado mit der legendären Motörhead am Grimselpass, gehen auf ihr Konto. Heavy Metal ist nicht nur die Musik, die sie begleitet. „ Als wir 1981 zwischen Lausanne und dem Grimselpass hin- und herfuhren, bescherte uns die unermüdliche Motörhead-Kassette euphorische Autofahrten. Sogar der Wagen zuckte vor Freude über die bahnbrechende HeavyMetal-Musik. Wir ließen die Fenster geschlossen, um uns nicht das Geringste des inspirativen Zaubers entgehen zu lassen und um zu vermeiden, dass draußen irgendwelche Tiere traumatisiert wurden“, sagt Claude Rémy 2015 gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung. Ihr Wirken geht längst weit über die Landesgrenze hinaus, schon in den 80ern gehörten sie zu den Pionieren im jordanischen Wadi Rum. In jüngerer Zeit trugen sie zum Gedeihen des Sportkletterns in Griechenland bei: 600 Touren auf Kalymnos und weitere in Leonidio. Auf ihr Lebenswerk rückblickend sagen sie in einem Interview von 2022: „Wir sind Wahnsinnige. Es gibt Sexbesessene, aber wir sind Felsbesessene. Oder Boltbesessene.“ [Text: Dominik Osswald]
Foto: D. Haefeli


Fragt man den Tiroler Berg- und Skiführer Andreas Nothdurfter danach, welche seiner Erstbegehungen die wichtigste für ihn war, kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Herzschlag der Leidenschaft“. Diese Linie mit 32 Seillängen und 1700 Klettermetern in einer 1100 Meter hohen Wand haben er und sein Bruder Thomas im Jahr 2011 eröffnet. Die Route am Sonnjoch im Karwendelgebirge hat es in den Ostalpen-Auswahlführer „Longlines“ von Adi Stocker geschafft und ist inzwischen ein moderner Klassiker geworden. Mehr als 145 Wiederholungen zählt die Marathonkletterei inzwischen, die frei geklettert mit einem Überhang im Grad VIII+ aufwartet. Die vielen Wiederholer:innen sind neben dem kurzen Zustieg auch der perfekten Absicherung geschuldet. Andi will nämlich keine Denkmäler seiner eigenen Kühnheit hinterlassen, sondern „möglichst vielen Wiederholern eine gute Zeit bereiten“.
Was ihn sonst noch so motiviert zum Erstbegehen? Die alten Bergsteigerlegenden, wie Hermann Buhl oder Hias Rebitsch, hätten immer schon eine große Faszination auf ihn ausgeübt. Sie haben neue Wege durch Wände gefunden, die noch nie zuvor von Menschenhand berührt wurden. Diese Unberührtheit gibt es in unserer zivilisierten Welt kaum mehr. Ein Stück Fels anzugreifen, wo noch nie jemand war, ein Stück Landschaft neu zu entdecken, übe einen großen Reiz aus, so Andi.
Dass sich Rebitsch und Co. ohne Vorkenntnisse in solche großen Wände wie die Laliderer-Nordwand einzusteigen trauten, sei einfach nur beindruckend. Auch wenn man inzwischen mit dem Bohrhaken das Abenteuer und das Risiko verkleinere, so könne man doch immer noch Pioniergeist bei einer Erstbegehung zur Entfaltung bringen und darf ein bisschen Christoph Columbus spielen. Sich ein klein wenig wie eine Miniaturausgabe von Hans Dülfer, Dibona und Konsorten fühlen zu dürfen, sei schön. Wichtig ist Andi dabei auch immer, eine intensive Zeit mit einem guten Freund oder seinem Bruder Thomas zu verbringen.
Gemeinsame Abenteuer und Erstbegehungen schweißen schließlich zusammen und schaffen wundervolle Erinnerungen. Inzwischen blickt Andi auf über 600 erstbegangene Einzelseillängen zurück und genauso wie sich der leidenschaftliche Blasmusikant Andi Nothdurfter über viele Zuhörer freut, freut sich der Erstbegeher in ihm über jede einzelne Wiederholerin und jeden Wiederholder. Denn, so sein Leitspruch: „Das Brot der Erstbegeher sind die Wiederholer.“
[Text: Gebi Bendler]
Foto: Archiv Nothdurfter

Uwe Eder, geboren 1971, ist nicht nur im Hauptberuf Ausbilder bei der Bergrettung Tirol und Meister des surrealen Humors, sondern einer der Haupterschließer im Zillertal. An die 1000 erstbegangene Seillängen kann er inzwischen auf seinem Konto verbuchen. Der Löwenanteil davon findet sich im erwähnten Tiroler Seitental, wo er zudem als Führerautor für Mehrseillängentouren aktiv war.
Doch Uwe auf einen Zillertaler Lokalmatador zu reduzieren, greift viel zu kurz. Seine unbändige Neugier und sein reiselustiges und offenes Wesen führten ihn klettertechnisch um die ganze Welt. Ob im amerikanischen Yosemite oder am australischen Mt. Arapiles, fast überall finden sich Spuren von ihm.
„Wenn ich eine schöne Linie am Felsen entdecke, beginnt ein kreativer Prozess in mir. Der Wunsch wächst und wächst im Kopf und irgendwann bleibt nichts anderes übrig, als zum schöpferischen Akt zu schreiten (lacht).“ Dabei ist das Routenerschließen für ihn Meditation und Yogaübung zugleich, weil er so fokussiert im Moment sein darf und völlig abschalten kann. „Ich mache es in erster Linie für mich selbst, aber ich will die Routen so hinterlassen, dass auch die Wiederholer eine Gaudi haben.“
Auch die Herangehensweise hat sich über die Jahre verändert. Als er um 1986 seine erste Route an der Auplatte eingerichtet hat, brauchte er dafür noch mehrere Tage, um die wenigen Bohrhaken mit dem Handbohrer anzubringen. Seither ist kein Jahr vergangen, in dem er nicht irgendeine neue Route erschlossen hat. Inzwischen geht es dank „Bosch“ und Routine zehnmal so schnell. Auch die Anzahl der Bohrhaken hat sich aufgrund wachsender Altersmilde erhöht.
Besonders stolz ist Uwe darauf, etwas für die nächsten Generationen zu hinterlassen und für die Jugend neue Klettermöglichkeiten zu schaffen. So glitzern seine Augen ganz besonders, wenn er davon erzählt, wie seine kleine Tochter im Alter von 12 Jahren Papas Erstbegehung „Space“ im Grad 8a wiederholen konnte. Genau 20 Jahre nachdem Uwe den Klassiker eingebohrt hat. [Text: Gebi Bendler]
Foto: Michael Meisl

„Ich habe das nie so wahnsinnig ernst betrieben“
Der Tiroler Richard Obendorfer schaffte zwischen 2021 und 2023 pro Jahr rekordverdächtige eine Million Höhenmeter aus eigener Kraft.
Im Schnitt sind das mehr als 2700 pro Tag. Ist der Mann süchtig?
Einfach nur irre? Ihm selbst gefällt ein anderer Begriff.
Von Dominik Prantl
Beginnen wir bei Richard Obendorfer mit seinem Bücherregal, weil ein Bücherregal einfach mehr verrät als jeder Höhenmeter. Natürlich stehen da die alten Bergklassiker, von Harrers „Die Weiße Spinne“ über Buhls „8000 drüber und drunter“ oder Messners „Siebter Grad“. Darunter stehen aber auch Thomas Manns „Zauberberg“, Heinrich Manns „Der Untertan“, Stephen Hawkings „Eine kurze Geschichte der Zeit“. Dazu Bücher über Homöopathie, gesunde Ernährung und „Das große Buch zum Abnehmen“, wobei man sich wirklich nicht vorstellen kann, wozu Obendorfer das genau braucht. Er wiegt 53 Kilogramm, bei mittlerer Größe und einem Alter von 57 Jahren. Wie soll man bei einem Jahrespensum von einer Million Höhenmeter auch dick werden?
Nochmal: eine Million Höhenmeter pro Jahr. 1,020.150 im Jahr 2021, 969.000 in 2022 und schließlich 1,041.500 im vergangenen Jahr. Macht im Schnitt 2768 Höhenmeter täglich. Einen komplett Bergverrückten stellt man sich allerdings irgendwie anders vor. Obendorfer empfängt mich in seinem Wohnort Sistrans jedenfalls wie der wandelnde Beweis dafür, dass es keineswegs modische Ausrüstung für die Berge braucht; eitel ist er nicht: Ein gemustertes, etwas ausgewaschenes Fleecehemd, dazu eine pinke Wollkappe, auf der „Staplertechnik Pfitscher“ steht. Gerade eben ist er schon auf Ski den Patscherkofel hochgestapft – zweimal, um genau zu sein, mehr als 2000 Höhenmeter, einmal bis zur Bergstation, einmal bis kurz vor den Gipfel, trotz wolkenverhangenem Himmel und teils eisiger Piste. Aufgestanden ist er um 4.36 Uhr, aber auch nur deshalb, weil Winter ist. „Im Sommer bin ich schon noch früher wach.“ Irgendwann muss der Mann ja auch noch arbeiten. „Ohne die Möglichkeit des Homeoffice ginge das nicht.“
Logische Frage: Warum tut man das? Ist das eine Sucht? Zögerliche Antwort: „Sucht ist das falsche Wort.“
Obendorfer, 1966 in Amberg, Oberpfalz als Sohn einer Bankkauffrau und eines Glasers geboren, merkte schon früh, dass er etwas anders ist: ausdauernder, unermüdlicher, gnadenloser, dass er Glück hatte mit seinem Körper, der ihn während manchen Geländelaufs auf Anhieb schneller und weiter trug als andere. Beim Fußballtraining habe er sich während mancher Konditionseinheit gedacht: „Ja, wo bleiben sie denn“, und meint damit die Teamkollegen. Obendorfer spielte Fußball, Tennis, Tischtennis – „ich kann auch mit dem
Ball umgehen“ –, zog nach München, wo er studierte, wo ihn das Bergfieber packte und wohl auch der Ehrgeiz. Erste Zäsur.
Obendorfer zieht jetzt ein Buch aus dem Regal, Ulrich Aufmuths „Zur Psychologie des Bergsteigens“. Darin ist auch von Realitätsflucht und Größenhunger und Individualitätsbedürfnis unter Bergsteigern die Rede, von Angst und Lust und Qual. „Das, was der schreibt, ist nicht so blöd. Das ist richtig gut“, sagt Obendorfer.
Gut, also Psychologie. „Das Selbstbewusstsein war nie so besonders stark an der Uni“, sagt Obendorfer über sein Studium des Bauingenieurwesens an der TU München. Es seien ja viele Geisteswissenschaftler im Wohnheim gewesen, und er kam mit seinem typisch oberpfälzischen Bellen in der Sprachmelodie daher, das er „noch immer intus“ habe. „Gut möglich, dass ich da was gebraucht habe und mir die innere Ruhe fehlte.“ Kann exzessives Berggehen weniger eine Sucht als vielmehr ein Boost fürs Selbstvertrauen sein? „Ja, das gefällt mir.“
Allerdings war die Studienzeit mehr Lust als Qual oder gar Angst für ihn. Er habe im Wohnheim „brutal viel gefeiert“, wie er überhaupt so einiges brutal viel gemacht hat oder zumindest „ziemlich intensiv“, auch und gerade später während seines ersten Jobs als Statiker in einem Ingenieurbüro in München. Er habe zwischenzeitlich brutal viel gelesen, auch mal jede Menge gearbeitet, intensiv Gitarre und Klavier gespielt, intensiv gemalt und Musik gehört. Ruhige Songs, bisserl jazzig, Eric Clapton, Bob Dylan, aber am liebsten Van Morrison. „Der ist ein echtes Genie.“ Nächste Zäsur.
Ende der Neunziger zog er nach Tirol – zu seiner Frau, die er in den Bergen kennengelernt hat, natürlich. „Ich habe alles hinter mir gelassen“, die Partys, seine alte Arbeitsstelle und irgendwann die Gitarre und das Malen. Er kletterte und radelte und lief die Berge brutal schnell hoch und runter, den Berliner Höhenweg in 25 Stunden, den Stubaier Höhenweg in 20 Stunden. Er begann mit Wettkämpfen und gewann diese mit schöner Regelmäßigkeit: 120 Tagessiege bei Bergläufen, Rad- und Skitourenrennen. Zweimal Tiroler Meister im Berglauf und fünfmal Zweiter. Zweimal Bronze bei den österreichischen Meisterschaften im Uphill-Mountainbiken. Österreichischer Skitouren-Meister im Vertical 2011. Den Rekord des Berglaufs auf den Glungezer – einen Berg, den er eine Zeitlang täg-
„Gut möglich, dass ich da was gebraucht habe und mir die innere Ruhe fehlte.“

Mehr zu Richard Obendorfer
www.richard-obendorfer.at
lich in Angriff nahm –, hält er mit 1:39 Stunden für die 2125 Höhenmeter bis heute. Etwas stolz ist er schon darauf. Oder wie er sagt: „Ein bisschen lustig ist das schon.“
Obendorfer gab Vollgas, ohne es richtig zu merken, mehr nach Lust als nach System. Er meint es völlig ernst, wenn er sagt: „Ich habe das nie so wahnsinnig ernst betrieben.“ Die Konkurrenz? „Die Typen waren ja so wahnsinnig ehrgeizig.“ Von Trainingsplänen hielt er jedenfalls nichts, und vielleicht war das ein Glück für die Gegner. Einmal, es sei schon einige Zeit her, etwa 15 Jahre, so erzählt er, habe er einen Sporttest absolviert. Die Ärzte schauten jedenfalls auf die Ausdauerwerte und den VO2max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, und hätten nur gemeint: „Das sind ja Wahnsinnswerte. Das gibt es gar nicht!“ Der Wert lag bei 83. Für Menschen im fünften Lebensjahrzehnt gelten Werte über 50 als hervorragend, mit mehr als 80 zählt man zur absoluten Elite, egal in welchem Alter.
Andererseits sei sein eigenes Pensum „ein Wahnsinn“ gewesen, schon damals lag es bei 700.000 Höhenmetern pro Jahr, trotz vieler eher zeitaufwändiger Klettereien und alpiner Touren, auch nach der Geburt seiner beiden Kinder 2004 und 2007. „Ich war da schon etwas egoistisch.“ Auf Skitouren habe er immer gespurt, meist führte ihn seine Bergpassion nicht weit von Innsbruck weg, allein auf den Bettelwurf sei er im Winter 25 Mal gestiegen. „Was man bei uns vor der Haustüre schöne Sachen machen kann!“, schwärmt Obendorfer. Er fahre ohnehin kaum Auto, hole sich sein Selbstvertrauen nicht über einen dicken Wagen oder ein großes Haus, „sondern darüber, etwas zu können“. Dazu zählt für ihn auch der Job, der ihn damals wohl unterforderte. „Vielleicht war ich auch deshalb so extrem.“
Und dann kam im April 2016 die Lawine, die nächste Zäsur in Obendorfers Leben. Wieder war er im Karwendel unterwegs, alleine. Große Seekarspitze, Einfahrt nordostseitig ins Marxenkar, „werden etwas mehr als 40 Grad gewesen sein“, sagt Obendorfer. Ein paar Schwünge, hinten hörte er es wummern – „und dann war das so richtig …“. Obendorfer ahmt mit den Händen die Bewegungen einer rotierenden Waschmaschine nach. 200, vielleicht 300 Meter nahm ihn das Schneebrett mit. „Zum Glück hat am Ende der Kopf rausgeschaut. Und den rechten Arm hab ich rausbekommen.“ Mit dem hat er sich ausgegraben, und als er sich ausgegraben hatte und zu Fuß ins Tal gestapft war, kam der Moment, als er sagte: „Jetzt muss was anderes her.“ Er habe schon vor der Lawine gefühlt, dass er es etwas langsamer angehen sollte.
Seitdem lässt er es also etwas langsamer angehen, was allerdings die Zahl der Höhenmeter noch einmal nach oben schraubte. Skitouren geht er inzwischen fast nur noch auf der Piste, die 960 Höhenmeter zur Patscherkofel-Bergstation auch nicht mehr wie früher in seiner Rekordzeit von 36 Minuten, sondern in etwas mehr als einer Stunde. „Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.“ Der Job nehme ihn außerdem stärker in Anspruch, obwohl er den fast noch lieber
mache, als draußen rumzurennen. Seit 13 Jahren arbeitet er bei der Tiwag, ist dort inzwischen Experte für Matlab, eine Software für numerische Berechnungen, und damit eine Art Sonderbeauftragter für knifflige Projekte, die sonst niemand machen wolle.
Er redet ohnehin auch gerne über andere Dinge; nicht nur über den Sport, nicht nur über Höhenmeter und die Energie in seinem Körper, sondern auch über die Energie, die wir alle brauchen, über Stromproduktion, Wind- und Wasserkraft, über Bevölkerungsentwicklung, Inflation oder sein ehrenamtliches Engagement als Obmann beim Pferde-Verein Pegasus. Und ja, gerade im Winter, da „zipft’s mich manchmal schon an“. Mehr als drei Millionen Höhenmeter in drei Jahren – womöglich ein Weltrekord – kommen ja nicht von nichts. Im Sommer schaffe er schon häufig 4000 Höhenmeter am Tag. Er findet: „Jeder sollte die Anlagen nutzen, die er hat. Und die meisten Menschen haben viele Anlagen.“
Vorschlag: Wollen wir es eine Verrücktheit nennen? Brutal schnelle Antwort: „Verrücktheit. Das ist gut!“
Und dann gerät er ins Schwärmen. Wenn er morgens 3000 Höhenmeter mache, meist mit dem Rennrad die Bergsträßchen hinauf, dann könne alles, was danach kommt im Job, nur leichter werden. Frische Luft, das sei Lebensintensität. Er komme da auch oft auf Ideen, für die Arbeit. Nein, eine Sucht sei Bergsteigen einfach nicht. „Das ist Meditation.“ Rhetorische Frage von Obendorfer: „Ein gesunder Mensch, der sich körperlich nicht anstrengen kann – kann sich der dann geistig anstrengen?“ Oder anders, frei nach dem römischen Dichter Juvenal: Wohnt in einem sportlichen Körper ein sportlicher Geist?
Morgen geht es für Obendorfer womöglich wieder auf den Patscherkofel, vielleicht mit Van Morrison im Ohr und einer Matheaufgabe im Kopf. Das heißt nicht, dass er nicht anders könnte. Er will es so.
Fotos: Archiv Obendorfer ■


sucht Dominik Prantl ist Journali st bei der Süddeutschen Zeitung und bei bergundsteigen. Für das Erreichen der Eine-Million-Höhenmeter-Marke wird er statt eines Jahres eher noc h ein zus ätzliches Leben brauchen.


Kletterer sind Gravitationssportler. Geringes Gewicht ist ein Baustein auf dem Weg zum Erfolg. Doch das Streben nach Leichtigkeit kann irgendwann zur Sucht werden. Ein Blick auf ein schwerwiegendes Problem: Essstörungen im Klettersport.
Von Rabea Zühlke
Die Beckenknochen stehen heraus, die Rippen sind einzeln zählbar. Die Kniescheiben zeichnen sich unter den mageren Oberschenkeln ab. Die Arme sind sehnig, die Handgelenke knochig. Willkommen auf den Laufstegen der Welt? Keineswegs. Wir befinden uns nicht auf den glanzvollen Bühnen der Pariser Fashion Week, der Mailänder Modewoche oder bei der selbstwertverachtenden Topmodelsuche à la Heidi Klum. Eine Lebensrealität, in der das obsessive Streben nach dem Size-zero-Ideal nicht minder tragisch ist, aber seit Jahrzehnten wenig überraschend, vielleicht sogar erwartbar ist.
Von jener Welt reden wir nicht. Stattdessen blicken wir auf einen uns bekannteren Schauplatz, der von starken, herausragenden Athleten geprägt ist: die Kletterwelt. Das Klettern hat schon lange ein Problem mit dem Gewicht. Vor einigen Jahren machte die amerikanische Filmemacherin Caroline Treadway mit der Dokumentation „Light“ auf diese dunkle Seite des Kletterns aufmerksam. Profi-Kletterinnen und -Kletterer wie Angie Payne, Emily Harrington, Andrea Szekely oder Kai Lightner erzählten ihre ganz eigene, erschreckende Geschichte über das Streben nach Leichtigkeit. Weltweite Aufmerksamkeit bekam das Thema im letzten Jahr – vor allem durch den Rücktritt der beiden Verbandsärzte Dr. Volker Schöffl und Dr. Eugen Burtscher von der Medical Commission des internationalen Kletterverbandes IFSC (International Federation of Sport Climbing). Grund für den Austritt der beiden fachlichen Berater waren die fehlenden Handlungsinitiativen des internationalen Verbandes: Diesem fehle der Wille zur Umsetzung von Maßnahmen, um Athletinnen und Athleten vor einem gefährlichen Gewichtszustand zu schützen.
Hungern im Leistungssport
„Essstörungen sind in allen Sportarten präsent, in denen ein niedriges Gewicht oder die Ästhetik Vorteile bringt“, erklärt Dr. Kai Engbert, der als Sportpsychologe die deutsche Nationalmannschaft im Sportklettern betreut. „Bei Gravitationssportarten wie dem Skisprung oder beim Klettern, insbesondere beim Leadklettern, ist es natürlich von Vorteil, weniger Masse bewegen zu müssen.“ Im internationalen Spitzenbereich ist das Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht ausschlaggebend – und das Gewicht ein Baustein auf dem Weg zum Erfolg. Dr. Karin Lachenmeir, die das Therapie-Centrum für Essstörungen (TCE) in München leitet, sieht genau deswegen eine Gefährdung: „Gewichtssensitive Sportarten können einen Risikofaktor für eine Essstörung darstellen.“ Allerdings, so betont die psychologische Psychotherapeutin, hätten Essstörungen nie „die eine“ Ursache: „Vielmehr ist es ein Mosaik aus mehreren Teilen. Je mehr davon zusammenkommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Essstörung zu erkranken.“
Die amerikanische Flimemacherin Caroline Treadway machte mit dem Dokumentarfilm „Light“ auf Essstörungen im Klettersport aufmerksam. Illustrationen von Sarah Nicholson aus dem Film.
Wenn das Nicht-Essen zur Sucht wird Ganz allgemein ist eine Essstörung eine psychosomatische Erkrankung, die durch ein abnormales oder gestörtes Essverhalten gekennzeichnet ist. Bei den Betroffenen spielen ein übermäßiges Bewerten von Figur und Gewicht genauso wie die Kontrolle über das Essen eine große Rolle. Man differenziert zwischen drei klassischen Störungsbildern: Magersucht (Anorexia nervosa), EssBrechsucht (Bulimia nervosa) und Binge-Eating-Störung (BES).
Bei Sportarten wie dem Klettern, in denen geringes Gewicht zur Leistungserbringung eine Rolle spielt, ist vor allem die Magersucht ein Thema. Anorexie geht mit einem starken Gewichtsverlust sowie mit gewichtsphobischen Ängsten einher: „Betroffene weisen ein bedeutsames Untergewicht auf, das aktiv herbeigeführt ist. Zum Beispiel durch Essensverweigerung, Sport oder gegenregulierende Maßnahmen wie Erbrechen“, erklärt Lachenmeir. „Die Vorstellung, zu dick zu sein oder zu werden, ist dabei deutlich angstbesetzt.“
Das Körpergewicht liegt dabei mindestens 15 Prozent unter dem für das Alter angemessenen Gewicht. Ebenso leiden die betroffenen Personen unter einer Körperschemastörung, also einer verzerrten Wahrnehmung ihres Körpers oder von Körperteilen als zu dick. Magersucht ist die psychische Erkrankung mit der höchsten Todesrate – etwa zehn Prozent sterben an den Folgen der Unterernährung.
Mit nur einem Fuß
Dass der Klettersport ein Eintritt in die Anorexie ist, dagegen möchte sich DAV-Kaderbetreuer Engbert allerdings wehren: „Im Leistungsbereich gilt es, alle Bausteine zu optimieren, das Gewicht ist ein Faktor – aber eben einer von vielen.“ Das bestätigt auch der deutsche Profikletterer Alexander Megos: „An einem gewissen Punkt spielt das Gewicht im Spitzensport eine Rolle: Wenn man im Weltcup dabei sein möchte, schraubt man auch am Gewicht. Es gibt keinen Athleten, bei dem das Thema nicht im Kopf rumspukt“, sagt Megos. Wenn die Gewichtsreduktion in einem professionellen Umfeld erfolge, mache sich Dr. Engbert weniger Sorgen: „Bei Kadersportlern wird die Gewichtsreduktion oft über einen Ernährungsberater und den Trainer professionell begleitet. Es wird geschaut, wie viel eine Person verbrennt, wie viel Kohlenhydrate und Eiweiß sie zu sich nimmt, und dann ein Ernährungsplan erarbeitet.“ Zum Problem wird es aber, wenn das Abnehmen krankhaft wird und Athleten ihre Gesundheit gefährden. „Eine übertriebene Gewichtsreduktion kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, wobei ein fließender Übergang zwischen einem gestörten Essverhalten bis hin zu einer schweren Essstörung besteht“, sagt der ehemalige IFSC-Vorsitzende Dr. Eugen Burtscher. In einer wissenschaftlichen Umfrage aus dem Jahr 2021 gaben beispielsweise 16 Prozent der Athletinnen an, keine Menstruation mehr zu bekommen. Auch Dr. Volker Schöffl, der seit über 25 Jahren als Teamarzt den deutschen Nationalkader betreut, hat immer wieder anorektische und magersüchtige Athleten behandelt. Um eine geeignetere Klassifizierung im Leistungssport vornehmen zu können, haben Sportwissenschaftler den Begriff RED-S entwickelt: Das Relative

Rabea Zühlke hat Psychologie studiert und ist schon früh mit dem Thema Essstöru ngen in Kontakt gekommen. Die Autorin hofft, das s das Thema künftig auch in der Kl etter welt sensibler betrac htet wird –und Angehörige wie Freunde den Mut haben, das Thema anzus prechen.
Energiedefizit-Syndrom (Relative Energy Deficiency in Sport) bezeichnet eine geringe Energieverfügbarkeit eines Sportlers als Folge von Übertraining oder einer negativen Kalorienbilanz. „Das RED-Syndrom kann als Überbegriff verstanden werden. Es bezeichnet nicht nur die Essstörung, sondern ebenso die Folgeschäden wie den Mangel an Knochendichte, die sekundäre Amenorrhö, also das Ausbleiben der Monatsblutung, sowie die psychische Komponente“, fasst Schöffl zusammen.
Eine Differenzierung müsse stattfinden, findet auch Lachenmeir: „Manche Sportler achten auf ein niedriges Gewicht, um funktional leistungsstärker zu sein, und nicht, weil ein dünner Körper mit dem Selbstwert verbunden ist. Das Kernsymptom einer Essstörung hingegen ist die Überbewertung von Figur und Gewicht.“ Viele Athletinnen und Athleten würden sich nach dem Wettkampf wieder etwas „gehen lassen“ und die verlorenen Kilos schnell wieder aufnehmen, weiß Alexander Megos. Trotzdem sind es gerade die Leistungssportler, die stets hohe Ansprüche an sich selbst haben. „Wenn die Person ein geringes Selbstwertgefühl hat, perfektionistisch ist und darauf bedacht ist, die Erwartungen anderer zu erfüllen, kann es gefährlich werden“, warnt die Leiterin des Therapie-Centrums für Essstörungen. All diese Punkte müssen nicht zu einer Erkrankung führen, können aber – genauso wie genetische Faktoren – eine Erkrankung begünstigen. „Ab dem Moment, in dem das Selbstwertgefühl von den Leistungen abhängig ist und das Essen den Großteil der Gedanken einnimmt, ist dies ein Alarmsignal“, so Lachenmeir.
Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde Klettern erstmals olympisch ausgetragen. „Seitdem sehen wir eine deutliche Zunahme der Problematik“, sagt der deutsche Sportarzt Schöffl. Auch Spitzenkletterer Megos findet die Entwicklungen bedenklich: „Der Grund ist sicherlich nicht das Geld. Vielmehr der Druck, der auf den Athleten lastet – genauso wie auf dem Kader, mehr Top-Athleten rauszubringen. Bei einem kritischen Gewicht macht der Verband dann eher die Augen zu.“ Für Wettkampfkletterer gab die IFSC lange einen Body-Mass-Index von 17,5 (Frauen) bzw. 18,5 (Männer) vor. 2022 wurde die Grenze für die weiblichen Athletinnen auf 18,0
Ansprechpartner bei Fragen und Sorgen
Deutschland. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Info-Telefon: +49 221 892031 bzg-essstoerungen.de
Österreich. Österreichische Gesellschaft für Essstörungen
Info-Telefon: 0800 20 11 20 (kostenlos, anonym, bundesweit) oeges.or.at/Essstoerungen
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft Essstörungen
Info-Telefon: +41 43 488 63 73 aes.ch
nach oben korrigiert. Mit dem BMI kann festgestellt werden, ob das Gewicht und die Körpergröße in einem medizinisch gesunden Verhältnis zueinander stehen. Das Normalgewicht eines Menschen liegt bei einem BMI von 18,5 bis 24,9. Mit den Vorgaben versucht die IFSC zu verhindern, dass eine Nation durch das Reduzieren des Gewichts die Leistung im Klettersport steigert. Allerdings liegt der Mindest-BMI bereits in einem sehr grenzwertigen Bereich: „Kein Sportler mit einem BMI unter 17,5 kann gesund sein. Außerdem denke ich: Sobald etwas nach außen sichtbar ist – wie das Gewicht –, haben wir auch eine Vorbildfunktion“, sagt Megos. Ähnlich besorgniserregend findet die Psychotherapeutin Lachenmeir den Wert: „Ein BMI von 17,5 ist ein klinisch relevantes Untergewicht. Ein Gewicht, bei dem die Reserven des eigenen Körpers am Limit sind und die Körperfunktionen bereits auf Sparflamme eingestellt sind.“
Die Unterschreitung der BMI-Grenze war bisher an eine gelbe Karte für den Sportler geknüpft: „Der Verband wird darauf hingewiesen, dass eine Problematik da ist, und muss medizinische Befunde einreichen“, sagt Schöffl. Was darauf folgte: die große Ernüchterung. „Selbst mit Befunden gibt es keine Konsequenzen – weder vom Verband noch von der IFSC. Beim nächsten Wettkampf taucht die schwerkranke Athletin oder der Athlet wieder auf.“ Und genau hier liegt der Teufelskreis: „Die IFSC disqualifiziert niemanden, weil es Sache der nationalen Verbände sei, auf die Gesundheit ihrer Athleten zu schauen. Aber die holen natürlich nicht ihre eigenen Athleten raus“, kritisiert Megos die Herangehensweise.
Ohne Sanktionen funktioniere das System nicht. Die beiden Sportmediziner Schöffl und Burtscher haben deswegen strengere Zugangsregeln und weitere Messwerte gefordert. „Wir messen seit über zehn Jahren den BMI und haben der IFSC bereits vor Jahren ein Konzept vorgelegt, wie man Athleten rausfiltern kann, die wirklich krank sind und einer Schutzsperre bedürfen.“ Neben dem BMI empfiehlt Schöffel den Massenindex (MI), welcher die individuelle Sitzhöhe und damit auch die Beinlänge berücksichtigt. Wer dann unter einen bestimmten Wert fällt, muss eine medizinische Dokumentation einreichen: medizinische Befunde zur Knochendichte, aber genauso psychologisch-psychiatrische Evaluierungen. „Danach werden die Athleten in ein Score-System eingeordnet und es wird entschieden, ob sie starten oder einer Schutzsperre bedürfen“, erklärt Schöffl. Auch die Kletter-Olympiasiegerin Janja Garnbret hat sich auf dem Kletterblog 8a.nu positionier t. Sie plädiert neben sofortigen Wettkampfsperren für eine obligatorische Ausbildung für internationale Wettkampfkletterer, die die Grundlagen der Ernährungsbedürfnisse von Sportlern umfasst und auch auf Essstörungen eingeht. Ziel müsste es sein, dass die Athleten und Athletinnen gar nicht erst in einen kritischen Bereich rutschen – sondern sie durch professionelle Unterstützung und Aufklärung im Vorhinein geschützt werden. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Megos: „Die Athleten dürfen auch nach dem Ausschluss nicht alleingelassen werden. Sie sollten von Psychologen und Ernährungsberatern begleitet werden, um nicht noch weiter abzurutschen.“ Auf einer Pressekonferenz Anfang Februar 2024 präsentierte die ISFC schließlich ein neues Regelwerk: Athletinnen und Athleten müssen künftig beispielsweise Fragebögen zu ihren Gesundheitsdaten wie Größe, Gewicht und Blutdruck ausfüllen, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Sind die Werte grenzwertig, sollen die Betroffenen beobachtet und bei gesundheitlichen Risiken präventiv gesperrt werden.
Was im Leistungssport teils gravierende Ausmaße angenommen hat, ist auch bei Hobby-Kletterern keine Seltenheit. Die Beta „Nimm ab, wenn du hart klettern willst“ hat wohl jeder Kletterer schon mal gehört. In welche falsche Richtung das allerdings geht, wird oft nicht umrissen: „Das unkontrollierte ‚Tunen‘ am Gewicht ist im Breitensport gerade bei jungen, ehrgeizigen Sportlern gefährlich“, sagt der Sportpsychologe Engbert. In einer amerikanischen Studie von 2019 haben Forscher über 600 Kletterer zu ihrem Essverhalten befragt. Über einen standardisierten Test zur Erfassung von Essstörungen (Eating Attitudes Test) mussten Kletterer Aussagen wie „Ich fühle mich schuldig nach dem Essen“ oder „Ich habe Angst, übergewichtig zu werden“ bewerten. Zudem wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie Aussagen wie beispielsweise „Meine Kletterleistung würde sich verbessern, wenn ich abnehmen würde“ oder „Ich versuche mein Körpergewicht zu reduzieren, um meine Kletterleistung zu verbessern“ zustimmen. Durchwegs beantworteten die Kletterer diese Aussagen mit einem Ja. Gleichzeitig stimmten jene Kletterer, welche die Fragen im Eating Attitudes Test häufiger bejahten, auch eher zu, dass Körperfett und Körpergewicht für die Kletterleistung ausschlaggebende Faktoren seien.
So wie falsches Krafttraining den Körper ruiniert, schadet ihm auch eine unterkalorische Ernährung: Bei einem drastischen Gewichtsverlust schwinden neben Fettmasse auch Knochen- und Muskelmasse, die Immunität wird geschwächt, der Hormonhaushalt gerät ins Ungleichgewicht. Bei Frauen führt das zum Ausbleiben der Regel, bei Männern zu einem gesunkenen Testosteronlevel. „Auch die Regenerationsphasen werden länger, die Verletzungsgefahr erhöht sich und das Körpergewebe ist dauerhaft gestresst“, warnt Sportpsychologe Engbert. So ist vor allem im Leistungssport ein dauerhafter Hungerzustand gefährlich, weil sich der Körper die benötigte Energie von der eigenen Substanz holt. Genau hier beginnt das Dilemma, weil Personen mit einem starken Untergewicht dennoch sportliche Hochleistungen erbringen können: „Das ist evolutionär bedingt: Wenn wir Hunger leiden, können wir trotzdem noch flüchten und auf Nahrungssuche gehen. Die Funktionen, die früher mal überlebenswichtig waren, sind also noch bis zuletzt vorhanden“, erläutert Dr. Lachenmeir.
Verstecktes Hungern, langes Leiden Leider vergehen in der Regel viele Jahre, bis eine Essstörung überhaupt erkannt wird und erste professionelle Hilfe erfolgen kann. „Bei der Anorexie um die 2,5 Jahre, bei einer Bulimie dauert es oft doppelt so lange, bis jemand im Umfeld aufmerksam wird oder eine Therapie infrage kommt“, sagt Lachenmeir. Im Schnitt dauert eine Therapie im Therapie-Centrum für Essstörungen bei Frau Lachenmeir acht Monate: vier davon in der Intensivphase, vier Monate in der Stabilitätsphase, wo die Personen schrittweise in den Alltag zurückkehren. Danach startet eine ambulante Therapie. „Oft braucht es aber mehrere Anläufe“, bedauert Lachenmeir. „Wenn man einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, kann man die Hälfte der Personen als genesen betrachten. Rund ein Drittel hat noch subklinische Symptome, die zum Beispiel in Stressphasen auftauchen – und etwa zwanzig Prozent weisen auch nach zehn Jahren noch das Vollbild einer Essstörung auf.“
Essstörungen sind ernsthafte Erkrankungen, die das ganze Leben beeinflussen und behandelt werden müssen. Der Klettersport ist dabei keineswegs pauschal als Einstieg in eine Essstörung zu betrachten, kann aber in der Kombination mit anderen Risikofaktoren einen Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Für Betroffene, Angehörige und andere Personen gibt es verschiedene Anlaufstellen, die Hilfe und Erstgespräche kostenfrei anbieten – sie unterliegen selbstverständlich alle der Schweigepflicht. ■
Quellen
Marisa Michael, 2022, climbing.com (climbing.com/skills/weightloss-eating-disorders-rock-climbing-expert-advice/); 8a.nu, 2022 (https://www.8a.nu/news/garnbret-wants-strict-bmi-rules-in-20234od6u); Dr. Kai Engbert & Dr. Tom Kossak, 2021, Mentales Training im Leistungssport; Briggs, James, Kohlhardt, Pandya, 2020, Relative Energy Deficiency in Sport
Hier geht es zum Dokumentarfilm „Light”


Normalhaken schlagen lernen ist genauso schwer, wie einen Text darüber zu schreiben –wo fängt man bloß an? Die einfachste Lösung ist wohl, einfach draufloszuschlagen – oder zu schreiben. Versuch einer Anleitung.
Von Alex Walpoth
Seit 150 Jahren werden Haken in den Felsen getrieben, um sich daran hochzuziehen oder zu sichern. Mauerhaken waren die ursprünglichsten Modelle, sie glichen eher festeren Bilderhaken und besaßen keine Öse, sodass man das Seil im besten Fall drüberlegen konnte. Als Aufstiegshilfe wurden sie natürlich auch benutzt. Der erste mit den heutigen Modellen vergleichbare Haken mit Einhängeöse wird Hans Fiechtl zugeschrieben. Die „Fiechtlhaken“ tauchten Anfang des 20. Jahrhunderts auf und dienten als Vorlage für alle späteren Modelle. Viele Jahrzehnte lang wurden die Haken von den Alpinisten

eigenhändig oder vom Schmied des Vertrauens hergestellt, sodass unzählige Varianten entstanden. Für den Haken-Interessierten ist das Klettern einer klassischen Dolomiten-Tour somit fast schon ein Ausflug ins Freilichtmuseum. Das Problem ist lediglich, dass die Haken in erster Linie unsere Sicherheit gewährleisten sollen und der spannende Blick in die Vergangenheit, den sie uns bieten, nur die Draufgabe ist
Zumindest in den Dolomiten gilt heutzutage das Erstbegehen einer Route nur mit Normalhaken als die eleganteste, „ethisch korrekteste“ Variante, der das Attribut „by fair means“ verliehen wird. Wie alles andere unterliegt auch die Ethik dem Wandel der Zeit. Der Einsatz von Normalhaken wurde am Anfang von manchen puristischen Alpinisten kritisiert. So werden „Drahtseile, Mauerhaken, Eisenstifte und Handhaben“ in einem Artikel von Fritz Eckardt aus dem Jahre 1903 bereits als „unfair means“ bezeichnet. Über Ethik, Sinn und Unsinn von Bohr- und Normalhaken wurde aber schon an anderer Stelle ausreichend diskutiert (zum Beispiel von Andreas Gschleier in „Unsere heiligen Haken“, bergundsteigen 02/12). Ich wurde ausdrücklich gebeten, in diesem Beitrag Tipps und Tricks zum Hakenschlagen zu geben.
Das Setzen eines Normalhakens ist ein Handwerk, man benötigt dazu das richtige Werkzeug. Felshämmer gibt es in verschiedenen Ausführungen, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind sicher das Gewicht, die Länge, das Material des Schafts und die Kopfform. Das Gewicht variiert ungefähr zwischen 400 und 900 Gramm. Kraft ist bekanntlich Masse mal Beschleunigung, sodass die Anzahl an notwendigen Schlägen mit einem schweren Hammer naturgemäß geringer ist. Den Gewichtsunterschied merkt man wiederum beim Klettern. Ist es absehbar, dass man viele Haken schlagen wird, zum Beispiel bei einer Erstbegehung, bevorzuge ich
einen schweren Hammer, damit die Arme nicht irgendwann zu müde zum Klettern sind. Schlägt man bloß ein paar zusätzliche Standhaken oder will für einen eventuellen Rückzug gerüstet sein, kommt man mit den leichteren Modellen auch gut zurecht. Ein Schaft aus Holz federt die Aufprall-Energie besser ab, schlägt aber mit einem höheren Preis zu Buche. Schlussendlich lohnt es sich, mehrere Hämmer auszuprobieren (nicht nur im Geschäft, sondern mit Haken am Felsen, Kurse sind dafür besonders geeignet), um für sich selbst den besten zu finden.
Bei Kursen ist es mir wichtig mitzugeben, dass der Hammer immer leicht erreichbar am Gurt hängen soll. Dafür gibt es eigene Hammerhalterungen. Bei manchen Gurten kann man den Hammer auch direkt in die hintere Materialschlaufe stecken. Eine Befestigung mittels Bandschlinge um die Brust beugt dem Verlust vor. Von der Aussage „Hammer sollte man zumindest im Rucksack mitführen“ halte ich nichts. Nur wenn der Hammer jederzeit erreichbar ist, wird man ihn öfters einsetzen, um alte Haken zu überprüfen, neue zu schlagen oder unbrauchbare zu entfernen, um sie an geeigneter Stelle wieder zurückzulassen. Grundsätzlich kann ich nur wenige Tipps niederschreiben, die in der Praxis wirklich helfen – „Übung macht den Meister“ gilt auch beim Setzen von Normalhaken. Dolomit ist durch seine Porosität ein besonderes Gestein, die Tiefe von Rissen und Löchern kann man nur schlecht einschätzen und oft muss man einige Möglichkeiten abklopfen, bevor man einen guten Haken versenken kann. Unweigerlich taucht jetzt die Frage auf: Wann ist ein Haken gut? Die Normung von modernen Haken hilft uns nur bedingt weiter, weil die Anbringung jedes Mal anders und häufig schwierig ist. Die Haltekraft wird vom umgebenden Felsen beeinflusst. Zum Beispiel ist es wenig sinnvoll, einen Haken hinter eine kleine, hohl klingende Schuppe zu schlagen. Generell

könnte man vielleicht sagen, je mehr Kraft man braucht, um den Haken einzutreiben, desto größer ist seine Haltekraft. Vor allem bei Profilhaken aus Hartstahl in Löchern habe ich aber schon öfters erlebt, dass der Haken nach vielen Schlägen plötzlich zurückspringt und sich dann mit der Hand wieder entfernen lässt (vermutlich, weil das Loch größer wird). Ohne auf Versuchsreihen zurückgreifen zu können, bin ich der festen Überzeugung, dass die Richtung und die Klemmwirkung des Hakens im Felsen eine entscheidende Rolle spielen. Aus einem senkrechten Riss zieht es einen Haken eher raus, beim waagrechten Riss sollte die Kraftübertragung günstiger sein. Ein Haken, den man von oben nach unten eintreibt, hält wahrscheinlich mehr als im umgekehrten Fall.
Laut Lehrbüchern sollte man zwei Drittel eines Hartstahlhakens und ein Drittel des Weichstahlmodells schon mit bloßer Hand versenken können, damit der Haken sich bis zur Öse reinschlagen lässt. Das mag im Granit gelten, im Dolomit, denke ich, kann man diese Regel nur schlecht anwenden, zu unterschiedlich sind die Setzmöglichkeiten.
Die Wahl der richtigen Länge ist da oft Glückssache, wird jedoch durch langjährige Erfahrung sicher erleichtert. Ein herausstehender Haken ist zwar nicht ästhetisch, kann aber problemlos abgebunden werden.
Hart- oder Weichstahl eröffnet die nächste interessante Diskussion. Hartstahlhaken lassen sich viel leichter wieder entfernen.
In die zum Teil sehr unregelmäßigen Risse oder Löcher in den Dolomiten lassen sich die biegsamen Weichstahlhaken leicht eintreiben, ohne den umgebenden Felsen zu zerstören. Eine spezielle, keineswegs neue Technik ist jene, Löcher zunächst mit kleinen Holzkeilen aufzufüllen und anschließend den Haken hineinzuschlagen. Es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Natürlich stellt sich die Frage, wie hoch die Haltekraft nach vielen Jahren noch ist, wenn das Holz längst morsch geworden ist
Alex Walpoth ist einer der jungen wilden Südtiroler, die nicht nur stark klettern, sondern sich bei ihren alpinen Erstbegehunge n der Tradition verpflichtet fühlen und wenn möglich auf den Bohrhaken ver zichten. Alex ist Bergund Skiführer, Ausbilder im AVS und hat in Innsbruck Medizin stud iert.
Wie (Haken-)Korrosion und (Fels-)Erosion die Haltekraft im Laufe der Zeit beeinflussen, ist wohl kaum einschätzbar. Prüfendes Draufschlagen kann einen Hinweis auf die innere Beschaffenheit des Hakens geben. Auch wenn die Öse nur oberflächlich rostig ist, kann der Schaft im Fels komplett durchgerostet sein.
Weil so viele unbeeinflussbare und unklare Faktoren eine Rolle spielen, bleibt uns nichts anderes übrig, als redundant zu sichern, vor allem beim Standplatzbau. Einen klassischen Dolomitenstand sollte man wo möglich immer um ein mobiles Sicherungsgerät oder einen neuen Haken erweitern. Diese Ungewissheit trägt zu den großen Abenteuern bei, die man in den Dolomiten erleben kann. Das und ein gewisses Traditionsbewusstsein sind die Gründe, warum viele Südtiroler:innen so sehr an Normalhaken hängen. Beim Alpinklettern führe ich stolz einen Hammer mit und im Zweifel denke ich an Georges Livanos’ Aussage in seinem wunderbaren Buch „Au-delà de la Verticale“: „Besser ein Haken mehr als ein Alpinist weniger, vor allem wenn ich derjenige bin.“
01 Der Hammer ist über eine armlange Schnur an einer Bandschlinge rund um die Brust gesichert. Der Hammer hängt in diesem prekären Moment, im Cliff hängend, frei hinunter, damit er besonders schnell greifbar ist und nicht erst aus der Halterung gelöst werden muss. Wenn man mehrere Risse oder Löcher „sondiert“, muss der Arm zwischendurch rasten. 2015 in der Erstbegehung „Via degli studenti“ führte ich den Camp Brenta mit Metallschaft mit …
02 Inzwischen bevorzugen wir einen Schaft aus Holz wie jenen des Black Diamond Yosemite Hammer. Vor allem wenn man viele Haken schlagen muss, ermüden die Arme weniger. Der Hammer steckt im Camp Hammer Holder, ist dort gut befestigt, stört nicht beim Klettern, ist aber jederzeit zum Einsatz bereit.
03 Mein guter Freund Titus setzt zum Schlagen eines Normalhakens an. Der kopfnahe Teil des Schaftes wurde mit einer Kordel, welche in Holzleim getaucht wurde,
umwickelt. Damit wird der empfindlichere Schaft aus Holz geschützt.
04 In „Ricordi nebbiosi“ an der Busazza hatten wir drei unterschiedliche Hammermodelle mit. Im Vorstieg wollte jeder das linke Modell verwenden. Zum Entfernen von Haken im Nachstieg eignen sich die zwei Modelle rechts im Bild besser, durch die längere und dünnere Nase kann man den Haken leichter „raushebeln“.
05 Die Hakenauswahl für eine Erstbegehung nimmt viel Zeit in Anspruch. Zur Auswahl stehen Universalhaken (auch Drehmomenthaken genannt), Querhaken, Längshaken, Messerhaken, Profilhaken oder Ringhaken jeweils aus hartem oder weichem Stahl. Schlussendlich wird es immer eine bunte Mischung aus allen Hakentypen. Schwieriger ist es, eine geeignete Stelle (Riss, Loch) zu finden als den richtigen Hakentyp, weil meistens mehrere Arten passen. Sehr feine Risse erfordern (kurze) Messerhaken, in breiten Rissen und Löchern kommen Profilhaken zum Einsatz.
06 Ein Querhaken mit Profil (Petzl U), 12 cm lang, der erstaunlicherweise in ein unscheinbares Loch versenkt werden konnte. Solche Stellen findet man nur, wenn man geduldig viele Löcher durchprobiert.
07 Der gleiche Haken aus einer anderen Perspektive.
08 Wie der Name schon sagt, sind Universalhaken am universellsten einsetzbar. Mit diesem Petzl Universel haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Öse stabil ist und sich kaum verformt. Durch die um 45° gedrehte Öse wird sowohl in Längs- als auch Querrissen eine Klemmwirkung erzeugt.
09 Längshaken sind (meiner Meinung nach zu Unrecht) seltener geworden. Durch den geraden Schaft haben sie eine gute Kraftübertragung auf die Spitze. Wahrscheinlich sind sie durch den erzeugenden Drehmoment für waagrechte Risse besser geeignet als für senkrechte. Teilweise kann man die Öse mit in den Felsen versenken, dann muss man jedoch eine (Kevlar-)Schlinge einhängen.
10 Querhaken gehören neben den Universalhaken auch zu den Alleskönnern. Wenn die beiden Seiten des Risses ungleich
tief sind, kann man sie trotzdem bis zum Anschlag versenken, ohne dass die Öse sich verkeilt. Insbesondere sind sie auch leichter zu entfernen, weil die Öse senkrecht zur Schlagrichtung steht.
11 Dieser schöne Querhaken Modell CAMP
Annello Fisso, von oben nach unten in offenbar festen Felsen geschlagen, hat höchstwahrscheinlich eine sehr hohe Haltekraft.
12 Ein Riss, zwei unterschiedliche Hakenexemplare. Der obere hält wahrscheinlich mehr, weil er durch die gedrehte Öse eine bessere Klemmwirkung erreicht. Den unteren könnte man vermutlich noch 1–2 cm versenken und die Öse mit einer Schlinge fädeln.
Hier gibt es viele Ansätze. Ich gebe euch kurz Einblick in unsere Erfahrungen am Beispiel des Projekts „Alpinist Team“ des Alpenvereins Südtirol, bei dem acht ausgewählte junge Bergsteigerinnen und Bergsteiger die Chance erhalten, zwei Jahre lang in allen alpinen Spielformen gecoacht zu werden. Wichtig ist, dass alle Kursteilnehmer mit der richtigen Ausrüstung zum Kurs erscheinen. Für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer sollte ein Hammer zur Verfügung stehen. Naturgemäß bringen alle unterschiedliche Modelle mit, sodass man gute Vergleiche anstellen kann.
Nach einer kurzen theoretischen Einführung über Hammermodelle und Hakentypen drängen die meisten schon ganz ungeduldig an den Felsen, um loszuschlagen. Bisher haben wir die Übungen immer am ersten Tag an einem Felsen in Nähe der Schutzhütte durchgeführt. Ziel ist es, unter Verwendung aller Sicherungsmittel einen soliden Stand zu bauen, also nicht nur mit Normalhaken, sondern natürlich auch mit Sanduhren, Friends und Klemmkeilen. Nach einiger Zeit schauen wir uns die Ergebnisse zusammen an. Dabei schätzen wir zunächst die Haltekraft der Einzelpunkte ein und diskutieren dann, wie diese miteinander verbunden wurden. Schon geht es in die nächste Runde, bis das baldige Abendessen zum Aufbruch drängt. Für die Entfernung der Haken sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, bei guten Haken ist man schnell eine Viertelstunde beschäftigt. ■












Lifehacks sind Tipps und Tricks, die das Leben leichter machen. Alpinhacks sollen euch das Bergsteigen erleichtern.
Über alpine Sportkletterrouten wird oft abgeseilt. Dabei werden solche Routen gerne mit Einfachseilen geklettert. Eine Hilfsleine kann dabei zum Nachholen eines kleinen Haulbags verwendet werden und ermöglicht ein Abseilen über die volle Seillänge. Welche Probleme und Fragen beim Abseilen mit Hilfsleinen häufig auftreten, klären wir hier.
Kann man ein Einfachseil und eine 5- oder 6-mm-Reepschnur zum Abseilen verwenden?
Abb. 1 Gut gemeint, aber schlecht getroffen. Zwei Sackstiche verhängen sich beim Abziehen viel leichter als einer.
Ja, zum Abseilen kann man auch Seile mit unterschiedlichen Seildurchmessern verwenden. Auch ein Einfachseil und eine 5- bis 6-mm-Reepschnur können verwendet werden.
Welcher Verbindungsknoten ist geeignet?
Als Verbindungsknoten reicht auch bei unterschiedlich dicken Seilen der einfache Sackstich. Selbst bei der Verbindung eines Einfachseils mit einer 6-mm-Kevlar- oder Dyneema-Reepschnur beträgt die Festigkeit des Sackstichs 4–5 kN, bevor der Knoten sich aufzieht. Diese Festigkeit am Einzelstrang liegt weit über den beim Abseilen auftretenden Kräften.
Erstens hängt man beim Abseilen ja an zwei Strängen, das heißt, nur die Hälfte der Belastung wirkt auf den Verbindungsknoten. Zweitens treten beim Abseilen am Stand lediglich Lasten von 70–150 % des Körpergewichts auf. 70 %, wenn sich der Abseilende bereits weiter unterhalb des Stands befindet und das Seil durch Reibung beim Aufliegen am Fels einen Teil der Last aufnimmt. 150 %, wenn der Abseilende nahe am Stand sehr ruckartig abseilt.
Abb. 2 Zwei Karabiner verstärken die Reibung.
Selbst wenn man es drauf anlegt und frei hängend ein Stück durchrauscht, um dann sehr ruckartig abzubremsen, konnten lediglich Kräfte von maximal 2,5 kN am Abseilpunkt gemessen werden (vgl. Hellberg, bergundsteigen #123). Im Worst Case werden demnach etwa 1–2,5 kN am Stand wirken. Somit wird der Verbindungsknoten nur mit 0,5–1,25 kN – das entspricht 50–125 kg – belastet. Das sind Lasten, bei denen jeder
Verbindungsknoten sich „noch langweilt“. Auf keinen Fall sollte man zwei Sackstiche nacheinander auf die Seilenden knüpfen. Denn das erhöht die Gefahr eklatant, dass sich das Seil beim Abziehen am Knoten irgendwo am Fels verhängt (Abb. 1). Die Bruchfestigkeit einer 5- bis 6-mm-Reepschnur mit einem Einfachseil kann im Übrigen nicht ermittelt werden, da der Sackstichknoten zu „rollen“ beginnt, bis die Enden durchrutschen, bevor die Bruchlast erreicht ist. Das ist der Grund, warum als Back-up die Enden des Sackstichs beim Abseilen 30 cm überstehen sollten. Selbst ein erstes Rollen stellt dann keine Gefahr dar.
Muss man zwingend eine hochfeste Dyneema- oder Kevlar-Reepschnur verwenden?
Nein. Auch eine 5-mm-Polyamid-Reepschnur besitzt in Verbindung mit einem Einfachseil eine Festigkeit von 4 kN. Allerdings bietet eine herkömmliche Reepschnur wenig Komfort beim Nachziehen des Haulbags, da sie zu viel Dehnung besitzt und zudem eine deutlich geringere Kantenfestigkeit als Kevlar- oder Dyneema-Reepschnüre zeigt.
Welches Abseilgerät eignet sich?
Als Abseilgerät funktioniert das Tube. Kombiniert man ein dünnes Einfachseil mit einer Reepschnur, kann die Bremswirkung sehr gering werden, weshalb man dann zwei Karabiner unter dem Tube verwenden sollte (Abb. 2).
Was kann man machen, damit sich das Seil beim Abseilen am Stand nicht verschiebt?
Wer des Öfteren an unterschiedlich dicken Seilen abgeseilt hat, wird beobachtet haben, dass sich zu Beginn der Abseilfahrt das Seil im Abseilring verschiebt. Grund ist, dass auf das dünnere Seil im Tube eine geringere Bremskraft wirkt. Somit rutscht es nach oben in Richtung Abseilstand, während das dicke Seil beim Abseilen langsam abgezogen wird. Das geschieht, bis entweder der Verbindungsknoten am Abseilring ansteht oder – wenn sich der Verbindungsknoten auf der Seite des dickeren Strangs befindet – bis das Seil am Fels aufliegt. In der Regel hört dieses Phänomen also nach einigen Abseilmetern auf. Seilt man komplett überhängend ab und befindet sich der Knoten auf der Seite des dicken Seilstrangs, kann das jedoch ein Problem darstellen.
Vermieden wird das Verrutschen, wenn der Knoten auf der Seite des dünnen Seils platziert wird und an der Abseilöse ansteht. Hat man das Seil bereits gefädelt und abgezogen und möchte den Verbindungsknoten nicht erneut auflösen und auf der anderen Seite des Abseilrings wieder einknoten, kann auch das Tube des zweiten Abseilendes bereits ins Seil eingelegt werden. Die Reibung im unbelasteten Tube verhindert bereits das Verschieben der Seilstränge.
Bei der zweiten Person wird dann zu Beginn der Abseilfahrt das dünne Seil vom unteren Kletterer mit der Hand festgehalten, gerade so stark, dass es nicht wandern kann, aber dem oberen das Abseilen noch ermöglicht. Nach den ersten Metern wird dann die Reibung am Fels ein Verrutschen sowieso verhindern. Techniken mit einer Karabineraufhängung zur Fixierung des Einzelstranges am Stand, um dann am Einzelstrang abseilen zu können, sind eher problematisch. Zwar kann das Seil dabei nicht verrutschen, jedoch lässt sich das Seil durch die erhöhte Reibung oft nur schwer abziehen. Zudem kann sich ein Seil mit fixiertem Karabiner beim Abziehen leicht verhängen. Nur
bei steilen Abseilern (z. B. Canyoning), bei denen das Seil sich nicht so leicht am Fels hängenbleiben kann, ist das eine gute Option (Abb. 3).
Was ist beim Abziehen zu beachten? Abgezogen wird am besten immer an der Hilfsleine (Abb. 4). Das setzt voraus, dass der Knoten auf der Seite des dünnen Seilstrangs gelegt ist – was ja auch ein Vermeiden des oben beschriebenen Problems des Wanderns bewirkt. Denn dadurch fällt das dicke, steifere Seil runter. Zöge man am dicken Strang ab, würde die dünne Hilfsleine am Fels entlang nach unten fallen, was häufiger zum Verhängen führt und auch eine erhöhte Tendenz zum Seilverhau zeigt. Es lohnt sich also, beim Abseilen über mehrere Seillängen beim Abziehen den Verbindungsknoten immer auf der Seite des dünnen Seilstrangs anzubringen (Abb. 5). ■
Abb. 4 Immer an der Hilfsleine abziehen.
Abb. 3 Am blauen Einzelstrang wird abgeseilt. Über die rote Hilfsleine wird das Seil abgezogen. Techniken mit Karabineraufhängung sind jedoch oft problematisch, da der Karabiner sich beim Abziehen leicht verhängt.
Abb. 5 Knoten auf der Seite des dünnen Seilstranges knüpfen.
Text: Chris Semmel
Illustrationen: Georg Sojer
Zum Download der Nivocheck-App im Google Play Store
Zum Download der Nivocheck-App im Apple App Store


y Nivocheck App für Lawinen
In dieser bergundsteigen-Ausgabe wird der überarbeite Nivocheck 2.1 des Schweizer Bergführerverbandes für die Beurteilung der Lawinengefahr vorgestellt. Achtung! Es gibt auch eine App mit dem Namen Nivocheck. Die App ist die digitale Abbildung des Nivocheck von Werner Munter, aber in der alten, ursprünglichen Version. Der überarbeitete Nivocheck 2.1 ist in keiner App erhältlich. Mittels Abfrage führt die App durch den Entscheidungsprozess für den alten Nivocheck. Im ersten Teil werden die Kriterien für die Schneedeckenbildung abgeschätzt. Im zweiten Teil geht es um die Einschätzung der Warnstufe. Beide Teile zusammen ergeben die lokale Warnstufe. Anschließend kann diese Warnstufe noch wahlweise mit dem „Bierdeckel“, der elementaren oder der professionalen Reduktionsmethode verknüpft werden und so als Entscheidungsgrundlage dienen. Die Nivocheck-App ist ein praktischer Wegbegleiter für alle, die sich etwas mehr mit der Lawinengefahr beschäftigen möchten und/oder in einer Region ohne Lawinenlagebericht unterwegs sind bzw. lokal überprüfen möchten, ob die Einschätzung des Lawinenlageberichts passt. Aber nochmals: Nivocheck App ist nicht Nivocheck 2.1! [Georg Rothwangl]




y Alpine Notfallmedizin.
Deutsche Ausgabe
Das internationale Standardwerk „Mountain Emergency Medicine“, 2021 herausgegeben von Hermann Brugger, Ken Zafren, Luigi Festi, Peter Paal und Giacomo Strapazzon, ist im Herbst 2023 auf Deutsch erschienen. Die haptische Qualität der deutschen Ausgabe wurde gegenüber der englischen Originalausgabe nochmals verbessert.
Einige Kapitel wie z. B. Akzidentelle Hypothermie wurden aufgrund neuer Publikationen komplett überarbeitet. Aktualisiert wurden auch die Notfallalgorithmen, sie entsprechen nun den gültigen Richtlinien des European Resuscitation Councils (ERC) von 2021. Der Aufbau der englischen Ausgabe wurde beibehalten. Die Kapitel befassen sich mit der Geschichte der alpinen Notfallmedizin, mit der medizinischen Behandlung von allgemeinen Notfällen im alpinen Gelände, mit Großunfällen und spezifischen alpinen Notfällen, wie z. B. akzidenteller Hypothermie, Erfrierungen, Canyoning- und Kletterunfällen, Höhlenund Lawinenrettung. Das Werk wird von allen deutschsprachigen alpinen Vereinen und Rettungsorganisationen empfohlen. Ein Must-have für alle Bergbegeisterten mit alpinmedizinischem Interesse!
[Gebi Bendler]


y Sehnsucht Weitwandern Verlockende Fernwege in Österreich
Alpenvereinsmitglied Claudia Schallauer hat über 35.000 Höhenmeter und 850 Kilometer Wegstrecke auf den österreichischen Weitwander-Routen zurückgelegt und erzählt von ihren Erlebnissen. Dabei gibt die Wanderführerin, die auch Tourenführerin bei der österreichischen Alpenvereinssektion Gmunden ist, wertvolles Praxiswissen weiter – von der Packliste und der notwendigen Ausrüstung bis zur Anreise, Verpflegung und Nächtigung. Das Buch ist ein interessantes Kompendium für alle, die das Weit(-er)wandern ausprobieren und genießen wollen! Vier der schönsten Weitwanderwege in Österreich werden im Detail vorgestellt: Johannesweg, Luchstrail, Lebensweg und Hohe Tauern Panorama Trail. Tipp der Autorin: „Wenn du das erste Mal eine (längere) Weitwanderung unternimmst, empfehle ich dir ein Einwandern von drei bis vier Tagen, um zu eruieren, wie es dir mit einem schwereren Rucksack geht und ob deine Schuhe dich gut tragen. Der Johannesweg in Oberösterreich ist für mich in dieser Hinsicht die perfekte EinsteigerMehrtageswanderung.“
[Gebi Bendler]


y Neuauflage: Kletterspiele für Kletterwand und Turnsaal
Das Werk – jetzt neu überarbeitet – ist mittlerweile ein Klassiker im Bereich Sportkletter-Lehrmittel und bietet 186 Vorschläge für aufregende und spielerische Kletterstunden, insbesondere für Kinder, Jugendliche und kletterbegeisterte Erwachsene. Es richtet sich an Lehrerinnen, Trainer, Eltern und alle, die Klettern professionell oder ehrenamtlich vermitteln. Der Inhalt umfasst allgemeine Aufwärmspiele, Klettertechniken, Boulder- und Trainingsspiele. Zudem gibt es Anleitungen für kletterspezifische Übungen im Turnsaal ohne Kletterwand. Das Buch ist durch präzise Grafiken anschaulich illustriert und wurde von Bergsportexpert:innen des Österreichischen Alpenvereins verfasst und herausgegeben. [Alexandra Schweikart]


y Val di Mello. Trad- und Sportklettern in der Wiege des Freikletterns in Italien
„Kein anderes Tal der Alpen kann es mit dem Val die Mello aufnehmen“, schreibt Führerautor Niccolò Bartoli, 1991 in Mailand geboren. Oben steile Wände, unten eine ebene Talsohle, durchzogen vom türkisblauen Wasser des Wildbachs. Das Val di Mello ist ein legendärer Ort in der Geschichte des Kletterns: Hier hat in den 70er-Jahren eine Gruppe junger Leute das Klettern in Italien quasi neu erfunden und Routen in einst unmöglichen Wänden geschaffen, inmitten einer imposanten und mächtigen Natur. Auch davon handelt dieser Führer. Ein Buch mit langem Atem, in dem jede Route mit ihrem Charakter und ihrer Kraft dargestellt wird, egal ob Pionierarbeit aus den 70ern oder noch ganz junges Werk. Von einigen der Pioniere sind schriftliche Zeugnisse erhalten und abgedruckt, die von einer Zeit erzählen, in welcher der Alpinismus und die Art, ihn zu leben, komplett revolutioniert wurden –die Wiege des freien Kletterns in Italien findet man im Val die Mello! [Redaktion]

Tom Dauer schreibt an dieser Stelle regelmäßig über seine Gedanken zum komplexen Themenfeld Mensch und Natur.
In den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für mich. Nicht in den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für andere und die Natur ganz allgemein. Was also soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten – meinen Mitmenschen und der Berg-Natur-Kultur-Landschaft gegenüber?
Tom Dauer sucht Antworten. #inunsrernatur 13
Ich will ganz ehrlich sein, und auch ein bisschen persönlich. Deshalb zu Beginn ein Geständnis: Diese Kolumne zu schreiben, ist eine der interessantesten und zugleich schwierigsten Aufgaben, denen ich mich als Autor regelmäßig stelle. Ich habe lange überlegt, warum das so ist, und glaube, den Grund gefunden zu haben; nämlich den latenten Widerspruch zwischen dem, was ich auf dieser Seite niederschreibe, und dem, was ich bin.
Tatsächlich fiel mir beim Durchlesen der bisher erschienenen Texte auf, dass die meisten einen eher negativen Beiklang haben. Vermutlich liegt das daran, dass sie aus einer abwehrenden Haltung heraus entstanden sind, und um auch diesbezüglich ganz ehrlich zu sein: Das ist durchaus berechtigt, denn der Alpinismus, das Bergsteigen und ganz generell das Unterwegssein in den Bergen sind auf vielerlei Weisen bedroht. Ambitionierte Naturschützer und solche, die sich dafür halten, plädieren und sorgen für immer mehr Betretungsverbote und Aktivitätseinschränkungen. Auf der anderen Seite machen Touristen, die ohne jegliches Erfahrungswissen in die alpine
Sekundärwildnis eindringen, genau diese Maßnahmen notwendig. Outdoorfirmen, Bergmedien und Influencer werden nicht müde, das Leben in den Bergen zu preisen und tragen mit ihren Geschäftsmodellen zur Verunmöglichung desselben bei. Überhaupt, das Business … manchmal habe ich den Eindruck, dass es inzwischen mehr Experten, Lehrer, Coaches und Trainer für alle Fragen rund um den Bergsport gibt als Menschen, die ihn betreiben.
Also gut, ich könnte noch ein bisschen so weitermachen, denn es liegt vieles im Argen, über das ich mich aufregen könnte. Andererseits habe ich die Stimme meines damals 14-jährigen Sohnes im Ohr, der zu mir sagte, ich solle mich fragen, ob mein Ärger so groß sei, dass ich auf dem Sterbebett drüber nachdenken würde. Dieser Anflug kindlicher Weisheit hat mir schon über manche miese Laune hinweggeholfen. Angesichts der Ewigkeit verdünnisieren sich viele Probleme einfach von selbst. Außerdem, um auf den eingangs erwähnten Widerspruch zurückzukommen: Ich kann zwar ganz schön grantig sein und meinen Grant im Geschriebenen darstellen, im Grunde aber bin ich ein durchwegs optimistischer Typ, der in seinen Mitmenschen vor allem das Gute und in der Zukunft eine Palette an Möglichkeiten sieht. Statt mich allzu lange über irgendeine Unbill zu grämen, suche ich in Fehlern, Niederlagen, Missverständnissen und Missgeschicken das Positive. Ich bin stoisch genug, um das sein zu lassen, was ich nicht ändern kann. Und wenn es jemand schafft, den Absurditäten des Lebens die Schönheit einer sinnstiftenden Geste entgegenzuhalten, dann freue ich mich.







Kurzum, nachdem ich in den vergangenen Ausgaben Zustände benannt habe, die mir ungerechtfertigt und ungerecht erscheinen, möchte ich mich künftig mit Menschen befassen, die Lösungen für die Probleme und Konflikte entwickeln, die es in den Bergen gibt. Damit meine ich nicht nur Großprojekte, die im Rahmen des europäischen Alpenraumprogramms (Interreg Alpine Space) gefördert werden und deren oft erstaunliche Ergebnisse im Elfenbeinturm der Wissenschaft einstauben. Eher geht es mir um lokale und regionale Initiativen, um konkrete Taten, um damit verbundene Schwierigkeiten und wie sie bewältigt werden, um Ergebnisse – und vor allem geht es mir um die Menschen, die hinter diesen, oft im Verborgenen stattfindenden Arbeiten stecken. Und von denen ich zu lernen hoffe. Einige Frauen und Männer, von deren Engagement ich weiß und deren Leistung ich bewundere, habe ich bereits auf meiner Liste. Aber um wieder ganz ehrlich zu sein: Ich bin auf Ihre Mithilfe, liebe Leserin und
lieber Leser, angewiesen. Vielleicht kennen Sie jemanden, der den Rückbau eines Skigebiets initiiert, Konflikte zwischen Jägern und Kletterern gelöst hat oder Bergtouren mit kulturellem Hintergrund führt? Oder jemanden, die ihr Leben lang mit dem Fahrrad in die Berge gereist ist, ein Verkehrskonzept für die Anreise in eine entlegene Region ausgearbeitet hat? Jemanden, der etwas ganz Neues, Anderes erdacht hat? Und über die oder den wir alle etwas wissen sollten?
Wenn dem so ist, dann schreiben Sie mir bitte (redaktion@bergundsteigen.at). Weil: Geld und Angst haben wir noch nie gehabt. Dafür aber Zuversicht. ■









Bergführer Christian Hechenberger hatte zwei schwere Unfälle. Anschließend interviewte ihn Walter Würtl dazu. Nun, zwei Jahre später, hat ihn Walter nochmals getroffen und nachgefragt ...

bergundsteigen Jahrgang 33, Auflage: 27.000 Herausgeber Deutscher Alpenverein, Schweizer Alpen-Club SAC, Alpenverein Südtirol, Österreichischer Alpenverein
Medieninhaber Österreichischer Alpenverein, ZVR 989190235, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Fon +43 512 59547-30, redaktion@bergundsteigen.at
Redaktion Gebhard Bendler – Chefredakteur, gebhard.bendler@alpenverein.at, Dominik Prantl, Alexandra Schweikart, Chris Semmel, Birgit Kluibenschädl
Onlineredaktion Simon Schöpf, Rabea Zühlke, www.bergundsteigen.com
Redaktionsbeirat Herausgeber Michael Larcher, Gerhard Mössmer, Markus Schwaiger, Georg Rothwangl (alle ÖAV); Julia Janotte, Stefan Winter, Markus Fleischmann (alle DAV); Marcel Kraaz (SAC); Stefan Steinegger (AVS) Redaktionsbeirat Bergführerverbände Albert Leichtfried (VÖBS), Reto Schild (SBV), Erwin Steiner ( Berg- und Skiführer Südtirol), Michael Schott (VDBS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.com
Abonnement € 36,– / Österreich € 32,– / vier Ausgaben (März, Juni, September, Dezember) inkl. Versand und Zugang zum Online-Archiv auf www.bergundsteigen.com
Aboverwaltung Theresa Aichner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.com
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at, Anna Brunner Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl, Stefan Heis Druck Alpina, 6022 Innsbruck
Eigenverantwortung. Ein Schlagwort, das in der Bergsportszene seit vielen Jahren präsent ist. Braucht es mehr Eigenverantwortung?

Dialog Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie über Beitragsvorschläge (redaktion@bergundsteigen.com) und bitten um Verständnis, dass wir nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrücklich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.com in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen.
Inhalt Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autor:innen wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpub- likum, das an aktuellen Entwicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen inter- essiert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem unten abgebildeten Stempel gekennzeichnet.
Werbung Die abgedruckten Inserate haben keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichterstattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemeinsam Messungen/Feldtests o. Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redaktion nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil, welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.
Titelbild grafische auseinandersetzung, Telfs – Julian Rappold, Anna Höllrigl
bergundsteigen fördert Land Tirol
bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.





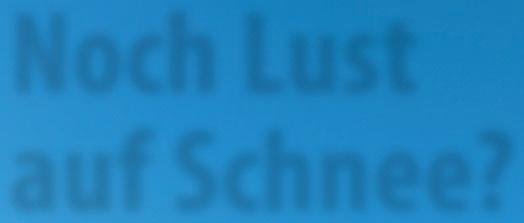








Wetter & Schneelage gecheckt?
Die Schneehöhen und Wetterkarten unter „Wetter & Klima“ helfen dir dabei.



Lawinenlage gecheckt?
Auch in der App sind die Lageberichte nun mit allen Infos enthalten.


Route gut geplant?
Mit ATHM-Karte und HangneigungsLayer gut informiert die Spur anlegen.


Tourenbeschreibungen gelesen?
Unter „Mehrtages-Skitouren“ findest du Durchquerungen und Hüttentouren.








-Ltd. Edition
Pro verkau昀em Set spenden wir 5,00 € an die Kinderkrebshilfe


