heft #4.2025 — Dezember/Jänner/Februar
Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875

heft #4.2025 — Dezember/Jänner/Februar
Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875

t hema
Kälte, Absturz, Lawine: praxisnahes Wissen für richtige Entscheidungen am Berg.
_ 12
UN te RW e GS Alte Wege.
Ein Blick in die Vergangenheit _ 52
R e SP e K t VOLL Klima bewegt.
Rückblick auf das AV-Klimajahr _ 76
KULt UR
In der Schatzkammer.
Zu Besuch im Alpenvereinsdepot _ 98


YOU SHINE FOR A MOMENT: LIGHTING UP THE NIGHT, DRAWING LINES. LISTENING TO YOUR BODY, YOUR BREATH, YOUR HEARTBEAT. FOLLOWING YOUR OWN RHYTHM, SHARING THE NIGHT WITH YOUR PEOPLE. SET THE TONE, OF YOUR NIGHT.


Ivona Jelčić schreibt als Kulturjournalistin für die Tageszeitung Der Standard und weitere Medien. Sie ist Autorin mehrerer Bücher zu Themen aus Kunst, Kultur, Architektur, Zeitgeschichte und Gesellschaft. Für dieses Bergauf hat sie einen Blick in „Die Schatzkammer“ des Alpenvereins (S. 98) geworfen.

Georg Rothwangl ist wichtig, Wissen über die Natur zu vermitteln (S. 82), damit Wildtiere und Pflanzen weiterhin ihren Platz in den Bergen haben. Als Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung und Naturschutz, Forstwirt, Aufsichtsjäger und Bergsportler lädt er in Bergauf immer wieder dazu ein, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.


Chefredakteurin Bergauf
wenn der Winter ins Land zieht, ändert sich nicht nur der Ausblick auf die Berge – auch unsere Art, sie zu erleben, bekommt eine neue Dynamik. Gemeinsam ziehen wir los: mit Ski, Schneeschuhen oder einfach auf eigenen Spuren im Schnee. Die Bewegung in der Winterlandschaft ist ein Kernstück unseres Bergsports – und ein verbindendes Element im Alpenverein.
Damit wir diese Erlebnisse sicher genießen können, braucht es Wissen, Vorbereitung und Austausch. Genau hier setzt unser neues „WinterUpdate“ an: eine Vortragsreihe, die aktuelles Lawinen- und Schneewissen niederschwellig zugänglich macht – getragen von Experten und mit dem klaren Ziel, sicheres Unterwegssein mit genussvollem Bergsport zu verbinden.
Dass der Alpenverein aber mehr ist als Sport, zeigt sich auch in anderen Facetten dieser Ausgabe: in der Patenschaftsaktion im Nationalpark Hohe Tauern, wo Vereinsmitglieder aktiv zum Schutz seltener Arten beitragen, oder in der Geschichte der Kartographie, die unseren Blick auf die Alpen über Generationen geprägt hat.
Und schließlich blicken wir zum Abschluss des 150-Jahr-Jubiläums von Bergauf auf das, was uns als Magazin und als Verein verbindet: die Leidenschaft für die Berge – und das Miteinander auf allen Ebenen. Ob in der Alpenvereinssektion, auf der Hütte oder im Lesesessel: Es sind die Menschen, die diesen Verein lebendig machen.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen – und einen sicheren, gemeinschaftlichen Winter in den Bergen.
Fotos:
Vanessa Berger ist Ökologin an der Fachhochschule Kärnten. Ihr Schwerpunkt liegt auf neuen Technologien für das Monitoring von Biodiversität und Ökosystemen. In ihrer Freizeit erkundet sie gerne die Bergwelt der Hohen Tauern (S. 70).
He F t # 4.2025
Dezember/Jänner/Februar

10 Bildgewaltig
12 Kalt erwischt
Wie man sich vor Temperatur, Wind und Strahlung schützt
16 Lawine und Absturz
Alpine Gefahren erkennen und vermeiden
20 Tipps vom Bergsport: So bleibt die Tour absturzfrei
22 Rückschläge und mentale Werkzeuge im Bergsport
Teil 1 einer neuen Bergauf-Serie über den Weg zurück
26 Tourentipp: Schneeschuhtour auf den Wiederachriedel
28 Tourentipp: Skitour auf den Hochkasern
30 Surviving Osttirol
Rückblick auf einen Tourentag der besonderen Art mit risk’n’fun FREERIDE
34 Wintererlebnisse
Ausbildungen der Alpenverein-Akademie abseits von Skitouren
36 Skitest
Das Titelbild ist in den Tuxer Alpen auf dem Grat vom Glungezer (2.677 m) zur Kreuzspitze (2.746 m) von Peter Plattner aufgenommen worden.
3 edit OR ia L 7 aUSGa NGSPUNK t
We G etatiON
48 Gratulation: Umweltgütesiegel für Alpenvereinshütten
52 Alte Wege
Ein Blick in die Vergangenheit
56 Funktionstipp: alpenvereinaktiv
58 Die Geschichte der Kartographie
64 MoMo Inklusionsfestival
K t VOLL
70 Nationalpark Hohe Tauern: Patenschaft
75 Zahlen, bitte: Wie erhebt man CO2-Emissionen in einem Verein?
76 Klima bewegt Ein Rückblick auf das Klimajahr im Alpenverein
80 Klimakrise im Hochgebirge Was der neue Klimabericht für die Alpen bedeutet
84 Beyond Snow Zukunft ohne Schneegarantie
88 Lauenen ist neues Bergsteigerdorf
90 Alpingeschichte in Göriach
97 Schaukasten: Edelweiß-Ofenkachel
98 In der Schatzkammer Zu Besuch im Depot des Alpenvereins
102 150 Jahre Bergauf
104 Bildgeschichten: Hinter den Kulissen einer Postkartenlandschaft

Geschichte der Kartographie im Alpenverein In über 150 Jahren hat sich die Alpenvereinskarte zu einem Musterbeispiel der Gebirgskarte entwickelt. Wie es dazu kam? Bergauf öffnet ein Fenster in die Vergangenheit.
Foto: Gerold Benedikter
Jetzt auf digitale
Beitragsvorschreibung umstellen!
Schont die Ressourcen mit einem Klick!

Bergauf digital lesen oder per Post erhalten? Weitere
Mitgliedermagazin

Deine AlpenvereinsMitgliedskarte gibt es auch digital.



Alpenvereinskalender erhalten oder abbestellen?

Je mehr wir sind, desto mehr können wir bewegen. Begeistere deine Freunde von den Vorteilen der Alpenvereinsmitgliedschaft und hole dir dein persönliches Dankeschön!

1 neues Mitglied
Du bekommst eine unserer Alpenvereinskarten* deiner Wahl und zusätzlich einen Alpenvereins-Kuli.

Du bekommst ein Jahresabo PRO für die App alpenvereinaktiv.com im Wert von € 30,–.

Du bekommst einen Gutschein im Wert von € 100,–von SPORTLER**.

* Expeditions- und Sportkletterkarten sind von dieser Aktion ausgenommen.
** Der Warengutschein von Sportler kann im Onlineshop www.sportler.com, in allen Sportler-Filialen oder telefonisch unter +39/0471/208202 eingelöst werden. SPORTLER Innsbruck Grabenweg SPORTLER Alpine Flagship Store Innsbruck SPORTLER Alpin Kufstein Atemberaubende Sportmomente



dOR i S h a LL ama
Alpenvereins-Vizepräsidentin
Oder: Warum alpine Infrastruktur mehr ist als nur ein Netz aus Steinen und Holz.
Alte Saumpfade und moderne Schutzhütten prägen den Alpenraum – und unser Verständnis vom Unterwegssein in den Bergen. Sie erzählen Geschichten, stiften Gemeinschaft und geben Halt – auch im übertragenen Sinn. Ihre Erhaltung ist ein stilles Engagement, das politische Unterstützung verdient. Denn Hütten und Wege sind nicht nur Infrastruktur, sondern Ausdruck gelebter Verantwortung im Gebirge.
Wer durch die Alpen wandert, folgt nicht selten alten Spuren. Historische Steige, Saumpfade und Übergänge erzählen Geschichten – von Handel, Flucht, Krieg, aber auch von Begegnung und Verbindung.
Denn Hütten und Wege sind nicht nur Infrastruktur, sondern Ausdruck gelebter Verantwortung im Gebirge.
Diese Wege sind nicht nur Teil unseres kulturellen Erbes, sie sind auch ein Fundament für den heutigen Bergsport. Ihre Pflege und Erhaltung sind eine stille, oft unsichtbare Leistung – getragen von den vielen Ehrenamtlichen in unseren Sektionen.
Genauso still, aber wirkungsvoll ist der Betrieb unserer Schutzhütten. Sie bieten Schutz, Orientierung
und Gastfreundschaft – auch unter immer herausfordernderen Bedingungen. Dass der Österreichische Alpenverein heuer vier neue Hütten mit dem Umweltgütesiegel auszeichnen konnte, zeigt: Nachhaltigkeit im Gebirge ist kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis.
Der Sanierungsstau ist groß, die Herausforderungen wachsen.
Umso wichtiger ist es, dass auch die Politik Verantwortung übernimmt. Dass die Bundesregierung nun zusätzlich 11 Millionen Euro für den Erhalt alpiner Infrastruktur bereitstellt, ist ein Schritt in die richtige Richtung – auch wenn wir als Alpenverein 95 Millionen Euro als notwendig erachten. Denn der Sanierungsstau ist groß, die Herausforderungen durch Klimaerhitzung, Extremwetter und Nutzungsdruck wachsen. Jeder investierte Euro kommt nicht nur den alpinen Vereinen und vor allem jenen, die in der Bergwelt unterwegs sind, sondern dem gesamten Alpenraum zugute.
Hütten und Wege sind mehr als Infrastruktur –sie sind Ausdruck einer Haltung: zugänglich, gemeinschaftlich, verantwortungsvoll. Es liegt an uns allen, diesen Weg weiterzugehen.

IDas Foto stammt von Erich Auer. Nach einem dichten Schneefall lief ihm das scheue Wild vor einem Bauernhof vor die Kameralinse. „Die Gruppe war sichtlich auf der Suche nach Fressbarem“, erzählt Erich. Das Foto entstand in Fellbach bei Lind im Drautal.
Dieses Bild wurde vor wenigen Wochen auf unserem InstagramKanal veröffentlicht. Wir haben einige FollowerKommentare für euch eingefangen: »Ohren.« I »Ich sehe was, was du nicht siehst.« I »Und wenn du bis zu den Ohren im Schnee steckst, es geht immer weiter.« I »Rücksicht auf Wildtiere im Winter!« I »Ruhe, Innehalten, ein Moment voller Zauber.« I »Fledermaus oder Rentier, man weiß es nicht.« I »Ich kenne da eine Abkürzung.« I »Schnee legt sich wie ein Schleier aus Stille über das Land.« I »Lauter Flügelmuttern.« I »Hier heißt es Rücksichtnahme.« I »Stehen bleiben, langsam und leise den Rückzug antreten.« I »Spotted!« I »Kuuurt, ich komm nicht weiter!« I
Museum am Berg


Wildlife Photographer of the Year
Cardfolder Mobilität
Welche Vorteile bieten ÖffiTouren und wie gelingt die Planung von umweltschonenden Bergabenteuern?

Ein Museum auf 1.744 Metern Höhe – von schroffen Rätikon- Gipfeln umgeben: Auf der Lindauer Hütte des Deutschen Alpenvereins öffnet eine Ausstellungsreihe ein Fenster in die Geschichte. Die aktuelle Ausstellung erzählt von den Pionier*innen der Rätikon-Besteigungen. Sie ist noch bis Herbst 2026 zu sehen.


Sebastian Frölich hat mit seinem Foto „Speicher“ den Wildlife Photographer of the Year 2025 des Londoner National Museums gewonnen, Kategorie Wetlands – The Bigger Picture. Das Foto ist auch im Buch „Das Platzertal – Ein bedrohter Schatz in Tirol“ zu finden, das der Alpenverein mitfinanzierte.

Der neue Cardfolder Mobilität des Alpenvereins gibt praktische Tipps und liefert spannende Fakten rund um die Mobilität im Bergsport. QR-Code scannen und Cardfolder kostenlos online lesen.


„Overtourism: Drehkreuz statt Gipfelkreuz?“ – Im Alpenvereinspodcast #58 dreht sich alles darum, wie die Zukunft am Berg aussehen könnte und was der Ansturm auf die Berge bedeutet. Das alpenverein basecamp entsteht mit Unterstützung der Generali Versicherung. Hier zu hören: alpenverein. at/basecamp

… Millionen Euro hat die Bundesregierung den alpinen Vereinen Österreichs als zusätzliches Rettungspaket zum Erhalt der Schutzhütten und Wanderwege zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der dramatischen Kürzungen aller Budgets ist die Bereitstellung dieser Mittel ein starkes Signal. Die alpinen Vereine wie der Österreichische Alpenverein, die Naturfreunde Österreich, der Österreichische Touristenklub und weitere neun Vereine halten ehrenamtlich insgesamt 272 alpine Schutzhütten in Extremlage instand und pflegen ein 50.000 km langes Wegenetz – für alle Menschen, die am Berg Erholung suchen.
Über 100.000 Mitglieder der alpinen Vereine haben die Petition „Notruf aus den Alpen“ unterschrieben. Ihr Engagement und das aller Weggefährt*innen trägt entscheidend dazu bei, Hütten und Wege zu erhalten. Mehr erfahren: www.notruf-aus-den-alpen.at


¡ Informationen zum Alpenvereinsjahrbuch BERG 2026:

Die 150. Ausgabe des Alpenvereinsjahrbuchs ist da! Protagonist des Jubiläumsbandes ist – wie schon im allerersten Jahrbuch – der Großvenediger. 1865, als der erste Band erschien, ging die Kleine Eiszeit gerade zu Ende. Heute verkörpern die rasant schmelzenden Gletscher den Beginn einer neuen Epoche. Alpenvereinsmitglieder, die ihr Jahrbuch direkt bei ihrer Sektion erwerben, beziehen mit diesem Band gratis die Alpenvereinskarte 36 Großvenediger, Maßstab 1:25.000. Bergauf wünscht eine genussvolle Lektüre!

Ich freue mich auf die Abwechslung, die der Winter bereithält. Es ist die Jahreszeit, in der man flexibel sein und sich anpassen muss. Ich komme im Sport mit Hitze und Kälte gleichermaßen gut zurecht. Doch man muss sich erst an die Kälte des Winters gewöhnen. Und das dauert eine Weile. Minus vier Grad können sich im Herbst kälter anfühlen als später im Hochwinter. Winter bedeutet auch, in andere Sparten des Sports zu wechseln. Man beschäftigt sich intensiver mit den Gegebenheiten in der Natur, wie etwa der Lawinengefahr. Besonders im Winter wechseln die Bedingungen rasch. Und an manchen Tagen muss man akzeptieren, dass es besser ist, gar nicht erst in die Berge aufzubrechen. —
Philipp Brugger war als Vortragender zu Gast in Graz auf der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins.

Hoch hinaus. Am Grat zählt nicht nur die Kondition, sondern auch die Entscheidungskraft. Schnee kann trügen, Wind verfälschen, Spuren verleiten. Lawinen, Wetterumschwünge, Orientierungslosigkeit – sie sind keine dramatischen Ausnahmen, sondern ständige Begleiter, wenn wir die gesicherte Piste verlassen. Sichere Entscheidungen beginnen weit unterhalb des Gipfels – in der Planung, im Wissen, im ehrlichen Einschätzen der eigenen Fähigkeiten. Und sie enden nicht mit dem Erreichen des Ziels, sondern mit der gesunden Rückkehr.

Das Thema Wärmemanagement wird auch im neuen Winter Update umfassend behandelt.
Mehr Infos zur Veranstaltung und den Terminen gibt es hier.

Das Wärmemanagement ist im Winter von zentraler Bedeutung. Der Schutz vor Temperatur, Wind und Strahlung steht dabei im Fokus.
t hOma S Wa NN e R

In der alpinen Welt ist die Kälte ein stiller, aber unerbittlicher Gegner. Während technische Herausforderungen, Höhenmeter und körperliche Erschöpfung die Aufmerksamkeit binden, wird die Gefahr durch Auskühlung häufig unterschätzt – oft mit schwerwiegenden Folgen. Wer in den Bergen unterwegs ist, muss sich mit dem Thema Wärmemanagement intensiv auseinandersetzen. Es geht nicht nur darum, komfortabel zu bleiben, sondern konkret darum, die Gefahr durch Unterkühlung, Erfrierungen, Windchill und notfalls das Biwakieren im Freien zu beherrschen.
Auch im Sommer kann Wärmemanagement zum Thema werden, wenn wir etwa in der prallen Mittagshitze in südseitigen Hängen unterwegs sind oder intensiver
Sonnenstrahlung exponiert sind. Mehr dazu aber im Frühjahrs-Bergauf!
Unterkühlung – wenn der Körper die Kontrolle verliert
Die Unterkühlung, medizinisch Hypothermie genannt, ist eine der häufigsten und gefährlichsten Folgen unzureichenden Wärmemanagements. Sie tritt ein, wenn die Körperkerntemperatur unter 35 Grad Celsius sinkt. Bereits ein leichtes Absinken dieser Temperatur kann zu Leistungseinbußen, Koordinationsstörungen und Bewusstseinstrübungen führen – Zustände, die am Berg lebensgefährlich werden können und die meisten von uns bereits auf die ein oder andere Art erlebt haben.
Die Ursachen für eine Unterkühlung sind oft banal: feuchte Kleidung, ein unerwarteter Wetterumschwung, lange Pausen im Wind oder schlichte Erschöpfung. Besonders tückisch ist, dass die Kälte den Körper langsam schwächt – zuerst unbemerkt, dann schlagartig. Das Zittern setzt ein, Konzentration und Urteilsvermögen lassen nach, Bewegungen werden unkontrolliert. In schweren Fällen kommt es zur Bewusstlosigkeit und schließlich zum Kreislaufstillstand.
Entscheidend ist daher nicht nur die passende Ausrüstung, sondern auch ein vorausschauender Umgang mit Energiehaushalt, Pausen und Kleidung. Wer spürt, dass die Kälte langsam „nach innen kriecht“, sollte sofort reagieren: Aktiv bleiben, winddichten Schutz suchen, nasse Kleidung wechseln und sich durch Nahrung und warme Getränke von innen stabilisieren. Im Fall einer ausgeprägten Hypothermie darf die betroffene Person keinesfalls aktiv bewegt oder massiert werden, da dies zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Stattdessen geht es um behutsames Aufwärmen, idealerweise unter professioneller Aufsicht.
Erfrierungen – lokale Schäden durch Kälteeinwirkung
Während sich eine Unterkühlung auf den ganzen Körper auswirkt, betreffen Erfrierungen nur einzelne Körperteile – meist Finger, Zehen, Nase und Ohren. Sie entstehen durch eine starke lokale Ausküh-
lung, bei der die Durchblutung so weit reduziert wird, dass das Gewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und Zellen absterben können.
Im Anfangsstadium äußern sich Erfrierungen durch Taubheitsgefühle, Prickeln und Blässe der betroffenen Regionen. Wird nicht rechtzeitig gegengesteuert, kann es zu Blasenbildung, bläulicher Verfärbung und in schweren Fällen sogar zu schwarz verfärbtem, abgestorbenem Gewebe kommen. Spätestens dann ist ärztliche Hilfe unumgänglich – oft droht der Verlust des betroffenen Körperteils.
Auch hier gilt: Vorbeugung ist der beste Schutz. Warme, trockene Kleidung, das regelmäßige Bewegen der Extremitäten und der bewusste Umgang mit Pausen und Windexposition sind essenziell. Kommt es dennoch zu ersten Anzeichen einer Erfrierung, sollte man die betroffenen Stellen vorsichtig wärmen – nicht aber mit direkter Hitze wie Feuer oder Heizpads, da das geschädigte Gewebe extrem empfindlich ist.
Reibung oder Druck sind ebenso zu vermeiden. Je früher Erfrierungen erkannt werden, desto höher sind die Chancen auf vollständige Heilung. Am Berg ist es sehr wertvoll, wenn man seine Kamerad*innen frühzeitig auf Erfrierungszeichen wie eine weiße Nasenspitze aufmerksam macht.
Windchill –die unsichtbare Gefahr
Ein Faktor, der oft unterschätzt wird, ist der sogenannte Windchill-Effekt. Dabei handelt es sich um die gefühlte Temperatur, > » Vorbeugung ist der beste Schutz. Warme, trockene Kleidung, das regelmäßige Bewegen der Extremitäten und der bewusste Umgang mit Pausen und Windexposition sind essenziell. «


^ Wärmeerhalt mittels Rettungsdecke beim Lawinenunfall.
‹ Die richtige Wahl des Standortes und die Vorbereitung auf ein Biwak sollten geübt werden.
>
die durch Wind erheblich niedriger sein kann als die tatsächliche Lufttemperatur. Der Wind führt die isolierende warme Luftschicht von der Hautoberfläche oder Kleidung ab, wodurch der Körper schneller auskühlt – und zwar nicht nur subjektiv, sondern auch physiologisch messbar.
Beispielsweise kann eine Lufttemperatur von –5 °C bei starkem Wind wie –15 °C empfunden werden – und die Auskühlung erfolgt entsprechend schneller. Besonders gefährlich wird es bei nasser Kleidung oder Schwitzen: Die Verdunstungskälte in Verbindung mit Wind kann innerhalb kürzester Zeit zu Unterkühlung führen, auch wenn man sich körperlich anstrengt.
Daher ist winddichte Kleidung ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Bergausrüstung – selbst im Sommer. Softshell- oder Hardshelljacken mit gutem Windschutz, Handschuhe, Mütze und universell einsetzbare Halstücher (Buff) gehören bei winterlichen Touren zur Standardausrüstung. Wer rechtzeitig windgeschützte Pausenplätze sucht und Kleidungsschichten frühzeitig anpasst, schützt sich effektiv vor dem unsichtbaren Angriff des Windes.
Biwakieren – Notlösung unter extremen Bedingungen
Das Biwakieren – also das Übernachten oder Verweilen im Freien ohne Zelt –gehört zu den intensivsten Erfahrungen am Berg, ist aber oft keine freiwillige
» Ein Biwak ist physisch und psychisch belastend. Die Dunkelheit, die Kälte und die Unsicherheit fordern mentale Stärke. «
Entscheidung. Ein ungeplanter Wetterumschwung, Orientierungslosigkeit, Erschöpfung oder Verletzungen können dazu führen, dass man nicht mehr rechtzeitig ins Tal gelangt und eine Zeit lang am Berg aushalten muss.
Ein wichtiger Faktor neben der richtigen Ausrüstung ist das Timing. Erfahrungsgemäß versuchen Gruppen so lange wie möglich, irgendwie vom Berg herunterzukommen. Wenn die Entscheidung zum Biwakieren dann irgendwann gefallen ist, sind viele Gruppenmitglieder bereits am Ende ihrer Kräfte und kaum mehr in der Lage, sich für das Biwak entsprechend vorzubereiten. Noch (viel) schwieriger wird es, wenn die passende Ausrüstung in Form eines „Groupshelters“ fehlt und man erst mühsam ein Panzerknackerbiwak errichten muss.
Ehrlicherweise muss man deshalb auch sagen, dass diese Form des Biwakierens fast ausschließlich geplant durchführbar ist und im Sturm am Berg wenig Erfolgschancen bietet. Ein Biwak ist physisch und psychisch belastend. Die Dunkelheit, die Kälte und die Unsicherheit fordern mentale Stärke. Klare Kommunikation, kleine Aufgaben und gegenseitige Unterstützung helfen, die Moral hochzuhalten – und damit auch die Überlebensfähigkeit.
Fazit: Planung, Ausrüstung und Erfahrung als Lebensversicherung
Wärmemanagement am Berg beginnt lange vor der Tour – mit der richtigen Planung, der passenden Ausrüstung und dem Wissen um die Mechanismen von Kälte, Wind und Auskühlung. Wer versteht, wie schnell eine Unterkühlung einsetzen kann, wie sich Erfrierungen frühzeitig erkennen lassen und wie stark Wind den Wärmeverlust beschleunigt, ist besser gewappnet für die Herausforderungen am Berg. Ebenso wichtig ist es, im Ernstfall richtig zu handeln. Ein improvisiertes Biwak kann zur Rettung werden – vorausgesetzt, man hat die richtige Ausrüstung dabei und weiß, wie man damit umgeht.
Thomas Wanner ist Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.


Das SAB First Aid Kit – „SAB“ steht für SicherAmBerg –, das in Kooperation vom Österreichischen Alpenverein mit der Bergrettung und dem Bergführerverband entwickelt und vertrieben wird, gehört schon seit Jahren zur Standardausrüstung am Berg. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit ist es nun endlich so weit, ein zweites Produkt zu etablieren, das an den Erfolg des Erste-Hilfe-Sets anknüpfen soll und eine ideale Ergänzung dazu bietet.
Die beiden tragischen Unfälle in den Westalpen am Pigne d’Arolla (7 Tote) und an der Tête Blanche (6 Tote), bei der Skitourengruppen im dichten Schneetreiben ums Leben kamen, gab den ausschlaggebenden Anlass für die Entwicklung eines extrem leichten und vielseitigen Biwaksacks.
Der Begriff Biwaksack ist für das neu entwickelte Produkt „BIVY 4“ allerdings wenig zutreffend. Es handelt sich dabei nämlich nicht um einen herkömmlichen Sack, sondern ein extrem leichtes Groupshelter, oder zu Deutsch „Gruppenzelt“, das im Notfall vier Personen Platz bietet. Der Slogan „Bivy 4 – für 4 Personen mit 4 Funktionen“ lässt schon erahnen, dass man sich mit einem einfachen Zelt nicht zufriedengab und versuchte, so viele Funktionen wie möglich in das neue Zelt zu packen. Das Ergebnis ist ein universell einsetzbares Tool, das folgende Einsatzzwecke abdeckt:
Groupshelter-Funktion: Vier Personen finden bei Notsituationen unter dem Zelt Platz und sind vor Wind und Wetter geschützt. In Kombination mit einer Alu-Rettungsdecke (Windeltechnik am Körper) und einem ultraleichten Alu-Biwaksack für jeden Teilnehmenden (Schutz vor Kälte von unten), setzt das Bivy 4 eine neue Benchmark im Bereich Wärmemanagement in Notsituationen.
Als Schutz bei Pausen auf Graten, Gipfeln oder Umkehrpunkten: Das Bivy 4 verfügt über zwei große verschließbare Kopföffnungen. Zwei Personen können so gemütlich nebeneinandersitzen und sind vor Wind und Auskühlung geschützt, zum Beispiel beim Rasten, Warten oder Essen.
Als Schutz vor Kälte und Nässe von unten: Bei der Lagerung verunfallter Personen bietet das Bivy 4 wie jeder andere Biwaksack die Möglichkeit, als erste Schutzschicht am Boden verwendet zu werden.
Als Regenponcho bei Wanderungen oder Hüttenzustiegen: Mit ein paar wenigen Handgriffen kann das Bivy 4 zum Regenponcho umfunktioniert werden und wird über die Regenjacke und den Rucksack gezogen. Man kann damit ohne Probleme laufen. Das silikonierte Polyamidmaterial hält den Regen draußen.
Wie jedes smarte Ausrüstungstool bedingt es aber auch die richtige Anwendung! Das Bivy 4 ist extrem leicht –entsprechend aber bedingt stabil und nicht geeignet, Personen mittels Biwakschleife über Schnee und Eis zu ziehen. Wem das wichtig ist, der sollte besser auf herkömmliche Biwaksäcke zurückgreifen. Auch das planmäßige Biwakieren ist mit dem Bivy 4 nur bedingt möglich, da es aufgrund seiner Maße nicht zum Liegen, sondern zum Sitzen konzipiert ist.
Mit seinen 350 Gramm und dem Rolltop-Beutel ist das Bivy 4 nicht nur leichter als normale Biwaksäcke, sondern lässt sich auch sehr kompakt verstauen. Das Bivy 4 ist ab Anfang Dezember im Alpenvereinsshop bzw. bei der Bergrettung und dem Bergführerverband zum Preis von 99 Euro (Alpenvereinsmitglieder 85 Euro) erhältlich.
¡ alpenverein.shop
Das Bivy 4 als Regenponcho und als Schutz vor Kälte und Nässe bei der Lagerung.



Das neue Winter Update knüpft an das erfolgreiche Lawinenupdate an – mit erweitertem Fokus: Neben Lawinen stehen nun auch Absturz und Kälte im Zentrum. Aktuelle Unfallbeispiele, fundierte Analysen und klare Take-HomePoints liefern praxisnahes Wissen für deine Entscheidungen am Berg.
Neu: Drei Perspektiven – Bergsport, Lawinenwarnung, Flugrettung – treffen in einer moderierten Bühnendiskussion aufeinander. Für alle, die im Winter draußen unterwegs sind.
Mehr Infos zur Veranstaltung und den Terminen gibt es hier.
Skitourengehen liegt im Trend. Damit steigt auch die Anzahl der Menschen, die abseits der Piste in den winterlichen Bergen unterwegs ist. Das ist grundsätzlich erfreulich! Das ist grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung. Doch wenn es um Risikominimierung geht, steht fast immer die Lawinengefahr im Mittelpunkt.
Ge R ha R d mÖSS me R
Trotz der stetig steigenden Anzahl an Tourengeher*innen gibt es – nicht zuletzt wegen der guten Präventionsarbeit der ausbildenden Institutionen – bei den Lawinentoten keinen Anstieg, sondern sogar einen Rückgang im Zehnjahresmittel. Auch das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist aber die Tatsache, dass vor allem die Unfallursache Absturz wenig Beachtung findet. Tödliche Absturzunfälle sind zwar seltener als tödliche Lawinenunfälle oder internistische Notfälle, dennoch führen sie überproportional oft zu schweren Verletzungen.
Im Winter 2023/24 verzeichnete das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) für den Zeitraum von 01.11.2023 bis 01.04.2024 insgesamt 28 Tote auf Skitour in Österreich. Das liegt leicht unter dem Zehnjahresmittel von 22 Toten. Zählt man Sturz, Stolpern und Ausgleiten (zwei Tote) sowie Absturz (ebenfalls zwei Tote) als Unfallursache zusammen, kommen wir auf insgesamt vier Tote im Zehnjahresmittel. Auf die Unfallursache Lawine entfallen elf Tote, auf Herz-Kreislauf-Störung immerhin fünf Tote im Zehnjahresmittel. Diese Daten zeigen: Absturzunfälle machen einen substanziellen Anteil der tödlichen Unfälle beim Skitourengehen aus.
Leider ist diese Tatsache – im Gegensatz zur „quasi omnipräsenten Lawine“ – in den Köpfen der meisten Skitourengeher*innen noch nicht verankert. Klar, nicht auf jeder Skitour gibt es potenzielles Absturzgelände, aber dennoch macht es Sinn, sich mit dem Thema einmal näher auseinanderzusetzen, denn mit relativ einfachen(!) Maßnahmen könnten wir das Unfallrisiko Absturz auf Skitour deutlich minimieren.
Typische Risikosituationen
„Hatti, wari, wenn i …“ ist im Nachhinein immer leicht gesagt. Aber anhand konkreter Unfallbeispiele lassen sich Schlüsse ziehen, die uns zukünftig helfen könnten, in ähnlichen Situationen besser zu reagieren, frei nach dem Motto: „Wir analysieren, du entscheidest!“
Harscheisen rechtzeitig anlegen!
Im März 2022 stürzte ein erfahrener Tourengeher am Großvenediger auf einer harten Firnflanke rund 250 Höhenmeter ab. Er war ohne Harscheisen unterwegs und stürzte in Folge eines Ausrutschers tödlich ab …
Tipp für Multiplikator*innen: Die konkrete Anweisung „Jetzt ziehen wir alle die Harscheisen an!“ hilft, Gruppendruck zu nehmen und negativer Gruppendynamik – inklusive mühsamer Diskussionen – vorzubeugen. „Wer will, kann Harscheisen anziehen!“ ist hier keine gute Option.
Spitzkehrentechnik sicher beherrschen!
Im Mai 2023 rutscht am Schrocken in Hinterstoder ein Tourengeher – trotz Harscheisen –bei einer Spitzkehre auf der verharschten Schneeoberfläche aus. Er stürzt ca. 200 Höhenmeter über steiles Gelände ab und wird dabei schwer verletzt …
In steilen, hartgefrorenen Hängen sind wir mit Steigeisen deutlich sicherer unterwegs.
Die einfachste aller Maßnahmen hätte diesen Unfall vermutlich verhindert: Rechtzeitig und bequem – im flachen Gelände – Harscheisen anlegen! Das setzt allerdings voraus, dass wir absturzgefährdete Passagen bewusst erkennen bzw. wenn möglich sogar umgehen. Kommt man erst im steilen Hang drauf, dass Harscheisen eine gute Idee gewesen wären, ist es meist zu spät, und zudem steigt dann – beim Versuch, die Harscheisen anzulegen – erst recht das Risiko, abzustürzen.
Wie dieses Beispiel zeigt, schützen Harscheisen allein leider nicht vor Absturz. Zusätzlich zur richtigen Ausrüstung braucht es zum Begehen steiler, verharschter Hänge zwingend eine ausgefeilte Spitzkehrentechnik. Wer diese nicht beherrscht, läuft Gefahr, schnell in heikle Situationen zu geraten. Beim Gehen mit Harscheisen nehmen wir die Steighilfe heraus, da so die Zacken der Eisen tiefer in den Harsch eindringen. Tipp für Multiplikator*innen: Schafft euch durch rechtzeitiges Üben im leichten Gelände Klarheit, dass die Teilnehmenden eurer Gruppe die Spitzkehrentechnik sicher beherrschen, denn:
„Harte, vereiste Hänge erfordern sicheres Gehen mit Harscheisen!“
Achtung beim Umbauen von Ski auf Steigeisen!
Im Januar 2020 wollte eine Gruppe die Skitour auf den Großen Pyhrgas mit einem kurzen
Foto: Alpenverein/G. Mössmer >
>
Gratanstieg beenden. Beim Abschnallen der Tourenskier rutschte ein Teilnehmer ab und stürzte 150 Meter über eine Rinne.
Dieser Unfall verdeutlicht die Gefahr beim Materialwechsel in exponiertem Gelände. Wie beim Anlegen der Harscheisen gilt es auch beim Ausziehen der Skier bzw. beim Anlegen der Steigeisen, einen möglichst bequemen und vor allem absturzsicheren Ort zu finden.
Steigeisen rechtzeitig anlegen, Steigeisentechnik sicher beherrschen!
Anfang März 2025 stürzt eine Tourengeherin knapp unterhalb des Gipfels des Zuckerhütls in den Stubaier Alpen über ca. 120 m tödlich ab. Laut Polizeibericht war sie für eine derartige Tour adäquat ausgerüstet. Gut drei Monate später stürzt am Großglockner im Bereich des Ködnitzkeeses ein Tourengeher über eine Firnflanke ca. 250–300 Meter ab und erliegt im Krankenhaus den Folgen seiner schweren Verletzungen.
Was beim Anlegen der Harscheisen gilt, gilt auch beim Anziehen der Steigeisen: Rechtzeitig! Dabei empfiehlt es sich – besonders für schwächere Tourengeher*innen –, lange und sehr steile (> 35°), hartgefrore Firnhänge anstatt mit Skiern und Harscheisen besser gleich mit Steigeisen zu begehen. Das spart Kraft und Nerven.
Am Grat oder in der steilen Scharte geben Steigeisen ebenso deutlich mehr Sicherheit. Letztlich reichen zwei, drei blöde, vereiste Meter im ausgesetzten, absturzgefährdeten Gelände, um uns den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben und uns schnell wieder „Hatti, war i, wenn i …“ ins Gedächtnis rufen.
Geländefallen erkennen, Skitechnik beherrschen!
Lackenkogel (Pongau, Salzburg), 15.01.2025: Ein Tourengeher stürzt bei der Abfahrt über einen fünf Meter hohen Felsen ab und wird schwer verletzt.
Nicht nur im Aufstieg, auch in der Abfahrt kann es zu schweren Unfällen durch Absturz kommen. Besonders im unbe-
kannten Gelände gilt es, Geländefallen wie Felsabbrüche, Gräben und Bäche etc. zu erkennen. Das lässt uns das Absturzrisiko besser einschätzen und wir können unsere volle Aufmerksamkeit fokussieren sowie unsere Abfahrtstechnik bzw. -geschwindigkeit anpassen. Dafür braucht es natürlich für heikle Passagen eine adäquate Skitechnik.
Menschliche Faktoren
Zu diesen typischen, gelände- bzw. verhältnisbedingten Faktoren kommen zusätzlich noch menschliche Faktoren hinzu, die uns das Risiko Absturz unterschätzen lassen.
Wie bereits eingangs erwähnt, ist in unserer Wahrnehmung die Lawine die
» Klar, nicht auf jeder Skitour gibt es potenzielles Absturzgelände,
aber dennoch macht es Sinn, sich mit dem Thema einmal näher auseinanderzusetzen, denn mit relativ einfachen (!) Maßnahmen könnten wir das Unfallrisiko Absturz auf Skitour deutlich minimieren.«


Besonders bei Frühjahrsverhältnissen geben Harscheisen in harten, steilen Firnhängen Sicherheit. Wirds noch steiler (> 40°), bauen wir auf Steigeisen um.
Fotos: Alpenverein/G. Mössmer
Verunfallte (Unverletzte, Verletzte und Tote) sowie unverletzte, verletzte und tote Skitourengeher:innen nach Unfallursache im 10-Jahres-Mittel (01.11.2014–31.10.2023) (reduziert).
Quelle: analyse:berg 2024/25, ÖKAS, Alpinpolizei
alles dominierende Hauptgefahr und lässt uns andere Risikofaktoren gern vergessen. Hinzu kommt die Überschätzung des eigenen Könnens bzw. die Unterschätzung des Risikos, das besonders im harten und steilen Gelände zum Tragen kommt. Damit einhergehend werden Harscheisen oder Steigeisen entweder gar nicht oder zu spät eingesetzt.
Außerdem darf uns Gruppendruck, der uns dazu verleitet, heikle Passagen ohne Hilfsmittel zu begehen („Wenn Toni keine Harscheisen anlegt, dann probier’ ich’s auch ohne … !“) nicht beeinflussen. Aber nur weil Toni „ohne“ geht, muss ich nicht mit. Hier gilt es – entgegen dem Gruppendruck –die eigene Komfortzone realistisch einzuschätzen und für sich selbst zu entscheiden, was am besten ist.
Absturzunfälle beim Skitourengehen sind keine seltene Ausnahme: Statistik und Fallbeispiele zeigen, dass selbst gut ausgerüstete, erfahrene Tourengeher*innen in relativ „moderatem“ Gelände in gefährliche Situationen geraten können – oft
aufgrund einer Kombination aus mehreren kleinen Fehlern oder ungünstigen Umständen.
Wer das Risiko im Blick hat, kann durch clevere Routenwahl, rechtzeitiges Umrüsten und realistische Selbsteinschätzung inklusive passendem Eigenkönnen viel tun, um heikle Situationen zu vermeiden. Lawinenairbag, LVS & Co. sind wertvolle Tools „gegen die Lawine“, helfen aber nicht gegen Absturz. Hier zählen Technik, Taktik und Entscheidungskompetenz.
Gerhard Mössmer ist Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.
Praktische Tipps aus der Bergsportabteilung des Österreichischen Alpenvereins und im Besonderen von unserem Autor Gerhard Mössmer finden interessierte Leser*innen hier:

Mehr Infos: www.alpenverein.at/ portal/bergsporttipps

SAB Booklet Skitour
Skitouren liegen im Trend. Die Lehrschrift des Alpenvereins vermittelt grundlegendes Wissen für Einsteiger*innen und vertieftes Know-how für Fortgeschrittene. Ziel ist es, die Freude am Tourengehen mit einem verantwortungsvollen Umgang mit alpinen Gefahren zu verbinden. 15,90 €

Slide-Autolock
Schnell, sicher, intuitiv: Der HMSKarabiner überzeugt mit einfacher Bedienung und automatischer Verriegelung. Dank seiner robusten Konstruktion bleibt er auch unter Belastung zuverlässig geschlossen – ideal für alle, die mit Seil unterwegs sind. 16,90 €

Spikes „Snowline Chainsen Light“: Leichte, aber sehr griffige Grödel fürs Winterwandern und Traillaufen, Rodeln oder zum Queren von Schneefeldern. Ausgezeichnet mit dem ISPO Award 2013. Inkl. Packtasche. 49,90 €
Fünf Tipps damit du während und nach der Skitour nicht abstürzt. 5 Tipps vom Bergsport, Teil 14.
1 2 3

1
Rechtzeitig umrüsten
Die einfachste und wichtigste Maßnahme, nicht abzustürzen, besteht darin, dass wir die Harscheisen oder Steigeisen früh genug einsetzen und nicht erst, wenn es schon kritisch wird. Dafür müssen wir das Gelände – respektive die Steilheit des Hanges bzw. die Schwierigkeit und die Verhältnisse am Grat – richtig einschätzen. Im Zweifelsfall bauen wir einmal zu viel als zu wenig oft um, denn im Nachhinein – sprich mitten im Hang – ist dieses Manöver mit erhöhtem Risiko verbunden.

2
Linienwahl bewusst treffen
Wenn möglich meiden wir absturzgefährdete Bereiche bzw. Querungen, indem wir sie – auch wenn es mit einem weiteren Weg verbunden ist – umgehen. Bei Abfahrten berücksichtigen wir etwaige Geländefallen wie Felsabbrüche, Rinnen und Bäche etc. und fahren in diesen Bereichen bewusst kontrolliert und langsam. Ebenso passen wir auf hartem Untergrund wie Eis oder Harsch Technik und Tempo an und fahren kein „Heldentempo“, sondern achtsam und defensiv.

3
Gruppendruck widerstehen
Auch wenn einige in der Gruppe meinen, dass sie keine Harsch- oder Steigeisen brauchen, muss das nicht für alle zutreffen. Eine selbstbewusste Entscheidung im Sinne der Risikominimierung zu treffen, kann nie verkehrt sein und spart oft viel Kraft und Nerven. Und passen die Verhältnisse am Gipfelgrat nicht in unsere Komfortzone, geht die Welt auch nicht unter, wenn wir darauf verzichten und wir im Skidepot entspannt unser Jausenbrot genießen – frei nach dem Motto: „Heil wieder hinunterkommen ist Pflicht, der Gipfel ist optional.“

4
Alleingänge überdenken
Tritt trotz aller Maßnahmen der Fall des Absturzes oder Sturzes ein, müssen wir uns bewusst sein, dass wir als Alleingänger schlechtere Karten haben als mit einem Partner oder in der Gruppe. Eine kaputte Bindung, ein verlorener Ski oder gar ein gebrochenes Bein können dann – besonders im Hochwinter bei kurzen Tagen und tiefen Temperaturen – schnell zu einem ernsten Problem werden. Im exponierten Gelände ist daher Begleitung ein wichtiger Sicherheitsfaktor.
5
Regeneration statt Absturz beim Einkehrschwung
Das Thema Absturz wird auch im neuen Winter Update umfassend behandelt.
Mehr Infos zur Veranstaltung und den Terminen gibt es hier.
Bier hat in der Regel deutlich weniger Kalorien und Zucker als klassische Sportgetränke oder Limonaden, ist aber ähnlich erfrischend. Je nach Sorte enthält Bier 3 bis 5 g Kohlenhydrate pro 100 ml, was zum Auffüllen der Energiespeicher dient. Zudem enthält Bier sekundäre Pflanzenstoffe (v. a. Polyphenole) mit entzündungshemmender und antioxidativer Wirkung. Das kann Muskelkater, Entzündungen und Infektanfälligkeit nach intensiven Belastungen vorbeugen. 4 5

Nach der Tour haben wir uns das ein oder andere „Regenerationsgetränk“ redlich verdient. Meistens nehmen wir dieses in Form von gelbem Gerstensaft zu uns. So lange wir mit den Öffis bzw. in Fahrgemeinschaften unterwegs sind, spricht auch nix dagegen. Um einen Absturz beim Einkehrschwung zu vermeiden und die positiven Effekte von Bier voll auszukosten, bietet sich alkoholfreies Bier – egal ob Hell oder Weizen – perfekt an, denn tatsächlich enthält das gelbe Gebräu verschiedene Inhaltsstoffe, die nach dem Sport positive Effekte haben können: Es ist förderlich für den Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich, da es Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und geringe Mengen Natrium, die beim Schwitzen verloren gehen, liefert.

statt 61,70 € jetzt nur 45,00 €
Das MELASAN SPORT WINTERPAKET stärkt dein Immunsystem und sorgt für ausreichend Energie bei jedem Abenteuer.
Wähle deinen Geschmack! 2x ENERGIEBLOCK GRATIS
Im Bruchteil einer Sekunde ist es zu dem schweren Unfall gekommen. Zwei Halswirbel waren gebrochen – und es hätte viel schlimmer kommen können. Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein, hatte sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben dem Wettkampfsport verschrieben, als er sich beim Training für den nächsten Radmarathon bei einem Sturz schwer verletzte. Gerade erst davon erholt führte einige Monate später der Bruch des Sprunggelenks zur endgültigen Zwangspause. Dieser Rückschlag, so beschreibt es der mittlerweile zweifache Familienvater heute gut zehn Jahre später, war gleichzeitig ein mentaler Schlüsselmoment.
Ein Gespräch über Rückschläge und mentale Werkzeuge im Bergsport.
Teil 1 einer neuen BergaufSerie über (mentale) Gesundheit im Bergsport.

Bergauf spricht mit ihm über die stillen Krisen im Kopf und darüber, wie man Schritt für Schritt seinen Weg zurück in die Bewegung findet.
Bergauf: Was bedeutet es, plötzlich im Sport pausieren zu müssen?
Jörg Randl: Wenn es der Organismus gewohnt ist, so intensiv zu trainieren, bleibt ein Stopp nie folgenlos. Ich habe mich gerade auf einem Höhenflug im Training befunden, im Bereich Skibergsteigen waren internationale Weltcups auch schon Thema. Kurz: Ich war in Bestform. Ich habe nach dem Trainingsstopp Thrombosespritzen benötigt, um nicht schlaganfallgefährdet zu sein, weil

»Solange du erfolgreich bist, bist du Everybody’s Darling. Es sprechen dich fremde Personen vertraut mit deinem Vornamen an, als würden sie dich schon ewig kennen. Kaum hast du aber eine Verletzung und bist nicht mehr vorne mit dabei, ist das Interesse oft schnell erloschen.«
mein Körper so sehr an die Bewegung gewöhnt war. Man verliert an Gewicht und wird anfällig für Infekte. All das kommt noch zum ganzen mentalen Aspekt hinzu. Der sportliche Erfolg ist immer nur die Spitze eines Eisberges. Was dem aber alles zugrunde liegt, bleibt meist im Verborgenen und wird von außen nicht wahrgenommen.
Ist es ein Tabu, über die psychischen Auswirkungen von Verletzungspausen zu sprechen?
Für mich persönlich war das nie ein Tabu. Daher war das für mich auch nicht schwierig. Eine psychische Herausforderung liegt aber sehr wohl darin, mit der Reaktion anderer Menschen umzugehen, wenn man kürzertreten muss. Solange du erfolgreich bist, bist du Everybody’s Darling. Es sprechen dich fremde Personen vertraut mit deinem Vornamen an, als würden sie dich schon ewig kennen. Kaum hast du aber eine Verletzung und bist nicht mehr vorne mit dabei, ist das Interesse oft schnell erloschen. Damit muss man schon zurechtkommen.
Sind dir bei deiner Rückkehr in den Sport Fehler unterlaufen?
Wenn man leistungsorientiert ist, setzt man sich in einem fitten Zustand ohne-
hin schon enorm unter Druck. Das gilt insbesondere für den Amateurbereich. Berufssportler*innen haben eigene Trainer*innen und Therapeut*innen und auch mehr Zeit, sich ihren Trainings zu widmen und Erholungsphasen einzuplanen. Neben einem Vollzeitjob muss man aber die Trainingspläne für die Wettkämpfe, seine Familie und das Sozialleben und natürlich den finanziellen Aspekt unter einen Hut bekommen. Trainingslager, gute Ausrüstung oder Personaltraining kosten immerhin auch viel Geld.
Ist man körperlich fit und gut im Training, verlangt das der mentalen Seite dennoch einiges ab. Diese ganze psychische Komponente verschärft sich nach einer Verletzung oft noch mehr. Man möchte sich auf das frühere Niveau zurückkämpfen. Dadurch entsteht nicht nur ein mentaler Stress, sondern man schlittert auch körperlich schnell in ein Übertraining. Man gibt dem Körper zu wenig Zeit und Raum für die Heilung. Ich würde sagen, dass ich zeitweise in ein Übertraining geraten bin. Der Sport hat sich körperlich und mental nicht mehr so gut und leicht angefühlt wie vorher.
Ist man egoistisch, wenn man so viel über die eigene Leistung nachdenkt? >

»Verletzungen sind Chancen, in sich zu gehen und auch Geschmack an einer neuen
Sportart zu finden, die man im Moment eben besser ausüben kann.«
> Jeder Mensch braucht einen gesunden Egoismus und Sport ist etwas Schönes. Er ist wichtig für die Gesundheit und gibt einem auch mental viele wichtige Dinge mit. Man lernt, für einen Erfolg ehrlich zu arbeiten und die Bewegung in der Natur zu genießen. Das Training aber so weit voranzutreiben, dass der eigene Körper und das soziale Umfeld dauerhaft darunter leiden, sollte nicht passieren.
Natürlich sollte man sich auch mental nicht dauerhaft einem zu hohen Leistungsdruck aussetzen.
Leider bemerkt man das aber oft erst im Nachhinein. Es ist auch in Ordnung, sich sportliche Ziele zu setzen und dafür hart zu arbeiten. Man sollte aber wissen, dass dann auch wieder die Familie, das soziale Umfeld und ein geregelter Alltag Priorität haben. Die Motivation sollte sein, glücklich zu sein und nicht Bestätigung von außen zu bekommen.
Sollte man sich mental also besser darauf vorbereiten, dass jederzeit Rückschläge passieren können?
Die „Patrouille des Glaciers“, eines der größten Skibergsteiger-Rennen.
Foto: Swisscom
Wenn man sich körperlich auf einem Höhenflug befindet, ist das schon ein richtig gutes Gefühl. Ein gesundes Risikobewusstsein ist wichtig, aber man sollte nicht in der ständigen Angst unterwegs sein, dass ein Unfall passieren oder man sich verletzen könnte. Würde man das immer im Kopf haben, geht auch die Leichtigkeit verloren und man traut sich nicht mehr so viel zu. Wenn man unsicher wird, können außerdem erst recht Fehler und Unfälle passieren.
Was würdest du jemandem sagen, der gerade aufgrund einer Verletzung mit Frustrationen kämpft?
Die Zeit heilt alle Wunden. Verletzungen sind Chancen, in sich zu gehen und auch Geschmack an einer neuen Sportart zu finden, die man im Moment eben besser ausüben kann. Auch ich habe verletzungsbedingt zu anderen Sportarten gefunden. Zwischen zehn und 16 Jahren war ich im Nationalteam im

Ein Blick zurück in die Wettkampfzeit: Jörg Randl in Action.
Foto: studiopatrick.ch
Wettkampfklettern. Durch eine Verletzung an der Hand habe ich dann meinen Weg auf das Rennrad und später zum Skibergsteigen gefunden.
Kann Sport wiederum dabei helfen, mit Frustration besser zurechtzukommen?
Definitiv. Der Sport ist eine Schule fürs Leben, getreu dem Motto: Von nichts kommt nichts. Man kann im Sport lernen, auch in psychisch schwierigen Zeiten beständig zu bleiben, seinen Fokus zu verändern und nach neuen Lösungen zu suchen. Eine dieser Lösungen kann auch sein, die Pause im Sport für einen anderen Bereich zu nutzen. Etwa, um sich seinem Sozialleben
zu widmen oder sich weiterzubilden. Mein Unfall war ein Schlüsselmoment, der mir gezeigt hat: Jetzt geht’s erst richtig um was.
Jörg Randl (43) ist seit seiner Kindheit im Bergsport verwurzelt – vom internationalen Sportklettern und Berglauf über TransAlp-Rennen im Radsport bis hin zu großen Wettkämpfen im Skibergsteigen wie die „Patrouille des Glaciers“.

Der Wiederachriedel ist ein Teil jenes von der Mandlwand nach Südwesten absinkenden Bergrückens, der bei der Wiederachalm nach Süden schwenkt. Er bildet die östliche Begrenzung des Riedingtales bzw. -grabens. Die sonnige Lage, eine großartige Aussicht und ein kurzer Aufstieg sind die Pluspunkte dieser Schneeschuhtour für Einsteiger*innen.


Wegbeschreibung
Direkt bei der Bushaltestelle „Mühlbach Mandlwandhaus“ zweigt der Skiweg des Grießfeldliftes ab. Vom Parkplatz des Saukarliftes sind es zusätzlich rund 400 m entlang der L 246. Auf dem Skiweg geht es zwischen den Ferienhäusern hindurch und bei der ersten Gelegenheit nach links über einen kleinen Graben, der von einer Baumzeile gesäumt wird. Auf der anderen Seite steht man am Beginn der anfangs sanften Hänge, die in Richtung Mandlwand hinaufziehen. Links oder rechts einer Baumgruppe aufwärts.
Die Wiederachalm lässt man links liegen und steigt über die oberhalb befindlichen Hänge etwas steiler, aber stets unschwierig und gefahrlos weiter auf. Nach der Querung eines weiteren Wanderweges beliebig höher zu einem Bergrücken. Unterhalb davon wenige Meter nach rechts zum Punkt 1.585 m, dem höchsten Punkt des Wiederachriedels. Man kann über ein kurzes, schmales Gratstück ein wenig höher hinauf bis auf die nächste Kuppe gehen (ca. 1.625 m), die durch einen kleinen Felsblock mit Baum und Jagdstand gekennzeichnet ist. Von hier bietet sich noch eine etwas bessere Aussicht. Der Abstieg erfolgt über den Anstiegsweg. Ein alternativer Abstieg als kleine Rundtour: Von der höheren Kuppe einige Meter am Grat abwärts, dann links über eine schmale, deutliche Rippe wei-

ter absteigen. An geeigneter Stelle links über die nur mäßig steilen Hänge beliebig nach Osten queren, bis man auf den oberen Wanderweg trifft, der direkt zum Arthurhaus führt. Auf ihm sanft ansteigend durch ein kleines Waldstück und unmittelbar danach im sogenannten „Schmaltal“ scharf rechts hinab. An einem Lawinendamm vorbei und über die große Wiese talwärts zum Skiweg des Grießfeldliftes. Entlang der L 246 zurück zum Ausgangspunkt.
Hinweis: Lawinengefahr besteht nur bei sehr ungünstigen Schneeverhältnissen. Einkehrmöglichkeiten gibt es im Arthurhaus, entlang der L 246 und in Mühlbach.
Vom Bahnhof in Bischofshofen mit der Regionallinie 590 nach Mühlbach am Hochkönig und weiter mit dem Skibus 591 Richtung Arthurhaus, Haltestellen „Mühlbach Saukarlift“ oder „Mühlbach Mandlwandhaus“. Für Anreisende mit dem Auto eignet sich der Privatparkplatz beim Saukarlift.
Aufstieg: 330 Hm, 5,2 km
Dauer: 2:15 h
Manfred Karl, Alpenverein Salzburg
Kartenausschnitt
Outdooractive-Kartographie
Mehr Details zu dieser Tour auf alpenvereinaktiv: www.alpenvereinaktiv.com /s/xjLka


t OUR e N
Die Tour auf die Marbachhöhe oberhalb von Hintermoos ist einfach zu bewältigen. Vor allem wegen der meist kunstvoll vereisten Strukturen im oberen Bereich lohnt sich der Besuch. Mit der zunehmenden Höhe ändert sich der Charakter der Tour und wechselt von sanften Wald- und Hügelanstiegen auf windexponierte Flanken. Diese erfordern oft eine fortgeschrittene Steigtechnik oder den Einsatz von Harscheisen. Interessant wird die Tour in der Abfahrt, wenn der Weg durch das selten befahrene Hochkasern-Nordkar führt. Es bietet sich eine gleichmäßige Abfahrt mit konstanten Bedingungen.
Wegbeschreibung
Von der Bushaltestelle Maria Alm Hintermoos geht es der Straße entlang, an den Parkplätzen vorbei bis zum Übungsschlepplift. Zuerst diesen Lift bergan, vorbei am Bundessportzentrum und am Hotel Hintermoos. Sobald sich eine geeignete Stelle bietet, auf die andere Bachseite wechseln, um über die Wiesen aufzusteigen.
Der erste markante Punkt ist die alte Hütte der Neualm. An dieser führt der Weg zuerst weiter nach Osten, um nach dem dichten Wald nach Süden abzudrehen. Von hier an folgt man dem immer wieder sichtbaren Sommerweg, zuerst durch Jungwald, dann durch Altbestand. Sobald man den Wald verlässt und die freien Almflächen erreicht, erblickt man die Marbachhöhe, den Klingspitz, Hochkasern, Hundstein und Langegg. Die Route führt vorbei an einer kleinen Almhütte hinauf auf die Marbachhöhe.
Dort angekommen folgt man dem Rücken in mehreren Kehren bergauf und wieder bergab bis zum letzten Anstieg zum Klingspitz. Meistens gibt es von hier mehrere Spuren zum Gipfel – entweder nahe an den Wechten im Süden über die oft vereisten Nordhänge. Für gewöhnlich sind beide Varianten gleich schwierig. Eine entsprechende Skitechnik ist erforderlich. Harscheisen sind hier oft empfehlenswert.
Der Weg vom Klingspitz zum Hochkasern folgt dem Höhenzug Richtung Westen und ist nicht zu verfehlen.
Die Abfahrt vom Hochkasern folgt zuerst wenige Meter dem nordseitigen Rücken. Danach sucht man sich eine ge-

Die Marbachhöhe bei Hintermoos gilt als klassische Tour für Einsteiger*innen. Für den Klingspitz ist aufgrund der oft eisigen Verhältnisse eine etwas fortgeschrittene Gehtechnik gefragt. Wer zudem eine spannende Abfahrt mit entsprechend sicheren Verhältnissen sucht, wird bei der Direktvariante über das Nordkar fündig.

Abfahrt über das Nordkar.
eignete Einfahrt in die Flanke. Nach dem ersten steilen Hang führt die Route nach rechts an einer Baumgruppe vorbei. Hier öffnen sich mehrere Gräben. Es empfiehlt sich der nach unten führende Graben, den eine einzelne Lärche markiert. Nach dieser Durchfahrt führt die Route wieder nach links. Nach weiteren steilen Abfahrten gelangt man auf den Forstweg. Die weitere Routenfindung folgt dem Forstweg mit mehreren Möglichkeiten für Abkürzungen zurück zum Ausgangspunkt.
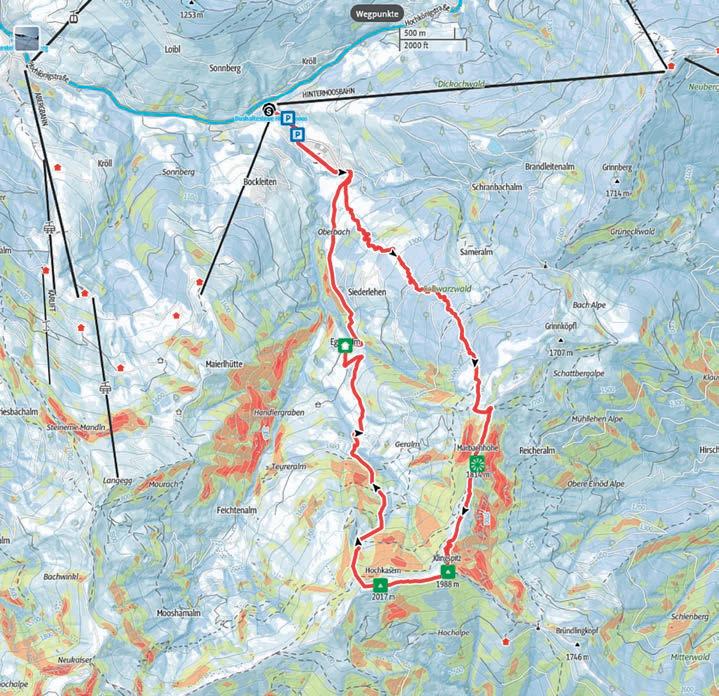

Von der Marbachhöhe bietet sich ein wunderbarer Ausblick auf die gesamte Abfahrtsstrecke. Am besten direkt von hier aus genießen! Unterwegs abgelenkt gerät man nämlich schnell vor einen Felsabbruch oder in einen Graben.
Die Tour ist mit dem Regionalbus 620 von Saalfelden oder Dienten aus gut erreichbar. Alternativ verkehren auch Skibusse. Der Start beim Skizentrum Hintermoos liegt nur wenige Meter vom Parkplatz für Tourengeher*innen entfernt.
Aufstieg: 1.100 Hm
Distanz: 11,8 km
Dauer Aufstieg: 3:30 h
Skitouren- und Sicherheitsausrüstung mit Harscheisen
Autor
Georg Schild, Alpenverein Saalfelden
Kartenausschnitt
Outdooractive-Kartographie
Mehr Details zu dieser Tour auf alpenvereinaktiv: www.alpenvereinaktiv.com/ s/zMCZA
Rückblick auf einen Tourentag im März 2025, der im Rahmen einer risk’n’fun-FREERIDE-Veranstaltung besprochen und nachbearbeitet wurde.
m a NU m aye R

Die Anfahrt war gemütlich. Wir hatten sogar ein zweites Frühstück. Max fuhr recht wild, was mich etwas aus der Ruhe brachte. Um elf Uhr gingen wir los. Es war warm, was nach kurzer Zeit unsere Felle aufstollen ließ. Es war für alle anstrengend. Dadurch verging noch mehr Zeit, und meine Moral wurde getrübt. Ich erinnere mich kurz vor der Filmoor-Standschützenhütte an einen offen ausgesprochenen Satz meinerseits: „Ich habe keine Lust mehr. So a Schaß.“ Wir gingen weiter zur Hütte. Daneben fiel uns der Tscharrknollen auf, und wir überlegten, über den Ostgrat aufzusteigen und über den Nordgrat abzufahren. Der Schnee war großteils pulvrig. Bei der Hütte angekommen, packte jede*r etwas zum Jausnen aus. Ich war schon etwas geschafft. Ich vermutete, Mate auch. Wir fantasierten übers Zelten und mögliche Linien im nächsten Tal. Mel kam kurz nach uns und fing ebenfalls zu jausnen an. Max fragte, ob noch wer zum Tscharrknollen mitkommen will. Mate sagte zu, Mel meinte, sie komme eventuell nach der Jause nach. Ich war mir nicht sicher, entschied mich aber kurz danach auch für den Aufstieg.
Missverständnis
Bevor alle losgingen, sagte Max, er gehe über links. Mel meinte: „Ach, spar dir das, du kannst auch über rechts gehen, das sieht mir ganz gut aus.“ Gesagt, getan: Max spurte voran. Hier kam es zu einem großen Missverständnis. Mel meinte, über rechts auf den Grat zu gelangen und dort aufzusteigen. Max verstand etwas anderes. Für ihn klang es, als wären die Nordhänge eh okay zum Aufsteigen. Ich beeilte mich, zu den anderen aufzuschließen, und sah es als Workout. Ich bemerkte viel Pulverschnee und packte den Auslösemechanismus meines Airbag-Rucksacks aus. Fast bei den anderen angekommen, fragte ich Max noch aus etwas Entfernung, ob ich das Spuren übernehmen soll. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich nicht wahr, wohin Max genau ging. Im Nachhinein erfuhr ich von ihm, meine Frage sei für ihn eine Art Bestätigung gewesen, am richtigen Track zu sein. Mate blieb vor mir stehen, um zu verschnaufen – dachte ich. Vielleicht war es

Erst ein Wumm-Geräusch, dann überall Schnee: Eine Lawine ist der Alptraum auf Tour.
aber sein Bauchgefühl, das ihn stocken ließ. Ich schloss auf zehn Meter zu ihm auf, blieb stehen, blickte zu Max hoch, der über mir eine Spitzkehre machte.
In diesem Moment realisierte ich, dass ich mir die Aufstiegslinie anders vorgestellt hatte und wir woanders waren, als ich dachte. Ich hatte das Gefühl, dass der Hang eindeutig zu steil ist. 20 Meter über mir war Max schon fast aus dem Hang raus und meine Zunge gelähmt. Ich sagte nichts. Mate auch nicht. Wir gingen weiter.
Beim nächsten Schritt vernahm ich ein WummGeräusch und dachte, die Schneedecke setzt sich. Gleichzeitig rief Max:
Beim nächsten Schritt vernahm ich ein Wumm-Geräusch und dachte, die Schneedecke setzt sich.
Gleichzeitig rief Max: „Fuuuccckkkkk!“ Ich schaute nach oben und merkte, dass wir uns zwischen großen Schneeschollen nach unten bewegten. Ich löste den Airbag aus und sah noch einen kleinen Abbruch vor mir. Ich dachte an meinen Helm, den ich nicht aufhatte. Und schon spülte es mich in der Lawine kreuz und quer. Ich sah nichts und hatte meine Atemwege voller Schnee. Ich wusste um meine geringe Überlebenschance.
Die Lawine kam zum Stillstand. Ich war an der Oberfläche und konnte es kaum glauben. Ich stand auf, befreite meinen Mund vom Schnee. Max war wenige Meter neben mir bis zur Hüfte im Schnee eingegraben, und ich sah, dass es ihm mehr oder weniger gut ging. Ich forderte ihn auf, sein LVS-Gerät auszuschalten. Mein eigenes stellte ich auf Suchen, jedoch empfing ich kein Signal. Ich sah mich um und in etwa 60 Meter am Lawinenkegel aufwärts eine Hand mit Schnee werfen.
Ich sprintete los. Im Augenwinkel sah ich Mel losstarten. Gleichzeitig kamen wir bei Mate an und sahen, dass sein Kopf aus dem Schnee herausragte. Wir gruben alle.
Bei den risk’n’fun-Kursen fließen die Themen Kommunikation, Gruppe und Entscheidung in alle Ausbildungslevels mit ein.
Foto: Heli Düringer

>
Ein Bergführer, der mit einer Gruppe unterwegs war und kurz nach der Lawine zu uns stieß, half uns dabei. Er organisierte auch den Abtransport von Mate und mir, da wir keine Ski mehr hatten.
Von Scham und starken Männern
Während wir auf den Hubschrauber warteten, holte er uns zusammen. Ich stand vor ihm, voller Scham, wie ein Kind, das bei etwas Ernstem ertappt wurde. Es war mir unangenehm, dass mir so etwas passieren konnte. Doch er erinnerte uns daran, dass Unfälle passieren können. Er forderte uns auf, darüber zu reden, was passiert ist. Kein Geheimnis daraus zu machen, sonst kann das Erlebte dich ein Leben lang verfolgen. Die Zeit der „starken Männer“ sei vorbei. Wir dürften Gefühle zeigen und darüber reden. Wow, ich war berührt und zutiefst dankbar für diese wichtigen Worte. Wieder beim Auto angekommen, fuhren wir nach Lienz und gingen Pizza essen. Die Reflexion begann da – und hält bis heute an.
Manu Mayer arbeitet als Trainer im risk’n’fun-Team und macht aktuell die Ausbildung zum Bergführer.
¡ nfo risk’n’fun FREERIDE –Reflexion
Ereignisse wie diese gehören zum Draußen unterwegs sein dazu. Sie machen betroffen, rütteln an Selbstverständlichkeiten und bringen einen ins Wanken. In diesen kurzen Momenten geht es um Leben oder Tod. Gleichzeitig steckt in der Reflexion ein enormes Lern- und Entwicklungspotenzial. In diesem Sinne: Danke fürs Teilen der Geschichte. Manu steckt auch Monate später noch in der Aufarbeitung dieses Ereignisses. Der Beitrag ist ein weiterer Baustein auf diesem Weg.
Reflektieren ist wichtig. Dafür gibt es im Ausbildungsprogramm risk’n’fun Tools. risk’n’fun orientiert sich am inhaltlichen Leitsatz: wahrnehmen – beurteilen –entscheiden. Anhand dieser drei Ebenen kann die erlebte Sequenz analysiert werden:
• Wahrnehmungsebene: Wurden Zeichen übersehen? Persönliche Befindlichkeiten ausgeblendet?
• Beurteilungsebene: Wurden die Bedingungen richtig eingeordnet? Standen sie im passenden Zusammenhang mit dem Lawinenlagebericht?
• Entscheidungsebene: Wurden Fakten ausgeblendet? Wurde die eigene Einschätzung von der Gruppe überstimmt?
Eingebettet in die Übung „Gerade nochmal gut gegangen“ wird bei risk’n’fun aktiv Lernraum für genau solche Erfahrungen geöffnet. Jede Form von Training und Ausbildung ist neben dem Kompetenzgewinn auch eine gute Vorbereitung auf die psychischen Belastungen einer möglichen Notfallsituation.
Wer sein Freeride-Know-how vertiefen möchte, ist beim Ausbildungsprogramm risk’n’fun FREERIDE der Alpenvereinsjugend genau richtig. Immer mit dabei: Softskills UND Hardskills – in einer gesunden Balance zwischen Risiko und Spaß. Info & Anmeldung: www.risk-fun.com
Im aktuellen DREI D Magazin der Alpenvereinsjugend beleuchtet ein Beitrag von Klemens Fraunbaum fortführend das Thema „Schuld und Scham“, bei Gerhard Mössmer ist die „Lawinenrettung im Fokus“.

Mehr Infos zum DREI D Magazin


Schneeschuhwandern, Gletscherausstellung, Iglubau, Winter inklusiv: Ausbildungen der Alpenverein-Akademie abseits von Skitouren.
aS t R id Neh LS
Was bietet der Winter doch für zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam draußen unterwegs zu sein, sich zu bewegen, die Natur zu erkunden und zu entdecken! Etwa beim Schneeschuhwandern, wofür im Repertoire der Alpenverein-Akademie die klassische, fundierte Übungsleiter*in-Ausbildung steht. Vor allem die Seminare der
»Locken wir sie nach draußen mit Kursen aus den Reihen Naturwissen & RespektAmBerg, Bergsport & Gesundheit und erlebnisorientierten Seminaren. «
Alpenverein-Akademie inspirieren zu Aktivitäten im Schnee und an der Winterluft, ergänzt durch eLearnings im warmen Inneren.
Es gibt ausreichend Menschen, die nicht auf Skitouren gehen, auch nicht abseits der Piste Freeriden wollen oder Eisklettern am gefrorenen Wasserfall. Denen bei diesem Gedanken gleich ganz kalt wird. Ein Schauder den Rücken herunterläuft. Und die dennoch im Winter in Österreich leben. Locken wir sie nach draußen mit Kursen aus den Reihen Naturwissen & RespektAmBerg, Bergsport & Gesundheit und erlebnisorientierten Seminaren.
Nach der frischen Winterluft ist das Hirn durchgepustet und freut sich auf ein Heißgetränk. Neues Wissen kann man sich auch indoor aneignen, gemütlich im Sessel, gemeinsam, allein, zeitunabhängig – also auch, wenn es draußen dunkel ist und der
Mensch so oder so nicht mehr im Naturreich der Tiere stören sollte.
Thematisch passt da gleich das RespektAmBerg-Tiere-eLearning. Es zeigt die Lebensbedingungen von Wildtieren im Winter auf und gibt Tipps, wie sich der Mensch der Natur zuliebe rücksichtsvoll beim Schneeschuhwandern, Schlitteln oder Waldspaziergang verhalten kann.
Kulturell punktet das eLearning-Programm mit virtuellen Rundgängen wie Gletscherrückgang in der Kunst oder Hoch hinaus mit alpiner Architektur. Und wäre jetzt nicht die ideale Zeit, um sich mit der Treibhausgasbilanz zu beschäftigen?
Auch dazu bietet das digitale Lernportal der Alpenverein-Akademie einen informativen Kurs.
Wer es dann doch lieber wieder sportlicher, aber witterungsunabhängig möchte, der nimmt sich die „Boulderregeln to go“ vor und startet anschließend persönlich in der Kletterhalle durch. Beispielsweise mit einem vorbereitenden Kurs zur richtigen Gestaltung von „Klettertraining für Kinder“, der 2026 neu im Repertoire ist und vom 24. bis 26. Jänner in Dornbirn stattfindet.
Wieder raus in den Schnee: Gut geschult und fit durch die Winterlandschaft ist das Motto für Übungsleiter*in Schneeschuhwandern. Mit dem Bildungsangebot Übungsleiter*in verfolgt der Alpenverein das Ziel, alpine Veranstaltungen in den Sektionen ausschließlich von geschulten und geprüften Personen, den sogenannten Tourenführer*innen, geleitet zu wissen. Qualität an erster Stelle! Eigenkönnen und Erfahrung vorausgesetzt, können an der fachsportlichen Ausbildung aber alle Interessierten teilnehmen. Praxis und Theorie wechseln sich an den intensiven Kurstagen ab. Die Termine zu dieser Grundausbildung im Führen und Leiten von Gruppen finden in den Bergsteigerdörfern Birnbaum im Jänner und Trins Mitte März statt. Danach fängt es in tieferen Lagen schon wieder zum Grünen an.
Astrid Nehls ist in der Alpenverein-Akademie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Unterwegs in den Ausbildungen und Kursen für bestes Winterwissen:
Detaillierte Infos & OnlineBuchungen: Dezember/Jänner/Februar
Erlebnisorientierte
Seminare
27.02.–01.03.2026, Obernberg am Brenner (T)
Mit Kindern unterwegs im Winter Tage draußen mit Kindern gestalten 09.–11.01.2026, Steinach am Brenner (T)


Wintererlebnis inklusiv Kreativ auf Bedürfnisse achten –alle können mitmachen 20.–22.02.2026, Mühlbachl/Maria Waldrast (T) Abenteuer Biwak Winter Schneebehausung bauen und drin übernachten
Bergsport & Gesundheit
23.–25.01.2026, Donnersbachwald (ST) Schneeschuhwandern & Yoga Aus der Stille des Winters Kraft schöpfen
Naturwissen & RespektAmBerg

16.–18.01.2026, Bergsteigerdorf Hüttschlag (S) Natur im Winter Harsche Lebensbedingungen im Winterwunderland

Boulderregeln to go Hoch hinaus mit alpiner Architektur
RespektAmBerg: Wildtiere im Winter Treibhausgasbilanz
Übungsleiter*in
Schneeschuhwandern

28.01.–01.02.2026, Bergsteigerdorf Birnbaum (K) 11.–15.03.2026, Bergsteigerdorf Trins (T)

Nach zwei schneearmen Wintern steigt die Sehnsucht nach Pulverschnee – und mit ihr die Lust, das eigene Equipment auf Vordermann zu bringen.
Viele hatten in den letzten Jahren mit erhöhtem Materialverschleiß zu kämpfen. Da kann ein Update bei der Ausrüstung auch dazu beitragen, unsere Freude und Motivation für Unternehmungen größer werden zu lassen. Bevor wir im Detail auf alle getesteten Neuheiten eingehen, fassen wir hier die wichtigsten Entwicklungen und Trends zusammen, geben Orientierung bei der Auswahl und liefern Tipps für den Kauf. Die wirtschaftlich angespannte Lage hat auch die Wintersportindustrie erreicht: Viele Hersteller reduzieren ihr Neuheitenangebot oder fokussieren sich auf
den Alpinskibereich. Trotzdem bietet die neue Skitourensaison 2025/26 eine Reihe spannender Modelle. Die Unterschiede in den einzelnen Kategorien werden kleiner, das Niveau insgesamt höher. Skier lassen sich leichter fahren, bieten dennoch hohe Stabilität und Kontrolle. Das kommt sowohl Einsteiger*innen als auch sportlichen Fahrer*innen zugute.
Unsere Tests fanden über mehrere Wochen mit Skifahrer*innen unterschiedlichen Könnens statt. Getestet wurde bei verschiedensten Bedingungen: auf Tour, im freien Gelände und auf der Piste. Auf nicht vormontierten Skiern wurden Bindungsmodelle von Fritschi (Xenic, Vipec Evo, Tecton) montiert. Die Bewertungen basieren auf einer Kombination aus objektiven Kriterien und subjektiven Eindrücken der Tester*innen.
Ski
Zu den Favoriten im Allroundbereich zählen der spielerisch-agile Kästle TX 88 UP mit seiner ausgewogenen Abfahrtsperformance, der Majesty SUPERWOLF CARBON mit überzeugendem Verhalten im Pulver und der Scott EXPLOREAIR 88, der bei jeder Schneebedingung durch Ausgewogenheit punktet. Im Freetourbereich überzeugt der BlackDiamond HELIUM CARBON 95 durch einfaches Handling und sehr gute Kontrolle, auch für weniger geübte Fahrer*innen, während der Stoeckli EDGE FT durch seine Stabilität und Vielseitigkeit, auch auf der Piste, punktet. Wer es noch breiter mag, findet mit dem Armada DECLIVITY X 102 einen superstabilen Ski, der auch bei schnellen Runs, im verspurten Gelände und auf hartem Untergrund bestens funktioniert. Die BlackCrows ATRIX & ATRIX BIRDIE sind verspielt, einfach im Handling und gleichzeitig sehr kontrolliert bei sportlichem Freeriden, vor allem auf hartem oder zerfahrenem Schnee. Und der Head KORE 94 Ti ist fast ein Muss für SpeedFreaks, denn bei Stabilität und Kontrolle ist er nahezu konkurrenzlos. Die richtige Skilänge ist ebenso entscheidend wie die Wahl des passenden Modells. Kürzere Ski (Körperlänge minus 5 bis 10 cm) erleichtern den Aufstieg, machen Spitzkehren einfacher und ermöglichen enge Radien. Dafür fehlt es ihnen
im tiefen Schnee an Auftrieb. Sportlich Ambitionierte setzen daher auf längere Ski, die mehr Stabilität und Sicherheit bei Tempo bieten. Auch das Fahrkönnen spielt bei der Auswahl eine Rolle: Für Anfänger*innen eignen sich am besten fehlerverzeihende Ski mit einem weichen Flex (Härte des Skis) mit leichter Schwungauslösung und -kontrolle. Fortgeschrittene und Expert*innen legen Wert auf Stabilität, Sicherheit und Speed, wollen während der Fahrt mehr Feedback und bevorzugen Ski mit härterem Flex und mehr Torsionssteifigkeit. Wer es schnell liebt und vorwiegend im waldfreien Gelände unterwegs ist, greift besser zu einem Modell mit größerem Radius. Ski mit kleinem Radius sind hingegen agiler im Fahrverhalten. Die Mittelbreite gibt Hinweise auf den Einsatzbereich: Allroundski mit 85 bis 100 Millimetern sind vielseitig und leicht, breitere Modelle bieten im Powder mehr Auftrieb. Auf hartem Untergrund profitieren Fahrer*innen von aufwendig konstruierten, etwas schwereren Ski, die mehr Kantengriff bieten. Tipp: Das Abfahrtsvergnügen und die Sicherheit sind klarerweise mit einem gepflegten, gewachsten, servicierten Ski ungleich besser.
Schuhe
Nicht minder wichtig für Komfort und Sicherheit sind passende Tourenschuhe. In der Kategorie der Leichtgewichte gibt es heuer spannende Modelle von Dynafit, Fischer, LaSportiva, Scarpa und Tecnica. Einige davon wurden optimiert, andere komplett neu entwickelt, wie etwa die TRAVERSE-Serie von Fischer. Bei den Allroundern sticht Tecnica hervor, im Freeridebereich zeigen Atomic, Head und LaSportiva interessante Neuheiten.
Auch das Fahrkönnen spielt bei der Auswahl eine Rolle: Für Anfänger*innen eignen sich am besten fehlerverzeihende Ski mit einem weichen Flex (Härte des Skis) mit leichter Schwungauslösung und kontrolle. Fortgeschrittene und Expert*innen legen Wert auf Stabilität, Sicherheit und Speed. >
Guter und fester Halt bei Ferse und Sprunggelenk sind entscheidend für eine gute Kraftübertragung. Weitere Kriterien sind Eigenkönnen und Einsatzzweck. Skitechnisch weniger Versierten ist von superleichten Modellen und Freeridemodellen abzuraten. Die beste Beratung gibt’s natürlich im Fachhandel – hier können die Schuhe auch mit dem entsprechenden Sockenmaterial anprobiert werden. Für „Problemfüßler*innen“ oder bei Druckstellen schafft ein professionelles Schuhfitting meist Abhilfe und sorgt manchmal sogar für kleine Wunder. Unnötige Blasenbildung lässt sich mit eng anliegenden Socken weitgehend vermeiden. Zu großzügig geöffnete Schuhe im Aufstieg tragen ebenso dazu bei. Leichtgewichte bieten außerordentlich guten Gehkomfort und ordentliche bis gute Abfahrtseigenschaften. Die im Vergleich zu anderen Modellen kurze Sohlenlänge ermöglicht ein rundes Abrollen. Trage-, Gehoder Kletterpassagen machen damit mehr Spaß und das Ganze wird sicherer. Allrounder und Performer stellen den bestmöglichen Kompromiss aus Gewicht, Aufstiegskomfort und Abfahrtsperformance dar. Eine enge Passform, direkte Kraftübertragung und sportliche Fahrweise sind damit möglich. Das gilt auch für einen Abstecher auf die Piste. In der Freeride-Kategorie zählt in erster Linie die Abfahrtsperformance. Aufstiegskomfort und Gewicht spielen hier eine untergeordnete Rolle.
Auch im Bindungssegment geht der Trend der letzten Jahre zu Hybridlösungen weiter. Besonders spannend ist die ATK HY 11/13 FREE, eine leichte, vielseitige Bindung mit hohem Innovationspotenzial. Head/ Tyrolia bietet mit der ATTACK HYBRID
ein stabiles System mit Walk/Ski-Wechsel, Fritschi hat mit der XENIC PLUS ein superleichtes Modell mit zwei Steighilfen vorgestellt. ATK setzt bei den neuen RAIDER- und RT EVO-Modellen auf die hauseigene EVO-Technologie. Dynafit hat zur BLACKLIGHT-Serie eine passende Bindung im Programm, PLUM bringt mit der KAIRN und der S170 zwei neue Optionen.
Die Wahl der richtigen Bindung hängt stark vom Einsatzzweck ab. Ideal ist es, wenn Ski, Schuh und Bindung in der gleichen Kategorie liegen. Für Aufstiegsorientierte sind leichte Bindungen ideal. Einige Modelle in dieser Kategorie gibt’s allerdings nur mit fixem Z-Wert und damit verbundenen möglichen Abstrichen bei der Auslösesicherheit. Wer auf Auslösesicherheit wie bei einer Alpinbindung setzt, greift auf ein Modell mit getrennten Auslöseeinheiten zurück (Seitauslösung am
Vorderbacken und Frontalauslösung am Hinterbacken). Bei den reinen PIN-Bindungen gibt’s diese nur von Fritschi (TECTON und VIPEC EVO). Hybridbindungen bieten Atomic (SHIFT), Salomon (SHIFT), Head (ATTACK HYBRID 14 MN/PT) und ATK (HY FREE) an. Alle genannten Bindungen lassen sich als einzige Modelle an einem Standardprüfstand einstellen. Sportliche Fahrweise bringt auch etwas mehr Risiko mit sich. Hier sind Stabilität und ein aktiver Längenausgleich angesagt, damit die Kraftübertragung passt und ungewollte Auslösungen vermieden werden. Für Tourenfreerider*innen sind Hybridbindungen, also PIN im Aufstieg und Alpinbindung im Abfahrtsmodus, mit einem deutlichen Plus bei Auslösesicherheit und Kraftübertragung die perfekte Wahl. Vor dem Saisonstart sollte die gesamte Ausrüstung auf Sicherheit geprüft werden. Neben der Bindung verdienen auch
Tourenschuhe und Inserts besondere Aufmerksamkeit, denn Beschädigungen können die Auslösewerte beeinträchtigen. Die neue Saison bringt keine Revolution, dafür viele durchdachte Weiterentwicklungen. Wer seine Ausrüstung auf das eigene Können und den bevorzugten Stil abstimmt, ist für Schnee und Wetter bestens gerüstet.
Andreas Lercher ist immer auf der Suche nach dem optimalen Equipment für den Winter. Die Ergebnisse seiner Suche präsentiert er Jahr für Jahr im Bergauf-Skitest.

Denselben Skitest mit ausführlicheren Bewertungen finden interessierte Leser*innen hier.

Die Alleskönner — aufwendigere Bauweise, 85+/–5 mm in der Mitte, und etwas schwerer. Vor allem auf hartem Untergrund heben sie sich von Leichtmodellen sehr deutlich ab und sie sind für Pistentouren am besten geeignet. Mittellange Schwünge bei moderater bis maximal mittlerer Geschwindigkeit sind angesagt.

Blizzard
ZERO g 88
R (m): 19,0
G (g/Paar): 2.260
T (mm): 118–88–102


L (cm): 157 | 164 | 171* | 178
EURO 700,00 www.blizzard-tecnica.com
• vielseitiger klassischer Allrounder
• stabiles und sicheres Fahren
• sehr ausgewogene Fahreigenschaften
• ideal auch auf langen Touren short long
Dynafit BLACKLIGHT 88
FI70 women
L (cm): 151 | 158 | 165 | 172* | 178 | 184
R (m): 18,7
G (g/Paar): 2.180
T (mm): 122–88–110
EURO 700,00 www.dynafit.com

• sehr leichter Ski
• weich abgestimmter Flex, wendig und spielerisch
• gut kontrollierbar
• kraftsparend im Aufstieg
Fischer ALPROUTE 88
R (m): 21,0
G (g/Paar): 3.000
T (mm): 121–89–108 EURO 550,00 www.fischersports.com


TX 88 UP
L (cm): 155 | 162 | 169 | 176*
• harmonischer Flex und fehlerverzeihend
• perfekter Einsteigerski
• fährt sich auch gut auf der Piste
• gibt’s auch für SIE in den Längen 148 | 155 | 162
R (m): 15,5
G (g/Paar): 2.990
T (mm): 138–88–112
L m (cm): 151 | 159 | 167 | 175* | 183


EURO 699,00 / 1.199,00 inkl.
RTS-Bindung; ATK gebrandet www.kaestle.com
• sportlichagiler und lebendiger Ski
• toller Auftrieb im soften Schnee
• sehr gut auch auf der Piste
• ein RundumAllrounder
BlackCrows CAMOX FREEBIRD
L (cm): 157,1 | 164,3 | 171,1 | 178,4* | 183,4 | 188,2
R (m): 17,0
G (g/Paar): 3.100
T (mm): 136–95–114 EURO 799,00 www.black-crows.com
• einer der vielseitigsten Freetourer
• lässt sich spielerisch fahren
Wahre Könner — leichter als reine Freerider und im Powder viel besser – für alle, die lange Turns und höhere Geschwindigkeiten lieben.
HELIO CARBON 95
L (cm): 155 | 162 | 169 | 176* | 183
R (m): 19,0
G (g/Paar): 2.800
T (mm): 124–95–113
EURO 800,00
www.blackdiamondequipment.com
• sehr gelungener, leichter Freetourer
• sehr ausgewogen und sicher
• sehr ausgewogene Fahreigenschaften
• leicht auch auf langen Touren short long slow fast beginner expert turn speed level
R (m): 18,0
Majesty SUPERWOLF CARBON
L (cm): 154 | 160 | 166 | 172 | 178* | 184
G (g/Paar): 2.700
T (mm): 131–91–111 EURO 849,00 www.majestyskis.com


• sehr lebendiger und leichter Allrounder
• ideal bei soften Verhältnissen
• sehr guter Auftrieb
• kräftesparend zu fahren short long


• einfache Schwungeinleitung und hohe Torsionsstabilität
• ideal bei soften Verhältnissen und tiefem Pulver

Scott EXPLOREAIR 88 Women’s
L (cm): 150 | 157 | 164*
R (m): 16,0
G (g/Paar): 2.640
T (mm): 120–87–105 EURO 599,95 www.scott-sports.com


• hat das Zeug zum Klassiker
• souverän in jeder Situation
• stark bei schwierigen Schneeverhältnissen
• sehr gute Stabilität und Kontrolle short long
Blizzard ZERO g 96 W
L (cm): 157 | 164 | 171* | 178
R (m): 19,0
G (g/Paar): 2.400
T (mm): 126–96–110 EURO 750,00


www.blizzard-tecnica.com
• sehr universell – ein Leichtgewicht
• spielerisch, stabil und sicher
• ausgewogene und gute Fahreigenschaften
• liebt lange Schwünge im soften Schnee bei moderatem bis flottem Tempo


Elan RIPSTICK 96
BLACK EDITION
L (cm): 161 | 168 | 175* | 182 | 189
R (m): 16,8
G (g/Paar): 3.140
T (mm): 131–95–112
EURO 849,95

www.elanskis.com

• leicht, dynamisch, sportlich
• stark dämpfende Schaufel, ideal im zerfahrenen Schnee
• perfekter Auftrieb im weichen Schnee
• am besten sportlich und flott fahren
SUPERNOVA CARBON
L (cm): 161 | 169 | 177* | 185
R (m): 19,6
G (g/Paar): 3.080
T (mm): 136–103–120
EURO 849,00
www.majestyskis.com
• für soften Schnee und tiefen Pulver

L (cm): 163 | 170 | 177* | 184
R (m): 19,0
G (g/Paar): 2.820
T (mm): 128–95–113
EURO 649,95
www.scott-sports.com
• vielseitiger Freetourer
• gute Stabilität und Torsionssteifigkeit
L (cm): 168 | 174 | 180*
R (m): 20,4
G (g/Paar): 3.270
T (mm): 130–96–119
EURO 1.199,00
www.stoeckli.ch
• wendig, spielerisch und sportlich zu fahren
Atomic MAVERICK 96 CTI
L (cm): 165 | 172 | 179* | 186
R (m): 18,0
G (g/Paar): 3.800
T (mm): 129–96–114,5 EURO 759,99 www.atomic.com
• mag Geschwindigkeit
• dämpft Schläge sehr gut weg
• spielerisch und sehr kräftesparend
• einer der Favoriten als Freetourer
• ideal bei moderater Geschwindigkeit und langen Turns


• sehr leicht, dennoch auch bei wechselnden Schneeverhältnissen
• sehr gut bei soften Schneeverhältnissen
• sehr gut bei wechselnden Schneeverhältnissen und auf hartem Untergrund
• als Allrounder konkurrenzlos
• sehr sportliche, beeindruckende Performance
• top auf hartem Untergrund und bei wechselnden Schneeverhältnissen

MAVEN 94 CTI
L (cm): 151 | 158 | 165 | 172*
R (m): 17,0
100 mm und mehr, Performance pur –stabil und schnell mit ganz viel Auftrieb im Pulver.
G (g/Paar): 3.160 (165 cm)
T (mm): 127,5–95,5–113
EURO 759,99 www.atomic.com

• Pendant zum MAVERICK für Frauen
• dämpft Schläge sehr gut weg
• sportliche, beeindruckende Performance
• top auf hartem Untergrund und bei wechselnden Schneeverhältnissen
ATRIS BIRDIE
L (cm): 160,2 | 166,3 | 172,1* | 178,4
R (m): 19,0
G (g/Paar): 3.600

T (mm): 136–105–122 EURO 749,00 www.black-crows.com

• für Frauen, die gerne sportlich und schnell unterwegs sind
• lässt sich spielerisch fahren
• sehr stabiler Ski auf hartem Untergrund und in zerfahrenem Schnee
• auch für schnelle Lines im Tiefschnee

BlackDiamond HELIO CARBON 108
L (cm): 166 | 173 | 180* | 187
R (m): 24,0
G (g/Paar): 3.190
T (mm): 133–108–120
EURO 900,00

www.blackdiamondequipment.com
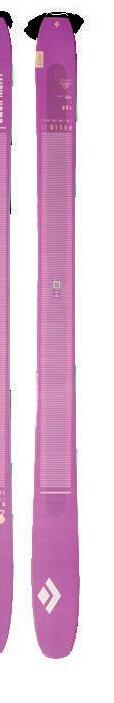
• neuer Aufbau, Shape, Materialien, geringes Gewicht – sehr gelungen
• dämpft Schläge und Unebenheiten sehr gut weg
• perfekt für mittlere bis lange Turns bei mittlerer bis flotter Geschwindigkeit im tiefen Powder
Elan
RIPSTICK 102 BLACK EDITION
L (cm): 161 | 168 | 175 | 182* | 189
R (m): 18,8
G (g/Paar): 3.440
T (mm): 138–102–118
EURO 899,95
www.elanskis.com
• sehr leichter Ski in dieser Liga
• für anspruchsvolle Lines im Gelände
• tolle Performance in jeder Situation
• am besten bei langen Turns und guter Geschwindigkeit
Atomic HAWX ULTRA
XTD 120 BOA
F: 120
G: 3.720 g (Gr. 26–26,5)
Schaftrotation: 54°
EURO 759,99
www.atomic.com

Head

KORE 94 Ti

Bemerkenswerter Komfort im Aufstieg. Speziell im KnöchelFersenBereich hervorragende Passform auch dank MemoryFitAnpassung bei Schale und Zunge und thermoverformbarem MimicPlatinumInnenschuh. 98 mm schmaler sportlicher Leisten und BOA® H+i1System zeigen in Kombination eine TopAbfahrtsperformance.

L (cm): 156 | 163 | 170 | 177* | 184 | 191
R (m): 16,3
G (g/Paar): 3.810
T (mm): 131–94–116 EURO 790,00 www.head.com

• perfekte Kontrolle in jedem Gelände und Schnee
• unheimlich stabil, sehr gute Kontrolle
• bärenstark auf jedem Untergrund
• für gute und sehr gute Fahrer*innen
Majesty VANGUARD 108 CARBON
L w (cm): 174 | 180* | 186
R (m): 20–22 / 20–18
G (g/Paar): 3740
T (mm): 132–108–124
EURO 899,00
www.majestyskis.com


• im soften Schnee und Pulver spielerisch zu fahren
• perfekter Mix aus Freeride und Freetouring
• kann auch sportlich gefahren werden
• am besten für lange bis sehr lange Turns

Armada DECLIVITY X 102
L (cm): 164 | 172 | 180* | 188
R (m): 18,0
G (g/Paar): 3.900

T (mm): 135–102–125 EURO 729,95 www.armadaskis.com
• nahezu perfekter Tourfreerider
• unheimlich stabil
• auch im zerfahrenen Schnee
• macht bei Tempo am meisten Spaß


750,00 www.lasportiva.com
Leicht genug für lange, anspruchsvolle Anstiege und dennoch sehr gute Stabilität und Kraftübertragung für anspruchsvollste Abfahrten. Der neue SENDER schafft den Spagat zwischen Tour und Tourfreeride mit Bravour. Die spezielle Zungenkonstruktion ermöglicht einen sehr angenehmen progressiven Flex –sehr gute Passform und Halt im Fersenbereich.
F: 130
G: 2.140 g
Schaftrotation: 70°
EURO 850,00 www.fischersports.com
F: k. A.
G: 2.300 g
Schaftrotation: 80°
Head KORE 130 MV GW
F: 130
G: 3.200 g (Gr. 25)
Schaftrotation: ~50° EURO 700,00 www.head.com
KILO XTR
Women & Men
F: 110
G: 2.260 g (Gr. 24,5)
Schuh und mit 80° Schaftrotation natürlich besonders. Komfortabel im Aufstieg. Der volumenreduzierende SlimLiner bietet auch schmalen Füßen eine sehr gute Passform. Sehr gute Kraftübertragung in der Abfahrt. Das BOA Fit SystemH4 arbeitet in Kombination mit dem DoubleLockMechanismus sehr gut. Fischer TRAVERSE
Extrem leicht gepaart mit 80° Schaftbeweglichkeit – ideal also für aufstiegsorientierte Skitourengeher*innen. Der Materialmix mit Carbon macht den Schuh steif und sehr stabil, auch anspruchsvollste Abfahrten sind damit sehr gut zu fahren. Durch das CarbonSoleInsert zeigt diese eine sehr hohe Torsionssteifigkeit und in Kombination mit dem mikrojustierbaren BOA Fit SystemH4 zeigt sich der Schuh auch in der Abfahrt sehr sportlich und kompromisslos.


EURO 680,00 www.fischersports.com
Sehr leichter, aufstiegsorientierter Schuh und mit 80° Schaftrotation natürlich besonders komfortabel im Aufstieg. Der volumenreduzierende SlimLiner bietet auch schmalen Füßen eine sehr gute Passform, ist sehr komfortabel und zeigt sehr gute Kraftübertragung in der Abfahrt. Das BOA Fit SystemH4 arbeitet in Kombination mit dem DoubleLockMechanismus sehr gut.


Ein kompromissloser Abfahrer für anspruchsvollste Anwender*innen. Der neue Hike/SkiMechanismus macht sich ausgesprochen gut. Perfekte Kraftübertragung und Kontrolle auch dank eines 53 mm breiten PowerStraps und eines anpassbaren, thermoverformbaren Innenschuhs. Ausreichend Gehkomfort im WalkModus, für den Aufstieg der leichteste Schuh in dieser Kategorie. Auch als LowVolumeModell mit 96 mm Leisten in den Größen 22,00–30,5 um € 780,00


Schaftrotation: 68°
EURO 800,00 www.lasportiva.com
Sehr leichter, aufstiegsorientierter

Dynafit
BLACKLIGHT BOOT (women/men)
F: 130
G: 1.960 g (women)/2.280 g (men)
Schaftrotation: 70° EURO 780,00 www.dynafit.com
Ein extrem leichter Schuh mit dem bewährten HojiLockSystem. Ohne klassische Zungenkonstruktion, aber mit einem neuen Tech Gaiter für besten Schutz und optimalen Aufstiegskomfort. Bestens anpassbarer Innenschuh, Ultra Lock Strap und perfekter Fersenhalt sorgen für eine sehr gute Abfahrtsperformance.
Tecnica
ZERO-G PEAK CARBON (unisex)
F: 130
G: 2.120 g
Schaftrotation: 75° EURO 950,00 www.blizzard-tecnica.com
Außerordentlich guter Gehkomfort, stabile Schalenkonstruktion mit CarbonManschette, die für sehr gute Kraftübertragung und Kontrolle in der Abfahrt sorgt. Hervorzuheben ist der für einen Leichtschuh tolle progressive Flex in der Abfahrt. Schale und Innenschuh sind thermoverformbar und damit sehr gut Individuell anpassbar.
Dezember/Jänner/Februar
Tecnica
ZERO-G TOUR W
F: 105
G: 2.660 g
Schaftrotation: 65°
EURO 570,00
www.blizzard-tecnica.com
Jede Menge Schaftbeweglichkeit und Komfort im Aufstieg. C.A.S.Schale und Innenschuh sind bestens individuell anpassbar. Schnallen, Straßen und WalkSkiMechanismus lassen sich bequem auch mit Handschuhen bedienen. Tolle Passform, sehr gute Abfahrtsperformance – ein sehr guter Allrounder.


Tecnica
COCHISE 130 DYN GW
F: 130 G: 3.770 g
Schaftrotation: 55° EURO 700,00 www.blizzard-tecnica.com
Der COCHISE 130 DYN GW ist ein HighPerformanceModell für all jene, die es richtig zur Sache lassen wollen und können. Schale und Innenschuh sind bestens individuell anpassbar. Zudem gibt’s für empfindliche Schienbeine eine eigene C.A.S.Zunge. Auch als HV mit 102 mm Leisten für breite Füße. Den CHOCHISE DYN GW ist auch in Damenmodellen mit Flex 115 (€ 650,00) oder 105 (€ 600,00) erhältlich.
G/Paar: 1.350 g (inkl. Stopper)
DIN: 4–11 (6–13 / HY FREE 13)
Stopperbreite: 97 | 108 | 120 mm
EURO 799,00
www.atkbindings.com
• sehr leichte Hybridbindung mit perfekter Balance aus Aufstiegskomfort einer PINBindung und Abfahrtsperformance einer Alpinbindung
• 7 mm aktiver Längenausgleich, 25 mm längenverstellbar
• 2stufige Steighilfe
• sichere und optimale Auslösewerte



G/Paar: 650 g (inkl. Stopper) (740g / EVO 13 inkl. Stopper)
DIN: 3–11 (5–13 / EVO 13)
Stopperbreite: 86 | 91 | 97 | 102 | 108 | 120 mm
EURO 649,00 www.atkbindings.com
• Neu: EVOTechnologie (Drehung des Hinterbackens um 180° mit automatischer Arretierung des Stoppers und einstellbarer DINWert am Vorderbacken für die Seitauslösung)
• 2stufige Steighilfe
• 14 mm aktiver Längenausgleich, 25 mm längenverstellbar
• sehr zuverlässig, sicher und supereinfach im Handling


ATK RT 11 & 13 EVO
G/Paar: 650 g (inkl. Stopper)
DIN: 3–11
Stopperbreite: 86 | 91 |
EURO 599,00
www.atkbindings.com
• Neu: EVOTechnologie
• 2stufige Steighilfe
• 12 mm aktiver Längenausgleich, 20 mm längenverstellbar
• auf das Wesentliche reduzierte Bindung ohne Abstriche bei Sicherheit und Handling

S170
G/Paar: 340 g (ohne Stopper)
DIN: 8 (fix)
Stopperbreite: 80 | 90 | 100 | 110 mm
EURO 449,00 inkl. Stopper www.fixation-plum.com
• minimalistischpuristische Tourenbindung mit fixem DINWert
• neue Steighilfe mit einfacherem Handling und intuitiv einfacher Bedienung
• verbesserter, einfacherer Einstieg in den Vorderbacken
• Spacerplatte am Hinterbacken bringt zusätzliche Stabilität in der Abfahrt
Plum KAIRN
G/Paar: 710 g (inkl. Stopper)
DIN: 4–10
Stopperbreite: 80 | 90 | 100 | 110 mm
EURO 489,00 inkl. Stopper www.fixation-plum.com
• leicht, funktional und vielseitig
• Seit als auch Frontalauslösewerte sind getrennt einstellbar
• Verbesserter einfacherer Einstieg in den Vorderbacken
• aktiver Längenausgleich
• Spacerplatte am Hinterbacken bringt zusätzliche Stabilität in der Abfahrt
Head
ATTACK HYBRID 14 MN/PT
G/Paar: 1.730 g (Hike), 2.230 g (Ski)
DIN: 4–14
Stopperbreite: 95 | 110 | 130 mm
EURO 525,00 www.head.swiss
• kombiniert Aufstiegskomfort einer PINBindung und kompromisslose TopAbfahrtsperformance
• AFDSlider ermöglicht ein Anpassen an unterschiedliche Sohlenhöhen
• im Hardcase lassen sich die Vorderbacken für Aufstieg/Abfahrt wunderbar im Rucksack verstauen
• auch als ATTACK HYBRID 11 MN/PT € 475,00, DIN 3–11, 1610 g (HIKE) 2110 g (SKI)


Fritschi
XENIC PLUS 12/10
G/Paar: 680 g–670 g inkl. Stopper
DIN: 6–12 (4–10 XENIC PLUS 10)
Stopperbreite: 85 | 95 | 105 mm
EURO 479,95 (449,95 XENIC PLUS 10) inkl. Stopper www.fritschi.swiss
• Neu: 2 Steighilfen
• einzige PINBindung mit horizontal verschiebenden Hebeln für die beste Auslösesicherheit und das Vermeiden von ungewollten Auslösungen
• 10 mm aktiver Längenausgleich, 25 mm Verstellbereich
• sehr breites Bohrmuster und damit optimale Kraftübertragung
• absolut top bei Sicherheit und Komfort
Dynafit
BLACKLIGHT CARBON PRO+
G/Paar: 564 g (inkl. Stopper), 484 g (ohne Stopper)
DIN: 6–12
Stopperbreite: 75 | 90 | 105 mm
EURO 440,00/480,00 (mit Stopper) www.dynafit.com
• sehr hoher Bedienungskomfort
• 11 mm aktiver Längenausgleich, 20 mm längenverstellbar
• für die Arretierung des Skistoppers im Aufstieg einfach einen kleinen Hebel umlegen
• breite Auflagefläche für den Schuh am Hinterbacken und gute Kraftübertragung


FREETOUR
WAHRNEHMEN BEURTEILEN

ENTSCHEIDEN



Fritschi
TECTON 10
G/Paar: 1.200 g (inkl. Stopper)
DIN: 5–10
Stopperbreite: 90 | 100 | 110 | 120 mm
EURO 549,95 inkl. Stopper www.fritschi.swiss
• die kompromisslosen Vorzüge bei Abfahrt und Sicherheit nun auch für leichtere Fahrer*innen mit getrennten Auslöseeinheiten für Seitauslösung (Vorderbacken) und Frontalauslösung (Hinterbacken)
• über einen einstellbaren DINWert kann die Seitwärtsauslösung mit 13 mm dynamischem Weg/ Elastizität am Vorderbacken definiert werden
• 10 mm aktiver Längenausgleich, 25 mm Verstellbereich
• hervorragende Abfahrtsperformance, absolut top bei Sicherheit
• nach wie vor die leichteste Bindung, wenn’s um Sicherheit und Performance geht
Dezember/Jänner/Februar
Serfaus-Fiss-Ladis • Kitzsteinhorn-Kaprun Fieberbrunn • Saalbach-Hinterglemm • Sonnenkopf Kühtai • Tauplitz • Hochkönig • Leogang • Dachstein Tuxer Alpen • Stubaier Alpen • Ankogelgruppe
Alle Infos & Termine
D e t a illierteInform ationen


•
• www.alpe nverein-akade m i e ta.
Österreichischer Alpenverein
Alpenverein-Akademie
Olympiastraße 37 6020 Innsbruck
T +43 / 512 / 59 547-45
M akademie@alpenverein.at
W alpenverein-akademie.at
Bildung gibt Sicherheit. Die AlpenvereinAkademie bietet beides. SicherAmBergKurse, risk’n’fun-Sessions, Seminare und Workshops, Aus- und Weiterbildungen bis hin zu zertifizierten Lehrgängen, persönlich und auch digital. Immer mit dabei: hohe Qualität und nachhaltige Freude in, an und mit der Natur.
e V e L i N Sta RK
EeR zäh L UNS dei N e Öffi Ge S chichte!
Winterport beginnt bei uns nicht auf der Piste, sondern an der Bushaltestelle. Als alleinerziehende Mutter ohne Auto bedeutet ein Ausflug in den Schnee: sorgfältige Planung, optimistische Wetterprognosen und eine große Portion logistischer Geduld. Wobei die Portion mit steigendem Alter der Mutter und wachsender Selbstständigkeit des Kindes von Jahr zu Jahr kleiner wird. Der Rodeltag letzten Winter war da keine Ausnahme – eher ein Paradebeispiel.
Ich wünschte mir einen Tag im Schnee, mein Sohn hatte Rodeln zum Wunsch. Der Himmel war blau, der Rucksack wie immer vollgepackt. Rodel, Helm, Thermosflasche, Jause – alles dabei. Die Verbindung zur Rumer Alm war machbar, die Laune bestens. Der Aufstieg im Schnee kostete Kraft, aber belohnte mit Aussicht und Vorfreude. Der Tag verlief wie geplant, fast zu gut. Nur die Uhr verloren wir aus den Augen – und mit ihr den Bus. Fünf Minuten zu spät! Eine Stunde Wartezeit bis zum nächsten. Und das in dieser Kälte! Panik breitete sich
Foto: Alpenverein/E. Stark
Hast auch du eine Geschichte vom Unterwegssein mit Öffis? Vom spontanen Umweg, vom verpassten Anschluss oder vom perfekten Timing? Vom Skitag ohne Auto, von der Hüttenwanderung mit Bus und Bahn – oder einfach vom täglichen Drauflosfahren? Ob gescheitert oder geglückt, witzig, berührend oder lehrreich – Bergauf sucht deine Öffi-Story! Erzähl uns, wie du mit Bus oder Bahn unterwegs bist. Alleine, mit Familie oder in der Gruppe. Im Alltag oder im Abenteuer. Wir sind gespannt auf deine Geschichten!
Schick sie (gern mit Foto) an: redaktion@alpenverein.at
Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir in einer der nächsten Ausgaben.

in mir aus. Und Ärger darüber, dass ich falsch kalkuliert habe. Ein Scheitern. Und doch keines, wie sich herausstellte.
Statt zu frieren, kamen wir mit einer älteren Dame ins Gespräch, die ebenfalls unterwegs war. Gemeinsam wanderten wir zur nächsten Haltestelle, einfach um in Bewegung zu bleiben. Sie erzählte von früheren Wintern, vom Stadtleben ohne Auto, vom Glück der kleinen Umwege. Der Bus kam pünktlich, wir kamen heim. Müde, aber zufrieden.
Solche Tage zeigen mir: Öffis sind mehr als bloßes Transportmittel. Sie verlangen Flexibilität, manchmal auch Demut. Aber sie schenken Begegnungen, kleine Abenteuer, einen anderen Blick auf das Unterwegssein. Natürlich wäre ein Auto bequemer. Aber unsere Mobilität hat Tiefe –gerade, weil sie nicht selbstverständlich ist. Am Ende bleibt die Erinnerung nicht an den verpassten Bus. Sondern an einen besonderen Tag, an Gespräche im Schnee, an ein Kind, das am Abend sagt: „Das war der beste Rodeltag ever.“ —
Im Fokus des Umweltgütesiegels steht die Frage, wie umweltfreundlich die Technik und der Betrieb von Hütten sind. Auch in diesem Jahr wurden auf der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins vier Vorzeigehütten mit dem strengen Gütesiegel ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
aBtei LUNG h ütte N UN d We G e
Tennengebirge, Alpenverein Salzburg

Oberhalb von Werfenweng auf 1.526 m liegt die Sölden-Hütte als Aussichtsloge im Herzen des Tennengebirges. Die Sonnenterrasse lockt im Sommer vor allem Tagesgäste an. Übernachtungsgäste, die das Tennengebirge durchqueren, Gipfel wie den Tauernkogel oder Eiskogel besteigen oder zum Klettern die Hütte
ansteuern, finden 25 Schlafplätze vor. Im Winter werden Ski touren geher*innen und Splitboarder*innen herzlich begrüßt. Die Hütte wurde bereits 1912 erbaut und seitdem behutsam erweitert und saniert, um ihren Charme zu erhalten.
Die Hüttenwirte Benedikt und Anton sorgen hier oben
mit regionalen Gerichten und Getränken dafür, dass sich ihre Gäste rundum wohlfühlen. Sie bauen Kräuter und Gemüse selbst an, verzichten auf Produkte von großen Konzernen und legen Wert auf verpackungsarme Lebensmittel. Das kleine, ausgewählte Angebot umfasst auch vegetarische und vegane Gerichte.
Die Sölden-Hütte (1.526 m) liegt als charmante Aussichtsloge im Herzen des Tennengebirges.
Foto: Alpenverein/C. Scharfenstein
Die Hüttentechnik entspricht den Vorgaben des Umweltgütesiegels vollumfänglich. Die Stromversorgung erfolgt über einen Netzanschluss mit Ökostrom-Tarif. Das Abwasser wird mittels Kanals ins Tal geleitet. Wo es geht, werden Ressourcen gespart: Für die Gäste gibt es anstelle einer Dusche eine Waschgelegenheit am Brunnen. Die Putzmittel sind umweltfreundlich und werden stets bewusst dosiert. Für einen reduzierten Stromverbrauch sorgen Bewegungsmelder. Mit einer gezielten Kommunikation lädt das Hüttenteam seine Gäste dazu ein, ihren Aufenthalt umweltfreundlich mitzugestalten.
Ennstaler Alpen, Alpenverein Spital am Pyhrn
Die Hofalm-Hütte liegt auf 1.305 m Seehöhe oberhalb von Spital am Pyhrn und westlich des Großen Pyhrgas. Die Hofalm wird gerne als „Balkon“ von Spital am Pyhrn bezeichnet. Ihre Lage zeichnet sich aus durch einen bemerkenswerten Ausblick auf das Sengsengebirge im Norden, die Warscheneckgruppe im Westen und einen Fernblick in das gesamte Garstnertal. Wer den Abend auf der Hütte verbringt, wird mit einem überwältigenden Sonnenuntergang belohnt. Die Hüttenwirtsleute Ingrid und Gabriel sorgen mit ihrem Team dafür, dass es ihren Gästen an nichts fehlt. Fertigprodukte sucht man in der Küche vergeblich. Stattdessen werden mit regionalen, teils biologischen Produkten hochwertige Gerichte auf die Teller
gezaubert. Nicht nur die hervorragende Kost und die herzlichen Hüttenwirtsleute locken viele Bergbegeisterte an, sondern auch Events wie das Bergsteigerfrühstück, Poetry Slam oder Yoga am Berg. Eine Aktion ganz im Sinne des Umweltgütesiegels ist die „Freie Nacht fürs Klima“. Im Rahmen dieser Initiative können Gäste, die öffentlich anreisen, kostenlos an zwei Tagen in der Sommersaison übernachten. Darüber hinaus wird man auf der Hütte zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ermutigt.
Die Hüttentechnik ist umweltfreundlich ausgebaut. Strom wird mittels Photovoltaikanlage erzeugt, die Reinigung des Abwassers erfolgt in einer biologischen Kläranlage. Eine Dusche steht den Gästen nicht zur Verfügung.
Seehöhe 1.740 m, Salzburg
Ankogelgruppe, Alpenverein Graz
Die Rotgüldensee-Hütte liegt auf 1.740 m Seehöhe am Fuße des Großen Hafners und am Ufer des Unteren Rotgüldensees. Im Zuge der Stausee-Erweiterung (1994) wurde die Hütte neu erbaut. Den gut befestigten und nicht allzu steilen Weg zur Hütte können selbst junge Gäste problemlos meistern. Die Hütte ist aufgrund ihrer Lage bei allen Naturgenießer*innen beliebt –sei es für Wanderungen oder
zum Bergsteigen auf die Dreitausender der Hafnergruppe. Übrigens: Hier befindet sich der östlichste Dreitausender der Alpen.
Die Hüttenwirtsleute Anna und Thomas setzen gemeinsam mit ihrem Team auf eine bodenständige und hausgemachte Küche mit gutem Geschmack. Die Getränke- und Speisekarte ist vielfältig und so regional wie möglich gehalten. Kuchen und Brot werden >
Eine Hütte mit Weitblick: Die Hofalm-Hütte (1.305 m) in den Ennstaler Alpen.
Foto: Georg Kukuvec

Auf der Rotgüldensee-Hütte (1.740 m) setzt man auf hausgemachte Kost und einen nachhaltigen Betrieb.
Foto: Max Mauthner

täglich mit viel Liebe frisch gebacken.
Die Sonnenterrasse direkt am Seeufer lädt zum Verweilen ein. Die regelmäßigen Yogakurse, ebenfalls direkt am Ufer, bieten eine erholsame Abwechslung. Für die nächtliche Ruhe auf der Hütte stehen 50 gemütliche Schlafplätze zur Verfügung.
Am Morgen wartet auf der Hütte ein herzhaftes, frisch zubereitetes Frühstück.
Die Hüttentechnik ist sehr einfach aufgebaut. Ein Stromanschluss an das öffentliche Netz ist vorhanden, da die Hütte direkt am Speichersee liegt. Die Abwasserreinigung erfolgt über eine mechanische Vorreinigung und
eine nachgeschaltete Tropfkörperanlage. Die gereinigten Abwässer werden nach Prüfung in den Rotgüldenbach eingeleitet. Die Trinkwasserversorgung mit Tagesspeicher und UV-Anlage funktioniert einwandfrei. Ein zentraler Kachelofen sowie ein Küchenherd sorgen für die Beheizung.
Seehöhe 1.432 m, Oberösterreich
Totes Gebirge, Alpenverein Lambach

DieLambacher Hütte auf 1.432 m liegt neben dem Sonnkogel (1.437 m) zwischen Bad Goisern und Altaussee und somit unweit der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark. Die Hütte ist eine Selbstversorgerhütte, die im Sommer zusätzlich von eh-
renamtlichen Mitgliedern des Alpenverein Lambach am Wochenende bewirtschaftet wird. Die einfache, urige Hütte bietet minimalen Komfort, verfügt aber dennoch über alles, was ein ruhiges Hüttenerlebnis ausmacht. Sie wird gerne auf Wanderungen oder beim
Tourengehen besucht. Außerdem ist sie ein beliebtes Ziel für Familien mit Kindern, die das Innere Salzkammergut erkunden. Auch für Gruppenausflüge eignet sich die Hütte hervorragend.
Die Bewirtschaftung mit der einfachen Küche und der
Das Umweltgütesiegel der Alpenvereine zeichnet Hütten aus, die sich durch vorbildlichen Umweltschutz, nachhaltige Bewirtschaftung und einen respektvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen hervorheben. QR-Code scannen und mehr erfahren.

Auch die Lambacher Hütte (1.432 m) im Toten Gebirge erfüllt die strengen Kriterien des Umweltgütesiegels.
Foto: Max Gebhart
technischen Ausstattung ist vorbildlich und entspricht den Kriterien des Umweltgütesiegels und der allgemeinen Wertehaltung des Alpenvereins. Es gibt keine fossilen Energieträger, die PV-Anlage ist auf die Anforderungen abgestimmt und bedarfsgerecht dimensioniert. Die Trinkwasserversorgung erfolgt über die Fassung des Regenwassers, das sparsam in Tagesmengen zu Trinkwasser aufbereitet wird. Die Abwasserentsorgung erfolgt über eine Trockentoilette mit anschließender Verrieselung. Das gemütliche Schlaflager der Hütte mit Aussicht auf den Dachstein bietet Platz für bis zu 25 Personen.

WOL f Ga NG Sch Na BL Alpenvereinspräsident
Vier Alpenvereinshütten wurden bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet –ein Erfolg und zugleich ein Spiegel: Während auf den Bergen der Klimawandel längst sichtbar ist, scheitert die Gesellschaft im Tal oft an ihrem eigenen Anspruch.
Das Umweltgütesiegel ist kein freundliches Etikett für Imagebroschüren. Es ist der Nachweis, dass Verantwortung mehr wiegt als Bequemlichkeit. Seit über 25 Jahren werden jene Hütten ausgezeichnet, die einen nachhaltig und klimafreundlich geführten Betrieb nach einem strengen, umfassenden Kriterienkatalog nachweisen. Grundvoraussetzungen sind ein energieeffizienter Betrieb, klimafreundliche Speisen und Beschaffung sowie Abfall-, Wasser-, Bau- und Mobilitätskonzepte.
Die Hütten mit Umweltgütesiegel sind Vorbilder, weil sie zeigen, dass ökologisches Handeln nicht vom guten Willen abhängt, sondern von konsequenten Entscheidungen. Doch ihr Beispiel bleibt wirkungslos, wenn Gesellschaft und Politik nicht nachziehen. Solange um jeden Parkplatz gestritten, aber kein Wort über kluge Mobilität verloren wird, solange Förderungen für fossile Strukturen weiterfließen, während Pioniere des Umweltschutzes um Unterstützung ringen und klare gesetzliche Vorgaben für klimaverträgliches Wirtschaften fehlen, bleibt der Fortschritt Stückwerk. Verantwortung darf nicht länger freiwillig sein: Sie muss politisch eingefordert, gesetzlich verankert und finanziell ermöglicht werden.
Die Klimakrise ist keine ferne Bedrohung, sie ist Realität – spürbar in jedem Sommer, sichtbar in jedem schwindenden Gletscher und in jedem Winter, der ohne Schnee vergeht. Die Zeichen sind unüber-
sehbar, die Folgen längst da. Es reicht nicht mehr, über Maßnahmen zu sprechen – sie müssen jetzt umgesetzt werden. Jede Verzögerung kostet Zukunft. Das Umweltgütesiegel ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es darf kein Alibi sein, sondern muss Maßstab werden – für Hütten, Gemein-
»Verantwortung darf nicht länger freiwillig sein: Sie muss politisch eingefordert, gesetzlich verankert und finanziell ermöglicht werden.«
den und politische Entscheidungen gleichermaßen. Wer die Berge bewahren will, darf Verantwortung nicht delegieren. Denn wahre Veränderung beginnt erst, wenn das Bewusstsein wächst, dass Nachhaltigkeit keine Option ist, sondern Verpflichtung jedes Einzelnen von uns.
Schon seit über 5000 Jahren prägen Wege zu Land und zu Wasser das Bild der Alpen. Zu denken sei hier nur an Ötzi – den Mann vom Tisenjoch, der im vierten vorchristlichen Jahrtausend die hochalpinen Pässe überschritt. Auch wenn von Wegen aus dieser Zeit selbst keine Zeugnisse erhalten sind, so muss doch davon ausgegangen werden, dass zumindest Routen vorhanden gewesen sein müssen, die heute durch moderne Technologien zum Teil rekonstruiert werden können.
Spätestens in römischer Zeit sind Straßen über die Alpen archäologisch nachweisbar. Als Objekte von langer Dauer werden die Trassen zu einem beträchtlichen Teil bis heute noch genutzt. Dadurch sind viele der älteren Wege nur noch in Fragmenten erhalten und wenige Funde (wie Keramikbruchstücke, Schuhnägel oder in besonders günstigen Fällen Münzen) zeichnen einen Weg bereits als Römerweg aus. Daher muss die heutige Forschung zu historischen Altwegen ein zuerst einmal nicht direkt eingängliches Verfahren wählen und nicht den historischen Verlauf von früher bis heute betrachten, sondern von der Gegenwart in die Vergangenheit rekonstruieren.
Was sind Altwege?
Laut einer Definition sind Altwege Verkehrsverbindungen früherer Zeiten, die durch historische Dokumente und ihr Erscheinungsbild im Gelände nachweisbar sind. Im allgemeinen Verständnis decken Altwege einen Zeitraum bis zum Beginn des modernen Straßenbaus ab, wobei Wege von besonderer historischer Bedeutung –wie zum Beispiel die Großglocknerstraße – ebenfalls zu Altwegen hinzugezählt werden. Dabei ist nicht nur der Wegekörper selbst von Bedeutung, sondern auch eine ganze Reihe von dazugehörigen Baumaßnahmen (Drainagen, Brücken, Tunnels oder befestigte Böschungen), Infrastruktur (wie Steinabbaustellen, Stallungen, Herbergen oder auch Wegweiser) und weitere Wegbegleiter (z. B. Kapellen oder Bildstöcke).
Hinzu kommen – und dies ist meist nur in zu den Wegen gehörigen Schriftquellen nachzuweisen – Techniken der Wegeerhaltung wie Trockensteinmauern,

Wer häufig in den Bergen unterwegs ist, begegnet ihnen immer wieder: alten Brücken, Trockensteinmauern oder kaum mehr sichtbaren Trassen. Manch heutiger Steig folgt jahrhundertealten Routen. Doch wie lassen sich diese stummen Zeugen der Vergangenheit bewahren – und was erzählen sie uns?
Leif Sche U e R ma NN , m a Rc O Ga BL

Organisationsformen für den Transport wie das Säumerwesen sowie Zölle und Wegegelder. Altwege sind Teile kulturellen Erbes, das sich in der Landschaft heute noch zeigt, jedoch in seiner materiellen wie immateriellen Gesamtheit weitaus mehr ausmacht. Sie beinhalten auf verschiedenste Weise Praktiken des alltäglichen Lebens der Vergangenheit, die die Alpen zutiefst geprägt haben.
Gefährdetes Kulturerbe
Das historische Erbe ist heute mehr denn je gefährdet. Traditionelle Berufe wie Säumer*in, Wagenbauer*in, Schmied*in oder Trockensteinmaurer*in sind weitestgehend ausgestorben oder fristen ein Nischendasein. Auch die Wege selbst sind erhöhten Gefährdungen durch das sich rapide verändernde Klima, aber auch durch den Einsatz schwerer Maschinen zur Be-
» Im allgemeinen Verständnis decken Altwege einen Zeitraum bis zum Beginn des modernen Straßenbaus ab, wobei Wege von besonderer histori
scher Bedeutung –wie zum Beispiel die Großglocknerstraße – ebenfalls zu Altwegen hinzugezählt werden. «
Der Krimmler Tauernweg wurde bereits in vorrömischer Zeit genutzt und war seit dem Mittelalter ein wichtiger Säumerweg zwischen dem Krimmler Achental auf Salzburger Boden und dem Südtiroler Ahrntal.
Foto: Alpenverein/G. Unterberger
wirtschaftung ausgesetzt. Vermehrte Murenabgänge und Überflutungen tragen ebenso zur Zerstörung des kulturellen Erbes Altweg bei wie die unsachgemäße Freizeitnutzung gefährdeter Wege oder der Gebrauch schwerer land- und forstwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge.
Dabei ist klar: Eine touristische Nutzung historischer Wege ist nicht per se schädlich – der uneingeschränkte Gebrauch sensibler Strukturen führt jedoch unweigerlich zu deren Zerstörung. Es braucht daher vor allem Wissen über die Wege und die Information einer interessierten Öffentlichkeit.
Ein Altwegeinventar – als Sammlung und Dokumentation aller noch bestehenden historischen Trassen – erscheint da als erster Schritt: um ein Bild der Gesamtlage zu erhalten, dieses allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen und nicht zuletzt neue Einblicke in die Alltagsgeschichte Öster-
reichs zu ermöglichen. In einem weiteren Schritt können daraus Konzepte der sanften Nutzung entstehen – etwa durch die Reaktivierung verkehrsgeschichtlich bedeutsamer Alpenübergänge oder die Auszeichnung noch sichtbarer, vergessener Trassen im Gelände.
Ein Altwegeinventar für Österreich?
Als herausragendes Beispiel eines solchen Altwegeinventars ist zweifellos das IVS (Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz) zu nennen. In einem Schweizer Bundesgesetz ist verankert, dass Wanderwege über historische Wegstrecken verlaufen sollen, um so zur Erhaltung der Substanz beizutragen.
Um dies zu erreichen, wurden in den Jahren 1983 bis 2003 im Auftrag des Bundes am Historischen und Geographischen Institut der Universität Bern grundlegende Informationen über Verlauf, Zustand, Geschichte und Bedeutung aller Altwege gesammelt und in einer öffentlich zugänglichen Datenbank dokumentiert (viastoria.ch/pages/inventar-ivs, zuletzt aufgerufen am 2.9.2025). Verantwortlich für das Kataster ist das Schweizer Bundesamt für Straßen, welches auch Beihilfen zur Erhaltung und Instandsetzung historischer Wege vergibt – sodass Dokumentation, zielgerichtete Erhaltung und Vermittlung in einer Hand liegen.
Ähnliche Strukturen fehlen in Österreich bislang vollständig. Zwar gibt es zahlreiche Einzelinitiativen – gerade die Sektionen des Alpenvereins haben sich immer wieder bemüht, den historischen Wert eigener Wege zu ergründen und einer interessierten Öffentlichkeit zu vermitteln –, eine systematische Zusammenführung, Ergänzung und Vernetzung dieser Arbeiten ist jedoch noch nicht erfolgt. Um hier etwas zu bewegen, hat sich eine Interessensgruppe namens ALWIN (ALtWegeINventar) Österreich zusammengefunden. Ihr Ziel ist es, dauerhafte Strukturen aufzubauen, um Altwegen in Österreich die Aufmerksamkeit und Unterstützung zukommen zu lassen, die ihrem historischen Wert entsprechen. Beteiligt sind derzeit 56 Fachleute aus Museen, Naturparks, den Denkmalschutzbehörden, Universitäten sowie private Interessierte
–

Frühes 20. Jahrhundert: landschaftsprägender Militär-Saumweg im Valle Gesso – Seealpen. Foto: Albert Schweizer

Oft unbeachtet unter Wanderfüßen: Steinpflasterung eines historischen Saumweges. Foto: Albert Schweizer

Zeugnis historischer Handwerkstechnik: Trockensteinmauer an einem Jagdreitweg – heute wieder genutzt zur Versorgung einer Schutzhütte mittels Saumtieren. Foto: Albert Schweizer
und nicht zuletzt der Österreichische Alpenverein, dessen Wegenetz teilweise auf historischem Altbestand verläuft.
Die konkreten Ziele von ALWIN sind:
• Die flächendeckende Aufnahme aller historisch bedeutsamen Wege Österreichs
• Die Eingliederung der historischen Wege in die Raumordnung (Wegeinventar)
• Die Sensibilisierung der Bevölkerung für historische Altwege unter besonderer Berücksichtigung ihres identitätsstiftenden Charakters
• Die Erarbeitung didaktischer Konzepte für Schulen
• Die Erhaltung schützenswerter Wege und damit verbunden historischer Handwerkstechniken
• Die Entwicklung von nachhaltigen Nutzungskonzepten für einen sanften Tourismus im Kontext des Klimawandels
• Der Aufbau überregionaler Kulturrouten nach dem Vorbild der Schweiz.
• Kultur- und Naturlandschaftsschutz durch Nutzung und gezielte Erhaltungsmaßnahmen (Revitalisierung)
• Die Vernetzung aller nationalen
Akteure und Zusammenführung bestehenden Wissens für eine verbesserte internationale Sichtbarkeit mit einem langfristigen Ziel des Aufbaus europaweiter Strukturen
Um hier etwas zu bewegen, hat sich eine Interessensgruppe namens ALWIN (ALtWegeINventar) Österreich zusammengefunden. Ihr Ziel ist es, dauerhafte Strukturen aufzubauen, um Altwegen in Österreich die Aufmerksamkeit und Unterstützung zukommen zu lassen, die ihrem historischen Wert entsprechen.
Um diesen Zielen näher zu kommen, fanden 2022 und 2024 Workshops in Mittersill und Innsbruck statt. Zudem wurden Pilotprojekte initiiert, die eine Umsetzung in lokal begrenzten Räumen erprobten und teilweise bereits abgeschlossen sind. Ferner konnte die Interessensgruppe im Rahmen des 23. Internationalen Wege- und Hüttenfachsymposiums des ÖAV in Kufstein im März 2025 über die praktische Arbeit der Dokumentation von Altwegen informieren. Eine Förderung durch staatliche Stellen –wie sie in der Schweiz realisiert wurde – erscheint in Österreich derzeit ausgeschlossen. Daher liegt es gerade an der Zivilgesellschaft, sich für ein gefährdetes Kulturgut wie die Altwege und Altstraßen einzusetzen, die Österreich seit frühester Zeit geprägt haben – und es noch heute tun.
Univ. Prof. Dr. Mag. Leif Scheuermann ist Querschnittsprofessor für digitales historisches Erbe an der Universität Trier. In dieser Funktion verbindet er neueste technologische Entwicklungen mit traditionellen historischen Arbeitsweisen. Während seiner langjährigen Arbeit an der Karl-FranzensUniversität Graz entwickelte sich das österreichische Altstraßenwesen zu einem zentralen Schwerpunkt seiner Arbeiten.
Marco Gabl ist Mitarbeiter der Abteilung Hütten und Wege des Österreichischen Alpenvereins und Lehrbeauftragter am Institut für Geographie an der Universität Innsbruck.
Egal, ob du einen Hüttenaufenthalt auf einer Skitour planst oder bereits sehnsüchtig auf den Hüttensommer wartest: Deine Schlafplätze kannst du auf etwa 500 Hütten im gesamten Alpenraum ganz einfach online über „Hut Reservation“ (hut-reservation.org) reservieren.
Beachte aber bitte der Fairness halber gegenüber den Hüttenwirtsleuten und anderen Gästen ein paar Spielregeln: Reserviere nur, wenn du deinen Aufenthalt wirklich wahrnehmen möchtest. Verzichte auf Doppelreservierungen – egal, ob am selben Tag auf mehreren Hütten oder auf einer Hütte an verschiedenen Tagen in der Saison. Kommt dir etwas dazwischen, storniere oder ändere die Reservierung möglichst rechtzeitig.
Dir ist etwas bei der Reservierung unklar? Dann schau gerne in den FAQs vorbei und finde die Antworten auf die häufigsten Fragen: t1p.de/hutreservationfaqs
Winterwandern erfährt eine zunehmende Beliebtheit. Einer Erhebung in der Schweiz zufolge unternehmen gut 80 Prozent der Wandernden auch in den Wintermonaten Wanderungen. Das Angebot an speziell ausgewiesenen Winterwanderwegen (meist magentafarben gekennzeichnet) ist im Vergleich zum Angebot an Sommerwanderwegen gering, wenig koordiniert und oft auf Initiativen

Wer im Winter auf Ski- oder Schneeschuhtour unterwegs ist, ist manchmal auf eine Übernachtungsmöglichkeit angewiesen. Dafür sind die Winterräume der Hütten in der Zeit vorgesehen, in der sie nicht bewirtschaftet sind. In Winterräumen findet man einfache Schlaf-, Heizund Kochgelegenheiten vor. Wichtig ist aber, sich vor einem geplanten Aufenthalt gründlich über die Ausstattung und –noch wichtiger – über den Zugang zum Winterraum zu informieren. Sprich: Ist der Winterraum verschlossen? Wenn ja, mit welcher Art von Schlüssel? Und wo bekomme ich ihn her?
Im Winterraum selbst heißt es: sparsam mit Brennmaterial umgehen, alles wieder sauber hinterlassen und die Nächtigungsgebühr bezahlen. Ein Appell aller Menschen, die einen Winterraum betreuen: Winterräume sind der falsche Ort für Partys oder ein langfristiges Nomadenleben. Sollte dir etwas kaputtgehen oder etwas auffallen, melde den Schaden bitte unbedingt an die für den Winterraum zuständige Alpenvereinssektion. Das Verständnis füreinander und die Einhaltung der Regeln sorgen dafür, dass diese Form der Übernachtungsmöglichkeit auf Alpenvereinshütten langfristig weiter bestehen kann.
von Tourismusorganisationen zurückzuführen. Winterwanderwege müssen präpariert, gegen alpine Gefahren gesichert und ggf. auch von der lokalen Lawinenkommission beurteilt werden.
Unsere Alpenvereinswege werden hingegen nicht als Winterwanderwege ausgewiesen. Zwar können sie bei guten Witterungsverhältnissen und in den Niederungen das ganze Jahr über begangen werden, müssen jedoch bei Schneelage nicht gesperrt werden. Die Begehung erfolgt wie im Sommer in Eigenverantwortung. Schnee, Schneeglätte oder Vereisung sind typische alpine Gefahren, die selbst zu meistern sind. Die Verkehrssicherungspflichten der Wegewarte sind im Winter praktisch gegen null reduziert.











BÜber den Link „Bergwetter“ gelangt man zum Alpenvereinswetter, das DAV und ÖAV gemeinsam betreiben. Der Link in der alpenvereinaktiv-App führt zur Version auf der Website des DAV, da hier die deutschen Mittelgebirge ebenfalls inkludiert sind. 1 5 4 2 3




Wer auf Skitour oder beim Freeriden unterwegs ist, sollte sich nicht blind auf vorhandene Spuren verlassen. Es braucht gute Planung, laufende Orientierung und solides Wissen. alpenvereinaktiv hilft – mit Karten, Infos zu Wetter, Schnee und Lawinen. Serie alpenvereinaktivTipp, Teil 7.
WOL f Ga NG Wa R m U th Team alpenvereinaktiv
evor man im Winter auf den Berg startet, sollten der Wetterbericht und die Lawinenprognose zu den zentralen Elementen der Tourenvorbereitung gehören. In der alpenvereinaktiv-App findet man beides im Hamburgermenü unter „Themen“ (Bild 1 ).
Das Alpenvereinswetter des ÖAV ist auf www.alpenverein.at/wetter zu finden.
Durch Schnittstellen zu den Lawinenwarndiensten findet man auf alpenvereinaktiv für alle Regionen des Alpenbogens und sogar darüber hinaus die tagesaktuell gültigen Lawinenlageberichte/-prognosen. Neben der Lawinenlage im Hamburgermenü wird im Winter die Warnstufe direkt bei jeder Tour eingeblendet und man gelangt über einen Link zum vollständigen Bericht. Hinweis: Auch über die beste Schnittstelle kann sich mal ein
Fehler einschleichen, daher lohnt es sich immer, die Lawinenlage auch auf der Originalseite der Lawinenwarndienste anzuschauen. Den Link dorthin findet ihr bei jedem von alpenvereinaktiv veröffentlichten Bericht.
Aktuelle Bedingungen
So wichtig Wetterbericht und Lawinenprognose sind, so liefern sie uns leider keine Infos, wie die Tourenverhältnisse am Berg wirklich sind bzw. waren. Das ist die Aufgabe der aktuellen Bedingungen, die ihr im Hamburgermenü unter „Inhalte“ findet (Bild 1 ).







Jede*r Nutzer*in von alpenvereinaktiv kann über die erlebten Tourenverhältnisse berichten und dazu eine aktuelle Bedingung anlegen. Das Veröffentlichen geht flott und einfach: Auf der Karte den entsprechenden Ort markieren, Fotos von der Tour hochladen und die Tourenverhältnisse sowie etwaige Gefahren und das Wetter kurz beschreiben. Mehr zum Thema der aktuellen Bedingungen und wie man sie am besten findet, könnt ihr im alpenvereinaktiv-Tipp, Teil 4, im Bergauf #1.2025 nachlesen.
Karten und Zusatzlayer
Für die Planung zuhause und für die Orientierung im Gelände gibt es eine Reihe von Karten und Zusatzebenen, die speziell für den Winter interessant sind. In der Kartenauswahl stehen unter „Karte“ verschiedene Grundkarten zur Verfügung (Bild 2 – 3 ). Je nachdem, welche Grundkarte aktiviert ist, können unter „Stil“, „Aktivitätsnetze“ und „Zusätzliche Ebenen“ weitere Optionen genutzt werden. Die meisten Optionen stehen bei den beiden digitalen Vektorkarten OpenStreetMap (OSM) und Outdooractive zur Verfügung. Bei diesen beiden Karten ist nur zu beachten, woher die Daten wirklich kommen. Während die OSM eine kostenlose Karte auf Basis eines Community-Projekts ist,


bietet die Outdooractive-Karte im Alpenraum die „offiziellere“ Alternative. Dadurch unterscheiden sich beide Karten in der Genauigkeit der Geländedarstellung und im eingezeichneten Wegenetz. (Lesetipp zum Thema der OSM: „Im Glauben erschüttert“, Bergauf #2.2025).
Das Aktivitätsnetz „Wintersport“ und die Zusatzebene „Hangneigung“ unterscheiden sich daher bei beiden Karten stark voneinander. Während im „Wintersport“-Layer der OSM die Lifte und Skipisten oft genauer passen, sind im „Wintersport“-Layer von Outdooractive die offiziellen Skitourenrouten der Alpenvereine enthalten. Ganz wichtig für euch: Den „Hangneigung Basic“-Layer der OSM solltet ihr nicht verwenden, da hier die Datengrundlage mittlerweile sehr alt und ungenau ist! Der Hangneigungslayer von Outdooractive hingegen basiert auf hochwertigen Daten und ist sehr zu empfehlen (Bild 4 ).
Weitere interessante Layer: ATHM
Neben der Hangneigungskarte ist die Avalanche Terrain Hazard Map (ATHM), bereitgestellt von Skitourenguru-Gründer Günter Schmudlach, ein zentrales Element der winterlichen Tourenplanung geworden. Wie die Karte zustande
kommt und wie sie zu verstehen ist, könnt ihr einerseits auf skitourenguru.com nachlesen oder ihr schaut auf der Wissensseite nach, die ihr über das kleine „i“ beim ATHM-Button erreicht. (Bild 5 ).
Unter „Stil“ / „Wetter & Klima“ findet ihr eine Karte mit den aktuellen Schneehöhen. Die Karte stammt von der Schweizer Firma ExoLabs, die versucht, mit Hilfe von Satelliten- und Stationsdaten die Schneehöhen zu ermitteln – nicht nur für den Alpenbogen, sondern auch darüber hinaus. (Bild 6 )
Wer sich damit schwer tut, die Ausrichtung der Hänge oder bestimmte Geländeformen aus der Karte herauszulesen, der findet mit dem neuen HangausrichtungsLayer eine super Hilfe. Die Karte wird damit deutlich plastischer und man kann Geländestrukturen erkennen, die man sonst, vor allem aus der OSM, nicht herauslesen könnte. Gerade im 3-D-Modus des Onlineportals unterstützt uns die Einfärbung der Hangausrichtungen dabei, nicht die Orientierung zu verlieren. (Bild 7 )
Tippt man in der Kartenauswahl auf „Webcams“, dann werden in der Karte Webcams eingeblendet, die über die Wetter-App Windy bereitgestellt werden. Neben den aktuellen Bedingungen sind Webcams eine gute Möglichkeit, sich über die Verhältnisse am Berg zu informieren. (Bild 8 )
¡
Alle bisher in Bergauf erschienenen Funktionstipps von alpenvereinaktiv sind hier zu finden: www.alpenverein.at/ portal/bergsporttipps

Mehr dazu: www.alpenverein.at/ portal/bergsporttipps
Zwischen Google Maps und alpenvereinaktiv scheint die Landkarte als physisches Produkt heute keine Bedeutung mehr zu haben. Wir aus der Smartphone-Generation wissen oft schon gar nicht mehr, wie man ein solches „Leintuch“ auseinanderfaltet, ohne Risse zu erzeugen. Trotzdem gibt der Österreichische Alpenverein (ÖAV) noch fast 90 physische Landkarten heraus. Früher war die „Alpenvereinskartographie“ ein Gemeinschaftsprojekt von ÖAV und DAV. Der Name „Alpenvereinskarte“ steht heute für Qualität und für eine jahrhundertealte kartographische Tradition.
In diesem Beitrag soll es aber nicht um die Möglichkeiten und Herausforderungen der Kartographie im digitalen Zeitalter oder etwa um Sinn und Unsinn von Papierkarten oder Bildschirmorientierung gehen. Stattdessen wollen wir uns mit genau dieser kartographischen Tradition beschäftigen. Wie kamen die Alpenvereine zu ihrer Karte?
„Die Alpenvereinskartographie ist so alt wie der Verein selbst“, betonte der Geograph und ÖAV-Vorsitzende Hans Kinzl (1898–1979) einmal. Die erste vom Alpenverein herausgegebene Karte erschien nämlich als Beilage zum Alpenvereinsjahrbuch 1865, nur drei Jahre nach der Gründung des Österreichischen Alpenvereins 1862. Die Karte der Ankogelgruppe im Maßstab 1:72.000 von Franz Keil läutete damit den Beginn dieser kartographischen Erfolgsgeschichte ein. Wer die modernen Alpenvereinskarten mit den runden Maßstäben 1:50.000 oder 1:25.000 kennt, wird sich über das seltsame Maß dieser ersten Karte wundern. Der andere Maßstab rührt von der Umrechnung des alten Längenmaßes auf das metrische System. Bis zur bewährten Alpenvereinskarte war es noch ein weiter Weg.
Die Erstellung von brauchbaren Karten ist auch in Zeiten von GPS, Satelliten und digitalen Tools kein einfaches Unternehmen. Umso größer war der Aufwand, der für Kartierungsarbeiten im 19. Jahrhundert betrieben wurde. Ohne Luftaufnahmen oder Satellitenbilder mussten Kartographen die Landschaft zuerst einmal

Von der Vermessung mit Theodolit und Bleistift bis zum Orthofoto: In über 150 Jahren hat sich die Alpenvereinskarte zu einem Musterbeispiel der Gebirgskarte entwickelt. Dabei geht es bei der Alpenvereinskartographie um mehr als nur traditionelle Wanderkarten. Phi L i PP f e

Bei der mühsamen und zeitintensiven Kartierung im Gelände waren
Gebirgsgegenden der Endgegner. Einerseits waren sie aufwändiger zu vermessen und zu zeichnen. Andererseits mussten die Kartographen vor Ort sein, um Vermessungen zu machen, was im Hochgebirge nicht überall möglich war.
Ein Paradebeispiel der Kartographie von L. Aegerter: die Karte von Langkofel und Sellagruppe (Nachdruck von 1926). Wie damals üblich, wurde die Papierkarte auf Leinen geklebt.
Fotos: AVSArchiv
vermessen. Dabei nutzte man seit dem 17. Jahrhundert die Methode der Triangulation: Mithilfe des Dreiecksatzes maß man die Entfernung zwischen zwei Punkten anhand des Winkels und der bekannten Entfernung zu einem dritten Punkt. Diese Methode war einfacher und genauer, als die Entfernung „per Hand“ auszumessen, bedeutete aber immer noch einen großen Aufwand und die physische Anwesenheit der Kartographen vor Ort. Hatte man genug Punkte gesammelt, wurde die Karte schließlich von Hand gezeichnet und für den Druck auf eine Kupferoder Steinplatte übertragen. Vermessung und Erstellung von Karten waren Aufgaben, die staatliche Institutionen jahrzehntelang beschäftigten.
Wie kam also ein einfacher Verein dazu, sich an eine solche Mammutarbeit zu wagen? Das hat zwei Gründe. Zuerst einmal das Selbstverständnis des neu gegründeten Deutsch-Österreichischen Alpenvereins (1869 war der Deutsche Alpenverein gegründet worden, 1873 schlossen sich DAV und OeAV zum Deutsch-Oesterreichischen Alpenverein DuOeAV zusammen). Der Verein hatte von Anfang an eine wissenschaftlich-akademische Ausrichtung. Dazu gehörten auch die kartographische Arbeit und die Erstellung von Karten über das Hochgebirge – die damit auch die Bereisung der Alpen erleichterten. Der zweite Grund war die Qualität der amtlichen Karten. Für die Orientierung im Hochgebirge, aber auch für die Erforschung dieses Raumes waren diese Karten nicht genau genug.
Bei der mühsamen und zeitintensiven Kartierung im Gelände waren Gebirgsgegenden nämlich der Endgegner. Einerseits waren sie aufwändiger zu vermessen und zu zeichnen. Andererseits mussten die Kartographen vor Ort sein, um Vermessungen zu machen, was im Hochgebirge
nicht überall möglich war. Daher galt in der amtlichen Kartographie auch im 19. Jahrhundert noch ein Satz, den Preußenkönig Friedrich II. schon seinem Kartographen gesagt haben soll: „Wo ich nicht hinkann, mache er einen Klecks.“ Amtliche Karten dienten vor allem der Verwaltung (Kataster) oder dem Militär. Für beide war das Hochgebirge nicht interessant genug, um den Aufwand einer genauen Aufnahme zu rechtfertigen.
Schummerung & Schraffen
Neben der Vermessung der Berge war aber auch ihre genaue und übersichtliche Darstellung ein Problem. Liefern moderne gedruckte Karten mit durchdachten Farbverläufen und Schummerung (Schattenwurf) zusätzlich zu den Höhenlinien eine plastische Darstellung von Höhenverläufen, waren alte Bergdarstellungen weniger anschaulich. Das bekannteste neuzeitliche Kartenwerk von Tirol, der Atlas Tyrolensis (1774 veröffentlicht), stellt Berge als für die Zeit typische „Maulwurfshügel“ dar, ähnlich wie bei einer Panoramakarte. Die Form und Höhenverhältnisse der Landschaft ließen sich von so einer Karte aber nicht ablesen.
Das nächste große amtliche Kartierungswerk der Habsburgermonarchie, die Franziszeische Landesaufnahme aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, verwendete sogenannte Schraffen, um Geländeformen darzustellen. Je steiler die Berghänge, desto dunkler die Schraffierung. Auf besonders steilen Hängen konnte daher keine andere Information verzeichnet werden, auch Höhenlinien waren schwer darzustellen. Höhenangaben wurden (wenn überhaupt) durch einzelne Höhenpunkte gemacht.
Das verfügbare Kartenmaterial entsprach im Hochgebirge also nicht den alpinistischen oder akademischen Ansprüchen der Alpenvereinsmitglieder und der Verein begann, eigene Kartierungsarbeiten vorzunehmen. Dabei stützten sich die Kartographen des Alpenvereins auf die schon existierenden amtlichen Karten der österreichischen Landaufnahme oder des topographischen Atlas von Bayern, nahmen aber auch eigene Vermessungen vor, um Geländeformen genauer darzustellen und Höhen exakter zu bestimmen.

Keine Stubenhocker: Kartographen mussten sich zur Vermessung ins Gelände begeben.
Fotos: DAV-Archiv >
Nach der „Specialkarte der Umgebung des Ankogel“ 1865 wurde im Jahrbuch eine weitere Karte von Keil veröffentlicht: die „Karte der Großvenedigergruppe“. An der Karte sieht man weitere Entwicklungen in der Geländedarstellung des 19. Jahrhunderts: einmal die Höhendarstellung über Farbtöne, in diesem Fall in Brauntönen entsprechend der „Hauslab-Skala“ (je höher, desto dunkler), und zweitens Höhenlinien im Abstand von 500 Wiener Fuß (ca. 160 m). Höhenlinien waren zwar schon im 18. Jahrhundert eingeführt worden, setzten sich aber erst langsam durch. Damit fiel der Startschuss für die über 150-jährige Geschichte der Alpenvereinskartographie. Die Karten veränderten sich dabei ständig in Darstellungsform, Maßstab und Blattschnitt, vor allem in den Anfangsjahren. Mit der Kartierung wurden externe Experten wie Franz Keil oder Julius Payer beauftragt. Der Alpenverein versuchte dabei, immer am Puls der kartographischen Entwicklung zu sein. Ende des 19. Jahrhunderts war u. a. die Schweizer Landestopographie führend in der Kar-

Alpenvereinskartograph Alexander Ingenhaeff zeigt die Verwendung des Stereoautographen.
tierung des Hochgebirges, z. B. durch den damals entstandenen „Siegfried-Atlas“ im Maßstab 1:50.000. Also beauftragte der DuÖAV den Schweizer Kartographen S. Simon mit der Erstellung der Karte der Ötztaler Alpen.
An der Wende zum 20. Jahrhundert wurde ein weiterer Schweizer mit regelmäßigen Kartierungen beauftragt: Leo Aegerter. Zusammen mit dem Lithographen Hans Rohn und dem Wiener Kartenverlag Freytag und Berndt prägte er die „klassische“ Alpenvereinskartographie. Seine im Maßstab 1:25.000 gedruck-
ten Karten mit Höhenlinien in 25 Metern Abstand waren für die Verwendung im Gelände geeigneter als die bisherigen. Zu erwähnen ist z. B. die Karte der Langkofelund Sellagruppe (1904), bei der Aegerter das Gelände mithilfe eines Messtisches vollständig neu aufnahm. Felsformationen wurden dabei kunstvoll auf die Karte gezeichnet.
Die Karten der damaligen Zeit sind also nicht nur topographisch genaue Arbeiten, die unter körperlichem Einsatz im Gelände vermessen und gezeichnet wurden, sondern auch handwerkliche und
» Die Alpenvereinskartographie ist so alt wie der Verein selbst. «
Hans Kinzl (1898–1979) Geograph und ÖAV-Vorsitzender
künstlerische Erzeugnisse. Der Steinstecher Hans Rohn sollte später selbst auch als Topograph für den Alpenverein tätig sein und beeindruckende Felszeichnungen produzieren.

Die erste „Alpenvereinskarte“: die Specialkarte der Umgebung des Ankogels, 1865.
ten von Richard Finsterwalder oder die gewohnten, anschaulichen Felszeichnungen von Hans Rohn vorzogen. Die klassische Methode gewann damals noch, doch das von Finsterwalder entwickelte Gerät für photogrammetrische Vermessung im Gelände sollte bis in die 1960er zum Standard gehören.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Entwicklung in der Kartographie noch einmal richtig Fahrt auf. Bahnbrechend war z. B. die Methode der Photogrammetrie, die es ermöglichte, Landschaftsbilder mithilfe eines sogenannten Stereoautographen auszumessen und auch im Felsengebiet genaue Höhenlinien zu ziehen. Die Methode wurde von der Alpenvereinskartographie erstmals 1915 angewandt, brauchte aber noch ein paar Verbesserungen. 1926 veranstaltete der Verein sogar eine Umfrage unter seinen alpinistisch und wissenschaftlich aktiven Mitgliedern, ob sie die geodätisch genaueren, stereophotogrammetrisch erstellten Kar- >
Fotos: OAVArchiv
Zehn Jahre später gelang es dem Kartographen Fritz Ebster, beide Seiten zu verbinden und anschauliche Felszeichnungen mit den durch die Photogrammetrie gewonnenen exakten Höhenlinien zu kombinieren. Das Produkt seiner Arbeit war das ab 1937 erschienene Kartenwerk der Ötztaler und Stubaier Alpen. Ebster war seiner Arbeit so verbunden, dass er sich nach seiner Einberufung zur Wehrmacht sogar einen 80 kg schweren Gravurstein an die Eismeerfront liefern ließ, um „im Felde“ am Blatt Gurgl der Karte der Ötztaler und Stubaier Alpen weiterzuarbeiten. Perfektioniert wurde die Arbeit Ebsters nach dem Zweiten Weltkrieg

Staatlich geprüfte*r Berg- und Skiführer*in • 5 × Hütte im Lager • Halbpension • Leihausrüstung: LVS-Gerät, Schaufel, Sonde • Versicherungen

Deutsch sprechende*r Bergwanderführer*in • Bahnticket 2. Klasse /ICE ab/bis Deutschland • ab/bis beliebigem Bahnhof in Deutschland • Gruppenreise ab Kopenhagen bis Hamburg HBF • 11 × Hotel/Pension im DZ • 11 × Frühstück • Bahnfahrten im Zielgebiet lt. Detailprogramm • Versicherungen
6 Tage | 5 – 8 Teilnehmer*innen
Termine: 28.12.2025 und 02.01. | 04.01. | 25.01. | 08.02. | 22.02. | 08.03. | 15.03.2026 14 Tage | 6 – 15 Teilnehmer*innen Termine: 19.07. | 02.08.2026
von Leonhard Brandstätter. Die Verwendung von Luftbildern sollte die kartographische Arbeit dann noch einmal verbessern und erleichtern.
Trotz der Zäsur des Zweiten Weltkrieges führten die neu gegründeten Alpenvereine DAV und ÖAV ihre kartographische Tätigkeit fort. Zuerst nur von Innsbruck aus, später durch die Anstellung von Rüdiger Finsterwalder als eigenem Beauftragten auch beim DAV in München. 1969 wurde die Zusammenarbeit der beiden Vereine in der „Alpenvereinskartographie“ institutionalisiert. Statt ständig neue Gebiete zu kartieren, versuchte die Alpenvereinskartographie ab jetzt, die existierenden Karten aktuell zu halten, und ein festes Korpus von Alpenvereinskarten etablierte sich.
Die Alpenvereinskartographie wurde vor 160 Jahren mit dem Ziel gestartet, die Orientierung im Hochgebirge zu vereinfachen und die wissenschaftliche Erforschung dieses Raumes zu ermöglichen. Heute sind Karten generell und historische Alpenvereinskarten im Besonderen aber viel mehr als das. Sie halten ein Zustandsbild fest und spielen so eine wichtige natur- und kulturhistorische Rolle. Dazu gehört z. B.
1969 wurde die Zusammenarbeit der beiden Vereine in der „Alpenvereinskartographie“ institutionalisiert.
Statt ständig neue Gebiete zu kartieren, versuchte die Alpenvereinskartographie ab jetzt, die existierenden Karten aktuell zu halten, und ein festes Korpus von Alpenvereinskarten etablierte sich.

auch die Namensgebung in den AV-Karten: Schon im 19. Jahrhundert engagierte die Alpenvereinskartographie Linguisten, um Orts-, Berg- und Flurnamen so genau wie möglich wiederzugeben. Ein anderes Beispiel ist der Rückgang der Gletscher der Ostalpen, der sich in den Alpenvereinskarten beobachten lässt.
Historische Karten also sind wertvoll, weil sie Orientierung bieten. Besonders angesichts der immer schneller werdenden Veränderungen des Alpenraums auch in der Zeit.
Dieser Artikel ist erstmals im Bergeerleben 04/24 des Alpenverein Südtirol (AVS) erschienen.
Philipp Ferrara ist Mitarbeiter im AVS-Archiv.
‹ Mithilfe des Stereoautographen konnten Bilder genau vermessen werden. Foto: ÖAV-Archiv
ˆ Alpenvereinskartograph Richard Finsterwalder bei Vermessungsarbeiten am Nanga Parbat. Foto: ÖAV-Archiv

Mit dem ersten Schnee kehrt am Berg scheinbar Ruhe ein: Hütten schließen, Wege werden zurückgebaut, die Vegetation zieht sich zurück. Doch unter der Oberfläche laufen Vorbereitungen – für den nächsten Frühling, das nächste Bergjahr.
t eam Nat URS ch U tz, h ütte N UN d We G e
Im Gebirge kehrt nun endgültig die stille Zeit ein. Die meisten Hütten sind winterfest gemacht und bleiben bis zum Frühjahr geschlossen. Einige Wege, besonders in Hochgebirge, sind vor dem Winter auch bereits zurückgebaut worden, um die Einbauten wie Seilversicherungen und Brücken vor den rauen Bedingungen und dem Schneedruck zu schützen. Doch nicht nur bei den Hütten und Wegen wird alles winterfest gemacht, auch die Pflanzenwelt begibt sich in ihre Winterruhe. Doch diese Ruhe ist oft nur oberflächlich. Hinter den Kulissen laufen bei den Wegewarten bereits erste Planungen für das kommende Jahr – insbesondere die Budgetfragen stehen jetzt im Fokus. Einige Hütten öffnen gar schon wieder im Dezember ihre Türen für die Skitourengeher*innen. Und auch die Natur bleibt nicht untätig: Mit raffinierten Anpassungsstrategien bereiten sich die Pflanzen auf ein erneutes Aufblühen im nächsten Frühjahr vor.
Viele Pflanzen ziehen sich mehr oder weniger in den Boden zurück. Kräuter und Gräser speichern ihre Energie in Wurzeln und Rhizomen, während ihre oberirdischen Teile absterben oder unter einer dicken Schneedecke verschwinden. Der Schnee dient dabei als Schutz: Er isoliert den Boden und bewahrt Pflanzen vor extremen Temperaturschwankungen.
Die Flechten, unsere Doppellebewesen aus Pilz und Alge, stellen ihren Stoffwech-

sel fast völlig ein und verfallen in eine Art „Winterstarre“. Sie betreiben keine Fotosynthese, kein Wachstum und keine Nahrungsaufnahme. Wenn die Bedingungen jedoch wieder passen, werden sie innerhalb kürzester Zeit wieder aktiv.
Bei manchen Pflanzen deutet schon der Name auf ihre Zähigkeit im Winter hin. Die Schneeheide (Erica carnea), auch Winterheide genannt, blüht von Dezember bis März und hält Temperaturen bis –30° Grad aus. Sie ist eine typische Gebirgspflanze und kommt in Höhen bis 2.700 m vor. Ähnlich zäh ist auch unser Wegenetz, das seit über 160 Jahren Bestand hat und zum Teil auf noch wesentlich ältere Säumersteige und Handelsrouten zurückgeht.
Die Serie Wegetation ist eine Zusammenarbeit zwischen Birgit Kantner (Naturschutz) sowie Marco Gabl und Esther Röthlingsdorfer (Hütten und Wege).
Vom 12. bis 14. September 2025 verwandelte sich die
Gerlosplatte in Tirol in ein lebendiges Festivalgelände: Rund 90 Menschen kamen zum ersten inklusiven MoMo – Mosaik-Mountain Festival der Alpenvereinsjugend Österreich und des Österreichischen Alpenvereins.
S OLV eiG m eie R , SimON e h ütte R
Die Idee für das Festival nahm im Frühjahr im Rahmen des achten Netzwerktreffens Inklusion Form an. Die Teilnehmer*innen sammelten in einem kreativen Workshop ihre Wünsche und Vorstellungen: Bunt sollte es sein, inklusiv sowieso, barrierefrei, naturnah, mit viel Bewegung, Austausch, gutem Essen, Musik und Beisammensein. Der Name war schnell gefunden: MoMo – MosaikMountain Festival. Ein Mosaik besteht aus vielen kleinen Teilchen, die zusammen ein großes Ganzes ergeben – genauso wie die Menschen, die dieses besondere Wochenende möglich gemacht haben. Der barrierefreie Veranstaltungsort hätte dabei kaum besser gewählt sein können: Das Jugendgästehaus Gerlosplatte im Nationalpark Hohe Tauern bot den rund 90 Teilnehmer*innen beste Bedingungen für Indoor- und OutdoorAktivitäten und beeindruckte nicht nur landschaftlich, sondern auch architektonisch: Das gesamte Treppenhaus ist als befahrbare Rampe angelegt und ermöglicht barrierefreie Mobilität bis in den fünften Stock.
Besonders schön war die bunte Durchmischung der Gruppe – von der jüngsten Teilnehmerin mit zwei Jahren bis hin zum ältesten Besucher mit 82 Jahren. Inklusion wurde nicht nur gedacht, sondern gelebt und gefeiert.
Das Programm spiegelte genau das wider: eine vielfältige Auswahl an Aktivitäten, vorbereitet von einer engagierten Gruppe aus dem Netzwerk Inklusion. Über 40 Erlebnisstationen luden zum Mitmachen ein, von Naturerkundung und Bewegungsspielen bis hin zu kreativen Impulsen. Besonders beliebt: die auf Holz gedruckten MoMo-Festival-Medaillen, die für jede absolvierte Station gesammelt werden konnten. Auch an der Indoor-Kletterwand wurde gemeinsam angepackt. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sicherten einander und kletterten Seite an Seite.
Trotz durchwachsenem Wetter ließen sich die Wandergruppen nicht abhalten: Mal wurden Sonnenstrahlen am Gipfel eingefangen, mal Regenbögen an den Krimmler Wasserfällen bestaunt. „Ich werde die schönen Begegnungen, die ehrlichen Gespräche und die intensiven Mo-
mente noch lange in Erinnerung behalten. Ich bin froh, dass ich ein Teil vom MoMo Festival sein durfte. Danke dafür“, so eine Teilnehmerin.
Auch abends war die Stimmung ausgelassen. Ob beim Pubquiz, beim gemeinsamen Cocktailmixen oder auf der Tanzfläche – das Festival bot viele Gelegenheiten, um neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam Spaß zu haben. Ein Highlight war der Auftritt der Band The Eternal Rags aus Wattens, die das Publikum begeisterte und am selben Abend noch um einige Fans reicher wurde.
Das Feedback der Teilnehmer*innen zeigt deutlich: Das MoMo Festival war ein voller Erfolg. Herzerwärmend, motivierend und so bunt wie das Mosaik, das ihm den Namen gab.
Solveig Meier ist Ansprechpartnerin für Inklusion im Österreichischen Alpenverein und seit 2023 Leiterin des Projekts „Alpenverein inklusiv“.
Simone Hütter ist in der Abteilung Jugend des Österreichischen Alpenvereins für die Kommunikation und Medien der Alpenvereinsjugend Österreich verantwortlich.





»Ich werde die schönen Begegnungen, die ehrlichen Gespräche und die intensiven Momente noch lange in Erinnerung behalten. Ich bin froh, dass ich ein Teil vom MoMo Festival sein durfte.«






¡ nfo MoMo –MosaikMountain Festival 2025
MoMo konnte dank der Förderung von „Licht ins Dunkel“ und als Teil des Projekts „Alpenverein inklusiv“ der Alpenvereinsjugend umgesetzt werden. Mehr Infos zur Inklusion im Alpenverein via www.alpenvereinsjugend.at/ inklusion
Im Rahmen der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins 2025 in Graz wurden ein neues Präsidiumsmitglied und fünf neue Bundesausschussmitglieder gewählt.
Präsidium

Valerie Braun
Alpenverein Imst-Oberland
… wurde in der Steiermark geboren und wuchs in München auf. Schon früh prägten Bergabenteuer mit ihrem Vater ihre Verbundenheit zur alpinen Landschaft. Während ihres Biologiestudiums in Innsbruck entdeckte sie die Berge als sensiblen Kulturlebensraum – eine Erkenntnis, die bis heute ihre berufliche Auseinandersetzung mit Schutzgebieten in alpinen Räumen prägt. Nach mehreren Jahren engagierter Tätigkeit im Landesverband Tirol wurde sie eingeladen, im Präsidium des Österreichischen Alpenvereins mitzuwirken. Sie freut sich auf die damit verbundenen Herausforderungen und inspirierenden Begegnungen.
Bundesausschuss

Gerald Aichner
Alpenverein Hall in Tirol
… ist seit 1999 Vorsitzender des ÖAVLandesverbands Tirol und Ehrenvorsitzender der Sektion Hall in Tirol. Von 1999
bis 2015 war er Mitglied im Bundesausschuss, danach als Gastmitglied aktiv und seit der Hauptversammlung 2025 wieder vollwertiges Mitglied. Beruflich ist er als Journalist, Publizist, Autor und Verleger tätig. Seine Leidenschaft für den Alpenverein sowie für das Bergsteigen, Trekking, Mountainbiken, die Naturfotografie und Literatur ist ungebrochen. Als Vertreter der Basis engagiert er sich besonders für die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die Bedeutung der Sektionen und die Herausforderungen rund um die AV-Hütten. Ein zentrales Anliegen ist ihm die Stärkung der Autonomie insbesondere kleiner und mittlerer Sektionen. www.gerald-aichner.at

Alpenverein Britannia
… ist seit 1986 Mitglied der Sektion Britannia und seit 2024 Teil ihres Vorstands. Außerhalb des Alpenvereins war sie als Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Birmingham tätig. Sie klettert – nach eigenen Worten nicht besonders gut – und liebt Klettersteige, insbesondere in Südtirol. Im Winter zieht es sie auf Skitouren und Langlaufloipen, zuhause ist sie leidenschaftliche Radfahrerin. Mit großer Dankbarkeit blickt sie auf zahlreiche Sommerhochtouren in den österreichischen Alpen zurück, die sie noch mit Steigeisen und Pickel begehen konnte. Die Folgen des Klimawandels hat sie dabei hautnah erlebt. Ihre Erfahrung und ihre Verbundenheit zu den Bergen bringt sie nun als Vertreterin der Auslandssektionen im Bundesausschuss ein.

Hubert Simon
Alpenverein Austria
… wurde in Innsbruck geboren und wuchs in Wien auf. Nach dem Gymnasium in der Wasagasse studierte er Rechtswissenschaften, absolvierte verschiedene berufliche Stationen im Justizwesen und wurde 1988 als selbständiger Rechtsanwalt eingetragen. Seine Kanzlei führt er seit 2004 mit Schwerpunkten im Medien- und Wirtschaftsrecht. Daneben war er als Lektor für Medien- und Wettbewerbsrecht an der Donau-Universität Krems tätig. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Wanderer und Schneeschuhgeher, engagiert sich in der naturnahen Bewirtschaftung seines Waldes und betreibt eine eigene Forstwirtschaft. Seit 1982 ist er Mitglied der Sektion Austria, wo er ab 1990 verschiedene Vorstandsfunktionen innehatte, zuletzt als Rechtsberater. Für sein langjähriges Engagement wurde er 2022 zum Ehrenmitglied ernannt. Nach dem Rückzug aus dem aktiven Berufsleben freut er sich darauf, seine Erfahrung im Bundesausschuss einzubringen.

Tirol
… wurde 1964 in Feldkirch geboren und verbrachte ihre Kindheit in Gargellen, wo ihre Begeisterung für die Berge geweckt wurde. Nach ihrer Ausbildung zur biomedizinischen Analytikerin in Innsbruck absolvierte sie zahlreiche Weiterbildungen, unter anderem zum Bachelor und Master of Science in Biomedical Sciences. Bis Ende August 2025 leitete sie das Labor im LKH Hall, seit September befindet sie sich im Ruhestand. Mit ihrem Mann Bernhard, ebenfalls im Alpenverein aktiv, teilt sie die Leidenschaft für Skitouren und alpine Unternehmungen. Ehrenamtlich ist sie seit vielen Jahren als Tourenführerin in der Sektion Hall engagiert und bringt sich aktiv in die Ausbildung „Sicher am Berg“ ein. Die Besteigung ihres ersten 6000ers in Nepal zählt zu ihren persönlichen Highlights. Ihre Stärken sieht sie in Kommunikationsfreude, Zuhören und Verantwortungsbewusstsein – Qualitäten, die sie nun in den Bundesausschuss einbringt.

Alpenverein Klagenfurt
… übernimmt seit Mai 2025 als engagierter und junger Funktionär den Vorsitz des Landesverbands Kärnten. Der 42-Jährige ist seit frühester Kindheit im Alpenverein aktiv und leitet das Landesjugendteam. Besonders in der Jugendarbeit, etwa bei Skitourencamps in der Großfragant, zeigt sich sein unermüdlicher Einsatz. Beruflich ist er seit fast 15 Jahren als Produzent und Gestalter von Film- und Fernsehdokumentationen mit Schwerpunkt auf bergsteigerische, kulturelle und sozialpolitische Themen international tätig. Als langjähriger Mitgestalter der ORF-3-Sendereihe „Land der Berge“ und Träger des Kärntner Kulturförderpreises bringt er wertvolle Perspektiven und Expertise in seine neue Funktion ein.
Rüc KBL ic K

Die Hauptversammlung 2025 in Graz war ein voller Erfolg. Herzlichen Dank an den Alpenverein Graz für die Ausrichtung! Eine solche Veranstaltung mit über 600 Teilnehmenden auszurichten, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
aNK ü N diGUNG
Der Alpenverein Laakirchen bietet einen Skiurlaub in St. Anton vom 14.03. bis 21.03.2026. Inklusive Betreuung auf der Piste sowie im freien Gelände durch staatlich geprüfte Skilehr- und Skitoureninstruktoren mit langjähriger Arlberg-Erfahrung in Kleingruppen von 6 bis 8 Personen.
Info und Anmeldung: Klaus Seyr, 0664/184 2557, seyr.klaus@gmx.at; Karl Robatscher, 0664/1214399, karl.robatscher@gmail.com
Wir trauern um …
… Hans Mair, langjähriger Obmann der Ortsgruppe Kuchl (Alpenverein Hallein). Hans ist im Alter von 73 Jahren im August 2025 verstorben.
… Josef Kriebaum . Er war über viele Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit der Sektion Austria und des Landesverbands Wien. Ab 1971 engagierte er sich zunächst als Beirat, später als 3. und 2. Vorsitzender sowie langjährig als Gruppenreferent. Von 2012 bis Anfang 2021 war er 1. Schriftführer und wurde anschließend zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt. Im Landesverband Wien wirkte er von 2005 bis 2019 als Schriftführer. Der Gruppe Bergkameraden war er seit deren Gründung 1960 als stellvertretender Leiter verbunden und leitete sie ab 1987 mit großer Leidenschaft.
Bergpartnerin – M 63, Nichtraucher und -trinker aus dem Bezirk Krems-Land sucht nette, schlanke Dame für gemeinsame Wanderungen und Unternehmungen. Kontakt: 0676/6735058.
Ihr liebt die Berge und möchtet auch eure Hochzeit an dem Ort feiern, an dem ihr euch am wohlsten fühlt? Ich bin Sissi, spezialisiert auf Hochzeiten in den Bergen. Ob auf einer Hütte, am Gipfel oder bei einem Standesamt mit Bergblick: Ich halte genau diese besonderen Momente in den Bergen für euch fest. Echt, ungestellt und mitten in der Natur. So wie in einem Artikel im nächsten Bergauf, für den ich die Fotos gemacht habe. Mehr Infos unter www.hochzeit-in-den-bergen.com

Kinderdecke FUSSENEGGER
Samtige und kuschelige Decke für Kinder und Babys. Mit Edelweiß-Muster.
Material: 60 % Baumwolle, 40 % Bambus
39,90 €
Ab Anfang Dezember erhältlich!
Das Bivy 4 ist ein extrem leichtes Groupshelter (Gruppenzelt) für vier Personen. Es kommt im Rolltop-Beutel.
Material: silikonbeschichteter
Nylonstoff | Gewicht: 350 g
84,90 €


KLETTERKLENKES
Die originellen Klettertassen bringen Kletterfeeling direkt in deine Morgenroutine! Mit dem Griff 7b oder 6b erhältlich.
Material: Porzellan | Volumen: 190 ml
22,90 €

Bestellungen und weitere Artikel online, per Mail oder telefonisch: www.alpenverein.shop shop@alpenverein.at +43/512/59547–18
Alle Preise sind Mitgliederpreise, inkl. UST, zzgl. Porto.
Von Bergrettung, Bergführerverband und Alpenverein gemeinsam entwickeltes SicherAmBerg-Erste-Hilfe-Set. Kompakt, klein, wasserdicht, inkl. Israeli-Bandage und Alu-Rettungsdecke.
41,90 €

Tolles Sockendoppelpack mit roten und grünen Socken. In unverwechselbarem Höhenliniendesign.
Material: 77 % Bio-Baumwolle, 20 % Polyamid, 3 % Elasthan.
32,90 €



Bequemer Fleece als zweite Schicht für Wanderungen, Trekking, Bergsport und alle Aktivitäten bei kühlem Wetter. In den Farben Olivgrün und Blau erhältlich.
Material: 94 % recyceltes Polyester, 6 % Elasthan
Damen-Fleecejacke 122,90 €
Herren-Fleecejacke 122,90 €



Warme, wasser- und winddichte Fäustlinge – perfekt für kalte Wintertage.
Material: Innen: 100 % Polyester; Außen: 100 % Polyester; Handfläche: 65 % Nylon, 35 % Leder 69,90 €

Urbane Strick-Beanies für Tage draußen. Durch das kleine, leichte Packmaß sind die Beanies immer mit dabei. In den Farben Grau und Anthrazit erhältlich.
Material: 50 % Merinowolle, 50 % recyceltes Polyester 35,90 €



Unscheinbar – aber ein echtes Multitalent! Ob auf der Hütte für verschwitzte Kleidung, am See für den nassen Badeanzug oder beim Wandern für Essensreste – der Dry Bag hält dicht, was er verspricht. Er ist leicht, kompakt und faltbar – passt in jeden Rucksack und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Ich habe ihn ausprobiert, und nun ist er ein unverzichtbarer Begleiter für meine Tage draußen geworden. Mit ihm bleibt meine Ausrüstung trocken, sauber und organisiert.

Maße: geschlossen 24 cm x 39 cm | Volumen: 6 Liter | Farbe: grün mit Muster

9,90 €
ist Mitarbeiterin in der Alpenvereinsjugend im Österreichischen Alpenverein und für das Projekt „Junge Alpinisten“ zuständig.
Unterwegs auf einer hochalpinen Untersuchungsfläche für Klimawandel und Biodiversität.

Begeben wir uns auf eine Reise zum ehemaligen „Nunatak“ des Kleinen Burgstalls – also einem Berggipfel, der einst aus der Gletscheroberfläche hinausragte. Hier oben führten die Fachhochschule Kärnten und das E.C.O. Institut für Ökologie im vergangenen Jahr eDNAAnalysen durch und machten Wiederholungsaufnahmen der Vegetation. Die Arbeit wurde im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern durchgeführt und vom Patenschaftsfonds des Österreichischen Alpenvereins finanziell unterstützt.
Labor in der Natur
Der 2.709 Meter hohe Gipfel war einst von Gletschern umgeben und ist ein einzigartiges Forschungsgebiet. Er gewährt Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels auf alpine Ökosysteme. Seit 2009 zählt der Kleine Burgstall nicht mehr zu den Nunataks, denn der Berg ist nicht mehr vollständig von Gletschern umgeben. Die Vegetation und der Boden erzählen heute noch davon, dass der Kleine Burgstall weder beim Gletschervorstoß von 1620 noch von 1850 vollständig von Eis bedeckt war. Besonders beeindruckend sind die geschlossenen Rasenflächen, die bereits 1956 dokumentiert wurden. Sie stecken voller Artenvielfalt und erreichen unter günstigen Bedingungen ein Alter von über 1.000 Jahren. Sie bieten spezialisierten Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum, zumal sie aufgrund der steigenden Temperaturen zunehmend unter Druck geraten. Hohe Temperaturen führen nämlich dazu, dass sich der Stoffwechsel beschleunigt und konkurrenzstarke Arten aus tieferen Lagen vordringen.
Die Erhebungen der Vegetation hat das Forschungsteam mit einem Rahmen in der Größe von zwei mal zwei Meter entlang bestimmter Linien im Gelände durchgeführt. Mithilfe des Rahmens wurden Veränderungen in den eingegrenzten Flächen seit der letzten Untersuchung im Jahr 2002 dokumentiert. Lediglich zwei dieser Flächen konnten aufgrund eines Felsabbruchs nicht wiedergefunden werden.
Alpine Pflanzen überdauern auch unter widrigen Umweltbedingungen längere Zeiträume. Foto: H. Kirchmeir
Die Ergebnisse zeigen: Die Pflanzengesellschaften auf den meisten Flächen haben sich stabil gehalten. Alpine Pflanzen sind außergewöhnlich robust. Sie überdauern auch unter widrigen Umweltbedingungen längere Zeiträume.
Woran lassen sich also Veränderungen in der Vegetation erkennen? Ein erster Hinweis darauf ist die Veränderung der Deckung von Arten. Selbst wenn eine Art weiterhin in einem Gebiet vorkommt, kann ein Rückgang ihrer Deckung darauf hindeuten, dass die Umweltbedingungen für sie ungünstig werden. Anhand des sogenannten „Shannon-Index“ werden solche Veränderungen in der Artenvielfalt und ihrer Verteilung benannt. Sinkt dieser Index, weist das auf solche Veränderungen hin. Weil die Bodenentwicklung Zeit benötigt, ist die Vegetation auf neu freigelegten Flächen spärlich. Auf älteren Schuttflächen sind hingegen Polsterpflanzen wie der Rudolf-Steinbrech und die QuendelWeide zu finden. Diese Pflanzen schaffen durch ihren polsterartigen Wuchs ein eigenes Mikroklima, das ihnen Schutz bietet und das Wachstum fördert. Sie sind oft Pioniere in unwirtlichen Gebieten.
Die Vegetation kann sich im Laufe der Zeit erstaunlich verändern. So wurden Flächen beobachtet, auf denen sich innerhalb von 20 Jahren eine ganz andere Pflanzengesellschaft etabliert hat. Insgesamt hat das Forschungsteam auf allen 20 Flächen 93 Pflanzenarten dokumentiert. Die erst kürzlich eisfreien Flächen waren von mindestens neun Arten, die dicht bewachsenen Flächen hingegen von bis zu 39 Arten besiedelt.
Erstmals kamen bei den Untersuchungen der Fauna des Kleinen Burgstalls moderne molekularbiologische Methoden zum Einsatz. Die Wissenschaftler*innen haben Bodenproben auf Umwelt-DNA (eDNA) analysiert, um die Artenvielfalt zu erfassen. Auf diese Weise lassen sich Organismen bestimmen, ohne sie direkt beobachten oder sammeln zu müssen. Die Ergebnisse zeigen, dass alpine Böden trotz extremer Bedingungen eine erstaunliche Vielfalt an Mikroorganismen und kleinen Tieren beherbergen. Unter anderem wurden der Gemeine Gebirgs-

weberknecht und die Rote Keulenschrecke nachgewiesen. Fehlbestimmungen kommen bei der eDNA-Methode gelegentlich vor, beschränkten sich aber auf wenige Arten und Gattungen.
Ein Blick aus der Luft
Dank moderner Drohnentechnologie sind außerdem hochauflösende Luftbilder und ein 3D-Modell des Gipfels entstanden. Damit werden auch die Veränderungen des Geländes und der Vegetation sichtbar. Die Technologie ermöglicht eine präzise Kartierung und zeigt eindrucksvoll, wie der Gletscherrückgang die Landschaft formt. Die Drohnenaufnahmen wurden mit einer Auflösung von zehn Zentimetern erstellt und anschließend zu einem digitalen Geländemodell verarbeitet. Dieses Modell dient nicht nur der Dokumentation, sondern auch als Grundlage für zukünftige Untersuchungen. Die Ergebnisse zeigen, wie sich der Gletscherrückgang
» Die Ergebnisse der Untersuchungen aus 2024 verdeutlichen, wie dynamisch und zugleich fragil alpine Ökosysteme sind. «
auf die Topografie des Kleinen Burgstalls auswirkt und welche neuen Flächen für die Vegetation freigelegt wurden. Außerdem wird deutlich, wie sensibel alpine Lebensräume auf klimatische Veränderungen reagieren. Während wärmeliebende Pflanzenarten in anderen Regionen auf dem Vormarsch sind, blieb dies am Kleinen Burgstall bisher aus. Dies könnte an der langsamen Reaktion alpiner Pflanzen und der Vielfalt an Mikrohabitaten liegen, welche die Veränderungen abmildern. Dennoch zeigt der Rückgang des Gletschers, wie dynamisch sich der Lebensraum entwickelt.
Die Forschungsarbeit liefert wertvolle Einblicke in die Dynamik hochalpiner Ökosysteme. Um diese sensiblen Lebensräume zu verstehen und zu schützen, ist langfristiges Monitoring notwendig. Der Kleine Burgstall dient dabei als Labor für die Erforschung des Klimawandels und der Biodiversität. Die Ergebnisse der Untersuchungen aus 2024 verdeutlichen, wie dynamisch und zugleich fragil alpine Ökosysteme sind. Sie unterstreichen, wie wichtig es ist, diese einzigartigen Lebensräume für zukünftige Generationen zu bewahren.
Vanessa Berger und Klaus Steinbauer arbeiten an der Fachhochschule Kärnten. Sie beschäftigen sich in der Lehre und Forschung mit dem Einsatz neuer Technologien im Biodiversitätsmonitoring und der Ökosystemforschung.
Blick ins Tal auf Rauris und die Goldberggruppe im Nationalpark
In der geschichtsträchtigen Nationalparkgemeinde Rauris trafen sich Anfang September rund 50 engagierte Patinnen und Paten aus nah und fern beim 21. Patentreffen des Österreichischen Alpenvereins. Das Treffen findet regelmäßig statt und ist Ausdruck des Dankes an die Unterstützenden des Nationalparks Hohe Tauern für ihre wertvolle Spende. Dabei liegt der Fokus auf einer nachhaltigen und sanften Wertschöpfung in den Nationalparkgemeinden.
Im Mittelpunkt eines jeden Patentreffens steht das Kennenlernen des Nationalparks, so auch der Nationalparkgemeinde im Unterpinzgau. Dazu gehörten geführte Wanderungen im Raurisertal, zugeschnitten auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Konditionen aller Personen. Das Angebot reichte vom entspannten Naturspaziergang im Tal bis hin zur anspruchsvollen zweitägigen Tour ins Hochgebirge – stets mit Herz und Fachwissen begleitet von den Nationalpark-Rangern Ekki und Roland sowie den Bergführern Wolfgang und Benni. Als besonderer Höhepunkt gleich zu Beginn führte eine Exkursion ins Krumltal, auch bekannt als das „Tal der Geier“. Geduld und ein gutes Auge wurden reichlich belohnt: Majestätisch zogen Bart-, Mönchsund Gänsegeier ihre Kreise am Himmel, während sich Steinadler, Steinwild, Murmeltiere und sogar ein scheuer Fuchs zeigten. Die Begeisterung, die-

Ein Blick zurück auf das Patentreffen des Österreichischen Alpenvereins mit den Patinnen und Paten des Nationalparks Hohe Tauern.
sen faszinierenden Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum zu begegnen, war bei allen spürbar.
Der Natur- und Lebensraum in der Nationalparkregion stand inhaltlich auch abends im Mittelpunkt – mit spannenden Einblicken in die Arbeit des Nationalparks Hohe Tauern, der Alpenvereinssektion Rauris sowie der Nationalparkgemeinde Rauris. So entstand eine gelungene Verbindung aus Bergerlebnissen, fundiertem Wissen über die alpine Natur und einer geselligen Atmosphäre. Diesem
Austausch liegt die gute und enge Zusammenarbeit zwischen dem Alpenverein, der Gemeinde mit ihrem Bürgermeister, dem Tourismusverband und der Gastgeberin im Mesnerhaus zugrunde – sowohl in der Vorbereitung als auch vor Ort.
Das nächste Patenschaftstreffen des Österreichischen Alpenvereins findet 2028 in Osttirol statt. Gemeinsam entdecken wir dort die beeindruckende Bergwelt, erleben bewusst den Wert des Nationalparks Hohe Tauern und vertiefen unser Engagement
für seinen Schutz. Wir freuen uns darauf, viele vertraute und neue Patinnen und Paten zu einer abwechslungsreichen Woche voller Bergsteigen, Wandern und Kultur willkommen zu heißen!
Jasmin Maringgele ist Mitarbeiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein.
Der Patenschaftsfonds Nationalpark Hohe Tauern des Alpenvereins besteht seit dem Jahr 1982 und ermöglicht die Finanzierung von Projekten in der Nationalparkregion nach definierten Kriterien. Nur durch die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit werden Projekte wie die Inventarisierung der Kulturlandschaftselemente in der Nationalparkregion Hohe Tauern Tirol möglich. Ein besonders wichtiger Teil der Finanzierung des Patenschaftsfonds sind die großzügigen freiwilligen Spenden und Mitgliedsbeiträge der Pat*innen. Mithilfe dieser wertvollen Unterstützung können zahlreiche Projekte aus den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Wissenschaft realisiert werden.
Mit einer Spende ab 10 Euro werden Sie Patin oder Pate – oder machen jemandem ein nachhaltiges Geschenk. Als Dank erhalten Sie eine Patenurkunde, eine Lageskizze der symbolisch erworbenen Quadratmeter im Nationalpark Hohe Tauern und einen Auszug der geförderten Aktivitäten im Nationalpark Hohe Tauern von 2005 bis heute. Im aktuellen Bergauf finden Sie einen Zahlschein zur Aktion „Patenschaft für den Nationalpark Hohe Tauern“. Wenn eine Patenschaftsurkunde als Weihnachtsgeschenk angedacht ist, muss der Zahlungseingang bis spätestens 8. Dezember erfolgt sein. Eine Zustellung bis Weihnachten kann ansonsten nicht garantiert werden. Weitere Informationen online unter: t1p.de/pate-werden






















Panorama mit Bernkogel (links) und Sladinkopf (rechts). Fotos: Benjamin Stern














Die anspruchsvollsten Anstiege beim Skitourengehen werden mit den herrlichsten Abfahrten belohnt.


Kilo XTR: maximale Leichtigkeit beim Aufstieg, Präzision und Spaß bei der Abfahrt.
Die neue zentrale Zunge ist eine einzigartige Stütze: Sie überträgt die Energie optimal auf die Schale aus Grilamid® Bio



Optimale Reaktionsfähigkeit. Maximale Performance und Leichtigkeit - und Megaspaß.

Mehr erfahren über Kilo XTR auf lasportiva.com
































































































Wenn ein Verein klimaneutral werden will, führt kein Weg an einer CO2-Bilanz vorbei. Ein Blick auf Öffi-Touren, LED-Lampen und Hüttenkost.
aNNa P R axma R e R
Bis 2033 möchte der Österreichische Alpenverein im Rahmen seiner Klimastrategie klimaneutral sein. Im Verein engagieren sich Menschen schon längst für den Klimaschutz. Jetzt aber wird all das in Zahlen gefasst – denn ohne Bilanz keine Vergleichswerte. Worin liegen die größten Hebel, um Emissionen zu senken? Bergauf fragt nach in einer Sektion des Alpenvereins, die keine Scheu vor Zahlen und Bilanzen kennt.
Der Alpenverein-Gebirgsverein im Großraum Wien macht als bereits etablierter Klimabündnisbetrieb ernst mit dem Klimaschutz. Konsequent werden Emissionen bilanziert
und das hat Folgen: Für Mitarbeitende gibt es Dienstreiserichtlinien, um stets die umweltfreundlichste Form der Anreise zu wählen. Jede Beschaffung – vom Locher bis zur LED-Lampe – folgt einer nachhaltigen Beschaffungsrichtlinie. Ein gewaltiger Kraftakt –oder? „So schwierig ist das gar nicht“, sagt Christian Schreiter, Klimakoordinator und Vereinsmanager im AlpenvereinGebirgsverein. „Aber ohne die Gemeinschaft kann man nichts bewegen.“ Und die lebt im Alpenverein-Gebirgsverein von der Mitgestaltung vieler engagierter Menschen.
Beim Bilanzieren sind verlässliche Vergleichswerte es-
senziell, die absolute Genauigkeit in der Erfassung eher weniger, findet Schreiter. Die Methodik muss stimmen und praktikabel sein. Positive Überraschungen gehören auch dazu. Etwa dann, wenn auf einer Hütte im Vergleich mit anderen ein hoher Wasserverbrauch auffällt, der sich schon mit einer kleinen technischen Reparatur drastisch senken lässt.
Der größte CO2-Posten? Ganz klar: die Mobilität – vor allem bei der An- und Abreise zu den Bergabenteuern. Ein Ansporn, dort weiter anzusetzen – obwohl bereits 80 Prozent des Tourenangebots im Alpenverein-Gebirgsverein öffentlich erreichbar sind und viel Arbeit in diesem Bereich geleistet wird. Man ist sich einig: Jeder Schritt zählt.
¡ nfo Klimabilanz einer
222 Kilometer legt jede Person auf einer Mehrtagestour im Österreichischen Alpenverein im Durchschnitt für die An- und Abreise zurück. Das verursacht knapp 50 Prozent der Emissionen, die auf der Tour ausgestoßen werden. Rund 25 Prozent der Emissionen fallen auf die Verpflegung. Diese Angaben basieren auf Erhebungen von zwölf Sektionen im Österreichischen Alpenverein.

Mehr Infos: www.alpenverein.at/ klima
Der zweite Spitzenreiter in der Bilanz des Gebirgsvereins ist die Verpflegung auf den Alpenvereinshütten. Die Produktion und der Transport von Lebensmitteln schlagen sich massiv in den Zahlen nieder. Wie also die Hüttenkost für die Wanderer in der Extremlage am Berg klimafreundlich gestalten? Bereits ca. 80 Alpenvereinshütten tragen das Gütesiegel So schmecken die Berge Diese strenge Prämierung garantiert regionale Produkte –zumeist aus einem Umkreis von 50 Kilometern und aus möglichst ökologischer Berglandwirtschaft. Eine wichtige Stellschraube also, auch für den Alpenverein-Gebirgsverein. Nun arbeitet man daran, auf möglichst vielen Hütten die Standards von „So schmecken die Berge“ zu erfüllen und auch die des strengen Umweltgütesiegels der Alpenvereine. Was die Bilanz am Berg zeigt, gilt auch im Tal: Was auf den Teller kommt und wie wir uns fortbewegen, zählt – auch in der persönlichen Klimabilanz. —

Rund 200 Projekte sind es, die engagierte Menschen im Alpenverein innerhalb eines Jahres im Rahmen seiner Klimastrategie vermeldet haben. Es hat sich viel getan – für morgen.
Hinter all dem stehen inspirierende Geschichten, Pioniergeist und Aufbruchstimmung. Die folgenden sind einige davon.
Legende




Klimafreundliche Mobilität
Energie & Ressourcen
Ernährung
Recycling & Upcycling




Veranstaltungen & Green Events
Informationen & Literatur
Politische Einflussnahme
Sonstiges
Klimageschichten auf Reisen
Der Alpenverein Vorarlberg unterstützt Fotojournalist Fridolin Schuster, der mit einem solarbetriebenen Elektro-Lastenfahrrad durch Europa und mittelmeernahe Länder reist.
Mit seiner Dokumentation Emotions Of Change widmet er sich den emotionalen Auswirkungen der Klimakrise und erzählt bewegende Geschichten.



Start im Klimabündnis
Mit seinem Beitritt zum Klimabündnis bekräftigt der Alpenverein Imst-Oberland sein Engagement für den Klimaschutz. Die Begeisterung für klimafreundliches Handeln zeigt sich dabei auf vielen Ebenen: vom nachhaltigen Einkauf über eine verbesserte Energieeffizienz bis hin zur klimafreundlichen Mobilität.

Klimafreundliche Mobilität hat auch im Alpenverein Salzburg einen hohen Stellenwert. Dabei setzt man auf: Planung mit Köpfchen. Die Jugendgruppen organisieren sämtliche Touren grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn nötig, wird die letzte Meile per Taxi zurückgelegt.

Ab in die Tonne mit alten Kletterseilen? Nicht beim Alpenverein Melk! Dort wird den ausgedienten Seilen neues Leben eingehaucht. Mit Kreativität und Geschick entstehen daraus Gürtel, Chalkbags, Hundeleinen und vieles mehr. Die originellen Unikate werden gegen Spenden für wohltätige Zwecke abgegeben.


Touren mit den Öffis planen, dabei Erfahrungswerte sammeln und anderen Menschen Hilfestellungen bieten – darum geht es im Alpenverein Klagenfurt. Unterstützung gibt es dabei vom Bergtourenportal „Bahn zum Berg“ –sei es in der Wissensvermittlung oder im Tourenangebot.

Mit der Klimaallianz setzt der Alpenverein Austria ein starkes Zeichen. Ziel der Initiative ist, eine klimagerechte und soziale Mobilitätswende zu schaffen. Faktenbasierte Erkenntnisse und gesellschaftliche Bedürfnisse sollen direkt in politische Handlungsvorschläge einfließen. Die Stärke der Klimaallianz liegt in ihrer Breite: Mit an Bord sind die Naturfreunde, der Österreichische Gewerkschaftsbund, die Katholische Aktion Österreich, die Bundesvereinigung Logistik, die Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft – sowie ein wissenschaftlicher Beirat.

QR-Code scannen und zur Projektkarte gelangen



Die Alpen – majestätisch, wild, verletzlich. Was einst als Sinnbild für Beständigkeit galt, ist heute ein Ort des Wandels. Gletscher schmelzen, Quellen versiegen, Wälder kämpfen gegen Trockenheit.
Der Klimawandel ist längst Realität – mitten in unserer Heimat.
Wenn sich die Alpen verändern, verlieren wir mehr als ein Postkartenmotiv. Wir verlieren Lebensräume für unzählige Tier- und Pflanzenarten, den Ursprung unseres Trinkwassers und einen Rückzugsort für Menschen, die in der Natur Kraft schöpfen. Die Veränderungen sind spürbar –und sie betreffen uns alle.
Doch es gibt Hoffnung. Denn dort, wo politische Prozesse oft zu langsam sind, können starke Partnerschaften sofort handeln. Wenn Menschen, Unternehmen und Vereine ihre Kräfte bündeln, entstehen Projekte, die wirklich etwas bewegen –für heute und für morgen. Für die Natur. Für uns.
Starke Partnerschaft –konkrete Wirkung
Wenn es um den Schutz alpiner Lebensräume geht, ist der Österreichische Alpenverein seit vielen Jahren eine treibende Kraft. Mit großer Sorgfalt organisiert und begleitet er Bergwaldprojekte und Umweltbaustellen in ganz Österreich. Doch die wahre Stärke dieser Initiativen liegt bei den freiwilligen Helfer*innen: Menschen, die ihre Zeit und ihre Energie investieren, um Bäume zu pflanzen, Wege zu sanieren und sensible Ökosysteme zu pflegen. Ihr Engagement macht den Unterschied – und der Alpenverein schafft die Plattform dafür.
Allein 2024 wurden 19 Bergwaldprojekte mit 181 Teilnehmenden und 15 Umweltbaustellen mit 149 Teilnehmenden umgesetzt. Dabei entstanden nicht nur neue Wurzeln im Boden, sondern auch neue Verbindungen zwischen Mensch und Natur –ein aktiver Beitrag zur Widerstandskraft unserer alpinen Lebensräume. Diese Projekte verbinden aktiven Naturschutz mit gelebtem Miteinander. Menschen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen – ob aus der Stadt oder vom Land – arbeiten Seite an Seite, lernen voneinander und erweitern ihren Blick auf die Welt. Diese Begegnungen schaffen Verständnis, fördern den Austausch und zeigen, wie sehr uns der Einsatz für unsere Umwelt verbinden kann.
Seit 2019 unterstützt Werner & Mertz Hallein – bekannt für die Öko-Marke Frosch – diese Projekte als engagierter Kooperationspartner. Parallel dazu entwickelt das Unternehmen seit über einem Jahrzehnt innovative Lösungen für die Kreislaufwirtschaft, etwa im Rahmen der Recyclat-Initiative.
Beide Partner setzen auf konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz – jeder in seinem Wirkungsbereich, aber mit einer gemeinsamen Vision: gelebte Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.
Nachhaltig entscheiden
Klimaschutz beginnt nicht erst am Gipfel, sondern viel früher – bei den Entscheidungen, die wir täglich treffen. Ob beim Einkauf im Supermarkt oder bei der Materialbeschaffung für Großprojekte: Jede Entscheidung – ob von Einzelpersonen, Vereinen oder Unternehmen – beeinflusst, wie viele Ressourcen verbraucht, Emissionen verursacht und Lebensräume belastet werden. Die größten ökologischen Auswirkungen entstehen oft schon bei Rohstoffgewinnung, Produktion und Transport – lange bevor ein Produkt genutzt wird. Deshalb verankert der Alpenverein in seiner Klimastrategie eine nachhaltige Beschaffung: Produkte und Materialien müssen nicht nur funktional sein, sondern auch strengen ökologischen und sozialen Standards entsprechen. Denn wer bewusst auswählt, schützt die Natur – heute und für kommende Generationen.
Werner & Mertz achtet genau auf diese Prinzipien: Das Unternehmen denkt Nachhaltigkeit nicht als Schlagwort, sondern als tägliche Verantwortung. Es achtet auf transparente Lieferketten, setzt bewusst auf heimische, europäische Rohstoffe und verfolgt konsequent das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Aus gebrauchten Verpackungen entstehen neue – direkt aus dem Gelben Sack. So wird Abfall zu Wertstoff und Verantwortung zu gelebter Realität.
Mit dieser Haltung passt Werner & Mertz perfekt zum Alpenverein: Beide Partner eint der Anspruch, nicht nur zu reden, sondern zu handeln – für die Umwelt, für die Gesellschaft und für eine Zukunft, in der Nachhaltigkeit selbstverständlich ist.
Ein Weltrekord für die Kreislaufwirtschaft
Ein starkes Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit setzte Werner & Mertz im Juni 2025: Die milliardste Flasche aus 100 % Altplastik wurde produziert. Dieser Weltrekord ist mehr als nur eine Zahl: Er zeigt, dass Kreislaufwirtschaft funktioniert – wenn man sie konsequent lebt.
Die Grundlage dafür bildet die Recyclat-Initiative, die Werner & Mertz bereits 2012 mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette ins Leben gerufen hat. Der Erfolg gehört nicht nur den technischen und logistischen Mitstreitern, sondern vor allem den Konsument*innen, die mit ihrer Kaufentscheidung den Wandel vorantreiben.
Auch der Österreichische Alpenverein war bei der Weltrekordfeier in Berlin mit dabei. Die gemeinsame Botschaft: Nachhaltigkeit funktioniert nur gemeinsam –mit starken Partnern, die Verantwortung übernehmen, und mit Menschen, die bewusste Kaufentscheidungen treffen. Ganz in diesem Sinne folgte auf den Weltrekord schon der nächste Schritt: Alle rPETFlaschen der Marke Frosch werden nun vollständig aus Recyclat aus dem Gelben Sack hergestellt.
Starke Allianzen für die Zukunft
Die Kooperation zwischen Werner & Mertz und dem Alpenverein soll in den kommenden Jahren noch intensiver werden. Gemeinsam will man die Klimastrategie des Alpenvereins weiter voranbringen, wie durch ökologische Standards, faire Lieferketten und konsequente Ressourcenschonung.
In einer Zeit, in der sich die Politik aus dem Klimaschutz zurückzieht, setzen beide Partner ein klares Zeichen: Nachhaltigkeit braucht gemeinsames Handeln – von Vereinen, Unternehmen und Einzelpersonen.
Jetzt bist Du gefragt
Ob am Berg oder beim alltäglichen Einkauf: Deine Entscheidung macht den Unterschied. Klima- und Naturschutz sind untrennbar miteinander verbunden: Wer zu Produkten greift, die im Kreislauf bleiben, schützt Wälder und Gewässer und leistet auch einen direkten Beitrag zum Klimaschutz – mit weniger Emissionen, weniger Müll und mehr Zukunft für unsere alpinen Lebensräume.
Mehr Infos: www.werner-mertz.at
Der Österreichische Alpenverein präsentierte die Zusammenarbeit mit Werner & Mertz Hallein bei der Weltrekordfeier in Berlin.
Foto: Werner & Mertz


» Der aktuelle Klimasachstandsbericht betont, wie wichtig es ist, die Anpassung an den Klimawandel aktiv zu gestalten – und nicht nur auf Schäden zu reagieren. Für den Alpenverein bedeutet das: Weitblick bei der Planung, nachhaltige Bauweisen, ein sensibler Umgang mit der Natur. Und ein klarer politischer Auftrag an Entscheidungsträger*innen, diese Anpassung auch finanziell zu unterstützen.«
‹ Das „ewige Eis“ der Alpen schmilzt uns davon – auch eine Folge der Klimakrise. Das Foto wurde am Ochsentaler Gletscher (Silvrettagruppe) aufgenommen.
Foto: Alexander Fuchs
Österreich erwärmt sich doppelt so stark wie der globale Durchschnitt. Während weltweit von etwa 1,2 Grad seit 1900 die Rede ist, sind es in Österreich bereits rund 3,1 Grad Celsius. Diese Zahl steht im Mittelpunkt des neuen Klimasachstandsberichts für Österreich, der im Sommer 2025 veröffentlicht wurde. Was trocken und wissenschaftlich klingt, hat ganz konkrete Auswirkungen –auch und besonders im Gebirge.
Der Bericht, erstellt von über 200 Forscher*innen aus unterschiedlichsten Disziplinen, versammelt den aktuellen Stand der Klimaforschung für Österreich. Er zeigt, wie tief der Klimawandel bereits in unser tägliches Leben eingreift –in Hinblick auf den Alpenverein sind das etwa die Wasserverfügbarkeit in den Bergen, der Zustand unserer Wälder und die Stabilität unserer Berge.
Instabile Berge, schwindende Gletscher
Besonders eindrücklich ist die Entwicklung im Hochgebirge. Der Rückzug der Gletscher hat sich in den letzten Jahren dramatisch beschleunigt. Ganze Gletscherzungen sind verschwunden, das Eisvolumen hat stark abgenommen. Nicht nur der Landschaftscharakter verändert sich dadurch, sondern auch der Wasserhaushalt: Schmelzwasser speist viele Bäche und Flüsse – wenn es fehlt, kann das Folgen für Landwirtschaft, Ökologie und Energieversorgung haben.
Auch der Permafrost taut – jener „ewige“ Frost im Inneren der Berge, der bislang viele Hänge und Gipfel stabilisiert hat. Wenn diese Eisstrukturen schmelzen, verlieren ganze Flanken an Halt, was Felsstürze, Muren und instabile Geröllhänge begünstigt. Der Bergsport wird dadurch nicht nur anspruchsvoller, sondern mitunter auch gefährlicher. Klassische Routen müssen umgelegt, Sicherungen neu geplant und Alpinwissen ständig angepasst werden.
Was der neue Klimabericht für die Alpen bedeutet: Ein Weckruf für alle, die die Berge lieben.
Die Klimaveränderung trifft auch die Infrastruktur im Gebirge. Zahlreiche Schutzhütten des Alpenvereins sind bereits mit Herausforderungen wie Wassermangel, Starkregen oder der Erschließung alternativer Energiequellen konfrontiert. Auch die ehrenamtlichen Warte der Wanderwege in Österreich müssen zunehmend auf Hangrutschungen, Erosion und Unwetterschäden reagieren.
Der aktuelle Klimasachstandsbericht betont, wie wichtig es ist, die Anpassung an den Klimawandel aktiv zu gestalten –und nicht nur auf Schäden zu reagieren. Für den Alpenverein bedeutet das: Weitblick bei der Planung, nachhaltige Bauweisen, ein sensibler Umgang mit der Natur. Und ein klarer politischer Auftrag an Entscheidungsträger*innen, diese Anpassung auch finanziell zu unterstützen.
Ein Appell an uns alle
Die Veränderungen treffen besonders jene Lebensräume, die ohnehin unter Druck stehen: Moore, hochalpine Ökosysteme und Wälder. Viele dieser sensiblen Ökosysteme liegen in den Schutzgebieten, für die sich der Österreichische Alpenverein seit Jahrzehnten einsetzt. Doch auch dort braucht es neue Strategien: Wie geht man mit Trockenperioden um? Wie kann die Biodiversität erhalten werden, wenn sich Lebensräume verschieben? Welche Rolle spielen Wiedervernässung, Renaturierung oder Besucherlenkung?
Der Klimabericht ruft eindringlich dazu auf, Klimaschutz und Anpassung nicht nur als technische, sondern als ge-
sellschaftliche Aufgabe zu verstehen. Das bedeutet auch, die Menschen vor Ort –von den Jugendlichen bis zu den Bergbauern – in die Gestaltung dieser Veränderungen einzubeziehen.
Die gute Nachricht: Der Alpenverein ist nicht tatenlos. Viele Hütten setzen längst auf Sonnenstrom, Regenwassernutzung oder energieeffiziente Sanierung. Alpenvereinssektionen engagieren sich für nachhaltige Mobilität. Wanderwege werden naturnah saniert, Tourenempfehlungen überarbeitet. Das alles sind Schritte in die richtige Richtung – aber sie müssen mehr werden, größer gedacht, besser unterstützt.
Denn: Die Klimakrise ist keine ferne Bedrohung, sie ist bereits allgegenwärtig. Der neue Bericht macht deutlich, dass schnelles Handeln gefragt ist – beim Emissionsausstoß genauso wie bei der Anpassung an das, was schon passiert. Und er zeigt auch: Wer jetzt investiert – in kluge Planung, in stabile Infrastruktur, in Umweltbildung –, spart später nicht nur Geld, sondern schützt das, was uns allen am Herzen liegt: unsere Berge.
¡ nfo
Klimasachstandsbericht

Der vollständige aktuelle Klimasachstandsbericht ist hier zu finden: aar2.ccca.ac.at
… schafft für die Natur und uns neue Chancen und neue Herausforderungen. Vierter und letzter Teil einer vierteiligen RespektAmBerg-Serie zum Thema Besucherlenkung.
Ge ORG RO th Wa NGL
Immer häufiger kommt es vor, dass in den Wintermonaten der Boden braungrau-grün bleibt und nicht unter einer weißen Schneedecke verschwindet. Für die Besucherlenkung ergeben sich dadurch neue Herausforderungen. So gibt es Rotwildfütterungen, die für einen schneereichen Winter errichtet worden sind. Der Wanderweg, der an der Fütterung vorbeiführt, wurde bisher im Winter nicht begangen, da der lohnende Routenverlauf für Skitouren und Schneeschuhwanderungen anderswo verläuft. Nun sind aber Bergsportler in gewöhnlicher Wanderausrüstung mitten im Winter unterwegs und kommen in die Nähe der Fütterung. Dabei stören sie unbeabsichtigt die Tiere bei der Äsung.
Auch andere Wildtiere haben zu kämpfen. Man möchte meinen, die Nahrungssuche sei nicht schwierig, wenn kein Schnee liegt. Leider ist es nicht so einfach.
Tiere wie Schneehase, Schneehuhn oder Schneewiesel bekommen zur Tarnung ein weißes Fell oder Federkleid. Hinter dieser Verwandlung steckt die Sonnenbahn. Sie beginnt also dann, wenn die
Tage kürzer werden. So stehen die Tiere in schneearmen Wintern unter höherem Stress, weil ihnen die Tarnung vor Raubtieren fehlt. Zum Schutz vor der Kälte lassen sich außerdem zahlreihe Tierarten einschneien oder graben sich Höhlen im Schnee. Auch diese Möglichkeit fehlt.
Somit gilt auch in schneearmen Wintern: mit Respekt in der Natur unterwegs sein und mit dem eigenen Verhalten den Wildtieren das Leben leichter machen.
Georg Rothwangl ist Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein.

Dieser Artikel ist der letzte Teil einer vierteiligen Serie zu RespektAmBerg.
Bisher war ein wichtiges Bewertungskriterium für eine erfolgreiche Tour, ob alle Teilnehmer*innen wohlbehalten am Abend wieder zu Hause angekommen sind. Dabei lag der Fokus auf der Gruppe bzw. auf der Person, welche die Tour unternommen hat. Mit Fokus auf die Menschen wurden Gefahren beurteilt, Alternativen analysiert und nach einer gewissenhaften Tourenplanung die Tour möglichst gut umgesetzt. Die Auswirkung der Tour auf Wildtiere und -pflanzen ist manchmal in den Hintergrund gerückt. Dieses Jahr wollen wir uns gemeinsam auf Touren machen, die gut für uns und gut für die Natur sind. Wir als Alpenvereinsmitglieder wollen Vorbild für alle bergsportbegeisterten Menschen sein und zeigen, dass wir auf unseren Touren auch an die Wildtiere und Pflanzen in den Bergen denken und auf sie Rücksicht nehmen.

Mehr Infos: www.alpenverein.at/ portal/natur-umwelt/ respektamberg
Egal, wo du unterwegs bist – achtsames Verhalten schützt die Bergwelt, die wir lieben. Die Berge sind kein Ort, den wir erobern, sondern den wir uns gemeinsam mit vielen anderen Lebensraumpartnern teilen. Finde heraus, wie du beim Wintersport Rücksicht auf Natur, Wildtiere und andere Menschen nehmen kannst.
Ich unternehme nur Touren, wo ich mit Bahn oder Bus hinkomme – klimafreundliche Mobilität ist mir wichtig!
Super, damit beginnt die Rücksicht schon im Tal.
… und am Berg?
Ich bleibe auf markierten Wegen oder ausgewiesenen Skitourenrouten.
Naturverträglicher Wintersport –wie schaut’s bei dir aus?

Ich such mir lieber meine eigene Spur.
Ich gehe meist dort, wo’s schön und besonders ruhig ist.
Wer im Gelände unter wegs ist, teilt sich die sen Lebensraum mit Wildtieren, Pflanzen und anderen Menschen. Achtsamkeit ist hier wichtig!
Ich plane mit Apps oder Karten und verlasse mich gerne auf die Erfahrungen anderer.

Informierst du dich über Ruhe- und Schutzgebiete und umgehst sie?
unterwegs, wo sonst niemand geht .
Top – so schützt du Pflanzen und vermeidest Stress für Wildtiere.
Achte dabei auf Waldränder und halte Abstand zu Futterstellen.
RespektAmBerg-Tipp
Gerade in der Dämmerung sind Wildtiere besonders aktiv. Vermeide Touren in der Dämmerung – das schont das Leben von Rehen, Schneehühnern und anderen Tieren.
Zu welcher Tageszeit bist du denn unterwegs?
Ich halte Abstand zu Wildtieren und bleibe auf ausgeschriebenen Routen.

Ich bin oft früh oder spät unterwegs –da ist’s ruhiger.
Ich gehe tagsüber, um die dämmerungsaktiven Wildtiere nicht zu stören.
RespektAmBerg-Tipp
Pssst! Die Stille des Im-Schneeunterwegs-Seins schätzen nicht nur wir Menschen, sondern besonders auch die Tiere, die da leben. Genießen und schweigen wir deshalb am besten.
So vermeidest du Stress für Wildtiere und Schäden an jungen Bäumen.
RespektAmBerg-Tipp
Alles, was du mitbringst, nimm auch wieder mit –selbst Taschentücher oder Orangenschalen gehören nicht in die Natur.


Viele kleine Wintersportorte in niedrigen und mittleren Höhenlagen stehen derzeit vor einer großen Herausforderung: Der Klimawandel sorgt dafür, dass es immer weniger zuverlässig Schnee gibt. Besonders betroffen sind Regionen, die früher auf natürliche Schneesicherheit zählen konnten. Heute ist dort oft unklar, ob die Loipen und Pisten überhaupt ausreichend Schnee abbekommen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf Umwelt und Natur, sondern auch auf die Menschen vor Ort – und auf den Tourismus, der in vielen Gemeinden ein wichtiger Wirtschaftszweig ist.
Neuer Fokus im Wintertourismus
Genau hier setzt das EU-weite Forschungsprojekt BeyondSnow an. Es will Wintersportorte in den Alpen widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel machen.
Wie das Projekt BeyondSnow alpine
Winterorte fit für die Zukunft macht.
h e NR ieta Wi NKL hOfe R
Das Ziel ist, dass diese Orte auch in Zukunft lebenswert bleiben – für Einheimische ebenso wie für Gäste.
Im Mittelpunkt des Projekts stehen zehn sogenannte Pilotregionen – verteilt auf sechs Alpenländer, darunter auch Österreich. Sie unterscheiden sich in
Größe, Entwicklung und Dringlichkeit, doch alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Gemeinsam mit Expert*innen aus Wissenschaft, Gemeinden und Tourismus wird daran gearbeitet, wie man trotz weniger Schnee zukunftsfähig bleiben kann.

Balderschwang (Oberallgäu), früher für lange Winter bekannt, lebt stark vom Wintertourismus. Nun ist es Pilotregion des Gemeindenetzwerks Allianz der Alpen und untersucht, wie es sich als Wintersportort an schneearme Winter anpassen kann.
Fotos: Alpenallianz
Dazu wurden zunächst Daten gesammelt und ausgewertet: Wie stark ist die Schneesicherheit bereits zurückgegangen? Was bedeutet das für den lokalen Tourismus? Und wie könnten Klima und Wirtschaft sich in den kommenden Jahrzehnten entwickeln? Daraus entstand ein Modell zur Klimaanpassung, das die Verwundbarkeit einzelner Regionen sichtbar macht und zeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Darauf aufbauend wurde ein digitales Tool entwickelt, das Tourismusdestinationen dabei unterstützen soll, passende Maßnahmen zu finden. Es ist öffentlich und kostenlos zugänglich, damit möglichst viele Regionen davon profitieren können.
Erste Ideen
In Workshops und Beteiligungsformaten erarbeiteten Menschen vor Ort nachhaltige Zukunftsszenarien: Welche touristischen Angebote können unabhängig vom
» Daraus entsteht ein Modell zur Klimaanpassung, das die Verwundbarkeit einzelner Regionen sichtbar macht und zeigt, wo Handlungsbedarf besteht
Die Vulnerability Map (Verwundbarkeitskarte) zeigt, wie stark kleine alpine Wintersportorte von den Auswirkungen des Klimawandels gefährdet sind. Grundlage sind mehrere Dimensionen:
• Exposure: wie stark ein Ort klimatischen Veränderungen ausgesetzt ist (z. B. weniger Schneefall, höhere Temperaturen)
• Sensitivity: wie empfindlich die Region auf diese Veränderungen reagiert (z. B. durch Bevölkerungsstruktur, Infrastruktur)
• Adaptive Capacity: wie gut ein Ort sich anpassen kann (z. B. ökologischer und touristischer Handlungsspielraum)
• Potential Impact: das Zusammenspiel aus Exposure und Sensitivity
Insgesamt fließen 12 Indikatoren ein. Die Karte ordnet jede Region in eine von fünf Gefährdungsklassen ein – von niedrig bis akut. Sie ist öffentlich einsehbar und soll Gemeinden, Politik und Interessierten eine Orientierung geben, wo besonderer Handlungsbedarf besteht.
Schnee funktionieren? Welche Strategien bringen Umwelt, Lebensqualität und wirtschaftliche Perspektiven in Einklang?
Erste Ideen wurden direkt in den Pilotregionen getestet – im kleinen Rahmen, aber mit großer Wirkung. Denn was hier gut funktioniert, kann später auch auf andere Orte übertragen werden.
Werfenweng liegt im Salzburger Land auf rund 900 bis 1.800 m Seehöhe. Das Skigebiet umfasst 29 Pistenkilometer, zehn Aufstiegshilfen und ist durch eine Gondelbahn direkt mit dem Ort verbunden. Mit rund 2.000 Betten ist der Tourismus gut etabliert, die Saisonen sind ausgewogen.
Als Mitglied der „Alpine Pearls“ setzt Werfenweng stark auf nachhaltige Mobilität: Werfenweng Card, E-Autos, das „W³-Shuttle“ oder das Ortstaxi „ELOIS“ sind Beispiele dafür. Im Rahmen von BeyondSnow beteiligt sich Werfenweng an Workshops, Umfragen und Expert*innen-
. « >

» Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, wie der Ort unabhängiger vom Schnee werden kann. Erste Maßnahmen werden derzeit erprobt. «
wie ein Wintersportort sich an schneearme Winter anpassen kann.
Umgesetzt wurde auch in Balderschwang vieles: Workshops mit der Bevölkerung, die Entwicklung eines neuen Tourismusleitbilds („Balderschwang 2040“), alternative Angebote für die Wintersaison und eine transparente Kommunikation zu Wetter- und Schneelage. Ziel ist, die Attraktivität auch mit weniger Schnee zu erhalten und einen nachhaltigen Ganzjahrestourismus zu fördern.

Balderschwang hat weit mehr zu bieten als Pisten und Loipen: Im Winter entlang eines Flusses wandern zu gehen ist eine von vielen Möglichkeiten, Alternativen im Winterurlaub auszuprobieren. Fotos: Beyond Snow
¡
>
austausch. Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, wie der Ort unabhängiger vom Schnee werden kann. Erste Maßnahmen werden derzeit erprobt.
Balderschwang im bayerischen Oberallgäu an der Grenze zu Österreich auf über 1.000 m war früher für besonders lange Winter bekannt. Heute ist die Schneesicherheit auch hier nicht mehr selbstverständlich. So fehlte etwa 2022 zu Weihnachten der Schnee für die Langlaufloipen. Der Ort lebt stark vom Wintertourismus – neben Skifahren und Langlauf spielen auch Winterwanderungen und Schneeschuhgehen eine Rolle. Als Pilotregion des Gemeindenetzwerks Allianz in den Alpen untersucht Balderschwang,
Zum Abschluss des Projekts geht es nun darum, die Erkenntnisse zu verbreiten: durch Schulungen, Informationsmaterialien und konkrete Empfehlungen für Politik und Verwaltung. Ziel ist, dass Gemeinden, Tourismusverbände, Unternehmen und auch die Bevölkerung besser verstehen, wie sie mit den Veränderungen umgehen können – und welche Chancen in einem nachhaltigeren, vielfältigeren Wintertourismus liegen.
Denn auch wenn sich die Winter in den Alpen verändern: Die Zukunft dieser Regionen lässt sich aktiv mitgestalten.
Henrieta Winklhofer ist im Bereich Kommunikation und PR für das Gemeindenetzwerk
„Allianz in den Alpen“ e. V. tätig.
Das Resilience Adaptation Model (RAM) ist ein Leitfaden zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit alpiner Wintersportregionen. Es unterstützt Gemeinden und Akteure dabei, Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit einzuschätzen –und bildet die Grundlage für das digitale Entscheidungstool. Bewertet werden vier Bereiche:
• Destinationsmerkmale (z. B. Bevölkerung, Wirtschaft)
• Klima und Umwelt (z. B. Schneefallmengen, Trockenphasen)
• Management und Governance (z. B. Strategieentwicklung, Stakeholder-Zusammenarbeit)
• Tourismusindikatoren (z. B. Schneeabhängigkeit, Infrastruktur, Aktivitätenangebot)
Für jeden Indikator gibt es Fragebögen, Dateninputs und Bewertungsskalen. So können Regionen besser priorisieren, wo sie ansetzen müssen.

Mehr Infos: www.alpine-space.eu/ project/beyondsnow


Die Trachtenserie der Münze



Holen Sie sich österreichische Lebensfreude. Die Münzen „AUFDIRNDLN – Leinen“ und „AUFBREZELN – Leder“ vereinen Tradition und Kultur in einzigartigen Sammlerstücken. Erhältlich in Silber und Kupfer. Mehr auf muenzeoesterreich.at

MÜNZE ÖSTERREICH – ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.
Lauenen liegt im Berner Oberland, im Lauenental. Rund die Hälfte
des Gemeindegebiets steht unter Naturschutz. Ein Abstecher in das neue Bergsteigerdorf – begleitet vom Lauener Bergführer Daniel Oehrli.

Die Schwemmebene im Rottal bezeichnet Daniel Oehrli als Kraftort. Auf rund 2.100 Metern über Meer erstreckt sich eine unerwartet ebene Fläche. Mehrere Wasserläufe ziehen sich durch das lockere Gestein, dazwischen liegen verstreut große Felsblöcke, deren Herkunft Rätsel aufgibt. Heute ist der Platz menschenleer. In Kürze öffnet jedoch die nahe gelegene Geltenhütte des SAC (Schweizer Alpen Club), nur wenige Gehminuten entfernt. Dann kommen wieder mehr Besucher*innen hierher – auch für Aktivitäten wie z. B. Yoga, erzählt Oehrli. Steinmänner und aus Steinen gelegte Figuren sind stille Spuren früherer Gäste.
Daniel Oehrli ist in Lauenen aufgewachsen und lebt noch immer im Dorf –zusammen mit seiner Frau Ruth Oehrli, der amtierenden Gemeindepräsidentin. Trotz Pensionsalter arbeitet er gelegentlich weiterhin als Bergführer und begleitet Gäste auf die umliegenden Gipfel. Auf dem Weg zur Geltenhütte zeigt er nach links: „Da habe ich meine Bienen.“ Auf der anderen Seite liegt sein Jagdrevier, wo er im Herbst auf Hochjagd geht. Die Gegend kennt er wie seine Westentasche – und er vertritt sie mit Überzeugung. „Ich bin viel auf der Welt herumgekommen, aber es gibt kein schöneres Gebiet als dieses hier“, sagt er.
Dank seiner Erfahrung als Bergführer und seiner Ortskenntnis gehörte Daniel Oehrli zum fünfköpfigen Team, das in Innsbruck die Kandidatur von Lauenen als Bergsteigerdorf präsentierte. „Da wurden auch kritische Fragen gestellt“, erinnert er sich. Etwa zum Gebirgslandeplatz auf dem Wildhorn an der Grenze zwischen Lauenen und Ayent im Wallis. Auch die Nähe zum mondänen Gstaad kam zur Sprache.
Die Bauvorschrift, dass Häuser im Tal mit Holz verkleidet sein müssen, prägt das Dorfbild und die Streusiedlungen mit ei-
nem einheitlichen Chaletstil. Die Gemeinde mit rund 850 Einwohnerinnen und Einwohnern hat sich zudem ihre Eigenständigkeit bewahrt. Vom Dorf führt nur eine schmale Straße weiter ins Tal zum Lauenensee. Weder eine große Bergbahn noch andere Infrastrukturbauten sind vorhanden – beides Ausschlusskriterien für das Netzwerk der Bergsteigerdörfer. „Das verdanken wir der Weitsicht unserer Vorfahren“, sagt Oehrli. Er erinnert an ein Projekt, nach dem das Wasser des Gältebachs einst durch einen Stollen in den Sanetsch-Stausee hätte geleitet werden sollen. Wäre es realisiert worden, gäbe es den Gälteschutz – einen Wasserfall, der sich auf dem Weg zur Geltenhütte über mehrere Stufen ergießt – heute nicht mehr. Stattdessen wurde das Gebiet vom Lauenensee bis zum Wildhorn, zum Arpelistock und zum Spitzhore Ende der 1960er-Jahre unter Schutz gestellt. Es gehört seither zum kantonalen Naturschutzgebiet Gelten-Iffigen sowie zum gleichnamigen Bundesinventar der Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN). Grundlage für die Aufnahme ins BLN waren unter anderem die beiden Lauenenseen mit ihren Flach- und Hochmooren sowie das
Heute steht fast die Hälfte des Gemeindegebiets unter Naturschutz –und konnte so ihre Ursprünglichkeit bewahren.
vielfältige Vorfeld des Gältegletschers mit der Schwemmebene im Rottal. Heute steht fast die Hälfte des Gemeindegebiets unter Naturschutz – und konnte so ihre Ursprünglichkeit bewahren.
Allgegenwärtiges Rauschen
Wasser prägt die Landschaft in besonderem Maß. Nicht nur der Gältebach stürzt sich als Wasserfall über die Felsen, auch der Tungelbach bildet mit dem Tungelschutz ein eindrucksvolles Naturbild. Immer wieder kreuzt der Wanderweg gurgelnde Bäche. Auch im Rottal ist das Rauschen allgegenwärtig. Über rund 200 Meter stürzt
das Schmelzwasser des Gältegletschers in die Tiefe und zeichnet sich vor der dunklen Felswand als weißer Streifen ab. Über den Gältegletscher führen Hochtourenrouten auf die Dreitausender Gältehore und Wildhorn, während der ebenfalls über 3.000 Meter hohe Arpelistock über einen Alpinwanderweg erreichbar ist.
Oehrli weiß auch, wo die schönsten Blumen wachsen. Trollblumen, Teufelskrallen und Alpenanemonen gehören dazu; Edelweiß und Männertreu vervollständigen für ihn die alpine Wiese. Und was erhofft sich Lauenen von der Auszeichnung als Bergsteigerdorf? „Seit der Coronapandemie hat der Tourismus massiv zugenommen“, erklärt Oehrli. Vieles konzentriere sich auf die bekannten und oft besungenen Lauenenseen. Doch die Zufahrtsstraße ist schmal, der Parkplatz klein. „Wir möchten den Tourismus lenken“, betont er. Die Idee der Bergsteigerdörfer passe dazu gut.
Anita Bachmann ist Journalistin und Fotografin. Sie arbeitet als Redakteurin beim Schweizer Alpen Club für die Zeitschrift „Die Alpen“. Mit ihrer Familie lebt sie in Worb bei Bern. In ihrer Freizeit ist sie oft beim Bouldern, Wandern oder auf Skitour unterwegs.
› Der Weg zur Geltenhütte führt am Gälteschutz vorbei. Foto: Anita Bachmann
ˆ Die beiden Lauenenseen sind berühmt, viel besucht und Teil des Naturschutzgebiets Foto: Anita Bachmann


„Paradiese sind klein“, lautet das Motto des Lungauer Bergsteigerdorfs. Jüngst hat auch Göriach seine „Alpingeschichte kurz und bündig“ erhalten.

Göriach ist 2021 in den Kreis der Bergsteigerdörfer aufgenommen worden. Der kleine Ort im Salzburger Lungau mit seinen 340 Einwohner*innen ist in einem Talschluss gelegen. Ähnlich wie in Partnerorten (etwa Johnsbach, Hüttschlag, Vent oder Ginzling) hat sich der Nachteil einer Randlage längst in einen touristischen Vorteil verwandelt: In Sackgassen lebt es sich ruhiger! Die touristisch-alpinistische Erschließung des Lungaus hat später als vielfach andernorts begonnen. Zu abgelegen waren
Die touristisch-alpinistische Erschließung des Lungaus hat später als vielfach andernorts begonnen. Zu abgelegen waren und zu wenig attraktiv erschienen lange die Niederen Tauern –welch Irrtum.
und zu wenig attraktiv erschienen lange die Niederen Tauern – welch Irrtum. Göriachs bedeutendster Gipfel ist der Hochgolling (2.862 m). Es ist charakteristisch für die Region, dass über dessen Erstersteigung wenig bekannt ist: 1791 gelangten vier Leute aus Tamsweg auf den „Hochgailling“, hielt ein Chronist fest, Details und ihre Namen sind nicht überliefert. Dafür kennen wir jenen des Bergsteigers, der 1817 am Gipfel stand –Erzherzog Johann. Die benachbarten Berge sind weniger bekannt, aber auf die eine

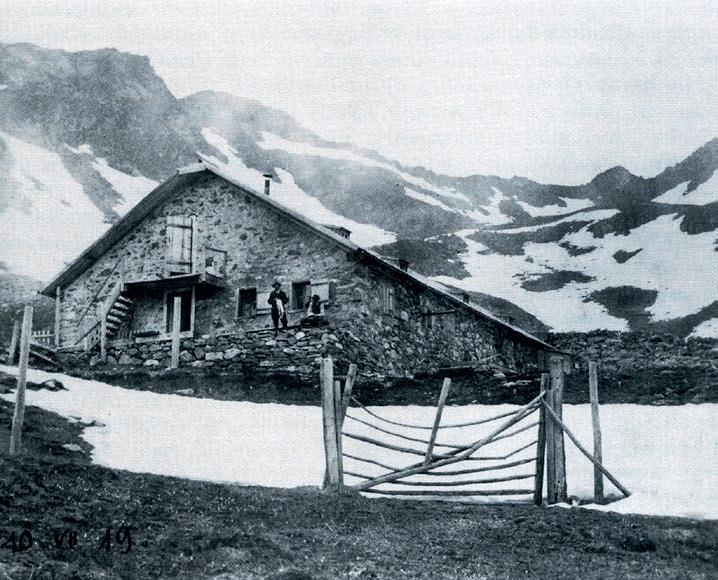
‹ Die Landawirsee-Hütte hat sich über Neu- und Umbauten hinweg den Charakter einer Almhütte bewahrt.
Foto: Archiv Alpenverein Sektion Lungau
ˆ Die Landawirsee-Hütte ist seit über hundert Jahren ein Herzstück des Göriacher alpintouristischen Angebots, hier 1919.
Foto: Archiv Hans Guggenberger
oder andere Weise durchaus herausfordernd und attraktiv.
Ein Herzstück der Göriacher Alpininfrastruktur ist die Landawirsee-Hütte (1.985 m), gelegen in einem wunderschönen Kessel und vom Hüttendorf am Talschluss des Göriachtals in zwei Stunden erwanderbar. 1911 mietete sich der Alpenverein Lungau in die Hütte der Alpsgenossenschaft ein, zwölf Jahre später wurde er nach einem Umbau Pächter.
Nach einer starken Beschädigung durch eine Staublawine kaufte die Alpenvereins-
sektion das Grundstück und errichtete bis 1981 einen Neubau. Mehrere Um- und Zubauten später ist die Landawirsee-Hütte heute vielbesucht und das emotionale Zentrum des Alpenvereins Lungau. Alpingeschichteautor Konrad Meindl bettet die Geschichte Göriachs ausführlich in jene der Sektion Lungau ein, deren Funktionär er jahrelang war (u. a. Obmann 1994–2006).
Eine Besonderheit der Gemeinde Göriach sei hier noch erzählt: Über Jahrhunderte scheiterte der Wunsch der Göriacher Bevölkerung nach einer eigenen Kirche und
¡pp

Konrad Meindl Göriach
Alpingeschichte kurz und bündig erhältlich auf alpenverein.shop
bergsteigerdoerfer.org/ alpingeschichte
vor allem einem eigenen „Gleit“ von Kirchenglocken, von dem man sich Unterstützung bei der Abwehr von Unwettern erhoffte. Erst seit 1973 gibt es eine Kirche in Göriach, auf den Kirchturm samt Glocken musste weitere 25 Jahre gewartet werden. 1998 gelang schließlich ein kluger Kompromiss: Der 25 Meter hohe Turm der Kirche ist zugleich jener der Feuerwehr, in dem diese ihre Schläuche zum Trocknen aufhängt!
Hannes Schlosser ist seit 2008 Redakteur der Buchreihe „Alpingeschichte kurz und bündig“.
Airbag Plume 30 UL | ARVA
„Plume“ – französisch für „Feder“ – ist Programm: Mit nur 48,3 g pro Liter Volumen und einem Gesamtgewicht von 1.450 g inklusive Carbonpatrone ist der Plume 30 UL der leichteste AirbagRucksack auf dem Markt. Trotz des Rekordgewichts bleibt die Sicherheit kompromisslos: Das bewährte Reactor2.0System mit Doppelairbag schützt besonders effektiv, indem es über die gesamte Rücken länge verläuft und möglichst viel Körpermasse aus den Lawinenscherkräften hebt. Ein HochleistungsGassystem (300 Bar) kombiniert mit einem VenturiAnsaugsystem sorgt für kraftvolle Entfaltung – auch im bewegten Schnee. Das extrem reißfeste Material ALLULA® (UHM WPE, 78 g/m²) ist siebenmal stärker als Nylon. Für lange Lebensdauer liefert Arva passende Reparaturpatches mit. Trotz seines Namens ist der Plume alles andere als zerbrechlich: Getestet bis 5.000 N (entspricht 500 kg), übertrifft er die Norm EN 16716 deutlich. www.arva-equipment.com
949,90 €




Mit nur 200 g (Herren) bzw. 180 g (Damen) zählt die Guardian Air zu den leichtesten Wetterschutzjacken ihrer Klasse. Das PFASfreie GoreTexePE3LMaterial sorgt für zuverlässigen Schutz bei hoher Atmungsaktivität – vom Skitourenaufstieg bis zur technischen Abfahrt. Praktische Features: helmkompatible CrossPull™Kapuze, ZweiWegeReißverschluss, gurtfreundliche Taschen und 10mmNahtabdichtung. www.7mesh.com
450 €


Mit einem innovativen Mix aus 59 % Merinowolle und 41 % Nylon präsentiert ODLO seine bislang leistungsstärkste Unterwäsche für den Winter. Der Baselayer punktet mit natürlicher Wärme, Atmungsaktivität und angenehmem Tragekomfort. Die nahtlose Konstruktion und BodyMappingTechnologie sorgen für optimale Passform und Bewegungsfreiheit. www.odlo.com
Funktionsshirt: 129,95 € Funktionstights: 129,95 €

Das neue PIEPS Mini IPS überzeugt mit minimalem Gewicht (158 g) und maximaler Leistung: Das Interference Protection System schützt im Sendemodus vor Störungen durch elektronische Geräte, während das neue Search Assist Plus mit piktogrammbasierter Benutzerführung für Übersicht in Notsituationen sorgt. Dank vollständig digitaler Gen3Plattform arbeitet das LVSGerät schnell, stabil und zuverlässig – mit bis zu 50 m Suchstreifenbreite und 300 Stunden Batterielaufzeit. Ideal für Tourengeher*innen, Freerider und alpine Einsatzkräfte. www.pieps.com
299 €

Die Lumina ist eine Daunenjacke für ambitionierte Wintereinsätze. Gefüllt mit italienischer Gänsedaune (1.000 cuin) und umhüllt von daunendichtem, recyceltem Pertex Quantum, bietet sie exzellente Isolationsleistung bei minimalem Gewicht. Erhältlich in drei Gewichtsklassen (170 g / 250 g / 350 g) und als Damenmodell – von der Skitour bis zum Biwak im Hochgebirge. www.lasportiva.com
250 € bis


Dieser Spray neutralisiert anhaltende Gerüche – mit modifizierter Kieselsäure auf Wasserbasis. Ideal für Funktionsbekleidung, Ausrüstung und Textilien, die häufig in Kontakt mit Geruchsquellen stehen. Sanft zu Stoffen und hautverträglich. www.camaro.at
14,95 € (100 ml), 24,95 € (225 ml)
Der Helio Tour ist ein 3in1Hand schuhsystem für anspruchsvolle Skitouren: Ein atmungsaktiver Innenhandschuh trifft auf einen wetterfesten, Primaloftisolierten Außenhandschuh mit robustem Softshell und Ziegenleder. Zusätzlicher Schutz kommt durch die integrierte OvermittKapuze. TouchscreenFunktionalität und schnelltrocknendes Material erhöhen die Alltagstauglichkeit. www.blackdiamondequipment.com
140 €
Jacket | Grüezi bag
Seide trifft Wolle. Die Isolation aus feiner, recycelter Seide und Wolle sorgt für ein natürlich reguliertes Körperklima – angenehm warm, atmungsaktiv und trocken bei wechselnden Bedingungen. Für maximalen Tragekomfort am Berg. www.gz-bag.de
280 €




Ein funktionaler Hoodie aus Merinowolle und SchoellerAcryl – winddicht dank GORE WINDSTOPPER® Membran. Atmungsaktiv, weich, langlebig – und bluesign®zertifiziert. Funktionelle Details wie ÄrmelReißverschlusstasche und verstellbarer Saum runden das Design ab. www.kama.cz
389,90 €
Die Wild Places 3in1 Jacket kombiniert eine isolierte Innenjacke mit 80 g Primaloft Black Rise und eine wasserdichte, atmungsaktive Texapore Ecosphere Core Außenjacke zu einem flexiblen Wetterschutzsystem. Das bewährte 3in1Konzept ermöglicht den variablen Einsatz je nach Witterung – von der leichten Übergangsjacke bis zur vollwertigen Winterlösung. Das elastische Obermaterial der Innenjacke sorgt für Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort, während verstellbare Bündchen und eine anpassbare Kapuze funktionelle Details bieten. Entwickelt für wechselhafte Bedingungen, bei denen Schutzschicht und Isolationsleistung flexibel kombiniert werden können. www.jack-wolfskin.de
250 €

unbezahlte Werbung

Gabriel
Die
Zum
Haben Sie sich auch schon darüber geärgert, dass der Duschschlauch sich immer widerborstig in die falsche Richtung dreht oder das Bedienfeld des Herdes, mit kryptischen Zeichen versehen, sich viel zu nah an den Herdplatten befindet? – Dann sind Sie nicht allein. Den deutschen Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Yoran inspirierten diese Ärgernisse des Alltags dazu, sich die Fortschrittlichkeit gewisser Entwicklungen einmal genauer anzuschauen.
Seine Erkenntnisse packte er in das Buch Die Verkrempelung der Welt. Zum Stand der Dinge (des Alltags), das nicht ohne Grund zum Bestseller wurde. Auf flotte und sehr überzeugende Art entlarvt er diverse technologische „Errungenschaften“ aus Nutzersicht als tatsächliche Rückschritte. Dabei, und das ist wichtig, stimmt der Autor nicht die Leier des „Früher war alles besser“. Vielmehr betont er: „Erst die Massenproduktion von Waren ermöglichte überhaupt die Steigerung der Lebensqualität für Milliarden von Menschen. Niemand will hinter das industrielle Zeitalter zurück, niemand will auf Wasch- und Spülmaschinen, gut schließende Fenster und funktionierende Heizungen verzichten.“
Darum schaut er sich an, wie und warum es zu „Verschlimmbesserungen“ bei Gegenständen des täglichen Gebrauchs kommt. Der Grund ist einfach wie vertrackt: Zum einen ist zum Beispiel die Produktion von Tastfeldern an Herden deutlich günstiger als Drehknöpfe. Zum anderen hat die Industrie der Langlebigkeit von Erzeugnissen längst den Marsch geblasen. Sie will schließlich verkaufen! Beständigkeit und Reparatur sind da kontraproduktiv. Beim Lesen des Buches werden Sie Augen machen, was sich in vielen Innovationen an prak-
tischen Rückschritten versteckt. Nicht nur bewegliche Schläuche an Duschköpfen und robuste Knöpfe an Herden gab es schon.
Neben weiteren heißen Eisen der Konsumgesellschaft widmet sich Die Verkrempelung der Welt zudem der Eigentümlichkeit, dass gewisse Produkte ein und desselben Erzeugers in bestimmten Ländern deutlich schlechter, andere gar nicht erhältlich sind. So findet man in Italien in den Regalen von Drogeriemärkten einen Rasierschaum, der leicht entzündungshemmend wirkt – nicht aber in Deutschland oder Österreich. Yoran zeichnet an diesem Beispiel nach, wie ein erfolgreiches amerikanisches Familienunternehmen an einen Konzern verkauft wurde und dieser die bestens eingeführte Marke zugunsten einer anderen zum Nischenprodukt machte.
Einmal mehr stellt der Autor fest, ein Produkt könne noch so gut sein, dem Handel gehe es „eben nicht um ein möglichst interessantes Produktportfolio, sondern um möglichst verlässlichen Absatz“. Und werbeaffin, wie wir Menschen sind, sagen uns Clips, was wir gerne hätten. Anders gesagt: Was in der Werbung nicht vorkommt, findet keine Käufer.
Eines aber ist fix: Nach der Lektüre von Yorans Buch werden Sie selbst die euphorisch gepriesenen Einstellungen von Kaffeevollautomaten, die vom Sofa aus zu bedienen sind, weitaus kritischer sehen. Und ganz nebenbei Ihr Konsumverhalten! Besonders fein an Die Verkrempelung der Welt: Kein erhobener Zeigefinger! Sich selbst an der Nase packend, lässt Yoran seine Leserinnen und Leser teilhaben an den eigenen Irrungen und Wirrungen – und der einen oder anderen tiefgreifenden Erkenntnis darüber, wie wir der Verkrempelung der Welt entgegentreten können.

Rebecca Solnit Umwege.
Essays für schwieriges Terrain aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger
„Die Zukunft ist kein Schicksal, sondern das, was wir aus ihr machen.“ – Ein solcher Satz, in Großbuchstaben auf der Rückseite eines Buches: Wer würde in Zeiten wie diesen nicht danach greifen? Zumal Rebecca Solnit zu den profiliertesten Essayistinnen Amerikas zählt und spätestens seit dem Buch Wanderlust. Eine Geschichte des Gehens (2000 auf Deutsch erschienen) bei Liebhabern und Liebhaberinnen dieser Fortbewegungsart bzw. Freizeitbeschäftigung einen Stein im Brett hat.
Dass die Aktivistin und Feministin vielseitig interessiert ist, spiegelt sich in ihren zahlreichen Publikationen. Zu ihren Kernthemen gehören neben Demokratie die Ökologie und ihre Gefährdungen, soziale Strukturen im Wandel, Machtverhältnisse und Feminismus. Dabei enthält die Essaysammlung Umwege. Essays für schwieriges Terrain sehr unterschiedliche persönliche wie politische Texte, die in den vergangenen Jahren unter anderem in der Zeitschrift The Guardian erschienen sind.
Solnit verweigert sich dem Pessimismus, zeigt auf, wie Bewegungen, die im Kleinen entstehen, oft über Umwege in die Breite wirken und Großes bewegen können. Denn es gab und gibt nie einfache Antworten auf komplexe Themen. So ist der Sammelband als Plädoyer fürs Weitermachen zu lesen, fürs Kämpfen. Solnits Essays sind Ermutigungen, sich nicht von Umwegen abschrecken zu lassen: Sie sind Teil selbstwirksamen Handelns. Und wer wüsste besser, dass oft Umwege zum Ziel führen, als Alpinistinnen und Alpinisten?

Rudolf Alexander Mayr
Karls Wiederkehr. Ein Bergroman
Mehr als zwei Jahre ist Karl bereits verschwunden. Zwar war er immer wieder für einige Zeit abgetaucht, aber so lange noch nie. Im Gasthaus, das am Fuß jenes Berges liegt, auf dem Karls Hütte steht, stapeln sich die Gerüchte. Der eine will ihn in Alaska gesehen haben, der andere in Nepal … Mit diesem Szenario beginnt der Roman Karls Wiederkehr des ehemaligen
Bergsteigers und Mitarbeiters des Österreichischen Alpenvereins Rudolf Alexander Mayr. Seit er das Extrembergsteigen an den Nagel gehängt hat, widmet er sich verstärkt dem Schreiben. Nach Erzählungen und Kurzgeschichten – Lächeln gegen die Kälte (2016) und Das Licht und der Bär (2021) – ist Karls Wiederkehr Mayrs erster Roman.
In einem weiten Bogen beschreibt er Karls Werdegang, von der Knabenschule im Internat und seinen strengen Sitten bis herauf zu seinem mysteriösen Verschwinden – spinnt einen Bergroman, der sich zum Thriller entwickelt, und verzahnt die Handlung mit alpinistischem Wissen. Die Schilderungen zehren von den umfangreichen Bergerfahrungen Mayrs in heimischen Gefilden ebenso wie von seinen Expeditionen in fernen Regionen. Passende Lektüre also für lange Winterabende, in denen ganz nebenbei vielleicht Pläne für die nächste große Bergtour geschmiedet werden.

Herbert Tichy
Zum heiligsten Berg der Welt. Auf Landstraßen und Pilgerpfaden in Afghanistan, Indien und Tibet
Herbert Tichys Reisebericht Zum Heiligsten Berg der Welt ist ein faszinierendes Zeugnis von Abenteuerlust, kultureller Neugier und wissenschaftlicher Entdeckung. 1935 begibt sich der junge Geologiestudent auf eine außergewöhnliche Reise durch Afghanistan, Indien und Tibet – teils mit dem Motorrad, teils zu Fuß. Mit feinem Gespür schildert er Begegnungen, Landschaften und spirituelle Erfahrungen. Die Neuauflage 2025 ergänzt den Klassiker um rare Fotos und ein Vorwort von Wolfgang Nairz.
Jahrbuch 2024 2025
Verein zum Schutz der Bergwelt


Verein
zum Schutz der Bergwelt Jahrbuch 2024/2025
Jubiläumsausgabe 1900–2025
Wer sich für alpinen Naturschutz interessiert, findet hier Lesefutter: Das Jahrbuch 2024/25 des Vereins zum Schutz der Bergwelt (VzSB) erscheint als umfangreicher Doppelband anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Vereins – und verbindet historische Tiefenschärfe mit aktueller Relevanz.
Herzstück des Bandes ist die fundierte Chronik von Klaus Lintzmeyer. Sie zeichnet nach, wie sich der VzSB seit seiner Gründung im Jahr 1900 für den Schutz der bayerischen Alpen einsetzt – von den Anfängen in einer noch kaum regulierten Erschließungsphase bis zur heutigen Rolle als kritisch-konstruktiver Partner in Umweltfragen. Rudi Erlacher ergänzt diesen Rückblick mit einer Analyse, wie sich der Verein gegen den Zugriff der industriellen Moderne auf den alpinen Raum gestellt hat. Deutlich wird: Der VzSB war oft unbequemer Mahner, aber stets eine verlässliche Stimme für die Natur.
Die thematische Spannweite des Jahrbuchs reicht dabei weit über die eigene Geschichte hinaus. So widmen sich mehrere Beiträge den Folgen des Klimawandels: Harald Pauli berichtet über das GLORIA-Projekt zur Veränderung der Hochgebirgsflora, Sabine Rösler dokumentiert in einem Citizen-Science-Projekt das Höhersteigen der Baumarten seit 1854. Beide zeigen: Der Wandel ist messbar – und deutlich.
Ein weiteres Highlight ist die Vorstellung des neuen Nationalparks Vjosa in Albanien, Europas erstem FlussNationalpark. Das Autorenteam um Fritz Schiemer plädiert eindringlich für ein dynamisches, ökologisch ausgerichtetes Flussgebietsmanagement – ein Modell mit Vorbildwirkung weit über den Balkan hinaus.
Auch gesellschaftliche und politische Aspekte kommen nicht zu kurz: Beiträge zur Geschichte des Umweltschutzes in der Bayerischen Verfassung, zur Landesplanung, zur Seilbahnförderung oder zur Neuordnung des Wald-Wild-Konflikts beleuchten zentrale Schnittstellen zwischen Naturschutz, Politik und Gesellschaft. Besonders lesenswert ist die Rezension zu Bernhard Löfflers Buch Das Land der Bayern. Der Landeshistoriker wirft einen kritischen Blick auf die Rolle des alpinen Naturschutzes im Spannungsfeld zwischen Landschaftsklischee und Realität – eine Einladung zur Selbstreflexion auch für engagierte Naturschützer*innen.
Das Jubiläumsjahrbuch des VzSB ist weit mehr als eine Festschrift. Es ist ein sorgfältig kuratierter, journalistisch und wissenschaftlich anspruchsvoller Band –für alle, die sich für den Schutz der Alpen interessieren und verstehen wollen, wie vielschichtig und zukunftsrelevant dieses Engagement ist. Das Jahrbuch ist über den VzSB erhältlich: www.vzsb.de/kontakt
Wie die Kachelöfen in die Schutzhütten kamen.
Im Schaukasten, Teil 49
m a Rti N ach R ai N e R Historisches Archiv des Alpenvereins

Eine Tour, eine Hütte, eine Stube, der behagliche Kachelofen. Diese Abfolge würde man vermutlich in vielen Köpfen vorfinden, könnte man nur hineinschauen. Doch der Kachelofen hat langsam und spät in die Schutzhütten Einzug gehalten. Denn dafür braucht es neben der Heizung auch einen separaten Herd – also getrennte Bereiche für Stube und Küche.
In den ältesten und kleinen (Einraum-)Hütten platzierte man daher nur einen (eisernen) Ofen, der zum Heizen und Kochen gleichermaßen taugen sollte. Johann Stüdl, der Alpenvereinshüttenexperte der ersten Stunde, empfahl den Sparherd und dessen „nicht zu verachtende Wärme“. Die Abtrennung der Schlafräume und zusätzliche Öfen lehnte Stüdl ab, da das Holz nur sehr kostspielig zu beschaffen sei. Die meisten Hütten lagen ja doch deutlich über der Waldgrenze.
Teils wurde noch um 1900 an Stelle „eines zwecklosen Kachelofens“ ein Sparherd aufgestellt. Das von Stüdl empfohlene Stangenviereck darüber zum Trocknen von Kleidungsstücken aber ist jenem des Kachelofens der Bauernstube gleich. Witze über die Würze, die aus den aufgehängten nassen Socken in die Suppe tropft, waren die logische Folge.
Häufiger wurden Kachelöfen dann gesetzt, wenn Hütten erweitert oder gleich größer und komfortabler gebaut wurden: Küche und Stube sind getrennt, und die „wohlige Wärme“ des Kachelofens kommt zur Geltung. Wer sich heute in seiner Nähe befindet, möge nach dem Edelweiß des Alpenvereins suchen –unsere abgebildete ŒAV-Ofenkachel ist wohl kein Einzelstück, war jedoch nie verbaut.
Der erste Erkundungsgang führt nicht ins Innsbrucker Depot, sondern ins Wiener Leopold Museum. Dort absolviert ein Gemälde aus der Sammlung des Österreichischen Alpenvereins nämlich gerade ein Auswärtsspiel in prominenter Gesellschaft. Die Ausstellung „Verborgene Moderne“ ist unter anderem mit Werken von Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Edvard Munch und Wassily Kandinsky bestückt. Sie ist dem um 1900 aufkeimenden Bedürfnis nach spiritueller Erneuerung gewidmet. In künstlerischphilosophischen Zirkeln, in bürgerlichen Salons und in Lebensreform-Bewegungen suchte man die Balance zwischen Körper, Geist und Seele wiederherzustellen. Diese war im Zuge der Industrialisierung verloren geglaubt. Neben Esoterik und Okkultismus spielten dabei die Kräfte der Natur und speziell die Berge als Symbol der Reinigung und Befreiung eine wichtige Rolle. „Der Alpinismus“, heißt es im Leopold Museum, „kann als einer der elitärsten Clubs der Reformbewegung bezeichnet werden. Das Café Griensteidl in der Wiener Innenstadt, Treffpunkt der Okkultisten, wurde auch das AlpinistenCafé genannt.“ Am Berg kamen Fitnesskult und Philosophie, Naturverbundenheit und Spiritualität zusammen. Ablesen lässt sich das auch an der Leihgabe aus dem Alpenverein: Otto Barths großformatigem Ölgemälde „Morgengebet der Bergführer auf dem Gipfel des Großglockners“ aus dem Jahr 1911.
Zu Besuch im Alpenvereinshaus
Um den höchsten Berg Österreichs kreist das Gespräch einige Tage später auch im Alpenvereinshaus in Innsbruck – allerdings geht es dabei nicht allein um künstlerische und gesellschaftliche Strömungen der Jahrhundertwende. Zum Thema Großglockner gibt es auch sonst einiges zu erzählen. Veronika Raich fallen dazu reihenweise Objekte aus der hauseigenen Sammlung ein. Zum Beispiel der rund 6.000 Jahre alte Wurzelstock einer Zirbe aus der Pasterze. Das Stück gibt nicht nur Aufschluss über die klimatischen Bedingungen der Nacheiszeit, sondern auch über die dramatische Gletscherschmelze der Gegenwart. Da wären aber auch
In der Geschichte des Alpinismus spiegeln sich gesellschaftspolitische und künstlerische Entwicklungen genauso wie das Verhältnis des Menschen zur Natur. Das ist österreichweit wohl nirgends sonst so gut dokumentiert wie im Museum und Archiv des Österreichischen Alpenvereins. Eine Bestandsaufnahme von A wie Antisemitismus bis Z wie Zirbe.
iVONa Je L čić

die Kristallsammlung aus der Glocknerwand und das historische Glockner-Biwak, das 1958 auf 3.260 Metern Seehöhe errichtet wurde. Es bot Alpinistinnen und Alpinisten mehr als ein halbes Jahrhundert lang Schutz und wurde dann als mobiler Ausstellungsraum für die „Wunderkammer Alpen“ genutzt. Oder der aus Kärnten stammende Alpinist und Maler Markus Pernhart, über dessen GlocknerDarstellungen noch zu sprechen sein wird.
Veronika Raich, Sonja Fabian und die Historiker Martin Achrainer und Michael Guggenberger betreuen gemeinsam mit Leiter Gerald Zagler das Museum und Historische Archiv des Österreichischen Alpenvereins, der seit seiner Gründung 1862 eine einzigartige Sammlung aufgebaut hat. Sie umfasst alpine Kunst, Fotografie, Kartografie, Alltags- und Ausrüstungsgegenstände. Darunter befinden sich

Objekte aus der Sammlung des Alpenvereins sind regelmäßig als Leihgaben in österreichischen und internationalen Ausstellungen zu sehen.
an die 3.000 Gemälde und Grafiken von den Anfängen der Alpenmalerei bis zur Gegenwart, die größte Sammlung an historischen Reliefs der Ost- und Westalpen und Karten von Peter Anich oder Matthias Burglechner. Touren- und Gipfelbücher gehören ebenfalls dazu sowie Equipment wie hölzerne Firngleiter oder Kletterpatschen mit Hanfsohle. Diese muten heute archaisch an, dürften zu ihrer Zeit aber die Must-haves der modernen Bergsportlerinnen und -sportler gewesen sein. Seit 2008 wird diese Sammlung im Depot des heutigen Hauptquartiers des Österreichischen Alpenvereins verwahrt.
Sammeln und erzählen
Nicht nur am Beispiel Großglockner zeigt sich eine große Stärke der Sammlung: nämlich die Möglichkeit, einzelne Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und dabei verschiedene Wissensbereiche und Disziplinen miteinander zu verbinden – von den Naturwissenschaften bis zur Kunst- und Kulturgeschichte. Dieses Prinzip gewinnt übrigens in der gesamten Museumswelt immer mehr Bedeutung. Höchst erfreulich findet Raich aber auch noch etwas anderes: „Der Österreichische Alpenverein hat das unwahrscheinliche Glück, eine Sammlung zu haben, über die er seine eigenen Themen
Rundgang mit Veronika Raich durch das Depot des Österreichischen Alpenvereins.
Foto: Alpenverein/P. NeunerKnabl
unglaublich gut erzählen kann. Das ist genial.“ Gemeint sind damit unter anderem Natur- und Landschaftsschutz, die Sensibilisierung für Umweltfragen und die möglichst ökologische Bewirtschaftung von Alpenvereinshütten.
Der Entstehungsgeschichte und Gegenwart des alpinen Hütten- und Wegenetzes hat man 2016 in der Ausstellung „Hoch hinaus! Wege und Hütten in den Alpen“ beleuchtet. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein und dem Alpenverein Südtirol konzipiert. In Tirol war sie im Archiv für Bau.Kunst.Geschichte der Universität Innsbruck zu sehen. Über einen eigenen Standort verfügt das Alpenverein Museum nämlich nicht, wiewohl seit Jahren danach gesucht wird. Dabei sprechen gute Gründe für so ein eigenes Museum, zum Beispiel der Erfolg des sieben Jahre währenden Gastspiels in der Innsbrucker Hofburg: Rund 300.000 Besucherinnen und Besucher sahen dort zwischen Ende 2007 und 2014 die mehrfach preisgekrönte Alpenvereins-Ausstellung „Berge, eine unverständliche Leidenschaft“.
Objekte aus der Sammlung des Alpenvereins sind regelmäßig als Leihgaben in österreichischen und internationalen Ausstellungen zu sehen. Darüber hinaus gibt es immer wieder Kooperationen, wie zuletzt mit den Ötztaler Museen für die Ausstellung „Ötztaler Gletscher. Katastrophen, Klimawandel, Kunst“. In den letzten Jahren habe sich außerdem viel in der digitalen Vermittlungsarbeit getan, sagt Raich, „durch Corona ist das Verständnis dafür stark gestiegen.“ Auf der eLearning-Plattform der Alpenverein-Akademie (elearning.alpenvereinakademie.at) kann man nicht nur virtuelle Rundgänge durch vergangene Ausstellungen unternehmen. Es finden sich dort auch umfangreiche Lernpakete und Dossiers zur Vereinsgeschichte.
Unter uns
Das Historische Archiv ist eine Schatzkammer, in der jedoch bei weitem nicht alles in positivem Licht erstrahlt. „So, jetzt sind wir ganz unter uns!“, lautet die Bildunterschrift einer Karikatur von Paul Humpoletz, die Ende 1924 unter dem Titel „Der judenreine Alpenverein“ im Wiener Satire-
blatt „Der Götz von Berlichingen“ er schienen ist. Die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die sich in Humpoletz’ Karikatur unter Hakenkreuzen und einem Schild mit der Aufschrift „Hunden und NichtAriern ist der Eintritt verboten“ versammeln, sind als Esel dargestellt. Aber sie stellen längst auch die aggressiv gegen jüdische Mitglieder hetzende Mehrheit in den Alpenvereinssektionen dar.
Antisemitismus und völkische Tendenzen breiten sich im Alpenverein bereits Ende des 19. Jahrhunderts aus und nehmen die engen Verstrickungen mit dem späteren NS-Regime vorweg. Dieses dunkle Kapitel der eigenen Geschichte haben der Deutsche, Oesterreichische und Südtiroler Alpenverein in einem gemeinsamen Forschungsprojekt aufgearbeitet und 2011 publiziert. Zuletzt beschäftigten sich auch Achrainer und Guggenberger, die beiden Historiker im Alpenverein, intensiv mit der Sektion Donauland. Sie wurde 1921 von jüdischen und liberalen Bergsteigern gegründet, aber bereits 1924 aus dem Deutschen und Oesterreichischen Verein ausgeschlossen.
Historische Akten aus dem Archiv dokumentieren die Gründung der Sektion Donauland, aber auch die Proteste und Diffamierungen aus dem deutschvölkischen Lager, denen sie ausgesetzt war.
Schatzkammer der Vergangenheit
Beim Rundgang durchs Depot fällt vor allem eine riesige, schwarzglänzende Apparatur ins Auge. Sie hat mehr als hundert Jahre auf dem Buckel und bringt ein paar hundert Kilo auf die Waage. Der Zeiss Stereoautograph aus dem Jahr 1913 ist ein komplexes, jahrzehntelang für die alpine Kartografie verwendetes Höhenlinienkarten-Zeichengerät. Das ein paar Meter wei-

^ Josef Preyers „Wildspitze“, Öl auf Leinwand, um 1880.
› Auf dünnen Beinen steht eine Skulptur der Künstlerin Johanna Tinzl, die direkt am Gletscher Abgüsse in Alabastergips abnimmt und im Atelier in Skulpturen aus Weißbeton transformiert.
Fotos: WEST. Fotostudio/Österreichischer Alpenverein
ter aufbewahrte, aufklappbare Modell der Badener Hütte aus dem Jahr 1906 ist dagegen ein ziemliches Leichtgewicht, aber kaum weniger faszinierend. Wenn Raich die Gemäldezuganlage bedient, kommen Werke von prominenten Landschaftsmalern des 19. Jahrhunderts wie Thomas Ender oder Edward Theodore Compton zutage. Auch ein Blick auf Albin Egger-Lienz’ „Bergraum I“ von 1911 ist zu erhaschen.
Daneben steht auf dünnen, insektenartigen Beinen eine Skulptur von Johanna Tinzl. Die junge Tiroler Künstlerin legt mit ihren Gletscherabgüssen, die sie direkt am Gletscher in Alabastergips abnimmt und im Atelier in Skulpturen aus
Rund 300.000 Besucherinnen und Besucher sahen zwischen Ende 2007 und 2014 die mehrfach preisgekrönte AlpenvereinsAusstellung „Berge, eine unverständliche Leidenschaft“.
Weißbeton transformiert, seit einigen Jahren ein „Archiv des Verschwindens“ an. Tinzls Skulptur ist eine der jüngsten Neuzugänge in der Sammlung, die unter anderem durch Schenkungen, gelegentlich aber auch durch Ankäufe wächst. Dafür gebe es ein „kleines Budget“ und neuerdings auch eine mit dem Kunsthistoriker Günther Moschig erarbeitete Sammlungsstrategie, sagt Raich. „Eine Sammlungsstrategie generiert sich aus dem Wissen, was da ist.“ Es sei darum gegangen, den Bestand zu erheben, Lücken zu erkennen und daraus einen Leitfaden für die Weiterentwicklung der Sammlung zu destillieren. Markus Pernhart kommt da wieder ins Spiel. Der Kärntner Alpinist und Landschaftsmaler wollte den Großglockner im 19. Jahrhundert nicht nur aus sicherer Entfernung von Heiligenblut aus malen, sondern soll ihn 1857 innerhalb von nur vier Tagen gleich dreimal bestiegen haben, um jene Stimmungen einzufangen, die er dann auf die Leinwand brachte. Unlängst ist es gelungen, eine um 1860 gemalte GlocknerDarstellung Pernharts aus einer Auktion für die Sammlung zu ersteigern.
Bei Eröffnung bitte angeben:


Für Begeisterung sorgen bei Raich aber auch andere Neuzugänge: Über eine Schenkung der Familie Pischl aus Telfs kamen 2023 ein großes Ötztaler Kreuzspitz-Panorama und weitere Aquarelle des Münchner Landschaftsmalers und Alpinisten Carl Brizzi in die Sammlung. Sie ergänzen nicht nur vorhandene Bestände, sondern erzählen auch von den Anfängen des alpinen Tourismus. Der so genannte Gletscherpfarrer, Tourismuspionier und Alpenverein-Mitbegründer Franz Senn hatte das Kreuzspitz-Panorama 1868 bei Brizzi in Auftrag gegeben, war mit dem aus seiner Sicht zu wenig naturalistischen Ergebnis dann aber unzufrieden. Was Brizzi zwar um seinen Lohn gebracht, aber der Begeisterung von Alpintouristen für die Ötztaler Alpen und folglich auch deren Erschließung keinen Abbruch getan hat.
Ivona Jelčić ist freie Journalistin, Autorin und Moderatorin und widmet sich in ihrer Arbeit insbesondere der bildenden Kunst, Kultur sowie gesellschaftspolitischen Themen.
¡ nfo
Das Alpenverein-Museum verfügt derzeit über keine Räumlichkeiten für eine eigene Ausstellung, die besucht werden kann. Es stellt seine Objekte aber laufend für nationale und internationale Ausstellungsprojekte zur Verfügung. Nach einem Ausstellungsstandort für ein Alpenverein-Museum wird gesucht.
Die Ausstellung „Ötztaler Gletscher – Katastrophen, Klimawandel, Kunst“, ein Gemeinschaftsprojekt der Ötztaler Museen und des Österreichischen Alpenvereins, ist vor Ort bereits beendet – online kann sie jedoch noch als virtueller Rundgang erlebt werden.

Scannen und virtuelle Ausstellung besuchen
Exklusiv für Vereinsmitglieder: Jetzt KontoBox Large eröffnen und als Vereinsmitglied den exklusiven 100 Euro Gipfelbonus* sichern – ganz einfach durch:
• Nutzung des Kontowechsel-Service mit Information von mindestens vier Zahlungspartnern
• Aktivierung und Verwendung der BAWAG Banking App
Für junge Vereinsmitglieder:
Bei Eröffnung eines B4-19 Kontos gibt es 20 Euro Startbonus*
Der Startbonus von 20 Euro wird nach Eingang einer Mindestgutschrift von 25 Euro und mindestens einmaligem Login in der BAWAG Banking App auf das neueröffnete Jugendkonto gutgeschrieben.
*Gültig bei Kontoeröffnung bis 31.12.2025. Die Gutschrift des Gipfelbonus bzw. Startbonus erfolgt automatisch innerhalb von 6 Wochen. Barablöse ausgeschlossen. Der Gipfelbonus und Startbonus sind nicht mit anderen Boni oder Aktionen kombinierbar. Dies gilt insbesondere für Empfehlungsprogramme sowie sonstige gleichzeitig laufende Werbeaktionen.
Wie alles begann: 1875 erscheint die erste Ausgabe der Mitteilungen des Alpenvereins. Zunächst streng, sachlich, fast belehrend – doch schon bald wird daraus ein Magazin, das Identität stiftet. Eine Zeitreise durch 150 Jahre Alpenvereinsgeschichte in gedruckter Form.


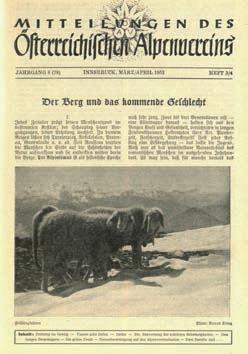

Wer heute durch alte Jahrgänge der Alpenvereins-Publikationen blättert, öffnet ein Zeitfenster in eine andere Bergwelt. Kaum etwas spiegelt den Verein so präzise wie sein eigenes Print-erbe. Was einst als nüchternes Amts- und Nachrichtenblatt begann, wurde zum Spiegel des alpinen Lebens –und schließlich zum Vorgänger des heutigen Bergauf-Magazins, in dem Sie gerade blättern.
Der Impuls, Alpinismus schriftlich zu dokumentieren, kam aus England: 1863 erschien das Alpine Journal, die erste Bergsteigerzeitschrift der Welt. In den Alpenländern reagierte man rasch – in Österreich etablierte sich im selben Jahr eine Jahrbuchtradition: wissenschaftlich orientiert, mit Tourenberichten, Karten und geologischen Studien. Wichtig: Dieses
Jahrbuch ist nicht mit den späteren „Mittheilungen“ zu verwechseln. Es war eine periodische, aber jahresweise erscheinende Publikation – die große Enzyklopädie des Alpenwissens jener Zeit.
1872 – kurz vor der Vereinigung von Deutschem und Österreichischem Alpenverein – ging das Jahrbuch in eine gemeinsam herausgegebene Zeitschrift des DuOeAV über. Und ist diese bis heute.
Stimme des Vereinsalltags
1875 beginnt eine zweite, für den Vereinsalltag entscheidende Linie: die „Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins“. Anders als das Jahrbuch erschienen sie regelmäßig und wesentlich häufiger. Was darin stand? Nachrichten aus den Gremien und Sek-
tionen, Berichte über Wege, Hütten und Verkehrsverbindungen, neue Ausrüstungsgegenstände, Aufsätze über Neutouren – kurz: das laufende Leben im Verein. Mit dem Alpinismusboom wuchs der Takt, und 1885 wurden Mitglieder bereits alle zwei Wochen mit Neuigkeiten versorgt.
Die „Mittheilungen“ brachten damit eine neue Nähe: weniger Monument, mehr Alltag; weniger Archivband, mehr Community. Und sie öffneten die Bühne für grundsätzliche Debatten – etwa über Sinn und Zweck des Alpinismus – ebenso wie für praktische Hinweise vom Führerwesen bis zur Tourenplanung.
Nach dem Ersten Weltkrieg waren Papier und Geld knapp. 1921 traf der Verein eine kluge redaktionelle Entscheidung: Trockene Vereinsangelegenheiten – Wah-


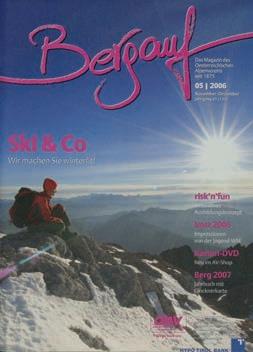
len, Finanzen, Protokolle – wurden in ein eigenes Nachrichtenblatt für die Sektionen ausgelagert. Ergebnis: In den „Mittheilungen“ entstand Platz für längere, essayistische Texte und Reportagen. Parallel änderte sich die Szene: Die Pionierphase mit ständig neuen Erstbegehungen flaute ab; das klassische Bergführerwesen wurde zunehmend vom führerlosen Bergsteigen ergänzt. So rückten nicht mehr nur Route und Gipfel in den Fokus, sondern auch Haltung, Ethik und das Erleben. Die „Mittheilungen“ wurden erzählerischer –ohne ihre Service-DNA zu verlieren.
Stil mit Understatement
Vieles liest sich heute bemerkenswert zurückhaltend. Selbst alpinistische Sensationen – man denke an die Erstbesteigung
der Eiger-Nordwand – wurden bisweilen sachlich und knapp vermeldet. Keine Sensationslust, keine Überhöhung, eher leise Anerkennung: Leistung, Ernst –und Bescheidenheit. Dieses Understatement prägte den Ton und verlieh Glaubwürdigkeit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte der Neustart: 1946 erschienen die „Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins“ nach einem Jahr Pause wieder – getragen vom Idealismus einer Generation, die den Verein erneuerte. In den 1950erJahren hielt die Fotografie Einzug: Aus Textwüsten wurden bildstarke Doppelseiten, aus reinen Nachrichten wurde Lesefreude. Das Magazin wirkte moderner, ohne seine Aufgabe zu vergessen: informieren, verbinden, Verantwortung sichtbar machen.
¡ nfo
Unter www.alpenverein.at/ bergauf finden interessierte Leser*innen ältere Bergauf-Ausgaben im PDFFormat und jüngere zum online Durchblättern.


Heute: Bergauf als Identitätsstifter
Aus der Linie der „Mittheilungen“ entwickelte sich über Jahrzehnte das, was wir heute kennen: Bergauf – ein Magazin, das Wissen, Service und Haltung vereint. Es zeigt, wie der Alpenverein sich selbst erzählt: mit Fakten und Gefühl, mit Nähe zur Basis und Respekt vor der Natur. Vom Jahrbuch (seit 1863) als wissenschaftlicher Säule bis zu den „Mittheilungen“ (seit 1875) als Stimme des Alltags reicht ein doppeltes Fundament, auf dem Bergauf heute steht. Fazit: Vom Amtsblatt zum Magazin –das ist mehr als ein redaktioneller Wandel. Es ist der Werdegang einer Gemeinschaft, die sich immer wieder neu erfindet und ihrem Kern treu bleibt: Berge erleben, Wissen teilen, Natur schützen. —

Ein Blick hinter die Kulissen einer Postkartenlandschaft. Aus der Sammlung des AlpenvereinMuseums, Teil 62
t ON hOL ze R
Schnee, soweit das Auge reicht. Das Dach der Almhütte trägt schwer unter der Last der Schneemassen. Im Querschnitt lassen sich die einzelnen Schichten der weißen Pracht, die sich im Laufe des Winters angehäuft haben, gut erkennen. Die letzte Schneeschicht scheint noch nicht allzu lange zu liegen. Die Schneeoberfläche ist nämlich fein pulverig, die Eiskristalle glänzen im Sonnenlicht. Ein sorgsam komponiertes Landschaftsbild liegt vor uns. Im Vordergrund sehen wir eine Almhütte und angeschnitten das Dach einer zweiten Hütte. Dahinter erstreckt sich ein faszinierendes Winterpanorama. Gipfel reiht sich an Gipfel, Grat an Grat. Unberührt ist diese winterliche Bergszene freilich nicht, im Schnee sind Skispuren zu erkennen und auch im Vordergrund ist der Schnee eingedrückt. Zeichnen sich im Neuschnee die Umrisse einer menschlichen Figur ab, die sich rückwärts in den Schnee hat fallen lassen? Eher nicht, denn der „Kopf“ erscheint dafür etwas zu markant.
Glasplatte als Negativ
Die Aufnahme entstand Ende Februar 1933 auf der Wurmeggalm im Tiroler Alpbachtal. Ein paar kleine Eiszapfen am Dach des angeschnittenen Hüttendachs weisen darauf hin, dass es untertags schon recht warm gewesen sein muss, sodass der Schnee zeitweise ins Schmelzen kam. Und noch ein kleines Detail gibt das Foto preis. Wenn wir die „ausgefransten“ Ränder des Negativs, das ebenfalls überliefert ist, genauer in Augenschein nehmen, wird klar, dass als fotografisches Trägermaterial für dieses Foto eine Glasplatte verwendet wurde. Die lichtsensible Emulsion ist am Negativ nicht ganz bündig aufgetragen. Die unebenen Ränder sind im vorliegenden schwarzweißen Positivscan deutlich sichtbar. In der Zwischenkriegszeit arbeiteten vor allem geübte Amateurfotograf*innen, die Technik und Material beherrschten, mit Glasplatten. Die anspruchsloseren Knipser hatten in diesen Jahren häufig bereits Rollfilme im Gepäck.
Fotograf und Lithograf
Aus den Angaben im Archiv des Alpenvereins, in dem diese Aufnahme aufbe-
Ein paar kleine Eiszapfen am Dach des angeschnittenen Hüttendachs weisen darauf hin, dass es untertags schon recht warm gewesen sein muss, sodass der Schnee zeitweise ins Schmelzen kam.
wahrt wird, geht hervor, dass das Foto von Emil Schneider (1887–1962) stammt, den wir in dieser Rubrik bereits vorgestellt haben. Er stammte ursprünglich aus Böhmen, war ausgebildeter Lithograf und kam 1911 nach Kufstein, wo er bei der Blechwarenfabrik Pirlo tätig war. Schon kurze Zeit später, 1914, zog er in den Krieg. Der begeisterte Alpinist kehrte nach 1918 nicht mehr in seinen angestammten Beruf zurück, sondern zog nach Innsbruck. Er wurde Angestellter der dortigen Gebietskrankenkasse und begann, seine beiden Leidenschaften, das Bergsteigen und das Fotografieren, zu verbinden – und zum Nebenberuf zu machen. Seine selbst gefertigten Bergansichten vervielfältigte er im eigenen Labor und baute einen kleinen Postkartenverlag auf. Bereits in Kufstein war Emil Schneider den Naturfreunden beigetreten, bald wurde er zum vielbeschäftigten Funktionär (Landeshüttenreferent). Er war zudem viele Jahre lang Mitglied der Photosektion des Vereins.
Griff in den Farbtopf
Doch zurück zu unserem Bild, von dem, wie gesagt, zusätzlich zum Abzug auch das Negativ erhalten ist. Wenn wir dieses genauer betrachten, staunen wir. Der Fotograf und Lithograf Schneider beherrschte den technischen Umgang mit Bildern perfekt. Er hat das Negativ nachträglich farblich sorgsam aufbereitet, damit im Abzug Kontraste und Tonwerte ideal zur Geltung kommen. Die Hütte ist am Negativ mit einem leuchtenden Rotton eingefärbt. Wieso dieser Griff
in den Farbtopf? Weil die fotografische Aufnahme von sehr hellem Schnee in der Kombination mit dem Dunkel der Hütte eine Herausforderung darstellt. Mithilfe des Farbauftrags lassen sich die Helligkeit der Farben und die Wiedergabe der Tonwerte steuern.
Endprodukt: Ansichtskarte
Schneider war sehr daran gelegen, hochwertige Abzüge herzustellen, weil er seine Motive auch als Postkarten vervielfältigte und verkaufte. Dafür brauchte er sowohl ästhetisch ansprechende Inszenierungen als auch technisch perfekt komponierte Szenen, also stimmige und sorgsam abgestimmte Tonungen von Schnee, Landschaft und Himmel.
Im Archiv des Alpenvereines ist neben dem Negativ auch eine Ansichtskarte mit dem vorliegenden Motiv überliefert. Die Spuren der farblichen Aufbereitung sind nicht mehr zu erkennen. Niemand ahnt, dass das Ausgangsmaterial, nämlich das Negativ, derart stark bearbeitet wurde. Welche Auflage die Ansichtskarte im Handel erreichte, wissen wir nicht. Dazu sind keine Aufzeichnungen überliefert. Aber wer weiß, vielleicht hat jemand noch ein Exemplar zu Hause.
Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker, Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift „Fotogeschichte“, er lebt in Wien. www.anton-holzer.at
m ärz/aP ri L / m ai
Die kommende Ausgabe des Bergauf nimmt uns mit auf eine Reise zu den heimischen Gletschern: Der jährliche Gletscherbericht des Gletschermessdienstes des Österreichischen Alpenvereins gewährt tiefe Einblicke in das Ausmaß der Gletscherschmelze und legt offen, wie es um die „ewigen“ Eisriesen inzwischen steht. GeRhaRd LieB und aNdReaS KeLLeReRPiRKLBaUeR vom Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz leiten den Gletschermessdienst des Alpenvereins. Gemeinsam mit über 20 Ehrenamtlichen vermessen und dokumentieren sie jedes Jahr die Veränderungen. Ein wissenschaftlicher Schatz mit langer Tradition: Bereits seit 1891 sammelt der Alpenverein diese Daten. Wie gewohnt finden sich im Magazin außerdem praktische BergsportTipps, Naturwissen, Hüttenfakten – und vieles mehr.
Bergauf #1.2026 erscheint Mitte März.
Umgezogen? Bergauf digital lesen oder Beitragsvorschreibung per E-Mail?
Halte deine Daten auf mein.alpenverein.at ganz einfach aktuell!
Rät S e L haft Wo sind wir hier? Welchen Gebirgssee suchen wir hier? Bergauf verlost fünf Karten unter den richtigen Antworten: Einfach bis 20.12.2025 E-Mail an gewinnspiel@alpenverein.at schicken!
Alle Infos zum Gewinnspiel unter t1p.de/bergauf-raetsel


Bergauf. Mitgliedermagazin des Österreichischen Alpenvereins #3.2025, Jg. 80 (150)
Herausgeber und Medieninhaber: Österreichischer Alpenverein, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck Tel. +43/512/59547 www.alpenverein.at
ZVR-Zahl: 989190235
Redaktion: Anna Praxmarer, Evelin Stark, redaktion@alpenverein.at
Redaktionsbeirat:
Präsident Wolfgang Schnabl, Generalsekretär Clemens Matt
Design und Gestaltung: himmel. Studio für Design und Kommunikation, www.himmel.co.at
Korrektorat: Christoph Slezak
Druck: Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG
Anzeigenannahme:
Werbeagentur David Schäffler, office@agentur-ds.at Tarife: www.bergauf.biz
Die grundlegende Richtung des ÖAV-Mitgliedermagazins wird durch die Satzung des Österreichischen Alpenvereins bestimmt. Abgedruckte Beiträge geben die Meinung der Verfasser*innen wieder. Für unverlangte Sendungen wird keine Haftung übernommen. Retournierung nur gegen beiliegendes Rückporto. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Adressänderungen bitte bei Ihrer Sektion bekanntgeben bzw. direkt unter mein.alpenverein.at ändern. Beiträge in Bergauf sollen nach Möglichkeit geschlechterneutral formuliert oder die Schreibweise mit dem „Gender Star“ (Autor*in) verwendet werden. Bei Texten, deren Urheberschaft klar gekennzeichnet ist, liegt es in der Freiheit der Autor*innen, zu gendern oder nicht.
Gefördert durch die















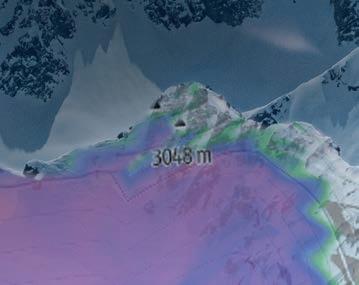

Der ATHM-Layer von Skitourenguru zeigt in 2D/3D, wo das Gelände eine Lawinenauslösung begünstigt. Finde und plane deine Tour mit dem Tourenportal und den Tools von alpenverein aktiv.com










Transparent: kein Lawinengelände Lawinen, die von Wintersportlern ausgelöst werden, sind in diesem Gelände sehr unwahrscheinlich. Lawinenunfälle durch Spontanlawinen sind jedoch immer noch möglich.
Grün: atypisches Lawinengelände Lawinen, die von Wintersportlern ausgelöst werden, sind in diesem Gelände atypisch
Blau: typisches Lawinengelände Lawinen, die von Wintersportlern ausgelöst werden, sind in diesem Gelände typisch
Rot: sehr typisches Lawinengelände Lawinen, die von Wintersportlern ausgelöst werden, sind in diesem Gelände sehr typisch




FLOWLINE PRO 2L JACKE
HINFALLEN, AUFSTEHEN – IMMER IM FLOW BLEIBEN.