

Information
Alle Informationen rund um die Talks, Masterclasses and Workshops finden Sie auf hrffb.de
All information on talks, masterclasses and workshops at hrffb.de/en
VERANSTALTUNGSORTE / VENUES
ACUDKINO
Veteranenstraße 21
10119 Berlin (Mitte)
→ U 8 Rosenthaler Platz
→ Tram 12, M 1, M 5, M 8 Brunnenstraße / Invalidenstraße
CITY KINO WEDDING
Müllerstraße 74
13349 Berlin (Wedding)
→ U6 Rehberge
COLOSSEUM
Schönhauser Allee 123
10437 Berlin (Prenzlauer Berg)
→ S Schönhauser Allee
DOKUMENTATIONSZENTRUM FLUCHT, VERTREIBUNG, VERSÖHNUNG
Stresemannstraße 90
10963 Berlin (Kreuzberg)
→ S Anhalter Bahnhof
HACKESCHE HÖFE KINO
Rosenthaler Straße 40–41
10178 Berlin (Mitte)
→ S Hackescher Markt
KANT KINO
Kantstraße 54
10627 Berlin (Charlottenburg)
→ S/U 7 Wilmersdorfer Straße
SPUTNIK KINO AM SÜDSTERN
Hasenheide 54
10967 Berlin (Kreuzberg)
→ U 7 Südstern
ZEISS-GROSSPLANETARIUM
Prenzlauer Allee 80
10405 Berlin (Prenzlauer Berg)
→ S Prenzlauer Allee
SELECTED FILMS AVAILABLE ONLINE DURING THE FESTIVAL
TICKETS hrffb.de/tickets
KINO / CINEMA: 10,00 EUR
ONLINE: 5,50 EUR
PÄSSE / PASSES hrffb.de/passes
UNLIMITED: 90 EUR
5 FILMS: 40 EUR
STREAMING Ausgewählte Filme streamen auf hrffb.de/streaming
Stream selected films on hrffb.de/streaming
Alle Filme werden in der Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt. All films will be screened in the original version with English subtitles.
IMPRESSUM
Herausgeber: Aktion gegen den Hunger gGmbH, Geschäftsführung: Jan Sebastian Friedrich-Rust (CEO), Dr. Helene Mutschler | Wallstraße 15a | 10179 Berlin | info@hrffb.de | www.hrffb.de | V.i.S.d.P: Anna Ramskogler-Witt, Vassilios Saroglou | Redaktionelle Leitung: Anna Ramskogler-Witt, Jana Sepehr | Mit Beiträgen von: Lydia Band, Katja Berlin, Jenny Brunner, Kateryna Bystrytska, Pia Grohmann, Simon Käsbach, Yasmin Khaleghian, Antonia Kruse (Filmtexte), Hila Limar, Javier Luque, Gianna Main, Marvin McNeil, Abdalle Ahmed Mumin, Dr. Helene Mutschler, Manfred Nowak, Akindare Okunola, Lisa Paping, Anna Ramskogler-Witt, Josephine Schmidt, Jana Sepehr, Hugo Slim, Anna von Gall, Dr. Gunda Windmüller, Kilian Wolter | Lektorat: André Gabriel, Antonia Kruse, Lydia J. White | Bei allen Film- und Ausstellungsfotos liegen die Bildrechte bei den Filmemacher*innen bzw. Künstler*innen |
Gestaltung: Veronika Neubauer | Druck: Pinguin Druck | Printed in Germany
78 Closing Film Mutige Geschichten des Widerstands und der Hoffnung / The courageous tale of resistance and hope in ‘Bread and Roses’


80 Interview mit Wolfgang Thierse: „Es sind gefährliche Zeiten“ / Interview with Wolfgang Thierse: ‘These are dangerous times’

82 Wettbewerb / Competition
83 Filmprogramm / Film program
93 Förderer und Partner / Sponsors and Partners
Cover: Filmstill aus „Twice Colonized“ / Film still from ‘Twice Colonized’

Wir müssen den Mut aufbringen, hinzuschauen
Seit mehr als einem halben Jahrzehnt öffnen wir alljährlich im Herbst unsere Türen und Herzen für jene außergewöhnlichen Menschen, deren unermüdlicher Einsatz für eine bessere Welt uns mit tiefer Bewunderung erfüllt. Ihr Mut, ihre Standhaftigkeit und ihr unablässiger Kampf für die Gerechtigkeit haben uns dazu inspiriert, das Festival in diesem Jahr unter das Motto „The Good Fight“ zu stellen.
Mit 42 international ausgezeichneten Filmen und einem vielfältigen Rahmenprogramm, das Talks, Masterclasses und Workshops umfasst, möchten wir Sie inspirieren und Ihnen einen vertiefenden Einblick in Themen geben, die allzu oft in der überwältigenden Flut täglicher Nachrichten untergehen. Unser Wunsch ist es, dass die hier vorgestellten Filme und Diskussionen eine Oase der Reflexion, des Lernens und des Handelns inmitten des oft stürmischen Alltags bilden.
Einen besonderen Fokus legen wir in diesem Jahr auf den Kampf indigener Aktivist*innen. Trotz Landraub, versuchter Auslöschung ihrer kulturellen Identität, Massenmorden und Genoziden haben sie ihre Stimmen nie verloren. Sie kämpfen weiterhin unermüdlich für ihre Rechte und die Anerkennung geschehenen Unrechts. Ihre Geschichten sind eine dringende Erinnerung daran, dass unser Kampf für Menschenrechte niemals aufhören darf – und wir der Welt gegenüber Verantwortung tragen.
Zu dieser Verantwortung gehört es auch, hinzuschauen, wenn Unrecht passiert, laut zu sein und solidarisch mit denjenigen, die in weniger sicheren Ländern leben als wir. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, wir haben vergessen, was Krieg tatsächlich bedeutet. Krieg ist grausam, schmerzhaft und zerstörerisch. Bilder des Krieges sind oft kaum auszuhalten – deshalb schauen wir weg, verdrängen, ignorieren. Unser diesjähriger Eröffnungsfilm „20 Days in
Mariupol“ schaut hin und zeigt einen ungeschönten Blick auf das wahre Gesicht des Krieges. Mstyslav Chernovs Kamera flieht nicht vor der brutalen Realität, sondern fängt sie für uns ein – in Bildern, die fast unerträglich sind. Wenn die Menschen diese Realität überleben können, können wir zumindest den Mut aufbringen, hinzusehen.
Gemeinsam mit meinen Kolleg*innen und unseren Kooperationspartnern möchte ich Sie herzlich einladen, sich auf diese spannende Reise zu begeben und sich von den erzählten Geschichten sowie dem unerschütterlichen Willen der Protagonist*innen und Aktivist*innen inspirieren zu lassen. ¶

EN We have to muster the courage to open our eyes
For more than half a decade now, we have been opening our doors and hearts each autumn to the exceptional individuals whose tireless efforts to create a better world fill us with deep admiration. Their courage, their steadfastness and their relentless fight for justice were the inspiration for this year’s festival theme, ‘The Good Fight’.
Featuring forty-two internationally acclaimed films and a diverse program that includes talks, masterclasses and workshops, our aim is to inspire you and provide deeper insights into topics that often get lost in the overwhelming flood of daily news. Our hope is that the films and discussions presented here will provide an oasis for reflection, learning and taking action amidst the chaotic routines of everyday life.
This year, we are placing a special focus on the struggles of Indigenous activists. Despite land grabs, attempted erasures of their cultural identities, mass killings and genocides, they have never lost their voices. They continue to fight tirelessly for their rights and for the recognition of past injustices. Their stories
are an urgent reminder that our fight for human rights can never cease – and that we shoulder a responsibility to the world.
Part of this responsibility is to bear witness when injustices take place, to speak out and to stand in solidarity with those who live in less secure countries than our own. At the same time, I sometimes feel that we have forgotten what war truly means. War is cruel, painful and destructive. Images of war are often unbearable – which is why we look away, suppress, ignore. This year’s opening film, ‘20 Days in Mariupol’, takes a square look at war and presents an unfiltered view of its true face. Mstyslav Chernov’s camera does not shy away from the brutal reality and captures it for us instead – in images that are difficult to endure. If people can survive this reality, we can at least summon the courage to open our eyes to it.
Together with my my colleagues and our partners, I would like to warmly invite you to embark on this exciting journey with us and allow yourself to be inspired by these stories and the unwavering determination of their protagonists and activists. ¶

 Filmstill aus „20 Days in Mariupol“ / Film still from ‘20 Days in Mariupol’
© Mstyslav Chernov
Filmstill aus „20 Days in Mariupol“ / Film still from ‘20 Days in Mariupol’
© Mstyslav Chernov
Die Brutalität des Krieges aufdecken
„20 Tage in Mariupol“ zeigt die Belagerung der strategisch wichtigen Hafenstadt der Ukraine während der russischen Invasion hautnah. Der Dokumentarfilm des Pulitzer-Preisträgers Mstyslav Chernov zeugt von der rohen Brutalität und erschütternden Unmenschlichkeit des Krieges.
Mstyslav Chernovs Kamera filmt die schonungslose Realität: schwangere Frauen, die aus zerbombten Entbindungskliniken fliehen, behelfsmäßige Kindergräber, Zivilist*innen, die verzweifelt ums Überleben kämpfen. Gemeinsam mit seinen Kolleg*innen von Associated Press, dem Fotografen Evgeniy Maloletka und der Produzentin Vasilisa Stepanenko, den letzten in der Stadt verbliebenen internationalen Journalist*innen, stellt sich Chernov der überwältigenden Aufgabe, diese erschütternden Szenen nicht nur zu dokumentieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie die Weltöffentlichkeit erreichen.
Dieser Film ist nicht nur ein Dokumentarfilm, sondern auch ein Appell an das kollektive Gewissen der Menschheit – eine schmerzhafte, intime Auseinandersetzung mit der erschreckenden Gleichzeitigkeit von der Banalität und Grausamkeit des Krieges. Chernov gewährt einen seltenen Einblick in seine persönlichen Erlebnisse während der Dreharbeiten. An dieser Stelle können Sie einen Auszug aus dem Statement lesen – der vollständige Text steht online zur Verfügung.
Auszug aus dem Director’s Statement zu „20 Tage in Mariupol“
Die Russen jagten uns. Sie hatten eine Liste mit Namen, darunter auch unsere, und sie kamen immer näher.
Wir waren die einzigen internationalen Journalist*innen, die sich noch in der ukrainischen Stadt Mariupol aufhielten, und wir hatten seit mehr als zwei Wochen dokumentiert, wie die russischen Truppen die Stadt belagerten. Wir berichteten aus dem Krankenhaus, als die bewaffneten Männer begannen, die Gänge zu durchstreifen. Die Chirurg*innen gaben uns weiße Kittel zur Tarnung.
Plötzlich, im Morgengrauen, stürmten ein Dutzend Soldaten herein: „Wo sind die Journalisten, verdammt noch mal?“ Ich schaute auf ihre blauen Armbinden, die für die Ukraine standen, und versuchte herauszufinden, ob es sich um verkleidete Russen handelte. Ich trat vor und gab mich zu erkennen. „Wir sind hier, um euch rauszuholen“, sagten sie.
Die Wände des Operationssaals bebten unter dem Artillerie- und Maschinengewehrfeuer von draußen und es schien sicherer zu sein, drinnen zu bleiben. Aber die ukrainischen Soldat*innen hatten den Befehl, uns mitzunehmen.
Wir rannten auf die Straße und ließen die Menschen um uns herum zurück: die Ärzt*innen, die uns Schutz gewährt hatten, die schwangeren Frauen, die beschossen worden waren, und die Menschen, die in den Fluren schliefen, weil sie nirgendwo anders hingehen konnten. Sie alle zurückzulassen, fühlte sich schrecklich an. Neun Minuten, vielleicht zehn, eine Ewigkeit zwischen Straßen und zerbombten Wohnhäusern. Als in unserer Nähe Granaten einschlugen, ließen wir uns auf den Boden fallen. Die Zeit spannte sich von einer Granate zur nächsten, unsere Körper verkrampften sich, wir hielten den Atem an. Eine Schockwelle nach der anderen erschütterte meine Brust und meine Hände wurden kalt. Wir erreichten einen Eingang und wurden mit gepanzerten Fahrzeugen in einen dunklen Keller gebracht. Erst dort erfuhren wir von einem Polizisten, warum die Ukrainer*innen das Leben von Soldat*innen riskiert hatten, um uns aus dem Krankenhaus zu holen.
„Wenn sie euch erwischen, werden sie euch vor die Kamera zerren und euch zwingen zu sagen, dass alles, was ihr gefilmt habt, eine Lüge ist“, sagte er. „All eure Bemühungen und alles, was ihr in Mariupol getan habt, wird umsonst gewesen sein.“ Der Polizist, der uns einst angefleht hatte, der Welt seine sterbende Stadt zu zei-
FILMTIPP
20 DAYS IN MARIUPOL
Durch ein Team ukrainischer Journalist*innen wurde die Welt Zeuge der brutalen russischen Invasion. → Seite 88 EN It was through a team of Ukrainian journalists that the world witnessed the brutality of the Russian invasion.
→ Page 88
gen, wollte nun, dass wir gehen. Er drängte uns zu den Tausenden von kaputten Autos, in denen Menschen Mariupol verlassen wollten. Es war der 15. März. Wir wussten nicht, ob wir es lebend schaffen würden. ¶
Mstyslav ChernovEN Revealing the Brutality of War
‘20 Days in Mariupol’ presents an unparalleled close-up of the siege carried out on the strategic Ukrainian port city during the Russian invasion. Crafted by Pulitzer-Prize-winner Mstyslav Chernov, the documentary is an unflinching testament to the raw brutality and haunting inhumanity of war.
Mstyslav Chernov’s camera reveals relentless realities: pregnant women escaping bombed-out maternity hospitals, civilians scraping survival together out of despair, children’s makeshift graves. Along with his AP colleagues, photographer Evgeniy Maloletka and producer Vasilisa Stepanenko – the last international journalists to remain in the city –Chernov grapples with the overwhelming task of not just documenting these harrowing scenes but also ensuring that the world gets to see them.
This film is both a documentary and an appeal to humanity’s collective conscience – a painful, intimate journey into the terrifying duality of war’s banality and savagery. In his director’s statement, Chernov shares a rare glimpse into what he personally experienced during filming. Explore an excerpt here or delve into the full account online.
Excerpt from the director’s statement on ‘20 Days in Mariupol’
The Russians were hunting us down. They had a list of names, including ours, and they were closing in.
We were the only international journalists left in the Ukrainian city of Mariupol, and we had been documenting its siege by Russian troops for

more than two weeks. We were reporting inside the hospital when gunmen began stalking the corridors. Surgeons gave us white scrubs to wear as camouflage.
Suddenly, at dawn, a dozen soldiers burst in: ‘Where are the journalists, for fuck’s sake?’ I looked at their armbands, blue for Ukraine, and tried to calculate the odds of them being Russians in disguise. I stepped forward to identify myself. ‘We’re here to get you out,’ they said.
The walls of the surgery were shaking from the artillery and machine gun fire outside, and it seemed safer to stay inside. But the Ukrainian soldiers were under orders to take us with them.
We ran into the street, abandoning the doctors who had sheltered us, the pregnant women who had been shelled and the people who were sleeping in the hallways because they had nowhere else to go. I felt terrible leaving them all behind. Nine minutes, maybe ten, an eternity through roads and bombed-out apartment buildings. As shells crashed nearby, we dropped to the ground. Time was measured from one shell to the next, our bodies tense and breath held. Shockwave after shockwave jolted my chest, and my hands went cold. We reached an entryway, and armoured cars whisked us to a darkened basement. Only then did we learn from a policeman why the Ukrainians had risked the lives of soldiers to extract us from the hospital.
‘If they catch you, they will get you on camera and they will make you say that everything you filmed is a lie,’ he said. ‘All your efforts and everything you have done in Mariupol will have been in vain.’ The officer who had once begged us to show the world his dying city was now pleading with us to go. He nudged us towards the thousands of battered cars preparing to leave Mariupol. It was 15 March. We had no idea if we would make it out alive.¶
Mstyslav Chernov
TALKING HUMANITY
AN VORDERSTER
FRONT: DIE ROLLE
VON JOURNALIST*INNEN IN KRIEG UND KRISEN
EN ON THE FRONTLINES: JOURNALISM’S ESSENTIAL ROLE IN WAR AND CRISES
→ 12. Okt., 18:30 Uhr
→ Dokumentationszentrum
→ Im Anschluss / followed by:
20 Days in Mariupol (Seite 88 / page 88)
→ Mehr Informationen
auf Seite 26 / more information on page 26
Mstyslav Chernov
Mstyslav Chernov wurde 1985 im Osten der Ukraine geboren. Seit jeher interessiert er sich für die Suche nach der Wahrheit und nutzt dafür verschiedene Formen. Furchtlos erzählt er seine Geschichte und widmet sich der Aufgabe, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Chernovs Antrieb ist es, wie er in einem Artikel schreibt, „der Welt die Verwüstung aus erster Hand zu zeigen“. So hat er in über 50 Ländern der Welt über die Erfolge, Kämpfe und Leiden der Menschheit berichtet.
Chernovs Arbeit ist unvoreingenommen. Seine Fotos, Videos und Texte erkunden die Vielfalt der menschlichen Facetten – das Schöne und das Tragische, das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche. Seine Arbeiten für The Associated Press wurden weltweit in den renommiertesten Medien veröffentlicht.
Chernovs Wurzeln liegen in Charkiw, einer nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Stadt. Hier wurde Chernov schon als Jugendlicher mit der harten Realität und ihren Konflikten konfrontiert. Der Umgang mit der Waffe war Teil seiner Schulausbildung. „Das erschien mir sinnlos. Ich dachte, die Ukraine sei von Freunden umgeben“, sagt Chernov.
Sein Weg hat ihn von den lokalen ukrainischen Medien auf die internationale Bühne geführt. Seine ersten Beiträge zu globalen Themen befassten sich mit sozialen und gesundheitlichen Problemen in der Ukraine, Myanmar und Kambodscha.
Seine Arbeit erregte Aufmerksamkeit und bald arbeitete er mit den Vereinten Nationen, dem Internationalen Roten Kreuz und anderen renommierten Nichtregierungsorganisationen zusammen. Er wurde zur Stimme der Stimmlosen, zu einem Vermittler ihrer Geschichten in die Welt.
Seit er für The Associated Press arbeitet, hat er aus dem Zentrum von Konflikten berichtet, von der europäischen Migrationskrise bis hin zu Kriegen in Syrien und Afghanistan. Aber seine ersten und vielleicht bewegendsten Einsätze waren die in der Nähe seiner Heimat, beginnend im Jahr 2014 mit dem russischen
Abschuss von Flug MH-17. Als der Krieg immer näher an seine geliebten Städte Charkiw und Mariupol rückte, fuhr er mit seinen langjährigen Kolleg*innen, dem Fotografen Evgeniy Maloletka und der Produzentin Vasilisa Stepanenko, in die Nacht hinaus. „Aber nur wenige Menschen glaubten an einen Krieg, und als die meisten ihren Irrtum erkannten, war es schon zu spät“, erzählt er.
Sein Mut und sein Engagement trugen Früchte: Für ihre journalistische Arbeit in Mariupol bekamen Chernov und seine Kolleg*innen Maloletka und Stepanenko den renommierten Pulitzer-Preis in der Kategorie „Dienst an der Öffentlichkeit“ verliehen. Heute setzt Chernov Chernov seine Suche nach der Wahrheit fort und ist noch immer entschlossen, „der Welt die Verwüstung aus erster Hand“ zu zeigen. ¶
EN Born in Eastern Ukraine in 1985, Mstyslav Chernov has always been drawn to the truth, whatever form it takes. A fearless storyteller, he is dedicated to shedding light on the truth hidden in the shadows. Chernov once shared in an article that he is driven to ‘show the world the devastation firsthand’. And show it he has, in over fifty countries across the globe, bearing witness to humanity’s triumphs, struggles and sorrows.
Chernov’s work does not discriminate. Through photos, videos and text, he has explored many facets of humanity – the beautiful and the tragic, the ordinary and the extraordinary. His work for the Associated Press has been reported across the globe and has appeared in the world’s most prominent media outlets.
Chernov’s roots are in Kharkiv, a city just twenty miles from the Russian border. It was here, as a teenager, that Chernov was first introduced to the harsh realities of conflict, learning to handle a gun as part of the school curriculum. ‘It seemed pointless. Ukraine, I reasoned, was surrounded by friends,’ he recalls.
Chernov’s journey has taken him from local Ukrainian media outlets to the international stage. His early works on social and healthcare issues in Ukraine, Myanmar and Cambodia were the first steps he took into global storytelling.
His work received attention, and he soon found himself working with the United Nations, the International Red Cross and other esteemed NGOs. He became a voice for the voiceless, someone who conveyed their stories to the world. Since joining the Associated Press, he has reported from the heart of conflicts – from the European migration crisis to wars in Syria and Afghanistan. But his first and perhaps most poignant assignments were the ones closest to home, beginning in 2014 with the Russian downing of flight MH-17. As the war moved closer to his beloved city of Kharkiv and the city of Mariupol, he drove into the night with long-time colleague and photographer Evgeniy Maloletka and field producer Vasilisa Stepanenko. ‘But few people believed a war was coming, and by the time most realised their mistake, it was too late,’ he shares, his words painting a grim picture.
His courage and commitment have borne fruit: Together with his colleagues Maloletka, Stepanenko and Lori Hinnant, Chernov received the prestigious Pulitzer Prize for Public Service. Today, Mstyslav Chernov is continuing on his quest for truth, determined, as always, to show the world ‘the devastation firsthand.’ ¶
 Anna Ramskogler-Witt, Jana Sepehr
Anna Ramskogler-Witt, Jana Sepehr
Warum wir weiterkämpfen müssen
An manchen Tagen ist der Blick in die Nachrichten zum Verzweifeln: Eine Katastrophe scheint die nächste zu jagen. Krieg, Gewalt und Zerstörung verursachen unvorstellbares Leid. Die Polarisierung der Gesellschaft führt zu Hass und Ausgrenzung. Doch in einer Welt im Umbruch ist Resignation keine Option! Wir können Ungerechtigkeit und Ungleichheit nicht einfach hinnehmen. Wir sollten niemals die Augen verschließen, wenn Menschenrechte systematisch verletzt werden. Und wir dürfen nicht akzeptieren, dass die Klimakrise bereits heute Millionen Menschen die Lebensgrundlagen raubt und weiterhin jeder zehnte Mensch hungrig zu Bett geht.

„Es erscheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist“, sagte einst Nelson Mandela. Mit dem Human Rights Film Festival Berlin legen wir dieses Jahr unseren Fokus auf die Geschichten von Menschen, die sich trotz aller Widrigkeiten für eine bessere Welt einsetzen. Bei der Sichtung unserer diesjährigen Filmauswahl musste ich oft an die Mitarbeitenden von Aktion gegen den Hunger denken, die in 55 Ländern täglich beweisen, dass jeder einzelne Mensch einen Unterschied machen kann. Sie arbeiten teilweise unter schwierigsten Bedingungen in Krisenregionen, in die sich kaum noch jemand traut, um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen – und riskieren dabei ihr eigenes Leben. Sie behandeln mangelernährte Kinder und unterstützen Familien dabei, ein neues Leben aufzubauen.
Lassen Sie sich von unserer diesjährigen Filmauswahl bewegen: Eindringliche Bilder und unverfälschte Stimmen machen auf Krisen aufmerksam, die Millionen Menschen ihre Lebensgrundlagen rauben, wie in Äthiopien, im Jemen oder in der Ukraine. Wir zeigen Geschichten von Menschen, die Missstände und Menschenrechtsverletzungen aufdecken und für ihre Rechte
kämpfen. Was uns weit weg erscheint, kann uns an einem Filmabend erstaunlich nahekommen. Dabei zeigen wir nicht nur Krisen und Leid, sondern auch viele Geschichten voller Hoffnung. Geschichten, die zeigen, dass es sich lohnt, für das Gute zu kämpfen. Geschichten, die uns inspirieren, es ebenso zu tun. ¶
EN Why we have to keep fighting the Good Fight
Some days, looking at the news is frustrating: one catastrophe seems to chase the next. War, violence and destruction lead to unimaginable suffering. The polarization of society leads to hatred and exclusion. But in a world in upheaval, resignation is not an option! We cannot simply accept injustice and inequality. We should never close our eyes when human rights are being systematically violated. And we cannot accept that the climate crisis is already robbing millions of their livelihoods and that one in ten people will continue to go to bed hungry.
‘It always seems impossible until it’s done,’ Nelson Mandela once said. This year, we at the Human Rights Film Festival Berlin are focusing on the stories of people who, against all odds, are working to make the world a better place. While viewing our selection of films this year, I often found myself thinking of the staff at Action Against Hunger,
who, in 55 countries, are proving every day that every single person can make a difference. They sometimes work under the most difficult conditions in crisis regions where hardly anyone dares to help people in need – and risk their own lives in the process. They treat malnourished children and help families rebuild their lives.
This year’s selection of films is sure to move you: powerful images and genuine voices draw attention to crises that rob millions of their livelihoods in places like Ethiopia, Yemen and Ukraine. We are showing the stories of people who expose abuses and human rights violations, and fight for their rights. What seems far away can come surprisingly close to us during a film screening. We present not only crises and suffering but also many stories full of hope. Stories that show that the good is worth fighting for. Stories that inspire us to do the same. ¶
Über Menschheit und Menschlichkeit
Die Stand-up Künstlerin und Aktivistin Enissa Amani ist die Schirmfrau des diesjährigen Human Rights Film Festival Berlin. Im Interview spricht sie über Freiheit, die Macht von Dokumentarfilmen und Humor.
Was bedeutet Freiheit für Sie?
Enissa Amani: Freiheit ist die Grundidee der Schöpfung. Freiheit steht jedem Leben auf dieser Erde zu, und natürlich gibt’s da noch diesen wunderschönen Satz von Rosa Luxemburg: „Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden“. Freiheit bedeutet auch, die Freiheit des anderen zu verteidigen, der andere Ideen hat, solange sie im Rahmen der Menschenrechte und der Verfassung liegen.
Als Schirmfrau des Human Rights Film Festival Berlin haben Sie eine wichtige Rolle in der Förderung von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Was hat Sie dazu motiviert, sich für diese Themen zu engagieren?
Amani: Ich bin die Tochter zweier Menschenrechtler, die ihr Leben diesen Themen gewidmet haben. Ich brauche keine besondere Motivation dafür, ich glaube, es ist die Pflicht eines jeden Menschen, sich für das Leben, die Menschheit und das Gerechte einzusetzen.

Welche Rolle spielen Filmfestivals wie das Human Rights Film Festival Berlin Ihrer Meinung nach in der Förderung von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit?
Amani: Filme sind eine wundervolle Erfindung der menschlichen Kultur. Sie visualisieren uns, spiegeln uns, inspirieren uns. Ein Film gibt dir die Möglichkeit, in eine Welt einzutauchen, die nicht deine reale Welt ist, aber zu deiner werden kann.
Sie sind wichtig, gerade im Widerstand oder um den Horizont zu erweitern. Filme sind wunderbare Instrumente, um zu malen, wie eine Welt sein könnte oder um zu beweinen, wie sie ist. Filme können so viel in einem bewegen. Ich liebe Filme.
Sie sind in Deutschland für Ihren Humor bekannt. Welchen Beitrag kann Comedy zum gesellschaftlichen Diskurs und sozialen Wandel leisten?
Amani: Mit Humor lässt sich Schmerzliches nicht nur ertragbarer, sondern für andere zugänglicher und verstehbarer machen. Stand-up kann, wie ein Film, in Menschen durch das bloße Zuhören neue Türen öffnen. Ich bin – mehr noch, als ich selbst Stand-uperin bin – ein großer Fan von Stand-up.
Ihre Eltern wurden als Linke politisch verfolgt, Ihr Vater war im Iran vier Jahre lang im Gefängnis und schließlich floh Ihre Familie 1987 aus dem Iran. Wie haben Ihre Eltern mit Ihnen über diese Zeit gesprochen?
Amani: Stetig und immer ohne Filter. Ich kenne ihre Kämpfe und ihre Biografien bis ins Detail. Ich wurde gefüllt mit tausenden Erzählungen aus den traurigen Zeiten, aus den schönen Zeiten, aus den Zeiten, die beides waren. Heute sind mir all diese Geschichten eine so große Quelle der Inspiration für meine Kunst, aber auch für meinen Anspruch an die Menschlichkeit.
Aktivismus spielte somit schon in Ihrer Kindheit eine Rolle. Können Sie sich erinnern, wann Sie sich zum ersten Mal für Menschenrechte eingesetzt haben und wie Sie sich dabei gefühlt haben?
Amani: Viele Demos, vor Konsulaten, dem iranischen, dem amerikanischen, Hungerstreiks meines Vaters, Sitzungen, Organisation, Büchertische, Diskussionen unter Intellektuellen. Es gab keinen Anfang, ich war von Baby an, wie viele andere Babys auch, dabei.
Sie haben immer wieder gesagt, dass Sie daran glauben, dass die Proteste erfolgreich sein werden. Was macht Ihnen Hoffnung?
Amani: Die Menschheit und die Menschlichkeit. ¶
Interview von Jana Sepehr
EN On humanity and humaneness
Stand-up artist Enissa Amani is the honorary patron of this year’s Human Rights Film Festival Berlin. In this interview, she talks about freedom, the power of documentary films and the importance of humour.
What does freedom mean to you?
Enissa Amani: Freedom is the fundamental idea of creation. Freedom belongs to every life on this Earth, and of course, there’s also that beautiful quote from Rosa Luxemburg: ‘Freedom is the freedom of the person who thinks differently.’ Freedom also means defending the freedom of others who have different ideas, as long as they uphold human rights and the constitution.
As the patron of the Human Rights Film Festival Berlin, you play an important role in promoting human rights and social justice. What motivated you to engage in these issues?
Amani: I am the daughter of two human rights activists who dedicated their lives to these issues. I don‘t need any special motivation to do this. I believe it is the duty of every human being to stand up for life, humanity and justice.
In your opinion, what role do film festivals like the Human Rights Film Festival Berlin play in promoting human rights and social justice?
Amani: Films are one of human culture’s wonderful inventions. They visualise us, mirror us, inspire us. A film gives you the opportunity to immerse yourself in a world that is not your real world but that can become your world.
„Filme sind wunderbare Instrumente, um zu malen, wie eine Welt sein könnte oder um zu beweinen, wie sie ist.“
Enissa Amani
Films are important, especially within the context of resistance and in order to expand horizons. Films are wonderful tools that can be used to paint a picture of a world that could be or to mourn one that is. Films can move so much within a person. I love films.
15.10.2023
You are known in Germany for your humour. What role can comedy play in social discourse and social change?
Amani: Humour can be used to make painful things not only more bearable but also more accessible and understandable for others. Stand-up can open new doors in people if they just listen, much like in a film. Even more than I am standup comedian, I am a big fan of stand-up.
Your parents were politically persecuted as leftists: your father spent four years in prison in Iran, and your family eventually fled Iran in 1987. How did your parents talk to you about that time?
Amani: Constantly and never with any filter. I know their struggles and their biographies in detail. I was filled with thousands of stories of the sad times, of the beautiful times, of the times that were both. Today, all these stories are such a great source of inspiration for my art but also for my demand for humanity.
Activism played a role in your childhood. Can you remember when you first became involved in human rights and how you felt at the time?
Amani: Many protests, in front of consulates, the Iranian consulate, the American consulate, hunger strikes by my father, meetings, organising, book tables, discussions among intellectuals. There was no beginning; I was there from infancy, as were many other babies.
You have often said that you believe the protests will be successful. What gives you hope?
Amani: Humanity and humaneness. ¶
Interview by Jana Sepehr‘Films are wonderful tools that can be used to paint a picture of a world that could be or to mourn one that is.’
Enissa Amani
der Kugel
Mutlus Familie ist stolz. Gerade einmal 19 Jahre alt ist die Kurdin aus der türkischen Provinz Diyarbakır, als sie kurz vor dem Einzug in das Finale eines landesweiten Gesangswettbewerbs steht. Die Medien feiern die junge Frau, deren Name Programm zu sein scheint: Mutlu bedeutet glücklich auf Türkisch.
Heute guckt Mutlu bedrückt auf die Aufnahmen der TV-Show. „Ich habe mein eigenes Klagelied gesungen“, erinnert sie sich in dem Dokumentarfilm „My Name Is Happy“ (türkisch „Benim Adım Mutlu“) an das kurdische Volkslied, das ihr 2015 zum Einzug ins Finale verholfen hat. Sie steckte gerade in den Vorbereitungen für ihren nächsten Auftritt, als ihr ein Mann in den Kopf schoss – weil sie zuvor seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte. Mutlu überlebte den versuchten Femizid – doch sie sitzt seitdem im Rollstuhl. Die Verletzungen, die sie erlitt, waren so schwer, dass sie essen und sprechen erst wieder lernen musste.
Aufgefangen wurde Mutlu von ihrer Familie, besonders ihre ältere Schwester Dilek war für sie da. Bis das vermeintlich Unvorstellbare erneut geschah: Dilek wurde von einem Mann erschossen, mit dem sie zuvor eine Beziehung geführt hatte.
Trotz der Trauer um ihre Schwester und ihre zerbrochenen Träume gibt Mutlu nicht auf und arbei-
tet unermüdlich an ihrer Genesung. Heute ist sie Aktivistin für Frauenrechte: Auf TikTok hat sie 1,9 Millionen Follower*innen. Es ist ihr Fenster zur Welt, hier tauscht sie sich mit ihrer Community aus, die Mutlu aufgrund der Kugel in ihrem Kopf bewundernd „Iron Woman“ nennt. Außerdem hat sie einen Protestsong geschrieben. Er ist härter als ihre alten Lieder. Trap Beats vermischt mit traditionellen Elementen spiegeln Mutlus Wut über die patriarchalen Verhältnisse wider.
Mit eindrücklich geschilderten Alltagsszenen, durchzogen von Archivaufnahmen aus der Talentshow und Nachrichtensendungen, folgt der preisgekrönte Dokumentarfilm Mutlu und ihrer Familie bei der Verarbeitung der schrecklichen Taten. Die intimen Einblicke der Regisseur*innen Nick Read und Ayse Toprak zeigen dabei vor allem eines: Mutlus Stärke.¶
Gesine Gerdes
Mutlu’s family is proud. The Kurdish woman from the Turkish province of Diyarbakır was just 19 years old when she entered the finals of a nationwide singing competition. The media celebrated the young woman, whose name seems to set the agenda: ‘Mutlu’ means ‘happy’ in Turkish.
Today, Mutlu looks glumly at the TV footage. ‘I sang my own lament’ she recalls in the documentary ‘My Name Is Happy’ (Turkish: ‘Benim Adım Mutlu’) about the Kurdish folk song that helped her to make it to the 2015 finals. She was preparing for her next performance when a man shot her in the head – because she had previously rejected his marriage proposal. Mutlu survived the attempted femicide – but she has been in a wheelchair ever since. The injuries she suffered were so severe that she had to relearn how to eat and speak.
Mutlu was picked up by her family, and her older sister Dilek in particular was there for her. Until the supposedly unimaginable happened again: Dilek was shot dead by a man with whom she had previously been in a relationship.
Despite the grief for her sister and her shattered dreams, Mutlu has not given up and is working tirelessly on her recovery. Today, she is a women’s rights activist with 1.9 million followers on TikTok. It is her window to the world, where

„Ich habe Frieden mit
in meinem Kopf geschlossen“
EN ‘I have made peace with the bullet in my head’„In einem unglücklichen Leben war mein Name ‚glücklich‘. Aber inzwischen hat mein Name eine neue Bedeutung für mich: ‚Überlebende‘.“ Filmstill aus „My Name Is Happy“ / ‘In an unhappy life, my name was “happy”. But now my name has a new meaning for me: “survivor”.’ Film still from ‘My Name Is Happy’
she exchanges ideas with her community, which admiringly calls Mutlu ‘Iron Woman’ because of the bullet in her head. She has also written a protest song. It’s grittier than her old songs. Trap beats mixed with traditional elements reflect Mutlu’s anger about patriarchal conditions.
With impressively layered everyday scenes interspersed with archival footage from the talent
Weltweit erfolgt alle 11 Minuten
ein Femizid
Femizid bezeichnet die Tötung einer Frau wegen ihres Geschlechts oder wegen bestimmter Vorstellungen von Weiblichkeit oder einer Rolle, die Frauen erfüllen sollen, es aber nicht tun. Laut der UN wurde 2021 mehr als die Hälfte aller getöteten Frauen durch einen (Ex-)Partner oder ein Familienmitglied umgebracht.
Die Türkei hat eine der höchsten Zahlen an Femiziden in der Welt. Trotzdem entschied Staatschef Erdoğan per Erlass den Austritt seines Landes aus der Istanbul-Konvention, einem internationalen Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Die nicht enden wollende patriarchale Gewalt und die unzureichenden Reaktionen der Justiz mobilisierten landesweit Proteste. Dennoch: Femizide sind ein globales Problem, das auch in Deutschland auftritt. Hierzulande tötet durchschnittlich alle drei Tage ein Mann seine (Ex-) Partnerin.
Der Begriff Femizid wurde von Diana E. H. Russell geprägt, einer feministischen Aktivistin und Soziologin. Während der Begriff in den USA seit den 1990er-Jahren genutzt wird, ist er in Deutschland bisher weniger geläufig. Oft werden Femizide in den Medien als „Familientragödien“ oder „Eifersuchtsdramen“ benannt – und dadurch verharmlost. Eine Gruppe von Journalistinnen, einer Überlebenden eines Femizidversuchs sowie anderen Expertinnen hat deshalb einen Leitfaden für die Berichterstattung von Femiziden veröffentlicht. Denn Medien und ihre Wortwahl beeinflussen oft, wie wir ein Ereignis oder eine Tat wahrnehmen und damit umgehen.
Und auch die Justiz spielt eine Rolle: Noch immer ist ein Femizid in Deutschland kein eigener Straftatbestand. Die Regierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag zwar vereinbart, dass Gewalt gegen Frauen künftig strenger bestraft werden soll – von Femizid als Mord ist dort allerdings nicht die Rede.¶
Jana Sepehrshow and news broadcasts, this award-winning documentary follows Mutlu and her family as they come to terms with the horrific acts that have befallen them. The intimate insights provided by directors Nick Read and Ayse Toprak demonstrate one thing above all: Mutlu’s strength.¶
Gesine GerdesEN Worldwide, a femicide occurs every 11 minutes
Femicide refers to the killing of a woman due to her gender or due to certain ideas of femininity or the role that women are supposed to play but do not. According to the UN, more than half of all women killed in 2021 were killed by an (ex-) partner or family member.
Turkey has one of the world’s highest femicide rates. And yet, head of state Erdoğan decided to withdraw his country from the Istanbul Convention, an international treaty to combat gender-based violence against women. Never-ending patriarchal violence and inadequate judicial responses mobilised protests across the country.
However, femicide is a global problem that also occurs in Germany. Here, a man kills his (ex-)partner every three days on average. The term femicide was coined by Diana E. H. Russell, a feminist activist and sociologist. While the term has been used in the United States since the 1990s, it has been less common in Germany. Often, femicides are referred to in the media as ‘family tragedies’ or ‘dramas of jealousy’ – and are thereby trivialised. A group of journalists, a survivor of a femicide attempt and other experts have therefore published a guide for reporting femicides.
After all, the media and their choice of words often influence how we perceive and deal with an event or an act. And the judiciary also plays a role: femicide is not yet a separate criminal offence in Germany. Although the government agreed in its coalition agreement that violence against women would be punished more severely in the future, there is no mention of femicide as a form of murder.¶
Jana SepehrTALKING HUMANITY
DAS SCHWEIGEN
BRECHEN: ÜBER FEMIZIDE UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE GEWALT
EN BREAKING THE SILENCE:
CONFRONTING FEMICIDE AND GENDER VIOLENCE
→ 14. Okt., 18:30 Uhr
→ Dokumentationszentrum
→ Im Anschluss / followed by:
My Name Is Happy (Seite 86 / page 86)
→ Mehr Informationen auf Seite 26 / more information on page 26
FILMTIPP
MY NAME IS HAPPY Mutlu verliert ihre Schwester und fast ihr eigenes Leben – doch ihre Stimme lässt sie sich nicht nehmen.
→ Seite 86
EN Mutlu loses her sister and almost her own life – but does not let her voice be taken away. → Page 86
 Filmstill aus „Sānsūr“
Film still from ‘Sānsūr’
Filmstill aus „Sānsūr“
Film still from ‘Sānsūr’
Die bunten Blätter segeln, der Tee duftet aromatisch. Endlich Herbst, endlich Zeit, um in Ruhe zu lesen. Wir haben bei der Redaktion des Lila Podcasts nachgefragt, welche feministischen Bücher bei ihnen dieses Jahr auf der Leseliste stehen.

EN Colourful leaves drift on the breeze, and tea fills the air with its wonderful aroma. Autumn has finally arrived –it’s finally time to read in peace.
Monika Helfer, Lena Gorelik u.v.m.: Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung
Christina Clemm: AktenEinsicht:

Geschichten von Frauen und Gewalt Jede dritte Frau in Deutschland erlebt physische oder sexualisierte Gewalt. Und sie geht in den meisten Fällen von Partnern oder Expartnern aus. In „AktenEinsicht: Geschichten von Frauen und Gewalt“ erzählt die Strafrechtsanwältin von Frauen, die Gewalt erlebt haben, und deckt Leerstellen und Fehlerquellen in der Arbeit von Justiz und Polizei auf.
EN One in three women in Germany experiences physical or sexual violence. And in most cases, it comes from partners or ex-partners. In ‘AktenEinsicht: Geschichten von Frauen und Gewalt’, a criminal lawyer tells the stories of women who have experienced violence, uncovering gaps and errors in the work done by the judiciary and the police.
Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland noch immer illegal. Unter Umständen straffrei – aber illegal. Und Gynäkolog*innen können die Behandlung aus Gewissensgründen ablehnen. Schwangere müssen deshalb zum Teil hunderte Kilometer fahren, bis sie eine Praxis finden, in der ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann. In „Glückwunsch“ erzählen 15 Autor*innen von 15 ungewollten Schwangerschaften. Die Protagonist*innen leben in verschiedenen Ländern und Jahrhunderten, ihre Lebenssituationen und Wünsche unterscheiden sich. Ein wichtiges Buch über die Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen.
EN Abortions are still illegal in Germany. Under certain circumstances they go unpunished – but they are illegal. And gynaecologists can refuse treatment for conscience reasons. Pregnant women therefore sometimes have to travel hundreds of kilometres to find a practice where an abortion can be performed. In ‘Congratulations’, 15 authors tell the stories of 15 unwanted pregnancies. The protagonists live in different countries and centuries, their situations and wishes differ. An important book about the freedom to decide for yourself.

Gilda Sahebi: „Unser Schwert ist Liebe“: Die feministische Revolte im Iran
Im September 2022 starb die Kurdin Jina Mahsa Amini, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei verhaftet wurde. Ihr Tod löste landesweite Proteste und eine feministische Revolution im Iran aus. Die Journalistin, Ärztin und Autorin Gilda Sahebi beschreibt in „Unser Schwert ist Liebe“ die Aufstände gegen das Regime und macht deutlich, was den Menschen vor Ort Kraft gibt, sich weiterhin aufzulehnen: der Glaube an ein gerechteres Zusammenleben und die Liebe der Protestierenden zueinander.
EN In September 2022, Jina Mahsa Amini, a Kurdish woman, died after being arrested by Iran’s morality police. Her death sparked nationwide protests and a feminist revolution in Iran. In ‘Our Sword is Love’, journalist, doctor and author Gilda Sahebi describes the uprisings against the regime and explains what it is that has given the people on the ground strength to continue their rebellion: their belief in a more just way of living together and their love for one another.
feministische Bücher, die du diesen Herbst lesen solltest
Three feminist books you must read this autumn
Filmstill aus „My Blond GF“ / Film still from ‘My Blond GF’

HRFFB meets Bundestag: Gemeinsam mit den Expert*innen von HateAid laden wir zu einer politischen Filmaufführung von „My Blonde GF“ ein. Mit dem Ziel, Bundestagsabgeordnete zu sensibilisieren und den Schutz vor ungewollten sexualisierten Deepfakes einzufordern.
EN HRFFB meets Bundestag: Together with experts from HateAid we are inviting you to attend a political film screening of ‘My Blonde GF’. The aim is to raise awareness among members of the German Federal Parliament and call for protection against unwanted sexualised deepfakes.
Wie Deepfakes unsere Demokratie ins Wanken bringen
Der Papst in weißer Daunenjacke mutet vielleicht noch lustig an – an anderer Stelle sind manipulierte Bilder jedoch gefährlich. Das zeigt etwa das FakeVideotelefonat mit dem Bürgermeister von Kiew, das die damalige Regierende Bürgermeisterin Berlins kurzzeitig getäuscht hat.
Bei Deepfakes handelt es sich um Video-, Bild- oder Audiodateien, die mittels künstlicher Intelligenz manipuliert wurden. Neue Methoden machen solche Fälschungen immer realistischer.
Viele Deepfakes können anhand bestimmter Kriterien jedoch entlarvt werden:
→ unnatürliche Mimik oder weichgezeichnete Gesichtszüge
→ ein leerer Blick oder fehlendes Blinzeln
→ nicht korrekte Schattenwürfe
→ Veränderungen beim Hautton
→ Abweichungen zwischen Ton und Mundbewegungen.
Oft sind die Nuancen nur auf einem Bildschirm mit hoher Auflösung sichtbar. Allerdings gucken die wenigsten so genau hin. Und selbst, wenn Fakes aufgedeckt werden: Der Zweifel ist gesät, die Gerüchte kursieren.
Deepfake-Pornos zur Einschüchterung von Frauen. Von Bikinibild bis Hardcoreporno: Deepfakes werden fast ausschließlich zur bildbasierten sexualisierten Gewalt genutzt, also zur nicht einvernehmlichen Erstellung von Pornografie. Betroffen sind zu 90 Prozent Frauen. Bisher traf es vor allem bekannte Personen: Politiker*innen, Schauspieler*innen und Journalist*innen. Doch es wird immer einfacher, Deepfakes zu erstellen – mit den „Face Swap“Apps auch für technische Lai*innen. Dadurch steigt die Gefahr für alle, ungewollt in einem Deepfake zu landen.
Manipulierte Aufnahmen, reale Folgen. Deepfakes haben schwerwiegende Folgen für Betroffene: psychische Belastung, Traumatisierung und Ausgrenzung in der Familie oder im Job. Sind Deepfakes erst einmal verbreitet, ist es sehr schwer, sie wieder zu löschen. Teilweise sind Betroffene noch nach Jahren damit beschäftigt, Bilder aufzuspüren und deren Löschung zu beantragen.
Eine Gefahr für die Demokratie. Das Ziel solcher Deepfakes: Betroffene zu demütigen und mundtot zu machen. Das hat Folgen für die ganze Gesellschaft. Wenn beispielsweise Kandidatinnen für politische Ämter durch Porno-Manipulationen verleumdet werden, kann das Frauen davon abhalten, sich politisch zu engagieren. Sie müssen sich gründlich überlegen, ob sie sich und ihre Familie der Gefahr aussetzen wollen –und sehen im schlimmsten Fall davon ab. Dann war die Strategie derjenigen, die Deepfakes als politisches Mittel einsetzen, erfolgreich: Sie bekommen freie Bahn für Desinformation und Frauenhass. Das ist eine Bedrohung für unsere Demokratie.
Manipulationen stoppen, Demokratie stärken. Das eigene Gesicht ungewollt im Porno: Damit niemand mehr Angst davor haben braucht, muss die Bundesregierung wirksame Gesetze erlassen. Die gemeinnützige Organisation HateAid macht beim diesjährigen Human Rights Film Festival Berlin auf die Gefahren von Deepfakes aufmerksam und fordert von Politik und Onlineplattformen mehr Initiative für den Schutz von Menschenrechten im Netz ein.¶
Jenny Brunner, HateAidFILMTIPP ANOTHER BODY
Die pornografischen Videos sind Fakes, doch die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sind umso realer.
→ Seite 85
EN The pornographic videos are fakes, but the impact of artificial intelligence is all too real. → Page 85
EN How deepfakes are undermining our democracy
The Pope in a white puffer jacket might still be funny, but manipulated images pose a real danger. This became evident when the former Mayor of Berlin was deceived by a fake video call from the Mayor of Kyiv.
Deepfakes are video, image or audio files that have been manipulated using artificial intelligence. New methods are making these forgeries increasingly realistic.
However, many deepfakes can be uncovered on the basis of certain criteria, such as:
→ unnatural facial expressions or blurred features,

→ an empty gaze or lack of blinking,
→ incorrect shadows,
→ changes in skin tone and
→ discrepancies between audio and mouth movements.
Often, these nuances are only visible on a high-resolution screen. However, most people don’t examine videos that closely. And even if the fakes are uncovered, doubts persist, and rumours circulate.
Deepfake porn being used to intimidate women. From bikini shots to hardcore pornography, deepfakes are predominantly being used to create sexually explicit content without consent, and 90 per cent of victims are women. So far, the targets
have generally been well-known personalities: politicians, actors and journalists. However, it is becoming increasingly easy for even non-experts to create deepfakes using face swap apps. This poses the risk that anyone might involuntarily end up in a deepfake.
Manipulated recordings, real consequences. Deepfakes have severe consequences for victims: psychological distress, trauma and social exclusion in both family and work settings. Once deepfakes have been widely circulated, it is very difficult to remove them. In some cases, victims are still searching for and requesting the deletion of such images years later.
A threat to democracy. The aim of these deepfakes is to humiliate and silence victims, which has implications for society as a whole. For instance, when female political candidates are defamed through sexualised manipulations, it can discourage women from engaging in politics. They must carefully consider whether they want to expose themselves and their families to this risk – and, in the worst case, will refrain from engaging in politics altogether. In this way, the strategy of those who use deepfakes as a political tool proves successful, giving them free rein to spread disinformation and misogyny. This poses a threat to our democracy.
Stopping manipulation, strengthening democracy. Finding your face involuntarily featured in a porn flick: in order to eliminate the fear of that happening, the federal government must enact effective laws. The non-profit organisation HateAid is raising awareness of the dangers of deepfakes at this year’s Human Rights Film Festival and calling on politicians and online platforms to take action to protect human rights on the internet.¶
Jenny Brunner, HateAidGuilty Feminist
Bei Guilty Feminist lernt man alles über Feminismus – und über Humor. Beste Kombination! Seit
2015 spricht Deborah
Frances-White mit wechselnden Gästinnen über feministische Themen. Die dazugehörigen Stand-up-Einlagen beweisen ein für alle Mal, dass Frauen einfach die lustigeren Menschen sind. Englischsprachig.
EN In ‘Guilty Feminist’, you will learn all about feminism – and humour.

A winning combination!
Since 2015, Deborah
Frances-White has been talking about feminist issues with changing guests. The accompanying stand-up interludes prove once and for all that women are simply funnier. English.
Hört mehr Frauen! 5 feministische Podcast-Empfehlungen
Listen to women! Five feminist podcast tips
Podcast ist, wenn zwei Männer über ihre Hobbys reden – zumindest hätte man das lange denken können. Aber zum Glück gibt es zunehmend Podcasts nur von Frauen, die zeigen, wie wichtig, witzig und interessant weibliche Stimmen sind. Hier stellen Katja Berlin und Gunda Windmüller, Hosts des feministischen Mittelalter-Podcasts „Fix und Vierzig“ (für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen) ihre fünf Lieblingspodcasts vor.
EN A podcast is when two men talk about their hobbies – at least that’s what you might have thought. But thankfully, there is an increasing number of women-only podcasts that show how important, funny and interesting female voices are. Here, Katja Berlin and Gunda Windmüller, hosts of the feminist middle-age podcast ‘Fix und Vierzig’ (for women over 40 and those who want to be) present their five favourite podcasts.

Wiser than me
Julia Louis-Dreyfus hat sich die gleiche Aufgabe gestellt wie wir: dem Altern nicht negativ begegnen, sondern neugierig und optimistisch zu sein. Sie interviewt dafür in ihrem Podcast berühmte alte Frauen zu ihren Erfahrungen, ihren Weisheiten und ihrem Leben. Die Folge mit Jane Fonda ist besonders empfehlenswert. Englischsprachig.
EN Julia Louis-Dreyfus has set herself the same task we have: to be curious and optimistic about aging instead of negative. To this end, in her podast she interviews famous older women about their experiences, their wisdom and their lives. The episode with Jane Fonda comes highly recommended. English.

Bookshelfie
Women’s Prize for Fiction – Die BBC-Journalistin Vick Hope spricht mit Gäst*innen (u. a. Isabel Allende und Gillian Anderson) über aktuelle Literatur von Frauen, ihre Lieblingsbücher und wie Literatur unser Leben verändern kann. Englischsprachig.

EN Women’s Prize for Fiction – BBC journalist Vick Hope talks with guests (like Isabel Allende and Gillian Anderson) about current literature by women, their favourite books and how literature can change our lives. English.

Die Alltagsfeministinnen

Wie weit es mit der Gleichberechtigung wirklich ist, zeigt sich oft auch in den kleinsten Kleinigkeiten. Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich Zapata nehmen Alltagssituationen auseinander, geben praktische Tipps und beleuchten das große Ganze dahinter.
Deutschsprachig.
EN We can often see how far equality has really come in the smallest things. Sonja Koppitz and Johanna Fröhlich Zappata take everyday situations apart, give practical tips and shed light on the big picture. German.
Alice und Maxi sind gute Freundinnen. Einmal im Monat sprechen sie über explizit Feministisches, Popkultur, Persönliches. Zum Beispiel: toxische Männlichkeit, Menstruation und Rap. Deutschsprachig.
EN Alice and Maxi are good friends. Once a month they talk about explicitly feminist, popcultural and personal stuff. For example: toxic masculinity, menstruation and rap. German.
„Mein Traum ist es, die Wahrheit schreiben zu können –ohne Angst vor Zensur“
Yasmin Khaleghian ist eine der Protagonistinnen im Dokumentarfilm „Sānsūr“, in dem sechs iranische Frauen porträtiert werden, die für die Freiheit kämpfen. In ihrem Essay gibt uns Khaleghian einen Einblick in ihr Leben.

Vor drei Jahren habe ich den Iran verlassen. Ich lebe jetzt in Kanada und kann nicht in meine Heimat zurückkehren, weil ich befürchte, verhaftet zu werden. Ich habe keine Angst vor dem Gefängnis, aber ich weiß, dass es so viel einfacher ist, für die Demokratie einzutreten, sich gegen Tyrannei auszusprechen und außerhalb des Gefängnisses etwas zu bewirken. Auch wenn ich weit weg vom Iran bin.
Ich wollte schon immer reisen, schreiben und eine Geschichtenerzählerin sein. Mein Traum ist es, die Wahrheit schreiben zu können – ohne Angst vor Zensur. Noch kann ich das nicht offen tun, weil die Islamische Republik Iran weiterhin Dissidenten im Ausland zum Schweigen bringt, indem sie Druck auf ihre Familien im Iran ausübt.
Aber die Einschüchterung hält Leute wie mich nicht davon ab, die Verbrechen des Regimes aufzudecken, auch wenn das bedeutet, dass ich es anonym tun muss. Wenn sie uns den Weg versperren, schaffen wir eine neue Route, um unseren Kampf fortzusetzen.
Der surrealste Moment meines Lebens war, als ich mit einem Koffer den Iran verließ. Es fühlte sich an, als gehörte ich nirgendwo mehr hin. Ich
war verloren. Doch ich musste fliehen, um mein Leben zu retten. Während meines Studiums begann ich, mich ernsthaft politisch zu engagieren, und in meinem letzten Semester wurde ich deswegen suspendiert. Später, als ich als Journalistin arbeitete, wurde ich mehrfach für meine Berichterstattung bedroht. Nachdem ich zum Beispiel über die Säureangriffe auf Frauen in der Provinz Isfahan berichtet hatte, bei denen Extremisten Frauen Säure ins Gesicht warfen, weil sie sich nicht angemessen gekleidet hatten, erhielt ich Drohungen von anonymen Personen, die mich davor warnten, weiter zu berichten. „Wenn ich die Angelegenheit weiterverfolgen würde“, so sagten sie, „würde mir dasselbe Schicksal bevorstehen.“ Bei der Arbeit wurde ich wegen meines Instagram-Kontos gerügt, da ich keine „unverhüllten“ Fotos von mir posten durfte.
Ich berichtete auch über das ukrainische Passagierflugzeug, das am 8. Januar 2020 von der Islamischen Revolutionsgarde mit einer Rakete abgeschossen wurde. Die Geheimdienstagenten durchsuchten mein Zuhause und behaupteten, ich hätte die Revolutionsgarde zu Unrecht beschuldigt, das Flugzeug absichtlich angegriffen zu haben. Sie konfiszierten meinen Reisepass
sowie persönliche Gegenstände wie mein Telefon und meinen Laptop. Dann wurde ich stundenlang verhört. Ich ertrug verbale Beleidigungen und Gewalt. Einer der Agenten griff mich körperlich an. Sie brachten immer wieder meine Bilder und meine privaten Gespräche auf meinem Telefon zur Sprache. Sie bestellten auch einen meiner Verwandten ein und verhörten ihn sieben Stunden lang, um ihn unter Druck zu setzen, gegen mich auszusagen. Sie drohten damit, meine Mutter und meinen Bruder festzunehmen, wenn ich nicht die Geständnisse aufschrieb, die sie diktierten. Sie drohten außerdem damit, die Anklage „als Journalist auf Twitter und Instagram auftreten“ zu ihrer langen Liste von Anklagepunkten gegen mich hinzuzufügen. Schließlich wurde mir bis zu meinem Gerichtstermin die Arbeit untersagt.
Ich verließ den Iran vor meinem Gerichtstermin, weil mir das, was für mich am wichtigsten war, gewaltsam genommen wurde. Wer war ich, wenn ich keine Journalistin mehr war? Mir wurde mein grundlegendes Menschenrecht verweigert. Ich verließ das Land auch für meine Familie. Ich wollte nicht, dass sie wegen mir in Gefahr gerieten.¶
Yasmin Khaleghiansibility of arrest. I am not afraid of prison, but I know it’s much easier to advocate for democracy, speak out against tyranny and make a difference outside of prison. Even if I am far away from Iran.
I have always wanted to travel, write and be a storyteller. My dream is to be able to write the truth without fear of censorship. I still cannot openly do that because the Islamic Republic of Iran continues to silence dissidents abroad by putting pressure on their families in Iran.
But intimidation won’t stop people like me from exposing the regime’s crimes, even if it means doing so anonymously. When they block our way, we forge new paths to continue our fight.
The most surreal moment of my life was leaving Iran with one suitcase. I felt like I no longer belonged anywhere. I was lost. But I had to flee to save my life. I began taking my political activism seriously in college, and in my final semester, I was suspended for it. Later, while working as a journalist, I was threatened numerous times because of my reporting. For example, after writing about the acid attacks on women in Isfahan province, where extremists splashed acid into women’s faces for not being dressed properly, I received threats from anonymous individuals who warned me to stop reporting. ‘If you keep pursuing the matter,’ they said, ‘the same fate will await you.’ At work, I was reprimanded for my Instagram account: I was not allowed to post ‘unveiled’ photos of myself.
MASTERCLASS
GILDA SAHEBI: DER SCHMALE GRAT –WIE AKTIVISTISCH
DÜRFEN JOURNALIST*INNEN SEIN?
Journalist*innen haben wie andere Menschen eine Haltung und Werte. Die Journalistin, Ärztin und Autorin Gilda Sahebi berichtet über die Lage der Frauenrechte im Iran, über Rassismus und Feminismus.
EN GILDA SAHEBI: THE FINE LINE –HOW ACTIVISTIC ARE JOURNALISTS ALLOWED TO BE?
Yasmin Khaleghian is one of the protagonists in the documentary film ‘Sānsūr’, which portrays six Iranian women fighting for freedom. In her essay, Khaleghian gives us insights into her life.

Three years ago, I left Iran, the country of my birth. Now I live in Canada and have been unable to return to my home country due to the pos-
I also reported on the Ukrainian passenger plane shot down by the Islamic Revolutionary Guard Corps missile on 8 January 2020. Intelligence agents raided my home, claiming I had wrongfully accused the corps of intentionally targeting the airplane. They confiscated my passport and many personal belongings, such as my phone and laptop. Then, I was interrogated for hours. I endured verbal abuse and violence. And one of the agents physically assaulted me. They repeatedly brought up my pictures and the private conversations on my phone. They also summoned one of my relatives and interrogated them for seven hours, pressuring them to testify against me. The agents threatened to arrest my mother and brother if I didn’t write down the confessions they were dictating. They also threatened to add the charge of ‘posing as a journalist on Twitter and Instagram’ to their long list of charges against me. Finally, they banned me from working until my court date.
I left Iran before my court date because what mattered most had been forcibly taken from me. Who was I if I wasn’t a journalist anymore? I had been denied my most basic human right. I also left for my family’s sake. I didn’t want them to come into harm’s way because of me.¶
Yasmin KhaleghianJust like everyone else, journalists have their own attitudes and values. Journalist, doctor and author Gilda Sahebi reports on issues like racism, feminism and the state of women’s rights in Iran.
→ 14. Okt.
→ 16:30-18:00 Uhr
→ Dokumentationszentrum
EN ‘My dream is to be able to write the truth without fear of censorship’
Verstoßen, gejagt, gefoltert
Der Dokumentarfilm „Out of Uganda“ zeigt die erschütternden Lebensrealitäten geflüchteter queerer Menschen.
„Du bist nicht mein Sohn. Du bist Satan.“ Sätze wie diese müssen LGBTQIA+-Personen in Uganda und anderswo ertragen. Geistliche rufen dazu auf, sie im Namen Gottes oder Allahs zu töten. Nachbarn, Lehrer*innen, Verwandte und sogar die eigenen Eltern glauben mitunter, dass ihre Kinder der Teufel sind, wenn sie lesbisch, schwul, bisexuell oder transgeschlechtlich sind. Neben der verbalen Gewalt, die sie erleben, werden sie von der Gesellschaft verstoßen, gejagt, gefoltert, ermordet. Und auch vor den Regierungen sind sie nicht sicher: weltweit wird Homosexualität in 66 Staaten noch immer strafrechtlich verfolgt, in 12 Ländern droht sogar die Todesstrafe. Vor allem in Ost- und Westafrika und in Teilen Asiens werden einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen besonders hart bestraft. Für viele ist die letzte Hoffnung, alles hinter sich zu lassen und zu fliehen.
Der Dokumentarfilm „Out of Uganda“ porträtiert Lynn, Shammy, Hussein und Philip, die in ihrer Heimat – dem ostafrikanischen Uganda – genau das erleben. Drei von ihnen gelingt die Flucht in die Schweiz. Doch auch hier erwarten sie neue Hürden und Ausgrenzung. ¶
Jana SepehrEN Exiled, hunted, tortured
The documentary ‘Out of Uganda’ depicts the harrowing realities of displaced queer people.

‘You are not my son. You are Satan.’ These are the kind of words that LGBTQIA+ people in Uganda and elsewhere have to endure. The clergy de-
mand that they are killed in the name of God or Allah. Neighbours, teachers, relatives and even their own parents sometimes believe their children are demons if they are lesbian, gay or bisexual or identify as transgender. In addition to the verbal abuse they experience, they are ostracised, hunted down, tortured and murdered by society. They are not safe, not even from governments: homosexuality is still a crime in 66 countries worldwide, with twelve countries even punishing it with the death penalty. In East and West Africa and parts of Asia, consensual same-sex sexual acts are punished severely. For many, the last hope is to leave everything behind and flee. The documentary film ‘Out of Uganda’ portrays Lynn, Shammy, Hussein and Philip, who experience precisely this in their homeland – East African Uganda. Three of them manage to escape to Switzerland. But even there, they face new obstacles and exclusion.¶
Jana SepehrFILMTIPP
OUT OF UGANDA
Niemand will seine Heimat verlassen.
Doch für vier queere Ugander*innen geht es ums Überleben.
→ Seite 86
EN No one wants to leave their home. But survival is at stake for four queer Ugandans.
→ Page 86

Was hat Periodenhygiene mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun? / What does period hygiene have to do with gender justice?
2Rund 17.000 Menstruations produkte verbraucht eine Frau im Laufe ihres Lebens. Das kostet eine Frau in Deutschland durch schnittlich rund 2.600 Euro – rechnet man Medikamente, neue Unterwäsche und andere Folgekosten mit ein, liegen Hochrechnungen bei knapp 5.000 Euro. EN A woman will use 17,000 menstrual products in her lifetime. On average, this costs a woman in Germany 2,600 euros – if you include medication, new underwear and other follow-up costs, it adds up to just under 5,000 euros.
Jeden Monat blutet rund die Hälfte der Weltbevölkerung – und doch ist die Periode vielerorts noch immer ein Tabu. Oft bleibt unsichtbar, was für Menstruierende zum Alltag gehört: Schmerzen, Kosten für Hygieneprodukte und Medikamente – die sich einige nicht leisten können. Das zementiert die Geschlechterungleichheit.

EN The monthly period affects half of the world’s population – and yet it is still taboo. The everyday lives of menstruating people thus remain invisible: regular discomfort, severe pain and the costs of hygiene products and medication. If girls and women cannot afford these things, they stay at home instead of going to school or work. This fosters gender inequality.
1Schätzungsweise 300 Millionen
Frauen und Mädchen haben genau in diesem Moment ihre Periode. 60 Milliliter Blut verliert eine Frau durchschnittlich pro Zyklus. Das entspricht etwa einer halben Kaffeetasse.
EN About 300 million women and girls are menstruating right now. A woman loses 60 millilitres of blood per cycle on average. That corresponds to about half a cup of coffee.
3Weltweit haben 1,25 Milliarden Frauen und Mädchen während ihrer Periode keinen Zugang zu sauberen Toiletten und 500 Millionen Menstruierende haben keinen Zugang zu hygienischen Menstruationsprodukten. Das hat oft Folgen: Wenn sich Frauen und Mädchen keine Periodenprodukte leisten können, bleiben sie meist zuhause, statt zur Schule, zur Arbeit oder zu Arztterminen zu gehen. Das verhindert langfristig ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
fungieren und über wichtige Gesundheitsfragen aufklären. Wir verbessern den Zugang zu sauberem Wasser und bauen Latrinen sowie sanitäre Anlagen, um einen möglichst sicheren und hygienischen Toilettengang zu ermöglichen. Zudem bieten wir Schulungen rund um das Thema „kontrollierte Familienplanung“ an. Im Rahmen unserer Nothilfe verteilen wir Hygiene-Kits, die auch Menstruationsprodukte wie Binden enthalten.
EN Hygiene kits for everyone
Action Against Hunger trains community health workers who act as role models for young girls and educate them about important health issues. We improve access to clean water and build latrines and sanitation facilities to make going to the toilet as safe and hygienic as possible. We provide training for women and men on controlled family planning options. And as part of our emergency response, we distribute hygiene kits that contain menstrual products such as sanitary pads.
Fauen ohne Zugang zu Menstruationsprodukten verpassen bis zu 5 Jahre Schulbildung!
EN Around 1.25 billion women and girls do not have access to clean toilets during their periods, and 500 million menstruating people worldwide do not have access to hygienic menstrual products. This is a problem. Because if women and girls cannot afford period products, they stay at home instead of going to school, work or doctor’s appointments. This prevents them from participating equally in society. 4
EN Women without access to menstrual products lose up to five years of schooling! ¶

Lisa Paping, Aktion gegen den Hunger
FILMTIPP
PERIODICAL
Dies ist kein Sexualkundeunterricht, sondern eine Erzählung über das Wunder der Menstruation. → Seite 86
EN This is not a sex education class, but a story about the marvel of the menstrual cycle. → Page 86
Können Geschichten Leben verändern? Als humanitäre Journalist*innen glauben wir daran.
Für uns bei The New Humanitarian – der einzigen globalen Nachrichtenredaktion, die sich auf die Berichterstattung über humanitäre Krisen spezialisiert hat – sollten „Geschichten“ auf faktenbasierten Reportagen und Analysen beruhen. Unser Blick ist daher kritisch auf die folgenden Themen gerichtet: Kriege, Vertreibung, klimabedingte Naturkatastrophen, Hungersnöte, Gefahren für die öffentliche Gesundheit (z. B. Covid-19, Ebola und der Anstieg von Cholera) und was das für Gemeinschaften bedeuten kann.
zu ermöglichen? Deshalb berichten wir beispielsweise darüber, wie Selbsthilfenetzwerke die humanitäre Hilfe im Sudan vorantreiben und wie eine syrische Familie in Deutschland neu anfängt.
Als humanitäre Journalist*innen haben wir die Macht, falsche Narrative zu hinterfragen, die oft mit einem bestimmten Denk- oder Politiksystem, dem Erbe der Kolonialherrschaft oder anderen Ungerechtigkeiten verbunden sind. Wir tragen die Verantwortung, nicht nur zu berichten, was geschehen ist – sondern Geschichten zu erzählen, die es uns allen ermöglichen, nach vorn zu blicken, uns etwas Besseres vorzustellen und damit zu beginnen, etwas aufzubauen. Und das, so hoffe ich, wird Ihnen und anderen Leser*innen das Gefühl geben, dass es noch Hoffnung gibt.¶
Wir können verstehen, wenn es auf den ersten Blick so erscheint, als habe unser Journalismus nur Hoffnungslosigkeit zur Folge. Die humanitäre Berichterstattung übermittelt prekäre Nachrichten – und zwar hart und direkt.
Wer sich auf unserer Website oder auf unseren sozialen Kanälen umschaut, wird feststellen, dass sich ein Großteil unserer Berichterstattung in letzter Zeit auf klimabedingte Notlagen konzentriert hat. So ist Hunger ein zentrales Thema –oft als Folge des Klimawandels. Und wie immer tragen Frauen und Mädchen in vielen dieser Krisen die Hauptlast.
Als Journalist*innen der humanitären Hilfe konzentrieren wir uns besonders auf die „vergessenen Krisen“ – auf chronische Konflikte und Umbrüche, die es nur selten in die Schlagzeilen der internationalen Mainstream-Medien schaffen. So verschwindet die Ukraine aus dem öffentlichen Bewusstsein, Syrien und der Jemen werden nur gelegentlich erwähnt, ab und zu taucht auch Äthiopien auf. Wir hingegen berichten über all diese Länder und darüber hinaus: über den Aufstieg von Banden und wie sie das Leben in Teilen Lateinamerikas verändern, über die Situation der mehr als eine Million Rohingya, die in Lagern in Bangladesch leben, und über den Wie-
deraufbau nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei.
Um gut zu sein, muss Journalismus die Hoffnungslosigkeit überwinden können. Er muss einen Weg nach vorn aufzeigen. Und hier kommt das Storytelling ins Spiel, um die Stimmen der Menschen vor Ort zu verstärken – und nicht nur zu berichten, was passiert ist, sondern auch warum. Wer oder was ist verantwortlich? Und welche Schritte können unternommen werden, um den Menschen zumindest ansatzweise zu helfen und ihr früheres Leben wieder
EN Can stories change lives? As humanitarian journalists, we think so.
For us at ‘The New Humanitarian’ — the only global newsroom dedicated to covering humanitarian crises –‘story’ means fact-based reporting and analysis. Our journalism addresses all the usual suspects: wars, displacement, climate emergencies, hunger, public health risks (think Covid-19, Ebola or surges in cholera) etc., and the toll they are taking on communities.
We understand if, at first glance, it seems that we humanitarian journalists are in the business of hopelessness. In a lot of humanitarian reporting, bad news comes hard and fast.
When you take a look at our site or social feeds, you’ll see that much of our coverage of late has focused on the relentless piling-up of climate emergencies. Hunger looms large – often anoth-
„Als humanitäre Journalist*innen haben wir die Macht, falsche Narrative zu hinterfragen, die oft mit einem bestimmten Denk- oder Politiksystem, dem Erbe der Kolonialherrschaft oder anderen Ungerechtigkeiten verbunden sind.“
er result of our changing climate. And as always, women and girls are bearing the brunt of many of these crises.

As humanitarian journalists, we place a special focus on ‘forgotten crises’ –chronic conflicts and upheavals that rarely make international mainstream headlines. Ukraine is fading from public awareness, Syria and Yemen pop up occasionally, and once in a while Ethiopia might make an appearance. We cover all of those regions, but we are also committed to exploring how the rise of gangs are changing lives in parts of Latin America, how more than a million Rohingya are living in camps in Bangladesh and how people are rebuilding after the Syria-Turkey earthquake.

But to do our jobs well, our journalism has to push past hopelessness. It must offer a way forward. And that’s where storytelling comes in as a tool to amplify the voices of real people and chronicle not only what has happened but why, who or what is accountable, and what steps can be taken to help people at least begin to rebuild their lives. That’s why we report on mutual
aid networks powering Sudan’s humanitarian response and Syrian families starting over in Germany.
As journalists, we have the power to challenge false narratives – often narratives tied to a specific system of thinking or politics, to legacies of colonial rule or other inequities. We have the responsibility to not only chronicle what has happened but to tell stories that allow all of us to look ahead, to imagine something better and begin to build it. And I have faith that this will leave you and other readers with the feeling that there is in fact hope ahead.¶
‘As journalists, we have the power to challenge false narratives – often narratives tied to a specific system of thinking or politics, to legacies of colonial rule or other inequities.’
zum Dialog / An invitation to engage in dialogue
Gemeinsam mit unseren Partnern laden wir internationale Künstler*innen, Aktivist*innen und Expert*innen ein, um sich im Dialog mit dem Publikum eine Stunde lang den drängendsten Fragen unserer Zeit zu widmen. Jenseits von alltäglicher Berichterstattung wollen wir
tiefgründig, kontrovers und offen diskutieren. Im Anschluss an jedes Gespräch zeigen wir ein Film-Highlight aus unserem Festivalprogramm.
EN Together with our partners, we have invited international artists, activists and experts to engage in dialogue with
our audience for one hour on the most pressing issues of our time. Going beyond superficial reporting, we want our discussions to take place in depth, passionately and openly. Following each discussion, we will be screening a film highlight from our festival program.
An vorderster Front: Die Rolle von Journalist*innen in Krieg und Krisen / On the Frontlines: Journalism’s Essential Role in War and Crises
Wer darf eine Geschichte erzählen? Und wie stehen Erfahrungen von Betroffenen in Kriegen und Krisen Medienberichten gegenüber? Expert*innen und Reporter*innen diskutieren die Bedeutung und Herausforderungen von Kriegsberichterstattungen.
EN Who gets to tell the story? And how do the experiences of those affected by war and crises compare to media reports? Experts and reporters discuss the significance and challenges of war reporting.
In Partnerschaft mit / in partnership with The New Humanitarian
Im Anschluss / followed by: 20 Days in Mariupol → Seite / page 88

Das ethische Dilemma: Wenn Kindersoldaten von Opfern zu Tätern werden / The Ethical Dilemma: When Child Soldiers Become Perpetrators
Dominic Ongwen, als Kind entführt und zum Töten gezwungen, wird 30 Jahre später wegen Völkermordes angeklagt. Dieser Fall wirft die Frage auf: Wann wird ein Opfer zum Täter?

EN Dominic Ongwen, abducted as a child and forced to kill, is charged with genocide 30 years later. This case raises the question: When does a victim become a perpetrator?
In Partnerschaft mit / in partnership with ARTE
Im Anschluss / followed by:
Theatre of Violence → Seite / page 89
Das Schweigen brechen: Über Femizide und geschlechtsspezifische Gewalt / Breaking the Silence: Confronting Femicide and Gender Violence

In einer Welt, in der geschlechtsspezifische Gewalt oft übersehen wird, geht es in dieser Diskussionsrunde um die Frage, wie wir Femizide als Gesellschaft beenden können –und welche Rolle Medien dabei spielen.
EN In a world where gender-based violence is often overlooked, this panel is about how we as a society can end femicide – and what role the media can play in this.
In Partnerschaft mit / in partnership with Der Lila Podcast
Im Anschluss / followed by:
My Name Is Happy → Seite / page 86
15. Oktober
Das Streben nach Frieden: Eine umfassende Sichtweise / Pursuing Peace: A Holistic Perspective
Klimagerechtigkeit, Geschlechtergleichheit und Migration sind für nachhaltigen Frieden wesentlich. Doch was ist der Preis, um Frieden zu erzeugen? Expert*innen beleuchten die physischen, emotionalen und diplomatischen Kosten.
EN Climate justice, gender equality and migration are essential to achieving long-term peace. But what is the price of peace? Experts shed light on the physical, emotional and diplomatic costs.
Präsentiert von / presented by Greenpeace
Im Anschluss / followed by:
This Kind of Hope → Seite / page 89
16. Oktober
Nebenschauplatz des Krieges: Mädchenbildung in Konfliktregionen / Battles Beyond the Battlefield: Securing Girls’ Education in Conflict Zones
Krieg, Geschlechterungleichheit und der Zugang zu Bildung sind eng miteinander verwurzelt. Dieses Panel untersucht die komplexen Zusammenhänge und konzentriert sich dabei auf die Bildungschancen von Mädchen.
EN This panel explores the complex connections between war, gender inequality and education, focusing on girls’ access to education. It is a call for a universal right to education for girls in conflict zones.
Präsentiert von / presented by Global Partnership for Education
Im Anschluss / followed by:
Children of the Taliban → Seite / page 92

INFORMATION
→ 18:30 Uhr

→ Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung
Stresemannstraße 90, 10963 Berlin (Kreuzberg) → S Anhalter Bahnhof
Alle Informationen rund um die Talks, Masterclasses und Workshops auf hrffb.de/talks / All information on talks, masterclasses and workshops at hrffb.de/en/talks
Hunger als Kriegswaffe: Wie gewaltsame Konflikte zu Hunger
führen / Hunger as a Weapon of War: How Violent Conflicts Lead to Hunger

Hunger ist eine der tödlichsten Waffen im Krieg: 85 Prozent der akut an Hunger leidenden Menschen leben in Konfliktregionen. Aushungern wird systematisch als Kriegswaffe benutzt. Was kann die internationale Gemeinschaft dagegen tun?
EN Hunger is one of the deadliest weapons in war: 85 per cent of people suffering from acute hunger live in conflict regions. Starvation is used systematically as a weapon of war. What can the international community do about it?
Präsentiert von / presented by Aktion gegen den Hunger
Im Anschluss / followed by:
Le Spectre de Boko Haram → Seite / page 89

In der Auseinandersetzung mit den drängenden Problemen des Klimawandels wird das Wissen indigener Gemeinschaften oft vernachlässigt – dabei könnte es zur Lösung beitragen.
der GIZ eine Diskussionsrunde, die indigene Stimmen aus Lateinamerika mit Entscheidungsträger*innen aus Deutschland und Europa zusammenbringt. Euroclima ist ein Programm, das von der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kofinanziert und von der GIZ mit umgesetzt wird.
zu Wort: „Indigene Völker und Bewohner*innen der Amazonasregion sollen ihre Ideen, Anliegen und Partizipationswünsche einbringen können. Ich hoffe, dass dadurch ein konstruktives Gespräch über die nachhaltige Entwicklung der Bioökonomie entsteht.“
Seit Jahrhunderten pflegen indigene Völker eine tiefe Verbundenheit mit Ihrer Umwelt sowie eine Lebensweise, die die Erde nicht als Verwaltungsraum betrachtet und eine starke identitäre Bedeutung hat. Valérie Courtois, Geschäftsführerin der kanadischen Organisation Indigenous Leadership Initiative, fasst das Ethos treffend zusammen: „Wenn wir uns um das Land kümmern, kümmert sich das Land um uns.“ Als Eckpfeiler des indigenen Lebens untermauert diese Philosophie die Praktiken, die die Gemeinschaften inmitten sich verändernder Landschaften aufrechterhalten.
Das Human Rights Film Festival Berlin hat zusammen mit dem Euroclima-Programm dazu aufgerufen, dass Filmemacher*innen indigene Perspektiven zum Klimawandel erkunden und Themen wie den Schutz der Biodiversität im Amazonasgebiet beleuchten. Ziel ist es, die Relevanz einer reflexiven Auseinandersetzung mit indigenem Wissen zu betonen und die Anerkennung und Beachtung indigener Erkenntnisse zu fördern. Die ausgewählten Filme thematisieren das komplizierte Zusammenspiel von Klimawandel, Demokratie, Umwelt und sozialer Gleichheit. Über den filmischen Teil hinaus ermöglicht das Festival in Kooperation mit Euroclima und unterstützt von
Das Diskussionsforum „Positive future scenarios: bioeconomy and sustainable development in the Amazon region“ dient als Plattform und Förderung des interdisziplinären Dialogs und Wissensaustauschs. Primär soll das Forum unterschiedliche Perspektiven, insbesondere die der indigenen Völker, mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, um das transformative Potenzial der Bioökonomie gemeinsam zu adressieren. Dieser Ansatz ist entscheidend für die Förderung einer nachhaltigen Transformation, die einen gerechten und ökologisch verantwortlichen wirtschaftlichen Wandel erfordert, der nur durch die Bewältigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Herausforderungen erreicht werden kann. Ziel ist es, die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen zu beenden – hin zu einem zirkulären, regenerativen Modell, das im Einklang mit den Grenzen der Erde steht. Um die Vision einer Bioökonomie zu verwirklichen, müssen Regierungen, die Privatwirtschaft, Expert*innen und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.
Die Teilnahme von BMZ-Vertreter*innen, Expert*innen der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Union und lateinamerikanischen Initiativen wird wichtige Einblicke geben. Im Mittelpunkt stehen die internationale Zusammenarbeit, die Politikgestaltung und die Förderung eines integrativen Dialogs für eine globale nachhaltige Entwicklung, insbesondere in der Amazonasregion. Indigenes Wissen rückt als unverzichtbarer Wert in den Fokus, um den Dialog durch Perspektiven zu bereichern, von denen politische Akteur*innen und die Zivilgesellschaft lernen können, um ihre Maßnahmen zum Klimawandel anzupassen. Bernhard Zymla, GIZ-Koordinator für das Programm Euroclima, wird das als zentrale Aufgabe adressieren. Aber auch die Menschen in den betroffenen Regionen kommen beim Round Table
In Zeiten wütender Waldbrände und andauernder Dürren, in denen sich Gemeinschaften auf das Unvorhersehbare einstellen müssen, wird der Wert indigenen Wissens immer deutlicher. Das Human Rights Film Festival Berlin will dazu beitragen, indigenen Stimmen im Klimadiskurs und in der Politik mehr Gehör zu verschaffen. Denn in einer Welt, die sich auf unbekanntem Terrain bewegt, können die Lösungen für unsere dringendsten Herausforderungen in den Wurzeln der Tradition und im Land selbst liegen. Von indigenen Völkern zu lernen und sie einzubeziehen, ist daher nicht nur eine Option, sondern ein Gebot der Stunde.¶
EN ‘If we take care of the land, the land takes care of us’
As the world grapples with the pressing realities of climate change, often-overlooked sources of knowledge can be found in Indigenous communities.
Indigenous knowledge is not a monolithic entity; rather, it comprises a diverse array of systems, values and principles, unique to each Indigenous group. For centuries, these communities have maintained profound connections to the Earth, crafting ways of life that go beyond stewardship and that have become an intrinsic part of their particular identities. Indigenous leader Valérie Courtois, member of the Innu community of Mashteuiatsh, captures this ethos succinctly: ‘If we take care of the land, the land takes care of us.’ This philosophy reflects one of many approaches within Indigenous communities and is characterised by ethical and ecologically grounded knowledge, and a profound connection to the land.
„Wenn wir uns um das Land kümmern, kümmert sich das Land um uns“
It underpins practices that sustain communities in times of upheaval.
The Human Rights Film Festival Berlin, in cooperation with the Euroclima program and the Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), has invited film-makers to delve into Indigenous perspectives on climate change and shed light on topics such as biodiversity conservation in the Amazon region. The aim is to highlight the importance of reflecting on the diversity of Indigenous knowledge systems and to recognise the multifaceted insights that Indigenous voices can offer in climate action. The selected films provide a lens through which to view the intricate interplay between climate change, democracy, the environment and social equality. Going beyond the scope of cinema, the festival, in alliance with Euroclima and with support from GIZ, has put together a roundtable connecting Indigenous voices from Latin America with decision-makers and experts from Germany and Europe. Euroclima is a program being co-funded by the European Union and the German federal government through the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and co-implemented by GIZ.
The roundtable, titled ‘Positive Future Scenarios: Bioeconomy and Sustainable
Development in the Amazon Region’, will provide a platform on which to foster cross-disciplinary dialogue and knowledge exchange. Its primary mission is to bring together diverse perspectives, including those of Indigenous peoples and other experts from various sectors. Together, they will delve into the transformative potential embedded within the bioeconomy. This concept will be crucial for driving sustainable transformation by addressing economic, social and environmental challenges within the scope of a just and eco-responsible economic shift. Achieving the vision of the bioeconomy will require collaboration between governments, the private sector, experts and civil society.

The participation of representatives from the BMZ / German Government, experts from the EU’s Directorate-General for the Environment and Latin American initiatives [tbd] will provide crucial insights into international collaboration and policy-making, fostering inclusive dialogue for global sustainable development, specifically in the Amazon region. Simultaneously, the essential value of Indigenous knowledge will take centre stage, enriching the dialogue with perspectives that policymakers and civil society can learn from and integrate into climate change action. Bernhard Zymla,
GIZ Coordinator for the Euroclima program, emphasises this central aspect: ‘At this roundtable we also want to give the floor to people living in the affected regions. Indigenous people and inhabitants living in the Amazon will talk about their ideas, concerns and desires for participation, and I hope that we can carry out a constructive discussion on the sustainable development of the bioeconomy in that region.’
This endeavour reflects the festival‘s broader commitment to bridging gaps and fostering meaningful dialogue. By creating spaces where Indigenous knowledge can meet with decision-making expertise, the festival seeks to act as a catalyser for actionable change. As wildfires rage, droughts loom, and communities brace for the unpredictable, the value of Indigenous knowledge is becoming increasingly evident. The Human Rights Film Festival Berlin will be a conduit for this expertise, recognising the urgent need to amplify Indigenous voices in climate discourse and policy-making. In a world navigating uncharted waters, the solutions to our most pressing challenges could benefit from the roots of Indigenous knowledge in tradition and the land itself. Listening, learning and incorporating Indigenous knowledge is not just optional – it‘s imperative.¶
Twice
Colonized –Über die Rechte indigener Völker

Ein Gespräch mit Aaju Peter, Anwältin und Aktivistin für indigene Rechte
In „Twice Colonized“ nimmt uns Regisseurin Lin Alluna mit auf eine bemerkenswerte Reise in das Leben und die Kämpfe von Aaju Peter, einer engagierten Verfechterin der Rechte der indigenen Völker der Arktis. Durch die Linse dieser kraftvollen Dokumentation erkunden wir die Herausforderungen, Widerstandsfähigkeit und Transformation einer Frau, die gegen die giftigen Auswirkungen des Kolonialismus kämpft. Unser Interview mit Aaju Peter, enthüllt Einsichten, die den Geist verändern und den Film zu einem unverzichtbaren Sehvergnügen machen.
Wie hat Lin Alluna Sie kennengelernt und warum haben Sie am Film mitgewirkt?
Aaju Peter: Ich habe Lin Alluna in Kopenhagen getroffen, denn ich wurde eingeladen, über die Robbenjagd und die negativen Auswirkungen des europäischen Robbenverbots auf das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Wohl der Inuit im zirkumpolaren arktischen Gebiet zu sprechen.
Lin hatte mich draußen auf einer der Straßen in Kopenhagen gesehen und mich einfach so angesprochen. Als sie mich fragte, ob ich mit ihr Kaffee trinken wolle, stimmte ich zu. Sie interessierte sich für meine Geschichte, also erzählte
ich ihr von meinem Schulbesuch in Dänemark als Kind und wie ich meine Muttersprache und meine Verbindung zu meiner grönländischen Kultur und Identität verloren habe.
Ich erzählte ihr auch von 1979. Ein Jahr nach meiner Rückkehr nach Grönland gab es ein großes Treffen von Inuit aus Grönland, Kanada und Alaska. Ich wusste bis dahin nicht, dass es andere Inuit gab als Grönländer. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe einen der kanadischen Inuit getroffen und bin mit ihm nach Iqaluit gezogen, als er 1980 zu einem Besuch nach Nunavut in Kanada zurückkehrte. Seit 1981 lebe ich in Iqaluit. Ich glaube, ich setze mich für die Rechte der Inuit ein, weil sie mir genommen wurden. Als Kind hatte ich keine Wahl – doch als Erwachsene schon, also habe ich mich dafür entschieden, die Sprache und Kultur der Inuit zu schützen.
Was soll das Publikum aus dem Film mitnehmen?
Peter: Dass andere dir ihre Sprache und Kultur aufzwingen, deinen Verstand vollständig einnehmen und dir deine Sprache und Kultur rauben können. Aber mit harter Arbeit und Beharrlichkeit kannst du zurückgewinnen, was dir genommen wurde, und darüber hinausgehen.
FILMTIPP
TWICE COLONIZED
Als Kind wurde Aaju Peter ihrer Sprache und Kultur beraubt.
Heute kämpft sie für die Rechte der Inuit.
→ Seite 84
EN As a child, Aaju Peter was deprived of her language and culture. Today she is fighting for the rights of the Inuit.
→ Page 84
Als mich jemand wütend gemacht hat, hat mir meine Schwiegermutter gesagt: „Es ist deine Wahl, wütend zu werden, niemand kann dich wütend machen.“ Sie hatte recht, denn wir haben alle eine Wahl und treffen jeden Tag Entscheidungen.

Ich habe verstanden, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen müssen, das Leben für uns selbst und für andere besser zu machen. Es geht nicht nur um dich. Es geht um uns alle.
Wo finden Sie Inspiration?
Peter: Bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich finde, ihre Herangehensweise besteht darin, dass das Leben voller Möglichkeiten steckt. Ich finde, dass ihr Denken nicht eingeschränkt ist, was im Leben alles getan werden kann. Ich finde das so erfrischend. Ich finde meine Inspiration auch bei Weltführer*innen, die trotz unglaublicher Hindernisse, Entbehrungen und scheinbar unmöglicher Ziele zu Veränderungen angeregt haben. Es inspiriert mich, dass sie am Ende eines Lebens voller Kampf durchgehalten und die Welt für andere besser gemacht haben.¶
Interview von ÁNORÂK FILM
EN ‘Twice Colonized’: The rights of Indigenous people
An interview with Indigenous rights lawyer and activist Aaju Peter
In ‘Twice Colonized’, director Lin Alluna takes us on a remarkable journey into the life and struggles of Aaju Peter, a fierce advocate for the rights of the Indigenous peoples of the Arctic. Through the lens of this powerful documentary, we explore the resilience and transformation of a woman fighting against the toxic effects of colonialism and the challenges she faces. Our interview with Aaju Peter reveals the mind-changing insights that make this film essential viewing.
How did the director approach you about the film? Why did you agree to participate?
Aaju Peter: I met Lin Alluna in Copenhagen, where I had been invited to give a talk on sealing and how the European seal ban was negatively affecting the social, economic and cultural well-
being of the Inuit in the circumpolar Arctic. Lin had seen me walking outside in one of Copenhagen’s streets. She told me that she wanted to speak with me, and when she asked me if I wanted to go for a coffee with her, I agreed. She was interested in learning more about my story, so I told her how I had been sent to school in Denmark from Greenland as a child, how I lost my mother tongue and my connection to my Greenlandic culture, and how I forgot how to be a Greenlander.
In 1979, a year after I moved back to Greenland, a big gathering of Inuit from Greenland, Canada and Alaska took place. I didn’t know that there were any Inuit other than Greenlanders. I was very much taken by this. I met one of the Canadian Inuit and moved with him to Iqaluit when he went back home to Nunavut, Canada, for a visit in 1980. I have lived in Iqaluit since 1981. I think the reason why I have fought to protect the Inuit’s rights to their language and culture is that those things were taken from me. I was just a child, and I did not have a choice. As an adult, I do have a choice, and I choose to protect Inuit language and cultural rights.
What do you want audiences to take away from this film?
Peter: That others can impose their language and culture on you and totally inhabit your mind. They can take your language and culture away from you, but with hard work and persistence, you can regain what was taken from you and go beyond it. My mother-in-law once told me, ‘It’s your choice to get angry, no one can make you angry.’ That was in response to me telling her about how someone had made me angry.
I have since come to understand that she was right. We all have choices and we all make choices every day. I have come to understand that we all need to do our part to make life better for ourselves and others. It’s not just about you. It’s about all of us.
Where do you draw inspiration from?
Peter: I draw my inspiration from children, young people and young adults. I find that their approach is to see life as something full of possibilities. I find that their minds are not constrained regarding all the things that can be done in life. I find that so refreshing. I also draw my inspiration from world leaders who have inspired change despite unbelievable obstacles, hardships and seemingly impossible goals. What inspires me is that, at the end of a lifetime of struggle, they persevered and made the world a better place for others.¶
Interviewby ÁNORÂK
FILMElla’s Riot
Die Sámi sind ein zähes Volk. Obwohl ihr Lebensraum in den nordischen Regionen von Skandinavien und Russland seit Jahrhunderten bedroht ist, verteidigt die indigene Bevölkerung ihre kulturellen und territorialen Rechte gegen Umweltverschmutzung und Klimawandel auf beeindruckende Weise.
Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ihres Heimatlandes
Sápmi begann bereits im 17. Jahrhundert und führte zu erheblichen Landverlusten. Aber auch dazu, dass sie von anderen Bevölkerungsgruppen unterdrückt wurden, Zwangsarbeit leisten mussten und ihnen ihre religiösen Praktiken verboten wurden. Sámi-Kinder wurden dazu gezwungen, in Internatsschulen zu leben, in denen ihre Muttersprache verboten war.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte nahm der Widerstand der Sámi stetig zu, angeführt von beeindruckenden Persönlichkeiten wie Elsa Laula Renberg, die Pionierarbeit leistete, mit der Organisation der ersten „Samischen Nationalversammlung“ in Trondheim am 6. Februar 1917. Dieser Tag ist heute offizieller samischer Nationalfeiertag. Im Jahr 1956 wurde der „Samische Rat“ gegründet, eine der ersten transnationalen indigenen Organisationen. Trotz der bemerkenswerten Fortschritte der Sámi in verschiedenen Bereichen, darunter Sprache, Bildung, Kunst und Medien, besteht weiterhin ein dringender Bedarf an materieller Unterstützung und formaler Anerkennung.
Schweden, Finnland und Russland haben das Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), das darauf abzielt, die Rechte indigener Völker zu schützen, noch nicht ratifiziert. Norwegen hingegen hat dieses Übereinkommen bereits 1990 angenommen und die Kontrolle über das Land der nördlichsten Provinz, Finnmark, an die dort lebende Bevölkerung übergeben. In der jüngsten Zeit sind Konflikte um Bergbau, Windparkprojekte und Fischereirechte in den Vordergrund gerückt. Auch der sogenannte „grüne Kolonialismus“ bedroht das Leben der Sámi. Dieser Begriff bezieht sich auf Projekte, die im Namen des Klimaschutzes durchgeführt werden, aber die traditionelle Lebensweise der Sámi gefährden. Obwohl Proteste der Sámi in einigen Fällen zu bedeutenden Gerichtsentscheidungen geführt haben, die ihre Rechte stärken, geht der Kampf der Sámi um den Erhalt ihrer Kultur und ihrer territorialen Rechte weiter.¶
EN The Sámi are a tough people. Although their habitat in the Nordic regions of Scandinavia and Russia has been under threat for centuries, these Indigenous people have impressively defended their cultural and territorial rights against pollution and climate change.
The eploitation of the natural resources of their homeland, Sápmi, began back in the seventeenth century, resulting in significant land loss. It also led to their oppression by other populations, forced labour and the prohibition of their religious practices. Sámi children were forced to live in boarding schools, where their native language was forbidden.
In the centuries that followed, Sámi resistance grew steadily, led by impressive figures like Elsa Laula Renberg, one of the pioneers who organised the first Sami National Assembly, held in Trondheim on 6 February 1917 – now an official Sami bank holiday. In 1956, the Sami Council was founded, one of the first transnational Indigenous organisations.
Sweden, Finland and Russia have not yet ratified International Labour Organisation (ILO) Convention 169, which aims to protect the rights of Indigenous peoples. Norway, on the other hand, adopted this convention back in 1990, handing over control of the land in the northernmost province, Finnmark, to the people living there. Recently, conflicts over mining, wind farm projects and fishing rights have come to the fore. ‘Green colonialism’ is also threatening the lives of the Sámi. This term refers to projects that are being carried out in the name of climate protection but jeopardising the Sámi’s traditional way of life. Although Sámi protests have led to some significant court decisions that have strengthened their rights, the Sámi are still fighting to preserve their culture and territorial rights.¶
Anna Ramskogler-WittFILMTIPP
RAHČAN – ELLA’S RIOT
Sängerin Ella verlässt die große Bühne – und stellt sich dem Bergbau entgegen, der ihre samische Heimat bedroht. → Seite 84
EN Singer Ella leaves the big stage – and risks everything when she confronts the mining operations threatening her Sámi home.
→ Page 84

You’ve been talking over me Seconds, minutes turn into hours
And I keep on waiting For you to start listening Is any of this sinking in?

Here I am offering guidance
Cause we’re out here fighting for fundamental rights
And we’ll keep on fighting for the rest of our lives
re:combine your thoughts.
Demonstration in Lützerath gegen den Braunkohlentagebau Garzweiler II / Demonstration in Lützerath against the brown coal mine Garzweiler II
How to become an activist
Klimakrise, Hunger, Verletzung der Frauenrechte – wo wir hinschauen, so scheint es oft, gibt es Krisen. Als Aktivist*in kommt man irgendwann an den Punkt, dass all diese Probleme viel zu groß wirken. „Können wir das überhaupt schaffen?“ Das ist eine völlig legitime Frage – und die Antwort darauf hat niemand. Aber bleibt uns eine andere Wahl, als wenigstens den Versuch einer Veränderung zu unternehmen? Realistisch betrachtet: Nein!
EN Hunger, the climate crisis, women’s rights violations – everywhere you look, it seems, there are crises. As an activist, you eventually reach the point where all these problems seem far too big.
‘Can we even do this?’ – it’s a perfectly legitimate question. No one has the answer. But do we have any other choice but to at least try to make a change? Realistically speaking, no!
Deshalb sollten wir alle aktiv werden –und dafür gibt es viele Möglichkeiten:
EN That’s why we should all take action –and there are countless ways to do so:
lung. Aber eine große Demonstration ergibt ein starkes Zeichen und ist für die Teilnehmenden sehr empowernd.
1
Erzählen – Nichts ist einfacher, als seinen Liebsten davon zu erzählen, was einen bewegt. Und nebenbei tut es unheimlich gut, sich die Sorgen von der Seele zu reden.
EN Talking – Nothing is easier than sharing what’s on your mind with your loved ones. And besides, it’s really good to get your worries off your chest.
EN Demonstrations – Taking part in demonstrations takes a bit more time. But a large protest makes a powerful statement and is very empowering for those who participate.
4
Gruppen bilden – Du kannst dich einer Gruppe anschließen, um genau deine Fähigkeiten einzubringen und selbst Sachen zu organisieren – seien es Demos, Petitionen oder Aktionen.
2
Petitionen – Zu zeigen, dass du eine Forderung unterstützt, dauert oft nur Sekunden und erfordert wenige Klicks oder eine Unterschrift. Und richtig viele Unterschriften sind ein starkes Druckmittel für Verantwortliche.
EN Petitions – Showing that you support a cause often takes only seconds and requires just a few clicks or a signature. And having a lot of signatures is powerful leverage against those in charge.
3
Demonstrieren – Ein bisschen mehr Zeitaufwand erfordert die Teilnahme an einer Versamm-
EN Groups – Join a group to apply your skills to organise things yourself, be they demonstrations, petitions or campaigns.
5
Gespräche mit Politiker*innen –Schreibe Politiker*innen aus deinem Wahlkreis und bitte vielleicht sogar um ein Gespräch. Wenn das viele Leute tun, übt es enormen Druck aus.
EN Conversations with politicians –Write to politicians from your electoral district and maybe even ask to talk to them. If a lot of people do this, it exerts enormous pressure. ¶
Kilian Wolter, Greenpeace Jugend

FILMTIPP
WE ARE GUARDIANS
„We are Guardians“ ist ein super Film und sollte unbedingt angeschaut werden, weil er die dramatische Abholzung im Regenwald deutlich macht. Zuschauer*innen bekommen gute Einblicke in das Leben indigener Menschen, ihre Perspektiven und die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Außerdem werden in dem Film die Schlüsselrollen indigener Völker als Beschützer*innen der Natur deutlich. Für mich steht fest: Wir müssen dringend etwas gegen die Zerstörung von Ökosystemen tun! → Seite 85

EN ‘We are Guardians’ is an awesome, must-watch film because it highlights the dramatic deforestation of the rainforest. Viewers get good insights into the lives of Indigenous people, their perspectives and the dangers they face. In addition, the key role played by Indigenous peoples as guardians of nature becomes clear in the film. For me, there’s no doubt about it: we urgently have to do something about ecosystems being destroyed! → Page 85
Simon Käsbach, Greenpeace Jugend
Menschenrechte in Gefahr –die Rückkehr der Geopolitik
Russlands Einmarsch und seine Folgen: Ein Blick in eine unsichere Zukunft, in der Klima-, Menschenrechte und der Kampf für Freiheit auf dem Spiel stehen.
Die Geopolitik ist zurück –so heißt es allerorten seit dem brutalen Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022. Mit der „Rückkehr der Geopolitik“ wird jedoch nicht nur die zynische Machtpolitik von Wladimir Putin und die harte westliche Antwort darauf mit Sanktionen, der Suche nach neuen Energielieferanten, Waffenlieferungen an die Ukraine und der Aufrüstung beschrieben, sondern auch der Machtkampf zwischen den USA und China um die Vorherrschaft im pazifischen Raum. Eine
neue Ära der kalten, rein interessengeleiteten Außen- und Sicherheitspolitik steht der Menschheit womöglich bald bevor. Eine Ära, in der Menschenrechte und sozial-gerechte Ressourcenpolitik weltweit noch stärker unter Druck geraten dürften, als es schon vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine der Fall war. Das gilt für die Innenpolitik der Staaten, die – unter der Prämisse der eigenen Sicherheit – mit Populismus und dem Aufruf zur Abschottung Europas zum Erstarken rechter Parteien führt. Es gilt aber auch für die Außenpolitik, in der schnell das Interesse an guten Beziehungen zu einem Partnerstaat über das Ziel triumphiert, in diesem Staat Menschenrechte gewahrt zu sehen. Der Kalte Krieg, insbesondere in seinen ersten beiden Jahrzehnten, bietet das traurige Anschauungsmaterial dazu, wie die gerade anbrechende neue Ära der Geopolitik aussehen könnte.
In Zeiten wie diesen dürfen wir zwei Dinge nicht vergessen. Erstens: Wir brauchen offene und diverse Gesellschaften, um den anderen großen Bedrohungen der Menschheit – der Erderhitzung und dem Verlust der Biodiversität – begegnen zu können. Ohne den mutigen Kampf der Aktivist*innen
rund um den Globus werden sich die Konzern- und Machtinteressen durchsetzen und Klima und Umwelt existenzielle Schäden erleiden. Zweitens: Frieden und wahre Sicherheit, d. h. Sicherheit für alle Menschen und vom einzelnen Menschen aus gedacht, kann es nur geben, wenn die Rechte der*des Einzelnen gewahrt sind. Soziale Rechte, Geschlechtergerechtigkeit, das Recht auf Leben in einer gesunden Umwelt, das Recht auf Zugang zu Bildung, das Recht auf Unversehrtheit, freie Meinungsäußerung und Menschenrechte: All diese Aspekte sind die Grundlage für eine aktive und starke Zivilgesellschaft. Greenpeace hat im jahrzehntelangen Kampf der Organisation für Umwelt und Frieden davon profitiert, dass andere zuvor das Fundament für eine starke Zivilgesellschaft und damit für unsere Proteste und Aktionen erkämpft haben. Es ist einer unserer Grundwerte, mit unserer Arbeit dazu beizutragen, dieses Fundament zu erhalten und zu stärken. Die Versenkung unseres Schiffs Rainbow Warrior, das für den Protest gegen französische Atombombentests zum Einsatz kam, durch den französischen Geheimdienst im Jahr 1985, bei der unser Aktivist Fernando Pereira getötet wurde, mahnt uns, wie kostbar und fragil die Gesellschaften sind, in denen wir leben und kämpfen.
Die „Rückkehr der Geopolitik“ ist eine direkte Bedrohung der Gesellschaften, die heute in Freiheit leben und Unterdrückung und Unfreiheit überwinden

„Wir brauchen offene und diverse Gesellschaften, um den anderen großen Bedrohungen der Menschheit – der Erderhitzung und dem Verlust der Biodiversität – begegnen zu können.“© Lorenzo Moscia / Greenpeace
wollen. Die Filme beim Human Rights Film Festival Berlin, die vom Kampf so vieler mutiger Menschen für die Wahrung der Menschenrechte berichten, sind Inspiration und Mahnung zugleich. Sie zeigen, was für so viele Menschen noch erreicht werden muss, und sie mahnen, was zu verlieren ist. ¶
Anna von Gall
EN Human rights at risk: The return of geopolitics
Russia’s invasion and its consequences: a glimpse into an uncertain future where human rights, the climate and the fight for freedom are at stake
Geopolitics are back – that is what everybody has been saying since Russia launched its brutal invasion of Ukraine on 24 February 2022. However, the buzzword ‘return of geopolitics’ describes not only Vladimir Putin’s cynical power politics and the harsh Western sanctions imposed in response, the search for new energy suppliers, arms deliveries and rearmament, but also the power struggle between the US and China for dominance in the Pacific region. A new era of cold, purely interest-driven foreign and security policy could soon be on the horizon – an era in which human rights and sustainable resource policies are likely to come under even greater pressure worldwide than before the war started in Ukraine. This applies to the internal state policies that – under the premises of national security – are leading to the strengthening of populist right-wing politics and calls to isolate Europe. But it also applies to foreign policy, where the interest in good relations with partner states quickly trumps the goal of seeing human rights upheld in those states. The Cold War, in particular its first two decades, is a sad example of what the dawn of the new era of geopolitics could look like.
In times like these, we should not forget two things: firstly, we need open and diverse societies to confront the other
major threats facing humanity – global warming and dwindling biodiversity. Without the courageous struggles of activists around the globe, corporate and power interests will dominate, and the environment will suffer existential damage. Secondly, peace and true security – meaning security for all people – can only exist if individual rights are upheld: social rights, gender justice, the right to live in a healthy environment, the right to access education, the right to integrity, freedom of expression and human rights. All of these form the foundation for a strong, active civil society.
In its decades-long struggle for the environment and peace, Greenpeace has benefited from the fact that others have previously fought for a strong civil society and thus laid the foundations for our protests and campaigns. It is one of our core values to help maintain and strengthen this foundation through our work. The sinking of a ship Greenpeace was using to protest French nuclear tests, the Rainbow Warrior, by French intelligence agents in 1985, which killed Greenpeace activist Fernando Pereira, reminds us how precious and fragile the societies are in which we live and struggle.
TALKING HUMANITY
DAS STREBEN
NACH FRIEDEN:
EINE UMFASSENDE SICHTWEISE
EN PURSUING
PEACE: A HOLISTIC PERSPECTIVE
→ 15. Okt., 18:30 Uhr
→ Dokumentationszentrum
→ Im Anschluss / followed by:
This Kind of Hope (Seite 89 / page 89)
→ Mehr Informationen auf Seite 26 / more information on page 26
The ‘return of geopolitics’ poses a direct threat to the societies that live in freedom today and want to overcome oppression and the lack of freedom elsewhere. The films at the Human Rights Film Festival Berlin, which tell the stories of so many courageous people fighting to uphold human rights, are both an inspiration and a reminder. They show what still needs to be achieved for so many people, and they remind us of what we have to lose.¶
‘We need open and diverse societies to confront the other major threats to humanity – global warming and the loss of biodiversity.’Anna von Gall ist PolitikCampaignerin bei Greenpeace und leitet das europäische Projekt „Climate for Peace“. / Anna von Gall is a political campaigner at Greenpeace and heads the European Climate for Peace project. © Lucas Wahl / Greenpeace
FILMTIPP THEATRE OF VIOLENCE

Kann ein Mensch
Henker und Opfer zugleich sein?
→ Seite 89
EN Can a person be both victim and perpetrator?
→ Page 89
Kindersoldaten: Opfer oder Täter?
Manfred Nowak ist Jurist und Professor für internationale Menschenrechte. Von 2004 bis 2010 war er als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter tätig. In seinem Essay schreibt er über seine Erfahrungen, den Weg von Kindersoldaten und die Frage von Schuld.
Im Oktober 2019 präsentierte ich der Generalversammlung der Vereinten Nationen als unabhängiger Experte und Lead Author eine Studie, in der es um die Frage der ethischen und rechtlichen Zulässigkeit des Freiheitsentzugs von Kindern ging. Denn während Erwachsene für ihre Verbrechen in Polizei-, Untersuchungs-, Straf- oder Schubhaft genommen werden und sogar lebenslang eingesperrt werden dürfen, ist die Kinderrechtskonvention diesbezüglich restriktiver: Artikel 37(b) bezeichnet die Haft von Kindern als allerletztes Mittel. Es darf nur dann zur Anwendung kommen, wenn ein Kind (bis zum 18. Lebensjahr) so gefährlich ist, dass gelindere Maßnahmen nicht ausreichen, um andere Menschen (oder auch das Kind vor sich selbst) zu schützen.
Der Grund dafür: Kinder und Jugendliche befinden sich in einem Entwicklungs- und Bewusstseinsstadium, in dem sie für ihre Taten nicht oder nur sehr beschränkt zur Verantwortung gezogen werden dürfen. Außerdem stellt der Freiheitsentzug von Kindern ein Mittel der strukturellen Gewalt dar, die in der Regel nicht zur „Besserung“ des Verhaltens des Kindes, sondern zu dessen Verrohung führt – also eher eine Spirale der Gewalt auslöst.
Die Studie mit dem Titel „United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty“ hat auf der Basis empirischer Studien und der Auswertung einer großen Zahl statistischer Daten festgestellt, dass konservativ geschätzt weltweit mehr als 7 Millionen Kinder hinter Gittern sitzen. Der weitaus größte Teil
betrifft Kinder, die wegen schwieriger familiärer Umstände, einer Behinderung oder wegen ihres unangepassten oder unsozialen Verhaltens in sogenannten Institutionen – von Waisenhäusern bis zu Anstalten für „schwer erziehbare“ Kinder – untergebracht sind. Die zweitgrößte Gruppe betrifft Kinder, die schon strafmündig sind (in den meisten Staaten ab 14 Jahren) und wegen einer Straftat in Polizei-, Untersuchungs- oder Strafhaft sitzen. Viele Kinder oder Minderjährige, die mit ihren Familien oder unbegleitet aus ihren Herkunftsländern geflüchtet oder ausgewandert sind, befinden sich heute in geschlossenen Flüchtlingslagern oder Schubhaftzentren. Für alle diese Kinder fordert die Global Study ein radikales Umdenken, nämlich Deinstitutionalisierung, Diversion und Verbot der Migrationshaft, und in vielen Staaten führen diese Empfehlungen auch dazu, dass deutlich weniger Kinder hinter Gittern sitzen.
Zwei Kapitel befassen sich mit Kindern in bewaffneten Konflikten und solchen, die aus Gründen der nationalen Sicherheit, also vor allem wegen einer Mitgliedschaft in terroristischen oder extremistischen Organisationen, in Haft sind. Kinder und Jugendliche werden häufig durch soziale Medien oder Hassprediger in den Bann von extremistischen oder terroristischen Organisationen wie dem sogenannten Islamischen Staat in Syrien oder im Irak gezogen. In vielen afrikanischen Staaten wie Sierra Leone, Uganda, Somalia und Nigeria werden Kinder von bewaffneten Gruppen entführt und gezwungen, als Kindersoldaten zu kämpfen und an vorderster Front besonders grausame Gewalttaten wie Folter, Vergewaltigungen oder Verstümmelungen zu begehen. Ich habe in meiner früheren Rolle als UNO-Sonderberichterstatter über Folter junge Menschen in Gefängnissen interviewt, die etwa zuerst von bewaffneten Gruppen wie den Maoisten in Nepal oder den Tamil Tigers in Sri Lanka aus der Schule entführt und als Kindersoldaten missbraucht, nach einem möglichen Fluchtversuch gefoltert und durch Verstümmelungen grausam bestraft und schließlich von Regierungstruppen festgenommen und wegen ihrer Mitgliedschaft in diesen bewaffneten Gruppen wieder gefoltert und bestraft wurden –
ein fürchterlicher Teufelskreis, aus dem zu entkommen fast unmöglich schien.
Sind diese Kinder Opfer oder Täter? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Film „Theatre of Violence“, der den bekannten Fall des Kindersoldaten Dominic Ongwen behandelt, der im Alter von neun Jahren von der besonders brutalen Lord’s Resistance Army (LRA) im Norden Ugandas entführt, schon als Kind zu grausamen Verbrechen gezwungen wurde und sich später bis zu einem der führenden Kommandanten der LRA hochgearbeitet hat. Er wurde 2021 vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag (International Criminal Court = ICC) wegen besonders brutaler Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ongwen gab zu, diese Verbrechen begangen zu haben. In seiner Berufung führte er jedoch aus, dass ihm seine schrecklichen Erfahrungen als Kindersoldat und das brutale Regime der LRA keine andere Wahl gelassen hätten, als diese schweren Verbrechen zu begehen.
Konservativ geschätzt sitzen mehr als 7 Millionen Kinder weltweit hinter Gittern.
Dieser Zwang und seine daraus folgende psychische Krankheit seien Schuldausschließungsgründe – auch noch für Taten, die er im Erwachsenenalter begangen hat. Die Berufungskammer lehnte diese Argumentation ab und bestätigte die 25-jährige Haftstrafe des damals 40-jährigen ehemaligen Kindersoldaten.
In der Global Study haben wir gefordert, dass Kindersoldaten und Kinder als Mitglieder terroristischer oder extremistischer Organisationen vor allem als Opfer und nicht als Täter behandelt werden sollten. Das bedeutet, dass sie in der Regel nicht verhaftet, verfolgt und bestraft werden dürfen, sondern durch Rehabilitierungs- und Deradikalisierungsmaßnahmen wieder in die Gesellschaft integriert und im Idealfall mit ihrer Familie vereint werden sollten.
Auch das Römische Statut des ICC sieht vor, dass Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr für ihre Taten nicht vor dem ICC zur Verantwortung gezogen werden dürfen.
Aber gilt das auch für ehemalige Kindersoldaten, die im Erwachsenenalter schwere Verbrechen begehen?
Das Strafrecht beruht auf dem römisch-rechtlichen Grundsatz „Nulla poena sine culpa“ – keine Strafe ohne Schuld. Dieses Schuldprinzip bedeutet, dass Menschen für ihre Straftaten nur dann zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie auch wirklich schuldhaft – vorsätzlich oder fahrlässig –gehandelt haben. Kinder sind bis zum Alter der Strafmündigkeit, in der Regel 14 Jahre, absolut schuldunfähig, weil ihnen die Reife fehlt, das Unrecht ihrer Taten einzusehen. Jugendliche bis 18 Jahre sind nur bedingt schuldfähig. Aber auch Erwachsene, die an einer krankhaften seelischen Störung oder tiefgreifenden Bewusstseinsstörung leiden oder im Vollrausch eine Straftat begehen, können als schuldunfähig von der Strafe ausgenommen werden. Auch wenn Kindersoldaten wegen ihrer schrecklichen Erfahrungen in der Kindheit meist ein Leben lang schwer traumatisiert sind, kommen sie doch in ein Alter, in dem sie wie andere Erwachsene für ihre als Erwachsene begangenen Verbrechen schuldfähig sind und daher auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Ausnahmen gelten nur, wenn sie wirklich beweisen können, dass sie wegen ihrer schrecklichen Erfahrungen als Kindersoldaten an einer krankhaften seelischen Störung leiden, die ihre Zurechnungs- und Schuldfähigkeit ausschließt. Eine solche Entscheidung kann ein Strafgericht wie das ICC allerdings nur im Einzelfall unter Abwägung aller Umstände mit der Einbeziehung psychiatrischer Gutachten treffen. Auch wenn kein Schuldausschließungsgrund vorliegt, sollten die traumatischen Erfahrungen als Kindersoldat bei der Strafzumessung als mildernde Umstände berücksichtigt werden, wie eine Richterin des Internationalen Gerichtshofs in einer abweichenden Meinung hervorhob. Das ethische Dilemma bleibt: für die Opfer dieser Verbrechen, für die Täter, die auch gleichzeitig Opfer
sind, für die Richter und Richterinnen, die über solch schwierige Fragen entscheiden müssen, und für die Gesellschaft. Viel besser wäre es, wenn das völkerrechtliche Verbot der Rekrutierung von Kindersoldaten endlich in der Praxis durchgesetzt würde. Aber leider sieht die Realität anders aus: Oft sind es (ehemalige) Kindersoldaten wie Dominic Ongwen, die neue Kindersoldaten rekrutieren.¶
EN Child soldiers: Victims or perpetrators?
Manfred Nowak is a lawyer and Professor of International Human Rights. From 2004 to 2010, he served as the United Nations Special Rapporteur on Torture. In this essay he writes about his experiences, the path taken by child soldiers and the question of guilt.
In October 2019, I presented a study to the United Nations General Assembly as an independent expert and lead author, focusing on the ethical and legal permissibility of depriving children of their freedom. While adults can be taken into police custody, investigated, put on trial or even imprisoned for life for their crimes, the Convention on the Rights of the Child is more restrictive. Article 37(b) designates the detention of children as a measure of last resort. It should only be applied when a child (up to the age of 18) is deemed to be so dangerous that milder measures are insufficient to protect other people or the child themselves from harm.
The reason for this is that children and adolescents are in a stage of development and consciousness where they should not or can only be held to limited account for their actions. Moreover, depriving children of liberty constitutes a form of structural violence that usually
leads not to the ‘improvement’ of the child’s behaviour but to its deterioration, thus triggering a spiral of violence.
The study, titled ‘United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty’, found, based on empirical studies and the evaluation of a large number of statistical data, that, conservatively estimated, more than 7 million children worldwide are behind bars. The vast majority of them are children placed in so-called ‘institutions’, ranging from orphanages to facilities for ‘difficult-to-manage’ children, due to challenging family circumstances, disabilities or their non-conforming and antisocial behaviour. The second-largest group includes children who have already been deemed criminally responsible (in most states from the age of 14) and are in police custody, under investigation or serving a sentence. Many children or minors who have fled or emigrated from their countries of origin, either with their families or alone, are currently being held in closed refugee camps or detention centres. The Global Study calls for a radical rethinking of the system for all these children, namely towards deinstitutionalisation, diversion and a ban on migrant detention. In many states, these recommendations have led to significantly fewer children behind bars.
Two chapters of the study deal with children in armed conflicts and those detained for reasons of national security, mainly due to their affiliation with terrorist or extremist organisations. Children and adolescents are often lured in under the influence of extremist or terrorist organisations, such as the so-
called Islamic State in Syria and Iraq, through social media or hate preachers and then forced to commit particularly brutal crimes. In many African countries, like Sierra Leone, Uganda, Soma-
Conservatively estimated, more than 7 million children worldwide are behind bars.
lia and Nigeria, children are abducted by armed groups and forced to become child soldiers, engaging in extremely violent acts on the front lines, including torture, rape and mutilation. In my previous role as the UN Special Rapporteur on Torture, I interviewed young people in prisons who had been abducted from school and abused as child soldiers by armed groups like the Maoists in Nepal and the Tamil Tigers in Sri Lanka. After attempting to escape, they had been tortured and cruelly punished by means of mutilation and eventually rearrested and subjected to torture and punishment by government forces due to their affiliation with those armed groups –a horrific cycle from which escape seemed nearly impossible.
Are these children victims or perpetrators? This question is explored in the film ‘Theatre of Violence’, which deals with the well-known case of child soldier Dominic Ongwen. He was abducted at the age of nine by the particularly brutal Lord‘s Resistance Army (LRA) in Northern Uganda, forced to commit cruel crimes as a child and later rose to become one of the leading commanders in the LRA. In 2021, he was sentenced to 25 years in prison by the International Criminal Court (ICC) in The Hague for particularly brutal war crimes and crimes against humanity. Ongwen admitted to committing these crimes. However, in his appeal, he argued that his terrible experiences as a child soldier and the brutal LRA regime had left him with no choice but to commit these serious crimes. He claimed that his compulsion and resulting mental illness should be considered grounds for exonerating his crimes, even crimes he had committed as an adult. The appeals chamber rejected this argument and upheld the 25-year sentence for the former child soldier, who was then 40 years old.
In the Global Study, we demand that child soldiers and children involved in terrorist or extremist organisations be treated primarily as victims and not as perpetrators. This means that they should generally not be arrested, prosecuted or punished, but rather reintegrated into society through rehabilitation and deradicalisation measures, ideally reuniting them with their families. The
ICC’s Rome Statute also stipulates that children under the age of 18 should not be held accountable for their actions before the ICC.
But what about former child soldiers who commit serious crimes as adults?
Criminal law is based on the Roman legal principle Nulla poena sine culpa – no punishment without guilt. This principle means that individuals can only be held accountable for their criminal acts if they have acted with culpability – intentionally or negligently. Children are absolutely incapable of culpability until they reach the age of criminal responsibility, usually at 14 years, because they lack the maturity to understand the wrongfulness of their actions. Adolescents up to the age of 18 are only partially culpable. However, adults who suffer from a severe mental disorder or profound impairment of consciousness, or who commit a crime while in a state of full intoxication, can be exempted from punishment due to lack of culpability. Even though child soldiers are usually deeply traumatised for life due to their terrible childhood experiences, they eventually reach an age where, like other adults, they become criminally responsible for crimes committed as adults and can therefore be held accountable under criminal law. Exceptions apply only if they can truly demonstrate that their terrible experiences as child soldiers have led to a severe mental disorder that excludes them from being held responsible. Such a decision can only be made by a criminal court like the ICC on a case-by-case basis, taking into account all circumstances and considering psychiatric assessments. Even when there are no grounds for exoneration, the traumatic experiences they had as child soldiers should be taken into account as mitigating factors in sentencing, as highlighted by a judge at the International Court of Justice in a dissenting opinion. The ethical dilemma remains – for the victims of these crimes, for the perpetrators who are also victims, for the judges who must decide on such difficult issues and for society. It would be much better if the international legal prohibition against recruiting child soldiers was finally enforced in practice. Unfortunately, the reality is different: often, it is (former) child soldiers like Dominic Ongwen who recruit new child soldiers.¶
TALKING HUMANITY
DAS ETHISCHE DILEMMA: WENN KINDERSOLDATEN VON OPFERN ZU TÄTERN WERDEN
EN THE ETHICAL DILEMMA: WHEN CHILD SOLDIERS BECOME PERPETRATORS
→ 13. Okt., 18:30 Uhr
→ Dokumentationszentrum
→ Im Anschluss / followed by: Theatre of Violence (Seite 89 / page 89)
→ Mehr Informationen auf Seite 26 / more information on page 26
Manfred Nowak ist ein österreichischer Jurist und Menschenrechtsanwalt. / Manfred Nowak is an Austrian jurist and human rights lawyer.

Aufbau der ukrainischen Resilienz
Letztes Jahr startete Greenpeace Mittel- und Osteuropa (CEE) ein Projekt in der Ukraine mit dem Ziel, sich für neue saubere Technologien beim Wiederaufbau von Städten und Dörfern einzusetzen. Dies ist die Geschichte eines kleinen Krankenhauses in Horenka, das zum Vorreiter wurde.
Die Explosionen begannen in Horenka am Morgen des 24. Februar. So erfuhren die Einwohner*innen am ersten Tag des Krieges vom Einmarsch der russischen Truppen. Die Luftangriffswarnung funktionierte nicht und die Menschen verbrachten Stunden und dann Tage in den Kellern ihrer Häuser. Zwar gelang es den russischen Truppen nicht, Horenka einzunehmen, doch mehr als hundert Einwohner*innen wurden bei den Angriffen getötet und Tausende mussten aus ihren Häusern fliehen.
Die ortsansässige Ärztin Olena Opanasenko erzählte uns, dass das Krankenhaus in Horenka trotz des Krieges, der draußen tobte, weiter funktionierte. „Ich war mit einem anderen Arzt im Krankenhaus. Wir versuchten weiter, Menschen zu behandeln“, erinnert sie sich. „Am 25. Februar 2022 wurde die Stromversorgung des Krankenhauses unterbrochen und erst im Mai wiederhergestellt.“ Eine russische Granate schlug vor der Klinik ein, sprengte die Fenster heraus und beschädigte die Fassade des Gebäudes. Die fehlende Stromversorgung führte zu einem Ausfall des Heizungssystems und auch die kalte Jahreszeit machte den Heizanlagen zu schaffen.
Greenpeace CEE und ukrainische Organisationen starteten ein Projekt zur Installation einer Wärmepumpe und einer Solaranlage im Krankenhaus. Nun verfügt es über ein modernes Heizsystem, mit dem das gesamte Gebäude dank der Solarpaneele beheizt und wieder genutzt werden kann – selbst bei Stromausfällen. Nach vorläufigen Schätzungen wird das Krankenhaus seine Heizkosten dadurch um 80 Prozent senken können und die Hybrid-Solaranlage könnte bis zu 60 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs des Gebäudes decken.
„Wenn es um eine langfristige Perspektive geht, müssen wir moderne energieeffiziente Technologien nutzen, die nicht nur Geld sparen, sondern
auch die CO2-Emissionen und unsere negativen Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Wir wollen nicht, dass die von den internationalen Partnern für den Wiederaufbau bereitgestellten Gelder für ineffiziente alte Technologien ausgegeben werden, die das Land weiterhin in die Energieabhängigkeit treiben und die CO2-Emissionen noch weiter erhöhen“, sagt Denys Tsutsaiev, Aktivist von Greenpeace CEE. Dieses kleine Krankenhaus in Horenka ist eines von Tausenden, die während des Krieges zerstört wurden. Gleich nach der Befreiung der Städte kehrten viele Ukrainer*innen in ihre Heimat zurück und begannen mit dem Wiederaufbau der zerstörten Gebäude. Die Menschen bauten ihre Häuser, Schulen und Krankenhäuser wieder auf und errichteten neue Infrastrukturen. Die entscheidenden Prinzipien sollten sein: „Build Back Better“. Das Krankenhaus zeigt, dass ein grüner Wiederaufbau auch in Kriegszeiten möglich ist. Dieses und ähnliche Projekte sind Investitionen in unsere gemeinsame europäische Zukunft, die in grüne Energielösungen fließen müssen.¶
EN Building Ukrainian resilience
Last year, Greenpeace Central and Eastern Europe (CEE) launched a project in Ukraine that is working towards providing new clean technologies for the reconstruction of towns and villages. This is the story of a small hospital in Horenka that became an example of green reconstruction.

The explosions began in Horenka on the morning of 24 February. That was how local residents learned about Russia’s invasion on the first day of the war. The alert system for air raids was not working, and people spent days in their basements. Although the Russian troops did not succeed in capturing Horenka, more than a hundred residents were killed in the attacks, and thousands had to flee their homes.
Local doctor Olena Opanasenko told us that the hospital in Horenka continued to operate despite the war raging outside. ‘I was at the hospital with another doctor. We continued to treat people,’ she recalls. ‘On 25 February 2022, the hospital’s power supply was cut off, and it wasn‘t restored until May.’ A Russian grenade struck in front of the clinic, blowing out the windows and damaging the building’s facade. The lack of electricity caused the heating system to fail, with the cold weather also taking its toll.
Greenpeace CEE and Ukrainian organisations launched a project to install a heat pump and a solar system in the hospital. Now it has a modern heating system, and thanks to the solar panels, the entire building can be used again – even during power shortages. According to estimates,

the new technology could reduce heating costs by 80 per cent, and the hybrid solar system could meet up to 60 per cent of the building’s annual energy needs.
‘When it comes to a long-term perspective, we need to use advanced energy-efficient technologies that not only save money but also reduce CO2 emissions and our negative impact on the environment. We don‘t want the funds that are being supplied by international partners for reconstruction to be spent on old, inefficient technologies that will continue to drive the country into energy dependency and further increase CO2 emissions,’ says Denys Tsutsaiev, activist with Greenpeace CEE.
This small hospital in Horenka is one of thousands destroyed during the war. Immediately following liberation in cities, many Ukrainians have returned to their homes and started restoring destroyed buildings. People have rebuilt their houses, schools and hospitals and established new infrastructures. The key principle should be: ‘Build back better’. The hospital shows that green reconstruction is possible, even in times of war. This and similar projects are investments in our shared European future that need to go into green energy solutions.¶
FILMTIPP WHEN SPRING
CAME TO BUCHA
Die Überlebenden der ukrainischen Kleinstadt Bucha stehen vor einem existenziellen Neuanfang. → Seite 90 EN The survivors in the small Ukrainian town of Bucha face a new beginning. → Page 90

FILMTIPP CHILDREN OF THE TALIBAN

Vier Kinder in Kabul, Afghanistan, deren Leben sich dramatisch verändert hat, seit die USA ihre Truppen abgezogen und die Taliban die Macht übernommen haben.
→ Seite 92
EN Four children in Kabul, Afghanistan whose lives have changed dramatically since U.S. troops completed their withdrawal from the country and the Taliban swept to power. → Page 92
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit – und Neutralität: Das sind die vier Grundprinzipien der humanitären Hilfe. Doch zunehmend wird die Bedeutsamkeit der Neutralität infrage gestellt. Ein Pro und Kontra.
Darf humanitäre Hilfe neutral sein? Pro
Vor allem in Kriegsregionen ist Neutralität ein sehr schwieriges und oft undankbares Unterfangen. Aktuell hat der russische Krieg in der Ukraine die Debatte um humanitäre Neutralität nochmals verschärft: Wie können wir angesichts der dokumentierten Kriegsverbrechen in der Ukraine, wie sie uns der Eröffnungsfilm des diesjährigen Festivals („20 Days in Mariupol“) eindrucksvoll und schmerzhaft vor Augen führt, „neutral“ sein? Aber auch in Krisenregionen wie in Syrien, Äthiopien und Afghanistan, wo Menschenrechte massiv verletzt werden, taucht die berechtigte Frage auf: Darf humanitäre Hilfe neutral sein?
Für uns als humanitäre Organisation lautet die Antwort: Ja, wir müssen den Anspruch haben, neutral zu sein, wenn wir Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung helfen möchten. Das ist unser Mandat. Dabei ist Neutralität kein Wert an sich, sondern eine notwendige Grundlage, um überhaupt humanitäre Hilfe leisten zu können. Unsere Aufgabe ist es, möglichst vielen Menschen in Not ein Überleben in Würde zu bieten. Das geht nur, wenn wir sicheren humanitären Zugang zu den betroffenen Gemeinden haben, um die Menschen vor Ort mit Nahrung, Wasser und Medikamenten versorgen zu können. Werden wir als parteiisch und nicht neutral wahrgenommen, ist der sichere Zugang gefährdet. Vermehrte Angriffe auf humanitäre Helfer*innen zeigen, wie real diese Gefahr ist. Wir müssen also mit allen
beteiligten Akteuren sprechen und sie überzeugen, dass wir neutrale und unparteiische humanitäre Hilfe leisten.
Zur Realität gehört auch, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen unsere neutrale Position herausgefordert wird. Als die Taliban im vergangenen Dezember ein Berufsverbot für Frauen im Hilfssektor in Afghanistan aussprachen, standen wir vor einem Dilemma: Unsere überlebenswichtige Arbeit wurde vom einen auf den anderen Tag massiv eingeschränkt, denn 400 unserer rund 1.000 Mitarbeitenden in Afghanistan sind Frauen. Insbesondere für unsere Ernährungs- und Gesundheitsprogramme sind weibliche Fachkräfte essenziell. Humanitäre Hilfe ohne Frauen? Undenkbar!
Mit Ausnahmegenehmigungen konnten auch Frauen in medizinischen Einrichtungen arbeiten. Wir haben nach Lösungen gesucht, um unsere Arbeit, die wir vorübergehend unterbrechen mussten, wieder aufzunehmen – mit unseren weiblichen Mitarbeitenden. Dabei haben wir immer wieder an die Behörden appelliert, die Ausgrenzungsmaßnahmen für Frauen zu beenden, denn sie gefährden das Leben von Millionen von Menschen. Neutralität im humanitären Kontext bedeutet eben nicht Gleichgültigkeit, sondern das Gegenteil: Das Prinzip der Menschlichkeit leitet unser Handeln. Manchmal müssen wir schmerzhafte Kompromisse eingehen, um unser Mandat zu erfüllen: Menschenleben retten.¶
Dr. Helene Mutschler
Kontra
Vier Grundsätze – Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit – gelten als die Grundlagen humanitärer Maßnahmen. Ohne sie, so heißt es, können Hilfskräfte weder legitim noch effektiv sein.
Zu lange wurde vorgeschlagen, dass internationale Organisationen humanitäre Aktionen dominieren sollten, weil nur sie wirklich neutrale Dritte im Krieg sein können.
Es ist an der Zeit, diese Annahmen zu hinterfragen.
Das neutrale humanitäre Modell, das heute als internationale Norm domi-
nant ist, stammt weitgehend aus dem Einfluss der schweizerischen politischen Ideologie. Im Jahr 1815 verhandelte Charles Pictet de Rochemont, ein schweizerischer Politiker, die internationale Anerkennung der politischen Neutralität der Schweiz und schuf so den charakteristischen Wert des modernen schweizerischen Internationalismus. 1965 bekräftigte Jean Pictet, leitender Anwalt des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, die humanitäre Neutralität als dritten seiner berühmten „grundlegenden Prinzipien“ für die Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds.
Im Jahr 1991 wurden Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit durch die Resolution 46/182 der UN-Generalversammlung in das Dogma der Vereinten Nationen aufgenommen. Diese vier Grundsätze definieren seither humanitäre Arbeit. Das schweizerische Modell wurde idealisiert, ist in Wahrheit aber nicht für jeden geeignet. Erstens ist politische Neutralität nach dem Völkerrecht nicht zwingend erforderlich. Die Genfer Konventionen erkennen eine Reihe von Akteuren an, von denen die meisten nicht politisch neutral sind – und von denen auch nicht erwartet wird, neutral zu sein – wie Konfliktparteien, Militärärzt*innen und zivile Vereinigungen.
Zweitens ist es für viele Hilfsorganisationen, die ausschließlich im Gebiet einer Konfliktpartei tätig sind, nicht praktikabel, Kontakte, Verhandlungen und Hilfsvereinbarungen mit anderen Konfliktparteien zu entwickeln, um sie von ihrer Neutralität zu überzeugen. Es erfordert viel Zeit, Geld und diplomatische Netzwerke, um in einem Konflikt neutral zu agieren.
Drittens ist neutrale Humanität nicht unbedingt ethisch wünschenswert, wenn wir Menschen aus guten Gründen als Feinde betrachten. Ist es vernünftig zu erwarten, dass eine syrische Hilfskraft neutral bleibt, während ihre Gemeinschaft bombardiert wird? Ist es moralisch vertretbar, dass Humanitäre angesichts von Ungerechtigkeit oder Völkermord neutral bleiben?
Das alles bedeutet, dass wir rechtlich, operativ und moralisch Partei ergreifen und dennoch Humanitäre sein können. ¶ Hugo Slim
EN Can humanitarian aid be neutral?
Humanity, impartiality, independence –and neutrality: these are the four basic principles of humanitarian aid. But the relevance of neutrality is increasingly being called into question. Arguments for and against.
For
Neutrality is a very difficult and often thankless endeavour, especially in wartorn regions. Russia’s war in Ukraine has intensified once again, as has the debate about humanitarian neutrality: How can we be ‘neutral’ in the face of the war crimes being documented in Ukraine, as the film ‘20 Days in Mariupol’, which is opening this year’s festival, impressively and painfully asks us? Serious violations of human rights in crisis regions like Syria, Ethiopia and Afghanistan also raise the legitimate question: Can humanitarian aid be neutral?
For us as a humanitarian organisation, the answer is: yes. We must claim neutrality if we want to help people regardless of their origins, religion or ideology. That is our mandate. Neutrality is not a value in itself but the necessary foundation for being able to provide humanitarian aid in the first place. Our task is to ensure dignified survival for as many people in need as we can. This is only possible if we have secure humanitarian access to the affected communities so that we can supply people on the ground with food, water and medicine. If we are perceived to be biased and not neutral, it jeopardises our ability to access those communities safely.
An increasing number of attacks on humanitarian workers show how real this danger is. So we have to talk to all the actors involved and convince them that we are providing neutral, impartial humanitarian aid.
Part of the reality is that there will always be situations where our neutral position is challenged. When the Taliban imposed a ban on women working in the aid sector in Afghanistan last December, we were faced with a dilemma: our vital work was massively curtailed from one day to the next because 400 of
our roughly 1,000 employees in Afghanistan were women. Female professionals are essential, especially in our nutrition and health programs. Humanitarian aid without women? Unthinkable!
With special permits, women were able to work in medical facilities. We looked for solutions that would allow us to resume our work – together with our female employees – after we had to suspend it temporarily. We have since repeatedly appealed to the authorities to end the exclusion measures for women as they put the lives of millions of people in danger. Neutrality in a humanitarian context does not mean indifference – it means the opposite: the principle of humanity guides our actions. Sometimes we have to make painful compromises to fulfil our mandate: saving lives.¶
Dr Helene MutschlerAgainst
This is a shortened version of an article published by ‘The New Humanitarian’. Four principles – humanity, impartiality, neutrality and independence – are considered to be the foundations of humanitarian action. Without them, it is said, aid workers can be neither legitimate nor effective.
For too long, it has been suggested that international organisations should dominate humanitarian action because only they can be truly neutral third parties in war.
It’s time to question this assumption.
The neutral humanitarian model that has become so dominant as an international norm comes largely from the influence of Swiss political ideology. The modern Swiss commitment to neutrality was driven by two men from the same Genevan family. In 1815, Charles Pictet de Rochemont, a Swiss politician, negotiated the international recognition of Switzerland’s political neutrality, thereby producing the signature value of modern Swiss internationalism. In 1965, Jean Pictet, senior lawyer at the International Committee of the Red Cross, affirmed humanitarian neutrality as the third of his famous ‘fundamental principles’ for the Red Cross and Red Crescent Movement.

In 1991, humanity, impartiality, neutrality and independence were absorbed into UN dogma via General Assembly
Resolution 46/182. These four ‘humanitarian principles’ have since come to define humanitarian action. The Swiss model of neutral humanitarian practice has been idealised, but, in truth, it is not a model for everyone.
Firstly, political neutrality is not legally required under international humanitarian law. The Geneva Conventions recognise a range of relief providers, most of whom are not politically neutral – and are not expected to be neutral – like the parties in conflicts, military medics and civilian associations of various kinds.
Secondly, it is not operationally feasible for many relief organisations that work solely in the territory of one conflict party to develop contacts, negotiations and aid agreements with other parties to convince them of their neutrality. It takes a lot of time and money as well as diplomatic networks to maintain neutrality throughout a conflict in the way the ICRC envisages.
Thirdly, neutral humanitarianism is not necessarily ethically desirable when we see people as enemies for good reasons. Is it reasonable to expect a Syrian aid worker to be neutral when her community is being bombed? Is it moral for humanitarians to stay neutral in the face of injustice or genocide?

This all means that, legally, operationally and morally, we can take sides and still be humanitarians.¶
Hugo SlimMenschen, die Frauen interessierte, interessierte auch Rechte




10 für 10! Jetzt kennenlernen: 10 Ausgaben für 10€taz.de/woche-10









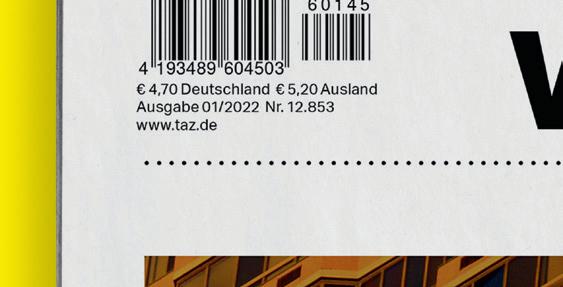



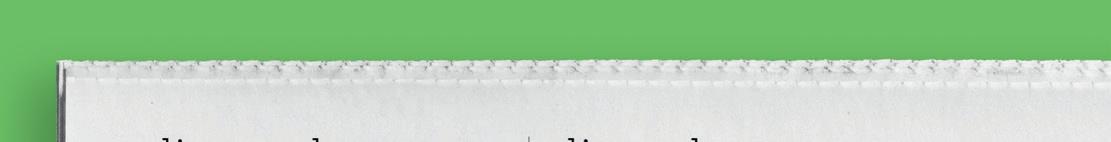





Bildung in Afghanistan: Jetzt nicht den Blick abwenden!

Journalistin, Ingenieurin, Richterin, Ärztin – Berufe wie diese habe ich häufig gehört, wenn ich als Vorsitzende der Hamburger NGO Visions for Children e.V. auf Projektreisen afghanische Schülerinnen nach ihren Wünschen und Zielen für die Zukunft gefragt habe.
Mit dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan und der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 werden die Zukunftspläne der Mädchen akut bedroht. Als unsere Kolleg*innen ein Jahr später mit Schülerinnen der 6. Klasse an einer Projektschule in Kabul sprechen, sind ihre Träume noch da. Aber sie mischen sich mit Sorgen: „Mit den Taliban an der Macht kann ich keine Journalistin werden, denn nach der 6. Klasse darf ich nicht weiter zur Schule gehen“, sagte etwa Saba*, eine Sechstklässlerin.
Afghanistan – ein Ort, der für viele mit Krieg, Armut und Unterdrückung verbunden ist. Doch hinter den Nachrichten und politischen Entwicklungen
dürfen wir nicht vergessen, was das Land eigentlich ausmacht: seine Menschen, ihre unermüdliche Stärke durch Jahrzehnte der Konflikte und ihr Streben nach einer besseren Zukunft.
Die dramatischen Krisen in Afghanistan lassen sich nicht ignorieren: Der Kollaps der Wirtschaft, der Einbruch des Finanz- und Gesundheitswesens, Jahre extremer Dürre und die Machtübernahme der Taliban mit einhergehenden Sanktionen nahmen Millionen Menschen die Lebensgrundlage. Kinder leiden besonders: Hunger, kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser, tödliche Krankheiten und die Zunahme von Kinderarbeit sind nur einige der Folgen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, rund 23 Millionen Menschen, können sich kein Essen mehr leisten. Parallel erfolgt unter der Defacto-Regierung eine Menschenrechtsverletzung nach der anderen: Das Recht von Frauen und Mädchen auf Bildung, Arbeit und freie Kleidungswahl wird massiv eingeschränkt. Reisen oder zum Arzt gehen dürfen sie nur in männlicher Begleitung. Der Besuch von Parks und Schönheitssalons und sportliche Aktivitäten sind für sie verboten. Frauen werden immer stärker aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen und ihre Sicherheit ist zunehmend bedroht.
Krisen, die in ihrem Ausmaß entmutigen können. Doch gerade jetzt ist es wichtiger denn je, die Zivilbevölkerung nicht sich selbst zu überlassen, denn sie
kämpft Tag für Tag weiter: Lehrer*innen, die aufgrund aus dem Ausland eingefrorener Staatsgelder auch nach Monaten ohne Bezahlung weiter in den Klassenräumen stehen und unterrichten. Eltern und Schüler*innen, die, obwohl es ihnen an allem fehlt, ihr Recht auf Bildung einfordern und einer selbstbestimmten Zukunft entgegenstreben. Und nicht zuletzt unsere Kolleg*innen in afghanischen NGOs, die sich trotz massiver Gefahren und Unsicherheiten unermüdlich für ihre Mission einsetzen, mit den De-facto-Autoritäten in Verhandlungen gehen und so viele Kinder erreichen, wie sie nur können.
„Ich bin ein Mädchen, aber ich habe trotzdem dasselbe Recht wie ein Mann, zu unserer Gesellschaft beizutragen und sie zu verbessern. Dafür brauche ich Bildung“, bringt es Afia* an der Grundschule in Kabul auf den Punkt.
Bildung ist ein Schlüssel zur Freiheit. Sie ermöglicht es Menschen, über die Grenzen ihrer Umstände hinauszuschauen und eine bessere Zukunft zu sehen. Sie stärkt die Stimmen von Frauen und Mädchen, auch wenn man versucht, sie in den Schatten zu drängen. Wenn wir Kreisläufe von Armut und Gewalt durchbrechen wollen, müssen wir in die Bildung investieren.
Daher ist jeder Tag, den wir mit Visions for Children e.V. an der Seite unserer mutigen Kolleg*innen und durch die Unterstützung großzügiger Spender*innen aus Deutschland in Afghanistan aktiv bleiben können, ein Gewinn. Während sich institutionelle Geldgeber teils zurückziehen oder Förderungen pausieren, ist die Rolle von Privatpersonen, wie Fördermitgliedern, die unsere Arbeit monatlich unterstützen, umso wichtiger – und wir sind für jede*n Einzelne*n dankbar, die*der sich mit der afghanischen Zivilbevölkerung solidarisch zeigt. Diese Überzeugung gibt uns die Kraft, dafür zu kämpfen, dass es auch weiterhin so bleibt.¶
Afghanistan: Don’t look away now!
Journalist, engineer, judge, doctor – these were the professions that many Afghan schoolgirls responded with when I asked them about their wishes and goals for the future on the project trips I undertook as Chairwoman of Hamburg-based NGO Visions for Children e.V.
The withdrawal of NATO troops from Afghanistan and the takeover by the Taliban in August 2021 posed an acute threat to the girls’ plans for the future. When our colleagues talked to sixthgrade students at a project school in Kabul a year later, they still had the same dreams. But they were mixed with worry: ‘With the Taliban in power, I can’t become a journalist because I won’t be allowed to keep going to school after sixth grade,’ said Saba*, a sixth grader.
Afghanistan is a place that many associate with war, poverty and oppression. But behind the news and political developments, we must not forget what actually makes the country tick: its people, their tireless strength despite decades of conflict and their aspirations for a better future.
The dramatic crises in Afghanistan cannot be ignored: the collapse of the economy, the collapse of the financial and health care systems, years of extreme drought, the Taliban’s seizure of power and the ensuing sanctions have deprived millions of people of their livelihoods. Children have suffered especially: hunger, little access to clean drinking water, deadly diseases and an increase in child labour are just some of the consequences. More than half of the population, some 23 million people, can no longer afford food.
At the same time, under the de facto government, one human rights violation follows the next. The rights of women and girls to work, to access education and to clothe themselves as they choose have been massively restricted. They are only allowed to travel or go to the doctor when accompanied by a male chaperone. They are forbidden
from visiting parks and beauty salons, and from engaging in sports. Women are increasingly being excluded from public life, and their safety is increasingly under threat.

These are crises that can be disheartening in their magnitude. But right now, it is more important than ever not to leave the civilian population to its own devices, because they continue to fight day after day. Teachers who are still in the classroom even after months without pay due to state funds that have been frozen abroad. Parents and students who, although they lack everything, are asserting their right to education and striving for a self-determined future. And last but not least, our colleagues in Afghan NGOs who, despite massive dangers and insecurities, are working tirelessly to carry out their mission, negotiating with the de facto authorities and reaching as many children as they can.
‘I am a girl, but I still have the same rights as a man to contribute to and improve our society. For that, I need education,’ as Afia* summarises it at the elementary school in Kabul.
Education is the key to freedom. It enables people to look beyond their circumstances and envision a better future. It strengthens the voices of women and girls, even when people are trying to push them into the shadows. If we want to break the cycles of poverty and violence, we must invest in education.
Therefore, every day that we can remain active in Afghanistan with Visions for Children e.V. alongside our courageous colleagues and with support from our generous donors in Germany is a win. While institutional donors sometimes withdraw or suspend funding, the role of private individuals, like the members who sustain our work on a monthly basis, is all the more important and we are grateful for every single person showing solidarity with the Afghan civilian population. This conviction gives us the strength to fight for this to continue.¶
FILMTIPP INSIDE KABUL
Zwei afghanische Freundinnen, zwei Lebensentscheidungen, ein Wendepunkt: die Machtergreifung der Taliban. → Seite 89 EN Two Afghan friends, two life choices, one turning point: the Taliban’s seizure of power. → Page 89
*Names of students have been changed for their safety.
Hila Limar setzt sich als geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Vereins Visions for Children e.V. seit mehr als 17 Jahren für verbesserte Bildungschancen von Kindern in Kriegs- und Krisengebieten ein. Der Verein realisiert seit 2006 in Zusammenarbeit mit lokalen Partner*innen nachhaltige Bildungsprojekte an Schulen in Afghanistan und Uganda und wird durch Spenden finanziert. Mehr auf visions4children.org. / Hila Limar has been working to improve educational opportunities for children in war and crisis zones for over 17 years as the Executive Chairwoman of the Visions for Children e.V. association. Since 2006, the association has been implementing sustainable educational projects at schools in Afghanistan and Uganda in cooperation with local partners. It is financed by donations. You will find more information at visions4children.org.
TALKING HUMANITY
NEBENSCHAUPLATZ DES KRIEGES: MÄDCHENBILDUNG IN KONFLIKTREGIONEN EN BATTLES BEYOND THE BATTLEFIELD: SECURING GIRLS’ EDUCATION IN CONFLICT ZONES
→ 16. Okt., 18:30 Uhr
→ Dokumentationszentrum
→ Im Anschluss / followed by: Children of the Taliban (Seite 92 / page 92)
→ Mehr Informationen auf Seite 26 / more information on page 26
Das jähe Ende vom Fortschritt
Seit der Machtübernahme durch die Taliban 2021 haben sich die Bildungschancen für Kinder in Afghanistan verschlechtert – vor allem für Mädchen.
Während die Einschulungsrate 2001 bei fast null lag, stieg sie 2005 auf 5 Millionen Schüler*innen und 2018 sogar auf 9,5 Millionen Schüler*innen an – Afghanistan erlebte Jahre des Fortschritts. Die höhere Einschulungsrate von Mädchen führte dazu, dass mehr Frauen Universitäten besuchten und stärker an der Wirtschaft des Landes beteiligt waren. Zwischen 2001 und 2018 ist die Zahl der Frauen an Universitäten von 5.000 auf 90.000 gestiegen. In dieser Zeit spielten Frauen eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft und ihre Beteiligung trug zum Wirtschaftswachstum Afghanistans bei.
Doch im August 2021 fanden zwei Jahrzehnte des Fortschritts ein jähes Ende. Seitdem dürfen Schülerinnen der Sekundarstufe nicht mehr in den Unterricht zurückkehren und auch der Zugang zu Universitäten ist ihnen verwehrt. Mädchen dürfen den Unterricht ausschließlich bis zur sechsten Klasse besuchen. Alle anderen
Mädchen und jungen Frauen müssen zu Hause bleiben. In der Öffentlichkeit verspricht die Defacto-Regierung immer wieder, dass Schülerinnen und Studentinnen bald wieder die weiterführende Schule bzw. die Universität besuchen können – doch niemand weiß, wann die Schulen und Universitäten für sie wieder öffnen werden.
Die Globale Bildungspartnerschaft (GPE) arbeitet mit Partnerorganisationen in Afghanistan zusammen, um sicherzustellen, dass alle afghanischen Kinder, einschließlich Mädchen, Zugang zu Bildung haben. Dabei leistet die GPE Unterstützung, ein Übergangssystem für den afghanischen Bildungssektor zu implementieren. Erste kleine Zuschüsse für die Verteilung von Schulbüchern (3 Millionen US-Dollar) wurden bereits genehmigt. Größere Zuschüsse werden derzeit erarbeitet, um Kindern, insbesondere Mädchen, in abgelegenen Regionen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.¶
Javier Luque und Gianna Main, Globale Bildungspartnerschaft (GPE)

EN An abrupt end to progress
Since the Taliban took over the country two years ago, the situation and educational opportunities for children in Afghanistan have deteriorated – especially for girls.
Prior to the Taliban’s takeover, there was a strong upward trend in education in Afghanistan, mainly for boys but also for girls. While school enrolments were close to zero in 2001, they climbed to 5 million students in 2005 and rose as high as 9.5 million students in 2018. Girls’ schooling led to increased college attendance for girls and more participation from women in the country’s economy. Between 2001 and 2018, the number of women attending university increased from 5,000 to 90,000. During that time, women played an increasingly important role in the economy, and their participation contributed to Afghanistan‘s economic growth.
In August 2021, two decades of progress came to an abrupt end. Since then, female secondary school students have not been allowed to return to class, and women have been denied access to universities. Girls may attend school up to sixth grade. All other girls and young women must stay at home. Publicly, the de facto government keeps promising that female secondary school and university students will soon be allowed to return to class. However, no one knows when schools and universities will reopen.
To ensure that all Afghan children, including girls, have access to education, the Global Partnership for Education (GPE) is working with partner organisations in Afghanistan, helping them to implement the country’s Education Sector Transitional Framework. Some small initial grants for the distribution of textbooks (USD 3 million) have been approved. Larger grants are currently being developed to provide school access to children in remote areas, mostly benefiting girls.¶
Javier Luque and Gianna Main, Global Partnership for Education (GPE)
GPE hostet beim Human Rights Film Festival Berlin den Film „Children of the Taliban“ sowie eine Diskussionsrunde zum Thema „Bildung für Mädchen in Afghanistan“. / In light of this year‘s festival motto ‘The Good Fight,’ GPE is partnering with the Human Rights Film Festival Berlin to screen the film ‘Children of the Taliban.’ It is also hosting a panel on ‘Girls’ Education in Afghanistan.’
Ein lebensbedrohliches Spiel
Sajid muss vor den Taliban nach Europa fliehen. Doch auch hier findet er keinen Schutz. „The Mind Game“ zeigt die Gewalt gegen flüchtende Kinder. Und wirft die Frage auf: Was zählt – Europas Humanität oder mehr Abschottung?
Sajid Khan Nasiri, ein 14-jähriger Junge aus Afghanistan, wird eines Morgens von seiner Mutter geweckt, die ihm voller Sorge erklärt: „Du musst fliehen, sonst werden die Taliban dich finden und sie werden dich töten, wie sie deinen Vater getötet haben.“ Sajid trifft die Entscheidung, den Weg nach Europa zu versuchen, in der irreführenden Hoffnung, dass er dort leicht Einlass und Schutz finden könnte. Es dauert nicht lange, bis der Junge erkennen muss, dass ihn diese Wahl in das gefährlichste Spiel seines Lebens stürzen wird.
Die Geschichte von Sajid, die im Film „The Mind Game“ anschaulich illustriert wird, zeigt, mit welchen Herausforderungen geflüchtete Kinder konfrontiert sind, die nur eines suchen: Sicherheit. Ihre Flucht nach Europa ist meist mit extremer Gewalt, Ohnmacht und Abhängigkeit von Dritten verbunden. Es mangelt an grundlegenden Strukturen, die eine sichere und reguläre Einreise in die EU ermöglichen und insbesondere Kinder auf der Flucht vor extremer Gewalt und Ausbeutung schützen. Auch ein auf Kinder ausgerichtetes Asylsystem und Erwachsene, die sie in dieser Extremerfahrung kindgerecht begleiten, sind nicht vorhanden.

Die Erlebnisse von Sajid sind realistische Abbilder der Erfahrungen, die hunderttausende Kinder auf ihrer Flucht nach Europa machen. „The Game“ (das Spiel) – so bezeichnen Kinder wie Sajid den Versuch, an Grenzpolizist*innen vorbei in die EU zu gelangen. Angst und systematische Gewalt sind fester Teil dieses grausamen „Spiels“. In „Wherever we go, Someone does us Harm“, einem Bericht von Save the Children, berichten diese Kinder von körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt. Staatliche Akteure wie Grenzpolizist*innen sind oft Täter*innen. Die EU toleriert solche Verstöße, um Abschreckung zu fördern.
Auch Sajids Erfahrungen in Belgien ähneln deutschen Zuständen: Sammelunterkünfte bieten wenig Raum für Bildung, Spiel und Schutz. Die langwierigen und bürokratischen Prozesse haben insbesondere auf die psychische Gesundheit der Kinder einen fatalen Einfluss, psychosoziale Unterstützungsangebote sind für geflüchtete Kinder wiederum kaum vorhanden. Die systemischen Mängel sind uns in Deutschland seit langem bekannt. Und trotzdem hat der Film gerade jetzt eine besondere Aktualität: Die EU und ihre Mitgliedstaaten verhandeln derzeit über die Reform des neuen, gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Dabei ist der Kurs deutlich: Die Mauern sollen noch weiter nach oben gezogen werden. So soll der Zugang zum individuellen Asyl noch weiter erschwert, der Grenzschutz weiter ausgebaut und die Möglichkeit geschaffen werden, dass Kinder im sogenannten Grenzverfahren in Grenzlagern untergebracht werden können – also unter haftähnlichen Zuständen leben müssen.
Wir stehen in Europa an einem Scheideweg. Denn je höher die Mauern der Festung Europas werden, desto gewaltvoller wird das Spiel bei der Überwindung dieser – und desto schwerer werden es Kinder wie Sajid haben. Am Ende stellt der Film die Frage: Was ist uns Humanität wert?¶
Marvin McNeil, Advocacy Manager Flucht & Migration, Save the Children Deutschland
EN A life-threatening game
Sajid has to flee from the Taliban to Europe. But he doesn’t find any protection there either. ‘The Mind Game’ reveals the violence being exerted against refugee children. What counts more: Europe’s humanity or more isolation?
Sajid Khan Nasiri, a 14-year-old boy from Afghanistan, is woken up one morning by his mother, who says, full of worry, ‘You have to escape, otherwise the Taliban will find you and they will kill you like they killed your father.’ He has to leave immediately, although at this point it is completely unclear where he will go. Sajid makes the decision to try to make his way to Europe, in the misguided hope that it will be easy for him to find
refuge and protection there. It is not long before the boy must realise that this choice has plunged him into the most dangerous game of his life.
Sajid’s story, which is vividly illustrated in the film ‘The Mind Game’, demonstrates the challenges faced by refugee children, who are only looking for one thing: safety. Their journey to Europe is usually accompanied by extreme violence, powerlessness and dependence on third parties. There is a lack of basic structures enabling regular, safe entry into the EU and, in particular, protecting children on the run from extreme violence and exploitation.
Sajid’s experiences are realistic examples of the experiences that hundreds of thousands of children have on their journeys to Europe. ‘The game’ – this is how children like Sajid refer to their attempts to get past the EU’s border police. Fear and systematic violence are an integral part of this cruel ‘game’. In Save the Children’s report ‘Wherever We Go Someone Does Us Harm’, these children report physical, sexual and psychological violence, often perpetrated by state actors like border police officers. The EU tolerates such violations to promote deterrence.
What Sajid experiences in Belgium is similar to German conditions: collective accommoda-
tion offers little space for education, play or protection. Bureaucratic asylum procedures have a psychological impact on children; there is a lack of psychosocial help.
These systemic shortcomings have been known to us in Germany for a long time. And yet this film is particularly topical right now: the EU and its member states are currently negotiating the reform of the new Common European Asylum System. The course is clear: the walls are to be raised even higher. Access to individual asylum will be made even more difficult, border protection will be further expanded, and the reforms will make it possible for children to be accommodated in border camps within the scope of the so-called ‘border procedure’. In other words, they will have to live in conditions similar to detention.
We are at a crossroads in Europe. Because the higher the walls of Fortress Europe are raised, the more violent the game of overcoming them becomes – and the harder it gets for children like Sajid. In the end, the film asks: What value do we place on humanity?¶
 Marvin McNeil, Advocacy Manager Asylum & Migration, Save the Children Germany
Marvin McNeil, Advocacy Manager Asylum & Migration, Save the Children Germany
FILMTIPP THE MIND GAME
„Um nach Europa zu kommen, musst du viele Spiele mitmachen.“ Und in Europa beginnt für den jungen Sajid ein ganz neues Spiel. → Seite 89
EN ‘To get to Europe, you have to play a lot of games.’ And they do not end here for young Sajid.
→ Page 89
Pressefreiheit ist auch unsere Freiheit / Freedom of the press is our freedom too
Wie wichtig die Arbeit unabhängiger Journalist*innen ist, zeigt sich auch in der Anzahl ihrer Feinde: Selten war kritische Berichterstattung so gefährlich wie heute.
EN The importance of the work being done by independent journalists can be measured by the number of their enemies: critical reporting has rarely been as dangerous as it is today.
Wo ist das Arbeitsumfeld für Journalist*innen am besten, wo am schlechtesten?
Norwegen belegt auf der Rangliste der Pressefreiheit zum siebten Mal in Folge den ersten Platz. Erstmals seit langem folgt auf dem zweiten Platz mit Irland ein Land außerhalb Skandinaviens; Platz drei belegt Dänemark. In diesen Ländern können auch kritische Journalist*innen sicher arbeiten – in Irland schützt sie beispielsweise ein neues Gesetz vor missbräuchlichen Klagen. Auf den hintersten Plätzen liegen Vietnam, China und als Schlusslicht – Rang 180 – Nordkorea. Autoritäre Regime haben für unabhängigen Journalismus oft nichts übrig; für sie sind Medienschaffende nur ein Werkzeug der staatlichen Propaganda.
EN What is the best place for journalists to work and what is the worst?
Wie steht es weltweit um die Pressefreiheit?
Viele Regierungen und politische Parteien, aber auch Wirtschaftsunternehmen versuchen, kritische Berichterstattung zu unterbinden – auch in Deutschland. Die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende sind weltweit in 70 Prozent der Länder problematisch. Sorgen macht die Sicherheitslage: Abseits von Kriegen wie in der Ukraine sind Recherchen zu Korruption und organisierter Kriminalität das gefährlichste Feld für Journalist*innen. Auch Desinformation ist ein wachsendes Problem: Sie reicht von russischer Staatspropaganda in TV-Sendern wie RT oder Perwy kanal bis zu den „electronic flies“, den saudischen oder algerischen Trollarmeen auf Twitter.
EN What is the state of press freedom worldwide?
Many governments, political parties and companies are trying to prevent critical reporting, in Germany and across the globe. The working conditions for media professionals are problematic in roughly 70 per cent of countries around the world. The security situation is one of the main causes for concern: apart from wars like the one in Ukraine, the most dangerous work for journalists is investigating corruption and organised crime. Disinformation is also a growing problem, from Russian state propaganda on TV channels like RT and Perwy Kanal to ‘electronic flies’, the Saudi and Algerian troll armies on Twitter.
Norway has taken first place in the Reporters Without Borders Press Freedom Index for the seventh time in a row. For the first time in a long while, a country outside Scandinavia has followed in second place – Ireland – while Denmark has taken third. In these countries, even critical journalists can work in safety. In Ireland, for example, a new law protects journalists from abusive lawsuits. Vietnam, China and, at the bottom of the list in 180th place, North Korea are the worst performers. Authoritarian regimes often have no understanding of independent journalism; for them, media professionals are merely a tool of state propaganda.
Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban in Afghanistan die Macht. Wie ist die Lage nun für Journalist*innen vor Ort?
Die Taliban drohen Medienschaffenden und verfolgen sie, nehmen Reporter*innen fest, verdrängen Journalistinnen aus der Medienlandschaft, zensieren Berichte und durchsuchen Redaktionen. Die Taliban haben große Teile der einst lebendigen Medienlandschaft zerstört. Mehr als die Hälfte der 547 Medien, die 2021 registriert waren, sind nach Angaben der Afghan Independent Journalists Association (AIJA) inzwischen verschwunden. Von den 150 Fernsehsendern arbeiten heute weniger als 70.
Von den 307 Radiosendern berichten nur noch 170. Und von den rund 12.000 Journalist*innen, die 2021 noch in Afghanistan arbeiteten, haben mehr als zwei Drittel ihren Beruf aufgegeben.
Vor allem Frauen fehlen in der Medienlandschaft seit der Übernahme der Taliban weitgehend: Mehr als 80 Prozent der afghanischen Journalistinnen mussten ihre Arbeit aufgeben.
Doch auch der Widerstand afghanischer Medienschaffender ist beachtlich: Sie recherchieren trotz schwierigster Bedingungen weiter vor Ort oder informieren die Bevölkerung aus dem Exil.
EN On August 15, 2021, the Taliban took power in Afghanistan. What is the situation like now for journalists on the ground?
The Taliban threaten and persecute media workers, arrest reporters, oust female journalists from the media landscape, censor reports and conduct searches of editorial offices. The Taliban have destroyed large parts of the once vibrant media landscape. More than half of the 547 media outlets that were registered in 2021 have now disappeared, according to the Afghan Independent Journalists Association (AIJA). Of the 150 television stations, fewer than 70 are now operating, and of the 307 radio stations, only 170 are still on air. Finally, of the roughly 12,000 journalists still working in Afghanistan in 2021, more than two-thirds have given up their profession.
Women in particular have been largely absent from the media landscape since the Taliban took over: more than 80 per cent of female Afghan journalists have had to give up their jobs. But the resistance of Afghan media professionals is also remarkable: they are still conducting research on the ground despite the most difficult conditions and continue to inform the population from exile.
Wo ist journalistische Arbeit in Deutschland am gefährlichsten?
Ganz klar auf Demonstrationen. Grundsätzlich können unabhängige Journalist*innen in Deutschland frei arbeiten, aber Reporter ohne Grenzen hat eine steigende Zahl an Übergriffen dokumentiert, von 80 im Vorjahr auf 103 im Jahr 2023. Die große Mehrheit, 87 davon, fand in verschwörungsideologischen,
antisemitischen und extrem rechten Kontexten statt.
EN Where is it most dangerous to work as a journalist in Germany?
Clearly at demonstrations. In principle, independent journalists can work freely in Germany, but Reporters Without Borders has documented an increasing number of assaults, from 80 last year to 103 in 2023. The vast majority, 87 of them, took place in ideologically conspiracy-based, antisemitic and extreme right-wing contexts.

Warum ist Pressefreiheit so wichtig? Die Freiheit zu informieren und informiert zu werden ist ein zuverlässiger Gradmesser für die Wahrung der Menschenrechte in einem Land. Denn Informationen sind der erste Schritt zu Veränderungen – deshalb fürchten nicht nur autoritäre Regierungen eine freie und unabhängige Berichterstattung. Wo nicht unabhängig berichtet werden darf und wo Menschen ihre Meinung nicht
frei äußern können, werden auch andere Menschenrechte verletzt.
EN Why is freedom of the press so important?
The freedom to inform and be informed is a reliable measure of a country’s respect for human rights. After all, information is the first step towards change – which is why it is not just authoritarian governments that fear free and independent reporting. Wherever independent journalism is prohibited and people cannot freely express their opinions, other human rights are being violated too.
Was kann ich tun?
Jede*r kann die Arbeit unabhängiger Medien unterstützen, indem er oder sie ihre Artikel und Beiträge verbreitet, für guten Journalismus auch mal etwas bezahlt oder sich solidarisch mit inhaftierten Journalist*innen zeigt. Man kann auch an Reporter ohne Grenzen spenden oder für einen kleinen monatlichen Betrag Mitglied werden und damit den Einsatz für die Pressefreiheit stärken –in Deutschland und weltweit.
EN How can I help?
You can support the work of independent media by disseminating their work, paying for high-quality journalism or showing solidarity with imprisoned journalists. You can also donate to Reporters Without Borders or become a member by paying a small monthly contribution, thereby strengthening the commitment to press freedom in Germany and around the world.¶
Die Menschenrechts-NGO Reporter ohne Grenzen dokumentiert seit knapp 30 Jahren die Situation der Pressefreiheit und hilft bedrohten Journalist*innen. / For almost 30 years, the human rights NGO Reporters Without Borders has been documenting press freedom and helping journalists under threat.
FILMTIPP WHILE WE WATCHED
Unabhängiger Journalismus befindet sich weltweit im freien Fall. Dies ist ein Weckruf.
→ Seite 90
EN Independent journalism is in free fall around the world. This is a wake-up call.
→ Page 90

Von bescheidenen Anfängen
zum Symbol der Pressefreiheit: Die Geschichte von Ravish Kumar
In der hektischen Medienlandschaft Indiens ist Ravish Kumar einer der wenigen, die für journalistische Integrität stehen. Als ruhiges und wortgewandtes Gesicht der NDTV-Hauptnachrichten hebt sich Kumar durch sein furchtloses Engagement für die Wahrheit ab – in einer Zeit, in der die Pressefreiheit des Landes angegriffen wird.
Kumars Berichterstattung weicht von dem melodramatischen und sensationssüchtigen Journalismus ab, der weite Teile der indischen Medien prägt. Stattdessen zeichnet sich seine Arbeit durch eine unnachgiebige Hingabe an Fakten, eine empathische Auseinandersetzung mit gewöhnlichen Bürger*innen und die Bereitschaft aus, die schwierigen Fragen zu stellen, vor denen andere zurückschrecken.
In der Kleinstadt Motihari geboren und aufgewachsen, verankerten Kumars bescheidene Anfänge in ihm eine tiefe Verbindung zu den Kämpfen und Hoffnungen gewöhnlicher Inder*innen. Sein empathischer Ansatz findet bei den Zuschauer*innen Anklang und rückt oft Geschichten in den Fokus, die von den MainstreamMedien marginalisiert werden.
Sein Mut, mächtige Figuren und Institutionen herauszufordern, macht ihn zu einem Symbol der Pressefreiheit. Doch sein Engagement für demokratische Werte hatte einen hohen Preis. Er wurde belästigt, bedroht und von denen, die seine Stimme unterdrücken wollen, als „antinational“ – in Indien ein schwerwiegender Vorwurf – bezeichnet.
Trotz der Drohungen, die auch seine Frau und Tochter zu spüren bekommen, bleibt Kumars Entschlossenheit ungebrochen. Seine Arbeit, die mit Auszeichnungen wie dem Ramon Magsaysay Award – dem asiatischen Nobelpreis – gefeiert und anerkannt wurde, inspiriert weiterhin eine neue Generation von Journalist*innen in Indien.
In einer Welt, in der die Wahrheit oft dem politischen Opportunismus zum Opfer fällt, ist Ravish Kumars beharrlicher Kampf für freien und wahrheitsgetreuen Journalismus eine Erinnerung daran, wie die Presse sein kann und sollte. Seine Stimme, die aus dem Herzen der größten Demokratie der Welt schallt, ist nicht nur ein Ruf nach Pressefreiheit, sondern ein Appell an das Gewissen einer Nation.¶
Anna Ramskogler-Witt, Jana SepehrEN From humble beginnings to an icon of press freedom: The story of Ravish Kumar
In India’s bustling media landscape, Ravish Kumar is one of a few champions of journalistic integrity. The calm and eloquent face of NDTV’s primetime news, Kumar stands out due to his fearless commitment to truth in a time when the country’s press freedom is under attack.
Kumar’s reporting style diverges from the melodramatic, sensationalist journalism that characterises much of India’s media landscape. Instead, his work is marked by an unyielding dedication to facts, empathetic engagement with ordinary citizens and a readiness to ask the difficult questions that others shy away from.
Born and raised in the small town of Motihari, Kumar’s humble beginnings instilled in him a deep connection with the struggles and hopes of ordinary Indians. His empathetic approach resonates with viewers, often shifting the focus to stories marginalised by mainstream media.
His courage to challenge powerful figures and institutions makes him a symbol of press freedom. But his commitment to democratic values has come at a high price. He has been harassed, threatened and labelled ‘anti-national’ – a grave accusation in India – by those who seek to suppress his voice. These threats have even been extended to his wife and daughter.
Despite this intimidation, Kumar’s resolve remains unbroken. His work, celebrated and recognised with awards such as the Ramon Magsaysay Award – referred to as Asia’s Nobel Prize – continues to inspire a new generation of journalists in India.
In a world where truth often falls victim to political convenience, Ravish Kumar’s persistent fight for free and honest journalism is a reminder of what the press can and should be. His voice, resounding from the very heart of the world’s largest democracy, is not merely a cry for freedom of the press but an appeal to the conscience of a nation.¶
Anna Ramskogler-Witt, Jana SepehrFILMTIPP TRANSITION
Der australische Journalist Jordan Bryon findet in Afghanistan seine Heimat und nennt es das „schönste Land, das er je gesehen hat“. Hier arbeitet er als Korrespondent für internationale Medien – und beginnt seine Geschlechtsumwandlung. Eine mutige Entscheidung, vor allem in Afghanistan. Inmitten der turbulenten Machtübernahme durch die Taliban führt Bryon ein Doppelleben. Mit jedem Tag wächst seine Angst vor einer möglichen Enttarnung. „Transition“ ist ein eindrucksvolles und sehr persönliches Porträt eines Mannes, der um seine Identität kämpft. Der Film bietet außergewöhnliche Einblicke in ein Afghanistan unter Taliban-Herrschaft.
→
Seite87
EN Australian journalist Jordan Bryon finds a home in Afghanistan, which he thinks is the ‘most beautiful country I have ever seen’. He works there as an international media correspondent and begins his gender transition there as well, a courageous decision, especially in Afghanistan.
During the Taliban’s tumultuous takeover, Bryon leads a double life. With each passing day, his fear of potentially being exposed grows. ‘Transition’ is an impressive and deeply personal portrait of a man fighting for his identity. It offers extraordinary insights into Afghanistan under Taliban rule. → Page 87
 Lydia Band, Production Coordinator, Human Rights Film Festival Berlin
Lydia Band, Production Coordinator, Human Rights Film Festival Berlin
Somalia: Ein gefährliches Terrain für mutige Journalist*innen
Somalia ist einer der schwierigsten Orte der Welt für Journalist*innen. Ich weiß das, weil ich dort 44 Tage in Haft verbracht habe – verfolgt, weil ich für Pressefreiheit eintrat und ethische Berichterstattung verteidigte.
Zunächst einmal sind Journalist*innen in Somalia unglaublicher physischer Gefahr ausgesetzt. Es ist der gefährlichste Ort in Afrika, um als Medienschaffender zu arbeiten. Dann gibt es die Intoleranz und Korruption der Regierung, die Kritiker verhaftet und Medienhäuser schließt. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 84 Journalist*innen inhaftiert.
Schließlich gibt es die große logistische Schwierigkeit, die städtischen Gebiete zu verlassen, um ihren journalistischen Job zu erledigen und frei über Somalias lebensbedrohliche Dürre und Hungersnot zu berichten.
Als Generalsekretär des Somali Journalists Syndicate (SJS) dachte ich, ich hätte alles gesehen. Das änderte sich, als ich festgenommen wurde und eine Albtraumreise durch Somalias Strafjustizsystem begann.
Es fing am 11. Oktober 2022 an, als ich am Aden Adde International Airport in der Hauptstadt Mogadischu gestoppt wurde, kurz bevor ich meinen Flug nach Kenia antreten sollte, um meine Familie zu besuchen. Beamte der National Intelligence and Security Agency (NISA) brachten mich vom Flughafen ins Godka Jila’ow, ein berüchtigtes unterirdisches Gefängnis.
Ich wusste, worum es ging. Am Vortag hatte das SJS zusammen mit anderen professionellen Journalist*innengruppen eine Erklärung veröffentlicht, in der eine vage formulierte Anweisung des Informationsministeriums verurteilt wurde, die den Medien untersagte, die
„Lügen und Propaganda“ von der islamistischen Terrororganisation al-Shabaab zu zitieren. Wir argumentierten, dass die Anordnung, ohne Konsultation mit Medienorganisationen getroffen, den legitimen Ausdruck und die Pressefreiheit bedrohe.
Im Godka Jila‘ow wurden mir acht Stunden lang Fragen gestellt. Um 1 Uhr morgens sperrten sie mich in eine winzige Zelle aus Beton ohne Licht und Belüftung. Etwa 20 Zellen, identisch mit meiner, waren dort – ich konnte aus einigen von ihnen Schreie hören. In dieser ersten Nacht dachte ich, ich würde sterben. Nach zwei weiteren Tagen des Befragens und wiederholter Drohungen wurde ich in eine andere Haftanstalt gebracht –diesmal von der Polizei betrieben –, wo sie mich weitere elf Tage festhielten.
„Die Nation verächtlich machen“. Die Die Generalstaatsanwaltschaft hat drei Anklagen gegen mich erhoben, darunter den Vorwurf, die „Nation verächtlich zu machen“.
Tage zuvor haben Beamte des Informationsministeriums Kontakt zu mir aufgenommen, um einen Deal zu machen. Ich könnte das Land verlassen, wenn ich zustimme, die Regierung nicht mehr zu kritisieren, und mich vollständig entschuldige. Ich lehnte ab.
lassen – ich litt unter einer Niereninfektion und einer Augenallergie, die während meiner Inhaftierung aufgetreten waren. Der nächste Schritt war der Prozess. Die Behörden haben die Richter am Regional- und Berufungsgericht ausgetauscht – eine Maßnahme, die offenbar darauf abzielte, das Urteil in meinem Fall negativ zu beeinflussen.
Am 13. Februar 2023, nach vier Gerichtsverhandlungen, wurde ich zu zwei Monaten Haft verurteilt. Doch die Gefängnisbeamten weigerten sich, die Entscheidung umzusetzen. Als ich ins zentrale Gefängnis von Mogadischu gebracht wurde, erklärten die dortigen Beamten, ich hätte bereits fünf Monate unter verschiedenen Arten der Isolierung verbracht, und gaben mir meine Freiheit zurück.
Das war jedoch von kurzer Dauer. Zehn Tage später nahmen mich bewaffnete Männer von der Polizei und der NISA erneut fest, als ich mich mit Abgeordneten des Bundesparlaments in einem Hotel in Mogadischu traf. Ich wurde eineinhalb Tage lang in einem Privathaus im Stadtteil Bondhere von Mogadischu gefangen gehalten, bevor ich zurück ins zentrale Gefängnis von Mogadischu gebracht wurde.
Ich verbrachte dort über einen Monat in einer Zelle mit 41 anderen Insassen. Es gab kaum Wasser, die hygienischen Bedingungen waren äußerst schlecht und die Gefangenen wurden oft krank.
Schließlich wurde ich nach 33 Tagen ohne jegliche Dokumentation oder Erklärung freigelassen.
Das Problem der Straflosigkeit. Jetzt bin ich wieder mit meiner Familie in Nairobi vereint, aber ich bin wütend. Ich wurde angegriffen und verfolgt, nur weil ich meinen Beruf als Journalist verfolgt und mich für Menschenrechte und Pressefreiheit eingesetzt habe.
Ich bin auch wütend, weil ich mir so viel Besseres für mein Land wünsche.
Nach der Anklageerhebung wurde ich nur unter Reisebeschränkungen freigelassen, die mich daran hinderten, nach Kenia zu fliegen, um mich behandeln zu
Mehr als 20 Jahre nach den dunklen Tagen des Clan-Krieges haben wir föderale und staatliche Regierungen, die immer noch Menschenrechtsverletzungen begehen und der Rechenschaftspflicht entkommen, die für Gerechtigkeit und dauerhaften Frieden unerlässlich ist.
Die internationale Gemeinschaft –einschließlich der UN, der EU und der
„Etwa 20 Zellen, identisch mit meiner, waren dort – ich konnte aus einigen von ihnen Schreie hören.
In dieser ersten Nacht dachte ich, ich würde sterben.“
Abdalle Ahmed Mumin
Afrikanischen Union – muss ihr Schweigen brechen und die von einer korrupten Regierung begangenen Verbrechen anprangern, die sie sowohl finanziell als auch politisch weiterhin unterstützt.¶
EN Somalia: one of the hardest places to be a journalist
Somalia is one of the hardest places in the world to be a journalist. I know, because I spent 44 days in detention –persecuted for trying to defend press freedom and ethical reporting.
Firstly, journalists in Somalia face incredible physical danger. It’s the most hazardous place in Africa to work as a media professional. Then there’s the intolerance and corruption of the government, which arrests its critics and shuts down media houses. A total of 84 journalists were detained in 2022.
Finally, there’s the sheer logistical difficulty of leaving urban areas to do your job and report freely on Somalia’s life-threatening drought and hunger.
As the Secretary-General of the Somali Journalists Syndicate (SJS), I thought I’d seen it all. That was until I was detained and began a nightmarish journey through Somalia’s criminal justice system.
My journey began on 11 October 2022, when I was stopped at Aden Adde International Airport in the capital, Mogadishu, as I was about to board my flight to Kenya to visit my family. National Intelligence and Security Agency (NISA) officers took me from the airport to Godka Jila’ow, a notorious underground detention centre.
I knew what it was about. The day before, the SJS – along with other professional journalist groups – had issued a statement condemning a vaguely worded directive by the Ministry of Information banning the media from quoting alShabab’s ‘lies and propaganda’. We argued that the order, given without consulting with media organisations, threatened legitimate expression and press freedom.
In Godka Jila’ow, they interrogated me for eight hours. At 1 am, they locked me in a tiny concrete cell with no lighting or ventilation. There were roughly 20 cells identical to mine. I could hear screaming coming from some of them. That first night, I thought I was going to die.
After two more days of questioning and repeated threats, I was taken to another detention facility – this time run by the police – where they held me for eleven more days.
‘Bringing the nation into contempt’. The office of the attorney general had brought three charges against me, including an accusation of ‘bringing the nation into contempt’.
Days earlier, officials at the Ministry of Information had contacted me to try and make a deal. They would allow me to leave the country if I agreed to stop criticising the government and made a full apology. I declined.
After being charged, I was released, but only under travel restrictions that prevented me from flying to Kenya for medical treatment for a kidney infection and an eye allergy that had flared up during my incarceration.
The next step was trial. The authorities had replaced the judges at the regional and appeals court – a move that seemed designed to negatively influence the verdict in my case.
On 13 February 2023, following four court hearings, I was sentenced to two months in jail. But prison officials refused to implement the decision. When I was taken to Mogadishu central prison, the officers there said I had already served five months under various types of confinement and gave me back my freedom.
But this was short-lived. Ten days later, armed men from the police and NISA detained me again as I met with lawmakers from the federal parliament in a Mogadishu hotel. I was held captive in a private house in Mogadishu’s Bondhere district for a day and a half before being taken back to Mogadishu’s central prison.
I spent more than a month there, sharing a cell with 41 other inmates. There was little water, the hygiene conditions were extremely poor, and prisoners frequently fell sick.
Finally, after 33 days without any documentation or explanation, I was released.
The problem with impunity. I have now been reunited with my family in Nairobi, but I am angry. I have been attacked and persecuted solely for pursuing my profession as a journalist and for advocating for human rights and press freedom.
I am also angry because I want so much better for my country.
More than 20 years on from the dark days of clan warfare, we have federal and state governments that are still committing human rights abuses and escaping the accountability that is essential to achieving justice and lasting peace.
The international community – including the UN, the EU and the African Union – must break their silence and call out the crimes being committed by a corrupt government that they continue to support both financially and politically.¶
BERLINS EINZIGARTIGER LERNUND ERINNERUNGSORT
Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist ein einzigartiger Lern- und Erinnerungsort zu Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration in Geschichte und Gegenwart. Neben der Ständigen Ausstellung „Das Jahrhundert der Flucht“ erwarten Sie eine Bibliothek mit Zeitzeugenarchiv, ein Raum der Stille, Führungen, Workshops und Veranstaltungen.
EINTRITT FREI
A UNIQUE PLACE OF LEARNING AND REMEMBRANCE IN BERLIN
The Documentation Centre Displacement, Expulsion, Reconciliation is a unique place of learning and remembrance on displacement, expulsion and forced migration in history and the present. In addition to the permanent exhibition „The Century of Flight“ there are a library & testimony archive, a room of stillness, guided tours, workshops and events.
ADMISSION IS FREE
FÜHRUNGEN DURCH DIE STÄNDIGE AUSSTELLUNG/ GUIDED TOUR OF THE PERMANENT EXHIBITION

So, 15.10, 15–16 Uhr, Englisch /English Di, 17.10, 17.30–18 Uhr, Englisch/English
Anmeldung/Registration: veranstaltungen@f-v-v.de
journalist in Mogadishu, for ‘The New Humanitarian’

DOKUMENTATIONSZENTRUM FLUCHT, VERTREIBUNG, VERSÖHNUNG
Stresemannstraße 90, 10963 Berlin
Öffnungszeiten: Di–So 10–19 Uhr www.flucht-vertreibung-versoehnung.de
‘There were roughly 20 cells identical to mine. I could hear screaming coming from some of them. That first night, I thought I was going to die.’
Abdalle Ahmed Mumin
FILMTIPP

HOLY SHIT
Können unsere Fäkalien die Welt retten? → Seite 91
EN Can poo save the world? → Page 91
Holy Shit!
Wie eine Schauspielerin und ein Filmemacher unsere Sicht auf Abfall verändern.
Bei den Oscars 2015 überraschte Patricia Arquette mit einem Thema, mit dem wohl keiner gerechnet hat: Kot. Als sie den Preis als beste Nebendarstellerin entgegennahm, nutzte sie das Rampenlicht, um auf eine globale Krise aufmerksam zu machen: Zugang zu sanitärer Versorgung.
„Für meine Helden, Freiwilligen und Experten, die mir mit GiveLove.org geholfen haben, ökologische Sanitärversorgung in Entwicklungsländer zu bringen“, erklärte sie. Mit diesen Worten legte sie ein oft übersehenes Problem offen: 40 Prozent der ärmsten Menschen der Welt leben ohne Toilette.
Rubén Abruñas Dokumentarfilm „Holy Shit“ geht ähnlichen Themen nach, darunter auch einem Projekt von GiveLove in Kenia – ein Beispiel für die weltweiten Bemühungen, dieses Problem anzugehen. Auf einer Reise durch 16 Städte auf vier Kontinenten deckt Abruña auf, was mit unseren Ausscheidungen passiert, nachdem sie unseren Körper verlassen haben. Könnte es eine wiederverwendbare Ressource sein?
Von Pariser Abwasserkanälen bis zu einer Kläranlage in Chicago folgt der Film den Spuren menschlicher Fäkalien – und einer Frage, die uns alle betrifft: Könnten unsere Exkremente die drohende Düngemittelknappheit lösen? ¶
 Anna Ramskogler-Witt
Anna Ramskogler-Witt
EN How an actress and a film-maker are changing our view of waste
When Patricia Arquette took the stage at the 2015 Oscars, she surprised the world by linking two seemingly disparate subjects: the Oscars and poo. When she won Best Supporting Actress, she used her spotlight not to celebrate her achievement but to call attention to a global crisis: sanitation.
She dedicated her award to her ‘heroes, volunteers and experts who have helped me bring ecological sanitation to the developing world with GiveLove.org’. With these words, she pointed to an often overlooked problem – 40 per cent of the world’s poorest people live without toilets, and untreated sewage is a significant concern.
Rubén Abruña’s documentary ‘Holy Shit’ explores similar themes, including a project by GiveLove in Kenya as an example of the global efforts being made to tackle this issue. Journeying through 16 cities on four continents, Abruña uncovers what happens to our excrement after it leaves our bodies. Could this resource be reused instead of being turned into waste?
From the sewers of Paris to a Chicago sewage treatment plant, the film follows the trail of human faeces – and a question that affects us all: Could our excrement solve the looming fertiliser shortage? ¶
Anna Ramskogler-WittHeilige Sch … oder Holy Shit wir können es benutzen, Baby, that is it!
Es ist viel mehr als einfach nur Dreck, als Kompost ist es wertvoll, im WC spült’s sinnlos weg.
Ja die Erde wird nicht jünger, Mensch, wir brauchen unsern Dünger.
Was ist Klimakolonialismus?
Klimakrise und Kolonialismus sind untrennbar miteinander verbunden. Was man über den Zusammenhang wissen sollte.

Viele würden nicht erwarten, die beiden Begriffe in einem Zusammenhang zu sehen, aber Klimakrise und Kolonialismus sind untrennbar miteinander verbunden.
Werfen wir einen Blick darauf, warum das so ist und warum die Berücksichtigung der Auswirkungen historischer und aktueller kolonialistischer Praktiken so wichtig für die Bewegung zur Bekämpfung der Klimakrise ist.
Doch zunächst sollten wir den Begriff „Kolonialismus“ kurz auffrischen.
Was ist Kolonialismus? Kolonialismus ist definiert als „Kontrolle einer Macht über ein abhängiges Gebiet oder Volk“. Im Allgemeinen geht es darum, dass ein Land die Kontrolle über ein anderes Land übernimmt, oft unter Gewaltanwendung und durch Tötung, Vertreibung und/oder Ausgrenzung der bestehenden Bevölkerung.
Die Ursprünge des Kolonialismus reichen bis in die Zeit des antiken Griechenlands, Roms, Ägyptens und Phöniziens zurück. Danach gab es zwei Hauptwellen des Kolonialismus: eine, die im 15. Jahrhundert begann, als europäische Länder andere in Nord- und Südamerika kolonisierten, und eine, die als „Scramble for Africa“ bekannt ist und im 19. Jahrhundert begann.
dass ihre Hinterlassenschaften in der Gegenwart weiterleben.“
FILMTIPP
HOLDING UP THE SKY
„Der Himmel wird einstürzen und alles unter sich begraben.“
Sind wir bereit, etwas dagegen zu unternehmen? → Seite 84 EN ‘The sky will collapse and crush everything beneath it.’ Are we willing to do anything about it? → Page 84
Der Kolonialismus ist verantwortlich für jahrhundertelange schädliche Ausbeutungspraktiken in Regionen des Globalen Südens, wie Afrika und Lateinamerika, die zu Reichtum im Globalen Norden und Armut im Globalen Süden geführt haben.
Was also ist Klimakolonialismus? Es gibt zwei Möglichkeiten, die Klimakrise im Zusammenhang mit Kolonialismus zu betrachten. So formuliert es The Conversation (ein Netzwerk aus Wissenschaftler*innen und Journalist*innen):
„Wenn man den Klimawandel mit solchen kolonialen Handlungen in Verbindung bringt, muss man anerkennen, dass historische Ungerechtigkeiten nicht der Geschichte angehören, sondern
Im ersten Fall geht es um die historischen Ursachen der Klimakrise. Der Globale Norden ist für den massiven Wandel verantwortlich, den wir derzeit erleben – schließlich stammen über 92 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen von dort.
Die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise, insbesondere extreme Wetterereignisse, sind jedoch in den Ländern des Globalen Südens zu beobachten, die zudem überproportional von Armut betroffen sind, deren Wurzeln in ausbeuterischen kolonialen Aktivitäten und Praktiken liegt.
In einem Bericht von Greenpeace UK aus dem Jahr 2022 heißt es: „Der ökologische Notstand ist das Erbe des Kolonialismus“.
Es ist diese Ungerechtigkeit, die eine Welle von Forderungen nach Klimareparationen ausgelöst hat – im Wesentlichen eine Aufforderung an die wohlhabenden Länder des Globalen Nordens (die den Klimawandel verursacht haben), dieje-
nigen Länder finanziell zu unterstützen, die am wenigsten zur Verursachung beigetragen haben. Das wurde bereits 2009 erkannt, als sich die reichen Länder verpflichteten, ärmeren Ländern von 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden Dollar an Klimafinanzierung zukommen zu lassen. Wir schreiben jetzt das Jahr 2023 – und die versprochenen Mittel sind bisher in keinem Jahr vollständig bereitgestellt worden.
Die zweite Art, wie sich der Klimakolonialismus manifestiert, ist die Ausbeutung der Ressourcen des Globalen Südens durch Länder des Globalen Nordens, um ihre Klimaagenda voranzutreiben.
Die Universität Oxford drückt es so aus: „Unter dem Deckmantel der ‚Entwicklungsprojekte‘ und des ‚Kohlenstoffausgleichs‘ können westliche Länder und Unternehmen ihre Umweltverschmutzung wie gewohnt fortsetzen, wovon BIPOC [Black, Indigenous, People of Color] in Industrie- und Entwicklungsländern unverhältnismäßig stark betroffen sind.“
„Außerdem“, so heißt es weiter, „beinhalten viele dieser Lösungen die Vertreibung der indigenen Bevölkerung aus ihrem Land, was zu weit verbreiteten Menschen- und Landrechtsverletzungen führt.“
Ein Beispiel dafür sind laut Fair Planet die vom Globalen Norden unterstützten Projekte zur Auf-

Der Kolonialismus ist verantwortlich für jahrhundertelange schädliche Ausbeutungspraktiken in Regionen des Globalen Südens, wie Afrika und Lateinamerika, die zu Reichtum im Globalen Norden und Armut im Globalen Süden geführt haben.Filmstill aus „Holding up the Sky“ / Film still from ‘Holding up the Sky’
forstung und Wiederaufforstung, von denen einige nachweislich mit Menschenrechtsverletzungen, Landraub und Gewalt in Teilen Afrikas, Lateinamerikas und Indonesiens verbunden sind.
Wie Vijaya Ramachandran, Direktorin für Energie und Entwicklung beim Breakthrough Institute, 2021 schrieb: „Die Verfolgung von Klimazielen auf dem Rücken der ärmsten Menschen der Welt ist nicht nur scheinheilig – sie ist unmoralisch, ungerecht und grüner Kolonialismus in seiner schlimmsten Form.“
Vom Klimaschutz über die Anpassung an den Klimawandel bis hin zu Schäden und Verlusten werden die derzeitigen Lösungen für das Klima ungerecht und letztlich unzureichend bleiben, wenn die Auswirkungen des Kolonialismus nicht auf die Länder mit geringen Einkommen konzentriert werden, die über weniger Ressourcen verfügen, um ihre Klimaresilienz aufzubauen.
Was wird über Klimakolonialismus gesagt? Die Diskussion über Klimakolonialismus und die damit zusammenhängenden Themen – wie etwa die Forderung nach Klimareparationen, nach der Finanzierung von Schäden und Verlusten und nach der Übernahme von Verantwortung durch die Länder des Globalen Nordens für ihren Anteil an der Klimakrise – hat in den letzten Jahren stark zugenommen, insbesondere durch die Stimmen und Aufrufe zum Handeln von Aktivist*innen und Organisationen aus dem Globalen Süden.
Wie die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley (die an der Spitze einer potenziell bahnbrechenden Lösung für die Klimafinanzierung, der Bridgetown-Initiative, steht), auf der UNKlimakonferenz COP26 im Jahr 2021 sagte: „Wir wollen dieses gefürchtete Todesurteil nicht, und wir sind heute hierhergekommen, um zu sagen: ‚Strengt euch mehr an‘.“
Die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate drückte es nach der COP26 so aus: „Wir können uns nicht an den Hungertod anpassen. Wir können uns nicht an das Aussterben anpassen. Wir können keine Kohle essen. Wir können kein Öl trinken. Wir werden nicht aufgeben.“
Ein sehr bedeutsamer Moment war im Jahr 2022, als der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) in seinem sechsten Bericht über die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den Planeten zum ersten Mal in der Geschichte des IPCC den Begriff „Kolonialismus“ in seine Zusammenfassung aufnahm.
In dem Bericht stellte der IPCC fest, dass historische und anhaltende Formen des Kolonialismus die Anfälligkeit bestimmter Menschen und Orte für die Auswirkungen des Klimawandels direkt verschlimmert haben.
Wer ist davon betroffen? Die Menschen in Ländern mit geringen Einkommen in Afrika, Lateinamerika und Asien haben alle mit den Auswirkungen des Klimakolonialismus zu kämpfen, ebenso wie die Menschen in besonders klimaanfälligen Regionen wie der Karibik. In all diesen Regionen haben Millionen von Menschen durch die Auswirkungen des Klimawandels ihre Lebensgrundlage, ihr Zuhause, ihre Familienangehörigen und vieles mehr verloren.
In den letzten Jahren hat die Zahl der klimabedingten extremen Wetterereignisse weltweit unverhältnismäßig stark zugenommen.
Der Globale Klima-Risiko-Index 2021, der analysiert, inwieweit Länder und Regionen von den Auswirkungen wetterbedingter Schadensereignisse (Stürme, Überschwemmungen, Hitzewellen usw.) betroffen sind, einschließlich der Auswirkungen auf den Menschen und der direkten wirtschaftlichen Verluste, besagt, dass „weniger entwickelte Länder im Allgemeinen stärker betroffen sind als Industrieländer“.¶
Akindare Okunola, Global Citizen
EN What is climate colonialism?
Climate change and colonialism are linked. Here you will find out why.
They might not be two terms you expect to see together in any given context, but climate change and colonialism are inextricably linked. We’re going to take a look at why that is, and why considering the impact of historic and ongoing colonialist practices is so essential in the movement to tackle climate change.
Let’s start with a quick refresher of what colonialism means, before we dig into what it has to do with climate change.
What is colonialism? Colonialism is defined as ‘control by one power over a dependent area or people’. It generally involves one country taking control of another, often amid violence, and the killing, displacement and/or marginalisation of the existing population.
It dates right back to empires like Ancient Greece, Ancient Rome, Ancient Egypt and Phoenicia – but there have been two main waves of colonialism since then: one beginning in the fifteenth century, which saw European countries colonising lands across North and South Ameri-
ca, and another, known as the ‘Scramble for Africa’, which began in the nineteenth century.
Colonialism has been responsible for centuries of harmful extractive practices across Global South regions such as Africa and Latin America that have driven wealth in the Global North and poverty in the Global South.

So what’s climate colonialism? There’s two main ways to look at climate change in the context of colonialism. As The Conversation put it: ‘Connecting climate change to such acts of colonization involves recognizing that historic injustices are not consigned to history: their legacies are alive in the present.’
The first is about the historic causes of climate change. The Global North is responsible for the climate crisis we’re currently living through – in fact, Global North countries are responsible for over 92 per cent of carbon emissions.
Yet, it’s Global South countries – which are also disproportionately impacted by poverty, which also has its roots in exploitative colonial activities and practices – that are experiencing the worst impacts of climate change, in particular of extreme weather events.
As a 2022 report from Greenpeace UK stated: ‘The environmental emergency is the legacy of colonialism.’ It’s this injustice that has sparked a
Colonialism is responsible for centuries of harmful extractive practices across Global South regions, such as Africa and Latin America, that have driven wealth in the Global North, and poverty in the Global South.
Akindare Okunola
FILMTIPP
BETWEEN THE RAINS
Kole wird erwachsen – und hadert mit seinem vorgegebenen Weg als Viehhüter und Krieger. Der junge Kenianer gibt auf so eindrucksvolle und intime Weise Einblicke in sein Leben, dass ich gar nicht anders konnte, als jede Sekunde des Films mitzufiebern – und mit Kole zu hoffen. Dass die Gewalt aufhört. Dass das Vieh nicht mehr von wilden Tieren gerissen wird. Dass endlich der Regen kommt. Er zeigt sein Leben zugleich auf eine spannende und berührende Art – eine ganz klare Empfehlung! → Seite 91
EN Kole’s growing up – and struggling to come to terms with his destiny as a cattle herder and warrior. The Kenyan boy gives such impressive and intimate insights into his life that I followed every second of this film with excitement – and hope. Hoping with Kole that the violence will stop. That the cattle will stop being killed by wild animals. And that it will finally rain. He shows us his life in a way that is both exciting and touching – I highly recommend this film!

→ Page 91
Pia Grohmann, Aktion gegen den Hunger
wave of calls for climate reparations – essentially calling on wealthy countries in the Global North (that have caused climate change) to financially support the countries that have done the least to cause climate change in order to respond to the impacts that it is having on them.
This was recognised back in 2009, when wealthy countries pledged to deliver USD 100 billion every year in climate finance to developing countries from 2020 to 2025. It is now 2023, and the promised funding has not been delivered in full in any year so far.
The second way that climate colonialism is manifesting itself is through the exploitation of the resources of the Global South by countries in the Global North in order to further their climate agendas.
As the University of Oxford puts it: ‘Under the veil of “development projects” and “carbon offsetting”, western countries and companies can continue to pollute as normal, which disproportionately affects BIPOC [Black, Indigenous, People of Color] folk in both developed and developing countries.’
‘Further,’ it adds, ‘many of these solutions involve displacement of Indigenous populations from their lands leading to widespread human and land rights abuses.’
One example of this, according to Fair Planet, is Global North-backed afforestation and reforestation projects, some of which have been shown to involve human rights abuses, land grabs and violence in parts of Africa, Latin America and Indonesia.
As Vijaya Ramachandran, Director for Energy and Development at the Breakthrough Institute, wrote in 2021, ‘Pursuing climate ambitions on the backs of the poorest people in the world is not just hypocritical – it is immoral, unjust, and green colonialism at its worst.’
From climate mitigation and adaptation to loss and damage, current climate solutions will remain inequitable and ultimately insufficient if we do not focus on the impact that colonialism is having on developing nations that have fewer resources to build climate resilience.
What’s been said about climate colonialism?
The conversation about climate colonialism and related issues – such as calls for climate reparations, for loss and damage financing, and for Global North countries to take responsibility for their part in the climate crisis – has quickly escalated in recent years, particularly through the voices of and calls to action made by activists and organisations across the Global South.
As Prime Minister of Barbados Mia Mottley (who is spearheading a potentially groundbreak-
ing climate finance solution called the Bridgetown Initiative) said at the UN Climate Change COP26 in 2021, ‘We do not want that dreaded death sentence and we have come here today to say, “try harder”.’
Following COP26, Ugandan climate activist Vanesssa Nakate put it this way: ‘We cannot adapt to starvation. We cannot adapt to extinction. We cannot eat coal. We cannot drink oil. We will not give up.’
A very significant moment came in 2022 when the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in its sixth report on the impact of global warming on the planet, included the term ‘colonialism’ in its report summary – for the first time in IPCC history.
In this report, the IPCC asserted that historic and ongoing forms of colonialism had directly exacerbated the vulnerability of specific people and places to the effects of climate change.

Who is this affecting? People living in developing countries in Africa, Latin America and Asia are all grappling with the effects of climate colonialism, along with those in especially climate-vulnerable places like the Caribbean. Across these regions, millions of people have lost their livelihoods, their homes, family members and more due to the effects of climate change – in particular extreme weather events.
In the last few years, there has been a disproportionate rise in the number of climate-induced extreme weather events around the world.
In 2021, the Global Climate Risk Index, which analyses the extent to which countries and regions have been affected by the impacts of weather-related loss events (storms, floods, heat waves etc.), including human impacts and direct economic losses, said that ‘less developed countries are generally more affected than industrialised countries.’¶
Akindare Okunola, Global Citizen
Dieser Artikel wurde zuerst auf globalcitizen.org veröffentlicht. Global Citizen ist eine globale Bewegung engagierter Menschen, die gemeinsam ihre Stimmen nutzen, um extreme Armut jetzt und überall zu beenden. / This article was first published on globalcitizen.org. Global Citizen is one of the world’s leading international advocacy organisations on a mission to end extreme poverty.
VERNISSAGE
→ 13. Okt., 16:30 Uhr
→ Öffnungszeiten: Di–So 10–19 Uhr

OPENING
→ 13 Oct, 4:30pm
→ Opening hours: Tue–Sun 10am–7pm
→ Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung
Stresemannstr. 90, 10963 Berlin
© Peter CatonUnaufhaltsame Überschwemmungen – Dem Klimawandel begegnen / Unyielding Floods
–Facing Climate Change
Eine Fotoausstellung von Aktion gegen den Hunger und dem Fotografen Peter Caton über die Folgen der Klimakrise im Südsudan
EN A photo exhibition by Action Against Hunger and photographer Peter Caton on the consequences of the climate crisis in South Sudan.
„Obwohl die Menschen im Südsudan am wenigsten zur Klimakrise beitragen, sind sie es, die von den katastrophalen Folgen des Klimawandels in besonderer Weise betroffen sind. Über einen Zeitraum von drei Jahren habe ich die Gemeinden Old Fangak und Paguir im Südsudan mehrmals besucht. Es war mir wichtig, die Widerstandsfähigkeit der Menschen zu bezeugen, die die massiven Zerstörungen durch Überschwemmungen überlebt haben. Ich habe die wichtige Arbeit von Aktion gegen den Hunger fotografisch dokumentiert, die die Gemeinden dabei unterstützt, sich an das veränderte Klima anzupassen und neue Lebensgrundlagen zu schaffen. Das gibt den Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft.“ ¶
Peter Caton, FotografEN The people of South Sudan have contributed least to the climate crisis but are the ones most affected by its catastrophic consequences. Over a three-year period, I visited the communities of Old Fangak and Paguir in South Sudan several times. It was important to witness the resilience of the people who have survived the massive destruction caused by floods. In photos, I documented the important work being done by Action Against Hunger, which is helping communities to adapt to climate change and find new livelihoods, giving people hope for a better future. ¶
Peter Caton, photographer
„Menschenrechte müssen im Zentrum der globalen Ernährung stehen“
Wie sollte ein gerechtes globales Lebensmittelsystem aussehen? Obwohl es theoretisch für alle genug zu essen gibt, leiden immer noch Millionen von Menschen unter Hunger und Armut. Wir sprechen mit Yvonne Takang von Aktion gegen den Hunger über das globale Ernährungssystem, Agrarökologie und warum das Wissen von lokalen Kleinbäuer*innen so wichtig ist.

Einer von zehn Menschen weltweit leidet an Hunger. Manche Expert*innen sagen, wir bräuchten die industrielle Landwirtschaft, um alle 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Stimmen Sie zu?
Yvonne Takang: Die Verbreitung der sogenannten „konventionellen Landwirtschaft“ hat zu einer weltweiten Massenproduktion geführt – die jedoch Nahrungsmittel mit viel weniger Mikronährstoffen produziert! Die industrielle Landwirtschaft setzt massiv Chemikalien ein und ist von langen Produktionsketten abhängig. Das ist schlecht für die Umwelt und schlecht für die Verbraucher*innen. Wir von Aktion gegen den Hunger sind der Meinung, dass es bessere Ansätze gibt, um gesunde Lebensmittel für alle Menschen zu produzieren
… zum Beispiel die Agrarökologie, eine Methode, die Aktion gegen den Hunger in verschiedenen Programmen weltweit fördert. Wie funktioniert sie?
Takang: Im Gegensatz zur industriellen Landwirtschaft fördert die Agrarökologie die Diversifizierung von Nutzpflanzen. Die meisten Menschen essen jeden Tag die gleiche Getreidesorte. In West- und Zentralafrika ist der sogenannte „versteckte Hunger“ sehr verbreitet: Die Menschen werden satt, ernähren sich aber so einseitig, dass sie trotzdem Mangelernährungserscheinungen haben. Vor allem für Kinder ist eine ausgewogene Ernährung sehr wichtig.
Wenn alle Landwirt*innen weltweit nur Agrarökologie betreiben würden, könnten wir dann genug Nahrung für alle produzieren?
Takang: Ja. Wenn die Politik die Agrarökologie vorantreiben würde, indem sie die Regierungen und die Bäuer*innen vor Ort richtig unterstützt, dann wäre es möglich. Wir müssten uns vollständig vom konventionellen Ansatz verabschieden und uns nur auf die Agrarökologie konzentrieren. Dann wären wir in der Lage, die Welt in einer Weise zu ernähren, die nachhaltig, umweltfreundlich, gesund und fair ist – für alle.
Können Sie uns einige Beispiele nennen?
Takang: In Kamerun haben wir ein Projekt, bei dem wir biologischen Dünger aus menschlichem Urin hergestellt haben. Sie können sich vorstellen, dass die Landwirt*innen erst einmal sehr zurückhaltend waren. Doch tatsächlich konnten wir die Ernten auf den agrarökologisch bebauten Feldern um 80 Prozent steigern!
In Burkina Faso haben viele Bäuer*innen große Probleme, weil durch die Folgen der Klimakrise die Ernten ausbleiben und sie ihre Familien nicht mehr ernähren können. Wir haben in unserem Projekt Bio-Düngemittel und nachhaltige Methoden der Bodenbearbeitung eingeführt – mit bestimmten Umgrabetechniken und Tiermist konnte die Bodenqualität maßgeblich gesteigert werden. Die teilnehmenden Bäuer*innen konnten ihre Erträge um bis zu 70 Prozent steigern!
West- und Zentralafrika ist bereits stark von der Klimakrise betroffen. Müssen die Menschen ihre landwirtschaftlichen Methoden anpassen?
Takang: Die meisten Kleinbäuer*innen sind noch nicht auf die Herausforderungen der Klimakrise vorbereitet. Sie versuchen immer noch, die gleichen Produkte anzubauen wie eh und je. Aber die Realität des Klimawandels ist bereits da. Im Senegal hatten wir die schwersten Über-
Yvonne Takang
schwemmungen seit vielen Jahren. Die Pflanzensorten, die die Landwirt*innen vor über zehn Jahren anbauten, wachsen heute nicht mehr. Wir ermutigen sie, nachhaltigere Methoden anzuwenden, Wechselwirtschaft zu betreiben und Bio-Pestizide einzusetzen.
Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass das agroindustrielle System viel traditionelles Wissen über die Landwirtschaft zerstört hat. Traditionelles Saatgut hatte eine viel bessere Qualität. Wir müssen immer schauen, was für die Menschen vor Ort in ihrem spezifischen Kontext funktioniert – und sie am Ende entscheiden lassen.
Die Lebensmittelsysteme funktionieren heute global. Was sind die Folgen und was würden Sie gern ändern?
Takang: Die globalisierten Lebensmittelsysteme sind mitverantwortlich für Umweltzerstörung, den Zusammenbruch der biologischen Vielfalt und den voranschreitenden Klimawandel. Außerdem haben sie katastrophale soziale Auswirkungen, da sie den Reichtum in den Händen weniger Großkonzerne konzentrieren und gleichzeitig die Lebensgrundlagen von Kleinbäuer*innen zerstören.
Wie die jüngsten Krisen gezeigt haben, sind unsere Ernährungssysteme nicht widerstandsfähig. Sie bieten keine Antworten auf die aktuellen Herausforderungen der Ernährungssicherheit.
Diese Systeme müssen überdacht werden. Politiker*innen müssen jetzt handeln und dabei die Bedürfnisse der Kleinbäuer*innen bedenken. Das öffentliche Interesse und die Menschenrechte müssen im Mittelpunkt der globalen Ernährung stehen. ¶
Interview von Lisa Paping
TALKING HUMANITY
HUNGER ALS
KRIEGSWAFFE: WIE GEWALTSAME KONFLIKTE ZU HUNGER FÜHREN
EN HUNGER AS A WEAPON OF WAR: HOW VIOLENT CONFLICTS LEAD TO HUNGER
→ 17. Okt., 18:30 Uhr
→ Dokumentationszentrum
→ Im Anschluss / followed by: Le Spectre de Boko Haram (Seite 89 / page 89)
→ Mehr Informationen auf Seite 26 / more information on page 26
„Die meisten Kleinbäuer*innen sind noch nicht auf die Herausforderungen der Klimakrise vorbereitet. Sie versuchen immer noch, die gleichen Produkte anzubauen wie eh und je.“
FILMTIPP BETWEEN THE RAINS
Inmitten von Stammeskonflikten und der Gefahr durch die Klimakrise muss ein Hirtenjunge seine Identität hinterfragen.
→ Seite 91
EN In the midst of tribal conflicts and the threat being posed by the climate crisis, a shepherd boy must question his identity.
→ Page 91
What should fair food systems look like? While there is enough food for everybody in theory, millions of people still suffer from hunger and poverty. We talked to Yvonne Takang from Action Against Hunger about global food production, agroecology and why local farming knowledge is so important.
One out of ten people worldwide suffer from hunger. Some experts say we need industrial agriculture to feed the world’s 8 billion people.
Do you agree?
Yvonne Takang: The development of so-called ‘conventional agriculture’ has led to global mass production – which produces food with much poorer essential micronutrients! Industrial agriculture is based on the use of chemical inputs and long production chains. This is bad for the environment and bad for consumers. We at Action Against Hunger think that there are better systems that could be used to produce healthy food for everybody
… for example, agroecology, a method that Action Against Hunger is promoting in various programs around the globe. How does it work?
Takang: Unlike monoculture-based systems, agroecology promotes what we call crop diversification. Most people consume one cereal over and over again. In West and Central Africa, what is referred to as ‘hidden hunger’ is very wide-

Gemeinschaftsgarten in Kaédi, Mauretanien, 2022. Das Projekt ist ein Vorhaben zur Ernährungssicherheit und zur Stärkung der Frauen, das durch Unterstützung von landwirtschaftlichen Genossenschaften und Gemeinschaftsgärten umgesetzt wird, unter anderem mit agroökologischen Ansätzen.
Community garden in Kaedi, Mauritania, 2022. This project seeks to ensure food security and empower women by providing support to agricultural cooperatives and community gardens, etc., that take an agroecological approach.
spread: people eat enough meals, but have such an unbalanced diet that they suffer from malnourishment. Diversified diets are really important, especially for children.
If all farmers worldwide only used agroecological methods, could we produce enough food for everybody?
Takang: Yes. If politics aimed to push the agroecological approach by putting in place the right support to governments and local farmers, then it would be possible. We would need to turn away from conventional systems altogether and focus on agroecology. We would be able to feed the world with an approach that is sustainable, environmentally friendly, healthy – and fair for all human beings.
Can you give us some examples?
Takang: In Cameroon, we have a project where we use human urine as a fertiliser – at first, farmers were reluctant to use this new method. But you won’t believe it: improved yields up to 80 per cent higher were observed on plots where agroecological practices had been adopted!
EN ‘Human rights need to be at the heart of global food systems.’
‘Most small-scale producers have not yet been trained to adapt to climate change. They are still trying to grow the same things they always have.’
Yvonne Takang
In Burkina Faso, farmers regularly tell us about the negative impacts of climate change: yields are decreasing more and more, and farmers are finding it hard to feed their families. We have introduced new methods such as biopesticides and soil rotation. Our team trains farmers to rotate their soil and use animal dung. This prevents the erosion of land and significantly increases soil quality. Farmers participating in this initiative have reported a 70 per cent increase in agricultural yields!
The climate crisis is already heavily affecting West and Central Africa. Do people have to adapt their agricultural methods?
Takang: Most small-scale producers have not yet been trained to adapt to climate change. They are still trying to grow the same things they always have. But we are already seeing the reality of climate change. In Senegal, we have had the most severe floods we have seen in years. Right now, the plants farmers used to plant ten years ago no longer grow. We are encouraging them to use more sustainable methods, to rotate their crops, to use biopesticides.
At the same time, we have to acknowledge that agro-industrial methods have destroyed a lot of traditional farming knowledge. Traditional seeds were of much better quality. We always have to look at what works for people in their local context – ultimately letting them decide.

Food systems operate globally today. What are the consequences and what would you like to change?



Takang: Globalised food systems are largely responsible for environmental degradation, the collapse of biodiversity and increasingly severe climate change. Moreover, they have had a disastrous social impact by concentrating wealth in the hands of few big corporations while destroying the livelihoods of smallholders.


As recent crises have shown, our food systems are not resilient. They don’t provide answers to current food security challenges. These systems have to be rethought. Decision-makers have to act now, considering the needs of small-scale farmers in their own villages. Public interest and human rights need to be at the heart of global food systems. ¶
Interview by Lisa Paping






















Yvonne Takang ist Regionale Advocacy-Koordinatorin von Aktion gegen den Hunger im Regionalbüro für West- und Zentralafrika in Dakar, Senegal. Ihre Schwerpunktthemen sind Ernährungssouveränität, Nahrungsmittelsicherheit und die Stärkung der regionalen Landwirtschaft. / Yvonne Takang is Regional Advocacy Advisor for Action Against Hunger’s Regional Office for West and Central Africa in Dakar, Senegal. Her main topics are food sovereignty, food security and the strengthening of regional agriculture.




Geschichten, die Veränderungen bewirken
Die globalen Herausforderungen wie Klimawandel und Ungerechtigkeit sind entmutigend. Doch was wäre, wenn wir durch inspirierende Geschichten junge Menschen überzeugen könnten, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen, um einen gerechteren Planeten zu gestalten? Genau das ist das Ziel von „Stories for Change“, einer Initiative des Human Rights Film Festival Berlin und von Schulen gegen den Hunger.

Multimediale Ansätze und persönliche Begegnungen öffnen Fenster zu neuen Realitäten. Durch diese Erlebnisse können Jugendliche Ressentiments und Vorurteile abbauen und sich über globale Fragen informieren. Diese Erfahrungen aktivieren ihre Empathie und ihr Solidaritätsempfinden und inspirieren sie, Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen.
Die Philosophie von „Stories for Change“ besteht darin, Raum für Gedanken, Fragen und Perspektiven zu bieten und einen partizipativen Ansatz zu verfolgen. Diese Methode fördert Reflexion und setzt eine Dynamik in Gang, die weit über den schulischen Kontext hinaus wirkt.
Im Rahmen dieses Projekts nehmen wir junge Menschen auf eine Reise mit, die ihre Sicht auf die Welt erweitert und sie dazu motiviert, sich aktiv für eine gerechtere Welt einzusetzen. Interaktive Vorträge und multimediale Bildungsmaterialien ermöglichen es den Schüler*innen, die Lebensumstände Gleichaltriger im Globalen Süden zu verstehen. Ein maßgeschneidertes Filmprogramm bietet ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, tiefer in die Themen einzutauchen und ihre globale Bedeutung vollständig zu erfassen.
Interaktive Vorträge in Schulen werden durch dokumentarische Kurzfilme, erstellt von lokalen Filmemacher*innen, ergänzt und bieten so authentische Einblicke in die dortigen Lebensumstände. Dadurch fördern wir eine zeitgemäße Erzählweise, die zur Veränderung von Denk- und Handlungsmustern beiträgt.
Eine Filmtour durch Deutschland und Schulvorführungen bieten vielfältige Perspektiven und ermöglichen es, komplexe Themen wie Fluchtursachen oder globale Ungleichheit zu diskutieren. Der Ansatz verbindet Aktivist*innen deutschlandweit mit einem Publikum, klärt auf, motiviert und aktiviert, selbst tätig zu werden.
Wir sind überzeugt, dass wir durch die Aktivierung dieser Generation und durch die Förderung
ihres Verständnisses für ihre Rolle in der globalen Gemeinschaft einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und globaler Ungerechtigkeit leisten können. Die jungen Menschen sind die Protagonist*innen von morgen und es liegt in unserer Verantwortung, sie auf die Herausforderungen und Chancen, die vor uns liegen, vorzubereiten. ¶
EN Stories for Change
Global challenges such as climate change and injustice are daunting. But what if we could use inspiring stories to convince young people to actively work for a better world to shape a more just planet? That is the goal of ‘Stories for Change’, an initiative of the Human Rights Film Festival Berlin and Schools Against Hunger.
As part of this project, we take young people on a journey that broadens their view of the world and motivates them to actively work towards a more just world. Interactive lectures and multimedia educational materials enable students to understand the conditions that their peers in the Global South are living in. A tailored film program also offers them the opportunity to delve deeper into the issues and fully grasp their global significance.
Multimedia approaches and face-to-face encounters open windows to new realities. Through these experiences, young people can dismantle their resentments and prejudices and learn about global issues. These experiences activate their sense of empathy and solidarity, and inspire them to take responsibility for their future.
The philosophy of Stories for Change is to provide space for new thoughts, questions and perspectives while taking a participatory approach. This method encourages reflection and sets in motion a dynamic that has an impact that goes far beyond the school context.
Interactive presentations in schools are complemented by documentary shorts created by film-makers from the affected regions, offering authentic insights into the conditions there. In this way, we promote contemporary narratives that help to change patterns of thought and action.
A film tour through Germany and school screenings offer diverse perspectives and make it possible to discuss complex topics such as the causes of displacement and global inequality. This approach connects activists with audiences across Germany, educates, motivates and activates them to take action themselves.
We are convinced that, by mobilising this generation and enabling them to understand the role they play in the global community, we can make a significant contribution to combating climate change and global injustice. Young people are the protagonists of tomorrow, and it is our responsibility to prepare them for the challenges and opportunities that lie ahead.¶
SCHULEN GEGEN DEN HUNGER
Das Sport- und Bildungsprojekt „Schulen gegen den Hunger“ wurde von der humanitären und entwicklungspolitischen Organisation Aktion gegen den Hunger initiiert. Es sensibilisiert Kinder und Jugendliche in Deutschland für das weltweite Problem der Mangelernährung und ermöglicht es ihnen, sich auf sportliche Weise sozial zu engagieren. In interaktiven Vorträgen erfahren Schüler*innen, wie Gleichaltrige im Globalen Süden von aktuellen globalen Herausforderungen betroffen sind. Sie erhalten Fachwissen zum Thema Hunger und werden durch Experimente und Kurzfilme zu einem Perspektivwechsel angeregt.
EN The sports and education project Schulen gegen den Hunger was initiated by the humanitarian and development organisation Action Against Hunger. It raises awareness among children and young people in Germany about the global problem of malnutrition and enables them to get involved socially through sports. In interactive presentations, students learn how their peers in the Global South are being affected by current global challenges. They gain expertise in the topic of hunger and are encouraged to change their perspectives through experiments and short films.
Vom 22. Oktober bis zum 22. November präsentieren wir in verschiedenen deutschen Städten drei Filme aus unserem diesjährigen Festivalprogramm. Diese können darüber hinaus ganzjährig als Schulvorführungen im Kino oder in unserem digitalen Kinosaal gebucht werden. Die Aktivist*innen aus den Filmen begleiten uns auf der Tour, um einen tiefgreifenden Einblick in ihre Arbeit und Erfahrungen zu geben. Das Projekt „Stories for Chance“ wird von der Deutschen Postcode Lotterie ermöglicht.
EN From 22 October to 22 November, we will be presenting three films from this year’s festival program in various German cities. These films can also be booked as school screenings in the cinema or in our digital cinema room throughout the year. Activists from the films accompany us on tour to provide in-depth insights into their work and experiences. The project Stories for Change is supported by the Deutsche Postcode Lottery.
Closing Film Mutige Geschichten des Widerstands und der Hoffnung
In einer Welt, in der Stimmen oft zum Schweigen gebracht werden, fungiert der Film „Bread and Roses“ als mutiges Zeugnis für die Stärke von drei afghanischen Frauen. Er zeigt in aller Härte, wie die Machtübernahme der Taliban in Kabul das Leben der Menschen verändert hat.
Das Projekt entstand aus einer Sammlung von heimlich gefilmten, wackligen Handyvideos, die Frauen festhielten, denen von einem Tag auf den anderen grundlegende Rechte entzogen wurden. Die Entstehung des Films war nicht geplant, da die afghanische Regisseurin Sahra Mani mitten in einem anderen Projekt steckte. Doch die Aufnahmen formten sich zu einer Geschichte, die erzählt werden musste.
„Bread and Roses“ verwebt eine komplexe Erzählung, die sich auf drei charismatische Frauen konzentriert, die sich den konservativen Normen ihrer Familien widersetzen, um Symbole des Widerstands zu werden. Die Szenen wechseln zwischen den Frauen, die um ihr Leben kämpfen, die in innigen Gesprächen mit ihren Familien aufgehen, sich unaufhaltsam nach Freiheit sehnen und zugleich unbändige Entschlossenheit verspüren, das Schicksal afghanischer Frauen zu verändern.
„Alles brach in wenigen Tagen zusammen“, sagte Jennifer Lawrence, Co-Produzentin des Films, gegenüber Variety. „Wir fühlten uns hilflos und frustriert. Wir wollten einen Weg finden, die Geschichten aus dem Nachrichtenkarussell in die Köpfe der Menschen zu bringen.“
„Dieser Film ist eine Botschaft von Frauen in Afghanistan, eine sanfte Botschaft: Bitte seid die Stimme der Frauen, die unter der Taliban-Diktatur stumm sind“, sagt Regisseurin Mani bei der Premiere in Cannes.
Möchten Sie wissen, wie Mut aussieht? Dann schauen Sie „Bread and Roses“. Hören Sie die Geschichten von Frauen, die alles riskieren: für das Recht zu arbeiten, ohne männliche Begleitung in die Öffentlichkeit gehen zu dürfen und eine Aus-
bildung zu erhalten. Entdecken Sie einen Film, der nicht nur Spiegelbild einer tragischen Realität ist, sondern ein Aufruf zum Handeln. ¶ Anna Ramskogler-Witt, Jana Sepehr

EN The courageous tale of resistance and hope in ‘Bread and Roses’
In a world where voices are often silenced, the film ‘Bread and Roses’ resonates as a courageous testament to the strength of three Afghan women. Born of the urgency of a situation quickly deteriorating after the Taliban’s takeover of Kabul, this documentary, directed by Afghan native Sahra Mani, brings a harsh reality to the fore.
The project emerged from a collection of secret and shaky camera phone footage, capturing confrontations and the daily lives of Afghan women in a society suddenly stripped of basic human rights. The film’s inception was not planned, as Mani was in the midst of another project. However, the footage she received was a calling. It was a story that needed to be told.
‘Bread and Roses’ weaves a complex narrative, focusing on three charismatic women who defy the conservative norms of their families to become symbols of resistance. Its scenes transition between the women as they struggle for their lives, engage in heartfelt conversations with their families and display an unstoppable yearning for freedom coupled with an indestructible determination to change the fate of Afghan women.
‘It all just collapsed in a matter of days,’ as actress and coproducer of the film Jennifer Lawrence told Variety. ‘We felt helpless and frustrated with how to get these stories off the news cycle and into people’s psyches. To help galvanize peo-
FILMTIPP BREAD AND ROSES
Mit der Machtübernahme der Taliban verloren sie ihre Rechte, doch die afghanischen Frauen kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben und ihre Würde. → Seite 85
EN They lost their rights with the Taliban’s takeover, but Afghan women are fighting for their dignity and their right to lead a self-determined life.

→ Page 85
ple and make them care about the plight of these women.’
‘This film coneys a message from women in Afghanistan, a soft message: please be the voice of those who are voiceless under the Taliban dictatorship,’ said Mani at the premiere in Cannes.
Do you want to know what bravery looks like?
Watch ‘Bread and Roses’. Listen to the stories of the women who have risked everything for the rights to work, to appear in public without a male chaperone and to receive an education. Discover a film that is not just a reflection of a tragic reality but a call to action.¶
Anna Ramskogler-Witt, Jana SepehrDer SPD-Politiker und ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse war Willy Brandts wichtigster Gesprächspartner der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Im Interview spricht er über seine Leidenschaft zur Politik, die Kraft von Dokumentarfilmen und die größten Herausforderungen unserer Zeit.
Das diesjährige Festival steht unter dem Motto „The Good Fight“. Was ist der größte gesellschaftspolitische Kampf, den es aktuell zu führen gilt?
Wolfgang Thierse: Wir leben in einer Zeit, in der wir mit dramatischen Herausforderungen und Ungerechtigkeiten konfrontiert sind. Dazu gehört der Überfall Russlands auf die Ukraine und die sich zuspitzende Klimakatastrophe, die wir verhindern müssen. Es ist Aufgabe der Politik, die Lasten, aber auch die Chancen gerecht zu verteilen. Das ist eine große Herausforderung, die wirklich radikale Veränderungen unserer Produktionsweise und unseres Konsumverhaltens verlangt.
In vielen unserer Filme geht es genau um dieses Ungleichgewicht im Kontext der von Ihnen angesprochenen Produktionsprozesse. Wo sehen Sie Handlungsansätze für jede*n Einzelne*n, um sich nicht ohnmächtig zu fühlen?
Thierse: Allem voran muss eine gerechte Handels- und Ressourcenpolitik im globalen Maßstab betrieben werden. Was der einzelne Verbraucher tun kann, ist dagegen fast bescheiden, aber doch notwendig: Es geht um einen Bewusstseinswandel im Konsumverhalten. Man sollte mehr darauf achten, woher ein Produkt kommt, und sich fragen, ob der Preis dafür angemessen und fair ist – oder unverschämt billig. Denn unser bisheriges Konsumverhalten im Westen hat zu der Katastrophe geführt, in der wir uns jetzt befinden.
Der Willy-Brandt-Dokumentarfilmpreis für Freiheit und Menschen-
rechte soll herausragende Filmemacher*innen unterstützen, deren Arbeit exemplarisch für die Werte Brandts stehen. Warum sind Filme als Medium besonders gut für die Vermittlung von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität geeignet? Worin liegt ihr Potenzial für den gesellschaftlichen Wandel?
Thierse: Der Dokumentarfilm ermöglicht im Gegensatz zum Spielfilm eine größere Unmittelbarkeit und Authentizität. Er zeigt Menschen in ihrer realen Lebenswelt mit ihren Konflikten und Nöten und lässt sie in ihrer authentischen Sprache zu Wort kommen. Es gibt keine konstruierten, fiktiven Heldinnen und Helden. Dieser direkte Zugang erzeugt eine einzigartige Wirkung, anders als beim Spielfilm, der durch den Umweg über die Fiktion oft der Beschönigung, Verharmlosung oder gar Verlogenheit verdächtigt wird.
Es ist auch unser Ansatz als Filmfestival, Menschen einen direkteren Zugang zu Geschichten zu ermöglichen.
Thierse: Wer sich den täglichen Nachrichten aussetzt, erlebt eine Flut von Informationen über Konflikte, Kriege, Armut und Elend. Dies führt unweigerlich zu einem Prozess der Gewöhnung und Abstumpfung, sonst wäre es nicht auszuhalten. Der Dokumentarfilm hat die Chance, genau diesen Prozess zu durchbrechen, indem er ein einzelnes Ereignis, einen einzelnen Ort oder einen einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt und dessen Geschichte erzählt. Diese Form der Vermittlung ist so viel eindrücklicher und dem Betrachter sowohl im Kopf als auch im Herzen nahe.
Sie selbst haben in der DDR an Drehbüchern für DEFA-Dokumentarfilme
mitgewirkt. Müssen – und können –Dokumentarfilme objektiv sein?
Thierse: Dokumentarfilme sollen so präzise wie möglich sein, aber sie müssen nicht unparteiisch sein. Es gehört zum Wesen des Dokumentarfilms, etwas zur Sprache zu bringen, was sonst übersehen oder verfälscht wird. Diese Parteilichkeit halte ich für sehr wertvoll. In der DDR wurde der Film jedoch oft instrumentalisiert und als Agitationsinstrument genutzt, um ideologische Urteile über die Wirklichkeit zu verbreiten.
Sie haben selbst eine bewegte Biografie, haben Engagement in der DDR, während der Wendezeit und bis heute erlebt. Gab es in Ihrem Leben einen Moment, der Sie politisiert hat?
Thierse: Ich bin in einem sehr politischen Elternhaus aufgewachsen und habe die politische Leidenschaft von meinem Vater geerbt. Wenn man in der DDR lebt, in einem unfreien, kommunistischen Staat an der Grenze zum Westen, stellt man sich immer die Frage, wie man die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse verändern kann. Die Erfahrung von Einschränkung, Unfreiheit und Demütigung hat mich politisiert, die Sehnsucht nach einem anderen Land hat mich angetrieben. Wirklichkeit werden konnte dies erst mit der friedlichen Revolution von 1989/90. In diesem Moment fanden wir unsere öffentliche Stimme und verloren unsere Angst – und Angst ist ein zentraler Pfeiler einer Diktatur. Wir erkannten, wie viel Kreativität und Mut in uns steckten, die im Alltag der Diktatur verborgen geblieben waren. Das war der Aufbruch, an den ich mich mit großer Begeisterung erinnere. Es war der entscheidende Moment der friedlichen Revolution.
„Es sind gefährliche Zeiten“
„Es gehört zum Wesen des Dokumentarfilms, etwas zur Sprache zu bringen, was sonst übersehen wird.“
Wolfgang Thierse
In ganz Europa erleben wir derzeit einen erschreckenden Rechtsruck – in Polen, Ungarn, Österreich, aber auch in Deutschland. Sie engagieren sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus. Was kann man tun?
Thierse: Das ist eine beunruhigende Entwicklung, die tiefere Ursachen hat. Dramatische Zeiten des Wandels sind auch Zeiten der Ängste, der Verunsicherung und damit Zeiten für Populisten, die einfache Antworten geben, die Lösungen für Probleme versprechen und die Menschen verführen. Es sind gefährliche Zeiten. Daher ist es erstens notwendig, dass sich die demokratischen Politiker und Parteien sichtbarer um Lösungen bemühen, ohne Wunder zu versprechen. Zweitens müssen sie ihr Handeln und ihre Entscheidungen verständlich machen und damit die Bürger zum Mitdenken, Mitfühlen und Mitmachen einladen. Das scheint mir das Entscheidende zu sein. Das Dritte ist: Die demokratischen Kräfte müssen solidarisch miteinander sein und die Abgrenzung zu den Nationalisten, Neonazis und Rechtsextremisten deutlich machen. Sie müssen denen entgegentreten, die Hass verbreiten.¶
Interview von Anna Ramskogler-Witta big challenge that requires really radical changes in the ways that we produce and consume.
Many of our films are precisely about this imbalance in the context of the production processes you mentioned. Where do you think action can be taken to prevent each individual from feeling powerless?
Thierse: First and foremost, a fair trade and resource policy must be pursued on a global scale. What individual consumers can do, on the other hand, is somewhat modest but necessary nonetheless: it’s about changing awareness in consumer behaviour. We need to pay more attention to where a product comes from and ask ourselves whether the price is reasonable and fair – or outrageously cheap. Because our previous consumer behaviour in the West has led to the catastrophe in which we now find ourselves.
Thierse: Anyone exposed to the daily news experiences a flood of information about conflicts, war, poverty and misery. This inevitably leads to a process of habituation and desensitisation, otherwise it would be unbearable. Documentary films have the potential to break through precisely this process by focusing on a single event, a single place or a single person and telling their story. This form of delivery is so much more impactful and gets closer to the viewer’s mind and heart as well.
You yourself worked on scripts for DEFA documentaries in the GDR. Do documentaries have to – and can they –be objective?
SPD politician and former Bundestag President Wolfgang Thierse was Willy Brandt’s most important interlocutor in the SPD of the GDR. In this interview, he talks about his passion for politics, the power of documentaries and the greatest challenges of our times.
The theme of this year’s festival is ‘The Good Fight’. What is the biggest sociopolitical fight that needs to be fought right now?
Wolfgang Thierse: We are living in times in which we are being confronted by dramatic challenges and injustices. These include Russia’s invasion of Ukraine and the worsening climate catastrophe, which we have to prevent. It’s up to policymakers to share the burdens, but also the opportunities, fairly. That’s
The Willy Brandt Documentary Award for Freedom and Human Rights is intended to support outstanding film-makers whose work exemplifies Brandt’s values. Why is film as a medium particularly well suited to conveying freedom, justice and solidarity?
What is its potential for social change?
Thierse: In contrast to feature films, documentaries allow for greater immediacy and authenticity. They show people in their real lives, with their conflicts and hardships, and let them speak in their own authentic languages. There are no constructed, fictional heroes. This direct approach creates a unique effect, unlike feature films, which are often suspected of whitewashing, trivialisation or even mendacity due to the detours they take through fiction.
It’s also our approach as a film festival to give people more direct access to stories.
Thierse: Documentaries should be as accurate as possible, but they don’t have to be impartial. It’s part of the essence of documentary film-making to bring up something that would otherwise be overlooked or distorted. I think this partiality is very valuable. In the GDR, however, film was often instrumentalised and used as an agitational tool to spread ideological judgments about reality.
You yourself have an eventful biography: you were politically engaged in the GDR and during the Wende period, and you are still engaged today. Was there a moment in your life that politicised you?
Thierse: I grew up in a very political household and inherited my passion for politics from my father. Living in the GDR, in an unfree, communist state on the border to the West, you constantly asked yourself how you could change political and social conditions. Experiencing restrictions, a lack of freedom and humiliation politicised me, and my longing for a different country spurred me on. This could only become reality with the peaceful revolution of 1989/90, when we found our public voice and stopped being
EN ‘These are dangerous times.’
‘Part of the nature of documentary is to bring up something that is otherwise overlooked’
Wolfgang Thierse
afraid – and fear is a central pillar of dictatorship. We realised how much creativity and courage we had in us that had remained hidden during everyday life under dictatorship. That was the awakening I remember with great enthusiasm. It was the decisive moment in the peaceful revolution.
All over Europe, we are currently experiencing a frightening shift to the right – in Poland, Hungary and Austria but also in Germany. You have been committed to combating right-wing extremism for years. What can be done?
Thierse: This is a disturbing development that has deeper causes. Dramatic times of upheaval are also times of fear, of insecurity and thus times for populists who give easy answers, promise solutions to problems and seduce people. They are dangerous times. Therefore, it is, firstly, necessary for democratic politicians and parties to make more visible efforts to find solutions without promising miracles. Secondly, they have to make their actions and decisions understandable and thus invite citizens to think, feel and participate. That seems to me to be the crucial thing. Thirdly, democratic forces must stand in solidarity with each other and clearly distinguish themselves from nationalists, neo-Nazis and right-wing extremists. They must confront those who spread hate. ¶
Interview by Anna Ramskogler-WittWilly-Brandt-Dokumentarfilmpreis für Freiheit und Menschenrechte
Auch in diesem Jahr dürfen zehn Filmemacher*innen auf den renommierten Willy-Brandt-Dokumentarfilmpreis für Freiheit und Menschenrechte hoffen. Sie stehen mit ihren Filmen im diesjährigen Wettbewerb des Human Rights Film Festival Berlin. Der von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung gestiftete Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Die internationale Jury zeichnet damit jährlich einen Wettbewerbsfilm für seine herausragende künstlerische und inhaltliche Leistung aus.¶
EN Willy Brandt Documentary Award for Freedom and Human Rights
This year, ten film-makers are once again hoping to receive the renowned Willy Brandt Documentary Award for Freedom and Human Rights. With their documentaries, they are participating in this year’s Human Rights Film Festival Berlin competition. The prize is endowed with EUR 3,000, which has been donated by the Federal Chancellor Willy Brandt Foundation. The international jury will select one of ten documentaries for its outstanding content and artistic achievements. ¶
Filme im Wettbewerb Competition Films
BETWEEN THE RAINS
(Seite 91 / page 91)
BEYOND UTOPIA
(Seite 88 / page 88)
BREAKING THE BRICK
(Seite 87 / page 87)
COLETTE AND JUSTIN
(Seite 87 / page 87)
HOLDING UP THE SKY
(Seite 84 / page 84)
Jury
MY NAME IS HAPPY
(Seite 86 / page 86)
SĀNSŪR
(Seite 86 / page 86)
WE DARE TO DREAM
(Seite 88 / page 88)
WE HAVE A DREAM
(Seite 88 / page 88)
WHILE WE WATCHED
(Seite 90 / page 90)
Peter Mudamba, Director, Docubox-EADFF Programs
Khadidja Benouataf, President, Impact Social Club
Ondřej Kamenický, Director, International Human Rights
Documentary Film Festival One World
Leslie Thomas, Executive Producer, Mira Studio
Malte Mau, Communications, Bundeskanzler Willy Brandt Foundation

Programm / Program
 Filmstill aus „Daughters of the Sun“ / Film still from ‘Daughters of the Sun’
Filmstill aus „Daughters of the Sun“ / Film still from ‘Daughters of the Sun’
INDIGENOUS VOICES
Über Menschen, deren Lebensraum und Kulturen seit Jahrhunderten von (post-)kolonialen Strukturen bedroht und unterdrückt werden – und die nie aufgegeben haben, für ihre Freiheit zu kämpfen.
EN About people whose homes and c ultures have been jeopardised and oppressed by (post-)colonial structures for centuries – and who have never given up fighting for their freedom.
HOLDING UP THE SKY
Pieter Van Eecke
80 Min. | BE, BR, NL | 2023
Der Regenwald verschwindet, die Erde erwärmt sich und Goldgräber verschmutzen die Flüsse. Als der brasilianische Präsident Bolsonaro Industrien auf dem Territorium der Yanomami erlaubt, muss Davi Kopenawa, Häuptling der Yanomami, sein Volk verteidigen.
EN The rainforest is disappearing, the earth is warming up, and gold miners are polluting the rivers. When Brazilian President Bolsonaro allows industry to set up on Yanomami territory, Yanomami chief Davi Kopenawa has to defend his people.
German Premiere
→ Mo, 16. Okt., 19:00, City Kino Wedding
→ Mi, 18. Okt., 18:30, Sputnik
→ So, 22. Okt., 21:00, ACUDkino
JAMES AND ISEY
Florian Habicht
91 Min. | NZ | 2021
Isey ist eine Bourbon trinkende Kriegerkönigin, ihr Gesicht voller Lachfalten, ihr Witz ansteckend – in einer Woche wird die Maori 100 Jahre alt. Dafür holt ihr treuer Sohn James sogar die Geisterwelt an Bord. Gemeinsam feiert das einzigartige Duo das Leben und die Liebe.
EN Isey is a bourbon-swilling warrior queen, her face full of laugh lines, her wit infectious. In a week this Māori woman will be 100 years old. Her faithful son James brings the spirit world onboard. Together this unique duo celebrate life and love.


German Premiere
→ Do, 19. Okt., 19:00, City Kino Wedding
→ Sa, 21. Okt., 19:00, ACUDkino
LAKOTA NATION VS. UNITED STATES
Jesse Short Bull, Laura Tomaselli
120 Min. | US | 2022
Die Lakota haben Ausbeutung und Umsiedlung erlebt. Ihre Heimat, der Gebirgszug „He Sapa“ in South Dakota, wurde mit der Ankunft der ersten Europäer 1492 zum Schauplatz von illegaler Landnahme –getrieben von der Gier nach Gold. Heute kämpfen die Lakota um ihr Land.

EN The Lakota have survived relocation, exploitation and mass murder – and kept their voice. They are fighting to protect their sacred lands and for America to acknowledge its guilt. Against the symbol of white supremacy, Mount Rushmore, they make their demand for self-determination.

German Premiere
→ Fr, 20. Okt., 18:30, Sputnik
→ So, 22. Okt., 18:00, Kant Kino
RAHČAN – ELLA’S RIOT
Anne Marte Blindheim
75 Min. | NO | 2022
Der Protest von der Bühne aus ist ihr nicht genug – als ein Bergbauunternehmen Land und Wasser der Sámi in Nordnorwegen bedroht, fasst die erfolgreiche Sängerin Ella einen Entschluss: Mit Ketten und Blockaden will sie gegen die Mine kämpfen, um ihre Heimat zu retten.
EN Protesting from the stage is not enough – when a mining company threatens Sámi land and water in northern Norway, successful singer Ella makes to a decision: she wants to fight against the mine with chains and blockades to save her home.

German Premiere
→ Di, 17. Okt., 21:00, ACUDkino
→ Mi, 18. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
→ Fr, 20. Okt., 20:30, Sputnik
TWICE COLONIZED
Lin Alluna
92 Min. | DK, GL, CA | 2023
Die Inuit-Anwältin und Aktivistin Aaju Peter kämpft für die Rechte ihres Volkes. Mit provokantem Witz zieht sie jene zur Rechenschaft, die mit kolonialem Blick auf sie herabschauen. Nach dem unerwarteten Tod ihres Sohnes begibt sie sich auf eine Reise in ihre Heimat – auch, um ihre eigenen Wunden zu heilen.
EN Inuit lawyer and activist Aaju Peter is fighting for the rights of her people. With provocative wit, she holds to account those who look down on her with their colonial gaze. After the unexpected death of her son, she embarks on a journey to her homeland – to heal her own wounds, too.
Berlin Premiere
→ Do, 12. Okt., 21:00, ACUDkino
→ Sa, 21. Okt., 18:00, Kant Kino
WE ARE GUARDIANS
Edivan Guajajara, Chelsea Greene, Rob Grobman
82 Min. | BR, US | 2023
Indigene Waldhüter*innen wehren sich gegen illegale Abholzung, Ausbeutung seltener Ressourcen und politische Korruption. Denn mit dem Schicksal des Amazonas steht auch das Schicksal seiner indigenen Gemeinschaften und das Gleichgewicht unseres Weltklimas auf dem Spiel.

EN Indigenous forest guardians are fighting against illegal logging, the exploitation of rare resources and political corruption. The fate of the Amazon is at stake, as is the fate of its Indigenous communities – and the balance of our global climate.


German Premiere
→ Fr, 13. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
→ So, 15. Okt., 19:30, Planetarium
→ Di, 17. Okt., 20:30, Sputnik
Presented by Greenpeace Jugend
GENDER EQUALITY
Geschlechterungerechtigkeit kennt viele Gesichter. Über Herausforderungen und Erfolge – und all jene, die für Inklusion und Chancengleichheit eintreten.
EN Gender inequality has many faces. About challenges and achievements – and the people taking a stand for inclusion and equal opportunity.
INDIGENOUS VOICES FEATURE: FOREST, A GARDEN WE CULTIVATE
Mari Corrêa
42 Min. | BR | 2023
Der Film bietet Einblicke in die Beziehung zwischen dem Wald und den indigenen Völkern und ihre Rolle im Kampf gegen die Klimakrise.
EN This film offers new perspectives on the relationship between the forest and Indigenous communities and the role they play in the fight against the climate crisis.
→ Fr, 13. Okt., 19:00, City Kino Wedding
→ Mi, 18. Okt., 18:30, Dokumentationszentrum
Presented by Euroclima
INDIGENOUS VOICES SHORTS
40 Min.
FESTA DE PAJÉS
Iberê Périssé
AUTODEMARCAÇÃO JÁ
Aldira Akai Munduruku, Beka Saw Munduruku, Rilcelia Akay Munduruku
TOCUMAGU RU MAUNI‘I – OUR WAY PROMOTES LIFE
Myrian Vasques Tikuna, Markus S. Enk
→ So, 15. Okt., 19:00, ACUDkino
→ Fr, 20. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
Presented by Euroclima
ANOTHER BODY
Sophie Compton, Reuben Hamlyn 80 Min. | US, UK | 2023
Die Videos sind gefälscht, aber ihre Auswirkungen sind nur allzu real: Die Studentin Taylor entdeckt gefälschte Pornos von sich im Internet. Eine Suche nach Antworten und Gerechtigkeit beginnt. Und wir alle müssen uns fragen: Können wir Realität und Fake noch unterscheiden?
EN The videos are fake, but their impact is all too real: college student Taylor discovers fake porn of herself on the Internet. A search for answers and justice begins. We all have to ask ourselves: can we still tell the difference between what is real and what is fake?

Berlin Premiere
→ Do, 12. Okt., 19:00, Coloseum
→ Mo, 16. Okt., 21:00, ACUDkino
BREAD AND ROSES
Sarah Mani
90 Min. | AF | 2023
Mit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 wird den afghanischen Frauen ihr modernes, selbstbestimmtes Leben von heute auf morgen geraubt. Doch trotz der erschütternden Notlage kämpfen sie darum, ihr Recht auf Bildung und Arbeit wiederzuerlangen – und um ihre Würde.
EN When the Taliban takes over in 2021, Afghan women are robbed of their modern, self-determined lives overnight. But despite their dire situation, they are fighting to regain their rights to education and work – and their dignity.

→ Fr, 20. Okt., 19:00, City Kino Wedding
→ So, 22. Okt., 19:00, City Kino Wedding
DAUGHTERS OF THE SUN
Reber Dosky
74 Min. | NL | 2023
2014 wurden jesidische Mädchen von ISKämpfern aus ihren Dörfern in Kurdistan entführt und als Sexsklavinnen verkauft. Heute sind viele von ihnen befreit. Mit Liebe und gegenseitiger Unterstützung versuchen sie, mit ihrem Trauma umzugehen.
EN In 2014, Yazidi girls were abducted from their villages in Kurdistan by IS fighters and sold as sex slaves. Today, many of them have been freed. With love and mutual support, they try to deal with their trauma.
→ Sa, 14. Okt., 19:00, ACUDkino
→ Mi, 18. Okt., 19:00, City Kino Wedding
MY NAME IS HAPPY
Nick Read, Ayşe Toprak
82 Min. | UK | 2022
Mutlu Kaya steht vor ihrem Durchbruch als Sängerin, als sie einen Femizid nur knapp überlebt. Fünf Jahre später wird ihre geliebte Schwester Dilek von ihrem Verlobten getötet. Mutlu kämpft – um ihre eigene Genesung und um Gerechtigkeit für ihre Schwester.
EN Mutlu Kaya is on the verge of her breakthrough as a singer when she barely survives a femicide. Five years later, her beloved sister Dilek is killed by her fiancé. Mutlu is fighting – for her own recovery and to get justice for her sister.


German Premiere
→ Fr, 13. Okt., 21:00, ACUDkino
→ Sa, 14. Okt., 18:30, Talking Humanity, Dokumentationszentrum
→ Di, 17. Okt., 19:00, City Kino Wedding
OUT OF UGANDA
Rolando Colla, Josef Burri
65 Min. | CH | 2023
Für vier junge LGBTQIA+-Menschen ist die Homophobie in ihrem Herkunftsland lebensgefährlich. Ihre letzte Hoffnung besteht darin, alles hinter sich zu lassen und ein langes und schmerzhaftes Exil zu erleben. Drei von ihnen gelingt die Flucht in die Schweiz.
EN For four young LBGTQIA+ people, homophobia in their country of origin is life-threatening. Their last hope is to leave everything behind and embark upon a long, painful exile. Three of them manage to flee to Switzerland.
Berlin Premiere
→ So, 15. Okt., 20:30, Sputnik
→ Mo, 16. Okt., 19:00, ACUDkino
PERIODICAL
Lina Plioplyte
96 Min. | US | 2023
Sind Tampons Luxusprodukte? Und ist die Wissenschaft wirklich frei von sexistischen Vorstellungen? Ärzt*innen, Sportler*innen und Prominente räumen mit Tabus über die Periode auf – und feiern die Entdeckung eines ungeahnten Potenzials im Menstruationsblut.
EN Are tampons a luxury product? And is science really free of sexist ideas? Doctors, athletes and celebrities are breaking taboos about periods – and celebrating the discovery of the unimagined potential of menstrual blood.

German Premiere
→ Di, 17. Okt., 19:00, ACUDkino
→ Fr, 20. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
POLISH PRAYERS
Hanna Nobis
84 Min. | CH, PL | 2022
In der katholischen Rechten ist Antek, 22, ganz in seinem Element: Er genießt seine wachsende Macht in der rechtsnationalen Bruderschaft bei Survival-Camps, Kirchenbesuchen und Anti-Pride-Demonstrationen. Doch als er sich verliebt, kommen ihm erste Zweifel.

EN Twenty-two-year-old Antek is in his element on the Catholic right, enjoying his growing power in the right-wing nationalist fraternity at survival camps, on church visits and at anti-pride demonstrations. But when he falls in love, he begins to have doubts.

Berlin Premiere
→ Fr, 20. Okt., 21:00, ACUDkino
→ Sa, 21. Okt., 20:30, Sputnik
SĀNSŪR
Mostafa Heravi
95 Min. | NL | 2022
Sechs iranische Frauen sind nicht bereit, sich einem unterdrückenden und frauenrechtsverachtenden Regime zu beugen. Die Konsequenzen: Entlassung, Schikane und Verhaftung. Können sie der Zensur entkommen, im Exil ihre Maske fallen lassen und wirklich frei sein?
EN Six Iranian women are unwilling to bow down to an oppressive regime that derides women’s rights. The consequences: dismissal, harassment and arrest. Can they escape censorship, drop their masks in exile and be truly free?

German Premiere
→ Sa, 14. Okt., 20:30, Sputnik
→ So, 15. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
→ Mo, 16. Okt., 21:00, City Kino Wedding
THE ILLUSION OF ABUNDANCE
Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert 60 Min. | BE | 2022
Drei Frauen, drei Länder, drei Kämpfe: Carolina, Bertha und Maxima sind auf der Jagd nach skrupellosen Unternehmen. Trotz zutiefst unausgewogener Mittel führen die Aktivistinnen einen unerbittlichen Kampf gegen die modernen Ausbeuter der Welt.
EN Three women, three countries, three struggles: Carolina, Bertha and Maxima are hunting down misbehaving corporations. Despite deeply unbalanced resources, the activists wage a relentless battle against the world’s modern-day exploiters.
→ Sa, 14. Okt., 21:00, City Kino Wedding
→ Sa, 21. Okt., 18:30, Sputnik
Presented by Greenpeace
TRANSITION
Jordan Bryon, Monica Villamizar
89 Min. | US, AU | 2023
Nach dem Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan ist der australische Journalist Jordan Bryon geblieben – und bekommt ungehinderten Zugang zu einer TalibanHochburg angeboten. Doch wenn die Taliban wüssten, dass Jordan trans ist, würden sie ihn wahrscheinlich töten.
EN As US forces withdraw from Afghanistan, Australian journalist Jordan Bryon stays on – and is offered unprecedented access to a Taliban stronghold. But if the Taliban knew Jordan was trans, they would probably kill him.

German Premiere
→ Do, 12. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
→ Fr, 13. Okt., 20:30, Sputnik
→ Mi, 18. Okt., 19:00, ACUDkino
BREAKING BARRIERS
Soziale Gerechtigkeit bedeutet faire Chancen und Ressourcen für alle – unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Einkommen.
EN Social justice means fair opportunities and resources for all – regardless of origin, gender or income.
BREAKING SOCIAL
Fredrik Gertten
93 Min. | SE | 2023
Wer am meisten beiträgt, bekommt am wenigsten. Wer am meisten gewinnt, gibt nichts zurück. So ist es in unserer kapitalistischen Welt oft. Doch was passiert, wenn wir mit globalen Aufständen und gemeinschaftlichem Handeln den sozialen Vertrag brechen, den die Reichen bereits gebrochen haben?
EN Those who give the most, receive the least. And those who gain the most, give nothing back. This is often the case in our capitalist world. But what happens when we break the social contract that the rich have already broken with global uprisings and collective action?
German Premiere
→ Mo, 16. Okt., 20:30, Sputnik
→ Di, 17. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
→ So, 22. Okt., 21:00, City Kino Wedding
BREAKING THE BRICK
Carola Fuentes, Rafa Valdeavellano
86 Min. | CL | 2022
Im Jahr 2019 fordern Millionen von Menschen in Chile das Ende des neoliberalen Wirtschaftsmodells aus der PinochetDiktatur. Mariana ist eines der Opfer des Modells, Ramiro einer der Profiteure. In diesem denkwürdigen Jahr durchleben beide eine unerwartete Wandlung.
EN In 2019, millions of people in Chile demand an end to the neoliberal economic model of the Pinochet dictatorship. Mariana is one of its victims, Ramiro one of its beneficiaries. Over the course of this memorable year, they both undergo unexpected transformations.



German Premiere
→ Do, 12. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
→ Fr, 13. Okt., 18:30, Sputnik
→ So, 15. Okt., 21:00, City Kino Wedding
COLETTE AND JUSTIN
Alain Kassanda
88 Min. | FR | 2022
Wie gut kennst du deine Familie? Alain Kassandras Großeltern schwiegen bis jetzt. Doch die Spuren der belgischen Kolonisation sind in der Demokratischen Republik Kongo allgegenwärtig – und der Großvater Justin spielte in den Jahren der Unabhängigkeit eine zentrale Rolle.
EN How well do you know your family? Alain Kassandra’s grandparents have remained silent until now. But the traces of Belgian colonisation are everywhere in the Democratic Republic of the Congo – and grandfather Justin played a central role during the independence period.

German Premiere
→ Mi, 18. Okt., 21:00, City Kino Wedding
→ Do 19. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
→ So, 22. Okt., 20:30, Sputnik
Presented by Aktion gegen den Hunger
FREE MONEY
Lauren DeFilippo, Sam Soko
75 Min. | US, KEN | 2022
Das weltweit größte Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen verändert das Leben eines kleinen Dorfes in Kenia. 12 Jahre, ein fester Lohn, Sicherheit. Doch das Experiment löst auch einen Sturm der Entrüstung aus und stellt das Zusammenleben auf eine Probe.
EN It’s the world’s biggest universal basic income experiment, and it’s changing life in a small village in Kenya. Twelve years, a fixed wage, dependability. But the experiment also stirs up a storm and puts communal life in the village under close scrutiny.
Berlin Premiere
→ So, 15. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
→ Di, 17. Okt., 18:30, Sputnik
Presented by Aktion gegen den Hunger
DISTURBED PEACE
Wie kann Krieg beendet, Frieden erreicht und aufrechterhalten werden? Über den schmalen Grat zwischen Vernichtung und Versöhnung.
EN How do we end war and achieve long-lasting peace? About the fine line between annihilation and reconciliation.
WE DARE TO DREAM
Waad Al-Kateab
96 Min. | UK | 2023
Sie mussten aus ihrer Heimat fliehen und ihre Familien zurücklassen, doch sie haben ihr Ziel fest im Blick: Junge, staatenlose Athlet*innen aus dem Iran, Syrien, Südsudan und Kamerun kämpfen im RefugeeTeam der Olympischen Spiele 2020 um Medaillen – und um ihren Platz in der Welt.
EN They have had to flee their homes and leave their families behind, but they have one goal in mind. Young, stateless athletes from Iran, Syria, South Sudan and Cameroon will compete for medals at the 2020 Olympic Games on the Refugee Team – and to find their place in the world.
German Premiere
→ Di, 17. Okt., 17:00, City Kino Wedding
→ Mi, 18. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
→ Fr, 20. Okt., 19:00, ACUDkino
WE HAVE A DREAM
Pascal Plisson
96 Min. | FR | 2023
Wer sagt, dass ein Leben mit Behinderungen bedeutet, die größten Träume aufzugeben? Diese außergewöhnlichen Kinder beweisen, dass Liebe, integrative Bildung, Humor und Mut Berge versetzen können und dass das Schicksal manchmal voller Überraschungen steckt.
EN Who said that living with a disability means giving up on your biggest dreams? These extraordinary children prove that love, inclusive education, humour and courage can move mountains and that destiny is sometimes full of surprises.
German Premiere
→ Fr, 13. Okt., 20:30, Planetarium
→ Sa, 14. Okt., 21:00, ACUDkino

→ So, 15. Okt., 17:00, City Kino Wedding
OPENING FILM
20 DAYS IN MARIUPOL
Mstyslav Chernov
94 Min. | UA | 2022
Ein Team ukrainischer AP-Journalist*innen sitzt in der belagerten Stadt Mariupol fest und dokumentiert die Gräueltaten der russischen Invasion. Ihre Bilder gehen um die Welt: sterbende Kinder, Massengräber, die Bombardierung einer Entbindungsklinik und mehr.

EN A team of Ukrainian AP journalists is trapped in the besieged city of Mariupol, documenting the atrocities of the Russian invasion. Their images go around the globe: dying children, mass graves, the bombing of a maternity clinic and more.

German Premiere
→ Mi, 11. Okt., 19:00, Colosseum (Opening)
→ Do, 12. Okt., 18:30, Talking Humanity, Dokumentationszentrum
→ Do, 19. Okt., 21:00, City Kino Wedding
BEYOND UTOPIA
Madeleine Gavin
115 Min. | US | 2023
Wer Nordkorea verlassen will, sucht die Freiheit – und riskiert bei einer Festnahme Gefängnis, Folter oder Hinrichtung. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern wagt dennoch die gefährliche Flucht. Hilfe kommt von einem heldenhaften Pastor und seinem Netzwerk im Untergrund.
EN Those who try to leave North Korea seek freedom – and risk imprisonment, torture and execution if they are caught. But one family with two young children dares to make the dangerous escape. Help comes from a heroic pastor and his underground network.
German Premiere
→ Mo, 16. Okt., 17:00, City Kino Wedding
→ Do, 19. Oct., 22:00, Hackesche Höfe Kino

→ So, 22. Oct., 18:30, Sputnik

FRITZ BAUER’S LEGACY
Isabel Gathof, Sabine Lamby, Cornelia Partmann
98 Min. | DE | 2022
Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg stehen ehemalige SS-Wachleute der Konzentrationslager vor Gericht. Doch warum konnten sie so lange unbehelligt bleiben? Und was bedeuten diese vermutlich letzten Prozesse gegen NS-Täter*innen für die Überlebenden der Shoah?
EN Decades after the Second World War, former SS concentration camp guards are on trial. But how did they go unpunished for so long? And what do the potentially last trials against Nazi perpetrators mean for the survivors of the Shoah?

Berlin Premiere
→ Do, 19. Okt., 18:30, Sputnik
→ Sa, 21. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
INSIDE KABUL
Caroline Gillet, Denis Walgenwitz
30 Min. | DK, FR | 2023
Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan trennen sich die Wege zweier Freundinnen: Marwa flieht, Raha bleibt. Doch beide kämpfen mit Einsamkeit und der Sorge um ihre Familien. Wie kann man erwachsen werden, wenn die Welt, die man kennt, zusammenbricht?
EN After the Taliban take power in Afghanistan, two friends part ways: Marwa flees, Raha stays. But both struggle with loneliness and fear for their families. How do you grow up when the world you know is falling apart?

German Premiere
→ Mo, 16. Okt., 18:30, Talking Humanity, Dokumentationszentrum
→ So, 22. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
LE SPECTRE DE BOKO HARAM
Cyrielle Raingou
75 Min. | CMR | 2023
Zwischen Soldaten mit Maschinengewehren toben zwei Brüder scheinbar unbeschwert über den Schulhof. Doch in den Bergen Kameruns lauert die terroristische Gefahr, die auch ihr Leben verändern wird. EN In amongst soldiers with machine guns, two brothers romp seemingly carefree across the schoolyard. But in the mountains of Cameroon lurks a terrorist threat that changes their lives.
Berlin Premiere
→ Mo, 16. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
→ Di, 17. Okt., 18:30, Talking Humanity, Dokumentationszentrum
→ Mi, 18. Okt., 21:00, ACUDkino
Presented by Aktion gegen den Hunger
THEATRE OF VIOLENCE
Emil Langballe, Lukasz Konopa
104 Min. | DK, DE | 2023
Mit 9 Jahren wird Dominic Ongwen von der ugandischen Terrorgruppe LRA entführt, gefoltert und gezwungen zu töten. Jahre später steht der ehemalige Kindersoldat vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Soll er für seine Taten verurteilt werden oder ist er selbst ein Opfer?

EN At the age of nine, Dominic Ongwen is abducted by the LRA, a Ugandan terrorist group. They torture him and force him to kill. Years later, the former child soldier stands before the International Criminal Court. Should he be convicted for his actions, or is he himself a victim?

→ Fr, 13. Okt., 18:30, Talking Humanity, Dokumentationszentrum
→ Sa, 21. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
THE MIND GAME
Sajid Khan Nasiri, Eefje Blankevoort, Els van Driel
61 Min. | NL | 2023
Sajid Khan Nasiri ist erst 14 Jahre alt, als er allein aus Afghanistan flieht. Seine zweijährige lebensbedrohliche Flucht hält er mit der Handykamera fest. Doch als er endlich in Belgien ankommt, beginnt ein ganz neues Spiel.
EN Sajid Khan Nasiri is just 14 years old when he flees Afghanistan on his own. He records the dangerous two-year journey on his phone. But when he finally arrives in Belgium, a whole new game begins.

German Premiere
→ Di, 17. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
→ Fr, 20. Okt., 18:00, Kant Kino
→ Sa, 21. Okt., 19:00, City Kino Wedding
THIS KIND OF HOPE
Pawel Siczek
83 Min. | DE, CH | 2023
Die Diplomatie ist Andrei Sannikovs Leben. Er wagte sich in die belarussische Opposition, kandidierte bei den Präsidentschaftswahlen 2021 gegen Lukaschenko und wurde im Gefängnis gefoltert. Trotzdem gab er nie auf: Im Exil in Warschau kämpft er weiter für die Rückkehr der Demokratie. EN Diplomacy is Andrei Sannikov’s life. He ventured into the Belarusian opposition, ran against Lukashenko in the 2021 presidential elections and was tortured in prison. But he never gave up: from exile in Warsaw, he continues to fight for the return of democracy.

Berlin Premiere
→ Sa, 14. Okt., 19:00, City Kino Wedding
→ So, 15. Okt., 18:30, Talking Humanity, Dokumentationszentrum
Presented by Greenpeace
FREEDOM OF SPEECH
WHEN SPRING CAME TO BUCHA
Mila Teshaieva, Marcus Lenz
66 Min. | UKR, DE | 2022
Was passiert, wenn die Kämpfe aufhören, die russische Armee abzieht? Die Bewohner*innen der ukrainischen Stadt Bucha kehren in ihre Heimat zurück. Die Toten müssen identifiziert werden, die Trümmer beseitigt. Der Krieg in der Ukraine wütet noch immer. Aber auch das Leben geht weiter.
EN What happens when the fighting stops and the Russian army withdraws? The people of Bucha, Ukraine, return to their town. The dead have to be identified, the rubble removed. The war in Ukraine goes on. But life does too.

→ Fr, 13. Okt., 21:00, City Kino Wedding
→ So, 15. Okt., 18:30, Sputnik
Presented by Greenpeace
THE ETILAAT ROZ
Abbas Rezaie
93 Min. | AF | 2022
Während draußen Schüsse fallen, bereiten sich die Journalist*innen von Kabuls größter Tageszeitung auf den Ernstfall vor. Seit die Taliban im August 2021 die Macht übernommen haben, ist nichts mehr, wie es war. Für ihre kritische Berichterstattung riskieren die Journalist*innen jeden Tag ihr Leben.
EN While gunshots ring outside, the journalists of Kabul’s largest daily newspaper prepare for the worst. Since the Taliban took power in August 2021, nothing has been the same. Every day, these journalists risk their lives to carry out their critical reporting.

Berlin Premiere
→ Do, 12. Okt., 19:00, City Kino Wedding
→ Sa, 14. Okt., 19:00, Hackesche Höfe kino
Presse- und Meinungsfreiheit sind gefährdet. Wir zeigen mutige Journalist*innen und Aktivist*innen, die für Gerechtigkeit, Transparenz und das unveräußerliche Recht kämpfen, die Wahrheit zu berichten.
EN Freedom of the press and freedom of expression are under threat. We present courageous journalists and activists fighting for justice, transparency and the inalienable right to report the truth.
WHILE WE WATCHED
Vinay Shukla
94 Min. | UK | 2022
Ravish Kumar tritt zur besten Sendezeit auf und steht für unabhängigen Journalismus in Indien – doch jetzt muss er gegen eine Flut von Fake News, sinkende Einschaltquoten und Budgetkürzungen kämpfen. Einige Menschen haben es persönlich auf ihn abgesehen.
EN Ravish Kumar is a primetime TV personality and stands for independent journalism in India – but now he is battling a flood of fake news, falling ratings and budget cuts. Some people are even out to get him personally.

German Premiere
→ Di, 17. Okt., 21:00, City Kino Wedding
→ Do, 19. Okt., 20:30, Sputnik
→ Sa, 21. Okt., 21:00, ACUDkino
PHANTOM PARROT
Kate Stonehill
82 Min. | UK, US | 2023
Ein Menschenrechtsaktivist wird strafrechtlich verfolgt, weil er sich weigert, bei einer Grenzkontrolle seine Passwörter herauszugeben. Die folgenden Enthüllungen werfen beunruhigende Fragen über Rechtsstaatlichkeit, moderne Spionage und strukturellen Rassismus auf.
EN A human rights activist is prosecuted for refusing to hand over his passwords at a border check. The revelations that follow raise unsettling questions about the rule of law, modern espionage and structural racism.

German Premiere
→ Do, 12. Okt., 19:00, ACUDkino
→ Mi, 18. Okt., 20:30, Sputnik
CLIMATE JUSTICE
Aktivist*innen kämpfen gegen Klimawandel und Umweltzerstörung. Sie inspirieren mit innovativen Lösungen zu nachhaltigem Handeln für die Erhaltung unseres Planeten.
EN Activists fight against climate change and environmental destruction. They inspire us with innovative solutions that allow us to take sustainable action to preserve our planet.
AGAINST THE TIDE
Sarvnik Kaur
97 Min. | IN, FR | 2023
Zwei Fischer aus der indigenen Koli-Gemeinschaft in Mumbai treibt das Sterben der Meere in die Verzweiflung. Ihre Freundschaft steht auf der Probe – denn sie schlagen ganz unterschiedliche Wege ein, um in der Not für ihre Familien zu sorgen.
EN Two fishermen from Mumbai’s Indigenous Koli community are driven to despair by the dying sea. As they take very different paths to provide for their families in times of need, their friendship is put to the test.

Berlin Premiere
→ Sa, 21. Okt., 21:00, City Kino Wedding
→ So, 22. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
Presented by Aktion gegen den Hunger
BETWEEN THE RAINS
Andrew H. Brown, Moses Thuranira
82 Min. | KE | 2023
Anhaltende Dürre bedroht das Land und die Kultur der Turkana-Ngaremara im Norden Kenias. Inmitten komplexer Stammeskonflikte und einer Klimakrise, die zur unmittelbaren Gefahr wird, hinterfragt der verwaiste Hirtenjunge Kole seine Identität als Krieger.
EN Persistent drought is putting the lands and culture of northern Kenya’s Turkana-Ngaremara people in jeopardy. In the midst of complex tribal conflicts and a climate crisis that poses an imminent threat, orphaned shepherd boy Kolei questions his identity as a warrior.

German Premiere
→ Fr, 13. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
→ Sa, 14. Okt., 20:30, Planetarium
→ So, 15. Okt., 19:00, City Kino Wedding
Presented by Aktion gegen den Hunger
ESTHER AND THE LAW
Tatiana Scheltema
72 Min. | NL | 2023
Ein milliardenschwerer Ölkonzern, verheerende Umweltverschmutzungen im Nigerdelta und ein Scheinprozess mit fragwürdigen Anschuldigungen. Fast 25 Jahre, nachdem Esther Kiobels Ehemann Barinem hingerichtet wurde, bringt Esther den Konzern Shell in den Niederlanden vor Gericht.
EN A billion-dollar oil company, devastating pollution in the Niger Delta and a sham trial with questionable charges. Almost 25 years after Esther Kiobel’s husband Barinem was executed, Esther takes Shell to court in the Netherlands.

German Premiere
→ So, 15. Okt., 21:00, ACUDkino
→ Mo, 16. Okt., 18:30, Sputnik
HOLY SHIT
Rubén Abruña
86 Min. | DE, CH | 2023
Was geschieht mit unserer Nahrung, nachdem wir sie ausgeschieden haben? Sind Fäkalien Abfall oder eine nützliche Ressource? Auf der Suche nach Lösungen reist Rubén Abruña um die Welt – und findet Wege, um womöglich die Menschheit zu ernähren und gleichzeitig die Klimakrise zu bremsen.
EN What happens to the food we digest after it leaves our bodies? Is excrement waste or a useful resource? Rubén Abruña travels the world in search of solutions –and finds ways to potentially feed humanity while slowing the climate crisis.

Berlin Premiere
→ Mo, 16. Okt., 19:00, Hackesche Höfe Kino
Presented by Aktion gegen den Hunger
RADIOACTIVE: THE WOMEN OF THREE MILE ISLAND

Heidi Hutner
76 Min. | US | 2022
Der schlimmste kommerzielle Atomunfall in der Geschichte der USA wurde zur größten Vertuschungsaktion des Landes. Aber diese unerschrockenen Frauen und Mütter wehren sich gegen die Atomindustrie und decken auf, wie ihre Familien in tödliche Gefahr gebracht wurden.
EN The worst commercial nuclear accident in US history became the country’s biggest cover-up. But these courageous women and mothers are standing up to the nuclear industry and revealing how their families have been put at risk.
→ Do, 12. Okt., 21:00, City Kino Wedding
→ Sa, 14. Okt., 18:30, Sputnik
→ So, 22. Okt., 19:00, ACUDkino
THE EARTH PROTECTORS
Anne de Carbuccia
96 Min. | US, IT | 2023
Auf ihren Reisen fängt die Umweltkünstlerin Anne de Carbuccia ein, was durch die Klimakrise verloren scheint. Dabei trifft sie auf junge Menschen, die zeigen: Mit Kreativität, Innovation und Technologie können wir so viel mehr für unseren Planeten tun.
EN On her travels, environmental artist Anne de Carbuccia captures what seems to have been lost in the climate crisis. On the way, she meets young people who prove that, with creativity, innovation and technology, there is so much more we can do for our planet.

German Premiere
→ Fr, 13. Okt., 19:00, ACUDkino
→ Sa, 14. Okt., 22:00, Hackesche Höfe Kino
SPECIAL SCREENINGS
In diesem Jahr zeigen wir im Rahmen des Festivals zwei exklusive Filmvorführungen außerhalb des regulären Programms. Unser Ziel ist es, einen Diskurs zu fördern, der die internationale Solidarität stärkt.
EN This year, two exclusive film screenings will take place outside the festival’s regular program. Our aim is to promote a discourse that strengthens international solidarity.
WHITE TORTURE
Narges Mohammadi

57 min | IR | 2021
Narges Mohammadi ist eine Menschenrechtsaktivistin in Iran. Für ihre Arbeit wird sie immer wieder willkürlich vom Regime inhaftiert. Während einer Haftpause hat sie diesen Film gedreht, der auf Interviews mit ehemaligen Gefangenen basiert.
EN Narges Mohammadi is a human rights activist in Iran. She has been repeatedly and arbitrarily imprisoned by the regime for her work. During a break from imprisonment, she made this film on the basis of interviews with former prisoners.
→ Fr, 13. Okt., 19:00, Colosseum
Presented by HÁWAR.help
CHILDREN OF THE TALIBAN

Marcel Mettelsiefen
47 min | AF, DE, GB | 2022
Der Film erzählt die Geschichten von vier Kindern in Kabul. Die beiden Jungs, beste Freunde, sind die Söhne hochrangiger Talibanmitglieder. Die Mädchen haben ihre Väter verloren und müssen nun Schuhe putzen, um ihre Familien zu unterstützen.
EN This film tells the stories of four children in Kabul. The two boys, best friends, are the sons of high-ranking members of the Taliban. The girls have lost their fathers and now have to clean shoes to support their families.
→ Mo, 16. Okt., 18.30, Talking Humanity, Dokumentationszentrum
Presented by Global Partnership for Education

Förderer und Partner / Sponsors and Partners






TICKETS hrffb.de/tickets
KINO / CINEMA: 10,00 EUR
ONLINE: 5,50 EUR
PÄSSE / PASSES
hrffb.de/passes
UNLIMITED: 90 EUR
5 FILMS: 40 EUR
STREAMING
Ausgewählte Filme streamen auf hrffb.de/streaming


Stream selected films on hrffb.de/streaming
Alle Filme werden in der Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt. All films will be screened in the original version with English subtitles.
