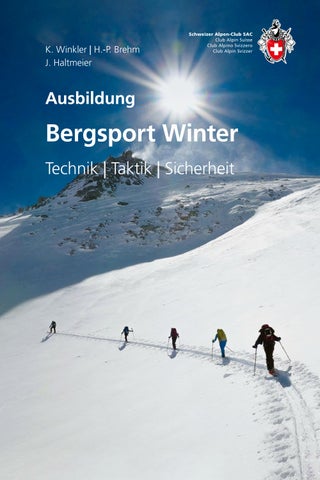K. Winkler | H.-P. Brehm
J. Haltmeier
Bergsport Winter Technik | Taktik | Sicherheit Ausbildung
Haftungsausschluss
Bergsteigen ist gefährlich und kann zu Körperverletzungen oder Tod führen. Die Angaben in diesem Lehrbuch unterliegen einem starken Wandel der Zeit. Dieses Lehrbuch soll die Risiken im Alpinismus möglichst umfassend aufzeigen, kann jedoch nicht davor schützen. Es entbindet daher in keiner Weise von der Selbstverantwortung jedes Benützers, wozu unter anderem das Erlernen der notwendigen Techniken unter fachkundiger Aufsicht sowie die Einhaltung aller Angaben der Bergsportartikelhersteller gehören.
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der im Lehrbuch enthaltenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Sofern in diesem Lehrbuch auf fremde Werke, Internetseiten oder Apps verwiesen wird, übernehmen die Autoren keine Verantwortung für deren Inhalte.
Impressum
Alle Angaben in diesem Buch wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihnen und dem Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autoren noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.
Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2023 Weber Verlag AG, CH-3645 Thun/Gwatt 6., aktualisierte Auflage 2023
Kartenausschnitte: Bundesamt für Landestopografie swisstopo Illustrationen: villard.biz, Worblaufen
Foto Umschlag: René Michel
Korrektorat: Jordi AG
Weber Verlag AG
Gestaltung Cover: Shana Hirschi
Satz: Shana Hirschi (Weber AG), Jordi AG
Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
ISBN 978-3-85902-488-5
www.weberverlag.ch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Verfasser
Wann hast du das letzte Mal auf dem Sofa gesessen und in einem Lehrbuch geblättert? Wir laden dich ein zum ersten Schritt eines verantwortungsvollen Bergsports. Geübt, angewendet und vertieft wird anschliessend draussen – in fachkundiger Begleitung. Ein, zwei Jahre später: Wer erinnert sich noch an all das, was er gelernt hat? Der Griff zum Buch: oft zielführender als ein Online-Tutorial. Bist du schon länger unterwegs und erzählst auf dem Sofa lieber deine Bergerlebnisse? Dann hast du die nötige Erfahrung. Aber sind Wissen und Techniken noch up to date? Die gute Mischung von neusten Methoden und Erfahrung bringt auch alte Hasen am Berg einen Schritt weiter – und sicherer zurück.
Theorie und Praxis – Buch und Bergsteigen – ergänzen sich. «Bergsport Winter» und «Bergsport Sommer» werden beide von Zehntausenden von Bergsteigerinnen und Bergsteigern gelesen. Als Standardwerke werden sie u. a. bei SAC-Kursen, von Bergführern, Jugend + Sport, Armee und der Alpinen Rettung Schweiz genutzt. Das freut uns sehr, lastet aber auch auf unseren Schultern. Der Erfolg weckt den Anspruch, die Lehrbücher inhaltlich und qualitativ auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Hohe Verkaufszahlen und durchwegs positive Rückmeldungen von Einsteigern bis zu Profibergführern aus dem ganzen Alpenraum –was macht «Bergsport Winter» so erfolgreich? Vermutlich der Mut zum Weglassen. Wir beschränken uns auf wenige, standardisierte Vorgehensweisen mit einem breiten Anwendungsbereich, die zudem fehlertolerant, von Anfängern leicht zu erlernen und bis hin zu schwierigsten Touren geeignet sind. Damit wird Bergsteigen einfacher und in den meisten Fällen auch sicherer als mit ständigem Improvisieren.
Lawinen

Lawinenarten
Je nach Schneebeschaffenheit entstehen verschiedene Lawinentypen. Diese brechen verschieden an und unterscheiden sich auch in ihrer Form.
Schneebrettlawinen
Schneebrettlawinen sind die gefährlichsten Lawinen und fordern über 90 % der Lawinenopfer. Bei einer Schneebrettlawine bricht eine Schwachschicht innerhalb der Schneedecke. Dieser Bruch breitet sich schnell aus, und in der Folge gleitet eine ganze Schneetafel grossflächig ab (siehe S. 79). Typisch ist der breite, scharfkantige Anriss.
Schneebrettlawinen können im trockenen oder nassen Schnee abgehen, auch lange nach einem Schneefall. Sie können spontan anreissen (ohne menschliches Dazutun) oder von einem beliebigen Punkt inner- oder sogar ausserhalb der Lawinenfläche ausgelöst werden. Schneebrettlawinen erreichen schnell eine hohe Geschwindigkeit. Wer sie auslöst, steht oft mitten drin und wird häufig erfasst. In 90 % der Fälle lösten die Opfer «ihre» Schneebrettlawine selbst aus.
Anrisskante Gleitfläche
Lawinenkegel
Lockerschneelawinen
Lockerschneelawinen breiten sich vom Auslösepunkt nach unten aus, indem der abrutschende Schnee immer mehr Schnee mitreisst. Lockerschneelawinen gehen oft während oder kurz nach einem Schneefall oder bei starker Erwärmung ab. Bei trockenem (Pulver-)Schnee ist im Auslösepunkt meistens eine Neigung von 40° erforderlich. Vor allem bei nassem Schnee können sie in anhaltend steilem Gelände beachtliche Grössen erreichen.
Lockerschneelawinen lösen sich oft spontan, fordern weniger als 10 % der Lawinenopfer und diese oft im Sommer. Eine vom Schneesportler ausgelöste Lockerschneelawine verschüttet diesen normalerweise nicht, kann ihn aber mitreissen und zum Absturz bringen.
Gleitfläche
Lawinenkegel
Auslösepunkt
Lawinen bei nassem Schnee
In einer durchfeuchteten Schneedecke können Lockerschnee-, Gleitschnee- und Schneebrettlawinen abgehen. Für Schneebrettlawinen besonders kritisch sind:
• Die erste Anfeuchtung einer grobkörnigen Schwachschicht, weil diese massiv an Festigkeit verliert.
• Eine feinkörnige über einer grobkörnigen Schicht. Am Übergang staut sich das einsickernde Wasser.
Massgebend sind die Verhältnisse innerhalb der Schneedecke im Bereich der Schwachschicht. Daher ist es möglich, dass Nassschneelawinen auch nach einsetzender, oberflächlicher Abkühlung noch abgehen. Erst eine tragfähig gefrorene Kruste macht nasse Lawinen unwahrscheinlich. Nasse Schneebrettlawinen gehen meist spontan ab, werden in seltenen Fällen aber auch von Menschen ausgelöst.

Tour bei Frühjahrsverhältnissen rechtzeitig beenden.
Gleitschneelawinen
Bei Gleitschneelawinen rutscht die gesamte Schneedecke auf glattem Untergrund wie abgelegtem Gras oder Felsplatten ab. Das geschieht, wenn der Schnee ganz unten, am Übergang zum Boden, feucht wird und damit die Reibung abnimmt. Je steiler der Hang, desto eher gleitet der Schnee ab. Gleitschneelawinen gehen spontan ab. Eine Auslösung durch Wintersportler ist praktisch unmöglich. Oft, aber längst nicht immer, beginnt das Gleiten der Schneedecke langsam (siehe S. 91) und es bilden sich zuerst Gleitschneerisse (sog. «Fischmäuler»). Daraus kann plötzlich eine Gleitschneelawine werden. Dieser Zeitpunkt ist nicht vorhersehbar, deshalb sollten wir uns nie länger als unbedingt nötig in der Umgebung von Fischmäulern aufhalten, und zwar weder unterhalb noch seitlich davon.
«Kalte» Gleitschneelawinen
Im Hochwinter ist die Schneedecke meist kalt und trocken. Die Anfeuchtung der Schneedecke erfolgt von unten: der warme Boden schmilz den daraufliegenden Schnee, oder der Schnee saugt Wasser aus dem feuchten Boden an. Im Hochwinter sind Gleitschneelawinen zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. In den Tagen nach grösseren Schneefällen sind sie häufiger, sonst werden sie nur wenig beeinflusst vom aktuellen Wetter.
«Warme» Gleitschneelawinen
Irgendwann im Frühling wird die ganze Schneedecke 0 °C «warm». Damit können Schmelzwasser und Regen durch die ganze Schneedecke sickern und die Basis der Schneedecke «von oben» anfeuchten. Bei diesen Verhältnissen gehen Gleitschneelawinen oft während den typischen NassschneelawinenZyklen und vermehrt in der 2. Tageshälfte ab.
Gefriert die Schneedecke in einer Kälteperiode bis auf den Boden, so stoppt die Gleitbewegung, und es besteht keine Gefahr von Gleitschneelawinen mehr.
Aktive Fischmäuler weisen auf die Gefahr von Gleitschneelawinen hin. In einem Hang mit Fischmäulern ist die Auslösung von Schneebrettlawinen eher unwahrscheinlich, aber trotzdem nicht ganz ausgeschlossen.

Dieses Fischmaul war bereits offen, als es schneite. Danach hat es sich weiter geöffnet, wie der apere Bereich zeigt.
Eislawinen
Eistürme (Séracs) brechen unabhängig von der Tageszeit ab. Auf ihrer Sturzbahn belasten sie die Schneedecke so stark, dass sie viel Schnee mitreissen und selbst bei relativ günstigen Verhältnissen Schneebrettlawinen tief im Altschnee auslösen können. Eislawinen korrelieren nicht mit der «normalen» Lawinengefahr. Wir sollten uns auch bei günstigen Verhältnissen nie unnötig unterhalb von Eistürmen aufhalten (siehe S. 52).
Die weiteren Ausführungen gelten für trockene Schneebrettlawinen.
Auslösung einer Schneebrettlawine
Bei einer Schneebrettlawine bricht eine Schwachschicht zunächst in einem kleinen Bereich («Initialbruch»). Danach breitet sich der Bruch schnell entlang der Schwachschicht aus, und in der Folge gleitet eine ganze Schneetafel grossflächig ab.
Bedingungen für eine Schneebrettlawine
Eine Schneebrettlawine ist nur möglich, wenn vier Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Gebundener Schnee über Schwachschicht
Eine Schneedecke besteht aus verschiedenen, übereinanderliegenden Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für eine Schneebrettlawine muss eine gebundene Schicht auf einer Schwachschicht liegen.
Schwachschicht innerhalb der Schneedecke
Schwachschichten sind weich und bestehen oft aus grossen, kantigen Kristallen. Je nach Kornform bzw. Entstehung bleiben sie unterschiedlich lange auslösbar. Typische Schwachschichten sind:
• Oberflächenreif. Er entsteht in kalten, klaren Nächten (siehe S. 92). Wird er eingeschneit, bildet er eine dünne, von Auge schwer erkennbare Schwachschicht, die oft über Wochen erhalten bleibt.
• Kantig aufgebaute Kristalle (Schwimmschnee) und Becherkristalle bleiben ebenfalls oft wochenlang problematisch. Sie entstehen in langen Schönwetterperioden, aber auch im Bereich von Krusten kann innerhalb der Schneedecke eine dünne Schicht kantiger Kristalle entstehen. Bei einem Schneeprofil sollten wir deshalb ober- und unterhalb von Krusten besonders genau hinschauen.
• Während eines Schneefalls müssen wir mit Schwachschichten innerhalb des Neu- und Triebschnees rechnen. Diese können weit verbreitet sein, verfestigen sich normalerweise aber recht schnell (oft ca. 1 Tag).
• Bei der ersten Anfeuchtung werden v. a. grobkörnige, weiche Schichten massiv geschwächt. Zuvor nicht mehr problematische Schwachschichten können so wieder aktiviert werden. Dieser Prozess geht schnell, meistens dauert es nur wenige Stunden (in der entsprechenden Höhe und Exposition).

Schneebrett
Typische Schwachschichten bestehen aus kantigen Kristallen, sind weich und haben grosse Hohlräume zwischen den Kristallen.
Die Schwachschicht muss von einer gebundenen Schneeschicht überlagert sein («Slab», «Schneebrett»). Ohne diese gebundene Schicht kann sich der Initialbruch nicht ausbreiten. Der Schnee in den Alpen ist durch die meist nicht so grosse Kälte und den Wind normalerweise gebunden. Bei grossen Neuschneemengen setzt und bindet sich der Schnee schon durch das Eigengewicht.

Um ein Schneebrett zu bilden, muss der Schnee nicht bis an die Oberfläche hinauf gebunden sein. Es reicht eine gebundene Schicht oberhalb der Schwachschicht.
Bleibt der Spursteg stehen, so ist der Schnee gebunden.

2. Ähnlicher Schneedeckenaufbau über eine grössere Distanz
Für eine Schneebrettlawine müssen Schwachschicht und Schneebrett flächig vorhanden sein. Bei markanten Änderungen im Meterbereich (oft im Variantengelände oder an stark windbeanspruchten Rücken) kann ein Initialbruch zwar ebenfalls entstehen, sich dann aber kaum so weit ausbreiten, dass es für eine Schneebrettlawine reicht.
3. «Genügende» Belastung für Initialbruch
Sind alle bisher beschriebenen Bedingungen erfüllt («passende» Kombination aus Schwachschicht und Schneebrett darüber, beide genügend flächig vorhanden), so kann sich ein anfänglich kleiner Bruch ausbreiten. Zuerst muss es aber noch zu diesem Initialbruch kommen:
• Bei sehr ungünstigen Verhältnissen können Lawinen spontan abgehen, also ohne menschliches Dazutun. Für eine Auslösung kann dann z. B. die Belastung durch Neuschnee oder Regen, ein Festigkeitsverlust der Schwachschicht (z. B. wenn sie feucht wird) oder auch schon eine Veränderung im Schneebrett reichen.
• Manchmal braucht es das Gewicht eines Skifahrers («geringe Zusatzbelastung»).
• Mit einer grossen Zusatzbelastung wie einer Sprengung oder einem Gletscherabbruch ist die Wahrscheinlichkeit am grössten, ein Schneebrett auszulösen.
Die zusätzliche Belastung1 nimmt mit der Tiefe ab, bei hartem Schnee besonders schnell. Eine Schneebrettauslösung ist wahrscheinlicher:
• wenn die Schwachschicht relativ nahe an der Schneeoberfläche liegt (idealerweise etwa 50 cm);
• bei weichem Schnee;
• bei grosser Belastung (z. B. Sturz, beieinanderstehende Gruppe).
40 –60 cm
Schwachschicht
Schneebrettlawinen sind oft leichter auszulösen an Orten mit geringer Schneehöhe. Ist die Schwachschicht tiefer als 1 Meter unter der Schneeoberfläche, so können wir sie an dieser Stelle kaum auslösen.
Korrekt: Zusatzspannung, d. h. zusätzliche Belastung pro Fläche.

4. Neigung
Initialbruch und darauffolgende Bruchausbreitung sind bei jeder Hangneigung und auch im Flachen möglich. Ist der Hang flach, so bleibt die gebrochene Schneetafel an Ort und Stelle liegen, allenfalls begleitet von einem Wummgeräusch oder Rissen in der Schneedecke («Alarmzeichen», siehe S. 98). Hat der Hang einen Bereich mit mindestens 30° Neigung, so kann die gebrochene Schneetafel als Schneebrettlawine abgleiten. Am häufigsten sind Schneebrettlawinen in Hängen mit 35 bis 45° steilen Bereichen.
Eine Schneebrettlawine kann nicht nur im Steilgelände, sondern auch aus dem flachen ausgelöst werden. Liegt der Auslösepunkt ausserhalb des Anrissgebietes der Lawine, sprechen wir von einer Fernauslösung.
Wumm- und Zischgeräusche sowie Risse in der Schneedecke sind untrügliche Zeichen, dass wir einen Initialbruch erzeugt haben und sich dieser ausgebreitet hat. Ob die gebrochene Schneetafel abgleitet, ist dann nur noch eine Frage der Neigung bzw. der Reibung an den frischen Bruchflächen.
Schwacher Hangbereich (Hot Spot)
Die Eigenschaften der Schneedecke sind nicht über den ganzen Hang gleich. Daraus resultieren Bereiche, in denen wir eine Schneebrettlawine auslösen können und andere, wo unsere Belastung für die Auslösung nicht ausreicht. Leider können wir nicht zuverlässig vorhersagen, wo genau diese Bereiche sind. Oft sind es aber eher schneearme Stellen, Übergänge von wenig zu viel Schnee oder frische Triebschneeansammlungen und insbesondere deren Randbereiche.
• Je leichter sich solche «schwachen Hangbereiche» auslösen lassen und je mehr davon vorhanden sind, desto grösser ist die Lawinengefahr. Die Gefahrenstufe des Lawinenbulletins ist ein Mass dazu.
• Je nach Höhenlage, Hangexposition oder Hangform existieren mehr oder weniger dieser «schwachen Hangbereiche». Die besonders betroffenen Geländeteile («Kernzone») werden normalerweise im Lawinenbulletin angegeben.
mässig
mässig
erheblich
mögliche Schneebrettlawinen
Hot Spot, auslösbar durch geringe Zusatzbelastung
Hot Spot, auslösbar durch grosse Zusatzbelastung
erheblich
mögliche Schneebrettlawinen
Hot Spot, auslösbar durch geringe Zusatzbelastung
Hot Spot, auslösbar durch grosse Zusatzbelastung
Bruchmechanismus
Eine Schneebrettlawine auszulösen ist einfach – der Bruchmechanismus dahinter deutlich komplizierter:
Initialbruch
In einer Schneedecke kommt es immer wieder zum Bruch einzelner, besonders hoch belasteter Bindungen zwischen zwei Schneekristallen (z. B. beim Pfeil in der Abb. auf S. 85). Sobald die Bindung gebrochen ist, kann dort keine Kraft mehr übertragen werden. Die zuvor dort einwirkende Kraft wird jetzt von der Umgebung aufgenommen. Ist die Schicht sehr schwach, oder wird sie plötzlich z. B. durch einen darüberfahrenden Skifahrer höher belastet, besteht die Gefahr, dass jetzt auch die umliegenden Bindungen brechen. So besteht ein Bereich, wo die Schwachschicht komplett gebrochen ist.
Bruchausbreitung
Ist der Initialbruch genügend gross (mehrere Quadratdezimeter), kann sich der Bruch in alle Richtungen ausbreiten. Das über der Schwachschicht liegende Schneebrett ist im Bereich des Bruches nicht mehr gestützt. Es verbiegt sich und senkt sich dabei ab. Am Rand der geschädigten Stelle entstehen Spannungsspitzen. Bricht die Schwachschicht auch dort, so breitet sich der Bruch aus. Das Absacken des Schneebretts können wir manchmal spüren, als «Wumm» hören oder am Rand einen Riss in der Schneedecke sehen (Alarmzeichen, siehe S. 98).
Absenken des Schneebrettes
kollabierter Bereich der Schwachschicht
Spannungsspitzen am Rand des Risses
Absenken des Schneebrettes
Absenken des Schneebrettes
kollabierter Bereich der Schwachschicht
kollabierter Bereich der Schwachschicht
Spannungsspitzen am Rand des Risses
Spannungsspitzen am Rand des Risses
Provisorische Verankerung im Schnee
Vor allem bei der Spaltenrettung entlasten wir uns manchmal zuerst mit einer provisorischen Verankerung, bevor wir als definitive Verankerung einen T-Schlitz erstellen.

Die «provisorischen» Verankerungen sind bei möglicher Sturzbelastung oder für einen Flaschenzug zu schwach!
Eingesteckte Ski
• Ski leicht nach hinten geneigt bis zur Bindung in den Schnee einrammen.
• Reepschnur mit Handschuh, Mütze o. Ä. vor den Skikanten schützen.
• Last unmittelbar an der Schneeoberfläche anhängen.
• Ski oben zurückhalten.
«Rocker»-Ski sind oft hinten «aufgebogen» und lassen sich kaum einrammen.

Wichtig: Während ganzer Belastungsdauer Ski oben zurückhalten!
Eingesteckter Pickel
• Pickel leicht nach hinten geneigt vollständig in den Schnee rammen.
• Auf Pickel stehen / knien.

Diese «Verankerung» ist sehr schwach nur bei Spaltenrettung verwenden, um einen T-Schlitz zu bauen.

Wichtig: Während ganzer Belastungsdauer auf dem Pickel verbleiben!
Testen einer Verankerung
Zeigen wir zu didaktischen Zwecken, was eine Verankerung taugt (z. B. dass ein eingesteckter Pickel praktisch nichts hält), sichern wir die Verankerung zurück (Herausschnellen kann zu Verletzungen führen).
am Hang: T-Schlitz
Erstellen einer Verankerung unter Zug siehe S. 264. i
Verankerung im Eis
Verankerungen im Eis sind leichter anzubringen und solider als im Schnee.
Eisschraube (-röhre)
Eine 13 cm lange Qualitätseisschraube ist im kompakten Eis eine zuverlässige Sicherung und hält oft mehr als die von der EN-Norm gefordeten 10 kN1
• Morsches Eis wegkratzen.
• Schraube senkrecht zu Eisoberfläche und Belastungsrichtung eindrehen.
• Bei hoher Temperatur oder direkter Sonnenbestrahlung besteht Ausschmelzgefahr: Schraube mit Schnee zudecken oder besser durch Eissanduhr ersetzen.
• Bei dünnem Eis eine kürzere Eisschraube verwenden. Zu lange, nicht ganz eingedrehte Schrauben halten deutlich weniger (steht eine Schraube 3 cm heraus, bricht schon bei etwa 7 kN der Schaft).
normaler Setzwinkel: senkrecht zur Eisoberfläche

• Können wir auch die kürzeste Schraube nicht ganz eindrehen: Abbinden mit Ankerstich oder Mastwurf.
Nur gut geschliffene Qualitätseisschrauben mit Zähnen aus Stahl und Kurbel lassen sich in jedem Eis rasch und mit einer Hand eindrehen.
Bei langer Belastung oder Wärme schmelzen die Eisschrauben aus. Für Rettungsübungen o. Ä. besser Eissanduhren verwenden.
1 Mit Alulasche etwa 14 kN (~ 1400 kg), mit Stahllasche noch mehr.
Eissanduhr
• Morsches Eis wegkratzen.
• Mit langer Eisschraube (z. B. 19 cm) im 60°-Winkel 2 Löcher bohren, die sich möglichst weit hinten treffen.
• Durchziehen einer Reepschnur mit dem (Abalakow-)Hooker
• Reepschnur zusammenknüpfen, Winkel max. 60°.
• Belastung senkrecht zur Ebene, in der sich die Sanduhr befindet.
Wenig empfindlich auf Ausschmelzen. Festigkeit bei 17 cm
Seitenlänge im kompakten
Eis ca. 10 kN (~1000 kg) bei Verwendung einer 8-mm-Reepschnur.
Dünne Reepschnüre doppelt fädeln.

Ein Hooker kann mit einem Draht selbst angefertigt werden. Im Notfall kann statt dem Hooker auch das Stahlkabel eines Klemmkeils verwendet werden.
Ausbildung
Bergsport Winter
Das Ausbildungsbuch des Schweizer Alpen-Club SAC vermittelt die wichtigsten Techniken für den Winterbergsport. Die aktuellen Erkenntnisse zur Tourenplanung, zur Fortbewegung im Gelände und zu Lawinen werden einprägsam erklärt und ausführlich illustriert.
Bergsport Winter richtet sich an alle Bergsportlerinnen und Bergsportler, die auf Tourenski, Schneeschuhen oder Snowboard unterwegs sind. Dem Eisklettern ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Das Grundwissen zu Orientierung, Wetter, Rettung, Fitness und dem rücksichtsvollen Verhalten gegenüber der Tierwelt ergänzt den praxisorientierten Inhalt.
Dieses Standardwerk erscheint im Verlag des Schweizer Alpen-Club SAC. Es eignet sich zum Einstieg in den Winterbergsport, als Nachschlagewerk wie auch zur Weiterbildung.
In Zusammenarbeit mit:


Mit Unterstützung von:
ISBN 978-3-85902-488-5
Weber Verlag AG
CH-3645 Thun / Gwatt www.weberverlag.ch