Isabelle Kaiser


Ein Lesebuch
Mit einem Vorwort von Philipp Theisohn und einem Nachwort von Dominik Riedo



Mit einem Vorwort von Philipp Theisohn und einem Nachwort von Dominik Riedo
MIT EINEM VORWORT VON PHILIPP THEISOHN UND EINEM NACHWORT VON DOMINIK RIEDO
Jana Avanzini (Hrsg.)
Mit einem Vorwort von Philipp Theisohn und einem Nachwort von Dominik Riedo
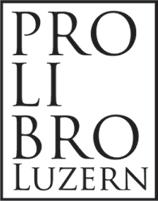
Isabelle Kaiser, die Dichterin der Zwischenlande
Inmitten der nicht unbeträchtlichen Zahl an kleinen Erzählungen, die die Nidwaldner Schriftstellerin Isabelle Kaiser zeit ihres Lebens veröffentlicht hat, fndet sich ein zehnseitiger
Text mit dem Titel Nachtzug. Im Zentrum der Geschichte steht der Domini Selm, ein «blöder Geselle, […] einsilbig und menschenscheu»,1 ein Bahnwärter, dessen Aufgabe sich darin erschöpft, die Bahngleise zwischen Sisikon und Brunnen zu beaufsichtigen, auf denen die Gotthard-Züge dahinrasen. An einem Winterabend, gerade vor Schichtende, bemerkt Selm, dass seine Strecke durch einen Bergrutsch verschüttet wurde – und der Nachtzug von Arth-Goldau bereits herannaht. Nachdem der Bahnwärter den Zugführer zunächst mittels auf den Gleisen platzierten Platzpatronen auf die Blockade aufmerksam zu machen versucht, die «knallenden Mahner» aber ihren Dienst versagen, erwartet Selm den Zug nach der Ausfahrt am Ölberg-Tunnel, rennt mit der Signallaterne so lange neben der Lokomotive her, bis man ihn bemerkt und das Unglück durch eine Vollbremsung gerade noch verhindert werden kann. Während die Passagiere sich noch über den ungeplanten Nothalt und den verpassten Anschluss nach Genua beschweren, fndet ein Bahnangestellter beim Aussteigen den toten Selm in einer Böschung liegen.
In ihrer sehr konzisen, sparsamen Komposition ist Nachtzug eine für Kaisers Œuvre durchaus charakteristische Erzählung, die nicht nur in der Knappheit, sondern auch in der zurückgehaltenen Bearbeitung des Stoffes ein basales Konzept dieser Prosa ausstellt und nicht von ungefähr explizit als «Skizze» ausgewiesen wird. Isabelle Kaisers Texte zeichnen sich recht regelhaft durch eine eigentümliche Vorsicht in der Behandlung des Rohgedankens aus, und diese Vorsicht besitzt
einen tieferen, literaturhistorischen wie poetologischen Grund. Tatsächlich lässt sich Nachtzug nämlich auch als eine Allegorie jener Schreibsituation lesen, in der das Werk Isabelle Kaisers verortet werden muss: Es ist ein Schreiben in den Zwischenlanden, ein Schreiben zwischen den Zeiten, zwischen den Sprachen – und dieses «Zwischen» ist nicht zwingend idealisierend zu lesen, sondern beschreibt auch eine Problemlage. So wie der Domini Selm von Nidwalden eine Strecke zu warten hat, auf der er selbst nie fahren wird, auf der kein Zug hält, so steht auch Isabelle Kaisers Erzählen abseits der Dynamiken, die das frühe 20. Jahrhundert umwälzen. Wie der mit ihr befreundete Carl Spitteler verharrt auch Kaiser just auf der Schwelle zur Moderne. In der Grundanlage ist ihre literarische Ästhetik noch ganz dem Historismus des 19. Jahrhunderts verhaftet, von dem noch Kaisers späte Texte, die Novelle Die Nächte der Königin und die Skizze Der König kommt (beide 1923) künden und der in ihren Romanen – etwa in Sorcière! (1896, 1921 als Bilda, die Hexe ins Deutsche übertragen), im Roman der Marquise (1909) oder in Der wandernde See (1910) – vollends zum Austrag kommt. Nicht allein in Kaisers Verpfichtung auf das Lokale, auf die Szenerie der Innerschweiz erkennt man dabei die Spuren realistischen Erzählens. Noch weitaus deutlicher tritt das literarische Erbe im Aufrufen und Verbrauchen moralphilosophischer, epistemischer wie religiöser Codes hervor, in der Situierung des Geschehens in einer instabil gewordenen Wirklichkeit, der ihre transzendente Rückversicherung sukzessive abhandenkommt und der formgeschichtlich die geradezu selbstverständliche Hinwendung zur Novellistik entspricht.
Zugleich weiss diese Literatur aber auch um ihre Verspätung: Längst hat sich die Welt, aus der das novellistische Erzählen einst wieder emporstieg, verändert, beschleunigt. Natürlich gibt es diese Welt noch, die Welt zwischen Sisikon und Brunnen – aber die Geschichte ist bereits an ihr vorbeigefah-
ren, hat neue Realitäten, Wahrnehmungsmodi und Schreibformen geschaffen, um die Kaisers Texte wissen, denen sie sich aber nicht anzuschliessen vermögen. Geprägt werden sie stattdessen vom Bewusstsein, nicht mehr von den realistischen Erzähltraditionen, zugleich gehören sie aber noch nicht zu den Avantgarden und können jedoch mit ihren Eingebungen und Begebenheiten noch nicht alleine stehen. Aus dieser Verlassenheit, die nicht nur Fluch, sondern auch Privileg der Provinz ist, erwächst bei Kaiser das Skizzenhafte, die Scheu vor allzu starker Ausarbeitung und prinzipientreuer Gestaltung.
Auch in anderer Hinsicht erweist sich der Nachtzug allerdings als ein quasi programmatischer Text Kaisers. Beschworen wird in ihm nämlich ein Verfahren, dem sich ein Grossteil ihres Schreibens verdankt: die Mortifkation. Nicht allein der Domini Selm endet sein Leben am Ende der Erzählung – vielmehr trägt diese ganze Innerschweizer Zwischenwelt Züge der Verstorbenheit und schreibt sie ihren Besuchern ein. Rasend, geschäftig, diesseitig nähern sich der Zug und seine Insassen; Selm, den bereits ein «gruftähnlicher Modergeruch»2 umhüllt, unterwirft dieses Leben bereits einem jenseitigen Blick und verwandelt es in ein «Flimmern wie von unzähligen Totenkerzen»,3 sieht bereits die Wellen des Vierwaldstättersee «sich rauschend über dem Wassergrab» schliessen.4 Jenes mortifzierende Auge aber, das Auge eines selbst bald Hingeschiedenen, ist auch das Auge des Textes, ja: das Auge vieler Texte Isabelle Kaisers, die das in ihnen verzeichnete Leben stillstellen, es als ein «Über-Leben» entpuppen. Der Zug mag der Katastrophe entgehen, doch Selm hat ihn gesehen, «aus der unterirdischen Gruft tretend»,5 und das heisst: als einen Totenzug aus dem Ölberg-Tunnel wieder emportauchen.
Die meisten Gestalten, die sich durch Kaisers Erzählungen bewegen, führen eine Doppelexistenz als zugleich Lebende und Tote. Sie alle sind Gespenster, Phantome einer Zwischen-
zeit, Passagiere der Nidwalden durchquerenden Nachtzüge. Das gilt etwa für den Patienten Lord Douglas Lindsay, der in Sein letzter Wille aus der Euphorie der Verliebtheit den nahenden Tod ignoriert und Zukunftspläne mit der ihm palliativ zugetanen Pfegerin Maria Sullivan hegt, «nicht auf die sterbende Sonne und nicht auf das Sinken der unwiderrufichen Nacht» achtend.6 Die Scheinwelt, die Maria ihm in seinen letzten Tagen errichtet, steht dabei für die conditio humana: Wenn sie den Sterbenden küsst, dann küsst sie auch «den ganzen Schmerz der Menschheit»7 und erklärt zugleich Lindsays Illusionen zur Wahrheit menschlicher Existenz. Den Tod verstellt immer nur das aus Liebe geborene Traumbild – eine dem symbolistischen Diskurs entlehnte Formel, die sich zum Ende der Novelle insofern als verheerend erweist, als dass Maria (und sie trägt diesen Namen nicht von ungefähr) schliesslich bei der Testamentseröffnung bekennen muss: «aber ich habe ihn nie geliebt.»8
Auch der Leuchtturmwärter Joel in der Novelle Auf dem Leuchtturm ist ein lebender Toter, wenn auch ein sehr bewusster: Um eine verspielte Liebe zurückzugewinnen, hat er sich ein Schweigegelübde auferlegt, von dem ihn nur die geliebte Joseline entbinden konnte – diese aber stirbt, und von ihrem Tod her ist sein weiteres Leben zu denken. Was dem Domini Selm seine Bahnstrecke ist, ist dem Joel der Ozean: «ein schwarzer Abgrund» zu seinen Füssen, auf dem «keine Flamme des Lebens» mehr zu sehen wäre, wenn es den Leuchtturm nicht gäbe.9 Das Leuchtfeuer aber erlischt wie von Geisterhand – ein Schiff havariert, als einzige Überlebende birgt Joel eine zweite Joseline, eine Wiedergängerin der ersten, die zwar infolge einer Lungenkrankheit auch bald wieder das Zeitliche segnet, den Leuchtturmwärter jedoch von seinem Schweigen entbinden kann, bis er dann selbst abberufen wird. Die Gesamtanlage der Novelle weist in Richtung einer Spiegelung: Über dem vom «bange[n] Stöhnen und Ächzen»10 erfüllten
Wasserspiegel sitzt der schweigende Joel, aus ihm hervor steigt aber eine bereits gestorbene, noch einmal sterbende Figur, deren Gesang «an der Schwelle zur Ewigkeit»11 ertönt. Hier ein im Tod Lebender, dort eine dem Tod kurzzeitig Entstiegene: Wichtig ist das aber einzig und allein, weil aus der Wiederbegegnung der beiden die Sprache gelöst wird und der Gesang in die Welt zurückkehrt. Abgesehen davon, dass Kaiser hier recht offensichtlich den Orpheus-Mythos aufnimmt, handelt es sich bei Auf dem Leuchtturm damit natürlich auch um einen poetologischen Text: Dem Selbstverständnis von Kaisers Dichtung entspricht es, ihren Ursprung in der Lebensunfähigkeit, in jener Zone zwischen Leben und Tod zu suchen, wovon auch ein Text wie Finelis Himmelfahrt etwas zu sagen weiss. Fineli, erst acht Jahre alt und ebenfalls schon dem Tod geweiht, gemahnt ihre Mitwelt nämlich «an die zarte Pfanze des Dichters, die der ‹Gärtner Tod› auf Erden setzt: die wehmutreiche Blume, um die er sich emsig bemüht, und vor der man sinnend steht, den Gärtner ahnend».12
Die Melancholie als poetisches Movens – nichts Neues, bei Kaiser jedoch gewandelt: Die Dichtung als «wehmutreiche Blume» birgt die Ahnung des Todes. Zum Ausdruck gebracht ist damit, dass dieses Erzählen nicht nur die Seinsgrenzen abschreitet, sondern seiner Leserschaft selbst das zweite Gesicht verleiht, um die Morbidität ihrer Wirklichkeit in allem spüren zu können. Die Besonderheit von Kaisers Werk ist mithin darin zu suchen, dass es doch recht ostentativ auch an die Theorematik der französischen Décadence anknüpft, in der Rezeption jedoch zu überraschenden Wendungen fähig ist. Dass Fineli am Ende eben gerade nicht stirbt, sondern von ihrer Himmelfahrt heimkehrt, ist eine recht perfde Volte. Wo zuvor nämlich die Erlösungsvorstellung, die das Kind begleitet, daran geknüpft ist, dass alles mit und nach ihm, ja, ihm «zusterben» soll – Mutter, Brüder, die Welt –, da erscheint seine wundersame Rettung nicht mehr als Wunder. Mit der vom Tod
bereits erfüllten Fineli tritt dieser selbst in die Welt ein und mortifziert diese.
Man muss diese eigentümlichen Ambivalenzen stets im Blick behalten, will man Kaisers oft scheinbar karge Texte richtig verstehen. Das gilt auch für ihre sicherlich populärste Erzählung, den Lanzigbub. Auch dieser, mit bürgerlichem Namen Wendelin, ein Todessucher und -seher, ein Wesen, das erst an Gestalt gewinnt, wenn es «in seiner erdgeborenen Urkraft […] am Rand des Abgrundes» steht und es die «Todestrunkenheit […] wie ein Rausch, ein Sehnen nach unumschränkter Freiheit»13 überkommt. Auf den ersten Blick scheint die Geschichte doch stark untermotiviert: Ein Totschläger wider Willen sieht die von ihm ersehnten Ehepläne in Scherben (denn es ist der Schwiegervater, den er auf dem Gewissen hat), weiss die Zeichen nicht richtig zu deuten, fieht vor den vermeintlichen Häschern auf den Berg und stürzt sich mitsamt einer Kuh in einem seltsamen Anfug von Sehnsucht und Ungeschick – «mit einem wilden Laut, das einem Juchschrei glich»14 – in die Schlucht hinab. Novellistisch daran ist nicht die simple Tragik, die darin zu suchen wäre, dass die Männer, die der Lanzigbub für Unheilsboten hält, in Wahrheit kommen, um ihm seine Entlastung zu verkünden – und ihm damit den Weg in sein Lebensglück wiedereröffnen würden. So trivial geht es bei Kaiser dann doch nicht zu, denn dem Verkennen auf Seiten Wendelins entspricht auch ein Verkennen auf Seiten der drei Älpler, die ihrerseits «niemals erfahren, dass der Lanzigbub einen ehrlichen Älplertod dem Verlust der Freiheit und der Liebe vorgezogen hatte, weil er einer war, der vom Herrgott her das Freiluftzeichen auf der Stirne trug.»15
Das ist ein in Anbetracht der Sachlage doch seltsam ambivalentes Ende, denn das Missverständnis Wendelins ist eben das eine, ein anderes jedoch die prononcierte Engführung von Tod und Freiheit, die ganz unbesehen des Irrtums einen Eigen-
wert zu besitzen scheint. Ohnehin setzt Kaiser auf eigentümliche Weise ihren Helden ins Recht, der «Juchschrei», mit dem er in den Abgrund fällt, überhebt sich jedes Einspruchs der Vernunft; die mit ihm zerschmetterte Liebe, die hinterlassene Braut und Gemeinschaft müssen hinter diesem eigenwilligen Pathos zurückstehen, das sich freilich wiederum aus der Landschaft begründet, in die es zurückstürzt. Der Weg des Lanzigbubs in den Berg bereitet gezielt jene Verschmelzung mit dem Tod vor, der ausgerufene Alpsegen,16 den die Bergwelt und ihre Tiere ihm sprechen, verkündet im Grunde den Eintritt ins Sterben. Und auch ist das wichtig: Kaisers Alpen, so konstant sie ihr Œuvre auch beherrschen mögen, sind keine idyllische, sondern eine morbide Sphäre. Die bisweilen überraschende Brutalität, mit der sich ihre Bewohner in Kaisers Erzählungen dem Tod nahezu beifällig überantworten, ist nur so zu verstehen: Am Ende liegt im Sterben die Wahrheit der Berge. Der Lanzigbub kennt sie, dem von ihm verwundeten Riedmattler hat er sie versehentlich beigebracht, auf dem Felsen kann er sie in all ihrer Klarheit sehen und sich mit ihr vereinen. Andere wie der Hundlimattsepp aus Ein blühender Apfelbaum verteilen das Sterben halb aus Ressentiment, halb ohne rechten Grund einfach en passant, weil nun einmal «der Sturmwind des Hasses durch die Niederungen des Menschentales blies»17 – und das ist schon alles an moralischem Aufwand, den das Erzählen hier noch betreiben kann, denn vollstreckt wird hier letzten Endes nichts als die Logik der Bergwelt.
Wie der Domini Selm übersieht Isabelle Kaiser von Beckenried aus jene Passage zwischen Leben und Tod, registriert ihre Spalten und Durchbrüche, erkennt und verzeichnet die bereits Verstorbenen unter den Lebenden – und die Toten unter den Lebenden. Letzteren hat sie sogar ein Gedicht gewidmet, dessen erste und letzte Strophe lautet:
Die Toten ruhen nicht im Grabe, Sie weilen nicht im Aschenkrug, Die Toten ziehn am Wanderstabe, Ein grosser heil’ger Pilgerzug.18
Kaisers Werk versammelt diese «stummen Gäste», lässt sie unmerklich herankommen, bei vielen erkennen wir lange nicht, dass sie bereits aus dem Jenseits zu uns sprechen. Manche wissen es sogar selbst nicht – und in jenem Moment, in dem uns das klar wird, beginnt diese lange ungelesene Dichtung damit, uns selbst zu befragen. Nicht bezweifelt werden kann: Isabelle Kaiser gehört vielleicht zu den unheimlichsten Autorinnen der Schweizer Literaturgeschichte. Man sollte sie wiederlesen.
Philipp Theisohn
1 Isabelle Kaiser: Nachtzug. Skizze. In: dies., Seine Majestät!, Novellen; Stuttgart/Berlin 1905, 99-108, hier 99.
2 Ebd., 102.
3 Ebd., 105.
4 Ebd., 103.
5 Ebd., 104.
6 Isabelle Kaiser: Sein letzter Wille. In: dies., Wenn die Sonne untergeht, Novellen, Stuttgart/Berlin 1902, 9-20, hier 18.
7 Ebd., 19.
8 Ebd., 20.
9 Isabelle Kaiser: Auf dem Leuchtturm. In: dies., Wenn die Sonne untergeht, Novellen, Stuttgart/Berlin 1902, 37-56, hier 42.
10 Ebd., 41.
11 Ebd., 51.
12 Isabelle Kaiser: Finelis Himmelfahrt. In: dies., Wenn die Sonne untergeht, Novellen, Stuttgart/Berlin 1902, 67-73, hier 68.
13 Isabelle Kaiser: Der Lanzigbub. In: dies., Seine Majestät!, Novellen, Stuttgart/Berlin 1905, 9-35, hier 34.
14 Ebd., 35.
15 Ebd.
16 Ebd., 31.
17 Isabelle Kaiser: Ein blühender Apfelbaum. In: dies., Seine Majestät!, Novellen, Stuttgart/Berlin 1905, 36-43, hier 43.
18 Isabelle Kaiser: Totenzug. In: dies., Mein Herz, Gedichte, Stuttgart/Berlin 1908, 25.
I.
Als die uralte Mao den bretonischen Spinnerinnen die Geheimnisse der nordischen Küsten zu offenbaren begann, trat der schmucke Fischer Jan Trevor missmutig aus der niederen Stube. Doch was heute Nacht durch die halb offene Türe fast gegen seinen Willen zu ihm drang, überstieg so sehr die Grenzen menschlicher Glaubwürdigkeit, dass er, wie gebannt, lauschte:
«…Ich, die alte Mao, sage euch, Kinder, dass es zur Sommerzeit Stunden gibt, wo gewisse Tiere, wie die Robben, die verzauberte Geschöpfe sind, den Vorzug geniessen, vom Schlag der Mitternacht bis zum Sonnenaufgang wieder ihre menschliche Gestalt anzunehmen und in Schönheit zu wandeln... Aber die schwerblütigen Menschen schlafen, dieweil die Verwandlung von sich geht, so dass keiner jemals Zeuge dieser wunderbaren Umgestaltung wurde…»
Jan zuckte in ungläubiger Abwehr die Achseln. Ein Schauer durchrieselte ihn, und eine geheimnisvolle Macht zwang ihn dennoch, der Düne entgegen vorwärts zu stürmen.
Da kam die urewige Klage der Wogen, das stöhnende, leidende Seligsein des Meeres… Jan liess die salzige Brise über seine Schläfen streichen, um den Spuk fortzuscheuchen. Der Mond strahlte auf die nordische Landschaft, und der junge Fischer erblickte die Schar der Wasservögel, die wie eine Wolke auf und nieder schwärmte. Am Strande tummelten sich unzählige Robben, und eine seltsame febernde Unruhe schien heute durch ihre sommernächtlichen Spiele zu pulsen.
Als die zwölf bedeutungsvollen Schläge der Mitternacht durch die Stille dumpf verhallten ging ein aufgeregtes Hasten und Schwirren durch den gefügelten Schwarm. Er fatterte auf und davon, und die Strandtiere krochen lautlos den Mulden zu… Lautlos schmiegten sie sich dem weichen Dünen-
land an… Sollte sich die Kunde der weissagenden Mao wirklich bewahrheiten? Jan glaubte immer noch von einem Zauber befangen zu sein, als er nun, mit verhaltenem Atem und hochklopfenden Pulsen, dem Schauspiel, das sich vor seinen staunengeweiteten Augen entrollte, beiwohnte.
Er fühlte sich jäh als unbefugten Eindringling bei diesem Weiheakt und kroch Scheu hinter einen Felsen, damit nichts seine Gegenwart verrate. Die Tiere hatten sich schon mit konvulsivischen Zuckungen gleichsam aus ihren Fellen herausgeschält, und langsam felen dieselben von ihnen ab.
Wie eine weisse Mandel aus rauher Hülle sprang hier und dort die Blüte eines weiblichen Körpers heraus, so rein und keusch, als wäre er neugeboren.
Eine über ihre Lenden wallende Mähne verschleierte ihre monderhellte Nacktheit. Diese Frauenleiber hatten den Glanz von ihren Muscheln entfallenen Perlen… Die winzigen Füsschen huben sogleich zu tanzen an, die Hände verketteten sich wie loses Blumengewinde, und sie führten kindliche Ringelreihen in stummer, jubelnder Freude aus. Ihre Locken schlangen sich um ihre Glieder, bald feurig wie eine Flamme und halb füssig wie eine Flut!
Jan, vornübergebeugt, vergass bald alle Vorsicht im trunkenen Taumel seiner Sinne, angesichts dieser berückenden Wandlungen. Er schritt vorwärts, die Hände verlangend nach den schwebenden Gebilden ausgestreckt, wie um ihre Wirklichkeit zu betasten. Sobald er jedoch eine fatternde Locke zu haschen glaubte, fohen die Gestalten mit behenden Füssen, und in den Fingerspitzen fühlte er nur wie das Rieseln einer frischen Liebkosung.
Er glaubte das Spiel einer Sinnestäuschung zu sein, aber die Stimme der alten Mao klang in ihm nach: «…Von der Mitternacht bis zum Sonnenaufgang!…» und forderte ihn mahnend zur Tat auf. Denn säumte er, so würde alles, sobald der Tag anbrach, in seinen gewohnten Zustand zurückfallen, und
der Mastwächter Trevor, in seiner Sehnsucht geprellt, kehrte mit leeren Händen in seine Hütte zurück!
Das durfte nicht sein! Da empfahl er sich «unserer lieben Frau», der Schutzpatronin isländischer Fischer… Nichts verhalf. Wie er die Augen wieder aufschlug, tanzten die schlanken Lilienkörper immer noch ihre verführerischen Reigen von den Sanddünen zu den Felsenmulden hin…
Jan strebte ihnen nach… Da stolperte sein Fuss über ein in seinem Weg liegendes Hindernis. Er beugte sich und erkannte betroffen das abgestreifte Fell eines Tieres, noch durchdrungen von der Wärme des Körpers.
Ohne jegliches Besinnen bemächtigte er sich der Hülle und barg sie, in höchster Eile, in einer Felsenhöhlung.
Und harrte bebend auf die Folgen seiner unbesonnenen Tat.
Als der neue Tag, wie ein Schwarm von Flamingos, rosig aus dem Meere stieg, kam die fiegende Unruhe wieder über die lichten Mondscheintänzerinnen.
Die Hände lösten sich, wie windverwehtes Blütengeranke, und jede kleine Nixe beeilte sich, die verschwiegene Mulde, wo die Verwandlung stattgefunden hatte, zu erreichen. Alle bebten davor, von der anbrechenden Helle in ihrer leuchtenden Nacktheit überrascht zu werden.
Jan bemerkte, wie die Meerjungfrauen sich am Strande niederliessen und sich der Haut ihres Felles so sanft anschmiegten, bis sie sich wieder ganz eng damit verwachsen fühlten.
Der erste Sonnenstrahl blitzte am Horizont auf!
Da schwanden die schmächtigen Tänzerinnen allmählich unter dem Pelzüberwurf, und die Mähnen schrumpften im lockigen Fliess ein. Langsam sah man wieder die Robben mit breiten Schwimmfossen schwerfällig der hohen See entgegenrutschen.
Plötzlich erblickte der junge Fischer eine verspätete kleine Wasserfee, die verirrt umhersprang, die Felsen suchend umbog und ängstlich nach der Tierhülle, die zur Wiederverkörperung vor Sonnenaufgang unerlässlich war, vergeblich umherspähte…
Beim Anblick eines Fremdlings bebte das geheimnisvolle Geschöpf, blass wie eine Perle, verscheucht zurück. Mit züchtiger Gebärde suchte es mit den losen Strähnen seiner Haare seine Nacktheit zu verschleiern und verbarg die Verwirrung seines Antlitzes hinter dem erhobenen Arm.
Angesichts der weitäugigen Furcht der Meerjungfrau warf der junge Fischer zartfühlend seinen Wettermantel auf ihre erschauernden Schultern. Sie schmiegte die Falten eng um ihre Lenden und heftete auf den männlichen Geber einen weltfernen, verständnislosen Blick. Ihre ganze Haltung war nur stumme Abwehr.
Doch es glomm etwas Menschliches in ihren Augen auf, wie sie den Liebesworten lauschte, die Jan ihr zufüsterte: «Komm zu mir, seltsames Mädchen… Meine Hütte harret dein!… Ich will dich hegen und pfegen und wie Kleinod und deinen Nacken mit Perlen und Korallen schmücken…
Denn ich habe mich ganz an dich verloren, und meine Liebe soll dich wie ein leidenschaftlicher Sturm umwehen, unergründlicher wie die Wogen und liebkosender wie die Strahlen der Gestirne… Komm zu mir!»
Da fühlte sie Eintagsfrau heimlich in ihrem Busen das Erwachen des Naturtriebes ihres Geschlechtes und das Sehnen nach dem bergenden Nest der Verlassenheit. Wie sie sprach, klang ihre Stimme eindringlich wie der Geruch der Meeresalgen und erschütterte den Fischer in die tiefsten Tiefen… Er hatte sie in sanfter Gewalt an sich gezogen, mit einer Gebärde festmilder Inschutznahme. Und sie liess sich wie eine ihm zugedachte Strandblume pfücken. Wie er sie gleichsam in das Netz seines werbenden Blickes zog, sprühte zwischen den beiden der göttliche Funke auf, der der Berührung zweier Wesen und dem Anprall zweier Schicksale entspringt und den man Liebe nennt!
«…Folge mir… Marina…» Der Name fel ungesucht von seinen Lippen, weil sie für ihn dem Wellenschaum des
Meeres entstammte.
Als aber der heisere Schrei der Möven und Albatrosse, einem menschlichen Rufe gleich, von der See erscholl, da warf die junge Frau noch einen langen Blick ohnmächtiger Begierde nach den Sonnendurchleuchteten Wassertiefen zurück…
Die Luft hauchte irdische Sehnsucht empor…
Sie folgte Jan Trevor in sein Haus…
II.
Zweimal hatte sich der Mastwächter Trevor für die Fischerei an den isländischen Küsten eingeschifft und zweimal war er wieder heimgekehrt, um Taufe zu feiern. Aber immer noch jagte ihm sein häusliches Glück eine Art unbestimmter Furcht ein. Er hatte das Gefühl, als hätte er dem seltsamen Geschöpf, das ihm seine Hütte zum Paradiese schuf, eine heimliche Schuld abzutragen. Hatte er Marina nicht gewaltsam ihrer Wasserheimat entrissen und für immer entfremdet, indem er ihr jede Möglichkeit, sich wieder dort einzuleben, entzog?
Sie sah auch immer noch förmlich erschrocken aus in ihrer menschlichen Schönheit und bliebt immer umhegt von einer gewissen Unnahbarkeit.
Sie schien sich zwar ihrem neuen Wirkungskreis angepasst zu haben, aber blieb wie durchdrungen von der heiligen Keuschheit eines grossen Leides.
Sie lächelte Jan in milder Liebe an, wenn sein Blick in andächtiger Inbrunst auf ihr ruhte. Aber selbst ihr Lächeln blieb weltfremd und jeder Menschlichkeit abhold…
Sie führte im Haushalt ihres Gatten alle täglichen Arbeiten aus, aber stets mit der Haltung einer verbannten Königin, die weiss, dass ihr Reich anderswo ihres Waltens harrt.
Es lag in der Glückseligkeit dieser zwei so verschieden gearteten Menschen etwas Unbeständiges, wie ein Traumzustand. Bei jeder Heimkehr staunte Trevor immer aufs neue,