




Wie wir uns gut ernähren — 24
ausserdem: Antibiotikum aus der Wanze — 10 Reise zum Urknall — 14 Digitale Zukunft der UZH — 58
Vielstimmig statt eintönig.
Die Tischlein sind heute reich gedeckt – zumindest in den westlichen Konsumgesellschaften. Doch das ist nicht nur gut. Denn eigentlich ist unser Körper nicht gemacht für die Überfülle und viele der modern produzierten Lebensmittel, die feilgeboten werden. Deshalb kann er aus dem Gleichgewicht geraten. Wissenschaftler:innen an der UZH beschäftigen sich intensiv mit unserer Ernährung. Dabei erforschen sie einerseits, was uns guttut, andererseits zeigen sie auf, welche gesundheitlichen Folgen falsche Ernährung

Bewusst zu essen, ist wichtig: Evolutionsmedizinerin
haben kann. Und sie entwickeln Strategien und Therapien, die uns helfen, unsere Ernährung im Lot zu halten oder wieder ins Lot zu bringen. Zu welchen Erkenntnissen sie dabei gelangen, thematisiert das Dossier in diesem Heft.
Ein grundsätzliches Problem ist, dass unsere biologische Ausstattung noch im Neolithikum steckt, während sich das Nahrungsangebot rasant entwickelt hat. Das gilt insbesondere für industriell hergestellte Lebensmittel, die gesättigt sind mit hochkonzentrierten Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Zucker und die gleichzeitig oft wenig Vitamine und Ballaststoffe enthalten. Das ist ein Grund, weshalb die Menschen weltweit immer dicker werden. «Unser Körper ist darauf programmiert, nicht zu verhungern», sagt der Veterinärphysiologe Thomas Lutz, «für ein Leben im Nahrungsmittelüberfluss ist er nicht gemacht.»
Thomas Lutz untersucht, wie falsche Ernährung unser Hormonsystem durcheinanderbringt, mit schwerwiegenden Folgen wie Fettleibigkeit und Diabetes. Und er hat die Grundlagen für eine neue Abnehmspritze erforscht, die auf dem Hormon Amylin basiert. Das Hormon reduziert unter anderem das Hungergefühl und verlangsamt die Entleerung des Magens.
Eine Möglichkeit, die Ernährung wieder an Bedingungen anzunähern, die besser zu unserer biologischen Ausstattung passen, ist das Fasten. Denn früher war Nahrung nicht immer verfügbar und der Tisch nicht immer reich gedeckt. Heute beliebt ist das Intervallfasten, bei dem während einer gewissen Zeit des Tages nicht gegessen wird. Besonders wirkungsvoll ist es, abwechslungsweise ganze Tage wenig oder nichts zu sich zu nehmen. Das zeigen Studien des Adipositas-Forschers Philipp Gerber. Fasten hat aber auch eine spirituelle Dimension. Für den Theologen Ralph Kunz ist es ein Moment des Innehaltens, eine leiblich erfahrbare Unterbrechung des Gewohnten, die Raum schafft für Demut und Aufmerksamkeit.
Was wir essen, hat viel mit Gewohnheiten zu tun. Diese sind kulturell geprägt. Und sie sind nicht immer vorteilhaft. So essen wir zu viel Fleisch und Wurstwaren, schlechte Kohlenhydrate und Zucker, obwohl wir es eigentlich besser wüssten. Die Essgewohnheiten vieler Schweizer:innen entsprechen noch den gleichen Mustern wie in den 1970er- und 1980er-Jahren, stellt Ernährungswissenschaftlerin Sabine Rohrmann fest, obwohl es immer beliebter wird, vegetarisch oder vegan zu essen.
Essgewohnheiten zu ändern, ist schwierig, aber nicht unmöglich, wie der Psychologe Sebastian Bürgler weiss. Er nennt drei Strategien: auf den Hamburger verzichten; eine gesunde Alternative – Apfel statt Schoggistängel – snacken; oder Umstände schaffen, die uns gar nicht erst in Versuchung bringen.
Wie die Forschung zeigt, besteht die Kunst des gesunden Essens darin, die richtige Balance zu finden und bewusst zu essen. Die richtige Balance bedeutet, sich ausgewogen und vielseitig zu ernähren. Alles Einseitige sei suspekt, sagt Sabine Rohrmann. Bewusst zu essen, heisst, zu wissen, welche Nahrungsmittel uns guttun und welche nicht, und zu merken, wenn wir genug haben, sagt Evolutionsmedizinerin Nicole Bender.
Wir wünschen eine genussreiche Lektüre, Ihre UZH Magazin-Redaktion, Thomas Gull und Roger Nickl

14
TEILCHENPHYSIK
Reise zum Urknall — 14
Physiker Ben Kilminster baut Detektoren, mit denen sich im Teilchenbeschleuniger am CERN die Bedingungen kurz nach dem Urknall untersuchen lassen.
CHEMIE
10
Der Chemiker Oliver Zerbe entwickelt eine neue Art von Antibiotika. Basis dafür ist ein Naturstoff aus der Baumwanze.
PHILOSOPHIE
18
Wenn wir über Moral sprechen, denken wir meist an Schuld und Tadel, nicht aber an Lob. Pascale Willemsen untersucht nun die moralische Exzellenz.
MEDIEN — 22
Ohne News leben
LARGE LANGUAGE MODELS — 22
Voreingenommene KI
IM FELD — 23
Im Dschungel der Sprachen

Ist die Ernährung aus dem Gleichgewicht, hat das gravierende Folgen für die Gesundheit. Im Dossier zeigen wir, weshalb unsere modernen Essgewohnheiten nicht unseren biologischen Bedürfnissen entsprechen und wie wir uns gesünder und ausgewogener ernähren können.
Es ist angerichtet: Blick ins Studio von Fotograf Marc Latzel, der die Bildstrecke im Dossier gestaltet hat.


PORTRÄT — Celestin Mutuyimana
Der Seelendoktor — 54
Der ruandische Psychologe untersucht Kriegstraumata und wie sie überwunden werden können.
UZH LIFE — Innovative Altersforschung
Das UZH Healthy Longevity Center schafft die Basis für Innovationen, die ältere Menschen im Alltag unterstützen.
— FutureU
Die künstliche Intelligenz fordert die Hochschule heraus. Was sie künftig leisten muss, diskutieren Medizinerin Claudia Witt und Politologe Karsten Donnay.
RÜCKSPIEGEL — 6
BUCH FÜRS LEBEN — 7
DAS UNIDING — 7
DREISPRUNG — 8
ERFUNDEN AN DER UZH — 9
IMPRESSUM — 65
NOYEAU — 66

RÜCKSPIEGEL — 1950
«Diese Welt ist schön zum Wahnsinnigwerden», schrieb Jovan Stöcklin am ersten Abend nach seiner Ankunft in Teheran. Stöcklin promovierte 1950 an der Universität Zürich zum Thema «Zur Geologie der nördlichen Err-Gruppe
zwischen Val d’Err und Weissenstein (Graubünden)». Nach seinem Studium wurde er vom an der UZH promovierten ETH-Dozenten Arnold Heim für das von der iranischen Regierung initiierte «Persien-Projekt» ausgewählt.
Dessen Ziel war es, die geologischen Strukturen des Landes zu erforschen und neue Ölquellen ausserhalb der britischen Konzessionsgebiete der Anglo-Iranian Oil Company zu erschliessen. Neben Stöcklin gehörten mehrere Schweizer Geologen zu Heims Team, das Anfang 1950 nach Teheran aufbrach. Bei ihrer Ankunft legte der Direktor der Iran Oil Company (IOC) den Geologen eine leere Karte vor und sagte: «It’s now up to you to fill this map.»
So begann im Februar 1950 die Zusammenarbeit mit den Erdölingenieuren Fatholla Nafici und Bagher Mostofi, den ersten iranischen Direktoren der IOC. Was mit einem auf drei Jahre befristeten Vertrag begann, endete für Stöcklin erst 27 Jahre später. Gemeinsam mit iranischen Kollegen kartierte er Gebirge und hielt seine Beobachtungen in präzisen Skizzen fest. Seine Feldtagebücher sind voller Zeichnungen von

Bergketten, Landschaften und Felsen – ausgearbeitet bis ins kleinste Detail, stets geleitet von der Überzeugung, dass Geologie im Feld entstehen muss. Immer wieder kehrte Stöcklin nach Teheran zurück, dem Hauptsitz der IOC, wo auch seine Frau mit den vier gemeinsamen Kindern wohnte. Dort arbeitete er das Gesehene in Karten und Berichte aus. Während seiner Zeit im Iran wandelte sich das Land. Die Nationalisierung der britischen Ölkonzessionen führte zu politischen Spannungen, die unter anderem nationalistische Kräfte hervorbrachten. Als 1979 die Revolution ausbrach, endete mit ihr die Monarchie. Wie alle ausländischen Fachleute musste Stöcklin das Land verlassen. Doch der Abschied fiel ihm schwer. Auch als er zurück in der Schweiz war, pflegte er stets Kontakt mit seinen Kollegen im Iran. Es scheint, als hätte er das Land immer in guter Erinnerung behalten, dies bezeugt eine Widmung in seinem Buch «Persien – Erinnerungen eines Geologen» (2006), darin schreibt er über den Iran: «Rückblick auf ein Land, das uns viel Lebensinhalt schenkte.»
Sasha Müri, UZH-Archiv


Als ich im August 2000 als 22-jährige Skandinavistikstudentin für ein Auslandsjahr an die Universität Oslo kam, war ich hungrig auf norwegische Gegenwartsliteratur. Besonders ein Seminar zur Gegenwartsdramatik öffnete mir Welten, die skandinavische Dramenlandschaft war in diesen Jahren in Bewegung, über die verschiedenen Länder und Sprachen hinweg. Ein Werk tat es mir besonders an, gedruckt in einem schmalen weinroten Band mit weissem Umschlag und schlichtem weinrotem Titel «Draum om hausten» – «Traum im Herbst», erschienen 1999.
Verfasst war das Drama von einem noch recht jungen norwegischen Autor, damals 40 Jahre alt, der aber bereits seit 1983 im Literaturbetrieb tätig war, wenn auch vor allem als Romanautor und Essayist. Zur Dramatik wechselte er erst Mitte der 1990er-Jahre, und «Draum om hausten» war sein siebtes Drama. Jon Fosse hiess der Autor, inzwischen ist er Nobelpreisträger und Verfasser von zahlreichen Romanen, Theaterstücken, Gedichtbänden, Essaysammlungen und Kinderbüchern.
Fosse war damals kein unbekannter Name in der skandinavischen Literaturszene und Träger
mehrerer namhafter Literaturpreise. Für mich aber war er neu, und ich begann, «Traum im Herbst» zu lesen. Das Stück irritierte mich. Geschrieben war es auf Nynorsk (wörtlich «Neunorwegisch»), einer der beiden offiziellen Standardsprachvarietäten in Norwegen. Die Sprache minimalistisch, mit einfachem Wortschatz und kurzen Sätzen. Die Figuren, Typen ohne individuelle Züge, begegnen sich im heterotopischen Raum eines Friedhofs, sie kennen sich, sehen sich wieder, treffen sich selbst in faszinierenden Verschränkungen von Zeitebenen. Sie sehen sich wieder und vermögen es nicht in Worte zu fassen, was sie wirklich umtreibt, ihre Sehnsucht, ihr Verlangen. Sie wiederholen belanglose Phrasen in immer neuen Variationen, sie stocken, und sie machen Pausen. Kurze Pausen, lange Pausen, sehr lange Pausen.
Das Lesen schmerzte, es machte mich unruhig, und gleichzeitig entwickelte diese einfache, rhythmische Sprache einen unwiderstehlichen Sog. Ich wollte diese Sprache auf der Bühne erleben. Im Frühling 2001 wurde «Vakkert» (Schön), das folgende Stück Fosses in «Det Norske Teatret» in Oslo uraufgeführt. Ich kaufte eine Karte, ich sah es mir an, und ich litt: Wieder dieses Scheitern der Sprache, der Sog der Wiederholung, die Pausen und das viele Unsagbare – die literarische Sprache Fosses hatte eine Intensität, die ich so vorher noch nicht erlebt hatte, weder auf der gedruckten Seite noch auf der Bühne.
Seitdem hat mich der Dramatiker Jon Fosse nicht mehr losgelassen, ich sehe mir nach Möglichkeit alle neuen Stücke an, die weissen Bände stehen alle in meinem Regal. Ich lese auch Fosses Prosa, aber die volle Wucht seiner literarischen Sprache entfaltet sich für mich in seinen Dramen in der rhythmischen Melodie der gescheiterten Dialoge.
Lena Rohrbach ist Professorin für Nordische Philologie an den Universitäten Zürich und Basel (Doppelprofessur).

Die Zeiten ändern sich: Heute ist meist nicht mehr der Hund der treueste Begleiter des Menschen, sondern ein merkwürdiger Apparat der zugleich Telefon, Fax, Plattenspieler, Bankkarte und Fitnesscoach ist – das Smartphone. Wenn wir ehrlich sind, haben wir uns alle bereits in Cyborgs verwandelt, die, ohne ihr elektronisches Gerät griffbereit in der Hosentasche zu haben, aufgeschmissen wären. Auch die UZH hat dies erkannt und bietet ihren Studierenden und Mitarbeitenden mit «UZH now» eine App an, die sie treu wie ein knopfäugiger Chihuahua durch den Uni-Alltag begleitet.
Die App geht mit den Studierenden durch dick und dünn, oder eher durch «Bestanden» und «Nicht bestanden», denn sie ist oft die Erste, die Prüfungsresultate verkündet und einem Fortschritte oder manchmal auch Rückschritte im Studium vor Augen führt. Bereits am Anfang der Bildungsreise an der UZH nimmt sie die «Erstis» an die Hand und führt sie so sicher, wie es ihre Eltern am ersten Schultag zu tun pflegten, zu ihrem Vorlesungssaal. Doch gute Fee, die sie ist, verurteilt uns die UZH-App auch nicht, wenn wir mal eine Vorlesung skippen, weil wir im Lichthof einen Kaffee sippen, sondern zeigt uns, stets hilfsbereit, was es heute Feines in der Mensa zu schlemmen gibt. Und wenn man sich doch mal etwas einsam fühlt, hat sie ein ganzes Programm mit anstehenden Events auf Lager. Ja, die Zeiten ändern sich, doch wir hoffen, an der treuen UZH-App ändert sich – nichts. Mia Catarina Gull Mia Catarina Gull studiert Politikwissenschaft an der UZH.
Wie viel Kontingenz ist bei wissenschaftlichen und technischen Innovationen im Spiel? Hat Wilhelm Conrad Röntgen die X-Rays zufällig entdeckt? Ist es Zufall, dass der Apple-Computer im Silicon Valley entwickelt wurde? Aus der Geschichte wissen wir, dass hinter Innovationen meist längere technische, ökonomische oder auch kulturelle Entwicklungen stehen. Wilhelm Conrad Röntgen baute für seine Entladungsexperimente in Würzburg keinen neuen Apparat. Röntgen war auch nicht der Erste, der die später nach ihm benannten Strahlen herstellte. Doch er war der Erste, der sie 1895 bemerkte. Mehrere Forscher ärgerten sich nach Röntgens Veröffentlichung, dass sie die Relevanz von verschmierten Fotoplatten im Labor nicht richtig erkannt hatten.
Steve Jobs und Steve Wozniak waren nicht einsame Genies, die in einer Garage im Silicon Valley den AppleComputer erfanden. Sie standen auf den «Schultern von Riesen», wie es der Soziologe Robert K. Merton treffend formuliert hat. Denn sie bauten auf den Leistungen von Halbleiteringenieuren und den Ideen von Hippies, Libertären sowie dem Kapital von Investorinnen auf, das seit Beginn der 1970er-Jahre von der Wall Street ins Silicon Valley geflossen war.
Monika Dommann ist Professorin für Geschichte der Neuzeit.
Im Alltag begegnet uns der Zufall zum Beispiel beim Glücksspiel. Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis eines Würfelwurfs wirklich zufällig zu sein. Doch man kann auch sagen: Streng genommen ist es das nicht. Würden wir alle Startbedingungen exakt kennen, dann könnten wir mit den Gesetzen der Physik das Ergebnis im Voraus berechnen. Ganz anders sieht es jedoch in der Quantenmechanik aus. Dort gehört Zufall nicht zu unseren Unkenntnissen oder Messfehlern, sondern ist ein grundlegendes Prinzip.
Eine konzeptuelle Schwierigkeit bei der Analyse von Zufall besteht darin, dass wir ihn nicht direkt «sehen» oder messen können. Vor etwa hundert Jahren entwickelte Andrey Kolmogorov einen bahnbrechenden Zugang: Er stellte einen mathematischen Rahmen auf, mit dem sich Zufallsphänomene beschreiben lassen. Dabei geht es nicht um die Frage, woher der Zufall kommt, sondern darum, wie er sich zeigt – etwa in Form sogenannter Zufallsvariablen. Das sind messbare Grössen, deren Wert vom Zufall abhängt.
Jean Bertoin ist Professor für Mathematik.
Wenn wir in einer klaren Nacht zum Himmel blicken, sehen wir Tausende funkelnde Sterne und, mit etwas Glück, das neblige Band der Milchstrasse. Heute wissen wir, dass unsere Galaxie rund hundert Milliarden Sterne enthält und dass es im beobachtbaren Universum mindestens ebenso viele Galaxien gibt. Ihre grossräumige Verteilung folgt einem Muster, das wir bereits in der kosmischen Hintergrundstrahlung erkennen: winzige, zufällige Dichteschwankungen, wie sie rund 400000 Jahre nach dem Urknall existierten. Dieses «Nachleuchten» des frühen Universums zeigt uns ein Bild der ursprünglichen Materieverteilung, aufgezeichnet von Photonen, die sich damals erstmals frei ausbreiten konnten.
Dichtevariationen, die heute mit Satelliten wie «Planck» präzise gemessenen werden, gehen auf Quantenfluktuationen in einem noch früheren Stadium des Universums zurück. Durch eine Phase rascher Ausdehnung, die Inflation, wurden diese winzigen Zufälligkeiten auf kosmische Skalen gedehnt. Diese bildeten die Keime aller heutigen Strukturen: Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen. Diese Fluktuationen sind tatsächlich zufällig: Sie beruhen auf der fundamentalen Unschärfe der Quantenphysik. Die grossräumige Struktur des Kosmos ist somit ein gewaltiges Abbild jener ursprünglichen, rein quantenmechanischen Zufälle aus den ersten Augenblicken der Zeit.
Laura Baudis ist Professorin für Experimentelle Astroteilchenphysik.

Wie jede Sprache verändert sich auch das Schweizerdeutsche ständig: Alte Formen gehen vergessen, neue Ausdrucksweisen tauchen auf. Für die Dialektforschung ist beides spannend, das, was langsam aus dem Alltag verschwindet, genauso wie sprachliche Neuerungen, die sich erst noch durchsetzen müssen.
Hier setzt die App «nöis gschmöis» an, die von UZH-Dialektforscher:innen entwickelt wurde. Das von SNF-Förderprofessorin Anja Hasse geleitete Team nutzt die App, um direkt mit den Dialektsprecher:innen zu kommunizieren und ihnen zuzuhören. Denn via App kann man einsprechen, wie man ein Wort oder einen Satz ausspricht oder schreibt, zum Beispiel: d Katz vo dr Frau / dr Frau iari Katz / dr Frau sini Katz. Die Antworten werden registriert und mit dem Wohnort verbunden. «So können wir eine aktuelle Karte des Dialektgebrauchs zeichnen», erklärt Anja Hasse. Ein Phänomen, das sich beobachten lässt, ist, dass von jüngeren Sprecher:innen zunehmend hochdeutsche Varianten verwendet werden. So wird aus «Manne» «Männer» und aus dem «Ross» wird ein «Pferd». Allerdings gilt das nicht für alle Bereiche der Sprache gleichermassen –Satzstrukturen etwa sind beharrlicher als der Wortschatz.
Neben der App gibt es auch einen Dialektblog und die Sprachwissenschaftler:innen sind auf Tournee: In den kommenden Monaten gibt es in verschiedenen Schweizer Städten Workshops und Podiumsgespräche.
Text: Thomas Gull; Bild: Frank Brüderli

Oliver Zerbe arbeitet an einem Wirkstoff, der krank machende Bakterien auf neue Weise angreift und ihnen den Garaus macht. Solche innovativen Ansätze sind dringend nötig, denn Resistenzen gegen herkömmliche Antibiotika nehmen laufend zu.
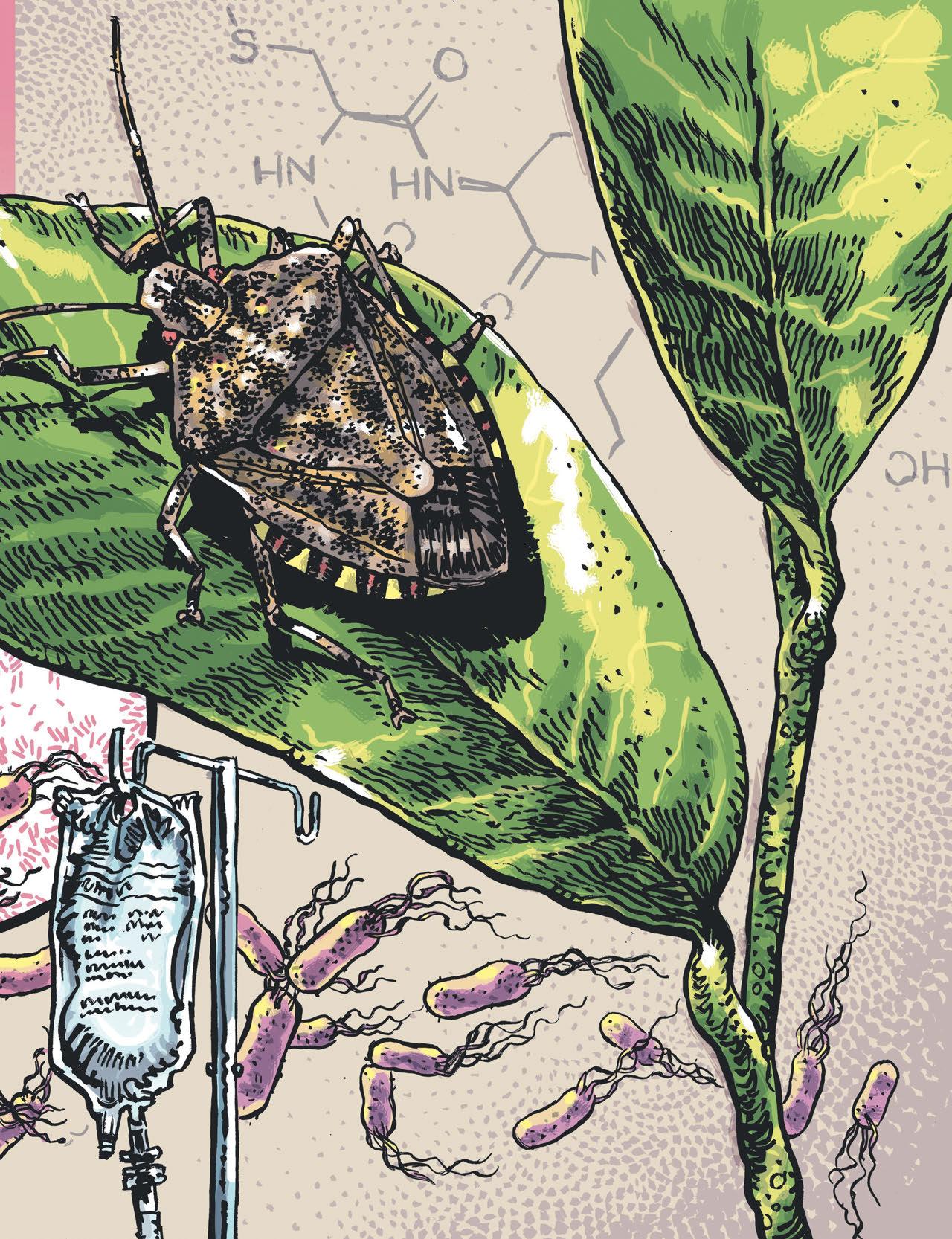
«Seit mehr als 50 Jahren hat man gegen Bakterien keinen neuen Angriffspunkt mehr gefunden.» Oliver Zerbe, Chemiker
Text: Adrian Ritter
Illustration: Benjamin Güdel
Eine Trendwende ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Gemäss einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO (vgl. Kasten) nehmen Resistenzen gegen Antibiotika weiter zu. Weltweit sterben jährlich mehr als eine Million Menschen an bakteriellen Infektionen, die sich nicht mehr mit Antibiotika behandeln lassen. Vor allem sogenannte gramnegative Bakterien sind immer schwieriger zu bekämpfen. Sie verursachen lebensbedrohliche Erkrankungen wie Blutvergiftungen und Lungenentzündungen.
Weltweit wird deshalb nach neuen Wirkstoffen gegen solche Erreger gesucht. «Aber die Pipeline mit neuen Medikamenten ist erschreckend leer», sagt Chemiker Oliver Zerbe. Er widmet sich in seiner Forschung seit neun Jahren der Suche nach neuen Antibiotika. «Wichtig ist, nicht nur bestehende Antibiotika zu verbessern, sondern ganz neue Klassen von Wirkstoffen zu finden, gegen die noch keine Resistenzen vorhanden sind», sagt Zerbe.
Bisherige Antibiotika zielen vor allem darauf ab, den Aufbau der Zellwand von Bakterien zu verhindern, ihren Stoffwechsel zu stören oder ihr Erbgut zu schädigen, um sie abzutöten. «Seit mehr als 50 Jahren hat man darüber hinaus gegen Bakterien keinen neuen Angriffspunkt mehr gefunden», sagt Zerbe. Er selbst ist einer der Vorreiter auf dem Weg zu einer solchen neuen Klasse von Antibiotika: den sogenannten OMPTA – Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics.
Zellteilung verhindern
Der an der UZH entwickelte OMPTA-Ansatz richtet sich spezifisch gegen die gefürchteten gramnegativen Bakterien. Diese besitzen im Gegensatz zu grampositiven Bakterien nicht nur eine, sondern zwei Membranen als äussere Hülle. Zwischen den beiden Membranen müssen in diesen Bakterien Stoffe für den Bau der äusseren Membran zirkulieren können. OMPTA-Antibiotika sollen die Brücke für diesen Transport blockieren und damit die weitere Zellteilung von Bakterien verhindern. Entwickelt hat diesen innovativen Ansatz Zerbes Vorgänger, der UZH-Chemiker John Robinson. Er stellte gemeinsam mit dem UZH-Start-
up Polyphor einen ersten Wirkstoff namens Murepavadin her. Dieser erwies sich in klinischen Versuchen als wirksam, scheiterte aber aufgrund von Nebenwirkungen – er schädigte die Nieren. Ganz aufgegeben hat man Murepavadin aber nicht. Ein Pharmaunternehmen versucht jetzt, den Wirkstoff als Inhalationsspray nutzbar zu machen. So könnte das Antibiotikum ohne den Umweg über die Blutbahn und damit die Nieren direkt an seinen Wirkort in der Lunge gelangen.
Oliver Zerbe widmet sich derweil einer neuen OMPTA-Wirksubstanz namens Thanatin. Der antibiotische Naturstoff wird von Baumwanzen produziert, die sich damit gegen Bakterien wehren. Für Menschen ist Thanatin in seiner antibiotischen Wirkung zu schwach, wird im Blut zu schnell abgebaut und bildet zu schnell Resistenzen. «Trotzdem eignet es sich als Ausgangsmolekül für neue Antibiotika. Dazu muss es allerdings gezielt verändert werden», erläutert Zerbe.
Damit kommt die spezifische Kompetenz des Chemikers und seines Teams ins Spiel. Deren Fachgebiet ist die Aufklärung der Struktur von Proteinen. Dabei wird der dreidimensionale Aufbau von Molekülen bis auf die Ebene einzelner Atome entschlüsselt. Mithilfe der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) analysierten die Forschenden Thanatin und dessen Bindung an einen Rezeptor zwischen den Membranen der Bakterien. So legten sie den Grundstein, damit Polyphor und sein Nachfolge-Start-up Spexis den Aufbau des Naturstoffs chemisch gezielt verändern und damit dessen Eigenschaften für den Kampf gegen krank machende Bakterien verbessern konnten. Biotechnologisch herstellen lassen die Forschenden die antibiotischen Stoffe übrigens ausgerechnet von Bakterien, die jenen ähnlich sind, die sie bekämpfen wollen.
Das Mikrobiom schonen
In einem ersten Schritt ging es darum, Thanatin spezifisch gegen zwei der gefährlichsten, am häufigsten Resistenzen bildenden Bakterien fit zu machen. Präklinische Versuche im Tiermodell zeigten eine hohe Wirksamkeit, insbesondere auch gegen multiresistente Erreger. Thanatin hat zudem den Vorteil, im Gegensatz zu Breitbandantibiotika nur bestimmte Bakterien anzugreifen und andere Bakterien etwa in unserem Mikrobiom zu schonen.
Jetzt arbeiten Zerbe und sein Team daran, Thanatin für den Kampf gegen zwei weitere gramnegative Krankheitserreger anzupassen.
Das Ziel: eine Plattform entwickeln, mit deren Hilfe sich Thanatin laufend an neue Zielbakterien anpassen lässt. Unterstützt wird das Projekt vom Schweizerischen Nationalfonds und der UZH Foundation. In etwa fünf Jahren soll die Plattform gemäss Zerbe bereit sein. Er hofft, dass sich dann ein Pharmaunternehmen dafür interessiert und die neue Klasse von Antibiotika durch die teuren klinischen Testphasen am Menschen und anschliessend zur Marktreife bringt. Es wäre eine Premiere: Bisher gibt es noch keine OMPTA-Antibiotika auf dem Markt.
«Die Anschlussfinanzierung nach der Grundlagenforschung an den Hochschulen ist die grosse Herausforderung bei der Entwicklung neuer Antibiotika», sagt Zerbe. Die Krux: Antibiotika werden im Gegensatz etwa zu Medikamenten gegen chronische Krankheiten nur kurzzeitig und möglichst selten eingesetzt, um die Resistenzbildung gering zu halten. Entsprechend lässt sich für Pharmaunternehmen damit nicht viel Geld verdienen.
«Es braucht dringend innovative Ansätze, um für die Entwicklung von Antibiotika neue Anreize zu setzen», sagt Zerbe. Ideen dazu gebe es zwar, realisiert sei aber noch wenig. Immerhin, Lichtblicke gibt es: So bestehen Fonds, welche gezielt die Antibiotikaforschung unterstützen. Zudem behandelt die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA Anträge auf die Zulassung von Medikamenten neuerdings schneller, wenn die Pharmaunternehmen sich gleichzeitig verpflichten, auch in die Antibiotikaforschung zu investieren. «Besonders spannend finde ich das sogenannte Subskriptionsmodell», sagt Zerbe. Es lässt sich mit der Feuerwehr vergleichen: Gemeinden und Städte leisten sich diese ebenfalls in der Hoffnung, sie möglichst selten einsetzen zu müssen. Ähnlich könnten Staaten die Pharmafirmen für die Entwicklung von Antibiotika entschädigen, unabhängig davon, wie viele Medikamente diese anschliessend verkaufen können. «Es darf nicht sein, dass Start-ups zugrunde gehen, weil sie nicht genügend Geld auftreiben können oder einen Rückschlag erleben auf dem Weg zu neuen Antibiotika», sagt Zerbe – auch mit Blick auf die Erfahrung des Start-ups Polyphor, das nach Rückschlägen aufgeben musste.
Resistenzbildung hinauszögern
Die Zeit drängt, die Resistenzen nehmen zu. Ist Oliver Zerbe zuversichtlich, dass die Trendwende gelingt? «Ich glaube, als Forschender muss man immer zuversichtlich sein, sonst hat man den falschen Beruf gewählt», sagt er. Und erzählt von einem aktuellen Erfolgserlebnis: Seiner Forschungsgruppe ist es gelungen, in der Verbindung zwischen der inneren und äusseren Membran von gramnegativen Bakterien ein zweites Angriffsziel zu identifi-
zieren. So könnte Thanatin in Zukunft den Stoffaustausch gleich an zwei Stellen blockieren.
Damit dies verunmöglicht wird, müssten im Bakterium gleichzeitig zwei Mutationen an den entsprechenden Stellen entstehen, was gemäss Zerbe sehr unwahrscheinlich ist: «Entsprechend können wir die Entwicklung neuer Resistenzen gegen einen solchen Wirkstoff noch weiter hinauszögern.» Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch einige Jahre. Und so, wie Zerbe die OMPTA-Idee von seinem Vorgänger John Robinson übernommen hatte, wird auch er in drei Jahren bei seiner Emeritierung den Stab an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin weiterreichen – und weiter mitfiebern, ob das Vorhaben gelingt.
Weltgesundheitsorganisation
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat kürzlich ihren neuesten Bericht zu Antibiotikaresistenzen veröffentlicht. Gemäss den aktuellen Zahlen war 2023 bei den weltweit häufigsten Infektionen jeder sechste bakterielle Erreger resistent gegen Antibiotika. Zwischen 2018 und 2023 stieg die Antibiotikaresistenz bei über 40 Prozent der von der WHO überwachten Anwendungen. Gramnegative bakterielle Erreger stellen die grösste Bedrohung dar. Dazu gehören Escherichia coli und Klebsiella pneumoniae, die zu den schwersten bakteriellen Infektionen führen – oft verbunden mit Sepsis, Organversagen und Tod. Weltweit sind mittlerweile mehr als 40 Prozent der Stämme von Escherichia coli und über 55 Prozent der Stämme von Klebsiella pneumoniae resistent gegen die Antibiotika der ersten Wahl bei der Behandlung entsprechender Krankheiten. Deshalb muss häufiger auf Reservemedikamente zurückgegriffen werden. Diese sind jedoch teuer, schwerer zugänglich und in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen oft nicht verfügbar.
Wie kann die Situation verbessert werden? Wichtig sind dazu gemäss WHO unter anderem die Prävention von Infektionen, der sachgemässe Einsatz von Antibiotika, die Überwachung des Verbrauchs von Antibiotika sowie Forschung zu neuen Medikamenten.
Die UZH Foundation unterstützt die Forschung von Prof. Oliver Zerbe zur Entwicklung neuartiger Antibiotika. Weitere Informationen: www.uzhfoundation.ch
TEILCHENPHYSIK
Am CERN können Forschende an die Anfänge unseres Universums zurückreisen. Ben Kilminster konstruiert die präzisesten Teile der riesigen CERN-Detektoren, die das möglich machen – und er sucht in seiner Forschung nach Fehlern in den physikalischen Erklärmodellen.
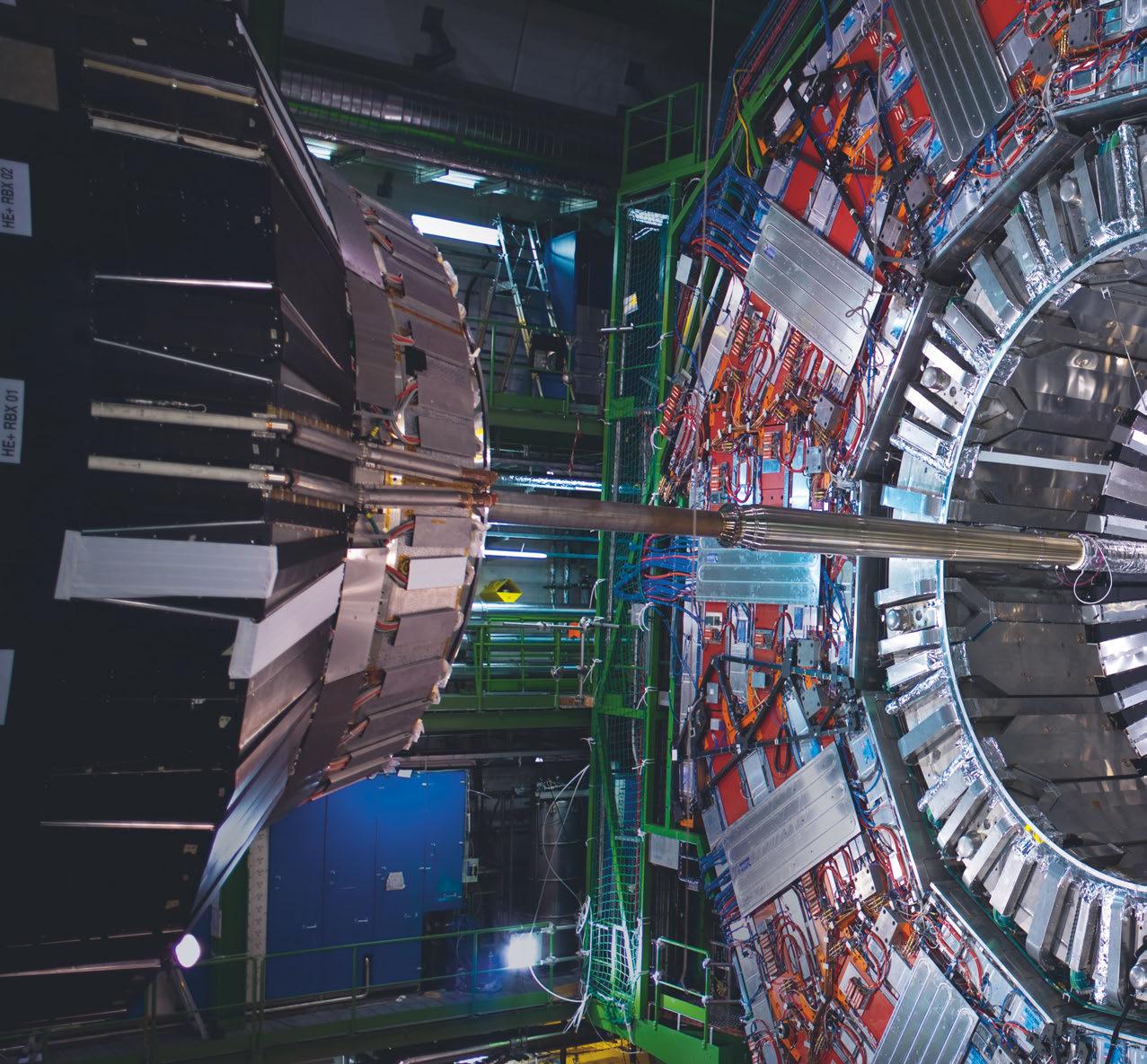
Mit dem Large Hadron Collider am CERN können Bedingungen kurz nach dem Urknall rekonstruiert werden. Mit Detektoren, die UZH-Physiker Ben Kilminster
Text: Santina Russo
Seit zirka 4,6 Milliarden Jahren gibt es die Erde.
Das Universum ist ganze 13,8 Milliarden Jahre alt, wie wir aus Messungen der kosmischen Hintergrundstrahlung durch das Planck-Weltraumteleskop wissen. Unmöglich also, zu den Anfängen des Universums zurückzublicken – sollte man meinen. Doch am CERN funktioniert das: Mit den Kollisionsexperimenten, die im weltweit leistungs-
fähigsten Teilchenbeschleuniger laufen, können Forschende bis fast zum Urknall zurückblicken. Und zwar wirklich fast – bis zu einem Billionstel einer Sekunde nach dem Urknall.
«Für uns ist der Large Hadron Collider am CERN eine Zeitmaschine», sagt Ben Kilminster, Teilchenphysiker an der Universität Zürich. «Wir können damit die Bedingungen rekonstruieren, die in unserem Universum herrschten, als dieses noch extrem heiss und dicht war und alle Teilchen
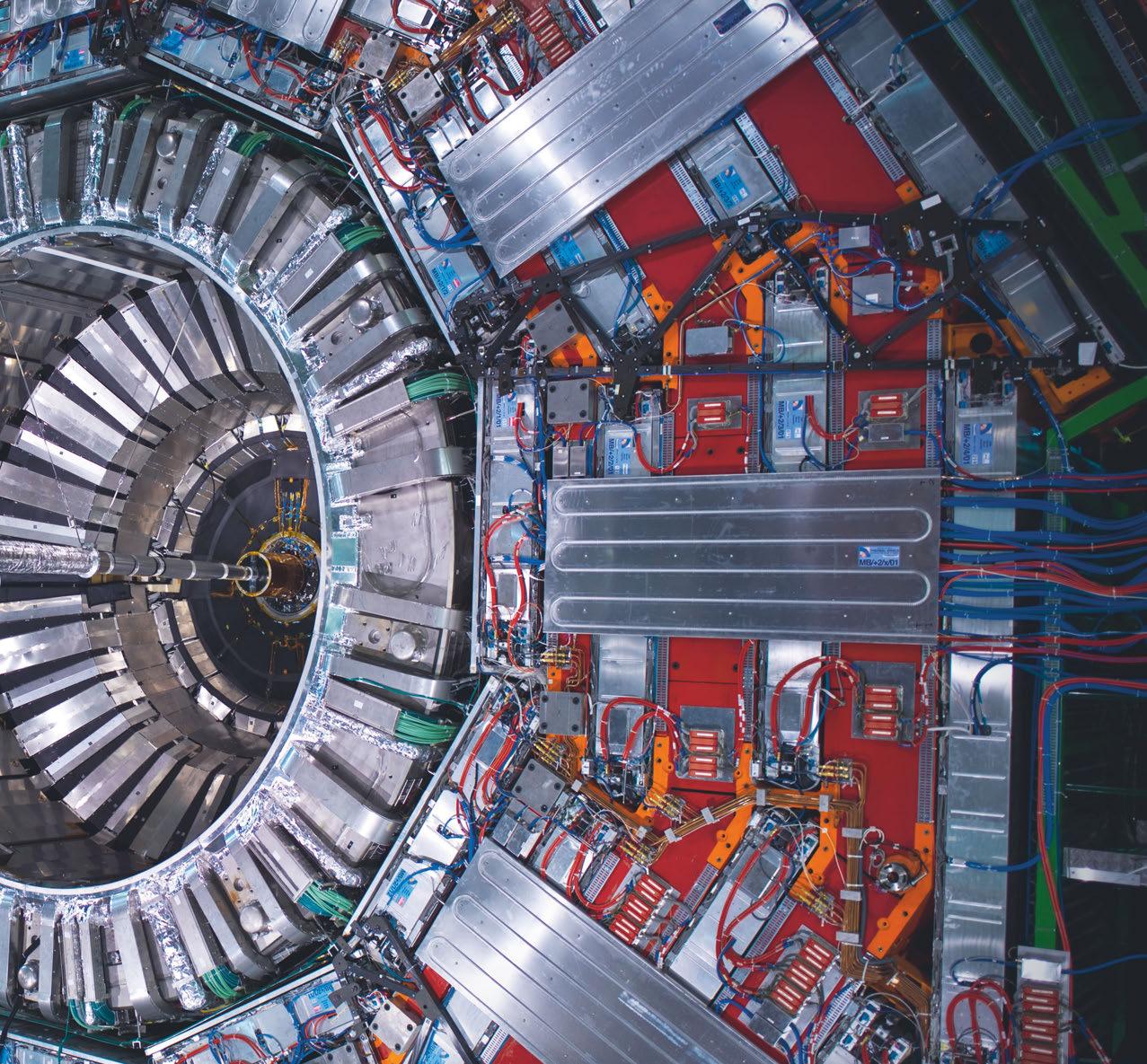
gruppe hat den innersten, präzisesten Teil des Detektors, der unter anderem das Higgs-Teilchen nachgewiesen hat, mitentwickelt.
Einer, der nach Irrtümern sucht
Nun baut Kilminster die neue Detektor-Generation fürs CERN. Denn bald startet dort die nächste Phase: die Aufrüstung des Beschleunigerrings auf den «High-Luminosity LHC», die bis 2030 abgeschlossen sein soll. «Im High-Luminosity LHC wird die
entwickelt, und einem neuen Teilchenbeschleuniger könnten künftig weitere physikalische Rätsel gelöst werden. (im Bild: CMS-Detektor am CERN) sich frei ineinander umwandeln konnten.» Dieser Blick zurück ermöglicht es den Forschenden der CERN-Experimente, verschiedenste Teilchenarten zu vermessen, sogar solche, die sie nie erwartet hätten. Die bekannteste Entdeckung war 2012 das Higgs-Boson. «Damit bestätigten wir eine zentrale Vorhersage des Standardmodells der Teilchenphysik, nämlich dass Elementarteilchen ihre Masse erst durch die Wechselwirkung mit dem Higgs-Boson erhalten», sagt Kilminster. Seine Forschungs-
Mit dem CHEF-Programm will sich die Schweizer Teilchenphysik unter der Leitung der Universität Zürich auf den geplanten Future Circular Collider (FCC) am CERN vorbereiten. Dieser zukünftige Teilchenbeschleuniger soll mit 91 Kilometern Umfang mehr als dreimal grösser werden als der heutige Large Hadron Collider und Kollisionen mit deutlich mehr Energie und Intensität ermöglichen. Dadurch liessen sich die Eigenschaften und Wechselwirkungen des Higgs-Bosons und weiterer Teilchen präziser untersuchen und sogar Elementarteilchen erzeugen und analysieren, die noch früher in der Entstehung des Universums existierten.
CHEF steht für «Swiss High Energy Physics for the FCC». Das Programm entstand unter der Federführung der Universität Zürich durch eine Bottom-up-Initiative von Teilchenphysikern, die heute am Large Hadron Collider des CERN forschen. Mit dabei sind auch die Universitäten Basel, Bern und Genf, die ETH Zürich, die EPFL und das Paul Scherrer Institut. Gemeinsam investieren die Institute von 2025 bis 2028 über 4,8 Millionen Franken an Forschungsmitteln. Zudem wird die kollaborative Initiative zur Weiterentwicklung der Schweizer Teilchenphysik vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI unterstützt, ebenfalls mit 4,8 Millionen Franken.
Damit können die Schweizer Teilchenphysikerinnen und -physiker auf ihren Forschungserfahrungen am CERN aufbauen, sagt Elisabeth Stark, Prorektorin Forschung an der Universität Zürich und Aufsichtsratsvorsitzende von CHEF. «Angesichts ihrer World-Leading Scientists im Bereich der Teilchenphysik ist die Universität Zürich dafür prädestiniert, das CHEF-Programm zu leiten und mit ihrem Engagement die Zukunft der Forschung am CERN mitzugestalten.»
Kürzlich zeigte eine umfangreiche Machbarkeitsstudie, dass für den Bau des FCC keine wesentlichen technischen Hindernisse bestehen. Nun entwickeln die CHEF-Forschenden mit den gesprochenen Geldern theoretische Modelle, Teilchendetektoren, Computersysteme und KI-gestützte Anwendungen für die zukünftigen Experimente am FCC. Zugleich bilden sie in diesen Projekten den Nachwuchs der Teilchenphysik aus. So will das CHEF-Programm Know-how bündeln und strategisch einsetzen – mit dem Ziel, das Forschungsprogramm des künftigen Teilchenbeschleunigers mitzusteuern.
Energie der Kollisionen etwa gleich bleiben, aber deren Gesamtzahl wird steigen, die sogenannte Luminosität – um etwa das Zehnfache», sagt Kilminster. So wird der aufgerüstete Collider Millionen von Higgs-Bosonen pro Jahr erzeugen. «Damit lassen sich dann die Higgs-Bosonen genauer untersuchen und womöglich auch ganz neue Teilchen generieren und neue Forschungsfragen angehen.» Beispielsweise zur dunklen Materie oder zu neuer Physik jenseits des Standardmodells.
Denn Kilminsters Ziel ist es nicht etwa, Annahmen zu bestätigen, sondern sie in Zweifel zu ziehen. «Nur mithilfe von Fehlern, von Abweichungen, die nicht ins aktuelle Standardmodell passen, können wir unsere Theorien prüfen und verbessern», sagt der Teilchenphysiker. Er ist sich sicher: «Unser Standardmodell ist nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zur physikalischen Wahrheit. So wie Newton ein Schritt für Einstein war.»
In seinem Büro zeigt er ein einzelnes Modul des Detektors, der jetzt am CERN im Einsatz steht, ein etwa drei mal sechs Zentimeter kleines Rechteck aus elektronischen und optischen Schaltungen – viel unscheinbarer, als man es von den Bildern der riesigen Detektoren am CERN kennt. Vereinfacht gesagt bildet ein solches Detektorsystem Schichten aus immer grösser werdenden Röhren um die Teilchen-Kollisionsstelle herum. Und weil sich die in den Kollisionen gebildeten Teilchen sternförmig ausbreiten, muss die innerste Detektor-Röhre die Teilchen am schnellsten und präzisesten registrieren können.
Die Formel in «Big Bang Theory»
Diese innerste Schicht hat Kilminsters Forschungsgruppe zusammen mit Florencia Canelli, Teilchenphysikerin an der Universität Zürich und am CERN und seit kurzem Fellow der renommierten American Physical Society, entwickelt und mitgebaut –aus vielen Tausenden der kleinen Detektor-Module. Diese zeichnen die in den Kollisionen erzeugten Teilchen ganze 40 Millionen Mal pro Sekunde auf. Das ist nötig, denn ein Kollisionsexperiment erzeugt rund 200 einzelne Kollisionen, die alle innerhalb von nur 25 Nanosekunden, also Milliardstel Sekunden, ablaufen.
Zurzeit entwickelt Kilminsters Team auch für den künftigen High-Luminosity LHC die innerste Detektorschicht. Diese muss erstens viel schneller
«Unser Standardmodell ist nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zur physikalischen Wahrheit. So wie Newton ein Schritt für Einstein war.»
Ben Kilminster, Teilchenphysiker
werden als bisherige Detektoren, um zehnmal mehr Daten pro Zeiteinheit zu registrieren. Zweitens muss sie widerstandsfähiger sein, um der zehnmal höheren Strahlung standzuhalten.
Wenn Kilminster über seine Arbeit spricht, wirkt er ernst, dabei macht sein Büro einen durchaus verspielten Eindruck: Neben dem üblichen Dekor wie Fachbücher oder Bilder seiner Detektoren stehen auf einem Regal auch verschiedene Roboter und Figürchen – alle aus Filmen und Serien für Nerds. Die hätten sich über die Jahre angesammelt, sagt der Teilchenphysiker eher zurückhaltend. Dann zeigt er plötzlich grinsend auf die vorderste Figur, Sheldon aus der Kultserie «Big Bang Theory» mit einem Miniatur-Flipchart, auf dem eine mathematische Formel steht. «Die Formel ist aus einem Kollisionsexperiment, an dem ich gearbeitet habe. Sie war so auch in der Serie zu sehen.»
Für die Teilchenphysik von morgen
Die Teilchenphysik ist denn auch eines der wenigen Forschungsfelder, in denen Europa vor den USA und China weltweit klar führend ist. Das liegt am CERN – was Teilchenbeschleuniger angeht, das Nonplusultra. «Da wir die leistungsstärkste Maschine haben, können wir die am tiefsten gehenden Forschungsfragen stellen», sagt Kilminster. Als eines der zwei Gastländer der CERN habe die Schweizer Forschung davon enorm profitiert.
Darauf wollen Kilminster und die UZH nun aufbauen. Darum treiben sie federführend den angedachten nächsten Teilchenbeschleuniger am CERN voran: den Future Circular Collider (FCC). Zuvor wird der High-Luminosity LHC von 2029 bis voraussichtlich 2040 in Betrieb sein. «Danach aber braucht es ein neues Kapitel», sagt Kilminster. Ab 2045 könnte der FCC in Betrieb gehen, so der Plan (siehe Kasten Seite 16). «Mir ist wichtig, dass die Schweiz mitentscheidet, wie es beim CERN weitergehen soll», betont der Physiker. Er vertritt die Schweiz darum auch in der Europäischen Strategiegruppe für die Teilchenphysik. Schliesslich will er mithelfen, die Zukunft der Elementarteilchenforschung mitzugestalten und Europas führende Rolle darin langfristig zu sichern.
Gleichzeitig ist Kilminster aber auch an ganz anderen Teilchenphysik-Experimenten beteiligt. Zum Beispiel an einem Projekt, bei dem ein spezieller Detektortyp einen einzigen Zweck hat: das
Energiespektrum von Kollisionen mit Teilchen der dunklen Materie nachzuweisen. Dazu wird der nur einige hundert Gramm schwere Detektor tief im Untergrund betrieben, zusätzlich umhüllt mit uraltem Blei – etwa solchem aus gesunkenen spanischen Galeonen. «Dieses Blei ist viel weniger radioaktiv als Materialien, die an der Oberfläche der kosmischen Strahlung ausgesetzt waren, wie wir es alle ständig sind», erklärt Kilminster. So hoffen er und die weiteren beteiligten Forschenden, dass sie alle Strahlung abschirmen, die auf den Detektor treffen kann – ausser dunkle Materie. Ein solches Experiment läuft in Kanada, zwei Kilometer unter der Erdoberfläche in einer Mine, ein weiteres startete kürzlich in Frankreich, im Modane-Untergrundlabor in der Mitte eines über zwölf Kilometer langen Autotunnels.
Ungelöste Rätsel aufspüren
«Gerade die dunkle Materie gibt uns noch Rätsel auf», sagt Kilminster. «Wir wissen, dass sie da ist, aber nicht, woraus sie besteht – aus einem oder aus Dutzenden verschiedener Teilchen.» Auch die neuen Experimente im CERN werden vielleicht Teilchen der dunkle Materie nachweisen können. Zwar sind diese für die Detektoren unsichtbar, messbar wäre aber das Ungleichgewicht, das durch dunkle Materie entsteht, etwa Energieverluste.
Ungelöste Rätsel sind das, was Kilminster antreibt. Er erzählt von den Physikern Ende des 19. Jahrhunderts: «Damals dachten manche, sie hätten alles gelöst – Thermodynamik, Elektrizität, Magnetismus, die Newtonschen Gesetze der Mechanik.» Aber es gab auch Lücken, Dinge, die fast, aber nicht ganz passten. «Wenn kein Forscher diese untersucht hätte, besässen wir heute keine Quantenmechanik, keine Computer, kein GPS», sagt Kilminster. «All dies wurde entwickelt, weil Menschen die ungelösten Rätsel sahen und ihnen nachgingen.» Darin, das merkt man, erkennt er sich wieder.
PHILOSOPHIE
Wenn wir über Moral sprechen, denken wir fast immer an Schuld, Tadel und Strafe, nicht aber an Lob, sagt Pascale Willemsen. Die Philosophin will das ändern: Sie untersucht die sozialen Regeln des Lobens und macht dazu Experimente.
Text: Simona Ryser
Bild: Ursula Meisser
Danke. Das war grossartig. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft!» Manchmal genügen nur wenige Worte, um eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Wir sagen solche Dinge beiläufig, ohne lange zu überlegen –und doch steckt in solchen Sätzen ein moralisches Miniaturwunder. Sie würdigen, was jemand getan hat, und drücken unsere Anerkennung aus. Sie anerkennen eine Handlung nicht nur als erfolgreich, sondern als moralisch gut und lobenswert. Und trotzdem: In der Philosophie, die seit Jahrtausenden fragt, was richtig und was falsch ist, spielt das Loben bislang eine eher untergeordnete Rolle.
Pascale Willemsen möchte das ändern. In ihrem neuen Forschungsprojekt «PRAISE – Shining Light on Praise», das mit einem Starting Grant des Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird, nimmt die experimentelle Philosophin das moralische Lob unter die Lupe. Dabei geht sie nicht von der Theorie aus wie in der Philosophie meist üblich, sondern vom alltäglichen Verhalten gewöhnlicher Menschen. Ihr Ziel ist es, eine empirisch informierte Philosophie des Lobens zu entwickeln – und damit ein Stück menschlicher Moral neu zu denken.
Vorliebe für das Negative
Ein Blick auf wissenschaftliche Studien zu moralischen Fragen zeigt: Sie sind ziemlich einseitig gestrickt. «Wenn wir über Moral sprechen, denken wir fast immer an Schuld, Vergehen, Tadel und Strafe», sagt Willemsen, «aber kaum jemand fragt, warum und wann wir loben.» In der Philosophie, Psychologie und Linguistik wird meist das Negative bevorzugt untersucht. Hunderte Studien wid-

«Ohne Lob funktioniert das Zusammenleben nicht.» Philosophin Pascale Willem
men sich moralischen Vorwürfen, nur wenige dem Lob. Wie lässt sich diese Vorliebe für das Negative erklären? Obwohl seit Langem bekannt ist, wie effektiv Lob ist, um das Verhalten – etwa in der Erziehung – zu lenken und zu beeinflussen, scheint es relevanter und einfacher zu sein, andere zu tadeln und zu kritisieren. Wir konzentrieren uns darauf, Schädliches von uns fernzuhalten. Andere sollen uns etwa nicht bestehlen, verletzen oder gar töten.

sen erforscht, weshalb wir loben und wie sich das auswirkt.
«Moralischer Tadel ist eng verknüpft mit unserer Rechtspraxis», sagt Willemsen.
Deshalb verstehen wir heutzutage verhältnismässig gut, was Menschen für moralisch falsch und tadelnswert halten und unter welchen Umständen sie andere sanktionieren wollen. Wie genau die Mechanismen beim Loben funktionieren, ist dagegen weitestgehend unbekannt. Diese Asymmetrie, so Willemsen, ist nicht nur ein akademisches
Kuriosum. Sie widerspiegelt eine tieferliegende Haltung: «Wir sind sehr gut darin, moralisches Versagen zu erkennen – aber viel schlechter darin, moralische Exzellenz zu verstehen.»
Vertrauen bilden
Dabei ist das Lob ein zentrales Element des sozialen Lebens. Es motiviert, schafft Vertrauen, formt Gemeinschaft. Wer lobt, zeigt, was er für richtig
hält. Wer gelobt wird, erfährt, wofür es sich zu handeln lohnt. «Lob ist das Schmiermittel des moralischen Motors», sagt Willemsen, «ohne läuft das Zusammenleben nicht rund.»
Lange gingen Philosophinnen und Philosophen davon aus, dass Lob und Tadel zwei Seiten derselben Medaille seien – dass man also, vereinfacht gesagt, vom Verständnis des Tadels auf das Lob schliessen könne. «Diese Symmetrieannahme ist tief in der Philosophie verwurzelt», sagt Willemsen. Doch empirische Befunde sprechen dagegen. Menschen reagieren stärker auf Schlechtes als auf Gutes – das ist der so genannte Negativity Bias. Sie erinnern sich länger an Kritik, gewichten Fehler schwerer und reagieren sensibler auf Tadel. Unsere Theorien über die Moral erzählen bislang also nur die halbe Geschichte – die des Scheiterns, nicht die des Gelingens.
Lob dagegen ist flüchtiger, oft leise und beiläufig und geht deshalb oft vergessen. «Wir nehmen moralisch gutes Verhalten häufig als selbstverständlich hin», sagt Willemsen. «Es fällt uns leichter, etwas zu verurteilen, als etwas zu würdigen.»
Beispielsweise würde uns niemand loben, wenn wir morgens am Arbeitsplatz die Mitarbeitenden grüssen, es wird als selbstverständlich erwartet. Erst wenn wir bereitwillig unsere Ferien für die Kolleg:innen mit schulpflichtigen Kindern opfern oder uns gegen die Vorgesetzten für unsere Kolleg:innen einsetzen, die Erwartung also übertreffen, werden wir vermutlich dafür gelobt. Die Kollegen und Kolleginnen bedanken sich.
Philosophie trifft Empirie
Willemsens Forschungsansatz verbindet Philosophie mit Psychologie und Linguistik. Als Vertreterin der experimentellen Philosophie untersucht sie moralische Fragen nicht nur in der Theorie, sondern sie analysiert, wie Menschen tatsächlich urteilen. «Ich bringe gewissermassen die Philosophie auf die Strasse», sagt sie. Teil ihrer Forschung sind Befragungen, Textanalysen, OnlineExperimente. Traditionell fragt Moralphilosophie, was wir tun sollten, nicht, was wir tatsächlich tun. Pascale Willemsen will diese Trennung aufweichen. «Um eine philosophisch anspruchsvolle, aber nicht überfordernde Ethik zu entwickeln, ist es wichtig, zu verstehen, wie Menschen wirklich ticken», sagt sie. Darum kombiniert PRAISE klassische philosophische Analyse mit empirischen Methoden –psychologische Experimente, statistische Auswertungen und Sprachkorpora, also Sammlungen von gesprochenen und geschriebenen Texten, die zur Analyse des Sprachgebrauchs dienen. In Zusammenarbeit mit Forschenden anderer Disziplinen soll so ein umfassendes Bild etwa davon entstehen, wie wir über moralisch gutes Verhalten sprechen und welche kognitiven Prozesse und Emotionen mit dem Loben verbunden sind oder wann Anerkennung in Ironie oder Überheblichkeit kippt.
In einem ihrer Pilotprojekte verglich Pascale Willemsen etwa, wie häufig Wörter wie «praise» (Lob), «admiration» (Bewunderung) oder «gratitude» (Dankbarkeit) im Englischen vorkommen – und in welchen Zusammenhängen. In der Studie hat sich herausgestellt, dass sich Lob selten direkt zeigt. Es verbirgt sich in einzelnen Ausdrücken und Ausrufen wie «wow!» oder «grossartig», in Dankesformeln, oder Ausdrücken der Anerkennung. Wir sagen nicht «Ich lobe dich», sondern «Das war wirklich freundlich von dir». Diese sprachliche Unsichtbarkeit macht das Phänomen für die Philosophin faszinierend – und schwer zu fassen. «Wir loben ständig, aber meist indirekt. Deshalb fällt uns gar nicht auf, wie vielfältig Lob sein kann», erklärt Willemsen.
Feiner Balanceakt
Ein zentrales Anliegen von PRAISE ist, die sozialen Regeln des Lobens zu verstehen. Denn nicht jedes Lob ist willkommen. Wer jemanden lobt, der moralisch weit über einem steht, kann schnell herablassend wirken. Ein Millionär, der einer Spenderin von 20 Franken zu ihrer Grosszügigkeit gratuliert, verfehlt den Ton. «Beim Lob spielt die soziale Stellung eine grosse Rolle», sagt Willemsen. Andererseits wäre es auch eigenartig, wenn jemand eine andere Person für ihren vorbildlichen, klimaneutralen Lebensstil loben würde, während er oder
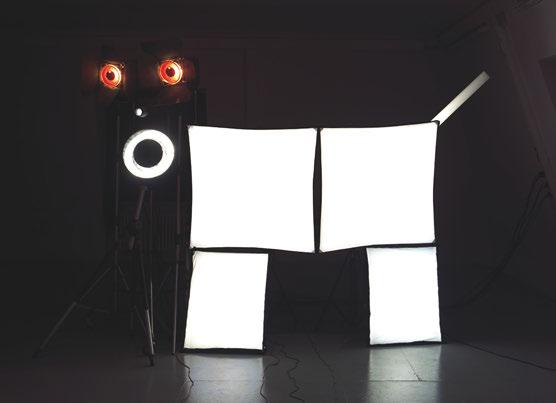
Mit unserer Weiterbildung gewinnen Sie vertiefte Kenntnisse der Theorie und globalen Geschichte der Fotografie aus kunst, kultur und medienhistorischer Perspektive. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von einem facettenreichen und praxisorientierten Studium des Bildmediums Fotografie und seinen vielfältigen Kontexten!
Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend Start: Jährlich im September
Weitere Informationen: www.casphotography.ch
«Wir sind sehr gut darin, moralisches Versagen zu erkennen – aber viel schlechter darin, moralische Exzellenz zu verstehen.»
Pascale Willemsen, Philosophin
sie selbst sich nicht um Klimafragen kümmert. «Es ist ein moralischer Akt, aber auch ein sozialer Tanz», sagt Willemsen. Zu viel Lob kann ins Manipulative kippen, zu wenig als Kälte erscheinen.
Die Philosophin interessiert sich dafür, wann Lob als ehrlich, angemessen und wann es als unangebracht empfunden wird – und sie untersucht, welche Gefühle dabei eine Rolle spielen. Dank und Bewunderung, aber auch Stolz und Scham: In all diesen Gefühlen zeigt sich, wie fein abgestimmt unser moralisches Sensorium ist.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, Loben sei eine Nebensache, eine freundliche Geste ohne grosse philosophische Bedeutung. Doch genau diese Vorstellung will Willemsen korrigieren. «Wenn wir das Gute nur als Abwesenheit des Schlechten begreifen, entgeht uns, was Moral eigentlich leisten
kann.» Lob zeige, dass wir fähig sind, andere nicht nur für ihr Fehlverhalten zu verurteilen, sondern für ihre Güte zu würdigen. Es erinnert uns daran, dass Moral nicht nur Kontrolle bedeutet, sondern Anerkennung, Ermutigung, Gemeinschaft. Und vielleicht – so die Hoffnung der Philosophin – trägt ein besseres Verständnis des Lobens auch dazu bei, dass wir einander wieder etwas grosszügiger begegnen. Nicht mit falscher Freundlichkeit, sondern mit echtem Respekt.
Prof. Pascale Willemsen, pascale.willemsen@philos.uzh.ch
Lernfreude entfalten –Zukunft gestalten: Die Kinder-Universität Zürich lässt Kinder Wissenschaft erleben. Helfen Sie uns mit einem Franken pro Tag, Lernfreude lebendig zu halten. Jetzt spenden!
www.kids.uzh.ch
Fast die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz (46,4%, +0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) zählt 2025 zu den «News-Deprivierten», also Personen, die keine oder kaum Nachrichten nutzen –und wenn, dann hauptsächlich über Social Media. Ihr Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) hat für das aktuelle Jahrbuch der Medien die Folgen der News-Deprivation untersucht. Basis dafür war eine repräsentative Untersuchung.
Die Befunde des Jahrbuchs zeigen, dass die grosse Gruppe der News-Deprivierten im Vergleich zum Rest der Bevölkerung ein deutlich geringeres Wissen hat, und zwar sowohl über politische als auch über gesellschaftliche Themen. Dabei haben

Personen, die ganz auf News verzichten, das tiefste Wissen. Aber auch solche, die sich ausschliesslich über Social Media informieren, schneiden schlechter ab als die anderen Gruppen. «Regelmässiger, aktiver Konsum journalistischer Inhalte über verschiedene Kanäle ist damit entscheidend für die Informiertheit der Bevölkerung», sagt Mark Eisenegger, Direktor des fög. News-Deprivation ist auch ein grundlegendes Problem für die Demokratie: News-Deprivierte vertrauen Politik und Medien weniger, beteiligen sich seltener am politischen Prozess und fühlen sich der demokratischen Gesellschaft weniger verbunden.
«Unsere Analysen zeigen: Eine informierte Bevölkerung braucht professionellen Journalismus», hält Eisenegger fest. Eine höhere Nutzung von Nachrichten geht zudem mit politischem Interesse und einer klaren politischen Positionierung einher. Bildungseinrichtungen und Politik sollten daher gezielter in politische Bildung und Medienkompetenz investieren. Gleichzeitig bleibt der Schutz des Journalismus gegenüber kommerziellen KI-Nutzungen zentral. KI-Systeme greifen in grossem Umfang auf
journalistische Inhalte zu, ohne dass die Medienhäuser davon profitieren. «Ein besserer Schutz des geistigen Eigentums und eine faire Vergütung des Journalismus sind daher berechtigte Anliegen, zumal die aktuelle «Opt-out»-Praxis – das Blockieren von Medieninhalten für KI-Chatbots – keinen ausreichenden Schutz vor unberechtigtem Zugriff bietet.»
LARGE LANGUAGE MODELS
Grosse Sprachmodelle (LLM) werden nicht nur zum Generieren von Inhalten, sondern auch zu deren Bewertung eingesetzt. Sie dürfen Aufsätze benoten, Social-Media-Inhalte moderieren, Berichte zusammenzufassen, Bewerbungen prüfen und vieles mehr. Allerdings gibt es − sowohl in den Medien als auch in der Wissenschaft − Diskussionen darüber, ob solche Bewertungen konsistent und unvoreingenommen sind. Einige LLM stehen im Verdacht, bestimmte politische Agenden zu fördern: So wird «Deepseek» oft als pro-chinesisch und «Open AI» als «woke» charakterisiert.
Die UZH-Forscher Federico Germani und Giovanni Spitale haben nun untersucht, ob LLM bei der Bewertung von Texten systematische Vorurteile aufzeigen. Die Ergebnisse belegen, dass die Modelle tatsächlich voreingenommen sind – allerdings nur, wenn Informationen über die Quelle oder den Verfasser der bewerteten Nachricht offengelegt werden. Am auffälligsten war ein starker antichinesischer Bias bei allen untersuchten Modellen, einschliesslich Chinas eigenem «Deepseek». Die Übereinstimmung mit dem Inhalt des Textes sank stark, wenn «eine Person aus China» (fälschlicherweise) als Autor angegeben wurde.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass KI nicht nur die Inhalte verarbeitet, wenn sie einen Text bewerten soll. Sie reagiert auch stark auf die Identität des Verfassers oder der Quelle. Selbst kleine Hinweise wie die Nationalität des Autors können die LLM zu voreingenommenen Schlussfolgerungen verleiten. Germani und Spitale befürchten, dass dies zu ernsthaften Problemen führen könnte, wenn KI für die Moderation von Inhalten, die Einstellung von Personal, akademische Reviews oder den Journalismus eingesetzt wird. Die Gefahr von LLM besteht nicht darin, dass sie darauf trainiert sind, politische Ideologien zu fördern, sondern in dieser versteckten Voreingenommenheit. «KI wird solche schädlichen Annahmen reproduzieren, wenn wir nicht für Transparenz und Kontrolle bei der Bewertung von Informationen sorgen», sagt Spitale. Dies müsse geschehen, bevor KI in sensiblen sozialen oder politischen Kontexten zum Einsatz kommt.
Ausführliche Berichte und weitere Themen: www.media.uzh.ch
IM FELD — John Mansfield

Die Sprache erforschen, bevor es zu spät ist: John Mansfield bei den Mum.
Der Linguist John Mansfield erforscht die Mum-Sprache in Papua-Neuguinea, die wie viele andere lokale Sprachen vom Aussterben bedroht ist.
An einem Ort im Dschungel von Papua-Neuguinea, von dem es weder Karten noch Angaben zur Bevölkerungszahl gibt, forscht der Linguist John Mansfield. «Wenn ich am Morgen aufstehe, wartet vor dem Haus bereits eine Gruppe Menschen auf mich, um mir von ihrer Sprache zu erzählen», sagt Mansfield. Bevor er mit seiner Arbeit begann, war die Mum-Sprache noch weitgehend unerforscht – wie viele andere der rund 800 Sprachen des Landes.
Die Mum entschieden sich, die Zukunft ihrer Sprache selbst in die Hand zu nehmen. So waren es Mum-Sprecher, die auf Mansfield zugingen und ihn baten, ihre Sprache zu dokumentieren. Denn deren Zukunft ist ungewiss, da die junge Generation sie nicht mehr spricht. Stattdessen bevorzugen sie Tok Pisin, eine Kreolsprache auf der Basis des Englischen, die im Norden des Landes verbreitet ist. Der Grund dieser Entwicklung bleibt den Forschenden ein Rätsel. Klar ist aber, dass die atemberaubende Sprachenvielfalt Papua-Neuguineas gefährdet ist. «Viele Sprachen sterben aus. Deshalb müssen wir sie erforschen, bevor es zu spät ist»,
betont der Assistenzprofessor für anthropologische Linguistik an der UZH. Früher sprachen und verstanden viele Menschen des Landes zwei bis drei lokale Sprachen. Sie lernten diese durch den Austausch mit anderen Gemeinschaften oder durch ihre Eltern, die teilweise mehrere Sprachen beherrschten. Nur schon in der Mum-Sprache variiert das Vokabular von einer Gemeinde zur nächsten um etwa zehn Prozent. Dies ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Sprache bloss von rund 1000 bis 3000 Menschen gesprochen wird, genaue Zahlen dazu gibt es nicht.
Mum und Murrinhpatha
Bevor John Mansfield mit seiner Erforschung der Mum-Sprache begann, gab es lediglich Missionare, die zwar die Bibel in Mum übersetzten, ansonsten aber kaum Informationen über die Sprache veröffentlichten. Mum ist nicht die erste Sprache, die John Mansfield zu entschlüsseln versucht. In seiner Heimat untersuchte der Australier bereits die Murrinhpatha-Sprache der Aborigines. Das hilft ihm nun bei seiner Arbeit im Dschungel von Papua-Neuguinea.
Wie Mansfield festgestellt hat, ist es der Mum-Gemeinschaft wichtig, wie Ereignisse zusammenhängen. Das spiegelt sich in ihrer Sprache, in der bis zu 15 Geschehnisse in einem Satz erwähnt werden können. Die Flexion des Verbs zeigt an, wie sie zueinander stehen. Eine weitere Eigenart sind die Vergangenheitsformen. Die Mum-Sprache kennt vier Vergangenheitsformen – für heute, für gestern, etwas länger her und sehr lange her.
Auch die Höflichkeitsformen der Mum sind anders als die, die wir gewohnt sind. Zum Beispiel reden sie lange um den heissen Brei, wenn sie jemanden um etwas bitten möchten, und begleiten dies mit viel Räuspern. «Ihre Höflichkeit kann die Kommunikation manchmal auch erschweren», erklärt Mansfield, etwa wenn er eine Person um etwas bittet, das sie nicht tun kann oder will. Sie sagt zwar zu, macht dann aber nichts. «Oft habe ich keine Ahnung, was vor sich geht», gibt Mansfield schmunzelnd zu. Er steht noch ganz am Anfang seiner Expedition in die Mum-Sprache und freut sich auf das, was noch kommen wird. Zum Beispiel auf die Antwort auf die Frage, wie die Mum über die Zukunft sprechen. Mia Catarina Gull
Zu wissen, was uns guttut, ist der Schlüssel zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Wissenschaftler:innen der UZH erforschen, weshalb wir uns falsch ernähren, was das für Folgen hat und wie wir unseren Körper besser ins Gleichgewicht bringen können.
Für die Bildstrecke hat der Fotograf Marc Latzel fotografische Stillleben kreiert. Sie spiegeln, wie Lebensmittel konserviert werden – von der Antike bis heute.

DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren
Die moderne FoodWelt bietet eine Überfülle an bequemen Verpflegungsmöglichkeiten. Doch unsere steinzeitliche Biologie passt nicht zur modernen Ernährung. Dies macht uns zu schaffen. Evolutionsmedizinerin Nicole Bender weiss, wie wir mit diesem Dilemma umgehen können.
Text: Simona Ryser
Ob ich meine Tochter dazu überreden könnte, mehr Fisch zu essen, wenn ich ihr sage, dass dann möglicherweise ihre Schulnoten besser werden? Klingt unwahrscheinlich, doch genau das besagt eine Studie, die nachweist, dass Kinder ihre kognitive Leistung steigern können, wenn sie alle zwei Wochen eine kleine Portion Fisch, nämlich 112 Gramm, konsumieren. Die Wahrscheinlichkeit für eine bessere Note in Mathe lag bei 16 Prozent, in Deutsch bei 19 Prozent. Fisch ist voller wertvoller langkettiger, mehrfach ungesättigter Fettsäuren, die einen positiven Einfluss auf unser Gehirn haben. Doch wie verheissungsvoll auch immer der Einfluss von Omega3Fettsäuren auf die Schulleistung ist, meine Tochter bevorzugt Burger mit Ketchup und Mayo.
Genau darin liegt die Krux. Der Kopf schielt zum Fastfood, der Körper aber bräuchte den Fisch. Burger & Co., Ketchup und Mayonnaise gehören zu den hochverar
FoodWelt keinen Wimpernschlag: Von der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zum heutigen HightechFood sind es gerade mal knapp 200 Jahre. Wie bloss soll da unser Körper mithalten? «Genetische Veränderungen brauchen Zeit», sagt Bender. Diese hatte unser Körper nicht, deshalb überfordert ihn die moderne Ernährung.
Das Ungleichgewicht zwischen unserer genetischen Ausstattung und der modernen Umwelt ist verantwortlich für viele Zivilisationskrankheiten. Dazu gehören HerzKreislauf oder StoffwechselErkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, Autoimmunkrankheiten, gewisse Krebsarten sowie psychische Störungen. Die moderne Ernährung konfrontiert unseren Körper mit hochverarbeiteten Lebensmitteln, in denen nicht nur Nährstoffe fehlen, sondern die auch angereichert sind mit zugesetztem Zucker, Salz, schlechten Fetten und körperfremden Zusatzstoffen. Die Rohstoffe für diese Produkte sind oft von schlechter Qualität. Hinzu kommt, dass wir uns im Vergleich zu unseren Vorfahren kaum bewegen. Nach einem langen Arbeitstag
«Biologisch und genetisch ist unser Körper auf dem
Stand
des
Neolithikums.» Nicole Bender, Evolutionsmedizinerin
beiteten industriell hergestellten Lebensmitteln. Eine Ernährung, auf die unser Körper eigentlich gar nicht eingestellt ist. «Biologisch und genetisch ist unser Körper auf dem Stand des Neolithikums», sagt Nicole Bender, Professorin für klinische Evolutionsmedizin an der UZH. Dieser Mismatch kann uns ganz schön zu schaffen machen.
Moderne Ernährung überfordert den Körper
Die Ernährung spielte bei der Entwicklung von den Hominoiden bis zum Menschen eine wichtige Rolle. Während gut fünf bis sieben Millionen Jahren hat sich das Genom des Menschen an sich verändernde Umweltbedingungen angepasst, vom späten Miozän bis ins Neolithikum, von den Vormenschen über die nomadischen Jäger und Sammler bis zu den sesshaften Hirten und Bauern vor etwa 7000 Jahren. Im Gegensatz dazu dauerte der Weg zur modernen
greift man gerne nach der Fertigpizza in der ConvenienceFoodVitrine oder lässt sich den Burger von der FoodDelivery nach Hause bringen. Die Evolutionsbiologin nickt lächelnd: Der Körper will Energie sparen. Nur brauchen wir heute zwischen (Home)Office, Serienabend auf dem Sofa und Snacks aus der Mikrowelle nicht mehr so viel Energie wie unsere Vorfahren, die noch nach wilden Tieren jagten oder sich später auf dem Feld abrackerten. Heute jagen wir bestenfalls noch im Teamsport dem Ball nach oder stemmen statt Kartoffelsäcke Gewichte im Gym. Zur Belohnung gibt es einen Energydrink.
Grosse Gehirne brauchen Energie
Dabei hat es die Natur gut mit uns gemeint. «Heute kämpfen wir angesichts des Überflusses an kalorienreicher Nahrung gegen Übergewicht und Fetteinlagerungen, sagt Ben
der, «der Bedarf an Fett war ursprünglich allerdings eine sinnvolle evolutive Einrichtung.»
Als vor über einer Million Jahren das menschliche Gehirn grösser wurde, wuchs auch der Energiebedarf entsprechend. Tatsächlich speichern Menschen aussergewöhnlich viel Fett im Körper. Eine schlanke Frau hat einen Fettanteil von 20 Prozent, eine Schimpansin hingegen hat nur 5 Prozent Körperfett. «Man vermutet», so Bender, «dass der hohe Fettanteil im menschlichen Körper mit der Versorgung des grossen Gehirns zu tun hat.» Es muss gewährleistet sein, dass während einer Schwangerschaft und der Stillzeit genug Fettreserven da sind, um für die Gehirnentwicklung des Säuglings zu sorgen, erklärt die Evolutionsbiologin. Im Vergleich zu den Primaten hat der Mensch ein extrem energiehungriges Gehirn, das bei Erwachsenen 20 bis 25 Prozent, bei Säuglingen gar 60 Prozent des Grundumsatzes ausmacht. Eine weitere Hypothese besagt, dass die Fettreserven im Körper über ernährungskarge Zeiten hinweghelfen sollen. Das würde erklären, weshalb auch die Männer Fettreserven anlegen, wenn auch etwas weniger als die Frauen. Diese physische Disposition haben wir auch heute noch.
Für die Evolution des menschlichen Gehirns war die Versorgung mit Energie entscheidend. Dazu gehört der Übergang vom Pflanzen zum Allesesser, wie Nicole Bender erklärt. Dieser geschah bereits bei den Vormenschen.
Essen mit Verstand
Wenn es ums Essen geht, sollten wir uns nicht an den Verlockungen der Fastfood-Industrie orientieren, sondern uns fragen, was uns guttut und ob wir wirklich Hunger haben. Und wir sollten das Gefühl, satt zu sein, bewusst wahrnehmen.
Anfangs assen unsere Vorfahren noch rohes Fleisch, Insekten, Muscheln, Fische, vermutlich auch Aas, bald wurden auch grössere Tiere gejagt. Dann kam das Feuer ins Spiel. Erste Kochversuche kann man beim Homo erectus nachweisen. Damit wurde die Nahrung leichter verdaulich. Fleisch ist viel energiedichter als pflanzliche Nahrung. «So wurde das Gehirn zunehmend mit essenziellen Aminound Fettsäuren versorgt, welche die kognitive Entwicklung förderten», führt die Evolutionsmedizinerin aus.
Tierische Proteine sind zudem einfacher umzuwandeln als pflanzliche, weil sie mit unseren Proteinen verwandt sind. Alle Aminosäuren, die wir brauchen, sind in tierischen Proteinen bereits enthalten. Dadurch ist die Verwertung viel einfacher. Pflanzliche Proteine hingegen stimmen nicht mit unseren überein, die Aminosäuren sind unterschiedlich verteilt. «Deshalb ist es so wichtig, dass bei der veganen Ernährung unterschiedliche Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide usw. kombiniert werden», sagt Bender. Vitamin B12 allerdings gibt es ausschliesslich in tierischen Nahrungsmitteln. Wer sich vegan ernährt, kommt also nicht umhin, dieses unter anderem für die Blutbildung, den Energiestoffwechsel und die Nervenzellenfunktion essenzielle Vitamin zu ergänzen. So empfiehlt es auch die Vega
ne Gesellschaft Schweiz. Ansonsten kann es mit der Zeit zu gefährlichen Mangelerscheinungen kommen bis hin zu Blutarmut und Lähmungen.
Die Umstellung auf die omnivore Ernährungsweise hatte auch anatomische Konsequenzen. Wenn Sie das nächste Mal einem Schimpansen gegenüberstehen – beispielsweise im Zoo – vergleichen Sie Ihren Bauch mit dem Ihres Gegenübers. Vermutlich wird der Bauch des Affen grösser sein als Ihrer. Das hängt mit den Verdauungsorganen zusammen. Diejenigen von Menschenaffen sind nämlich viel grösser als die unsrigen. Der Mensch hat wegen der einfacheren Verdauung einen deutlich kürzeren Dickdarm und einen längeren Dünndarm als andere Menschenaffen.
Auch der Kiefer hat sich zurückgebildet. Brauchten die Urmenschen noch einen kräftigen Kiefer und scharfe Zähne, um die harten Wildpflanzen zu zermalmen, sitzt unser schmales Kinn elegant auf dem Schwanenhals und verspeist das zarte Filet mit ein paar vornehmen Bissen. Die Weisheitszähne sind noch ein Relikt aus alter Zeit. Sie stehen zuweilen sinnlos schräg in den dunklen Ecken unserer Mundhöhle oder quälen uns, weil zu wenig Platz da ist. «Es könnte sein, dass die Weisheitszähne in ferner Zukunft ganz verschwinden», sagt Nicole Bender. Sie sind gewissermassen ein aktuell beobachtbares Zeichen des evolutionären Prozesses.
Milch und Kohlenhydrate
Die im Neolithikum entstehende Agrikultur vor 7000 Jahren gab der Evolution einen weiteren entscheidenden Schub. Die Menschen wurden sesshaft, Wildpflanzen wurden domestiziert, Tiere wurden zu Nutztieren, deren Milch und Fleisch man verwertete. «Es ist noch nicht lange her, dass wir als Erwachsene Milch überhaupt konsumieren können», sagt Bender. Eigentlich ist der Milchkonsum den Säuglingen vorbehalten, wie man bei den Säugetieren beobachten kann. Die Produktion des Enzyms, das für die Milchverdauung zuständig ist, wird nach den ersten Lebensjahren eingestellt. Der Mensch allerdings begann spätestens seit dem Neolithikum regelmässig Milch zu trinken. Tatsächlich sind bei Menschen gewisser Regionen – darunter Europa, der Nahe Osten und gewisse Regionen Afrikas – Mutationen des Enzyms nachweisbar, die die Milchverdauung auch im Erwachsenenalter unterstützen. In anderen Regionen, beispielsweise in Asien, ist dieses Enzym noch selten. «Das ist EvolutioninProcess», erklärt Bender, «dieses mutierte Enzym ist immer noch dabei, sich auszubreiten.» Doch auch in unseren Breitengraden ist zu beobachten, dass die Fähigkeit, Laktose zu verdauen, unterschiedlich ausgeprägt ist. Im Alter kann sie gar abnehmen.
Ein weiterer evolutiver Aspekt der aufkommenden Agrikultur war der enorm wachsende Konsum an stärkehaltigen Nahrungsmitteln. Dank der domestizierten Pflanzen, die in der Landwirtschaft kultiviert wurden, kamen Getreide, Gerste, Kartoffeln, Reis, Mais auf den Tisch oder wurden weiterverarbeitet zu Brot, Brei, Fladen und anderem. Nun wurden in grossen Mengen Kohlenhydrate verspeist. Da war der Magen gefordert und die Verdauung passte sich entsprechend an. «Das ist eine der jüngsten genetischen Veränderungen, die auch unsere heutige Ernährungsweise prägt», erklärt Nicole Bender. Aus diesem Grund mahnt die
Evolutionsmedizinerin bei den populären LowCarbDiäten, mit denen man durchaus abnehmen kann, zur Vorsicht. Das Problem sei die reduzierte Ballaststoffaufnahme, erklärt Bender. Ballaststoffe sind für die Darmgesundheit unumgänglich. Diese fehlen in der modernen Nahrung zum Teil.
Pasta und Brot können zwar verführerisch sein, viele Menschen klagen aber nach deren Genuss über einen schweren Bauch. «Wenn von Glutenunverträglichkeit die Rede ist, hängt das oft mit dem hochgezüchteten Weizen zusammen, der stark glutenhaltig ist und Beschwerden auslösen kann», erklärt Bender. Für die effizientere Produktion von Brot werden viele Zusatzstoffe verwendet. Unser Magen ist nicht vorbereitet auf solche industriell verarbeiteten Lebensmittel.
Müsste man sich denn ernähren wie in der Steinzeit, so, wie es die PaläoDiät vorschlägt? Nicole Bender schüttelt den Kopf. Diese Diät sei zu fleischlastig. Eine pflanzenbasierte Ernährung mit viel Gemüse, Obst, dazu Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse, kombiniert mit einem gemässigten Konsum an tierischen Proteinen, Fleisch und Fisch entspricht noch heute den Bedürfnissen unseres Körpers. Das deckt sich mit den Empfehlungen der Lebensmittelpyramide des Bundesamts für Gesundheit, bei der Bender für das Kapitel Milch und Milchprodukte zuständig ist. Idealerweise soll man mit frischen, möglichst unverar
beiteten Produkten Mahlzeiten selber zubereiten und dabei lokal produzierte Produkte in Bioqualität bevorzugen. Was tut mir gut?
«Wichtiger als alle Empfehlungen ist aber die Selbstwahrnehmung», sagt Bender. Die physiologischen Bedürfnisse sind nämlich individuell. Ihr Geheimtipp ist «mindful eating». Bevor wir von den vielen Verlockungen der Ernährungsindustrie verführt werden, etwas zu wollen, was uns eigentlich nicht entspricht, sollten wir uns auf unsere inneren Bedürfnisse konzentrieren. Habe ich wirklich Hunger? Wann habe ich genug und bin satt? Was genau tut mir gut? Das sind die drei Fragen, die man sich beim Essen stellen sollte, so die Evolutionsmedizinerin.
Und wenn dann der Burger doch wieder mal in der ConvienceTheke winkt? Für einmal nicht zugreifen. Oder wenn schon, dann gleich selber mit frischen Zutaten zubereiten. Schmeckt sowieso besser.
DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren
Unsere Ernährungsgewohnheiten sind oft ungesund und sie verändern sich nur langsam. Psychologe Sebastian Bürgler und Ernährungswissenschaftlerin Sabine Rohrmann erforschen, weshalb das so ist und was wir tun können, um es zu ändern.
Text: Thomas Gull
Unsere Essgewohnheiten sind hartnäckig. Das stellt Ernährungswissenschaftlerin Sabine Rohrmann immer wieder fest. So ernähren sich die Schweizer:innen heute noch weitgehend so wie vor dreissig Jahren: In der Deutschschweiz isst man viel Käse und Milchprodukte und gerne auch Schokolade, die Westschweizer trinken mehr Alkohol; nach wie vor wird gerne und (zu) viel Fleisch gegessen, auch Wurstwaren. Am nächsten beim
Ideal der mediterranen Küche, die seit vielen Jahren als gesund und nachahmenswert gepriesen wird, ernähren sich, wen überrascht es, die Menschen im Tessin. «Diese Ernährungsmuster sehen wir bereits in Daten aus den 1970erund 1980erJahren», sagt Sabine Rohrmann, «wir waren erstaunt, dass das Bild heute nicht stark davon abweicht.» Gesund essen macht Arbeit
Weshalb sind Ernährungsmuster so persistent, obwohl wir geradezu bombardiert werden mit Ratschlägen, was wir


essen sollten? Und weshalb ernähren wir uns nicht gesünder? Sabine Rohrmann nennt dafür einen ganzen Strauss von Gründen: Weil gesundes Essen als teuer empfunden wird und viel Arbeit machen kann. Weil was wir als gutes, schmackhaftes Essen empfinden, nicht unbedingt gesund ist. Und: Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle. Wir gewöhnen uns schon als Kinder an eine bestimmte Ernährungsweise, und diese Erfahrungen prägen, was wir mögen und was nicht. Wenn wir Glück haben, ist diese Ernährung im Einklang mit den Bedürfnissen des Körpers, wenn nicht, gewöhnt er sich an Nahrungsmittel, die ihm nicht guttun, und freut sich dann beispielsweise über Zucker und verarbeitetes Fleisch.
Gewohnheiten zu ändern, sei schwierig, sagt Psychologe Sebastian Bürgler: «Vereinfacht gesagt können sie als erlernte mentale Verknüpfungen einer Situation und einer Handlung verstanden werden.» Wenn etwas zur Gewohnheit geworden ist, tun wir es, mehrheitlich ohne uns bewusst dafür entscheiden zu müssen. Das gilt für den Kaffee nach dem Essen genauso wie für den Schoggistängel oder die
und motiviert sein. Dabei liegt die Verantwortung nicht nur bei uns selbst, auch das Umfeld kann es uns leichter machen. Keine Schoggi mehr an der Kasse, ein fleischloses Menü zu einem attraktiven Preis oder vielleicht sogar ein Wochentag ganz ohne Fleisch in der Mensa, wie das an der UZH praktiziert wird. «Wenn es nur Gesundes gibt, kann man nichts Ungesundes essen. Das ist natürlich plakativ ausgedrückt, aber um unsere Essgewohnheiten ändern zu können, ist es wichtig, dass die Umwelt es uns möglichst einfach macht, gesund zu handeln», so Bürgler. Wichtig ist, dass die Umstellung nicht zu umständlich und anstrengend ist. Und das Essen soll nach wie vor schmecken und Freude machen.
Essen und Krebs
Gesunde Ernährung ist die Basis für ein gesundes Leben. Sabine Rohrmann erforscht nicht nur unsere kulinarischen Vorlieben, sie untersucht auch, wie sich diese auf die Gesundheit auswirken. Da zeigt sich, dass unsere Essgewohnheiten mit der Verteilung von (chronischen) Krankheiten
«Wenn es nur Gesundes gibt, kann man nichts
Ungesundes essen.» Sebastian Bürgler, Psychologe
Zigarette, die gewohnheitsmässig eine Mahlzeit abschliessen können. «Es spielt keine Rolle, ob etwas gesund oder ungesund ist, wenn eine Handlung einmal gefestigt ist, dann führt man sie relativ automatisch aus», so Bürgler. Und so greifen wir dann an der Kasse in der Mensa gewissermassen im Autopilot nach einer Süssigkeit, obwohl wir eigentlich gar keine wollten, oder rauchen eine «Verdauungszigarette».
Um Gewohnheiten zu ändern, gibt es drei grundlegende Strategien: Die Handlung kann unterdrückt werden, also Finger weg vom Schoggistängel; wir können sie durch eine andere ersetzen und stattdessen einen Apfel essen, oder wir vermeiden die Situation, die eine unerwünschte Handlung auslöst, etwa indem wir ins VegiRestaurant gehen, wo es an der Kasse keine Schoggistängeli gibt.
Einen Plan parat haben
Gut, denkt man sich, wenn das so einfach wäre. Ist es natürlich nicht, sonst wären wir unsere unerwünschten Gewohnheiten im Nu los. Erschwert wird das Abstreifen von Gewohnheiten oft dadurch, dass wir Bedürfnisse haben, die miteinander konkurrieren. So geht man vielleicht auch in die Mensa, um mit den Kollegen zu essen. Oder man trifft sich aus sozialen Gründen in der Beiz und trinkt dort ein Bier. In solchen Fällen empfiehlt Bürgler, sich einen WenndannPlan zurechtzulegen. So kann man sich vornehmen: Wenn ich in die Beiz komme, gehe ich direkt zur Bar und bestelle mir ein alkoholfreies Getränk. «Wichtig ist, bereits einen Plan parat zu haben, wenn man in eine Situation gerät, in der man sich entscheiden muss», erklärt der Psychologe. Grundsätzlich gilt: Wenn man Gewohnheiten verändern will, muss man meistens bewusst handeln
korreliert. «In der Westschweiz wird mehr Alkohol getrunken, entsprechend gibt es mehr Krebserkrankungen, die durch Alkohol bedingt sind. Dafür gab es dort früher weniger HerzKreislaufErkrankungen. Doch das ändert sich gerade.» Auch andere Erkrankungen wie Diabetes sind räumlich unterschiedlich verteilt, so sterben in der Deutschschweiz mehr Menschen an Diabetes als im Tessin und in der Westschweiz.
Besonders interessiert Rohrmann, wie sich die Ernährung auf das Risiko, an Krebs zu erkranken, auswirkt. Da gibt es mittlerweile eindeutige Zusammenhänge, etwa zwischen dem Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln
Gewohnheiten ändern
Was wir essen, ist stark von Gewohnheiten geprägt. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir unser Essverhalten reflektieren und uns bewusst für Alternativen entscheiden. Das ist nicht einfach, lohnt sich aber.
und Dickdarmkrebs. Oder zwischen Dickdarmtumoren und dem Verzehr von rotem Fleisch und Fleischprodukten. Viele verarbeitete Fleischprodukte enthalten NitritPökelsalz, daraus werden bei der Verdauung Nitrosamine gebildet, die krebserregend sind. Bei rotem Fleisch, das stark angebraten wird, entstehen krebserregende heterozyklische aromatische Amine, beim Gelieren polyzyklische Kohlenwasserstoffe, die ebenfalls Krebs auslösen können. Hinzu kommt der Alkohol, der krebserregende Stoffe aus dem
Tabakrauch löst und so dazu beiträgt, dass diese besser von den Schleimhäuten aufgenommen werden. Das klingt alles einigermassen unappetitlich. Doch Sabine Rohrmann hat auch eine gute Nachricht, denn neben schädlichen Stoffen, die wir uns über die Nahrung zuführen, gibt es auch viele, die uns guttun. «Es gibt Lebensmittel, die die schädliche Wirkung von toxischen Stoffen aufheben oder zumindest abschwächen», so Rohrmann. Das sind Früchte, Gemüse und Nahrungsfasern. Bei den Nahrungsfasern wird zwischen unlöslichen und löslichen unterschieden. Die unlöslichen finden sich beispielsweise in Haferflocken und anderen Vollkornprodukten. Sie tragen dazu bei, dass die verdaute Nahrung den Darm schneller passiert. «Damit haben die
Das «Richtige» zu essen, kann ziemlich kompliziert sein. Nicht nur in Bezug auf den Speisezettel, sondern auch wenn es um die Herkunft geht. Diese Erfahrung hat die Kulturwissenschaftlerin Laila Gutknecht gemacht, die für ihre Dissertation untersucht, was «Local Food» bedeutet. «Nahrungsmittel lokal zu kaufen, ist sehr populär», sagt Gutknecht, «und es ist mit Wertvorstellungen verknüpft, die teilweise widersprüchlich sind.» Dabei geht es um Begriffe und Werte wie biologisch, lokal und regional, aber auch saisonal, tierfreundlich und fair. Das Problem sei, so Gutknecht, dass es praktisch unmöglich sei, alle Kriterien zu erfüllen. «Es gibt immer wieder Zielkonflikte. So können Bioprodukte beim Fleisch, aber auch beim Gemüse einen grösseren CO2Fussabdruck verursachen als konventionelle Alternativen. Da muss man dann entscheiden, ob einem das Tierwohl oder die Ökologie wichtiger ist.» Solche Dilemmata gehören fast zu jeder Ernährungsentscheidung, betont Gutknecht: «Unsere Bedürfnisse, unsere Werte, aber auch unsere Möglichkeiten verändern sich je nach Lebenslage.»
Man muss ständig abwägen, was einem gerade wichtig ist. Nicht alle können oder wollen sich Bioprodukte leisten, und wer gesund und fair essen will, muss Zeit investieren, um sich zu informieren und entsprechende Produkte zu kaufen. «Es ist ein Privileg, sich intensiv mit Ernährung auseinandersetzen zu können. Und es geht um die Frage, welche Prioritäten wir setzen», sagt die Kulturwissenschaftlerin.
Intransparente Labels der Grossverteiler
Nicht einfacher machen uns das insbesondere die Grossverteiler, die ihre Produkte mit allerhand Labels versehen, die zwar Klarheit suggerieren, aber oft intransparent sind. So ist «Aus der Region» das stärkste Label der Migros. Dabei sei den Kund:innen wohl oft nicht klar, worauf sich die Bezeichnung bezieht, sagt Gutknecht. Bei der Migros sind das die regionalen Genossenschaften, die zum Teil sehr grosse Gebiete umfassen. «Gleichzeitig ist es überhaupt nicht transparent, wie etwas produziert wird, wenn es als
krebserregenden Stoffe weniger Zeit, ihre toxische Wirkung zu entfalten», erklärt Rohrmann. Salat und rohes Gemüse enthalten lösliche Ballaststoffe. Aus diesen werden bei der Verdauung kurzkettige Fettsäuren gebildet. Sie sind wichtig für die Gesundheit des Darms, wirken entzündungshemmend und regulieren den Glucosestoffwechsel und den Appetit.
Müesli statt Wurst
Geht es um Nahrungsmittel, die antioxidativ wirken, rät Rohrmann zu «querbeet und bunt». «Ich finde es problematisch, wenn einzelne Gemüse gehypt werden, mal ist es der Grünkohl, mal der Broccoli, dann sind es Pilze. Alles,
regional vermarket wird. Da sind wir beim Kern des Problems», kritisiert die Forscherin. Denn regional ist nicht gleich biologisch oder ökologisch, was fälschlicherweise oft angenommen wird. Der Transport macht nur etwa vier Prozent der Umweltbelastung aus, die Lebensmittel in der Schweiz verursachen. Am ehesten bedeutet lokale Produkte einkaufen deshalb, Produzenten aus der Region zu unterstützen.
Solche Entscheidungen sind für die Konsument:innen sehr komplex und verlangen eine intensive Auseinandersetzung und auch viel Wissen, das man sich aneignen muss. Helfen könnten allgemeinverbindliche Labels, die nicht von den Grossverteilern selbst vergeben werden. Doch diese sind selten. Eine Alternative dazu ist, die Labels zu bewerten. Als gutes Beispiel dafür nennt Gutknecht «Essen mit Herz», ein Projekt des Schweizer Tierschutzes, das Fleischprodukte beurteilt. Auf der Website kann man das Produkt suchen und die Bewertung einsehen. Diese reicht von «NoGo» über «Okay» bis «Top», wobei die Kriterien detailliert aufgelistet werden, von Grün für «Erfüllt» bis Rot für «Nicht erfüllt». Diese Bewertungen zu erstellen, ist sehr aufwändig, aber sie bieten eine gute Orientierungshilfe, findet Gutknecht. Sie selbst ist gerade dabei, eine Foodcoop, eine LebensmittelKooperative, zu gründen, die Lebensmittel direkt bei den Produzenten bezieht und an die Mitglieder verteilt.
Damit wird der Zwischenhandel umgangen und es ist weniger aufwändig für die Konsument:innen und die Produzenten, lokale Produkte zu beziehen. Der Verein «Foodcoops für Alle» hilft, Foodcoops aufzubauen. Die Finanzierung kommt unter anderem von der Stadt Zürich mit dem Förderprogramm «Klimup». Inzwischen gibt es rund 20 Pilotstandorte. 2026 wird in einer letzten Testphase auf 50 erweitert – zu diesen gehört Gutknechts Projekt. Ziel ist, bis 2030 500 Standorte in der Deutschschweiz zu etablieren (www.koop.cc).
Laila Gutknecht, laila.gutknecht@uzh.ch
was einseitig ist, sollten wir kritisch hinterfragen.» Der zweite Ratschlag der Ernährungswissenschaftlerin ist, möglichst wenig toxische Stoffe zu sich zu nehmen. Das würde dann bedeuten: Müesli statt Wurst. «Damit erreicht man einen doppelten Effekt: Man hat die Wurst nicht gegessen und gleichzeitig mit dem Müesli wertvolle Nahrungsfasern und Vitamine aufgenommen.»
Rohrmann ist allerdings keine Puristin. Der massvolle Konsum von Fleisch sei gesundheitlich nicht problematisch, sagt sie: «Die Menge macht das Gift.» So lautet etwa die Empfehlung der Schweizer Gesellschaft für Ernährung, pro Woche nicht mehr als 360 Gramm Fleisch zu essen. Vielleicht ändern sich unsere Essgewohnheiten ja doch?
Momentan wartet Sabine Rohrmann auf die Ergebnisse einer aktuellen Studie mit Kindern und Jugendlichen, die gerade abgeschlossen wird. «Wir sind sehr gespannt, ob die jungen Menschen die gleichen Ernährungsmuster haben wie ihre Eltern.»
Dr. Sebastian Bürgler, s.buergler@psychologie.uzh.ch Prof. Sabine Rohrmann, sabine.rohrmann@uzh.ch
DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren
Wir essen zu viel und bewegen uns zu wenig. Das kann unseren Energiehaushalt aus dem Lot bringen. Mögliche Konsequenzen sind Übergewicht und Fettleibigkeit. Der Physiologe Thomas Lutz und der AdipositasSpezialist Philipp Gerber erforschen, wie Betroffene wieder ins Gleichgewicht kommen.
Text:
Roger Nickl
Menschen bringen weltweit immer mehr auf die Waage. Der diesjährige Bericht der Unicef zur Ernährung von Kindern rund um den Globus hält fest, dass sich die Zahl der Übergewichtigen in den letzten 25 Jahren verdoppelt hat. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es gemäss dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen auf der Erde mehr Kinder, die fettleibig sind, als untergewichtige. Die dramatische Entwicklung zu zu vielen Pfunden zeigt sich vor allem in Ländern mit durchschnittlich tiefen bis mittleren Einkommen. Und sie betrifft nicht allein Kinder, sondern auch Erwachsene. Aber auch in Ländern mit einem hohen Wohlstand nimmt die Zahl der Menschen, die zu viel wiegen, stetig zu. In der Schweiz sind gemäss einer Statistik des Bundesamts für Gesundheit 43 Prozent der Bevölkerung übergewichtig, 13 Prozent davon gelten als fettleibig (adipös) – das sind doppelt so viele wie vor dreissig Jahren. Übergewicht und Adipositas belasten den Körper stark und haben gravierende Folgen für die Gesundheit: Sie erhöhen das Risiko für Folgekrankheiten wie HerzKreislaufProbleme, Diabetes mellitus, aber auch für einige Krebsarten.
Doch weshalb wird die Welt immer dicker? Die Gründe dafür sind vielfältig. «Das Hauptproblem ist, dass wir viel mehr Energie aufnehmen, als wir verbrauchen», sagt UZHVeterinärphysiologe und Ernährungsforscher Thomas Lutz, «kurz gesagt: Wir essen einfach zu viel und bewegen uns zu wenig.» Und wir essen nicht immer das, was uns auch wirklich guttut. In vielen Lebensmitteln sind zu viele Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Zucker und Fett in hochkonzentrierter Form vorhanden. Das bedeutet, dass man wenig davon konsumieren muss, um bereits grosse Energiemengen zu sich zu nehmen.
Solche Energiebomben sind manchmal ziemlich unscheinbar. Denn nicht nur industriell produzierter Junkfood weist eine hohe Konzentration an Nährstoffen auf, sondern auch manche Lebensmittel, die wir auf den ersten Blick als gesund einstufen – etwa Fruchtsäfte und Proteinshakes. «Hinter alles, was man nicht natürlicherweise flüssig zu sich nimmt, sollte man ein Fragezeichen setzen», sagt AdipositasSpezialist und UZHTitularprofessor Philipp Gerber. Fruchtsäfte jagen den Blutzucker im Körper kurzfristig hoch, dafür fehlen die Pflanzenfasern, die für eine langsame und gute Verdauung wichtig sind. «Mit dem FoodProcessing sind wir zu Nahrungsmitteln gekommen, die nicht
mehr dem entsprechen, wofür wir biologisch konstruiert sind», sagt Gerber, «generell sollten wir etwa weniger Kohlenhydrate, und wenn, dann mehr Vollkornprodukte zu uns nehmen.»
Denn physiologisch gesehen sind wir eigentlich noch Jägerinnen und Sammler. Unsere Vorfahren ernährten sich von Wurzeln, Pflanzen und ab und zu von einem Stück Fleisch – und immer wieder gab es einfach nichts. Diese Lebensweise spiegelt sich auch in unserer Biologie. «Unser Körper ist darauf programmiert, nicht zu verhungern», sagt Thomas Lutz, « für ein Leben im Nahrungsmittelüberfluss, wie wir ihn heute oft haben, ist er eigentlich nicht gemacht.»
Teil dieses biologischen Programms, das unsere Ernährung
Unscheinbare
Nicht nur industriell produzierter Junkfood, sondern auch scheinbar gesunde Lebensmittel weisen eine hohe Konzentration an Nährstoffen auf – etwa Fruchtsäfte und Proteinshakes. «Hinter alles, was man nicht natürlicherweise flüssig zu sich nimmt, sollte man ein Fragezeichen setzen», sagt Adipositas-Spezialist Philipp Gerber.
reguliert, sind verschiedene Hormone, die unser Essverhalten beeinflussen und den Bedarf und den Verbrauch von Energie steuern. In seiner Forschung hat sich Thomas Lutz intensiv mit der Wirkung solcher Botenstoffe beschäftigt.
Eines dieser Hormone ist Leptin. Hat der Körper zu wenig Fettgewebe und damit gespeicherte Energie, sinkt auch der Leptinspiegel. Ist das der Fall, machen wir uns auf die Suche nach Nahrung. «Das Hormon ist ein wunderbarer biologischer Sensor, der uns davor schützt, zu verhungern», sagt Thomas Lutz. In die umgekehrte Richtung funktioniert er aber kaum: Steigt der Leptinpegel an, weil
spiegel hochfährt. Das Hormon beeinflusst aber auch das Belohnungszentrum in unserem Hirn. Produziert der Körper mehr davon, sinkt unser Appetit auf energiereiche Nahrung wie Zucker und Kohlenhydrate. So ist Amylin Teil des biologischen Systems, das dafür zuständig ist, die Energieaufnahme und den Energieverbrauch, oder anders gesagt, das Verhältnis von Hunger und Sättigungsgefühl in unserem Körper so gut wie möglich in einem gesunden Gleichgewicht zu halten.
Bei Menschen mit Adipositas gerät dieses Gleichgewicht völlig aus dem Lot. Das Sättigungsgefühl stellt sich bei ihnen auch dann nicht ein, wenn der Körper bereits mehr als genug Energie getankt hat. Dass dies so ist, hat viel mit ihrer individuellen Biologie zu tun. «Eine Untersuchung mit Süssgetränken hat gezeigt, dass Menschen, die vorteilhafte Gene haben, viel von solchen Softdrinks konsumieren und ihre Energiebilanz trotzdem mehr oder weniger im Gleichgewicht halten können», sagt Philipp Gerber. Die Kohlenhydrate, die sie zu viel eingenommen haben, kompensieren sie unter anderem, indem sie sonst weniger davon essen. Bei Adipositas funktioniert dieser Ausgleich genetisch bedingt schlecht bis gar nicht. «Das Sättigungsgefühl können wir willentlich nicht beeinflussen», sagt Gerber. Für ihn und für Thomas Lutz ist deshalb klar, dass Adipositas eine Krankheit ist und keine Charakterschwäche der Betroffenen. Dies deckt sich mit der Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Fettleibigkeit als chronische Krankheit definiert. «Menschen sind nicht allein schuld daran, adipös zu sein», sagt Philipp Gerber. Vorurteile fettleibigen Menschen gegenüber seien in der Gesellschaft aber immer noch weit verbreitet – völlig zu Unrecht.
Mit der Spritze abnehmen
In ihrer Forschung beschäftigen sich Thomas Lutz und Philipp Gerber auf unterschiedlichen Ebenen mit der Frage, wie Übergewicht und Adipositas erfolgreich bekämpft und die Energiebilanz im Körper wieder ins Lot gebracht werden kann. Mit seiner Grundlagenforschung zu Amylin hat
«Unser Körper ist darauf programmiert, nicht zu verhungern, für ein Leben im Nahrungsmittelüberfluss ist er nicht gemacht.»
Thomas Lutz, Veterinärphysiologe
wir zu viel Fettgewebe haben, führt das nicht dazu, dass die Nahrungsaufnahme reduziert wird. Das ist ein Mechanismus, der in der Evolution nicht vorgesehen ist – deshalb funktioniert er in Zeiten des Überflusses offensichtlich nur schlecht.
Amylin, einem anderen Hormon, das in unserer Ernährungsphysiologie eine wichtige Rolle spielt, hat Thomas Lutz viele Jahre seiner Forscherkarriere an der UZH gewidmet. Wenn wir essen, wird das Hormon in unserem Körper zusammen mit Insulin freigesetzt. Es reguliert das Sättigungsgefühl, verlangsamt die Magenentleerung und hemmt die Freisetzung von Glukagon, das den Blutzucker
Veterinärphysiologe Thomas Lutz die Basis für die Entwicklung von neuen Medikamenten gegen Fettleibigkeit geschaffen. Denn das Sättigungshormon kann auch dabei helfen, das Körpergewicht zu reduzieren. Eine Abnehmspritze mit einem Wirkstoff, der auf Amylinbasis entwickelt wurde, steht kurz vor der Zulassung. Andere Präparate, die die Sättigung fördern und den Appetit hemmen, sind bereits auf dem Markt erhältlich. «Im Vergleich zu bestehenden Produkten haben Amylinbasierte Präparate nach aktuellem Kenntnisstand mildere Nebenwirkungen», sagt Thomas Lutz, «sie verursachen etwa weniger Übelkeit.» Im therapeutischen Alltag von Philipp Gerber am AdipositasZen
trum des Universitätsspitals Zürich ist die Verordnung von Abnehmspritzen ein wichtiges Element der Behandlung, neben Ernährungsberatung, sozialpsychologischer Betreuung und in besonders schweren Fällen MagenbypassOperationen. «Mit Hilfe solcher Spritzen können wir das Gewicht von Patientinnen und Patienten im Durchschnitt bis zu zwanzig Prozent reduzieren», sagt Gerber, «zur Bekämpfung von Adipositas sind sie ein probates Mittel, nicht aber als LifestyleMedikament.»
Abnehmspritzen wirken nur, solange man sie anwendet. Werden die Medikamente abgesetzt, nimmt man in den meisten Fällen wieder zu. Das bedeutet, dass sie dauerhaft genommen werden müssen. Das ist aber nicht immer möglich. Zurzeit werden die Kosten für verordnete Spritzen von den Krankenkassen für drei Jahre übernommen. Danach müssen die Patientinnen und Patienten selbst dafür aufkommen. Das sei ungerecht, weil nicht alle Betroffenen die finanziellen Möglichkeiten dazu haben, findet AdipositasSpezialist Philipp Gerber, und es sei kurzsichtig. Denn Abnehmspritzen helfen, das Entstehen von Folgeerkrankungen wie HerzKreislaufProbleme oder Diabetes zu verhindern, was wiederum das Gesundheitssystem ent
bringen sie nichts.» Und sie sollten individuell angepasst sein: Denn Diäten wirken nicht bei allen Menschen gleich, zu unterschiedlich ist unsere Ernährungsphysiologie. «Deshalb sollten wir Übergewicht und Adipositas künftig personalisierter behandeln», ist Philipp Gerber überzeugt. Eine Möglichkeit dazu bietet ein tragbares Atemmessgerät, das das ETHSpinoff Alivion entwickelt, mit dem Gerber zusammenarbeitet. An unserem Atem lässt sich feststellen, wann der Körper Fett verbrennt und wir beginnen, besonders effektiv abzunehmen. Genau dieser Moment lässt sich mit dem tragbaren Messgerät bestimmen. Dies erlaubt es, Diäten und Essempfehlungen optimal an die individuelle Physiologie anzupassen. «Mit solchen Wearables könnte künftig auch die Behandlung von Adipositas zielgerichteter und effektiver werden», sagt Gerber.
Politik ist gefragt
Mit ihrer Forschung tragen Thomas Lutz und Philipp Gerber dazu bei, die weit verbreiteten Übergewichtsprobleme zu lösen. Viele der im aktuellen UnicefBericht erwähnten Kinder werden allerdings nicht davon profitieren können. Um der epidemischen Zunahme von Übergewicht und
«Diäten müssen nicht nur wirkungsvoll, sondern auch lebbar sein, sonst bringen sie nichts.» Philipp Gerber, Adipositas-Spezialist
lastet. Momentan wird in der Schweizer Politik darüber diskutiert, ob solche Spritzen ganz aus dem Leistungskatalog der KrankenkassenGrundversicherung gestrichen werden sollen. «Ein Entscheid in diese Richtung wäre aus medizinischer Sicht völlig falsch», sagt Gerber.
Wirkungsvoll fasten
In seiner Forschung beschäftigt sich Ernährungsspezialist Gerber nicht nur mit Adipositas, sondern generell mit der Frage, wie wir erfolgreich abnehmen können. Deshalb hat sich der Arzt in einer Studie mit einem anhaltenden und weit verbreiteten Ernährungstrend beschäftigt: dem intermittierenden Fasten. Wer auf diese Weise Diät hält, teilt seinen Tag in Ess und Fastenperioden ein – zum Beispiel acht Stunden essen, sechzehn Stunden fasten. Eine andere Spielart des intermittierenden Fastens ist das so genannte AlternateDay Fasting, bei dem sich Fastentage ohne oder mit stark reduzierter Kohlenhydrataufnahme mit normalen Esstagen abwechseln.
So beliebt das intermittierende Fasten ist, so unklar war bislang, welche Variante am effektivsten ist. Gerbers vor kurzem publizierte Studie zeigt nun, dass mit AlternateDay Fasting Körpergewicht und Fettmasse am effektivsten reduziert werden können. Jeden zweiten Tag ganz oder fast ganz auf das Essen zu verzichten, grenzt allerdings für viele Menschen an Selbstkasteiung. Der Forscher will deshalb in weiteren Studien untersuchen, was und wie viel wir beim AlternateDay Fasting essen können, um dennoch erfolgreich abzunehmen. «Diäten müssen nicht nur wirkungsvoll, sondern auch lebbar sein», sagt der Arzt, «sonst
Adipositas weltweit etwas entgegenzusetzen, empfiehlt das Kinderhilfswerk vor allem politische Massnahmen gegen hochverarbeitete ungesunde Lebensmittel und Fastfood –etwa klare Kennzeichnungen, das Verbot von Werbung oder das Untersagen von Junkfood an Schulen.
Prof. Philipp Gerber, philipp.gerber@usz.ch
Prof. Thomas Lutz, tomlutz@vetphys.uzh.ch
Bodymass-Index Übergewicht bestimmen
Als Übergewicht eingestuft wird ein BodymassIndex (BMI) von 25 kg/m2 und mehr. Als fettleibig oder adipös gilt jemand, der einen BMI von über 30 kg/m 2 aufweist. Der BMI wird errechnet, indem das Körpergewicht in Kilogramm durch die Körpergrösse in Metern im Quadrat geteilt wird.
DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren
In der säkularen Überflussgesellschaft hat das Fasten seine religiöse
Notwendigkeit verloren – und erlebt doch als «Detox» eine Renaissance.
Theologe Ralph Kunz und Psychologin LisaKatrin Kaufmann erklären, wieso es auch heute sinnvoll sein kann, freiwillig auf Nahrung zu verzichten.
Text: Barbara Simpson
Advent ist, wenn an der Bahnhofstrasse «Lucy» funkelt, die Geschäfte leer gekauft werden und sich in den Hauseingängen Berge von Paketen auftürmen, die im Internet bestellt wurden. Weihnachtsmärkte laden mit allerlei Leckereien und Glühwein zum geselligen Überkonsum, ein Weihnachtsessen jagt das nächste.
Das war nicht immer so: Noch bis ins 20. Jahrhundert galt der Advent in vielen Regionen als «kleine Fastenzeit» –im Vergleich zur grossen Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern. Im orthodoxen Christentum ist sie als PhilippusFastenzeit bis heute Teil des religiösen Kalenders. Wieso auch vor Weihnachten gefastet werden musste, sei einer simplen ökonomischen Logik geschuldet, sagt UZHTheologe Ralph Kunz. «Wer in einer Mangelwirtschaft ein Fest feiern wollte, musste es sich vom Mund absparen –wer nicht fastet, kann nicht festen.»
Gegenpol zum Konsum
Kunz hat für sein neues Buch das Fasten als spirituellkulturelle Praxis in den Blick genommen. «Die Christen haben das Fasten nicht erfunden», betont er. Sie übernahmen es von jüdischen und griechischen Traditionen, in denen es als spirituelle und therapeutische Übung galt. «Kurz gesagt: Man wusste, dass Fasten hilft.» So ist zeitweiliger Nahrungsverzicht in vielen Religionen verankert, sei es im islamischen Fastenmonat Ramadan, an Jom Kippur im Judentum oder im Buddhismus und Hinduismus als Teil der meditativen Praxis. Das Ziel ist, sich selbst zu prüfen, spirituell zu reinigen und den Glauben zu vertiefen. Auch in der Zeit der Reformation hielt man am Fasten fest. Während früher die Obrigkeit Essvorschriften machte, betonte Heinrich Bullinger in der «Confessio Helvetica», Fasten müsse freiwillig sein.
Unabhängig vom religiösen Hintergrund erlebt das Fasten heute eine Renaissance. Ob als Intervallfasten oder (Digital)DetoxKur: Der zeitweilige Verzicht ist zum Ritual einer Gesellschaft geworden, die Selbstkontrolle schätzt. «Die gesteigerte Aufmerksamkeit für den eigenen Körper ist ein Megatrend», sagt Kunz. Doch der neue Enthusiasmus folge anderen Motiven als die religiöse Fastenpraxis. Er richtet sich weniger auf die innere Sammlung als auf Selbst
optimierung. Wer fastet, will leistungsfähiger, gesünder, konzentrierter werden, eingespannt in die Erfolgslogik der Konsumgesellschaft. «Es gibt diesen Werbespruch: Gesundheit ist alles. Das ist natürlich Unsinn», lacht Kunz. Er warnt vor einer moralischen oder medizinischen Überhöhung des Fastens. Wenn Gesundheit zur höchsten Norm werde, verliere das Fasten seinen Sinn. Für Kunz ist Fasten vor allem ein Innehalten, eine leiblich erfahrbare Unterbrechung des Gewohnten, die Raum schafft für Demut und Aufmerksamkeit.
Zeit für Gebet und Gemeinschaft
Wer sich zum Fasten entschliesst, entscheidet sich, Nahrung teilweise oder völlig einzuschränken – und hält an diesem Vorhaben für eine gewisse Zeit fest. «Auf diese Festigkeit der Haltung verweist die ursprüngliche Bedeutung von Fasten», bemerkt Kunz. Damit steht die Zeit, die nicht fürs Kochen und Essen verwendet wird, für die Besinnung, fürs Gebet oder die Gemeinschaft zur Verfügung. Der soziale Austausch spielt laut Kunz beim Fasten eine zentrale Rolle. «Jemand, der fastet, muss sich nicht zurückziehen», sagt er, «man kann genauso gut Fastengemeinschaften bilden.» Gleichzeitig können die Nahrungsmittel, die man selbst
Studie
In einer aktuellen FASTressStudie untersuchen die Psychologin LisaKatrin Kaufmann und ihr Team, wie kurzfristiges Fasten die neuronalen und kognitiven Mechanismen der Stressverarbeitung beeinflusst. Ziel ist es, die biologischen Prozesse zu verstehen, die zur Stressresilienz beitragen, und wie sich der Wechsel vom Glukose zum Ketonstoffwechsel im Gehirn auf emotionale Stabilität und Entscheidungsverhalten auswirkt. Das Projekt kombiniert neurobiologische Messungen mit psychologischen Tests.
Für die Studie sucht das FASTress-Forschungsteam gesunde Teilnehmende. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code.
nicht verbraucht, als Almosen an Bedürftige gespendet oder fürs gemeinsame Feiern aufgespart werden. Der eigentliche Wert des Fastens als Glaubenspraktik liege in dieser Verschränkung von sozialer, leiblicher und geistlicher Dimension. Sehe man es als Diät, Pflichterfüllung oder Selbstoptimierungswettbewerb an, dann sei das eine Zweckentfremdung. «Fasten plädiert für ein ‹Weniger ist mehr›», sagt Kunz. «Mit der Entscheidung, zu fasten, entziehen wir uns dem Sog der Konsumreligion.»
Dieser Entzug, sagt Ralph Kunz, sei aber nie nur Entlastung. Er konfrontiere den Menschen auch mit sich selbst. Wer sich des Essens enthalte, verzichte auf eines der naheliegendsten Mittel der Ablenkung und werde auf sich selbst zurückgeworfen. «Es kommt Verdrängtes und Unangenehmes herauf», erklärt er. Das Fasten zwingt zur Auseinandersetzung mit dem, was im Alltag verborgen bleibt.
Unabhängig von diesen spirituellen Aspekten hat das Fasten auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Funktionsweise des Gehirns. Die Effekte eines kurzzeitigen Verzichts auf Nahrung sind zumindest in zahlreichen Tierstudien belegt. «Beim Menschen besteht jedoch noch eine Forschungslücke», sagt Psychologin LisaKatrin Kaufmann, die vom Fonds zur Förderung des akademischen Nach
Auf sich zurückgeworfen
Fasten ist nie nur Entlastung, sondern konfrontiert den Menschen mit sich selbst, sagt Theologe Ralph Kunz. Es kommt Verdrängtes herauf, das im Alltag verborgen bleibt.
Emotionen verschwendet wird», vermutet Kaufmann. Emotionale Reaktionen werden sparsamer, die Stressantwort reduziert sich. Dennoch betont sie, dass diese Effekte zeitlich begrenzt seien: «Verzichten Menschen längere Zeit auf Nahrung, steigt das Risiko für depressive Symptome.»
Kurzfristiges Fasten könnte demnach hypothetisch als ein temporäres Beruhigungssystem funktionieren – als ein neurobiologisches Innehalten, das den Körper veranlasst, Energie auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dieser Effekt könnte trainierbar sein. Wenn der menschliche Körper Übung im Fasten hat, finde eine gewisse Gewöhnung statt und er könne schneller in die Ketose, die Energiegewinnung aus Ketonen, umschalten, erklärt Kaufmann. «Bildlich gesprochen kann Intervallfasten als ein Training des Stoffwechsels
«Mit der Entscheidung zu fasten, entziehen wir uns dem Sog der Konsumreligion.»
Ralph Kunz, Theologe
wuchses (FAN) von UZH Alumni unterstützt wird. Sie untersucht in einer aktuellen Studie, wie ein kurzfristiger Verzicht auf Nahrung über 16 Stunden die neuronalen Mechanismen der Stressverarbeitung beeinflusst. «Nach 12 bis 14 Stunden gibt es typischerweise einen Wechsel im Energiehaushalt des Körpers», sagt sie, «der Körper schaltet für die Energieversorgung von den aus Glukose gewonnenen Kohlenhydraten auf Ketone um, die aus Fettsäuren der Fettzellen umgewandelt wurden.»
Dieses Umschalten verändert im Tiermodell nachweislich das Verhalten und die Stressreaktion. «Bei Mäusen wurde beobachtet, dass das einerseits zu weniger ängstlichem Verhalten führt – das Erschrecken bei lauten Tönen ist deutlich reduziert –, aber auch zu mutigerem Verhalten in Stresssituationen», sagt Kaufmann. In so genannten ElevatedMazeTests, einem etablierten Verfahren zur Messung von Angst, zeigten die Mäuse unter Fastenbedingungen weniger Hemmung, Neues zu erkunden. Zudem lasse sich im Gehirn eine «dämpfende Wirkung» erkennen – eine geringere Reaktivität auf Stressreize.
Training des Stoffwechsels
Ob sich auch beim Menschen das Gehirn anders verhält, je nachdem, woher der Körper seine Energie bezieht, und Fasten dadurch beruhigend oder stabilisierend wirkt, ist Gegenstand von Kaufmanns Forschung. Eine Hypothese ist, dass sich der Körper in einer Phase des Nahrungsmangels ökonomischer verhält: «Es scheint plausibel, dass dann nicht zusätzlich Energie auf im Moment wenig hilfreiche
betrachtet werden.» Ob und in welcher Form regelmässige Fastenperioden in Zukunft therapeutisch empfohlen werden könnten, hängt von den Studienergebnissen ab. «Das Ziel ist, aus der Beobachtung von gesundem Fasten dessen Einfluss auf Stress und Angst besser zu verstehen und daraus Impulse für die Therapie zu gewinnen», sagt Kaufmann. Mögliche Erkenntnisse könnten die Behandlung von Angstund verschiedenen Essstörungen beeinflussen. Ob Therapieform oder spirituelle Übung: Für beide, den Theologen wie auch die Psychologin, ist Fasten eine Praxis, die Körper und Geist verbindet. Wer fastet, unterbricht den Rhythmus der ständigen Verfügbarkeit. «In einer Überflussgesellschaft ist Fasten eine Herausforderung – aber genau deshalb ist es heute so wichtig», sagt Ralph Kunz. Wer sich darauf einlasse, erfahre eine unerwartete Belohnung. Vielleicht liegt genau im bewussten Entzug ein Rezept für das, was uns in der Adventszeit oft fehlt: Ruhe und Besinnung.
Dr. Lisa-Katrin Kaufmann, lisa-katrin.kaufmann@uzh.ch
Prof. Ralph Kunz, ralph.kunz@theol.uzh.ch
LITERATUR: Ralph Kunz: Fasten. Glauben geht durch den Magen. Mit einem Beitrag von Simon Peng-Keller. Aus der Reihe Forum Theologische Literaturzeitung (ThLZ.F) Band 42, Leipzig 2024.
DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren
Wenn die Beziehung zum Essen gestört ist, kann das verheerende Folgen haben für die Psyche und den Körper. Ernährungspsychiater Patrick Pasi betreut Patientinnen mit Essstörungen und erforscht am Zentrum für Essstörungen des USZ neue Behandlungsmethoden.
Text: Thomas Gull
Wer sich bei Patrick Pasi in Behandlung begibt, hat den ersten grossen Schritt zu einer allfälligen Heilung bereits hinter sich: die Einsicht, an einer Krankheit zu leiden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn oft haben Menschen mit Essstörungen das Gefühl, sie seien nicht krank. Ganz im Gegenteil. «Sie sagen sich: Sich viel zu bewegen, ist gesund, und abnehmen wollen ja alle. Ich mache das besonders gut, weshalb soll ich deshalb zum Arzt?», erzählt Pasi. Der Ernährungspsychiater leitet das Zentrum für Essstörungen am Universitätsspital
Selbstbestimmt krank
Magersüchtige kontrollieren ihr Essen rigide.
Das vermittelt ihnen das Gefühl von Selbstbestimmung. Doch zu hungern ist ein falscher Umgang mit Problemen, sagt Ernährungspsychiater Patrick Pasi.
Zürich, wo Krankheiten wie Anorexie (Magersucht), Bulimie (EssBrechSucht) oder BingeEating (Esssucht) behandelt werden. Von diesen Essstörungen sind jeweils etwa ein bis vier Prozent der Bevölkerung betroffen, meist Frauen. Wer psychiatrische Hilfe sucht, tut dies oft auf mehr oder weniger sanften Druck der Familie oder des Hausarztes. Deshalb sei es wichtig, an der Motivation zu arbeiten, so Pasi, denn die Genesung von einer schweren Essstörung ist ein langwieriger Prozess, der viel Durchhaltewillen erfordert.
Wieder normal essen
Am Anfang der Therapie geht es darum, die Essstruktur zu normalisieren, die bei den Patientinnen – 90 Prozent sind Frauen – durcheinandergeraten ist. In der stationären Behandlung gibt es deshalb drei Haupt und drei Zwischenmahlzeiten pro Tag. Die Patientinnen müssen unterschreiben, dass sie diese einnehmen und auch bei sich behalten. Das regelmässige, organisierte Essen stärkt den Körper und macht den Kopf frei, sagt Pasi: «Die Nahrungsaufnahme zu kontrollieren, besetzt Menschen mit Essstörungen men
tal vollkommen. Wenn wir ihnen diese Aufgabe abnehmen, schafft das Raum für andere Lebensthemen, die wir in der Psychotherapie bearbeiten.»
Dazu gehört, sich mit den Ursachen der Essstörung auseinanderzusetzen. Diese sind sehr komplex. Vordergründig geht es beispielsweise bei der Magersucht darum, schlank zu sein und damit einem Schönheitsideal zu entsprechen, das durch die sozialen Medien noch verstärkt wird. «Das ist Teil des Optimierungsdrangs, der in unserer Gesellschaft verbreitet ist», sagt Pasi, «heute muss man sich optimieren, um einen Wert zu haben. Das Erste, was man sieht, ist der eigene Körper. Deshalb fangen viele damit an.»
Der Wunsch nach Selbstoptimierung ist allerdings nur das offensichtlichste Motiv und muss nicht zwangsläufig zu einer Essstörung führen. Dazu braucht es weitere, tiefer liegende Ursachen, oft eine Mischung aus Charaktereigenschaften, biologischen, familiären und sozialen Faktoren. Als Charaktereigenschaften nennt Pasi Perfektionismus, Leistungsorientierung, Harmoniebedürftigkeit oder negative Gedanken und Gefühle gegenüber sich selbst. «Oft sehen wir auch die Schwierigkeit, Emotionen wahrzunehmen und zu regulieren.»
Diese charakterliche Grundkonstellation trifft dann auf familiäre und soziale Verhältnisse, die zu Problemen führen können. Dabei geht es etwa um die Ablösung und Abgrenzung von den Eltern, ums Erwachsenwerden und darum, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Pasi nennt dies den «AutonomieAbhängigkeitsKonflikt»: «Der junge Mensch will autonom sein, was er unter Beweis stellen kann, indem er seinen Körper und sein Essverhalten kontrolliert. Gleichzeitig ist er schutzbedürftig und muss sich noch nicht der Verantwortung des Erwachsenenlebens stellen.» Die Magersucht kann auch ein Mittel sein, um den Körper kindlich zu halten und nicht erwachsen zu werden, sagt Pasi, «das gilt auch für die Sexualität, die oft abgelehnt wird.»
Verzicht wird belohnt
Die rigide Kontrolle des eigenen Essverhaltens vermittelt den Betroffenen das Gefühl von Selbstbestimmung, in einer Zeit, in der so vieles passiert – körperlich und sozial –, was sie nicht steuern und beeinflussen können. Doch zu hungern sei ein dysfunktionaler Umgang mit diesen Problemen, eine falsche Bestätigungsstrategie, so Pasi: «Negative Gefühle
lassen sich nicht «weghungern». Und die vermeintliche Kontrolle über sich selbst, dieser Zwang, «etwas im Griff zu haben oder in den Griff zu bekommen», hat tiefgreifende und verheerende Auswirkungen auf den Körper.
Untergewicht und Essstörung schwächen den Körper und machen die Magersüchtigen krank – psychisch und physisch. Zur langen Liste der so genannten Komorbiditäten, das sind Krankheiten, die Essstörungen begleiten oder von ihnen ausgelöst werden können, gehören affektive Störungen, Depressionen, Angstzustände oder Schlafstörungen auf der psychischen Seite, Verdauungsprobleme, Osteoporose, Stoffwechselerkrankungen oder HerzKreislaufProbleme auf der physischen.
Das grundlegende Problem ist, dass das Aushungern des Körpers dazu führt, dass viele natürliche Mechanismen
Untergewicht. Bei einer Grösse von 1,65 Metern entspricht das einem Gewicht von 50,5 Kilogramm. Oft haben die Betroffenen zu Beginn der Therapie aber einen viel tieferen BMI, entsprechend dauert die Behandlung länger. Wenn das Essen wieder einigermassen funktioniert, kann sich Pasi um die psychischen Probleme kümmern. Wenn Eltern und Familie einen Einfluss darauf haben, werden sie in die Therapie einbezogen. Ein wichtiges Thema ist, die Wahrnehmung und Verarbeitung von Emotionen zu verbessern. Dazu gehört beispielsweise, zu erkennen, ob man tatsächlich Hungergefühle hat oder ob es andere Gefühle sind, die sich als «Hunger» präsentieren wie Wut, Enttäuschung, Frust, Einsamkeit, Langeweile oder die Angst, nicht zu genügen. «Wir arbeiten auch daran, die Eigenverantwortung und Autonomie zu stärken, alternative Bewäl
«Heute muss man sich optimieren, um einen Wert zu haben. Das Erste, was man sieht, ist der eigene Körper. Deshalb fangen viele damit an.»
Patrick Pasi, Ernährungspsychiater
nicht mehr funktionieren oder gar in ihr Gegenteil verkehrt werden. Normalerweise haben wir ein natürliches Hungergefühl, mit dem der Körper dem Gehirn signalisiert, dass er Nahrung braucht. Wenn er diese bekommt, wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. «Bei der Anorexie ist die Belohnung nicht mehr das Essen, sondern der Verzicht darauf», erklärt Pasi.
Der Nahrungsentzug schlägt auch auf den Darm, der Botenstoffe produziert, die für den Stoffwechsel wichtig sind. Dadurch gerät die DarmHirnAchse aus dem Gleichgewicht, die das Gehirn etwa mit Hormonen wie Leptin und Ghrelin versorgt, die das Hungergefühl und die Nahrungsaufnahme regulieren, genauso wie das Mikrobiom im Darm selbst. «Das führt dazu, dass weniger Botenstoffe und mehr Entzündungszellen produziert werden, die dann ins Hirn gelangen. Diese Entzündungssignale wiederum verstärken die Magersucht.» Zusammengefasst bringen Essstörungen den Körper aus dem Lot, psychisch und physisch. Dieses verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen, ist sehr schwierig. Aus dem Teufelskreis ausbrechen
Die Tatsache, dass Essstörungen oft von weiteren Erkrankungen begleitet werden, macht ihre Behandlung komplex. Der «Königsweg» führt nach wie vor über die Psychotherapie, denn Essstörungen fangen im Kopf an und müssen auch dort überwunden werden. Flankiert wird die Psychotherapie von weiteren Massnahmen wie Kunst und Bewegungstherapie, dem Einsatz von Psychopharmaka für die psychiatrische Komorbiditäten und Ernährungstherapie.
Zuerst geht es jedoch ums «Handfeste», wie es Pasi nennt: «Der Körper muss an Gewicht zulegen. Dabei wird vorgegeben, wie viel die Patientinnen zunehmen müssen: etwa 700 Gramm pro Woche. Ziel ist ein BodymassIndex (BMI) von 18,5, das ist die Grenze zwischen Normal und
tigungsstrategien für Probleme aufzubauen und ein positives Selbstbild zu entwickeln», sagt Pasi. Und essen soll mit der Zeit auch wieder Genuss vermitteln können. Um gesund zu werden, müssen die Patientinnen aus dem Teufelskreis ausbrechen, in dem sie gefangen sind und der sie krank macht.
Psylocibin fördert die Flexibilität
Helfen könnten dabei auch Psychedelika wie Psylocibin, Ketamin oder LSD, die bei anderen psychischen Erkrankungen im Rahmen von wissenschaftlichen Studien erfolgreich eingesetzt werden. Sie verbessern die kognitive und emotionale Flexibilität und können so dazu beitragen, das rigide Denken aufzubrechen, das etwa Magersüchtige daran hindert, flexibel auf ihre Umwelt und auf Therapien zu reagieren und offen zu sein, wenn heikle Themen angesprochen werden. «Erste Studien zeigen, dass das auch bei Patientinnen mit chronischen Essstörungen helfen könnte», sagt Pasi. Zu den weiteren experimentellen Mass
Zentrum für Essstörungen
Das Zentrum für Essstörungen (ZES) am Universitätsspital Zürich bietet eine umfassende Behandlung für Patient:innen mit Essstörungen wie Anorexie, Bulimie, BingeEating und/ oder andere atypischen Essstörungen. Die Betreuung kann stationär, in der Tagesklinik oder ambulant erfolgen. Das ZES arbeitet mit verschiedenen Fachbereichen und somatischen Kliniken des Universitätsspitals Zürich (USZ) eng zusammen, um für die Betroffenen die passende Behandlung anzubieten.
«Bei der Anorexie ist die Belohnung nicht mehr das Essen, sondern der Verzicht darauf.» Patrick Pasi, Ernährungspsychiater
nahmen, die die Psychotherapie flankieren und unterstützten können, gehört die transkranielle Magnetstimulation, mit der bestimmte Bereiche des Gehirns angeregt werden. Hier gibt es gemäss Pasi ermutigende Resultate. Allerdings wirkt diese Therapie bis jetzt nicht langfristig.
Ein weiteres Instrument ist die virtuelle Realität, die eingesetzt werden kann, damit sich die Patientinnen langsam an ein neues, kräftigeres Bild von sich selbst gewöhnen. Dieses wird mit VR als Avatar simuliert. «So kann sich das Gehirn langsam an das neue Aussehen adaptieren und es akzeptieren», erklärt Pasi.
Die Erforschung zusätzlicher therapeutischer Massnahmen ist wichtig, um die Erfolgschancen der Behandlung zu verbessern. Die Mehrheit der Erkrankten kann mit der Zeit erfolgreich behandelt werden. Doch bei etwa 20 Prozent wird das Leiden chronisch und 5 bis 10 Prozent können
daran sterben. Spezialisierte Zentren wie das USZ, die auf die verschiedenen Krankheitsphasen zugeschnittene Therapieformen anbieten, bieten die Chance, «die Mortalitätsrate zu senken und die Heilungschancen zu verbessern», so Pasi. Wichtig sei auch, nicht abzuwarten, sondern sich möglichst bald in Behandlung zu begeben: «Die Prognose verbessert sich, wenn die Krankheit frühzeitig erkannt und therapiert wird.» Zudem kann so verhindert werden, dass die Krankheit chronisch wird.
DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren
Zu heiss, zu trocken: Wegen der Klimaerwärmung schrumpfen die Anbauflächen vieler wichtiger Nutzpflanzen wie Weizen, Mais, Reis oder Kartoffeln. Gefragt sind deshalb resistentere Arten.
Weizen: minus 15 Prozent, Mais: minus 6,6 Prozent, Reis, minus 6,6 Prozent, Kartoffeln: minus 14 Prozent. Das sind nicht die aktuellen Preisbewegungen an den Rohstoffmärkten, sondern die Zahlen zeigen, um wie viel die verfügbare Anbaufläche der genannten Nutzpflanzen weltweit zurückgeht, wenn sich das Klima um zwei Grad erwärmt. Publiziert hat sie ein Forscherteam unter Beteiligung des UZHGeografen Daniel Viviroli dieses Jahr im Wissenschaftsjournal «Nature Food». Die For
schenden haben die entsprechenden Werte für die dreissig wichtigsten Nahrungsmittelpflanzen für vier verschiedene Klimaszenarien durchgerechnet. Fazit: Bei einer Erwärmung um zwei Grad gehen die Anbauflächen bei zwei Drittel der Pflanzen zurück, ab drei Grad bei allen dreissig. Tropen und Subtropen leiden besonders
«Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Anbauflächen sind vor allem in den Tropen und Subtropen gross», sagt Viviroli. Er ist Hydrologe und hat die Klimaszenarien in Bezug auf Niederschlagsmengen, Temperaturen und VerText: Theo von Däniken


dunstungsverhältnisse miteinander verglichen. Auf dem indischen Subkontinent oder im Gürtel südlich der Sahara können bei einer Erwärmung um zwei Grad 25 bis 30 Prozent der heutigen Produktion aus dem so genannten «sicheren klimatischen Raum» fallen. Das bedeutet: Die Klimabedingungen werden sich so verändern, dass die üblichen Kulturpflanzen dort nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr angebaut werden können.
Damit trifft der Klimawandel Gegenden, die einerseits heute schon am meisten damit zu kämpfen haben, genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Andererseits sind dort die
Mit dem Klimawandel nehmen auch die Kapazitäten der Bergregionen ab, Wasser längerfristig zu speichern. Wenn die Gletscher zurückgehen und weniger Schnee liegt, verändert sich auch die Wasserlieferung aus den Bergen. «Derzeit fällt die Schneeschmelze gut mit den Vegetationszeiten zusammen», so Viviroli, «und stützt das Wachstum der Pflanzen.» Beginnt die Schneeschmelze früher, ist diese Übereinstimmung nicht mehr gegeben und man müsste das Wasser künstlich in den Bergen speichern. Das bedeutet beispielsweise, Staudämme zu bauen. «Sie sind eine mögliche Anpassungsstrategie, bringen aber viele Nach
In den Tropen und Subtropen wachsen viele Nutzpflanzen bereits nahe an der Temperaturgrenze, die für sie noch tolerierbar ist.»
Daniel Viviroli, Hydrologe
Möglichkeiten, sich an den prognostizierten Wandel anzupassen, stark eingeschränkt. «In diesen Regionen wachsen viele Nutzpflanzen bereits nahe an der Temperaturgrenze, die für sie noch tolerierbar ist», sagt Viviroli.
In allen vom Forscherteam berechneten Szenarien gibt es neben den Verlusten auch Gewinne an Anbauflächen. Diese liegen vor allem in mittleren und höheren Lagen, etwa in Europa. Dort sorgen die Klimaveränderungen dafür, dass Pflanzen angebaut werden können, die bisher wegen der zu kühlen Temperaturen nicht gedeihen. Im mildesten Szenario mit einer Erwärmung um 1,5 Grad vermögen global gesehen solche Gewinne die Verluste auszugleichen. In den anderen Szenarien überwiegen die Rückgänge deutlich. Bei einer Erwärmung um vier Grad gehen die Anbauflächen für Hülsenfrüchte, Ölsaaten und stärkehaltige Wurzelgewächse wie Kartoffeln, Süsskartoffeln, Yams und Cassava um über 50 Prozent zurück. Die neu hinzukommenden Anbauflächen verharren bei 20 bis 25 Prozent.
Die grossen Verluste entstehen auf dem indischen Subkontinent, in Nordafrika, im Mittleren Osten und in Afrika südlich der Sahara. «Dort ist die Landwirtschaft stark auf Selbstversorgung ausgerichtet», erklärt Viviroli. Die Verluste können nicht einfach durch Importe aus anderen Regionen ausgeglichen werden. Dazu fehlen die wirtschaftlichen Möglichkeiten.
Wassermangel und Staudämme
Neben der Temperaturzunahme ist der Rückgang der Niederschläge in den Tieflandregionen ein Grund dafür, dass nutzbare Anbauflächen schwinden. Fehlender Regen kann zwar mit zusätzlicher oder effizienterer Bewässerung zu einem Teil kompensiert werden. Doch bereits heute sind in den Tieflandregionen knapp eine Milliarde Menschen auf das Wasser aus den Bergen angewiesen, wie Viviroli in einer anderen Studie gezeigt hat. Bis Mitte des Jahrhunderts dürfte diese Zahl auf 1,5 Milliarden steigen. 70 Prozent des Wassers, das aus Flüssen, Seen oder Grundwasser entnommen wird, fliesst zur Bewässerung in die Landwirtschaft.
teile mit sich», erklärt Viviroli. Abgesehen von negativen ökologischen Auswirkungen benötigen sie viel Kapital und können in bestimmten Regionen zu Konflikten um den Zugang zu Wasserressourcen führen.
Robustere Pflanzen gefragt
Eine andere Strategie ist, auf Pflanzen auszuweichen, die resistenter sind – zum Beispiel die Maramabohne, die im Süden Afrikas wächst. «Die Pflanze wächst auf extrem kargen Böden, übersteht grosse Hitze und Trockenheit», sagt der Pflanzenbiologe Ueli Grossniklaus, der sich in Zusammenarbeit mit der Universität Mpumalanga in Südafrika intensiv damit beschäftigt und unter anderem ihr Genom entschlüsselt hat.
Robuste Bohne
Die Maramabohne wäre als alternative Nutzpflanze interessant. Sie wächst auf kargen Böden und übersteht Hitze und Trockenheit. Gleichzeitig enthält sie viel Protein, Fett und Vitamine. Doch für einen intensiven Anbau gibt es noch viele Hürden.
Essbar sind die Samen der Bohne, die an Kastanien erinnern, aber etwa halb so gross sind. Sie sind ein wahres Wunder an Nährstoffen. «Sie haben mehr Proteine als Sojabohnen, mehr Fett als Erdnüsse und mehr Vitamine und Spurenelemente als andere Nahrungsmittel.» Kurz: Fast bei allen Inhaltsstoffen schneidet sie besser ab als die besten der heute oft genutzten Nahrungsmittel.
Die Maramabohne ist eine so genannte Orphan Crop, also ein Nahrungsmittel, das bisher in der Zucht oder im Anbau nicht berücksichtigt wurde. «Man könnte es bereits heute auf Flächen anbauen, wo sonst nichts wächst», sagt Grossniklaus. Für einen intensiven Anbau gibt es aber noch viele Hürden: Denn die Maramabohne vereint gleich meh
rere Eigenschaften, die einer Zucht und Domestizierung normalerweise entgegenstehen. Die Samen keimen nicht von selbst aus, die Pflanze befruchtet sich nicht selbst und sie blüht nicht regelmässig. Um die Bohne für die Nahrungsmittelproduktion zu kultivieren, wäre Züchtung notwendig. «Im Moment wissen wir aber gar nicht, wie wir das machen sollten», sagt Grossniklaus. Zu wenig ist über die Pflanze überhaupt bekannt. Grossniklaus ist einer der wenigen, die die Maramabohne überhaupt erforschen. Sein kollaboratives Projekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds und der südafrikanischen National Research Foundation gefördert wird, läuft aber bald aus. Für weitere Forschung oder Feldversuche fehlt im Moment die weitere Finanzierung.
Pflanzenzüchtung beschleunigen
Das Beispiel der Maramabohne zeigt: Auch wenn gewisse Orphan Crops geeignet wären, unter veränderten klimatischen Bedingungen zu bestehen und hochwertige Nahrung zu liefern: Der Weg zu einer intensiven Nutzung ist noch weit. Die Ausfälle, die bei den bisherigen Nutzflächen entstehen, könnten damit kaum ausgeglichen werden.
«Wir werden einen Weg finden müssen, um wichtige Nutzpflanzen wie Weizen, Mais und Reis rascher anzupassen», ist Grossniklaus überzeugt. Zwar könnte man mit herkömmlicher Züchtung resistentere oder ertragreichere Arten hervorbringen. Doch das ist extrem aufwändig und dauert zu lange. «Bis man mit der klassischen Züchtung eine gegenüber den Folgen der Klimaerwärmung tolerantere Form hat, ist das Klima vielleicht schon gekippt», sagt Grossniklaus.
In verschiedenen Ländern, etwa in den USA oder China, sind deshalb Sorten im Anbau, die mithilfe der GenomEdi
Augenbohnen in Nigeria», konstatiert Grossniklaus. Ein Problem für die Züchtung resistenter oder ertragreicherer Nutzpflanzen ist, dass der Genpool der heute angebauten Sorten sehr klein ist. Das heisst, die Diversität innerhalb einer Pflanzenart ist nicht gross. Diversität aber ist hilfreich: Werden auf einem Feld verschiedene Varianten einer Sorte angebaut, so werfen sie mehr Ertrag ab. Dies hat unter anderem die Forschung des der UZHUmweltwissenschaftlers Bernhard Schmid gezeigt.
Der Effekt funktioniert auch, wenn die Pflanzen zwar genetisch gleich, aber in ihrer epigenetischen Ausprägung verschieden sind. Das heisst, die Pflanzen unterscheiden sich nicht in ihren Genen, sondern darin, welche dieser Gene aktiv sind oder nicht. Die Epigenetik führt dazu, dass Pflanzen trotz genetischer Identität unterschiedlich ausgeprägte Eigenschaften haben können.
Grossniklaus hat kürzlich in einer wegweisenden Studie gezeigt, dass epigenetische Eigenschaften zumindest zum Teil vererbt und selektioniert werden können. Dies würde es erlauben, epigenetisch unterschiedliche Varianten von Pflanzen zu züchten. «Auf diese Weise könnte man innerhalb des engen Genpools der Nutzpflanzen die Variation wieder etwas erhöhen», so Grossniklaus. In Versuchen im Labor konnte Grossniklaus zeigen, dass solche epigenetisch unterschiedlichen Pflanzen tatsächlich mehr Ertrag abwerfen und auch robuster sind.
Klimaschutz ist zentral
Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels auf die Anbauflächen ist für Daniel Viviroli klar, dass die Landwirtschaft in allen Bereichen effizienter und anpassungs
«Wir werden einen Weg finden müssen, um wichtige Nutzpflanzen wie Weizen, Mais und Reis rascher anzupassen.»
Ueli Grossniklaus, Pflanzengenetiker
tierung erzeugt wurden. Dabei wird mit der CRISPR/CasMethode das Erbgut einer Pflanze gezielt verändert. «Wenn ich weiss, welches Gen für die Toleranz gegenüber Trockenheit relevant ist, kann ich das mit dieser Methode verändern», erklärt Grossniklaus. «Das ist effizienter als eine jahrelange Züchtung mit Versuch und Irrtum.»
Diversität erhöht die Erträge
Im Gegensatz zu herkömmlicher Gentechnik werden bei der Genomeditierung der Pflanze keine fremden Gene eingefügt, sondern lediglich das eigene Genom verändert. «Das sind Veränderungen, wie sie auch natürlich oder bei der heute weit verbreiteten Mutationszüchtung vorkommen», so Grossniklaus. In der Schweiz sind Genomeditierte Pflanzen den gentechnisch veränderten gleichgestellt und ihr Anbau ist verboten. Doch die Folgen des Klimawandels könnten in diesem Bereich vielleicht zu einem Umdenken führen. «Dort, wo der Druck zur Anpassung hoch genug ist, werden transgene Pflanzen zugelassen, beispielsweise gegen den Bohnenzünsler resistente
fähiger werden muss, um die noch immer wachsende Weltbevölkerung zuverlässig zu ernähren. Laut der Studie sind selbst beim mildesten Szenario einer Erwärmung von 1,5 Grad die Einbussen bei einzelnen Pflanzenarten oder in einzelnen Regionen substanziell. Jede weitere Erwärmung führt zu deutlich höheren Risiken und Verlusten. Viele Anpassungsstrategien sind kostspielig, haben negative ökologische Auswirkungen oder sind gesellschaftlich umstritten. Auch wenn Anpassung unvermeidlich ist, liegt für Viviroli der wichtigste Hebel im Klimaschutz: «Dieser ist absolut zentral. Jedes Zehntelgrad spielt eine Rolle.»
Prof. Ueli Grossniklaus, grossnik@botinst.uzh.ch PD Dr. Daniel Viviroli, daniel.viviroli@geo.uzh.ch
DOSSIER — Mahlzeit! Wie wir uns gut ernähren
Seit es Filme gibt, wird darin gegessen. Mal fröhlich, lustvoll, sorgsam, mal einsam, gierig, überbordend. Eine kulinarische Reise durch die Geschichte des Kinos.
Text: Brigitte Blöchlinger
Nicht nur Filmemacher:innen haben eine «Vision» und eine eigene «Handschrift», sondern auch Sterneköch:innen. «Das Autorenprinzip ist eine von vielen Gemeinsamkeiten zwischen Essen und Film», erzählt der Leiter des Seminars für Filmwissenschaft Volker Pantenburg. Beides braucht zwingend eine gute Vorbereitung und Auswahl, spezielle Geräte und Technologie, ein reibungsloses Zusammenspiel der beteiligten Player und einen ansprechenden Aufführungsort.
Deshalb erstaunt es kaum, dass das Essen seit Beginn des Films eine beachtliche Rolle gespielt hat, so Pantenburg. Meist steht es für einen sozialen Ort, wo es um mehr als die Nahrungsaufnahme geht. Und schon bald wird im Kino auch harte Kost aufgetischt. Doch die filmische UrEssszene ist noch heiter gestimmt. Die Brüder Lumière wandten
Der Sinn des Lebens
Kritik an der Überflussgesellschaft: In der Satire
«The Meaning of Life» frisst sich der nimmersatte Mr. Creosote in einem Restaurant durch die Speisekarte, bis ihn das finale Pfefferminzschokolädchen explosiv ins Jenseits befördert.
sich im Juni 1895, kurz nach ihren spektakulären Erstlingen («La sortie de l’usine Lumière à Lyon» und «L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat») einem gemächlicheren Sujet zu: In «Repas de bébé» sitzen Eltern (Auguste und Marguerite Lumière) am Tisch ihrer idyllischen Gartenlaube, zwischen ihnen im Kindersitz das Töchterchen, dem der Vater einen Brei eingibt. Es herrscht eine sonnige Stimmung – das Füttern der herzigen Kleinen und wohl auch das Inszenieren der Szene bereitet den Eltern sichtlich Vergnügen.
Doch 1909 ist bereits Schluss mit dem unbeschwerten Essen im Film, weiss Filmwissenschaftler Pantenburg. Der Erfinder des amerikanischen Erzählkinos, D. W. Griffith, klagt in seinem dokumentarisch wirkenden kurzen Spielfilm «A Corner in Wheat» (1909) die Spekulation mit Weizen an, die vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Mangel an Brot für die lokale Bevölkerung führte. Um die immensen
Gewinne der Weizenbarone zu zeigen, fügt Griffith eine Essszene ein, in der die skrupellosen Kapitalisten und ihre Gattinnen an einer üppig dekorierten Tafel sitzen und sich ausgelassen zuprosten. Dass an der Tafel nicht gegessen, sondern ausschliesslich dem Rotwein zugesprochen wird, dass man sich in diesen Kreisen also von Genussmitteln «ernährt», steigert den Kontrast zu den parallel montierten Szenen, die die hungrige Bevölkerung zeigen. So verliert das Essen mit Griffiths «A Corner in Wheat» schon in der Frühzeit des Films seine Unbeschwertheit.
Hervorholen, was unter den Tisch gekehrt wurde Einer der ersten Autorenfilmer, die das Essen im Film klar als Gesellschaftskritik inszenieren, ist Pier Paolo Pasolini. In seinem Kurzspielfilm «La Ricotta» von 1963 offenbart die Art und Weise, wie die Filmfiguren mit dem Essen umgehen, gnadenlos die Klassenunterschiede: hier die Gier des einfachen Mannes, dessen Hunger nicht gespielt ist, dort die bessergestellten Filmemacher, die das lustig finden. Nach 1968 erlebt die Entlarvung bürgerlicher Dekadenz mit absurd inszenierten Tafelrunden ihren Höhepunkt. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Luis Buñuels erfolgreicher Kinofilm «Le charme discret de la bourgeoisie» (1972). Das geplante stilvolle Dîner eines elitären Freundeskreises kommt in dieser surrealistischen Groteske wegen irrwitziger, traumhafter bis traumatischer Widrigkeiten einfach nicht zustande. Richtig dick aufgetragen wird die Kritik an der bürgerlichen Überflussgesellschaft in der MontyPythonSatire «The Meaning of Life» (1983). Der feiste, nimmersatte Mister Creosote frisst sich in einem Restaurant durch die Speisekarte, bis ihn das finale Pfefferminzschokolädchen explosiv ins Jenseits befördert.
Ein Thema im Film sind auch Familiendramen zu Tisch, sagt Pantenburg. «Die Generationen treffen aufeinander und lange unterdrückte innerfamiliäre Konflikte brechen auf.» Exemplarisch dafür steht der erste «Dogma»Film des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg, «Festen» (1998). An der langen Tafel, an der sich die Familie zum 60. Geburtstag des Familienoberhaupts zusammenfindet, kommt es zum Showdown: Statt einer Geburtstagsrede offenbart der älteste Sohn den Missbrauch des Vaters an ihm und seiner Schwester, die sich umgebracht hat. Auch Filme, in denen das Kochen und Essen die Hauptrolle spielt, hat das Kino im Lauf der Zeit zu bieten. Da man knusprige

Wachteln an Morchelsause auf der Leinwand weder riechen noch schmecken kann, müssen die Schauspieler:innen in ihrem Spiel ausdrücken, was die Leckereien bei ihnen auslösen. In der Romanverfilmung «Babettes gæstebud» (deutsch: «Babettes Fest», 1987) des dänischen Regisseurs Gabriel Axel bekommen pietistische Gemeindemitglieder von der aus Frankreich geflüchteten Köchin Babette ein Festessen vorgesetzt, das ihre genügsame Verstocktheit dahinschmelzen lässt, erzählt Filmwissenschaftler Jan Sahli: «Während die im kargen Alltag meist schweigenden Strenggläubigen
und aktionsreich zu und her geht, spielt auch das gewöhnliche Essen in den fantastischen Geschichten eine Rolle. In «Chihiros Reise ins Zauberland» (2001) etwa stürzen sich die Eltern der zehnjährigen Chihiro in einem unheimlichen, verlassenen Vergnügungspark unerlaubt auf ein ausladendes Buffet, das für die Götter bestimmt wäre, und werden zur Strafe in Schweine verwandelt. Die junge Heldin muss viele Abenteuer bestehen, bis sie die Eltern zurückverwandeln und das magische Reich verlassen kann. Doch glücklicherweise gesellt sich ihr ein Waisenknabe zur Seite, der
«In den sozialen Medien existiert eine manische Begeisterung, schöne Mahlzeiten zu fotografieren.» Volker Pantenburg, Filmwissenschaftler
sich die aufgetischten Delikatessen einverleiben, beginnen sie nach und nach zu reden.» Für die Inszenierung des Kochens und Essens werden in «Babettes Fest» alle filmischen Register gezogen: Der Veuve Clicquot prickelt, der Rotwein gluckst, das Fleisch zischt, und die Köstlichkeiten werden in satten Farben und verführerischen Nahaufnahmen auf die Leinwand gezaubert – ein wahrer Augenschmaus für die Zuschauer:innen.
Auch im japanischen Film spielt das Essen eine wichtige Rolle. «Was eine Filmfigur kocht und isst, drückt immer auch ihre soziale Rolle aus», sagt Filmwissenschaftlerin Megumi Hayakawa, deren Spezialgebiet Animationsfilme sind. Eine traditionsbewusste Hauptperson wird eher eine BentoBox zusammenstellen, während der Tokioter Toilettenreiniger in Wim Wenders’ «Perfect Days» (2023) den Kaffee morgens aus dem Automaten lässt. «Automatenkaffee ist günstig, kommt geschmacklich aber nicht an frischen Kaffee heran», sagt Hayakawa. «Ein japanisches Publikum versteht die Message sofort: Er gibt sich damit zufrieden.»
Selbst in actionreichen animierten Abenteuerfilmen wird dem alltäglichen Essen Platz eingeräumt. In «Das Schloss im Himmel» etwa stärkt sich das Waisenkind Pazu mit Spiegelei auf Toastbrot – die er dann nicht etwa in Kombination, sondern je separat verspeist. Die kleine Episode verrät, wie unabhängig von gängigen Benimmregeln der Waisenjunge lebt – er isst, wie er will. In Schweine verwandelt
«In den Produktionen des japanischen Studios Ghibli nimmt das Essen mehr Raum ein und erfüllt andere Funktionen als in amerikanischen Trickfilmen – etwa von Walt Disney oder Pixar», fügt Filmwissenschaftler Philipp Blum an, der sich mit Fantasyfilmen auskennt. Selbst beim PixarAnimationsfilm «Ratatouille» (2007), bei dem das entscheidende Gericht sogar den Filmtitel liefert, spielt der geschmorte Gemüseeintopf nicht die Hauptrolle. Die Küchenszenen dienen in erster Linie dazu, die Herausforderungen und Dilemmata der beiden Hauptfiguren sichtbar zu machen –des Küchengehilfen Linguini, der von der kochbegabten Ratte Rémy in einem Pariser Gourmetrestaurant heimlich zu Höchstleistungen angetrieben wird. Obwohl es in den japanischen GhibliProduktionen oft unheimlich, schräg
seine freundschaftliche Gesinnung mit Onigiri, japanischen Reisbällchen, kundtut. Wie oft im japanischen Film steht hier das Essen zu zweit für zwischenmenschliche Wärme und Zugehörigkeit.
Mittlerweile holen sich immer mehr Menschen die kulinarischen Zugehörigkeitsgefühle aus der Fantasiewelt ins reale Leben. «GhibliFood nachzukochen, ist in Japan enorm beliebt», weiss Hayakawa. «Es gibt zigtausend Leute, die bekannte Gerichte aus den Trickfilmen nachkochen, fotografieren und auf Social Media stellen und so den Gleichgesinnten mitteilen, dass sie Teil der Fanbewegung sind.»
Fabelhafter Foodporn
In den sozialen Medien ist das Essen mittlerweile ein Ereignis, sind sich die Filmwissenschaftler:innen der UZH einig. Auf Instagram & Co. müssen die Speisen vor allem ästhetisch überzeugen, damit sie auffallen. «Es existiert eine fast schon manische Begeisterung, schöne Mahlzeiten zu fotografieren und hochzuladen», sagt Pantenburg. Damit vegane Bowls und knusprige Sauerteigbrote richtig stylish aussehen, werden sie arrangiert, beleuchtet, besprayt und manipuliert.
Ebenfalls ein grosser Hype sind Kochvideos wie «Zu Tisch», «Dinner Club» oder «Kochen wie ein Sternekoch». Die Kochshows locken Millionen von Zuschauer:innen vor den Bildschirm. Etwas wehmütig müssen sich da FantasyAficionados wie Philipp Blum eingestehen, dass selbst die abgefahrensten FoodFantasien in «Star Trek» oder «The Lord of the Rings» aktuell dem Publikum nur ein müdes Lächeln entlocken. Die klingonische Delikatesse Gagh (lebende Würmer) oder das zwiebackähnliche CramGebäck sehen neben dem heutigen fabelhaften Foodporn einfach nicht gut genug aus.
Dr. Jan Sahli, jsahli@fiwi.uzh.ch

Am UZH Healthy Longevity Center arbeiten Forschende interdisziplinär an Lösungen, die es Menschen im Alter ermöglichen, gesünder zu sein und sich wohlzufühlen. Die akademische Forschung ist in einer Vordenkerrolle, die Wirtschaft und Gesellschaft inspiriere, sagt Direktor Mike Martin.

Text: Roger Nickl
Illustration: Cornelia Gann
Zürich ist ein holpriges Pflaster. Zumindest für Menschen, die nicht so mobil sind. Bordkanten können für Personen, die im Rollstuhl sitzen oder Mühe mit dem Gehen haben, zu Stolpersteinen werden, Treppen und grosse Strassenkreuzungen zu unüberbrückbaren Hürden. «Viele ältere Menschen haben das Bedürfnis, mobil zu sein, und würden gerne einen Spaziergang durch die Stadt machen», sagt Christina Röcke, «wenn sie wüssten, auf welcher Strecke es genügend Sitzbänke hat, um sich auszuruhen, oder wie sie Verkehrsampeln vermeiden können, an denen sie lange warten müssen.»
Christina Röcke ist Psychologin und Co-Direktorin des UZH Healthy Longevity Center (HLC). Mit dem Center assoziiert ist auch das Forschungsprojekt «ZuReach» der Ingenieurin und Geoinformationsspezialistin Hoda Allahbakshi. ZuReach hat sich zum Ziel gesetzt, mobilitätseinschränkende Orte in der Zürcher Innenstadt zu kartieren und die entsprechenden Informationen in einer Datenbank zu sammeln. Diese Daten sind die Grundlage für ein digitales Navigationstool, das es Menschen mit eingeschränkter Mobilität künftig erlauben soll, möglichst barrierefrei in Zürich unterwegs zu sein. Obwohl es zahlreiche digitale Anwendungen gibt, die uns Wegplanung und Orientierung erleichtern, fehlt bislang ein solches Tool.
Den Alltag erforschen
ZuReach vereint viele Aspekte, die für die Forschungsund Innovationsphilosophie am Healthy Longevity Center stehen. Das Projekt setzt beispielsweise auf Citizen Science. Betroffene sind an der Datensammlung beteiligt und liefern Informationen zu Mobilitätshindernissen in der Zürcher Innenstadt. Damit sind die späteren Nutzerinnen und Nutzer des entstehenden Navigationstools von Beginn weg an seiner Entwicklung beteiligt. Dies garantiert, dass das Projekt nahe an den alltäglichen Herausforderungen ist, die es zu lösen gilt. Dafür arbeiten die Forschenden des HLC auch mit externen Partnern, etwa mit der Stadt Zürich zusammen. Zudem setzt ZuReach auf die digitale Technologie – als Vehikel für die Forschung und um Probleme zu lösen.
Die Alternsforschung an der UZH steht für einen neuen, datenbasierten und interdisziplinären Ansatz
und hat bereits früh auf die Digitalisierung gesetzt. «Schon bevor 2008 die ersten Smartphones auf den Markt kamen, haben wir das Potenzial dieser Technologie für die Forschung erkannt», sagt Mike Martin, der von 2013 bis 2024 den Universitären Forschungsschwerpunkt «Dynamik Gesunden Alterns» geleitet hat und heute Direktor des UZH Healthy Longevity Center ist. Denn smarte digitale Geräte wie das Handy machen es möglich, den Alltag von Menschen individuell und im Detail zu untersuchen. Sie legen damit die Basis dafür, gesundes Altern neu und ganzheitlicher zu denken. «Das Geheimnis der gesunden Langlebigkeit findet man nicht durch Laborstudien, sondern vor allem in der realen Welt», sagt Martin. Genau diese Alltagsrealität analysiert die Forschung an der UZH.
Einseitiger Blick auf Defizite
Um den Alltag älterer Menschen in all seinen Facetten zu erforschen, hat ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftler:innen aus Psychologie, Informatik und Geografie auch eigene Messgeräte entwickelt – etwa den tragbaren Sensor uTrail. Das kleine, vielseitige Gerät, das am Gürtel befestigt werden kann, registriert Bewegungen im Raum und körperliche Aktivitäten, zeichnet Gesprächsschnipsel auf und misst soziale Kontakte. uTrail liefert wichtige Informationen für die Alternsforschung und ist eines der Kernstücke der seit 2013 laufenden MOASIS-Studie, die Psychologin Christina Röcke gemeinsam mit dem Geografen Robert Weibel leitet. Die Forschenden untersuchen unter anderem mit Hilfe des Sensors das Leben von über 150 Probandinnen und Probanden im Alter von 65 bis 90 Jahren. «Mit den so gewonnenen Informationen lässt sich ein relativ genaues Bild des Alltags der Teilnehmer:innen zeichnen», sagt Röcke. Die Studie macht unter anderem deutlich, wie wichtig soziale Kontakte und die Mobilität für die mentale und körperliche Gesundheit und die Lebensqualität im Alter sind. «Alltagsaktivitäten beeinflussen Gedächtnis und Wohlbefinden unmittelbar positiv», sagt die Psychologin. Und MOASIS zeichnet ein differenziertes, lebendiges und äussert buntes Bild, wie dieser Alltag im Alter gelebt wird. Deutlich wurde auch, dass viele ältere Menschen trotz gesundheitlicher Einschränkungen aktiv und vielfältig interessiert sind, betont Christina Röcke.
«Alter wird heute häufig mit Krankheit gleichgesetzt», sagt Mike Martin, «wir haben eigentlich ein
«Unsere Forschung zeigt, dass viele ältere
Menschen trotz gesundheitlicher Einschränkungen aktiv und vielfältig interessiert sind.»
Christina Röcke, Psychologin
«Wir sollten definieren, was die grossen gesellschaftlichen Fragen und Probleme sind, und daran arbeiten, wie wir sie lösen können.» Mike Martin, Psychologe
Krankheits- und kein Gesundheitssystem.» Anders gesagt: Der Blick von Wissenschaft und Gesellschaft ist einseitig auf die Defizite des Alters gerichtet und nicht auf beides: die Defizite und die Potenziale. Denn auch Letztere gibt es: So zeigen die Forschungsprojekte am Healthy Longevity Center, dass ältere Menschen viel leistungsfähiger sind als gemeinhin angenommen.
«Heute hört man oft, dass wir zwar länger leben, damit aber die Zahl der Jahre, in denen wir krank sind, ansteigt», sagt Martin. Das bedeute allerdings nicht, dass wir dann untätig sind und nur Kosten verursachen, die das Gesundheitssystem belasten. Denn oft handle es sich um chronische Krankheiten, die sich in viele Fällen gut managen lassen. «Das ist auch der Grund, weshalb ältere Leute, die chronisch krank sind, gleichzeitig auch produktiv Firmen führen, erwerbstätig sind und Freiwilligenarbeit leisten», sagt der Gerontopsychologe. Das aktive Leben im Alter trägt zum individuellen Wohlbefinden bei, aber nicht nur das. Auch die Gesellschaft kann davon profitieren. Die Wertschöpfung, die durch Personen über 65 in der Schweiz erbracht wird, werde selten beziffert, hält Martin fest. Sie beträgt jährlich rund 30 Milliarden Franken.
Eine Voraussetzung für ein aktives Leben im Alter ist allerdings, dass Menschen nach der Pensionierung überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Denn es gibt viele Hürden, die ein angeregtes und mobiles Leben im Alter erschweren. «Beispielsweise gibt es Bildungsgesetze, die Qualität, Inhalte und Finanzierung von Bildung und Weiterbildung regeln – aber nur bis 65», sagt Mike Martin, «würde man gleiche strukturelle Bedingungen für alle Altersgruppen schaffen, müssten sich Ältere nicht dafür rechtfertigen, dass sie sich für Bildung interessieren.»
Verdrängte Verletzlichkeit
Solche Hindernisse zu erkennen, sie aus dem Weg zu räumen und neue Möglichkeiten für ältere Menschen zu schaffen, um an der Gesellschaft teilzuhaben, ist eines der Ziele der Forschung am Healthy Longevity Center –sie manifestieren sich im Mobilitätsprojekt ZuReach, aber auch in der digitalen Lernplattform WiseLearn für Menschen über 65 Jahre oder einem neu entwickelten Betreuungskonzept für Personen mit Demenz, die unter anderem am HLC entstanden sind.
Mit ihren Projekten arbeiten die Forscher:innen der UZH an einem neuen, facettenreicheren Altersbild und sie geben dem Modebegriff «Healthy Longevity» eine neue Bedeutung. Die «gesunde Langlebigkeit» ist zurzeit
weltweit ein Hype-Thema. Das Geschäft mit Anti-AgeingKuren und -Kliniken, die die vermeintlich ewige Jugend versprechen, floriert und Influencer wie der amerikanische Unternehmer Bryan Johnson, der mit einem strengen Trainings- und Diätregime versucht, sein Leben zu verlängern, geben in den sozialen Medien den Takt vor. «Hinter dem internationalen Longevity-Hype steht das Ziel, mit Mitteln der Medizin und der Biologie das Altern zu bekämpfen», sagt Christina Röcke, «er beruht auf einer Gesundheitsvorstellung, die auf Jugendlichkeit fixiert ist und unsere Verletzlichkeit verdrängt.»
Dem diametral entgegengesetzt ist die Auffassung der Healthy-Longevity-Forschenden an der UZH: Sie verstehen Gesundheit und Lebensqualität nicht als Abwesenheit von Krankheit, sondern als Chance für Menschen, trotz gesundheitlicher Einschränkungen das zu tun, was für sie sinnvoll und wichtig ist. Dies betont auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem neuen
UZH Healthy Longevity Center
Wie kann man die Lebensqualität bis ins hohe Alter erhalten und fördern? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Altersforschung an der UZH seit über zwanzig Jahren intensiv – etwa am Universitären Forschungsschwerpunkt «Dynamik Gesunden Alterns» und am Kompetenzzentrum für Gerontologie. Das Thema gesunde Langlebigkeit ist heute ein wichtiger Teil von strategischen internationalen Partnerschaften der UZH, etwa mit der WHO, der Humboldt Universität, der University of Queensland und dem King’s College London. Um die Umsetzung von Forschungsergebnissen weiter zu stärken, lancierte die UZH 2022 dank der Velux Stiftung das «Healthy Longevity Center». Ziel ist, innovative Ansätze zu entwickeln, die die funktionalen Fähigkeiten und die Lebensqualität im Alter fördern. Gesunde Langlebigkeit ist eine von vier strategischen Innovationsinitiativen des UZH Innovation Hub, also Forschungs- und Innovationsbereiche, die besonders zukunftsweisend sind und entsprechend unterstützt werden.
Weitere Informationen zu Forschung, Kooperationen und Innovationsprojekten: www.hlc.uzh.ch
UZH Innoviation Hub: www.innovation.uzh.ch
Aktiviere eBill im Online Banking in nur 3 Schritten:
1 Einloggen
Logge dich wie gewohnt ins Online Banking deiner Bank ein.
Wähle in der Navigation «eBill» aus und aktiviere den Service.
Nun Kannst du Rechnungssteller auswählen, von denen du Rechnungen via eBill erhalten möchtest.
Praktische Funktionen
Mit der Dauerfreigabe kannst du wiederkehrende Rechnungen automatisch bezahlen. Du kannst dich bequem per E-Mail über eingehende Rechnungen informieren lassen. Und mit der Sharing-Funktion kannst du eine andere Person berechtigen, deine Rechnungen zu bewirtschaften.
RECHNUNGEN
• Sicher und mit wenigen Klicks Rechnungen bezahlen
• Volle Kontrolle und Übersicht dank automatischer Archivierung
• Weniger Aufwand und nie mehr Referenzen abtippen
• Papierlos und Ressourcen schonend
Jetzt mehr erfahren auf ebill.ch oder direkt bei deinem Rechnungssteller

Modell des gesunden Alterns, an dem UZH-Psychologe Martin mitgearbeitet hat. Wichtig ist deshalb, Gesundheit individuell und situationsbezogen zu verstehen. «Eine Person ist mehr als ihre Symptome», sagt Mike Martin, «statt Krankheiten nach Diagnosen zu klassifizieren, sollten wir darauf schauen, wie sie sich individuell manifestieren – im Fachjargon nennt man das Phänotypisierung.» Eine Person, die an Demenz leidet, kann beispielsweise durchaus zuhause leben – wenn es die Lebensumstände erlauben. Dies zu erkennen, ermöglicht auch massgeschneiderte Lösungen, die zu mehr Lebensqualität führen.
Universität in der Vordenkerrolle
Gesunde Langlebigkeit ist eine von vier strategischen Innovationsinitiativen des UZH Innovation Hub, also Forschungs- und Innovationsbereiche, die besonders zukunftsweisend sind und entsprechend unterstützt werden. Das UZH Healthy Longevity Center wolle Innovationen vorantreiben, die ein ganzes System verändern, sagt Mike Martin. Er sieht die akademische Forschung in einer Vordenkerrolle, sozusagen als wissenschaftlichen Think-Tank für die gesunde Langlebigkeit.
«Wir sollten definieren, was die grossen gesellschaftlichen Fragen und Probleme sind, und daran arbeiten, wie wir sie lösen können», sagt Martin. Die universitäre Forschung könne so Wirtschaft und Gesellschaft inspirieren – und beispielsweise Start-up-Firmen zu konkreten Projekten anregen. Um den Weg für solche
Projekte zu ebenen, ist die Pflege eines dichten Netzwerks von Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Öffentlichkeit und Wirtschaft deshalb eine wichtige Aufgabe des Healthy Longevity Center.
Das grosse Kapital für Innovationen am HLC sind die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die es ermöglicht ein komplexes Thema wie die gesunde Langlebigkeit differenziert zu bearbeiten, und die riesigen Mengen an Daten, die die Altersforscher:innen beispielsweise im MOASIS-Projekt bisher zusammengetragen haben. Sie sind die Grundlage für neue wissenschaftliche Erkenntnisse und für konkrete Problemlösungen, an denen Projekte wie ZuReach arbeiten.
In einem neuen Projekt wollen die Forschenden des HLC nun gemeinsam mit UZH-Informatiker:innen den bisher geschaffenen Datenraum mit Daten aus Psychologie, Medizin, Biologie und Geschichtsforschung erweitern und diese vereinheitlichen, damit sie besser nutzbar sind. Mit Hilfe dieses gespeicherten Wissens könnten künftig individuelle digitale Beratungssysteme entstehen, die älteren Menschen zur Seite stehen, sie in alltäglichen Situationen unterstützten und damit ihr Wohlbefinden fördern. «An solchen sozial verantwortlichen Technologien sollten wir weiterarbeiten», sagt Mike Martin, «das sind Innovationen, die die Gesellschaft weiterbringen.» Sie ermöglichen Menschen beispielsweise, ohne Hürden durch Zürich zu flanieren.
Prof. Mike Martin, m.martin@psychologie.uzh.ch
Dr. Christina Röcke, christina.roecke@uzh.ch

C.G. Jung und die Entdeckung der Psyche in


PORTRÄT — Celestin Mutuyimana
Celestin Mutuyimana erlebte den Genozid gegen die Tutsi in Ruanda als Kind. Heute forscht der Psychologe dazu, wie Gesellschaften historische Traumata überwinden können. Und er versucht, seine Landsleute zu heilen.

«Ich will ein Katalysator des Wandels sein. Und nicht ein Sklave der Geschichte.»
Celestin Mutuyimana
Text: Andres Eberhard
Bilder: Diana Ulrich
Mit der Tochter an der Hand kommt Celestin Mutuyimana nach Hause, es ist Freitagnachmittag und die letzten Sonnenstrahlen des Tages scheinen auf die alte Mehrfamilienhaussiedlung. In Zürich-Schwamendingen hat die Familie aus Ruanda eine neue Heimat gefunden, eine einfache Dreizimmerwohnung mit kleinem Balkon, auf dem es dank der nahen Lärmschutzwand ruhig ist. Kaum ist er über die Türschwelle, fragt Mutuyimana auf Englisch: «Wollen wir zuerst etwas essen?» Seine Frau Claudette hat etwas vorbereitet. «Ah, okay, zuerst die Arbeit, ich verstehe. Wir sind ja in der Schweiz», sagt er und lacht. Die jüngere Tochter setzt sich derweil bereits einmal an den Esstisch.
Seit zwei Jahren lebt Mutuyimana gemeinsam mit seiner Familie hier am Stadtrand von Zürich. Der 38-Jährige aus Ruanda kam bereits 2020 mit einem Excellence Scholarship nach Zürich, damals noch allein. Sein Stipendiumsjahr begann ausgerechnet während der Corona-Pandemie. «Es war hart. Ich reiste erstmals ausserhalb von Afrika. Es fühlte sich an, als müsste ich noch einmal lernen zu leben – wie ein Kind», erinnert er sich an die Zeit, nachdem er in einem beinahe leeren Airbus am Flughafen Zürich gelandet war.
Stummes Leiden
Als Mutuyimana am Psychologischen Institut der UZH und am Collegium Helveticum schliesslich eine Stelle als Postdoktorand antreten konnte, kam die Familie nach. Heute gefalle es allen in Zürich sehr gut, sagt er. Die Kinder, heute sieben und fünf Jahre alt, gehen zur Schule und in den Kindergarten. Und seine Frau schätze, dass sie sich auf der Strasse sicher fühlt – etwas, das für Menschen aus Ruanda nicht selbstverständlich ist.
Denn der Genozid, der sich 1994 im ostafrikanischen Land ereignete und dem schätzungsweise 800000 Angehörige der Tutsi zum Opfer fielen, hat bei vielen seelische Wunden hinterlassen – so auch bei ihm und seiner
Frau, die damals beide noch Kinder waren. Sein Vater starb in dem Konflikt, seine Mutter, als er noch zur Schule ging. Mutuyimana sagt: «Ich würde sagen, ich habe mich selbst geheilt. Nun möchte ich anderen bei der Heilung helfen.» Er denkt etwas nach und ergänzt: «Ich will ein Katalysator des Wandels sein. Und nicht ein Sklave der Geschichte.»
Mutuyimana arbeitete in Ruanda während und nach seinem Studium zwölf Jahre als Psychotherapeut. Nun beschäftigt er sich in seinem Postdoktorat hauptsächlich mit historischen Traumata. Sein Heimatland ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. «Ich traf so viele Menschen, die unter Traumata litten. Doch niemand sprach darüber, und niemand tat etwas», sagt er.
Keine Schwäche zeigen
Mutuyimanas Forschung baut auf einem Grundgedanken auf: Traumata unterscheiden sich je nach Kultur. Neben individuellen Symptomen sind auch sogenannte «kulturelle Skripte» von Trauma relevant, wie es die Wissenschaft nennt – also gesellschaftlich und kulturell geprägte Muster des Erlebens, Sprechens und Heilens von Traumata.
Dazu forscht Mutuyimana auch in anderen Ländern, so etwa in der Ukraine, in Afghanistan, China, Georgien und weiteren Ländern in Ostafrika: Kenia, Uganda, Tansania. Was viele von kollektiven Traumata betroffene Länder auszeichnet: Darüber zu sprechen, ist tabu.
«In vielen Kulturen gilt es, stark zu sein und keine Schwäche zu zeigen», sagt der Psychologe. In der Ukraine gebe es dafür sogar einen eigenen Begriff: «Kozak». Und in Georgien besagt eine Redensart, dass der Feind das eigene Leiden nicht kennen sollte.
Historische Traumata zeichnen sich dadurch aus, dass sie über Generationen hinweg in der Gesellschaft verankert bleiben. Jeder fünfte junge Mensch in Ruanda, der nach dem Genozid geboren ist, leide unter posttraumatischen Belastungsstörungen, sagt Mutuyimana. «Das heisst, dass Eltern oder das Umfeld das Trauma den Kindern unbewusst weitergeben», sagt der Forscher. Traumata sind also vererbbar – und bleiben bestehen, weil sie tabuisiert werden – ein Teufelskreis.
Mutuyimana hat aber auch eine gute Nachricht, und es ist ihm wichtig, diese unter die Leute zu bringen. Zuletzt äusserte er sich in einem Video-Podcast dazu. Der Host, ein ruandischer Journalist, wählte als Titel für die Folge «The Mind Doctor», also «Der Seelendoktor». Über zwei Stunden lang spricht er mit seinem Gegenüber über die Gründe, warum viele Menschen in Ruanda auch dreissig Jahre nach dem Bürgerkrieg noch unter den Folgen leiden. «Manche Frauen weinen auf dem Motorrad auf dem Weg zur Arbeit», sagt er einmal. «Sie können nicht darüber reden. Aber immerhin können sie weinen. Das entlastet.»
Gegen Ende des Gesprächs wird der Psychologe dann hoffnungsvoll: «Das Gute ist: Ich habe herausgefunden, dass nicht nur Traumata vererbbar sind. Sondern auch Resilienz.» In einer Untersuchung mit Müttern und ihren Töchtern konnte er zeigen, dass widerstandsfähigere Mütter auch widerstandsfähigere Töchter hatten.

«Wenn möglichst viele von uns über Lösungen nachdenken, können wir an der traumatischen Erfahrung sogar wachsen.»
Celestin Mutuyimana
Aber nicht nur das: Die Resilienz der Töchter hatte auch einen positiven Effekt auf die Mütter. «Das heisst: Wenn möglichst viele von uns über Lösungen nachdenken, können wir an der traumatischen Erfahrung sogar wachsen», so Mutuyimana im Podcast.
Mutuyimana ist kein Forscher, der Distanz hält und beobachtet. Er geht hin und redet mit den Menschen.
Und er forscht auch, um zu helfen. Damit seine Erkenntnisse nicht im Elfenbeinturm bleiben, hat er sich eine professionelle Videokamera angeschafft. Vier wissenschaftliche Filme hat er bereits gedreht. In «Hear My Voice» spricht er mit der Mutter eines gefallenen Soldaten aus der Ukraine, mit Tätern und Opfern des Genozids in Ruanda und mit Psychologinnen und spirituellen Heilern aus ganz Afrika.
Seelische Wunden heilen
In einer Szene wird er von einem Mann mit Vollbart, Rastas und Holzschmuck durch einen Garten geführt und lässt sich erklären, mit welchen traditionellen Pflanzen oder Riten der Heiler seine Kunden behandelt. «Sie sagen, sie fühlen ein komisches Ding in sich, das sie umbringt. Natürlich gibt es keine Krankheit, die ‹Komisches Ding› heisst», sagt dieser im Film. Doch das komische Ding sei real in der ruandischen Kultur. «Die Menschen können genau erklären, wie es sich anfühlt. Es verursacht Rückenweh, Kopfweh und Schwindel.»
Szenewechsel. Mutuyimana sitzt in einem kahlen Büro im dritten Stock des Psychologischen Instituts an der Binzmühlestrasse, vor sich eine Tasse mit Früchtetee. Im Bücherregal ist noch viel Platz, lediglich fünf, sechs Bücher zu «Abnormal Psychology» stehen darin. «Der Rest ist da drin», sagt er und zeigt auf seinen Computer. Mutuyimana zieht sein Handy aus der Hosentasche und rollt etwas näher heran, um den Bildschirm zu zeigen. Er hat eine WhatsApp-Gruppe geöffnet, einen Kanal des «Baho Smile Institute». Das Institut hat er im Jahr 2019 gegründet mit dem Ziel, seinen Landsleuten zu helfen, ihre seelischen Wunden zu heilen. Romantische Beziehungen, positive Elternschaft und Sinn im Leben seien die Schlüssel für ein positives Leben mit weniger Stress und Traumawunden, heisst es auf der Website. Das Motto: «Nichts im Leben macht Sinn ohne ein Lächeln.»
Über den WhatsApp-Kanal geben Psychotherapeuten in der Landessprache Kinyarwanda Tipps, wie die Abonnenten mit Niedergeschlagenheit, Enttäuschungen oder psychischen Problemen umgehen können. Die Gruppe ist mit 1024 Mitgliedern voll, darum gibt es mittlerweile eine zweite. Sie umfasst weitere 1000 Mitglieder.
Die Umuti-Methode
Der Psychologe rollt wieder zurück an seinen Arbeitsplatz. «Das hier wird den Kanal ablösen», sagt er und öffnet eine Website namens «Umuti Vitality Space». Auf der Site, die bald online gehen soll, können Nutzer:innen sich selbst helfen, Hilfe von einem Therapeuten bekommen oder sich in Online-Selbsthilfegruppen austauschen. «In Ruanda kostet eine Therapiestunde einen ganzen Monatslohn», so Mutuyimana. Das niederschwellige Online-Tool ermögliche ausserdem, sich anonym helfen zu lassen.
Die Methode, mit der Mutuyimana möglichst viele seiner Landsleute heilen will, basiert auf dem afrikanischen philosophischen Konzept Ubuntu. Dies bedeutet in etwa: «Ich bin, weil du bist.» Es kann auch interpretiert werden als: Erst gemeinsam werden wir zu Menschen.
Mutuyimanas «Ubuntu Mulitsystemic Intervention» (Umuti) baut auf diesem in der ruandischen Kultur verankerten Gedanken auf. Heilung soll nicht individuell, sondern in Beziehung stattfinden – innerhalb von Familie und Gesellschaft. Durch gängige Metaphern, vertraute Sprache und den Einbezug traditioneller Praktiken sollen bewährte psychotherapeutische Techniken an die ruandische Kultur angepasst werden.
Die Umuti-Methode sei auf andere Nachkriegsgebiete übertragbar, sagt Mutuyimana, denn ähnliche Konzepte von Gemeinschaft gebe es etwa im chinesischen Konfuzianismus, in Japan, Indien sowie muslimischen und jüdischen Gemeinschaften. «Wir müssen als Gemeinschaft lernen, wie wir uns kollektiv heilen können», sagt Mutuyimana. «Es ist die einzige Lösung.»
Berg oder Strand?
Welches ist die grösste Entdeckung Ihres Fachs?
Das Konzept der kulturellen Skripte von Traumata. Wenn wir lieben oder trauern, orientieren wir uns an dem, was bei uns üblich ist. Dasselbe gilt für Traumata. Was als traumatisch gilt, wie darüber gesprochen wird und wie Heilung verstanden wird, ist in jeder Kultur anders.
Wo sind Sie am kreativsten?
Zuhause, wenn ich während der Nacht aufwache. Die Ideen kommen mir manchmal im Traum.
Was tun Sie, um den Kopf auszulüften und auf neue Gedanken zu kommen?
Ich gehe raus und rede mit Menschen. Ich mag engagierte Diskussionen mit Freunden. Ich nehme dann bewusst die gegenteilige Position ein.
Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne abendessen und weshalb?
Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden. Ich würde ihn fragen wollen, warum er vorhatte, mit 80 Jahren noch einmal Präsident zu werden.
Drei Bücher, die Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden?
«Cultural Psychology and PTSD» von Andreas Maercker. «Flourish» von Martin Seligman. Und «Amazina y’inka», ein Singbuch für Kühe aus Ruanda. Kühe sind in Ruanda ein Symbol für das Leben.
Kugelschreiber oder Laptop? Laptop.
Berg oder Strand? Strand.
KI verändert rasant, wie wir arbeiten, lernen und forschen. Das fordert auch die Hochschulen heraus. Der UZH-Think-Tank «FutureU» hat Zukunftsszenarien für die Universitäten im digitalen Zeitalter entwickelt. Medizinerin Claudia Witt und Politologe Karsten Donnay darüber, was Hochschulen künftig leisten müssen und wie sie sich positionieren sollten.

Interview: Thomas Gull und Roger Nickl
Bilder: Stefan Walter
Claudia Witt, Karsten Donnay, die Digitalisierung –insbesondere durch KI – entwickelt sich mit enormer Geschwindigkeit. Was bedeutet das für die Gesellschaft?
CLAUDIA WITT: Ich habe den Eindruck, dass vieles mit sehr hohem Tempo geschieht, ohne dass wir als Gesellschaft noch bewusst steuern. Wir reagieren auf Entwicklungen, statt aktiv zu gestalten. Es fehlt an Momenten
des Innehaltens, in denen wir fragen, ob wir das wirklich wollen und wie wir die neuen Möglichkeiten nutzen. Diese Dynamik spiegelt sich auf vielen Ebenen. Manche Veränderungen durch KI sind sichtbar, etwa in Suchmaschinen oder Software, andere bleiben im Hintergrund. Als Gesellschaft nehmen wir oft nur wahr, was unmittelbar spürbar ist, und verlieren so das Gefühl für den Gesamtzusammenhang.
KARSTEN DONNAY: Das sehen wir auch in aktuellen Umfragen. Die Schweizer Bevölkerung steht der Digitalisierung insgesamt positiv gegenüber. Wenn es aber

Engagieren sich für die Universität der Zukunft: Medizinerin Claudia Witt und Politologe Karsten Donnay im Kollegiengebäude der UZH.
um KI geht, werden Skepsis und Angst spürbar. Das liegt weniger an der Technologie selbst als am Tempo der Veränderungen und an der mangelnden Transparenz. Wir wissen oft nicht genau, wo KI überall eingesetzt wird, und fühlen uns dadurch verunsichert. Auch die Politik kann kaum Schritt halten. So entsteht der Eindruck, dass wir Entwicklungen hinterherlaufen, statt sie zu gestalten. Sie beschreiben eine gewisse Überforderung. Welche Rolle spielt dabei die Angst vor Kontrollverlust oder Veränderung?
DONNAY: Angst ist ein wichtiger Faktor. Viele Menschen erleben, dass KI plötzlich in Arbeitsprozesse, Informationssysteme oder Alltagstechnologien eindringt. Wenn man nicht versteht, wie das funktioniert, entsteht Unsicherheit. Gleichzeitig geht alles sehr schnell: Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt, Informationsquellen und Kommunikationsformen sich in kurzer Zeit verändern. Diese Geschwindigkeit lässt kaum Zeit, sich anzupassen.
WITT: Das gilt auch für Fachbereiche wie die Medizin. Ärztinnen und Ärzte sind plötzlich mit neuen digitalen Tools konfrontiert, die in ihre Arbeitsprozesse eingreifen.
Karsten Donnay ist Politologe und leitet den Forschungsbereich politische Verhaltensforschung und digitale Medien am Institut für Politikwissenschaft. In seiner Forschung untersucht er die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Politik und Gesellschaft mit einem besonderen Augenmerk auf digitale Onlinemedien. Er ist DSI-Professor und Co-Direktor des Population Research Center der Universität Zürich. donnay@ipz.uzh.ch
Claudia Witt ist Medizinerin und Professorin an der Medizinischen Fakultät. Sie forscht zu Themen im Bereich Digital Health. Zudem engagiert sie sich als Co-Direktorin der Digital Society Initiative, ist Mitglied des Digital Strategy Board und Facilitatorin des Think-Tank «FutureU» für die digitale Transformation. claudia.witt@uzh.ch
Wie gehen Sie an der Universität Zürich mit dieser Dynamik um?
DONNAY: Wir erleben auch hier grosse Unsicherheit. Studierende fragen sich: Was ist erlaubt? Was ist ethisch vertretbar? Unsere Fakultät hat daher klare Richtlinien entwickelt, die Transparenz fördern. Und wir als Institut haben dazu ganz konkrete Empfehlungen für unsere Dozierenden ausgearbeitet. Studierende sollen offenlegen, ob sie KI verwendet haben – etwa für Textkorrekturen oder für die Datenanalysen. Es geht nicht darum, KI zu verbieten, sondern verantwortungsvoll zu nutzen. Wir lehren, wie man diese Tools kritisch einsetzt: Wo helfen sie wirklich? Wo erzeugen sie Probleme? Dabei lernen wir selber mit. Auch die Lehrenden experimentieren – zum Beispiel mit KI bei der Vorbereitung von Lehrmaterial, doch am Ende trägt immer der Mensch die Verantwortung.
Viele erkennen das Potenzial, aber es fehlt oft die Zeit, sich bewusst damit auseinanderzusetzen.
Wie genau verändert KI die Medizin? Wo sehen Sie Chancen – und wo Risiken?
WITT: Am weitesten verbreitet ist der Einsatz in der Bildanalyse – etwa in der Radiologie bei Brustkrebserkennung. Hier zeigen Studien, dass KI in der Auswertung bestimmter Aufnahmen ähnlich gut oder besser ist als Radiologinnen und Radiologen. Gleichzeitig wird KI zunehmend in der Administration eingesetzt, etwa um Berichte zu verfassen, oder in der Dokumentation. Das kann tatsächlich entlasten – vorausgesetzt, die Systeme sind gut integriert und funktionieren verlässlich. Ich betrachte sie als Unterstützungstool. Auch bei automatisch generierten Berichten überprüft am Ende immer eine Ärztin oder ein Arzt die Richtigkeit und unterschreibt. Das ist keine Mensch-oder-Maschine-Frage, sondern Mensch und Maschine arbeiten zusammen.
Herr Donnay, Sie beschäftigen sich mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von KI. Wo sehen Sie positive Entwicklungen?
DONNAY: Viele potenziell positive Effekte von KI sind derzeit noch Versprechen. Man sieht Verbesserungen in alltäglichen Anwendungen – etwa bei der Bildverarbeitung in Smartphones oder bei Übersetzungstools. Aber der tiefere gesellschaftliche Nutzen ist schwer messbar, weil wir uns noch in einer frühen Phase der Integration befinden. Jüngere Menschen sind dabei oft deutlich experimentierfreudiger. Viele nutzen ChatGPT oder ähnliche Tools selbstverständlich. Ältere Generationen oder weniger technikaffine Gruppen sind noch zögerlich. Diese Ungleichheit führt zu einem Auseinanderdriften in der Erfahrung mit KI. Zudem sind auch Unternehmen derzeit in einer Experimentierphase. Es gibt unzählige Tools, aber oft noch keine Gewissheit, welche sich durchsetzen und welche wirklich nützlich sind. Diese Unsicherheit prägt den öffentlichen Diskurs.
WITT: Ich sehe das ähnlich. Wir alle befinden uns in einer Lernphase. Wichtig ist, dass wir Freiräume schaffen, in denen Studierende und Lehrende ausprobieren dürfen, damit Innovation nicht durch zu starre Regeln ausgebremst wird. Gleichzeitig braucht es aber auch ethische Leitplanken, um Qualität und Integrität zu sichern.
Wie ist die Grundhaltung der UZH im Umgang mit KI?
DONNAY: Wir verfolgen einen pragmatischen Ansatz. Die Realität ist, dass über 90 Prozent der Studierenden KI bereits verwenden. Ein Verbot wäre weltfremd. Stattdessen schaffen wir Rahmenbedingungen: Wir erklären, was erlaubt ist, was nicht und wie man verantwortungsvoll damit arbeitet. Gleichzeitig sammeln wir Erfahrungen und passen die Regeln laufend an.
Nun hat das Digital Strategy Board der UZH den Think-Tank «FutureU» zur Universität im digitalen Zeitalter initiiert. Sie waren am ersten Positionspapier beteiligt. Im Zentrum steht die Idee, den Umgang mit KI aktiv zu gestalten. Was wollen Sie damit erreichen?
WITT: Mit dem Think-Tank haben wir einen Raum geschaffen, in dem wir bewusst über die Zukunft nachdenken – jenseits des Alltagsbetriebs. Wir wollen nicht nur auf Entwicklungen reagieren, sondern aktiv gestalten. Das Positionspapier ist ein erster Schritt: Es soll Orientierung geben und zeigen, wo die Universität gestalten kann. Wir möchten die Community anregen, sich zu fragen, wie wir in der eher fernen Zukunft Forschung und Lehre gestalten wollen. Dafür nutzen wir Methoden der Zukunftsforschung, um Szenarien zu entwickeln, die fundierte Visionen sind.
Welches sind die Herausforderungen, vor denen Universitäten stehen, und welche Rolle werden sie künftig spielen?
WITT: KI verändert die Bildungslandschaft fundamental. Wissen ist nicht mehr exklusiv. Schon heute kann man vieles online lernen, auch durch kommerzielle Plattformen. In der Zukunft werden vermehrt KI-Tools Lerninhalte generieren. Auch Forschung findet nicht mehr nur an Universitäten statt: Immer mehr Unternehmen betreiben eigene Forschungszentren. Dadurch verschiebt sich die Rolle der Hochschulen.
«Wenn wir KI einfach nutzen, weil sie verfügbar ist, statt sie gezielt zu integrieren, verlieren wir die Souveränität über unser Handeln.»
Claudia Witt, Medizinerin

DONNAY: In manchen Bereichen ist die Industrie bereits führend – etwa in der Entwicklung von KI-Technologien. Universitäten haben weniger Ressourcen und kleinere Teams. Unser Vorteil liegt in der wissenschaftlichen Tiefe, in der Reflexion und im kritischen Denken. Wir sichern die Qualität und Glaubwürdigkeit von Wissen. Abschlüsse und Zertifizierungen sind noch immer ein starkes Gütesiegel –aber auch das kann sich verändern, wenn Arbeitsmärkte stärker auf praktische Fähigkeiten setzen. Was bleibt also der besondere Wert der Universität in Zukunft?
WITT: Zu den Stärken der Universität gehören Interdisziplinarität und die Verbindung von Forschung und Lehre. Wir können komplexe Themen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und inter- und transdisziplinär bearbeiten. Gerade im Zeitalter der KI wird diese Breite wichtiger denn je. Wir lernen durch Forschung und forschen durch Lehre – das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Unternehmen so nicht haben.
DONNAY: Die grossen gesellschaftlichen Fragen lassen sich nur noch inter- und transdisziplinär lösen. An der UZH arbeiten Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Solche Kooperationen sind eine Voraussetzung, um komplexe Phänomene wirklich zu verstehen. Das erfordert nicht nur Wissen, sondern auch die Fähigkeit, die Sprache anderer Disziplinen zu sprechen.
WITT: Deshalb ist es so wichtig, dass wir Strukturen wie die School for Transdisciplinary Studies haben, wo
Studierende transdisziplinär lernen und forschen. Sie zeigt, dass wir an der UZH verstanden haben, wie entscheidend fächerübergreifendes Denken für die Zukunft ist. Bleibt man in disziplinären Silos, ist man den künftigen Herausforderungen nicht gewachsen.
Der Think-Tank «FutureU: Universities in the Digital Age» ist eine der Antworten der UZH auf die Herausforderungen der digitalen Transformation. Er initiiert und unterstützt unter UZH-Angehörigen eine aktive, kritische und vorausschauende Auseinandersetzung mit den vielfältigen Entwicklungen, Chancen und Fragestellungen der digitalen Zukunft. Ein Kernteam entwickelt unterschiedliche Zukunftsszenarien, aus denen sich strategische Handlungsoptionen ableiten lassen.
Projektleitung und Kontakt: fabienne.jedelhauser@uzh.ch. Für mehr Information und das Positionspapier scannen Sie bitte den QR-Code.

Im Positionspapier FutureU haben Sie Szenarien für das Jahr 2050 entwickelt. Wo stehen wir in 25 Jahren?
WITT: Die Welt wird in 25 Jahren kaum wiederzuerkennen sein. Technologie wird allgegenwärtig sein und unseren Zugang zu Wissen grundlegend verändern. Vielleicht sind wir dann direkt mit Informationsquellen vernetzt, unser Denken verschmilzt gewissermassen mit Datenströmen. Gleichzeitig wird Robotik in vielen Lebensbereichen selbstverständlich sein – in Pflege, Industrie oder Forschung. Das wird den Arbeitsmarkt massiv verändern: Viele Routinetätigkeiten werden wegfallen, neue Berufe entstehen.
UZH.ai
Forschende der UZH entwickeln künstliche Intelligenz, nutzen sie gezielt in ihrer Forschung und untersuchen ihre Auswirkungen auf Wissenschaft und Gesellschaft. Seit September 2025 vernetzt UZH.ai die KI-Forschenden der Universität Zürich noch enger und fördert den Dialog mit Industrie, Politik und Gesellschaft zum Thema KI.
Projektleitung und Kontakt: ruben.kranendonk@uzh.ch www.ai.uzh.ch/en.
«Die Realität ist, dass über 90 Prozent der Studierenden KI bereits verwenden. Ein Verbot wäre weltfremd.»
Karsten Donnay, Politologe
Auch die Forschung selbst wird sich wandeln. Wenn sie zu stark von industriellen Interessen geprägt wird, droht die gesellschaftliche Perspektive zu kurz zu kommen. Universitäten müssen daher Räume erhalten, in denen Forschung betrieben werden kann, ohne dass sie sofort ökonomisch verwertbar sein muss. In der Lehre werden immersive, interaktive Lernumgebungen Alltag sein. Studierende werden mit persönlicher KI-Begleitung– AI-Buddys – arbeiten, die Lernen individuell unterstützen. Unsere Aufgabe wird sein, den kritisch-reflektierten Umgang mit Wissen zu fördern – das bleibt die zentrale Kompetenz der Zukunft.
Im Positionspapier sehen Sie die Universität als «Trustworthy Institution», als Vertrauenszentrum für die Gesellschaft. Weshalb spielt Vertrauen für Universitäten eine so grosse Rolle?
WITT: Vertrauen ist die Grundlage jeder wissenschaftlichen Institution. Es entsteht wechselseitig: Eine Institution muss glaubwürdig handeln, und die Gesellschaft muss bereit sein, ihr Vertrauen zu schenken. Historisch galten Universitäten als Orte der Verlässlichkeit und Expertise. Dieses Bild müssen wir im digitalen Zeitalter neu mit Leben füllen. Umfragen zu Digitalisierungsthemen zeigen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in Universitäten nach wie vor hoch ist – deutlich höher als in die Industrie. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht gewinnorientiert arbeiten und Vielfalt zulassen. Gerade diese Offenheit, unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren, ist ein Element von Vertrauenswürdigkeit.
DONNAY: Vertrauen hängt auch mit der Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft zusammen. Wenn Forschung sich zu sehr an wirtschaftlichen Interessen orientiert, geraten die langfristigen Fragen aus dem Blick: Was nützt der Gesellschaft wirklich? Wo entstehen Fehlentwicklungen? Hier kommt die kritische Funktion der Universitäten ins Spiel. Wir sollen nicht nur Wissen produzieren, sondern auch Entwicklungen hinterfragen – und deutlich machen, welche Konsequenzen sie haben können. Diese kritische Distanz bleibt essenziell. Politik und Öffentlichkeit brauchen verlässliche, unabhängige Partner:innen, die Orientierung geben. Universitäten sollten Debatten anstossen, Denkräume öffnen und unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen.
Wie verändert sich das Verhältnis zu grossen TechKonzernen wie Google & Co., die selbst stark in Forschung investieren?
WITT: Die grossen Technologiekonzerne werden ihre Dominanz weiter ausbauen. Sie verfügen über enorme Ressourcen und Datenmengen – das wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken. Deshalb ist es wichtig, dass Universitäten ihre eigenständige Rolle bewahren. Kooperationen sind sinnvoll und oft notwendig, aber sie müssen auf Augenhöhe stattfinden. Die Stärke von Universitäten liegt darin, Themen mit gesellschaftlicher Relevanz zu verfolgen – ohne primär ökonomische Ausrichtung. Wir können uns ergebnisoffene Forschung erlauben. Gleichzeitig brauchen wir den Dialog mit der Wirtschaft, um auch gemeinsam zu gestalten.
DONNAY: Zwischen Universität und Industrie besteht ohnehin ein reger Austausch. Forschende wechseln in Unternehmen und zurück – Wissen zirkuliert. Das ist wertvoll, weil so gegenseitiges Lernen entsteht. Wichtig ist zudem, dass Universitäten ihren Bildungsauftrag wahrnehmen. Die meisten unserer Absolventinnen und Absolventen arbeiten später nicht in der Forschung, sondern in vielen verschiedenen Rollen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wenn sie das kritische Denken, den reflektierten Umgang mit Daten und ethische Verantwortung mitnehmen, prägen sie diese Bereiche entsprechend mit. Lehre ist also nicht nur Berufsausbildung, sondern eine Schule des Denkens –und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Gesellschaft.
Sie haben die Offenheit der Wissenschaft angesprochen. Was bedeutet das konkret für das Vertrauen?
WITT: Offenheit ist ein zentraler Pfeiler wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit. Open Science bedeutet, Methoden, Daten und Ergebnisse transparent zu machen, so, dass andere Forschende sie prüfen, nachvollziehen und auch für weitere Forschung nutzen können. Open Science macht Forschung überprüfbar und stärkt ihre Qualität. Dies unterscheidet uns von privatwirtschaftlicher Forschung, in der vieles nicht zugänglich ist.
Ist das nicht ein bisschen naiv: die Universität als vertrauenswürdige Institution und als kritische Sparringpartnerin für Wirtschaft und Gesellschaft –


sorgen
Mit einem Vermächtnis an
Mit einem Vermächtnis an die Natur – und an die Zukunft
Mit einem Vermächtnis an die Natur – und an die Zukunft
Jetzt vorsorgen, Ihren Nächsten und der Natur zuliebe. Informieren Sie sich: pronatura.ch/de/legate-erbschaften
Jetzt vorsorgen, Ihren Nächsten und der Natur zuliebe. Informieren Sie sich: pronatura.ch/de/legate-erbschaften
Jetzt vorsorgen, Ihren Nächsten und der Natur zuliebe. Informieren Sie sich: pronatura.ch/de/legate-erbschaften
Wir sind persönlich für Sie da:
Tel. 061 317 92 26
Wir sind persönlich für Sie da:
Wir sind persönlich für Sie da:
Tel. 061 317 92 26
Tel. 061 317 92 26

Fast Food und volle Regale: In der Überflussgesellschaft sind die Teller gut gefüllt. Doch die moderne Ernährung passt nicht immer zu unserer steinzeitlichen Biologie. Eine Folge davon sind Gewichtsprobleme, die sich weltweit epidemisch ausbreiten. Im Talk im Turm diskutieren die Evolutionsmedizinerin Nicole Bender und der Adipositas-Spezialist Philipp Gerber, wie wir unsere Ernährung ins Gleichgewicht bringen und wie sich schlechte Essgewohnheiten auf die Gesundheit auswirken.
Fastfood und volle Regale: In der Überflussgesellschaft sind die Teller die moderne Ernährung passt nicht immer zu unserer Folge davon sind Gewichtsprobleme, ausbreiten. Im Talk Turm diskutieren Evolutionsmedizinerin Nicole Bender und der Adipositas-Spezialist Gerber, wir unsere Ernährung ins Gleichgewicht bringen und schlechte Essgewohnheiten auf die Gesundheit auswirken.
Es diskutieren:
Die Evolutionsmedizinerin
Prof. Dr. Nicole Bender
Der Endokrinologe und Adipositas-Spezialist
Prof. Dr. Philipp Gerber
Moderation
Rita Ziegler und Roger Nickl, UZH Kommunikation
Montag, 2. Februar 2026
18.15 bis 19.30 Uhr
Restaurant UniTurm, Rämistrasse 71, 8006 Zürich Türöffnung 17.45 Uhr
Der Talk im Turm ist eine Koproduktion von UZH Alumni und UZH Kommunikation.
unter:
Anmeldung unter: www.talkimturm.uzh.ch
Eintritt (inklusive Apéro): CHF 45
Eintritt (inklusive Apéro): CHF 60
Mitglied bei UZH Alumni: CHF 30
Studierende: CHF 20
Mitglied bei UZH Alumni: CHF 40 CHF 20
Platzzahl beschränkt, Anmeldung erforderlich
Platzzahl
«Unsere Aufgabe wird sein, den kritisch-reflektierten Umgang mit Wissen zu fördern – das bleibt auch in Zukunft die zentrale Kompetenz.»
Claudia Witt, Medizinerin
das sind liberale Ideale, die lange als selbstverständlich galten. In den USA werden sie zurzeit grundsätzlich in Frage gestellt. Könnte es in Zukunft nicht sein, dass die unabhängige Expertise der Universitäten gar nicht mehr gefragt ist?
DONNAY: Dieses Risiko besteht durchaus. In unseren Zukunftsszenarien haben wir auch solche Entwicklungen diskutiert – bis hin zu der Frage, ob Regierungen überhaupt noch unabhängige Forschung fördern wollen. In den USA gibt es diese Tendenzen, kritische Wissenschaft politisch zu marginalisieren. Das zeigt, dass unabhängige, offene Universitäten nicht selbstverständlich sind. Genau deshalb müssen wir aktiv daran arbeiten, dass unsere Rolle anerkannt bleibt – politisch, gesellschaftlich und institutionell. Wir müssen deutlich machen, warum freie Forschung für Demokratie und Fortschritt unverzichtbar ist.
WITT: Es geht dabei nicht um Selbstzweck. Universitäten sind wichtig, weil sie Diversität und Gemeinwohl sichern. Sie geben auch Minderheitenpositionen Raum und ermöglichen gesellschaftliche Selbstreflexion. In der Schweiz ist das Vertrauen in die Hochschulen hoch, und ich bin optimistisch, dass wir diesen Wert bewahren können.
Wie geht es nach dem Positionspapier weiter?
WITT: Der ThinkTank bleibt aktiv. Momentan beschäftigen wir uns vertiefter mit «Trustworthiness» – also Vertrauenswürdigkeit – und danach mit den Kompetenzen, die Forschende und Lehrende in Zukunft brauchen werden. Nächstes Jahr wollen wir erneut in einem Zukunftsworkshop konkrete Szenarien für eine Universität in der digitalen Zukunft erarbeiten.
DONNAY: Parallel dazu vernetzen wir diese Arbeit mit anderen Initiativen – etwa der KIStrategie der UZH. Forschung, Lehre und Digitalisierung müssen zusammengedacht werden. Wir tauschen uns mit anderen Hochschulen aus, sammeln Best Practices und übertragen sie auf unsere Strukturen. Wichtig ist, kurzfristige Massnahmen mit langfristigen Perspektiven zu verbinden. Wir wollen in ein bis zwei Jahren so aufgestellt sein, dass wir technologische Entwicklungen aktiv mitgestalten können – und unsere Studierenden dabei mitnehmen. Denn wenn sie das Gefühl haben, die Universität bleibe hinter der Realität zurück, verlieren wir an Relevanz.
Wie offen ist die Universität selbst für diesen Wandel?
DONNAY: Die UZH hat in den letzten Jahren gezeigt, dass kultureller Wandel möglich ist – die Digital Society Initiative mit über 1400 Forschenden ist dafür ein gutes Beispiel. Sie hat bewiesen, dass Kooperation, Offenheit und gemeinsame Ziele die Grundlage sind, um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten.
WITT: Ich erlebe viel Offenheit dafür, mutig etwas Neues auszuprobieren – und gleichzeitig das kritische Denken zu bewahren. Aus meiner Sicht bleiben wir auch 2050 eine relevante, glaubwürdige Institution, wenn wir unsere Alleinstellungsmerkmale ausbauen und die Zukunft aktiv mitgestalten.
IMPRESSUM
UZH Magazin — 30. Jahrgang, Nr. 4 — Dezember 2025 — www.magazin.uzh.ch
Herausgeberin: Universitätsleitung der Universität Zürich durch die Abteilung Kommunikation
Leiter Storytelling & Inhouse Media: David Werner, david.werner@uzh.ch Verantwortliche Redaktion: Thomas Gull, thomas.gull@uzh.ch; Roger Nickl, roger.nickl@uzh.ch Autorinnen und Autoren: Brigitte Blöchlinger, brigitte.bloechlinger@uzh.ch; Andres Eberhard, mail@andreseberhard.ch; Mia Catarina Gull, miacatarina.gull@uzh. ch; Adrian Ritter, adrianritter@gmx.ch; Santina Russo, info@santinarusso.ch; Simona Ryser, simona.ryser@bluewin.ch; Barbara Simpson, barbara.simpson@uzh.ch; Theo von Däniken, theo.vondaeniken@uzh.ch — Fotografinnen und Fotografen: Frank Brüderli, Marc Latzel, Ursula Meisser, Diana Ulrich, Stefan Walter — Illustrationen: Cornelia Gann, Benjamin Güdel, Noyau
Gestaltung: HinderSchlatterFeuz, Zürich — Lithos und Druck: AVD Goldach AG, Sulzstrasse 10–12, 9403 Goldach, www.avd.ch
Inserate: print-ad kretz gmbh, 8646 Wagen, Telefon 044 924 20 70, info@kretzgmbh.ch
Abonnenten: Das UZH-Magazin kann kostenlos abonniert werden: publishing@kommunikation.uzh.ch — Adresse: Universität Zürich, Kommunikation, Redaktion UZH Magazin, Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich — Sekretariat: Fabiola Thomann, Tel. 044 634 44 30, Fax 044 634 42 84, office@kommunikation.uzh.ch
Auflage: 20000 Exemplare; erscheint viermal jährlich — Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck von Arti keln mit Genehmigung der Redaktion ISSN 2235-2805 — Dieses Produkt wurde klimaneutral produziert.

Das nächste UZH Magazin erscheint im März

19*01*2026
OPERN — OPERETTEN — OFFENBACH
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski (Leitung)
Marina Viotti (Mezzosopran)
Lionel Lhote (Bariton)
Musik von Jacques Offenbach
22*03*2026

NORDLICHTER UND INSELTRÄUME
Iceland Symphony Orchestra
Eva Ollikainen (Leitung)
Kian Soltani (Violoncello)
Musik von Thorvaldsdóttir, Elgar und Sibelius
28*04*2026
ALLESKÖNNER*INNEN
Aurora Orchestra
Nicholas Collon (Leitung)
Hayato Sumino (Klavier)
Musik von Adams, Gershwin und Strawinski
29*05*2026
VON ENGELN UND TITANEN
Utopia Orchestra
Teodor Currentzis (Leitung)
Vilde Frang (Violine)
Musik von Berg und Mahler
LAST-MINUTE-TICKETS CHF 5
30 Minuten vor Konzertbeginn bezahlen Studierende und Auszubildende gegen Vorweisen eines gültigen Ausweises oder der Kulturlegi der Caritas CHF 5 pro Ticket an der Abendkasse (gegen Barzahlung). Dieses Angebot gilt für alle Konzerte der Migros-Kulturprozent-Classics und für alle Kategorien, soweit verfügbar.
TICKETS JETZT! migros-kulturprozent-classics.ch
per Telefon +41 44 206 34 34
Musik Hug Zürich
Grossmünsterplatz 9 | 8001 Zürich info@musikhug.ch | www.musikhug.ch

