Preis: € 7,–
Ausgabe 2.25

SCHWERPUNKT: SICHERHEIT & RISIKO
WIEVIEL RISIKO BENÖTIGT SICHERHEIT UND WIE WIR DIE BALANCE HALTEN


Preis: € 7,–
Ausgabe 2.25

SCHWERPUNKT: SICHERHEIT & RISIKO
WIEVIEL RISIKO BENÖTIGT SICHERHEIT UND WIE WIR DIE BALANCE HALTEN

was Ihnen wichtig ist – mit unserem holistischen Ansatz.
Die Digitalisierung im Gebäudesektor schreitet stetig voran. Besonders im Hinblick auf Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen und einer hohe Anlagenverfügbarkeit spielen digitale Lösungen wie Datenanalyse oder proaktives Monitoring, Services oder Cloud-Plattformen eine große Rolle. Denn sie decken Energie-Einsparpotenziale auf und sorgen für eine hohe Gebäude-Performance. Je digitaler die Gebäudetechnik wird, desto wichtiger ist das Thema Cybersicherheit. Für Gebäudeeigentümer und -betreiber ist es unumgänglich bei ihrem Smart Building einen ganzheitlichen CybersecurityAnsatz zu berücksichtigen. Unsere Cybersecurity-Lösungen umfassen sowohl die Betriebstechnik (OT) als auch die Informationstechnik (IT). Unsere engagierten Expert:innen für Produkt- und Lösungssicherheit schützen Ihre digitalen Assets und kritischen Infrastrukturen über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom anfänglichen Produktdesign, bis hin zur kontinuierlichen Überwachung, Kontrolle und proaktiven Verteidigung, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
siemens.at/cybersecurity
Liebe Leserin, lieber Leser,

MAG. FRIEDRICH FAULHAMMER
Rektor der Universität für Weiterbildung Krems

MAG. STEFAN SAGL
Leiter Kommunikation und Chefredakteur „upgrade“
die Begriffe „Sicherheit“ und „Risiko“ , Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe des Universitätsmagazins upgrade, bilden ein gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld. Wie die jüngsten tragischen Ereignisse zeigen, erfährt Sicherheit paradoxerweise erst in ihrer Abwesenheit ihre volle Bedeutung. Die pointierte Wendung „There is no glory in prevention“ ist ebenso zutreffend wie „There is glory in prevention“. Letzteres jedoch meist in der differenzierten Rückschau und weit seltener mit Pathos bedacht. Unbestritten und bedeutsam bleibt, dass Sicherheit und Risiko globale Wettbewerbsfaktoren sind. Eine vollständige Vermeidung von Risiko durch ein Übermaß an Sicherheit und Regularien kann offenkundig jegliche Dynamik und Innovation untergraben – im schlechtesten Fall auch auf Kosten individueller Freiheiten. Entscheidend ist die kontinuierliche Abwägung. Erst in der Balance entsteht gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fortschritt.
Wie die Begriffe Sicherheit und Risiko zusammenhängen und in welchem Verhältnis sie zu Resilienz, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Krisenfestigkeit stehen, beleuchtet die aktuelle Ausgabe von upgrade. Sie spannt dabei einen weiten Bogen: von grundlegenden theoretischen Einordnungen über zentrale Themen der Sicherheitsforschung wie Cybersecurity, den Umgang mit Extremismus und Terrorismus bis hin zur bedeutenden Rolle der Spieltheorie und zum Wert von Risiken an sich.
Die Bildstrecke „Brick and the Wall“ illustriert anhand eindrücklicher Beispiele das Wechselspiel von Sicherheit und Risiko im Kontext historischer Gegebenheiten.
Viel Freude bei der Lektüre wünschen


Lesen Sie upgrade online!

Die Brandgilden des 16. Jahrhunderts waren Vorläufer der Feuerversicherung. Wenig später bildeten sich öffentliche Institutionen, die Garantien gegen das Risiko von Bränden übernahmen, wie erstmals in London um 1660. Die erste städtisch garantierte Feuerkasse in Deutschland wurde 1676 in Hamburg gegründet.
Schwerpunkt: Sicherheit & Risiko
Editorial Im Fokus
Campus Krems
Alumni-Club

Titelbild: Am 7. August 1974 balancierte Philippe Petit auf einem Drahtseil zwischen den Twin Towers. Sicherheit und Risiko sind ein Spannungsfeld, ihr Ausgleich ein Balanceakt. Die Bildstrecke „Brick and the Wall“ illustriert das Wechselspiel von Sicherheit und Risiko im Kontext historischer Gegebenheiten.
Idee und Konzeption: DLE Kommunikation & Wissenschaftsredaktion der Universität für Weiterbildung Krems
25 9 7 29 15 33 37 41 21
Was Sabine Herlitschka meint
Sicherheit und Risiko: Treiber oder Blockade für Innovation?
Von Menschen, Wölfen und dem guten Leben Spurensuche zwischen Philosophie, Politik und Ökonomie
Mut zur Freiheit
Im Gespräch mit Walter Seböck
Wenn viel auf dem Spiel steht Wie die Spieltheorie hilft, riskante Entscheidungen zu treffen
Trügerische Sicherheit Cyberattacken auf Unternehmen werden häufiger
Sicherheit beginnt mit Vertrauen Psychologische Sicherheit und wahre Bedrohung
Das Rennen ist offen Wie vertrauenswürdig und sicher ist aktuell KI?
Am stärksten im Verteidigungsmodus Gegen Extremismus hilft nur eine bessere Gegenerzählung
Das demografische Feld bestellen Integration muss uns gelingen – Ein Szenario zu Österreich 2040
Dieter Rothbacher widmet sich dem Schutz vor Gefahren 44 46 50
Wenn Algorithmen Wahrheit suchen Wie Desinformation automatisch erkannt werden kann
Gesellschaft und Forschung einander näherbringen
Im Porträt: Sicherheitsforscherin Bettina Pospisil
Alumni-Porträt
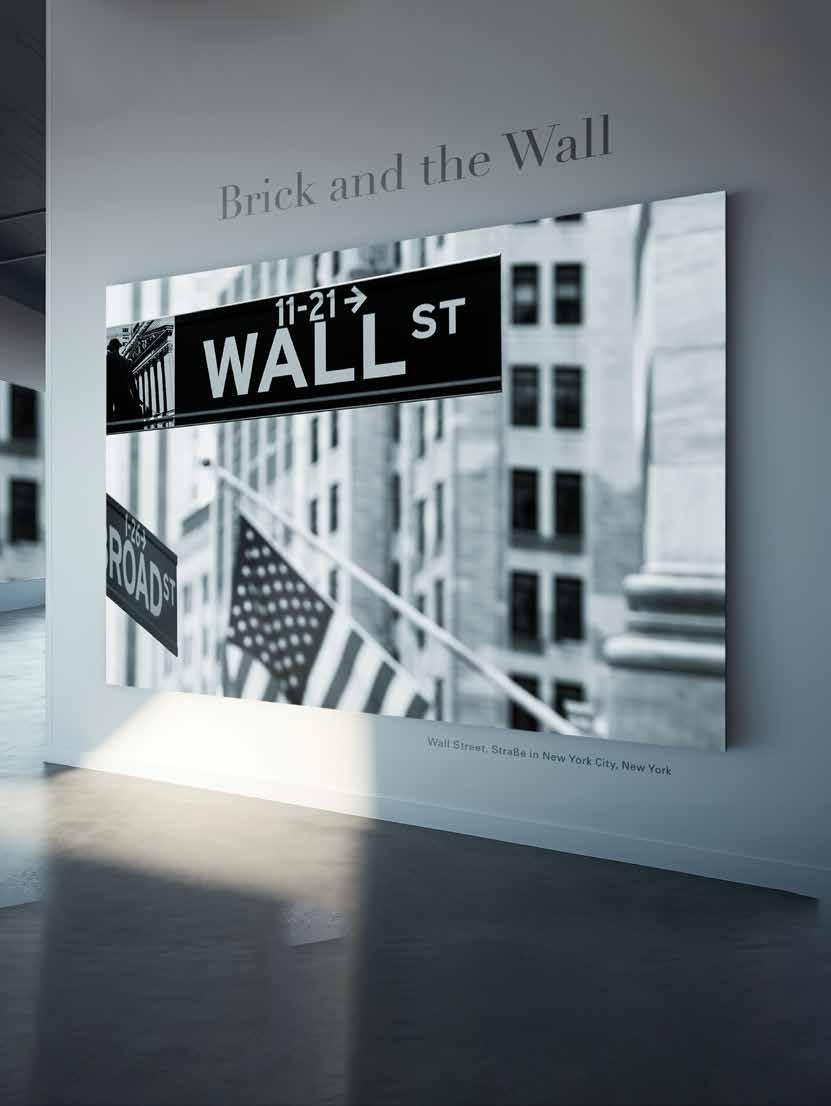
WALL STREET
Heute Synonym für Aktienhandel und Finanzmarkt, geht der Name Wall Street tatsächlich auf eine Mauer zurück, die der Gouverneur Peter Stuyvesant 1653 zum Schutz des ursprünglichen Ortes Nieuw Amsterdam vor einer britischen Invasion errichten ließ. Im 18. Jahrhundert wurde aus der Mauer eine Straße und dann ein Marktplatz als Vorläufer der NYSE. Marktrisiko löste Sicherheit ab.
n einer Welt rasanter technologischer Entwicklungen und globaler Vernetzung sind Sicherheit und Risiko keine Gegensätze, sondern zwei untrennbare Seiten derselben Medaille. Die Innovationsfähigkeit von Unternehmen wird davon bestimmt, wie sie Sicherheit als Basis und Risiko als Motor für Fortschritt und Transformation nutzen.
Unternehmen, die auf langfristigen Erfolg abzielen, begreifen Sicherheit als strategisches Fundament. IT-Sicherheitsarchitektur, klare Compliance-Richtlinien und umfassender Schutz von geistigem Eigentum unterstützen erfolgreiche Innovationen am Markt. Besonders im Forschungs- und Hochschulumfeld, wo viele technologische Durchbrüche entstehen, ist diese Basis essenziell, um Kooperationen mit der Industrie zu ermöglichen.
Andererseits ist Innovationsfähigkeit ohne Risikobereitschaft kaum denkbar. Oder wie es der Ökonom Peter Drucker treffend formulierte: „Jedes Mal, wenn Sie eine Entscheidung treffen, setzen Sie Risiken. Innovation steckt voller Unsicherheiten, aber genau das macht sie notwendig.“ Neue Produkte, Technologien oder Verfahren zu wettbewerbsfähigen Kosten stärken die globale Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen und schaffen neue Arbeitsplätze.
Disruptive Ideen entstehen dort, wo Risiken als Chance betrachtet werden und ein förderliches Klima für Experimente
und kreatives Denken herrscht. Unternehmen, die agile Arbeitsmethoden einsetzen und Fehlerkultur etablieren, schaffen Raum für bahnbrechende Innovationen. Viele der größten Errungenschaften, von der Erfindung des Penicillin bis zur Mondlandung oder dem Internet, wären ohne diese Bereitschaft undenkbar gewesen. So zeichnen wir als Infineon zum Beispiel die besten Innovationen aus, aber auch den „erfolgreichsten“ Fehler zur Stärkung diese Art der Lernkultur.
Mit dem richtigen Innovationsmanagement können wir echte Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit schaffen. Mit der Entwicklung des weltweit ersten 300-Millimeter-Dünnwafers haben wir 2011 Mikroelektronikgeschichte geschrieben. Stehen bleiben ist keine Option, daher arbeiten wir heute erfolgreich mit neuen Halbleitermaterialien, die große Hebel in der Energieeffizienz bewirken. Davon zeugen jüngste Weltneuheiten und unser konkreter Klimabeitrag: Unsere rund 7,5 Milliarden im Jahr 2024 produzierten Chips helfen, rund 10 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, rund 15 Prozent der gesamten jährlichen CO2-Emissionen in Österreich.
Innovation erfordert mehr als technologische Kompetenz – es braucht eine Kultur, die Kreativität und Mut belohnt. Bahnbrechende Ideen lassen sich nicht verordnen, sie wachsen in einem Umfeld, das Sicherheit nicht als Bremse, sondern als Sprungbrett versteht.

DI Dr.in Sabine Herlitschka, MBA ist seit April 2014 Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG. Herlitschka übernimmt Verantwortung u.a. als Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) sowie als Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbach. Sie fungierte auch als Gründungs-Vizerektorin an der Medizinischen Universität Graz.
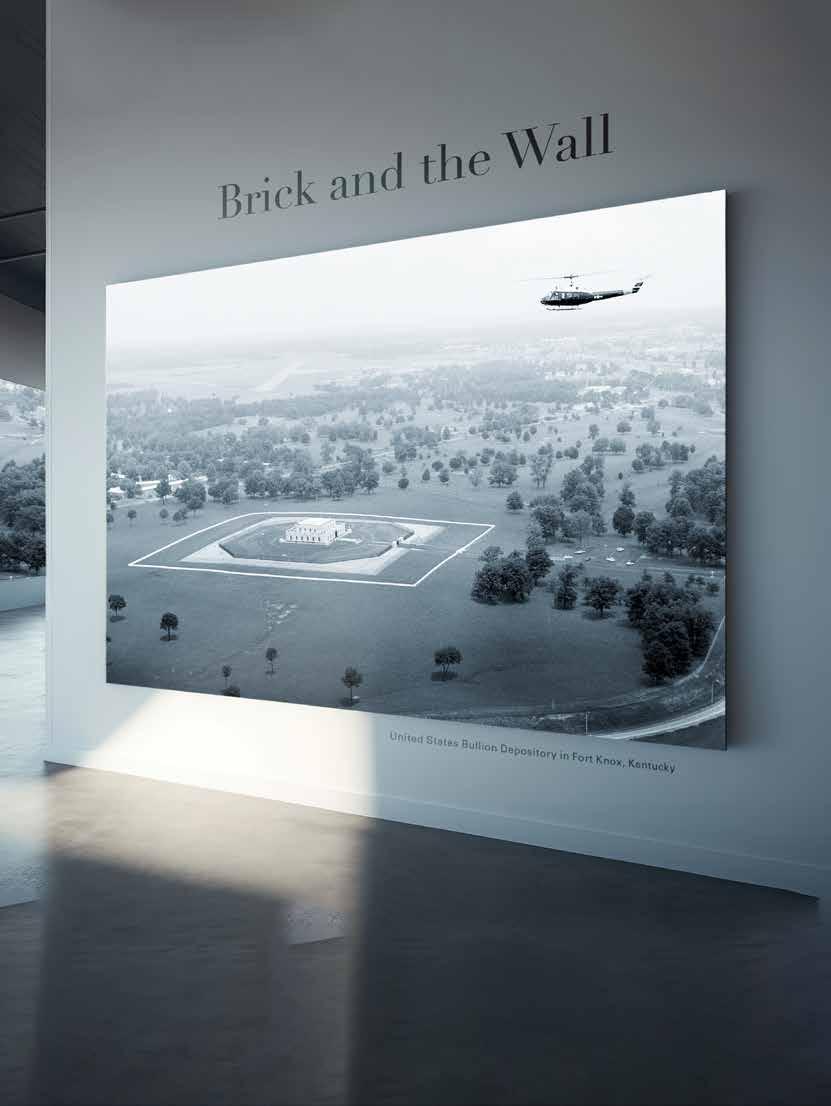
FORT KNOX
Fort Knox, eigentlich ein Stützpunkt der U.S.-Army in Kentucky, ist bekannt als Lager für die Goldreserve der Vereinigten Staaten, aktuell 147,3 Millionen Unzen. Untergebracht ist das Edelmetall dort, weil Fort Knox als einer der sichersten Orte der Welt gilt. Einzudringen ist bisher nur einem gelungen: „Goldfinger” im gleichnamigen James Bond-Film aus dem Jahr 1964.
Wie lässt sich eine Gesellschaft gestalten, in der Freiheit und Sicherheit einander nicht ausschließen, sondern stärken? Eine Spurensuche zwischen Philosophie, Politik und Ökonomie.
Von David Rennert
st der Mensch von Natur aus schlecht?
Wären sich Thomas Hobbes und John Locke je gegenübergesessen, sie hätten über diese Frage wohl trefflich streiten können. Persönlich sind sich die beiden einflussreichen Philosophen der frühen Neuzeit vermutlich nie begegnet. Beide beschäftigten sich aber im England des 17. Jahrhunderts mit Fragen nach dem Naturzustand des Menschen und der Legitimation von Herrschaft: Wie ist der Mensch ohne Staat, Gesellschaft und Gesetze? Die beiden Denker prägten mit ihren Ideen die moderne politische Theorie – und vertraten höchst unterschiedliche Ansichten.
Auf sich selbst gestellt, ist der Mensch bei Hobbes von gewaltsamer Selbsterhaltung, Machtstreben und Misstrauen ge -
genüber anderen getrieben – der Naturzustand ist ein „Krieg aller gegen alle“. Aus Angst vor dieser ständigen Unsicherheit seien Menschen bereit, ihre Freiheit zu großen Teilen aufzugeben und an einen starken Souverän abzutreten, der durch diese Macht für Sicherheit und Stabilität sorgen kann. Nur ein starker Staat könne verhindern, dass sich der Mensch, wie Hobbes es formulierte, als „Wolf dem Menschen“ gegenüber verhalte. Demgegenüber stellte John Locke die Freiheit des Individuums ins Zentrum seines Denkens: Für ihn war der Gesellschaftsvertrag nicht primär ein Mittel zur Herstellung von Sicherheit vor Gewalt. Er sah den Hauptzweck vor allem darin, die natürlichen Rechte der Einzelnen zu schützen. Während Hobbes vor allem

WALTER SEBÖCK
Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Professor für Security Studies und leitet das Department für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems.

FRANZ EDER
Assoz. Prof. Dr. Franz Eder ist assoziierter Professor für Internationale Beziehungen am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Er forscht unter besonderer Berücksichtigung u.a. zum Thema Sicherheitspolitik.
die Notwendigkeit staatlicher Macht zur Aufrechterhaltung von Ordnung betonte, warnte Locke vor dem Missbrauch dieser Macht und plädierte für eine Regierung, die an Rechtsstaatlichkeit und das Gemeinwohl gebunden ist. Für Locke ist der Staat nur so lange legitim, wie er die Freiheit der Bürger_innen schützt. Wird dieser Auftrag verletzt, so haben die Menschen nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, Widerstand zu leisten.
Dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit durchzieht die Debatten über die Gestaltung liberaler Gesellschaften bis heute. Wie viel Sicherheit braucht Freiheit – und wie viel Freiheit verträgt Sicherheit? Wo endet die Freiheit des Einzelnen zu Gunsten der Sicherheit aller und wie können Grundrechte auch bei
„Ein Staat, der versucht, jede Unsicherheit zu eliminieren, ist selbst der größte Unsicherheitsfaktor für seine Bürgerinnen und Bürger.“
Franz Eder
dynamischen Bedrohungslagen gewahrt werden? Fragt man Fachleute aus unterschiedlichen Gebieten, so findet sich schnell ein gemeinsamer Nenner: Antworten auf diese Fragen sind nie endgültig, sie müssen stets neu ausverhandelt werden.
„Wenn wir mit den klassischen Vertragsdenkern wie Hobbes argumentieren, dann gibt es den Staat, weil Menschen Schutz vor willkürlicher Gewalt suchen“, sagt der Politikwissenschaftler Franz Eder von der Universität Innsbruck. „Aber je mehr Macht der Staat hat, desto eher schränkt er auch die Freiheiten der Menschen ein.“ Alle Mittel, die dem Staat zur Verfügung stehen, werden früher oder später auch auf Kosten der Bürger_innen zum Einsatz kommen, zeigt sich Eder, der zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik forscht, überzeugt. Daher sei er skeptisch gegenüber Überwachungsmaßnahmen wie dem Bundestrojaner: „Ich verstehe, dass man ihn braucht – aber die Auflagen für die Verwendung müssten sehr, sehr streng sein.“
In einer liberalen Demokratie müsse akzeptiert werden, dass es immer ein gewisses Maß an Unsicherheit geben wird, sagt Eder. „Ein Staat, der versucht, jede Unsicherheit zu eliminieren, ist selbst der größte Unsicherheitsfaktor für seine Bürgerinnen und Bürger.“ Wie stark aber Sicherheit oder Freiheit in einer Demokratie betont werden, sei stets im Wandel. „Es gibt immer wieder Bewegungen in die eine oder andere Richtung – mal hin zu mehr Sicherheit auf Kosten der Freiheit, mal umgekehrt. Das ideale Gleichgewicht gibt es nicht, das Verhältnis muss stets neu ausverhandelt werden.“
Nach Terroranschlägen beispielsweise öffne sich für staatliche und politische Akteure ein Gelegenheitsfenster, um im Namen der Sicherheit mehr Mittel und Befugnisse zu erlangen und Freiheiten zu beschränken. Das könne legitim sein, dieses Fenster müsse aber auch wieder geschlossen werden. Dass Sicherheit nie Selbstzweck sein darf, betont auch Walter Seböck, Leiter des Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Eine Gesellschaft verliere ihre Würde, wenn sie Freiheit gegen Überwachung eintausche. Notwendig sei ein Gleichgewicht – auf Basis von Vertrauen (siehe Interview S. 15).
Wie Gesellschaften auf konkrete Bedrohungslagen reagieren, sei auch eine Frage der politischen Kultur, sagt Eder. In Österreich verortet der Politikwissenschaftler eine eher langsame, manchmal
träge, aber auch stabilisierende politische Kultur, in der nicht nur raschen Reformen, sondern auch einer schnellen Ausweitung staatlicher Macht Grenzen gesetzt sind.
Unverzichtbare Debatte
Apropos politische Kultur: Unverzichtbar sei eine breite Debatte über Freiheitsund Sicherheitsthemen, sagt Eder. „Die Bevölkerung braucht einen öffentlichen Diskurs. Wenn sie den nicht bekommt, kann sie sich kaum eine Meinung bilden oder findet etwas wichtig, das nicht wichtig ist.“ Das sehe man am Beispiel des Klimawandels. „Die Klimakatastrophe ist eine Klimakatastrophe, das ist einfach ein Faktum, es sagt uns die Naturwissenschaft, dass der Hut brennt. Aber wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, ist das Thema in der Bedeutung nach unten gewandert. Und zwar nicht, weil es kein Problem mehr ist, sondern weil die Öffentlichkeit und vor allem die Politik über andere Themen redet.“
Eder und seine Kolleg_innen führen jährlich Umfragen zu den Einstellungen der Österreicher_innen zu außen- und sicherheitspolitischen Themen durch. Da zeige sich, dass das Unsicherheitsgefühl durchaus hoch ist. Es sind aber nicht Kriege, Terrorismus oder eben der Klimawandel, die den Menschen die größten Sorgen bereiten, sondern wirtschaftliche Themen: Angst vor Inflation, vor Einkommensverlust, Sorge um den eigenen Status. Diese Themen seien in den vergangenen Jahren im politischen Diskurs besonders stark bearbeitet worden, sagt Eder. „Wenn wir in Österreich beginnen, stärker über Außen- und Sicherheitspolitik zu reden, werden diese Themen auch weiter nach oben wandern.“
Kein Entweder-Oder
Aber ist das Tauziehen zwischen Freiheit und Sicherheit wirklich eine unverrückbare Konstante? Keineswegs, wenn es nach der Philosophin Anne Siegetsleitner geht. „Ich sehe nicht, dass immer ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit bestehen muss, dass ich, wenn ich vom einen mehr bekomme, vom anderen zwangsläufig weniger habe“, sagt
die Professorin für Praktische Philosophie an der Universität Innsbruck. „Sicherheitsräume schaffen ja auch Freiheitsräume. Schutzzonen haben zumindest in liberalen Gesellschaften den Zweck, Freiheitsräume zu ermöglichen. Das gilt für die Privatsphäre ebenso wie für gesellschaftliche Räume, in denen Menschen anders leben können, ohne ständig beurteilt zu werden.“
„Ich sehe nicht, dass immer ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit bestehen muss: vom einen mehr zu bekommen und zwangsläufig vom anderen weniger zu haben.“
Anne Siegetsleitner

HARALD OBERHOFER
Univ.-Prof. MMag. Dr. Harald Oberhofer ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und als Senior Economist am Wirtschaftsforschungsinstitut in der Forschungsgruppe „Industrie-, Innovations- und internationale Ökonomie” tätig

Univ.-Prof.in Dr.in Anne Siegetsleitner hält die Professur für Praktische Philosophie an der Universität Innsbruck, wo sie das Institut für Philosophie leitet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf mehreren Gebieten der Allgemeinen und der Angewandten Ethik.
Freiheit sei kein abstrakter Wert, sondern immer relational: Frei wovon? Frei wozu? Wessen Freiheit? Im Konkreten könne die Einschränkung der Freiheit des einen die Freiheit eines anderen ermöglichen – in diesem Fall stehe nicht Freiheit gegen Sicherheit, sondern Freiheit gegen Freiheit. „Wenn die Willkür der Stärkeren nicht eingeschränkt wird, bedeutet das kleinere Freiheitsräume für alle, die schwächer sind“, sagt Siegetsleitner.
Zugleich betont die Philosophin, dass vermeintliche Sicherheit Freiheitsräume
auch einschränken kann. Sehr viel von dem, was wir vom Staat an Sicherheit verlangen würden, sei eigentlich ein Anspruch an den Sozialstaat, nicht an den Sicherheitsstaat, sagt Siegetsleitner. Das Streben nach sozialer Sicherheit, etwa durch Gesundheitsversorgung, Arbeitslosenunterstützung und Pensionen, eröffne vielen Menschen reale Freiheitsräume. Mit zunehmender staatlicher Verantwortung wachsen aber auch die Eingriffsrechte des Staates – auf Kosten von bürgerlichen Freiheiten: „Je höher meine Ansprüche an den Staat sind, umso legitimer werden auch Einschränkungen. Die Privatsphäre von Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, war immer schon geringer als die jener, die weniger staatliche Ressourcen erhalten. Wenn man das weiterdenkt: Der totale Sozialstaat kann kein liberaler Staat sein.“
Auch sei mehr Regulierung nicht gleichbedeutend mit mehr Sicherheit – obwohl bei vielen Menschen dieses Gefühl entstehe. „Mehr Regeln bedeuten nicht automatisch mehr Sicherheit – oft wird Sicherheit auch nur imitiert.“ Insbesondere in Krisen zeiten wie etwa während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie schnell Maßnahmen als Sicherheit empfunden werden: „Je strenger die Vorgaben wurden, desto sicherer fühlten sich viele –auch in Fällen, in denen es faktisch keine Evidenz für den Nutzen gab“, sagt Siegetsleitner.
Verlorenes Vertrauen
Durchaus komplementär können Freiheit und Sicherheit auch aus ökonomischer Perspektive sein, sagt Harald Oberhofer, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien. „Unter Freiheit würde man aus wirtschaftlicher Perspektive wohl verstehen, dass man im Rahmen eines rechtlichen Umfelds die Sicherheit hat, als Individuum ökonomisch so frei wie möglich agieren zu können.“
Aus diesem Blickwinkel sei Sicherheit keine Einschränkung wirtschaftlicher Dynamik, sondern eine Voraussetzung – insbesondere im Bereich der Innovation. „Für Innovation ist entscheidend, dass man eine gewisse Sicherheit darüber hat,
profitieren zu können, wenn man erfolgreich ist“, betont Oberhofer. In der Praxis bedeutet das: Schutz geistigen Eigentums, funktionierende Rechtsstaatlichkeit, international anerkannte Patentregeln. Ohne diese Basis sei wirtschaftliche Kreativität kaum möglich. „Wenn ich davon ausgehen muss, dass meine Idee sofort gestohlen wird und ich meine Rechte nicht durchsetzen kann, dann investiere ich erst gar nicht.“ Gerade in Zeiten wachsender Industriespionage und strategischer Technologietransfers – etwa im Spannungsfeld mit China – gewinne diese Sicherheitsdimension in der Ökonomie an Bedeutung. Zugleich warnt Oberhofer vor einem Missverständnis von Sicherheit, wie es sich in protektionistischen Maßnahmen manifestiert. Die Handelspolitik der USA unter Donald Trump sieht er als Beispiel für eine „Sicherheitsstrategie ohne klare Zieldefinition“. Zölle gegen China könnten noch mit der Konkurrenz der beiden Großmächte und dem Systemkonflikt zwischen liberaler Demokratie und autoritärer Staatswirtschaft erklärt werden. Doch wenn auch traditionelle Partner wie die EU, Mexiko oder Kanada mit denselben Maßnahmen belegt werden, entstehe vor allem eines: wirtschaftliche Unsicherheit. „In so einem Umfeld weiß niemand mehr, was morgen gilt – und das ist Gift für Investitionen.“ Planungssicherheit sei für langfristige wirtschaftliche Entscheidungen zentral. Wenn durch politische Willkür Vertrauen zerstört werde, schade das letztlich auch jenen Staaten, die sich damit eigentlich schützen wollen.
Alle Fachleute betonen, dass das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit immer in Bewegung sei. „Wir müssen uns als Gesellschaft stets fragen: Was wollen wir schützen? Wofür brauchen wir Regeln – und wo wollen wir Freiheit?“ sagt Siegetsleitner. „Für diesen Aushandlungsprozess müssen wir Diskursräume offenhalten, in denen wir diese Fragen diskutieren können. Nur dann können wir die Balance finden, die ein gutes Leben für viele ermöglicht – mit all den Kompromissen, die dazugehören.“
David Rennert ist Wissenschaftsjournalist bei der Tageszeitung „Der Standard“.
8000 Brandfälle gibt es jährlich in Österreich. Maßnahmen zur Klimafitness bringen neue Gefahren: Stadtbegrünung, Elektromobilität und Sonnenenergie stellen den Brandschutz vor neue Herausforderungen. Wissenswertes und Praxistipps von Brandschutz-Expert_innen.
E-AUTOS: Lange Brandzeiten mit hoher Energie. „Brennt ein Elektrofahrzeug, ist sehr viel Wasser notwendig, um das Feuer vorerst einmal zu löschen“, so Robert Mayer, Präsident Österreichischer Bundesfeuerwehrverband: „Selbst wenn es dann als gelöscht erscheint, kann es sich bis zu 48 Stunden später wieder durch den Akku entzünden“. Die Feuerwehr hebt verunfallte E-Autos deswegen in ein Wasserbad. Besonders kritisch: Elektrofahrzeugbrände in Tiefgaragen, da enorme Mengen an Rauch und Hitze entstehen. Derzeit dürfen Elektroautos trotz erhöhter Brandgefahr in Garagen aufgeladen werden. Ausgenommen: Garagen ohne direkte Einfahrt oder Rampen, also mit Autoaufzügen. Dort hätte die Feuerwehr nämlich keine Chance, ein entflammtes Auto aus dem Gebäude zu bringen.

E-SCOOTER UND -FAHRRÄDER: nicht in Wohnung oder unbeaufsichtigt laden. Allein 2024 wurden über 226.000 E-Bikes in Österreich verkauft. „Mittlerweile sind sehr viele E-Bikes in Verwendung, und deren Akkus stellen ebenfalls eine Brandquelle dar“, so Robert Mayer. Sie können oft nicht an sicheren Plätzen an die Steck dose gehängt werden. „An den meisten Fahrradabstell plätzen fehlt derzeit eine geeignete Infrastruktur, um E- Bikes oder E-Scooter sicher und unter Aufsicht zu laden“, sagt Monika Oswald, Universität für Weiter bildung Krems, Lehrgangsleitung „Fire Safety Management“ und „Academic Expert Program – Brandschutz“. Auf geladen wird daher häufig in Wohnungen oder in Kellerräumen, was das potenzielle Brandrisiko in Wohngebäuden erheblich erhöht. Bei einem Akkubrand entstehen außerdem giftige Gase. Beim Löschen verwendet die Feuerwehr deshalb schweren Atemschutz. Weitere Brandquelle: kleinere Lithium-Ionen-Akkus in Mobiltelefonen, elektronischen Zigaretten etc. „Solche Geräte sollten vorzugsweise tagsüber und unter Aufsicht geladen werden, beispielsweise am Schreibtisch, und keinesfalls über Nacht unbeaufsichtigt“, rät Oswald. Ebenso von großer Bedeutung: die fachgerechte Entsorgung dieser Geräte, da eine unsachgemäße Entsorgung im Restmüll schwerwiegende Folgen im Haushalt und in der Abfallverwertung nach sich ziehen könne. Um Entstehungsbrände frühzeitig zu erkennen, empfiehlt Oswald den Einsatz von Rauchwarnmeldern. Und: Löschversuche nur dann unternehmen, wenn das Feuer im Anfangsstadium ist. Andernfalls sich selbst und andere rechtzeitig warnen und in Sicherheit bringen.

BRANDGEFAHR DURCH PHOTOVOLTAIK – AUF FACHGERECHTE MONTAGE ACHTEN. Auch von Batterie-Speichern der Solarstromanlagen geht eine gewisse Brandgefahr aus. In größeren Gebäuden wie Mehrparteienhäusern muss dafür ein eigener Batterieraum eingerichtet werden. Irmgard Eder, Leiterin Kompetenzstelle Brandschutz, Wiener Magistratsabteilung 37 (Baupolizei): „Bei Einfamilien- und Reihenhäusern haben wir Erleichterungen eingeführt: bei diesen Gebäude kategorien darf man den Batteriespeicher mit einer Leistung von höchstens 20 Kilowattstunden quasi irgendwo hinstellen.“ In der Regel wird eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach montiert. In 99 Prozent der Fälle ist der bauliche Feuerwiderstand dort aus reichend. Dachbrände durch Photovoltaik-Anlagen passieren recht häufig, „speziell dann, wenn sie nicht fachgerecht montiert sind“, sagt Robert Mayer. Oft seien elektrische Klemmstellen und Kabeleinführungen nicht einwandfrei angebracht. Dann scheuern zum Beispiel die elektrischen Leitungen, der Kupferdraht liegt irgendwann frei, ein Funke kann zu einem Brandausbruch führen.

ENTZÜNDBARE FASSADENBEGRÜNUNG – ZURÜCKSCHNEIDEN WICHTIG. „Fassadenbegrünungen bieten zahlreiche ökologische und gestalterische Vorteile, bergen jedoch auch brandschutztechnische Risiken“, so Monika Oswald. Bestimmte Pflanzen enthalten leicht brennbare, ölige Substanzen, wodurch sich bei einem Brand die Flammen rasch entlang der Fassade ausbreiten können. „Bei Häusern mit mindestens drei Geschossen müssen deshalb Maßnahmen zur wirksamen Einschränkung der Brandweiterleitung über die Fassaden gesetzt werden“, erklärt Irmgard Eder: „Das können beispielsweise horizontal auskragende Bleche sein, oder entsprechende Abstände in alle Richtungen“. „Gerade in den Sommermonaten, wenn Fenster häufig geöffnet sind, ist es besonders wichtig, ausreichend Abstand zwischen der Begrünung und den Fensteröffnungen einzuhalten“, betont Monika Oswald. „Durch regelmäßiges Zurückschneiden der Pflanzen in diesem Bereich kann verhindert werden, dass ein Fassadenbrand auf die Innenräume übergreift – etwa durch entzündete Vorhänge.“ Von Jochen Stadler
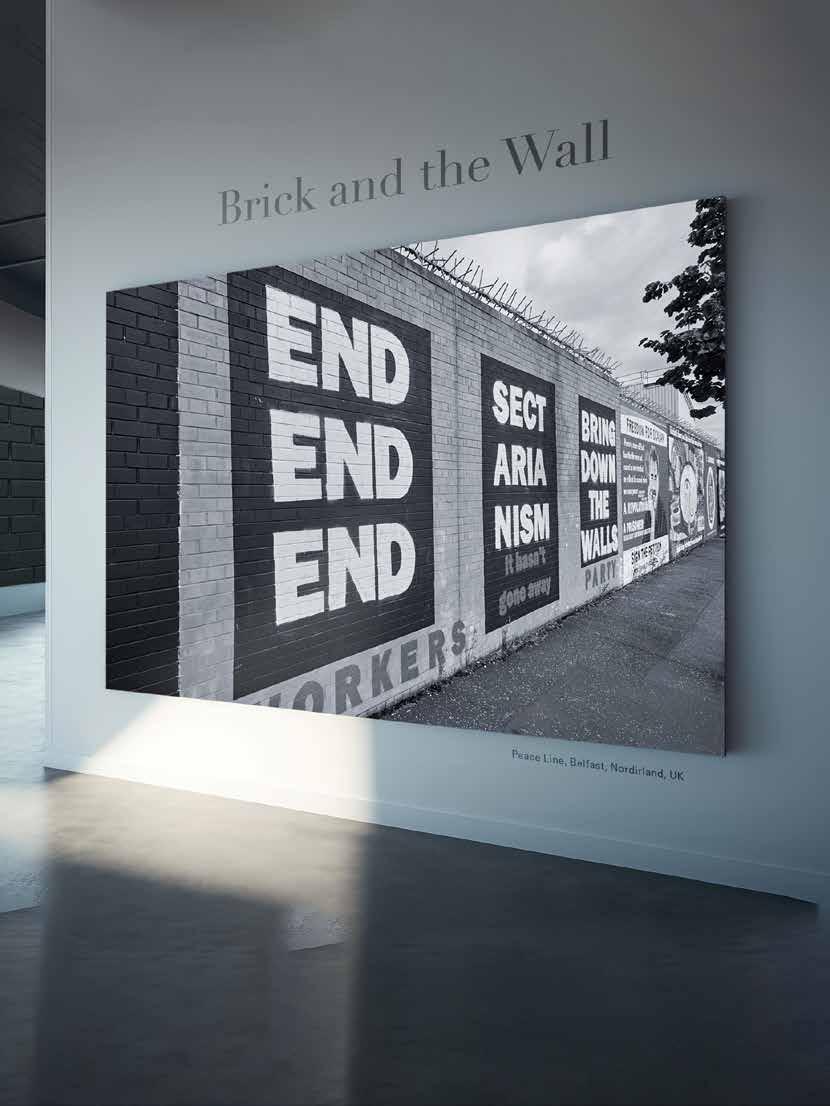
Zur Eindämmung des Konflikts zwischen Protestanten und Katholiken entstanden ab 1969 die „Peace Lines“. Diese vor allem in Belfast errichteten Zäune laufen durch Straßenzüge und sollten ursprünglich die Bevölkerung zum Abbau eigener Barrikaden bewegen. Als Provisorium geplant, gibt es die Bauwerke bis heute. Nun sind sie Sehenswürdigkeiten eines „Konflikttourismus“.
Der Politikwissenschaftler und IT-Experte Walter Seböck leitet das Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Ihn treibt die Frage um, wie ein ethischer Umgang mit neuen Technologien gelingen kann.
Interview: David Rennert
upgrade: Herr Seböck, was bedeutet Sicherheit für Sie?
Walter Seböck: Sicherheit ist ein vielschichtiger Begriff. Für mich persönlich kommt Sicherheit nicht ohne der Frage nach Freiheit aus: Wie viel Freiheit kostet Sicherheit – und wie viel Sicherheit verlangt unsere Freiheit? Die Balance ist entscheidend. Historisch betrachtet handelt es sich dabei um ein mittelalterliches Herrschaftsversprechen der Fürsten, die sagten: Gib mir deine Freiheit, und ich garantiere dir Sicherheit. Doch das ist in dieser Form heute genauso wenig einlösbar wie damals. Wir müssen als Gesellschaft immer wieder neu ausverhandeln, wie viel Kontrolle wir im Namen der Sicherheit akzeptieren wollen. Sicherheit ist wichtig, aber ohne die Freiheit dazu verliert sich völlig die Würde. Und da geht es nicht nur um den Schutz vor Gefahren, es geht letztlich um die Frage: Wer wollen wir als Gesellschaft sein?
Wo stehen wir heute in diesem Spannungsfeld?
Seböck: Die Politik tendiert naturgemäß mit der Zunahme technologischer Hilfs -
mittel dazu, sie einzusetzen und in Bereiche vorzudringen, wo nicht allzu große Gegenwehr zu erwarten ist. Hier wünsche ich mir Augenmaß: Nur weil etwas technisch machbar ist, heißt das nicht, dass es auch umgesetzt werden soll. Wir müssen Technologien so einsetzen, dass sie dem Gemeinwohl dienen. Und da braucht es auch den Mut, Nein zu sagen, wenn Überwachung und Kontrolle überhandnehmen.
Gerade hier gilt, dass Macht eine unabhängige Kontrolle benötigt, denn wenn schon überwacht wird, sollte auch sichergestellt werden, wer die Überwachenden kontrolliert.
Wird dieses Thema in der Öffentlichkeit ausreichend diskutiert?
Seböck: Die Diskussion findet statt, aber meist in verzerrten Kontexten. Es wird oft nicht mehr differenziert diskutiert, sondern so zugespitzt, bis das Vertrauen in Politik, Medien und Institutionen bröckelt. Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Polarisierung erlebt, auch befeuert durch Desinformationskampagnen. Das zieht sich durch die unterschiedlichsten Themen, ob es nun um die
Covid-Pandemie geht, um die Ukraine oder um die Milchpreise. Man kann Teile der Bevölkerung, die unsicher sind und Zweifel haben, an jedem Punkt mit Desinformation abholen und eine Elitendiskussion anstacheln mit dem Tenor: „Die da oben agieren ohnehin immer nur gegen uns kleinen Leute.“ So wird die Polarisierung immer weiter vorangetrieben mit dem Ergebnis, dass viele Menschen Politikerinnen und Politikern überhaupt nicht mehr vertrauen. Damit erscheinen automatisch auch traditionelle Medien unglaubwürdig, während ausgerechnet Social-Media-Kanälen vertraut wird, die keinerlei Qualitätssicherung haben und jede erdenkliche Lüge ungestraft in die Welt schicken.
Desinformationsforschung zählt zu den Schwerpunkten des neuen Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Wie können wir uns als Gesellschaft gegen Fakenews wappnen?
Seböck: Desinformation beinhaltet immer ein Körnchen Wahrheit – auch wenn sie verbogen wird, wenn Teile weggelassen werden. Das ist oft die Eintrittspforte,
„Sicherheit ist wichtig, aber ohne die Freiheit dazu verliert sich völlig die Würde.“
Walter Seböck
durch die Menschen abgeholt werden. Es ist unheimlich, wie schnell man auf SocialMedia-Plattformen von harmlosen Themen zum krudesten Unsinn oder zu gefährlichen Fakenews gelangt. Das hat viele Folgen, auf gesellschaftlicher Ebene zerstört
es den Diskurs. Wir dürfen nie aufhören, miteinander zu reden und Menschen mit ihren berechtigten Sorgen in die Debatte einzubinden, bevor sie völlig falsch abbiegen. Niemand muss mit politischen Entscheidungen einverstanden sein, heftige Debatten kann und muss eine Demokratie aushalten. Aber es braucht den Diskurs, er ist ein Wesenskern von Freiheit und eine Voraussetzung für Demokratie. Dort, wo kein Diskurs mehr stattfinden kann, herrscht zwar vielleicht innere Sicherheit, aber keine Freiheit – da muss man sich nur diverse autoritäre Regime anschauen.
Die Herstellung von Desinformation wird durch die rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz immer ausgefeilter, Stichwort Deepfakes: Videos, Fotos und Audiodateien lassen sich immer leichter fälschen. Wie lässt sich da gegensteuern?
Seböck: Das Thema wird uns noch sehr beschäftigen. Deepfakes lassen sich mit entsprechend hohem Aufwand identifizieren, als das, was sie sind. Das heißt, man kann diesen Fälschungen auf die Schliche kommen, wenn man entsprechende Anstrengungen unternimmt. Technisch ist es lösbar. Viel schwieriger ist das bei Texten – die Unterscheidung zwischen Fakten, Meinung, Fiktion und Lüge ist sehr komplex. Da gibt es kein einfaches Tool, sondern es braucht Medienkompetenz und auch Allgemeinbildung, um Desinformation zu erkennen.
Was sind weitere Schwerpunkte des Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems?
Seböck: Wir beschäftigen uns mit zentralen Fragestellungen rund um Sicherheit mit einem interdisziplinären Ansatz. In unserer Forschung und Lehre geht es um Cybersecurity und KI-Ethik, um Prävention von Terrorismus bis hin zu Themen wie Brandschutz oder Desinformationsforschung. Ein Fokus liegt auf der Frage: Wie können wir Technologien so gestalten, dass sie unsere Freiheit schützen und nicht gefährden? Wir arbeiten eng mit dem österreichischen Innenministerium und der Direktion für Staatsschutz zusammen, etwa im Bereich Counterterrorism.


Wir haben auch Projekte zu autonom fahrenden Fahrzeugen und zu Blockchain-Sicherheit – das wird ab 2026 ein Schwerpunkt bei uns sein. Zusammenfassend würde ich sagen: Es geht uns darum zu verstehen, wo Gefahren liegen, wie man Resilienz aufbauen kann und wie man Technologie so einsetzen kann, dass sie uns hilft und nicht schadet. Das geht immer auch mit ethischen Fragen einher.
Wie gehen Sie persönlich mit Bedrohungsszenarien um – sehen Sie als Sicherheitsforscher überall Gefahren?
Seböck: Ich habe sicher berufsbedingt einen geschulten Blick für Bedrohungen –und das beeinflusst meine Wahrnehmung. Ich überprüfe Fluchtwege, denke bei Veranstaltungen an Sicherheitskonzepte. Aber ich bin kein Alarmist, ich sehe das pragmatisch. Terrorismus macht mir keine Angst, aber ich beobachte die Entwicklungen sehr genau und überlege, was man dagegen tun kann. Ja, es gibt Risiken, die können und müssen wir adressieren. Wir können gegen Extremismus in sozialen Medien vorgehen, indem wir toxische Algorithmen analysieren und regulieren. Wir können mit Deepfakes umgehen – technisch ist es machbar,
auch wenn es aufwendig ist. Wir können Resilienz aufbauen, aber dafür braucht es Wissen, kritisches Denken und die Bereitschaft, Probleme zu benennen.
Welche Voraussetzungen sollten Menschen mitbringen, die sich für ein Studium am Department für Sicherheitsforschung interessieren?
Seböck: Wer sich für Sicherheitsforschung interessiert, sollte Neugier, technisches Verständnis und gewisse Vorerfahrungen mitbringen. Wir sind eine Universität für Weiterbildung, unsere unterschiedlichen Programme haben relativ klare Vorgaben, wer sich bewerben kann. Das kann beispielsweise jemand sein, der oder die im Bereich eines Unternehmens arbeitet, in dem Sicherheit eine Rolle spielt. Im Bereich Counterterrorism bewerben sich eher Personen aus dem nachrichtendienstlichen, polizeilichen oder militärischen Umfeld, die schon in irgendeiner Form mit dem Thema befasst waren. Für den Schwerpunkt Brandschutz sollte man in irgendeiner Form brandschutztechnische Vorerfahrungen haben. Und im Bereich Cybersecurity und KI sollten die Leute natürlich mit einer guten Portion Computerwissen zu uns kommen.
Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Leiter des Departments für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems. Er promovierte in Politikwissenschaft an der Universität Wien, schloss einen MBA in Informationstechnologie an der US-amerikanischen Alaska Pacific University ab und in Krems das Weiterbildungsstudium Telematik. Weiters ist er Mitglied in verschiedenen Gremien, u.a. Vorstand im Kompetenzzentrum Sicheres Österreich und A-SIT. Seine Forschungsschwerpunkte sind Infrastrukturund gesellschaftliche Sicherheit, Konflikt- und Terrorismusforschung, Cybersecurity, Desinformationssysteme und ihre politischen Effekte, Radikalisierung und KI-Sicherheit.

„Sicherheit ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen. Ohne sie fehlt die Basis für Vertrauen, Zusammenhalt und Fortschritt. In einer Welt, die von Krisen, globalen Umbrüchen und technologischen Umwälzungen geprägt ist, rückt Sicherheit mehr denn je ins Zentrum gesellschaftlicher Aufmerksamkeit“, sagt Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc, Leiter des Departments für Sicherheitsforschung. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Schutz und dem Anspruch auf Freiheit prägt die Sicherheitsforschung. Sie muss mit einem umfassenden Begriff von Sicherheit operieren, von der Gefahrenabwehr im analogen und digitalen Raum, über soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und politische Steuerung. Hier setzt das Department für Sicherheitsforschung an. Mit einem interdisziplinären Zugang verbindet es technologische, wirt schaftliche, sozialwissenschaftliche und politikwissenschaftliche Perspek tiven. „Wir untersuchen, wie neue Technologien unsere Vorstellung von Sicherheit verändern, die entstehenden sozialen und rechtlichen Strukturen sowie die Auswirkungen auf Alltag, Institutionen und Gesellschaft. Unsere Arbeit versteht sich als Brücke zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer Anwendung“, so Seböck.
www.donau-uni.ac.at/dsi
International state-of-the-art, führt das Department zahlreiche Masterstudien und Weiterbildungsprogramme durch:
Sicherheitskonferenz Krems: seit 2002 widmet sich die Konferenz jährlich wechselnden, sicherheitsrelevanten Themen und hat sich als dauerhafte institutionalisierte Plattform für interdisziplinären Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb sicherheitspolitischer Fachkreise etabliert.
ITDRR-Konferenz: Die internationale wissenschaftliche Fachkonferenz setzt sich interdisziplinär mit Fragestellungen der IT-basierten Disaster Risk Reduction (ITDRR) auseinander. Sie vernetzt Akteur_innen und entwickelt Strategien und Maßnahmen in der Katastrophenvorsorge weiter.
BM für Inneres • Bundeskriminalamt • Bundeskanzleramt • DSN – Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst • BM für Landesverteidigung • A-SIT – Zentrum für sichere Informationstechnologie • AIT Austrian Institute of Technology • ASW – Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. • BVS – Brandverhütungsstellen der Bundesländer in Österreich • EVN / Energieversorgung NÖ • IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung • KSÖ –Kuratorium Sicheres Österreich • NÖ FSZ – NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum • ÖBFV – Österreichischer Bundesfeuerwehrverband • SIEMENS Österreich AG • VKÖ – Vereinigung Kriminaldienst Österreich • VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs • Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH • Netzwerk Politische Kommunikation
Das Department bearbeitet ein breites Spektrum an sicherheitsrelevanten Themen:
• Sicherheitsmanagement & -forschung • Cybersecurity und Informationssicherheit • Sicherung kritischer Infrastrukturen • Safety & Security • Bauliche Sicherheit • Brandschutz • Blockchain • Algorithmische Extremismusprävention • Desinformation und Fakenews
• Terrorismusprävention – CBRN-Sicherheit • Sicherheit und innovative Anwendungstechnologien • Sicherheit und Künstliche Intelligenz • Technikfolgenabschätzung • Gesellschaftliche Sicherheit
Beispiele aktueller Forschung
• Früherkennung von Desinformationen • Detektion von Falschinformationen mittels Künstlicher Intelligenz
• CBRN Detektion • Mobiles Multisensorsystem zur Erhöhung der Betriebssicherheit im System Bahn • Semi-autonomes chemisches Luftspürsystem
• Kommunikationsmuster der Radikalisierung • Young Citizen Scientists against Disinformation


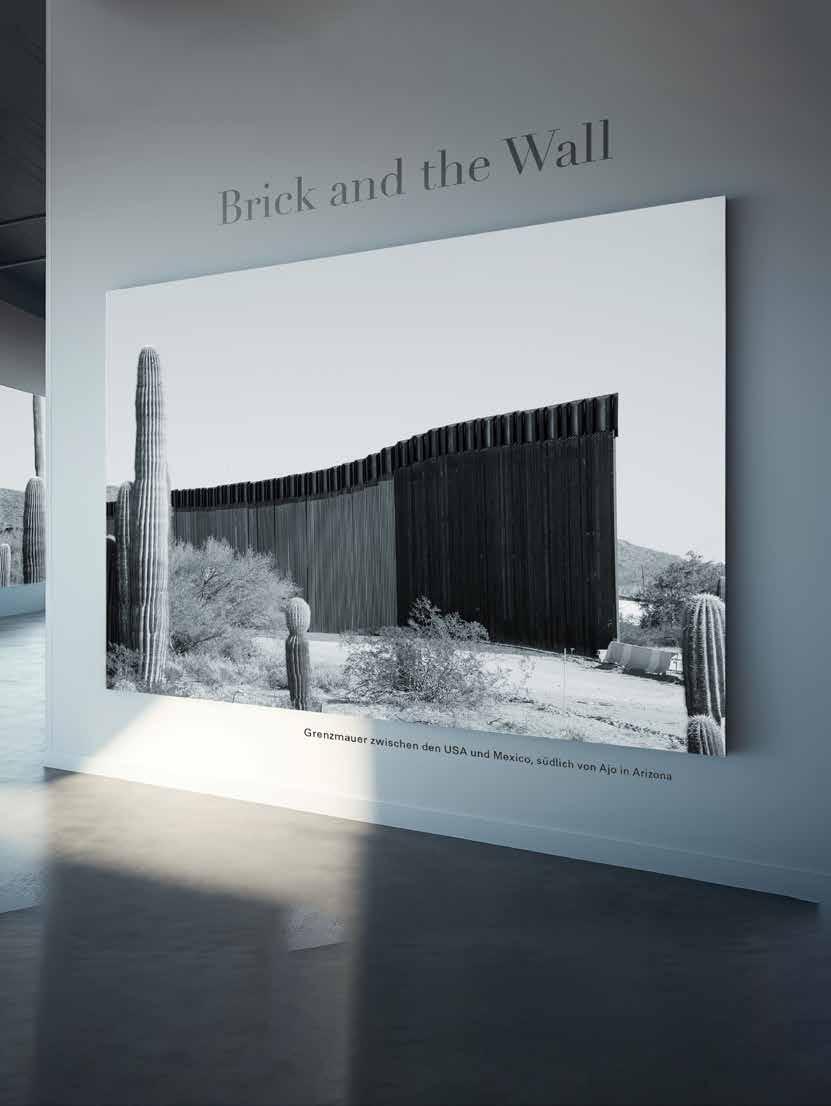
GRENZZAUN MEXIKO
2024 nutzten neben Menschen aus Mittelamerika immer mehr chinesische Bürger_innen eine Lücke im Grenzzaun zu Mexiko östlich von San Diego, um in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Mittlerweile geändert, verlangte Ecuador damals von chinesischen Bürger_innen kein Einreisevisum.
Viele Menschen aus China flogen daher von dort nach Tijuana in Mexiko, um sich danach zur Grenzlücke bringen zu lassen.
Die Spieltheorie ist ein abstraktes mathematisches Modell, um Entscheidungen in Konfliktsituationen zu durchdenken. Ob man sich mit ihr auskennt, entscheidet im Wirtschaftsleben oft über mehrstellige Millionenbeträge.
Von Miguel de la Riva
ie Wirtschaftsgeschichte ist voll von großen Unternehmen, die von einer überraschenden Innovation in die Knie gezwungen werden. Beispiele sind dafür etwa die Mobiltelefonhersteller Nokia und Blackberry, einst unangefochtene Marktführer, die auch die ersten Handys mit intelligenten Funktionen hergestellt haben – und trotzdem den Anschluss an die Smartphone-Welt verloren haben. „Große Unternehmen stehen immer vor dem Risiko, sich zu sicher zu fühlen und eine disruptive Innovation zu verpassen, die oft aus unerwarteter Richtung kommen kann – sie müssen sich auch dann selbst in Frage stellen, wenn es ihnen noch sehr gut geht“, sagt Barbara Brenner, Managementprofessorin an der Universität für Weiterbildung Krems.
Daraus ergebe sich ein Dilemma von „Exploit“ und „Explore“: „Einerseits sollten Unternehmen versuchen, mit ihrem laufenden Geschäftsmodell auch die dort möglichen Gewinne einzufahren – andererseits müssen Sie aber innovativ bleiben, wenn sie nicht den nächsten Produkt- und Innovationszyklus verpassen wollen“, sagt Brenner. Das sei ein schwieriger Balanceakt, erfordere die Verbindung von Effizienz und Flexibilität doch grundverschiedene Managementstile und Perfor manceKennziffern. Der englische Fachausdruck dafür sei „ambidexterity“, also die Fähigkeit, mit beiden Händen gleichermaßen geschickt zu sein.
Entscheidend sei es dabei, wie man das eigene Unternehmen gegenüber dem Mitbewerb aufstellt – eine Frage, die sich auch mithilfe der Spieltheorie analysieren

BARBARA BRENNER
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Brenner leitet das Department für Wirtschaftsund Managementwissenschaften an der Universität für Weiterbildung Krems. Davor war sie Fulbright Professor an der University of South Carolina, USA. Brenner forscht zu strategischem Management, Kontroll-, Innovations- und Wissensmanagement multinationaler Unternehmen.

MAARTEN JANSSEN
Univ.-Prof. Dr. Maarten Janssen ist Professor für Mikroökonomik am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Wien und ein Experte für Auktionstheorie. Davor lehrte und forschte er an der Erasmus-Universität Rotterdam.
lässt. So stelle sich Autobauern aktuell die Frage, inwieweit sie konservativ an ihrem bisherigen Geschäftsmodell festhalten wollen oder ob sie den Sprung wagen und auf neue, potenziell revolutionäre Technologien wie das autonome Fahren setzen. Zu bedenken gelte es Brenner zufolge dabei unter anderem, dass die „first mover“
„Wenn ich von einem bestimmten Lieferanten abhängig bin, sprechen wir von einer Monopolverhandlung, das ist wie ein Boxkampf, bei dem ich mit dem anderen in den Ring steige.“
Alexander Bergmann
oft nicht die sind, die aus neuen Innovationen auch erfolgreiche Geschäftsmodelle erschaffen – und dass sich die Konkurrenz zu strategischen Allianzen zusammenschließen kann, bei denen Mitbewerber_ innen informell zusammenarbeiten, um andere Konkurrent_innen auszustechen.
Spieltheorie gegen Marktmacht
Die Spieltheorie liegt jedoch nicht nur Entscheidungen über die Ausrichtung von Unternehmen im Wettbewerb zu Grunde. „Sie ist auch für Behörden wie die Europäische Kommission oder die US-amerikanische Handelsbehörde FTC wichtig, wenn
es darum geht, mit durchdachten Regulierungen zu verhindern, dass einzelne Unternehmen zu viel Marktmacht erhalten“, sagt Maarten Janssen. Er ist Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Wien und ein Experte für Auktionstheorie. In dieser Funktion berät der Niederländer regelmäßig auch Regierungen.
Angefangen hat das im Jahr 2000, als die Regierung seines Heimatlandes UMTS-Mobilfunkfrequenzen versteigerte. Mit Blick auf die Erlöse, die zuvor in Großbritannien erzielt wurden, erhoffte man sich in den Niederlanden 10 Milliarden Euro, die man auch bereits im Haushalt verplant hatte –erzielte jedoch nur eine Milliarde Euro. Janssen wurde vom Parlament beauftragt, eine Untersuchung über die Ursachen dafür zu leiten. In seinen Augen ist das enttäuschende Ergebnis auf ein schlechtes Auktionsdesign zurückzuführen, das in zuwenig Konkurrenz resultierte.
Der größte Fehler der Regierung habe darin bestanden, wie sie Frequenzen zu Paketen gebündelt habe. „In den Niederlanden gab es damals drei kleinere und zwei größere Mobilfunkanbieter, und die Regierung hatte die Frequenzen in drei kleinere und zwei größere Pakete eingeteilt – so gab es eine natürliche Art, wie sich die Unternehmen das Spektrum aufteilen“, sagt Janssen. Weil die Mobilfunkanbieter das verstanden habe, gaben sich die kleineren Anbieter schnell mit den kleineren Paketen zufrieden – sodass ein harter Bieter_innenwettbewerb, der zu höheren Preisen geführt hätte, ausblieb. Eine erste Schlussfolgerung aus der niederländischen UMTS-Auktion bestehe daher darin, dass man darauf achten muss, die zu versteigernden Güter nicht so zu Paketen zu bündeln, dass sich allen Teilnehmenden ein offensichtlicher Weg aufdrängt, wie sie ihren Konflikt lösen können – ein „fokaler Punkt“, wie es in der Fachsprache heißt. Eine weitere wichtige Entscheidung beim Auktionsdesign betreffe die Frage, ob man ein offenes oder verdecktes Bieter_innen-verfahren wählt. Weil das verdeckte Verfahren viel Unsicherheit für die Bietenden kreiere, das oft zu suboptimalen Ergebnissen führe, bevorzugt Janssen offene Verfahren, in dem die
Bietenden voneinander lernen und ihr Angebot weiter erhöhen können, wenn andere das auch tun.
Auftragsvergaben optimieren
Einsichten aus der Auktionstheorie sind nicht nur für Staaten nützlich. Alexander Bergmann, Partner bei Kerkhoff Consulting und dort Head of Negotiations, berät regelmäßig Unternehmen zur Spieltheorie. Meist geht es dabei um Auftragsvergaben – etwa bei einem Automobilhersteller, der für einen dreistelligen Millionenbetrag Kabel bestellt oder ein Eisenbahnunternehmen, das bestimmte Ersatzteile für seine Züge braucht. „In solchen Zusammenhängen entwickeln wir mit unseren Kunden einen maßgeschneiderten Verhandlungs- und Vergabeprozess, mit dem wir oft mehrstellige Millionenbeträge an Einsparungen und andere Konditionsverbesserungen heben können“, sagt Bergmann.
Wichtig sei dabei zu bedenken, in welcher Wettbewerbskonstellation man sich bewegt, führt Bergmann aus. „Wenn ich von einem bestimmten Lieferanten abhängig bin, sprechen wir von einer Monopolverhandlung, das ist wie ein Boxkampf, bei dem ich mit dem anderen in den Ring steige – aber wenn ich zwischen Verhandlungspartnern wählen kann, kann ich mich als Schiedsrichter positionieren und mir intelligente Turnierregeln überlegen.“ Auktionen können ein wichtiger Teil solcher Wettbewerbsvergaben sein, „aber der Prozess geht nicht einfach damit los, dass ich eine Auktion mache – so ein Vergabeprozess will gut durchdacht sein und erfordert eine solide Vorbereitung“, sagt Bergmann.
So sei es zunächst wichtig, den Markt zu verstehen – je nachdem, ob man es mit Bekleidung für Modeketten oder Ersatzteilen für Bremssysteme zu tun hat, können diese sehr unterschiedlich funktionieren.
Ein weiterer wichtiger Schritt sei, die Lieferant_innen, die sich nach Zahlungsfristen, Lieferzeiten oder ihrem Supportangebot stark voneinander unterscheiden können, vergleichbar zu machen, indem all diese Merkmale mit Preisen versehen werden. „Das ist aus der Innenperspektive
des Unternehmens wichtig, denn hier können alle Beteiligten mitsprechen, sodass es hinterher nachvollziehbare Ergebnisse gibt – gleichzeitig kann man so auch nach außen den Lieferanten signalisieren, dass man nicht nur versucht den Preis zu drücken, sondern ihnen Wertschätzung für andere Leistungen entgegenbringt und dafür einen Bonus bei der Vergabe gibt.“
Erst auf dieser Grundlage könne dann ein konkreter Prozess entwickelt werden, den man den möglichen Lieferant_innen im Vorhinein erklärt und auf den man sich ihnen gegenüber auch rechtsverbindlich festlegt. Ähnlich wie bei den Mobilfunkauktionen gehe es dabei wiederum darum zu überlegen, wie man Aufträge so in Pakete bündelt und die Vergaberunden so durchführt, dass der Wettbewerb zwischen den Bietenden erhöht wird. Bei dieser Planung könne nicht zuletzt auch eine gewisse Dramaturgie eine Rolle spielen –etwa, wenn man den Prozess so aufsetzt, dass bestimmte Teilnehmer_innen mutmaßlich zunächst leer ausgehen, um sie dazu anzustacheln, in der letzten Runde ein besonders gutes Angebot abzugeben.
Nicht immer rational
„Wir verlassen uns da nicht nur auf die rein spieltheoretische Perspektive, sondern versuchen auch psychologische und verhaltensökonomische Erkenntnisse beim Verhandlungsdesign zu berücksichtigen“, sagt Bergmann. „Nicht zuletzt, weil wir sehen, dass Bieter sich auch nicht immer rational im Sinne der Spieltheorie verhalten.“ Wie teuer das Unternehmen zu stehen kommen kann, weiß Janssen, der als Beispiel eine Mobilfunkauktion in der Schweiz erwähnt, bei der ein schlecht beratenes Unternehmen 120 Millionen Franken mehr bezahlte als ein Mitbieter und dafür schlechtere Frequenzen bekam – mit der Folge, dass der CEO und CFO zurücktreten mussten. Umso überzeugender wirkt da Bergmanns Aufruf an Studierende: „Für Gebiete wie Spieltheorie oder Behavioral Economics, die zunächst etwas theoretisch anmuten, gibt es hier wirklich ein Anwendungsfeld, in dem man einen Unterschied machen und messbaren Mehrwert heben kann.“

ALEXANDER BERGMANN
Alexander Bergmann ist Partner bei Kerkhoff Consulting mit Sitz in Düsseldorf und Wien. Er fungiert als Head of Negotiations und berät regelmäßig Unternehmen zur Spieltheorie und Advanced Negotiations.
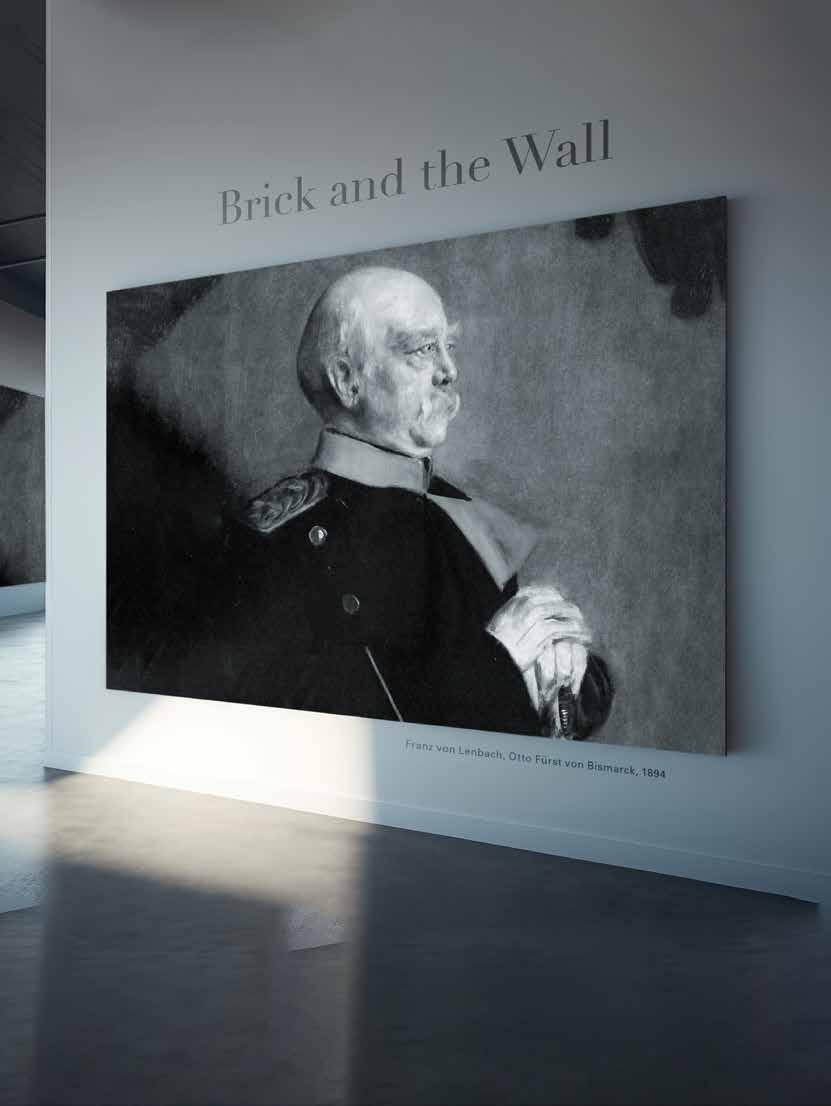
Unter Reichskanzler Otto von Bismarck verabschiedete der deutsche Reichstag 1889 die erste gesetzliche Rentenversicherung. Ein historischer Akt, der vor allem als Minimierung des Risikos gesellschaftlicher Verwerfungen und als Beruhigung für die erstarkte Arbeiterschaft interpretiert wurde.
Cyberattacken werden häufiger und gefährlicher, doch Unternehmen sind nicht ausreichend darauf vorbereitet. Wie sieht eine professionelle Abwehr aus?
Von Robert Prazak
iebstahl heikler Daten, Erpressungsversuche, gefälschte E-Mails und Anrufe – in Österreich ist mittlerweile jeder siebente Cyberangriff erfolgreich. Denn solche Attacken treffen heute nicht in Wellen auf unsere IT- und Kommunikationssysteme – es ist ein wahrer Tsunami, der über Unternehmen, Behörden und Organisationen hereinbricht. „Ein Cyberangriff ist wie ein Kriegsakt gegen ein Unternehmen“, sagt Georg Beham, Leiter Cybersecurity & Privacy bei PwC.
Das Problem: Die Firmen sind in dieser Hinsicht auf Friedenszeiten eingestellt. Das bedeutet aber auch: Nur die wenigsten Unternehmen sind adäquat auf Cyberangriffe vorbereitet. „Die meisten denken ja gar nicht, dass sie Opfer werden könnten“, sagt Beham. Oftmals haben sie auch nicht auf ihre Mitarbeiter_innen gehört, dass Investitionen getätigt werden müssten. Gerade das Gefühl, ohnehin schon ausreichend getan zu haben, führt in die
Irre. Denn Ransomware-Attacken, mit denen Lösegeld zur Freigabe von Daten erpresst werden soll, können jederzeit jeden treffen, warnt Josef Pichlmayr, CEO von Security Software. „Attacken treffen zwar auf Unternehmen, die nicht unvorbereitet sind und dennoch wird es immer schwieriger, sich zu schützen.“ Während Unternehmen der kritischen Infrastruktur gut aufgestellt seien, gebe es bei anderen –speziell bei KMU und EPU – noch substanziellen Verbesserungsbedarf, konstatiert Alexander Janda, Generalsekretär des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ), das gemeinsam mit dem KSV1870 ein Cyber risiko-Rating entwickelt hat, eine Art Bonitätsrating für Cybersecurity. Die Abwehr von Cyberattacken wird anspruchsvoller. „Es wird nicht nur immer mehr, sondern nimmt auch an Komplexität zu“, sagt Pichlmayr. Das hat mehrere Gründe: Cybercrime ist zu einer blühenden Schattenwirtschaft mit arbeitsteiligen Strukturen geworden, die in immer schnelleren

Georg Beham, MSc ist Leiter Cybersecurity & Privacy bei PwC. Dort leitet er ein Team von etwa 70 Personen, die sich um Prävention, sichere Prozesse und Technologien kümmern, außerdem um Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe. Beham ist auch Vortragender an der Universität für Weiterbildung Krems.

Josef Pichlmayr ist CEO von Ikarus Security Software – sein Unternehmen bietet klassische Sicherheitslösungen, Managed Security Services sowie Engines für große Unternehmen an, um deren CloudInfrastruktur zu schützen.

Dr. Alexander Janda ist Generalsekretär des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ), das Initiativen zur Erhöhung der Sicherheit in Österreich setzt.
Zyklen neue Werkzeuge für eine kriminelle Nutzung auf den Markt bringt. Und diese Tools können mit überschaubarem technischem Verständnis genutzt werden. Über die Dienstleistung „Cybercrime-as-aService“ kann sich jede_r potenzielle Kriminelle, darunter solche aus Österreich, genau das herauspicken, was er oder sie
„Ein Problem: der Austausch zwischen Behörden im Westen und jenen in Russland bzw. in den Russlandfreundlichen Regionen ist nicht mehr vorhanden.“
Josef Pichlmayr
für eine Cyberattacke braucht – bei relativ niedrigem Risiko. Schätzungen zufolge ist die Cybercrime-Industrie weltweit die drittgrößte Volkswirtschaft. Beham: „Heute gibt es Affiliate-Systeme, die kriminellen Organisationen zur Verfügung stehen.“ Diese sind hochspezialisiert und gegen diese Professionalisierung sind die meisten Unternehmen machtlos.
Zunehmend politisch motiviert
Die Bedrohung durch Cyberangriffe hat seit Mitte der 2010er-Jahre stark zugenommen, denn davor war kein Geschäftsmodell dahinter gestanden. Zudem hat die Abhängigkeit von der IT durch die Digitalisierung und die Entwicklungen im Zuge der Covid-Pandemie zugenommen.
Dazu kommt seit 2022 der Ukraine-Krieg; Cyberangriffe sind zunehmend politisch motiviert, teilweise gibt es sogar staatliche Unterstützung. Das bedeutet: Traditionelle Konflikte verschmelzen mit digitaler Kriegsführung und Zivilgesellschaften werden über Desinformation und Manipulation ins Visier genommen. „Ein Problem ist, dass der Austausch zwischen Behörden im Westen und jenen in Russland bzw. in den Russland-freundlichen Regionen nicht mehr vorhanden ist“, erläutert Pichlmayr. Das bedeutet: Leute, die von dort aus Unternehmen und Infrastrukturen in west lichen Ländern attackieren, haben nichts zu befürchten.
KI verschärft Situation
Und jetzt kommt noch der steigende Einsatz künstlicher Intelligenz dazu: Cyberkriminelle sind ja hochspezialisiert und nutzen stets fortschrittliche Technologien, um ihre Angriffe durchzuführen. So können mit Deepfakes Anrufe oder sogar Online-Meetings gefälscht werden; Menschen werden dabei anhand frei verfügbarer Bilder oder Videos aus dem Netz durch KI-Tools nachgebildet. Durch KI können zudem Phishing-Mails täuschend echt formuliert werden; Nachrichten in holprigem Deutsch gehören der Vergangenheit an. Dabei könnte KI im Prinzip nicht nur die Angriffsmöglichkeiten erhöhen, sondern auch die Verteidigung stärken. „Die Frage ist: Wer ist geschickter im Umgang mit der neuen Technologie?“, sagt Janda. Derzeit sind Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen seiner Meinung nach eher im Nachteil. Es wird jedenfalls immer wichtiger, Mitarbeiter_innen für das Risiko etwa von Deepfakes zu sensibilisieren, denn gerade diese Technologie entwickelt sich rasant. Auch die Scham der Unternehmen schadet der gemeinsamen Abwehr: So wird in Deutschland überhaupt nur jeder zehnte Ransomware-Vorfall den Behörden gemeldet.
Ehrlichkeit gegenüber sich selbst Was können Unternehmen konkret tun? Zunächst braucht es Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. „Fakt ist: Man kann 20 Jahre
Digitalisierung ohne Sicherheit nicht in einem halben Jahr nachholen“, meint Beham. Dass große Unternehmen besser geschützt sind, ist nach Ansicht Pichlmayrs übrigens ein Mythos: „Diese haben zwar mehr Ressourcen, bieten aber viel mehr Angriffsflächen, weil sie mehr Mitarbeiter und mehr Infrastrukturen haben, außerdem sind sie bekannter.“ KSÖ-Generalsekretär Janda hat einen Tipp für KMU parat: „Für Mitglieder der Wirtschaftskammer gibt es eine Fülle von Angeboten, die sie zur Erhöhung ihrer Sicherheit nutzen können, von Handbüchern über eine Cybersecurity-Hotline bis zum Kontakt mit spezialisierten Dienstleistern.“
Der Faktor Mensch spielt nach wie vor eine große, wenn nicht die größte Rolle in Sachen IT-Sicherheit. Cybersicherheit kann technologisch erledigt werden, aber die optimale Prävention hat ihre Grundlage in der Organisation, nicht in der IT, meint Georg Beham. „Führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen und den einzelnen Mitarbeitern muss bewusst gemacht werden, was auf dem Spiel steht.“ Die beste Firewall nütze nichts, wenn et-
was angeklickt wird oder Daten weitergegeben werden, warnt auch Janda. „Gesunder Menschenverstand ist nötig, um die Kommunikation trotz der Risiken aufrechtzuerhalten.“ Werden gewisse Grundregeln eingehalten, wird es schwierig für Angreifer_innen. „Dazu zählt, wer was in meinem Unternehmen machen darf“, sagt Pichlmayr. Es brauche eine Awareness-Strategie – statt einzelner Seminare ist es aber sinnvoller, die digitale Kompetenz der Mitarbeiter_innen insgesamt anzuheben, inklusive einem starken Fokus auf Sicherheit. Was bringt eigentlich eine Cyberversicherung? Diese könne Unternehmen zwar vor finanziellen Verlusten durch Cyberangriffe schützen, mache sie andererseits für Angreifer_innen aber attraktiver, warnt Beham. „Versicherte Unternehmen könnten daher ein größeres Risiko für Cyberangriffe haben.“ Sich in trügerischer Sicherheit zu wiegen ist generell ein falscher Ansatz. Denn Pichlmayr stellt klar: „Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz.“ Wichtig sei es, zu definieren, was ein vertretbares Maß an Risiko sein – und da müsse man eben priorisieren.
Ransomware:
Schadsoftware, mit der Dateien verschlüsselt und erst wieder freigegeben werden, wenn ein Lösegeld bezahlt wurde. Zunehmend nutzen Kriminelle dabei gestohlene Firmendaten auch auf andere Weise.
Phishing:
Ein Betrugsversuch, bei dem Kriminelle gefälschte E-Mails oder Websites erstellen, um an Passwörter oder andere wichtige Daten zu gelangen.
Malware:
Sammelbegriff für alle schädlichen Computerprogramme, die etwa dazu entwickelt wurden Daten zu stehlen. Zu Malware gehören Viren, Trojaner und auch Ransomware.
Deepfakes:
Mit Hilfe von KI manipulierte Medieninhalte wie Fotos oder Videos, die kaum von der Realität zu unterscheiden sind.
NIS2:
Richtlinie der EU („Network and Information Security Directive 2“) zur Cybersicherheit, mit der wichtige Organisationen bzw.
Weiterbildungstipp
MBA Information Security Management & Cyber Security: Die Universität für Weiterbildung Krems bietet das WeiterbildungsMasterstudium berufsbegleitend im Format Blended oder Distance Learning an.
Unternehmen widerstandsfähiger gegen Cyberbedrohungen gemacht werden sollen, etwa aus den Bereichen Energie und Gesundheit. In Österreich noch nicht umgesetzt, würde rund 4000 Firmen betreffen.
Cyber Resilience Act:
EU-Gesetz, das für alle Geräte mit Internetanschluss (etwa Smartphones, Spielekonsolen, aber auch Babymonitore) bestimmte Sicherheitsstandards vorsieht, damit diese nicht so leicht gehackt werden können.
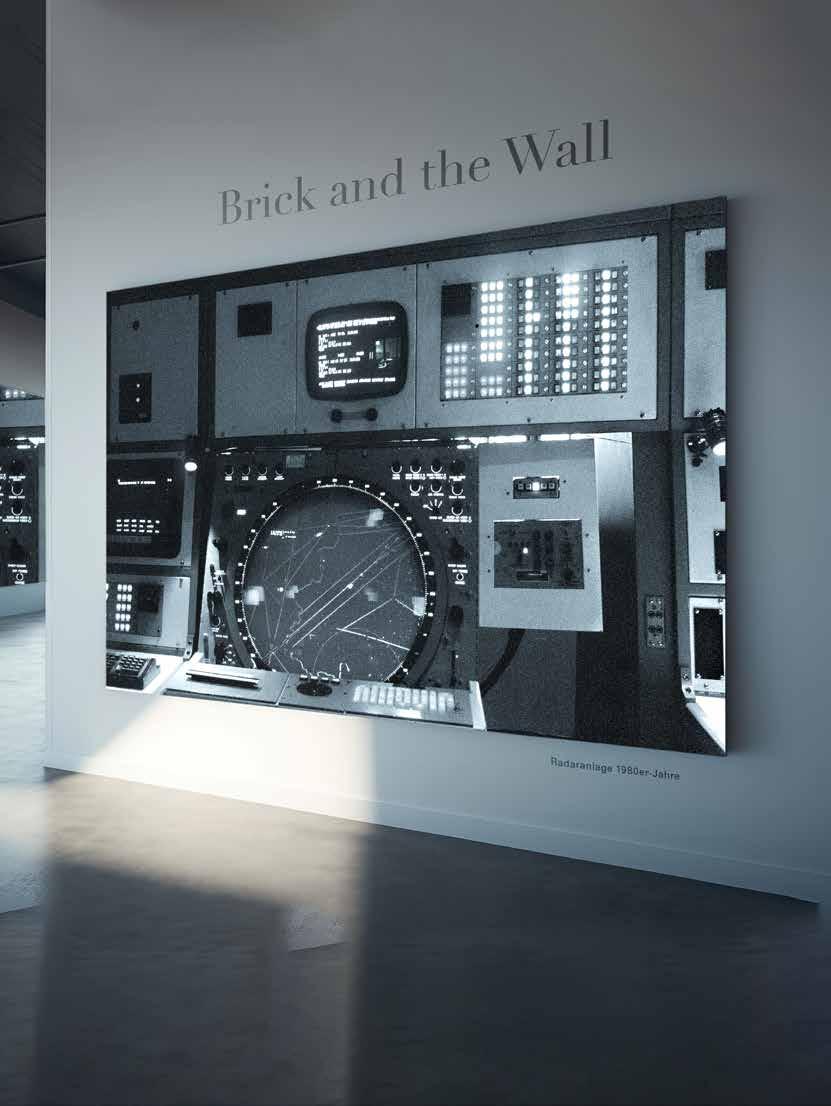
26. September 1983: Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow bekommt vom russischen Frühwarnsystem die Meldung über den Start US-amerikanischer Atomraketen. Das sowjetische System hätte einen sofortigen Gegenschlag vorgesehen. Petrow folgt trotz erheblichem Zeitdruck seiner Skepsis, meldet die Raketen nicht und hatte Recht: Satelliten missinterpretierten Wolkenreflexionen als startende Atomraketen. Seine Einschätzung unterbrach die Kettenreaktion der Befehle und die Vernichtung der Welt.
Psychologische Sicherheit reicht weit über das Fehlen von Bedrohung hinaus. Sie beschreibt ein subjektives Empfinden, das im Zusammenspiel individueller Erfahrungen und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen entsteht – mit Vertrauen als entscheidendem Faktor.
Von Mario Wasserfaller
er US-amerikanische Psycho -
loge Abraham Maslow definierte Sicherheit bereits 1954 als grundlegendes menschliches Bedürfnis, unmittelbar nach existenziellen Erfordernissen wie Nahrung und Schlaf. In seinem vielfach als „Bedürfnispyramide“ dargestellten sozialpsychologischen Modell steht die körperliche, seelische und materielle Sicherheit direkt über den lebensnotwendigen Bedürfnissen und bildet die Basis für soziale und individuelle Entfaltung.
Maslows Bedürfnishierarchie wirkt auf den ersten Blick plausibel, steht jedoch unter anderem wegen ihrer westlich geprägten, individualismus- und statusorientierten Sichtweise sowie aufgrund fehlender empirischer Fundierung in der Kritik. Das zeigt bereits ein zentrales
Spannungsfeld in der Diskussion um psychologische Sicherheit auf: Während sich objektive Sicherheit anhand quantifizierbarer Daten wie Kriminalitätsraten zumindest grob erfassen lässt, beruht subjektives Sicherheitsgefühl auf individueller Wahrnehmung und entzieht sich damit einer eindeutigen Analyse.
Mehrheit fühlt sich sicher
Eine Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres aus dem Jahr 2024 zeigt beispielsweise, dass sich 84 Prozent der österreichischen Bevölkerung „sehr“ oder „eher sicher“ fühlen. Die Ergebnisse variieren jedoch deutlich, etwa in Abhängigkeit von Wohnort oder Bildungsgrad. Menschen mit höherem Bildungsabschluss oder aus ländlichen Regionen empfinden tendenziell mehr

VANESSA KREUTER
Dr.in Vanessa Kreuter ist Ärztin und Psychotherapeutin in einer niedergelassenen
Kassenpraxis, ärztliche Leiterin im Ambulatorium „Haus der Zuversicht“ und Schulärztin in mehreren Schulen.

WALTER SEBÖCK
Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Professor für Security Studies und leitet das Department für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems.
Sicherheit als Stadtbewohner_innen oder Personen mit Pflichtschul- oder Lehrabschluss.
Für das individuelle Sicherheitsempfinden sind Statistiken allein kaum ausschlaggebend, weiß Walter Seböck, Leiter des Departments für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems: „Die Wahrscheinlichkeit, einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen, ist vermutlich in manchen Gegenden geringer als die, von einem Blitz erschlagen zu werden. Trotzdem ist dieses Gefühl da, sich unsicher zu fühlen.“ Seböck führt das Gefühl latenter Bedrohung an, etwa auf Bahnhöfen. Gerade solche öffentlichen Orte werden auch in der genannten Umfrage als besonders unsicher wahrgenommen: Lediglich 55 Prozent der Befragten gaben an, sich dort zumindest meistens sicher zu fühlen.
Selektive Wahrnehmung durch Nachrichten
Negative Ereignisse wie Gewaltverbrechen, Terroranschläge oder Naturkatastrophen schaffen es deutlich häufiger in die Schlagzeilen als positive Nachrichten. Diese selektive Wahrnehmung beeinflusst das Sicherheitsgefühl der Menschen erheblich. Bezeichnet wird diese kognitive Verzerrung als Verfügbarkeitsheuristik: Je öfter Menschen über Risiken hören oder lesen, desto wahrscheinlicher schätzen sie deren Auftreten ein. Soziale Medien verstärken diesen Effekt zusätzlich, indem sie Katastrophen, Gewalttaten und politische Krisen in Echtzeit verbreiten. Dadurch verfestigt sich das Bild einer Welt, die als überdurchschnittlich gefährlich wahrgenommen wird.
Die Ärztin und Psychotherapeutin Vanessa Kreuter erlebt diesen Zusammenhang auch in ihrer Praxis, in der Angststörungen zunehmend zum Thema werden. „Diese empfundene Nähe ist durch die sozialen Medien extrem in den Fokus gerückt, weil sie jede Schwierigkeit, jedes Problem und jede Angst direkt ins Wohnzimmer holen“, sagt Kreuter, die eine Kassenpraxis führt und auch als Schulärztin an mehreren Schulen tätig ist. Ihr Rat: so viel Zeit wie möglich offline verbringen,
idealerweise mit vertrauten Menschen und fernab vom Smartphone.
Weltverdruss bei Jugendlichen
„Vertrauen und Kontrolle sind die beiden zentralen Elemente, wenn es um psychologische Sicherheit geht“, erklärt sie. Menschen müssten darauf bauen können, dass ihre Umgebung Schutz bietet – sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. Die ärztliche Leiterin des Ambulatoriums „Haus der Zuversicht“ beobachtet, dass viele Menschen ihrem Umfeld
„Der Sicherheitsbegriff wird stark durch Sozialisation geprägt – durch Familien, Schulen, Freunde, aber auch Institutionen wie Religion und Medien.“
Michael Fischer
zunehmend misstrauen, was das persönliche Sicherheitsgefühl deutlich beeinträchtigt. Entscheidend sei, „dass man sich ohne Angst vor einem Verlust an Kontrolle aus dem Haus traut.“
Gerade bei Jugendlichen führt fehlendes Vertrauen häufig zu Ängsten, etwa durch Mobbing in der Schule oder durch die Sorge vor äußeren Bedrohungen wie Krieg oder dem Klimawandel. Kreuter schildert die Lage eindrücklich: „Die
Ängste beginnen damit, dass sie nicht mehr zur Schule gehen wollen, weil es ohnehin keinen Sinn hat. Entweder werden sie bereits gemobbt oder sie haben Angst, dass es passieren könnte.“
Sozialisation, Stabilität und Vertrauen
Auch auf gesellschaftlicher Ebene erweist sich Vertrauen als Schlüsselfaktor. Michael Fischer, Leiter der Fakultät für Sicherheit an der FH Wiener Neustadt, beschreibt Sicherheit als ein gesellschaftlich geformtes Konstrukt, das auf Sozialisation, Stabilität und Vertrauen beruht. „Der Sicherheitsbegriff wird stark durch Sozialisation geprägt – durch Familien, Schulen, Freunde, aber auch Institutionen wie Religion und Medien,“ erläutert Fischer.
Für ihn vermittelt Stabilität ein Gefühl von Sicherheit. Unerwünschte Veränderungen können dagegen Unsicherheit auslösen, so der Experte. Das zeige sich etwa in Neophobie, der Angst vor Neuem, oder in Xenophobie, der Angst vor Fremdem. Beides deute auf ein starkes Bedürfnis nach Orientierung hin. Ebenso wichtig sei das Vertrauen in staatliche Institutionen.
Fehlt dieses Vertrauen, nimmt das Unsicherheitsgefühl zu.
Auch die Gestaltung des öffentlichen Raums beeinflusst, wie sicher sich Menschen fühlen. Beleuchtete Wege, sichtbare Polizeipräsenz und gepflegte Plätze schaffen Orientierung und Vertrauen, sagt Fischer: „Oft ist Sicherheit nicht nur eine Frage der Kriminalität, sondern auch der Beleuchtung oder von baulichen und stadtplanerischen Maßnahmen.“
Wege zur psychologischen Sicherheit
Um das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft zu stärken, braucht es für die Expert_innen ein Bündel gezielter Maßnahmen, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen.
Ein wesentlicher Baustein dafür sind Bildung und Aufklärung, besonders eine frühzeitige Sensibilisierung in Schulen. Kinder sollen lernen, Ängste wahrzunehmen, richtig einzuordnen und souverän mit Krisensituationen umzugehen. Regelmäßige Krisenübungen, vergleichbar mit
Erste-Hilfe-Kursen, stärken die Handlungskompetenz. „Übung und permanentes Wiederholen solcher Situationen helfen, in Stressmomenten einen kühlen Kopf zu bewahren,“ erklärt Walter Seböck.
Dazu gehört für den Sicherheitsforscher auch der Kampf gegen die gerade auf sozialen Medien grassierende Desinformation: „Durch technologische Möglichkeiten kann die Realitätsverzerrung immer stärker werden.“ Der Experte verweist diesbezüglich auf laufende Forschungsprojekte an der Universität für Weiterbildung Krems, wie „DESINformations Früh erkennung von gefährdenden online nAChrichten Trends“ (siehe Seite 44) oder „Young Citizen Scientists against Disinformation“.
Klassische Medien stehen ebenso in der Pflicht. „Medien sollten als vertrauensbildende Maßnahme ihren Beitrag leisten, indem sie neben negativen Ereignissen verstärkt positive Entwicklungen in den Fokus rücken“, sagt Vanessa Kreuter. Dadurch entstehe ein ausgewogeneres Bild der Weltlage, das das subjektive Sicherheitsempfinden in der Gesellschaft festigen könne.
Vertrauen gegenüber Institutionen
Ein weiterer Schlüssel liegt im Aufbau von Vertrauen gegenüber staatlichen Institutionen, und gerade das ist alles andere als selbstverständlich. Sichtbare Polizeipräsenz und der offene Dialog mit Bürger_innen, wie ihn die Initiative „Gemeinsam Sicher“ fördert, können dabei unterstützend wirken. „Wir müssen der Polizei wieder ein Gesicht geben,“ fordert Michael Fischer. „Die Bevölkerung muss wissen, wer hinter der Uniform steckt, um Hemmschwellen abzubauen.“
Nicht zuletzt ist auch die Sicherheitsforschung gefragt, neue Perspektiven zu entwickeln und tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Sicherheitsfachmann Fischer sieht dabei vor allem im Zusammenspiel Potenzial: „Der Hochschulsektor muss bei Themen wie subjektiver Sicherheit, Cybersicherheit sowie sicherheitsrelevanten Fragestellungen im polizeilichen und gesamtgesellschaftlichen Kontext noch enger zusammenarbeiten.“

Mag. Dr. Michael Fischer, MSc ist Leiter der Fakultät Sicherheit an der FH Wr. Neustadt und Leiter der Forschungsabteilung der NÖ Landesgesundheitsagentur. Der ehemalige stv. Direktor des Bundeskriminalamts ist promovierter Soziologe und Absolvent des Masterstudiums Politische Bildung an der Universität für Weiterbildung Krems.
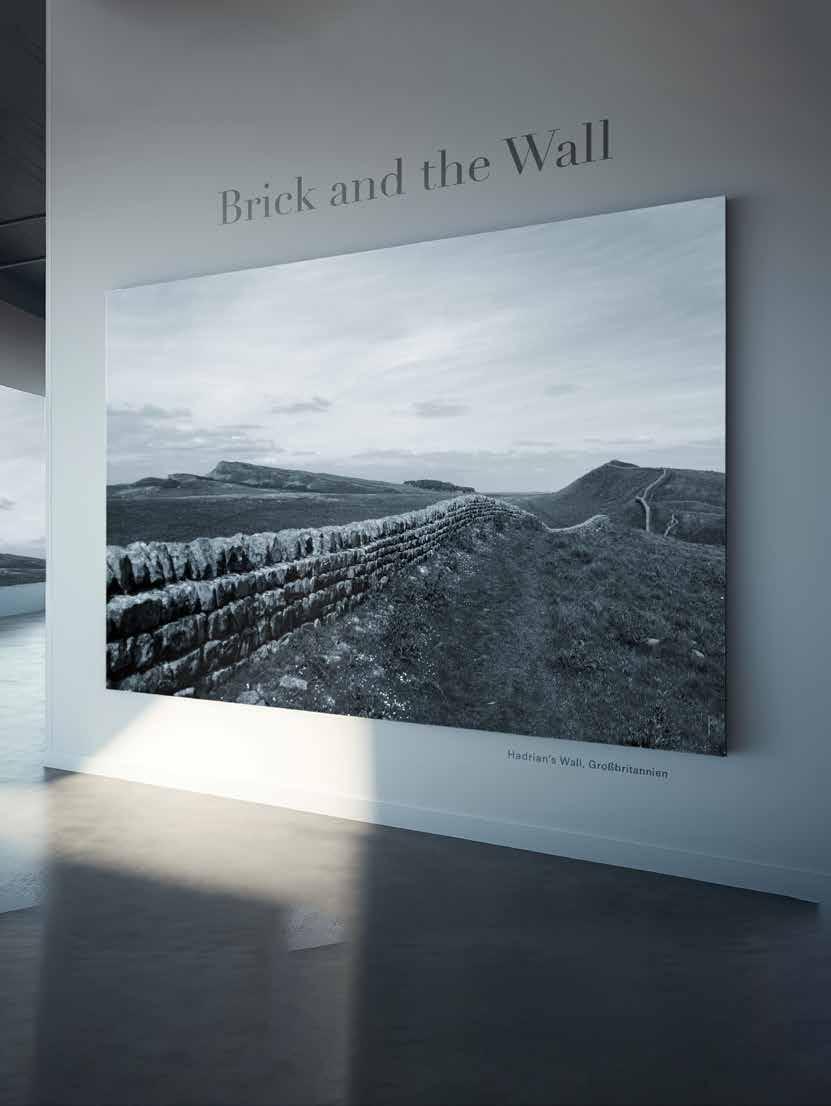
Der Hadrianswall in Schottland war eine bis 128 n. Chr. auf Anordnung Kaiser Hadrians erbaute, rund 118 Kilometer lange Befestigung, die vor allem der Überwachung des Handels- und Personenverkehrs sowie seiner Kanalisierung an Grenzübergängen diente. Damit wurde die Einhebung von Zöllen möglich.
ChatGPT und Deepseek sind in aller Munde, auch immer mehr Unternehmen setzen auf KI. Doch wie vertrauenswürdig und sicher sind diese Modelle?
Von Martin Stepanek
ünstliche Intelligenz (KI) ist keine Erfindung der 2020er-Jahre, auch wenn der anhaltende Diskurs um mächtige Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini und Deepseek das suggerieren könnte. Mehr oder weniger smarte Algorithmen beeinflussen schon seit Jahrzehnten Energie- und Flugticketpreise, helfen uns bei der Navigation auf der Straße oder berechnen aus Millionen Sensordaten und Tausenden Simulationen die wahrscheinlichste Wetterprognose. Und doch hat sich durch die erwähnten Large Language Models unser Umgang mit KI radikal verändert.
Dass man mit diesen digitalen Helfern plötzlich auf natürliche Weise ein Gespräch führen kann und diese in der Lage sind, auch komplexe Sachverhalte richtig abzuleiten, macht die gezielte Nutzung von KI erstmals der breiten Masse zugänglich. Durch den enormen Datenpool, mit dem diese Sprachmodelle in den vergangenen Jahren gefüttert wurden, sind sie zudem fast universell einsetzbar und lassen herkömmliche Suchmaschinen oft alt aussehen.
Doch das hat seinen Preis. Wim Vanderbauwhede von der University of Glasgow etwa rechnet in einer aktuellen Studie vor, dass der Energieverbrauch für eine KI-gestützte Suchanfrage um das 60bis 70-fache höher ist als bei einer herkömmlichen Web-Suche. Doch das ist nur ein problematischer Aspekt von vielen, die nicht zuletzt bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Alarmglocken schrillen ließen. Mit der im August 2024 in Kraft getretenen KI-Verordnung („AI Act“) wird der Einsatz von KI in vier Risikokategorien mit entsprechend strengen Auflagen unterteilt.
Europas ethische KI
„Im Vergleich zu den USA und China, wo die KI-Entwicklung mit enormer Geschwindigkeit und viel Geld vorangetrieben wird, geht Europa hier einen ganz anderen Weg“, erklärt Günther Kainz, Studienleiter beim Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. „Bei uns steht die Sicherheit solcher Systeme und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft viel stärker im Vordergrund.

GÜNTHER KAINZ
Mag. Mag. Dr. Günther Kainz, Bakk. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Dort leitet er u.a. das Weiterbildungsstudium „MBA Information Security Management & Cyber Security“.

ALEXANDER PFEIFFER
Mag. Dr. Alexander Pfeiffer, MBA MA ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Angewandte Spieleforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Der Blockchain- und Smart-Contracts-Experte forschte auch am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Das reicht von kritischer Infrastruktur über hochsensible Bereiche wie Medizin und Finanzen zu persönlichen Grundrechten am Arbeitsplatz und im privaten Bereich.“
Dass die EU ihre Bürger_innen sowie ihre Infrastruktur vor verantwortungslos eingesetzter KI schützen möchte, ist ein hehres Ziel. Doch kann das in einer globalisierten Welt überhaupt gelingen?
Kritische Stimmen warnen zudem davor, Europa könnte durch die strengeren Vorgaben und limitierten Einsatzmöglichkeiten an Tempo und Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Sorge ist groß, dass Europas KI-Zukunft am Ende erst wieder von Konzernen aus den USA oder China dominiert sein wird.
„Was den Status Quo der Entwicklung betrifft, scheint Europa momentan im Nachteil. Gleichzeitig haben alle KI-Systeme große Probleme, was ihre Vertrauenswür-
„Wenn Europa es schafft, zum Vorreiter für eine vertrauenswürdige KI zu werden, ist das ein großer Wettbewerbsvorteil.“
Günther Kainz
digkeit, Zuverlässigkeit, aber auch deren Bias, also vorurteilsbehaftete Schlussfolgerungen betrifft“, sagt Kainz. Wenn Europa es schaffe, zum Vorreiter für eine vertrauenswürdige KI zu werden, die ethisch und transparent in klar abgesteckten rechtlichen Rahmen agiere, sei das ein großer Wettbewerbsvorteil, ist Kainz überzeugt. Die technische und regulatorische Kompe -
tenz sei jedenfalls vorhanden. „Die meisten Unternehmen wissen derzeit noch nicht, wie und wo sie KI sinnstiftend und gewinnbringend einsetzen können. Das Rennen ist also noch nicht gelaufen“, ergänzt er.
Doch das Thema KI ist weitaus komplexer, als die meisten Menschen es sich aktuell vorstellen können. Denn es geht letztlich nicht um das eine oder andere KI-Modell, darum, ob wir ChatGPT oder Deepseek für eine Suchanfrage nutzen oder mit welchem Bild- oder Videogenerator wir aus unseren Handyaufnahmen lustige, aber wenig originelle Kunstwerke im Stil des japanisches Animationsstudios Ghibli produzieren. Denn künftig werden Milliarden von Geräten und Objekten zu sogenannten „digitalen Agenten“, die miteinander kommunizieren und mithilfe von KI selbstständig Entscheidungen treffen.
„KI-Systeme müssen nicht zwangsläufig Chatbots sein, denen ich Fragen stelle. Sie können auch in unserem Auftrag agieren – Termine aus meinem Kalender heraus ausmachen, oder automatisch Milch bestellen, wenn der Kühlschrank meldet, dass keine mehr da ist“, sagt Alexander Pfeiffer. Der Blockchain- und Smart-Contracts-Experte, der viele Jahre an der Universität für Weiterbildung Krems, aber auch am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu dem Thema forschte, warnt vor den rechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen dieser Interaktionen.
Riskanter Datenaustausch
Denn weder sei global geregelt, wie eindeutige und überprüfbare Identitäten für all diese digitalen Agenten gewährleistet werden können, noch in welcher Form teilweise sensible Daten verschlüsselt, aber gleichzeitig protokolliert übertragen werden. Abgesehen von Rechtsverletzungen, etwa wenn unternehmensinterne Daten in diesem undurchschaubaren System von digitalen Agenten an andere digitale Agenten automatisiert weitergegeben werden, öffne das ein riesiges und absolut unter-
schätztes Feld von Cybercrime und Manipulationen. Das betreffe sowohl das unternehmerische wie private Umfeld, ist Pfeiffer überzeugt.
Da technische Lösungen wie die digitale Signatur oder anderweitig verschlüsselte Kommunikation bis heute nicht flächendeckend und vor allem nicht länder- und kontinentübergreifend eingesetzt werden, ist der Forscher skeptisch, ob wir als Gesellschaft tatsächlich schon bereit für eine Welt mit zahllosen digitalen Agenten sind, die selbstständig und weitgehend ohne Kontrolle mit sensiblen Daten interagieren. „Technisch gesehen gibt es auch für die digitalen Agenten Lösungen – etwa SmartContract-Systeme mit durchdachten und umweltfreundlichen Blockchain-Lösungen“, sagt Pfeiffer.
So weitläufig die Einsatzmöglichkeiten und Ausgestaltungen von Künstlicher Intelligenz sind: Die digitale und Medien-Kompetenz zu stärken, ist auch nach Ansicht von Clemens Appl das Um und Auf, um von den neu vorhandenen KI-Möglichkeiten zu profitieren. „In vielen Bereichen, bis hin zur Wissenschaft, kann KI das Leben viel einfacher und effizienter machen. Darauf zu verzichten, wäre unsinnig“, erklärt der Leiter des Zentrums für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht der Universität für Weiterbildung Krems. „Gleichzeitig müssen wir die Fähigkeit noch stärker trainieren, KI-generierte Ergebnisse auf ihre Plausibilität zu überprüfen, diese einzuordnen und letztlich zu bewerten.“
Mehr Kreativität durch KI
Im Kreativbereich müsse man natürlich die Frage klären, wie Beteiligungsmodelle aussehen, wenn KI-Lösungen auf menschlicher Schöpfungskraft beruhen und jene gleichzeitig zu ersetzen drohen. Abgesehen von der schwierigen Urheberrechtsfrage bei Trainingsdaten, die von KI-Startups, aber auch den großen Tech-Konzernen eher unter den Tisch gekehrt werde, gibt es laut Appl aber auch eine positive Kehrseite. „Der Einsatz von KI kann insofern auch wieder zu mehr Kreativität führen, weil er vielen Personen erlaubt, ihre Ideen umzusetzen, die bisher nicht über das nö -
tige Handwerk verfügten – sei es mit Photoshop arbeiten, zu malen oder auch ein Computerprogramm zu schreiben.“
Die Diskussion über die Fehleranfälligkeit von KI-Systemen – bei Sprachmodellen wie ChatGPT spricht man von Halluzinieren, wenn sie faktisch falsche Antworten erfinden – sieht Appl hingegen
„Die mangelnde Regelung des undurchschaubaren
Systems digitaler Agenten öffnet ein unterschätztes Feld von Cybercrime.“
Alexander Pfeiffer
eine Spur gelassener als so manch anderer. „Auch von einem Menschen bekommt man hin und wieder eine falsche Information. Das Problem ist eher, dass wir Maschinen eine absolute Unfehlbarkeit unterstellen und ihnen vielleicht zu unkritisch vertrauen“, sagt Appl.
Abgesehen davon, dass man mit Maschinen nicht strenger als mit Menschen ins Gericht gehen solle, machten genau diese Fehlbarkeiten aber auch eines besonders deutlich: Der Mensch bleibe als Kontrollinstanz unersetzbar, ist Appl überzeugt. „Um diese Rolle wahrnehmen zu können, müssen wir gewisse Grundkompetenzen allerdings weiterhin erlernen, auch wenn wir wissen, dass es Maschinen vielfach besser, jedenfalls aber schneller können als wir“.
Martin Stepanek ist Wissenschaftsjournalist bei der Tageszeitung „Der Standard“.

Der Urheberrechtsspezialist Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M. ist Leiter des Zentrums für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht der Universität für Weiterbildung Krems.

TUNNEL 57
Als er zu graben begann, waren beide 22 Jahre alt, als Christa durch einen Tunnel in die Freiheit kroch war sie drei Jahre älter. So lange dauerte es, bis Joachim Neumann den heute als „Tunnel 57“ bekannten Fluchtweg unter der Berliner Mauer fertiggestellt hatte mit dem Ziel, seine Freundin in die Freiheit zu holen. Nach den Neumanns gelang insgesamt 57 Menschen die Flucht – daher der Name –, ehe der Tunneleingang entdeckt wurde.
Rechtsextremist_innen und islamistische Influencer_innen teilen sich dasselbe Feindbild: die liberale Demokratie. Kluge Worte gegen ihre starken Narrative helfen wenig.
Es braucht eine bessere Gegenerzählung.
Von Wolfgang Rössler
s ist verlockend, sich über den selbst ernannten Scheich lustig zu machen. Der lange Vollbart, der aussieht, als wäre er mit einer Motorsäge gestutzt. Dazu Kopftuch, Kaftan, Badeschlapfen. Und dann dieser übertrieben Ernst, mit dem er Fragen beantwortet. Etwa jene, ob man in einer Moschee Fußball spielen darf. „Ja“, sagt Ibrahim al-Azzazi, solange man dort nichts kaputt macht. Immerhin.
Bis vor einem Jahr hat sich der in München geborene Endzwanziger auf TikTok und YouTube mit Fragen junger Muslima und Muslime beschäftigt. Und meistens lautete seine Antwort „Nein“. Al-Azzazi ist Salafist, er vertritt eine archaisch-fundamentalistische Auslegung des Islam. Geburtstagsfeiern seien verboten, ebenso die Teilnahme an Wahlen. Frauen hätten sich Männern unterzuordnen, wenn nicht, soll-
ten diese Gewalt anwenden. Einzige Ausnahme: „Man darf Frauen nicht ins Gesicht schlagen.“
Weil er seine eigene Frau mit einem Schlagring verprügelt hatte, stand Al-Azzazi im Vorjahr vor Gericht. Inzwischen ist er untergetaucht, nach ihm wird gefahndet wegen Volksverhetzung. Er gilt als einer jener Influencer, die Ahmad G. beeinflusst haben – einen 23-jährigen Syrer, der im Februar in Villach mit einem Klappmesser einen Jugendlichen getötet und fünf weitere Personen verletzt hat. Der junge Mann ist nach Ansicht von DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner kein Einzelfall. Der oberste Verfassungsschützer des Landes schätzt, dass sich die Anzahl der so genannten Gefährder – die zu einem Terroranschlag bereit wären – in Österreich im höheren zweistelligen Bereich bewegt. Und unter diesen gebe es

Mag. Dr. Nicolas Stockhammer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für Sicherheitsforschung, wo er für den Research Cluster „Counter-Terrorism, CVE (Countering Violent Extremism) and Intelligence“ tätig ist.

WALTER SEBÖCK
Assoz. Prof. Mag.
Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Leiter des Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems.
auch immer mehr strafunmündige Jugendliche. In einem Fall kam das DSN sogar einem zehnjährigen Buben auf die Schliche. Al-Azzazi, der 130.000 Follower_innen auf TikTok hat und Interviews in reichweitenstarken Medien, wie der BILD, gab, hat den Bogen schließlich überspannt. Die bayerische Polizei fahndet nach ihm. Aber es gibt unzählige weitere TikTok-Stars mit ähnlichen Ansichten, die von den Behörden unbehelligt bleiben. Häusliche Gewalt ist verboten. Nicht aber der Verweis auf Koransuren, die diese gutheißen. Und die meisten TikTok-Salafisten (es sind in der Tat nur Männer) wissen genau, wie weit sie gehen können.
Meinung an der Grenzlinie
„Borderline-Content“ nennt das Nicolas Stockhammer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Inhalte und Formulierungen also, die gerade noch unter Meinungsfreiheit fallen. Dahinter stecke Kalkül: „Das ist ein Geschäftsmodell. Die Influencer verdienen Geld mit Werbung, Halal-Produkten und Pilgerreisen.“ Es handle sich mitnichten um Verrückte: „Sie gehen clever vor. Hinter den Videos steckt ein komplexes Konzept. Die Topstars der Szene können davon gut leben“, sagt er. Auch deshalb seien sie darauf erpicht, nicht mit Terrororganisationen wie dem IS in Verbindung gebracht zu werden. Das wäre schlecht für das Business.
Die Videos von Al-Azzazi und anderen holen aber orientierungssuchende Jugendliche mit muslimischem Hintergrund ab und bereiten den Boden auf für den IS. Sie sind eine Einstiegsdroge. Wer einmal im salafistischen Paralleluniversum gefangen ist, findet leicht Zugang zu Leuten, die junge Menschen über Chats manipulieren und zu Gewalt anstiften.
Dabei arbeiten salafistische Prediger über weite Strecken mit denselben Mitteln, wie ihre angeblich erbittertsten Gegner, die Rechtsextremen. Man teilt sich nicht nur die Bühne auf TikTok. Auch Ästhetik und Machart der Videos sind vergleichbar. Kein Zufall, meint Stockhammer: „Die Szenen kopieren voneinander.“ Etwa was
Memes betrifft, hartgeschnittene Videos mit einschlägiger Musik oder die Gamification der Propaganda. Letzteres war eine Innovation der rechtsextremen „Alt-Right“ Bewegung in den USA. Inzwischen ist das auch in der islamistischen Szene gang und gäbe. Technisch sind die Feinde der Freiheit am letzten Stand.
Das allein aber erklärt das Phänomen nicht. Es braucht eine Zielgruppe, die ansprechbar ist. Auch hier zeigen sich Überschneidungen. „Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die unter einer gewissen Orientierungslosigkeit leiden und nach Zugehörigkeit suchen“, sagt Walter Seböck, von der Universität für Weiterbildung Krems. Gerade Pubertierende seien anfällig: Probleme mit den Eltern, im Unterricht, Ausgrenzung am Pausenhof, Mobbing im Internet. All das führe zu einem starken Gefühl der Benachteiligung. „Es ist nicht schwer, sich mit 15 diskriminiert zu fühlen“, sagt Seböck. Das ist keine neue Entwicklung. Neu ist, dass die Welt zunehmend unübersichtlich wird, auch in Österreich. „Die Demokratie bietet kein geschlossenes Weltbild. Man muss sich dort erst zurechtfinden“, sagt Seböck. Und dabei fühlten sich viele Junge allein gelassen. Das ist ein Einfallstor für Radikale, die ein einfach gestricktes, schwarz-weißes Weltbild bieten und klare Antworten haben. Nicht nur pubertierende Jugendliche hadern mit der modernen Welt. Und nicht nur sie sind empfänglich für demokratiefeindliche Botschaften. „Europa und der freie Westen sind im ideologischen Zangengriff. Wir werden von unterschiedlichen Seiten angegriffen“, sagt der Journalist und Autor Stefan Kaltenbrunner, der zu Jahresbeginn gemeinsam mit profil-Redakteur Clemens Neuhold ein Buch mit dem Titel „Allahs mächtige Influencer“ veröffentlicht hat. Kaltenbrunner hat sich besonders mit der islamistischen Propaganda und deren Auswirkungen auf Jugendliche beschäftigt. Auch er weist auf die Parallelen zum Rechtsextremismus hin – auch die gemeinsamen Feindbilder: freie Universitäten, Feminismus, die LGBTQ-Szene und eine diverse Gesellschaft. Die
staatsfeindliche Propaganda extremer Agitator_innen auf TikTok richtet sich gezielt an die Jugend. Aber auch Erwachsene sind nicht gefeit gegen Fakenews auf Facebook, X und anderen Plattformen. Die Attacken auf die Freiheit kommen aus allen verfügbaren Kanälen. Der Kampf gilt dem „System“ – jenem Gesellschaftssystem der Demokratie, das Europa Wohlstand und Freiheit gebracht hat. Das, glaubt Kaltenbrunner, sei auch die Motivation für den Dauerbeschuss: Autokratische und diktatorische Regime fürchteten die Demokratie. „Einer der Gründe für den russischen Überfall auf die Ukraine war die Angst vor der Anziehungskraft der Demokratie auf die eigene Bevölkerung“, sagt er. Die Feinde der Freiheit fühlen sich bedroht.
Gegengewicht gegen Narrative
Hier, sagt Seböck, gelte es anzusetzen, wenn man eine weitere Radikalisierung verhindern möchte. Extremist_innen hätten schließlich keine „positive Vision“ zu bieten. „Die Blaupause sind letztlich failed states“. Die Macht der Radikalen sei die Macht ihrer kräftigen Narrative. Da brauche es ein Gegengewicht: „Leider sind Demokrat_innen erstaunlich spaßbefreit, wenn es um eine aufregende Darstellung der eigenen Stärken geht. Dieses Konzert spielen die anderen besser.“
Anders ausgedrückt: Mit Ermahnungen und Erklärungen ließe sich der Kampf gegen radikale Ideologien kaum gewin-
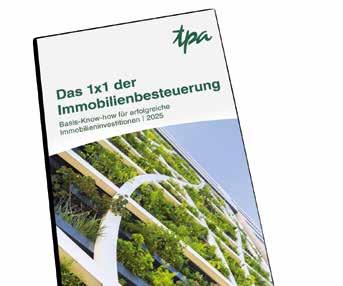
nen. Es brauche „coole Narrative“, die nicht nur auf den Verstand, sondern auch auf Gefühle zielen. Auch Demokratie brauche Pathos. Vielleicht, meint Seböck, sei der Dauerbeschuss von allen Seiten ein heilsamer Weckruf für die Demokratie,
„Europa und der freie Westen sind im ideologischen Zangengriff.“
Stefan Kaltenbrunner

Mag. Stefan Kaltenbrunner ist Journalist und Buchautor. Zuletzt veröffentlichte er mit Clemens Neuhold „Allahs mächtige Influencer: Wie TikTok-Islamisten unsere Jugend radikalisieren“. Kaltenbrunner war als Chefredakteur zuletzt für den Nachrichtensender „PULS24“ sowie für den „online-Kurier“ und „Datum“ tätig.
ihre vielen Vorzüge stärker und besser herauszuarbeiten, um ihre Gegner_innen mit den eigenen Waffen zu schlagen. Mit etwas mehr Witz und Subversion. Aber auch mit Leidenschaft und der Überzeugung, das bestmögliche Gesellschaftssystem gegen die autokratische Gefahr zu verteidigen. Seböck ist überzeugt, dass das gelingen kann: „Im Verteidigungsmodus ist die Freiheit am stärksten.“
ANZEIGE

Es wurde ein ikonischer Song der britischen Band Pink Floyd: „Another Brick in the Wall“ beschreibt die vielen Teile, aus denen jene Mauer besteht, die die fiktive Figur Pink um sich baut, als emotionale Barriere und Schutz vor einer feindlichen Außenwelt, insbesondere des Schulsystems. Sicherheit hat eine stark psychologische Komponente, der Kopf entscheidet über Abschottung oder Offenheit.
Um den Wohlstand des Landes abzusichern, ist Zuwanderung erforderlich. Dabei bleiben Migration und vor allem die Integration Risikofaktoren. Gelingt deren
Steuerung, profitiert das Land; schlägt Integration fehl, sind Verwerfungen die Folge.
Von Georg Renner
sterreich im Jahr 2040: Ein Land, das sich fundamental gewandelt hat. Die Bevölkerung ist von heute 9,1 auf 9,7 Millionen Menschen angewachsen – ausschließlich durch Zuwanderung, denn die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist seit 2020 negativ. Mit einer Fertilitätsrate von nur 1,31 Kindern pro Frau und einer rasant alternden Gesellschaft ist Migration zur Existenzfrage für Österreichs Wohlstand geworden. Doch diese demografische Transformation bringt sowohl wirtschaftliche Chancen als auch gesellschaftliche Herausforderungen mit sich, die eine strategische Neuausrichtung der Integrationspolitik erfordern.
Die demografische Realität zeigt bereits heute klare Muster: Wien wird bis 2040 um 18 Prozent wachsen und bleibt der zentrale Magnet für internationale Zuwanderung, während ländliche Regionen wie Kärnten sogar Bevölkerungsverluste verzeichnen werden. 45,4 Prozent der Wiener Bevölkerung haben bereits einen Migrationshintergrund. Diese Konzentration verstärkt urbane Integrationsherausforderungen erheblich – ein Phänomen, das sich in den Schulstatistiken niederschlägt: 45 Prozent der Wiener Erstklässler_innen gelten als „außerordentliche Schüler“, die dem Unterricht sprachlich nicht folgen können. Der Altersstrukturwandel ist dramatisch: Bis 2040 wird der Anteil der

MATHIAS CZAIKA
Univ.-Prof. Dr. Mathias
Czaika ist Leiter des Departments für Migration und Globalisierung der Universität für Weiterbildung Krems. Davor war er an der Universität Oxford tätig, wo er das International Migration Institute leitete. Er forscht u.a. zu internationaler Migration, Globalisierung und Migrationspolitik.
über 65-Jährigen von 19,2 auf 26,6 Prozent steigen, während die Erwerbsbevölkerung bereits seit 2025 schrumpft. Gleichzeitig erreicht der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 27,2 Prozent der Gesamtbevölkerung – ein Anstieg um 35 Prozent seit 2015. „Wir haben heute einen Anteil von etwa 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, der nicht hier
„Angestrebt wird eine moderne, ganzheitliche Sicherheitskultur, die alle Aspekte der Sicherheit –physisch, psychologisch sowie digital – abdeckt.“
Ingeborg Zeller
im Land geboren worden ist“, erklärt Mathias Czaika, Professor für Migration und Integration an der Universität für Weiterbildung Krems. „Durch Zuwanderung kompensiert Österreich die Alterung und den Rückgang seiner Geburtenrate. Auch wenn es schwer ist, Entwicklungen der Vergangenheit einfach so in die Zukunft zu projizieren, gehe ich davon aus, dass dieser Trend weitergehen wird und wir mittelfristig Richtung 25 Prozent gehen werden.“
Auf Zuwanderung angewiesen Österreichs Wirtschaft ist bereits heute auf Zuwanderung angewiesen. Für 2025 wurden 147 Mangelberufe identifiziert,
von Ärzt_innen über IT-Spezialist_innen bis zu Pflegekräften. Das Gesundheitswesen wird bis 2040 einen Personalbedarf von 360.000 zusätzlichen Arbeitskräften haben. Gleichzeitig steigen die Zuschüsse zum Pensionssystem auf 14,7 Prozent des BIP, während das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Pensionist_innen dramatisch sinkt. Das Land braucht jährlich etwa 50.000 Nettozuwandernde, um Bevölkerungsrückgang und wirtschaftlichen Niedergang zu verhindern.
Doch Czaika sieht die Politik vor einem beträchtlichen Spagat: „Einerseits wird sie versuchen müssen, die ungewollte irreguläre Migration zu reduzieren, damit die Akzeptanz für Zuwanderung im Allgemeinen gewahrt bleibt – dabei stößt sie an alle möglichen rechtlichen und faktischen Hürden. Aber gleichzeitig muss sie auch darauf achten, dass Österreich ein attraktives Ziel für reguläre Migrant_innen bleibt, um die Alterung und den Geburtenrückgang auszugleichen und um im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe zu bestehen.“
Die Arbeitsmarktintegration zeigt gemischte Erfolge: EU-Bürger_innen erreichen eine Beschäftigungsquote von 76,2 Prozent, Drittstaatsangehörige nur 63,1 Prozent. Besonders problematisch ist die NEET-Rate (young people who are not in employment, education or training) ausländischer Jugendlicher mit 22,6 Prozent –mehr als doppelt so hoch wie bei einheimischen Jugendlichen. Die Tatsache, dass den durch Asylmigration ins Land gekommenen Menschen häufig nötige Qualifikationen fehlen, sowie langwierige Anerkennungsverfahren verschärfen die Situation zusätzlich.
Die Kriminalitätsstatistik zeigt beunruhigende Entwicklungen: 46,8 Prozent aller Tatverdächtigen sind ausländische Staatsangehörige, obwohl sie nur 20 Prozent der Bevölkerung stellen. Besonders alarmierend ist die Jugendkriminalität: Die Straftaten von 10-14-Jährigen haben sich seit 2020 nahezu verdoppelt, wobei 48 Prozent der jugendlichen Tatverdächtigen keine österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen. Zahlen, die die gesellschaftlichen Spannungen – etwa das unbestimmte Gefühl, in Bezirken mit starker Zuwanderung „Fremder im eigenen Land zu sein“ – noch verstärken und das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung erheblich beeinträchtigen.
Im Innenministerium verweist man auf die Komplexität der Herausforderungen: Migration, innere Sicherheit und Kriminalitätsentwicklung überschnitten sich in „recht unterschiedliche Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche“, eine zentrale Koordination dieser Themenfelder gestalte sich schwierig.
Nicht nur im Sicherheitsbereich gibt es Handlungsbedarf, auch die Bildungsintegration stockt derzeit bedenklich. 45,4 Prozent der im Ausland geborenen Schüler_ innen verfehlen die Mindeststandards in Mathematik, verglichen mit 37,8 Prozent 2012. Das österreichische Schulsystem mit früher Selektion verstärkt diese Benachteiligung. In Wien haben 60 Prozent der Schüler_innen von Mittelschulen einen Migrationshintergrund, was soziale Segregation fördert.
Die österreichische Integrationspolitik zeigt sich ambivalent. Das Integrationsgesetz von 2017 fordert A2-Deutschkenntnisse für Aufenthaltsbewilligung und B1-Niveau für Dauerniederlassung, doch die Erfolgsquote bleibt gering. Nur 29 Prozent der Schüler_innen wechseln nach einem Semester aus Deutschförderklassen in den Regelunterricht. Regional divergieren die Ansätze erheblich: Während Wien auf soziale Durchmischung durch gemeinnützigen Wohnbau setzt, fehlt in ländlichen Gebieten oft die Infrastruktur für erfolgreiche Integration.
Gute Position, komplexe Antworten
Czaika sieht Österreich grundsätzlich gut positioniert: „Österreich spielt sicher in der Champions League im Wettbewerb um qualifizierte Migration. Es ist ein sicheres, wohlhabendes Land, damit ist die Republik jedenfalls konkurrenzfähig. Aber ob das so weitergeht, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die nicht alle hier im Land bestimmt werden. Österreich wird jedenfalls eine Willkommens -
kultur für erwünschte Migration pflegen müssen – und generell daran arbeiten müssen, gute Bedingungen für alle Menschen im Land zu erhalten.“
Die demografische Realität lässt keine einfachen Antworten zu. Erfolgreiche Modelle anderer EU-Länder bieten Orientierung: Die Niederlande etwa setzen auf dezentrale Flexibilität bei nationaler Koordination, nordische Länder auf umfassende Unterstützungssysteme. Österreich könnte möglichst frühe Bildungsförderung, verbesserte Qualifikationsanerkennung und regionale Verteilungsmechanismen stärken. „Wir sollten Migration jedenfalls nicht nur als Risiko sehen“, sagt Czaika, „wir brauchen einen Perspektivenwechsel, der uns auch die in die Zukunft reichenden Chancen zur Stärkung der österreichischen Gesellschaft erkennen lässt“.
„In Zukunft wird es im Safety-Management verstärkt darum gehen, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sich auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicher fühlen“, erklärt Ingeborg Zeller, stellvertretende Leiterin des Departments für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems. Denn die Herausforderungen des Arbeitsmarkts verschärfen sich durch die demografische Entwicklung: Eine alternde Erwerbsbevölkerung trifft zunehmend auf kulturell vielfältige Arbeitsumgebungen. Gerade in Zeiten des Wandels – etwa durch die technologische Beschleunigung – wird es daher immer wichtiger, Veränderungsprozesse frühzeitig und transparent zu kommunizieren, um Überforderung zu vermeiden und Sicherheit für alle Beschäftigten zu gewährleisten.
Zeller betont die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, um alle Herausforderungen zu bewältigen: „Dabei steht im Fokus eine moderne, ganzheitliche Sicherheitskultur zu etablieren, die nicht nur die physische, sondern auch die psychologische und digitale Sicherheit abdeckt. Das kann keine Ebene allein – weder die staatliche noch die Unternehmen oder die zivile – leisten, sondern es wird ein Zusammenspiel aller Ebenen brauchen.“

INGEBORG ZELLER
Mag.a Dr.in Ingeborg Zeller, MA, ist stellvertretende Leiterin des Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems. Sie ist wissenschaftliche Leiterin der jährlichen Sicherheitskonferenz der Universität für Weiterbildung Krems und seit Dezember 2021 Beiratsmitglied des Verbands für Sicherheitstechnik (VfS) in Hamburg.
Desinformation nimmt in der heutigen Medienlandschaft einen immer größeren Raum ein und stellt damit eine zunehmende Bedrohung für die Gesellschaft dar. Im Forschungsprojekt „DesinFact“ untersuchen Forscher_innen, wie Desinformation automatisch erkannt werden kann und welche Lösung es für verbleibende Probleme gibt.
Von Sophie Hanak
esinformation ist kein neues Phänomen – Propaganda und Fehlinformationen gab es schon immer, bis zurück zu Ramses II. Doch die Geschwindigkeit, mit der sich Falschinformationen heute über digitale Medien und soziale Netzwerke verbreiten, und die Möglichkeiten zur Täuschung durch Künstliche Intelligenz sind enorm gestiegen“, erzählt Walter Seböck, Leiter des Departments für Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung Krems. Im Rahmen des Kooperationsprojekts „DesinFact“, das gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) durchgeführt wird, widmet sich das Team der Früherkennung von Desinformationstrends. Das Projekt „DesinFact“ wird im Rahmen des Programms KIRAS durch das Bundesministerium für Finanzen gefördert bzw. finanziert und von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft abgewickelt.
Wie Desinformation entsteht
Der Forschungsschwerpunkt liegt darauf, wie sich Desinformation ausbreitet und ob und wie Künstliche Intelligenz als
Werkzeug eingesetzt werden kann und soll, um Desinformation sowie Hate Speech zu erkennen. Zu Beginn analysieren die Wissen schaftler_innen die sogenannten Desinformationsketten. „Wir untersuchen, wo sie ihren Ursprung haben, wie sie sich im Netz verbreiten und welche Merkmale auf fragwürdige Kampagnen hinweisen“, erklärt Seböck. Mithilfe von Modellierungen sollen schließlich Szenarien entwickelt werden, um Desinformation als solche zu erkennen und damit in weiterer Folge die Verbreitung eindämmen zu können – eine Aufgabe, die Künstliche Intelligenz dank ihrer Fähigkeit zur Mustererkennung besonders gut bewältigen kann.
Das Ziel ist es, ein Tool zu entwickeln, das Nutzer_innen dabei hilft, kursierende Desinformation zu erkennen bzw. besser einschätzen zu können. Hierbei wurde auch die österreichische Bevölkerung befragt, um ihre Erfahrungen zu Desinformation und Künstlicher Intelligenz zu erheben. Doch warum verbreiten sich manche Informationen rasant, während andere kaum Beachtung finden? „Zum einen, weil eine persönliche Betroffenheit besteht, zum anderen, weil manche Falsch informationen oder Lügen einfach
zu interessant sind, um sie nicht zu glauben. Oft bieten sie einfache Erklärungen für komplexe Sachverhalte“, so Seböck.
Technische, ethische und gesellschaftliche Herausforderungen
DesinFact arbeitet nicht mit öffentlich zugänglichen KI-Modellen, sondern mit eigens entwickelten Algorithmen. Hierbei legen die Forscher_innen neben den technischen Herausforderungen großen Wert auf rechtliche und ethische Leitlinien. „Die Wahrheit kann die Maschine nicht validieren – das müssen wir Menschen tun. Wahrheit ist auch immer eine Frage der Perspektive“, betont Seböck. Diese Erkenntnis prägt die ethischen Grundsätze des Projekts. „Gerade in der Technologieentwicklung sind Ethik und Rechtsstaatlichkeit für uns und unsere Partner, wie etwa Bundeskanzleramt und Bundesministerium für Landesverteidigung, unverzichtbare Grundpfeiler“, so Seböck.
Medienkompetenz als Schlüssel
Sind ältere Menschen, die ohne digitale Medien aufgewachsen sind, heute im Vorteil? Auch früher entsprach nicht alles der Wahrheit, was in der Zeitung stand – doch Fotos und Videos galten oft als glaubwürdige Belege. Heute ist es kaum noch möglich, die Echtheit von Bildern, Tönen oder Texten eindeutig zu erkennen. Diese Unsicherheit kann dazu führen, dass Kinder,
die mit digitalen Medien aufwachsen, von Anfang an lernen kritisch zu hinterfragen, ob etwas wahr oder falsch ist. Die Mehrheit der Jugendlichen konsumiert Medien heute fast ausschließlich über das Smartphone und soziale Netzwerke, während klassische Medien mit redaktioneller Kontrolle kaum noch genutzt werden. Dadurch fehlt oft die differenzierte Auseinandersetzung mit komplexen Themen. Deshalb ist es umso wichtiger, Medienkompetenz bereits in der Schule oder sogar im Kindergarten zu fördern – ein Bereich, in dem es aktuell noch Nachholbedarf gibt.
Österreich im internationalen Vergleich
I m internationalen Vergleich ist Österreich hinsichtlich der Forschung zur Eindämmung der Desinformation gut aufgestellt. Fachhochschulen, Universitäten und außeruniversitäre Forschungsin stitute arbeiten eng mit Behörden und der Wirtschaft an innovativen Projekten. Allerdings entsteht durch begrenzte Budgets ein Nachteil gegenüber Ländern, die deutlich mehr in Forschung investieren können. „Ich denke, dass Österreich und Europa angesichts der globalen Entwicklungen zunehmend auf eigenständige Systeme setzen werden. Unsere Forschungseinrichtungen und Universitäten sind hervorragend, und gerade im Bereich der Desinformation sind wir inter national gut positioniert“, ist Seböck überzeugt.

WALTER SEBÖCK
Assoz. Prof. Mag. Dr. Walter Seböck, MAS MSc ist Leiter des Departments für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems.
Projektinfo
Titel: DESINformations Früh erkennung von gefährdenden online nAChrichten Trends“ (Acronym: DesinFact)
Förderungsschiene:
Programm KIRAS
Abwicklung: FFG
Projektlaufzeit: 2024 – 2025
Mehr zum Projekt: https://projekte.ffg.at/projekt/4866636





















Die ständige Beobachtung und Analyse des Marktes durch unser Market Research Team sowie der laufende Dialog mit unseren KundInnen sind die Grundlage für die EHL Marktberichte. Unsere Marktberichte bieten einen umfassenden Einblick in die aktuelle Marktsituation im Gewerbe-, Wohn- und Investmentbereich und stellen eine solide Basis für gezielte Investitions- und Standortentscheidungen dar. Denn wir leben Know-how.




Die Digitalisierung überschwemmt uns im öffentlichen wie im privaten Bereich mit einer Flut an Informationen. Das eröffnet Chancen, aber auch Risiken. Vor allem Fragen der Sicherheit und Wahrheit müssen völlig neu betrachtet werden. Und wenn es nach der Sicherheitsforscherin Bettina Pospisil geht, mit Transparenz und möglichst viel Bürger_innenbeteiligung.
Von Ilse Königstetter

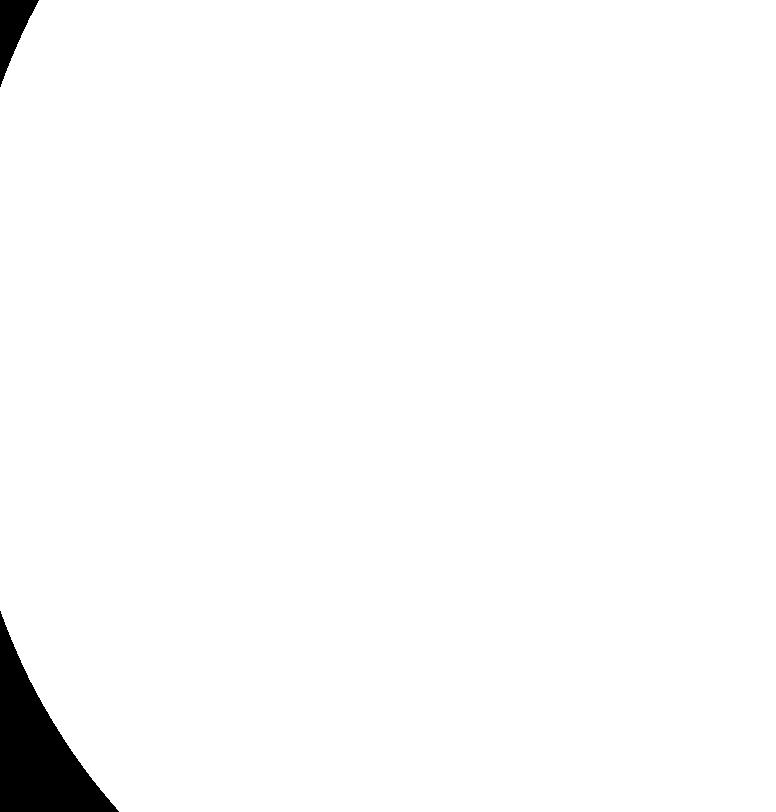
eit 2016 ist die Soziologin Bettina Pospisil als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department für Sicherheitsforschung tätig. Es widmet sich den dynamischen Entwicklungen der globalisierten Welt sowie der rasanten technologischen Transformation. Es befasst sich mit den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Strukturänderungen der Digitalisierung sowie den sich daraus ergebenden Herausforderungen im Sicherheitsbereich, wie etwa Kritische Infrastrukturen, Radikalisierung, Fakenews oder Cybercrime. Durchschnittlichen User_innen ist in aller Regel die Anzahl an immer raffinierter werdenden Cyberangriffen im öffentlichen, aber auch im privaten Sektor nicht bewusst. Von verschlüsselten Systemen durch Ransomware über Phishing-Mails, die sensible Daten abgreifen, bis hin zu Angriffen auf Kommunen und Krankenhäuser mit Millionenverlusten: Cyberkriminelle haben es häufig auf veraltete Systeme und den Menschen als Einfallstor abgesehen.
Heimautomation im Forschungsfokus
Eines der bereits abgeschlossenen Forschungsprojekte zum Thema Sicherheit, das Bettina Pospisil gemeinsam mit einem sozialwissenschaftlichen Team realisieren konnte, befasste sich mit angriffsresilienten IoT-basierten Sensoren in der Heimautomation. IoT steht für Internet of Things. „Wir wollten herausfinden, welche Heimautomationssysteme in Österreich genutzt werden und welches Potenzial für kriminelle Aktivitäten sie bereits jetzt haben“. In privaten Haushalten werden sie vor allem zur Einsparung von Energie und zur Erhöhung von Komfort und Sicherheit eingesetzt. Heimautomationssysteme können aber auch dafür benutzt werden, um die Bewohner_innen auszukundschaften und kriminelle Handlungen wie Einbrüche, Identitätsdiebstahl, Stalking oder Erpressung durchzuführen. „Als Sozialwissenschaftler_innen haben wir mit Hilfe einer repräsentativen Umfrage analysiert, wie die österreichische Bevölkerung in Bezug auf Heimautomationssysteme mit ihren Daten umgeht, welches Sicherheitsbe -
wusstsein sie an den Tag legt und welche Erfahrungen sie bereits mit Cyberkriminalität gemacht hat“, beschreibt Bettina Pospisil das Setting. Hier geeignete Schutzmaßnahmen zu entwickeln ist umso wichtiger, da die IoT-basierte Heimautomation eine der bedeutendsten (zukünftigen) Felder der Digitalisierung darstellt, die direkt die Privatsphäre vieler Menschen berührt.
Junge Citizen Scientists gegen Desinformation
Vor nicht ganz einem Jahr wurde ein Forschungsprojekt gestartet, das Bettina Pospisil besonders am Herzen liegt. „Da sich das Alltagsleben junger Erwachsener durch die ständige Konfrontation mit Medieninhalten und Informationen stark verändert hat, müssen sie selbst ein Stück weit zu Forscher_innen werden, um (Des-) Informationen kritisch zu analysieren“, ist die Soziologin überzeugt. Deshalb zielt das Projekt „Junge Citizen Scientists gegen Desinformation" darauf ab, das Thema Desinformation aus der Perspektive dieser jungen Erwachsenen zu erforschen, indem sie durch einen Citizen Science-Ansatz in das Forschungsprojekt eingebunden werden. „Der Schwerpunkt des Projekts liegt nicht unmittelbar auf dem Wahrheitsgehalt der vermittelten Inhalte, sondern auf den Bewältigungsstrategien und den Prozessen der Bewertung von (Des)-Informationen“, erklärt Bettina Pospisil. Um dieses Ziel in die Praxis umzusetzen, arbeiten die Universität für Weiterbildung Krems und die FH St. Pölten mit Citizen Scientists aus drei Klassen von höheren Schulen in Tulln, St. Pölten und Krems zusammen. Die Citizen Scientists sind eingeladen, das Phänomen „Desinformation" aus ihrer Sicht zu definieren und den Forschungsschwerpunkt darauf abzustimmen. Darüber hinaus werden sie Daten über (Des-) Informationen, die für sie in ihrem Alltag relevant sind, sammeln und auswerten. Alle erhobenen Daten werden gemeinsam mit den Citizen Scientists im Unterricht diskutiert, analysiert und interpretiert. Schließlich will das Forschungsprojekt ein auf diesen gemeinsam erarbeiteten Einblicken basierendes Konzept für eine zukünftige Infrastruktur beisteuern. Diese

soll Desinformation entgegenwirken. Ziel ist, die Bedürfnisse und Wünsche junger Erwachsener widerzuspiegeln.
Neben ihrer umfangreichen Forschungstätigkeit arbeitet Bettina Pospisil parallel an ihrer Dissertation. Diese befasst sich mit Sprachassistenzsystemen und damit, wie diese Art von Technologien unsere alltäglichen Wahrnehmungen und Handlungen in Bezug auf Beziehungen, Zeit und Werte beeinflussen. Immer wieder neue Forschungsfragen zu stellen, innovative Methoden auszuprobieren und dadurch Zusammenhänge zu verstehen, ist ihre erklärte Leidenschaft. Dass ihr an ihrem Department breiter Raum für ihre vielfältigen Forschungsinteressen zur Verfügung steht, weiß die Wissenschaftlerin besonders zu schätzen.
Medien- und Alltagssoziologie Ursprünglich war es ihr Plan, nach der Matura an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Tulln umgehend ins Berufsleben einzusteigen. Als dann an der Schule die Vielfalt an Studienrichtun-
gen vorgestellt wurde, entdeckte Bettina Pospisil ihr Interesse für die Soziologie. „Daran hat mich besonders gereizt, dass sich diese Wissenschaft mit den komplexen Strukturen der Gesellschaft beschäftigt, die vom großen Ganzen ausgehen“, erinnert sie sich an die Initialzündung für den Entschluss zum Studium. Dass dabei theoretische Annahmen auch mit vielen verschiedenen empirischen Methoden überprüft, bestätigt oder ergänzt werden können, kam ihrer Neugier auf innovative Sichtweisen ebenfalls sehr entgegen. Im Zuge ihrer Bachelorarbeit am Institut für Soziologie an der Universität Wien befasste sie sich vorrangig mit dem Themenbereich Mediensoziologie mit Schwerpunkt soziale Medien. Bettina Pospisil: „Während meines Masterstudiums habe ich mich ebenfalls in Richtung Medien konzentriert, mich intensiv mit Methoden auseinandergesetzt und auch sehr für Alltagssoziologie interessiert“. 2017 erwarb sie ihren Master of Arts mit einer Arbeit im Bereich Visuelle Soziologie. Parallel zu ihrem Studium sammelte Bettina Pospisil auch jede Menge berufliche Erfahrungen.
Bettina Pospisil, BA, MA studierte Soziologie an der Universität Wien. Von 2011 bis 2014 arbeitete sie parallel zum Studium als Journalistin und war danach als wissenschaftliche Projektmitarbeiterin im CERT Komm/KIRAS Projekt an der Universität für Weiterbildung Krems tätig, 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und bis 2016 als Research Assistant an der Wirtschaftsuniversität Wien. Bis heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität für Weiterbildung Krems. Aktuell arbeitet sie an ihrer Dissertation.
Sein gesamtes bisheriges Berufsleben widmete Alumnus
Dieter Rothbacher dem Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren – beim österreichischen Bundesheer, in zahlreichen internationalen Organisationen und im eigenen Unternehmen.
Von Ilse Königstetter
ls Dieter Rothbacher mit 18 Jahren zum allgemeinen Wehrdienst beim Österreichischen Bundesheer einrückte, war noch nicht vorauszusehen, dass das der Ausgangspunkt für eine militärische Karriere sein würde. Die Bildungsmöglichkeiten, die ihm die Militärakademie eröffnete, betrachtete er als durchaus attraktiv, umso mehr, als sie ihm nach vielfältigen Kursen und Ausbildungen auch Chancen zu internationalen Einsätzen, etwa über die Vereinten Nationen (UN) bot. „Ich beschloss, das Einjährig-Freiwilligenjahr zu absolvieren und dann Berufsoffizier zu werden“. 1993 absolvierte er einen Auslandseinsatz als Mitglied der Chemical Destruction Group der UNSCOM (United Nations Special Commission) im Irak. Diese Gruppe setzte sich über einen Zeitraum von über zwei Jahren aus mehr als 100 Personen aus 25 Ländern zusammen. Deren Aufgabe bestand darin, die Iraker bei der Zerstörung ihrer chemischen Waffen zu unterstützen und zu beaufsichtigen. „Nicht allzu viele ABC-Abwehrspezialisten (Anm: Abwehr atomarer, chemischer und biologischer Kampfmittel) bekommen die Gelegenheit, so intensiv und praxisnah in diesem Feld zu arbeiten“, so Rothbacher, der weiß, dass er sich glücklich schätzen kann, diese Erfahrung gemacht zu haben. „Das be -
einflusste meine weitere Arbeit im Bereich der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen (WMD) entscheidend und prägte meinen Lebensweg maßgeblich mit“. Vergleichbare Einsätze folgten im Rahmen seiner Tätigkeiten bei der Organisation für das Verbot chemischen Waffen (OPCW) und umfassten beispielsweise die Überprüfung von deklarierten chemischen Kampfstoffen in diversen Ländern sowie die Überwachung ihrer Zerstörung. „Diese Einsätze waren allerdings kürzer und weniger intensiv als die Arbeit im Irak“, erinnert sich der ehemalige Berufsoffizier.
Ein internationaler Werdegang
Inzwischen blickt Dieter Rothbacher auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich von CBRN, also chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren sowie WMD zurück. Er reüssierte in internationalen Organisationen in verschiedenen Funktionen, etwa als Leiter von Inspektionsteams und Trainingsverantwortlicher des Inspektorats der OPCW in Den Haag, als Teamleiter eines multidisziplinären Inspektionsteams bei den UN in New York (Einsatzort Irak), als Präsident des internationalen CBRNE (wobei das E für „explosives“ steht, Anm.) Institutes Belgien oder als Projektverantwortlicher für Massenvernichtungswaffen beim Österreichischen
Bundesheer, um nur einige zu nennen. 2009 entschloss sich Rothbacher, seine umfangreiche internationale zivile Expertise in Sicherheitsfragen in ein eigenes Unternehmen einzubringen und gründete die CBRN Protection GmbH.
Auf der akademischen „Schulbank“
Sich kontinuierlich für Innovationen zu interessieren und in verschiedensten Bereichen auf dem Laufenden zu bleiben, war für Rothbacher schon immer eine Selbstverständlichkeit. „Im Zuge meiner Unternehmensgründung habe ich dann nach einem vertiefenden Studium gesucht“, berichtet Rothbacher. An der Universität für Weiterbildung Krems, bereits damals Vorreiterin für diese Themen, wurde er mit dem Studienlehrgang Sicherheitsmanagement fündig. „Ausschlaggebend war für mich die Möglichkeit, das Studium berufsbegleitend absolvieren zu können und zu lernen, wie man sich einem Forschungsthema formaltechnisch annähern kann“, erinnert er sich an die Gründe für seine Entscheidung. Eine Wahl, die er nicht bereut: „Die gesamte Infrastruktur im Studienlehrgang erlebte ich positiv und den Unterricht sehr praxisorientiert.“ Da Rothbacher zu diesem Zeitpunkt selbst schon über ein großes Fachwissen verfügte, konnte er sich auch thematisch einbringen. Sein Studium schloss er 2012 mit einer aufwändigen Masterthese zum Thema „Verhinderung und Detektion von CBRN Anschlägen auf Öffentliche Verkehrsmittel“ als Bester seines Lehrgangs ab.
Immer wieder neu durchstarten
Seine internationalen Tätigkeiten und der stetige Aufbau seines Unternehmens hinderten Rothbacher nicht an weiteren umfangreichen Bildungsmaßnahmen. Er spricht nicht nur vier Sprachen, sondern setzte seinem Studium in Krems noch drei weitere nach. So erwarb er einen MSc in Business Development an der School of Management, Teil der Corvinus University Budapest, einen MSc an der University Tor Vergata Rom und 2023 einen PhD in CBRNE/ Industrial Engineering, ebenfalls an der University Tor Vergata Rome. Darüber hin-

aus ist er Mitglied des Directive Boards der „CBRN Masterstudien“ an der Universität Tor Vergata/Rom und hält dort auch Vorlesungen. Überhaupt zählen Schulungen und Trainings in Sachen Sicherheit zu seinen Leidenschaften. Seine umfassenden Erfahrungen im Bereich CBRN (inter alia Training, Testen, Research, CBRN Business Development and Consulting) bringt er jetzt in sein Unternehmen ein. „Mein Arbeitsumfeld macht mir noch immer viel Spaß, weil es abwechslungsreich ist und man ständig etwas Neues lernt“, sagt Rothbacher. Vom österreichischen Bundesheer hat er sich (im Rang eines Oberstleutnants) 2023 aus dem Aktivstand verabschiedet, um sich ausschließlich auf die eigene Firma zu konzentrieren. Und da sind ja auch noch seine Frau, eine gebürtige Italienerin und erfolgreiche Dolmetscherin sowie sein neunjähriger Sohn, die derzeit in Rom leben und im Augenblick ein Pendlerleben erforderlich machen. „Früher habe ich bis zu neun Monate pro Jahr im Ausland verbracht“, erzählt der Vielbeschäftigte, „aktuell versuche ich, das auf ein bis zwei Wochen im Monat zu beschränken“. Für die Familie möchte er sich jetzt einfach mehr Zeit nehmen.
Dr. Dieter Rothbacher, MMMSc ist CEO und Eigentümer der CBRN Protection GmbH. Mehr als 25 Jahre war er CBRN Verteidigungsoffizier beim Österreichischen Bundesheer, leitete ein Inspektionsteam bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und war UN WMD Experte im Irak. An der Universität für Weiterbildung Krems absolvierte er das Studium „MSc in Safety and Security Management 2012“ sowie drei weitere Studien in Budapest und Rom.
Auszeichnung
Im Rahmen seiner kürzlich abgeschlossenen Dissertation im PhD-Programm Regenerative Medizin der Universität für Weiterbildung Krems entwickelte Kenneth Chen ein Verfahren, das mithilfe künstlicher Intelligenz automatisiert Beinachsen-Abweichungen auf konventionellen Knie-Röntgenbildern erkennt. Jetzt wurde dieses innovative Projekt aufgrund seiner hohen Umsetzbarkeit im klinischen Praxisalltag mit dem tecnet accent Innovation Award ausgezeichnet. Der Preis, der herausragende Projekte mit hohem wirtschaftlichem Umsetzungspotenzial junger Forschender würdigt, wurde in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 24. April 2025 in St. Pölten überreicht.

Neue Dauerausstellung

Mit der neuen Dauerausstellung „Geschichte der Tabakfabrik Stein – zwischen Wohlfahrt und Widerstand“ wirft die Universität für Weiterbildung Krems einen vielschichtigen Blick auf ein zentrales Kapitel regionaler Industrie-, Sozial- und Frauengeschichte. Im Fokus stehen die Arbeitsbedingungen der sogenannten „Tschickweiber“, die Entwicklung der Austria Tabakregie zum Wohlfahrtsbetrieb sowie der mutige Widerstand von Arbeiter_innen während des Nationalsozialismus. Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie eng Arbeit, gesellschaftlicher Wandel und politisches Engagement miteinander verbunden waren.

V.l.n.r.: Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh, Leiter Universitätsambulanz, Peter McDonald, ÖGK-Obmann, Prim. Dr. Karlheinz Christian Korbel, Ärztlicher Direktor Landesklinikum Mauer, Ulrike KönigsbergerLudwig, Staatssekretärin für Gesundheit, Mag. Barbara Haid, MSc, Präsidentin ÖBVP
Die Universität für Weiterbildung Krems eröffnete am 8. Mai 2025 offiziell ihre neue Universitätsambulanz für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das Pilotprojekt wurde im September 2024 gestartet und ist am Campus der Universität angesiedelt. Die Ambulanz bietet Menschen mit fachärztlicher Überweisung die Möglichkeit, kassenfinanzierte Gruppenpsychotherapie in Anspruch zu nehmen. Finanziert wird das Projekt von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB). Ziel ist es, angesichts der steigenden Zahl psychischer Erkrankungen und des gleichzeitigen Mangels an psychosozialen Versorgungsstrukturen ein nachhaltiges und effektives Modell der Psychotherapie anzubieten.
David-Sackett-Preis 2025

Das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (EbMNetzwerk) hat den renommierten DavidSackett-Preis 2025 an Barbara Nußbaumer-Streit und die Cochrane Rapid Reviews Methods Group verliehen. Die internationale Arbeitsgruppe, der auch Gerald Gartlehner, Ursula Griebler, Lisa Affengruber, Irma Klerings und Sandra Hummel angehören, erhiehlt den Preis für ihre herausragenden Beiträge zur Weiterentwicklung von Rapid Reviews.

Mit einem Beitrag von 2,8 Prozent zum BIP und 117.000 Arbeitsplätzen weist Österreich eine starke Musikbranche auf. Doch Digitalisierung und KI stellen gerade diesen Kreativsektor vor große Herausforderungen. Mit welchen Modellen der Transformationsprozess gelingen kann und welche Innovationen den Wirtschaftsmotor Musik am Laufen halten, diskutierten bei der Blue Hour am 27. Mai im Haus der Musik Wien die Präsidentin des Österreichischen Musikrats, Eva-Maria Bauer, MA, auch tätig an der Universität für Weiterbildung Krems, Daniel Viertbauer, Mitbegründer von Label 4, der Musikproduzent Thomas Foster, sowie Dr. Michael Paul, CVA, MRICS, Geschäftsführer von paul und collegen consulting.
Insights
Rund 57 Millionen Menschen leben derzeit mit Demenz, Tendenz stark steigend. Studien belegen, dass bis zu 40 Prozent der Demenzerkrankungen durch gesunde Lebensgewohnheiten verhindert werden könnten. Bewegung, Ernährung, geistige Stimulation sowie die Kontrolle wichtiger medizinischer Parameter wie Blutdruck, Diabetes und Übergewicht wirken vorbeugend, so Dr. Stefanie Auer, Universitätsprofessorin für Demenzforschung der Universität Krems bei einer Alumni-Club-Veranstaltung am 10. April.
Vertrauen als Währung der Zukunft. Menschen, Wirtschaft und Institutionen.
In unsicheren Zeiten rückt Vertrauen ins Zentrum – sei es in Unternehmen oder in uns selbst. Doch was ist Vertrauen, wie entsteht es, wann geht es verloren – und lässt es sich wieder aufbauen? Und welche Rolle spielt dabei Verantwortung?
17. Oktober 2025, Universität für Weiterbildung Krems
Krems an der Donau glattundverkehrt.at
Bem-vindo, benvinguts, bienvenido, bun venit croeso, fáilte, hos¸ geldin, khosh amadid, minukui peai, mis´to avila˘n, tere tulemast, üdvözlöm, välkomna, welcome!

Die 29. Festival-Auflage bringt spannende Musikideen aus allen Erdteilen nach Krems und in die Wachau. 2025 feiert es die Vielfalt der Sprachen: in 17 Konzerten mit Musik aus 18 Ländern und vier Kontinenten

Landesgalerie Niederösterreich
24.05.2025–15.02.2026
Flower Power
Eine Kulturgeschichte der Pflanzen lgnoe.at
Bis 01.03.2026
Christa Hauer
Künstlerin. Galeristin. Aktivistin lgnoe.at

Festspielhaus St. Pölten
11.09.2025, 19 Uhr Domplatz Open-Air
Domplatz St. Pölten feststpielhaus.at
Tonkünstler & Friends: Im Feuerstrom der Reben 5/8erl in Ehr'n/ Kaiser Musikanten/ Katharina Straßer

11.09.2025,
Klezmer Trio
ft. Simon Reithofer
Haus der Regionen volkskulturnoe.at
Festivalatmosphäre – Glatt und Verkehrt
Grafenegg Festival 14.08.–05.09.2025
European Youth Orchestra
grafenegg.com/de/ konzertreihen/festival

Archiv der Zeitgenossen
September 2025
Das Land liest
Neue Publikationen zu Alfred Komarek und Bruno Weinhals sowie das Projekt „NÖ Kulturpreisträger:innen vor/nach 1945“ werden im Rahmen von „Das Land liest“ vorgestellt.
Kino im Kesselhaus
03.– 20.07.2025
Sommer.Kino
Open Air kinoimkesselhaus.at
Conference
The Information Technology in Disaster Risk Reduction Conference, ITDRR for short, is being held for the 10th time this year. The international scientific conference takes an interdisciplinary approach to issues relating to IT-supported disaster risk reduction. In 2024, the annual conference took place at the University for Continuing Education Krems. October 14-16, 2025, Kyoto https://itdrr.org/conference/itdrr2025/
Die aktuelle Risikostudie der NC State University und Protiviti zeigt zentrale Geschäftsrisiken für das Jahr 2025 auf. Mehr als 1.200 weltweit befragte Führungskräfte stufen Cyberattacken, Unsicherheiten rund um die Regulierung von KI, geopolitische Spannungen und den zunehmenden Fachkräftemangel als besonders kritisch ein. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung einer vorausschauenden Risikokultur, resilienter Geschäftsmodelle und einer stärkeren regulatorischen Anpassungsfähigkeit. https://erm.ncsu.edu
Das Spannungsfeld zwischen persönlicher Freiheit und öffentlicher Sicherheit steht im Mittelpunkt der 23. Sicherheitskonferenz Krems. Veranstaltet wird diese vom Department für Sicherheitsforschung der Universität für Weiterbildung Krems in Kooperation mit dem Innenministerium. Arnold Kammel, Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, und Prof. Peter Filzmaier, Universität Krems, halten die Keynotes. Mittwoch, 22. Oktober 2025, 10:00 Uhr www.donau-uni.ac.at/sicherheitskonferenz
Europe's leading trade fair for IT security, it-sa Expo&Congress, will once again bring together trends and innovations from the IT security industry in 2025. Important topics at the trade fair include cloud and mobile security, data and network security and securing critical infrastructures and Industry 4.0. it-sa is one of the most important dialog platforms for IT security solutions. October 7-9, 2025, Nuremberg https://www.itsa365.de
The OECD report “Megatrends and the Future of Social Prote c tion” analyzes far-reaching changes in the area of social protection. The world of work is undergoing rapid change due to digital ization, demographic shifts and climate change. The report makes it clear that traditional social security systems are often no longer sufficient. New struc tures are needed that respond flexibly to precarious employment, the need for care and income risks, while at the same time ensuring social participation and equal opportunities. OECD (2024), Megatrends and the Future of Social Protection, OECD Publishing, Paris doi.org/10.1787/6c9202e8-en



Sichere Unternehmen
Mit diesem Handbuch lassen sich Risiken identifizieren, wegweisendes effizienzförderndes Handlungswissen aufbauen und Unternehmen sowie seine Prozesse, Ressourcen und die Organisation absichern. Die dreidimensionale Sicherheitsmanagementpyramide sowie die innovative und integrative RiSiKo-Management-Pyramide liefern ein durchgängiges, praxisorientiertes und systematisches Vorgehensmodell für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Sicherheits-, Kontinuitätsund Risikomanagements. Beispiele und Checklisten unterstützen dabei.
Klaus-Rainer Müller Handbuch Unternehmenssicherheit Springer Verlag, 2022
Sicherheit fühlen
Was ist eigentlich Sicherheit? Ab wann fühlt sich ein Mensch sicher und warum? Schritt für Schritt erklärt der Autor in zwei Bänden, dass Sicherheit nicht einfach ein Gegenpol zu Risiko oder Gefahr ist, auch nicht das Ausbleiben von Bedrohungen, sondern vielmehr ein lebendiges und wandelbares Konstrukt aus der Perzeption der Umwelt und ihrer Bewertung im Hinblick auf die eigene Handlungsfähigkeit. Zwei Bände erörtern, wie ein Gefühl von Sicherheit entsteht und wie sie konstruiert ist.
Roman Auriga Sicherheiten – Risiken –Wahrscheinlichkeiten
Bd. 1: Vom Entstehen eines Sicherheitsgefühls
Bd. 2: Konstrukte der Sicherheit wvb Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2014
Vertrauen und Misstrauen
Das Verhältnis von Sicherheit und Vertrauen ist strukturell ambivalent: Einerseits sollen Sicherheitspraktiken Vertrauen ermöglichen – andererseits können sie es auch in Frage stellen. Benjamin Rampp untersucht diese Wechselbeziehung aus Perspektive der Gouvernementalitätstheorie. Das Beispiel Terrorismusbekämpfung zeigt, wie Sicherheitspraktiken u.a. zu einer Kultur des Verdachts führen können. Mit dem Phänomen des Vertrauens, das auf diese Weise potentiell untergraben wird, gerät zudem ein zentraler Aspekt von Subjektivierungs- und Vergesellschaftungsprozessen in den Blick.
Benjamin Rampp
Die Sicherheit der Gesellschaft transcript Verlag, 2026
EXZELLENTE ABSCHLUSSARBEITEN
Wie die optimale Checkliste zur Vermeidung von Planungsfehlern bei der Planung elektronischer Sicherheitstechnik im Eigenheim aussieht, erarbeitet diese Masterthese unter Einbezug von Normen, technischen Aspekten und der Fehlerquelle Mensch.
Paul Weissensteiner, MSC Sicheres Eigenheim –Elektronische Sicherheitstechnik richtig geplant Universität für Weiterbildung Krems, 2025
Drohnen sind ein Schlüsselelement im Bereich des Perimeterschutzes, also der Schnittstelle zwischen internen und externen IT-Netzen. Die Arbeit analysiert präzise Vor- und Nachteile der Fluggeräte für den BASK-Werksschutz. Die Arbeit erhielt den Cerberus-Award von Siemens.
Andrea Reinmuth Chancen und Risiken des Drohneneinsatzes im Perimeterschutz am Beispiel der BASF SE Ludwigshafen Universität für Weiterbildung Krems, 2021
upgrade: Das Magazin für Wissen und Weiterbildung der Universität für Weiterbildung Krems (ISSN 1862-4154)
Herausgeber:
Rektorat der Universität für Weiterbildung Krems
Medieninhaber:
Universität für Weiterbildung Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems
Chefredakteur: Mag. Stefan Sagl
Universität für Weiterbildung Krems
E-Mail: upgrade@donau-uni.ac.at
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Roman Tronner
E-Mail: upgrade@donau-uni.ac.at
Autor_innen & Mitarbeiter_innen:
Benjamin Brandtner, Sophie Hanak, Sabine Herlitschka, Ilse Königstetter, Robert Prazak, Georg Renner, David Rennert, Miguel de la Riva, Wolfgang Rössler, Jochen Stadler, Martin
Stepanek, Eva-Maria Stöckler, Roman Tronner, Mario Wasserfaller
Layoutkonzept: ki 36, Sabine Krohberger
Grafik: buero8, Thomas Kussin
Schlusslektorat: Barbara Ottawa
Fotostrecke: Idee und Konzept –DLE Kommunikation und Wissenschaftsredaktion
Telefon: +43 (0)2732 893-2246
E-Mail: upgrade@donau-uni.ac.at
Herstellung: sandlerprint&more – SANDLER Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., A-3671 Marbach
Auflage: 17.500
Erscheinungsweise: vierteljährlich Ausgabe 3_4.25 erscheint im Herbst 2025
Disclaimer: Für die Richtigkeit der wiedergegebenen Inhalte und Standpunkte wird keine Gewähr übernommen.
Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, SANDLER Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. UW-Nr. 750
Rückblick und Ausblick
Rund 33.000 Menschen haben in den vergangenen drei Jahrzehnten ein Studium an der Universität für Weiterbildung Krems abgeschlossen. Die Idee von Weiterbildung auf fundierter wissenschaftlicher Grundlage ist fester Bestandteil im Bildungs- und Innovationsystem geworden. Und sie gewinnt an Tragweite, denn immer bedeutender werden Wissen und Innovation für die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Am Übergang zum vierten Jahrzehnt der Universität für Weiterbildung Krems nimmt auch ein neues Rektorat seine Arbeit auf. Wie es die Universität in die Zukunft führen möchte und welche Akzente für die Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung zu erwarten sind, wird die kommende Ausgabe von upgrade thematisieren, ebenso wie die vielen Facetten der lebensbegleitenden Weiterbildung in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft und die Meilensteine der Universität auf ihrem nun 30-jährigen Weg.
ANZEIGE

Weltweite Kompetenz in Sachen Sicherheit. Mit dem richtigen Einsatz von Personal, Know-How und Technik schaffen wir für Sie eine optimale und individuelle Sicherheitslösung. 365 Tage im Jahr – 24 Stunden am Tag
Funny Birds – Das Gelbe vom Ei / Some Like it Hot / Der Spitzname / Konklave / One to One: John & Yoko / Bridget Jones – Verrückt nach ihm / Altweibersommer / Dirty Dancing / Like a Complete Unknown / Wunderschöner / Vom ewechn Lem – Molden Resetarits Soyka Wirth / Adieu Chérie / Thelma & Louise / Der phönizische Meisterstreich / Feste & Freunde –Ein Hoch auf uns! / Monsieur Blake zu Diensten Alle weiteren Infos auf: kinoimkesselhaus.at


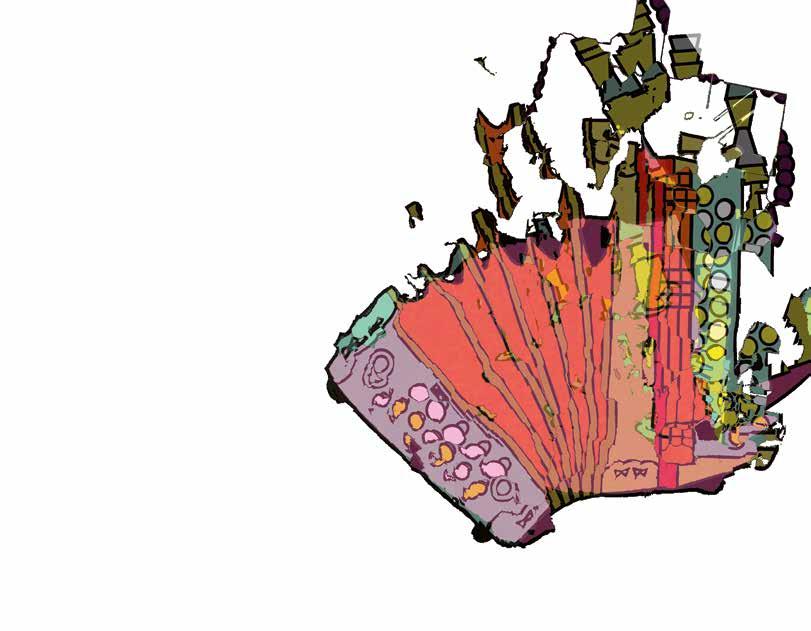
Laura Itandehui | Puuluup | Christian Muthspiel & ORJAZZTRA VIENNA | Fatima Szalay | Sélène Saint-Aimé | Cerys Hafana & Katharina Baschinger | Anna Mabo & Clemens Sainitzer | Black Lives | Kefaya & Elaha Soroor u. v. a.