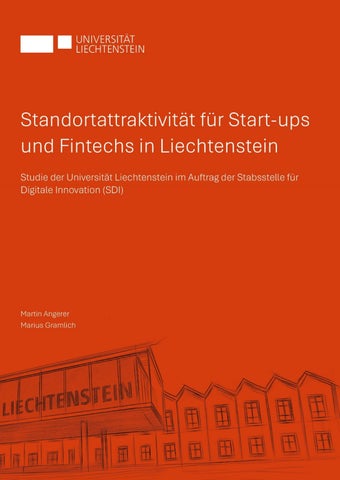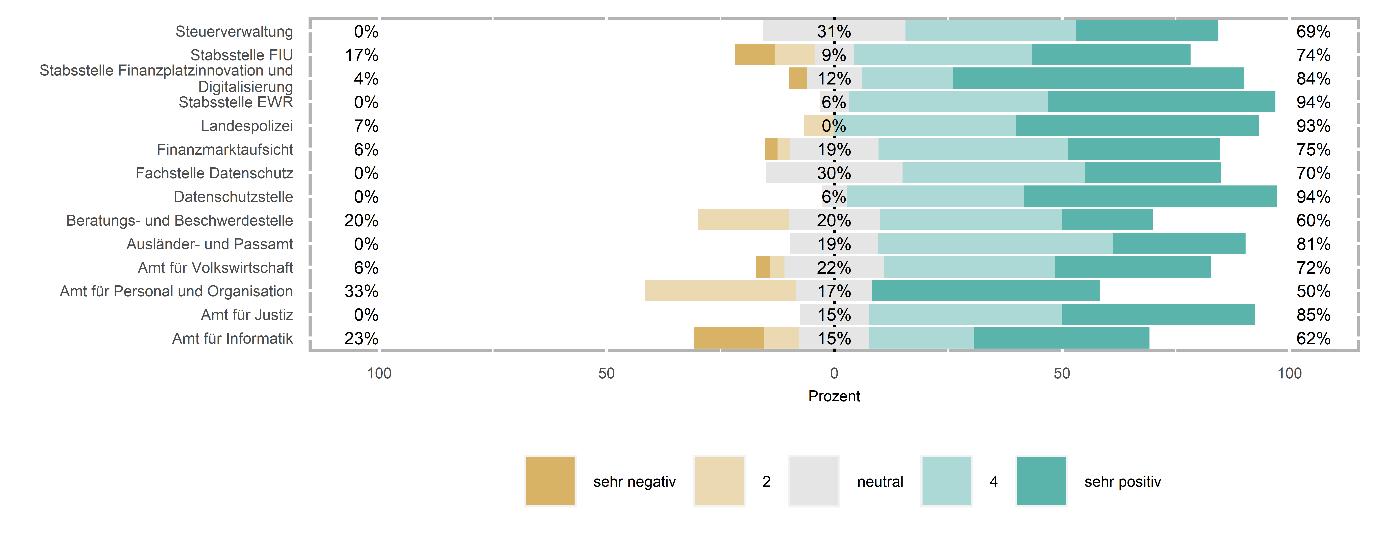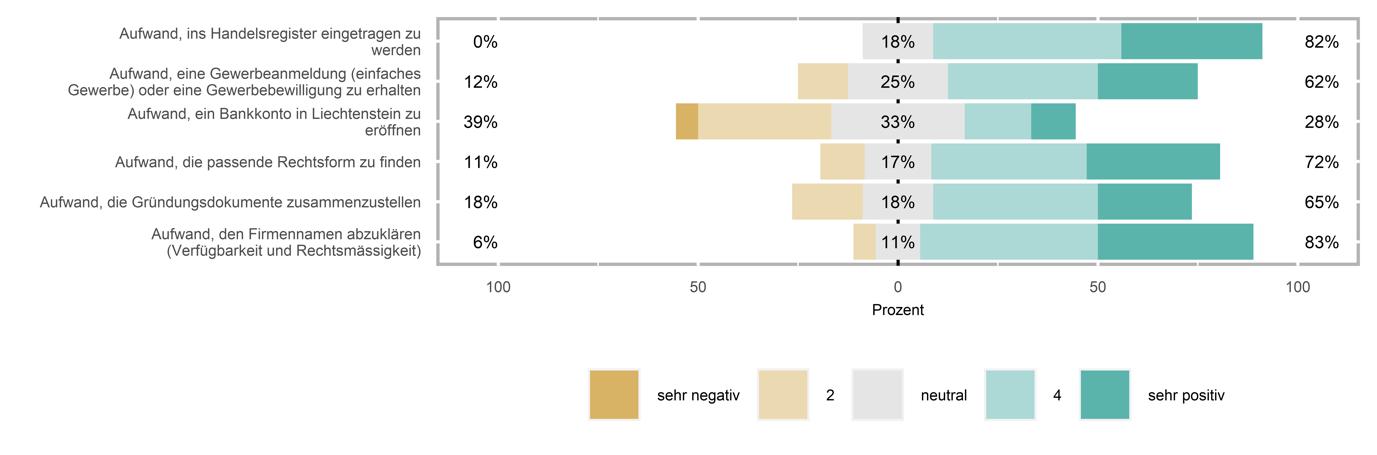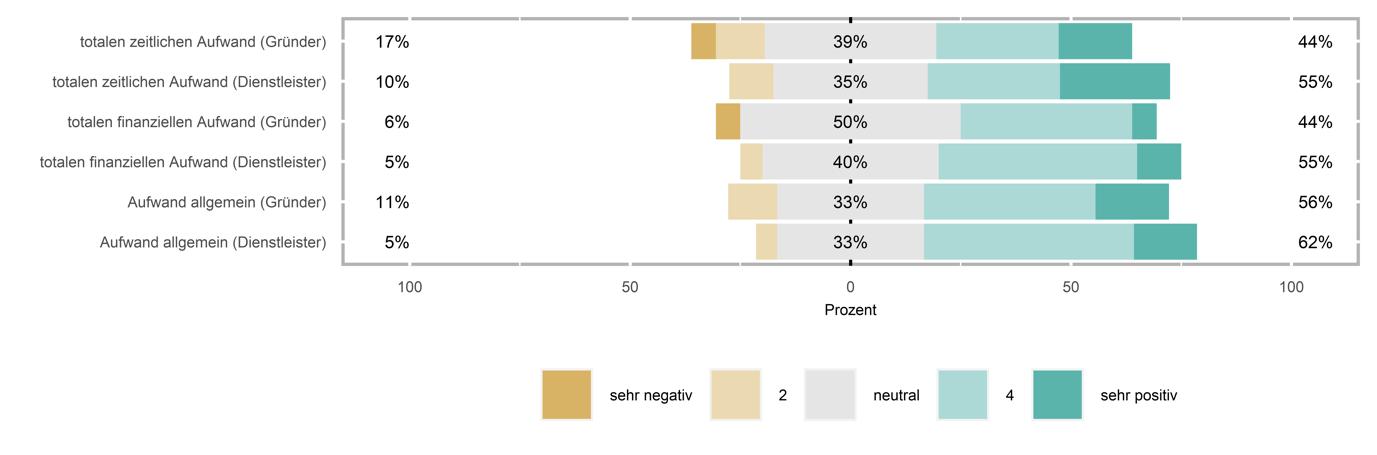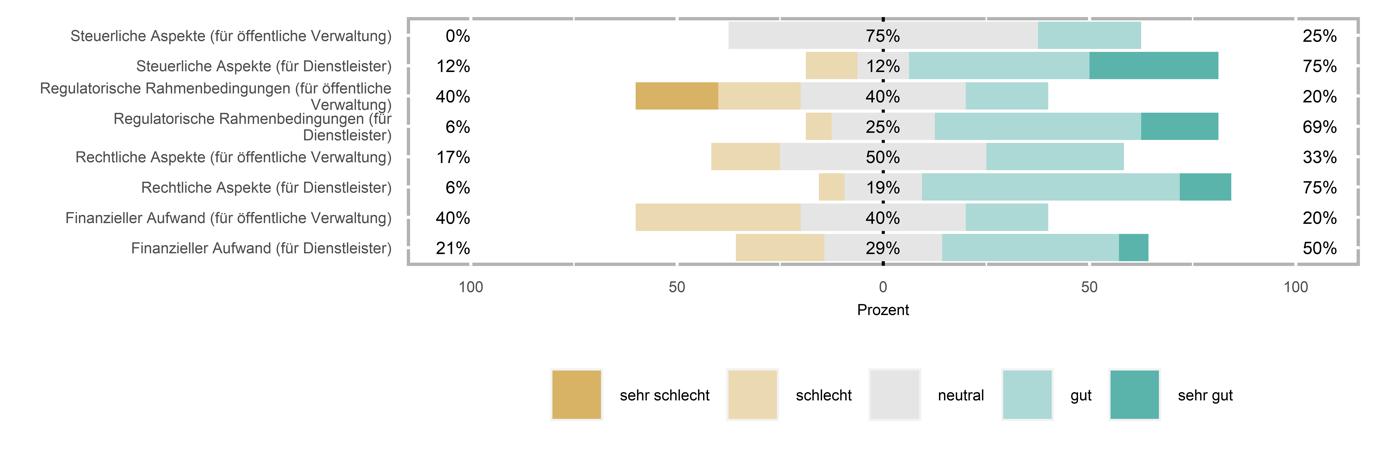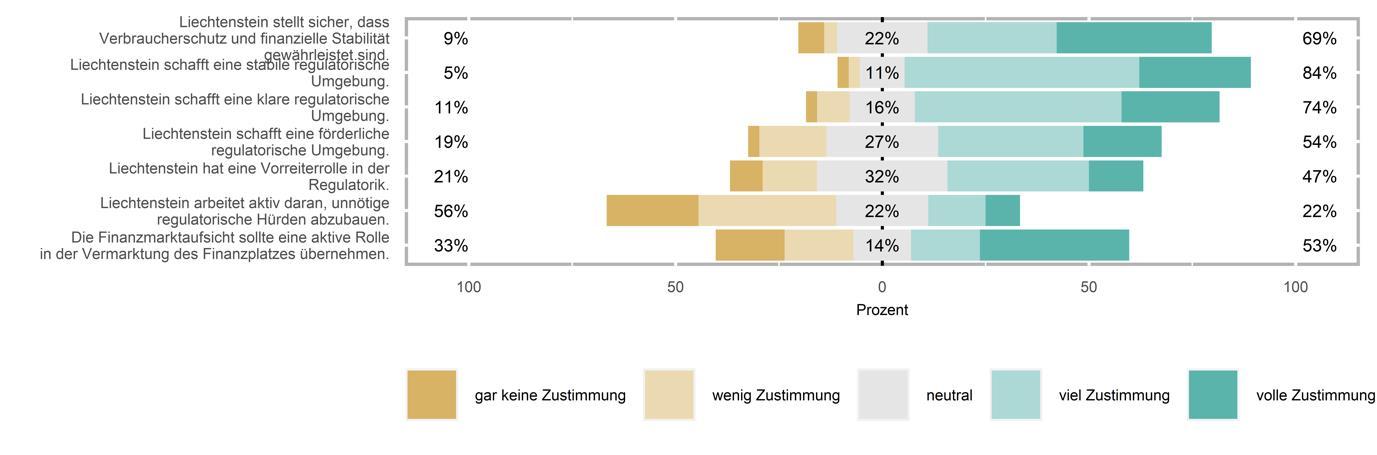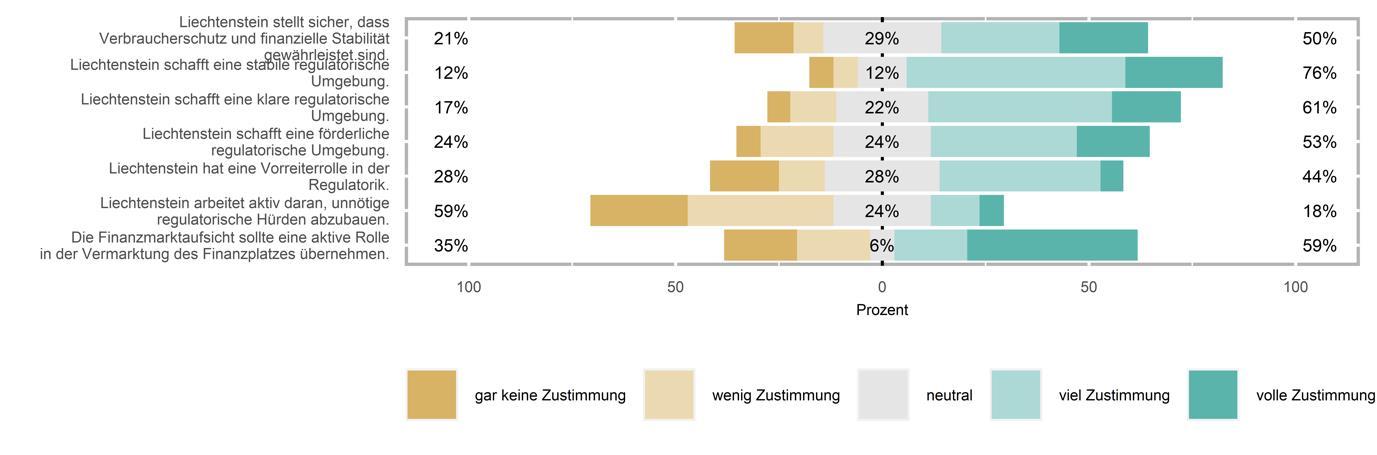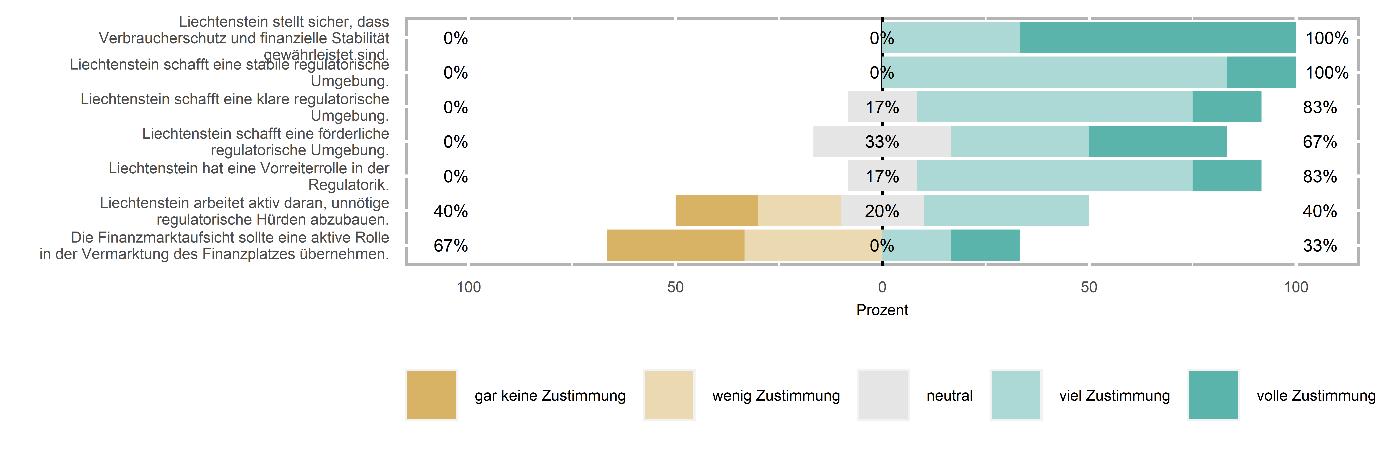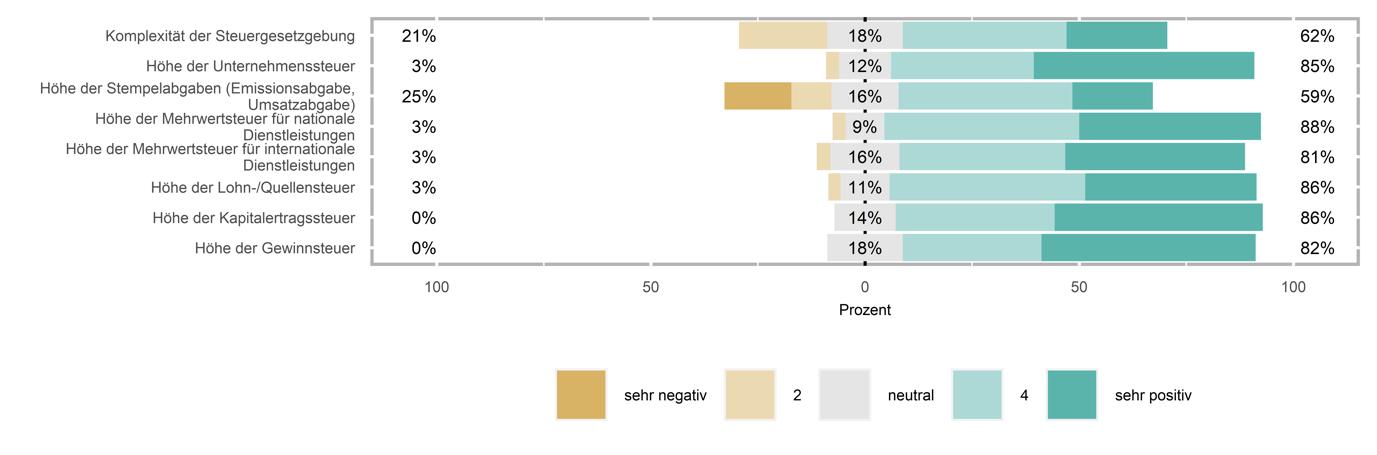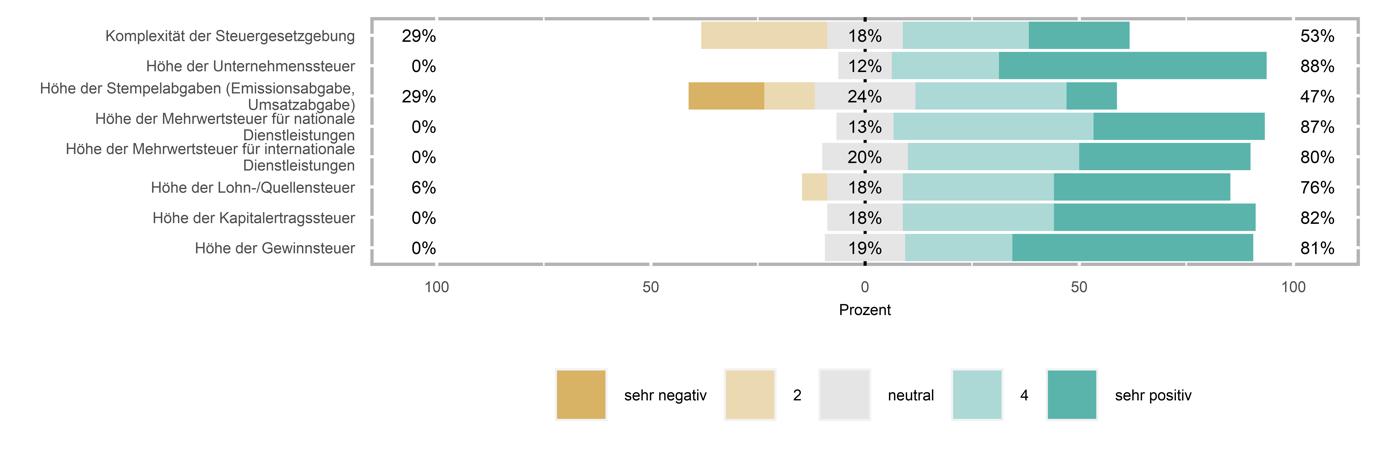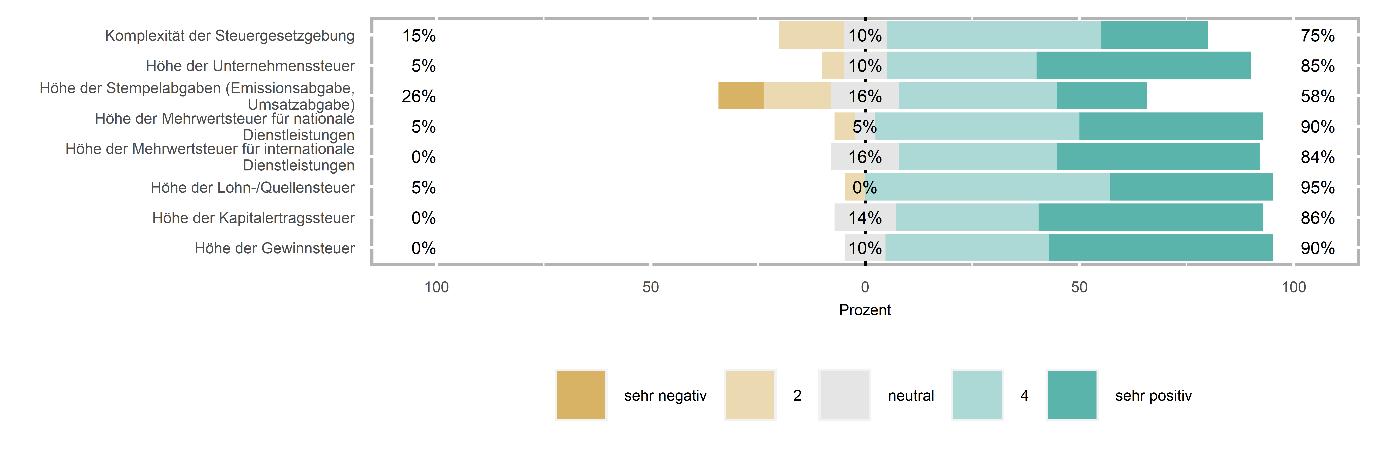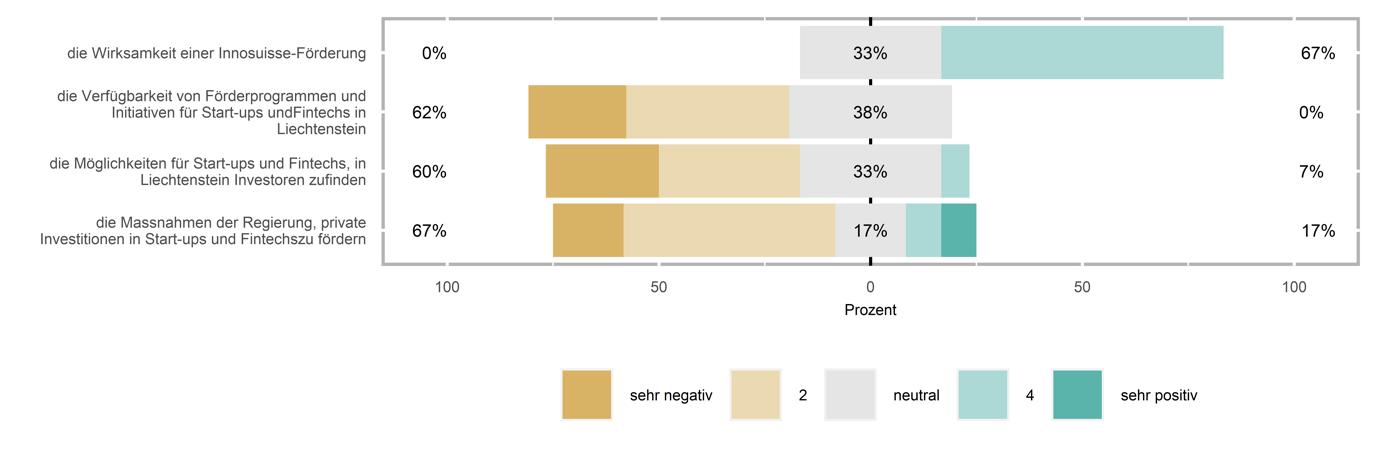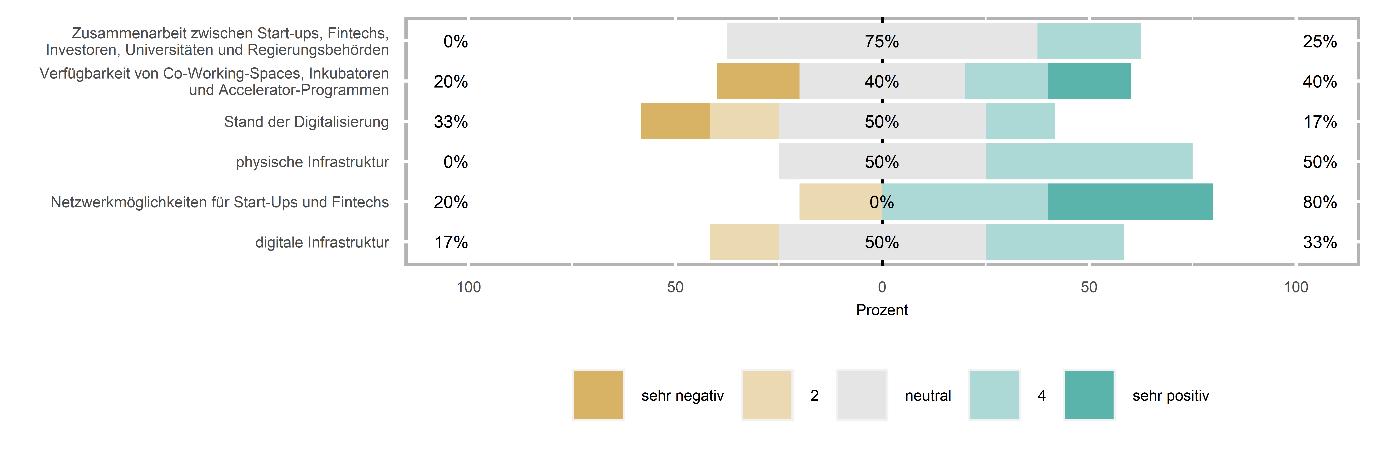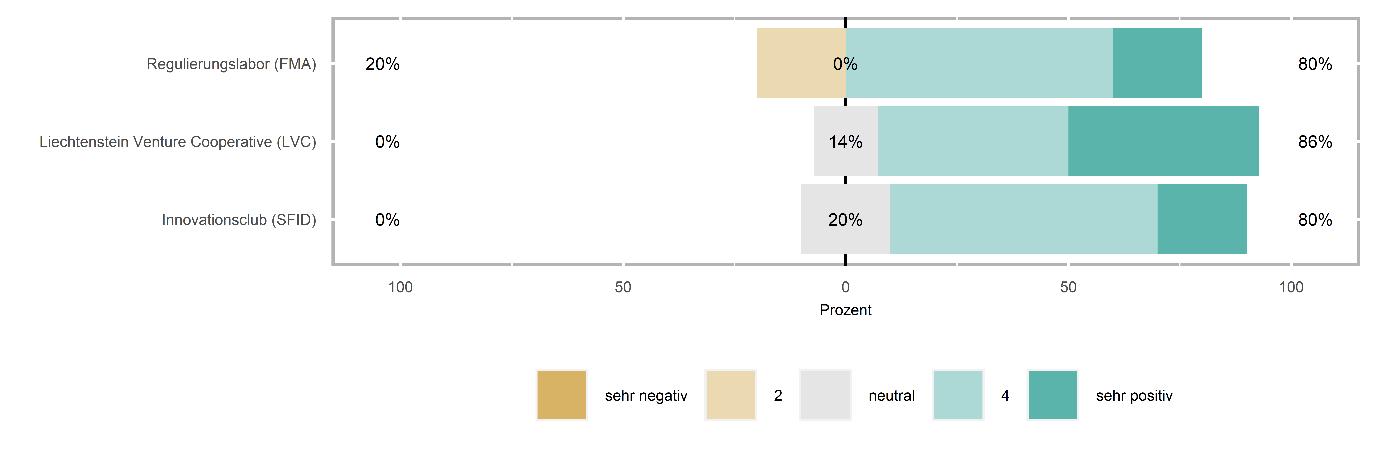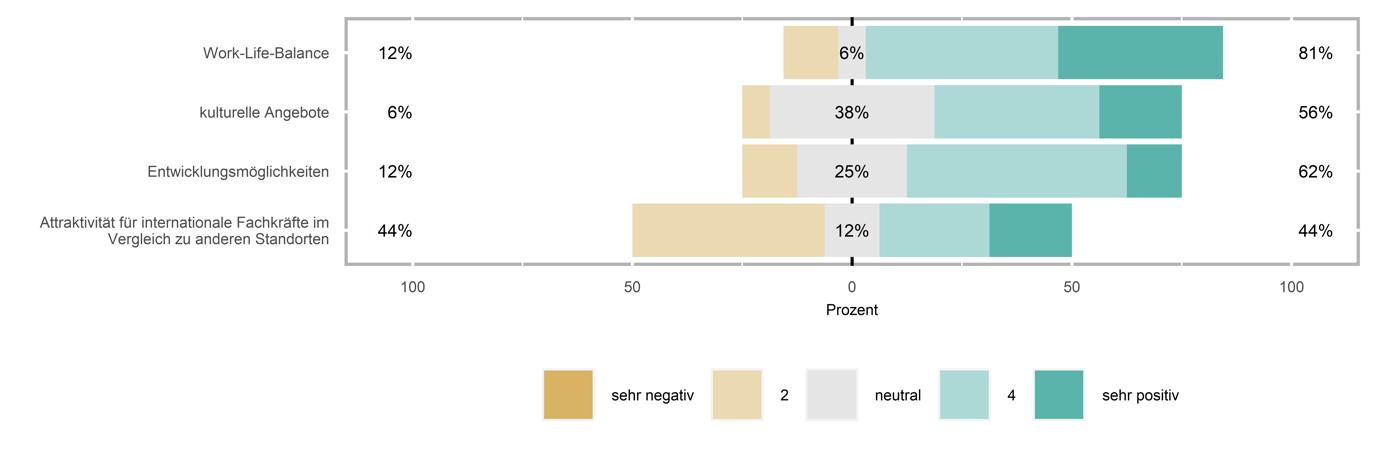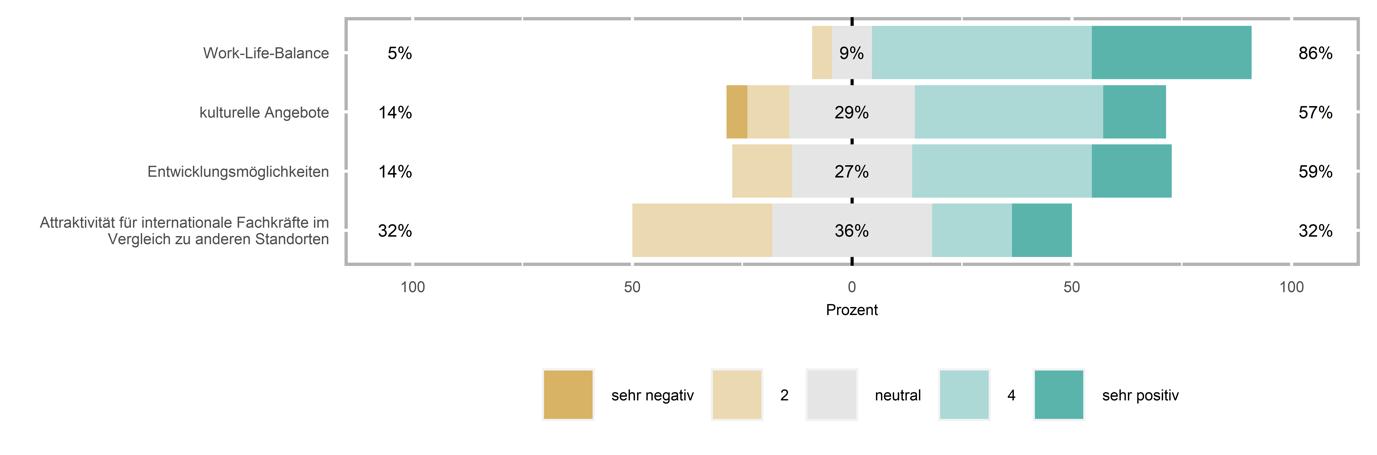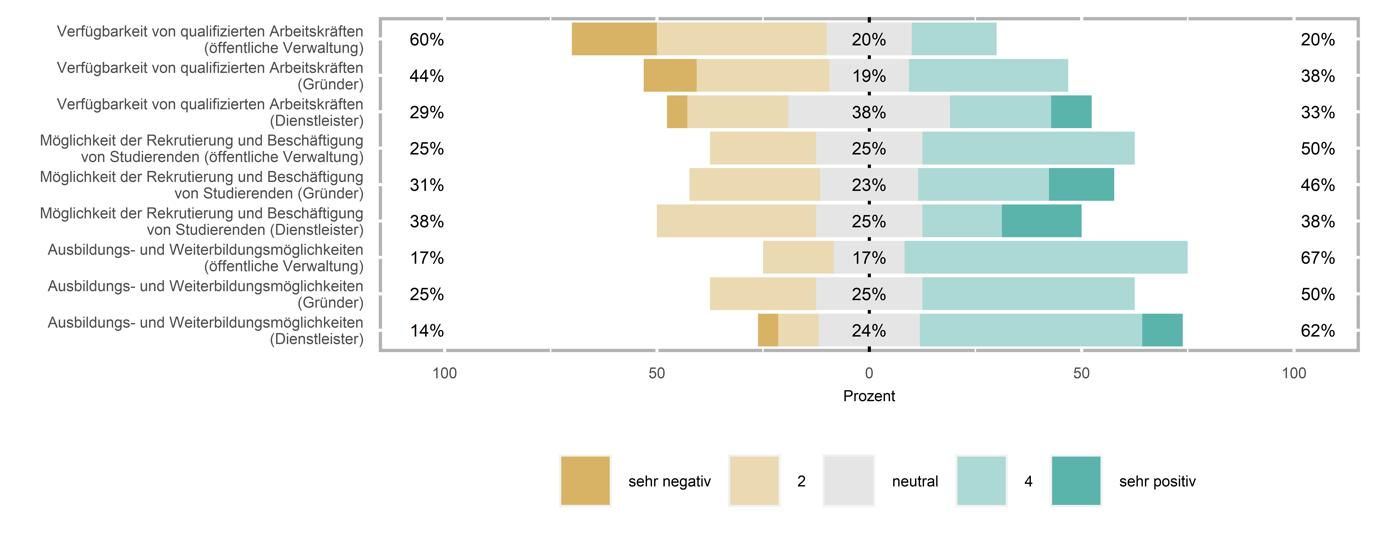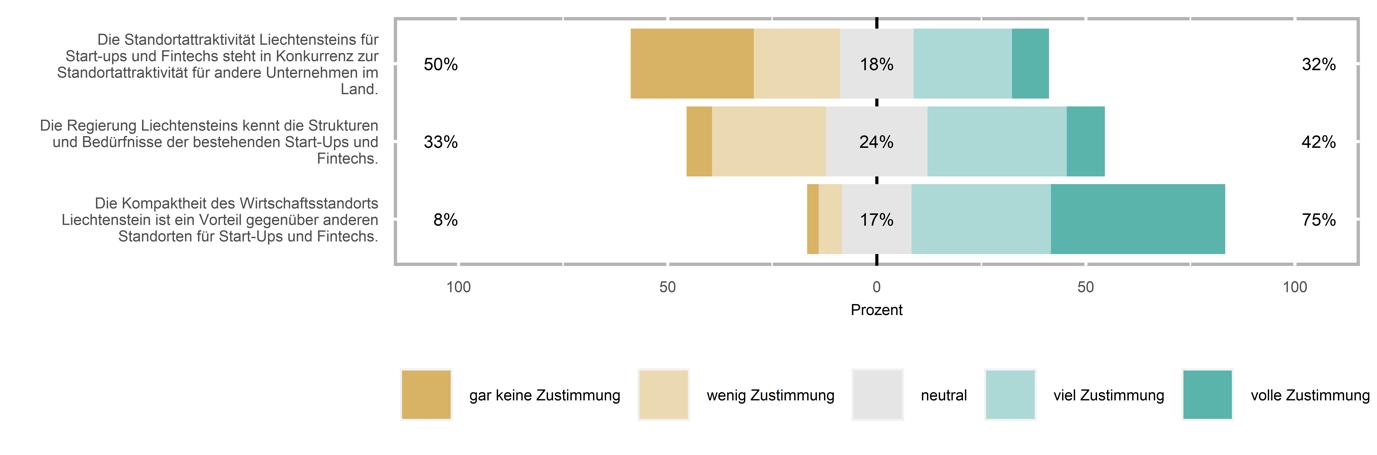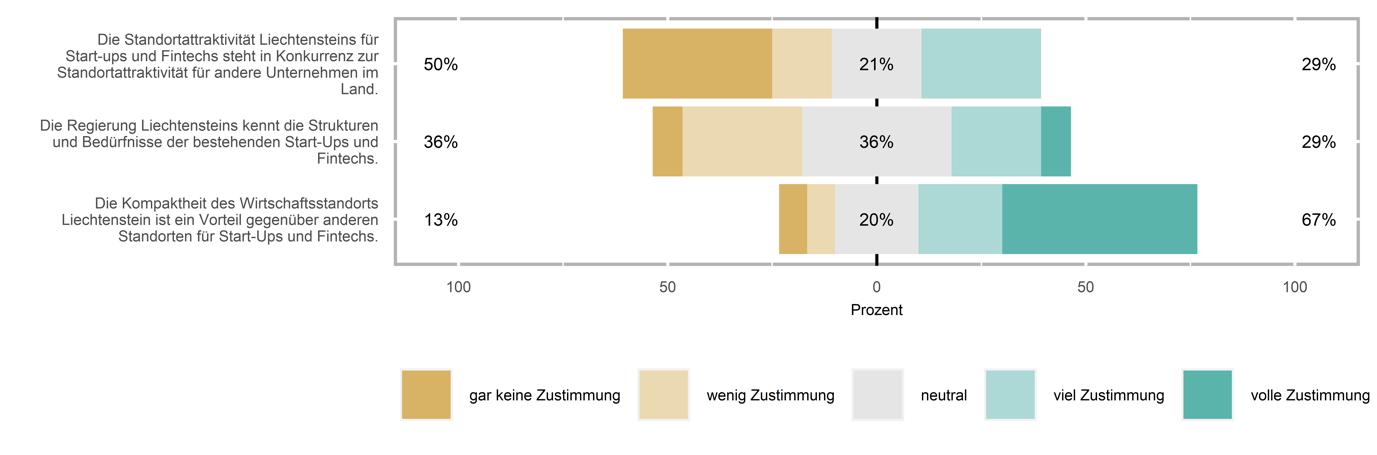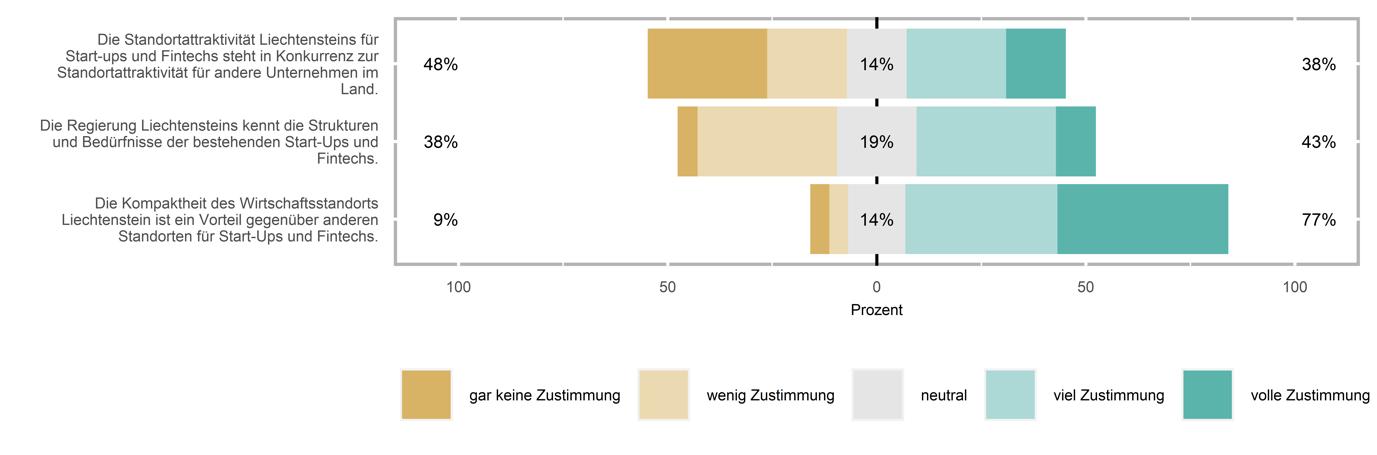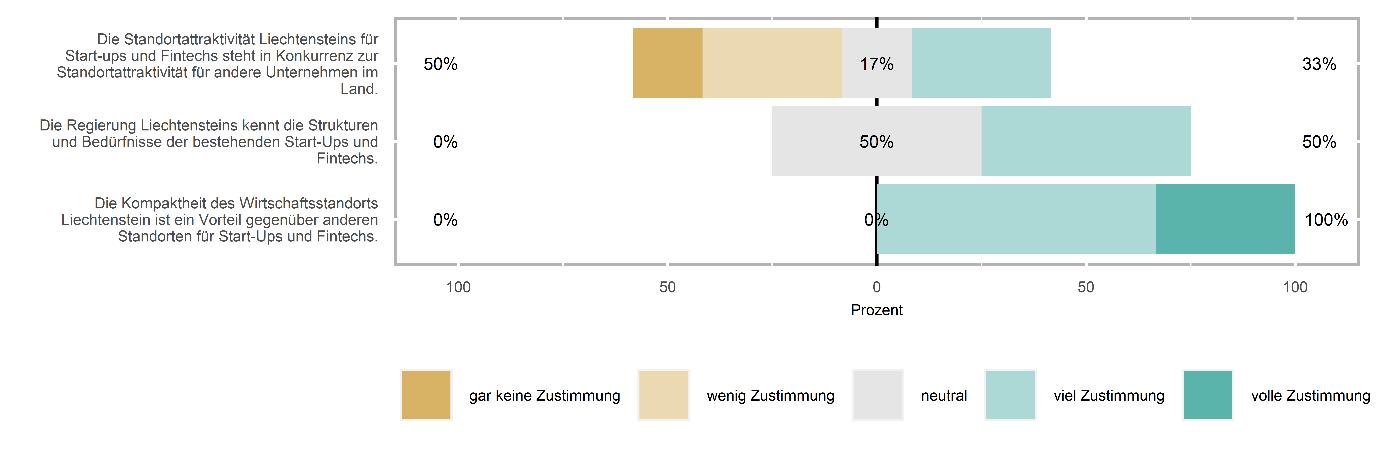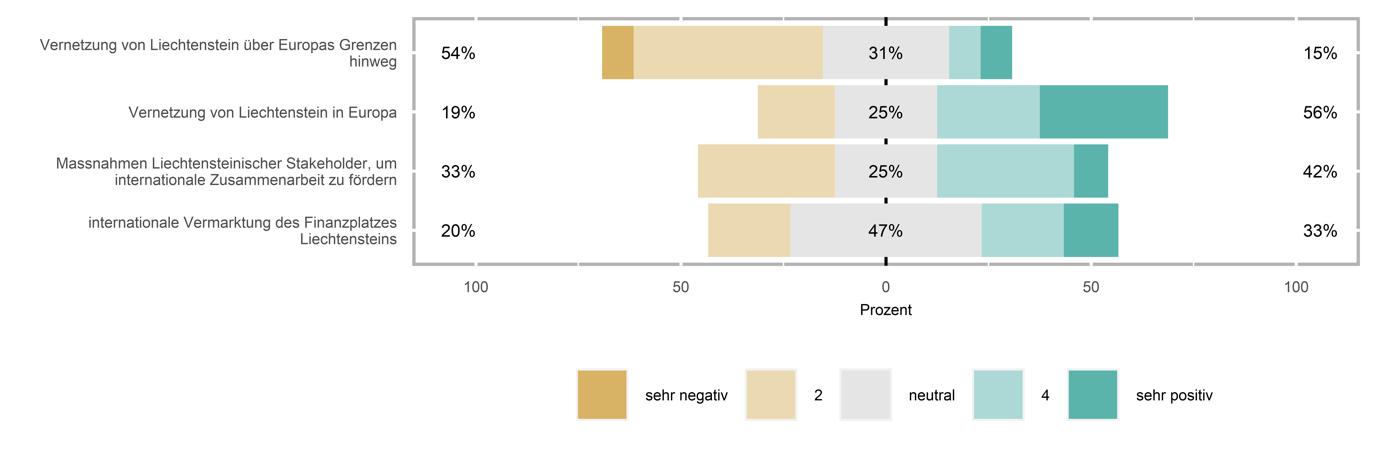Vaduz, Juli 2025
Angerer M., Gramlich M. (2025). Standortattraktivität für Start-ups und Fintechs in Liechtenstein, Universität Liechtenstein
Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Es ist mir eine grosse Freude, Ihnen diese umfassende Studie über das Start-up-Ökosystem in Liechtenstein vorzustellen. Diese Publikation ist das Ergebnis eingehender Untersuchungen und Analysen, die das Ziel hatten, die vielschichtigen Aspekte und die Dynamik des Start-upUmfelds in diesem einzigartigen Land zu beleuchten.
Liechtenstein mag durch seine geografische und wirtschaftliche Grösse klein erscheinen, doch sein Einfluss und seine Innovationskraft im Bereich der Start-ups und der FinTech-Industrie sind bemerkenswert. Diese Studie zielt darauf ab, ein detailliertes Bild von den vielfältigen Faktoren zu zeichnen, die das Start-up-Ökosystem in Liechtenstein prägen. Von der rechtlichen Rahmengebung über die wirtschaftlichen Herausforderungen bis hin zu den spezifischen Unterstützungsstrukturen für Unternehmungen in den Sektoren Technologie und Finanzen deckt diese Analyse alle relevanten Bereiche ab.
In den verschiedenen Kapiteln dieser Studie werden die einzigartigen Vorteile, die das Land bietet, ebenso behandelt wie die Herausforderungen, mit denen sich Unternehmer und Investoren konfrontiert sehen. Durch Interviews mit Schlüsselpersonen im Ökosystem, einer Fragebogenstudie und die Integration aktueller Forschungsergebnisse bietet dieser Bericht einen tiefen Einblick in die operative und strategische Realität von Start-ups in Liechtenstein. Diese Publikation wäre ohne die Mitwirkung vieler Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nicht möglich gewesen. Ihr wertvolles Wissen und ihre Perspektiven haben es ermöglicht, dass diese Studie nicht nur ein Spiegel der aktuellen Lage ist, sondern auch als Wegweiser für zukünftige Entwicklungen dienen kann. Ich möchte allen beteiligten Forschenden, Akademikerinnen und Akademikern sowie Praktikerinnen und Praktikern meinen tiefsten Dank aussprechen, deren unermüdliche Arbeit und Engagement die Grundlage für die Erstellung dieses wichtigen Dokuments bildeten. Insbesondere auch vielen Dank an Ertugrul Saygin für seine wertvolle Unterstützung bei der Durchführung der Interviews. Mein Dank gilt auch den politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie den Wirtschaftsführenden in Liechtenstein, deren Unterstützung und Einblicke unerlässlich waren.
Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass diese Studie wertvolle Erkenntnisse liefert und als Inspirationsquelle dient, um die Entwicklung eines noch dynamischeren und erfolgreicheren Start-up-Ökosystems in Liechtenstein zu fördern.
Mit besten Grüssen
Assoc. Prof. Dr. Martin Angerer
Professor für Finance
Schwerpunkt Innovative and Digital Finance
Liechtenstein Business School
Telefon +423 265 11 57 martin.angerer@uni.li
Executive Summary
Die vorliegende umfassende Studie zur Standortattraktivität für Start-ups und FinTechUnternehmen in Liechtenstein bietet durch eine Vielzahl an methodischen Ansätzen wie quantitative Umfragen, qualitative Experteninterviews und eine SWOT-Analyse eine fundierte Bestandsaufnahme der wahrgenommenen Attraktivität Liechtensteins sowie die Grundlage für strategische Handlungsempfehlungen zur weiteren Attraktivierung Ziel ist also eine tiefgehende Analyse des aktuellen Standes sowie ein Blick in die Potenziale und auch Gefahren der Zukunft. Im Folgenden werden die zentralen Punkte in aller Kürze dargestellt.
Bekannte Erfolgsfaktoren
Die Studie identifiziert und beschreibt zunächst bekannte kritische Erfolgsfaktoren, die essenziell für die Stärkung der Finanzplatzattraktivität sind:
Technologische Innovation und Infrastruktur: Der Zugang zu fortschrittlicher Technologie und einer robusten Infrastruktur ist entscheidend, insbesondere für technologieorientierte Startups und FinTech-Unternehmen.
Regulatorische Unterstützung und politische Stabilität: Ein transparentes und innovationsfreundliches regulatorisches Umfeld ist grundlegend, um ein sicheres und förderliches Geschäftsklima zu schaffen.
Zugang zu Finanzierungen und Kapitalmärkten: Vielfältige Finanzierungsoptionen und ein dynamisches Venture-Capital-Ökosystem sind entscheidend für das Wachstum junger Unternehmen.
Qualifizierte Arbeitskräfte und Humankapital: Ein talentierter Arbeitspool und enge Verbindungen zu Bildungseinrichtungen sind zentral für den Unternehmenserfolg.
Marktbedingungen und Kundenzugang: Günstige Marktbedingungen und direkter Zugang zu Kunden fördern das Wachstum und die Marktdurchdringung.
Vernetzung und Ökosystem: Ein starkes Netzwerk aus Unterstützungsstrukturen, Mentoren und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und Behörden stärkt das Innovationspotenzial und fördert die Entwicklung des Ökosystems.
Verwendete Forschungsmethoden
Experteninterviews: Durch Gespräche mit Branchenexperten wurden qualitativ hochwertige Einblicke in die spezifischen Herausforderungen und Vorteile des Standorts gewonnen. Diese Informationen sind besonders wertvoll, um die regional spezifischen Gegebenheiten zu verstehen.
Quantitative Umfragen: Eine breit angelegte Befragung von Unternehmen, Dienstleister und der Verwaltung ermöglichte es, ein quantitatives Verständnis über die allgemeine Zufriedenheit und die spezifischen Bedürfnisse von Start-ups und FinTechs in Liechtenstein zu entwickeln.
SWOT-Analyse: Die Identifikation von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken bietet eine strukturierte Übersicht über interne und externe Faktoren, die die Attraktivität Liechtensteins beeinflussen.
SWOT-Analyse
Die SWOT-Analyse bietet eine umfassende Übersicht über die internen und externen Einflussfaktoren, die das Start-up- und FinTech-Ökosystem in Liechtenstein prägen, und unterstreicht die Notwendigkeit einer proaktiven und anpassungsfähigen strategischen Planung, um sowohl Chancen zu nutzen als auch Risiken effektiv zu begegnen. Hier ist eine zusammenfassende Darstellung der Kernergebnisse der SWOT-Analyse des Start-up- und FinTech-Ökosystems in Liechtenstein.
Stärken
Regulatorische Exzellenz: Liechtenstein bietet fortschrittliche regulatorische Rahmenbedingungen, die besonders förderlich für Blockchain und andere FinTechInnovationen sind.
Effizienz und kurze Wege: Die kleine Grösse des Landes ermöglicht schnelle Entscheidungsfindung und effiziente Verwaltungsprozesse.
Starke Wirtschaftsstrukturen: Der gut entwickelte Banken- und Dienstleistungssektor sowie Bildungseinrichtungen bieten essenzielle Unterstützung für Start-ups.
Internationale Vernetzung: Die geografische Lage und die Mitgliedschaft im EWR bieten strategische Vorteile für internationale Geschäfte.
Schwächen
Limitierter Binnenmarkt: Die kleine Grösse des Landes beschränkt den Inlandsmarkt und zwingt Unternehmen, von Anfang an international zu agieren.
Konservativer Finanzsektor: Traditionelle Banken sind oft zurückhaltend bei neuen Finanztechnologien, was den Zugang zu Finanzdienstleistungen erschwert.
Fachkräftemangel: Trotz der Nähe zu Bildungszentren ist der lokale Talentpool begrenzt, insbesondere in spezialisierten Technologiebranchen
Grosse Abhängigkeiten vom Ausland: Durch die starke Einbindung in den europäischen Markt bestehen hohe externe Abhängigkeiten.
Chancen
Technologische Führungsrolle: Liechtenstein hat die Möglichkeit, in den schnell wachsenden Bereichen wie Digital Banking und Blockchain eine führende Rolle einzunehmen.
Bildungs- und Forschungskooperationen: Partnerschaften mit Hochschulen können Innovation fördern und zur Talententwicklung beitragen.
Nachhaltige Finanzierung: Liechtenstein könnte eine Vorreiterrolle im Bereich ethischer und nachhaltiger Finanzierung übernehmen.
Infrastrukturelle Investitionen: Weiterentwicklung der Infrastruktur kann die Attraktivität als Standort für Technologieunternehmen erhöhen.
Bedrohungen
Technologische Disruptionen: Schnelle technologische Veränderungen könnten bestehende Geschäftsmodelle herausfordern und rasche Anpassungen erfordern.
Stark wachsende Regulierungsanforderungen: Die Anforderungen an die Einhaltung internationaler Vorschriften könnten insbesondere für kleine Start-ups eine Herausforderung darstellen.
Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung: Probleme, junge Talente der Generationen Y und Z zu gewinnen, insbesondere aufgrund restriktiver Wohn- und Arbeitsbedingungen.
Handlungsempfehlungen
Die vorliegenden Handlungsempfehlungen zielen isoliert darauf ab, den Start-up- und FinTechSektor in Liechtenstein zu stärken. Sie wurden unabhängig von ihren potenziellen Auswirkungen auf andere politische, wirtschaftliche und soziale Bereiche in Liechtenstein erstellt und ohne eine Bewertung ihrer Umsetzbarkeit oder der daraus resultierenden Konsequenzen vorzunehmen.
Erhöhung der Attraktivität des Arbeitsplatzes:
• Liberalisierung des Aufenthaltsrechts für internationale Arbeitskräfte
• Lockerung der Homeoffice-Regelungen zur Erhöhung der Arbeitsflexibilität
• Verstärkung von Bildungsinitiativen durch spezialisierte Studiengänge und Weiterbildungsprogramme
Innovative Regulierung:
• Optimierung administrativer Prozesse, um schnelle Entscheidungswege besser zu nutzen
• Verschiebung des regulatorischen Fokus von Risikoaversion zu mehr Innovationsfreudigkeit
• Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen an neue Technologien
Bessere Vorbereitung der Gründer:
• Einrichtung einer zentralen Informationsplattform für alle relevanten Gründungsunterlagen
• Ausbau des Angebots an spezialisierten Unterstützungsdiensten
• Implementierung eines Mentorenprogramms
Stärkere finanzielle Unterstützung der Gründer:
• Einrichtung eines öffentlichen Fonds für Direktinvestitionen in Start-ups
• Ausweitung und Verbesserung von Förderprogrammen wie Innosuisse
• Reduzierung oder Erlass von Gebühren für junge Start-ups
Netzwerke:
• Gründung eines unabhängigen zentralen Hubs zur Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit im Ökosystem
• Stärkung des Finanzsektors zur Verbesserung des Zugangs zu Kapital
• Unterstützung internationaler Expansion durch politische und wirtschaftliche Initiativen
Ausbau der Infrastruktur für Start-ups:
• Investitionen in spezialisierte Infrastrukturen wie technologische Parks oder Inkubatoren
• Modernisierung des Finanzsektors zur Anpassung an die Bedürfnisse moderner Startups und zur Integration fortschrittlicher Finanztechnologien
1
Ausgangslage und Ziele der Studie
Liechtenstein hat in den vergangenen Jahren verstärkt versucht, sich als attraktiver Standort für Neugründungen und FinTechs zu positionieren. Stärkster Impulsgeber war dabei wohl die Einführung des Token- und VT-Dienstleister-Gesetzes (TVTG), welches Liechtenstein zeitweise in eine globale Vorreiterrolle in der Regulierung des Krypto- und FinTech-Sektors gebracht hat. Nach anfänglich starker Nachfrage wächst der Sektor aber nun nur noch langsam. So stieg die Anzahl der Unternehmen, die nach dem TVTG registrierte Dienstleister sind, von 10 im Jahr 2020 auf nur 28 im Jahr 2023. Einige Unternehmen haben den Markt auch wieder verlassen. Als weiterer Indikator kann gesehen werden, dass die Anfragen an das Regulierungslabor der FMA von 255 im Jahr 2018 auf 124 im Jahr 2021 und 101 im Jahr 2023 zurückgegangen sind.
Der Sektor wächst also langsamer als erwartet, und auch zukünftig gesteigertes Interesse ist aktuell nicht zu erkennen. Die Umsetzung der MiCAR-Verordnung über Märkte für Kryptowerte der Europäischen Union (die am 29. Juni 2023 in Kraft getreten ist) birgt einerseits einen Vorteil für den Sektor aufgrund zusätzlicher Harmonisierung, andererseits verdrängt sie auch einen Grossteil des Wettbewerbsvorteils, der durch das TVTG für einige Jahre geschaffen wurde.
Liechtenstein konkurriert somit wieder stärker mit vielen anderen globalen Standorten und muss sicherstellen, dass eine hohe Standortattraktivität gewährleistet ist.
Die vorliegende Studie wurde mit dem Ziel initiiert, ein umfassendes Verständnis für die Standortattraktivität Liechtensteins für Start-ups und FinTechs zu entwickeln. Sie soll nicht nur die aktuellen Gegebenheiten und Strukturen beleuchten, sondern auch potenzielle Wachstumsmöglichkeiten und Herausforderungen identifizieren, die für bestehende und zukünftige Unternehmer, Investoren sowie politische Entscheidungsträger von Bedeutung sind. Im Detail verfolgt diese Studie folgende spezifische Ziele:
1. Analyse der strukturellen Komponenten: Erfassung und Bewertung der Schlüsselkomponenten des liechtensteinischen Start-up-Ökosystems, einschliesslich der rechtlichen Rahmenbedingungen, finanziellen Ressourcen, technologischen Infrastrukturen und der verfügbaren Unterstützungsnetzwerke.
2. Identifikation von Vorteilen und Herausforderungen: Untersuchung der einzigartigen Vorteile, die Liechtenstein Start-ups bietet, und der spezifischen Herausforderungen, denen sich diese Unternehmen gegenübersehen, insbesondere im Hinblick auf Marktzugänge, regulatorische Bedingungen und internationale Expansion.
3. Förderung von Innovation und technologischem Fortschritt: Bewertung der Rolle von Innovationen im FinTech- und Technologiebereich und deren Einfluss auf die regionale und globale Wettbewerbsfähigkeit von Liechtensteins Start-up-Sektor.
4. Beitrag zur politischen Diskussion: Bereitstellung fundierter Erkenntnisse und Empfehlungen für politische Entscheidungsträger zur Gestaltung von Rahmenbedingungen, die das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung von Startups unterstützen.
5. Stärkung der internationalen Positionierung: Analyse der strategischen Ausrichtung Liechtensteins im internationalen Kontext und Entwicklung von Strategien, die das Land als attraktiven Standort für Start-up-Unternehmen und Investitionen positionieren.
6. Erleichterung des Stakeholder-Dialogs: Schaffung einer Grundlage für den kontinuierlichen Austausch zwischen den Stakeholdern des Ökosystems, um Synergien und gemeinsame Initiativen zu fördern.
Die Ergebnisse dieser Studie sollen also zusammengefasst dazu beitragen, ein tiefgreifendes Verständnis für die Dynamik und die spezifischen Bedingungen des Start-up-Ökosystems in Liechtenstein zu schaffen und somit eine wertvolle Ressource für alle Beteiligten zu bieten. Ziel ist es, durch gezielte Empfehlungen und strategische Einblicke die Grundlage für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine Stärkung des Innovationsgeistes im Land zu legen.
2 Methodik
2.1 Ausgangslage
Die Erstellung einer unabhängigen Studie über einen (noch) kleinen Wirtschaftssektor in einer kleinen Volkswirtschaft birgt grosse Herausforderungen in sich.
Geringe Vergleichbarkeit, hohe lokale Spezifizität
Staaten mit kleinen Volkswirtschaften haben oft eine hohe lokale Spezifizität und sind daher nicht direkt mit grösseren Märkten vergleichbar. Um dies zu berücksichtigen, ist es zwingend erforderlich, die lokalen Gegebenheiten und Besonderheiten zunächst zu erfassen und in einer gesamthaften Analyse zu berücksichtigen.
Wenige führende Akteure
In jedem Markt gibt es einige wenige Akteure, die eine bestimmte Führungsposition einnehmen. Diese haben und hatten mehr Einfluss auf die Entwicklung des Marktes als andere Teilnehmer. Ihre Meinung allein repräsentiert daher nicht die Ansichten aller Marktteilnehmer. Zudem ist sie meist wenig systemkritisch, da sie das System ja teilweise mitgestaltet haben. Eine reine Bewertung über Experteninterviews ist daher nicht zielführend.
Geringe Teilnehmerzahl
In einem kleinen Markt ist es schwierig, bis teilweise unmöglich, ausreichend viele Antworten auf eine reine Fragebogenstudie zu erhalten Die Ergebnisse wären in ihrer Validität entsprechend eingeschränkt. Zudem wären die Antworten der wenigen führenden Akteure für gewöhnlich überrepräsentiert, was zu einem zu positiven Bild führen könnte.
Survivorship Bias
Diese Studie erfasst, wie jede andere auch, die Meinungen der Marktteilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Marktteilnehmer, die in der Vergangenheit eine besonders negative Meinung hatten, haben den Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verlassen und werden somit nicht mehr repräsentiert, während Teilnehmer mit guter Meinung meist geblieben sind. Diese Verzerrung führt meist zu einer übermässig positiven Darstellung. Aus diesem Grunde müssen Statistiken stets recht kritisch betrachtet werden.
2.2 Aufbau der Studie
Alle oben genannten Herausforderungen liegen in Liechtenstein in hohem Masse vor. Die vorliegenden Bedingungen erlauben es daher nicht einfach die Methodiken anderer Studien zu übernehmen, sondern erfordern vielmehr ein spezifisches individuelles Forschungsdesign. Daher werden im methodischen Ansatz der Studie qualitative und quantitative Methoden kombiniert, um eine ganzheitliche Analyse zu gewährleisten (Creswell & Creswell, 2018, S. 337338). Qualitativ bezieht die Studie die Hauptakteure der liechtensteinischen Start-up-Szene durch ausführliche Interviews mit Unternehmern, Investoren und Fachleuten ein, die wertvolle Einblicke aus erster Hand in die Erfahrungen und Wahrnehmungen bieten, die das lokale Startup-Umfeld prägen. In quantitativer Hinsicht dienen die Interviewdaten als Grundlage für die Entwicklung einer umfassenden Umfrage in ganz Liechtenstein. Diese soll das breite Spektrum
an Perspektiven abdecken. In einer abschliessenden SWOT-Analyse werden alle Erkenntnisse zusammengefasst und interpretiert.
Die Studie wurde in vier Phasen umgesetzt:
Phase 1: Praktische und wissenschaftliche Hintergrundanalyse. Ziel war es die wichtigsten Kategorien und Einzelfaktoren für Standortattraktivität für FinTechs und Start-ups zu bestimmen. Dazu wurden sowohl die wissenschaftliche Literatur als auch bestehende Attraktivitätsstudien analysiert, um Erfolgsfaktoren zu bestimmen und kompetitive Märkte zu beschreiben. Die stark kondensierten Ergebnisse finden sich in den Kapiteln 3 (Erfolgsfaktoren für eine hohe Finanzplatzattraktivität) und 4 (Wettbewerbslandschaft).
Phase 2: Experteninterviews. Auf Basis der in Phase 1 gewonnen Erkenntnisse wurden semistrukturierte qualitative Interviews mit acht verschiedenen Stakeholdern aus Liechtenstein durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 40 Minuten und wurden aufgezeichnet. Es wurde darauf geachtet, dass die Interviewpartner alle essenziellen Teile des Ökosystems repräsentierten (z.B. Gründer, Banken, Verwaltungen, Rechtsanwälte, usw.) Ziel war es die wichtigsten spezifisch lokalen Faktoren zu identifizieren, zu diskutieren und im Studiendesign zu ergänzen. Zusätzlich wurden noch ca. 10 nicht dokumentierte oder strukturierte Einzelgespräche geführt, um die Ergebnisse aus den Interviews zu validieren und plausibilisieren.
Phase 3: Fragebogenstudie. Unter Einbeziehung der Erkenntnisse der Phasen 1 und 2 wurde eine Umfrage konstruiert und durchgeführt. Um ehrliche und kritische Antworten zu erhalten, wurde auf ein sehr hohes Mass von Anonymität geachtet. Es wurden daher keine demographischen oder unternehmensspezifischen Daten abgefragt. Dies birgt zwar den Nachteil einer geringeren Granularität bei der Auswertung, erhöht jedoch die Rücklaufquote und die Validität der Antworten. Der Link zur Umfrage wurde absichtlich nicht über Social Media oder andere Websites geteilt, sondern über möglichst viele Kanäle des Ökosystems selbst.1 Dies sollte verhindern, dass die Umfrage von nicht relevanten/betroffenen Personen ausgefüllt werden.
Phase 4: Dokumentation. Darstellung der Ergebnisse und Interpretation der Stärken und Schwächen in Form einer SWOT-Analyse dokumentiert und als Studie herausgegeben von der Universität Liechtenstein.
1 Die Autoren möchten sich noch einmal bei Lesern entschuldigen, die über mehrere Kanäle dieselbe Anfrage mehrfach erhalten haben. Dies war aufgrund des Studiendesigns leider nicht anders möglich.
3
Erfolgsfaktoren für eine hohe Finanzplatzattraktivität
Ein Ökosystem wird durch das Zusammenspiel materieller, sozialer und kultureller Faktoren geprägt. Im Mittelpunkt stehen kulturelle Elemente, die eine Grundlage für die Entstehung gesellschaftlicher Werte bilden. Diese Werte beeinflussen dann die Merkmale und Ausprägungen des Gesamtsystems. Anstatt isoliert zu existieren, interagieren und entwickeln sich diese Merkmale eines Ökosystems miteinander, wobei jedes die anderen beeinflusst und von ihnen beeinflusst wird. Diese wechselseitige Entwicklung sorgt dafür, dass die Schichten des Ökosystems nicht nur koexistieren, sondern sich gegenseitig fördern und ein dynamisches Ganzes bilden.
Im Folgenden wurden sechs Faktoren definiert, auf die sich die Bewertung der Forschungsfrage gestützt hat. Diese Faktoren sind wesentlich für die Beurteilung eines robusten Start-upÖkosystems und dienen als Massstab, um die Attraktivität Liechtensteins für Start-ups und FinTech-Unternehmen zu messen. Das Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren und der Dynamik der Unternehmer wird analysiert und gibt Aufschluss über die Fähigkeit Liechtensteins, in der globalen Wirtschaftsarena zu bestehen. Grundlage für die folgenden sechs Faktoren sind die Ausarbeitungen von Hess (2021, p. 60) sowie Skawińska und Zalewski (2020, p. 21) sowie die Analyse des kompetitiven Umfelds
3.1 Technologische Innovation und Infrastruktur
Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Zugang zu modernster Technologie und einer robusten technologischen Infrastruktur von unschätzbarem Wert. Hochentwickelte Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und Cloud Computing sind essenziell, insbesondere für Start-ups im FinTech-Sektor, die technologischen Vorsprung als Wettbewerbsvorteil nutzen. Eine ausgebaute Infrastruktur, einschliesslich innovativer Technologiezentren und zuverlässiger Netzwerke, ist unerlässlich, um Start-ups die Entwicklung und Skalierung ihrer Produkte zu ermöglichen.
3.2 Regulatorische Unterstützung und politische Stabilität
Eine klare und förderliche regulatorische Umgebung ist entscheidend für das Gedeihen von Neugründungen. Regulierungen, die Innovationen fördern und zugleich ein sicheres Investitionsklima gewährleisten, sind essenziell. Die politische Stabilität eines Landes garantiert dabei die notwendige Sicherheit für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen.
Regulatorische Sandkästen bieten zusätzlich den Raum, Innovationen unter realen Bedingungen zu erproben, ohne dabei die regulativen Lasten sofort vollständig tragen zu müssen.
3.3 Zugang zu Finanzierungen und Venture Capital (VC)
Die Verfügbarkeit von Kapital ist das Lebenselixier für Start-ups. Der Zugang zu einer Vielfalt an Finanzierungsquellen, sei es durch Venture Capital, Angel-Investoren oder staatliche
Fördermittel, ermöglicht den Unternehmen, sich von der Gründungsphase bis zur Marktreife zu entwickeln. Ein lebendiges Finanzökosystem unterstützt nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Fachwissen und Netzwerken, was essenziell für das nachhaltige Wachstum junger Unternehmen ist.
3.4 Qualifizierte Arbeitskräfte und Humankapital
Ein Pool an talentierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften ist grundlegend für den Erfolg von Start-ups. Zugang zu Spezialisten, etwa in den Bereichen Softwareentwicklung und digitales Marketing, sowie eine starke Verbindung zu Bildungseinrichtungen, die diese Talente fördern, sind unabdingbar. Weiterbildungsprogramme und eine Kultur des lebenslangen Lernens sorgen dafür, dass Arbeitskräfte mit technologischen und geschäftlichen Neuerungen Schritt halten.
3.5 Marktbedingungen und Kundenzugang
Ein attraktives wirtschaftliches Umfeld und günstige Marktbedingungen sind entscheidend für den Erfolg von Start-ups. Diese Faktoren bestimmen nicht nur die Grösse und Zugänglichkeit des Kundenstamms, sondern auch das potenzielle Marktwachstum und die Intensität des Wettbewerbs. Die Nähe zu Kunden erlaubt eine bessere Marktintegration und präzisere Anpassung der Produkte an Kundenbedürfnisse.
3.6 Vernetzung und Ökosystem
Ein effektives Netzwerk aus Start-ups, etablierten Unternehmen, Mentoren und Inkubatoren schafft ein Ökosystem, das wesentlich zur Unterstützung und Förderung von Innovationen beiträgt. Die Kooperation zwischen Industrie, Hochschulen und Behörden kann die Entwicklung neuer Ideen vorantreiben und den Zugang zu vielfältigen Ressourcen und Expertisen sichern. Konferenzen und Fachveranstaltungen fördern die Gemeinschaft und den Austausch.
Zusammenspiel der Faktoren
Der kombinierte Einfluss dieser Erfolgsfaktoren ist entscheidend für das Entwicklungspotenzial von Start-ups und dient als Leuchtturm für unternehmerische Talente und Investoren. Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren verdeutlicht sowohl die aktuellen Stärken als auch die potenziellen Entwicklungsbereiche innerhalb des liechtensteinischen Ökosystems.
Bei der Beantwortung der zentralen Forschungsfrage nach der Attraktivität Liechtensteins für Start-ups und FinTechs und den empfohlenen Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität ist es daher wichtig zu beachten, dass auch vermeintlich kleine Problemfelder grosse Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben können. Kleine Störungen können der Gesamtattraktivität Liechtensteins für Start-ups im Vergleich zu anderen Standorten signifikant schaden.
4 Wettbewerbslandschaft: Analyse des externen Umfelds
Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der dynamischen und vielfältigen Wettbewerbslandschaft, in der sich Standorte für Hightech-Start-ups und FinTechUnternehmen auf globaler Ebene bewegen. Wir untersuchen, wie unterschiedliche Länder und Innovationszentren ihre jeweiligen Start-up-Ökosysteme entwickelt haben. Durch die Analyse dieser Umfelder werden Schlüsselfaktoren identifiziert, die zum Erfolg und zur nachhaltigen Entwicklung von Start-ups beitragen. Diese Einblicke in die Strategien und Rahmenbedingungen, die unternehmerisches Wachstum und Innovation fördern, bilden die Grundlage für unser Verständnis des komplexen Zusammenspiels von Faktoren, die den Erfolg von Start-ups in verschiedenen globalen Kontexten beeinflussen.
4.1 Deutschland
Der deutsche FinTech-Sektor sowie das breitere Start-up-Ökosystem zeichnen sich durch eine überzeugende Mischung aus Stärken, Chancen und Herausforderungen aus. Dorfleitner et al. (2016) heben hervor, dass die deutsche FinTech-Branche von einer robusten Finanzinfrastruktur und einer starken Wirtschaft profitiert, die einen fruchtbaren Boden für Innovation und Wachstum bieten. Im Jahr 2015 belief sich das Gesamtmarktvolumen der FinTech-Unternehmen in den Segmenten Finanzierung und Vermögensverwaltung auf 22 Mrd. EUR, was bedeutende Kundenstämme und Marktchancen aufzeigt (S. 7). Die Branche zeichnet sich durch hohe Transparenz aus, insbesondere in Bereichen wie Robo-Advice und Social Trading, was wesentlich zur Kundenbindung beiträgt (S. 21). Deutschlands Position als zweitgrösster FinTech-Markt in Europa, gleich hinter Grossbritannien, und seine wachsende globale Bedeutung unterstreichen seine Attraktivität für FinTech-Unternehmen, die ein starkes europäisches Standbein suchen. Diese Wettbewerbsposition ist entscheidend, um internationale Investitionen und Partnerschaften anzuziehen, was durch den kooperativen Charakter des FinTech-Ökosystems in Deutschland noch verstärkt wird (S. 13).
Der deutsche FinTech-Sektor hat zudem von einer fortschrittlichen technologischen Infrastruktur und hochqualifizierten Arbeitskräften profitiert, die für die Entwicklung innovativer FinTech-Lösungen entscheidend sind. Das Vorhandensein einer technologisch versierten Bevölkerung und eines für die digitale Transformation förderlichen Geschäftsumfelds hat die schnelle Entwicklung und Einführung neuer Finanztechnologien ermöglicht, die einen zunehmend technikaffinen Markt bedienen. Der sich damals entwickelnde regulatorische Rahmen in Deutschland, der den besonderen Bedürfnissen von FinTech-Unternehmen Rechnung trägt, hat in Verbindung mit der staatlichen Unterstützung für digitale Initiativen ein Umfeld geschaffen, das Innovationen und die Einhaltung von Vorschriften begünstigt (Dorfleitner et al., 2016, S. 7). Aufgrund seiner strategischen Lage in Europa dient Deutschland als Tor für FinTechs, um ihre Geschäftstätigkeit auf den gesamten Kontinent auszuweiten, und den integrierten europäischen Finanzmarkt sowie einen vielfältigen Kundenstamm zu nutzen (S. 13).
Geibel und Manickam (2017) zeigen auf, dass das breitere Start-up-Ökosystem in Deutschland in bestimmten Bereichen stark ist, jedoch mit einzigartigen Herausforderungen und
Verbesserungsmöglichkeiten konfrontiert wird. Deutsche Start-ups profitieren von gut etablierten Co-Working-Spaces und Inkubatoren, jedoch besteht eine bemerkenswerte Lücke bei den Accelerator-Programmen, die für die schnelle Entwicklung und Skalierung von Startups entscheidend sind (S. 639). Ein wichtiger Bereich für Verbesserungen ist die Entwicklung einer stärkeren internen Team- und Arbeitskultur, die die Effektivität und Wettbewerbsfähigkeit deutscher Start-ups steigern könnte. Die Studie schlägt vor, dass die Anwerbung einer international vielfältigeren Bevölkerung an deutschen Universitäten den Talentpool vergrössern könnte, unterstützt durch die Förderung der englischen Sprache in der Ausbildung, um Sprachbarrieren zu überwinden (S. 648).
Die Risikoaversion des deutschen Marktes stellt eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere bei der Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen. Im Vergleich dazu bietet der US-amerikanische Markt mit einer höheren Konzentration von Early Adopters ein günstigeres Umfeld für solche Unternehmungen. Während deutsche Inkubatoren bei der Bereitstellung von Infrastruktur und rechtlicher Unterstützung hervorragend abschneiden, müssen sie sich stärker darauf konzentrieren, Gründer mit erfahrenen Mentoren und Risikokapitalgebern zusammenzubringen (Geibel & Manickam, 2017, S. 646).
Darüber hinaus muss sich das deutsche Start-up-Ökosystem an die sich entwickelnden globalen Markttrends anpassen. Die digitale Transformation und die Integration neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain können die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Start-ups weiter verbessern. Die Förderung einer Kultur der Innovation und des Unternehmertums, unterstützt durch staatliche Massnahmen und Investitionen, kann das Wachstum des Start-up-Ökosystems beschleunigen. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Regierung kann eine robustere Innovationslandschaft fördern und Start-ups mit den notwendigen Ressourcen und Fachkenntnissen ausstatten. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Beseitigung der Ungleichheiten beim Zugang zu Finanzmitteln. Deutsche Start-ups haben oft Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung, insbesondere in der Anfangsphase. Eine Verbesserung der Investitionslandschaft in Deutschland, einschliesslich Anreize für Risikokapitalgeber und Angel-Investoren, könnte diese Lücke schliessen (Geibel & Manickam, 2017, S. 646-647).
Während der deutsche FinTech-Sektor mit seinem grossen Markt, seiner Transparenz und seinem kooperativen Ökosystem eine attraktive Drehscheibe für Unternehmen darstellt, die nach Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten suchen (Dorfleitner et al., 2016, S. 7), muss das breitere Start-up-Ökosystem in Bereichen wie interne Teamentwicklung, Talentakquise, Marktanpassung und Finanzierungszugang gezielt verbessert werden (Geibel & Manickam, 2017, S. 639 & 648).
4.2 Schweiz
Die Schweiz hat sich durch eine Kombination strategischer Vorteile als erstklassiger Standort für Start-ups, insbesondere im FinTech-Sektor, etabliert. Laut Ankenbrand et al. (2016) und Dementyeva und DaSilva (2020) ist die Schweiz aufgrund vielfältiger Gründe ein attraktiver Ort für Wachstum und Innovation. Ankenbrand et al. (2016) beleuchten die Feinheiten des Schweizer FinTech-Ökosystems, darunter die nahtlose Integration von FinTech in den
traditionellen Bankensektor, was die fortschrittliche Einstellung der Schweiz zu neuen Technologien und innovativen Finanzlösungen verdeutlicht. Diese Integration bietet FinTechStart-ups eine wichtige Gelegenheit, sich mit etablierten Finanzinstituten zu vernetzen, die Zusammenarbeit und Innovation fördern (S. 10).
Die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Schweizer FinTech-Sektors wurden ebenso eingehend analysiert. Die positive gesellschaftliche Einstellung zu Technologie und Innovation spielt eine wesentliche Rolle für das Wachstum und die öffentliche Akzeptanz von FinTech-Start-ups. Der spezifische rechtliche Rahmen unterstützt die Betriebs- und Compliance-Landschaft dieser Unternehmen, sodass sie in einem regulierten, aber unterstützenden Umfeld gedeihen können (Ankenbrand et al., 2016, S. 14 & 23). Zudem trägt die wirtschaftliche Robustheit der Schweiz, bekannt als globales Finanzzentrum, dazu bei, dass FinTech-Unternehmen Finanzierungen sichern, einen stabilen Kundenstamm erschliessen und effektiv skalieren können (S. 27).
Ankenbrand et al. (2016) betonen auch die Vielfalt und den Erfolg der FinTech-Unternehmen in der Schweiz und bieten wertvolle Einblicke in erfolgreiche Geschäftsmodelle und Marktdynamiken (S. 45). Die globale FinTech-Landschaft und die Rolle der Schweiz darin wurden ebenfalls untersucht, um einen Überblick über die Position der Schweiz und ihren Beitrag zur internationalen FinTech-Szene zu geben, was für Start-ups entscheidend ist, um ihre strategische Position global zu verstehen (S. 49).
Dementyeva und DaSilva (2020) heben weitere Faktoren hervor, die zur Attraktivität der Schweiz als Start-up-Hub beitragen. Insbesondere die weltberühmten Bildungseinrichtungen wie die ETH Zürich und die EPFL Lausanne spielen eine zentrale Rolle, da sie hochqualifizierte Arbeitskräfte hervorbringen und eine Kultur der Innovation und wissenschaftlichen Forschung fördern. Dies bietet einen fruchtbaren Boden für bahnbrechende neue Ideen und Technologien (S. 3-4). Das dichte Netzwerkumfeld in der Schweiz erleichtert es Start-ups, schnell wichtige Verbindungen zu Mentoren, Partnern und potenziellen Kunden zu knüpfen, was in der Frühphase ihres Wachstums entscheidend ist.
Beschleuniger und Inkubatoren in der Schweiz verstärken diese Vernetzungsmöglichkeiten, indem sie Geschäftsberatung anbieten und den Zugang zu finanziellen Ressourcen erleichtern. Das starke VC-Netzwerk und staatlich geförderte Initiativen wie Innosuisse sind entscheidend, um den Start-ups die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, insbesondere für solche mit hohem Investitionsbedarf (Dementyeva & DaSilva, 2020, S. 9).
Kulturelle und regionale Faktoren sind ebenfalls von Bedeutung, darunter die politische Stabilität und die hohe Lebensqualität und das starke Engagement für Innovation und Technologie machen die Schweiz attraktiv für Unternehmer. Die konservative Geschäftskultur und die ausgeprägte Risikoaversion in der Schweiz sind Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um das Potenzial der Schweiz als führende Start-up-Drehscheibe voll ausschöpfen zu können (Dementyeva & DaSilva, 2020, S. 10-11).
In der Gesamtschau dieser Perspektiven bestätigt sich die Schweiz als ein äusserst attraktives Umfeld für Start-ups, insbesondere im FinTech-Sektor. Die Verflechtung mit dem traditionellen Bankwesen, unterstützende soziale und rechtliche Rahmenbedingungen, der robuste wirtschaftliche Hintergrund und die globale Perspektive passen gut zu den starken
Bildungsgrundlagen, der effektiven Vernetzung, den vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten und der staatlichen Politik. Nichtsdestotrotz müssen Herausforderungen im Zusammenhang mit der konservativen Unternehmenskultur und der Risikoaversion überwunden werden, damit die Schweiz weiterhin als erstklassiger Standort für Innovation und Wachstum von Start-ups florieren kann.
4.3 Der Verband der südostasiatischen Nationen (ASEAN)
Die ASEAN FinTech Ecosystem Benchmarking Study von 2019 lieferte eine umfassende Analyse des FinTech-Marktes innerhalb des Verbands Südostasiatischer Nationen. Die Studie analysierte Geschäftsmodelle, Kundendemografien, Strategien und Technologien sowie regulatorische Wahrnehmungen und Risikomanagement im Sektor. Eine wichtige Erkenntnis war die vergleichende Analyse der Vorschriften, die FinTech-Aktivitäten in den ASEANMitgliedstaaten steuern, einschliesslich innovativer Ansätze wie regulatorischer Sandkästen und RegTech, die darauf abzielen, die Anpassung an neue Technologien zu erleichtern und deren Einführung zu beschleunigen (CCAF et al., 2019, S. 11).
Die Finanzdienstleistungsbranche in ASEAN hat sich durch technologiegestützte Innovationen rapide verändert. FinTech-Unternehmen in dieser Region setzen auf Technologien wie Cloud Computing, Mobiltelefone, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain, um Finanzprodukte und -dienstleistungen effizienter und zugänglicher zu machen. Insbesondere wird der Fokus auf traditionell unterversorgte Bevölkerungsgruppen gelegt, um finanzielle Inklusion zu fördern und die wirtschaftliche Aktivität in diesen Gemeinschaften gesteigert wird (S. 7). Trotz der Fortschritte bleibt ein erheblicher Teil der erwachsenen ASEAN-Bevölkerung ohne Bankverbindung, vor allem jene, die an oder unter der Armutsgrenze leben oder in abgelegenen Gebieten ansässig sind (S. 8).
Die regulatorische Landschaft in ASEAN wird weiterhin als herausfordernd betrachtet, da Regulierungsbehörden mit den Unsicherheiten neuer Geschäftsmodelle konfrontiert sind. Die aktuellen FinTech-Vorschriften und die Erfahrungen der Regulierungsbehörden bei der Anpassung an technologische Fortschritte wurden eingehend untersucht, um Fördermassnahmen für Finanzinnovationen zu optimieren (CCAF et al., 2019, S. 9). Die Anwendung prädiktiver Analysen und maschinellen Lernens nimmt zu, und Technologien wie Blockchain und DLT gewinnen in Bereichen wie digitalen Zahlungen und Crowdfunding an Bedeutung (S. 10).
Das Konzept der Unternehmensökosysteme, das als dynamisches wirtschaftliches Umfeld, das von einem Netz interagierender Akteure getragen wird, hat sich als ein Eckpfeiler in der High-Tech-Industrie etabliert. Diese Ökosysteme revolutionieren die Unternehmensstrategien und fördern Wachstum sowie Innovation. High-Tech-Start-ups, die für die Volkswirtschaften von zentraler Bedeutung sind, haben global zu einer Verschiebung in der Wirtschaftslandschaft geführt, angetrieben durch technologiebasierte Unternehmungen. Das Wachstum dieser Startup-Ökosysteme hat die Weltwirtschaft deutlich beeinflusst (Lee et al., 2017, S. 158).
Trotz der Herausforderungen wird ein dynamischerer Ansatz vorgeschlagen, der die Wechselwirkungen zwischen unternehmerischen Initiativen und dem Kapitalfluss erfassen soll, um High-Tech-Start-up-Ökosysteme in Ländern wie Korea, China und Japan zu analysieren.
Diese Länder bieten aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds und ihrer unterschiedlichen Marktmerkmale eine einzigartige Gelegenheit, verschiedene Ökosystemmodelle zu untersuchen und nationale Politiken sowie Unternehmensstrategien zu formulieren, die mit der sich entwickelnden Natur von Hightech-Start-up-Ökosystemen übereinstimmen (Lee et al., 2017, S. 159-160).
4.4 Singapur
Singapur hat sich als dynamisches Zentrum für Start-ups und technologische Innovationen etabliert, was durch eine Reihe vorteilhafter Faktoren begünstigt wird. Der Stadtstaat zeichnet sich durch günstige Unternehmenssteuersätze aus und erhebt keine Steuer auf Kapitalgewinne, was ihn besonders für Venture-Capital-Fonds attraktiv macht. Zudem wird die Geschäftstätigkeit durch effiziente Prozesse bei der Unternehmensgründung, Baugenehmigungen und den Schutz von Minderheitsaktionären erleichtert. Ein umfangreicher Pool an Risikokapital, unterstützt durch private Investoren und die Regierung erheblich unterstützt wird, stärkt das robuste Start-up-Ökosystem in Singapur. Dieses System bietet umfangreiche Unterstützung, einschliesslich Beratung durch erfahrene VC-Investoren, um die Kommerzialisierung von Innovationen zu erleichtern (Asian Development Bank, 2022, S. 16-19).
Als zentrales Drehkreuz bietet Singapur ideale Bedingungen für Unternehmen, die in regionale Märkte expandieren möchten. Die Förderung von Forschung und Entwicklung, besonders im Bereich der Spitzentechnologie, wird durch die Anwesenheit hochqualifizierter Fachkräfte und die Zusammenarbeit mit etablierten Forschungseinrichtungen unterstützt (Asian Development Bank, 2022, S. 57-58). Die dynamische Innovationskultur in Singapur wird weiterhin durch zahlreiche technologiebezogene Veranstaltungen und Konferenzen gefördert, die wertvolle Vernetzungsmöglichkeiten und Zugang zu neuen Ideen bieten (S. 11-12). Die hohe Verfügbarkeit von qualifizierten Talenten und eine zunehmend positive Einstellung von Hochschulabsolventen gegenüber Unternehmensgründungen tragen ebenfalls zur Attraktivität Singapurs bei. Diese Kombination von Faktoren schafft ein günstiges Umfeld für Start-ups und macht Singapur zu einem attraktiven Standort für Unternehmensgründungen und Innovationen im Technologiesektor (S. 21-22).
4.5 Indien
Die Start-up-Landschaft in Indien hat ein bemerkenswertes Wachstum erlebt und trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Expansion des Landes Dieses Wachstum wird von mehreren entscheidenden Erfolgsfaktoren gestützt, allen voran die solide Unterstützung durch Regierungsinitiativen wie Start-up India. Diese Programme zielen darauf ab, eine Kultur der Innovation und des Unternehmertums zu fördern, insbesondere unter der Jugend, und sind entscheidend für die Schaffung eines günstigen Umfelds für aufstrebende Unternehmen (Garg & Gupta, 2021, S. 31-33).
Ein dynamisches Ökosystem, das aus verschiedenen Akteuren wie Inkubatoren, Beschleunigern, Investoren, Bildungseinrichtungen und etablierten Unternehmen besteht, bietet lebenswichtige Ressourcen, Vernetzungsmöglichkeiten und umfassende Unterstützung.
Diese Unterstützung erleichtert es Start-ups, sich in den frühen Phasen ihres Wachstums zu orientieren. Innovation steht im Mittelpunkt des Erfolgs von Start-ups, da sie durch die Entwicklung oder Optimierung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen auf spezifische Marktbedürfnisse und Probleme eingehen, was wiederum Mehrwert und Beschäftigungsmöglichkeiten schafft (Garg & Gupta, 2021, S. 31-33).
Der Zugang zu angemessenen Finanzmitteln ist entscheidend, von der ersten Startfinanzierung bis hin zu späteren Finanzierungsrunden, die notwendig sind für Produktentwicklung, Teamerweiterung und betriebliche Skalierung. Ebenso wichtig ist die Zusammenstellung eines qualifizierten und engagierten Teams, das die Vision des Start-ups teilt, was die Bedeutung des Humankapitals im Ökosystem unterstreicht. Die Verwaltung des geistigen Eigentums ist entscheidend für den Erhalt eines Wettbewerbsvorteils und die Sicherung von Investitionen. Start-ups müssen agil bleiben und auf Marktbedürfnisse und Kundenpräferenzen reagieren, indem sie ihre Angebote effektiv anpassen. Eine sorgfältige Strategie für Skalierbarkeit und Wachstum ist notwendig, um die Fallstricke einer verfrühten Skalierung zu vermeiden (Garg & Gupta, 2021, S. 34-35).
Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen fördert weiterhin die Innovation und ermöglicht den Zugang zu Forschungs- und Wissensressourcen. Die effektive Nutzung von Technologie in verschiedenen Geschäftsbereichen, von der Produktentwicklung bis hin zum Marketing, ist ein entscheidendes Merkmal erfolgreicher Start-ups und steht für eine unternehmerische Denkweise, die Risikobereitschaft, Innovation und proaktives Management von Herausforderungen umfasst. Diese Faktoren haben zusammen ein dynamisches Umfeld für Start-ups geschaffen, das zu einem erheblichen Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen geführt hat (Garg & Gupta, 2021, S. 36).
4.6 Lettland
Der FinTech-Sektor in Lettland ist trotz seines frühen Entwicklungsstadiums ein vielversprechender Zukunftsmarkt. Dennoch steht er schon jetzt vor zahlreichen Herausforderungen, die seine Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Zu den Hauptproblemen zählen unzureichende regulatorische Rahmenbedingungen, die nicht auf die spezifischen Bedürfnisse von FinTech-Unternehmen eingehen, der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und ein Innovationsumfeld, das dringend verstärkte Unterstützung benötigt. Diese Faktoren, verstärkt durch die segmentierte EU-Regulierung für verschiedene Finanzdienstleistungen, haben das Wachstum und die finanzielle Robustheit von FinTech-Unternehmen in Lettland behindert. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld insgesamt positiv ist, bleibt Lettland hinsichtlich der Dynamik des unternehmerischen Ökosystems und des finanzspezifischen Wirtschaftsklimas hinter seinen Nachbarn Estland und Litauen zurück (Rupeika-Apoga & Wendt, 2021, S. 1-3).
Trotz eines hohen Qualifikations- und Bildungsniveaus stellen die Abwanderung von Fachkräften, niedrige Entlohnung in Dienstleistungsberufen, die hohen Steuersätze für Arbeitskräfte und die Schwierigkeiten bei der Einstellung ausländischer Arbeitskräfte erhebliche Herausforderungen dar. In technologischer Hinsicht ist Lettland gut ausgestattet mit der Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien und dem Zugang zu
Elektrizität, auch wenn es bei seiner digitalen Agenda und technologischen Fähigkeiten nicht an der Spitze steht. Diese Erkenntnisse stammen aus einer gründlichen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und technologischen (PEST-)Analyse, die die Notwendigkeit modernisierter Vorschriften und Initiativen unterstreicht, um Lettlands Attraktivität für Fachkräfte zu steigern, Wettbewerbsbedingungen zu verbessern und das Sektorwachstum zu fördern (Rupeika-Apoga & Wendt, 2021, S. 5, 6-7 & 12-13).
Die Ergebnisse von Umfragen bestätigen diese Schlussfolgerungen, wobei unzureichende Vorschriften und die Verfügbarkeit von Fachkräften als Hauptanliegen genannt wurden. Interessanterweise zeigt die wachsende Integration und Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen eine Verschiebung von disruptiven zu innovativen und modernisierenden Kräften innerhalb des Finanzsektors (S. 18-19).
4.7 Vereinigte Arabische Emirate
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich zu einer führenden FinTech-Drehscheibe im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) entwickelt. Diese Entwicklung wird durch eine unterstützende Regierungspolitik, ein innovationsfreundliches Ökosystem für Finanzinnovationen sowie eine technikaffine Bevölkerung gefördert. Der Erfolg der in den VAE ansässigen FinTech-Start-ups hängt massgeblich vom Zugang zu notwendigen Ressourcen ab, insbesondere zu Venture-Capital. Finanzielle Hürden, das regulatorische Umfeld und rechtliche Fragen stellen jedoch erhebliche Herausforderungen dar und beeinträchtigen die Gründung und das Wachstum dieser Unternehmen. Der Erfolg von FinTechs in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird zudem durch spezifische Geschäftsmodelldimensionen wie Produkt/Dienstleistungsangebote und Wertversprechen beeinflusst (Zarrouk et al., 2021, S. 18-19).
Die Regierung der VAE hat erkannt, dass FinTechs eine Schlüsselrolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Diversifikation und der digitalen Transformation spielen. Daher unterstützt sie aktiv die Entwicklung dieses Sektors durch progressive Gesetze und Vorschriften, die darauf abzielen, ein ideales Umfeld für das Wachstum und die Skalierung von FinTech-Unternehmen zu schaffen. Trotz dieser Bemühungen bleiben die Herausforderungen in Form von finanziellen Barrieren und einem komplexen regulatorischen Rahmen bestehen, die eine fortlaufende Modernisierung der politischen Massnahmen erfordern.
Die VAE streben danach, ihre Position als globaler Knotenpunkt für Finanztechnologie weiter zu stärken, indem sie nicht nur lokale, sondern auch internationale FinTech-Innovationen anziehen und fördern. Dies erfordert eine fortlaufende Verbesserung des Zugangs zu Kapital, die Klarstellung regulatorischer Anforderungen und die Schaffung eines noch attraktiveren Geschäftsumfelds. Die Integration von FinTech-Innovationen in die Wirtschaft wird die VAE als Vorreiter in der globalen Finanzlandschaft stärken.
5 Ergebnisse der qualitativen Interviews
In diesem Abschnitt werden die empirischen Erkenntnisse aus umfassenden Experteninterviews detailliert dargestellt Ziel der Experteninterviews ist es, eine tiefgehende qualitative Analyse des Start-up-Ökosystems in Liechtenstein vorzunehmen. Die Antworten beleuchten die Vielschichtigkeit dieses Ökosystems und erörtern seine einzigartigen Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten in einem dynamischen unternehmerischen Umfeld. Durch die Synthese der Perspektiven verschiedener Experten entsteht eine umfassende, mehrdimensionale Analyse, die die Stärken, Herausforderungen und die spezifischen Merkmale des Ökosystems hervorhebt und dadurch unser Verständnis dieses dynamischen Umfelds erweitert. Diese Erkenntnisse wurden auch als Basis für die Erstellung jener Fragebogenstudie verwendet, die im kommenden Abschnitt präsentiert werden wird.
Interviewstruktur mit ersten Erkenntnissen
Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse stellen eine gesamthafte Zusammenfassung dar. Es wurden nur Punkte aufgenommen, die von mehreren Interviewpartnern erwähnt wurden, um Einzelmeinungen weitestgehend auszuschliessen. Wenn mehrere Teilnehmer eine Meinung vertreten haben, wurden einzelne Gegenmeinungen nicht berücksichtigt. Der Aufbau der semistrukturierten Interviews war sehr offen und explorativ gestaltet, folgte jedoch auch einem gewissen Fragenkatalog und Aufbau. Aus Gründen der Anonymität werden die Identitäten der Experten nicht publiziert, ebenso nicht die Transkripte, aus denen die Identität manchmal recht leicht feststellbar wäre.
Die Interviews begannen mit einer allgemeinen Diskussion der Erfahrungen innerhalb des liechtensteinischen Start-up-Ökosystems Die Experten lobten dabei fast ausnahmslos die hohe Motivation und die ehrgeizigen Ziele aller Akteure des Landes. Diese Faktoren vermitteln einen Eindruck von Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit, die speziell die Unternehmer antreibt. Daraufhin folgt eine Frage zur Positionierung im internationalen Wettbewerb, insbesondere der Positionierung Liechtensteins im Vergleich zu anderen Finanzzentren wie Luxemburg. Hierbei wurde analysiert, wie externer Druck strategische Entscheidungen und Entwicklungen innerhalb des Sektors beeinflusst.
Die Diskussion vertiefte sich dann in die Nuancen des regulatorischen Umfelds. Ein zentraler Punkt war hier das TVTG-Gesetz, ein bedeutender Meilenstein, der vor allem im Hinblick auf seine breiten Auswirkungen auf die Start-up-Landschaft wichtig ist. Es wurde betont, wie dieses Gesetz insbesondere Blockchain-Technologien fördert, das Wachstum von Start-ups antreibt, das Vertrauen von Investoren stärkt und die Innovationskraft steigert.
Im Weitern wurden die einzigartigen Vorteile und Herausforderungen, die sich aus der geringen Grösse Liechtensteins ergeben diskutiert. Häufig genannt wurde, wie die kompakte Grösse des Landes effiziente Kommunikations- und Entscheidungsprozesse erleichtert, aber auch Herausforderungen bei begrenzten Karriereoptionen und der Rekrutierung von Talenten mit sich bringt. Diese Diskussionen zeigen auf, wie solche grössenbedingten Dynamiken Start-upStrategien und die Skalierbarkeit beeinflussen.
Ein wesentliches Thema war auch die Spezialisierung des Ökosystems, insbesondere im Bereich des Kryptosektors. Hierbei wurden die Nischenmöglichkeiten und Herausforderungen durch begrenzte Aufenthaltsoptionen und Marktgrösse genannt. Es wurde diskutiert, wie Startups in diesen spezialisierten Sektoren navigieren, Marktbeschränkungen überwinden und Vorteile wie das Passporting für den Europäischen Wirtschaftsraum nutzen können.
Die Interviews gingen dann über zu den Herausforderungen und Vorteilen, mit denen Start-ups und FinTech-Unternehmen konfrontiert sind. Die Experten hoben die Herausforderungen bei der Eröffnung von Bankkonten für Blockchain-Unternehmen und den Umgang mit teilweise widersprüchlichen regulatorischen Entscheidungen hervor. Gleichzeitig werden die innovativen Rechtsformen und die proaktive Denkweise der Behörden als wesentliche Vorteile hervorgehoben, was ein ausgewogenes Bild des liechtensteinischen Geschäftsumfelds ergab
Die Gespräche schlossen mit einer eingehenden Betrachtung der Rolle der Vernetzung in der Gestaltung des Ökosystems ab. Der genannte Fokus liegt auf Networking-Veranstaltungen, die die Zusammenarbeit mit Universitäten fördern, den Wissensaustausch erleichtern und strategische Partnerschaften unterstützen, die alle entscheidend für das Wachstum und den Erfolg von Start-ups sind.
Diese tiefgehenden Interviews, gestützt auf die in Kapitel 3 vorgestellten Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur, zielten darauf ab, die zentrale Forschungsfrage durch die Liechtenstein spezifischen Aspekte und mögliche fehlende Aspekte zu ergänzen.
In der Analyse der Interviews konnten zehn zentrale Erkenntniskomplexe identifiziert werden, die nun im Detail erörtert werden. Diese Erörterung stellen rein die Meinungen und Ansichten der Interviewpartner dar. Eine gesamthafte Evaluation durch die Autoren dieser Studie, unter Einbeziehung der Interviews als auch der Fragebogenstudie, erfolgt im Rahmen der SWOTAnalyse in Kapitel 7
5.1 Positives regulatorisches Umfeld
Ein wiederkehrendes Thema in den Experteninterviews war das positive regulatorische Umfeld in Liechtenstein. Insbesondere das TVTG-Gesetz, auch bekannt als Blockchain-Gesetz, wurde als bedeutender Fortschritt gewürdigt, der den Sektor der Blockchain-Technologie erheblich stärkt. Dieses Gesetz verdeutlicht die Bedeutung eines anpassungsfähigen, innovationsfreundlichen regulatorischen Rahmens als Katalysator für den technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt (Linis & Praicheux, 2021, S. 4). Ein weiterer positiver Aspekt ist die proaktive und offene Haltung der Regulierungsbehörden gegenüber neuen Technologien und Geschäftsmodellen, die für die Förderung eines innovationsfreundlichen Umfelds entscheidend ist.
Das regulatorische Umfeld in Liechtenstein, wie es durch das Blockchain-Gesetz beleuchtet wird, stellt eine wichtige Säule in der Entwicklung des Start-up- und FinTech-Ökosystems des Landes dar. Dieser Ansatz deckt sich mit den Erkenntnissen aus der umfangreichen Literaturrecherche, in der die Bedeutung eines fortschrittlichen Rechtsrahmens für technologische Innovationen hervorgehoben wurde und durch die von den Interviewpartnern geteilten Erfahrungen weiter bestätigt wurde.
Wie von Linis und Praicheux (2021, S. 4) reflektiert und von den Interviewpartnern aufgegriffen, haben die fortschrittlichen regulatorischen Massnahmen die Attraktivität Liechtensteins als digitales Innovationszentrum deutlich erhöht. Diese regulatorische Klarheit, die besonders in Bereichen, in denen zuvor rechtliche Unklarheiten bestanden, von entscheidender Bedeutung ist, steht im Einklang mit der Literaturübersicht, die die Notwendigkeit von Rechtssicherheit für Investitionen und Innovationen in neue Technologien hervorhebt.
Der von den Interviewpartnern beschriebene Balanceakt zwischen Innovationsförderung und Verbraucherschutz in Liechtenstein spiegelt die in der Literatur ermittelten Themen wider (Brown et al., 2019, S. 124). Dieses Gleichgewicht, das für ein nachhaltiges Ökosystem von entscheidender Bedeutung ist, stellt sicher, dass die Innovation nicht die Sicherheit der Verbraucher oder die Integrität des Marktes gefährdet. Ein solches Umfeld ist attraktiv für Startups, die sich für verantwortungsvolle und ethische Geschäftspraktiken einsetzen.
Obwohl das regulatorische Umfeld überwiegend positiv wahrgenommen wird, müssen einige Herausforderungen angegangen werden. Die Kluft zwischen der fortschrittlichen Gesetzgebung und dem konservativen Bankensektor, die von den Interviewpartnern hervorgehoben wurde, stellt einen kritischen Bereich für Verbesserungen dar. Diese Beobachtung wurde in der Literatur bestätigt und unterstreicht die Notwendigkeit, dass sich der regulatorische Rahmen mit dem technologischen Fortschritt und der Marktdynamik weiterentwickelt.
Die Erkenntnisse aus den Interviews und der Literaturauswertung betonten gemeinsam die Bedeutung einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Wie von den Interviewpartnern vorgeschlagen, sollten die politischen Entscheidungsträger einen kontinuierlichen Dialog mit der Start-up-Community und den traditionellen Finanzinstituten führen. Wie in der Literatur empfohlen, könnten Bildungsinitiativen die Verständnislücke zwischen neuen Technologien und traditionellen Finanzsektoren schliessen.
Die progressive Gesetzgebung im regulatorischen Umfeld Liechtensteins, das im Rahmen der Literaturrecherche und aus der Sicht der Interviewpartner untersucht wurde, ist ein lobenswertes Beispiel für die Förderung eines günstigen Umfelds für Start-ups und FinTechUnternehmen. Liechtensteins Ansatz, eine fortschrittliche Gesetzgebung mit den Realitäten der Markt- und Technologieentwicklung in Einklang zu bringen, dient als Referenz für andere Länder, die ähnliche Ökosysteme fördern wollen. Anpassungsfähige regulatorische Rahmenbedingungen und eine mutigere innovative Auslegung der Regulierungsbehörden bei der Umsetzung sind jedoch entscheidend, um diese positive Entwicklung aufrechtzuerhalten.
5.2 Vorteile der geringen Grösse und der schnellen Entscheidungsfindung
Die geringe Grösse Liechtensteins, die oft als potenzielle Einschränkung wahrgenommen wird, verschafft dem Start-up- und FinTech-Ökosystem des Landes paradoxerweise einzigartige Stärken. Besonders evident wird dies bei der Erleichterung schneller Entscheidungen und schlanker Verwaltungsprozesse, wie Laidroo und Avarmaa (2020, S. 14) betonen. Diese Aspekte stellen einen klaren Wettbewerbsvorteil in der dynamischen Welt der Start-ups dar.
Einer der grössten Vorteile der geringen Grösse Liechtensteins für staatliche Stellen und private Unternehmen ist die Agilität und Flexibilität, die im schnelllebigen Technologie- und
Finanzsektor von zentraler Bedeutung ist. In diesem Kontext ist die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Marktbedingungen und technologische Fortschritte anzupassen, entscheidend. Dementyeva und DaSilva (2020) unterstützen diese Beobachtung und weisen darauf hin, dass kleinere Länder oft schneller auf globale wirtschaftliche und technologische Trends reagieren können (S. 3-4).
Es wird beobachtet, dass die effizienten Entscheidungsprozesse in Liechtenstein eine direkte Folge der kompakten Grösse des Landes sind. Dieser gestraffte Ansatz ist nicht nur auf Startups beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf den Regulierungs- und Finanzsektor und ermöglicht eine kohärentere und integrierte operative Landschaft. In der Literatur wird hervorgehoben, dass Entscheidungsprozesse, die in kleineren Ländern effizienter gestaltet werden können, was eine schnellere Umsetzung von Strategien ermöglicht, die für Start-ups unerlässlich sind, die sich schnell in der Regulierungs- und Finanzlandschaft zurechtfinden müssen.
Ein weiterer bedeutender Vorteil, der sich aus der Kleinheit Liechtensteins ergibt, ist die engere Zusammenarbeit und die Integration der Gemeinschaft innerhalb des Unternehmensökosystems. Es wird betont, dass der enge Zusammenhalt der Geschäftswelt das Gefühl der Zusammenarbeit und nicht des Wettbewerbs fördert, was für Start-ups von grossem Vorteil ist. Dementyeva und DaSilva (2020) stellen fest, dass kleinere Umgebungen direktere und persönlichere Geschäftsbeziehungen fördern können, was zu einem stärker unterstützenden Ökosystem für Start-ups führt (S. 3-4).
Die geringe Grösse stellt jedoch auch Herausforderungen dar. Es wird erwähnt, dass der begrenzte Inlandsmarkt die Wachstumsmöglichkeiten einschränken kann, sodass der Schwerpunkt auf internationale Expansion gelegt werden muss. Hinzu kommt die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen, die Start-ups bei der Skalierung ihrer Aktivitäten vor Herausforderungen stellt.
Trotz dieser Herausforderungen sind die Vorteile der geringen Grösse bei der Förderung eines dynamischen und reaktionsfähigen Start-up-Ökosystems erheblich. Die Kombination aus schneller Entscheidungsfindung, schlanken Prozessen und enger Zusammenarbeit in der Gemeinschaft bietet Liechtenstein ein einzigartiges Umfeld, das das Wachstum und den Erfolg von Start-ups und FinTech-Unternehmen begünstigt. Politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer in Liechtenstein sollten diese Stärken weiterhin nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen angehen, um den Wettbewerbsvorteil des Ökosystems zu erhalten und auszubauen.
5.3 Herausforderungen für den Bankensektor
In Liechtensteins Finanzökosystem stellt der Bankensektor Start-ups und FinTechUnternehmen vor besondere Herausforderungen. Trotz eines fortschrittlichen regulatorischen Umfelds und der durch die geringe Grösse des Landes bedingten Agilität des Geschäftsbetriebs wurden spezifische Reibungspunkte innerhalb des Bankensektors identifiziert, die sich insbesondere auf Start-ups in innovativen und technologiegetriebenen Bereichen auswirken.
Eine grosse Herausforderung besteht darin, dass Start-ups, besonders jene aus dem Blockchain- und Kryptowährungssektor, Schwierigkeiten beim Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen haben. Dieses Problem ist nicht nur in Liechtenstein präsent, sondern auch ein allgemeines Problem in vielen Ländern, die sich mit neuen Technologien befassen. Das Zögern traditioneller Banken, sich auf diese neuen Sektoren einzulassen, was oft auf regulatorische Bedenken oder ein mangelndes Verständnis der Technologie zurückzuführen ist, stellt für Start-ups eine erhebliche Hürde dar.
Ein weiteres kritisches Problem sind die strengen regulatorischen Anforderungen, die, während sie für die Aufrechterhaltung der Stabilität und Integrität des Finanzsystems unerlässlich sind, die Agilität und Innovation, die Start-ups mit sich bringen, behindern können. Diese Herausforderung ist besonders akut für FinTech-Unternehmen, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzen tätig sind und oft ein differenzierteres Verständnis der Regulierung erfordern.
Die Integration neuer Technologien in den Bankensektor birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Banken stehen vor der doppelten Aufgabe, mit den raschen technologischen Fortschritten Schritt zu halten und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Integrationen den regulatorischen Standards entsprechen. Daher müssen sich Start-ups in einer komplexen Landschaft zurechtfinden, in der die Bereitschaft der Banken, neue Technologien zu übernehmen, sehr unterschiedlich ist (Yazici, 2019, S. 190-192).
Die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen dem Bankensektor und Start-ups wird betont. Der Aufbau von Partnerschaften und die Förderung des Verständnisses zwischen diesen Einrichtungen könnten einige der Herausforderungen, mit denen Start-ups konfrontiert sind, abmildern, insbesondere beim Zugang zu Finanzdienstleistungen und bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen.
Während Liechtenstein ein günstiges Umfeld für Start-ups und FinTech-Unternehmen bietet, stellen die spezifischen Herausforderungen des Bankensektors bedeutende Hindernisse dar, die es zu bewältigen gilt. Dazu gehören der Zugang zu Bankdienstleistungen, Hürden bei der Einhaltung von Vorschriften und die Integration neuer Technologien. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine Zusammenarbeit zwischen Start-ups, Banken und Regulierungsbehörden, um sicherzustellen, dass das Finanzökosystem in Liechtenstein robust, innovativ und für alle Beteiligten zugänglich bleibt (Bryan & Hovenkamp, 2020, S. 331-332).
5.4 Möglichkeiten des Einflusses von Start-ups
In der sich wandelnden Wirtschaftslandschaft Liechtensteins passen sich Start-ups an das bestehende Geschäftsumfeld an und haben einzigartige Möglichkeiten, dieses zu beeinflussen und zu gestalten. Diese Fähigkeit zur Einflussnahme, die in den Interviews und der Literaturanalyse immer wieder thematisiert wurde, unterstreicht die zentrale Rolle von Startups bei der Förderung von Innovation und politischer Entwicklung. Insbesondere Start-ups in den Bereichen FinTech und Blockchain in Liechtenstein haben massgeblich zu politischen und regulatorischen Diskussionen beigetragen (Linis & Praicheux, 2021, S. 6-10). Ihre innovativen Ansätze und technologischen Fortschritte haben zu einer Neubewertung der bestehenden regulatorischen Rahmenwerke geführt. Dynamische Start-ups fungieren oft als Katalysator für
politische Innovationen, insbesondere in Volkswirtschaften, die sich als Zentren des technologischen Fortschritts etablieren wollen.
Die geringe Grösse Liechtensteins erleichtert eine engere Interaktion zwischen Start-ups und Regierungs- oder Regulierungsbehörden. Diese Interaktionen bieten Start-ups eine Plattform, um ihre Bedürfnisse und Perspektiven zu äussern, was zu einer fundierteren und effektiveren Politikgestaltung führt. Solche gemeinsamen Bemühungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass sich das regulatorische Umfeld gleichzeitig mit der Technologie- und Marktentwicklung weiterentwickelt.
Über die Politik hinaus haben Start-ups in Liechtenstein das Potenzial, das breitere Unternehmensökosystem zu beeinflussen. Beispielsweise können die Start-up-Kultur und innovative Geschäftsmodelle traditionelle Unternehmen und Sektoren dazu inspirieren, neue Technologien und Ansätze zu übernehmen. Almansour (2023) unterstützte diese Ansicht, indem er darauf hinwies, dass Start-ups oft neue Paradigmen der Geschäftstätigkeit einführen, die einen Welleneffekt auf die gesamte Wirtschaftslandschaft haben können (S. 5).
Die Vernetzung und der Aufbau von Gemeinschaften sind Schlüsselbereiche, die Start-ups beeinflussen können. Durch die Gründung und Teilnahme an unternehmerischen Netzwerken und Veranstaltungen fördern Start-ups eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs, die für das kollektive Wachstum und den Erfolg des Unternehmensökosystems in Liechtenstein entscheidend sind. Start-ups in Liechtenstein sind nicht nur Teilnehmer am Geschäftsumfeld, sondern gestalten es aktiv mit. Ihr Einfluss reicht vom Vorantreiben politischer und regulatorischer Veränderungen bis hin zur Anregung von Veränderungen im breiteren Business-Ökosystem. Diese Rolle ist in Liechtenstein aufgrund der geringen Grösse des Landes besonders ausgeprägt, was eine direktere und wirkungsvollere Interaktion zwischen Start-ups, der Regierung und den Regulierungsbehörden ermöglicht.
Daher müssen politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer die einflussreiche Rolle von Start-ups anerkennen und unterstützen, um Liechtensteins Position als innovatives und zukunftsorientiertes Wirtschaftszentrum aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.
5.5 Widersprüche in den Wahrnehmungen
In der dynamischen und facettenreichen Welt der Start-ups und FinTech in Liechtenstein haben sich widersprüchliche Wahrnehmungen und Meinungen herausgebildet. Diese Widersprüche spiegeln die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven innerhalb des Ökosystems wider und verdeutlichen die Komplexität des Navigierens in einem sich schnell entwickelnden Geschäftsumfeld.
Ein wichtiger Bereich, in dem Widersprüche bestehen, ist die Wahrnehmung des regulatorischen Umfelds. Einerseits wird der fortschrittliche, unterstützende Charakter der liechtensteinischen Vorschriften gelobt, andererseits wird auf die Herausforderungen und Starrheit des Rahmens hingewiesen. Diese Divergenz könnte auf die unterschiedlichen Sektoren zurückzuführen sein, in denen die Beteiligten tätig sind, oder auf ihre individuellen Erfahrungen mit der Einhaltung von Vorschriften und Innovationen.
Im Zusammenhang mit dem Bankensektor waren die Widersprüche in den Wahrnehmungen besonders ausgeprägt. Während einige die Bemühungen des Bankensektors anerkennen, sich an neue Technologien und die Bedürfnisse von Start-ups anzupassen, betonen andere die konservative Herangehensweise des Sektors und die Zurückhaltung, die entstehende FinTechLandschaft vollständig zu übernehmen. Dieser Kontrast unterstreicht das Spannungsverhältnis zwischen traditionellen Finanzpraktiken und dem disruptiven Charakter von FinTechInnovationen.
Ein weiterer Bereich, in dem es unterschiedliche Auffassungen gab, war die Rolle der staatlichen Unterstützung und ihre Wirksamkeit bei der Förderung des Start-up-Ökosystems. Einerseits wird betont, dass staatliche Initiativen massgeblich zur Schaffung eines günstigen Umfelds für Start-ups beigetragen haben. Andererseits werden die Grenzen dieser Initiativen hervorgehoben, insbesondere die Diskrepanz zwischen politischen Absichten und der praktischen Realität, der sich Start-ups gegenübersehen.
Diese widersprüchlichen Wahrnehmungen der verschiedenen Stakeholder im liechtensteinischen Start-up-Ökosystem zeigen, dass es vielfältig ist und sich weiterentwickelt. Sie unterstreichen die Bedeutung eines kontinuierlichen Dialogs und Engagements zwischen allen Parteien, um diese unterschiedlichen Ansichten in Einklang zu bringen. Daher sind das Verständnis und die Auseinandersetzung mit diesen Widersprüchen für politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer entscheidend, um ein kohärenteres und unterstützendes Umfeld für Start-ups und FinTech-Unternehmen in Liechtenstein zu schaffen.
5.6 Liechtenstein spezifische Faktoren und besondere Herausforderungen Liechtensteins Start-up-Ökosystem zeichnet sich durch spezifische Faktoren und Herausforderungen aus, die untrennbar mit seinem geografischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Kontext verbunden sind. Die Marktdynamik in Liechtenstein, die durch die Kleinheit des Landes unterstrichen wird, bietet sowohl Vorteile als auch Herausforderungen. Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen (2023, S. 9-10) schlägt vor, dass kleinere Volkswirtschaften ein agileres und reaktionsfreudigeres Geschäftsumfeld fördern könnten, was durch Beobachtungen über die schnelle Erprobung und Einführung in Liechtenstein bestätigt wird. Die begrenzte Grösse des Inlandsmarkts stellt jedoch gemäss den Erkenntnissen aus der Literatur eine Herausforderung der Skalierbarkeit für Start-ups in kleineren Volkswirtschaften dar.
Das massgeschneiderte regulatorische Umfeld Liechtensteins für Sektoren wie Blockchain und FinTech spiegelt den globalen Trend zu spezialisierten Regelungen im Bereich der Finanztechnologie wider. Diese Vorschriften bieten zwar Chancen, erfordern aber auch, dass sich Start-ups an eine komplexe und sich entwickelnde Regulierungslandschaft anpassen, was die Herausforderungen widerspiegelt, die in der Literatur in ähnlichen Ländern festgestellt wurden.
Die Gewinnung und Bindung von Talenten in Liechtenstein ist ebenfalls eine besondere Herausforderung. Pustovhr et al. (2019) weisen darauf hin, dass kleinere Volkswirtschaften oft mit grösseren Nachbarländern um qualifizierte Fachkräfte konkurrieren, insbesondere in technologischen Nischenbereichen. In der Literatur wird betont, wie wichtig es ist, starke
Bildungs- und Ausbildungsprogramme einzurichten, um einen lokalen Talentpool aufzubauen (S. 762).
Obwohl Liechtenstein über eine gut entwickelte Infrastruktur und Unterstützungssysteme verfügt, wird festgestellt, dass eine gezieltere Unterstützung für Start-ups erforderlich ist. Klein et al. (2020) decken sich mit dieser Einschätzung und betonen, dass spezialisierte Finanz- und Beratungsdienste für Tech-Start-ups notwendig sind, um mit der raschen Entwicklung technologieorientierter Unternehmen Schritt zu halten (S. 38).
Das Start-up-Ökosystem in Liechtenstein zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus Chancen und Herausforderungen aus, die durch die Grösse des Landes, das spezielle regulatorische Umfeld, die Talentdynamik und die infrastrukturellen Anforderungen geprägt sind. Die Erkenntnisse von Linis & Praicheux (2021, S. 2-6) ergänzen und vertiefen das Verständnis dieser empirischen Ergebnisse und unterstreichen die Notwendigkeit nuancierter Strategien, die Liechtensteins besondere Vorteile nutzen und gleichzeitig seine Herausforderungen abmildern. Die Anerkennung dieser Faktoren ist für politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer von entscheidender Bedeutung, um ein unterstützendes und dynamisches Umfeld für Start-ups in Liechtenstein zu fördern.
5.7 Strategische Ausrichtung und internationaler Wettbewerb
Die strategische Ausrichtung Liechtensteins innerhalb des internationalen Start-upÖkosystems ist durch ein komplexes Zusammenspiel von inhärenten Vorteilen und der breiteren globalen Marktdynamik geprägt. Die strategischen Vorteile des wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds Liechtensteins fungieren als Sprungbrett für Start-ups, um sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Durch seine zentrale Lage in Europa bietet das Land eine vorteilhafte Plattform für Start-ups, um Zugang zu grösseren Märkten zu erhalten. Dies spiegelt sich in den allgemeineren Erkenntnissen über kleine Volkswirtschaften und deren Fähigkeit, schnell auf globale Trends zu reagieren wider und unterstreicht das Potenzial der liechtensteinischen Start-ups, ihre Reichweite über die Landesgrenzen hinaus auszudehnen.
Während sie von einem unterstützenden inländischen Umfeld profitieren, müssen sich Startups in Liechtenstein durch die Komplexität der internationalen Märkte navigieren. Dazu gehört auch die Anpassung an unterschiedliche Verbraucherpräferenzen, technologische Veränderungen und Wettbewerbslandschaften. Diese Navigation erfordert einen strategischen Ansatz, bei dem Innovation mit einem scharfen Bewusstsein für globale Trends kombiniert wird. Eine bedeutende Herausforderung für liechtensteinische Start-ups, insbesondere im FinTechSektor, ist die Navigation durch die unterschiedlichen regulatorischen Landschaften der einzelnen Länder. Das Verständnis und die Einhaltung internationaler Vorschriften sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils und stehen im Einklang mit der Literatur, die die Bedeutung der regulatorischen Agilität für Unternehmen betont, die in stark regulierten Bereichen tätig sind.
Der Aufbau strategischer Partnerschaften und globaler Netzwerke ist für Start-ups in Liechtenstein unerlässlich, um sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Diese Kooperationen verbessern den Marktzugang und erleichtern den Austausch von Wissen und
Ressourcen. Dieses Konzept wird von der Literatur unterstützt, die den Wert von grenzüberschreitenden Allianzen in der heutigen vernetzten Geschäftswelt hervorhebt.
Die strategische Ausrichtung Liechtensteins im internationalen Start-up-Ökosystem besteht darin, seine einzigartige Position zu nutzen und sich gleichzeitig aktiv mit den Herausforderungen und Chancen des globalen Marktes auseinanderzusetzen. Dabei gilt es, ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung lokaler Stärken und der Anpassung an internationale Marktanforderungen zu finden. Für die liechtensteinischen Start-ups hängt der Erfolg auf dem internationalen Parkett von ihrer Fähigkeit ab, agil, innovativ und global vernetzt zu sein, wie die Interviews und die Literatur zu globalen Wirtschaftstrends und -strategien unterstreichen.
5.8 Weitere Herausforderungen aufgrund der Grösse
Die geringe Grösse Liechtensteins bietet zwar gewisse Vorteile in Bezug auf Agilität und engmaschige Geschäftsnetzwerke, stellt Start-ups und FinTech-Unternehmen jedoch auch vor besondere Herausforderungen. Diese Herausforderungen wirken sich auf verschiedene Aspekte der Geschäftstätigkeit aus, vom Marktzugang bis zur Ressourcenzuweisung. Eine der grössten Herausforderungen ist der begrenzte Inlandsmarkt, der das Wachstumspotenzial für Start-ups im Land einschränkt. Diese Einschränkung macht es erforderlich, über die Landesgrenzen hinaus zu expandieren.
Eine weitere Herausforderung ist die Ressourcenknappheit, einschliesslich des Zugangs zu einem dringend benötigten Talentpool. Start-ups in Liechtenstein stehen im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, nicht nur vor Ort, sondern auch aus den Nachbarländern. In der Literatur über Start-up-Ökosysteme in kleinen Volkswirtschaften werden ähnliche Herausforderungen hervorgehoben und die Notwendigkeit strategischer Ansätze zur Talentgewinnung und -bindung betont (Hess, 2021, S. 202-207).
Die Skalierung der Geschäftstätigkeit auf einem kleinen Inlandsmarkt ist für Start-ups in Liechtenstein eine komplexe Aufgabe. Die Herausforderung besteht darin, auf einem begrenzten Markt zu skalieren und sich auf engem Raum einem verstärkten Wettbewerb zu stellen. Dieses Konzept stimmt mit der Literatur überein, die darauf hinweist, dass Start-ups in kleinen Volkswirtschaften oft einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt sind, was den Bedarf an Innovation und Differenzierung erhöht (Barboza & Capocchi, 2020, S. 2575-2577). Darüber hinaus kann das konzentrierte Geschäftsumfeld in Liechtenstein zwar Kooperationen fördern, aber auch zu einem begrenzten Kundenstamm und zu grossen Herausforderungen bei der Marktsättigung führen. Diese Situation erfordert von Start-ups ein hohes Mass an Innovation und eine deutliche Differenzierung, um Marktanteile zu erobern.
5.9 Lücken in der Infrastruktur und Unterstützung
Im sich entwickelnden Ökosystem von Start-ups und FinTech in Liechtenstein gibt es zwar zahlreiche Stärken, aber auch erkennbare Lücken in der Infrastruktur und den Unterstützungssystemen, die aufstrebende Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Diese Lücken haben das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung von Start-ups in der Region entscheidend beeinflusst. Besonders hervorgehoben wurde der Mangel an
spezialisierter Infrastruktur, die auf die besonderen Bedürfnisse von Start-ups und FinTechUnternehmen zugeschnitten ist. Dieser Mangel umfasst physische Ressourcen wie Arbeitsräume, technologische Ausrüstung und Zugang zu spezialisierten Dienstleistungen, einschliesslich Rechtsberatung, finanzieller Unterstützung und Marketing. Sipola et al. (2016) betonen die Bedeutung einer solchen spezialisierten Infrastruktur für die effiziente Entwicklung und Skalierung von Start-ups (S. 180).
Trotz grundlegender Unterstützungsstrukturen gibt es Lücken in den gründungsspezifischen Unterstützungssystemen, die sich auf die Verfügbarkeit von gezielten Beratungsdiensten, Mentorenprogrammen und Vernetzungsmöglichkeiten auswirken, die entscheidend für das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung von Start-ups sind. Die Bedeutung effektiver Unterstützungssysteme und -netzwerke wird in der Literatur hervorgehoben und ihre entscheidende Rolle für den Erfolg von Start-ups in verschiedenen wirtschaftlichen Umfeldern betont (Hess, 2017, S. 62).
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die technologische Infrastruktur, insbesondere digitale Dienste und Internetzugang. Obwohl Liechtenstein in einigen Bereichen gut aufgestellt ist, besteht noch Raum für Verbesserungen, insbesondere bei der Bereitstellung fortschrittlicher digitaler Dienstleistungen für Start-ups. Die Literatur unterstreicht, dass eine robuste technologische Infrastruktur für Start-ups in Hightech-Branchen wie FinTech essenziell ist. Um seine Position als attraktiver Hub für Start-ups und FinTech-Unternehmen zu stärken, muss Liechtenstein spezifische Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur und des Unterstützungssystems angehen, spezialisierte Infrastrukturen ausbauen, gezielte Unterstützungsprogramme verbessern und technologische Dienstleistungen stärken. Ein proaktiver Ansatz zur Überbrückung dieser Lücken kann die Entwicklung bestehender Start-ups unterstützen und die Attraktivität des Standorts für zukünftige Unternehmer erhöhen.
5.10 Nutzung des Rechtsrahmens und spezialisierter Dienstleistungen
Die Erkenntnisse aus den Experteninterviews, kombiniert mit der Literatur, zeichnen ein Bild davon, wie wichtig die effektive Nutzung des rechtlichen Rahmens und spezialisierter Dienstleistungen für den regionalen Geschäftserfolg ist. Eine der Hauptstärken des liechtensteinischen Start-up-Ökosystems ist der solide Rechtsrahmen, der besonders für FinTech- und Blockchain-Unternehmen vorteilhaft ist. Dieser Rahmen sorgt für Rechtsklarheit und fördert das Gefühl der Sicherheit für Investoren und Unternehmer. Die Literatur untermauert diese Ansicht und weist darauf hin, dass eine klar definierte Rechtsstruktur entscheidend für die Schaffung eines förderlichen Umfelds für technologische Innovationen und Unternehmenswachstum ist (Hess, 2021, S. 16-19).
Die Einhaltung von Vorschriften ist ein wichtiger Aspekt des Rechtsrahmens in Liechtenstein. Start-ups, insbesondere im FinTech-Sektor, profitieren davon, diese Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, die oft als Massstab für Best Practices in der Branche gelten. Van Winden und Carvalho (2019) bekräftigen die Bedeutung der regulatorischen Compliance und weisen darauf hin, dass sie ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung der Unternehmensintegrität und den Aufbau von Vertrauen bei den Stakeholdern ist (S. 4).
Der liechtensteinische Dienstleistungssektor, reich an spezialisierten Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten sind, spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem. Der Zugang zu diesen Dienstleistungen, die von der Rechtsberatung bis zur finanziellen und technologischen Unterstützung reichen, ist entscheidend.
Der kollaborative Charakter des liechtensteinischen Geschäftsumfelds erleichtert Partnerschaften zwischen Start-ups und Dienstleistern. Diese Kooperationen sind für Start-ups unerlässlich, um die verfügbaren Dienstleistungen effektiv zu nutzen und sich in der Komplexität des Marktes zurechtzufinden. Ankenbrand et al. (2016) unterstützen diesen Ansatz und weisen darauf hin, dass Kooperationen die Ressourcennutzung und die Innovationskapazität verbessern können (S. 5). Die Kombination dieser Elemente schafft ein unterstützendes Ökosystem, das es Start-ups ermöglicht, zu gedeihen, innovativ zu sein und im lokalen und globalen Wettbewerb zu bestehen.
6 Ergebnisse Umfrage
Die Umfrage wurde auf Basis der Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Hintergrundanalyse und der Experteninterviews erstellt. Dabei haben sich folgende Kernthemen herauskristallisiert:
1. Unternehmensfreundlichkeit der öffentlichen Verwaltung
2. Aspekte um die Gründung von Unternehmen
3. Regulatorische Rahmenbedingungen
4. Rechtliche und steuerliche Aspekte
5. Förderung von Investitionen
6. Liechtensteinische Infrastruktur und Netzwerkmöglichkeiten
7. Attraktivität des Standorts Liechtenstein für Arbeitskräfte
8. Standortattraktivität im Vergleich
9. Internationale Zusammenarbeit und Vernetzung
Ziel der Umfrage ist es, ein breites Meinungsbild aller Stakeholder in der Start-up- und FintechSzene in diesen Bereichen einzuholen. Die Umfrage war auf etwa 10-15 Minuten ausgelegt und bestand aus einem Mix von Single-Choice, Multiple-Choice und offenen Fragen.
Die erste Frage der Umfrage bat die Teilnehmer sich selbst zu klassifizieren. Es bestanden die Optionen «Gründer/Unternehmer», «Dienstleister für Start-ups und Fintechs» wie bspw. Banken, Unternehmensberater, Steuerberater, Rechtsberater etc., oder «Öffentliche Verwaltung mit Berührungspunkten mit Start-ups und FinTechs». Darüber hinaus gab es ein Freitextfeld, falls sich Teilnehmer keiner Kategorie zuordnen konnten oder ihre Position präzisieren wollten. Sofern Gründer/Unternehmer ausgewählt wurde, folgt die Frage, ob der Teilnehmer in der Finanzdienstleistungsindustrie tätig ist. Ziel dieser Einteilungsfragen war es, differenzierter evaluieren zu können, ob sich die Wahrnehmung von Problemfeldern zwischen den Gruppen unterscheiden
Im Folgenden werden die Detailergebnisse der Umfrage in neun Kategorien präsentiert. Die Interpretation der interessantesten Kernergebnisse erfolgt dabei jeweils zu Beginn einer Kategorie anhand einer übergreifenden Interpretation einerseits und der Beschreibung von Auffälligkeiten andererseits.
Die Fragestellungen wurden auf Basis der obenstehenden Methodik verfasst. Die Auswertung erfolgt dabei meist in drei Teilgruppen «Gründer/Unternehmer», «Dienstleister», «öffentliche Verwaltung» sowie gesamthaft unter «Alle». Manche Fragestellungen wurden nur Teilgruppen gestellt (wie beispielsweise nur an die Gründer «Welche Services haben Sie in Liechtenstein beim Gründen in Anspruch genommen?». Diese Fragen sind entsprechend gekennzeichnet.
Im Rahmen der Umfrage wurden 41 Fragebögen vollständig ausgefüllt und ausgewertet. Besonders auffällig war die geringe Antwortquote von Seiten der öffentlichen Verwaltung, die auch trotz mehrmaliger Ansprache leider nicht erhöht werden konnte. Zur Bewertung der empfundenen Standortattraktivität stellt diese Gruppe jedoch eine weniger wichtige Gruppe dar als die Gruppen Gründer und Dienstleister. Die Teilgruppenergebnisse sind daher aber mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
6.1 Unternehmensfreundlichkeit der Verwaltungen
Die empfundene Unternehmensfreundlichkeit der öffentlichen Verwaltungen ist ein wichtiger Faktor für die Standortattraktivität. Speziell in Liechtenstein werden kurze Wege und offene Türen oft als Standortvorteile genannt, die den Finanzplatz von anderen, insbesondere grösseren und unpersönlicheren, unterscheiden
Kernerkenntnisse
Die Umfrageteilnehmer stellen der Verwaltung prinzipiell ein positives Zeugnis aus. Die Detailanalyse zeigt jedoch auch auffällige Teilaspekte:
• Generell herrscht eine hohe Zufriedenheit. Eine signifikante Anzahl von negativen Beurteilungen erhielten aber
o das Amt für Informatik (von der öffentlichen Verwaltung), o das Amt für Personal und Organisation (von Gründern und Dienstleister),
o die Stabstelle Financial Intelligence Unit (FIU) (von öffentlicher Verwaltung) und o die Beratungs- und Beschwerdestelle (von Gründern)
• Die Verwaltung bewertet sich selbst recht negativ
Zusätzlich zur strukturierten Fragestellung stand ein Freitextfeld zur Verfügung, in dem positive und negative Erfahrungen angegeben werden konnten. Es gab keine systematischen Mehrfachnennungen.
Detailauswertungen
Frage: «Wie bewerten Sie die Unternehmensfreundlichkeit der Verwaltungen in Liechtenstein allgemein?»
Frage: «Mit welchen dieser Ämter und Stabsstellen der Liechtensteiner Landesverwaltung haben Sie bereits gearbeitet? Wie waren Ihre Erfahrungen?»
Alle Teilnehmer
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung
6.2 Unternehmensgründung
Der Prozess der Unternehmensgründung ist oft der erste intensive Kontaktpunkt von Gründern mit dem Wirtschaftsstandort. Für einen Wirtschaftsstandort, der für Gründer und Start-ups attraktiv sein möchte, ist es unerlässlich, einerseits klare, transparente und schnelle Prozesse für die Gründung zu implementieren, andererseits aber auch die Gründer auf die hohen Anforderungen vorzubereiten, die in manchen Bereichen des Gründungsprozesses auftreten können.
In dieser Fragenkategorie wird speziell die empfundene Attraktivität bei der Unternehmensgründung in Liechtenstein präsentiert. Die ersten zwei Fragen beschäftigen sich mit dem zeitlichen und finanziellen Aufwand, ein Unternehmen zu gründen. Diese richten sich ausschliesslich an Gründer und Dienstleister. Die dritte Frage beschäftigt sich damit, wie gut Gründer in Liechtenstein auf die liechtensteinischen Gegebenheiten vorbereitet sind. Diese Frage wird lediglich an Teilnehmende gestellt, die sich nicht in der ersten Frage als Gründer
oder Unternehmer klassifiziert haben. Die Adressatengruppe(n) sind entsprechend bei jeder Frage markiert.
Kernerkenntnisse
• Gründer sowie auch deren Dienstleister betonen die Schwierigkeiten bzw. den Aufwand in Liechtenstein ein Bankkonto zu eröffnen.
• Die kaum mögliche Wohnsitznahme wurde mehrfach explizit als Hinderungsgrund angegeben
• Gründer (zum grössten Teil) und Dienstleister empfinden den allgemeinen, den zeitlichen und den finanziellen Aufwand für Gründungen relativ angemessen.
• Die öffentliche Verwaltung empfindet die Gründer als relativ schlecht auf den Gründungsprozess vorbereitet, insbesondere im Hinblick auf die Regulatorik.
• Die Dienstleister zeichnen ein besseres Bild in Hinsicht auf die Vorbereitung der Gründer.
Detailauswertungen
Frage (nur an Gründer und Dienstleister): «Wie bewerten Sie den ...»
Gründer
Dienstleister
Frage (nur an Gründer und Dienstleister): «Wie bewerten Sie den ... in Liechtenstein ein Unternehmen zu gründen?»
Gründer & Dienstleister
Frage (nur an Dienstleister und Öffentliche Verwaltung): «Wie sind Gründer von Start-ups und Fintechs in Liechtenstein auf die Gegebenheiten in Liechtenstein in den folgenden Aspekten vorbereitet?»
6.3 Regulatorische Rahmenbedingungen
Der nächste Fragenblock beschäftigt sich mit den regulatorischen Rahmenbedingungen in Liechtenstein. Ziel ist es, zu evaluieren, wie der Regulator in Liechtenstein wahrgenommen wird und wie zufrieden die Teilnehmer mit dem Status Quo sind. Als letztes werden die Teilnehmer gefragt, wie ausbalanciert sie die regulatorischen Gegebenheiten zwischen Innovationsförderung und Risikomanagement bewerten.
Kernerkenntnisse
• Generell werden in dieser Kategorie viele kritische Bewertungen abgegeben.
• Eher auffällig ist, dass 56 % aller Teilnehmer keine oder wenig Zustimmung zur Aussage «Liechtenstein arbeitet aktiv daran, unnötige regulatorische Hürden abzubauen» geben Es gibt dabei kaum Unterschiede zwischen den Gruppen.
• Bei allen anderen Fragen zur Regulatorik berichten Gründer ein kritisches, aber dennoch nicht schlechtes Gesamtbild, Dienstleister ein eher positives Bild und die öffentliche Verwaltung ein sehr positives Bild.
• Auf die Frage, ob die Finanzmarktaufsicht eine aktive Rolle in der Vermarktung des Finanzplatzes einnehmen sollte, gab es recht verteilte Meinungen, mit einem leichten Hang zu «ja» bei den Gründern und Dienstleistern und einem starken Hang zu «nein» bei der öffentlichen Verwaltung.
• Es wurde ein klares, homogenes Bild berichtet, wonach die Finanzmarktaufsicht eher den Ansatz des Risikomanagements verfolgt und nicht den der Innovationsförderung
• Rund ein Fünftel der befragten Gründer ist mit den regulatorischen Rahmenbedingungen unzufrieden. Etwa doppelt so viele sind jedoch zufrieden. Bei den Dienstleistern und der öffentlichen Verwaltung zeigt sich ein noch leicht besseres Bild.
Detailauswertungen
Frage: «Wie bewerten Sie folgende Aussagen?»
Alle
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung
Frage: «Wie bewerten Sie die Balance der Finanzmarktaufsicht zwischen Risikomanagement und Innovationsförderung?»
Alle
Frage: «Wie zufrieden sind Sie mit den aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen für Startups und Fintechs in Liechtenstein?»
Alle
6.4 Rechtliche und Steuerliche Aspekte
In dieser Kategorie wurden Fragen zu steuerlichen und rechtlichen Aspekten gestellt. insbesondere wurde die Meinung zum TVTG, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Aufenthaltsrecht abgefragt. Auch über die verschiedenen Arten von Steuern wurden Bewertungen abgegeben.
In zwei Freifelder konnten auch noch besonders förderliche und besonders hinderliche Aspekte angegeben werden. Diese Felder wurden sehr stark genutzt. Mehrfache Nennungen (sinngemäss) werden in den Kernerkenntnissen zusammengefasst.
Kernerkenntnisse
• 44 % aller Teilnehmer empfinden das Aufenthaltsrecht als nicht zeitgemäss.
• Das Arbeitsrecht wird ebenfalls von rund einem Viertel der Teilnehmer kritisch gesehen, insbesondere bei den Gründern.
• Die Bewertungen zu den Steuern fallen generell positiv aus. Einzig die Höhe der Stempelabgaben (Emissionsabgaben) wird deutlich kritischer gesehen.
• Im Freifeld wurde mehrfach fördernd erwähnt: Guter Marktzugang zum EWR und der Schweiz, innovatives TVTG, guter und schneller Zugang zu Behörden sowie eine generell innovative Stimmung.
• Im Freifeld wurde mehrfach hinderlich erwähnt: Hohe Emissionsabgaben, lange Genehmigungsprozesse (insbesondere bei der FMA), stetig steigender Regulierungsdruck, Beibehaltung des TVTG trotz Einführung von MiCAR (doppelte Regulierungsauflagen) und eine zu langsame Umsetzung von MiCAR.
Detailauswertungen
Frage: «Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Liechtensteins Gesetzeslage zum
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung
Frage: «Wie bewerten Sie die ?»
Alle
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung
6.5 Förderungen von Investitionen
Die Verfügbarkeit von umfassenden Fördermöglichkeiten ist ein entscheidender Faktor für die Attraktivität eines Standorts für Start-ups und FinTech-Unternehmen. Solche Förderungen bieten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Zugang zu einem Netzwerk von Mentoren, Beratern und potenziellen Partnern, die entscheidend für das schnelle Wachstum und die Skalierung junger Unternehmen sein können. In einem hart umkämpften globalen Markt dienen attraktive Förderprogramme dazu, innovative Unternehmer und Talente anzuziehen, die nach einer dynamischen und unterstützenden Umgebung suchen, um ihre Ideen zu verwirklichen und zu vermarkten.
Darüber hinaus signalisieren solide Förderstrukturen das Engagement eines Standorts für technologische Innovationen und Unternehmertum, was sowohl die lokale Wirtschaft stärkt als auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Dieser Abschnitt zeigt, wie Liechtenstein bei der Bereitstellung zielgerichteter Fördermöglichkeiten und der Schaffung eines anregenden Umfelds zur Unterstützung von Start-ups und FinTechs wahrgenommen wird.
Kernerkenntnisse
• Generell zeigt sich eine geringe Zufriedenheit bei o der Verfügbarkeit von Förderprogrammen,
o den Möglichkeiten Investoren zu finden und
o den Massnahmen der Regierung, Start-ups zu fördern.
• Das Innosuisse Programm wurde nur von wenigen Personen bewertet und ist vielen nicht bekannt (22 von 39 Teilnehmern). Jene, die bewertet haben, zeichnen jedoch ein äusserst positives Bild.
• In einem Freifeld konnten noch zusätzliche wahrgenommene Fördermöglichkeiten angegeben werden. Genannt wurden hier mehrfach fintech.li, Business Angels Club und Impuls Liechtenstein. Alle jedoch nur von weniger als 10% der Teilnehmer.
Detailauswertungen
Frage: «Wie bewerten Sie, ...»
Gründer
Alle
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung
6.6 Liechtensteinische Infrastruktur und Netzwerk
Eine hochwertige Infrastruktur und ein robustes Netzwerk sind unerlässliche Säulen für die Attraktivität eines Standorts für Start-ups und FinTech-Unternehmen. Gute Infrastruktur, die von verlässlicher IT und Kommunikationstechnologie bis hin zu physischen Räumlichkeiten wie Coworking-Spaces und technologischen Hubs reicht, ist grundlegend, damit Unternehmen effizient operieren, innovieren und wachsen können. Sie erleichtert den täglichen Betrieb, unterstützt die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen und ermöglicht eine reibungslose Skalierung der Geschäftsaktivitäten.
Gleichzeitig spielt ein starkes Netzwerk eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Start-ups und FinTechs, indem es Zugang zu Wissen, Ressourcen und Kapital bietet. Netzwerke verbinden junge Unternehmen mit Investoren, erfahrenen Mentoren, Dienstleistern und anderen Start-ups, was den Austausch von Best Practices fördert und Synergien schafft. Ein dynamisches, interaktives Netzwerk kann die Geschäftsentwicklung beschleunigen und wesentlich zur Überwindung von Markteintrittsbarrieren beitragen.
Kernerkenntnisse
• Generell haben die Teilnehmer eine relativ gute Meinung über die Infrastruktur und Netzwerke.
• Die Hälfte der Gründer bemängelt jedoch mangelnde Netzwerkmöglichkeiten
• Gründer und Dienstleister wünschen sich auch eine stärkere Zusammenarbeit aller Stakeholder im Land
• Die öffentliche Verwaltung sieht Nachholbedarf bei der Digitalisierung
• Die vorhandenen Netzwerkmöglichkeiten wie das (Digital) Finance Forum, Investor Summit werden sehr positiv wahrgenommen.
• Im Freitextfeld wurden zusätzlich «digihub.li» (positiv), «digital-liechtenstein.li» (sehr positiv) und der «SFID-Blockchain & Innovation Circle» (sehr positiv) von mehreren Personen erwähnt
• Im Freitextfeld gab es viele Kommentare, dass es wenig Gemeinschaft und/oder Zusammenhalt zwischen den Projekten gibt. Ein neutraler «Hub» wäre vielfach wünschenswert, bei dem nicht in Liechtenstein Ansässige sich finden könnten.
• Jene Teilnehmer, die das Regierungslabor, den Innovationsclub, oder die Liechtenstein Venture Cooperative in Anspruch genommen haben, berichteten von sehr guten Erfahrungen
Detailauswertungen
Frage: «Wie bewerten Sie »
Alle
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltungen
Frage: «Welcher dieser Netzwerkmöglichkeiten / Konferenzen haben Sie besucht? Wie waren Ihre Erfahrungen?»
Alle
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung
Frage (nur Gründer): «Welche dieser Liechtensteinischen Angebote haben Sie genutzt? Wie waren Ihre Erfahrungen?»
6.7 Standort Liechtenstein für Arbeitskräfte
Für Arbeitskräfte in Start-ups und FinTech-Unternehmen ist es entscheidend, nicht nur über eine innovative und unterstützende Arbeitsumgebung zu verfügen, sondern auch in einer Region mit hoher Lebensqualität und vielfältigen beruflichen sowie persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu leben. Liechtenstein zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität, starke wirtschaftliche Stabilität und attraktive steuerliche Vorteile aus, was es zu einem begehrten Ziel für hochqualifizierte Fachkräfte aus der ganzen Welt macht.
In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, wie Liechtenstein Arbeitskräfte anzieht und hält, und welche spezifischen Aspekte des Standorts die Entscheidungen von Talenten beeinflussen, sich für oder gegen eine Karriere in Liechtenstein zu entscheiden. Dabei wird auch auf die Herausforderungen eingegangen, die sich aus der kleinen Grösse des Landes ergeben, insbesondere in Bezug auf die Verfügbarkeit von Karrierechancen und Weiterbildung, WorkLife-Balance und weiteren Faktoren. Diese Analyse bietet Einblicke in die Strategien, die Liechtenstein verfolgen könnte, um seine Attraktivität als Top-Arbeitsziel weiter zu steigern und ein nachhaltiges Wachstum seines Arbeitsmarktes zu sichern.
Kernerkenntnisse
• Nur 38 % der Teilnehmer würden Liechtenstein eine (sehr) positive Attraktivität für internationale Fachkräfte im Vergleich zu anderen Standorten bescheinigen
• Work-Life Balance, kulturelle Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten schnitten gut ab.
• Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte wird von allen Gruppen als problematisch angesehen
• Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Land werden als gut bewertet.
• Die Möglichkeit, Studierende anzuwerben, wird als ausreichend bewertet.
Detailauswertungen
Alle
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung
Frage: «Wie bewerten Sie die …»
Alle:
6.8 Standortattraktivität allgemein
In dieser Kategorie wird die allgemeine Wahrnehmung über die Standortattraktivität und deren Entwicklung abgefragt. Ein zweiter Aspekt ist der Vergleich der Attraktivität mit anderen Standorten sowie die Wahrnehmung, wie gut die Politik den Start-up- und FinTech-Sektor versteht.
Kernerkenntnisse
• Es gibt sehr gemischte Wahrnehmungen über die allgemeine Standortattraktivität und deren Entwicklung über die letzten fünf Jahre.
• Die Attraktivität als Start-up- und Fintech-Standort wird nicht als Konkurrenz zur Attraktivität für andere Unternehmen im Land gesehen.
• Nur ein Drittel der Gründer und 42 % der Dienstleister glaubt, dass die Regierung die Strukturen und Bedürfnisse der bestehenden Start-ups kennt.
• Die Kompaktheit des Standorts wird als positiv wahrgenommen.
Detailauswertungen
Frage: «Wie bewerten Sie die …?»
Alle
Frage: «Wie bewerten Sie folgende Aussagen?»
Alle
Gründer
Dienstleister
Öffentliche Verwaltung:
6.9 Förderung der internationalen Zusammenarbeit
In einer zunehmend vernetzten Weltwirtschaft ist die Förderung der internationalen Zusammenarbeit ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Start-ups und FinTechUnternehmen. Liechtenstein, mit seiner strategischen Lage in Europa und der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit den umliegenden Ländern, steht in einer einzigartigen Position, um von grenzüberschreitenden Kooperationen und Partnerschaften zu profitieren. Diese internationalen Verbindungen sind nicht nur für den Zugang zu neuen Märkten und Kapitalquellen entscheidend, sondern auch für den Austausch von Wissen, Technologie und Talenten. In diesem Abschnitt wird analysiert, wie die internationale Vernetzung Liechtensteins wahrgenommen wird.
Kernerkenntnisse
• Die internationale Vernetzung Liechtensteins über Europa hinaus wird jeweils zu einem Drittel als positiv, neutral oder negativ eingestuft.
• Mehr als die Hälfte der Gründer stellt der internationalen Vernetzung ein schlechtes Zeugnis aus.
• Leicht negativ wird die Lage der internationalen Vermarktung des Standorts gesehen.
• Die Vernetzung von Liechtenstein in Europa wird positiv bewertet.
• Die Massnahmen liechtensteinischer Stakeholder werden ebenfalls positiv bewertet.
Detailauswertungen
Frage: «Wie bewerten Sie die …?»
Alle:
Gründer:
Dienstleister:
Öffentliche Verwaltung:
7 SWOT-Analyse
Die SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ist ein oft verwendetes Instrument der strategischen Planung. Es ermöglicht Entscheidungsträgern, Stärken und Schwächen eines Wirtschaftszweigs zu bewerten sowie Chancen und Bedrohungen zu identifizieren. Für das Start-up-Ökosystem Liechtensteins liefert diese Analyse einen tiefgreifenden Einblick in die internen und externen Faktoren, die dessen Erfolg beeinflussen können. Durch das Verständnis dieser Schlüsseldimensionen, können Entscheidungsträger und Stakeholder fundierte Strategien entwickeln, um das Potenzial des Standorts voll auszuschöpfen und um Herausforderungen proaktiv zu begegnen.
In diesem Abschnitt präsentieren wir eine umfassende SWOT-Analyse des Start-up- und FinTech-Ökosystems in Liechtenstein. Wir betrachten die einzigartigen Stärken, die das Land seinen Unternehmen bietet, erkennen die Schwächen, die überwunden werden müssen, identifizieren die Chancen, die durch globale Trends und lokale Entwicklungen entstehen, und analysieren die Bedrohungen, die in einer sich schnell ändernden globalen und technologischen Landschaft auftreten. Diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es uns, praktische Empfehlungen auszusprechen, die dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft Liechtensteins zu stärken.
7.1
Stärken
Liechtenstein bietet ein dynamisches und vielversprechendes Umfeld für Start-ups und FinTech-Unternehmen, das durch seinen fortschrittlichen Regulierungsrahmen gestärkt wird. Das Rechtssystem des Landes ist nicht nur robust, sondern auch zukunftsorientiert und speziell auf neue Technologien und Finanzdienstleistungen ausgerichtet. Dies macht Liechtenstein zu einem idealen Zentrum für FinTech-Innovationen, wo fortschrittliche Gesetze das Wachstum und die Entwicklung neuer Finanztechnologien unterstützen. Ergänzt wird diese Rechtslandschaft durch einen hochspezialisierten Dienstleistungssektor. Diese Unternehmen konzentrieren sich hauptsächlich auf Finanzdienstleistungen und bieten massgeschneiderte Lösungen, die über die allgemeinen Geschäftsanforderungen hinausgehen und gewähren Startups Zugang zu erstklassigem Fachwissen und Support.
Neben einer starken Rechts- und Dienstleistungsbasis zeichnet sich Liechtenstein durch eine innovationsfreundliche Kultur aus. Diese Kultur wird sowohl von staatlichen als auch von privaten Akteuren aktiv gefördert und schafft so einen fruchtbaren Boden für unternehmerische Ideen und neue Unternehmen. Das Engagement des Landes für Innovation wird durch seine strategische geografische Lage noch verstärkt. Liechtenstein liegt im Herzen Europas, in unmittelbarer Nähe zu Wirtschaftszentren wie der Schweiz und Österreich und profitiert von erheblichen strategischen Vorteilen. Diese Position erleichtert den Marktzugang und die Bildung wertvoller Partnerschaften.
• Regulatorische Exzellenz: Liechtenstein bietet ein fortschrittliches regulatorisches Umfeld, insbesondere durch das TVTG-Gesetz, welches Blockchain-Technologien fördert. Dieses Umfeld schafft eine sichere Rechtsgrundlage und zieht damit Investoren und neue Unternehmungen an.
7.2
• Kurze Wege: Die geringe Grösse des Landes ermöglicht schnelle Entscheidungsprozesse und effiziente Verwaltung, was besonders in der schnelllebigen Start-up-Welt von Vorteil ist. Die Agilität in der Governance erleichtert die Anpassung an neue Wirtschaftstrends und technologische Entwicklungen.
• Starke bestehende Strukturen und Organisationen am Wirtschaftsstandort: Insbesondere der starke Bankensektor, spezialisierte Dienstleister im Rechts- und Steuerbereich sowie eine sehr praktisch orientierte Universität bilden ein starkes System an Partnern.
• Internationale Positionierung und Vernetzung: Die geografische Lage und die Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum bieten strategische Vorteile für die internationale Expansion und Zusammenarbeit.
Schwächen
In Liechtenstein stehen Start-ups und FinTech-Unternehmen vor einzigartigen Skalierbarkeitsherausforderungen, vor allem aufgrund des kleinen Inlandsmarktes des Landes. Dies erfordert oft die Erschliessung von Wachstumschancen über die Landesgrenzen hinaus, was sowohl eine Hürde als auch eine Chance für die Expansion sein kann. Die internationale Skalierung erfordert jedoch die Bewältigung unterschiedlicher Marktdynamiken, regulatorischer Umgebungen und Verbraucherpräferenzen, was für aufstrebende Unternehmen entmutigend sein kann.
Zu diesen Herausforderungen kommt noch die begrenzte Diversifizierung der Wirtschaft hinzu, die stark vom Finanzsektor abhängt. Dieser Fokus birgt insbesondere in Zeiten finanzieller Abschwünge gewisse Risiken, die direkte und erhebliche Auswirkungen auf das Start-upÖkosystem haben können. Eine solche wirtschaftliche Konzentration bedeutet, dass sich alle Turbulenzen im Finanzsektor auf die gesamte Start-up-Landschaft auswirken und sowohl etablierte Unternehmen als auch neue Unternehmen betreffen können.
Darüber hinaus stellt die Verfügbarkeit der Ressourcen innerhalb Liechtensteins eine weitere Herausforderung dar. Der begrenzte Pool an lokalen Talenten und technologischen Ressourcen kann die Entwicklung und das Wachstum von Start-ups behindern. Diese Position erleichtert den Marktzugang und die Bildung wertvoller Partnerschaften. Diese Knappheit zwingt Unternehmen oft dazu, sich ausserhalb des Landes um die nötige Fachkompetenz und Technologie zu kümmern, was die Komplexität und Kosten des Betriebs erhöht. Zudem wird Liechtenstein nur teilweise als attraktiver Arbeitsort wahrgenommen.
Schliesslich bringen die engen wirtschaftlichen Verbindungen Liechtensteins mit dem grösseren europäischen Raum, und seine Abhängigkeit von externen Märkten, ein Element der Verwundbarkeit mit sich. Politische Veränderungen in diesen Regionen können erhebliche Auswirkungen auf das lokale Ökosystem Liechtensteins haben. Wenn sich die Richtlinien weiterentwickeln, müssen sich Start-ups schnell anpassen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Dazu ist häufig ein flexibler und reaktionsfähiger Ansatz für die Geschäftsstrategie erforderlich. Diese Abhängigkeit von externen Märkten und Richtlinien unterstreicht die Notwendigkeit eines proaktiven und
anpassungsfähigen Geschäftsumfelds in Liechtenstein, das in der Lage ist, die Komplexität einer vernetzten Welt zu bewältigen.
• Limitierter Binnenmarkt: Die geringe Grösse des Landes beschränkt den Inlandsmarkt, was Start-ups dazu zwingt, von Beginn an internationale Expansionsstrategien zu entwickeln. Dies kann insbesondere für junge Unternehmen eine Herausforderung darstellen.
• Konservativer Finanzsektor: Traditionelle Finanzinstitutionen sind oft zögerlich, sich auf innovative Finanztechnologien einzulassen, was den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Start-ups erschwert und deren Wachstum limitieren kann.
• Fachkräftemangel: Der Wettbewerb um hochqualifiziertes Personal ist intensiv, besonders da benachbarte Länder wie die Schweiz und Österreich attraktive Alternativen für Talente darstellen. Ein besonderes Problem sind hier die Einschränkungen bei der Wohnsitzname.
• Grosse Abhängigkeiten vom Ausland: Insbesondere im rechtlichen Bereich durch die verpflichtende Übernahme europäischer Rechtsprechung aber auch durch finanzielle Risiken wie beispielsweise steigende Wechselkurse.
7.3
Gelegenheiten
Für Liechtenstein ergeben sich grosse Chancen aus dem immer noch schneller werdenden grossen Wandel in der Finanzwelt und ist bereit, vom globalen Trend zu digitalen Finanzdienstleistungen zu profitieren. Während sich das FinTech-Ökosystem weiterentwickelt, hat das Land die einzigartige Chance, in Bereichen wie Digital Banking, Blockchain und anderen aufstrebenden Technologien eine führende Rolle einzunehmen.
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhöht die Komplexität zusätzlich. Das Navigieren im komplexen Netz lokaler und internationaler Vorschriften, insbesondere im Finanzsektor, stellt für Start-ups eine erhebliche Belastung dar. Für diejenigen mit begrenzten Ressourcen kann dies eine entmutigende Aufgabe sein, die sowohl Zeit als auch Kapital verschlingt, die andernfalls für Wachstum und Innovation verwendet werden könnten. Mit einer klaren Regulatorik und deren mutiger, effizienter Umsetzung, könnte Liechtenstein ein weiteren grossen Attraktivitätssprung erreichen.
Dieser Wandel wird durch mögliche Kooperationen mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen noch verstärkt. Solche Partnerschaften könnten von entscheidender Bedeutung sein, um Innovation und Talententwicklung in Liechtenstein voranzutreiben. Durch die Nutzung der Ressourcen und des Fachwissens von Universitäten und Forschungszentren können Start-ups in Liechtenstein Zugang zu modernsten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erhalten und so ein Umfeld schaffen, in dem neue Ideen und Technologien gedeihen können.
Des Weiteren ist Liechtenstein einzigartig positioniert, um im aufstrebenden Bereich der nachhaltigen und ethischen Finanzierung führend zu sein. Mit einem wachsenden globalen Fokus auf Umwelt- und Sozialpolitik kann sich das Land diesen Trends anschliessen und einen Präzedenzfall für verantwortungsvolle Finanzpraktiken und nachhaltige Geschäftsmodelle schaffen.
Darüber hinaus stellt die strategische Lage Liechtensteins in Europa einen wesentlichen Vorteil dar. Durch die Nutzung seiner Position kann das Land als Tor für Start-ups und FinTechUnternehmen dienen und ihnen Zugang zum breiteren EU-Markt verschaffen. Dieser Zugang ist von unschätzbarem Wert, da er ein grösseres Publikum und mehr Möglichkeiten für Wachstum, Zusammenarbeit und Einfluss bietet. Wachsende globale Bedeutung von FinTech und Blockchain: Als anerkanntes Zentrum für Blockchain und FinTech könnte Liechtenstein durch gezielte Förderung dieser Sektoren seine globale Präsenz und Attraktivität steigern.
• Durch konsequente weitere Innovationen im regulatorischen Bereich kann Liechtenstein weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung neuer Geschäftsideen einnehmen.
• Die Zusammenarbeit mit den Nachbarmärkten (insbesondere dem EWR) stellte einen grossen Vorteil dar. Die Aufrechterhaltung und Vertiefung (z.B. Passporting) birgt grosse Gelegenheiten für Start-ups und FinTechs.
• Infrastrukturelle Investitionen: Gezielte Investitionen in die Infrastruktur, besonders in technologische und spezialisierte Dienstleistungen, könnten die Attraktivität Liechtensteins als Standort für Start-ups und FinTech-Unternehmen weiter erhöhen.
• Bildungs- und Forschungskooperationen: Die Entwicklung von Partnerschaften mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen kann zur Schaffung eines qualifizierten Talentpools beitragen und die Innovationskraft des Landes stärken.
• Liechtenstein könnte auch im Nachhaltigkeitsbereich eine starke Rolle einnehmen.
7.4 Bedrohungen
Das Start-up-Ökosystem Liechtensteins ist auch mit einigen Bedrohungen konfrontiert. Durch die erhöhte Abhängigkeit von internationalen Absatzmärkten bestehen höhere Risiken für Startups in Liechtenstein im Vergleich zu Start-ups aus grösseren Märkten.
Eine weitere drohende Herausforderung ist das rasante Tempo des technologischen Wandels, insbesondere im FinTech-Sektor. Da neue Technologien in rasantem Tempo auftauchen und sich weiterentwickeln, kann es für Start-ups schwierig sein, Schritt zu halten. Diese schnelllebige Landschaft stellt ein Risiko für diejenigen dar, die sich nicht schnell anpassen können, und führt möglicherweise dazu, dass Unternehmen ins Abseits gedrängt werden, die nicht mit dem Innovationstempo mithalten können.
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhöht die Komplexität zusätzlich. Liechtensteins Unternehmen müssen oft die Vorschriften mehrerer Länder beachten. Das Navigieren im komplexen Netz lokaler und internationaler Vorschriften, insbesondere im Finanzsektor, stellt für Start-ups eine erhebliche Belastung dar. Für diejenigen mit begrenzten Ressourcen kann dies eine entmutigende Aufgabe sein, die sowohl Zeit als auch Kapital verschlingt, die andernfalls für Wachstum und Innovation verwendet werden könnten.
Darüber hinaus verschärft der zunehmende globale Wettbewerb im FinTech-Bereich diese Herausforderungen. Da immer mehr Länder in die Entwicklung ihrer FinTech-Ökosysteme investieren, eskaliert der Wettbewerb um Investitionen, Talente und Marktanteile. Dieser globale Wettlauf übt Druck auf die Nischenposition Liechtensteins in der Branche aus und stellt
die Start-ups vor die Herausforderung, sich in einem immer dichter werdenden und wettbewerbsintensiveren Umfeld zu differenzieren und ihren Wettbewerbsvorteil zu behaupten.
Zu guter Letzt wird Liechtenstein für junge Arbeitnehmer der Generationen Y und Z seit einigen Jahren weniger attraktiv. Die veränderten Werte der jungen Arbeitnehmer stimmen immer weniger mit den aktuellen Regelungen im Aufenthaltsrecht und Arbeitsrecht überein.
Insbesondere die äusserst restriktive Regelung für die Wohnsitznahme bei gleichzeitiger limitierender Homeoffice-Regelung machen es immer schwieriger, junge Arbeitnehmer nach Liechtenstein zu locken.
• Internationale Konkurrenz: Das höhere Risiko aufgrund der höheren Abhängigkeiten von internationalen Märkten schwächt Unternehmen im Kampf mit internationalen Konkurrenten.
• Technologische Disruptionen: Rasante technologische Veränderungen könnten bestehende Geschäftsmodelle schnell obsolet machen und neue Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens stellen.
• Stark wachsende Regulierungsanforderungen: Seit einigen Jahren wachsen die Regulierungsanforderungen stetig. Liechtensteiner Unternehmen trifft dies besonders hart, da sie meist die Regulierungen mehrerer Länder beachten müssen.
• Start-ups und FinTechs werden in anderen Wirtschaftsräumen viel stärker direkt über Förderungen oder indirekt über Steuererleichterungen öffentlich gefördert. Diesen Wettbewerbsnachteil müssen die Unternehmen selbst ausgleichen.
• Fehlende Fachkräfte: Liechtenstein hat ein wachsendes Problem qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuziehen. Die Problematik zeigt sich verstärkt bei der Anwerbung der Generationen Y und Z.
8 Handlungsempfehlungen
In diesem Abschnitt formulieren wir Handlungsempfehlungen, die darauf abzielen, den Startup- und FinTech-Sektor in Liechtenstein zu stärken. Diese Vorschläge werden unabhängig von ihren potenziellen Auswirkungen auf andere politische, wirtschaftliche und soziale Bereiche in Liechtenstein betrachtet, ohne die Umsetzbarkeit oder die daraus resultierenden Konsequenzen zu bewerten.
8.1 Förderung der Arbeitsplatzattraktivität
• Anpassung des Aufenthaltsrechts: Das aktuell restriktive Aufenthaltsrecht stellt einen bedeutenden Standortnachteil dar. Start-ups benötigen häufig Arbeitskräfte mit internationalem Hintergrund, die in der regionalen Arbeitsmarktsituation nicht verfügbar sind. Diesen ist kaum zu vermitteln, warum sie in einem Land als Arbeitskräfte erwünscht sind, aber dort nicht leben dürfen. Eine Liberalisierung des Aufenthaltsrechts könnte jüngeren Generationen, die oft keinen PKW besitzen, entgegenkommen und kürzere Arbeitswege ermöglichen.
• Anpassung des Arbeitsrechts: Insbesondere eine Lockerung der HomeofficeRegelungen würde die Attraktivität des Standorts für flexible Arbeitsmodelle deutlich erhöhen.
• Bildungsinitiativen stärken: Durch Stärkung der Universität und anderer Bildungseinrichtungen können Fachkräften in den Bereichen Technologie und Unternehmertum gefördert werden. Dies könnte durch von der Regierung geförderte spezialisierte Studiengänge und Weiterbildungsprogramme geschehen.
8.2 Innovative Regulierung
• Transparente und schnelle Verfahren: Um die bereits bestehende Stärke der schnellen Entscheidungsfindung zu nutzen, muss die Effizienz der administrativen Prozesse, insbesondere bei der Genehmigung neuer Projekte und Unternehmensgründungen, verbessert werden.
• Balance zwischen Risikoaversion und Innovationsfreudigkeit: Derzeit scheint der Fokus stark auf Risikoaversion zu liegen, was innovationshemmend wirken kann. Ein Ausgleich hin zu mehr Innovationsfreudigkeit, abgestimmt unter allen Entscheidungsträgern, wäre förderlich.
• Anpassung der Regulierungen: Es ist entscheidend, dass die Politik flexible und fortschrittliche regulatorische Rahmenbedingungen bewahrt und weiterentwickelt, die nicht nur bestehende Technologien wie Blockchain unterstützen, sondern auch schnell auf neue technologische Entwicklungen reagieren können
8.3 Bessere Vorbereitung der Gründer
• Zentrale Informationsplattform: Die Einrichtung einer zentral verwalteten und gehosteten Plattform, die alle relevanten Unterlagen und Hilfestellungen für Start-ups und Gründer bereitstellt.
• Erweiterung des Angebots an Unterstützungsdiensten: Die Entwicklung von Programmen, die gezielte Unterstützung in Form von Rechtsberatung, Finanzierungshilfen und Marketing für Start-ups bieten.
• Einführung eines strukturierten Mentorenprogramms: Dies würde neuen Unternehmern helfen, von erfahrenen Führungskräften zu lernen und Netzwerke aufzubauen.
8.4 Stärkere finanzielle Unterstützung der Gründer
• Direkte Unterstützung: Start-ups und Gründer brauchen gerade zu Anfang finanzielle Unterstützung. Ein öffentlicher Fonds könnte sich mit Direktinvestitionen an Start-ups beteiligen und diese Anteile nach einer bestimmten Zeit wieder veräussern
• Ausweitung indirekter Förderprogramme: Programme wie Innosuisse sollten ausgebaut werden. Wichtig wäre hier aber auch eine deutlich verbesserte Vermarktung der Programme sowie eine stärkere Anpassung an die Bedürfnisse und Möglichkeiten von Start-ups (für diese ist aktuell Innosuisse nur eingeschränkt sinnvoll).
• Reduzierung oder Erlass von Gebühren: Die Senkung oder der Erlass von hohen Emissions- und Stempelgebühren für junge Start-ups könnte die Standortattraktivität erheblich erhöhen.
8.5 Netzwerke
• Einführung eines unabhängigen zentralen Hubs: Dieser Hub sollte den Dialog zwischen den Stakeholdern im Ökosystem intensivieren, regelmässige RoundtableDiskussionen und Workshops organisieren, eine bessere Koordination zwischen den Veranstaltungen sicherstellen, die Bewerbung der Events verbessern und einen unabhängigen Zugang für Investoren ermöglichen.
• Stärkung des Finanzsektors für Start-ups: Der Zugang zu Finanzierung ist für das Wachstum von Start-ups entscheidend. Es sollte eine Umgebung geschaffen werden, die Venture Capital und andere Investitionsformen anzieht, eventuell durch steuerliche Anreize oder Co-Investment-Fonds.
• Unterstützung der internationalen Expansion: Angesichts der geringen Grösse des Inlandsmarkts sollten politische Strategien darauf abzielen, liechtensteinischen Startups den Zugang zu internationalen Märkten zu erleichtern.
8.6 Infrastruktur
• Entwicklung spezialisierter Infrastruktur: Es sollten verstärkt Investitionen in technologische Parks oder Inkubatoren getätigt werden, die speziell auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten sind. Solche Einrichtungen bieten die notwendige Umgebung, um Innovation und Kollaboration zu fördern und junge Unternehmen in ihrer Entwicklungsphase effektiv zu unterstützen.
• Modernisierung des Finanzsektors: Der Finanzsektor muss konsequent an die Anforderungen moderner Start-ups angepasst werden. Dies umfasst nicht nur verbesserte Zugänge zu grundlegenden Bankdienstleistungen, sondern auch die Integration fortschrittlicher Finanztechnologien, die die besonderen Bedürfnisse dieser Unternehmen adressieren. Eine solche Modernisierung würde die Standortattraktivität erheblich steigern und Liechtenstein als fortschrittlichen Finanzstandort stärken.
Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, das Start-up- und FinTech-Ökosystem in Liechtenstein zukunftsfähig zu gestalten.