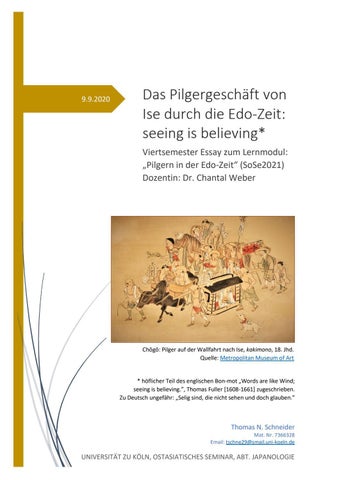18 minute read
Konstruierte Wirklichkeit: sankei mandala, Karten und Reiseführer
noch mehrmals bis zur Bestimmung von Kyôto 京都 in der Heian-Zeit 平安時代 [794-1185] wechseln. Der gekû als Schrein führt seine Geschichte auf das Jahr 478 zurück.
Eine naive Lesung der Gründungsmythe schließt einen ursprünglich natürlichen Offenbarungsund andere Verehrungsorte für Amaterasu nicht aus. Könnte Verehrung im stadtnahen gekû vor dem „1. Neubau“ des naikû begonnen haben? Vormachtstellung und Präzedenz von gekû und naikû beschäftigten auch den 3. shogûn Tokugawa Iemitsu [1604 – 1651]. 28 Die Affäre unterstrich Iemitsus Entschlossenheit, die Ise Priester zu korrigieren und Amaterasu dem „Drei Schreine“ Schema seiner göttlichen Legitimation einzufügen. Persönlich besuchte Iemitsu nur Nikkô, auf dessen Besuch durch kaiserliche und shogunale Emissäre er ebenfalls bestand. Ab 1640 wurde ein kôke 高家 (Intendant für zeremonielle Zwecke) in irregulären Abständen nach Ise gesandt. 1648 gestattete er dem tennô wieder, Emissäre zum kanname-sai 神 嘗 祭 (Erntedankfest) nach Ise zu senden. Damit war ein offizielles System etabliert, mit Nikkô und Ise als „Zwillingsorten“ und einer in der Person des Shogunes verkörperten „ewigen heiligen Autorität“, die keiner äußeren Legitimation des tennô mehr bedurfte.
Advertisement
Zeitgenössische Lagepläne und Karten des gekû und naikû sind interessant, da archäologische Ausgrabungen aufgrund der Vergänglichkeit von unbehandelten Holz-Stroh-Konstruktionen und dem stetigen Neubaurhythmus wenig aufschlussreich wären. Überlieferte Dokumente sind jedoch nicht repräsentativ und universal, können eine „konstruierte Wirklichkeit“ darstellen und aus moderner Perspektivemissverstanden werden. Ein Beispiel sind die Ise sankei mandala 参詣曼荼羅, die verschiedenen Interpretationen standhalten und deren Herkunft Rätsel aufwirft. 29 Augenscheinlich handelt es sich dabei um narrative Anleitungen: ausgelegt ähnlich wie eine Karte, werden neben den Sehenswürdigkeiten religiöse Praktiken, mythische Anspielungen, gelebte Traditionen und Verhaltensnormen gezeigt. Anders als eine Karte beschränkt sich das Layout nicht auf räumliche oder gar maßstäbliche Realität. Es wird vermutet, dass sankei mandala Wanderpredigern, kanjin hijiri 勧進聖, als Anschauungsmaterial für improvisierte erzählerische Darbietungen bzw. Bilderpredigten, etoki 絵 解 き, dienten. Format, Abnutzung- und Faltspuren deuten darauf hin, dass kanjin hijiri mit solchen kakemono 掛け物 (Hängerollen) als „Werbepromoter“ auf Reisen gingen. Die Produktion der sankei mandala wird aufgrund der Qualität der Malerei Stadtmalern zugeschrieben. Aufgrund des Inhalts sollen sie im Auftrag von buddhistischen Tempeln angefertigt worden sein.
28 Die Frage wurde von Ise Priestern zur Neujahraudienz 1636 in Edo aufgebracht und an das oberste Gericht geleitet. Der dem Kaiser verbundene kugyô 公卿 Nijô Yasumichi 二条 康道 [1607 – 1677] folgerte, der gekû müsse die Vormachtstellung behalten, da zwar beide Schreine den Titel Amaterasus trugen, der gekû aber den Vorfahren, der naikû den Eltern verbunden sei. Daher müsse die Präzedenz von Neujahrs-Opfergaben, erst am gekû und dann am naikû, beibehalten werden. Iemitsu zeigte sich mit dieser Folgerung unzufrieden. Sein Berater, der Gelehrte Razan Hayashi 林 羅山 [1583 – 1657] publizierte eine Zweitmeinung: bezüglich des gekû gäbe es verschiedene Gründungsmythen: Ninigi 瓊瓊, oder Kunitokotachi 国之常立, Mike-tsu-kami 三狐神 oder eben Toyo‘uke. Amaterasu sei nicht unter ihnen, ihr Name müsse daher mit dem naikû verbunden sein, der in allen Dingen, auch der Präsentation der Opfergaben, deshalb stets die Vormachtstellung genieße. 29 SCHNEIDER, Thomas: „Der Begriff des ie“. Seminararbeit der Japanologie, Universität zu Köln, 2020. Der zweite Teil des Essays beschäftigt sich mit der Problematik der Überlieferung von kulturellem Wissen und Methoden des inter-generationellen Wissenstransfers.
Die kanjin hijiri stellten sich auf ihr Publikum ein und vermittelten die Symbolik der Darstellungen anschaulich, aber auch selektiv. So konnte z.B. mit demselben Bildmaterial ein „Normalsterblicher“ seiner religiösen Pflichten gemahnt und an Verhaltensregeln erinnert,oder auf die zurückgezogene Kontemplation der Shinto Priester, frivoles Tanzen und Musizieren, und gieriges Einsammeln von Almosen hingewiesen werden. Vom kommerziellen Standpunkt bedeutet die Konzentration vieler Attraktionen auf einem Bild und an einem physischen Ort „etwas für jeden“. Auch wenn der einzelne nur einen Teil des Gesamtgeschäfts realisiert, profitieren im symbiotischen Verband alle, indem sie sich gegenseitig Kundschaft zuspielen. Ähnlich besteht ein gemeinsames Interesse zum Erhalt einer geteilten Infrastruktur (z.B. Straßen) und des virtuellen Kapitals (Branding, Reputation) der Stätte.
Die überlieferten Ise sankei mandala unterscheiden sich kaum im Layout - eine horizontal gespiegelte Darstellung von gekû (rechts) und naikû (links). Ein Unterscheidungsmerkmal sind die Platzierung von Sonne und Mond im oberen Teil der Darstellung: bei zwei der Mandalas findet sich die Sonne rechts (über dem gekû), bei zwei anderen links (über dem naikû). Es wird damit auf die beiden Welten des Ryôbu Shintô hingewiesen, die als Avatare von Dainichi Nyorai 大日如来 austauschbar wären. Auffällig ist neben den schintoistischen Heiligtümern die Darstellung buddhistischer Tempel: Segi-dera 世儀寺, Kaze no miya 風の宮, Keikôin 慶 光院, Kongôshô-ji 金剛證寺. Die Juxtaposition von Schreinen, Tempeln und Schauplätzen in der Natur zeigt eine gemischte Glaubenswirklichkeit. Unter den Pilgern erkennt man zwei Klassen: im roten Mantel und teilweise zu Ross, und in schlichten Kleidern zu Fuß. Knecht identifiziert letztere anhand ihrer roten Kappe, dem tokin 頭襟, und ihrem karierten Umhang als yamabushi 山伏. 30 Eine klare Hierarchie herrscht bei den Shintô Priestern: in den inneren Heiligtümern des gekû wie auch des naikû tragen die negi 禰宜 (hohen Priester des Shintos) ausschließlich schwarze Gewänder, im öffentlichen Raum sehen wir onshi in weißer Kleidung.
Die sankei mandala vermitteln einen Eindruck der Pilgerstätten und ihrer Nutzung vor und um den Zeitpunkt der Umdeutung Ises als exklusive Stätte des Shingon-Shintô und seiner „Bereinigung“ vom Buddhismus. 1643 gab es noch 57 buddhistische Tempel in Uji und bis 1670 weitere 227 in Yamada.31 1675 entzog das bakufu Buddhisten in Uji-Yamada das Recht, als oshi tätig zu sein. Die Nonnen des Keikôin 慶光院 waren ein Sonderfall: Tokugawa Ieyasu hatte ihnen, angesichts ihrer vormaligen Rolle als Spendeneintreiber des sengû, spezielle Privilegien gewährt. Sankei mandala verschwanden Mitte des 17. Jhd. mit den kanjin hijiri, denen keine tegata für die Straßen mehr gewährt wurde.
Wie also sah der „ideale“ Pilgerbesuch, dem sankei mandala zufolge, zu Beginn der Edo Zeit aus? Man beginnt am unteren rechten Bildrand mit der Überquerung des Miya Flusses über eine (temporäre? 32) Brücke. Nach dem misogi 禊 (Reinigungsritual) betritt man die betriebsame Stadt Yamada durch ein hölzernes Tor und läuft geradewegs der datsueba 奪衣婆 („die
30 KNECHT, Peter: “Ise sankei mandara and the Image of the Pure Land”. S. 228. 31 In dem Jahr wurden, mit weiten Teilen der Stadt, 189 Tempel von einem Großbrand zerstört. 47 wurden nicht wiederaufgebaut. Die Schreine der Stadt überlebten fast unversehrt. 32 Eine Brücke über den Miya wird in den Abbildungen der späteren Edo Zeit nicht gezeigt. Möglicherweise wurde sie nur temporär zu speziellen zeremoniellen Zwecken, wie dem sengû, errichtet. 9
Kleider abreißende Alte“) entgegen.
33 Der Sei-gawa 清川 teilt die Stadt in einen reinen und einen unreinen Bereich. Nach der Sujikai 筋向 Brücke ist zur rechten der Segi-dera, ein dem Shugendô 修 験 道 assoziierter Tempel und der vermutliche Auftraggeber für zwei der Ise Mandalas zu sehen. Mit dem Überschreiten des Toyo-gawa 豊川 gelangt man zum torii 鳥居 des gekû. Zur Rechten findet sich der korakan 子 良 館 , wo junge Mädchen adeliger Abstammung Dienst leisten. Vor den Zäunen des gekû halten Pilger verschiedener Klassen Andacht, der innere Hof ist den hohen Priestern, negi 禰宜, vorbehalten. In der oberen rechten Ecke des Mandalas, vor der ama no iwato 天の岩戸 („Felstür von Amaterasu“) am Takakura-yama 高 倉山, tanzt eine miko mai 巫女 (Schrein-Jungfrau) zu musikalischer Begleitung. Diese kagura geht auf eine Legende zurück: die Sonnengöttin, vom unzüchtigen Treiben ihres Bruders Susanô スサノヲ angewidert, zog sich in eine Höhle zurück und verschlug damit die Welt in Finsternis. Nur das freudige Feiern der Götter vor ihrem Versteck und die Behauptung, es sei ein noch größerer Gott erschienen, lockten sie heraus und retteten der Welt das Licht. Bei dieser List wurde Amaterasu der sagenhafte Spiegel yata-nokagami 八咫の鏡 vorgehalten, eines der drei kaiserlichen Insignien, und die Höhle mit einem shimenawa 注 連 縄 (Götterseil) verschlossen. Die besagte Höhle, möglicherweise einstige Meditationsstätte oder ein kôfun 古墳 („altes Grab“), können besichtigt werden. Der mittlere Teil des Mandalas zeigt den Abstieg durch Okamoto 岡本, berühmt für Kämme.34 Über die Oda 小田 Brücke geht es nach Ai no Yama 間の山, am Keikôin vorbei und zum Dorf Uji 宇治. Die Pilger überqueren die Uji Brücke mit Münzwürfen in den Isuzu – Almosen, die eifrig aufgesammelt werden. Bergauf, am korakan vorbei, findet sich der naikû, der an dieser Stelle als Spiegelbild des gekû nicht weiter beschrieben wird. Eine Brücke führt zum Kaze no miya 風の宮. 35 Über einen Bergpfad gelangt der (männliche) Pilger zum Kongôshô-ji, einem buddhistischen Tempel nahe dem Gipfel des Asama 朝熊 (555 m), dem höchsten Punkt der Halbinsel.36 Im oberen linken Bildteil sind die futami-ga-ura 二見が浦 Felsen, am Horizont der Fuji 富 士 (3776 m) sichtbar. An klaren Tagen kann man, je nach Blickrichtung, von Aussichtspunkten die umliegende See und den höchsten und heiligsten Berg Japans, den Fuji, erspähen. Nach Osten erstreckt sich der Pazifik.
Dieselben Orte waren auch in der späten Edo Zeit beliebte Ausflugsziele: Utagawa Hiroshige 歌川広重 [1797-1858] zeigt, über Teehausdächer und Hügel hinweg, eine Aussicht auf den Meereszugang der Ise Bucht in seinem, die Ise Provinz repräsentierenden, farbigen Holzschnitt von 1853 aus der Serie der 60+ Provinzen des Landes. Die durch shimenawa verbundenen futami-ga-ura Felsen werden auf anderen ukiyoe 浮世絵 im Anblick der aufgehenden Sonne
33 Volkstümlicher Überlieferung gemäß wartet die Datsueba am Grenzfluss zum Jenseits, dem mythischen Sanzu-gawa 三途川, auf die Verstorbenen. Tatsächlich wurden die zahlenden Pilger einer kô am Eingang der Stadt von Gesandten des onshi empfangen und zu dem Haus ihres onshi begleitet. 34 Yamato-hime no Mikoto verlor, der Legende nach, ihren Kamm auf der Suche nach dem geeignetem Verehrungsort für Amaterasu im Kushida 櫛田 Fluss, auf dem Weg nach Ise. 35 Hier sollen Gebete zur Bewahrung Nippons vor den Mongolenangriffen [1274, 1281] entrichtet worden sein. 36 Eine Redewendung (Werbeslogan?) der Edo-Zeit: 「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参り」 („Pilgerst Du nach Ise, besteige den Asama! Wer nicht den Asama besteigt, betet einseitig.”) Gemäß der Volkstradition des takemairi 岳参り steigen die Seelen der Toten in die Berge. Im Tempelhof des Kongôshô-ji findet man viereckige hölzerne Balken, tôba kûyo 塔婆供養, die zum Andenken an verstorbene Familienmitglieder aufgestellt werden.
gezeigt. Auf wieder anderen Darstellungen vom Strand vor den Felsen sieht man Kurtisanen in prunkvollen Kimonos und weibliche Pilger mit Sonnenschirmen. Ein späterer Holzschnitt [1857] aus der bakumatsu Zeit zeigt den sagenhaften Genji 源氏37, für den ama 海女 („Meeresfrauen“) nach Abalonen bzw. Perlmuscheln tauchen. 38 Diese Holzschnitte sind als Souvenirs zu verstehenund wurden –wie heute Postkarten –massenhaft vervielfältigtund für denprivaten Konsum verkauft. Sie haben mit religiösen sankei mandala, abgesehen von ihrem Werbecharakter und dass es sich auch hier um „konstruierte Realität“ handelt, wenig gemein.
Auf die Bedeutung von Informationstransparenz und das Problem von Informationsasymmetrien bei der Funktion des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, wie in Porters Modell beschrieben, ist schon hingewiesen worden. Für die Planung einer Wallfahrt ist der unabhängige Zugriff auf akkurate Information ein Paradigmenwechsel. Zusammen mit der Monetarisierung der Gesellschaft veränderten das Verlags- und Druckwesen in Edo und Ôsaka im Laufe des 18. Jhd. die Marktdynamik grundlegend im Interesse der einzelnen Kunden, danna, und zum Nachteil der Anbieter, onshi. Für Konsumenten tritt die langjährige Beziehung in den Hintergrund zum Preisvergleich einmaliger Leistungen. Individuelle Pilger können die Reiseplanung mithilfe von Karten und Reiseführern selbst in die Hand nehmen und die Angebote vieler Anbieter im Voraus vergleichen. Für die kô und die danna mawari bedeutete dies, dass sie ihre Schlüsselrolle in der Vertretung eines bestimmten Wallfahrtsorts zunehmend verloren. Die Kernkompetenz der kô verschob sich auf die Finanzierung der Reisen ihrer Mitgliedern zu verschiedenen Destinationen, ähnlich einem Reisebüro. An dieser Stelle soll exemplarisch Ursprung, Inhalt und Genauigkeit von Reisekarten und Reiseführern durch die Edo Zeit verfolgt werden.39 Zunächst werden die Anreisemöglichkeiten beschrieben. Yamada wird vom Tôkaidô 東海道 über den Ise-kaidô 伊勢街道 erreicht. Dieser zweigt in Yokkaichi 四日市 vom Tôkaidô ab, einige Kilometer nach der auf Reisen auf dem Landweg von Edo nach Kyôto üblichen abkürzenden Schiffsüberfahrt von Miya 宮 nach Kuwana 桑名, dem Shichi-ri no watashi 七里の渡し („Überfahrt von 7 ri“ Entfernung, ca. 28 km).Von Kyôto kommend, bietet der Ise-betsu-kaidô 伊勢別街道 ab Seki 関 eine Abkürzung mit Umgehung der Burgfestung Kameyama 亀山. Ise-kaidô und Ise-betsu-kaidô vereinigen sich hinter der Stadt Tsu 津 an der Ise Bucht und führen dann, der Küste entlang, über Matsusaka 松阪 zur Flussüberquerung des Miya vor Yamada. Direkter kann man von Ôsaka 大阪 oder Nara 奈良 unter Umgehung der shôgunalen Heerstraßen über die dazwischenliegenden Berge nach Yamada gelangen. Es lassen sich eine Reihe von Rundreisen konzipieren, z.B. unter Einschluss des Saikoku sanjûsan kasho 西国三十三箇所 („33 Tempel des westlichen Lands“) Pilgerwegs.
37 Hauptprotagonist des Genji Monogatari 源氏物語 („Die Geschichte vom Prinzen Genji“) der Hofdame Murasaki Shikibu 紫式部 [990–1010]. Spätgeborener Sohn eines alternden tennô, in die Familie der Minamoto (alias Genji) ausgegliedert, muss nicht arbeiten und verbringt seine Zeit mit den schönen Künsten. 38 Tatsächlich etablierte Mikimoto Kôkichi 御木本 幸吉 (1858 – 1954) in der Meiji Zeit erfolgreich die künstliche Perlenzucht im nahegelegenen Toba. 39 Dieser theoretische Ansatz stützt sich auf die These: „Maps are never value-free images… Both in the selectivity of their content and in their signs and styles of representation maps are a way of conceiving, articulating and structuring the human world which is biased towards, promoted by, and exerts influence upon particular sets of social relations.“ (HARLEY, J. B.: The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2002.) 11
Käuflich erwerbliche gedruckte Karten der Provinzen aus dem 18. und 19. Jhd. gehen auf die Katastererhebungen des bakufu zurück. In der Edo Zeit wäre es undenkbar, privat Land (oder Meer) zu vermessen und womöglich Informationen zu verbreiten, die nicht der Zensur des bakufu genügten. Die Abstammung ist z.B. aus einem Vergleich der schwarz-weiß gedruckten saiken Ise no kuni ezu 細見伊勢國絵図 (Detaillierte Karte der Provinz Ise) des Jahres 1830 und der handgemalten Version von 1702 ersichtlich. Ihrem ursprünglichen Zweck geschuldet, waren diese Karten nicht besonders maßstabsgetreu, zeigten aber die Eigentums- bzw. Dorfbezeichnungen als Kartuschen, Städte als Quadrate bzw. im Umriss, Verbindungswege, Wasserläufe und den ungefähren Küstenverlauf. Markante landschaftliche Orientierungsmerkmale – wie Berge und Wälder – wurden auf „unproduktiven“ bzw. leeren Flächen angedeutet. Für Uji-Yamada sind auf der Karte von 1702 Stadtteile, machi 町, explizit ausgewiesen, was auf den besonderen Status der Stadt hindeutet. Trotz des „detaillierten“ Anspruchs des Kartentitels von 1830 müssen lokale Karten zu Rate gezogen werden, um die Gemarkung bewirtschafteter oder bebauter Grundstücke und Wegverläufe zu erfahren. Tôkaidô bungen no zu 東海道分間之図 () [1690] („Karte des vermessenen Tôkaidô“) von Hishikawa Moronobu 菱 川 師 宣 [1618-1694] wurde als monochromer Holzschnitt im gefalteten Akkordeon Format verlegt. Der Tôkaidô wird im Maßstab 1 bu : 1 cho (= 1 : 36 000) detailliert aus einer Art Vogelperspektive dargestellt, die den Höhenverlauf erahnen lässt. Die gedruckte Auflage von 1752 enthält in der Einleitung eine Gezeiten- und Entfernungstabelle, im Anhang Transportkosten und Kontaktdaten für Agenten. Anschaulich werden die Attraktionen links und rechts des Weges-Brücken, Kreuzungen, jedes Haususw.-gezeigt. Die Straße ist mit Reisenden ausgeschmückt, z.B. die Prozession eines daimyo zwischen der Abzweigung des Ise-betsu-kaidô bei Seki (Station #47) und der Stadt/Burg Kameyama (Station #46). Die Ausrichtung der Straße nach Himmelsrichtung ist periodisch vermerkt und kann vom Sonnenstand bestimmt werden. Diese Form der Darstellung war praktisch für Reisende, die zügig und informiert auf dem Tôkaidô vorankommen wollten und nicht die Absicht hatten, weit des Weges abzukommen. Der Planung von Rundreisen dienten Übersichtskarten, die das Wegenetz zweidimensional mit Verzicht auf Höhenangaben abbildeten. Die Namen der Stationen (Dörfer, Städte) sind gekennzeichnet, ungefähre Entfernungen zwischen den Knoten in ri markiert, zu überquerende größere Wasserläufe und markante landschaftliche Orientierungsmerkmale, wie Berge, angedeutet. Provinzen werden benannt, genaue Grenzen aber nicht verzeichnet. Interessant auf einer dieser Karten, Saikoku sanjûsan kasho hôgaku ezu 西国三十三箇所方角絵図 („Pilgerkarte der 33 Tempel von Saikoku“) [1759], ist die Omission der Burg Kameyama auf dem Tôkaidô, von deren Besuch Pilger wohl wenig zu erwarten bzw. dort nichts zu suchen hatten. Im Laufe der Zeit und mit neueren Auflagen ist eine kontinuierliche Verbesserung in Qualität und Auflösung festzustellen, z.B. die 1800 Edition derselben Karte. Eine umfangreiche spätere Karte, DaiNihon saiken dôchû zukan 大日本細道中図鑑 („Detaillierte Wegekarte Großjapans“) [1850], bietet den Landesüberblick in Farbe - ohne Omission von Kameyama.
Einen Eindruck der politischen Aufteilung des Landes und des technischen Stands der Kartographie im 17. Jhd. lässt sich aus der handkolorierten Karte Fusôkoku no zu 扶桑国之図 [1666] („Karte von Japan“) von Nakabayashi Kichibei 中林 吉兵衛 gewinnen. Teile der Provinz Ise
sind „verrutscht”, Uji-Yamada und die Ise-jingû fehlen. Hokusai Katsushika 北 斎 葛 飾 entwickelte im frühen 19. Jhd. Landesübersichten aus der Vogelperspektive die z.B. den gesamten Tôkaidô zeigten. Hierfür wurden die räumlichen Verhältnisse kreativ den Papierdimensionen angepasst. In ähnlicher Darstellung erfreuten sich „virtuelle Reisen“ in der bakumatsu Zeit Beliebtheit. So kann der Ise-kaidô mit dem Brettspiel sangû jôkyô dôchû ichiran sugoroku 参宮上京道中一覧双六 [1856] bereist werden: Von Edo kommend, mag der Spieler am Ziel Ise oder Kyôto enden, über den Ise-betsu-kaidô ist ein Wegwechsel möglich. Trotz der ungewöhnlichen Perspektiven ist der Fortschritt im geografischen Verständnis, verglichen mit der Landeskarte von 1666, klar ersichtlich.
Dass akkurate Küstenvermessung in der bakumatsu Zeit [1853-1868] innerhalb der technischen Möglichkeiten des bakufu lag, belegt eine Seekarte der Provinz Ise von 1863, seikei ichiran 勢 海一覧. Bekanntlich kam der Schifffahrt - trotz der strategischen Lage von Ise – in der EdoZeit kaum Bedeutung zu. Abgesehen vom Umriss der Stadt Uji-Yamada mit den Ise Schreinen werden auf dieser Karte keine Orte im Landesinneren ausgewiesen. Magnetisch Nord und geografische Nordrichtung werden unterschieden, aber es fehlen Peilziele (wie z.B. der Gipfel des Asama), Lotmessungen und Warnungen (z.B. Bojen bei Untiefen, Leuchtfeuer bei Felsen). Die Schattierung des Wasserbereichs mag als grobe Andeutung der Wassertiefe zu verstehen sein.
Einfach, handlich und für begleitete Pilgerfahrten zu Land ein völlig ausreichendes Aidememoire und Souvenir zugleich waren Karten, die auf Geografie weitgehend verzichteten. In dem Beispiel einer Ôsaka Ise-kô wurden schematisch bzw. fahrplanmäßig nur die Namen der Stationen, Entfernungen und Sehenswürdigkeiten ausgewiesen.
Für die individuelle Wallfahrt nach Ise in der späteren Edo-Zeit konnten reich bebilderte gedruckte Reiseführer herangezogen werden. Diese erfreuten sich großer Popularität, wie die zahlreichen Neuauflagen belegen. Bemerkenswert ist vor allem der Ise sangû meisho zue 伊勢 参宮名所図絵 („Bebilderter Reiseführer für die Pilgerfahrt nach Ise“) von Shitomi Kangetsu 蔀関月 [1747-1797] in acht Bänden, der zuerst 1797 in Ôsaka verlegt wurde. Das individuelle Auge und die selbstgewählten Perspektiven des Autors bedeuten, dass viele Details mit Witz dokumentiert oder - in der Omission z.B. durch Wolken – explizit als vorenthalten gekennzeichnet wurden.
Aus dem Bildmaterial ist ersichtlich, dass der Ise-kaidô spätestens seit dem 18. Jhd. bis Matsusaka und dem Kushida 櫛田 Fluss von Steinlaternen beleuchtet und über breite Brücken passierbar war. Diese Bauwerke mussten einem saisonal-bedingt stark schwankendem Wasserpegel standhalten und überbrückten breite Flussdelta, wie den Miwatari 三 渡 Fluss. Die ausgebaute Infrastruktur, großzügigen Schrein- und Tempelanlagen, breiten Einkaufsstraßen mit gutbesuchten Geschäften und Raststätten zeugen von der wirtschaftlichen Stärke der Ise shônin, z.B. in der Baumwoll-Textilbranche.
40
Die Stadt Uji-Yamada passte sich den Veränderungen an: Die Zahl der onshi Häuser stieg von 145 im Jahr 1594, auf 391 im Jahr 1671, auf 615 im Jahr 1724, fiel aber bis 1792 auf 357.41
40 Genannt sei beispielhaft Mitsui Takatoshi 三井高利 [1622 – 1694] aus Matsusaka, der 1674 den Echigoya 越後屋 Kimonoladen, Vorläufer des Mitsukoshi 三越 Warengeschäfts, in Nihonbashi 日本橋 in Edo gründete. 41 CHIAVACCI, David: „Die soziale Konstruktion des japanischen Reisemarktes in der Edo-Zeit“. S. 427. 13
Die Zahl wohlhabender Kunden hohen Standes und später das organisierte Reisen in großen kô Pilgergruppen ließen nach. Gemäß Porters Theorie löste der Preisdruck auch Skaleneffekte aus: Im Wettbewerb um Kunden und in Verhandlungen mit Dienstleistern überlebten die zeitgemäßen und erfolgreichen onshi mit ausreichendem Kapital. Vor allem aber trat Pietät in der späteren Edo-Zeit zunehmend in den Hintergrund zu weltlichem Vergnügen und Kaufkraft – ein gesellschaftlicher „Gamechanger“ bzw. Türöffner für Ersatzleistungen. So reflektierte ein Schrein-Priester des gekû in der Meiji Zeit [1868-1912]: „Es gab nicht eine Person, die die Wallfahrt nach Ise nicht mit Furuichi assoziierte. Enorme Summen wurden von zehntausenden Pilgern verschwendet, fast alles floss nach Furuichi.“ 42
Furuichi 古市 avancierte zum drittgrößten Freudenquartier des Landes mit, auf seinem Höhepunkt, 71 Etablissements und 1000 Hostessen. Im Unterschied zum Yoshiwara ��原 in Edo waren die Bordelle unlizenziert und stylten sich als Teehäuser, chaya 茶屋. Im späten 17. Jhd. begründete die Prosa von Ihara Saikaku 井原 西鶴 [1642-1693] und kabuki 歌舞伎 Theaterstücke von Chikamatsu Monzaemon 近松 門左衛門 [1653-1725] den Ruf. Nach einem Inferno in den 1780’ern wurden die Etablissements prunkvoller und größer als zuvor schnell wiederaufgebaut. Ein Massenmord im Teehaus [1796] und das schnell aufgelegte kabuki, sowie Jippensha Ikkus Verkaufsschlager Tôkaidô dôchû hizakurige 東海道中膝栗毛 [1806-1822] förderten das Geschäft.
Es gab nicht nur Sex im Angebot: der Tanz und Gesang der Teemädchen, Ise ondo 伊勢音頭, wurden gerühmt, der Aufritt im lokalen kabuki galt als Sprungbrett für eine Karriere auf den großen Bühnen von Edo, Kyôto und Ôsaka. Werbewirksam wurde in (einzeln verlegten) Holzschnitten und Broschüren kein Hehl aus der Schönheit und den Talenten der örtlichen weiblichen Arbeitskräfte gemacht. Das Textilgewerbe profitierte von der geschäftlicher Synergie: Man lieferte die zeremonielle Kleidung, als auch Kimono Kollektionen für die Damen. Branding und Luxus waren geschäftsträchtig – den Bemühungen des bakufu zur Vermeidung des zur Schau gestellten „neureichen Wohlstands“ zum Trotz.
Wenn Markteintrittsbarrieren fallen, drängen neue Wettbewerber mit neuen Produkten auf den Markt. Dies zeigte auch die eifrige Vermarktung von Ise meibutsu 名物 (lokale Spezialitäten) und miyage 土産 (Souvenirs), die traditionsgemäß von Reisenden für die zu Hause gebliebenen eingekauft werden mussten. Der breite Informationszugang zu Reiseliteratur und Karten in der späteren Edo-Zeit veränderte die Werbekanäle, erhöhte die Transparenz des Angebots und die Selbstständigkeit der zu Touristen mutierenden danna. Wohlhabende Besucher mit der nötigen Finanzkraft konnten zunehmend auf die Vermittlungsdienste der onshi verzichten. Porters Modell illustriert: vier Kräfte wirken auf die Mittelmänner und erhöhen den Konkurrenzkampf unter den Marktteilnehmern. Die onshi versuchen Kundenerwartungen zu begegnen und die Effizienz ihres Geschäfts zu steigern. Der Preisdruck wird, wo immer möglich, auf die unabhängigen Dienstleister mit der geringsten politischen Interessenvertretung – die „Arbeiterklasse“ der bevorstehenden Industrialisierung - abgewälzt.
43
42 TEEUWEN, Mark u. BREEN, John: A social history of the Ise Shrines – Divine Capital. S. 141. 43 Eine Untersuchung zur möglichen Existenz „versteckter“ solidarischer Netzwerke unter den unabhängigen Dienstleistern war im Rahmen dieser Hausarbeit und der Quellenlage nicht möglich. 14