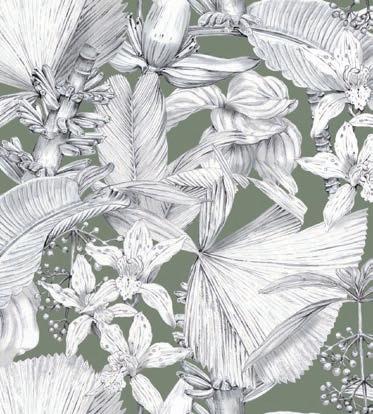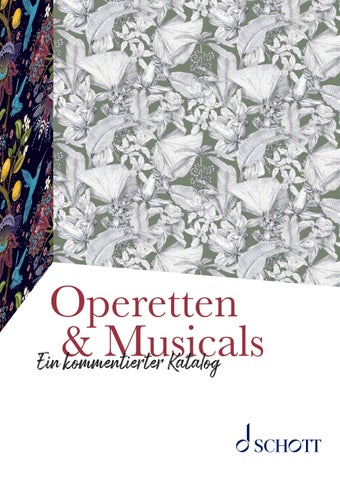








Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz Printed in Germany

Ein kommentierter Katalog von Schott Music und Partnerverlagen
www.schott-music.com

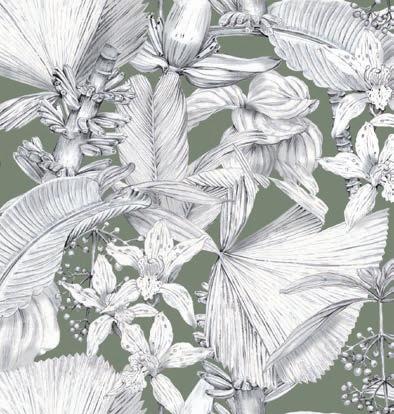









Egal ob Offenbachiade, Wiener Operette oder Musical: Seit einigen Jahren kommt frisches Leben in das humoristische Musiktheater. Mit der Intendanz von Barry Kosky begann die Komische Oper Berlin 2012 einen ganzen Zyklus der Operette des frühen 20. Jahrhunderts wiederzubeleben und hat damit viele andere Häuser inspiriert. Intendant Josef E. Köpplinger am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz bekannte sich zur Gleichwertigkeit der Spielplansäulen Oper, Operette, Musical und Ballett. Viele Häuser setzen Ausgrabungen an – die vor einigen Jahren noch beklagte Fokussierung auf wenige Zugtitel ist überwunden. Fundstücke wie Karneval in Rom von Johann Strauss oder Kurt Weills Der Kuhhandel, aber auch neue Kompositionsaufträge, wie zum Beispiel an Benjamin Schweitzer für Südseetulpen, spiegeln die Lust an der heiteren Kunstform im Stadt- und Staatstheater, in der freien Szene und bei Ensuite-Produktionen. TonträgerLabels tragen zu einer Revitalisierung früherer Epochen bei wie seit den 1950er Jahren nicht mehr.
Operette und Musical sind politisch brisant. Ihre Themen – Gleichstellung der Geschlechter, technischer Fortschritt, kriegerische Konflikte usw. – bleiben aktuell. Dirigent:innen und Regisseur:innen nehmen ihre Form ernst. Informierte Lesarten in der Nachfolge von Nikolaus Harnoncourt und sorgfältige Inszenierungen haben sich durchgesetzt. Eine neue Generation von Sänger:innen mit gewachsenen darstellerischen Mitteln setzt sich für das komische Genre ein.
ӆber Musik kann man am besten
mit
Bankdirektoren reden. Künstler reden ja nur übers Geld.“
Jean Sibelius
Dieser Katalog versammelt über 100 Werke von 70 Komponisten. Gegliedert ist er in die Kapitel „Offenbach“, „Wiener Operette“, “Berliner Operette”, „DDR“, „BRD“, „Nach 1989“ und „Sonderformen“. Aufgenommen haben wir Operetten, Musicals, Musikalische Lustspiele und Revuen, also beispielsweise die Operetten von Johann Strauss und die Musicals von Gerd Natschinski, aber keine heiteren Opern wie zum Beispiel Die schweigsame Frau von Richard Strauss. Fast alle Werke haben deutsche Texte – fremd- oder zweisprachige Ausgaben haben wir kenntlich gemacht.
Den überwiegenden Teil der Texte hat Roland H. Dippel geschrieben, der sich besonders im sogenannten heiteren Musiktheater der DDR auskennt. Weitere Autor:innen, wie zum Beispiel Michael Rot für Johann Strauss, werden am Ende des Katalogs auf Seite 79 nachgewiesen. Dort finden Sie auch die Vertretungen von Schott in Österreich und der Schweiz. Ein abschließender Index sortiert die Werke nach Namen der Komponisten, Spieldauer und Größe der Besetzung. Bitte wenden Sie sich für die Bestellung von Ansichtsmaterial wie üblich an info@schott-music.com.
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen für die Redaktion Joscha Schaback und Lea Wilms







Jacques Offenbach gilt aus heutiger Sicht noch immer als ein Gipfelpunkt des Musiktheaters. Die Gattungsdefinition – ob Oper, Operette, Posse, Singspiel, Kabarett oder Revue – wird von jeder Generation leidenschaftlich diskutiert. Dabei ist Offenbach seinen Interpret:innen immer ein Stück voraus. Als Komponist und Theaterdirektor zeigte er, wie nahe Pragmatismus, Vision und verdichtendes Können beieinanderliegen. Das ist auch der Grund, weshalb seine Werke für Franz von Suppé und die Wiener Operette, für Kurt Weill und für das heitere Musiktheater der DDR ein wichtiges Vorbild wurden.
Mit Offenbachs Parodien und Travestien – zum Beispiel mit Orpheus in der Unterwelt in der Übersetzung von Horst Bonnet – lässt sich das Moral- und Politikverständnis der Mächtigen aufs Korn nehmen. Neben Hoffmanns Erzählungen (bei Schott in der Ausgabe von Jean-Christophe Keck und Michael Kaye erhältlich) und den berühmten Offenbachiaden, gibt es eine ganze Reihe von Werken, welche ihren Weg ins Repertoire fanden.
Wer sich auf Offenbachs Spielen und Kokettieren mit den Genres des musikalischen Theaters einlässt, findet Leichtigkeit und Tiefgang. Schott verfügt über viele Bearbeitungen – auch von weniger bekannten Titeln wie Die verwandelte Katze und Die Zaubergeige. Viele dieser Bearbeitungen stammen aus der DDR, in der Offenbach einen noch höheren Stellenwert als in Westdeutschland hatte.


























Offenbach, Jacques / Urack, Otto
Eine unheimliche Komödie in zwei Teilen mit Musik von Jacques Offenbach von Christof Schulz-Gellen
Musikalische Bearbeitung von Otto Urack
Hortense · singende Salon-Schauspielerin – Nichette · Soubrette – Valentine · singende Schauspielerin – Marquise von Vavasour · alte Salondame – Alphonse · singender Schauspieler – Belphegor Spalanzani · Charakterspieler – Amadée · Buffo – 3 Pariser Lebemänner · singende, leicht komische Bonvivants – stumme Rollen
1 (auch Picc.) · 1 · 2 (2. ad lib.) · 1 - 2 (2. ad lib.) · 2 (2. ad lib.)
0
0 - P. S. (kl. Tr.
gr. Tr. · Trgl · Glsp. · Tamt. · Xyl. · Cel. · Beck. · Holztr. · Tamb. · Schellen · Tangotrommel) (1 Spieler) - Hfe. - Str. (3
1
1 [ad lib.]
1
1) · Die gesamte Musik kann auch an zwei Flügeln gebracht werden.
Astoria Verlag • 20‘
Offenbach, Jacques
Operette in zwei Teilen (1860) Libretto von Louis François Clairville und Jules Cordier
Deutsche Textfassung von André Müller
Musikalische Bearbeitung und Instrumentierung von Manfred Grafe
Chloë · Koloratursopran – Daphnis · Tenor – Pan · Bariton – Achates · Bass-Bariton – Äneas · Tenor – Calisto · lyrischer Sopran (mit Koloratur) – Locoe · Sopran – Xanthippe · Sopran – Niobe · Mezzosopran – Amalthea · Alt – Bacchantinnen, Krieger, Volk · Chor
2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 2 · 2 · 1 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. ·
Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.) (1 Spieler) - Str.
Uraufführung: 27. März 1860 Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens (F) · Musikalische Leitung: Jacques Offenbach
Schott Music • 45‘
Offenbach, Jacques
Opera buffa in drei Akten (1869) von Henri Meilhac und Ludovic Halévy
Textliche Neubearbeitung von Klaus Eidam
Die gefürchtete Bande um Räuberhauptmann Falsacappa hat schon lange keinen großen Fang mehr gemacht. Als sich aber die Möglichkeit ergibt, seine Tochter Fiorella als Prinzessin von Granada auszugeben, um sich drei Millionen Francs zu erschwindeln, ergreift Falsacappa die Gelegenheit sofort. Am Hof von Mantua angelangt muss er jedoch feststellen, dass der Schatzmeister die ganze Staatskasse verprasst hat und stattdessen Falsacappa
bestechen will. Außerdem mag der fürstliche Bräutigam nicht auf seine unzähligen Konkubinen verzichten. Mit dieser kriminellen Energie bei Hofe können die Banditen nicht mithalten. Als dann noch die echte Prinzessin von Granada auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Offenbach und seine Librettisten Henri Meilhac und Ludovic Halévy schaffen es, die loyaleren und integreren Räuber als Helden der Geschichte dastehen zu lassen. Durch schmissige Musik und musikalischen Humor zeichnet Offenbach die Bandenmitglieder als sympathische Charaktere. In dieser Operette sind alle Beteiligten Räuber, vom Carabinieri bis zum Fürsten. Les brigands ist Offenbachs politischstes Werk und nimmt das zweite französische Kaiserreich aufs Korn. Die Seitenhiebe gegen Korruption, Arroganz und Vetternwirtschaft sind hochaktuell und ermöglichen zeitgenössische Regieinterpretationen.
Mit eingängigen Melodien und einer großen Doppelchorpartie erinnert die Operette an die Grand OpéraTradition. Da nach ihr ausschließlich ernste Opern wie Hoffmanns Erzählungen (Sie finden dieses Werk in der Broschüre „Jacques Offenbach – Les Contes d‘Hoffmann“) folgten, ist sie Offenbachs letzte abendfüllende Opera buffa.
Falsacappa, Chef der Banditen – Fiorella, seine Tochter –Pietro, Falsacappas Vertrauter – Banditen: Barbavano, Carmagnola, Domino – Vier junge Bäuerinnen: Zerlina, Fiametta, Bianca, Cicinella – Fragoletto, ein junger Bauer – Der Fürst von Mantua – Der Baron von Campotasso, erster Stallmeister des Fürsten – Antonio, Finanzminister des Fürsten – Der Kapitän der Gendarmen des Fürsten von Mantua – Am Hofe von Mantua: Herzogin, Marquise – Ein Page des Fürsten – Die Prinzessin von Granada – Adolphe, ihr Lieblingspage – Der Graf von Gloria–Cassis, Kammerherr der Prinzessin – Der Hofmeister der Prinzessin – Pipo, Herbergswirt – Pipa, seine Frau – Pipetta, seine Tochter – Ein Kurier (stumm) – Banditen, Gendarmen, Bäuerinnen, Küchenjungen, Pagen, Edelherren und Damen der Höfe von Mantua und Granada
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 (ad lib. auch nur 2) · 2 · 3 ·
0 - P. S. (Trgl. · Tamb. · Schellen · kl. Tr. · gr. Tr. · Kast.) (2 Spieler) - Str.
Uraufführung: 10. Dezember 1869 Paris, Théâtre des Variétés (F) Schott Music • 135‘


Offenbach, Jacques / Masanetz, Guido
(Les Braconniers)
Große Operette in drei Akten (1873)
Libretto von Henri Charles Chivot und Alfred Duru
Musikalische Bearbeitung von Guido Masanetz (1958) Textliche Neufassung von Jan Möhwald
Bibletto (Bibletta) · (Koloratur-)Sopran – Ginetta · Sopran (Soubrette) – Bibès · Bariton – Marcassou · Tenor (Gesangsbuffo) – Lastécouérès · Tenor (Komiker) – Éléonor · Buffo (jugendl. Komiker) · Carmagnasse, Barbier und Onkel Ginettas · singende Charge – Gabastou, ein Schankwirt · singende Charge – Barbadès, Oberförster und Vertrauter des Gouverneurs · singende Charge – Tartarin, Pierrougue, Fourcade, Bauern, Mittelsmänner der Wilddiebe · singende Chargen – Barbiergehilfen und -gehilfinnen, Kunden, Hochzeitsgäste, Jagdgäste, Wilddiebe, Gendarmen, Jäger · gemischter Chor 2 (2. auch Picc.) · 2
2
2 - 4
2
3
0 - P. S. (Trgl. · kl. Gl. · kl. Tr. · Tamb. · gr. Tr.) - Hfe. - Str. Schott Music • 100‘
Offenbach, Jacques / Allihn, Jochen
Operette in einem Akt von Jacques Offenbach (1864) Libretto von Eugène Scribe und Mélesville (= AnneHonoré-Joseph Duveyrier) Deutsch von Adolf von Winterfeld Musikalische Einrichtung von Jochen Allihn (1984)
Guido, Sohn eines Kaufmanns aus Triest · Tenor – Marianne, seine Gouvernante · Mezzosopran – Minette, seine Katze · Sopran – Dig-Dig, indischer Jongleur · Bariton Fl. - Str.
Schott Music• 60‘
Offenbach, Jacques / Zimmermann, Bernd Alois
Jacques Offenbachs „Le Violoneux“ (1855) neu orchestriert von Bernd Alois Zimmermann (1950) Légende bretonne in einem Akt nach einem Text von Eugène Mestépès und Émile Chevalet in der deutschen Textfassung von Adolf Bahn
Bernd Alois Zimmermann war ein begnadeter Bearbeiter. Im Auftrag des Nordwestdeutschen Rundfunks Köln nahm er 1950 die Neuorchestrierung von Jacques Offenbachs Die Zaubergeige vor. Zimmermann hielt sich an
Offenbachs spritzigen und humorvollen Stil. Der Humor in Zimmermanns eigenen Werken, den man angesichts vieler dunkler Spätwerke kaum vermuten möchte, mag hier besondere Inspiration gefunden haben.
Die Handlung kreist um den Violinisten Martin und sein Instrument, dem teuflische Kräfte nachgesagt werden. Der Orchesterpart sieht für den Konzertmeister glanzvolle Solopartien vor. Dank seiner kleinen Sängerbesetzung ist es ein ideales Kammerspiel, das mit einem kleinen oder mittleren Orchester auskommt.
Vater Martin, der Dorfgeiger · Bariton – Rose, sein Mündel · Mezzosopran – Peter, ein Bauer · Tenor
2 (2. auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 · 2 - 2 · 2 · 2 · 0 -
P. S. (Beckenpaar · kl. Tr. · gr. Tr.) - Vl. solo · Str.
Uraufführung: 28. April 2018 Köln, Philharmonie (D) · Miljenko Turk, Bariton · Annika Boos, Mezzosopran · Christian Sturm, Tenor · Musikalische Leitung: Alfred Eschwé · WDR
Funkhausorchester Köln
Schott Music • 60‘

Offenbach, Jacques König
(Roi carotte)
Opera-bouffe-féerie (1872)
Buch von Victorien Sardou, Musik von Jacques Offenbach
Textliche Neufassung von Helmut Müller Musikalische Bearbeitung und Instrumentation von Manfred Grafe

Prinz Frido · Tenor – Prinzessin Fatmé · Sopran – Prinzessin Schirin · Koloratursopran – König Karotte · Tenor – Die Fee Oragante · Sprechrolle – Herr Pipertrunck · Bass-Bariton –Robert, sein Sohn · hoher Bariton (oder Mezzosopran) – Der taktische Rat Track · Bass-Bariton – Seine Frau · Mezzosopran – Der kommerzielle Rat Koffre · Bariton – Seine Frau · Sopran – Der geheime Rat Schopp · Bass – Seine Frau · Alt (Mezzo) – 1. u. 2. Oberohr · Sprechrollen – 1. Bürger · Tenor – 2. Bürger · Bass – 3. Bürger · Bass – Bürgerin · Sopran –Chor und Ballett
2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 2 · 2 · 1 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Str.
Uraufführung : 15. Januar 1872 Paris, Théâtre de la Gaîté (F) Schott Music • 150‘
Offenbach, Jacques
Opéra-bouffe en 3 actes et 4 tableaux (1867) Paroles de Henri Meilhac et Ludovic Halévy Kritische Neuausgabe herausgegeben von Michael Rot
Deutsch • Französisch
Die Operette erzählt die Geschichte der gelangweilten Großherzogin eines fiktiven Kleinstaates, die sich in den einfachen Soldaten Fritz verliebt. Um ihre Macht zu demonstrieren und ihre Liebe durchzusetzen, befördert sie Fritz zum General und ordnet einen Krieg an, der sinnlos ist und absurd verläuft. Fritz bleibt seiner Verlobten Wanda treu, was die Großherzogin in ihrer Eitelkeit tief verletzt. Nach zahlreichen Intrigen, Missverständnissen und Machtspielen erkennt die Großherzogin, dass sie ihren Platz und ihre Rolle akzeptieren muss und arrangiert sich mit der Situation. Die Operette endet mit einer Versöhnung, bei der die gesellschaftlichen Hierarchien wiederhergestellt sind, jedoch nicht ohne spöttischen Unterton.
Eine bissige Satire auf die Überheblichkeit des Adels, die Lächerlichkeit militärischer Posen und die politische Willkür. La Grande-Duchesse ist ein Meisterwerk der Gesellschaftskritik, das mit seinem satirischen Geist und Offenbachs genialer Musik nichts von seiner Aktualität verloren hat.

La Grande-Duchesse (Mezzosoprano) • Fritz, simple soldat (Ténor) • Wanda, sa fiancée (Soprano) • Le général Boum, général en chef des Armées (Basse) • Le baron Puck, précepteur de la Grande-Duchesse (Ténor) • Le prince Paul, fiancé de la Grande-Duchesse (Ténor) • Le baron Grog, précepteur du prince (Baryton) • Népomuc, aide de camp (Ténor) • Iza, Olga, Amélie, Charlotte, demoiselles d’honneur (2 Soprano / 2 Mezzosoprano) • Choeur
Flöte, Piccolo / Oboe / 2 Klarinetten in A, B, C / Fagott • 2 Hörner / 2 Kornette / Posaune • Pauken • Große Trommel mit Becken, kleine Trommel, Triangel, Glockenspiel, Schellen • Streicher • Bühnenmusik: Flöte, Piccolo / Oboe / 2 Klarinetten in B / Fagott • 2 Hörner / 2 Kornette / Posaune • Große Trommel mit Becken, kleine Trommel • Auf der Bühne: 2 Klarinetten in B • kleine Trommel
Uraufführung: 12. April 1867 Paris, Théâtre des Variétés (F) Verlagsgruppe Hermann • 180‘
Offenbach, Jacques
Opéra bouffe in zwei Akten und vier Bildern (1858 (1874)) von Hector Crémieux unter Mitarbeit von Ludovic Halévy
Neue deutsche Übersetzung von Horst Bonnet
„Mir ist es egal, was du mit deinen Schülerinnen machst. Und es hat dich nicht zu kümmern, was ich mit meinem Schäfer treibe“, erbost sich die seitensprungwillige Eurydike. Frust und Empörung: Der mythische Sänger und Musiker Orpheus ist längst vom großartigen Künstler zum gewöhnlichen Geiger abgerutscht.
Horst Bonnets Neuübersetzung von Orphée aux enfers ist ein Meilenstein der Offenbach-Rezeption: Sie wurde Grundlage der letzten DEFA-Produktion auf 70mm und zugleich der letzte aufwendige Operetten-Film der DDR. Die Moden, Dialoge und Capricen der olympischen Götter beim Ausflug zur Champagner- und Cancan-Party des geselligen Totengottes Hades geraten wie in vielen Inszenierungen zu einem trefflichen Spiegel des herrschenden Zeitgeistes.
Die öffentliche Meinung · Alt - Orpheus · Tenor - Eurydike · Koloratursopran - Pluto (Aristeus) · Tenor - Jupiter · Tenor - Juno · Alt - Diana · Sopran - Venus · Alt - Cupido · Alt - Minerva · Alt - Hebe · Sopran - Mars · Bass - Morpheus · Tenor - Merkur · Tenor - Hans Styx · Tenor - Bacchus · stumme Rolle - Götter, Göttinnen, Faune, Bacchantinnen, Furien, Teufel · Chor
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 1 - P. S. (Trgl. · Gl. · hg. Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. · Blechwirbel) (3 Spieler)Hfe. - Str. - 3. und 4. Horn, 2. und 3. Posaune sowie Tuba und Harfe sind ausschließlich in der Ouvertüre besetzt.
Uraufführung: 21. Oktober 1858 Paris, Théâtre des BouffesParisiens (F)
Schott Music • 165‘



”Denk an deine Karriere! Opern werden geschrieben, Operetten, Musicals, Filme! Alles dir zu Ehren!“
Orpheus in der Unterwelt














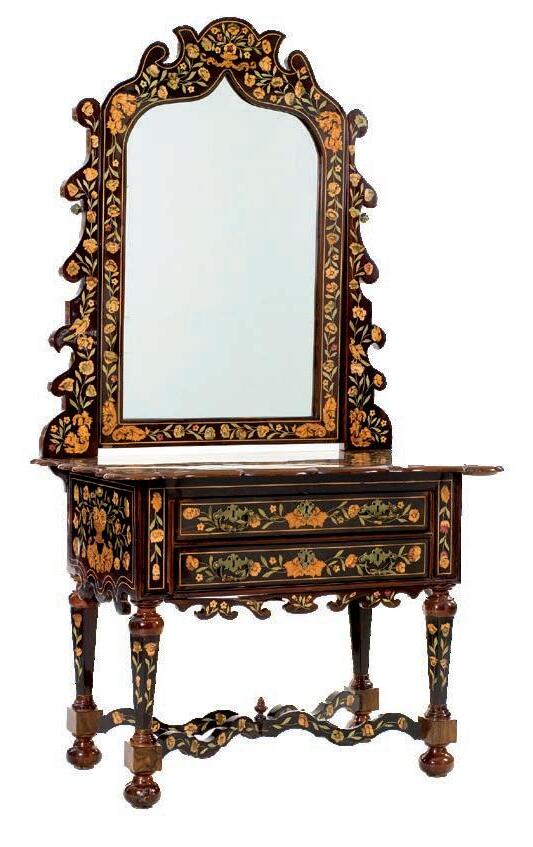


















Die Wiener Operette mit zahlreichen Spitzenwerken von Johann Strauss (Sohn) ähnelte durch Aufbau und durchkomponierte Szenenfolgen der Oper. Zugleich verarbeitete sie Stilprinzipien musikalischer Bühnenwerke mit Dialogen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach 1900 wurden die Nummern tendenziell knapper.
Die Muster der Wiener Operette blieben auch für den neuen Typus der Berliner Operette prägend (ab S. 28). In diesen beiden Weltstädten und an vielen anderen Orten avancierte die Operette – sowohl an Ensuite-Häusern als auch an Subventionstheatern und in schauprächtigen Sensationsproduktionen um Weltstars wie Fritzi Massary – zur topaktuellen, mondänen Gattung. Ihre Breitenwirkung nahm bereits die Ausmaße der Popkultur vorweg.




Die nach dem Zweiten Weltkrieg an fast allen Bühnen und im Fernsehen einsetzende Verharmlosung gehört heute zum Glück der Vergangenheit an. Theater wetteifern wieder im Enthüllen des subversiven OperettenPotenzials für eine aufgeklärte Zivilgesellschaft. Das beweist nicht zuletzt die ungebrochene Attraktivität der musikalischen Bühnenwerke von Strauss im Jubiläumsjahr 2025.

Heuberger, Richard Franz Josef
Wiener Operette in drei Akten (1898) nach dem Lustspiel „Les Dominos roses“ von Alfred-Charlemagne Delacour und Alfred Hennequin Libretto von Victor Léon und Heinrich von Waldberg Chorlose Fassung. Textliche Neufassung von Walter Niklaus. Musikalische Einrichtung von Günter Joseck Beaubuisson, Rentier · Bass - Madame Palmira Beaubuisson, seine Frau · Alt - Henri, ihr Neffe, Marinekadett · Tenor oder Mezzosopran - Paul Aubier · Tenor - Angèle, seine Frau und Madame Beaubuissons Nichte · Sopran - Georges Duménil · Tenorbuffo - Marguérite Duménil, seine Frau · SopranGermain, Diener bei Duménil · stumme Rolle - Hortense, Kammermädchen bei Duménil · Soubrette - Féodora · Sopran - Philippe, Oberkellner · Tenor 2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr.) (3 Spieler) - Hfe. - Str.
Uraufführung: 5. Januar 1898 Wien, Theater an der Wien (A) Schott Music • 135‘
Kreisler, Fritz
Singspiel in zwei Akten und vier Bildern von Ernst und Hubert Marischka nach einem Lustspiel von Ernst Decsey und Gustav Holm (1932)
Das Singspiel erzählt von der Eheanbahnung zwischen dem österreichischen Kaiser Franz Joseph I. und der zum Zeitpunkt der Verlobung erst 15jährigen Wittelsbacher Herzogin Elisabeth. Fritz Kreisler schäumte ein melodienreiches Baiser mit heiterem Gartenlauben- und Poesiealbum-Flair über drei schicksalsträchtige Tage in Schloss Possenhofen am Starnberger See und in Bad Ischl. Sissy ist als Adelsstück mit bürgerlichen Tugenden eine aparte Alternative zu zahlreichen Mätressen- und Abenteuerinnen-Operetten.
Als En-Suite-Erfolg lief das Werk von Weihnachten 1932 im Theater an der Wien bis zum ‚Anschluss‘ Österreichs, wurde danach jedoch wegen der jüdischen Herkunft des Komponisten abgesetzt. Tatsächlich nimmt Kreislers Sissy den Jahrhunderterfolg von Ernst Marischkas Film-Trilogie mit Romy Schneider (1955/57) vorweg.
Kreisler verarbeitete in Sissy einige berühmte Violinstücke wie Liebesleid, Liebesfreud und Schön Rosmarin (in unterschiedlicher Besetzung als Konzertstücke bei Schott erhältlich). Das Werk eignet sich nicht nur für die große Bühne, sondern ist auch ein beliebtes Open-Air-Ereignis. Auf Schloss Tabor im Burgenland, im erzgebirgischen Naturtheater Greifensteine und nahe des ersten Original -
schauplatzes Schloss Starnberg gelangte es in den letzten Jahrzehnten zur Aufführung.
Franz Josef, Kaiser von Österreich - Erzherzogin Sophie, seine Mutter - Herzog Max in Bayern - Ludovica, genannt Luise, seine Gemahlin - Helene, genannt Néné - Elisabeth, genannt Sissy - Karl Theodor, genannt Gackl - Sophie, genannt Spatz - Ruprecht - Annemarie - Maximilian - Feldmarschall Graf Radetzky - Prinz Thurn-Taxis - Baron Hrdlicka, Zeremonienmeister - Graf Creneville, Adjutant - von Kempen, Oberst der Gendarmerie - Fürst Menschikow, Abgesandter des Zaren - Ilona Varady, Balletttänzerin - Der Ballettmeister der Wiener Hofoper - Petzelberger, Wirt des Gasthofes „Zum goldenen Ochsen“ - Zenzi, Kellnerin - Peter, Diener - Ein Wachmann - Ein Burggendarm - Ballettmädchen, Offiziere, Leibgardisten, Hofdamen, Lakaien, Bauern, Sänger, Geistliche, Militär, Volk
2 (2. auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 · 1 - 3
3
2 · 1 -
P. S. (Vibr. · Gl. [t.]) (2 Spieler) - Hfe. · Klav. (auch Cel.) · Akk. - Str. - Bühnenmusik (kann auch im Orchester ausgeführt werden): 3 Trp. - 2 kl. Tr. - Zith. · Git. · Akk.
Uraufführung: 23. Dezember 1932 Wien, Theater an der Wien (A)
Schott Music / Carl Fischer / Papageno • 120‘
Lieferrechte für alle Länder außer USA, Mexiko, Kanada, Österreich und Ungarn
Lehár, Franz
Operette in 3 Akten
Text von Alfred Maria Willner und Robert Bodanzky
In deutscher Sprache
Kritische Neuausgabe herausgegeben von Gábor Kerényi in den Fassungen 1909 und 1937
Der Fürst Basil Basilowitsch will die bürgerliche Sängerin Angèle Didier heiraten, was aufgrund ihres Standes nicht möglich ist. Eine arrangierte Scheinhochzeit mit anschließender Scheidung soll das Problem lösen und die Sängerin in einen höheren Stand heben. Als Ehemann kommt der Graf von Luxemburg infrage, der eine finanzielle Entlohnung gut gebrauchen kann. Jedoch verlieben sich die beiden nun verheirateten Eheleute tatsächlich ineinander. Schlussendlich findet die verzwickte Situation durch das Erscheinen der Fürstin Anastasia Kokozeff, der ehemaligen Geliebten von Fürst Basil, ein Ende. Das Arrangement zwischen Fürst Basil und dem Grafen von Luxemburg wird aufgekündigt und die Handlung endet mit zwei glücklichen Paaren. Nicht immer wissen Komponisten ihre Werke richtig einzuschätzen. „Schmarrn“ soll dem Vernehmen nach Franz Lehár über seine Operette Der Graf von Luxemburg geurteilt haben. Dabei ist sie nach der Lustigen Witwe sein größter Welterfolg geworden. Am 12. November 1909 wurde das Original am Theater an der Wien uraufgeführt. Am 4. März 1937 folgte die Erstaufführung der erweiterten Berliner Fassung am dortigen Theater des Volkes. Sie hat sich durchgesetzt. Von der Wiener Urfassung existieren nur ein Klavierauszug, das Originaltext-
buch, ein Textbuch der musikalischen Stimmen sowie einige in der Budapester Nationalbibliothek aufbewahrte Orchesterstimmen. Die Wiener Verlagsgruppe Hermann legt erstmals beide Fassungen vor, gestützt auf sämtliche zur Verfügung stehenden Quellen. Damit wird erstmals deutlich, wie sehr sich Lehár bei der Behandlung der Orchesterstimmen von Gustav Mahlers Instrumentationstechnik beeinflussen ließ.
René, Graf von Luxemburg • Tenor - Fürst Basil Basilowitsch • Bariton - Armand Brissard, Maler • Tenor - Angèle Didier, Sängerin an der großen Oper in Paris • Sopran - Juliette Vermont • Sopran oder Mezzosopran - Sergei Mentschikoff • Bariton - Pawel von Pawlowitsch · Bariton - Pélégrin · Bariton - Sylviane, seine Frau · Sopran oder MezzosopranGräfin Stasa Kozokow · Mezzosopran oder Alt 2 Flöten (beide auch kleine Flöte) / 2 Oboen / 2 Klarinetten / 2 Fagotte • 4 Hörner / 2 Trompeten in F / 2 Posaunen / Bassposaune • Harfe, Celesta • Pauken • Glockenspiel, Triangel, kleine Trommel, Tamburin, Tam-Tam, Becken a2, große Trommel mit Becken • Streicher - Bühnemusik: Klarinette, Gitarre, Harmonika, Klavier, 1. u. 2. Violine, Violoncello Uraufführung der Wiener Fassung (1909): 12. November 1909 Wien, Theater an der Wien (A)
Uraufführung der Berliner Fassung (1937): 4. März 1937 Berlin, Theater des Volkes (D)
Verlagsgruppe Hermann • 140‘
Lehár, Franz
Operette in 3 Akten
Text von Victor Léon und Leo Stein In deutscher Sprache
Kritische Neuausgabe hrsg. von Gábor Kerényi
Im Mittelpunkt der Handlung steht Hanna, ein einfaches Mädchen vom Land, das durch die Heirat eines reichen Bankiers, der noch in der Hochzeitsnacht stirbt, zur reichen Witwe geworden ist und so zum Wunschobjekt heiratswilliger Männer wird. Über Umwege kommt am Ende jedoch die Liebesbeziehung mit dem Grafen Danilo, der Hanna wegen des Standesunterschieds vor ihrer ersten Ehe nicht heiraten durfte, zustande.
„Das ist doch keine Musik“, soll der Direktor des Theaters an der Wien, Wilhelm Karczag, dem Librettisten Victor Léon zugerufen haben, als ihm Franz Lehár die Operette Die Lustige Witwe vorspielte. Dennoch ließ er sich davon überzeugen, das Stück anzunehmen. Von ihm stammt auch der Titel des Werks. Ursprünglich wollte man den Operettendreiakter „Die kleine Witwe“ nennen. Die Uraufführung am 30. Dezember 1905 war durchwachsen, wirklich Fahrt nahm das Werk erst durch seine Übernahme an das Neue Wiener Stadttheater, heute die Volksoper Wien, auf. Längst ist Die Lustige Witwe einer der größten Operettenerfolge weltweit. Ihr Autograph befindet sich in der Lehár-Villa in Bad Ischl. Sie dient als wichtige Grundlage für die erste wissenschaftliche Ausgabe der Operette, die von der Wiener Verlagsgruppe







Hermann auf Basis aller bekannten Quellen ediert wurde. Sie präsentiert erstmals Lehárs an Gustav Mahler orientierte differenzierte Orchestrierung ohne die in bisherigen Editionen üblichen dynamischen und artikulatorischen Angleichungen. Das Stück ist auch in einer reduzierten Fassung (Matthias Fletzberger) erhältlich.
Baron Mirko Zeta, pontevedrinischer Gesandter in Paris · Bariton – Valencienne, seine Frau · Sopran – Graf Danilo Danilowitsch, Gesandtschaftssekretär, Kavallerieleutnant i. R. · Tenor oder Bariton – Hanna Glawari · Sopran – Camille de Rosillon · Tenor – Vicomte Cascada · Tenor – Raoul de SaintBrioche · Tenor – Bogdanowitsch, pontevedrinischer Konsul
· Bariton – Sylviane, seine Frau · Sopran – Kromow, pontevedrinischer Gesandtschaftsrat · Bariton – Olga, seine Frau · Sopran – Pritschitsch, pontevedrinischer Oberst in Pension · Bariton – Praškowia, seine Frau · Mezzosopran – Njegus, Kanzlist bei der pontevedrinischen Gesandtschaft, Charakterkomiker · Sprechrolle – Lolo, Dodo, Jou-Jou, Frou-Frou, Clo-Clo, Margot, Grisetten · Sopran – Pariser und pontevedrinische Gesellschaft, Guslaren, Musikanten, Dienerschaft
2 Flöten (2. auch kleine Flöte) / 2 Oboen / 2 Klarinetten in A und B / 2 Fagotte • 4 Hörner in F / 2 Trompeten in F / 2 Posaunen / Bassposaune • Pauken, Glockenspiel, Triangel, kleine Trommel, Tamburin, Tam-Tam, Becken a2, große
Trommel mit Becken • Harfe • Streicher
Bühnenmusik: Violine I, II, Viola, Violoncello, Kontrabass • Tamburizza-Ensemble: 2 Tamburizzas, Berda (Basstamburizza), Gitarre, Tamburin
Uraufführung der Originalfassung: 30. Dezember 1905
Wien, Theater an der Wien (A) · Musikalische Leitung: Franz Lehár
Verlagsgruppe Hermann • 140‘
Millöcker, Carl
Operette in drei Akten von F. Zell und Richard Genée (1884)
Musikalische Einrichtung von Albert Busch, textliche Einrichtung von Egon Maiwald
Carlotta, verwitwete Gräfin von Santa Croce · SopranNasoni, Podestá von Syrakus · Bariton - Sindulfo, sein Sohn · Tenor - Conte Erminio · Tenor od. Bariton - Luigi, dessen Freund · Sprechrolle - Benozzo, Wirt · Tenor - Sora, seine Frau · Sopran - Zenobia, die Gouvernante Carlottas · Alt - Marietta, Kammerzofe der Gräfin Carlotta · Sprechrolle - Massaccio, Benozzos Onkel, Schmuggler · Bariton - Ein Oberst, Ein Leutnant · Sprechrollen - Bauern, Bäuerinnen, Schmuggler, Zollwächter, Herren und Damen von Syrakus, Carabinieri · Chor und Statisten
2 (2. auch Picc.)
2
2
2 - 4
2
3
0 - P. S. (Glsp. · Trgl. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck.) (3 Spieler) - Str. Uraufführung: 26. Januar 1884 Wien, Theater an der Wien (A) Schott Music • 150‘

”Der schmucke Sekretär gefällt mir fast noch mehr.“
Der Bettelstudent

Millöcker, Carl
Operette in drei Akten von F. Zell und Richard Genée (1882)
Neufassung von Carl Riha und Wolf Ebermann
Der Bettelstudent verdankt seine Beliebtheit nicht nur der überragenden Musik mit opernhaften Gesangspartien, sondern auch der raffiniert konstruierten Doppelhandlung: Der kursächsische Oberst Ollendorf holt zwei polnische Sträflinge aus dem Gefängnis, um einen davon der stolzen polnischen Komtesse Laura als standesgemäßen Bräutigam unterzujubeln. Diese hatte sich gegen eine Kussoffensive des Obersts mit einem kräftigen Fächerschlag gewehrt. Doch der freigelassene Student Symon gewinnt schließlich auch ohne Geburtsadel Lauras Herz. Sein Mitgefangener Jan gibt sich als Anführer des polnischen Widerstands gegen die sächsische Annexion zu erkennen und erobert Lauras Schwester Bronislawa. Das Stück endet in großem Jubel.
Bei Schott sind zwei Fassungen erhältlich. Zum einen die musikalische Neueinrichtung von Egon Maiwald und Guido Masanetz, die in der DDR als großer Querschnitt (mit Tenor Peter Schreier) auf Schallplatte erschien. Zum anderen die textliche Bearbeitung Wolf Ebermanns und des Chemnitzer Operndirektors Carl Riha, die auch nach dem Mauerfall regelmäßig gespielt wurde. Durch Striche wie Lauras Solo im Frauenterzett am Beginn des zweiten Aufzugs wird das zweite Paar – der Politrebell Jan Janicki und die „ent-soubrettete“ Bronislawa – aufgewertet.
Symon Symonowicz · Tenor - Jan Janicki · Tenor - Janka · Sopran - Der Wirt, Jankas Vater · Tenor - Palmatica, Gräfin Nowalska · Alt - Laura und Bronislawa, ihre Töchter · Sopran - Fürst Bogumil Felinski · Bass - Eva, seine Gattin · Alt - Onuphrie, Palmaticas Diener · Bass - Rej, Wirt auf der Messe · Sprechrolle - Oberst Ollendorf, Gouverneur von Krakau · Bariton - Major v. Wangenheim · Tenor - Hauptmann v. Rochow · Tenor - Oberleutnant v. Schweinitz · Bass - Kornett v. Henrici · Bass - Leutnant von und zu Pillnitz · Tenor - Enterich, Kerkermeister · Tenor - Piffke und Puffke, Aufseher · Bass - Gäste im Wirtshaus: Stefan, Stanislaus, Joseph, Vondrak · 2 Tenöre, 2 Sprechrollen
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 2 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · Röhrengl. · Beck. · 2 Holzplattentr. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck. · Sporen) (3 Spieler) - Str. Schott Music • 165‘
Millöcker, Carl / Masanetz, Guido
Operette in zwei Akten von F. Zell und Richard Genée (1882)
Textliche und musikalische Neueinrichtung von Egon Maiwald und Guido Masanetz
Symon Rymanovicz, Student · Tenor - Jan Janicki, Student · Tenor - Palmatica, Gräfin Nowalska · Alt - Laura und Bronislawa, ihre Töchter · Sopran - Bogumil Malachowski, Palmaticas Vetter; Eva, seine Frau; Onuphrie, Palmaticas Diener · singende Chargen - Der Bürgermeister von Krakau · Sprechrolle - Oberst Ollendorf, Gouverneur von Krakau · Bass-Bariton - Major v. Wangenheim, Rittmeister v. Henrici, Leutnant v. Schweinitz, Cornet v. Richthofen · singende Chargen - Enterich, sächsischer Veteran und Gefängnisaufseher · drastischer Komiker - Piffke und Puffke, seine Gehilfen; Rej, ein Wirt · singende Chargen - Polnische Gefangene, Frauen, Mädchen, Damen und Herren der polnischen Adelsgesellschaft, Messebesucher, Bauern, Bürgersleute, Stadtväter · Chor und Statisten
2 (2. auch Picc.) · 2
2
2 - 4
2
3 · 0 - P. S. (Trgl. · Röhrengl. · Beck. · 2 Holzplattentr. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck.) (3 Spieler) - Str. - Bühnenmusik: 2 Klar. - Hr. · Tenorhr. · 2 Trp. · Tb. - S. (Trgl. · kl. Tr. · gr. Tr.)
Schott Music • 165‘
Millöcker, Carl / Velin, Martin
Operette in vier Bildern von Alois Berla (1878) Bearbeitung von Egon Maiwald und Martin Velin
Grosslechner, Bauer - Mirzel, seine Tochter - Sepp, Senn - Andredl, Geißbub - Simon, Wirt - Die alte Traudel - Regerl - Graf Geiersburg - Hahnentritt - Bonneville - Capponi - Coralie - Laura - Stella - Rosamunde - Lamotte, Haushofmeister - Bauern, Bäuerinnen, Mädchen, Burschen, Damen und Herren der gräflichen Gesellschaft, Lakaien
2 (auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · hg. Beck. · Beckenpaar · Tamt. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.)
(2 Spieler) - Str.
Schott Music • 150‘
Strauss (Sohn), Johann
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 8
Text: Heinrich Bohrmann, Richard Genée, Julius Rosen und O. F. Berg
Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot
Fächer und Spitzentücher waren stets beliebte Requisiten für Botschaften sowie die daraus resultierenden Missverständnisse. Hier trifft es den spanischen Natio -





naldichter Cervantes, den das Schicksal an den portugiesischen Hof verschlägt, wo er im Dienste der Königin Gedichte verfasst. Unversehens findet er sich im Zentrum dieser harmlos anmutenden Geschichte über ein Königspaar im Teenageralter, das von korrupten Regenten und Beratern kontrolliert wird. Die Affäre um das mit einer Liebesbotschaft versehene Spitzentuch wird zur Staatsaffäre, die Cervantes schlussendlich befrieden kann.
Wer jedoch tiefer in diese Geschichte eintaucht, wird die aktuellen Bezüge erkennen, die sich aus der Frage einer fremdbestimmten Regentschaft ergeben. Naivität oder Kor ruption – wer gewinnt die Oberhand? Und alles unter der argwöhnischen Beobachtung des Hofstaates, oder, wie man heute sagen müsste, der Yellow Press.
Die Strauss Edition konnte die unterschiedlichen Fassungen des Werkes rekonstruieren, darunter den ursprünglich als Terzett von Frauenstimmen angelegten Walzer Rosen aus dem Süden. Erich Wolfgang Korngold verarbeitete die Musik aus Das Spitzentuch der Königin in seiner Operette Das Lied der Liebe (siehe S. 32).
König · Mezzosopran – Königin · Sopran - Donna Irene, Vertraute der Königin · Sopran – Marquise von Villareal, Obersthofmeisterin der Königin · Mezzosopran – Cervantes · Tenor - Graf Villalobos y Rodriguez · Bariton – Don Sancho d‘Avellaneda y Villapinquedones · Tenor – Marquis de la Mancha und Villareal · Bariton – diverse kleine und diverse stumme Rollen - gemischter Chor
2 (auch 2 Picc.) / 2 / 2 (A,B,C) / 2 – 4 / 2 (F) / 3 / 0 – Hrf. – Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamb., Kast.) –Streicher
Uraufführung. 1. Okt. 1880 Wien, Theater an der Wien (A) Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘
Strauss (Sohn), Johann
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 2
Text: Josef Braun, Richard Genée und Maximilian Steiner nach der Komödie „Piccolino“ von Victorien Sardou Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot Victorien Sardou ließ sich von Goethes „Wilhelm Meister“ und der faszinierenden Figur des in Männerkleidern auftretenden Findelkindes Mignon inspirieren. Bei Johann Strauss entspricht Mignon dem Landmädchen Marie, das ihren Geliebten in Verkleidung als Savoyardenknabe Peppino nach Rom verfolgt. Dabei ist es eigentlich egal, ob Marie und die anderen Figuren wie bei Goethe in der Kutsche bzw. wandernd nach Rom gelangen oder wie bei Sardou die Eisenbahn benutzen können. Romantische Italiensehnsucht gab es immer.
Der Karneval in Rom ist in der Erstfassung 1872–1873, der Fassung der Uraufführung 1873 und der Letztfassung 1873 erhältlich. Außerdem ist das nicht zu verwechselnde Stück Karneval in Rom (ohne Der ) aus den letzten Jahren der DDR verfügbar. Dafür schlossen sich die
Komponisten Lothar Klunter und Manfred Nitschke mit Karl-Heinz Siebert, dem langjährigen Dramaturgen des Metropol-Theaters, für eine praktikable Bühnenfassung zusammen. Ob Uraufführungsfassung oder Bearbeitung – das von Johann Strauss selbst als „Polkaoper“ bezeichnete Meisterwerk wird viel zu selten aufgeführt.

Marie, ein Landmädchen · Sopran od. Mezzosopran – Arthur Bryk, Maler · Tenor – Robert Hesse, Maler · Bass – Benvenuto Rafaeli, Maler · Tenor – Graf Falconi · Tenorbuffo – Gräfin Falconi, seine Gattin · Koloratur-Soubrette – Donna Sofronia, Vorsteherin im Damenstift · Alt – Diverse Chargen – Bauern, Bäuerinnen, Malermodelle, Nonnen, Masken, Volk · gemischter Chor und Ballett
2 (auch 2 Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glsp., Glck. (b1), Tamb.) • Streicher • Bühnenmusik: obligat: 2 Trp. (F), Kindertrompeten; optional: alle Bläser und Schlagw.
Uraufführung: 1. März 1873 Wien, Theater an der Wien (A)
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘
Strauss (Sohn), Johann / Nitschke, Manfred Karneval
Operette in drei Akten von Johann Strass (Sohn) (1873) Libretto von Joseph Braun, nach der Komödie „Piccolino“ von Victorien Sardou, Gesangstexte von Richard Genée
Neufassung nach dem Original von Lothar Klunter und Karl-Heinz Siebert
Musikalische Bearbeitung von Manfred Nitschke (1986)
Marie, ein junges Mädchen · Sopran - Artur Bryk, ein Maler · Tenor - Robert Hesse, ein Maler · Bass - Friedrich Rafael, ein verhinderter Maler · Tenor - Graf Giacomo Falconi, ein Bildungsreisender · Tenor - Gräfin Beatrice Falconi, seine junge Gattin · Sopran - Sepp, Hausdiener in der „Goldenen Quelle“ · Tenor - Der Wirt der „Goldenen Quelle“ · Sprechrolle - Therese · Sopran - Franz, ihr Bräutigam · Tenor - Toni, Brautführer · Tenor - Corinna, Elena, Nanett, Anita, Bianca, Flora, Giovanna, Isabella, acht Modelle · Soprane - Sofronia, Äbtissin eines Damenstifts · Sopran - Der Prinzipal einer Gauklertruppe · Sprechrolle - Hochzeitsgesellschaft, Gauklertruppe, Maler, Modelle, Zöglinge, Volk, Karnevalszug · gemischter Chor und Ballett
2 (2. auch Picc.)
2
2
2 - 4
2
3
0 - P. S. (Glsp. · Glocke
· Trgl. · kl. Tr. · gr. Tr. mit Beck.) (1 Spieler) - Hfe. - Str.Bühnenmusik (ad lib.): Klar. - 2 Trp. · 2 Pos. - S. (kl. Tr. · gr. Tr. mit Beck.)
Schott Music • 150‘
Strauss (Sohn), Johann
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 9
Text: F. Zell und Richard Genée
Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot
Eine humorvolle Geschichte über die Macht der Liebe und die Absurdität des Krieges. Die Handlung spielt in Italien, wo zwei verfeindete Kleinsaaten eigentlich Frieden schließen wollen, doch aufgrund von Missverständnissen und Eitelkeiten eskaliert die Situation erneut. Im Mittelpunkt steht die schöne Neapolitanerin Violetta, die von beiden Seiten umworben wird, aber ihre eigenen Pläne schmiedet, um die Männer zu manipulieren. Der charmante Herzog von Pisa verliebt sich in Violetta und will sowohl im Krieg als auch in der Liebe triumphieren. Mit List und Humor bringt Violetta schließlich alle dazu, ihre Differenzen beizulegen und Frieden zu schließen. Der Titel dieses Werkes führt uns gleich doppelt in die Irre: Was könnte weniger lustig sein als ein Krieg? Tatsächlich setzt sich das Werk kritisch mit jener fragwürdigen Lust auseinander, die einen Konflikt aufrechterhält, der sich längst in Banalitäten verloren hat. Selbst der Begriff „Krieg“ erscheint fragwürdig in einer Auseinandersetzung, in der über die tägliche Routine der eigentliche Anlass bereits vergessen wurde. Dem gegenüber stehen die meist vergeblichen Versuche, einer militärischen
Konfrontation zumindest auf amouröser Ebene positive Seiten abzugewinnen.
Wie Jacques Offenbach in La Grande-Duchesse de Gérolstein, so begegnet auch Strauss der Kriegs-Thematik mit Ironie und Satire. Hinter dem komödiantischen Habitus offenbart das Werk unverhohlene Kritik an kleinstaatlichem Nationalstolz und der Unfähigkeit zur Lösung politischer Konflikte. Die Strauss Edition Wien publiziert alle erhaltenen Elemente der drei Fassungen, wovon zwei vollständig aufführbar sind.
Artemisia, Fürstin Malaspina, Gemahlin des regierenden Fürsten von Massa-Carrara · Sopran – Violetta, verwitwete Gräfin von Lomellini, ihre Cousine · Sopran - Marchese
Filippo Sebastiani, Neffe der Fürstin · Tenor - Umberto Spinola · Tenor - Riccardo Durazzo · Tenor - Carlo Spinzi · Bass - Fortunato Franchetti · Tenor - Balthasar Groot, Tulpenzüchter aus Haarlem · Tenorbuffo - Else, seine Frau · Sopran - Pamfilio, Podestà von Massa · Tenor - diverse kleine und diverse stumme Rollen - gemischter Chor
2 (auch 2 Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 – 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. •
Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glck. (g, a, h, c)) • Streicher • Bühnenmusik: obligat: 0 / 2 / 2 / 2 – 2 / 2 (C,F) / 0 / 0 • kl. Tr.; optional: alle Bläser und Schlagwerk
Uraufführung: 25. November 1881 Wien, Theater an der Wien (A)
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

”Mein idealer Lebensweck, ist Borstenvieh und Schweinespeck“
Der Zigeunerbaron
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 11
Text: Ignatz Schnitzer nach der Novelle „Saffi“ von Mór Jókai
Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot
Eine Geschichte voll Liebe, Abenteuer und Heimatgefühl vor dem Hintergrund der österreichisch-ungarischen
Monarchie: Der junge Sándor Barinkay kehrt nach Jahren der Verbannung in seine Heimat zurück, um den Besitz seines verstorbenen Vaters zurückzugewinnen. Dort verliebt er sich in Saffi, die Tochter einer Zigeunerkönigin, und wird von der Zigeunergemeinschaft als ihr „Baron“ anerkannt. Doch Intrigen und gesellschaftliche Vorurteile bedrohen ihre Liebe, besonders, da Barinkay zunächst








die wohlhabende Arsena, Tochter eines habgierigen Schweinezüchters, heiraten soll. Schließlich klären sich alle Missverständnisse, als Barinkay seinen Adelstitel und Saffi ihre königliche Herkunft zurückerlangen. Mit unvergesslichen Melodien wie dem „Zigeunerlied“ verbindet Strauss romantische Leidenschaft mit einem Hauch von exotischem Flair und politischem Zeitgeist.
Wegen der negativen Konnotation des Wortes „Zigeuner“ ist der Titel des Werkes heute umstritten. (Die Komische Oper half sich bei ihrer Inszenierung von 2021 mit einem Fragezeichen: „Der Zigeunerbaron?“) Doch es gibt keinen Anlass, dem Werk eine diskriminierende Absicht zu unterstellen. Ganz im Gegenteil ist diese Operette vom Geist des Ausgleichs und der Völkerverständigung getragen. Und die scheinbar kriegslüsternen Einlassungen erweisen sich bei genauer Betrachtung als massive Kritik an der martialischen Politik des 19. Jahrhunderts.
Mit zahlreichen Solistinnen und Solisten, zwei gleichzeitig agierenden Chören und einem ausladenden zweiten Akt gehört das Werk zu den aufwendigen Bühnenwerken von Johann Strauss. Dies liegt nicht zuletzt in der ursprünglichen Anlage als komische Oper. Innerhalb der Neuen Strauss Edition Wien liegen die Erstfassung 1885, die Fassung der Uraufführung 1885 und die Letztfassung 1886 vor.
Graf Peter Homonay, Obergespan des Temeser Komitats · hoher Bariton - Conto Carnero, königlicher Kommissär · Tenor od. Bariton - Sándor Barinkay, ein junger Emigrant · Tenor - Kálmán Zsupán, ein reicher Schweinezüchter im Banat · Tenorbuffo - Arsena, seine Tochter · Soubrette - Mirabella, Erzieherin im Hause Zsupáns, Mezzosopran - Ottokar, ihr Sohn · Tenorbuffo - Czipra, Zigeunerin · Mezzosopran - Saffi, Zigeunermädchen · Sopran - Diverse Chargen - Schiffsknechte, Zigeuner, Zigeunerinnen, Soldaten, Husaren, Marketenderinnen, Hofherren, Hofdamen, Volk · gemischter Chor 2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamtam, Tamb., Sporen) • Streicher • Bühnenmusik obligat: 3 Ambosse, nur in der A-Fassung: 2 Trp. (F), optional: alle Bläser und Schlagwerk
Uraufführung: 24. Oktober 1885 Wien, Theater an der Wien (A)
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘
Strauss (Sohn), Johann
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 3
Text: Richard Genée nach der Komödie „Le Réveillon“ von Ludovic Halévy und Henri Meilhac Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot
Deutsch • Französisch
Eine flotte französische Komödie aus der Feder des legendären Autorenduos Henri Meilhac und Ludovic Halévy diente Richard Genée als Vorlage für seine ausgesprochen wienerische Adaption dieses Verwirrspiels um Sein und Schein. Johann Strauss schuf dazu eine Musik, in der sich die Leichtigkeit und Frivolität des Pariser Boulevards ebenso spiegeln wie der Charme der Wiener Lebensart. Doch auch wenn Witz und Humor vordergründig dominieren, steht im Hintergrund unverhohlene Gesellschaftskritik. Die im ersten Akt hervortretenden Standesunterschiede und die Arroganz des wohlhabenden Bürgertums verlieren sich in der Maskerade des zweiten Aktes. Und der als Rahmenhandlung angelegte Ball im Palais Orlovsky eignet sich hervorragend für Einlagen und aktuelle Bezüge jeder Art, offenbart aber auch den morbiden Zustand einer Gesellschaft, die sich stets nur über ihren Standesdünkel definiert hat. Die Fledermaus ist das einzige seiner zahlreichen Bühnenwerke, das Strauss nie einer Umarbeitung unterzogen hat. Das Werk liegt in zwei Fassungen vor: zum einen in der gemeinfreien, von Karl Haffner und Richard Genée bearbeiteten Fassung bei Schott Music (nächster Eintrag). Zum anderen in der Kritischen Ausgabe der Strauss Edition Wien (dieser Eintrag). Eine neu aufgefundene Quelle ermöglichte es der Strauss Edition Wien, erstmals eine werkgetreue Ausgabe des Meisterwerkes vorzulegen. Ein Klavierauszug mit französischer Übersetzung (Pascal Paul-Harang) ist verfügbar.
Gabriel von Eisenstein, Rentier · Tenor od. hoher Bariton Rosalinde, seine Frau · Koloratursopran - Frank, Gefängnisdirektor · Bariton - Prinz Orlofsky · Mezzosopran - Alfred,
Gesangslehrer · Tenor - Dr. Falke, Notar · Bariton - Dr. Blind, Advokat · Tenorbuffo - Adele, Stubenmädchen Rosalindes · Koloratursopran oder Koloratur-Soubrette - Ida, Adeles Schwester · Sopran - Frosch, Gerichtsdiener · KomikerDiverse Chargen - Gäste des Prinzen Orlofsky, Herren, Damen, Bediente · gemischter Chor
2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A, B, C) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glsp., Glck. (e1, e2), Tamb., Sporen) • Streicher
Uraufführung: 5. April 1874 Wien, Theater an der Wien (A) · Musikalische Leitung: Johann Strauss (Sohn)
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘
Strauss (Sohn), Johann
Komische Operette in drei Akten (1874) nach Henri Meilhacs und Ludovic Halévys „Le Réveillon“ bearbeitet von Karl Haffner und Richard Genée
Gabriel von Eisenstein, Rentier · Tenor - Rosalinde, seine Frau · Sopran - Frank, Gefängnisdirektor · Bariton - Prinz Orlofsky · Mezzosopran - Alfred, Gesangslehrer · Tenor - Dr. Falke, Notar · Bariton - Dr. Blind, Advokat · Tenor - Adele, Stubenmädchen Rosalindes · Sopran - Ida, ihre Schwester · Sopran - Frosch, Gerichtsdiener · Sprechrolle - Iwan, Kammerdiener des Prinzen · Sprechrolle - Gäste des Prinzen Orlofsky · 4 Soprane, 4 Alti - Ali-Bey, ein Ägypter · TenorRamusin, Gesandschafts-Attaché · Tenor - Murray, ein Amerikaner · Bass - Cariconi, ein Marquis · Bass - Vier Diener des Prinzen · Tenöre - Herren und Damen, Masken, Bediente · Chor
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3
0 - P. S. (2 Gl. [tiefe in E und hohe in G] · Handgl. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. · Sporen) - Hfe. - Str.
Uraufführung: 5. April 1874 Wien, Theater an der Wien (A) · Musikalische Leitung: Johann Strauss (Sohn)
Schott Music • 150‘
Strauss (Sohn), Johann
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 10
Text: F. Zell und Richard Genée
Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot
Der attraktive Herzog von Urbino will den Karneval in Venedig nutzen, um die schöne Senatorengattin Barbara zu verführen, was ihr Gatte zu verhindern versucht. Ohne beider Wissen wird Barbara durch ihre Vertraute Ciboletta ersetzt, während Caramello, der ebenfalls ahnungslose Diener des Herzogs, wiederum seine Geliebte Ciboletta zurückgewinnen möchte. Die Maskerade und die nächtlichen Verwechslungen führen zu komischen und pikanten Situationen. Am Ende klären sich jedoch die Missverständnisse auf und die glücklichen Paare feiern im festlichen Karnevalstreiben ihre Liebe.
Venedig und der Karneval stehen hier sinnbildlich für eine Welt voller Täuschung und Doppelmoral. Während die Männer glauben, das Spiel zu kontrollieren, sind es letztlich die Frauen, die triumphieren – sei es durch List oder durch Zufall. Inmitten der Maskerade stehen betro -




gene Ehemänner und ahnungslose Verführer, während das einfache Volk die nächtlichen Verwirrungen schamlos für sich nutzt. „Man steckt ein …“, singt Pappacoda und spielt damit sowohl auf die Plünderei als auch auf die verletzte männliche Eitelkeit an. Am Ende bleibt die Frage: Wer manipuliert hier eigentlich wen?
Die latente Frivolität des Librettos entstammt wie bei der Fledermaus der französischen Textvorlage. Auch wenn dessen Vorzüge bei der Uraufführung in Berlin noch nicht entsprechend gewürdigt wurden, brachte die eilig für Wien verfasste Umarbeitung den erhofften Erfolg.
Guido, Herzog von Urbino · Tenor - Bartolomeo Delacqua · Bariton - Stefano Barbaruccio · Bass - Giorgio Testaccio · Bass - Barbara, Delacquas Frau · Mezzosopran - Agricola, Barbaruccios Frau · Mezzosopran od. Alt - Annina, Fischerstochter, Barbaras Milchschwester · Sopran - Caramello, des Herzogs Leibbarbier · Tenor - Pappacoda, Makkaronikoch · Tenorbuffo - Ciboletta, Zofe im Dienst Delacquas · Soubrette od. Mezzosopran - Enrico Piselli, Seeoffizier im Dienst der Republik Venedig, Delacquas Neffe - Diverse Chargen - Kavaliere, Gäste, Musikanten, Diener des Herzogs, Senatoren, Senatorsfrauen, Masken, Gondolieri, Matrosen, Fischer, Mädchen und Frauen aus dem Volk · gemischter Chor
2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. / 2 Git. / 2 Zith. • Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glsp., Glck. (c1), Bck., Tamb.) • Streicher • Bühnenmusik: obligat: 2 Trp., optional: alle Bläser
Uraufführung: 3. Oktober 1883 Berlin, Neues FriedrichWilhelmstädtisches Theater (D)
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘
Strauss (Sohn), Johann
Romantisch-phantastische Operette
Textliche Neufassung von Wolf Ebermann und Carl Riha Musikalische Neufassung von Wolfgang Schumann
König Indigo von Vindobonesien - Janio von Guntramsdorf, dessen Adjutant - Romadur, Oberpriester des Königs - Mitglieder der vindobonesischen Regierung: Corruptio, Wirtschaftsminister; Caracho, Kriegsminister; Moralino, Kultusminister; Pennunsio, Finanzminister - Ali Baba, fliegender Händler - Toffana, ehemalige Favoritin des Königs - Damen des Kgl. Lyzeums zu Vindobonesien: Mizzi Strobel, genannt Fantasca; Arabella; Anastasia; Eulalia; Sophie-Karolin - Pomeisl, Schuldiener - Chor und Ballett
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3
0 - P. S. (Glsp. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Hfe. - Str. Schott Music • 225‘

Strauss (Sohn), Johann Prinz Methusalem
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 5
Text: Delacour und Victor van Wilder, in deutscher Bearbeitung von Carl Treumann Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot
Mit Prinz Methusalem wollte Johann Strauss ein genuin französisches Werk schaffen. Die geplante Uraufführung kam jedoch nicht zustande, sodass das bereits weitgehend auf Französisch komponierte Werk für Wien umgearbeitet werden musste – erhalten blieben das Pariser Flair und der französische Humor. Er sorgte dafür, dass die unverhohlene Kritik an Kleinstaaterei und an den Eitelkeiten kleingeistiger Fürsten die Zensur überstand. Erst dem Liebespaar Methusalem und Pulcinella, die aus Staatsräson verbunden werden sollten, sich dann ineinander verlieben und schließlich wieder wie Romeo und Julia zwischen den Fronten landen, gelingt die Beendigung des sinnlosen Kriegsgeplänkels. Das Libretto ist heute aktueller denn je. Die Kritische Werkausgabe der Strauss Edition Wien konnte die Genese aller Fassungen lückenlos rekonstruieren, wovon zwei Versionen vollständig aufgeführt werden können.
Sigismund, Fürst von Trocadero · Tenor - Pulcinella, seine Tochter · Sopran - Marchese Carbonazzi, Ratspräsident · Bass - Vulcanio, Oberzeremonienmeister · Bass - Cyprian, Herzog von Rikarak · Tenor - Sophistika, seine Gemahlin · Mezzosopran - Prinz Methusalem · Mezzosopran - Trombonius, Komponist · Tenor - diverse kleine und diverse stumme Rollen - gemischter Chor
2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B,C) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr.) • Streicher • Bühnenmusik: 2 Trp. (F), Röhrengl. (b1); in der C: Fassung der Ouverture zusätzlich: 2 FlHr. (B), BFlHr. (B), 3 Trp. (Es), 2 Pos., Oph.
Uraufführung: 3. Januar 1877 Wien, Carltheater (A)
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann Wiener
Operette in 3 Akten
Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 17 für die Bühne bearbeitet von Adolf Müller jun.
Text: Victor Léon und Leo Stein
Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot
Eine spritzige Verwechslungskomödie über Liebe, Eifersucht und die Lebensfreude Wiens: Der Diplomat Graf Zedlau lebt in einer arrangierten Ehe mit seiner Frau Gabriele, während er eine Affäre mit der Tänzerin Franzi hat und zugleich die Probiermamsell Pepi umgarnt, die jedoch die Geliebte seines Dieners Josef ist. Die Verwicklungen beginnen, als Gabriele unangemeldet in Wien erscheint, um ihren Mann zu überraschen, der nun mühsam versuchen muss, seine Liebschaften voreinander zu verbergen. Nach turbulenten Missverständnissen, Verkleidungen und Eifersüchteleien kommt es schließlich zur Versöhnung.
Im Jahr 1899 war Johann Strauss nicht mehr geneigt, eine neue Operette zu komponieren. Also sollte Adolf Müller jr. ein Werk aus dem Fundus des kaum zu überblickenden Œuvres zusammenstellen. Die zur Zeit des Wiener Kongresses angesiedelte Handlung erlaubte Müller die Integration früherer Kompositionen des Meisters, ohne dadurch die Einheit des Werkes zu gefährden. Zentrum von Handlung und Musik ist das Ur-Wienerische – so entstand quasi als Abschiedsvorstellung das wohl wienerischste aller Bühnenwerke. Die Ausgabe der Strauss Edition Wien enthält neben der Rekonstruktion von Adolf Müllers Urfassung auch eine vollständige wissenschaftliche Aufarbeitung dieser einzigartigen Kom -
pilation. Außerdem ist eine Kammerfassung erhältlich, die jahrelang im Staatstheater am Gärtnerplatz gespielt wurde.
Fürst Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von ReußSchleiz-Greiz · Bariton - Balduin Graf Zedlau, Gesandter von Reuß-Schleiz-Greiz in Wien · Tenor - Gabriele, seine Frau · Sopran - Graf Bitowski - Demoiselle Franziska Cagliari, Tänzerin im Kärntnertortheater in Wien · Sopran - Kagler, ihr Vater, Karussellbesitzer · Komiker od. Bass-Buffo - Pepi Pleininger, Probiermamsell · Soubrette - Josef, Kammerdiener des Grafen · Tenorbuffo - Diverse Chargen - Gesinde, vornehme Ballgäste, Volk im Heurigenlokal · gemischter Chor, Ballett
2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B,C) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamb.) • Streicher • Bühnenmusik: 2 Vl., Git., A*B*-Fassung: Klar. (B) oder C-Fassung: Akkordeon
Uraufführung: 26. Oktober 1899 Wien, Carltheater (A)
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘
Strauss (Sohn), Johann / Rot, Michael Wiener Blut (1899 (1905))
Bearbeitung als Kammeroper von Michael Rot nach der Neuen Johann Strauss Gesamtausgabe (2014)
Text von Victor Léon und Leo Stein für die Bühne bearbeitet von Adolf Müller jun.
Fürst Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von ReußSchleiz-Greiz · Bariton - Balduin Graf Zedlau, Gesandter







von Reuß-Schleiz-Greiz in Wien · Tenor - Gabriele, seine Frau · Sopran - Graf Bitowski - Demoiselle Franziska Cagliari, Tänzerin im Kärntnertortheater in Wien · Sopran - Kagler, ihr Vater, Karussellbesitzer · Komiker od. Bass-Buffo - Pepi Pleininger, Probiermamsell · Soubrette - Josef, Kammerdiener des Grafen · Tenorbuffo - Diverse Chargen - Gesinde, vornehme Ballgäste, Volk im Heurigenlokal · gemischter Chor, Ballett
1 / 1 / 2 (A,B,C) / 1 • 2 (F) / 0 / 1 (ad lib.) / 0 • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamb.) • Streicher
Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘
Suppé, Franz von Boccaccio
Operette in drei Aufzügen (1879)
Libretto von F. Zell und Richard Genée
Was hat der Autor Giovanni Boccaccio als Student in Florenz erlebt? Was spiegelt sich davon in seinen berühmten erotischen Schelmen- und Abenteuergeschichten „Decamerone“, die er später schrieb? Der Musikwissenschaftler Albert Gier wies nach, dass die Librettisten Richard Génée und Camillo Walzel (Pseudonym: F. Zell) es mit den historischen Ereignissen nicht sonderlich genau nahmen. Die Chronologie bis zum fiktiven Happyend – in dem Boccaccio schließlich seine geliebte Fiametta in die Arme schließen kann – wurde gründlich durcheinandergebracht.
Die Originalversion sah für die Figur des jungen Boccaccio eine Hosenrolle vor. Marie Geistinger, gefeierte Operettendiva und Theaterdirektorin, brillierte darin bei der frühen Produktion des Theaters an der Wien. In der vorliegenden Einrichtung für das dem Sozialistischen Realismus verpflichteten Ostberliner Metropol-Theaters wurde der Boccaccio dagegen als Bariton-Partie angelegt. Die Autoren verknappten die Ereigniskette im mittelalterlichen Florenz und reicherten sie mit einigen sozialkritischen Schärfungen an. Boccaccio wurde von Rom bis Manaus in Brasilien gespielt und zählt zu den ganz großen Triumphen der Wiener Operette. Sie ist gewissermaßen das Tor von der italienischen Belcanto-Oper ins Walzer-, Polka- und Galopp-Delirium. Das Comeback dieses Reißers für eine Gesellschaft zwischen Fakenews und Storytelling ist längst überfällig.
Giovanni Boccaccio - Pietro, Prinz von Palermo - Scalza, Barbier - Beatrice, sein Weib - Lotteringhi, Fassbinder - Isabella, sein Weib - Lambertuccio, Gewürzkrämer - Petronella, sein Weib - Fiametta, beider Ziehtochter - Studenten, mit Boccaccio befreundet: Leonetto, Tofano, Chichibio, Guido, Cisti, Federico, Giotto, Rinieri - Ein Unbekannter (Herzog von Toscana) - Der Majordomus des Herzogs - Ein Kolporteur - Madonna Iancofiore - Elisa, deren Nichte - Marietta, ein Bürgermädchen - Madonna Nona Pulci - Deren Töchter: Augustina, Elena, Angelica - Gesellen bei Lotteringhi: Alberto, Gerbino, Giudotto, Riccardo, Feodoro, Rostogio - Fresco, Lehrjunge bei Lotteringhi - Bettler: Checco, Giacometto, Anselmo, Tita Nana - Mägde im Dienste Lambertuccios: Filippa, Oretta, Violanta -
Personen der Commedia dell‘Arte: Pantalone - Pantalones
Freunde: Brighella, Pulcinella - Colombina - ArlecchinoScapino, dessen Gefährte - Narcissino, ein Sizilianer, Colombinens Freier
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 1 - P. S. (Gl. · Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Str.
Uraufführung: 1. Februar 1879 Wien, Carltheater (A)
Schott Music • 150‘
Suppé, Franz von

Operette in einem Akt von Poly Henrion (1865) Textliche Neufassung von Ernst Hübner und Horst Bonnet
Musikalische Einrichtung von Robert Hanell
Pygmalion, ein Bildhauer · Tenor - Ganymed, sein Diener · Mezzosopran (Hosenrolle) - Mydas, ein reicher Kunsthändler · Tenor-Buffo - Galathee, eine Statue · Koloratursopran - Bürger Zyperns, beiderlei Geschlechts · Chor
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · kl. Tr. · gr. Tr.) (1 Spieler) - Str.
Uraufführung: 30. Juni 1865 Berlin, Meysels Theater (D) Schott Music • 60‘


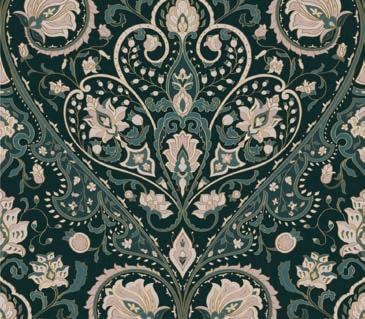






Paul Lincke komponierte neben seiner phantastischen Lokalposse Frau Luna die preußische Offenbachiade Lysistrata und begeisterte sich für den historischen Casanova. Walter Wilhelm Goetzes Adrienne wirkt wie eine jüngere Schwester älterer Operetten aus den Milieus des Hochadels und der schönen Künste nach Wiener Vorbild. Die Berliner Operette ist also ein viel weiteres Feld als man gemeinhin denkt. Die Grenzen zur Wiener Operette sind fließend, wie Erich Wolfgang Korngolds Das Lied der Liebe zeigt. Hier belebte der Komponist die goldenen, aber vergangenen Zeiten der Wiener Operette neu – für Berlin.
Die Berliner Operettenspielart entwickelte sich im deutschen Kaiserreich aus der lokalen Posse und dem Bekanntwerden Wiener Paradestücke. Sie erlebte ihren Zenit während der Weimarer Republik, in der sie Kurt Weill zur Opposition und damit zu den später als Musical-Vorläufern betrachteten Songspielen inspirierte. Im Nationalsozialismus blieb das Muster der Berliner Operette erhalten und führte ein äußerst schauprächtiges Eigenleben. Die Berliner Operette als Verschmelzung von Offenbachiade, Wiener Operette, Posse und mondänem Luxusspektakel erlangte internationale Bedeutung durch die Fluchtwelle jüdischer Operettenschaffender nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden neue Werke und Bearbeitungen von um 1900 geborenen Bühnenkomponisten wie Guido Masanetz und Paul Lincke, bis eine Generation von Newcomern das musikalische Unterhaltungstheater in Ost- und Westdeutschland veränderte. Noch Gerhard Kneifels Musical Bretter, die die Welt bedeuten für das Ostberliner Metropol-Theater ist ein Spätzünder von Berliner Operetten um Familienthemen.



Felix, Hugo
Operette in 3 Akten (1902)
Libretto von Maurice Ordonneau und Benno Jacobson
Mac Sherry · Tenor - Jane, seine Nichte · Sopran - Anatole, sein Neffe · Tenor - Léonard, Gesandtschaftsattaché · Tenor
- Mistigrette, Tänzerin · Sopran - Pepita, ehemalige geliebte Léonards · Sopran - Cathérine, Anatoles Haushälterin · Alt
- Aurillac, ihr Ehemann · Bass - kleine Solo-Rollen: Die Fleischerin · Alt - Der Bäcker · Tenor - Das Milchmädchen · Alt
- Der Kohlenhändler · Tenor - Die Gemüsefrau · Sopran - Der Hausherr · Tenor - Die Modistin · Alt - Der Schneider · Tenor
- Die Blumenschmückerin · Alt - Der Friseur · Tenor - Die Konfektioneuse · Sopran - Ein Beamter · Tenor – Chor
2 (auch Picc.) · 2
2
1 - 2
2
2
0 - P. S. (Trgl. · kl. Tr. · Gr. Tr. u. Becken · Glocke ·Xyl. · Tamb.) (2 Spieler) - Str.
Uraufführung: November 1902 Berlin, Central Theater (D)
Musikverlag Robert Lienau
Operette in 3 Akten (1926) Libretto von Oskar Felix nach Eugène Scribe Walter Wilhelm Goetzes Operettenschaffen umfasste possenhafte Lustspiele sowie historisch pikante Sujets. In Adrienne geht es um die Romanze zwischen der französischen Schauspielerin Adrienne Lecouvreur und Fürst Moritz von Sachsen. Spieluhrenartige Klänge und große Lieder, manchmal sogar in der Klangsprache Lehárs, begleiten ihr Liebesverhältnis. Adrienne spielt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Königreich Sachsen. Anna Iwanowna, verwitwete Herzogin von Kurland und konditionsstarke Branntwein-Genießerin, ist nicht begeistert von der delikaten Liaison ihres Gatten in spe Moritz mit Adrienne. Goetzes Erfolgsstück wächst zum großen Operetten-Sittenbild mit Damen. Die Protagonistinnen lassen sich für die Liebe nicht in Fesseln schlagen. Sie stellen ihre Attraktivität gleichermaßen in den Dienst des Vergnügens und der Vernunft. Das halb vergessene Operetten-Juwel, welches in einer Aufnahme mit dem Kölner Rundfunkorchester unter Franz Marszalek zugänglich ist, kann ohne Weiteres mit Werken Paul Linckes konkurrieren.
Diese ‚Berliner Operette‘ erlebte ihre Uraufführung in Hamburg bereits 1926 – also zehn Jahre vor der durch den Textdichter Oskar Felix umfassend bearbeiteten Fassung für Berlin 1936. In einigen Passagen erklingen tatsächlich Puccini-nahe Stellen.
August der Starke · Humorist - Moritz von Sachsen, sein Sohn · Tenor - Anna Iwanowna, verwitwete Herzogin von Kurland · Soubrette - Graf Kayserling · Buffo - Bestuscheff, Oberkammerherr · Charge - Larsdorf, Geheimsekretär · Charge - Adrienne Lecouvreur · Sängerin - Fleury, Ballettmeister · Komiker - Ignaz Poppowitsch, Diener des Herzogs Moritz · drastischer Komiker - Graf Brühl, Oberkammerherr am Sächsischen Hof · Charge - Baron von Kobel, Adjutant des Herzogs Moritz · singende Charge - weitere kleine RollenChor – Ballett
2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 2 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Vibr. · Trgl. · Beck. · Gong · Tamb. · kl. Tr. · Holztr. · gr. Tr. · Schellen · Klatsche) (2 Spieler) - Hfe. · Cel. - Str.
Uraufführung: 24. April 1926 Hamburg (D)
Astoria Verlag
Goetze, Walter Wilhelm
Operette in 3 Akten (1950)
Libretto von Emil Ferdinand Malkowsky und Walter Wilhelm Goetze
Mucki Nix · Tenor - Carola, Gutsbesitzerin auf Ebernstein · Sängerin - Kunibert, Senator, ihr Onkel · Charakterkomiker - Oberrichter · père noble - Martin Knipperling, Schneidermeister · Charge - Hannes, sein Sohn · Buffo - Franzl, ein Lehrjunge · kleine Rolle - Rosamunde · erste SoubretteHildegunde · zweite Soubrette - Flock, Schneidermeister · Gesangsrolle - Zorn, ein Bürger · Gesangsrolle - Der Ratsschreiber, Der Gerichtsbote, Der Diener · kleine Sprechrollen - Der Trommler, junge Burschen und Mädel, Bürger, Diener · Chor
2 (2. auch Picc.)
2
2
2 - 4
2
3
0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Gl. · Trgl. · hg. Beck. · Beckenpaar · Gong · Schellen · Tamb. · kl. Tr. · Tomt. · Holztr. · Rührtr. · gr. Tr. m. Beck. · Ratsche · Besen) - Hfe. - Str.
Uraufführung: 15. November 1950 Heidelberg (D) Astoria Verlag
Goetze, Walter Wilhelm
Operette in 3 Akten (1935) Libretto von Paul Harms und Günther Bibo nach Hippolyt Schaufert
König Jakob · 1. Komiker - Prinz William, sein Sohn · Tenor - Hippolyt Lennox, sein Minister· komischer Charge - Gwendoline Lennox, Oberhofmeisterin · komische Alte - Phips, königlicher Geheimsekretär · Buffo - Habakuk Thomson, Wirt vom Hafengasthof · drastischer Komiker - Harriet, seine
Tochter · Soubrette - Margareta · Sängerin - weitere kleine Rollen – Chor
2 (2. auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 · 1 - 2 · 2 · 3 (1. u. 2. ad lib.) · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Trgl. · Beck. · Gong · Tamb. · kl. Tr. · Holztr. · Rührtr. · gr. Tr. · Ratsche · Sandpapier) - Hfe. · Cel. - Str.
Uraufführung: 16. Mai 1935 Berlin (D)
Astoria Verlag
Goetze, Walter Wilhelm Wenn Männer
Ein musikalischer Schwank in 3 Akten (1911) nach einem Lustspiel-Motiv von Fritz FriedmannFrederich
Peter Zabel (Ernest) · Tenor - Käthe, seine Frau (Rose) · Sopran - Elfriede, seine Schwester (Yvonne) · Schauspielerin - Benjamin Posemann, Kommerzienrat (Larousse) · TenorLeonie, seine Frau · Sopran - Oskar Weiss (Octave) · Tenor - Anna, Stubenmädchen (Georgette) · Sopran - Nebenrollen – Chor
2 (auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Glöckchen · Trgl. · Tamb. · Beck. · gr. Tr. · kl. Tr. · Peitsche · Klapperholz) (2 Spieler) - Hfe - Str. Musikverlag Robert Lienau
Jessel, Leon / Strasser, Alfred
Operette in drei Akten von Aksel Lund und Erik Radolf (1934)
Musikalische Bearbeitung von Alfred Strasser
Gotthold Brauner, Oberförster · Chargenspieler - Gerti, seine Tochter · Sängerin - Dr. Robert Krusius, Rechtsanwalt · Bonvivant - Gitta, seine Schwester · jugendl. Salondame - Hans Schmidt · Tenor - Bob Ziegler, Reporter · Buffo - Bastl Huber, Briefträger · komische Charge - Christl, seine Tochter · Soubrette - Ein Herr aus Sachsen · Komiker - Eva Thormann, Schauspielerin · Salondame (nicht singend) - Alois Brack, Wirt zur „Alten Post“ · Chargenspieler - Martl, Angestellte bei Brack · drastische Komische - kleine Sprechrollen – Chor
2 · 1 · 2 · 1 - 3 · 3 · 2 · 0 - P. S. - Schlag-Gitarre · Hfe. - Str. (6 · 4 · 4 · 3 · 2) - Auf der Bühne: Harm. (evtl. Akk.) [Bei kleinerer Besetzung zusätzlich Klavier als Füllinstrument]
Uraufführung (In einer Bearbeitung von Hermann J. Vief): 12. April 2009 Neuburg/Donau, Stadttheater (D) · Musikalische Leitung: Nicola Kloss · Inszenierung: Oliver Vief Astoria Verlag

Korngold, Erich Wolfgang
Operette in drei Akten von Ludwig Herzer (1931) nach der Musik zu „Das Spitzentuch der Königin“ von Johann Strauss (Sohn) bearbeitet von Erich Wolfgang Korngold
Vom Flirt zur Heirat – am Ende von Das Lied der Liebe kommen die richtigen Paare zueinander: Der gutaussehende Graf Richard Auerspach mit der jungen Baronin Paulette, sein Vetter Franz Auerspach mit der bürgerlichen Burgschauspielerin Lotte Hohenberg. Mit viel Schmelz und einer Messerspitze Ironie geht es in dieser Verwechslungskomödie zur Sache, inklusive kurzer Verstimmung und fröhlichem Happy End.
Korngold hatte von Johann Strauss’ Witwe Adele die Genehmigung zur Bearbeitung von dessen Operette Das Spitzentuch der Königin erhalten. Das am Ende von Spaniens Goldenem Zeitalter spielende Stück frisierte er für die Uraufführung am Berliner Metropol-Theater 1931 um und schuf für die neue Handlung eine brillante Instrumentation. Bekannte Walzermelodien wie zum Beispiel Rosen aus dem Süden durchziehen die Partitur. Das Lied der Liebe wurde nach seiner Uraufführung am 23. Dezember 1931 im Berliner Metropoltheater an 17 Bühnen nachgespielt. Die Partie des Richard schrieb Korngold dem Startenor Richard Tauber in die Kehle. Den Orchestersatz bereicherte Korngold mit Harfe und markanten Bläserakzenten. Er gewann durch eine Kultur unschematischer Temporückungen und unkonventionelle Klangschichtungen neue Farben für die Gattung. Die Operette tritt hier in Konkurrenz zur Traumfabrik des frühen Tonfilms.
Fürst Franz Auerspach, Flügeladjutant des Kaisers - Graf Richard Auerspach, Ulanenrittmeister, sein Vetter - Fürstin Pauline Metternich - Baronin Paulette Kerekháza, junge Witwe, ihre Nichte - Baron Gigi Maria Josef Kerekháza,
ihr Schwager - Lotte Hohenberg, Burgschauspielerin - Lori Fallhuber, Solotänzerin der Hofoper in Wien - Der Oberst - Rittmeister Schöndorf - Oberleutnant Puchberg - Oberleutnant Markenau - Erster Kellner - Zweiter Kellner - Pali, Oberknecht - Hotelstubenmädchen: Tini, Mizzi - Der Kammerdiener bei Lotte Hohenberg - Zinkendorf - Hohenstein - Der Sekretär des Fürsten Auerspach - Eine junge Komtesse - Damen des Ballettkorps, Herren und Damen der Gesellschaft, Offiziere
2 (2.auch Picc.) · 1 · 2 · Altsax. · Tenorsax. · 1 - 3 · 2 · 3 · 0P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · Gong · Beck. · Tamt. · Holztr. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Hfe. · Cel. - Str.
Uraufführung: 23. Dezember 1931 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Erich Wolfgang Korngold · Inszenierung: Alfred Rotter · Bühnenbild: Erich E. Stern · Choreographie: Bruno Arno
Schott Music • 150‘
Lincke, Paul
Operette in drei Akten (1913)
Libretto frei nach dem Französischen von Paul Lincke
Casanova ist bei Lincke der einzige Mann, der nicht durch Karrierestreben, Dienstbeflissenheit, Opportunismus, Geldgier und Kriecherei verblödet. Eine Episode aus der Biografie des Helden wurde in Linckes Textbuch zum Handlungsmotor: Die Gefangenschaft des Edelmanns auf der Insel Forte Sant’Andrea vor Venedig. Bei Lincke macht Casanova der Nichte des Gefängniswärters und deren Patin schöne Augen und türmt in eine rauschende Ballnacht, bei der er Herzen und Sinne neuer Frauen entflammt. Der Womanizer mit dem abenteuerlichen Leben im Abendrot des Feudalismus nimmt nicht nur sein eigenes, sondern vor allem das Begehren des anderen Geschlechts ernst. Dafür drücken die Erhörten
beide Augen zu und nehmen es nicht allzu schwer, wenn Casanova nicht treu sein will. Diesen emanzipatorischen Aspekt rückte Wolfgang Dosch in seiner erfolgreichen Inszenierung am Theater Nordhausen 2011 und später am Theater Rudolstadt in den Vordergrund.
Der immense Erfolg von Frau Luna lenkte davon ab, dass der Schlager-, Possen- und Operetten-Repräsentant Lincke mit Lysistrata und Casanova weitaus brisantere erotische Stoffe vertonte. In diesen Werken setzte er Offenbachs Travestien und der in Berlin zum Erfolg gewordenen Eine Nacht in Venedig von Strauss originelle Neuschöpfungen entgegen. Linckes Operetten eignen sich mit ihrer direkten Bühnenwirksamkeit insbesondere für kleinere Theater und spartenübergreifende Besetzungen.
Casanova · Tenor - Troselli, Kommandant des Fort St. Andrée · Charakter-Komiker - Leonore, seine Gemahlin · 1. Sängerin - Cordini, venezianischer Edelmann · komischer Geck - Cornero, venezianischer Edelmann · Bass - Teresina, seine Tochter · 2. Sängerin - Giacomo, Gefangenenaufseher · 2. Charakter-Komiker - Isabella, seine Nichte · SoubretteNarcisso, ein junger Aufwärter · jugendlicher Komiker - Page - Gondolier - Offizier - Offiziere – Wachen
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 Korn. · 0 · 3 · 0 - P. S. (Gl. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Beck.) (3 Spieler)Hfe. · Klav. - Str.
Uraufführung: 1913 Darmstadt (D) Apollo-Verlag • 120‘
Operette in zwei Akten (1899) von Heinz Bolten-Baeckers (Originalfassung)
Linckes Musiknummern sind gleichermaßen Evergreens und Gassenhauer. Die musikalischen Eckpfeiler „Schlösser, die im Monde liegen“ und die in spätere Fassungen eingefügte „Berliner Luft“ umrahmen Divenmaterial à la Anneliese Rothenberger und doppeldeutigen Possenhumor für die Geschwister Pfister im Tipi am Kanzleramt. Bereits bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es von der Traumeskapade des Ingenieur-Tüftlers Fritz Steppke auf den Mond und zurück immer aufwendigere Spielfassungen.
Auf die Fassung des Dramaturgen und Operetten-Fachautors Otto Schneidereit für das Ostberliner MetropolTheater 1957 (siehe zweiter Eintrag) schwören Expert:innen bis heute. Diese ist so verbreitet, dass es immer wieder zu Verwechslungen mit dem Originaltextbuch kommt. Schneidereit parallelisierte die Mond-Personage konsequent mit Figuren und Typen aus dem Berliner Zille-Milieu. So erhält Frau Luna, die „Göttin des Mondes“, in der Chansonette Flora Huschke eine terrestrische Parallelfigur. Lunas Verehrer Prinz Sternschnuppe verlängerte Schneidereit zum Berliner Leutnant von Schlettow. Und sogar der Briefträger aus dem Traum des Raumfahrtpioniers Fritz Steppke hat einen Doppelgänger im Mondboten. Egal in welcher Fassung: Mit Frau Luna schuf Lincke den Prototyp der Berliner Operette – frech, knapp und: „die Leute uffs Maul jeschaut“.
Lincke, Paul
Operette in drei Akten von Alexander Oskar Erler und Max Neumann (1940) Gesangstexte von Paul Lincke
Philippine Tucker, Witwe, Handelsherrin in Nürnberg · 1. Sängerin - Annemarie und Dorothee, ihre Töchter · Sopran, Alt - Friederike Tucker, ihre Schwägerin · übertriebene Soubrette - Adalbert Königsmark, Verweser des Welthandelshauses Tucker in Nürnberg · Tenor - Franziska, Kammerjungfer · Soubrette - Casimir, ein alter Diener · Bass - Herzog Cyprian von Riquet · Bariton - Erbprinz Günther von Weißenburg · 1. Tenor - Erbgraf Theodor von Laubach-Immelheim · 2. Tenor - Anton, Diener des Herzogs · Tenor-Buffo - Der erste Schreiber · kleine Sprechrolle - Ein Bote aus Amsterdam · kleine Sprechrolle
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Xyl. · Marimba · Gl. · Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr. · Peitsche) (3 Spieler) - Hfe. - Str.
Uraufführung: 1940 Hamburg (D) Apollo-Verlag • 120‘
Frau Luna, Herrin des Mondes · Sopran - Prinz Sternschnuppe · Tenor - Stella, Lunas Zofe · Mezzosopran - Theophil, Haushofmeister auf dem Mond · Bariton - Frau Pusebach, Witwe · Alt - Marie, ihre Nichte · Sopran - Fritz Steppke, Mechaniker · Tenor - Lämmermeier, Schneider · BaritonPannecke, Steuerberater a. D. · Bass-Bariton - Venus · Sopran - Mars (Damenrolle) · Alt - Mondgroom (Damenrolle) · Mezzosopran - Mondelfen, Sternbilder, Mondschutzmänner · Chöre (SATB) - Hofstaat der Frau Luna, Pagen, Sterne, Arbeiter · Statisten – Ballett
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2
3 · 0 - P. S. (Glsp. · Marimba · Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr. · chin. Tr. · Waldteufel) (2 Spieler) - Hfe. - Str.
Uraufführung: 2. Mai 1899 Berlin, Apollo-Theater (D) · Musikalische Leitung: Paul Lincke Apollo-Verlag • 120‘
Lincke, Paul Frau
Operette in zwei Akten von Heinz Bolten-Baeckers (1899)
Textliche Neufassung von Otto Schneidereit (1957)
Fritz Steppke, Mechaniker · Tenor - August Lämmermeier, Schneider · Bariton - Wilhelm Pannecke, Portier · Bass-Bariton - Lieschen, seine Tochter (auch Jungfrau) · Sprechrolle
- Mathilde Pusebach, möblierte Wirtin · Alt - Marie, ihre
Nichte · Sopran - Flora Huschke, Chansonette (auch Frau Luna) · Sopran - Ella, ihr Dienstmädchen (auch Stella) · Mezzosopran (Soubrette) - Egon von Schlettow, Leutnant (auch Sternschnuppe) · Tenor - Theophil Finke, Schutzmann (auch Haushofmeister auf dem Mond) · Bariton - Heinrich Schulze, Gastwirt (auch Merkur) · Sprechrolle - Anna, Kellnerin bei Schulze (auch Venus) · Sprechrolle - ein Leierkastenmann (auch Mars) · Sprechrolle - ein Briefträger (auch Mondbote) · Bariton
2 (2. auch Picc.) · 2
2
2 - 4
2
3
0 - P. S. (Glsp. · Marimba · Trgl. · Beck. · kl. Tr.
gr. Tr.
chin. Tr. · Waldteufel) (2 Spieler) - Hfe. - Str. Apollo-Verlag • 120‘
Lincke, Paul
Operette in zwei Akten von Heinz Bolten-Baeckers und Hans Brennecke (1899)
Muckipur, König von Muckipur · Bass - Königin Sita, seine Frau · Sopran - Puffetius, Haushofmeister · Tenor - Puffetius, der Doppelgänger · stumme Rolle - Sarakatscheika, Kriegsminister · Bass - Karabatschi, Leibarzt · Tenor - Dschadajewa, Kultusminister und Märchenerzähler · Bariton - Bhimo, Fähnrich der Leibgarde der Königin · Mezzosopran - Kanischka, Kommandeuse der Amazonengarde · Alt - Gaja und Jaska, Zwillinge, Kanischkas Töchter, Amazonen der Königin · Sopran, Mezzosopran - Gustav Steinbock, Gelegenheitsreporter aus Berlin · Tenor-Buffo - Tambourmajor · Sprechrolle - Amazonencorps, Pagencorps, Begleiterinnen, männliche Garde · Chöre - Hofstaat; Berliner, Wiener u. Münchener Traumfiguren · Statisten – Ballett
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Vibr. · Gl. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck. · Vogelpf.) (2 Spieler) - Str. - Bühnenmusik: 4 Hr. · 2 Flügelhr. · 2 Tenorhr. · 4 Trp. · 3 Pos. · 2 Tb. · Bar. - Tamb.
Lincke, Paul
Operette in 3 Akten von Heinz Bolten-Baeckers und Henriot Chancel (1911)
Grigri ist eine humorvolle und exotische Liebesgeschichte, die in Afrika spielt. Im Mittelpunkt steht Grigri, die Tochter des Königs Magawewe, die durch einen Seitensprung der 169. Ehefrau des Königs geboren wurde und durch ihre helle Hautfarbe auffällt. Die Handlung dreht sich um Grigris Liebe zu einem französischen Kolonialbeamten. Nach turbulenten Ereignissen wird sie in Frankreich zur Zirkusattraktion, bevor sie am Ende ihr Glück mit dem Kolonialbeamten findet. Der König entdeckt unterdessen seine nächste Ehefrau, die Mutter der ehemaligen Verlobten seines zukünftigen Schwiegersohns. Grigri ist von der französischen Operette und Jacques Offenbach beeinflusst. Exotische musikalische Elemente, die den Schauplatz Afrika repräsentieren, fehlen jedoch. Stattdessen bleibt die Musik in der europäischen Tradition und bietet eingängige Melodien in meisterhafter Orchestrierung. Grigri gehört zu Linckes späteren Werken und markiert seinen Versuch, sich an größere Bühnenformate anzupassen.
Konsul Gaston - König Magawewe - Grigri, seine TochterTobias - Susy - Ima, Impresario - Frau Potschapoff - Sascha, ihre Tochter - Offizier der Schutztruppe - Regisseur des Apollogartens - Maud, Cissy, Amy, Olli, Polly, Molly (die 6 Cocktail-Girls) - Ein Japaner - Erster Herr - Zweiter HerrErster Reporter - Zweiter Reporter - Portier - Logenschließer - Polizeikommissar - Zwei Polizeibeamte - Kellner - Eingeborene - Hochzeitsgäste - Premierenbesucher – Artisten
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. · Tamt. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. · Telephonglocke) (2 Spieler)Hfe. - Str.
Uraufführung: 1911 Berlin (D)
Apollo-Verlag • 120‘
Uraufführung: 18. Dezember 1899 Berlin, Apollo-Theater (D) Apollo-Verlag • 120‘
Lincke, Paul
Operette in drei Akten (1902 (1934)), Erstfassung von Heinz Bolten-Baeckers und Max Neumann
Sexstreik und Antimilitarismus – auch das sind Themen für die Operette. Das Sujet der Komödie des Aristophanes ist zeitlos gültig. Frauen verweigern eheliche Pflichten, bis ihre Männer alle Kriegsbeile begraben und endlich Frieden einkehrt. Es ist erstaunlich, dass das 1902 als „phantastische Operetten-Burleske“ angekündigte griechisch-preußische Satyrspiel nicht häufiger gegeben wird. Um Linckes sprichwörtliches (und später in Frau Luna eingefügtes) „Glühwürmchen-Idyll“ geht es bunt und toll zu. Im zweiten Akt erlebte man im Apollo-Theater die Ballettpantomime Phryne und Adonis mit dem „berühmten Luftballett Grigolatis“. Figurennamen wie die der Hebamme Polygamia und des Leutnantsburschen Fritzios verraten die Geistesnähe zu Offenbachs Travestien.
Wie bei Frau Luna existieren auch von Lysistrata mehrere Fassungen. Auf die Erstgestaltung von 1902 folgte eine textliche Durchsicht von dem wenig später aus Deutschland geflohenen Kapellmeister Max Neumann für die Neuproduktion von 1934 in der „Plaza“ Berlin. 1976 gelangte – ursprünglich erschienen im von Lincke selbst gegründeten Apollo-Verlag – am Theater Magdeburg die Fassung von Wolfgang Böttcher und Ortwin Sudau zur Erstaufführung. Wie im Fall von Messeschlager Gisela leistete die Neuköllner Oper 2002 eine Pioniertat für Linckes „volkstümliche, boulevardeske, sehr freie Adaption der gleichnamigen Komödie von Aristophanes“.
Themistokles, Generalfeldmarschall von Athen - Lysistrata, seine Gemahlin - Bacchis und Cypris, Lysistratas NichtenPlautius, mit Bacchis vermählt - Nikias, mit Cypris vermählt
- Leonidas, Reserveleutnant im spartanischen Heer - Nulpios, sein Bursche - Polyxo, Besitzerin eines Schönheitssalons
- Paulina, Marketenderin - Der Vorsitzende des Schnellgerichts - Neppmannos - Frauen von Athen – Soldaten
2 (2. auch Picc.)
2
2
2 - 4
2
3
0 - P. S. (Glsp. · Xyl. ·
Trgl. · hg. Beck. · kl. Tr. · chin. Tr. · gr. Tr. m. Beck. · Tempelbl.
· Holzbl. · Gläser · Sandpapier) - Hfe. - Str.
Uraufführung: 31. März 1902 Berlin, Apollotheater (D) ·
Musikalische Leitung: Paul Lincke
Apollo-Verlag • 110‘
Lincke, Paul
”Und gebet nicht nach: die Männer sind schwach!
Bleibt Ihr resolut, dann wird alles gut!“
Lysistrata
Operette in zwei Akten (1902 (1934)), Neufassung (1976) von Heinz Bolten-Baeckers und Max Neumann
Textliche Neufassung von Wolfgang Böttcher
Musikalische Neueinrichtung von Ortwin Sudau
Themistokles, Athener General - Lysistrata, seine GattinAthenerinnen: Bacchis, Cypris, Anaxa - Plautius, Bacchis‘ Mann - Nikias, Cypris‘ Mann - Leonidas, ein SpartanerDomestikus, sein Diener - Polyxo, eine Barbesitzerin - Xenia, Bardame - Paulina, Marketenderin - Ein Richter - Frauen von Athen - Männer von Athen (Soldaten)
2 (2. auch Picc.)
2
2
2 - 4
2
3
0 - P. S. (Glsp. · Vibr. · Trgl. · hg. Beck. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Beck. · Gläser · Sandpapier) (2 Spieler) - Hfe. - Str.
Apollo-Verlag • 110‘
Die Selbstkritik ist mein Prinzip, nun habt mich wieder lieb
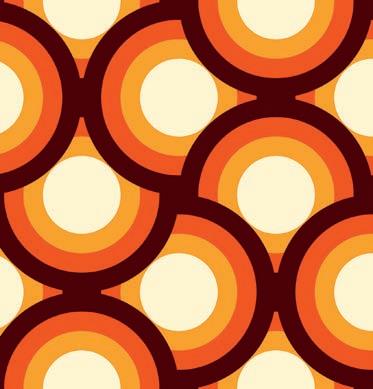
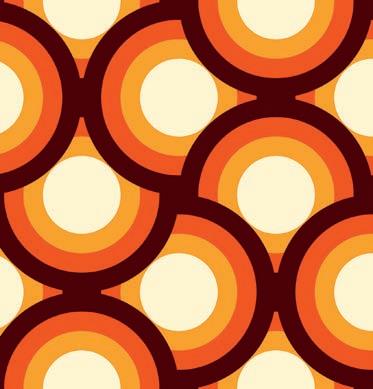








Mein Freund Bunbury und Messeschlager Gisela haben die Zugkraft Gerd Natschinskis vor und nach der Wende durch zahlreiche Neuproduktionen bewiesen. In der DDR entstanden bis 1989 über 200 Titel des ‚Heiteren Musiktheaters‘ – also Operette, Musical und Musikalisches Lustspiel. An Mehrspartentheatern wie in Erfurt, Halle und Rostock gab es neben den drei großen Operettenhäusern in Ostberlin, Dresden und Leipzig eine rege Unterhaltungskultur, oft mit Sujets aus dem Alltag der DDR.
Die Diskussion um kompetente Musicaldarstellung und die Ausbildung von Allroundern für Gesang, Spiel und Tanz begann in der DDR weitaus früher als in Westdeutschland. Gerd Natschinskis Werke waren die Leuchttürme. Parallel setzten sich Komponisten wie Guido Masanetz, Gerhard Kneifel, Jochen Allihn, Dieter Brand, Alo Koll, Horst Sander und Rolf Zimmermann für eine vielfältige Operetten- und Musical-Kultur ein, welche im Kreis der sozialistischen Nachbarstaaten ein vielgerühmter Sonderfall war.
Als in Westdeutschland die Verbreitung des Musicals durch Ensuite-Produktionen mit Spezialbesetzungen und -effekten begann, berücksichtigten die künstlerischen Ausdrucksmittel der neuen DDR-Werke immer die technischen und personellen Kapazitäten von Subventionstheatern mit Repertoirebetrieb. DDR-Theater ließen ihre Orchester spielen, seltener Bands. Zuspielungen vom Band gab es nie.
Neue Operetten wie Mein schöner Benjamino sollten den Spielplan neben Klassikern von Offenbach bis Weill bereichern und die als Teil der spätbürgerlichen Dekadenz kritisierten Operetten des frühen 20. Jahrhunderts ersetzen. Klaus Eidam, Dramaturg der Staatsoperette Dresden und Musical-Textdichter, definierte nach 1989: „Im Übrigen war der Unterschied zwischen der ‚gesellschaftskritischen‘ und der ‚Gegenwartsoperette‘ ganz einfach: In ersterer musste sich ein edler Mensch gegen eine verrottete Gesellschaft durchsetzen, in der neuen wurde ein rückständiger Mensch von der Gesellschaft gebessert.“
Die von Schott Music angebotenen DDR-Werke stammen vor allem aus dem nach dem Mauerfall aufgelösten Verlag VEB Lied der Zeit Musikverlag.


















Allihn, Jochen
Musikalisches Lustspiel in drei Akten
Libretto von Ursula Kollmann und Joachim Preil
Hans Storm · Bass - Knut Storm · Bariton - Herbert Brandt ·
Tenor - Ditha Donner · Mezzosopran - Fräulein Madeleine ·
Alt
Klar. - S. - Git. · Klav. - Kb. (zusätzl. Sax. u. Trp. ad lib.)
Schott Music • 110’
Allihn, Jochen
Musical in zwei Teilen (1985)
Libretto von Hansjörg Schneider und Brigitte Wulkow
Mitarbeit: Marga Roland
Hauptfiguren des Musicals Damals in Prag sind der Sänger Peter Rosenthal und die Tänzerin Liane Werner. Beide wollen weg aus dem unmenschlichen nationalsozialistischen System in Deutschland. Die Situation spitzt sich zu, als Liane in Prag von Gestapo-Agenten entführt und Peter wegen seiner jüdischen Herkunft die Stellung am Sudetendeutschen Theater verliert. Dem mit vielen Genreszenen bereicherten Episodenstück, das von einer „Großstadt in Deutschland im Frühsommer 1933“ nach Prag springt, wurde große Bedeutung beigemessen, denn es erschloss für das Musical der DDR ein brisantes Themenfeld. Jochen Allihn war als Dirigent des Metropoltheaters, Dramaturg bei VEB Lied der Zeit Musikverlag und als Komponist mehrerer musikalischer Lustspiele
eine wesentliche Größe im Musikleben der DDR. Damals in Prag wurde sein anspruchsvollstes Bühnenwerk.
Mit Ausnahme von Kurt Weill, dessen in der US-amerikanischen Emigration entstandene Werke man in der DDR lange vernachlässigt hatte, fand in Operette und Musical nur eine marginale Auseinandersetzung mit deutschsprachigen jüdischen Komponisten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt. Denn deren Werke gehörten oft zur negativ gewerteten „spätbürgerlichen Operette“, die man als „volksnahe Dekadenz“ und „kapitalistische Verblödungsindustrie“ diffamierte. Insofern ist Damals in Prag ein Meilenstein der Erinnerungskultur des DDR-Musiktheaters.
Peter Rosenthal, Sänger - Liane Werner, Tänzerin - Dr. Grosse, Jurist - Magda Schöner, Garderobiere - Irene Baum, Stenotypistin - Willi Schaper, Schriftsetzer - Frantisek Holob, Kanzleichef - Jan Dudek, Direktor - Antonín Lysenka, Pianist - Silberstein, Direktor eines sudetendeutschen Kulturtheaters - Vorsitzender eines Flüchtlingskomitees in Prag - Intendant eines reichsdeutschen Theaters - Hasso von Schenk, Sänger - Grieshuber, Regisseur - Oberregisseur eines sudetendeutschen Provinztheaters - Beamter der Zensurstelle in Prag - Vier Zeitungsverkäufer - Empfangschef - Mann von der Rezeption - Portier - Schlagersänger - Theatermitglieder, Hotelangestellte, Premierengäste, Kneipenbesucher und andere Nebenrollen
2 (2. auch Altfl. u. Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 (2. auch Bassklar.) · Altsax. · 1 - 3 · 3 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · Tamt. · Tamb. · Bong. · Drumset · Klatsche · Trillerpf.) (2-3 Spieler) - Git. · Bassgit. · Hfe. - Str. Uraufführung: 4. Januar 1985 Meiningen, Das Meininger Theater (D) · Musikalische Leitung: Werner Storch · Inszenierung: Fred Grasnick · Bühnenbild und Kostüme: Wolfgang Stärke · Choreographie: Marlies Fritsche Schott Music
Binder, Edmund
(Madame Cyprienne)
Eine unerhebliche Komödie mit etwas Musik in 3 Akten (1959)
frei nach dem Lustspiel „Cyprienne“ (Divorçons!) von Victorien Sardou und Émile de Najac Libretto von Heinz Kramer
Henri Prunelles, Beamter - Cyprienne, seine Frau - Robert Clavignac, sein Freund, Journalist - Marianne Brionne, Cypriennes Freundin, Witwe - Adhémar von Gratignan - Josepha, Mädchen bei Prunelles - Bernhard Chartell, Polizeikommissar
Violine oder Akkordeon - Bass - Gitarre - Schlagwerk (Gl. · Gong · Drum Set)
Schott Music
Brand, Dieter / Sander, Harry


(Der Mann, der lachen musste)
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1976) Gesangstexte von Jürgen Degenhardt Musik von Dieter Brand und Harry Sander (Pseudonym von Harald Sondermann)
„Immer nur lächeln“ – sogar in peinlichen Momenten. Weil Washington Flip so smart und sympathisch lachen kann, wird er zum Star aller Werbeauftritte der Firma Fresh. Schließlich aber hat er die Rendite-Geilheit seines Arbeitsumfelds satt. Washington steigt aus und freut sich auf seine neue Rolle als Familienvater an der Seite des Filmstar-Doubles Shirley. Aber bis dahin lauert Gefahr: Jean Diamond, Firmenchefin und Filmstar will Washingtons Lachen und dazu den ganzen Mann. Vergleiche der Zustände in der BRD und in der DDR, wie sie in Messeschlager Gisela angestellt wurden, waren nach dem Mauerbau im heiteren Musiktheater der DDR nicht mehr erwünscht. Ein anderes Narrativ bewährte sich dagegen: Die Figur des Washington Flip, der sich mit unregelmäßigen Beschäftigungen in den Vereinigten Staaten der 1930er Jahre durchs Leben schlägt, sollte die Schattenseite des glänzenden amerikanischen Traums widerspiegeln.
Wie schon bei Mein Freund Bunbury und Ein Fall für Sherlock Holmes machten sich die Textdichter Helmut Bez und Jürgen Degenhardt für Dieter Brand und den als Orchester-, Tanz-, Laien- und Bühnenkomponist wirkenden Harry Sander in Genres wie der Screwball-Comedy
und Handlungsmustern des Films kundig. Sanders Musik greift Broadway- und Hollywood-Sounds auf. Sie kopiert, karikiert und persifliert, zeigt aber auch heimliche Sympathie für kapitalistische Klangverführungen.
Washington Flip - Shirley Robinson - Jean Diamond, Filmstar - Mortimer Dunn, Chef der Firma „Fresh“ - Eduard S. Butterbread, Chef der Firma „Clean“ - Buddy Smoke, Producer - Larry, Filmregisseur - Fritz Stein, SchauspielerJim, Filmkomparse - Passanten, Komparsen, Atelierarbeiter, Zeitungsverkäufer, Dauertänzer, Manager, Stenotypistinnen, Girls, die Gesangsgruppe der „Melody-Swingers“, Partygäste, Reporter, Stars u.a.
2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 (2. auch Bassklar.) · 1 - 3 · 3 · 3 ·
0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Hi-Hat · Beck. · Bong. · kl. Tr. · gr. Tr. · Marac.)(4 Spieler) - Git. · Hfe. - Str.
Uraufführung: 30. April 1976 Leipzig, Musikalische Komödie (D) · Musikalische Leitung: Roland Seiffarth · Inszenierung: Wolfgang Weit · Bühnenbild: Günter Thielemann · Kostüme: Christa Hahn · Choreographie: Wolfgang Baumann
Schott Music • 100‘
Brand, Dieter / Sander, Harry / Gocht, Joachim
Musical (1978)
Libretto von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt Liedtexte von Jürgen Degenhardt Arrangement von Joachim Gocht
Harry - Max - Lily van Breek - Waldemar von Brosig, Kammerherr - Mrs. Ellinor Walcott - Mimi - Strebsam, Hoteldirektor - von Maltzahn - Reichswehroberst - Frieda, Zeitungsfrau - Kriminalbeamter - Ein Budiker - GamaschenEde - käufliche Mädchen - ein Kommissar - Penner - Arbeitslose - Polizisten - Hotelpersonal - Hotel- und Schlossgäste - Mannequins – Diener
2 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 (1. auch Altsax., 2. auch Bassklar. u. Tenorsax.) · 1 - 3 · 3 · 3 · 1 - Drumset · S. (P. · Glsp. · Xyl. · Vibr. · Trgl. · Kuhgl. · Kast. · Waschbrett) (1 Spieler) - Hfe. · Klav. · E-Git. · Bassgit. - Str.
Uraufführung: 9. April 1978 Erfurt, Städtische Bühnen (D) · Musikalische Leitung: Manfred Fabricius · Regie: Joachim Franke · Bühnenbild: Siegfried Bach · Kostüme: Inge Laube Schott Music








”Schmierentheater! Wissen Sie denn überhaupt, was eine Schmiere ist?“
Bretter, die die Welt bedeuten






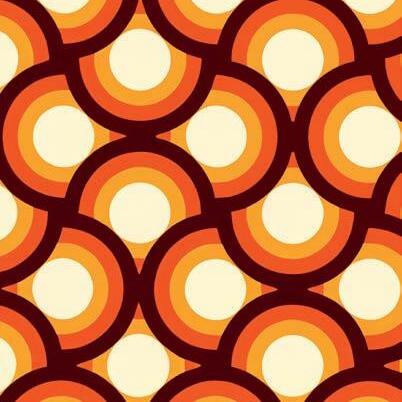
Kneifel, Gerhard
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1970) „Bretter, die die Welt bedeuten, können – das gefällt den Leuten – Himmelreich und Hölle sein!“ Diese Titelmelodie wurde in der DDR zum Hit. „Wenn die Musik erklingt“ und „Das wär zu schön, um wahr zu sein“ waren Radio-Dauerbrenner. Die kleinstädtischen Spitzen der wilhelminischen Gesellschaft mit ihren kleinen Obsessionen erlebten in der DDR das fulminante Comeback in einer vitalen Musikkomödie. Darin schmetterte die Schauspielerin Bella della Donna ihre Schlager im Karnevalssound. Die witzige Schelte am mittelständischen Bürgertum feierte Triumphe.
Gymnasialdirektor Martin Gollwitz komponiert, befeuert durch die Musikdramen Richard Wagners, die Oper „Der Raub der Sabinerinnen“. Aber er hält sie aus Angst vor Blamage unter Verschluss. Theaterdirektor Striese wittert für das kleinstädtische Neustadt an der Dosse eine Sensation und studiert die Oper innerhalb weniger Tage ein. Nach der wegen mehrerer Pannen abgebrochenen Uraufführung der Oper und dem dadurch ausgelösten Eklat kommt der wohlanständige Stadt- und Haussegen schnell wieder in Ordnung. Strieses fahrendes Theaterunternehmen erhält ein stehendes Domizil.
Helmut Bez und Jürgen Degenhardt boten ihr Textbuch nach dem berühmt-berüchtigten Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“ der Brüder Schönthan zunächst Gerd Natschinski an. Doch zu einem der größten Musical-Erfolge der DDR machte es der führende Tanzkomponist und Arrangeur Gerhard Kneifel. Im Rückblick ist erstaunlich, wie sich die westdeutschen Unterhaltungsmusiken von James Last bis Caterina Valente und die heiteren bis unterhaltenden Musikgenres der DDR ähnelten.
Professor Martin Gollwitz, Direktor des Städtischen Lyzeums - Friederike, seine Frau - Paula und Marianne, seine Töchter - Dr. Leo Neumeister, Rechtsanwalt, Mariannes MannRosa, Dienstmädchen bei Gollwitz - Meißner, Pedell des Lyzeums - Emanuel Striese, Theaterdirektor - Emil Sterneck, Schauspieler - Bella della Donna, Schauspielerin - Die Wandertruppe von Emanuel Striese, darunter: Martha, Strieses Frau; Gottlieb, sein Sohn; Mimi Müller, Naive - Bürger und Bürgerinnen von Neustadt, darunter Honoratioren: Karl-
Theodor Hufnagel, Bürgermeister, und seine Frau; Wilhelm Kornfrank, Apotheker, und seine Frau; Eugen Liebeskind, Barchentfabrikant, und seine Frau - Karl Groß, Weinhändler - Ein Monteur - Das Ballett: Lyzeumsschülerinnen, darunter Hedwig Hufnagel, Meta Kornfrank, Ottilie Liebeskind; Fritzad lib.: andere Kinder Strieses, ein Papagei
2 · 2 · 2 · 2 - 4 · 3 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Beck. · Hi-Hat ad lib. · Tamb. · Tomt. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Beck. · Tempelbl. · Hupe od. Kuhgl. · Fahrradklingel) (2 Spieler) - Hfe. · Klav. · Git. · 2 Bassgit. - Str. (5 · 4 · 3 · 2 · 2)
Uraufführung: 24. April 1970 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Werner Krumbein · Regie: Hans-Joachim Martens · Bühnenbild und Kostüme: Werner Schulz · Choreographie: Helga Wasmer-Witt Schott Music • 120‘
Koll, Alo
oder Die musikalische Reise um die Erde, zu Lande, zu Wasser - und sogar in der Luft, auf der Route des Jules Verne (1971)
Buch von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt Liedertexte von Jürgen Degenhardt
Die Wette zwischen Mister Fogg und den Herren des Londoner Reform Club aus Jules Vernes Roman „In 80 Tagen um die Welt“ übertrugen die Textdichter Helmut Bez und Jürgen Degenhardt kurzerhand vom 19. Jahrhundert auf ihre Gegenwart. Phileas Fogg und sein Kammerdiener Passepartout, die Enkel der Romanfiguren, sind die neuen Helden. Die Wette um die Erdumkreisung

Gerhard Kneifel: Bretter die die Welt bedeuten
Musikalische Komödie Leipzig 2020 Foto: Kirsten Nijhof
in fururistischen 40 Stunden gab Koll Anlass zu einer ethnographischen Erkundung mit Mitteln der Operette. Die für das 20. Jahrhundert zeitgemäße Flugzeug-Hetzjagd ereignet sich auf hohem musikalischen Niveau. Alo Koll war von 1968 bis 1975 Leiter der Abteilung Tanzund Unterhaltungsmusik an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und ein berühmter TanzorchesterDirigent. Die Aktualität seines Musical-Sujets hat sich seit der Uraufführung nicht abgeschwächt. In Anbetracht von Reiseschnellverbindungen, Weltraumtourismus und medialer Ausschlachtung exotischer Topographien wurde sie sogar noch größer. Die Spiegelung der besseren Gegenwart an der schlechteren Vergangenheit war ein wichtiges Narrativ der DDR-Kultur: In Die Wette des Mister Fogg übertreffen Komfort und gesellschaftlicher Fortschritt die Welt der alten Klassengesellschaft, in der man noch ritt und die Eisenbahn benutzte.
Phileas Fogg - Passepartout - Fix, Detektiv - Stamp Proctor, Amerikaner - Aouda - Jeanette - Tsching-Mi - Hanchi-Franchi - Flugkapitän / Batulcar, Zirkusdirektor / Gefängniswärter (von einem Darsteller gespielt) - Glen Ralph / arabischer Scheich / Inder / chinesischer Wirt / Reklamemann / Kapitän Speedy (von einem Darsteller gespielt) - Andrew Stuart / Consul / Beamter / Mister Trip, Reiseführer / Waffenhändler (von einem Darsteller gespielt) - Fluggäste, Stewardessen, Reisende, Reporter, orientalische Händler, Schiffspassagiere, Chinesen, Rauschgiftsüchtige, Touristen, Hawaiianer, Cowboys, Matrosen, Damen und Herren der englischen Gesellschaft · Chor - Stewardessen, Butler, Pariser Mädchen, Sklavinnen, Bajaderen, Inder, Geishas, Opiumraucher, HulaMädchen, Clowns, Indianer, Ballbesucher · Ballett
2 (2. auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 (2. auch Bassklar.) ·
2 - 3 · 3 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. ad lib. · Trgl. · Gong · Beck. · Tamb. · 2 Tomt. · Drums · Bongo · Tumba) (2 Spieler) - Hfe. · Plektrum-Git. · Klav. · Akk. - Str.
Uraufführung: 30. September 1971 Leipzig, Musikalische Komödie (D) · Musikalische Leitung: Ralph Rank · Regie: Erwin Leister · Bühnenbild: Gunter Kaiser · Kostüme: Elisabeth Selle · Choreographie: Wolfgang Baumann Schott Music • 110‘
Krtschil, Henry
Eine Posse nach August Wilhelm Iffland von Peter Bause versehen mit bezüglichen Gesängen von Klaus Fisch und einer vorzüglichen Musik von Henry Krtschil
Herr Balder, ein Buchbinder - Frau Balder, seine Ehefrau - Justine, beider Tochter - Herr Krappe, ein Chirurg oder ähnliches - Herr Grünstein, ein Liebhaber - Gerichtsdiener, der auch noch ein Ausrufer ist
Fl. · Klar. - Pos. - S. (Glsp. · Trgl. · Drumset · Kast. · Holzbl.) - Klav. - Kb.
Uraufführung: 2. Juli 1990 Berlin (D)
Schott Music • 70‘
Kunze, Hans
Musical von Karl-Heinz Lennartz (1968)
Conny - Frank - Frau Lüder, seine Wirtin - Professor - Studenten: Rolf, Chris, Dieter, Regina, Uta, Sabine, Karin, Rudi, Frau „Lang“, Herr „Kurz“ - Chor – Ballett
2 (2. auch Picc.) · 1 · 1 · 1 - 2 · 2 (auch 2 Bach-Trp.) · 3 · 0 -
P. S. (Glsp. · Xyl. · Tamb. · Drum Set) (3 Spieler) - Git. (Banjo) m. Verstärker · Bass-Git. · Klav. · Tonband - Str. (5 · 5 · 3 · 2 · 1)
Schott Music • 90‘
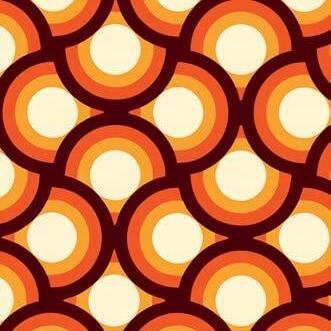
Masanetz, Guido
”Bei Autos und beim Lieben ist wichtig, dass es funkt.“
Mein schöner Benjamino
(Liebe, Zwist und Illusionen)
Operette in zwei Akten von Jo Schulz (1963)
Meint die Handlungszeitangabe „Neulich im Sommer“ die unmittelbare Gegenwart oder den letzten ‚mauerfreien‘ DDR-Sommer 1960? Die Geschichte der ‚Pferdebraut‘ Brigitta, die ihren ‚schönen Benjamino‘ als ‚besten Kavalier‘ besingt und ihrer Zwillingsschwester Marlis, die in Westdeutschland aufwuchs, erlebte nur wenige Vorstellungen. Dann verschwand Mein schöner Benjamino, obwohl sich die beiden jungen Frauen für bodenständige und verantwortungsbewusste Männer des Arbeiter- und Bauernstaates entscheiden. Marlis‘ rosaroter Traum von der Ehe mit einem amerikanischen Millionär zerrinnt und sie erhört den Autoschlosser Jochen Kolbenring. Dagegen findet Brigitta ihr Glück an der Seite des Zirkusdirektors Barsonny, der auch ein Herz für ihren schönen Benjamino hat. Das alles ereignet sich in der gesunden Luft des Rennsteigs in Südthüringen und an der Ostsee. Wie bei seinem Textbuch-Debüt Messeschlager Gisela präsentiert Jo Schulz einen theatralen Schlagabtausch über West- und Ost-Deutschland. Solche Gegenüberstellungen waren allerdings seit Errichtung der Mauer am 13. August 1961 offiziell nicht mehr erwünscht. Akute politische Ereignisse hatten die DDR-Relevanz des Stückes gründlich untergraben. Spuren und Überklebungen





im Textbuch legen die Vermutung nahe, dass das Hotel „Zum rüstigen Tiroler“ ursprünglich im bundesdeutschen Alpenvorland und nicht im DDR-Bezirk Suhl lag. Mein schöner Benjamino ist ein unerschlossenes Zeitdokument mit Geheimnissen.
Brigitta, die „Pferdebraut“ - Marlis, ihre ZwillingsschwesterBarsonny, Chefdresseur des Zirkus Karawane - Neptun alias Jochen, Meeresgott und Autodoktor - Dorothy, Tigerdompteuse - Leo Sänftig, ein verhinderter Dompteur - Mutti Röschen, Wirtin des Hotels „Zum Rüstigen Jodler“ - Paul Patsch, Futtermeister - Milchbart, Gestütslehrling - Schnauze, Pferdepfleger - Baby, ein boxender Riese - Kaiser Wilhelm, der lebende Strandfunk - Der grüne Heinrich, beinahe ein Auto - Jonny, ein Tiger - Reiterinnen und Reiter, Messerwerferinnen, Badenixen, Standlöwen etc.
2 · 2 · 2 · 2 Altsax. · Baritonsax. · 2 - 3 · 3 · 3 · 0 - P. S. (Xyl. · Vibr. · Holz Tr. · kl. Gl · gr. Beck. · Schüttelrohr · 3 Bongos · Zischbecken · Cong. · 2 Hupen · Tamb. · Windmasch. · Totenglocke · Waschbrett · Beck. · Peitsche · Rats.)(1 Spieler) - Hfe. · Klav. - Str.
Uraufführung: 11. Mai 1963 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Guido Masanetz · Regie: Hans Pitra · Bühnenbild und Kostüme: Werner Schulz · Choreographie:
Nina Feist
Schott Music
Natschinski, Gerd

Musical (1988)
Buch und Gesangstexte von Jürgen Degenhardt
Die ihrem abtrünnigen Verlobten in Männerkleidern folgende und halb Madrid aufmischende Juana wird während der ersten großen Tango-Welle Lateinamerikas zu einer Torera. Der Textdichter Jürgen Degenhardt verlegte (wie in Mein Freund Bunbury und Terzett) einen populären Komödienstoff, hier Tirso de Molinas „Don Gil von den grünen Hosen“, von der Originalzeit an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Gegenüberstellung der emanzipierten Juana und ihres vorerst den strengen Moralkonventionen Spaniens verpflichteten Liebhabers Manuel inspirierte Gerd Natschinski zu einer lustvollen Reminiszenz an das Genre der Revueoperette. Seine Musik ist wie immer farbig, abwechslungsreich und fantasievoll, seine Lust auf kompositorische Chamäleonsarbeiten ungebrochen.
Natschinskis letztes Bühnenwerk war eine der letzten Musical-Uraufführungen der DDR. Der 9. November 1989 unterbrach die Erfolgsserie dieser „Fiesta mexi -
cana“. Man merkt dem Stück die Entstehung in Nähe der DDR-Operettenrenaissance von Paul Abraham und Friedrich Schröder an, aber auch Natschinskis Lust auf Rhythmen und gepfeffertes musikalisches Kolorit.
Juana - Manuel de Galindo - Camino, Faktotum - Enrique Cruz, Chef des Bankhauses „Cruz und Sohn“ - Fernando, ebendieser Sohn - Blanca, seine Schwester - Antonio, Banklehrling - Flora Final, Freundin Blancas, Trocadero-Star - Rosaura, Garderobiere (später Kellnerin) - José, SchuhputzerFelipe, Straßensänger - Ein Zivilgardist - Damen und Herren, Menschen und Tiere, Torreros und Stiere · Chor und Ballett 2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 2 · 2 · 2 · 0 - S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Trgl. · Hi-Hat · kl. Beck. · gr. Beck. · Bong. · kl. Tr. · gr. Tomt. · Cong. · Mar. · Kast. · Clav. · Woodbl.) (4 Spieler)Git. (auch Banjo) · Hfe. - Str.
Uraufführung: 16. Dezember 1988 Leipzig, Musikalische Komödie (D) · Musikalische Leitung: Roland Seiffert · Inszenierung: Klaus Winter · Bühnenbild: Bernd Leistner · Kostüme: Helga Müller-Steinhoff · Choreographie: Monika Geppert
Schott Music • 130‘
Natschinski, Gerd
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1976)
Casanovas Erzählungen: Der Abenteurer berichtet dem Abt eines Klosters bei Warschau von seinen Amouren und Eskapaden. Die Inhaltsfülle des Textbuchs kommt der eines Spannungsromans in mehreren Bänden gleich, und Gerd Natschinski schrieb eine für Mitte der 1970er Jahre höchst experimentelle Musical-Partitur. Seine Musik entwickelt sich von geschlossenen Nummern hin zu großen durchkomponierten Szenen. Er wollte keinen Rückblick eines abgehalfterten Lebemannes, sondern das „Dutzend explosiver Jahre in der Mitte seines Lebens, kreuz und quer durch Europa“.
Die Textdichter Helmut Bez und Jürgen Degenhardt machten Casanova zum Rebell gegen Übergriffe der Machthabenden auf seine Person. Am Ende schlägt Casanova deren Angebot zur Narrenfreiheit aus und verlässt mit seiner Geliebten Anna die adeligen Kreise. Natschinski notierte: „Die Geschichte über das Scheitern eines Genies im Spiegel der Zeit. Lohnende Aufgabe für große Theater mit einem stattlichen Fundus an BarockKostümen und Perücken.“ Es besteht die Möglichkeit, die Partien von Casanovas Geliebten mit einer Darstellerin und mehrere Männerfiguren mit einem Darsteller zu besetzen.
Die verschiedenen Handlungsschwerpunkte von Paul Linckes Casanova (S. 32) und dem von Gerd Natschinski zeigen paradigmatisch den Zeit- und Gattungswandel von der Berliner Operette zum großen DDR-Musical. Bei Lincke ist die Liebe der dominierende Handlungsimpuls. Natschinski entfaltet ein facettenreiches Zeitpanorama. Gleiche Bedeutung wie die Fraueneroberungen des klugen Kopfes Casanova hat der Absolutismus als Abenteuerspielplatz in seiner letzten Hochphase.

Giacomo Casanova - Magdalena / Marianna / Mary Ann / Anna (sollten von einer Darstellerin gespielt werden) - Der Abt / Abbé de Bernis / Lord Pembroke (sollten von einem Darsteller gespielt werden) - Marquise d‘Urfé / Friedrich II (sollten von einer Darstellerin gespielt werden) - Catarina Capretta - Teresa Casacci - Clairmont, Casanovas Diener - Capretta, Catarinas Vater / Passano, Maler / Branicki, Ulanenoberst (können von einem Darsteller gespielt werden) - Manuzzi, Edelsteinhändler u. Spion / Calsabigi, Projektemacher und Librettist / Jerome, Friseur und Liebhaber / Bininski, Ulan und Draufgänger (können von einem Darsteller gespielt werden) - Lorenzo, Kerkermeister / Duverney, Staatsbeamter / Fielding, Richter / Tomatis, Theaterdirektor (können von einem Darsteller gespielt werden) - Ein Klosterbruder - Andrea Memmo - Bernardo Memmo - Ein
Soldat - Ein Offizier - Chevalier d‘Arginy - Gräfin Montmartel - Madame de Pompadour - Die Tante der Mary Ann - Die Großmutter der Mary Ann - Graf Poninski - Maskierte - Sbirren - Militär - Unternehmer - Adlige - Bürger - Volk - Händler - Zeitungsausrufer – Huren
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 3 · 3 · 1 - P. S. (Glsp. · Vibr. · Xyl. · Trgl. · gr. Beck. · Hi-Hat · Tamt. · Tamb. · Bong. · kl. Tr. · gr. Tr. · Tempelbl. · Clav. od. Woodbl. · Eimer od. Blechplatte) (2 Spieler) - Hfe. - Str. – Tonband
Uraufführung: 10. September 1976 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Gerd Natschinski; Hans-Werner Nicolovius · Choreinstudierung: Wolfgang Schottke · Inszenierung: Wilfried Serauky · Bühnenbild und Kostüme: Werner Schulz · Choreographie: Johanna Freiberg Schott Music • 140‘
Natschinski, Gerd
Fünf ergötzliche Geschichten nach dem „Dekamerone“ des Herrn Giovanni B. (1979–1982) Musicalfolge von Heinz Kahlow Gerd Natschinski fand den ursprünglichen Titel ABC der Liebe zwar banal, das innovative Projekt aber großartig. Mit dem von einer Frau und einem Mann moderierten Rahmenbau, in dem mittelalterliches und modernes Liebesverhalten gegenübergestellt wurde, sollten sechs Fernsehfolgen mit Episoden aus Giovanni Boccaccios berühmter Novellensammlung „Decamerone“ produziert werden: Dem Musical-Mehrteiler im DDR-Fernsehen folgte die bereits zu Beginn des Projekts geplante Bühnenfassung. Kultstatus erlangte die Folge mit der Schauspielerin Nina Hagen als (nackte) Nonne. Die insgesamt fünf für die Bühne verfügbaren Episoden sind beliebig kombinierbar. Dialektischer Geschichtsbegriff, DDRMoralkritik an „westlicher Prüderie“ und erotischer Freisinn ergeben in Natschinskis Hybrid-Experiment eine frivole Kombination.
Dabei geht es vor allem um die schönste Nebensache der Welt in variantenreichen Seitensprungsituationen: Kaufmannsgattin vergnügt sich mit ihrem Nachbarn, die Frau des Gelehrten empfängt den Gärtnerburschen und ein anderer Kaufmann rächt sich für die Eskapade seiner Frau mit seinem Dichterfreund, indem er es ihr mit gleicher Münze heimzahlt.
Die fünf Musicals sind auch einzeln aufführbar und beliebig miteinander zu kombinieren. Die Verbindung zwischen den Kurzmusicals bildet das Paar ER und SIE, das, Boccaccios ‚Decamerone‘ lesend, zwischen den Szenen überleitet.
I Der Segen von oben
Knecht (auch ER) · Bariton - Magd (auch SIE) · Alt - Der reiche Kaufmann · Bariton - Seine schöne junge Frau · AltDer junge Nachbar Filippo · Bariton - Ein alter dicker Priester · Charakterfach, Baritonlage
30‘
II: Die Früchte der Gelehrsamkeit
Pietro, ein freundlicher und belesener Herr · SchauspielerIsabella, seine liebe Frau · tiefer Alt - Leonetto, ein junger Gärtner · singender Schauspieler - Lambertuccio di Spinnolo, ein großer Ritter · Bass od. tiefer Bariton, auch Charakterfach - Reitknecht (auch ER) · Bariton - Magd (auch SIE) · Alt
35‘
III: Der Wert des Wechsels
Zeppa, Kaufmann, ein politischer Kopf · Bariton - Elissa, seine träumerische Frau · lyrischer Sopran - Dioneo, Kaufmann, Zeppas dichtender Nachbar · lyrischer Tenor - Filippa, Dioneos energische Frau · Alt - Giovanni, Diener bei Dioneo (auch ER) · Bariton - Pampinea, Köchin bei Zeppa (auch SIE)
· Alt
55‘




IV Die Freuden der Frommen
Nonne Filomena · Mezzosopran - Die strenge Nonne Costanza · Mezzosopran - Die dienende Schwester Salvestra · Alt - Ein junger Landstreicher (auch ER) · Bariton - Die gewitzte Nonne Simona (auch SIE) · Alt 55‘
V Die gute Bewirtung
Pinuccio, ein junger Herr aus Florenz · lyrisch-dramatischer Tenor - Adriano, sein etwas älterer Freund · Bass - Cipolla, ein wackerer Bauer · Bariton - Seine Frau · Alt - Niccolosa, beider Tochter · Mezzosopran - Vagabund (auch ER) · Bariton - Vagabundin (auch SIE) · Alt 45‘
1 (auch Picc.) · 1
2
1 - 1
1
1 · 1 - S. (Glsp. · Vibr. · Xyl. · Marimba · Tamb. · Drum Set · Gurke · Tempelbl.) (3 Spieler) - E-Git. · E-Bass · Mand. · Hfe. · Akk. · E-Org. (auch Keyboard u. Synth.) - Str. (6 · 0
4 · 3 · 2)
Uraufführung der Episoden I–III: 18. November 1979 Halle, Landestheater (D) · Musikalische Leitung: Volker Münch · Inszenierung: Klaus Winter · Bühnenbild: Rolf Klemm · Kostüme: Helga Müller-Steinhoff
Uraufführung der kompletten Musicalfolge: 1982 Wittenberg, Theater (D) · Musikalische Leitung: Gerd Natschinski · Inszenierung: Helmut Bläss · Bühnenbild und Kostüme: Roderich Vogel Schott Music • 220‘
Natschinski, Gerd
Vaudeville aus dem alten Warschau in einem Vorspiel und 4 Bildern (1959) polnische Neufassung von Julian Tuwim Übersetzung und Bearbeitung für die deutschen Bühnen von Maurycy Janowski
Saturnin Masurkiewicz, Rechtsanwalt aus Radom, Vorsitzender der „Lilie von Radom“ - Kasimir, genannt Kazio, sein Sohn - Kamilla, Soubrette am Arkadia-Theater in Warschau - Sabine, arme Verwandte der Mackis - Wladyslaw Macki, ein warschauer Geschäftsmann - Macka, seine Schwägerin - Wladek Macki, ihr Sohn - Lemicka, Mackis SchwesterGregor, Diener im Hause Mackis - Der Kantor von St. marien in Radom - Ein Eisenbahner - Der Regisseur - Der Inspizient - Georgette, eine Tanzelevin - Ruzkowska, Garderobiere - Ein Tenor - Ein Schauspieler, der einen Diener spielt - Ein Schauspieler, der einen König spielt - Ein Kellner im Hotel Europa - Reisende, Ehrenjungfrauen, eine Blaskapelle, Tänzerinnen 2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 3 · 2 · 3 · 0 - S. (2 Spieler) - Str.
Uraufführung: 1959 Görlitz, Gerhart-Hauptmann-Theater (D) Schott Music
Natschinski, Gerd
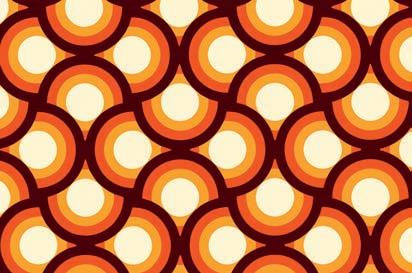
Krimical in zwei Akten (1982) mit Vorspiel, todsicherem Finale und verbindlichem Dank an Sir Arthur Conan Doyle Libretto und Gesangstexte von Jürgen Degenhardt Der Textdichter Helmut Bez wählte „Der Hund von Baskerville“ aus den berühmten Sherlock-Holmes-Erzählungen von Arthur Conan Doyle aus. Es geht um die Regelung komplizierter Erbschaftsansprüche, das ausgenutzte Hörigkeitsverhältnis einer Frau und das schwarze Schaf einer Familie, das endlich auch ans große Geld will. Schon der Prolog verspricht „einen echten Krimi“ (und ironisiert zugleich dieses Muster). Das Publikum macht die Bekanntschaft mit dem schöngeistigen Detektiv aus der Perspektive seines Freundes Doktor Watson. Für Natschinski, der gern an Schnittstellen zwischen den Genres arbeitete und sie in seinen Kompositionen auslotete, erwies sich die Detektivgeschichte mit Elementen aus dem romantischen Schauerroman als ideal.
Den Erfolg des Stückes betrachtete man auf DDR-Bühnen als willkommene Alternative zu Musicals aus dem „sozialistischen Alltag“. Spitzen gegen den bürgerlichen Konservatismus halten sich in Grenzen, nicht aber die von Oscar Wilde bis Agatha Christie genüsslich ausgespielten Schrullen des Adels. Elke Schneider, strenge Theaterkritikerin und in den Nachwendejahren Intendantin der Staatsoperette Dresden, lobte: „Musikalische Erfindung und Arrangement der kleinen Orchesterbesetzung haben nicht nur einen hohen Grad von Übereinstimmung mit Text und Handlung, sondern geben dem Werk eine wirklich eigene Dimension hinzu, von intelligentem Kommentar, illustrativ-komischen Spannungseffekten über Salonmusik bis hin zu ausgewachsenen Shownummer und Liedern, die ins Ohr gehen, ohne anspruchslos zu sein.“
Lord Henry - Dr. Robert Mortimer, Arzt - Jonathan Frankland, Gutsbesitzer - Jack Stapleton, Naturforscher - Beryl, seine Schwester - Lady Pubdustery - John Barrymore, Butler - Miller, Gärtner - Sherlock Holmes, Privatdetektiv - Dr. Watson, sein Freund
2 Klar. (2. auch Bassklar.) - Trp. · Pos. - S. (Xyl. [ad lib.] · Vibr. · gr. Beck. mit Paukenschlägel · Hi-Hat · Bong. · Drumset · kl. Tr. · Tomt. · gr. Tr. · Tempelbl. · Gurke · Rumbakugeln) (3 Spieler) - Klav. - Vl. · Kb.
Uraufführung: 10. April 1982 Erfurt, Opernhaus (D) · Musikalische Leitung: Uwe Hanke · Inszenierung: Joachim Franke · Bühnenbild: Hans Hohnbaum · Kostüme: Waltraut Moser · Choreographie: Sigrid Trittmacher-Koch
Schott Music • 110‘

Natschinski, Gerd
Musical in sieben Bildern (1964) Frei nach Oscar Wildes Komödie „Bunbury“ von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt
Seit 1964 steht Mein Freund Bunbury in lückenloser
Aufführungsgeschichte als Leuchtturm für die gesamte Werkgruppen des heiteren DDR-Musiktheaters: Algernon rechtfertigt sein stundenweises Verschwinden damit, dass er sich um seinen Freund Bunbury kümmern müsse. Das ist zwar eine Lüge, ermöglicht allerdings beträchtliche Freiräume. Etikette, unliebsame Pflichten und Begegnungen lassen sich umgehen. Die Textdichter Helmut Bez und Jürgen Degenhardt gaben der Erfindung von Alibis im gesellschaftlichen Verkehr einen Namen: „Bunburisieren.“ Gemeint waren natürlich auch reale Rollenspiele in der DDR-Gesellschaft. Die Titelmelodie vom „Alibi“, das „nie im Stich lässt“, bleibt sprichwörtlich. Die Verschiebung der Handlung von Wildes Gesellschaftskomödie „The Importance of Being Earnest“ aus dem späten 19. Jahrhundert in die 1920er Jahre zündete. Im Jahr 2011 zählte der Komponist „175 Inszenierungen, an die 6000 Aufführungen in 11 Sprachen“. Am Metropol-Theater folgte neun Jahre nach der Uraufführung schon die zweite Inszenierung. Lady Bracknells Song „Ein bisschen Horror und ein bisschen Sex“ war gleichermaßen Kritik wie lüsterner Seitenblick auf die Sensationsgier der „kapitalistischen Verblödungsindustrie“. Sex sells.
Jack Worthing - Cecily Cardew - Algernon Moncrieff - Lady Augusta Bracknell - Gwendolen, ihre Tochter - Frederic Chasuble - Laetitia Prism - John u. Jeremias, 2 Butler (von einem Schauspieler gespielt) - Entertainer - Tom, Freddy, Maud und andere Freunde Algernons, Lord Ipswich, Lady Ipswich,
Lady Plumpering, Lady Greenham, Ladies und Lords, Girls, Sportler, Passanten, Reporter Slim, Anthony, Arbeitslose, Rumtreiber, Heilsarmee
2 (beide auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 3 · 3 · 1 - P. S. (Glsp. [auch Vibr. ad lib.] · Xyl. · Trgl. · gr. Beck. · Hi-Hat · Charleston-Maschine · Tamb. · Bong. · kl. Tr. · Tomt. · gr. Tr. · Drum Set · Tempelbl. · Stöcke) (2 Spieler) - Hfe. · Git. (mögl. mit Verstärker) - Str. - Bühnenmusik: gr. Tr. m. Beck. - Git. · Banjos · Klav.
Uraufführung: 2. Oktober 1964 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Werner Krumbein · Choreinstudierung: Wolfgang Schottke · Inszenierung: Charlotte Morgenstern · Bühnenbild und Kostüme: Manfred Grund · Choreographie: Nina Feist
Schott Music • 120‘
Operette in einem Vorspiel und drei Akten von Jo Schulz (1960)
Mode, Messe, Modelle – aber auch Intrigen und kalter Krieg – das alles bietet Messeschlager Gisela, mit dem Natschinski seinen Durchbruch als Bühnenkomponist feierte. Die handwerklich perfekte und menschlich integre Modeschneiderin Gisela behauptet sich auf der Leipziger Messe gegen praxisferne Vorstellungen ihres Direktors. Am Ende siegt das nach der Erfinderin benannte Modell Gisela gegen die West-Konkurrenz. Schon Mitte der 1960er Jahre wurde der legendäre Titel über den DDR-Modebetrieb Berliner Schick unliebsam, weil nach dem Mauerbau Wettbewerbe zwischen West- und Ostdeutschland auf den Bühnen der DDR nicht mehr er-








wünscht waren. Allerdings erschien 1965 noch Erwin Leisters Verfilmung für das DDR-Fernsehen mit Eva-Maria Hagen als „stur auf Figur“ machender und den Warenlockrufen des Westens höriges Luder Margueritta. Die Adaption zeigt den hohen künstlerischen Standard der DDR in Sachen Unterhaltungskultur.
Nach der Wende erwies sich Messeschlager Gisela als neuer Erfolgsmagnet. Frank Schwemmers und Peter Lunds Interpretation an der Neuköllner Oper bestätigte, dass zeitgemäßes Arrangement den Nostalgiekick begünstigt und das Vergnügen an den versteckten, aber erkennbaren Kritikspitzen gegen das DDR-System steigert. In seiner Inszenierung demonstrierte Axel Ranisch 2024 mit der Komischen Oper Berlin, dass eine Öffnung des Sujets für die Ideale von Humanität und Genderpluralismus ohne schroffe Änderungen möglich ist. So ist Messeschlager Gisela nicht nur eine der letzten DDR-Operetten, sondern auch ein Stück mit Zukunft.

”Chefchen! Na nu machense mal‘n Fotografiergesicht! Lächeln, immer nur lächeln. Wie‘n Werktätiger auf‘m DEWAG-Plakat!“
Messeschlager Gisela
Gisela Claus, junge Modegestalterin · Sopran - Helga, Näherin · Soubrette - Ingrid, Zuschneiderin · MezzosopranEmma Puhlmann, Werkstattleiterin · Charakterschauspielerin - Robert Kuckuck, Leiter des VEB Berliner Schick · Charakterkomiker - Marghueritta Kulicke, seine Sekretärin · Soubrette (jugendl. Charakterfach) - Heinz Stubnick, Gütekontrolleur · Tenor-Buffo - Fred Funke, Journalist · Tenor - Paul Büschel, ein Messeonkel · Charakterschauspieler - Priemchen, Wächter im Ringmessehaus · Charakterkomiker - Elli, Gerti, Hela und andere Besucherinnen des VEB Berliner Schick, Näherinnen, Zuschneiderinnen, Mannequins, Hausbewohner, Messegäste aus aller Welt · Chor und Ballett 2 · 2
2
2 - 3
2
3
0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Trgl. · Beck. · Gl. · Röhrengl. · Gong · Hi-Hat · Tanzschlagzeug · Tamt. · Bong. · Tamb. · Tomt. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Beck. · Schüttelrohr · Klatsche · Mar. · Tempelbl.) (2 Spieler) - Hfe. · Klav. (auch Cel.) - Str.
Uraufführung: 16. Oktober 1960 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Gerd Natschinski · Choreinstudierung: Martin Kirchner · Inszenierung: Hans Pitra · Bühnenbild: Manfred Schröter · Kostüme: Wilfried Werz ·
Choreographie: Nina Feist
Schott Music • 140‘
Natschinski, Gerd
Utopische Revue (1984–1985)
Libretto von Heinz Kahlow und Gerd Natschinski nach Motiven der Erzählung „Szerelmesek bolygója“ von Fekete Gyula
Realisation der elektronischen Musik: Reinhard Lakomy
Fassung A: Dina - Ali - Robby, ein Roboter, der Humor lernen soll - Opa Leo, Dinas Urgroßvater - Lollo, Dinas Freundin - Sven, Merkurforscher - Florika, ein Marsmädchen - Adonis, der schönste Venus-Mann - 1. Stellvertreter des Präsidenten - 2. Stellvertreter des Präsidenten - Marsüberhauptoberbürovorsteher - MarseinflugkontrolleurassistentDinas Mutter, Professorin für Erotik - eine Zuschauerin - der Dichter, der sich zeitweilig zum Weltpräsidenten macht
Fassung B: Dina - Ali - Robby, ein Roboter, der Humor lernen soll - Opa Leo, Dinas Urgroßvater - Lollo, Dinas Freundin - Sven, Merkurbewohner - Adonis, schönster Mann der Venus - Marsüberhauptoberbürovorsteher - Marskontrolleurassistent - Florika, ein Marsmädchen - Präsident des Hohen Rates des Sonnensystems - 1. Stellvertreter des Präsidenten - 2. Stellvertreter des Präsidenten - Svens Kumpane (Chorherren) - Bewohner der Erde, des Mondes, der Merkur und des Mars sowie der Venus · Chor und Ballett
2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 3 · 3 · 3 · 1 - S. (Trgl. · Hi-Hat · gr. Beck. · gr. Tomt. · kl. Tr. · gr. Tr. · 3 Tempelbl. · Stöcke) (2 Spieler) - E-Git. · E-Bass · E-Org. - Str. – Tonband
Uraufführung: 21. Dezember 1984 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Gerd Natschinski; Hans-Werner Nicolovius · Choreinstudierung: Wolfgang Schottke · Inszenierung: Wolfgang Weit · Bühnenbild: Manfred Bitterlich · Kostüme: Anne Felz · Choreographie: Lothar Hanff
Schott Music • 130‘
Natschinski, Gerd
Musikalisches Lustspiel in drei Akten (1961) von Alfred Berg und Hans Hardt Liedtexte von Hans Hardt
Auch in der kleinen Form setzte Natschinski Maßstäbe. In Servus Peter kommt es zu Verwechslungen zwischen dem Schriftsteller Peter Stamm und dem Sportreporter Peter Schnell, seinem Schulfreund. Sand ins Ehegetriebe des einen Peter wirft Ilona aus Budapest, die Geliebte des anderen. Irritationen und Missverständnisse explodieren, das Happy End bleibt nicht aus. Servus Peter war das erfolgreichste musikalische Lustspiel der DDR und feiert auch die Vorzüge des modernen Wohnungsbaus. Zwei Jahre nach der Uraufführung erschien eine Schallplatte. 1972 wurde erstmals eine Fernsehverfilmung gesendet. Nach der Wende war Servus Peter 2001 an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul erfolgreich. Am Volkstheater Rostock kam es 2005 als „heiteres Musical um den DDR-Alltag“ heraus. 2008 folgte eine Aufführung im Eduard von Winterstein-Theater Annaberg-
Gerd Natschinsky: Servus Peter

Buchholz. Mit der gleichnamigen Hommage an Peter Alexander hat Natschinskis Gegenwartskomödie nichts zu tun. Ein Hauptthema ist der Bitterfelder Weg, in dem Kunstschaffende durch Begegnungen mit Werktätigen zu Darstellungen über die DDR-Lebenswirklichkeit angeregt wurden.
Peter Stamm, Schriftsteller - Petra, seine Frau - Peter Schnell, Sportjournalist - Ilona Terecz, Journalistin aus Budapest - Eberhard Wagner, Mitarbeiter im VEB Blütenduft (alle singende Schauspieler)
S. (Vibr. · Beck. · Hi-Hat · Bong. · Tempelbl.) (2 Spieler)Klav. · Git. - Str. - Alternativ ist eine kleine Besetzung ohne Streicher möglich: S. (Vibr. · Beck. · Hi-Hat · Bong. · Tempelbl.) (2 Spieler) - Klav. · Git. · Streich-, Zupf- oder E-Bass Uraufführung: 1. September 1961 Chemnitz, Städtisches Theater (D) · Musikalische Leitung: Fritz Oettel · Inszenierung: Erwin Leister · Bühnenbild: Klaus Briel · Kostüme: Renate Heuschkel
Schott Music • 110‘
Natschinski, Gerd
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1974)
Gesangstexte von Jürgen Degenhardt
Bis zum Mauerfall war Terzett in der DDR und auf Auslandsbühnen ein großer Erfolg. Der Archäologe Florian Faber, die ägyptische Dolmetscherin Leila und die Denk-

malpflegerin Otti leben in einer Menage à trois, wollen aber aus diesem Liebeskonflikt heraus. Wie konnte es dazu kommen? Otti und Florian hatten sich eine temporäre Eheauszeit verordnet – und dann funkte es bei einer Arbeitsexkursion im Nahen Osten zwischen Florian und Leila. Das „Terzett“ arrangiert sich nun auf der thüringischen Burg Gleichen ganz ähnlich wie deren Graf im 13. Jahrhundert nach der Rückkehr vom Kreuzzug mit seiner deutschen Ehefrau und seiner sarazenischen Geliebten. Leila und Otti betrachten sich allerdings als Herrinnen der Situation und nicht als Opfer. Natschinskis letztes Gegenwartsstück nach Messeschlager Gisela und Servus Peter endete bei der westdeutschen Erstaufführung in Gelsenkirchen mit einer Abstimmung durch das Publikum, welche Frau Florian nun ganz abbekommen sollte. Terzett gibt es als große und kleine Fassung (ohne Chor und Ballett). Das originelle Stück ist Ausdruck der erotischen Freizügigkeit der DDR um 1970, als man in Westdeutschland noch an den ersten Auswirkungen der sexuellen Revolution knapste.
Florian Faber - Leila - Otti - Corbatty - Reiseleiterin - Touristen · Chor u. Ballett
2 (2. auch Picc.) · 0 · 2 (2. auch Bassklar.) · 0 - 0 · 2 · 2 · 0S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Röhrengl. · kl. Trgl. · gr. Beck. · Tamt. · Tamb. · 2 Tomt. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Fußmasch. · Tempelbl. · Bong. · Gurke · Clav. · Charleston-Maschine · Schüttelrohr · Kokosschalen) (2 Spieler) - Hfe. · Git. (m. Verstärker) · Bassgit. (od. Kb. m. Tonabnehmer) - Str.
Uraufführung: 15. Juni 1974 Leipzig, Musikalische Komödie (D) · Musikalische Leitung: Gerd Natschinski · Inszenierung: Wolfgang Weit · Bühnenbild: Volker Walther · Kostüme: Christa Hahn · Choreographie: Monika Geppert
Schott Music • 120‘
Nitschke, Manfred Küssen verboten!
Musical von Heinz Hall (1960) unter Mitarbeit von Hans Peter


Gerd Natschinsky: Terzett
Karl Bollenstrat, Kapitän · singender Schauspieler - Lottchen, seine Frau · singende Schauspielerin od. Mezzosopran - Hans, beider Sohn · Tenor - Renate, Hansens Braut · Soubrette - Karl-Eduard Murkel, Chefsteward · Komiker od. singender Schauspieler · Bass-Bariton - Arno Holzmann, Bootsmann · Bariton - Rolf Stamm, Storekeeper · Tenor-Buffo - Flips, Decksmann · Tänzer - Ein Matrose · Tenor - Ein leichtes Mädchen · Tänzerin - Besitzer einer Attraktionsschau · Schauspieler - Ein Kubaner · Sprechrolle - Eine Kaffeeverkäuferin · Tänzerin - Mitglieder der Schiffsbesatzung, Rummelplatzbesucher, Kubaner · Chor
2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 3 · 3 · 0 - S. (2 Spieler) - Git. · Hfe. · Akk. - Str. - Tonband: Musikboxdixie
Schott Music • 120‘



Reese, Günter / Sander, Harry
Singspiel in fünf Bildern (1965/66) nach Kotzebues „Die deutschen Kleinstädter“ von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt Musik von Günter Reese und Harry Sander (Pseudonym von Harald Sondermann)
Bürgermeister Olmers hält die Einkommen der Kleinstadt Krähwinkel in Schwung, indem er schadhafte Straßen im öffentlichen Raum zulässt. So passieren Kutschenunfälle, die dem lokalen Gewerbe Aufträge sichern. Als Leiter der Leihbibliothek fördert Olmers trendiges Amüsement und Spaß statt substanzieller Bildung. Außerdem will er seine Tochter Sabine in eine ungewollte Ehe pressen. (Die Adaption desselben Stoffes von Siegfried Köhler heißt Sabine, seit sittsam. Siehe Seite 53). Alles geht gut aus, aber die Kleinstadtidylle erleidet einen als Bagatellsache abgetanen Imageschaden.
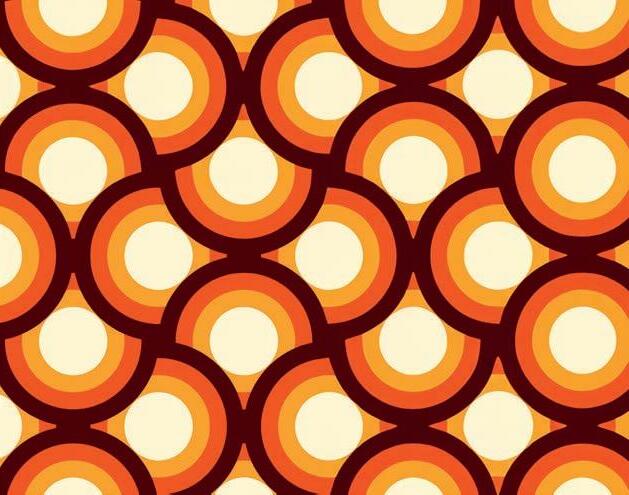
Siebholz, Gerhard
Musical in 3 Akten (1985)




August von Kotzebues unverwüstliche Komödie und Sommertheater-Dauerbrenner „Die deutschen Kleinstädter“ wurde zur Posse mit Gesang über die „gute alte Zeit“. Dieses Singspiel zeigt Parallelen zwischen dem Biedermeier und dem kapitalistischen Geschäftsgebaren des 20. Jahrhunderts.
Als Leiter der nach ihm benannten Combo war Günter Reese besonders im Thüringer Land bekannt. Er spielte Klavier in seiner Gruppe und begann Anfang der 1960er Jahre zu komponieren. Dabei arbeitete Reese erfolgreich mit dem Textdichter-Duo Helmut Bez und Jürgen Degenhardt zusammen. Wie Kneiffels Bretter, die die Welt bedeuten geißelt Kleinstadtgeschichten kleinbürgerliche Verhaltensweisen und Zwänge.
Nikolaus Staar, Bürgermeister von Krähwinkel - Frau Staar, seine Mutter - Sabine, seine Tochter - Frau Brendel - Frau Morgenrot - Leopold Sperling - Karl Olmers - Margarete, Magd
2 (1. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 0 · 1 · 0 · 0 - P. S. (Glsp. · Vibr. · Xyl. · Trgl. · Beck. · Bong. · kl. Tr. · gr. Tr.) - Git. · RhythmusBass · Klav. (Cel.) - Str.
Uraufführung: 18. Februar 1967 Erfurt, Städtische Bühnen (D) · Musikalische Leitung: Volker Münch · Regie: Horst Ludwig · Bühnenbild: Hans Hohnbaum · Kostüme: Romi Wallat Schott Music • 120‘

Buch und Gesangstexte von Goetz Jäger
Max Baumann, Rentner - Herta, seine Frau - Horst, sein Sohn - Waltraud, genannt „Wally“, dessen Frau - Jens, beider Sohn - Erna Mischke, Kollegin von Max - Ferdinand Holz, deren Verlobter - Cornelia Holz, dessen TochterFridolin Holz, Zwillingsbruder von Ferdinand (Doppelrolle) - Ramona Besenbrenner, Barmixerin - Benno Grieshübel, ein Feriengast - Kleingärtner, Liebespaare, Feriengäste, Kellnerinnen und Kellner - Chor und Ballett
2 (auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 (1. auch Altsax., 2. auch Bassklar) · 2 - 3 · 3 · 3 · 0 - P. (auch Trgl., Schellentr., Pandeira) · S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Röhrengl. · Kuhgl. · Schellentr. · Bngs. · Conga · Donnerbl.) · Drumset (auch Trgl., Röhrengl., Tempelbl.) - Hfe. · Klav · 2 Mand. · E-Git. · E-Bass - Str.
Uraufführung: Mai 1986 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Günter Josek · Inszenierung: Horst Ludwig · Bühnenbild: Manfred Bitterlich · Kostüme: Anneliese Felz · Choreographie: Johanna Freiberg Schott Music
Werion, Rudi
Musikalisches Lustspiel von Gerd E. Schäfer Liedtexte von Dieter Schneider
Robert Habermehl - Lisbeth Habermehl, seine Frau - Gitta Habermehl, beider Tochter - Max Stemmer, Geschäftsführer - Isolde Lerche, Sekretärin - Harry Engel, Bürogehilfe - Theodor Scholz - Gustav Müller, Möbelfabrikant - Kurt Müller, dessen Sohn - Vera Kelm, Fabrikantenwitwe - Carola, Stemmers Braut - Berta, Dienstmädchen bei HabermehlsOttokar Steglitz-Stieglitz - Kleindarsteller (Chor oder Ballett)
Fl. (Picc.) · Klar. · Fg. - 2 Trp. · 2 Pos. - S. (Glsp. · Cowbell · Tamb. · Bong. · Drum Set · Schüttelrohr) (2 Spieler) - Git. · Bass(-Gitarre) · Klav. Obligat - Die Besetzung ist notfalls reduzierbar auf Klavier und Rhythmusgruppe.
Schott Music
Zimmermann, Rolf
Musical in zwei Akten (1966/67) Buch und Texte von Klaus Eidam
Inspizient - Brenck, Regisseur - Regieassistentin - Rehlein - Kamerafahrer - Cornelia („Connie“) Mai - Frau RehleinLohmann - Hella Daniel - Dittrich, Produktionsleiter - Egon - Heinz - Karla - Teo - 3 Ausrufer - Schützenliesl - Feuchtfröhlicher Augenzeuge - Gesangslehrerin - Sprecherzieher - Ballettmeister - Fotograf - Kellner - 3 Kameramänner - Techniker, Künstler, Tänzer, Tänzerinnen, Hilfspersonal, Jahrmarktspublikum, Barbesucher 2 (2. auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 (2. auch Bassklar.) · 1 - 3
2
3
1 - S. (P. · Glsp. · Xyl. · Vibr. · Röhrengl. · Trgl. · 4 Kuhgl. · Drumset · Tomt. · Mar. · Kast. · Tempelbl. · Trillerpf.) (2 Spieler) - Git. (mit Verstärker) · Hfe. - Str. (mind. 6 · 4
3
3 · 2 [darunter ein Rhythmusbass mit elektr. Tonabnehmer])
Schott Music

”Bei einer Intrige können Sie immer auf mich rechnen. Was muss ich tun?“
Alles für Figaro
Zimmermann, Rolf
Musical von Therese Angeloff
Alles für Figaro zeigt die Kabalen, die Verbote und den Triumph der Uraufführung von Pierre de Beaumarchais‘ Komödie „Die Hochzeit des Figaro“ in Paris 1784. Das Musical spinnt die Legende vom Schriftsteller als „Sturmvogel der Revolution“ aus. Dem Dichter Beaumarchais, der im Stück eher für eine geistige als für eine gewaltsame Revolution eintritt, stellte Rolf Zimmermann den jungen Straßensänger Paul gegenüber.
Fritz Steiner, langjähriger Intendant der Staatsoperette Dresden, stammte aus einer Theater- und Künstlerfamilie. Seine Schwester Therese Angeloff, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland lebte, schrieb das Textbuch für Zimmermann, der als Schlagersänger unter dem Pseudonym Robert Steffan auftrat. Wie andere Tanz- und Stimmungsmusikkomponisten geht Zimmermann auf die Genrevorgaben des Textbuchs gekonnt ein.
Beaumarchais - Hortense - Paul - Armand - Gudin - Choiseul - Croix - Vaudreuil - Polignac - Königin - Bertin - Theaterdirektor - Préville - Emilie - Gefängniswärter - Spitzel - Zeremonienmeister - Marktfrauen - Bürger – Hofgesellschaft



2 (2. auch Picc.) · 2



- P. S. (Glsp. · Xyl. ·
Kuhgl. · Tamb. · Drum Set · Kast. · 2 Tempelbl. · Triangel · Pandeira · kleine Pauke · große Pauke · ) (1 Spieler) - Hfe.Str. (5 · 4 · 3 · 2 · 2)
Uraufführung: 28. Juni 1972 Dresden, Staatsoperette (D) · Musikalische Leitung: Manfred Grafe · Regie: Fritz Steiner · Bühnenbild und Kostüme: Peter Friede, Eberhard Ahner · Choreographie: Rudolf Klüver Schott Music • 110‘
Zimmermann, Rolf
(Das Fräulein wird Minister) Komödie in einem Vorspiel und zwei Teilen von Margit Gáspár (1969) Chansons und deutsche Bühneneinrichtung (nach der Übersetzung von Gáspár Soltesz) von Klaus Eidam
Mademoiselle Clairon, Schauspielerin, Mitglied der Comédie Francaise - Babette, ihre Garderobiere - Friedrich Alexander, Herzog von Dornspach - Amalie, geborene von Mecklenburg, Herzogin, seine Gemahlin - 4 Minister - Der Wöchner der Comédie Francaise - 2 kleine Mohren (stumm)
Fl. (ad lib. auch Picc.) · Ob. · Fg. - Hfe. - P. S. (Trgl. · Drumset · Tempelbl.) (1 Spieler insgesamt) - Akk. · Klav. - Kb.
Schott Music





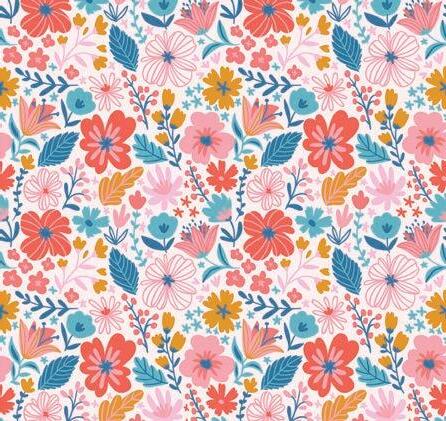






Die Operetten aus den Jahren der frühen Bundesrepublik bis zur Verbreitung des Musicals sind noch weniger bekannt als das eigenständige Operetten- und Musicalschaffen der DDR. Komponisten wie Walter Wilhelm Goetze und Paul Lincke knüpften mit wechselnden Erfolgen an den Karriereglanz vor 1945 an. Noch immer gab es eine breite Operettenproduktion an Subventionsund Tourneetheatern, der man anmerkt, dass sie sich gegen den Film und gegen die zunehmende Bedeutung des Fernsehens durchsetzen musste: Die ältere Generation berief sich auf bewährte Muster und eine behutsam modernisierte Form von Operette und musikalischer Komödie.
Trotzdem ist die Palette der Nachkriegsproduktion zwischen der Bearbeitung eines Vorkriegsstücks wie Goetzes Adrienne und Kurt Heusers Das Fest in Coqueville erstaunlich vielfältig. Mit dem Aufkommen des Musicals kam die Neuschöpfung von Operetten vorerst zum Erliegen.
Nach 1960 wurde das Musical zunehmend zur Attraktion und zum Vorbild für deutschsprachige Stücke. In diesen Jahren blieben in der gesamten deutschsprachigen Theaterlandschaft die formalen Übergänge zwischen Operette und Musical fließend. Mitunter wurden in Ost und West die gleichen Stoffe adaptiert. So entstanden nach Kotzebues Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter“ in der BRD das Musical Sabine, sei sittsam von Siegfried Köhler und in der DDR Kleinstadtgeschichten von Günter Reese.





Czernik, Willy
Operette in drei Akten (1963)
Elisabeth, Kaiserin von Russland · Sopran - Bestuschew, Großkanzler · Bass - Nelly · Sopran - Esterhazy · TenorRasumowskij · Tenor - Chevalier d‘Eon · Tenor - Peliponne · Tenor - Charlotte d‘Eon · Sopran - Tschulkow · Bass - Iwan ·Tenor - Krotoschin · Tenor - Williams · Bass - Lavalliere · Bass - Woronzow · Bass - Schuwalow · Bass - Narijschkin · Alt – Chor
2 · 1 · 2 · 2 - 3 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · Piatti, · Timp. · Tamtam · Cassa · kl.Tr. · Glsp. · Xyl. · Vibr. · Holztr. · Rumbakugeln · C. e p. · Peitsche) (4 Spieler) - Git. · Hfe. · Klav. (auch Cel. und Akk.) - Str.
Musikverlag Zimmermann

Heuser, Kurt
”Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.“
Das Fest in Coqueville
Musikkomödie in drei Akten nach Émile Zolas gleichnamiger Novelle von Herbert Grube und Kurt Gaebel
Manchmal ist Alkohol kein Gift, sondern soziale Medizin mit harmonischer Wirkung. Insofern spiegelt diese Musikkomödie nach der Novelle Émile Zolas die nach 1950 noch recht schlichten und damals kostengünstigen Lebensfreuden der jungen Bundesrepublik. Die lächerliche Familienfehde in dem besiedlungsschwachen Dorf Coqueville an der südfranzösischen Küste ist für die Liebe zwischen Delphin und Margot ein drastisches Handicap. Die verfahrene Romeo und Julia-Situation des jungen Paars wendet sich zu einem glücklichen Ende, als die verfeindeten Familien unter Alkoholeinfluss ihre Aggressionen und Animositäten „hinunterspülen“.
In diesem Stück stehen Momente der traditionellen Operetten-Vergangenheit und pointierte Aufbrüche, normative Ehevorstellungen und Visionen von Autonomie nebeneinander. Es gibt Spurenelemente jenes Fernwehs, das bald zum ersten Flow des Massentourismus führen sollte.
La Queue, Besitzer des Fischkutters „Storch“ und Bürgermeister · Bass - Rouget, Besitzer des Fischkutters „Qualle“
· singender Schauspieler - Ventre, Gastwirt · Schauspieler - Brisemotte, Matrose · Bass - Fouasse, Sohn der Françoise, Matrose · Bariton - Toupain, sein Bruder, Matrose · Tenor - Delphin, Matrose · Bariton - Abbé Radiguet, Pfarrer · Schauspieler - L‘Empereur, Gendarm · Schauspieler - Mouchel, Fischhändler · Schauspieler - Dufeu, Inspecteur der Regierung · Tenor - Françoise, eine alte Witwe · Alt - Marie, Rougets Frau · Alt - Margot, La Queues Tochter · Sopran - Jeanette, Ventres Tochter · Sopran - Louise, Brisemottes Frau · Sopran - Fischer, Frauen und Mädchen aus Coqueville · Chor
2 (beide auch Picc.) · 0
2 · 1 - 2 · 2 · 1 · 0 - P. S. (Rührtr. · 2 Beck. · gr. Tr. · kl. Tr. · Xyl. · Glsp. · Trgl. · Tamb. · hg. Beck. · 2 Tomt. · Holztr.) (2 Spieler) - Git. · E-Git. · Hfe. · Akk. · 2
Klav. - Str. (0 · 0 · 2 · 2 · 1)
Uraufführung: 9. November 1954 Mainz (D)
Astoria Verlag
Heuser, Kurt
Geschrieben von Fritz Rügamer und Hermann Wanderscheck
Der König Dukaterich - Die Königin Kunigunde - Die Prinzessin Rosita - Der Minister Redekunst - Der Schatzmeister Sammelfix - Der Hauptmann Fehlschuss - Der Spielmann Immerfoh - Das Erdmännchen Kritzegrau - Die Blumenfee - Die Eiskönigin - Der Zwerg Rapunzel - Soldaten, Pagen, Burschen und Mädchen, Bergelfen, Berghexen, Zwerge, Schmetterlinge, Blumenkinder, Schneeflocken und Eiszapfen · Kinderchor und Kinderballett
1 · 1 · 1 · 1 - 2 · 1 · 0 · 0 - P. S. (Trgl. · Glsp. · Beckenpaar · hg. Beck. · kl. Tr. · Tomt. · gr. Tr.) (1 Spieler) - Klav. - Str. (mind. 6 · 4 · 3 · 2 · 1)
Uraufführung: 5. Dezember 1942 · Stettin (D) Astoria Verlag • 100‘
Killmayer, Wilhelm Yolimba oder
Musikalische Posse in einem Akt und vier Lobgesängen (1962 - 1963 (1970)) von Tankred Dorst und Wilhelm Killmayer
Herr Möhringer ist Erfinder – und er hasst die Liebe und will dieses Laster ein für alle Mal ausrotten. Was tun? Er erfindet Yolimba, ein Kunstwesen, darauf spezialisiert, jeden zu töten, der das Wort „Liebe“ ausspricht. Das funktioniert dank der „Macht der Magie“ auch tadellos, bis Herbert erscheint. Ihm verfällt Yolimba und plötzlich ist es Möhringer, der gejagt wird und schließlich in einer Mülltonne sein wohlverdientes Ende findet. Alle – inklu -

sive der wieder zum Leben erweckten Opfer Yolimbas –stimmen in den „Großen Lobgesang auf die Müllabfuhr, die Grenzen der Magie und Finale“ ein.
Möhringer, ein Magier · Bass-Bariton - Yolimba, sein Geschöpf · Koloratursopran, Tanzrolle - Drei Herren · 2 Tenöre, 1 Bass - Professor Wallerstein, Archäologe · Tenor od. Bariton - Die Gattin · Sopran - Die drei Söhne (zwischen 8 und 10 Jahren), Die drei Töchter (zwischen 14 und 16 Jahren) · Sprechrollen - Gerda, das Hausmädchen · Mezzosopran - Ein Operntenor · Tenor - Sechs Witwen · 2 Soprane, 2 Mezzosoprane, 2 Alt - Herbert, ein Plakatankleber · Tenor - Drei Postbeamte / Drei Polizisten · 2 Tenöre, 1 Bass - Ein Polizeihund · Schauspieler - Bürger und Bürgerinnen, Postbeamte und Postbeamtinnen, Opernbesucher, Hochzeitspaare, Müllmänner · gem. Chor - Kinderchor - Zwei der Witwen sollen von den Darstellerinnen der Gattin und der Gerda übernommen werden.
2 (2. auch Picc.) · 2 · 1 (auch Altsax.) · 2 - 3 · 2
3 · 1 - P. S. (Trgl. · Zimb. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr. · Tempelbl. [od. Holztr.] · 2 Bong. · Tomt. · Peitsche · Kast. · Mar. · Rasseln · Trillerpf. · Lineal, auf harten Gegenstand geschlagen · Schreibmasch. · Glsp.) (3-4 Spieler) - Klav. (auch vierhd.) · Reißnagel-Klav. (od. Klavier mit Cymbaleinsatz, insges. 2 Spieler) - Str. Bühnenmusik (aus Musikern des Orchesters): 1 (auch Picc.) · 2
0
2 - 0
1
1
1 - S. (kl. Tr.) (1 Spieler) - Harm. (evtl. über Tonband) - Schüsse auf der Bühne – Tonbandeffekte
Uraufführung: 15. März 1964 Wiesbaden, Hessisches Staatstheater (D) · Musikalische Leitung: Wilhelm Killmayer · Inszenierung: Hans Neugebauer · Bühnenbild: Jan Lenica · Choreographie: Imre Keres Uraufführung der revidierten Fassung: 9. Mai 1970 München, Staatstheater am Gärtnerplatz (D) · Musikalische Leitung: Wilhelm Killmayer · Inszenierung: Kurt Pscherer · Bühnenbild: Max Bignens · Choreographie: Franz BaurPantoulier
Schott Music • 75‘

Köhler, Siegfried
Musikalische Kriminalkomödie in vier Bildern von Peter Steinbach (1970) mit Liedertexten und Szenen von Kurt Neufert Musik von Siegfried Köhler, veröffentlicht unter dem Pseudonym „Fred Frederik“
Baroness Somerset-Snowdon - Lady Manuela Douglas, ihre Tochter - Caroline Douglas, Manuelas Tochter - Wladimir Mouse - Ignaz Mouse, sein Sohn - Adam Mouse, sein Enkel - Antony Koslowsky, Chauffeur - Inspektor McAhearnPinnewaker, Polizeibeamter
Klavier oder Elektro-Orgel - S. (Jazz-Schlgz., Rhythmusgruppe)
Uraufführung: 11. Januar 1970 Saarbrücken, Saarländisches Staatstheater (D) Schott Music • 100‘
Köhler, Siegfried Sabine, sei sittsam
Musical in drei Akten (1967) nach Kotzebues „Die deutschen Kleinstädter“ Libretto von Kurt Neufert
In Krähwinkel – einer feinen Stadt mit zwei Hauptstraßen, fünftausend Einwohnern, „darunter sogar einige Dichter“ – durchzogen von einem Fluss, in dem man „herrlich baden“ kann, es aber nicht braucht, denn hier ist man ohnehin stets sauber –, dürfte die „Sittsamkeit“ beinahe vererbbar sein.





Doch Sabine, die Tochter des Bürgermeisters, bringt die spießbürgerliche Welt ihrer Familie ins Wanken – zunächst, ohne dass es jemand merkt. Sei es, weil sie im Fluss doch „herrlich baden“ würde. Oder, weil sie sich heimlich verliebt hat und ihren von der Familie arrangierten, langweiligen Verlobten nicht ausstehen kann?
„Sabine, sei sittsam!“ – dieser Satz erklingt im Musical nicht nur einmal und ist ein direkter Aufruf an die lebensfrohe, frisch verliebte Sabine, sich nicht gegen die kleinprovinzielle bürgerliche Ordnung aufzulehnen.
Die Ironie des Kleinbürgerlebens bleibt in Köhlers Musical erhalten, ganz im Sinne von Kotzebues Die deutschen Kleinstädter (1803), auf dem das Musical basiert. Was letztlich zählt, ist weniger die Liebe, sondern ein Titel: Der gesellschaftliche Rang des geliebten Olmers, selbst wenn er „aus dem Hut gezaubert“ wurde, entscheidet über Sabines Glück und das Happy End.
Der Komponist Siegfried Köhler arbeitete teils unter Pseudonymen. Besonders erfolgreich sind die Operette Alles Capriolen, das Musical Sabine, sei sittsam! (unter dem Namen Frank Kolar) und die Kriminalkomödie Ladies and Gentlemen (als Fred Frederik).
Nikolaus Staar, Bürgermeister zu Krähwinkel - Frau Untersteuereinnehmerin Staar, seine Mutter - Sabine, seine Tochter - Herr Vizekirchenvorsteher und Gewürzkrämer Staar, sein Bruder - Zwei Muhmen - Herr Bau-, Berg- und Weginspektorsubstitut Sperling - Karl Olmers - Ratsdiener Klaus - Margarete, Magd - Ein Bauer - Ein Nachtwächter - Eine Jungfrau - Sprecher der Schützendeputation - Kinder, Volk, Jungfrauen, Ehrenwachen, eine Schützendeputation · Chor
1 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 3 (1. auch Es-Klar., 2. auch Bassklar., 3. auch Altsax.) · 1 (auch Kfg.) - 3 · 3 · 1 · 1 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Röhrengl. · Trgl. · Beck. · Tamt. · Drum Set · Charleston-Maschine · kl. Tr. · Tomt. · gr. Tr.)
(1 Spieler) - Git. · Mand. · Hfe. · Klav. (auch Cemb., Cel. u. Harm.) - Str. (4 · 4 · 2 · 2 · 1) - Bühnenmusik: kleines Blasorchester ad lib.
Uraufführung: 15. März 1967 Saarbrücken, Saarländisches
Staatstheater (D)
Schott Music • 120‘
Köhler, Siegfried / Köhler, Emil
Operette in drei Akten von Will Petersen und Friedrich Wilhelm Jürgens (1952)
Musik von Emil Köhler und Siegfried Köhler
Lincoln Armstrong, Verleger von Kriminalromanen · Schauspieler (auch singend) - Lil, seine Tochter · Sopran - Joe Peines, ein Gentleman · Schauspieler (auch singend) - Harry, eine sehr zweifelhafte Persönlichkeit · Tenor - Pips · Schauspieler (auch singend) - Betsy · Soubrette - Peggy Robertson · Soubrette - Nat Ponkerting, Schiffsdetektiv · Schauspieler (auch singend) - Bob, sein Gehilfe · Buffo - Mestizen und deren Anführer · Chor
kleine Besetzung: 1 (auch Picc.) · 1 · 1 (auch Altsax.) · 1 - 1
2
1
0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · Gong · Beck. · kl. Tr. · Holztr. · Tomt. · gr. Tr. · Drum Set · Kast. · Sambahölzer · Rumba-Instrumente) - Git. · Klav. - Str. (3 Vl. I · 3 Vl. II · 3 Vl. III · 2 Va. · 2 Vc. [geteilt] · Kb.) - große Besetzung: 2 (beide auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 (1. auch Altsax., 2. auch Bassklar.) · 1 · Kfg. - 2 · 2 · 2 · 0 - P. S. - Hfe. · Git. · Klav. - Str. (3-4 Vl. I · 3 Vl. II · 3 Vl. III · 2 Va. · 2 Vc. [geteilt] · Kb.)
Uraufführung: 31. Dezember 1952 Koblenz, Stadttheater (D) Schott Music • 120‘
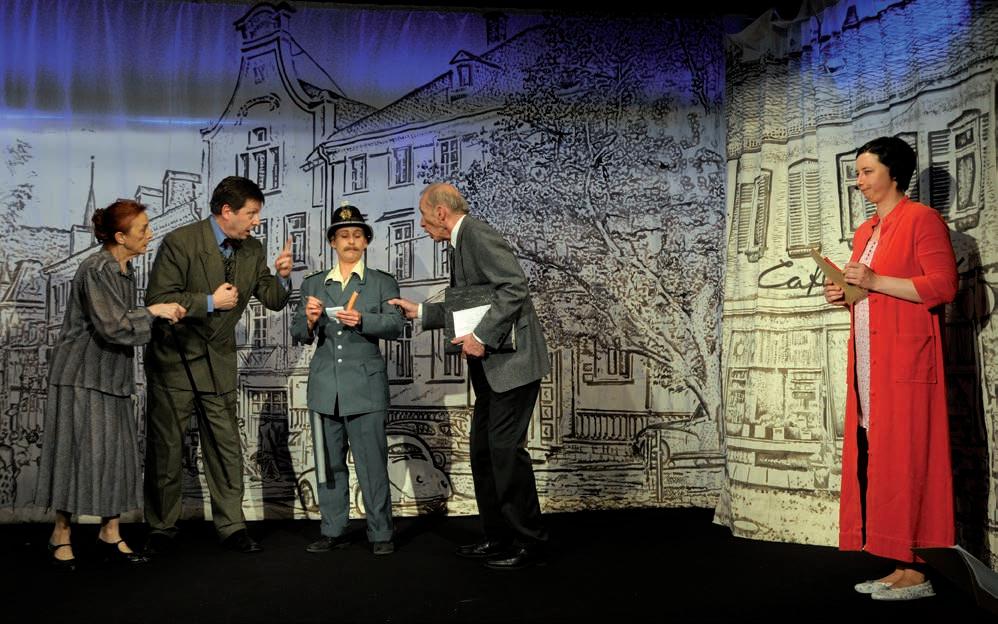
Küster, Herbert
Operette in drei Akten von Ernst Nebhut
Mike Proud, Aktienbesitzer eines Bergwerk-Konzerns · singender Schauspieler - Barbara und Lydia, seine Töcher · Sopran und Soubrette - Cecile, seine Schwester · singende Schauspielerin - Pierre Meunier, Maler · Buffo - Dan Carper, ein reicher junger Mann · Tenor - Barnabas, Butler in einem schottischen Schloss · Schauspieler - Patricia, eine Dame mit leichter Lebensauffassung · Sopran - Skinner, Detektiv · singender Schauspieler - Robledo, Inhaber eines Pariser Nachtlokals · Schauspieler - Marcel, Kellner bei Robledo · Schauspieler - zwei Diener · Chor-Chargen - ein zweiter Kellner · Schauspieler - Gäste auf der Jacht, im Nachtclub und im schottischen Schloss · Chor und Ballett 2 (2. auch Picc.)
1
2
1
2
2
3
0 - P. S. (Beck.) - Hfe. · Git. · Klav. (ad lib.) - Str. Apollo-Verlag • 90’

Nils Lerche
(Hundratusen för en fru)
Musikalische Komödie in fünf Bildern von Knut Hagberth Deutsche Bühnenfassung und Gesangstexte von Michael Rogati Instrumentation von Hans-Klaus Langer
John Ferguson, Businessmann - Liane, seine Frau - Mady Biller, eine berühmte Kosmetikerin - Gwenny Flynn, Fergusons Sekretärin - Der Mann, der durch‘s Fenster steigt - Juan Carrasco, Chef eines mexikanischen Nachtclubs - Lolo, seine Frau - Casavantes, motorisierter Polizeisergeant - Williams, Kammerdiener bei Ferguson - Raimond, der (Wiener) Koch bei Ferguson - James Potkins, Chauffeur - Pueblo, ein Mestize (Kellner) - Drei wilde mexikanische Gesellen - Zwei Negerboys bei Ferguson - Publikum im „Eldorado“
2 Klar. (2. auch Altsax.) · Tenorsax. - 2 Trp. · Pos. - S. (Glsp. · Trgl. · Gong · Drum Set) - Git. · Akk. · Klav. - Str. (ohne Va.)
Uraufführung: 1955 Finnland
Astoria Verlag
Reutter, Hermann
Ein Spiel nach einer Idee von Sonia Korty Dialoge von Fred Schmitz
Topsy, schwarze Garderobiere in einem großen Variété - Colombine, blond wie Gold · klassische Tänzerin - Tom, schwarzer Garderobier im gleichen Variété, verheiratet mit Topsy - Harlekin · klassischer Tänzer - Zwei Manager · Bariton u. Bass - Vier kleine, schwarze Kinder - Ein Boy (Alle Rollen, mit Ausnahme der beiden Manager, sind mit Schauspielern bzw. Tänzern zu besetzen.)
2 (beide auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 (2. auch Bassklar.) · Altsax. · 2 - 4 · 2 · 2 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · Tamb. · Rührtr. · kl. Tr. · Holztr. · gr. Tr. m. Beck.) (3 Spieler)Klav. (auch Cel.) - Str.
Uraufführung: 26. November 1950 Wiesbaden, Hessisches Staatstheater (D) · Musikalische Leitung: Karl Maria Zwißler · Inszenierung: Heinrich Altmann · Bühnenbild: Hans Weyl
Schott Music • 40‘

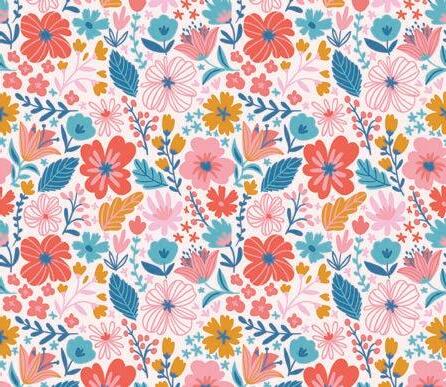




Schütz, Hans Georg
Musikalisches Lustspiel in drei Akten
Buch von Henry Peters-Arnolds, Gesangstexte von Henry Peters-Arnolds und Hans Georg Schütz
Gretel Petersen - Resel Fichtinger - Frank Garwin - Hugo Fischer - Alois Schmidthuber - Paul Mehltreter [Das Stück kann mit einem Schauspielensemble besetzt werden, da die Gesangspartien sehr einfach gestaltet sind.]
2 Altsax. (beide auch Klar.) · 2 Tenorsax. (beide auch Klar.) - 3 Trp. · 2 Pos. - P. S. (Cel. · Glsp. · Vibr. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Beck.) (2 Spieler) - Git. - Piano-Direktion - Str. (ohne Va.)
Astoria Verlag
Spickermann, Adolf
Schwankhaftes Lustspiel mit Musik in drei Akten von Kurt Neufert
Zebedäus Sauerwein, Wirt - Dessen Töchter: Inge, LuiseTaxichauffeure: Hannes, Stoffel, Adrianne (Mindestbesetzung): 3 Sax. (oder Klar.) - 2 Trp. · Pos.S. - Klav. - 5 Vl. · Vc. · Kb.
Uraufführung: ~1949 Mannheim (D)
Schott Music • 120‘
Triebel, Walter Pfälzer Wein


Operette in drei Akten (1947)
Libretto von Friedrich-Wilhelm Jürgens
Babett Huber, Wirtin vom Spinnrädl · Mezzosopran - Heiner, ihr Sohn · Tenor (lyr. Bass) - Lene, ihre Tochter · Soubrette - Schorsch Bauer, Weingutsbesitzer · Bariton - Maria, seine Tochter · Sopran - Alois Brandl, genannt Schlapper · BassBariton - Gottlieb Horbach, Lehrer · Tenor - Ursula Herten, Schauspielerin · Operettensängerin - Max Weber, Schauspieler · Tenor - Robert Bohm, Schauspieler · Bass - Pfälzer, Pfälzerinnen, Musikanten, Burschen, Kellnerin und Kinder · Chor
2 (beide auch Picc.) · 2 · 2 (2. auch Es-Klar.) · 2 - 4 · 2 · 3 · 1 (nur für Bühnenmusik) - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. · Knarre) - Hfe. · Cel. - Str.
Uraufführung: Oktober 1947 Detmold (D)
Apollo-Verlag • 120‘

Winkler, Gerhard
Operette in drei Akten (1950) von Waldemar Frank und Eduard Rogati nach einer Novelle von Carl Peter Gillmann Liedertexte von Günther Schwenn
Accordeon XI., König von Triolien · Komiker - Sonata, seine Tochter · Sängerin-Soubrette - Arietta, deren Hofdame · Soubrette - Ernesto Flauto, Innenminister; Enrico Clarino, Justizminister; Guiseppe Fagotti, Finanzminister · drei singende Chargen - Sardinia, Herzogin von Risotto · Komikerin - Erbprinz Chianti, ihr Sohn · Buffo - Tino Belcanto, ein berühmter Operettenkomponist · Tenor - Signora Doullieux, Leiterin der „Casa Musica“ · drastische Komikerin - Piano, Leibdiener des Königs · drastischer Komiker - Inspizient im „Teatro del Corso“; Oberkellner; Wachtmeister; Gendarm · 4 Chargen - Chor - Ballett – Tanzsolisten
2 (beide auch Picc.) · 2
2
2 - 3
3
3 · 0 - P. S. (Glsp. · Vibr. · Gl. · Glockenstab · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. · Kast. · Sir.) - Hfe. - Str.
Uraufführung: 12. Februar 1950 Dortmund, Theater der Stadt (D)
Astoria Verlag
Wunderlich, Hans-Joachim
Posse mit Gesang und Tanz
Aus den Komödien des Titus M. Plautus zusammengesetzt von Rolf Wilken
Titus Maccius Plautus (um 254 v. Chr.) gilt als einer der wichtigsten Komödiendichter der römischen Literatur. Er wurde vor allem dadurch bekannt, dass er die griechischen Komödien dem derben Geschmack des römischen Publikums anpasste und seine Stücke mit Liedern und teilweise explizit erotischen Tanzeinlagen durchsetzte. Von den über 100 Stücken, die unter seinem Namen überliefert sind, gelten heute 21 als echt und tatsächlich von ihm verfasst.
Rolf Wilken und Hans-Joachim Wunderlich schufen mit ihrer „Posse mit Gesang und Tanz“ ein humorvolles Pasticcio aus Motiven dieser 21 Plautus-Komödien. Alle wichtigen Protagonisten der Komödien sind versammelt
und eingearbeitet in eine heitere Geschichte, die in kabarettartiger Weise Plautus‘ Lieblingsthema aufgreift: die beißende Kritik an der Lebensweise der Begüterten und den – stets erfolgreichen – Versuch der weniger Privilegierten, ein Stück vom Kuchen zu ergattern. Der Anteil der Musik ist überschaubar und beschränkt sich auf einige schwungvolle Tanzeinlagen und chansonhafte Lieder.
Merkur - Amor - Cleäreta - Phronesium - Planesium - Leäna - Simon - Artemona - Carinus - Palästrio - PyrgopolynikesSelenion - Harpax - Calidorus - Epidicus – Curculio
1 · 1 · 1 · 1 - 2 · 2 · 1 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · Beck. · Gong · gr. Tr.) (1 Spieler) - Git. · Hfe. - Str.
Uraufführung: 6. April 1973 Baden-Baden (D)
Astoria Verlag



Seit 1989 wurden die Gattungen (Neue) Operette und Musical bunter, aber auch schwärzer. Die Jahre nach der Wiedervereinigung sind auch hier durch Öffnung der Blockgrenzen, Wechselbeziehungen regionaler Ausprägungen und künstlerische Fluidität geprägt. Das Musical feierte Welterfolge in explosiven Sujets und lief der Operette im deutschsprachigen Raum für fast zwei Jahrzehnte den Rang ab. Zugleich brachte es neue Publikumsströme. Broadway- und West End-Musicals wurden für Produktionen an Subventionstheatern freigegeben. Parallel setzte um 2000 eine umfangreiche Entdeckungsarbeit für unbekannte Operetten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ein, z. B. für Johann Strauss und Jacques Offenbach. Nach manchen Vereinfachungen mit dem Ziel hoher Besuchszahlen begann die Neubesinnung auf das kritische, subversive, queere und emanzipatorische Potenzial der Operette vor 1945. An Spezialhäusern und Mehrspartentheatern überraschten Besetzungskombinationen aus Opernsänger:innen, Musicaldarsteller:innen, Tänzer:innen und Schauspieler:innen, die gegen überkommene Klischees rebellierten.





Operette gewann in dieser neuen Ausprägung auch für jüngeres Publikum an Attraktivität als mondäne, aktuelle und frivole Kunstform – ähnlich wie zwischen den Weltkriegen. Es entstanden Fortführungen älterer Stückmuster. Zum Beispiel meinte Siegfried Köhler mit seinem Titel Old Germany nicht die altdeutsche Butzenscheibenromantik, sondern die Wirtschaftswunderjahre und die Öffnung Westdeutschlands für den amerikanischen Lebensstil. Neue Werke wie Benjamin Schweitzers postmoderne Operette Südseetulpen und Enjott Schneiders Musical Diana – Cry for Love reagieren auf mediale Umwälzungen mit einem imposanten Reichtum kompositorischer Mittel.













Schweitzer, Benjamin
Operette in zwei Akten (2012–2014) Libretto von Constantin von Castenstein
Welche Priorisierung ist die passende? „Die Queen, die Kosten, der Krieg!“ oder „Die Kosten, der Krieg, die Queen!“ oder „Der Krieg, die Queen, die Kosten!“ – Die Schöpfer von Südseetulpen hatten während der Rezession 2010 ihre Idee für ein Sujet über Gründung und Pleite der South Sea Company: Der Südseehandel ab 1711 sollte die Kriegsschulden von Queen Anne ausgleichen und den Staatsbankrott verhindern. Die smarten Möchtegern-Wirtschaftsgewinner George Caswell und John Blunt fallen von unserem Heute nicht nur zurück ins 18. Jahrhundert, sondern auch noch ins 17. Jahrhundert und sind in der Vergangenheit ebenso miese Schaumschläger und Glücksritter wie im Jetzt. Nach der Pause geht es in Holland um den Handel mit Tulpen, bis die Südseeschönheit Pandora mit dem Geschäftsmann Peter Stuyvesant zur eigenen turbokapitalistischen Eroberungsfahrt aufbricht.
Schweitzer und sein Librettist von Castenstein wollten mehr als die Basiszutaten von „schmelzenden Melodien, schmissigen Ensembles, viel Wortwitz und einer Liebesgeschichte“. So entstand in der Nachfolge der großen Erfolgsmuster vor 1945 eine junge Operette, die von allegorischen Figuren bis zum listig hingeworfenen Szenenzitat die Mittel des postmodernen Theaters genüsslich und hemmungslos ausschlachtet.
Hauptrollen: Pandora; Das Glück, allegorische Gestalt · Mezzosopran - Lady Margaret Hamilton · Alt - John Blunt, Finanzjongleur · Tenor - George Caswall, Finanzjongleur · Bariton - Sir Robert Harley; Peter Stuyvesant · Bass(bariton)
Nebenrollen: Der Zufall; Queen Anne; Mrs. Hutchinson; Frau Antje; Königin Amalie · Sopran - Zollbeamter (Sprechpartie); Sir Isaac Newton; Mr. Woodgate; Marktleiter Koopman · Tenor - Gouverneur Hamilton, (Sprechpartie); John Gay; Biemoto; Prinzgemahl Frederik (Sprechpartie) · Bariton - Kapitän Bragwater; Georg Friedrich Händel; Immobilienhändler van Wucheren · Bass - Chor (Matrosen, Volk, Parlamentarier) - Ballett - Figurentheater (ad. libitum)
Anmerkung: Die Nebenrollen können selbstverständlich auch auf mehrere Sängerinnen verteilt werden
3 (2. auch Picc., 3. auch Altfl.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 (1. in Es und B, 2. in A) · Bassklar. · Altsax (auch Baritonsax.) · 2 (2. auch Kfg.) - 4 · 2 · 3 (1. Tenorpos. ad lib., 3. auch Basspos.) · 1 - P. S. (I: Trgl. · hg. Beck. · Hi-hat · 2 Cong. · gr. Tr. · 3 Holzbl. · 3 Tempelbl. · 2 Blumentöpfe · Papier; II: Vibr. · Marimba · 2 Kuhgl. · 2 Bong. · Schlitztr. · Donnerbl. · Regenmacher · Papier; III: Marimba · Beck. · Son. · Wassertamt. · kl. Tr. · 2 Tomt. · 2 Holztomt. · Guiro · 2 Mar. · Kast. · Flex.; IV: Steel Dr.) (4 Spieler) - Hfe. · Cemb. (auf der Bühne) · Klav. - Str. (8 · 6 · 6 · 6 · 4 [2 Fünfsaiter])
Uraufführung: 14. Januar 2017 Chemnitz, Theater (D) · Musikalische Leitung: Ekkehard Klemm · Inszenierung: Robert Lehmeier · Bühnenbild: Tom Musch · Kostüme: Ingeborg Bernerth · Choreographie: Danny Costello Schott Music • 120‘
Schneider, Enjott / Zoller, Thomas nullvier
Das Schalke-Musical zum 100jährigen Jubiläum des FC Schalke 04 (2004)
Libretto von Michael Klaus, Songtexte von Bernd Matzkowski
Arrangements von Thomas Zoller
In den 1980er Jahren: „Der Alte“ sackt vor dem Fernseher genervt in den Herzinfarkt und schließt mit Gott noch die Wette ab: Er darf so lange noch bleiben, bis Schalke 04 gewinnt. Dies gelingt dann umständlich, weil eine Liebesgeschichte mit der Cellistin Louisa Stegemann aus bestem Hause Verrwirrung bringt, dem Jungtalent Jojo Schrader in einem spannend grandiosen Finale. Die Geschichte orientiert sich frei an der legendären Rettung des Vereins durch den damals jungen Olaf Thon, aber auch an den Intrigen und Ränken, denen Schalke 04 immer ausgesetzt war. Enjott Schneider Frauenstimmen: 1. Stimme (obere), 2. Stimme (mittlere, bei Zweistimmigkeit oben, ad lib. unten), 3. Stimme (2. Stimme bei Zweistimmigkeit) in folgenden Rollen: Louisa Stegemann, Tochter aus gutem Hause · Anna, Louisas beste Freundin · Aurora, Tattooladenbesitzerin · Gisela Schrader, Jojos Mutter und Inhaberin eines Friseursalons · Sigrid Stegemann, Louisas Mutter, wohnhaft in KorschenbroichMännerstimmen: 1. Stimme (obere), 2. Stimme (mittlere, bei Zweistimmigkeit oben, ad lib. unten), 3. Stimme (2. Stimme bei Zweistimmigkeit) in folgenden Rollen: Gott · Der Alte, Fußballfan · Jojo, junges Fußballtalent · Stephan Potthoff, Fußballstar, Jojos Idol · Ümit, Jojos bester Freund · Mücke, repariert Motorräder · Präsident des Fußballvereins · Manager des Fußballvereins · Trainer der 1. Mannschaft · Dipl. Ing. Berthold Stegemann, Unternehmer, Louisas Vater · Udo, Kioskbesitzer - Fußballspieler, Fußballfans, Nachbarschaft vom Schalker Markt, Geburtstagsgäste, Discobesucher, Zocker · Chor
1 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 4 (1. auch Bassklar., 2. auch Altsax., 3. auch Altsax. u. Tenorsax., 4. auch Tenorsax.) · Bassklar. (auch Baritonsax.) · 1 - 2 · 3 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Beck. · Tamt. · Tamb. · Bong. · Tomt. · gr. Tr. · Drum Set · Chimes · Guiro · Timbales · Cabaça · Vibraslap · Clav. · Woodbl.) - E-Bass · Klav. - Str.
Uraufführung: 9. Mai 2004 Gelsenkirchen, Musiktheater im Revier (D) · Musikalische Leitung: Kai Tietje · Inszenierung: Matthias Davids · Bühnenbild: Knut Hetzer · Kostüme: Judith Peter · Choreographie: Melissa King Schott Music • 130’
Schneider, Enjott
Memorial für Soli, Chor, Ballett und Orchester (2001–2002)
Libretto von Wolfgang Rögner
Englische Fassung von Dean Wilmington
Deutsch • Englisch
Die Ereignisse, die zu Dianas Tod führten, werden durch die Augen von Dodi Al-Fayeds Butler René nachgezeichnet. Während sich Dianas Beziehung zu Dodi entwickelt, verliebt sich Dianas enge Freundin Debbie in René. Diana und Dodi fühlen sich durch die Aufmerksamkeit der Paparazzi gestört, die sich in ihr Leben einmischen und sie ihrer Intimität berauben. Diana erinnert sich daran, dass sie sich in ihrem Leben immer unwillkommen gefühlt hat und sich nach einem „normalen“ Leben sehnt. Als das Interesse und das Eindringen von Presse und Medien explodiert, beschließt Dodi, mit Diana an einen geheimen Ort zu fliehen. Zusammen mit René und Henri, dem Sicherheitschef des Pariser Hotels Ritz, plant er eine geheime Abreise, aber die Paparazzi entdecken ihn. Die Jagd beginnt ...
Lady Diana · Sopran - Debbie (Kammermädchen) · Sopran (Soubrette) - Mr. Dodi al Fayed · Tenor (lyrischer Bariton)René (Mr. Dodis Butler) · Bariton - Henri Paul (stellvertretender Sicherheitschef Hotel Ritz) · Bariton - Repossi (Juwelier) · Bariton - Diverse Kleinpartien wie: Trevor (Mr. Dodis Leibwächter) - Christiano (Koch) - Luigi (Kapitän) - Hotelpagen - Gäste - Paparazzi, Crew der Jonical, Hotelgäste · ChorHotelpersonal, Paparazzi, Traumfiguren · Ballett - Hotelgäste, Unfallhelfer · Statisten
2 (2. auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 (auch Bassklar. u. Altsax.) · 0 - 3 · 2 · 2 · 1 - P. S. (Vibr. · Marimba · Tamt. · kl. Tr. · Tomt. · gr. Tr. · Drumset) (2 Spieler) - E-Git. · Bassgit. · Klav. (auch Cel.) · Keyboard - Str. (12 · 10 · 8 · 6 · 4)ad lib. Tonbandzuspielung (Livemix, Teilmikrophonierung)
Uraufführung: 12. Oktober 2002 Görlitz, Theater (D) · Musikalische Leitung: Wolfgang Rögner · Inszenierung: Valentina Simeonova · Bühnenbild und Kostüme: Iris Jedamski
Schott Music • 135‘
Natschinski, Thomas Wunderbar
Revue (2001)
Buch von Sascha Iljinskij, Jürgen Nass und Roland Welke
Dinarsade · Mezzosopran, rockig balladeske Musicalstimme - Sultan · hoher Bariton, lyrische Rockstimme - Wesir · Bass/ Bariton, kräftige Rockstimme - Vocalise · lyrischer Alt (live oder per Bandzuspiel, keine Bühnenpräsenz) – Artistik
1 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 (auch Tenor-, Alt- oder Baritonsax.) · 0 - 1 · 3 · 3 (3. auch Basspos.) · 0 - P. S. (Drum Set · orientalische Percussion, diverse Gongs und Trommeln) - Git. (E-Git. u. Akustik-Git.) · Bass-Git. (auch Kb.) · 2 Keyboards (1: Klavier, E-Piano u. Samplerstation; 2: Synthesizer, Strings, Chöre u. Flächen) - Str. (ohne Kb.)
Uraufführung: 1. März 2002 Berlin, Friedrichstadtpalast (D) · Musikalische Leitung: Detlef Klemm · Inszenierung: Jürgen Nass · Bühnenbild: Fred Berndt · Kostüme: Ingrid Böttcher · Choreographie: Gail Davies-Sigler; Marvin Smith; Birgitta Nass
Schott Music • 120‘
Koschev, Dmitri / Steuerwald, Frank / Streul, Eberhard
Nur! für Erwachsene
Musical von Eberhard Streul (2022) frei nach Motiven des gleichnamigen Märchens der Brüder Grimm
Dornröschen (auch Rosenhecke, Zofe, Hermine) · SopranPrinz (auch Bischof) · Tenor - König · Bass-Bariton - Königin (auch Rosenhecke) · Sopran - Koch · Tenor - Danimonia, Hexe (auch Frosch) · Sopran - Musikmeister · Sprechrolle (wird vom Keyboardspieler übernommen)
Drum Set (Jazz) – Keyboard
Uraufführung: 19. November 2022 Worms, Das Wormser (D) · Inszenierung: Eberhard Streul
Schott Music • 100‘
Köhler, Siegfried
Ein deutsches Revuemusical nach einer Idee von Kurt Neufert (1992/2007)
Libretto/Dialoge von Jutta Schubert
Liedtexte von Kurt Neufert und Jutta Schubert
Fast zu viel Handlung für ein einziges Bühnenstück: Eine Gruppe amerikanische Touristinnen erlebt alle Deutschland-Highlights von der Loreley bis Neuschwanstein, aber nicht das Wesentliche von Old Germany, nämlich die Grabenkämpfe der Amerikanisierung und der sexuellen Revolution. Diese werden an den familiären Grundsatz- und Seitensprungkonflikten der schwächelnden Firmenspitze von „Miederwaren en gros und en détail“ dargestellt: Vater hat eine Geliebte, Mutter agitiert in der Sittendeliktausrottungspartei. Die komödiantischen Böller der Operette knallen zuerst im schäbigen Club „Blaue Grotte“ und später am Sylter Nacktbadestrand. Und an all dem ist die Presse nicht ganz unschuldig … Der Rückblick auf die Wirtschaftswunderjahre Westdeutschlands besticht durch Witz und Tempo. Als Generalmusikdirektor in Wiesbaden, Hofkapellmeister der Königlichen Oper Stockholm und genialer Einspringdirigent war Siegfried Köhler (1923 bis 2017) international anerkannt. Sein kompositorisches Schaffen widmete er überwiegend dem musikalischen Unterhaltungstheater. Der Globetrotter-Boogie aus Old Germany reibt sich spielerisch an Gershwins Orchesterstück An American in Paris (alle Versionen bei Schott unter LS 5957 und LSMC 20250-01 bestellbar). Das flotte Stück parodiert vieles –von der Popmusik bis zum Stimmungsschlager und vor allem die Doppelmoral.
Fridolin Schmitz, Chef der Firma „Miederwaren en gros und en détail“, hat schon bessere Zeiten gesehen - Lina Schmitz, seine Frau, Spitzenkandidatin der SDP (Sittendeliktausrottungspartei), immer noch attraktiv - Gabi Schmitz, ihre Tochter, mausert sich von der Jungfrau zur Fachfrau - Maya, jobbt als Chansonette in der „Blauen Grotte“, hat jedoch höhere Ambitionen - Mauritius, Mayas reicher Onkel aus Amerika, Geschäftsführer der Firma SSW (Slip & Strip Worldwide), in den besten Jahren - Freddy Seitz, Modedesigner mit Aussicht auf eine Karriere, eben ein Bonvivant - Detlef von Haase, Reporter der Boulevardzeitung „Alles im Bilde“Maier, Buchhalter und Faktotum in der Firma Schmitz - Iwan
Moskowitsch alias Erich Honnenberger, zwielichtige Figur in diversen Rollen, u.a. Reiseleiter, Fahrer der Deutschen Bank, Portier, Ganovenboss Williams, Direktionschef, Bademeister, Badearzt - Chöre: Damen: amerikanische Reisegruppe / Drei Stewardessen / Drei Parteigenossinnen / Tippmamselln - Herren: Mitarbeiter der Firma Schmitz / Drei Parteigenossen / Kurgäste im Schwitzbad (Quartett) - gesamter Chor: Reisende und Passanten am Flughafen / Barbesucher in der „Blauen Grotte“ / Kurgäste und Badegäste auf Sylt - Tanzgruppe - Statisterie ad lib.
1 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 3 (1. auch Es-Klar., 2. auch Bassklar., 3. auch Altsax.) · 1 (auch Kfg.) - 3 · 3
2 ·
1 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · 3 Gongs · Röhrengl. · Trgl. · hg. Beck. · 4 Bong. · 4 Tomt. · Schellentr. · kl. Tr. · Rührtr. · 2 gr. Tr. · 3 Holztr. · Kast. · Ratsche · 2 kl. Stahlstücke · Schiffsgl. · Waschbrett. · Drumset) (2 Spieler) - Git. (evtl. keyed guitar) · 2 Mand. · Banjo (oder Keyboard) · Klav. (auch Harm., Cemb., Cel., Akk. [1 Spieler, Keyboard-Klaviatur]) · Hfe. - Str. - Bühnenmusik (Live oder Toneinspielung): Klar. · Bassklar. · Sax. - 3 Trp. · 2 Pos. · Tb. - S. - Git. · E-Bass · Klav. - Str. (1 · 0
0
1 · 1)
Schott Music • 100‘
Um die eindeutig als Operette oder Musical bestimmbaren Werke gibt es einen breiten Strahlenkranz von Bühnenkompositionen, die keines von beiden sind. Trotzdem lassen sie sich als Phänomen unter Zuhilfenahme der dominierenden Gattungen erklären. Zu diesen gehören die Werke von George Gershwin, welche sich von den Entwicklungssträngen des amerikanischen Musicals absondern. Von Gershwin stammt auch das berühmteste zwischen allen Musiktheater-Gattungen stehende Werk überhaupt: Porgy and Bess. Verspielte US-amerikanische Fortschrittler wie Marc Blitzstein mit Triple Sec schufen über den Gattungskategorien schwebende Partituren, in denen sie mit polystilistischen Mitteln, irritierenden Handlungskonstellationen und Humor die Ungewissheiten des Menschen in modernen Gesellschaften spiegeln.













Marc Blitzstein: Triple-Sec Konzerthaus Berlin 2015 Foto: Stephan Pramme

Blitzstein, Marc
(Die Sünde des Lord Silverside) Opera-farce in one act (1928)
Text by Ronald Jeans Englisch • Deutsch
Triple-Sec ist eine Dreiecksgeschichte und erfordert im Laufe des Stücks immer mehr Darstellende für jeweils eine Figur: Den Mann, die Ehefrau, die Geliebte des Mannes aus der US-amerikanischen Upperclass, dazu eine Conférencière sowie Bedienstete. Doppelt sehen in diesem „Dinnerdrama” der außergewöhnlichen Art nach mehreren Gläsern der Cocktailzutat Triple-Sec nicht nur die Betroffenen des hochprozentigen Seitensprung-Dramoletts, sondern auch das Publikum. Zuschauer nehmen das frivole Geschehen wahr, als hätten sie selbst Alkohol konsumiert.
Die Musik von Marc Blitzstein (1905–1964) ist anschmiegsam, witzig und gestisch. Das Stück gehört so wenig zur „echten“ Oper wie Weills Happy End. Der vom Kompositionsunterricht bei Arnold Schönberg enttäuschte Blitzstein interessierte sich nach einem Aufenthalt in Berlin vor allem für Zeitopern, wie zum Beispiel für Neues vom Tage von Paul Hindemith. Wie einige deutsche Weill-Stücke steht der Einakter auf der Schwelle zwischen den Gattungen und gerät dabei zu einer lustvollen Entfesselung von Theater, bei der Musik eher Motor als Anlass ist. Der 1928 entstandene und ursprünglich „Theater for the Cabaret“ betitelte absurde Schwank erlebte seine europäische Erstaufführung erst im März 2015 im Rahmen des Festivals Mythos Berlin an einem Abend mit George Gershwins Jazzoper Blue Monday (bei Schott unter LSMC 20310 bestellbar) im Konzerthaus Berlin.
Hostess · Alt - Hopkins I, butler · Bariton - Hopkins II · Bass-Bariton - Hopkins III · Bass - Perkins I, maid · SopranPerkins II · Sopran - Perkins III · Sopran - Perkins IV · Sopran - Perkins V · Alt - Perkins VI · Alt - Perkins VII · Alt - Perkins
VIII · Alt - Stranger I · Mezzosopran - Stranger II · Alt - Lord Silverside I · Tenor - Lord Silverside II · Tenor - Lady Betty I · Sopran - Lady Betty II · Sopran - Lady Betty III · Mezzosopran
0 · 0 · 2 · 1 - 0 · 1 · 1 · 0 - S. (P. · Xyl. · Kuhgl. · Schellentr. · kl. Tr. · gr. Tr. · Holzbl. · Ratsche) (2 Spieler) - Klav. vierh.Str. (1 · 0 · 1 · 0 · 1)
Uraufführung: 6. Mai 1929 Philadelphia (PA), Bellevue-Stratford Ballroom (USA) · Musikalische Leitung: Alexander Smallens · Inszenierung: James Light · Kostüme: Louis Simons
Schott Music • 15’
Gershwin, George Porgy
An opera in three acts (1935) Libretto by DuBose Heyward
Lyrics by DuBose Heyward and Ira Gershwin founded on the play „Porgy” by Dorothy and DuBose Heyward
Englisch
Porgy · bass-baritone - Bess · soprano - Crown · baritone - Sportin‘ Life · tenor - Robbins · tenor - Serena · soprano - Jake · baritone - Clara · soprano - Maria · alto - Mingo · tenor - Peter · tenor - Lily · soprano - Frazier · baritone - Annie · mezzo-soprano - Strawberry woman · mezzo-soprano - Jim · baritone - Undertaker · baritone - Nelson · tenorCrab man · tenor - Scipio · boy soprano - speaking roles: Mr. Archdale, Detective, Policeman, Coroner – chorus Originalversion: 2(2.pic).2(2.ca).3(2.,3.asax).bcl(tsax).1-
3.3.2.1-timp.perc(xyl, tri, bells, sus cym, crash cym, hand cyms, s.d, tom-t, b.d, African drums, chimes, wdbl, tempbl, sand paper, train whistle)-pno.banjo-str - on stage: pno
George and Ira Gershwin Definitive Performance Edition edited by Wayne D. Shirley: 2(2.pic).2(2.ca).3(2.,3.asax). bcl(tsax,clar.).1-3.3.2.1-timp.perc(glsp., xyl, tri, bells, sus cym, crash cym, hand cyms, s.d, tom-t, b.d, African drums, chimes, wdbl, tempbl, sand paper, train whistle)-pno.banjostr - on stage: pno
Uraufführung der Originalversion: 10. Oktober 1935 New York (NY), Alvin Theatre (USA)
Uraufführung Revision: 11. Oktober 2018 London, English National Opera, London Coliseum (UK) · Veranstalter: English National Opera · Musikalische Leitung: John Wilson · Inszenierung: James Robinson · Kostüme: Catherine Zuber · Bühnenbild: Michael Yeargan
Gershwin Music, administered exclusively by European American Music Distributors Company (EAMDC) • 180’
Gershwin, George / Murray, Diedre L.
adapted by Suzan-Lori Parks and Diedre L. Murray (2011)
Orchestration by William David Brohn and Christopher Jahnke
Original libretto by DuBose Heyward lyrics by DuBose Heyward and Ira Gershwin founded on the play „Porgy” by Dorothy and DuBose Heyward
Englisch
Porgy · bass-baritone - Bess · soprano - Crown · baritone - Sportin‘ Life · tenor - Robbins · tenor - Serena · soprano - Jake · baritone - Clara · soprano - Maria · alto - Mingo · tenor - Peter · tenor - Lily · soprano - Frazier · baritone - Annie · mezzo-soprano - Strawberry woman · mezzo-soprano - Jim · baritone - Undertaker · baritone - Nelson · tenorCrab man · tenor - Scipio · boy soprano - speaking roles: Mr. Archdale, Detective, Policeman, Coroner – chorus picc.1.1.asax(picc).1(tsax).barsax.0-2.2.1.btbn.0-1perc(cym, xylo, s.d, timp)-2vn.va.vc.db
Gershwin Music, administered exclusively by European American Music Distributors Company (EAMDC)
Gershwin, George
An opera in one act (1922) Libretto and lyrics by Buddy de Sylva
Englisch
Joe, a gambler · tenor - Vi, his sweetheart · lyric soprano - Tom, Cafe entertainer · baritone - Mike, Cafe proprietor · bass - Sam, Boy-of-all-work · baritone - Sweetpea, Cafe pianist · spoken
Orchestration by George Bassman (1953): 5 reeds(I: fl, Bbcl, bcl, asax; II: pic, fl, Bbcl, bcl, asax; III: fl, ob, Bbcl, bcl, tsax; IV: fl, ca, bcl, tsax; V: fl, Bbcl, barsax, bsn)-2hn.3tpt.2tbn. btbn-timp.perc(xyl, bells, big cym, s.d, chimes, wdbl).2pnobanjo-str
Orchestration by Gregg Smith (1976): 1.1.1.tsax.1-2.2.2.0timp.perc(tri, bells, cym[or gong], s.d, b.d, wdbl)-hp.pnostr
Gershwin Music, administered exclusively by European American Music Distributors Company (EAMDC) • 25’
George
Blue Monday Musiktheater im Revier
2010 Foto: Pedro Malinowski





Paul Hindemith: Neues vom Tage
Theater Lüneburg 2015
Foto: Andreas Tamme

Hindemith, Paul
Lustige Oper in drei Akten (1928–1929)
Text von Marcellus Schiffer
Die frisch verheirateten Eduard und Laura geraten in einen wüsten Streit, der mit dem Entschluss endet, sich scheiden zu lassen. Auf der Jagd nach neuen Sensationen erscheint die Fotoreporterin Pick und findet in dem heillos zerstrittenen Ehepaar ihre „Opfer“. Um nach Irrungen und Wirrungen wieder zusammenzuleben, gehen sie auf das Angebot des allmächtigen Medienmoguls Baron d‘Houdoux ein, auf dessen Weltstadtbühnen Streitszenen ihrer Ehe zu spielen. Nach unzähligen erfolgreichen Auftritten als streitendes Ehepaar beschließen Eduard und Laura, sich aus dieser Glamour-Welt ins Private zurückzuziehen.
Im August 1953 bat das Teatro di San Carlo in Neapel den Schott-Verlag um die Aufführung der Erstfassung der Oper Neues vom Tage. Hindemith behielt sich eine Umarbeitung des Textes von Marcellus Schiffer vor. Das Libretto des großen Kabarettautors schien ihm zu sehr an die gesellschaftlichen Zustände der 1920er Jahre gebunden. Für die von Hindemith geleitete Uraufführung der Neufassung am 7. April 1954 im Teatro di San Carlo wurde das Libretto von Rinaldo Kufferle ins Italienische übersetzt. Das ursprüngliche Sujet der Oper, die Entprivatisierung des Lebens und die öffentliche Zurschaustellung intimster Dinge, hielt Hindemith aber nach wie vor für aktuell. Anstelle der ursprünglichen Akzentsetzung auf unbedingte Aktualität und Ausgeliefertsein der Prot-
agonisten trat in der neuen Fassung das letztendlich autonome Handeln von Laura und Eduard als Quintessenz eines ethischen Bekenntnisses in den Vordergrund. Laura · Sopran - Eduard · Bariton - Der schöne Herr Hermann · Tenor - Herr M. · Tenor - Frau M. · Mezzosopran - Hoteldirektor · Bass - Standesbeamter · Bass - Fremdenführer · Bass - Zimmermädchen · Sopran - Oberkellner · TenorSechs Manager (2 Tenöre · 2 Baritone · 2 Bässe) – Chor 2 (beide auch Picc.) · 1 · Engl. Hr. · Es-Klar. · 1 · Bassklar. · Altsax. · 2 · Kfg. - 1 · 2 · 2 · 1 - S. (Xyl. · Glsp. · Trgl. · gr. Gong · Crot. / kl. Beck. · Beck. · Beckenpaar · Tomt. · kl. Tr. · gr. Tr. · 3 elektr. Klingeln) (4 Spieler) - Mand. · Banjo · Hfe. · Klav. (2hd.) · Klav. (4hd.) - Str. (6 · 0 · 4 · 4 · 4)
Uraufführung: 8. Juni 1929 Berlin, Krolloper (D) · Musikalische Leitung: Otto Klemperer · Choreinstudierung: Karl Rankl · Inszenierung: Ernst Legal · Bühnenbild und Kostüme: Traugott Müller Schott Music • 110‘
Hindemith, Paul Neues vom Tage
Lustige Oper in zwei Akten (Neufassung 1953–1954) Text von Marcellus Schiffer Deutsch • Englisch
Laura · Sopran - Eduard · Bariton - Baron d‘Houdoux, Präsident des Konzerns „Universum“ · Bass - Frau Pick, Reporterin · Alt - Der schöne Herr Hermann · Tenor - Elli · Sopran - Olli · Alt - Ali · Tenor - Uli · Bass - Fremdenführer ·
Bass - Hotelmanager · Bass - Oberkellner · Bariton - Zimmermädchen · Sopran - Standesbeamter · Bass - Sechs Manager (2 Tenöre · 2 Baritone · 2 Bässe) – Chor
2 (beide auch Picc.) · 1 · Engl. Hr. · Es-Klar. · 1 · Bassklar. · Altsax. · 2
Kfg. - 1
2
2
1 - S. (Xyl. · Glsp. · Trgl. · Crot. · Gong · Beck. · Tomt. · kl. Tr. · gr. Tr. · 3 elektr. Klingeln) (2 Spieler) - Mand. · Banjo · Hfe. · Klav. (2hd.) · Klav. (4hd.)Str. (6 · 0
4 · 4 · 4)
Uraufführung: 7. April 1954 Napoli, Teatro di San Carlo (I) · Musikalische Leitung: Paul Hindemith · Inszenierung: Alessandro Brissoni · Bühnenbild und Kostüme: C. M. Cristini · Choreographie: Bianca Gallizia Schott Music • 120‘
Schmidt, Lesch
Ein Musiktheaterspiel (1993–1997) Libretto von Ulla Berkéwicz
Hoffmann / Golem · Tenor - Mädchen / Miriam · Koloratursopran - Apotheker / Rabbi Löw · Bariton - Stadtrat / 3. Kabbalist · Sprechrolle - Hasskappen / Kabbalisten, Festgäste · gemischter Chor (SATB; 14 Stimmen, auf mindestens 28 Sänger aufgeteilt)
1 · 1 (auch Engl. Hr.) · 1 (auch Bassklar.) · Altsax. · Tenorsax. · 1 (auch Kfg.) - 1 · 1 · 1 · 0 - S. (I: Drumset · Bong. · Cong.; II: P · Röhrengl.; Signalhorn · gr. Tr. · Clav. · Oceandrum je nach Verteilungsmöglichkeit, Signalhorn kann auch vom Chor gespielt werden) (2 Spieler) - Klav. - Str. (Vl. I, Vl. II, Va. jeweils divisi) - vom Chor oder alternativ von den Schlagzeugern zu spielen: Signalhorn, Nebelhorn
Uraufführung: 18. Mai 1999 Wien, Burgtheater/Akademietheater (A) · Musikalische Leitung: Jobst Liebrecht · Inszenierung: Einar Schleef
Suhrkamp Theaterverlag • 140‘
Sullivan, Arthur Seymour
Operette in zwei Akten (1889) Libretto von Sir William Schwenck Gilbert Deutsche Textfassung von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt
Ziehkinder und der ausgesetzte Nachwuchs höherer und höchster Kreise beschleunigen die Konfliktspiralen britischer Kulturschöpfungen. So in The Gondoliers des in satirischen wie in seriösen Musiktheater-Genres bestens beschlagenen Arthur Sullivan. Da soll eine Amme Licht in die wahre Abstammung der bereits glücklich liierten Ziehbrüder Giuseppe und Marco bringen. Wer von den beiden ist der wahre Thronfolger von Barataria und wird Casilda, Tochter des Fürsten von Plaza-Toto, angetraut? Am Ende müssen weder Giuseppe noch Marco aus der
Lagunenstadt an einen dieser langweiligen spanischen Höfe, weil der legitime Erbe von Barataria ein ganz anderer ist und bereits die besondere Gunst Casildas genießt. Sullivan ist der einzige Schöpfer des musikalischen Unterhaltungstheaters im 19. Jahrhundert, welcher in Hinblick auf Originalität, Überraschungsreichtum, sozialer Sensibilität und Witz für ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Offenbach in Frage kommt. Beider musikalische Einfälle sind überaus authentisch und ironisieren sich in den richtigen Augenblicken selbst. Von Sullivans sogenannten Savoy Operas und seines Textdichters William Schwenck Gilbert erfreut sich im deutschen Sprachraum diese „Entirely Original Comic Opera“ besonderer Wertschätzung. Der Herzog von Plaza-Toro, ein spanischer Grande · BaritonLuiz, sein Begleiter · Tenor od. Bass - Don Alhambra del Bolero, der Großinquisitor · Bass - Die Herzogin von Plaza-Toro · Alt - Casilda, ihre Tochter · Sopran - Inez, Pflegemutter des Königs · Alt - Venezianische Gondolieri: Marco Palmieri · Tenor, Giuseppe Palmieri · Bariton, Antonio · Bariton, Francesco · Tenor, Giorgio · Bass, Annibale · Bariton, Ottavio · Gesangsrolle - Landmädchen: Gianetta · Sopran, Tessa · Mezzosopran od. Alt, Fiametta · Sopran, Vittoria · Sopran od. Mezzosopran, Giulia · Sopran - Gondolieri, Landmädchen, bewaffnete Männer, Herolde, Pagen · Chor und Ballett
2 (2. auch Picc.)
1
2 · 2 - 2 · 2 Korn.
0
3 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Str. - Auf der Bühne: Rührtr. · Kast.
Uraufführung: 7. Dezember 1889 London, Savoy Theatre (UK)
Schott Music • 150‘


Vollmer, Ludger Zusammenstoß

Musikalische Komödie (2020–2021) nach einem grotesken Opernlibretto von Kurt Schwitters
Einrichtung des Originallibrettos von Ulrike Schumann unter Mitarbeit des Komponisten und von Jürgen Popig
„Der Tag, an dem die Welt durchdrehte“ titelte der Spiegel am 17. Mai 2010, und schrieb weiter: „Selbstmorde, Sexorgien, Sakramente: Als im Mai 1910 der Halleysche Komet erschien, geriet die Welt auch ohne Einschlag aus den Fugen. Die Medien schürten Massenpanik, die Wissenschaft Verwirrung. Postkarten zeugen von den Phantasien jener Zeit - zwischen Untergangsängsten und Ausschweifungen.“
Kurt Schwitters schrieb im Jahr 1927 das Libretto für eine dadaistisch-absurde Oper, eine urkomische und regelrecht durchgeknallte Story. Er nahm die oben beschrie -


benen skurrilen Ereignisse um den drohenden Kometeneinschlag zum Anlass, welche 1909 an der Universität Heidelberg ihren Ausgangspunkt nahmen, und innerhalb kürzester Zeit die Welt zwischen Amerika und Indien in den Wahnsinn stürzten.
Virmula, Astronom · Bariton (mittlere Partie) - Alma, seine Assistentin, Tochter Meisterlichs · Mezzosopran (mittlere Partie) - Meisterlich, Oberordnungskommissar, Polizeichef · Countertenor (große Partie) - Taa, Tänzerin · Kolorautrsopran/Soubrette (kleine Partie) - Kammersänger Paulsen · Rapband (2 Rapsänger, 2 Beatboxer) - Zeitungsverkäufer, Ordnungspolizei, Bettler, Männer, Mädchen, Herren · Chor und Chorsoli - Rommel, Astronomie-Diener · Schauspieler - Frau Rommel, seine Mutter · Schauspielerin - Noll, Tänzer · Schauspieler - Bana, Meisterlichs Frau · SchauspielerinTeddi, Taas großer Bär, später lebendig · Schauspieler - Die Direktrice, Der Veteran, Der Oberkellner, 6 Herren vom Nachtasyl, Schmidt (Ansage vom Rundfunk), Der Versammlungsleiter, Kommunist. Monarchist. Pazifist. Librettist, Liberaler. Nationaler. Rationaler. Radikaler, Der Regisseur, Blasser Herr. Der Ungläubige. Der Leichtgläubige. Der Fette. Das Dämchen. Die Dame. Der Kavalier. Fräulein Jugendlich. Der Kappellmeister, Heinrich, Agnes, Fräulen Bitte Sehr, 1. Mann, 2. Mann ·Schauspielerinnen und Schauspieler (kleine Partien) - Puppenpanzen. Distelkavaliere. Die große Katze. Der große Hund. Pierro. Dorfbewohner. Menschenmengen und Stimmen · Tänzerinnen und Tänzer
2 (2. auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 (1. auch Klar. in Es, 2. auch Bassklar.) · 2 Sax. (1. Altsax. u. Tenorsax., 2. Tenorsax. u. Baritonsax.) · 2 ( 2. auch Kfg.) - 2 · 2 · 2 · 1 - P. S. (I: Glsp. · Crot. · Vibr. · Röhrengl. · Trgl. · hg. Beck. · Beckenpaar · Agogo · Schlittengl. · Tamt. (gr.) · kl. Tr. · Tomt. (h./t.) · gr. Tr. (mit aufgeschnalltem Beck.) · Cuica · Guiro · Mar. · Kast. · Clav. · Holzbl. (h./t.) · Trillerpf. (h.) · Peitsche · Waschbrett
· Zeitungspapier; II: Glsp. · Xyl. · Trgl. · hg. Beck. · Beckenpaar · Schlittengl. · Cowbell · Tamt. (gr.) · Bong. · gr. Tr. (mit aufgeschnalltem Beck.) · Cuica (h.) · Guiro · Shaker · Cabasa · Kast. · Clav. · Holzbl. (h./t.) · Trillerpf. (h./t.) · Peitsche · Flex. · Waschbrett · 2 gr. Topfdeckel · Luftrüssel; III: Drumset) (3 Spieler) - Klav. (auch Keyboard) · Banjo (auch Gitarre) · Str. (8 · 6
4
3
2)
Uraufführung: 20. April 2024 Heidelberg, Theater (D) · Musikalische Leitung: Dietger Holm
Inszenierung: Christian Brey · Bühnenbild und Kostüme: Anette Hachmann · Choreographie: Iván Pérez Schott Music • 75‘
Weill, Kurt
(A Kingdom for a Cow)
Operette in zwei Akten (1934)
Text von Robert Vambery eingerichtet und herausgegeben von Lys Symonette (1978)
Englische Textfassung von Jeremy Sams
Deutsch • Englisch
Die Heirat von Juan und Juanita verzögert sich, weil deren einzige Kuh konfisziert wird und der Erlös in staatliche Rüstungsausgaben fließen soll. Um Geld zu verdienen, arbeitet Juanita sogar in einem Bordell. Der internationale Waffenhändler Leslie Jones schürt indes Krieg zwischen den zwei karibischen Republiken. Bis sich

Ludger Vollmer: Zusammenstoß
Theater Heidelberg 2024
Foto: Dieter Wuschanski
die Liebenden in die Arme schließen können, wird Juanitas Treue auf die Probe gestellt und entgeht Juan einer Hinrichtung als Staatsverräter. Zum Glück erweisen sich die von Jones gelieferten Waffen als unbrauchbar und es beginnt zwangsläufig eine Friedenszeit.
Nie war Kurt Weill seinem Vorbild Offenbach näher als in diesem Stück. Er schuf drei Fassungen von der Operette und wollte möglichst „weit weg von dem Wiener Operettenschund“ kommen. Dafür komponierte er schräge Märsche, Arien und Szenenmusiken. Die deutsche Urfassung „Ein Kuhhandel“ ließ Kurt Weill unvollendet. Lys Simonette, Weills ehemalige Korrepetitorin, rekonstruierte sie 1978. (In Paris entstand die 1935 in London als Musical uraufgeführte Fassung A Kingdom for a Cow). Wichtige Stationen der Rezeptionsgeschichte von Der Kuhhandel sind die Uraufführung am Sorbischen Volkstheater Bautzen 1994, die Inszenierung von David Pountney bei den Bregenzer Festspielen 2004 und eine CD-Einspielung unter Jan Latham Koenig.
Juanita Sanchez · lyrischer Sopran - Juan Santos · lyrischer Tenor - Felipe Chao, Waffenhändler · Operetten-Bariton - Präsident Mendez · Tenorbuffo - Ximenez · TenorbuffoGeneral García Conchas · hoher Operetten-Bariton - Emilio Sanchez · Bass-Bariton - Juans Mutter · Mezzosopran - Madame Odette · Mezzosopran - Gerichtsvollzieher · Tenorbuffo - Rektor · Tenor - Bürgermeister · Tenor - Bimbi, Sohn des Präsidenten · Knabenstimme - Redakteur · Bariton - Minister von Ucqua · Bariton - Mädchen · Sopran - 3 Burschen · 1 Tenor, 2 Baritone - 3 Gäste · 1 Tenor, 2 Baritone - 3 Soldaten · 2 Tenöre, 1 Bariton - 2 Diener · 2 Tenöre - Eine Frau - Ein dicker Mann - Der Mann - Ein Diener - 3 Packer - Der Gast - Soldat - Unteroffizier - Frasquita - Die dicke WandaYvonne - Eine Sekretärin · Sprechrollen - Chor, Mädchenchor (ad lib.)
2 (beide auch Picc.) · 1 · 2 (1. auch Altsax., 2. auch Tenorsax.) · 1 - 1 · 2 · 2 · 1 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Trgl. · Gong · Beck. · Tamb. · 3 Tomt. · Rührtr. · Steel Drum · kl. Tr. · gr. Tr. · Kast.) (4 Spieler) - Git. (auch Banjo u. Bassgit.) · Hfe. · Org. od. Harm. (auch Akk.) - Str.
Uraufführung der englischen Fassung: 28. Juni 1935 London, Savoy Theatre (UK) · Musikalische Leitung: Muir Mathieson · Inszenierung: Ernest Matrai; Felix Weissberger
Uraufführung der von Lys Symonette revidierten Fassung: 18. Juni 1994 Bautzen, Deutsch-Sorbisches Volkstheater (D) · Musikalische Leitung: Dieter Kempe · Inszenierung: Wolfgang Poch · Bühnenbild und Kostüme: Hans Ellerfeld Schott Music • 120’
2 x Madeleine Allihn, Jochen S. 38
Adrienne Goetze, Walter Wilhelm S. 30
Alles Capriolen Köhler, Siegfried / Köhler, Emil S. 54
Alles für Figaro Zimmermann, Rolf S. 49
Alphonse Offenbach, Jacques / Urack, Otto S. 10
Blue Monday (135th Street Blues), orchestration by George Bassman Gershwin, George / Bassman, George S. 67
Blue Monday (135th Street Blues), orchestration by Gregg Smith Gershwin, George / Smith Gregg S. 67
Boccaccio Suppé, Franz von S. 26
Bretter, die die Welt bedeuten Kneifel, Gerhard S. 40
C
Caballero Natschinski, Gerd S. 42
Casanova , Musical von Helmut Bez und Jürgen
Degenhardt (1976) Natschinski, Gerd S. 42
Casanova , Operette in drei Akten (1913)
Lincke, Paul S. 32
Connie und der Löwe Zimmermann, Rolf S. 49
D
Damals in Prag Allihn, Jochen S. 38
Daphnis und Chloë Offenbach, Jacques S. 10
Das Dekameronical, Fünf ergötzliche Geschichten:
Der Segen von oben, Der Wert des Wechsels, Die Freuden der Frommen, Die Früchte der Gelehrsamkeit, Die gute Bewirtung
Natschinski, Gerd S. 43
Das Fest in Coqueville Heuser, Kurt S. 52
Das Haus ohne Männer Schütz, Hans Georg S. 56
Das Lied der Liebe Korngold, Erich Wolfgang S. 32
Das Märchen von der Wundergeige
Heuser, Kurt S. 52
Das Spitzentuch der Königin Strauss (Sohn), Johann S. 19
Das verwunschene Schloss Millöcker, Carl / Velin, Martin S. 19
Der Bettelstudent , Textliche und musikalische
Neueinrichtung Millöcker, Carl / Masanetz, Guido S. 19
Der Bettelstudent , Neufassung Millöcker, Carl S. 18
Der Golem in Bayreuth Schmidt, Lesch S. 69
Der Graf von Luxemburg Lehár, Franz S. 17
Der Karneval in Rom Strauss (Sohn), Johann S. 20
Der Komet Krtschil, Henry S. 41
Der Kuhhandel Weill, Kurt S. 70
Der lustige Krieg Strauss (Sohn), Johann S. 21
Der Opernball Heuberger, Richard Franz Josef S. 16
Der Soldat der Königin von Madagaskar
Natschinski, Gerd S. 44
Der Zigeunerbaron Strauss (Sohn), Johann S. 21
Diana – Cry for Love Schneider, Enjott S. 61
Die Banditen Offenbach, Jacques S. 10
Die Fledermaus Strauss (Sohn), Johann S. 23
Die Fledermaus, Neue Johann Strauss
Gesamtausgabe Strauss (Sohn), Johann S. 22
Die Gondolieri oder Der König von Barataria
Sullivan, Arthur Seymour S. 69
Die listigen Frauen oder Die Wilderer Offenbach, Jacques / Masanetz, Guido S. 11
Die Lustige Witwe Lehár, Franz S. 17
Die schöne Galathee Suppé, Franz von S. 26
Die verwandelte Katze Offenbach, Jacques / Allihn, Jochen S. 11
Die Wette des Mister Fogg Koll, Alo S. 40
Die Zaubergeige Offenbach, Jacques / Zimmermann, Bernd Alois S. 11
Dornröschen Koschev, Dmitri / Steuerwald, Frank / Streul, Eberhard S. 62
Ein Fall für Sherlock Holmes Natschinski, Gerd S. 44
Ein Liebestraum Lincke, Paul S. 33
Eine Nacht in Venedig Strauss (Sohn), Johann S. 23
Ferien mit Max Siebholz, Gerhard S. 48
Frau Luna , Originalfassung Lincke, Paul S. 33
Frau Luna , Textliche Neufassung Lincke, Paul S. 33
Frauen machen Geschichte Czernik, Willy S. 52
Frauen ohne Chance Spickermann, Adolf S. 56
Gasparone Millöcker, Carl S. 18
Grigri Lincke, Paul S. 34
Heute Nacht kommt Conny Kunze, Hans S. 41
Hoftheater Zimmermann, Rolf S. 49
Im Reiche des Indra Lincke, Paul S. 34
Ja oder Nein Binder, Edmund S. 39
Karneval in Rom Nitschke, Manfred / Strauss (Sohn), Johann S. 21
Keep Smiling Brand, Dieter / Sander, Harry S. 39
Kleinstadtgeschichten Reese, Günter /
Sander, Harry S. 48
König Indigo Strauss (Sohn), Johann S. 24
König Karotte Offenbach, Jacques S. 12
Küssen verboten! Nitschke, Manfred S. 47
L
La Grande-Duchesse de Gérolstein
Offenbach, Jacques S. 12
Ladies and Gentlemen Köhler, Siegfried S. 53
Liebe im Dreiklang Goetze, Walter Wilhelm S. 31
Liebe, Dollars und Banditen Lerche, Nils S. 55
Lysistrata , Erstfassung Lincke, Paul S. 34
Lysistrata , Neufassung Lincke, Paul S. 35
M
Madame Sherry Felix, Hugo S. 30
Mein Freund Bunbury Natschinski, Gerd S. 45
Mein schöner Benjamino Masanetz, Guido S. 41
Messeschlager Gisela Natschinski, Gerd S. 45
Miss Petticoat Küster, Herbert S. 55
Neues vom Tage Hindemith, Paul S. 68
Neues vom Tage, Neufassung Hindemith, Paul S. 68
nullvier – Keiner kommt an Gott vorbei
Schneider, Enjott / Zoller, Thomas S. 61
O
Old Germany Köhler, Siegfried S. 62
Orpheus in der Unterwelt Offenbach, Jacques S. 13
PPfälzer Wein Triebel, Walter S. 56
Planet der Verliebten Natschinski, Gerd S. 46
Play Plautus Wunderlich, Hans-Joachim S. 57
Pomp auf Pump Werion, Rudi S. 48
Porgy and Bess, based on the George and Ira Gershwin Definitive Performance Edition
Gershwin, George S. 66
Porgy and Bess Gershwin, George S. 66
Premiere in Mailand Winkler, Gerhard S. 57
Prinz Methusalem Strauss (Sohn), Johann S. 24
Prinz von Preußen Brand, Dieter / Sander, Harry / Gocht, Joachim S. 39
S
Sabine, sei sittsam Köhler, Siegfried S. 53
Schach dem König Goetze, Walter Wilhelm S. 31
Servus Peter Natschinski, Gerd S. 46
Sissy Kreisler, Fritz S. 16
Südseetulpen Schweitzer, Benjamin S. 60
TTerzett Natschinski, Gerd S. 47
The Gershwins’ Porgy and Bess
Gershwin, George / Murray, Diedre L. S. 67
Topsy Reutter, Hermann S. 55
Treffpunkt Tegernsee Jessel, Leon /
Strasser, Alfred S. 31
Triple-Sec Blitzstein, Marc S. 66
WWenn Männer schwindeln
Goetze, Walter Wilhelm S. 31
Wiener Blut Strauss (Sohn), Johann S. 25
Wiener Blut , Bearbeitung als Kammeroper
Strauss (Sohn), Johann / Rot, Michael S. 25
Wunderbar – die 2002. Nacht
Natschinski, Thomas S. 62
YYolimba oder die Grenzen der Magie
Killmayer, Wilhelm S. 52
ZZusammenstoß Vollmer, Ludger S. 69
AAllihn, Jochen
2 x Madeleine S. 38
Damals in Prag S. 38
Die verwandelte Katze S. 11
Bassman, George
Blue Monday (135th Street Blues) S. 67
Binder, Edmund
Ja oder Nein S. 39
Blitzstein, Marc
Triple-Sec S. 66 Brand, Dieter
Keep Smiling S. 39
Prinz von Preußen S. 39
CCzernik, Willy
Frauen machen Geschichte S. 57
FFelix, Hugo
Madame Sherry S. 30
Gershwin, George
Blue Monday (135th Street Blues),
orchestration by George Bassman (1953) S. 67
Blue Monday (135th Street Blues),
orchestration by Gregg Smith (1976) S. 67
Porgy and Bess, based on the George and Ira Gershwin Definitive Performance Edition S. 66
Porgy and Bess
The Gershwins’ Porgy and Bess
Gocht, Joachim
Prinz von Preußen
Goetze, Walter Wilhelm
Adrienne
Liebe im Dreiklang
Schach dem König
Wenn Männer schwindeln
Heuberger, Richard Franz Josef
Der Opernball
Heuser, Kurt
Das Fest in Coqueville
S. 66
S. 67
S. 39
S. 30
S. 31
S. 31
S. 31
LLehár, Franz
Der Graf von Luxemburg
Die Lustige Witwe
Lerche, Nils
Liebe, Dollars und Banditen
Lincke, Paul
Casanova
Ein Liebestraum
Frau Luna, Originalfassung
Frau Luna, Neufassung
Grigri
Im Reiche des Indra
Lysistrata, Erstfassung
Lysistrata, Neufassung
MMasanetz, Guido
Der Bettelstudent, Textliche und musikalische
Neueinrichtung
S. 16
S. 52
Das Märchen von der Wundergeige S. 52
Hindemith, Paul
Neues vom Tage
Neues vom Tage, Neufassung
Jessel, Leon
Treffpunkt Tegernsee
Killmayer, Wilhelm
Yolimba oder die Grenzen der Magie
Kneifel, Gerhard
Bretter, die die Welt bedeuten
Köhler, Emil
Alles Capriolen
Köhler, Siegfried
Alles Capriolen
Ladies and Gentlemen
Old Germany
Sabine, sei sittsam
Koll, Alo
Die Wette des Mister Fogg
Korngold, Erich Wolfgang
Das Lied der Liebe
Koschev, Dmitri
Dornröschen
Kreisler, Fritz
Sissy
Krtschil, Henry
Der Komet
Kunze, Hans
Heute Nacht kommt Conny
Küster, Herbert
Miss Petticoat
S. 17
S. 17
S. 55
S. 32
S. 32
S. 33
S. 33
S. 34
S. 34
S. 34
S. 35
S. 68
S. 68
S. 31
S. 19
Die listigen Frauen oder Die Wilderer S. 11
Mein schöner Benjamino
Millöcker, Carl
Das verwunschene Schloss
Der Bettelstudent, Neufassung
Der Bettelstudent, Textliche und musikalische Neueinrichtung
Gasparone
Murray, Diedre L.
The Gershwins’ Porgy and Bess
NNatschinski, Gerd
S. 52
S. 40
S. 54
S. 54
S. 53
S. 62
S. 53
S. 40
S. 32
S. 62
S. 16
S. 41
S. 41
S. 55
Das Dekameronical
• Der Segen von oben
• Die Früchte der Gelehrsamkeit
• Der Wert des Wechsels
• Die Freuden der Frommen
• Die gute Bewirtung
S. 41
S. 19
S. 18
S. 19
S. 18
67
43
Der Soldat der Königin von Madagaskar S. 44
Ein Fall für Sherlock Holmes S. 44
Mein Freund Bunbury S. 45
Messeschlager Gisela
Planet der Verliebten
Servus Peter
45
46
46 Terzett
Natschinski, Thomas Wunderbar – die 2002. Nacht
Nitschke, Manfred
Karneval in Rom
Küssen verboten!
47
62
21
47 O
Offenbach, Jacques
Alphonse S. 10
Daphnis und Chloë
Die Banditen
10
10
Die listigen Frauen oder Die Wilderer S. 11
Die verwandelte Katze S. 11
Die Zaubergeige
König Karotte
La Grande-Duchesse de Gérolstein
Orpheus in der Unterwelt
Reese, Günter
Kleinstadtgeschichten
Reutter, Hermann
S. 11
S. 12
S. 12
S. 13
Triebel, Walter Pfälzer Wein
Urack, Otto
Alphonse
S. 48
Topsy S. 55
Rot, Michael
Wiener Blut, Bearbeitung als Kammeroper
Sander, Harry
Keep Smiling
Kleinstadtgeschichten
Prinz von Preußen
Schmidt, Lesch
Der Golem in Bayreuth
Schneider, Enjot
Diana – Cry for Love
S. 25
Velin, Martin
Das verwunschene Schloss
Vollmer, Ludger
Zusammenstoß
S. 39
S. 48
S. 39
S. 69
S. 61
nullvier – Keiner kommt an Gott vorbei S. 61
Schütz, Hans Georg
Das Haus ohne Männer
Schweitzer, Benjamin
Südseetulpen
Siebholz, Gerhard
Ferien mit Max
Smith, Gregg
Blue Monday (135th Street Blues), orchestration by Gregg Smith
Spickermann, Adolf
Frauen ohne Chance
Strasser, Alfred
Treffpunkt Tegernsee
Strauss (Sohn), Johann
Das Spitzentuch der Königin
Der Karneval in Rom
Der lustige Krieg
Der Zigeunerbaron
Die Fledermaus
Die Fledermaus, Neue Johann Strauss
Gesamtausgabe
Eine Nacht in Venedig
Karneval in Rom
König Indigo
Prinz Methusalem
Wiener Blut
S. 56
S. 10
S. 19
S. 69
Weill, Kurt
Der Kuhhandel
Werion, Rudi
S. 70
Pomp auf Pump S. 70
Winkler, Gerhard
Premiere in Mailand S. 57
Wunderlich, Hans-Joachim
Play Plautus
S. 56
S. 60
S. 48
S. 67
S. 56
S. 31
S. 19
S. 20
S. 21
S. 21
S. 23
S. 22
S. 23
S. 21
S. 24
S. 24
S. 25
Wiener Blut, Bearbeitung als Kammeroper S. 25
Steuerwald, Frank
Dornröschen
Streul, Eberhard
Dornröschen
Sullivan, Arthur Seymour
S. 62
S. 62
Die Gondolieri oder Der König von Barataria S. 69
Suppé, Franz von Boccaccio
S. 57
ZZimmermann, Bernd Alois
Die Zaubergeige
Zimmermann, Rolf
Alles für Figaro
Connie und der Löwe
Hoftheater
S. 11
S. 49
S. 49
S. 49
Zoller, Thomas nullvier – Keiner kommt an Gott vorbei S. 61
Allihn, Jochen
Damals in Prag
Musical in zwei Teilen (1985)
Brand, Dieter / Sander, Harry Keep Smiling
(Der Mann, der lachen musste)
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1976)
Brand, Dieter / Sander, Harry / Gocht, Joachim
Prinz von Preußen
Musical (1978)
Kneifel, Gerhard
Bretter, die die Welt bedeuten
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1970)
Köhler, Siegfried
S. 26
Die schöne Galathee S. 26
Old Germany
Ein deutsches Revuemusical nach einer Idee von Kurt Neufert (1992 (2007))
S. 38
S. 39
S. 39
S. 40
S. 62
Köhler, Siegfried
Sabine, sei sittsam
Musical in drei Akten (1967) nach Kotzebues
„Die deutschen Kleinstädter“
Koll, Alo
Die Wette des Mister Fogg
S. 53
S. 40 oder Die musikalische Reise um die Erde, zu Lande, zu Wasser - und sogar in der Luft, auf der Route des Jules Verne (1971)
Koschev, Dmitri / Steuerwald, Frank / Streul, Eberhard
Dornröschen
Musical von Eberhard Streul frei nach Motiven des gleichnamigen Märchens der Brüder Grimm
Kunze, Hans
Heute Nacht kommt Conny
Musical von Karl-Heinz Lennartz (1968)
Natschinski, Gerd
Caballero
Musical (1988)
Natschinski, Gerd
Casanova
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1976)
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical
Fünf ergötzliche Geschichten (1979 - 1982) nach dem „Dekamerone“ des Herrn Giovanni B.
Das Dekameronical
Der Segen von oben
Das Dekameronical
Die Früchte der Gelehrsamkeit
Das Dekameronical
Der Wert des Wechsels
Das Dekameronical
Die Freuden der Frommen
Das Dekameronical
Die gute Bewirtung
Natschinski, Gerd
Mein Freund Bunbury
Musical in sieben Bildern (1964)
Natschinski, Gerd
Planet der Verliebten
Utopische Revue (1984 (1985))
Natschinski, Gerd
Terzett
Musical von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt (1974)
Nitschke, Manfred Küssen verboten!
Musical von Heinz Hall (1960)
Siebholz, Gerhard
Ferien mit Max S. 48
Musical in 3 Akten (1985)
Zimmermann, Rolf
Alles für Figaro
Musical von Therese Angeloff
Zimmermann, Rolf
Connie und der Löwe
Musical in zwei Akten
S. 62
Blitzstein, Marc Triple-Sec
S. 41
S. 42
S. 42
S. 43
S. 45
S. 46
S. 47
S. 49
S. 49
S. 47
Schneider, Enjott / Zoller, Thomas nullvier – Keiner kommt an Gott vorbei S. 61
Das Schalke-Musical zum 100jährigen Jubiläum des FC Schalke 04 (2004)
S. 66 14’
Offenbach, Jacques / Urack, Otto Alphonse S. 10 20’
Gershwin, George / Bassman, George
Blue Monday (135th Street Blues) S. 67 25’
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical Der Segen von oben S. 43 30‘
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical Die Früchte der Gelehrsamkeit S. 43 35‘
Reutter, Hermann Topsy S. 55 40‘
Offenbach, Jacques Daphnis und Chloë S. 10 45‘
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical Die gute Bewirtung S. 43 45‘
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical Der Wert des Wechsels S. 43 55‘
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical Die Freuden der Frommen S. 43 55‘
Allihn, Jochen 2 x Madeleine S. 38 Klar. - S. - Git. · Klav. - Kb. (zusätzl. Sax. u. Trp. ad lib.)
Binder, Edmund
Ja oder Nein S. 39
Violine oder Akkordeon - Bass - GitarreSchlagwerk (Gl. · Gong · Drum Set)
Blitzstein, Marc Triple-Sec S. 66
0 · 0 · 2 · 1 - 0 · 1 · 1 · 0 - S. (P. · Xyl. · Kuhgl. · Schellentr. · kl. Tr. · gr. Tr. · Holzbl. · Ratsche) (2 Spieler) - Klav. vierh. - Str. (1 · 0 · 1 · 0 · 1)
Köhler, Siegfried
Ladies and Gentlemen
Klavier oder Elektro-Orgel - S. (Jazz-Schlgz., Rhythmusgruppe)
S. 53
Koschev, Dmitri / Steuerwald, Frank / Streul, Eberhard
Dornröschen
Drum Set (Jazz) – Keyboard
Krtschil, Henry
Der Komet
Fl. · Klar. - Pos. - S. (Glsp. · Trgl. · Drumset · Kast. · Holzbl.) - Klav. - Kb.
Natschinski, Gerd
Servus Peter
S. (Vibr. · Beck. · Hi-Hat · Bong. · Tempelbl.)
(2 Spieler) - Klav. · Git. - Str. - Alternativ ist eine kleine Besetzung ohne Streicher möglich: S. (Vibr. · Beck. · Hi-Hat · Bong. · Tempelbl.) (2 Spieler) - Klav. · Git. · Streich-, Zupf- oder E-Bass
Offenbach, Jacques / Allihn, Jochen
Die verwandelte Katze
S. 62
S. 41
Knecht (auch ER) · Bariton - Magd (auch SIE) · Alt - Der reiche Kaufmann · Bariton - Seine schöne junge Frau · AltDer junge Nachbar Filippo · Bariton - Ein alter dicker Priester · Charakterfach, Baritonlag
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical
Die Früchte der Gelehrsamkeit S. 43 Pietro, ein freundlicher und belesener Herr · SchauspielerIsabella, seine liebe Frau · tiefer Alt - Leonetto, ein junger
Gärtner · singender Schauspieler - Lambertuccio di Spinnolo, ein großer Ritter · Bass od. tiefer Bariton, auch Charakterfach - Reitknecht (auch ER) · Bariton - Magd (auch SIE) · Alt
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical
S. 46
S. 11 Fl. - Str.
Spickermann, Adolf
Frauen ohne Chance
(Mindestbesetzung): 3 Sax. (oder Klar.) - 2 Trp. ·
Pos. - S. - Klav. - 5 Vl. · Vc. · Kb.
Allihn, Jochen
2 x Madeleine
Musikalisches Lustspiel in drei Akten
S. 55
Die gute Bewirtung S. 43
Pinuccio, ein junger Herr aus Florenz · lyrisch-dramatischer Tenor - Adriano, sein etwas älterer Freund · Bass - Cipolla, ein wackerer Bauer · Bariton - Seine Frau · Alt - Niccolosa, beider Tochter · Mezzosopran - Vagabund (auch ER) · Bariton - Vagabundin (auch SIE) · Alt
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical
Der Wert des Wechsels S. 43
Zeppa, Kaufmann, ein politischer Kopf · Bariton - Elissa, seine träumerische Frau · lyrischer Sopran - Dioneo, Kaufmann, Zeppas dichtender Nachbar · lyrischer Tenor - Filippa, Dioneos energische Frau · Alt - Giovanni, Diener bei Dioneo (auch ER) · Bariton - Pampinea, Köchin bei Zeppa (auch SIE) · Alt
Natschinski, Gerd
Servus Peter S. 46
Musikalisches Lustspiel in drei Akten (1961)
Peter Stamm, Schriftsteller - Petra, seine Frau - Peter Schnell, Sportjournalist - Ilona Terecz, Journalistin aus Budapest - Eberhard Wagner, Mitarbeiter im VEB Blütenduft (alle singende Schauspieler)
S. 38
Hans Storm · Bass - Knut Storm · Bariton - Herbert Brandt · Tenor - Ditha Donner · Mezzosopran - Fräulein Madeleine · Alt
Gershwin, George / Smith, Gregg
Blue Monday (135th Street Blues)
S. 67
Joe, a gambler · tenor - Vi, his sweetheart · lyric soprano - Tom, Cafe entertainer · baritone - Mike, Cafe proprietor · bass - Sam, Boy-of-all-work · baritone - Sweetpea, Cafe pianist · spoken
Koschev, Dmitri / Steuerwald, Frank / Streul, Eberhard Dornröschen
S. 62
Dornröschen (auch Rosenhecke, Zofe, Hermine) · SopranPrinz (auch Bischof) · Tenor - König · Bass-Bariton - Königin (auch Rosenhecke) · Sopran - Koch · Tenor - Danimonia, Hexe (auch Frosch) · Sopran - Musikmeister · Sprechrolle (wird vom Keyboardspieler übernommen)
Krtschil, Henry
Der Komet
S. 41
Herr Balder, ein Buchbinder - Frau Balder, seine Ehefrau - Justine, beider Tochter - Herr Krappe, ein Chirurg oder ähnliches - Herr Grünstein, ein Liebhaber - Gerichtsdiener, der auch noch ein Ausrufer ist
Natschinski, Gerd
Das Dekameronical
Der Segen von oben
S. 43
Offenbach, Jacques / Zimmermann, Bernd Alois
Die Zaubergeige S. 11
Vater Martin, der Dorfgeiger · Bariton - Rose, sein Mündel · Mezzosopran - Peter, ein Bauer · Tenor
Offenbach, Jacques / Allihn, Jochen
Die verwandelte Katze S. 11
Guido, Sohn eines Kaufmanns aus Triest · Tenor - Marianne, seine Gouvernante · Mezzosopran - Minette, seine Katze · Sopran - Dig-Dig, indischer Jongleur · Bariton
Reese, Günter / Sander, Harry Kleinstadtgeschichten S. 48
Nikolaus Staar, Bürgermeister von Krähwinkel - Frau Staar, seine Mutter - Sabine, seine Tochter - Frau Brendel - Frau
Morgenrot - Leopold Sperling - Karl Olmers - Margarete, Magd
Schütz, Hans Georg
Das Haus ohne Männer S. 55
Petersen - Resel Fichtinger - Frank Garwin - Hugo FischerAlois Schmidthuber - Paul Mehltreter
[Das Stück kann mit einem Schauspielensemble besetzt werden, da die Gesangspartien sehr einfach gestaltet sind.]
Spickermann, Adolf
Frauen ohne Chance S. 55
Zebedäus Sauerwein, Wirt - Dessen Töchter: Inge, LuiseTaxichauffeure: Hannes, Stoffel, Adrianne
Herausgeber:
Schott Music GmbH & Co. KG
Verantwortlich:
Christopher Peter
Redaktion:
Dr. Joscha Schaback
Tel.: +49 6131 246-806 joscha.schaback@schott-music.com
Mitarbeit:
Roland H. Dippel, Dr. Alexander Hermann, Dr. Philipp Weber, Lea Wilms
Schott Music GmbH & Co. KG
Weihergarten 5 55116 Mainz · Germany
Tel.: +49 6131 246-886 infoservice@schott-music.com
Unsere Vertretung in der Schweiz: Musik und Verlage GmbH
Frau Nicole Froidevaux
Kalkbreitestrasse 33 8003 Zürich
SCHWEIZ
Telefon: +41 43 4998660
Telefax: +41 43 4998662
E-Mail: info@musikundverlage.ch
Die Aufführungsmateriale zu den Bühnenwerken dieses Verzeichnisses stehen leihweise nach Vereinbarung zur Verfügung, sofern nicht anders angegeben. Bitte richten Sie Ihre Bestellung per E-Mail an hire@schott-music. com oder an den für Ihr Liefergebiet zuständigen Vertreter bzw. die zuständige Schott-Niederlassung.
Autor:innen:
Roland H. Dippel, Prof. Dr. Walter Dobner, Kolja Porschke, Agne Pupelyte, Prof. Michael Rot
Gestaltung und Layout: Engler Schödel, Atelier für Gestaltung, Mainz
Redaktionsschluss: 1. Februar 2025
© Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz Printed in Germany
Unsere Vertretung in Österreich: Universal Edition AG Abt. Leihmaterial Forsthausgasse 9 1200 Wien
AUSTRIA
Telefon: +43 1 33723-0
Telefax: +43 1 33723-470
E-Mail: customer-relations@universaledition.com
© Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz Printed in Germany
Kostenloses Informationsmaterial zu allen Werken können Sie per E-Mail an infoservice@schott-music. com anfordern.




Roland H. Dippel:
• Offenbach - Die Götter müssen verrückt sein
• Orpheus in der Unterwelt
• Wiener Operette - Champagner hat’s verschuldet
• Sissy
• Der Bettelstudent
• Der Karneval in Rom
• Boccaccio
• Berliner Operette - Komm, kiek mal ins Miljö
• Adrienne
• Das Lied der Liebe
• Casanova (Lincke, Paul)
• Frau Luna
• Lysistrata
• Das heitere Musiktheater in der DDR – Die Selbstkritik ist mein Prinzip, nun habt mich wieder lieb
• Damals in Prag
• Keep Smiling
• Bretter, die die Welt bedeuten
• Die Wette des Mister Fogg
• Mein schöner Benjamino
• Caballero
• Casanova (Natschinski, Gerd)
• Das Dekameronical
• Ein Fall für Sherlock Holmes
• Mein Freund Bunbury
• Messeschlager Gisela
• Servus Peter
• Terzett
• Kleinstadtgeschichten
• Alles für Figaro
• Operette und Musical in der BRD – Raus aus den Talaren
S.1/4-5/8-13/80: iStock©Sunny Lion
S. 6/65/67-69: iStock©Anastasiia Hevko
S. 6/64-65/66/70: Engler Schödel
S. 8/9/14/37/50/58: iStock
S. 9: JOffenbach©Félix Nadar/wikipedia
S. 14-27: iStock©Matorinni
S. 28-35: Engler Schödel
linkedin.com/company/ schott-music-gmbh-&-co-kg
• Das Fest in Coqueville
• Nach 1989 - Völlig losgelöst
• Südseetulpen
• Old Germany
• Sonderformen - Ein Königreich für eine Kuh
• Triple-Sec
• Neues vom Tage
• Die Gondolieri oder Der König von Barataria
• Der Kuhhandel
Walter Dobner:
• Der Graf von Luxemburg
• Die lustige Witwe
Michael Rot:
• La Grande-Duchesse de Gérolstein
• Der Graf von Luxemburg
• Die lustige Witwe
• Das Spitzentuch der Königin
• Der lustige Krieg
• Der Zigeunerbaron
• Die Fledermaus
• Eine Nacht in Venedig
• Prinz Methusalem
• Wiener Blut
Kolja Porschke:
• Die Banditen
Agne Pupelyte:
• Sabine, sei sittsam
S. 36: Bundesarchiv Bild 183-1987-0429-018
S. 36-49: iStock©InnaPoka
S 50-56: iStock©Utra_no_more
S. 64/71: iStock©Sunny Lion
S. 65: iStock©Nerthuz
S. 65/69/80: iStock©Trapeznikova
tiktok.com/@schottmusic1 threads.com/@schottmusic