Berichte und Hintergründe aus Israel und dem Nahen Osten
Begehrte Rechenkünstler
Chipentwickler Nvidia begeistert mit israelischer Technik
Das Pilgern ist des Christen Lust
Religiöser Tourismus im Lauf der Zeit
Ersehntes Wiedersehen
Eine Geiselbefreiung und der letzte Wunsch einer Mutter


BUCHREZENSION
Pilgerberichte im Wandel der Zeit
4 N O'A ARGAMANI
Rechtzeitig befreit
6 C HIPENTWICKLER NVIDIA
Aufstieg mit israelischem Antrieb
9 REFORMER OHNE NEUER UNGEN
Was bringt Peseschkian?
10 MELDUN GEN
Holocaust-Überlebender findet Verwandte
11 BIBELKOLUMNE
Ausländer im Ackerfeld

BOTSCHAFTEREMPFANG
„Helden des Südens“ geehrt
Israelische Schauspielerin Schira Haas gewinnt Jurypreis in Monte Carlo
Die israelische Schauspielerin Schira Haas hat den Spezialpreis der Jury beim 63. Fernsehfestival von Monte Carlo gewonnen. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Rolle in der neuen israelischen Serie „Night Therapy“, die zur offiziellen Auswahl des Festivals gehörte. Bei der Preisverleihung am 18.Juni konnte die 29-Jährige die „Goldene Nymphe“ aus Termingründen nicht persönlich entgegennehmen. In einer Videobotschaft sagte sie laut der Zeitung „Jerusalem Post“, der Preis sei eine „un-
IMPRESSUM

glaubliche Ehre“. In der Serie gehe es um Heilung, Trauer und Liebe. „Die Rolle ist mir auf der persönlichsten Ebene sehr wichtig.“ Haas kam auch auf ihre 2022 verstorbene Mutter zu sprechen: „Ich möchte meiner Mutter danken, die ich jeden Tag und in jedem Augenblick vermisse.“ Ihren Erfolg habe sie ihr zu verdanken.
„Night Therapy“ dreht sich um einen arabisch-israelischen Psychologen, gespielt von Jusef Sweid. Nach dem Suizid seiner jüdisch-israelischen Frau muss er die beiden Kinder alleine großziehen. Nach einer weiteren schlaflosen Nacht entscheidet er sich, seine Patienten zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen zu behandeln. Haas spielt in der Serie eine Patientin, die ein Computergenie ist. Als solches verlässt sie kaum das Haus, da sie das virtuelle Leben bevorzugt.
Trotz des düsteren Themas hat die Serie für die Geschäftsführerin des Medienunternehmens „Yes“, Scharon Levi, eine positive Botschaft. Sie verbreite mit ihrem Blick auf das Leben und der ihr eigenen Botschaft über die Kraft der Heilung Optimismus. | Daniel
Herausgeber Christliche Medieninitiative pro e.V. | Charlotte-Bamberg-Straße 2 | D-35578 Wetzlar
Telefon +49 (64 41) 5 66 77 00 |Telefax -33 | israelnetz.com | info@israelnetz.com
Vorsitzender Dr. Hartmut Spiesecke |Geschäftsführer Christoph Irion (V.i.S.d.P.)
Büro Wetzlar Elisabeth Hausen (Redaktionsleitung), Daniel Frick, Carmen Shamsianpur Büro Jerusalem mh
Titelfoto Nvidia-Chef Huang präsentiert bei einer Konferenz in Taiwan am 2. Juni Roboter, die dank Künstlicher Intelligenz mit Menschen interagieren können; Quelle: picture alliance Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 19. Juli 2024
Spenden Israelnetz lebt von Ihrer Spende. Volksbank Mittelhessen eG IBAN DE73 5139 0000 0040 9832 01 | BIC VBMHDE5F | www.israelnetz.com/spenden
Neue Perspektiven statt Perspektivlosigkeit
Liebe Leserin, lieber Leser,
Zeiten des Krieges sind immer auch Zeiten der Depression. Wenn Berichte über Gewalt, Unrecht, blinden Hass und Blutvergießen die Nachrichtenlage dominieren, dann leiden viele Millionen Menschen auch an ihrer Seele. Ganz besonders jedoch jene, die unmittelbar von Krieg und Kriegsfolgen betroffen sind – wie derzeit die knapp 10 Millionen Israelis sowie rund 5 Millionen Menschen in den palästinensischen Autonomiegebieten. Solche seelischen Belastungen haben nicht nur mit Verlust, Verwundungen und Trauer zu tun. Krank macht den Menschen auch das Gefühl der Perspektivlosigkeit – weil oft die Phantasie abhanden gekommen ist, wie friedliche, gerechte Lösungen denn aussehen könnten.
Interessant ist: Schon die Hebräische Bibel, die viele Menschen heute für unzeitgemäß und womöglich für ein bluttriefendes historisches Geschichtenbuch halten, bietet in ihren Kernaussagen eben nicht gesammelte Perspektivlosigkeiten mit Sünde und Tod. Sondern serienweise Perspektivwechsel. Und sogar mutmachende, seelsorgerliche, reale Lebenshilfe. „Zukunft und Hoffnung“ will der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs seinem leidenden Volk schenken (Jeremia 29,11). Und Gott sagt ausdrücklich: Hilfe, Heilung und echte Erneuerung sind längst auf dem Weg. Der Mensch muss nur bereit sein, diese positiven Entwicklungen auch wahrzunehmen: „Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“ (Jesaja 43,19).






Die Redaktion von Israelnetz interessiert sich daher für die Geschichten hinter den Geschichten. Und für wirklich Neues. In unserer aktuellen Titelgeschichte berichtet Redakteur Daniel Frick von bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Viele Medien greifen solche Themen auf. Wenig bekannt ist allerdings: Kreative Chip-Entwickler aus Israel tragen derzeit maßgeblich zu wegweisenden neuen Anwendungen bei. Führende Hersteller im kalifornischen Silicon Valley können auf das Spitzen-Knowhow aus Israel nicht mehr verzichten. Und zugleich senden die Hightech-Entwickler sogar Signale der Versöhnung: Denn auch Talente in den palästinensischen Autonomiegebieten werden systematisch in die Entwicklungsprojekte eingebunden (Seite 6).
Ich wünsche Ihnen eine Gewinn bringende Lektüre, Herzlich grüßt Sie,
Ihr Christoph Irion




Jerusalem hat die Marke von einer Million Einwohnern geknackt. Damit ist es Israels erste Millionenstadt. Dies gab das israelische Statistikbüro zum Jerusalem-Tag am 5. Juni bekannt. Ende 2023 waren etwa 60 Prozent der Einwohner Juden. Knapp 40 Prozent waren Araber. Ultra-orthodoxe Juden machen knapp 30 Prozent der Bevölkerung aus.




















NO’A ARGAMANI
Gerade noch rechtzeitig befreit
Eine hochriskante Rettungsaktion der israelischen Sicherheitskräfte im Gazastreifen ermöglicht einer Mutter die Erfüllung ihres letzten Wunsches: Vor ihrem Tod kann sie ihre von der Hamas verschleppte Tochter wiedersehen. Eine andere befreite Geisel kommt zu spät. Elisabeth Hausen
Ende November veröffentlichte Liora Argamani eine bewegende Videobotschaft. Ihre 26-jährige Tochter No’a befand sich zu dem Zeitpunkt als Geisel in der Gewalt der Terrorgruppe Hamas. Die Mutter appellierte in dem Video an US-Präsident Joe Biden und an das Internationale Rote Kreuz. Denn sie litt unter einem Hirntumor und hatte einen sehnlichen Wunsch – vor ihrem Tod die Tochter noch einmal wiederzusehen. „Bringt mir meine

Die todkranke Liora Argamani im Januar bei einem Treffen in der Knesset, bei dem Angehörige die Freilassung der Geiseln forderten
No’a so schnell wie möglich, damit ich sie noch einmal sehen kann“, sagte Liora Argamani. Später schrieb sie an Biden: „Ich bin an Krebs im Endstadium erkrankt, Hirnkrebs, auf der Stufe 4“, zitiert die Nachrichtenseite „Arutz Scheva“ aus dem Brief. „Alles, was mir durch den Kopf geht, bevor ich mich für immer von meiner Familie verabschiede, ist der Wunsch, meine Tochter, mein einziges Kind, ein letztes Mal zu umarmen.“ Anlässlich ihres Geburtstages bat sie den Demokraten um ein Geschenk: „meine Tochter zu sehen, bevor ich diese Welt verlasse“. No’a habe es verdient, ihre Mutter noch ein letztes Mal zu treffen.
Dieser Wunsch erfüllte sich am 6. Juni – aber nicht durch das Einschreiten internationaler Akteure. Vielmehr gelang es israelischen Sicherheitskräften in einer hochriskanten Aktion, No’a Argamani und drei weitere Geiseln zu befreien: den 21-jährigen Almog Meir-Jan, den 27-jährigen Andrej Koslow und den 41 Jahre alten Schlomi Siv. Die vier Teilnehmer und Sicherheitskräfte des Nova-Festivals wurden in zwei Wohnungen im zentralen Gazastreifen festgehalten. An der Rettungsaktion beteiligten sich die Armee, der Inlandsgeheimdienst Schabak und die Polizei. Die Geretteten wurden mit Autos zu zwei Hubschraubern gebracht und umgehend nach Israel geflogen.
Einer der Befreier erzählte danach, No’a habe als Erstes nach dem Zustand der Mutter gefragt: „No’a saß zitternd im Fahrzeug, und dann schaute sie mich an und fragte: ‚Ist meine Mutter am Leben?‘ Ich antwortete ihr: ‚Ja‘. Sie sah alle an und fragte: ‚Seid ihr sicher?‘“ Nach der Ankunft in Israel wurde die 26-Jährige zunächst im Scheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv untersucht. Sie traf ihren Vater Ja’akov, für den es in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag war: „Heute ist mein Geburtstag. Ich hätte nie geglaubt, dass ich so ein Geschenk bekommen würde.“
Wenige Stunden später konnte sie im Ichilov-Krankenhaus ihre todkranke Mutter wiedersehen. Krankenhausdirektor Ronni Gamsu sagte, die Ärzte hätten sich nach dem 7. Oktober acht Monate lang bemüht, No’as Mutter in einem Zustand zu halten, in dem sie kommunizieren kann.
Jubel und Freudentänze nach der Befreiung
Die Botschaft von der Befreiung der vier Geiseln löste in Israel große Freude aus. An mehreren Stränden verkündeten Bademeister und Rettungsschwimmer die Nachricht per Lautsprecher. Die Badegäste jubelten. Menschen tanzten auf der Straße. Israelische Touristen in der griechischen Hauptstadt Athen stimmten die Nationalhymne an.
Nach der ersten Freude über das Wiedersehen mit Verwandten und Freunden erhielt Almog Meir-Jan indes eine traurige Nachricht: Sein Vater war einen Tag vor seiner Befreiung gestorben. Jossi Meir war krank, er wurde nach einem Herzinfarkt tot in seinem Haus in Kfar Saba aufgefunden. Er lebte allein.
Ein Kommandeur der Anti-Terror-Einheit Jamam, Arnon Smora, erlitt bei dem Rettungseinsatz lebensgefährliche Verletzungen. Er starb nach der Ankunft im Krankenhaus. Ihm zu Ehren wurde die Aktion in „Operation Arnon“ umbenannt.
Am 9. Juni wurde der Kommandeur auf dem Jerusalemer Herzl-Friedhof beigesetzt. Tausende Menschen säumten die
Straßen in der Nähe seines Wohnhauses in Mevasseret Zion und erwiesen ihm mit Israelflaggen die letzte Ehre.
Die Mutter Ruti erzählte bei der Beerdigung, Arnons Lieblingsfilm als Kind sei „Robin Hood“ gewesen. Außerdem habe er Joni Netanjahu für die Operation im ugandischen Entebbe bewundert. Der Bruder des jetzigen Regierungschefs Benjamin Netanjahu (Likud) war 1976 bei der Befreiung von Geiseln nach einer Flugzeu-
Knapp dreieinhalb Wochen nach der Befreiung ihrer Tochter erlag Liora Argamani ihrem Krebsleiden, wie das IchilovKrankenhaus in Tel Aviv am 2. Juli bekanntgab. Sie wurde 61 Jahre alt. Am 29. Juni hatte sich No’a noch per Videobotschaft bei einer Kundgebung in Tel Aviv geäußert, deren Teilnehmer die Freilassung der anderen Geiseln forderten: „Als einziges Kind meiner Eltern, als Kind, dessen Mutter unheilbar krank ist, hat mich die

gentführung getötet worden. Die Mutter sagte: „Ich wusste, dass es Russisches Roulette war. Du hast dein Leben für das Land geopfert.“ Smora hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.
Die drei Männer wurden nach Angaben der Armee im Haus von Abdallah Aldschamal befreit. Der palästinensische Journalist war vor einigen Jahren Sprecher des Hamas-Arbeitsministeriums in Gaza. Er schrieb unter anderem für „Palestine Chronicle“. 2019 verfasste er einen Beitrag für „Al-Dschasira“. Der katarische Sender bestreitet, dass Aldschamal sein Korrespondent in Gaza gewesen sei. Bei der Befreiungsaktion wurden mehrere Mitglieder der Familie getötet, auch der Journalist und dessen Vater Ahmed Aldschamal.
Nach Angaben der Hamas noch am selben Tag wurden bei der Rettungsaktion mindestens 274 Palästinenser getötet. Dies lässt sich nicht unabhängig bestätigen. Zudem differenziert die Terrorgruppe nicht zwischen Bewaffneten und Zivilisten. Die Armee räumte ein, dass auch Zivilisten ums Leben gekommen seien. Dafür sei allerdings die Hamas verantwortlich, die Geiseln in dichtbesiedelten Wohngebieten festhalte. Armeesprecher Daniel Hagari sprach nach einer Untersuchung von weniger als 100 Toten.
Sorge um meine Eltern in der Gefangenschaft am meisten beschäftigt“, sagte No’a. Es sei ein großes Vorrecht, nach acht Monaten der Ungewissheit bei ihrer Mutter sein zu dürfen.
„Liora, seligen Andenkens, verbrachte ihre letzten Tage an der Seite ihrer Tochter No’a, die aus der Geiselhaft zurückgekehrt war, und an der Seite ihrer engsten Familie“, heißt es in der Mitteilung der Klinik. „Wir geben die Bitte der Familie weiter, die Privatsphäre in diesen schweren Stunden zu respektieren. Wir nehmen teil an der Trauer der Familie Argamani. Möge die Erinnerung an sie zum Segen sein.“ No’a indes bangt um ihren Freund Avinatan Or, der sich immer noch als Geisel im Gazastreifen befindet (Stand: Ende Juli).
Liora Argamani stammte ursprünglich aus der chinesischen Stadt Wuhan. 1994 kam sie aus beruflichen Gründen für einen kurzen Aufenthalt nach Israel. In Be’er Scheva verliebte sie sich in Ja’akov Argamani, heiratete ihn und blieb im jüdischen Staat. Nach der Entführung appellierte Israel mehrmals an die chinesische Regierung, sich für No’as Freilassung einzusetzen. Diese Bitten verhallten jedoch ebenso ungehört wie die Appelle der Mutter an die internationalen Akteure. |

Nvidia-Chef Huang präsentiert bei der Technologie-Konferenz des Konzerns im März stolz die neue Plattform mit 2 Blackwell-Chips – mit jeweils 208 Milliarden Transistoren – und einem Zentralprozessor. Links ist die Testplattform zu sehen, rechts das etwas kleinere Endprodukt.
Nvidia
Von Grafikkarten zur Künstlichen Intelligenz
Bis vor kurzem war Nvidia nur Computerspielern ein Begriff: Die Grafikkarten des 1993 gegründeten Unternehmens zauberten 3D-Welten auf die Monitore; mit den Jahren nahmen dabei Detailtiefe und Realitätstreue zu. Möglich wurde dies durch Chips, die spezialisierter sind als der Zentralprozessor eines Computers: Sie teilen die Rechenaufgaben für die Darstellung in mehrere Komponenten und erledigen sie parallel. In den vergangenen Jahren zeigte es sich, dass sich dieser Ansatz für die rechenintensive Erstellung von KI-Modellen besonders eignet. So wurde der Ende 2022 vorgestellte ChatBot ChatGPT mithilfe von Nvidia-Chips trainiert.
CHIPENTWICKLER NVIDIA
Aufstieg mit israelischem Antrieb
Der amerikanische Chipentwickler Nvidia war im ersten Halbjahr der hellste Stern an der Börse. Entscheidend für diesen Erfolg ist Fachkenntnis aus Israel. Daniel Frick
In den vergangenen Monaten hat der Chipentwickler Nvidia einen sagenhaften Aufstieg an der Börse hingelegt: Seit Ende 2023 schnellte sein Wert in die Höhe. Mitte Juni erreichte er 3,3 Billionen US-Dollar, Nvidia wurde vor Microsoft zum teuersten Unternehmen der Welt. Erst zwei Wochen zuvor hatte es sich den zweiten Platz von Apple geschnappt.
Inzwischen ist Nvidia zwar wieder hinter Microsoft und Apple zurückgefallen. Doch die Entwicklung bleibt eindrucksvoll. Sie ist dem Rummel rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu verdanken – und der herausragenden Marktposition, die Nvidia hierbei hat: Künstliche Intelligenz erfordert immense Rechenleistungen.
Nvidia bietet seinen Kunden dafür nicht nur die Chips, sondern auch ein erweiterbares Gesamtpaket mit passender Software.
Einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg hat Israel: In den dortigen Forschungszentren ist nicht nur die Halbleiter-Architektur entstanden, mit der Nvidia nun auftrumpft. Israelische Fachkenntnis hat dem amerikanischen Unternehmen nach Einschätzung von Experten überhaupt erst die „Eintrittskarte“ in den KI-Markt beschert.
Für das aktuelle Momentum sorgen insbesondere die beiden angekündigten Chipgenerationen Blackwell und Rubin. Bei einer Präsentation im März betonte Nvidia-Chef Jensen Huang,
dass Blackwell nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern mit einer Verbesserung um den Faktor 5 bei KI-Berechnungen einen „massiven Leistungssprung“ darstellt.
Huang, selbst ein Elektroingenieur, sprach dabei von einem „technischen Wunder“. Bei dem Prozessor seien zwei Plättchen, die die Transistoren enthalten, auf einzigartige Weise verbunden und kommunizierten mit ungeahnter Geschwindigkeit. „Als uns gesagt wurde, dass die Ambitionen des Blackwell-Chips jenseits der Grenzen der Physik liegen, sagten die Ingenieure: ‚Na und?‘“
Bei einer anschließenden Fragerunde mit Journalisten vergaß Huang nicht zu erwähnen, wem er diese Entwicklung zu verdanken hat: „Was ich hier gezeigt habe, der Kern des Blackwell-Prozessors, kommt aus Israel.“
Doch dann stellte der kanadische Computerwissenschaftler Alex Krischevski fest, dass sich mit den Grafikkarten künstliche neuronale Netzwerke, also vom Aufbau des Gehirns inspirierte technische Modelle, um ein Vielfaches schneller trainieren lassen als mit normalen Prozessoren. Mit seinem Modell „AlexNet” gewann der damalige Doktorand 2012 einen Wettbewerb für Bilderkennung. Die Ergebnisse waren derart gut, dass sich die Jury fragte, ob er irgendwo gemogelt hatte.
Durchbrüche wie dieser gaben der Disziplin Auftrieb, sodass sich auch Nvidia verstärkt darauf einließ. Das Forschungszentrum in Israel bestand anfangs aus 20 Mitarbeitern. Inzwischen sind vier Standorte dazugekommen. Mit 3.300 Angestellten ist Israel heute die größte Nvidia-Vertretung außerhalb des Heimatlandes
„Als uns gesagt wurde, dass die Ambitionen des Blackwell-Chips jenseits der Grenzen der Physik liegen, sagten die Ingenieure: ‚Na und?‘“
Nvidia-Chef Huang über das „Wunder“ des in Israel entwickelten Blackwell-Prozessors
Bekanntlich hat in den vergangenen Monaten nicht nur der Börsenkurs von Nvidia, sondern auch die Stimmung gegen Israel einen steilen Aufstieg erlebt. Unter diesem Blickpunkt hätte es sich Huang auch einfach machen und die israelische Herkunft seines Erfolgs verschweigen können. Doch das Gegenteil ist der Fall: „Wir werden weiter in Israel investieren“, betonte der 61-Jährige. Huang weiß, was er an Israel hat.
Später Eintritt
Dabei ist Nvidia noch nicht lange im Land präsent. Seit Ende der 2000er Jahre war das Unternehmen dort zwar aktiv, indem es etwa in Jungunternehmen investierte. Doch erst im Jahr 2016 entstand das erste Forschungszentrum in Tel Aviv. Dessen Schwerpunkt war von Anfang an Künstliche Intelligenz. Jeff Herbst, damals für die Unternehmensentwicklung zuständig, sagte zu dem Vorstoß: „Nvidia ist ein tiefgehendes Technologieunternehmen, und Israel ein tiefgehendes Technologieland, es passt also perfekt zusammen.“
Zu diesem Zeitpunkt hatte Huang die Entscheidung gefällt, auf KI zu setzen. Noch Anfang der 2010er Jahre fristete diese Disziplin aufgrund eher bescheidener Ergebnisse, etwa bei der Spracherkennung, eine Randexistenz.
USA. Des Weiteren befinden sich drei Standorte in den umstrittenen Gebieten: In Hebron, Nablus und der palästinensischen Planstadt Rawabi.
Rasante Verbindung
Ein entscheidender Schritt zum Aufstieg erfolgte 2019, als Nvidia den israelischen Netzwerkspezialisten Mellanox für 6,9 Milliarden US-Dollar aufkaufte. Das Unternehmen aus Jokneam Illit am Fuße des Karmel entwickelt die Technik für den schnellen und reibungslosen Austausch vernetzter Rechner in Datenzentren. Das ist ein zentrales Element, da bei der Erstellung von Künstlicher Intelligenz mehrere Recheneinheiten im Verbund arbeiten. Huang bezeichnete den Kauf von Mellanox rückblickend als „eine der großartigsten strategischen Entscheidungen“, die Nvidia je getroffen habe. Die kombinierte Technik von Nvidia und Mellanox sorgt nicht nur für die hervorragende Marktposition. Sie ermöglicht auch den Bau von Supercomputern wie des „Israel-1“, der im vergangenen Herbst im jüdischen Staat in Betrieb ging.
Huang ließ es sich auch zum Betriebsstart nicht nehmen, von Israel zu schwärmen: „Israel ist das Zuhause von führenden KI-Forschern und -Entwicklern, die Anwendungen für die
Israel: Das „Königreich der Chips“
Israel hat in der Halbleiterbranche einen herausragenden Ruf: Der jüdische Staat gilt als „Königreich der Chips“. Bei knapp 10 Millionen Einwohnern tüfteln dort rund 30.000 Ingenieure an dieser Spitzentechnologie. Unternehmen wie Nova oder Camtek stellen zudem Maschinen für die Qualitätskontrolle her, die zu den besten der Welt gehören. Ein Meilenstein für den Erfolg war das Jahr 1974: Damals siedelte sich Intel in Haifa an. Die Entscheidung zahlte sich aus: Dank der Innovationen aus Israel konnte Intel in den folgenden Jahrzehnten eine dominante Marktposition aufbauen. Das Zentrum entwickelte etwa den Chip, der 1981 im berühmten IBM PC, der zum Industriestandard werden sollte, Verwendung fand. Dieser und weitere Erfolg lockten andere Unternehmen an. Hinzu kommt, dass der Staat Steuererleichterungen zusichert, wenn Unternehmen im Land forschen. Heute betreiben fast alle Chipentwickler von Rang und Namen Zentren in Israel.
nächste KI-Welle erstellen“. Mit „Israel-1“ hätten eine Reihe innovativer Unternehmen in Israel die Möglichkeit, „die Produktivität und das Geschäftsmodell von Unternehmen auf der ganzen Welt zu verändern“.
Talentnutzung mit Risiko
Ein Engagement in Israel ermöglicht jedem Unternehmen den Zugriff auf immenses Talent; es geht aber auch mit Sicherheitsrisiken einher. So

Huang und MellanoxGründer Waldmann verkündeten Ende März 2019 den Kauf von Mellanox durch Nvidia. Huang wird später von „einer der großartigsten Entscheidungen“ für Nvidia sprechen.
hat der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und der anschließende Krieg auch für Nvidia Umstellungen erzwungen: Viele Angestellte mussten als Reservisten zur Armee. Am 15. Oktober sollte eigentlich ein zweitägiger KI-Gipfel in Tel Aviv beginnen, mit rund 2.500 Gästen und Huang als Hauptredner. Angesichts des Kriegsgeschehens sagte das Unternehmen ihn aber ab.
Hinzu kam, dass die Terror-Organisation Hamas auch einen Mitarbeiter in den Gazastreifen entführt hat. Avinatan Or gehörte zu den Besuchern des Nova-Festivals. Er erreichte weltweite Bekanntheit, weil er auf einem der Entführer-Videos mit seiner Freundin No’a Argamani zu sehen war. Während Argamani jedoch inzwischen freikam, ist das Schicksal von Avinatan unbekannt.
Gegen Ende 2023 hatte Nvidia rund 15 Millionen US-Dollar an Spenden zusammengetragen, die größte Spendensammlung der Unternehmensgeschichte. Die Gelder sollen den vom Konflikt Betroffenen zugute kommen – sowohl den Israelis als auch den Palästinensern, wie Huang betonte. Angestellte aus aller Welt steuerten 5 Millionen US-Dollar bei, das Unternehmen selbst verdoppelte diese Summe nochmal.
Versuch der Integration
Der Hinweis, dass die Gelder auch für die Palästinenser bestimmt sind, ist kein bloßes Zugeständnis an politische Korrektheit. Mellanox hatte schon seit Jahren auch Palästinenser angestellt – im Westjordanland, seit 2016 auch im Gazastreifen. Unternehmensgründer Ejal Waldmann sagte damals, es gehe bei derartigen Anstellungen auch darum, „unsere Nachbarn erfolgreich zu machen“. Er war sich sicher: „Das wird Menschen einander näher bringen.“
Umso bitterer ist, dass die Hamas bei dem Terrormassaker auch Waldmanns 24-jährige Tochter Danielle ermordete. Sie war mit ihrem Freund Noam Schai auf dem Nova-Festival. Die letzten Aufnahmen von ihr zeigen sie auf dem Rücksitz eines Autos auf der Flucht vor den Terroristen.
Trotz dieses Verlustes glaubt Waldmann weiterhin an den Frieden. Gegenüber der BBC sagte er, dass ein palästinensischer Staat der Weg dazu sei. Zuerst müssten jedoch diejenigen vernichtet werden, die für das Terrormassaker verantwortlich seien.
Israelische Technik im Alltag
Die Geschichte von Nvidia und seiner Verbindung mit Israel zeigt: Wer KI nutzt, greift mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf israelische Technik zurück. Zumal auch andere Unternehmen, die im KI-Geschäft mitmischen, auf den jüdischen Staat setzen: Konkurrent Intel versucht aktuell, verlorenes Terrain gutzumachen. Die Amerikaner hoffen dabei unter anderem auf Entwicklungen des Chipunternehmens Habana-Labs, das sie 2019 zugekauft haben. Der Technologiegigant Apple, der im Juni sein KI-Programm vorstellte, hat sich 2020 entschieden, auf eigene Chips zu setzen. Deren Entwicklung erfolgt unter Leitung des israelisch-arabischen Christen Johny Srudschi, des Hardware-Chefs bei Apple. Das Unternehmen betreibt drei Forschungszentren in Israel: In Haifa, Herzlia und seit 2022 auch in Jerusalem. Zu den großen Unternehmen mit Chipentwicklung in Israel gehören zudem Microsoft und Amazon, Samsung und Huawei. Künstliche Intelligenz kommt mit dem Versprechen, den Arbeits- und Lebensalltag zu vereinfachen. Den Befürwortern eines IsraelBoykotts macht die Entwicklung das Leben hingegen schwerer: Sollte KI den Alltag so prägen, wie es die Prognosen erahnen lassen, wird es in Zukunft noch aufwändiger, wenn nicht gar unmöglich, einen Bogen um israelische Produkte zu machen. |
REFORMER
OHNE NEUERUNGEN
Iran: Was bringt Peseschkian?
Der Iran bekommt einen neuen Präsidenten. Nach dem Flugzeugabsturz von Ebrahim Raisi im Mai lag die Wahlbeteiligung unter 50 Prozent. Eine Analyse von Carmen Shamsianpur
Masud Peseschkian ist der designierte neue Präsident der Islamischen Republik Iran. Im Wesentlichen kündigt er an, alles so weiterzumachen wie bisher. Ein außenpolitischer Schwerpunkt bleibt der Kampf gegen Israel.
Peseschkians Vita mutet menschlicher an als die seines Vorgängers Ebrahim
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass jeder vom Wächterrat zugelassene Präsidentschaftskandidat in erster Linie für ein menschenverachtendes Regime steht und dem Obersten Führer Ali Chamenei treu ergeben ist.
Selbst nach offiziellen Angaben erschienen mehr als 50 Prozent der wahlberechtigten Iraner nicht an den Wahlurnen. Im

Keine Reformen zu erwarten: Masud Peseschkian wird den Weg seiner Vorgänger weitergehen
Raisi, des „Schlächters von Teheran“. Der bald 70-Jährige ist Allgemeinmediziner und Herzchirurg – also jemand, der im Gegensatz zu Raisi Leben eher rettete, als sie zu nehmen. Er leitete ein Krankenhaus, bevor er in die Politik wechselte und 2001 unter Mohammed Chatami Gesundheitsminister wurde. Auch seine Frau war Ärztin. Bei einem Autounfall 1994 verlor er sie und eines seiner vier Kinder. Danach heiratete er nicht mehr.
Durch seine Herkunft repräsentiert Peseschkian ethnische Minderheiten im Iran. Er hat einen aserbaidschanischen Vater und eine kurdische Mutter. Das alles
ersten Wahlgang waren es sogar mehr als 60 Prozent. Dabei sehen sich viele zur Wahl gezwungen, weil die Stimmabgabe im Iran per Stempel im Familienbuch dokumentiert wird.
Oppositionelle Gruppen meldeten kurz nach der Stichwahl erste Zweifel an. Von 30.530.157 gezählten Stimmen habe Peseschkian 16.384.403 (53,6 Prozent) und sein Mitbewerber Said Dschalili 13.538.179 (44,3 Prozent) erhalten. Die Zahl der ungültigen Stimmen wurde mit 607.575 angegeben. In der ersten Wahlrunde waren es noch rund 1,06 Millionen. Die ohnehin schon erstaunlich niedrige Zahl soll sich
also trotz höherer Wahlbeteiligung fast halbiert haben.
Der Iran feiert die Wahl als Sieg der „Islamischen Demokratie“. Das „Ziel der Feinde“ sei es gewesen, die „Wahlbeteiligung auf unter 20 Prozent zu drücken“, sagte der Leiter des Wahlsicherheitskommandos Madschid Mir Ahmadi. Das „zionistische Regime“ habe die Wahl mit Cyberangriffen beeinflussen wollen. Außerdem seien Terrorattacken auf Wahlinfrastruktur geplant gewesen. In Bezug auf Israel machte der neue Präsident seine Position von Anfang an klar: Er werde Hamas und Hisbollah weiterhin „mit aller Kraft“ unterstützen, bis „das zionistische Gebilde“ besiegt sei. Den iranischen Angriff auf Israel im April nannte er den „Stolz der iranischen Nation“. Die USA machen sich kaum Illusionen über den „Reformer“ Peseschkian. Die Regierung zeigt sich ausdrücklich nicht bereit, über eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen unter dem neuen Präsidenten nachzudenken. Offener begegnet dem Iran die Europäische Union. Sie beglückwünschte Peseschkian zum Sieg und streckte umgehend die Hand zum Frieden aus. Wohlwollende westliche Analysten stellen bedauernd fest, dass Peseschkian „allein“ im Iran nicht viel verändern könne. Oppositionelle gehen davon aus, dass der linientreue Politiker nie die Absicht dazu hatte. Sie verweisen auf den Wahlkampf, in dem er weder zur Außenpolitik noch zum Atomprogramm noch zur Kopftuchfrage irgendwelche Reformen anregte. Der wirtschaftliche Abwärtstrend und die außenpolitische Isolation des Iran werden unter Peseschkian weiter voranschreiten. Innenpolitisch könnte es geringfügige Lockerungen geben. Der „Reformer“ wird eventuell nicht anordnen, dass ein Mädchen wegen eines verrutschten Kopftuches zu Tode geprügelt wird. Wenn es dennoch passiert, dürfte es ihm egal sein. |
MELDUNGEN
Protest gegen Kürzung des Religionsunterrichts
In der Nacht zum 18. Juni haben Eltern im Großraum Tel Aviv vor Dutzenden Schulen leere hebräische Bibeln ausgelegt. Auf Schildern formulierten sie Protest gegen die Politik von Bildungsminister Joav Kisch. Unter seiner Aufsicht ist der Umfang des Bibelunterrichts im Lehrplan drastisch zurückgegangen. Nach der Covid-19-Pandemie betrug er nur noch 40 Prozent des zuvor behandelten Stoffes. Weitere Streichungen folgten, darunter viele Prüfungen. Dabei stelle die Bibel ein „kulturelles, historisches und pädagogisches Fundament des jüdischen Volkes“ dar, sagte eine der Protestierenden. |
Carmen Shamsianpur
Korai auf der Website des Netzwerkes. Dank des Tests stellten er und seine Cousine zweiten Grades eine Verbindung her. Hellman wusste, dass ein entfernter Zweig ihrer Familie während des Holocausts starb. Von einem Überlebenden hatte sie bisher jedoch keine Kenntnis. Sie kannte den Namen von Korais Tante; die Namen seiner Eltern sind auch ihr unbekannt. „Ich habe ein Gefühl, als ob ich jemandem ein neues Leben geschenkt hätte. Er ist mein Kind geworden. Ich muss ihn beschützen und auf ihn aufpassen“, sagte Hellman, obwohl sie ein paar Jahre jünger ist als Korai. „Wir können jemandem eine Familie schenken, der nie gedacht hätte, dass es eine gibt.“ | Valentina Brese
Holocaust-Überlebender findet Verwandte

DUnerwartet hat Schalom Korai Verwandtschaft in den USA
er Holocaust-Überlebende Schalom Korai hat durch einen DNA-Test seine Cousinen und seinen Cousin zweiten Grades ausfindig machen können. Am 10. Juli traf er am Flughafen im US-Bundesstaat South Carolina zum ersten Mal auf seine Verwandten. Unter ihnen befand sich Ann Meddin Hellman, seine Cousine zweiten Grades, mit der er seit dem Ergebnis des DNATests in engem Kontakt steht. Kamerateams begleiteten das Szenario, wie die Onlinezeitung „Times of Israel“ berichtet. Hellmans und Korais Großväter waren Brüder. Hellmans Vorfahren wanderten noch vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA aus, während Korais Familie in Polen blieb und dort ein Familienunternehmen führte. Als Hellman ein Bild des unbekannten Cousins zweiten Grades sah, fiel ihr sofort die Ähnlichkeit mit ihrem Bruder auf.
Ein Polizist rettete Korai im Jahr 1943 als Kleinkind aus dem brennenden Ghetto in Warschau nach dem Aufstand. Er brachte ihn in ein Kloster, wo Nonnen ihn tauften und als Nichtjuden eine Zeit lang großzogen. Die Nazis ermordeten den Rest seiner Familie. Korai verbrachte einige Zeit in einem jüdischen Internat in Polen, kam dann nach Frankreich und 1949 schließlich nach Israel. Da er seinen eigenen Namen nicht kannte, gab er sich den Namen Schalom Korai. Der Vater von drei Kindern und Großvater von acht Enkeln arbeitete 35 Jahre lang als Lastkraftfahrer.
Das soziale Netzwerk „MyHeritage“ hilft Menschen, anhand von DNA-Tests Verwandte zu finden. Im Sommer 2023 bot es Holocaust-Waisen einen solchen Test an. „Man kann nicht anfangen, nach etwas zu suchen, von dem man nichts weiß“, schrieb
68 Kinder aus Gaza nach Ägypten gebracht
Am 27. Juni sind 68 kranke und verwundete Kinder durch den Übergang Kerem Schalom aus dem Gazastreifen ausgereist. Angehörige begleiteten sie. Die kleinen Patienten wurden nach Ägypten gebracht – und von dort aus teilweise in weitere Länder. Sie leiden unter anderem an Krebs und an Brandverletzungen, die durch die Kämpfe in Gaza verursacht wurden.
Bis zum 7. Mai konnten Patienten über Rafah direkt vom Gazastreifen nach Ägypten gelangen. Wegen der israelischen Bodenoffensive gegen die Terrorinfrastruktur der Hamas in der Grenzstadt wurde dies unmöglich. Die Organisation „Ärzte für

Kinder aus dem Gazastreifen mit erwachsenen Begleitpersonen auf dem Weg nach Ägypten
Menschenrechte Israel“ kritisierte diesen Umstand. Vor der Bodenoffensive seien pro Tag etwa 50 palästinensische Patienten über Rafah nach Ägypten ausgereist, sagte der Anwalt Adi Lustigman der Nachrichtenagentur AP. Der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO für das östliche Mittelmeer, Hanan Balkhy, begrüßte auf der Plattform X zwar die Evakuierung der 68 Kinder. Doch mehr als 10.000 Patienten benötigten noch eine Behandlung, fügte er an. Die Aktion hat Israel mit der US-Regierung, Ägypten und der internationalen Gemeinschaft abgestimmt. |
Elisabeth Hausen
BIBELKOLUMNE
Ausländer im Ackerfeld
Zum ersten Mal fliegt Micha Hägele nach Israel. Als Erntehelfer im Kibbuz Nizana und bei Haifa werden für ihn biblische Verheißungen lebendig. Micha Hägele
Der Kibbuz Nizana liegt in der Negev-Wüste, etwa 45 Kilometer südlich des Gazastreifens, direkt an der Grenze zu Ägypten. Vom Ben-Gurion-Flughafen fuhren wir direkt dorthin und kamen am Abend an. Im Dunkeln sahen wir das Lager der Wüstenzelte, im Hintergrund glitzerten viele Lichter über einer steppenartigen Landschaft.
Am nächsten Morgen trafen wir uns in der strahlenden Wüstensonne für den ersten Feldeinsatz. In Kleinbussen und Kleingruppen wurden wir zu riesigen Plantagen in der näheren Umgebung gebracht. Dort werden verschiedene Tomatensorten angebaut, unter anderem die Cherry-Tomate, eine Erfindung der Israelis. Etwa 90 Prozent der israelischen Tomatenzucht befindet sich im Negev. Aber auch Kartoffeln, Zwiebeln, Kohlrabi, Ananas, Kräuter und Wein werden in den Farmen um Nizana angebaut.
Die israelischen Bauernhöfe, auf denen ich arbeitete, bestehen aus unstrukturierten „Bauhöfen“ für die Rohmaterialien zur Errichtung der Plantagenzelte sowie für die Bewässerungs- und Agrartechnik, Unterkünften für die Arbeiter, Verpackungsstationen und natürlich den eigentlichen Plantagen. Die hohen Zelte aus Stoff oder Kunststoff stehen auf Feldern. Sie dienen zum Schutz vor Wetter und Sand, aber auch zur Begrenzung der bestäubenden Hummeln.
„Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein.“
Jesaja 61,5
Die Tröpfchenbewässerung ist ebenfalls eine Entdeckung Israels, die vor allem in der Wüste überall genutzt wird, um Wasser einzusparen. Die Technik besteht vor allem darin, dass die Wasserschläuche, die an den Pflanzen angelegt sind, mit Löchern ausgestattet sind, aus denen gezielt und gleichmäßig eine bestimmte Menge Wasser austritt, und dies auch gesteuert werden kann. Mithilfe dieses Systems lässt sich auch der Salzgehalt im Wasser regulieren, der die Süße und Größe der Früchte beeinflusst. Eine große Salzzufuhr beispielsweise führt zu kleineren Früchten, aber mit einer höheren Süße.
Wir wurden in die Arbeit auf dem Feld eingewiesen. Dabei entwickelte jeder seine eigene Technik und einen eigenen Rhythmus. Wir jäteten das Unkraut und ernteten und verpackten die Früchte. Im Hintergrund waren immer wieder dumpfe Einschläge von Detonationen auf einem naheliegenden Militärübungsplatz zu hören.
Nizana ist hebräisch und bedeutet „Knospe“. Der Ortsname trifft hier exakt auf die Wirkung des Ortes, der das Potential für das Blühen birgt. Das Aufblühen war für mich nicht nur in den Plantagen zu sehen, sondern auch im Kontakt mit anderen aus dem Team. Leicht kamen wir miteinander ins Gespräch und es entfaltete sich ein gesegnetes Miteinander.
Aufgrund des Krieges fehlen zur Zeit 40.000 Arbeiter in der Landwirtschaft in Israel. In Friedenszeiten kommt etwa die Hälfte von ihnen aus dem Gazastreifen. Daneben bilden auch Thailänder eine große Arbeiterschar auf Israels Feldern. Weil jedoch im Oktober auch Thailänder von der Hamas als Geiseln genommen wurden, hat die thailändische Regierung deren Ausreiseerlaubnis widerrufen. Es gibt eine biblische Verheißung des Propheten Jesaja für Israel. In Kapitel 61,5 steht: „Fremde werden hintreten und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein.“
Nun, nach dem 7. Oktober, kommen eben freiwillige Erntehelfer aus anderen Ländern nach Israel, um in dieser Zeit die Verheißung Gottes zu erfüllen.
Für neue Erfahrungen, biblische Erkenntnisse und viele Begegnungen bin ich dankbar. Müde, aber erfüllt und gesegnet kam ich aus Israel zurück. Und auch ein halbes Jahr nach dem Einsatz denke ich: Ich habe dadurch mehr bekommen, als ich gegeben habe. Ich möchte jeden ermutigen, Israel zu helfen. Oder, wie es der Psalmist in 122,6 ausdrückt: „Wünscht Israel Schalom!“ | Der Text entstand unter Mitwirkung von Nicolas Dreyer und mh

Micha Hägele wohnt zur Zeit in einer christlichen WG im württembergischen Schorndorf. Seine Verbundenheit mit Israel möchte er künftig stärker zum Ausdruck bringen und glaubt, dass sein Einsatz ein guter erster Schritt war. Derzeit arbeitet er an einer Software-Projektarbeit.

Eines von zwei Bildern, die der Künstler Brofman während des Empfangs gestaltete
EMPFANG DER ISRAELISCHEN BOTSCHAFT
„Helden des Südens“ geehrt
Beim Jahresempfang der israelischen Botschaft in Berlin sind Überlebende des Massakers vom 7. Oktober zu Gast. Ein deutscher Politiker würdigt die Menschenrechte im jüdischen Staat. Elisabeth Hausen

Botschafter Prosor schöpft Hoffnung dank der „Helden des Südens“
Israel wird dafür sorgen, dass sich ein Massaker wie der Hamas-Angriff am 7. Oktober nicht wiederholen kann. Dies versicherte der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor, am 25. Juni bei einem Empfang zum 76. Unabhängigkeitstag.
Er stand unter der Überschrift: „I love Darom“ – „Ich liebe den Süden“.
„Wir werden das Versprechen des jüdischen Staates erneuern und sicherstellen, dass unsere Kinder nie wieder so leiden müssen wie die Menschen im Süden“,
sagte Prosor bei der Veranstaltung in Berlin. Angesichts des am 7. Oktober von der Hamas angefangenen Krieges feiere er mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Doch israelische Helden gäben ihm Hoffnung. Sie stünden im Zentrum des Empfanges. Dabei nannte er auch die vielen Israelis, die nach dem Terrorangriff der Hamas aus aller Welt nach Israel geflogen waren, um die Armee zu unterstützen.
Spezialitäten, Musik und Kunst aus Südisrael
Mehrere dieser „Helden des Südens“ waren bei der Veranstaltung zugegen. Zu ihnen gehört Rachel Edri aus dem Kibbuz Ofakim. Sie hatte den Terroristen, die in ihr Haus eindrangen, Essen und Trinken angeboten – und Schokoladenkekse. Daher sahen die palästinensischen Angreifer davon ab, auf sie zu schießen. Auch ihr
Sohn nahm an der Feier in Berlin teil. Der Polizist hatte am 7. Oktober geholfen, seine Familie zu schützen.
Die Gäste konnten sich persönlich vom guten Geschmack der Kekse überzeugen, die beim Empfang angeboten wurden. Zudem bereicherten Köche aus Be’eri und Kfar Asa das kulinarische Angebot.
Auch der DJ Jarin (Artifex) nahm an der Veranstaltung teil. Am Tag des Massakers hatte er beim Nova-Festival um 6.29 Uhr die Musik ausgeschaltet, weil der Raketenalarm losging. Er habe nicht gewusst, was wirklich geschehen würde und dass die Raketenangriffe nur zur Ablenkung dienten, sagte er gegenüber Israelnetz.
Weitere israelische Gäste waren der Koch Jaki und der Bierbrauer Izik aus dem Kibbuz Be’eri. Ben Nahum aus Schita präsentierte Produkte seiner Eismanufaktur. Der Graffiti-Künstler Benzi Brofman


Der DJ Jarin (o.) war ebenso in Berlin zu Gast wie der Graffiti-Künstler Brofman
gestaltete zwei Bilder, die den südisraelischen Helden gewidmet sind. Er hatte im November zu Ehren der Geiseln eine Hauswand in Berlin-Mitte mit dem Slogan „Bring them home now“ besprüht –„Bringt sie jetzt heim“.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth sagte in einem Grußwort, er

(v. l.) Drei Vertreter der Gastronomie aus Südisrael, DJ Jarin, Rachel mit den Keksen und ihr Sohn, Graffiti-Künstler Brofman, Botschafter Prosor mit seiner Frau Hadas sowie SPD-Politiker Roth
habe nach dem 7. Oktober viele Freunde verloren. Antisemitismus von rechts sei ihm bekannt gewesen. Komplett unterschätzt habe er hingegen den Antisemitismus „in meiner eigenen politischen Familie der Linken“. Das gelte auch für muslimisch oder in anderer Weise religiös motivierten Judenhass.
„Israel braucht unsere Nachhilfe nicht!“
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag äußerte sich auch zum Antisemitismus in der Kulturszene und bei Bildungseinrichtungen. Er frage sich: Was wäre, wenn in Kunst oder Bildungseinrichtungen ein Redner rassistische oder gegen die LGBTQIGemeinschaft gerichtete Parolen verbreitete? Würde dann immer noch auf Toleranz und Meinungsfreiheit gepocht?
Den Deutschen, die an guten Ratschlägen für den jüdischen Staat nicht sparen, rief er zu:
„Israel braucht unsere Nachhilfe nicht!“ Roth forderte einen klaren Appell, wenn Juden beschimpft oder gar angegriffen würden – ob von Alteingesessenen oder Neubürgern aus anderen Ländern: „Nie wieder in unserem Land!“ Der Vorwurf, in Israel würden Menschenrechte nicht geachtet, sei absurd: „Menschenrechte haben in Israel eine Heimat gefunden“, betonte Roth. Der Staat sei diesbezüglich ein Vorbild für Deutschland und Europa. |
Rachel's Cookies
240 g Mehl
90 g brauner Zucker
1 EL Zucker
1 EL Backpulver
2 Eier
160 g weiche Butter
230 g Schokoladenstückchen
Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Zutaten in einer großen Schüssel vermengen. Den Keksteig zu kleinen Kugeln mit einem Durchmesser von etwa 3 cm formen und leicht ab�achen. Die Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, dabei einen Abstand von 2 bis 3 cm zwischen den Keksen lassen. 14 Minuten backen und abkühlen lassen.




Eine der frühesten Landkarten von Palästina und Umgebung in hebräischer Sprache, veröffentlicht in Jerusalem 1908. Über den Verkauf wurden Spenden für den Fonds von Rabbi Meir gesammelt, eine wohltätige Einrichtung.
DPilgerberichte im Wandel der Zeit
Der bekannte Sachbuchautor Bernd Brunner hat unzählige Reiseberichte von Pilgern, Forschern und Verrückten gesammelt, die sich durch die Jahrhunderte vom Heiligen Land haben beeindrucken lassen. Herausgekommen ist ein wunderschönes, unterhaltsames und informatives Buch, bei dem man nebenbei viel über Israels Geschichte lernen kann.
Jörn Schumacher
as Heilige Land war immer schon ein Ort der Sehnsucht. Utopie und Verheißung zugleich. Für Fanatiker die Möglichkeit, die eigene religiöse Verrücktheit auszuleben, für Schriftsteller ein Ort, um die Bibel-Berichte mit der eigenen Erfahrung abzugleichen, für Naturforscher ein riesiges Betätigungsfeld. Bernd Brunner ist Autor vieler erfolgreicher Sachbücher. Dazu gehören „Die Erfindung des Nordens – Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung“, „Nach Amerika – Die Geschichte der

Aus dem Archiv der Biblischen Schule in Jerusalem: eine christliche Familie in festlicher Aufmachung, als Pilger in Jerusalem
deutschen Auswanderung“ und „Wie das Meer nach Hause kam. Die Erfindung des Aquariums“. Das neueste Buch trägt den Titel „Unterwegs ins Morgenland: Was Pilger, Reisende und
Abenteurer erwarteten, und was sie fanden“. Dafür hat er unzählige Reiseberichte gesichtet, von denen er die interessantesten Ausschnitte präsentiert. Der Blick der vielen Pilger auf das kleine, aber so bedeutende Land macht dieses Buch zugleich höchst unterhaltsam und informativ. So persönlich gefärbt die Berichte auch sind, mal freudig erregt, oft zutiefst enttäuscht, so lassen sie den Leser doch mit auf eine Reise gehen, auf eine Zeitreise.
Beginnend im 4. Jahrhundert, gibt der Autor etwa die Eindrücke einer Klosterfrau aus dem Benediktinerkloster von Monte Cassino wieder. Die Pilgerin war fast vier Jahre in Ägypten und im Heiligen Land unterwegs. Egeria, wie sie vermutlich hieß, benutzte dabei die Bibel als Reiseführer. „Anders als Rom“ sei Israel jahrhundertelang der Ort gewesen, wo die Gläubigen das Land der Bibel „be-greifen“ konnten, stellt Brunner fest: Sie konnten dort gehen, wo Jesus gegangen ist. Viele meinten, durch den Besuch sich ihrer Sünden entledigen zu können oder besonders „effektiv“ für das eigene oder das Heil anderer zu beten. Der Autor spricht eine interessante und noch heute relevante Frage an: Gibt es Orte, die heiliger sind als andere?
Erwartung versus Realität
Ab dem 19. Jahrhundert wurde Israel durch die zunehmenden Besucher aus Europa und Amerika zu einem eigenen literarischen Topos, schreibt Brunner: „Die Reise wurde zum Prüfstein für die Festigkeit des eigenen Glaubens.“ Erwartung und Realität klafften oft drastisch auseinander. Einige Pilger meinten gar, in muslimischen Arabern, die sie auf dem Land antrafen, biblische Gestalten wiederzuerkennen.
Die in Massen pilgernden Wallfahrer benötigten schon im Mittelalter Schutz, denn Räuberbanden kontrollierten die Wege zum und im Heiligen Land. Ostern 1120 sollen von einer 700 Seelen umfassenden Pilgergruppe 30 getötet und 60 gefangengenommen worden sein. Nachvollziehbar also die Gründung der Orden der Templer, der Franziskaner oder der Johanniter –sie waren die Pilger-Versicherung, und Brunner widmet ihnen ein eigenes Kapitel.
Natürlich darf in diesem Buch das „JerusalemSyndrom“ nicht fehlen. Brunner nennt mehrere solcher bizarr erscheinenden KurzzeitPsychosen, bei denen Israel-Reisende sich auf einmal in die Zeit der Bibel versetzt fühlen. Auch den sehr früh einsetzenden TouristenNepp in Sachen Reliquien beschreibt Brunner. Im Grunde wurden schon seit dem Mittelalter massenweise angebliche Stücke vom Kreuz, Nägel, Dornen, Knochen und so weiter an willfährige Touristen verkauft. Dem großen Thema widmet Brunner mit „Amulette, Knochensplitter und zweifelhafte Konterfeis“ daher ebenfalls ein eigenes Kapitel.
Anekdoten und Israel-Berichte von Prominenten
Brunner kann mit teilweise witzigen Anekdoten aufwarten. Da ist der Londoner Quäker George Robinson, der 1657 nach Jerusalem kam, um vor dem Herrscher der Stadt das Königreich Gottes auszurufen. Die Franziskaner wollten das Vorhaben verhindern. Einer verkleidete sich als islamischer Rechtsinhaber, empfing Robinson und bestätigte ihm, dass seine Verkündung rechtskräftig sei, worauf der Quäker zufrieden das Heilige Land wieder verließ. Auch Israel-Berichte Prominenter gibt Brunner wieder. Der „Moby Dick“-Autor Herman Melville etwa schrieb 1856 über die Versuche amerikanischer Missionare, Juden und Muslime zum Christentum zu bekehren: „Genauso gut könnte man versuchen, Ziegelsteine in Hochzeitstorten zu verwandeln, wie die Orientalen in Christen.“ Die englische Lady Hester Lucy Stanhop glaubte einem Insassen einer Londoner psychiatrischen Anstalt und wollte die Juden der Welt ins Land ihrer Vorfahren geleiten. Sie suchte in Aschkelon nach einem vergrabenen Goldschatz, und herrschte schließlich jahrzehntelang als eine Art Königin in den Bergen des Libanon und in Syrien, wo sie vereinsamt starb. Brunner erwähnt auch Berichte seriöser Forscher, wie den des amerikanischen protestantischen Theologen Edward Robinson, der als Begründer der biblischen Archäologie gilt. „Mit Bibel, Teleskop und Kompass“ traf er 1838 in
Jerusalem ein. Er identifizierte an der Umfassungsmauer des Tempelbergs einen Vorsprung als Überrest eines Bogens. Der „Robinson“Bogen ist Jerusalem-Touristen ein Begriff. Wie ein roter Faden zieht sich durch das Buch die aufkeimende Enttäuschung der Besucher, die voller Erwartungen Jerusalem betreten. Als 1849 Gustave Flaubert nach Jerusalem kam, war er geradezu angewidert: „Überall Ruinen, es riecht förmlich nach Grab und Verwesung; Gottes Fluch scheint über der Stadt zu liegen, der Heiligen Stadt von drei Religionen, die vor Langeweile, Entkräftung und Verlassenheit dahinstirbt.“ 1867 besuchte der Schriftsteller Mark Twain das Heilige Land, ihm ging es ähnlich: „Die Berge sind kahl, ihre Farben sind matt, ihre Form unansehnlich. Die Täler sind hässliche Wüsten, gesäumt von armseliger Vegetation, die aussieht, als würde sie sich ihrer Kargheit schämen. … Es ist das hoffnungsloseste, trostloseste, unglückseligste Land jenseits von Arizona.“ Brunners Buch endet mit dem Zionismus, dem Engagement Theodor Herzls und dem Plan

des britischen Außenministers Arthur Balfour 1917, eine „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ zu gründen. Durch das Buch zieht sich die Frage: Ist nun die Bibel der „beste Führer für das Heilige Land“ (wie der britische Verlag John Murray behauptete), oder ist doch eher das Heilige Land der beste Führer für die Bibel (der Baedeker Reiseführer)? Der Ulmer Dominikanermönch Felix Fabri war sich 1480 unsicher, ob er ins Heilige Land reisen soll. Graf Eberhard der Ältere von Württemberg, der schon Jerusalem besucht hatte, sagte ihm: „Drei Taten gibt es für den Menschen, bei denen ihm keiner zu- noch abraten soll. Die erste ist, eine Ehe zu schließen, die zweite, einen Krieg anzufangen, die dritte ist, ins Heilige Land zu fahren.“ Fabri machte die Reise dann sogar zwei Mal. Und stellte am Ende fest: „Ich behaupte ganz entschieden, dass sich jemand in 40 Wochen auf dieser Pilgerfahrt besser kennenlernt als sonst in 40 Jahren.“ |

Das Gemälde „Die Klagemauer“ (1904) vom schwäbischen Orientmaler Gustav Bauernfeind, der die letzten Jahre seines Lebens in Palästina verbrachte
Wie sich der deutsche Theologe Heinrich Bünting 1581 die Welt vorstellte: als Kleeblatt mit Jerusalem im Zentrum. Er war nie in Palästina, von seinem Reiseführer „Itinerarium Sacrae Scripturae“ erschienen aber mindestens 61 Ausgaben.

Bernd Brunner: „Unterwegs ins Morgenland: Was Pilger, Reisende und Abenteurer erwarteten, und was sie fanden“, Galiani-Berlin, 320 Seiten, 28 Euro, ISBN: 978-3869712529
Der Israel Kalender






CLASSIC EDITION ISRAEL 2025
Der kompakte Kalender zum
Aufklappen mit Platz für Notizen, im offenen Format von 34x48 cm.
9,95€
zzgl. Versand
Jetzt erhältlich in zwei Formaten shop.israelnetz.com
DESIGN EDITION ISRAEL 2025
Große Bilder mit einer großen Wirkung: Im Format von 42x42 cm tauchen Sie noch tiefer ein – in Israel, das Land der Wunder. Der Kalender verfügt über eine praktische Ringbindung und ist exklusiv bei Israelnetz erhältlich.
15,95€
zzgl. Versand



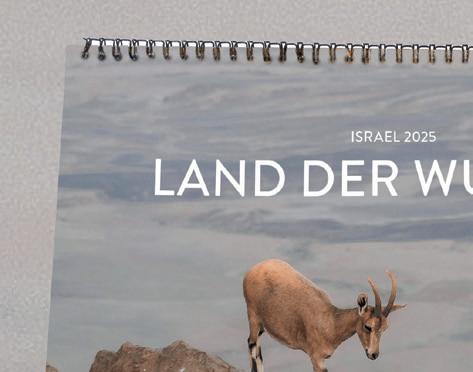





Die Kalender sind auf hochwertigem Papier gedruckt. Genießen Sie eindrucksvolle Motive und nutzen Sie das Kalendarium für individuelle Einträge. Das Kalendarium enthält neben den christlichen und gesetzlichen Feiertagen auch die jüdischen Festtage mit einer kurzen Erklärung.

