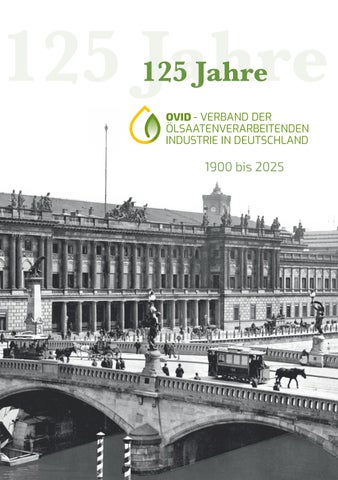125 Jahre

1900 bis 2025
125 Jahre OVID
1900 bis 2025
















Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86263-217-6
Alle in diesem Buch enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben und Hinweise ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages, der Herausgeber oder der Autoren. Diese übernehmen deshalb keinerlei Haftung.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Foto auf der Titelseite zeigt die Berliner Börse in der Burgstraße 25/26, dem Gründungsort des Verbands. Das Gebäude wurde von 1859 bis 1863 von Friedrich Hitzig im Stil der Neorenais-sance errichtet.
Konzept, Recherche, Text: Dipl. Ing. Alexander Faridi & Dr. rer. pol Marc Engels, Engels & Faridi GbR Projektmanagement OVID: Dr. Ulrich Hettinger Geschäftsführung OVID: Dr. Gerhard Brankatschk, Dr. Momme Matthiesen
©2025 ERLING Verlag GmbH & Co. KG
mail@erling-verlag.com www.erling-verlag.com
Lektorat: Beate Carle
Artwork: Helge Putzier
Gedruckt in Deutschland
Der Inhalt dieses Buches ist auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier gedruckt, hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff aus FSC-zertifiziertem Holz.
1900 bis 1914: GRÜNDUNG UND ERFOLG
EIN TAG IM FRÜHLING
Der 19. April 1900 ist ein heiterer Frühlingstag. Wie üblich herrscht an diesem Donnerstag auf den Straßen Berlins reges Treiben. In der Burgstraße am Ufer der Spree, nur einen Steinwurf vom Reichstagsgebäude entfernt, bestimmen Kutschen und Pferdeomnibusse die Szenerie; Automobile sieht man kaum, ihre große Zeit steht noch bevor.
Vor dem mächtigen Eingangsportal der Berliner Börse treffen die geladenen Gäste aus dem ganzen Deutschen Kaiserreich ein. Man kennt sich, man begrüßt sich. Es sind allesamt Inhaber oder Direktoren von Ölmühlen, sie kommen aus Berlin, Breslau, Hamm oder Hamburg, aus Köln, Mannheim oder Neuss. Viele von ihnen haben eine lange, strapaziöse Anreise hinter sich.
EINE NACHRICHT WERT
Der Anlass für ihre heutige Zusammenkunft? Im prächtigen Versammlungssaal der Börse werden sie in Kürze den Verband der deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinschaftlichen Interessen (VDOe) gründen.
Rund 60 Ölmühlen sind vertreten, kleinere und große, bekannte Traditionsunternehmen ebenso wie Branchenneulinge, die sich anschicken, auf dem vielfältigen Markt der Ölsaatenverarbeitung Fuß zu fassen.
Das feierliche Ereignis ist auch den großen Tageszeitungen eine Nachricht wert. Noch am gleichen Tag berichtet beispielsweise die Berliner Börsen-Zeitung in ihrer Abendausgabe:
»Die Oelmüller Deutschlands, und zwar diejenigen aller Branchen für Rüböl, Leinöl, Palmkernöl etc., waren heute aus dem Westen, Osten, Süden und Norden unseres Reiches hier zusammengetreten, um einen Verband zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen zu gründen.«1
SINNBILDLICH
40 Jahre zuvor feierlich eingeweiht, steht die imposante, im Stil der Neorenaissance gehaltene Börse nahe der Friedrichsbrücke sinn-
1 Berliner Börsen-Zeitung, Abendausgabe, Donnerstag, 19. April 1900; Handels-Zeitung des Berliner Tageblattes, Donnerstag, 19. April 1900.
bildlich für das ökonomisch aufstrebende Kaiserreich. Um die Jahrhundertwende ist Berlin nach New York und London einer der drei wichtigsten Finanzplätze der Welt. Ohne Frage: Aus der Perspektive der Verbandsgründer bietet der gewaltige Repräsentativbau in BerlinMitte den angemessenen Rahmen für ihre feierliche Versammlung.
HOCHKARÄTIG
Für Kenner ist die Liste der Sitzungsteilnehmer absolut hochkarätig. Alles, was Rang und Namen hat, ist erschienen. Fast die gesamte Branche ist versammelt. Unter den Gründungsmitgliedern befinden sich die bedeutendsten Ölmühlen des Kaiserreichs, zusammen vereinen sie rund 80 % der in Deutschland verfügbaren Produktionskapazitäten. Viele der anwesenden Ölmühlen blicken auf eine lange Geschichte zurück, ihre Ursprünge reichen teils weit zurück bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts. Das Neusser Traditionsunternehmen C. Thywissen gehört als Gründungsmitglied noch heute, nach 125 Jahren, dem Verband an.
DER ERSTE VORSTAND
Nach der konstituierenden Generalversammlung tritt noch am Abend der 17-köpfige Vorstand des VDOe zusammen und bestimmt den Berliner Unternehmer Paul Herz zu seinem Vorsitzenden.2 Der 46-jährige Kommerzienrat entstammt einer traditionsreichen jüdischen Kaufmannsfamilie. In deren Besitz befinden sich mehrere Firmen, darunter eine Getreidegroßhandlung, eine Gummifabrik und eine 1823 in Wittenberge an der Elbe gegründete und von Paul Herz geleitete Ölmühle. Dieser Mühle, die sich auf die Herstellung von technischen Ölen versteht, ist eine Ölhandelsgesellschaft angeschlossen; das spezialisierte Handelshaus in Wittenberge ist das erste dieser Art in Deutschland.3
MITSTREITER
Dem Vorstandsvorsitzenden Paul Herz werden zwei erfahrene Mitstreiter zur Seite gestellt. Zu seinem ersten Stellvertreter wird Kom-
2 Berliner Börsen-Zeitung, Donnerstag, 17. September 1925.
3 Hierzu ausführlich: Heinz Muchow, Wie sich das Ackerbürgerstädtchen Wittenberge zu einer Industriestadt entwickelte. Die wichtige Etappe der Stadtgeschichte vom 19. Jahrhundert bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts, 2001, S. 10-18.
merzienrat Otto Hubbe bestimmt, Besitzer der Palmölkernfabrik Gustav Hubbe GmbH in Magdeburg. Arnold Willemsen bekleidet das Amt des zweiten Stellvertreters; Willemsen ist geschäftsführender Gesellschafter der auf die Herstellung von Rohleinöl und Leinkuchen spezialisierten Ölmühle Holtz & Willemsen in Uerdingen.4
DIE ARBEIT BEGINNT
Die Anfänge des jungen Verbandes nehmen sich eher bescheiden aus, eigene Büroräume gibt es nicht. Der VDOe beginnt seine Tätigkeit in den Räumen des Zentralbüros der Firma Herz in der Dorotheenstraße 2 in Berlin-Mitte.5 Weitere Mitarbeiter? Fehlanzeige. Erst ein gutes Jahr später, als Verbandssekretär Theodor Gritzka eingestellt wird,6 erhält der Vorstandsvorsitzende Paul Herz Verstärkung. Immerhin: Die Adresse des VDOe befindet sich nur wenige Schritte vom Spreeufer und nur einige hundert Meter entfernt vom Reichstagsgebäude. Hier – inmitten des politischen Zentrums des Kaiserreichs – sind die Wege kurz, eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit eines soeben gegründeten Wirtschaftsverbandes, der sich erst noch etablieren muss.
MEHR SCHLAGKRAFT
Eine eigene Geschäftsstelle gibt es erst 1916, als sich der Verband angesichts der vielen kriegsbedingen Aufgaben neu aufstellt. Im Zuge dessen wird auch die Stelle eines hauptamtlichen Geschäftsführers geschaffen. Besetzt wird die zentrale Position mit dem Rechtsanwalt Heinrich Willemsen, dem Bruder des stellvertretenden Vorsitzenden. Heinrich Willemsen wird die Geschicke des Verbandes und seiner Nachfolgeorganisationen bis zu seinem Tod im Jahr 1957 maßgeblich prägen.
Am 22. Juli 1917 beschließt die Generalversammlung, den VDOe in einen Verein umzuwandeln. Unter leicht verändertem Namen – an die Stelle der »gemeinschaftlichen« treten die »gemeinsamen« Interessen – wird der VDOe am 23. Januar 1918 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-Mitte unter der Nummer 2122 eingetragen.
4 Die deutsche Oelmühlen-Industrie (kurz: Festschrift): Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V., Berlin 1925, S. 11.
5 Vgl. z. B. Berliner Adreßbuch 1913, hier: I. Band, S. 1150.
6 Festschrift, S. 15.
Mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer, einer leistungsfähigen Geschäftsstelle und in einer festen Rechtsform entwickelt der VDOe e. V. noch mehr Schlagkraft.
BOULEVARD
Die neuen Büroräume liegen in der Mittelstraße 53/54, noch etwas näher zum Reichstagsgebäude und zum prachtvollen Boulevard Unter den Linden. Im selben Haus befindet sich laut Berliner Adressbuch auch die neue Anschrift von Heinrich Willemsen, der eine Wohnung oberhalb der Geschäftsstelle bezogen hat. Sicherlich verstärkt sich der junge Verband auch personell durch Schreib- oder Hilfskräfte, für die nun in den neuen Büros Arbeitsplätze eingerichtet werden können.
UMTRIEBIG
Was zunächst vielleicht wie ein eher zaghafter und bescheidener Anfang anmutet, ist alles andere als das. Der Verband, in dessen Branche zum Zeitpunkt seiner Gründung rund 7.000 Menschen in Lohn und Brot stehen,7 ist umtriebig und beginnt sogleich mit der Arbeit. Großen Raum nehmen die Bemühungen ein, den laufend drohenden Zollerhöhungen auf die Einfuhren von Ölsaaten entgegenzuwirken, die den Ölmühlen das Leben zunehmend erschweren.
PAUKENSCHLAG
Aber was mag die 60 Unternehmen vor 125 Jahren zur Gründung des VDOe bewogen haben? Hier lohnt ein Blick zurück in das Jahr 1898: Wer Mitte Juli 1898 die Tageszeitungen aufschlägt, stößt immer wieder auf eine Nachricht, die für reichlich Zündstoff sorgt. Gleich mehrere Zeitungen vermelden unter Berufung auf das Berliner Tageblatt, dass eine Novelle des 20 Jahre alten Zolltarifgesetzes und damit eine Ausarbeitung neuer Zolltarife bevorstehe. Das Berliner Tageblatt will aus zuverlässiger, aber nicht namentlich genannter Quelle sogar erfahren haben, dass im Reichsschatzamt „die Arbeiten für den Entwurf eines Zolltarifs […] schon seit einiger Zeit im Gange sind, die Festsetzung bestimmter Zollsätze ist aber bisher noch nicht erfolgt.“8
7 Berliner Tageblatt, Mittwoch, 25. Dezember 1901.
8 Berliner Tageblatt, Abendausgabe, Dienstag, 19. Juli 1898; vgl. z. B. auch: Hamburgischer Correspondent, Morgenausgabe, Mittwoch, 20. Juli 1898.
Diese Meldung gleicht einem Paukenschlag. In vielen Unternehmen geht die berechtigte Sorge um, dass die bevorstehende Novelle vor allem der deutschen Landwirtschaft sowie der Eisen- und Stahlindustrie der mächtigen Ruhrbarone in die Hände spielen wird.
DEBATTE
Mit dem »alten« Zolltarifgesetz steht ein Gesetz zur Disposition, das rund 20 Jahre zuvor am 12. Juli 1879 im Reichstag durch eine Mehrheit von konservativen Abgeordneten und der Zentrumspartei angenommen wird. Demnach sind Zölle auf Einfuhren nahezu aller wichtiger Güter vorgesehen, vor allem auf Roheisen und Getreide.9
Die sich 1898 entzündende Debatte um die Novelle des Zolltarifgesetzes wird fast vier lange Jahre andauern. Diese handelspolitische Auseinandersetzung bildet den Rahmen, in den die Gründung des VDOe eingebettet ist.
KOMETENHAFT
Die Jahrzehnte nach der Reichsgründung im Jahr 1871 sind durch die Integration Deutschlands in den rasch wachsenden internationalen Welthandel geprägt. Nicht von ungefähr wird in diesem Zusammenhang von einer weiteren Globalisierungsphase gesprochen.10 Deutschland erlebt bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen kometenhaften Aufstieg und verdrängt bis 1913 sogar das Vereinigte Königreich als größten Exporteur der Welt.11
Die mit dem Gründerkrach – den dramatischen Börsenkurseinbrüchen von 1873 – einsetzende Wirtschaftskrise, die starke britische Industriekonkurrenz und die Einfuhren von billigem russischem und nordamerikanischem Getreide führen dazu, dass die Stimmen gegen die bisher verfolgte Freihandelspolitik immer lauter werden.
BESIEGELT
Reichskanzler Otto von Bismarck leitet schließlich 1877 eine Schutzzollpolitik ein. Diese verfolgt vor allem das Ziel, die heimische Wirt-
9 Andreas Etges, Wirtschaftsnationalismus: USA und Deutschland im Vergleich (1815-1914), Frankfurt a. M./New York 1999, S. 270.
10 Vgl. Nikolaus Wolf, Deutschland in der ersten Globalisierung, in: Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs ab 1871 – Lehren für die heutige Zeit?, in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg. 2021, Heft 4, S. 254-258.
11 Hierzu ausführlicher z. B. Werner Plumpe, Ein wilhelminisches Wirtschaftswunder?, in: Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs ab 1871 – Lehren für die heutige Zeit?, in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg. 2021, Heft 4, S. 250-253.
schaft, und hier insbesondere die Eisen- und Stahlindustrie sowie die Landwirtschaft, zu schützen. Das Kaiserreich steht damit nicht alleine da, fast alle europäischen Staaten wenden sich dem Protektionismus zu – lediglich Großbritannien bleibt hier die Ausnahme. Mit der Verabschiedung des Zolltarifgesetzes ist das Ende des klassischen Freihandels besiegelt. Ein umfassender Protektionismus steht nun fast überall auf der Tagesordnung, er wird zum Normalzustand. Auch als in den 1890er Jahren die gesamteuropäische Wirtschaftskrise überwunden ist, bleibt die Rückkehr zur früheren Freihandelsordnung aus.
RIVALITÄT
Zollfragen prägen die Wirtschafts- und Handelspolitik im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Sie werden im Parlament sowie in den Medien ausgiebig und kontrovers diskutiert. Zahlreiche unternehmerische Interessenverbände gründen sich. Sie sehen die Chance und die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit und Entscheidungsträger von ihren Positionen zu überzeugen. Dies ist der Beginn des organisierten Lobbyismus in Deutschland.12 Prominente Beispiele liefert hier die Eisen- und Stahlindustrie: 1869 schließen sich 14 Gießereibetriebe zum Verein deutscher Eisengießereien zusammen. Fünf Jahre später wird der Verein Deutscher Eisenund Stahlindustrieller ins Leben gerufen. Und 1876 folgt der Centralverband deutscher Industrieller. In diesen Verbänden sammeln sich vor allem die an Schutzzöllen und Kartellierung interessierten Grundstoffindustrien. Die dort vertretenen Positionen stehen allerdings den Interessen der verarbeitenden Industrie entgegen. Sie organisiert sich schließlich im Jahr 1895 als Gegenkraft im Bund der Industriellen 13
VERORTUNG
Das Spektrum der wirtschaftspolitischen Überzeugungen, die durch die Branchenverbände vertreten werden, ist breit gefächert und reicht
12 Vgl. hierzu eingehend: Werner Bührer, Geschichte und Funktion der deutschen Wirtschaftsverbände, in: Wolfgang Schroeder/Bernhard Weßels (Hrsg.), Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Wiesbaden 2017, S. 53-83; Ralf Kleinfeld, Die historische Entwicklung der Interessenverbände in Deutschland, in: Thomas Winter, Ulrich Willems: Interessenverbände in Deutschland, 2007, S. 51-83.
13 Vgl. auch: Achim Knips, Deutsche Arbeitgeberverbände der Eisen- und Metallindustrie 1888-1914, Stuttgart 1996.
von einem Extrem zum anderen, von protektionistisch bis freihändlerisch.
Wo in dieser zollpolitisch komplexen Landschaft lassen sich die Interessen der Ölmühlen verorten? Eine eindeutige Antwort fällt nicht leicht: Die ölsaatenverarbeitende Industrie befindet sich in einer komplizierten Lage. Die produzierten Öle, Fette oder Futtermittel gelangen fast ausschließlich auf den deutschen Markt, der Export spielt nur eine untergeordnete Rolle. Sie hat ein starkes Interesse daran, die Einfuhren von billigeren Konkurrenzprodukten vom deutschen Markt fernzuhalten, ihn zu schützen.
Zugleich sind die Mühlenbetriebe von Rohstoffimporten aus der ganzen Welt abhängig. Erdnüsse, Kopra und Palmkerne kommen aus den britischen und französischen Kolonien in Afrika und Asien, Leinsaat aus Argentinien.
Um die Jahrhundertwende werden 60 % der benötigten Rohstoffe aus dem außereuropäischen Ausland bezogen und rund 25 % aus Europa. Lediglich 15 % der Ölsaaten, die in den Mühlen verarbeitet werden –darunter Raps oder Sonnenblumenkerne – stammen aus heimischem Anbau.
Die Mühlenbetreiber müssen also dafür Sorge tragen, dass die für ihre Produktion erforderlichen Rohstoffe aus dem Ausland ausreichend fließen. Dies führt immer wieder dazu, dass die Ölmühlen in teils heftige Kontroversen mit der deutschen Landwirtschaft geraten: ein Interessenkonflikt, der im Zeitverlauf noch häufiger zum Vorschein kommt.
BALANCEAKT
Es lässt sich bereits erahnen: Als im Jahr 1898 die Diskussionen um die Novelle des Zolltarifgesetzes beginnen, steht den Ölmühlen ein schwieriger Balanceakt bevor. Denn der Versuch einer Einflussnahme auf die Ausgestaltung neuer Zolltarife benötigt Fingerspitzengefühl, einen langen Atem und vor allem einflussreiche Kräfte. Lange vor der Gründung des VDOe sind die Ölmühlen nur vereinzelt in handels- bzw. zollpolitischen Fragen aktiv. Im Dezember 1884 – so berichtet die Festschrift, die anlässlich des 25-jährigen Bestehens des VDOe im Juli 1925 erscheint14 – kommt es zu einer ersten »gemeinsa-
14 Vgl. hierzu: Berliner Börsen-Zeitung, Donnerstag, 2. Juli 1925.
men Aktion«, als bei einer Versammlung deutscher Ölmüller eine Petition an den Reichstag adressiert wird, »die sich gegen die von landwirtschaftlicher Seite beantragten Zollerhöhungen auf ausländische Ölfrüchte, speziell Raps und Rüben, richtete.«15 Solche Eingaben gibt es in den nachfolgenden Jahren zwar immer wieder,16 es handelt sich hierbei allerdings eher um einzelne, zögerliche Versuche, den Interessen der Ölmühlen auch auf politischer Ebene Gehör zu verschaffen.
GERÜCHTE
Im Sommer 1898 ist jedoch alles anders: Als erste Meldungen zur Überarbeitung des Zolltarifgesetzes durchsickern, spitzt sich die Lage zu. Rasch mehren sich die Gerüchte, dass die Novelle auch weitreichende Folgen für die Ölmühlen haben werde. Es drohen – wie die Festschrift unterstreicht – höhere Zölle auf die Einfuhren von Ölsaaten und Ölkuchen.17 Andererseits bietet die Neugestaltung der Tarife die Chance, die bestehenden Schutzmauern gegen die ausländische Konkurrenz zu erhöhen oder auszubauen.
122 UNTERSCHRIFTEN
Dieses Ziel verfolgt beispielsweise die Petition, die im November 1898 an den Bundesrat geht, dessen Zustimmung für das Inkrafttreten des neuen Zolltarifgesetzes erforderlich ist. In dieser Eingabe fordern die Ölmühlen den Bundesrat auf, durch Zollerhöhungen die Einfuhr insbesondere von amerikanischem Baumwollsamenöl zu erschweren und für denaturierte Öle keine Ermäßigungen mehr zu gewähren.18 Die Petition sticht unter allen anderen hervor und stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Sie trägt die Unterschriften von insgesamt 122 deutschen Ölmüllern, fast die gesamte Branche spricht hier erstmals mit einer Stimme. Dieses denkwürdige Ereignis entgeht auch der Presse nicht. Prompt wird in der Rheinischen Volksstimme am 30. November 1898 gemutmaßt:
15 Festschrift, S. 2
16 Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Morgen-Ausgabe, Donnerstag, 19. März 1896; Berliner BörsenZeitung, Abend-Ausgabe, Mittwoch, 3. Februar 1897.
17 Festschrift, S. 11.
18 Rheinische Volksstimme, Sonntag, 27. November 1898.
»Es dürfte nicht ausgeschlossen sein, daß die Oelindustriellen, dem Beispiele der Landwirte folgend, sich in absehbarer Zeit auch einmal vereinigten.«19
Tatsächlich soll nicht mehr lange dauern, bis diese Vermutung Wirklichkeit wird: Im März 1900 nimmt eine Versammlung der Ölmühlen einstimmig den Vorschlag an, »einen Verband deutscher Ölmüller zu gründen, der die Interessen der Mitglieder nach innen und nach außen zu wahren habe.«20 Nur wenig später werden die Einladungsschreiben für die konstituierende Sitzung in der Berliner Börse am 19. April versendet.21
EINGREIFEN
Der frisch gegründete Verband greift umgehend in die laufenden Verhandlungen über die Novellierung des Zolltarifgesetzes ein. Er fordert beispielsweise, wie das Berliner Tageblatt in seiner Ausgabe vom 25. Dezember 1901 berichtet, den Reichstag durch eine Petition dazu auf, »die in dem Zolltarifentwurf vorgesehene Zollerhöhung für Rapssaat und Rübsen von 2 auf 3 Mark sowie die Einführung eines Zolls auf Leinsaat von 0,75 Mark pro Doppelcentner ablehnen zu wollen.« Ansonsten werde »ein größerer Theil dieses Gewerbes gezwungen werden, den Betrieb einzuschränken oder gar einzustellen […].«22
ERRUNGENSCHAFTEN
Als das neue Zolltarifgesetz nach 13 zähen Verhandlungsmonaten und unzähligen Sitzungen schließlich am 14. Dezember 1902 im Reichstag verabschiedet wird,23 verstummen auch die Diskussionen nach und nach.
Dies hat Einfluss auf die Verbandsarbeit des VDOe. Fortan bestimmen andere Themen die Agenda: Bei den Frachtverhältnissen beispielsweise werden wichtige Fortschritte erzielt, darunter auch die nach jahrelanger Verhandlung erreichte Zulassung sämtlicher Ölsaaten für die Kesselverladung.24 Gerade dies ist im Hinblick auf den Versand in großem Maßstab eine zentrale Errungenschaft.
19 Rheinische Volksstimme, Mittwoch, 30. November 1898.
20 Festschrift, S. 2.
21 Festschrift, S. 2.
22 Berliner Tageblatt, Mittwoch, 25. Dezember 1901.
23 Andreas Etges, Wirtschaftsnationalismus: USA und Deutschland im Vergleich (1815-1914), Frankfurt a. M./New York 1999, S. 280.
24 Festschrift, S. 15.
Darüber hinaus widmet sich der VDOe zunehmend der Aufgabe, die vielen, teils einander widerstrebenden Interessen der Ölmühlen zusammenzuführen, um sich als gemeinsame Stimme der Branche zu etablieren. Der Erfolg ist eher mäßig, wie die Kölnische Zeitung am 29. Juni 1905 bescheinigt: Trotz aller Bemühungen »konnte die Bildung von besonderen örtlichen Vereinigungen nicht verhindert werden«.25
Dem VDOe gelingt es in den ersten Jahren offenbar nicht, insbesondere kleinere, eher lose Interessenvertretungen einzubinden, die vornehmlich auf regionaler Ebene agieren und partikulare Interessen verfolgen.
FÜRSPRECHER
Zollfragen, so berichtet die Festschrift, geben hingegen nur noch »vereinzelt Anlass zur Wahrung der Interessen der Ölmühlen-Industrie«.26 Doch dort, wo dies dem VDOe erforderlich erscheint, findet er immer wieder auch auf höchster politischer Ebene Fürsprecher.
Am 23. Februar 1910 beispielsweise greift der Reichstagsabgeordnete der Nationalliberalen Partei und spätere Reichskanzler Gustav Stresemann eine Petition des VDOe in seiner Reichstagsrede auf.
In dieser Rede klingt das ganze Dilemma der deutschen Zollpolitik an: Sie ist ein langwieriger Aushandlungsprozess zwischen vielen, teils stark divergierenden Interessen, in dem nur wenig Gestaltungsfreiheit bleibt. Unter ausdrücklichem Verweis auf die Eingabe des VDOe führt der junge Abgeordnete aus:27
»Eine Bitte habe ich noch auf diesem Gebiet der Handelspolitik anzusprechen, das ist die Eingabe des Verbandes der deutschen Ölmühlen sowie der Handelskammern in Neuß und Darmstadt wegen der Einfuhr zollfreier Sojabohnen. Es wird darauf hingewiesen, daß England dieses Produkt zollfrei einläßt, daß es hiervon 400.000 Tonnen einführt, und daß die deutschen Ölmühlen, die dessen sehr bedürfen, durch den Zoll, den wir darauf haben, in ihrer Konkurrenz sehr geschwächt werden. Ich weiß ja, daß die Regierung große Abneigung dagegen hat, überhaupt an dem Gefüge des Zolltarifs etwas zu ändern; aber vielleicht lässt sich hier durch Versetzung in eine andere Position die Möglichkeit einer zollfreien Einfuhr schaffen.«28
25 Kölnische Zeitung, Beilage zur Abendausgabe, Donnerstag, 29. Juni 1905.
26 Festschrift, S. 12.
27 Vgl. auch: Beilage zum Amts- und Anzeigenblatt für den Bezirk des Amtsgerichts Eibenstock und Umgebung vom 13. März 1910.
28 Verhandlungen des Reichstags, XII. Legislaturperiode, II. Session, Stenographische Berichte, Band 259, von der 23. Sitzung am 25. Januar 1910 bis zur 43. Sitzung am 24. Februar 1910, Berlin 1910, S. 1460.
HAMBURG, ANTWERPEN UND ROTTERDAM
Nachdem die Debatte um die Novelle des Zolltarifgesetzes abklingt, liegt die »Haupttätigkeit des Verbandes der Deutschen Ölmühlen«, so die Festschrift, »auf dem rein wirtschaftlichen Gebiete, insbesondere in dem Bestreben, den Mitgliedern mehr und mehr Schutz gegenüber den Rohstofflieferanten zu gewähren«.29 Konkret bedeutet dies, dass der VDOe in schneller Abfolge an den für die deutschen Ölmühlen wichtigen Umschlagplätzen von Ölsaaten –in den Häfen von Hamburg, Antwerpen und Rotterdam – sogenannte Kontrollbüros einrichtet, die direkt vor Ort die Qualität und Abwicklung der zwischen seinen Mitgliedern und den Rohstoffhändlern geschlossenen Kontrakte überprüfen.30
Dabei handelt es sich in der Regel um standardisierte Kontraktformulare, in denen die Rechte und Pflichten der Transaktionspartner im Hinblick auf die Qualität der Ware sowie auf Lieferzeit, Lieferart und -ort oder Zahlungsmodalitäten festgelegt sind.
TONANGEBEND
Solche Kontrakte werden in der Regel nicht direkt zwischen Hersteller und Rohstoffempfänger ausgehandelt, sondern über große Exporthäuser, die dem Handel zwischengeschaltet sind. Tonangebend sind zu damaliger Zeit vor allem die Vertragsbestimmungen der Incorporated Oil Seed Association (IOSA) mit Sitz in London.31 Insbesondere der Handel mit den seinerzeit so wichtigen britischen Importeuren, die große Bereiche des weltweiten Ölsaatenhandels dominieren, wird über IOSA-Kontrakte abgewickelt, so beispielsweise die Importe von Sesamsaaten aus China32 oder Leinsaaten aus Indien.33 Zunächst laufen die Versuche des VDOe, auf die Arbeit der IOSA zugunsten der eigenen Mitglieder Einfluss zu nehmen, ins Leere, denn Firmen, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, ist eine Mitgliedschaft in der IOSA verwehrt.
29 Festschrift, S. 12.
30 Festschrift, S. 12-13.
31 Ernst Feld, Die deutsche Margarine-Industrie, Dissertation Marburg 1921, Marburg 1922, S. 92-93.
32 Arnold Otting, Die Stellung Hamburgs in der Organisation des Welthandels mit pflanzlichen Ölrohstoffen und den Erzeugnissen der Ölmüllerei, Berlin 1925, S. 23.
33 Gustav Hefter, Technologie der Fette und Öle. Handbuch der Gewinnung und Verarbeitung der Fette, Öle und Wachsarten des Pflanzen- und Tierreiches, II. Band: Gewinnung der Fette und Öle, spezieller Teil, Berlin/Heidelberg 1908, S. 12.
KONTAKTE UND KONTRAKTE
Im internationalen Vergleich handelt es sich bei der IOSA zwar um eine relativ kleine Organisation, sie hat jedoch im weltweiten Rohstoffhandel mit Ölsaaten eine enorme Bedeutung. Nicht nur bilden die IOSA-Kontraktformulare die Grundlage für den Handel mit britischen Importeuren: Die IOSA agiert im Fall von Streitigkeiten zwischen den Kontraktpartnern auch als Schiedsgericht und gewinnt durch diese Funktion beachtliches Gewicht.34
Als sich die IOSA im Jahr 1906 auch für ausländische Unternehmen öffnet, wirbt der VDOe sogleich stark für die Mitgliedschaft. Und das mit durchschlagendem Erfolg: Bis zum Jahr 1914 tritt mehr als ein Drittel der 102 VDOe-Mitglieder der ISOA bei.35
INTERNATIONALISIERUNG
Trotz aller Anstrengungen des VDOe ist dem Versuch einer direkten Einflussnahme auf die IOSA nur wenig Erfolg beschert. Als zu stark erweist sich die traditionell ausgeprägte Machtposition der sogenannten Ablader, also jener Unternehmen, die für die Verpackung, Verladung und Versendung der Ölsaaten zuständig sind.
Flankierend treibt der VDOe deshalb die europäische Vernetzung voran. Die Bemühungen fruchten, sodass schließlich auf Betreiben des VDOe zahlreiche Ölmühlen aus ganz Europa die Gründung einer eigenen Interessenvertretung anstreben.36 Dies soll den Ölmühlen insbesondere in den Verhandlungen mit der IOSA mehr Gewicht verleihen, um auf internationale Kontraktbestimmungen bzw. -standards einzuwirken.
Den entscheidenden Anstoß geben offenbar anhaltende Schwierigkeiten mit Rohstofflieferanten aus Übersee. Um welche Missstände es sich dabei genau handelt, rückt die Kölnische Zeitung im Mai 1912 ins Licht: Veranlasst wird der Zusammenschluss »durch die unbefriedigende Erledigung von Saatkontrakten durch ausländische Ablader, namentlich durch indische Verkäufer, die ihre Macht zu sehr ausnützten«.37
34 Christopher A. Casey, Nationals Abroad – Globalization, Individual Rights, and the Making of Modern International Law, Cambridge 2020, S. 151.
35 Festschrift, S. 14.
36 Festschrift, S. 14.
37 Kölnische Zeitung, erste Morgen-Ausgabe, Mittwoch, 1. Mai 1912; vgl. hierzu auch: Handels-Zeitung des Berliner Tagesblatts, Abendausgabe, Dienstag, 30. April 1912.
STOSSRICHTUNG
Vorbereitend kommen am 2. März 1912 Ölmühlen aus ganz Europa in Köln zusammen, um über die Gründung einer solchen internationalen Vereinigung zu beraten.38 Eine gemeinsame Erklärung benennt dabei auch gleich die Stoßrichtung des künftigen Verbandes: Die Anwesenden sind sich darüber einig, so die Kölnische Zeitung am 11. März 1912, dass »auf dem Gebiet des internationalen Saathandels erhebliche Missstände vorhanden sind, die der Abhilfe dringend bedürfen«.39
SCHLAGKRÄFTIG
Wenige Wochen später ist es so weit: Im April 191240 wird in Brüssel das Internationale Komitee zur Wahrung der Interessen der europäischen Oelmüller41 ins Leben gerufen. Neben Deutschland treten Ölmühlen unter anderem aus England, Frankreich und Italien sowie aus Belgien, Holland und Skandinavien dem Komitee bei.
Von Anfang an gelingt es dem VDOe, personell großen Einfluss zu gewinnen. Auf der konstituierenden Sitzung des Komitees wird der Vorstandsvorsitzende des VDOe, Kommerzienrat Paul Herz, zum Präsidenten des Präsidiums bestimmt.42 Derart gut vernetzt avanciert der VDOe auch auf internationaler Ebene zu einem wichtigen Akteur. In den kommenden zwei Jahren gehört es zu seinen Hauptaufgaben, auf konkrete Vertragsklauseln der IOSA, wie zum Beispiel bei Streikfragen, Qualitätsanalysen oder Schiedsgerichtsverfahren, Einfluss zu nehmen.43 Hier erweist sich das Komitee als schlagkräftiges Instrument, um auf die Ausgestaltung der Kontraktbestimmungen beim weltweiten Rohstoffhandel nachhaltig einzuwirken.44 Dieser Erfolg ist jedoch nur von kurzer Dauer. Der Erste Weltkrieg setzt der internationalen Zusammenarbeit ein jähes Ende.
VIELVERSPRECHEND
Der VDOe steht im Sommer 1914 hervorragend da. Der Verband ist etabliert, die Zahl der Mitgliedsfirmen ist von 60 auf 102 gestiegen. In zwei
38 Festschrift, S. 9.
39 Kölnische Zeitung, Abend-Ausgabe, Mittwoch, 11. März 1912.
40 Kölnische Zeitung, erste Morgen-Ausgabe, Mittwoch, 1. Mai 1912.
41 Chemische Revue über die Fett- und Harzindustrie, 19 (1912), Heft 8, S. 190-192.
42 Handels-Zeitung des Berliner Tagesblatts, Abendausgabe, Dienstag, 30. April 1912.
43 Kölnische Zeitung, erste Morgen-Ausgabe, Mittwoch, 1. Mai 1912.
44 Festschrift, S. 14.
wichtigen Aufgabenbereichen, bei Zollfragen und Kontrakten, weist der VDOe konkrete Erfolge vor. Zudem ist er bestens vernetzt, international anerkannt und einflussreich. Er vertritt eine ölsaatenverarbeitende Industrie, die rasant wächst. Der Blick in die Zukunft ist vielversprechend, denn Hochindustrialisierung und steigender Lebensstandard verleihen der Nachfrage nach technischen Ölen und Speiseölen, nach Fetten für Seifen und Reinigungsmittel eine enorme Dynamik.
Der wachsende Bedarf kann jedoch nur durch die konsequente Einbindung Deutschlands in den Weltmarkt für Ölsaaten gedeckt werden. Der VDOe hat einen großen Anteil daran, dass dies bisher reibungslos gelingt.
1914 – 1945: KRISEN UND KRIEGE
ENDE EINER ÄRA
Der Erste Weltkrieg bedeutet für den Verband und seine Mitgliedsfirmen einen schwerwiegenden Einschnitt. Er beendet eine Ära der Globalisierung, die auf einem verhältnismäßig freien Welthandel beruht. Schlagartig verändert sich damit auch die Arbeit des VDOe.45 Mangelverwaltung und Krisenbewältigung bestimmen die Agenda der Industrie und ihres Verbandes in den nächsten Jahrzehnten.
VERHÄNGNISVOLL
Der Kriegsbeginn ist für die Ölmühlen, wie Geschäftsführer Heinrich Willemsen im Rückblick berichtet, von »verhängnisvollster Wirkung«46. Vor allem das britische Handelsembargo und die folgende Seeblockade treffen das Deutsche Kaiserreich und die mit ihm alliierten Mittelmächte schnell und hart. Sie werden nahezu vollständig von der Zufuhr ausländischer Rohstoffe und Güter abgeschnitten.47
Für die Ölmühlen kommt dies einer Katastrophe gleich, denn die bislang importierten Ölsaaten stammen zumeist aus den Kolonien der jetzigen Kriegsgegner. Hat die Branche in Friedenszeiten von der internationalen Arbeitsteilung profitiert, leidet sie nun unter der kriegsbedingten Unterbrechung.
Ein bedrohlicher Versorgungsmangel, die sogenannte Fettlücke, tut sich auf, der man durch Importsubstitutionen und Ersatzstoffe sowie Beimischungen und Einsparungen zu begegnen versucht.
ADENAUERS SOJAWURST
Die Suche nach Ersatz macht erfinderisch. Der junge Konrad Adenauer, seit 1914 als Erster Beigeordneter für die Lebensmittelversorgung der Kölner Bevölkerung zuständig und auch als Hobbytüftler bekannt, erfindet in den Kriegsjahren eine »Sojawurst«: einen festen, gewürzten Brotbelag, hauptsächlich auf Sojabasis und Spuren von Fleisch.
45 Festschrift, S. 20.
46 Heinrich Willemsen, Die Entwicklung der deutschen Oelmühlenindustrie in der neueren Zeit, in: Die deutsche Oelmühlen-Industrie: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V., Berlin 1925, S. 89.
47 Vgl. hierzu: Herfried Münkler, Der Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918, Berlin 2013.
Das Ersatzprodukt soll die deutsche Zivilbevölkerung, so die Hoffnung Adenauers, vor einer Hungersnot bewahren.
Die Sojawurst ist nur eine von vielen Erfindungen des späteren Bundeskanzlers. Aber diese ist besonders visionär. Das Rezept lässt er sich 1918 im Vereinigten Königreich patentieren »als Verfahren zur Geschmacksverbesserung eiweißreicher und fetthaltiger Pflanzenmehle und zur Herstellung von Wurst«48. Wer sich heute, über 100 Jahre später, in Supermärkten umschaut, findet Fleischersatzprodukte auf Pflanzenölbasis in großer Anzahl und unzähligen Variationen.
HEIMATFRONT
Doch der Reihe nach. Im August 1914 heißt es vielfach: Hurra, der Krieg ist da! Die Begeisterung ist groß. Ein schneller Feldzug, so das Kalkül, soll zeigen, dass Deutschland eine Weltmacht ist. Doch schon nach vier Wochen zerplatzen diese Träumereien. Frankreich und England bringen die deutsche Offensive zum Stehen, der Grabenkrieg beginnt. Nicht Schlachtpläne bestimmen fortan über den Kriegsausgang, sondern Ressourcen und Industriekapazitäten. Dieser Krieg wird an der Heimatfront entschieden.
IMPROVISATION
Auf diese Situation ist das Kaiserreich nicht vorbereitet. Nur langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine Kriegswirtschaft benötigt wird, um den Mangel zu verwalten und die Produktion und Verteilung von Gütern zu lenken.
Zu diesem Zweck muss zunächst eine funktionierende Verwaltung geschaffen werden. Ihr Aufbau erfolgt nicht systematisch, sondern ist vor allem durch Improvisation geprägt. »Kriegsausschüsse« und »Kriegsgesellschaften« werden gegründet. An der Schnittstelle zwischen Industrie und Verwaltung setzen sie die kriegswirtschaftlichen Erfordernisse in den jeweiligen Branchen und Märkten durch.
KOOPERATIV
Bis 1918 entstehen 134 solcher Kriegsgesellschaften, von der Aaleinfuhrgesellschaft mbH über die Kriegsmetall AG bis hin zur Zigaret-
48 https://www.swr.de/swrkultur/musik-klassik/26061918-konrad-adenauer-erfindet-die-sojawurst-100.html; https://adenauerhaus.de/digital/unsere-originale/patent-fuer-die-sojawurst/25.
tentabak-Einkaufsgesellschaft mbH. Der Staat setzt auf Kooperation: Großunternehmen und Verbände werden in die Gesellschaften eingebunden. Sie besitzen nicht nur Know-how und Branchenkenntnisse, sondern verfügen auch über die Kontakte zu Betrieben und Akteuren. Industrieverbände wie der VDOe übernehmen somit eine zentrale Rolle in der deutschen Kriegswirtschaft.
Grundsätzlich gilt: Wer gut vernetzt ist, wird gehört. Auch deshalb tritt der VDOe im Jahr 1916 – nach langem Zögern – dem Bund der Industriellen bei, etwas später dann auch der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände
KRIEGSVERWALTUNG
Anfang Dezember 1914 wird die Kriegsabrechnungsstelle der Deutschen Ölmühlen gegründet. Sie soll nicht nur den Import von Ölsaaten unter Kriegsbedingungen aufrechterhalten, sondern auch die in den besetzten Gebieten gewonnenen Ölsaaten, also die Kriegsbeute, »den Ölmühlen zuführen«, wie es in der Festschrift heißt.49
Doch damit lässt sich die Fettlücke nicht einmal annähernd schließen. Vielmehr spitzt sich die Lage weiter zu. 1916 erreicht die Einfuhr von Ölsaaten lediglich sechs Prozent des Vorkriegsniveaus. 50
BÜROKRATISCH
Der Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette wird am 1. Januar 1915 ins Leben gerufen. Rasch entwickelt er sich zu einem bürokratischen Apparat beachtlicher Größe, der bereits zum Jahresende 222 Mitarbeitende zählt.
Sein Aufgabenfeld umfasst den Anbau und die Beschaffung von Ölsaaten, die Gewinnung von Ölen und Fetten sowie die Verteilung an die verschiedenen Bedarfsgruppen. Zudem veranlasst der Kriegsausschuss umfangreiche Einsparmaßnahmen, die vor allem aus unzähligen Verwendungsverboten in technischen Bereichen bestehen und zu einer Flut von Verordnungen und Gesetzen führen.51
49 Festschrift, S. 16.
50 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1916. Streng geheim, Berlin [1917], S. 300ff.
51 Siehe hierzu das 143-seitige Werk: Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette (Hrsg.), Wirtschaftsgesetzgebung auf dem Gebiete der pflanzlichen und tierischen Öle und Fette während der Kriegsjahre 1915/16 abgeschlossen am 1. April 1916, Berlin 1916.
DIE GROSSEN UNTER SICH
Die Kriegsabrechnungsstelle bildet das Scharnier zwischen Rohstoffbeschaffung und Verteilung der Öle.52 Ihr obliegt die Zuteilung der Ölsaaten an die Ölmühlen und sie sorgt dafür, dass Öle und Presskuchen an die Rohstoffzentrale zurückgelangen. Von hier aus werden sie dann den Verteilungsgesellschaften wie der Kriegs-Schmierölgesellschaft oder der Kriegsabrechnungsstelle der deutschen Margarine- und Speisefettfabriken übergeben.
Das Verteilungsverfahren regeln sogenannte Verteilungskommissionen, in denen die Verbände wiederum maßgeblichen Einfluss haben. Dies trifft auch für die Verteilungskommission der Kriegsabrechnungsstelle der Deutschen Ölmühlen zu, der Paul Herz vorsitzt. Ihm zur Seite stehen Arnold Willemsen (Ölmühle Holz & Willemsen, Mitglied im VDOe-Vorstand und zukünftiger Nachfolger von Paul Herz) sowie die Chefs der Harburger Ölwerke Brinkmann & Mergell, der Bremen-Biesigheimer Ölfabrik, des Vereins Deutscher Ölfabriken Mannheim, von Carl Hagenbucher & Sohn, Heilbronn, B. W. Fahrenholz, Magdeburg sowie A. H. Zander, Stettin und C. Thywissen, Neuss.53
Die Betriebe sind allesamt VDOe-Mitglieder. Doch nicht nur das: Es handelt sich zudem um die Schwergewichte der Branche. Die Großen bleiben also unter sich, die Kleineren außen vor.
RATIONALISIERUNG
Die Abrechnungsstelle erarbeitet zunächst ein Kontingentsystem, nach dem jeder Ölmühle eine bestimmte Menge an Saaten zur Verarbeitung zusteht. Da aber die Importe weiter sinken und die Vorräte bald aufgebraucht sind, sind die Produktionskapazitäten bereits 1915 nicht mehr ausgelastet.
Rationalisierung wird zum Gebot der Stunde, wie auch der Bericht des Kriegssauschusses für das Jahr 1916 verdeutlicht:
»Die Erfahrung, dass die kleineren Mühlen wesentlich geringere Ölausbeuten erzielen als die größeren, modern eingerichteten Betriebe, veranlasste die Abrechnungsstelle, bei den beiden letzten Verteilungen [es gab drei] den Mühlen den Rücktritt von der Über-
52 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1916. Streng geheim, Berlin [1917], S. 293.
53 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1915. Streng geheim, Berlin [1916], S. 124.
nahme der Verarbeitung gegen eine Entschädigung von 30 Mark für die Tonne Rohmaterial anzubieten.«54
Noch ist diese Verzichtsprämie ein freiwilliges Angebot. Mit anderen Worten: Die Mühlenbesitzer können entscheiden, ob sie die Produktion drosseln oder ganz einstellen.
Doch schon bald folgt der Zwang. Im Winter 1916/17, der als »Steckrübenwinter« in die Geschichte eingehen wird, kommt es in Deutschland zu einer Hungersnot. In den Mühlen gibt es nichts mehr zu mahlen, lediglich fünf Prozent der verfügbaren Verarbeitungskapazitäten werden noch genutzt. Hinzu kommt, dass Arbeitskräfte, Transmissionsriemen und die Kohlen für die Dampfmaschinen anderweitig dringend benötigt werden.
ENTSCHEIDUNG
Doch welche Ölmühlen sollen stillgelegt werden? Und vor allem: Wer soll darüber entscheiden? Zuständig ist der übergeordnete Kriegsausschuss der Deutschen Wirtschaft mit seinem Fachausschuss für die Zusammenlegung der Ölindustrie, in dem zwölf Vertreter von Ölmühlen sitzen.
Im Winter 1916/17 berät dieses Gremium über mögliche Stilllegungen. Berichterstatter ist der wahrscheinlich kompetenteste Fachmann auf diesem Gebiet: VDOe-Geschäftsführer Heinrich Willemsen.
Im Dezember 1916 schlägt der Fachausschuss vor, Ölmühlen mit einer Jahreskapazität von unter 10.000 Tonnen stillzulegen. Dies würde bedeuten, dass 28 von etwa 700 Betrieben weitermachen könnten. 55 Doch das geht dem Vorsitzenden des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Gerichtsassessor a. D. Kurt Weigelt, Vertreter des Kriegswirtschaftsamtes, nicht weit genug. Gegenüber einem württembergischen Vertreter erklärt er, »dass die zugezogenen Sachverständigen der Industrie genau die von ihnen vertretenen Betriebe zur Aufrechterhaltung vorgeschlagen hätten. Der Ausschuß hätte sich diesem Verfahren nicht anschließen können, wenn er sich nicht den größten Vorwürfen von Leitern der nicht vertretenen Fabriken hätte aussetzen wollen. Und
54 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1916. Streng geheim, Berlin [1917], S. 127.
55 Sitzung des Fachausschusses Ölindustrie am 21.12.1916 und 09.02.1917, Staatsarchiv Ludwigsburg E 170 Bü 1812.
so habe er, da er Deutschland als ein Wirtschaftsgebiet ansehe, eben die Betriebe zur Aufrechterhaltung empfohlen, die im Frieden eine Jahresproduktion von über 30.000 erzielt hätten […]. Die Bevorzugung der großen Betriebe sei erfolgt wegen ihrer günstigen Lage an Wasserstraßen und der konzentrierten Transportmöglichkeit«.56
STRUKTURWANDEL
Die Empfehlung bedeutet den Kahlschlag. Lediglich die elf leistungsfähigsten Großbetriebe sollen fortbestehen. Sofort organisiert sich Widerstand, doch der Erfolg ist mäßig: Am Ende befinden sich auf der Liste insgesamt 16 Ölmühlen, durchweg Mitgliedsfirmen des VDOe.57 Mehr als 700 kleinere und mittelgroße Mühlen müssen im Laufe des Jahres 1917 gegen Zahlung einer Entschädigung ihren Betrieb einstellen. Sie verlieren Fachpersonal und Produktionsmittel, viele werden ihr Geschäft nach Kriegsende nicht wiederaufnehmen. Der Erste Weltkrieg treibt die Marktkonzentration mit Tempo voran.
ÜBERGANG
Nach dem Krieg bleibt den Ölmühlen kaum Zeit zum Durchatmen. Mit dem Waffenstillstand im November 1918 beginnt eine bis 1920 andauernde Phase des Übergangs von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft.
Angesichts knapper Devisen, einer ausgezehrten Landwirtschaft sowie großer Versorgungsprobleme bei Nahrungsmitteln wird der Markt für Ölsaaten, Fette und Öle weiterhin vom Staat kontrolliert und reguliert. Der deutschen Wirtschaft gelingt es zunächst nicht, an den abrupt unterbrochenen Aufschwung der Vorkriegszeit anzuschließen. 1919 befindet sich die Industrieproduktion auf dem Stand von 1888. Das Niveau des letzten Friedensjahres wird erst 1927 wieder erreicht.
FREIGEGEBEN
Als das Reichswirtschaftsministerium im Mai 1920 entgegen dem Rat des VDOe und dem Willen der Industrie verfügt, die Märkte freizuge-
56 Oberregierungsrat Liesching, Vertreter der K. Württ. Zentralstelle für Gewerbe und Handel auf dem Gebiete der Kriegs- und Übergangswirtschaft, Bericht über die Ausführung des Auftrags betr. Aufrechterhaltung des Betriebs der Firma Carl Hagenbücher & Sohn, Ölfabriken in Heilbronn, vom 27.2.1917, Staatsarchiv Ludwigsburg E 170 Bü 1812.
57 Kriegsamt, Kriegsministerium, an Kgl. Zentralstelle für Gewerbe und Handel, betr. Ölmühlen, vom 25.7.1917. Liste der Mühlen und Extraktionsanlagen, die weiterarbeiten dürfen, Staatsarchiv Ludwigsburg E 170 Bü 1812.
ben, sind die Folgen für die Ölmühlen dramatisch: Die Lager sind leer und die Verbindungen zu Geschäftspartnern im Ausland fast vollständig abgerissen. Kaum eine Mühle besitzt in ausreichendem Umfang harte Devisen, um auf dem Weltmarkt einzukaufen. US-Dollar oder das britische Pfund verdient man nur durch den Export – dieser bleibt aber zur Sicherung der Ernährung vorerst verboten.
AUSGESCHALTET
Die Außenhandelspolitik rückt erneut in den Fokus der Verbandstätigkeit. Denn durch den Wegfall der Handelsblockaden wird der deutsche Markt mit ausländischen Ölen und Fetten regelrecht geflutet. Für die deutsche Ölindustrie ist dies eine vollkommen neue Situation: Anders als früher ist sie kaum mehr in der Lage, den heimischen Bedarf an Ölen und Fetten zu befriedigen, dies übernehmen nun andere. Selbst 1922 erreicht die Rohstoffverarbeitung der Ölmühlen nur knapp 50 % des Vorkriegsniveaus. Dies verdeutlicht, wie es in der Festschrift heißt, »in welchem Maß die deutsche Ölindustrie von dem deutschen Markt ausgeschaltet war«.58
INTERNATIONALE AKTEURE
Einzige nennenswerte Importeure von Rohstoffen sind in dieser Phase die niederländischen Margarineproduzenten van den Bergh und Jurgens, die auch Fabriken in Deutschland besitzen und mit aller Macht auf den deutschen Markt drängen. Mit ihren Devisen kaufen sie auf dem Weltmarkt Saaten oder Öle, die sie in Deutschland pressen oder weiterverarbeiten.
Als starke Marktteilnehmer – 1927 bilden sie die Margarine Union, 1929 entsteht aus ihnen Unilever – übernehmen sie mehrere deutsche Mitbewerber, die auch Ölmühlen besitzen. Damit wird erstmals ein internationaler Konzern Mitglied im VDOe.59
TARIFPARTNER
Mit den politischen und sozialen Umwälzungen des Jahres 1918 kommen auf den VDOe ganz neue Herausforderungen zu. Unter dem
58 Festschrift, S. 94.
59 W. J. Reader, Fifty Years of Unilever, 1930-1980, London 1980, S. 17; zur Zusammenarbeit mit mehreren deutschen Ölmühlen, die bis in die Vorkriegszeit zurückreicht, siehe: Charles Wilson, The History of Unilever, A Study in Economic Growth and Social Change, Vol. II, London 1954, S. 104 ff.
unmittelbaren Eindruck der Revolution am 9. November 1918 unterzeichnen 21 Arbeitgeberverbände und sieben Gewerkschaften nur eine Woche später eine wegweisende Vereinbarung: Im sogenannten Stinnes-Legien-Abkommen werden die Gewerkschaften als legitime Vertreter der Arbeiterschaft anerkannt.
Arbeitsbedingungen und Löhne werden künftig in Tarifverträgen geregelt, Unternehmen können Betriebsräte einrichten. Im Gegenzug verzichten die Gewerkschaften auf alle Versuche einer (gewaltsamen) Sozialisierung. Das Tarifvertragswesen, dem ein langer Kampf der Gewerkschaften vorausgegangen ist, gleicht einer Revolution in der Arbeitswelt.
ACHT STUNDEN
Unter der Leitung von Cornelius Thywissen handelt der VDOe einen eigenen Manteltarifvertrag aus, dessen innerbetrieblich befriedende Wirkung der Verband noch Jahre später zu schätzen weiß.
Am 5. November 1919 wird mit den drei maßgeblichen Gewerkschaften, dem (sozialdemokratisch orientierten) Verband der Fabrikarbeiter, dem Zentralverband der christlichen Fabrik- und Transportarbeiter und dem (liberalen) Gewerkverein der deutschen Fabrik- und Handarbeiter eine vertragliche Vereinbarung geschlossen, die Lohnstruktur, Modalitäten der Lohnzahlung und Urlaubsansprüche sowie Überstundenentgelt und Arbeitszeiten regelt. VDOe und Gewerkschaften einigen sich darin unter anderem auf den Achtstundentag bzw. die 48-Stunden-Woche.60
ANPASSUNG
Die strategische Vernetzung des VDOe wird in der Weimarer Republik womöglich noch wichtiger als im Kaiserreich. Das Parlament und demokratisch gewählte Regierungen nehmen nun die industrie- und handelspolitischen Weichenstellungen vor. Der VDOe passt sich diesen veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich an und richtet seine Kommunikationskanäle entsprechend aus – eine Adaption, die umso leichter fällt, da allzu radikale Brüche ausbleiben.
60 Festschrift 1925, S. 18; siehe auch: Vertragsentwurf für den Vertrag zwischen dem Verband Deutscher Ölmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V. und dem Verband der Fabrikarbeiter Deutschland, Archiv Thywissen, o. D., Nr. 34 Fasz. 6.
Als sich die verschiedenen Industrieverbände im Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) vereinigen, ist auch der VDOe mit von der Partie und sorgt für die Einrichtung einer Fachgruppe der Öl- und Fettindustrie. Besonders wichtig: Über den RDI erlangen die Ölmühlen direkten Einfluss auf die künftigen Handelsvertragsverhandlungen.
Durch die Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (ZAG), die im November 1918 ins Leben gerufen wird, erhält der VDOe zudem einen Sitz im Vorläufigen Reichswirtschaftsrat. Innerhalb der ZAG initiiert er dann die Reichsarbeitsgemeinschaft für Öle und Fette
FÜHRUNGSWECHSEL
Im Jahr 1922 steht beim VDOe ein wichtiger Führungswechsel an. Der langjährige Vorsitzende Paul Herz, inzwischen 69 Jahre alt, überlässt sein Amt dem Uerdinger Unternehmer und Vorstandsmitglied Arnold Willemsen, der die Verbandsarbeit in den nächsten zwei Jahrzehnten entscheidend prägen wird.
Die Beweggründe für diese Entscheidung sind übrigens nicht bekannt, doch das verhältnismäßig hohe Alter von Paul Herz oder auch gesundheitliche Einschränkungen spielen vermutlich eine Rolle.
RÜCKKEHR
Deutschlands Rückkehr in die internationale Gemeinschaft ist die große politische Aufgabe der Weimarer Republik. Die Mitarbeit daran wird zum vornehmlichen Tätigkeitsfeld des VDOe, denn für die Ölmühlen ist die Wiedereingliederung in den internationalen Handel lebenswichtig. Die Ausgangslage ist jedoch kompliziert: Der Versailler Vertrag verpflichtet Deutschland dazu, allen ehemaligen Kriegsgegnern bis zum Jahr 1924 Meistbegünstigung einzuräumen; die junge Republik kann also ihren Außenhandel nicht über Handelsverträge steuern. Das bedeutet zwar einerseits, dass keine Importzölle auf Ölsaaten und Ölfrüchte erhoben werden, andererseits können ausländische Fertigprodukte wie Öle und Fette nicht durch Zölle vom Markt ferngehalten werden.
EINE DEUTLICHE SPRACHE
Im Zuge der 1924 beginnenden Handelsvertragsverhandlungen versucht der VDOe, die Reichsregierung sowohl von der Aufrechterhaltung zollfreier Rohstoffimporte als auch von der Einführung von Zöllen auf Fertigprodukte zu überzeugen.
Dem stehen die Positionen anderer Branchen entgegen: Die ölverarbeitenden Industrien wie zum Beispiel die Margarineindustrie haben kein Interesse an Zollmauern. Und die Landwirtschaft wiederum will sich durch möglichst hohe Zölle auf Ölsaaten geschützt sehen.
Zwar lassen sich nicht alle Forderungen der Ölmühlen durchsetzen, dennoch sind die Verhandlungen aus ihrer Sicht erfolgreich. Eine Phase der Beruhigung und Normalisierung beginnt: Mitte der 1920er Jahre erreicht das internationale Handelssystem eine Struktur, in der die Ölmühlen zufriedenstellend mit ausländischen Rohstoffen versorgt werden. Und mit der Reichsmark steht ab 1924 auch wieder eine konvertible Währung zur Verfügung. Die Handelsbilanz spricht eine deutliche Sprache: Bereits 1927 exportiert Deutschland wieder mehr Öle und Fette, als es importiert.
INTERNATIONALES PARKETT
Die Normalisierung gelingt auch bei den internationalen Beziehungen des VDOe. Als Nachfolgerin des Internationalen Komitees zur Wahrung der Interessen der europäischen Ölindustrie wird im Jahr 1922 die International Association of Seed Crushers (IASC) in London gegründet. Auch außereuropäische Länder zählen zu ihren Mitgliedern, Deutschland als Kriegsverlierer bleibt zunächst ausgeschlossen. Erst im Jahr 1925 erhält der VDOe eine offizielle Einladung zum IASCJahreskongress in London. Damit erhält der Verband die Chance, wieder internationales Parkett zu betreten. Nur fünf Jahre später wird der Jahreskongress in Hamburg ausgerichtet,61 ein unübersehbares Zeichen, dass Deutschland gleichberechtigt in den Kreis der Industrienationen zurückgekehrt ist.
BEWÄHRUNGSPROBE
Am 25. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag, endet der kurze wirtschaftliche und politische Aufschwung. Der New Yorker Börsencrash
61 http://www.lonsea.de/pub/org/406.
wächst sich rasant zu einer globalen Finanz-, Wirtschafts- und Agrarkrise aus.
Massenarbeitslosigkeit, Verelendung und Not prägen die 1930er Jahre und werden zu einer ernsthaften Bedrohung für die Weimarer Demokratie. Der Protektionismus, die möglichst radikale Abschottung der Märkte, scheint das handelspolitische Gebot der Stunde. Für den VDOe wird die Weltwirtschaftskrise zur schweren Bewährungsprobe.
SOZIALE VERANTWORTUNG
Das zeitgenössische Rezept der Wirtschaftspolitik, um der Krise zu begegnen, ist die Senkung von Löhnen und Preisen. Mittels Notverordnungen greift die Reichsregierung in die Tarifautonomie ein und ordnet in mehreren Wellen die Senkung der Stundenlöhne an. Doch die Deflationspolitik verschärft die Krise, viele Einkommen sinken unter das Existenzminimum.
Zahlreiche Ölmühlen übernehmen in dieser Situation soziale Verantwortung, indem sie die Spielräume, die sich ihnen durch Notverordnungen bieten, nicht einseitig oder übermäßig ausschöpfen. Dies dokumentiert beispielsweise das Protokoll zur Vorstandssitzung des VDOe am 6. Oktober 1932:
»Im Allgemeinen ist von einer Lohnkürzung auch da, wo sie nach den Verordnungen zulässig gewesen wäre, Abstand genommen [worden], um das Verdienst der alten Arbeiter nicht über die durch die Arbeitszeitverkürzung [ohne Lohnausgleich] schon entstandene Schmälerung hinaus noch weiter zu reduzieren. […] Der Vorstand war einstimmig der Auffassung, dass alle Betriebe nach Möglichkeit besorgt sein müssten, soweit es ihnen möglich ist, Neueinstellungen durchzuführen, dass aber Lohnkürzungen nur dann vorgenommen werden sollten, wenn die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse dies erfordern.«62
MILCHFETT ODER PFLANZENÖL?
Die Krise ist so weitreichend, dass auch die Ausgaben für Grundnahrungsmittel drastisch sinken. Die Konsumenten greifen statt zur Butter zur kostengünstigeren Margarine. Damit sinkt die Nachfrage nach der
62 Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes am 6. Oktober 1932, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.
vorwiegend in Deutschland hergestellten Milch wesentlich schneller als die nach den meist importierten Ölsaaten und Ölen: Schuld an der Agrarkrise ist nach Meinung vieler Zeitgenossen die Margarine. Um die deutsche Landwirtschaft zu stützen und die knappen Devisenvorräte zu schonen, werden im Jahr 1932 viele Maßnahmen umgesetzt, die insbesondere die Fettwirtschaft betreffen. Schutzzölle auf Ölsaaten und Öle oder der Zwang, der Margarine Butter beizumischen, bedrohen Ölmühlen und Margarinehersteller existenziell.
ZUSAMMENRÜCKEN
Handelspolitisch haben Ölmühlen und die Margarineindustrie durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Während die Ölmühlen günstige Saaten aus dem Ausland beziehen, aber ausländische Fertigprodukte vom Markt fernhalten wollen, sind die Margarinehersteller an billigen Vorprodukten interessiert, lehnen also Zölle auf Öle und Fette grundsätzlich ab.
Doch bei aller Verschiedenheit gibt es auch Verbindendes, denn die Margarinehersteller sind wichtige Kunden der Ölmühlen. In der anhaltenden Krise rücken nun die beiden Interessengruppen zusammen.
VERBÄNDEFRIEDEN
Am 13. September 1932 schließen der VDOe und die Vereinigung der freien deutschen Margarine- und Kunstspeisefettefabriken einen »vorläufigen Burgfrieden«63. Im Sitzungsprotokoll heißt es:
»Der Vorstand des [VDOe] erklärt sich mit dem Abschluss eines Abkommens zwischen dem Verband und der Margarine-Industrie einverstanden, demzufolge beide Industrien hinsichtlich der Zölle auf Margarinerohstoffe vorläufig den Status quo anerkennen. Die Margarine-Industrie soll sich demgegenüber verpflichten, die Ölmühlen-Industrie, falls notwendig, in der Abwehr von Zöllen auf Ölsaaten und Ölfrüchte und gegebenenfalls in der Verfolgung von Anträgen auf Einführung von Ölkuchenzöllen zu unterstützen. Sie soll ferner sich verpflichten, keine Schwierigkeiten zu bereiten, falls die Ölmühlen-Industrie andere, die Margarine-Industrie nicht berührende Zollmaßnahmen beantragt.«64
63 Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes am 13. September 1932, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.
64 Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes am 13. September 1932, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.
Es wird sich zeigen, dass diese Vereinbarung dringend nötig ist, denn zum Ende des Jahres nimmt der Druck auf beide erheblich zu.
PROTEST
Am 23. Dezember 1932 erlässt Reichspräsident Hindenburg die Verordnung zur Förderung der Verwendung inländischer tierischer Fette und inländischer Futtermittel. Sie zwingt die Margarinehersteller, ihrem Produkt deutsche Butter oder gehärteten Waltran, den billigsten Fettrohstoff, beizugeben. Öle aus heimischen Saaten sind den importierten vorzuziehen. Für die Margarineproduktion wird eine Höchstmenge vorgegeben. Die Verordnung entzieht der Ölindustrie einen großen Teil ihrer Geschäftsgrundlage, die Essener Allgemeine Zeitung spricht zu Recht von einem »Schlag gegen die Ölmühlen « 65 . Vergeblich protestiert der VDOe, der die Margarineindustrie, viele Vertreter der Landwirtschaft und der Verbraucher sowie weite Teile der Öffentlichkeit auf seiner Seite weiß. Doch weder ein öffentlichkeitswirksames Telegramm an den Reichskanzler noch eine ausführliche Denkschrift erreichen eine Milderung. Der Verweis auf die Erhöhung der Lebenshaltungskosten verfängt genauso wenig wie das Argument, dass steigende Preise für Presskuchen gerade die Landwirte treffen, die die Notverordnung schützen soll.66
FETTPLAN
Im Gegenteil: Agrarminister Alfred Hugenberg, einer der konservativen Steigbügelhalter Hitlers, macht die Ölmühlen und die Margarineindustrie als zentrale Gegner aus. Im Eiltempo exekutiert er seinen »Fettplan«: Schon im Februar 1933 – Adolf Hitler ist erst wenige Tage an der Macht – folgt für die Mühlen der Verwendungszwang für deutsche Saaten. Im März wird eine 50-prozentige Absenkung der Margarineproduktion (im Vergleich zum vierten Quartal 1932) für drei Monate verfügt, im April erlässt die Reichsregierung eine als Diskriminierung gedachte Kennzeichnungspflicht und ab Mai gilt eine
65 Ein Schlag gegen die Ölmühlen, Essener Allgemeine Zeitung vom 5.1.1933.
66 Denkschrift des Verbandes der Deutschen Ölmühlen e. V., Berlin, zur Verordnung des Reichspräsidenten zur Förderung der Verwendung inländischer tierischer Fette und inländischer Futtermittel vom 23.12.1932, vom 14.1.1933, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.
Fettsteuer von 0,50 RM pro Kilogramm Margarine, Kokosfett, Öl und Kunstspeisefett, die den Preis verdoppelt.67
Die Auswirkungen sind verheerend und entsprechen den düsteren Prognosen des VDOe. Zwar gehen die Importe zurück, aber zu welchem Preis? Die Mühlen sind nicht ausgelastet, Arbeitsplätze gehen verloren, die Futtermittelpreise steigen und die Situation der Milchwirtschaft verschlechtert sich weiter. Fette und Öle sowie Butter und Margarine werden so teuer, dass Arbeiter- und Arbeitslosenhaushalte sie sich bald nicht mehr leisten können.
SCHATTEN DER KRIEGSWIRTSCHAFT
Hugenbergs Nachfolger, der nationalsozialistische Agrarideologe Walther Darré, reagiert. Statt einer Liberalisierung folgt allerdings die autoritär-staatliche Bewirtschaftung: Die Dritte Verordnung über die gewerbsmäßige Herstellung von Erzeugnissen der Margarine-Fabriken und Ölmühlen vom 23. September 1933 entwirft ein System aus Maximalpreisen, Verbrauchskontingenten und Bezugsscheinen. Die Marschrichtung ist klar: Autarkie bei Ölen und Fetten. Der Schatten der Kriegswirtschaft ist hier bereits erkennbar.
BEKENNTNIS
Berlin, 31. Oktober 1933. Der nationalsozialistische Führerstaat ist bereits weitgehend installiert. Die demokratischen Institutionen sind entmachtet. Arnold Willemsen, frisch wiedergewählt als Vorsitzender des VDOe, spricht auf der außerordentlichen Generalversammlung. Das Protokoll hält fest:
»Die gesamte deutsche Wirtschaft stehe hinter dem Führer und Kanzler Adolf Hitler, erfüllt von der heiligen Pflicht, an ihrem Teile [sic!] daran mitzuarbeiten, dass die großen Ziele des Führers verwirklicht würden. Dies gelte auch für die deutschen Ölmühlen, für die er in diesem Augenblicke das Gelöbnis unbedingter Treue und Gefolgschaft ablege. Er fordere die Mitglieder auf, dieses Gelöbnis durch ein dreimaliges ‚Sieg Heil‘ zu bekräftigen.«68
67 Reinhold Reith, »Hurrah die Butter ist alle!« »Fettlücke« und »Eiweißlücke« im Dritten Reich, in: Michael Pammer, Herta Neiß, Michael John, Erfahrung der Moderne, Stuttgart 2007, S. 385-402, hier S. 404f.; vgl. Bernd Kaiser, Die Implikationen wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen für die Rohstoffbeschaffung internationaler Industrieunternehmen und sich hieraus ergebende Unternehmensstrategien am Beispiel der Henkel-Gruppe, Diss. Nürnberg 2009, S. 89.
68 Niederschrift über die außerordentliche Generalversammlung am 31.10.1933, Archiv Thywissen, Nr. 23, Fasz. 6.
Bekenntnisse dieser Art hallen im Herbst 1933 durch viele Versammlungen von Unternehmen, Verbänden und Vereinen. Arnold Willemsen wird – wie übrigens auch sein Bruder, der Geschäftsführer Heinrich Willemsen – nie in die NSDAP oder eine ihrer Gliederungen eintreten.69 Dennoch sind solche Loyalitätsbekundungen und Unterwerfungsgesten durch gestandene Unternehmer folgenschwer: Ihre Worte haben Gewicht und Einfluss. Sie erklären offen und öffentlich ihre Bereitschaft, die Ziele Hitlers umzusetzen und den nationalsozialistischen Umbau von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft tatkräftig zu unterstützen. Die Protagonisten der deutschen Ölmühlenindustrie sind hier keine Ausnahme.
»FÜHRERPRINZIP«
Die außerordentliche Generalversammlung des VDOe verabschiedet an diesem 31. Oktober 1933 eine neue Satzung, die, so der Vorstand, das »Führerprinzip« nach den Maßgaben des Reichsverbandes der Industrie (RDI) umsetzt.70
Der Vorsitzende wird weiterhin gewählt, muss allerdings vom Vorsitzenden des RDI bestätigt werden. Diese Änderung ist wichtig, weil nun ein externer Akteur Einfluss erhält, swenn auch ein Industrievertreter und kein Parteimann der NSDAP.
Vereinsorgane sind jetzt nur noch die Mitgliederversammlung und der Vorsitzende, Vorstand und Präsidium existieren nicht mehr. Der Vorsitzende entscheidet alleine über die Aufnahme neuer Mitglieder, er allein beruft den Beirat und setzt bei Bedarf Ausschüsse ein.
Beirat, Ausschüsse oder Mitgliederversammlung »sollen« vor wichtigen Entscheidungen gehört werden, verpflichtend ist dies aber nicht. Die Position des Vorsitzenden ist also deutlich gestärkt, er bleibt aber der Mitgliederversammlung verantwortlich. Das Ganze entspricht jedoch nicht dem, was sich die Nationalsozialisten unter dem »Führerprinzip« vorstellen. Die »Gleichschaltung« ist noch nicht abgeschlossen.
69 Entnazifizierungsakte Arnold Willemsen, Landesarchiv NRW, NW 1010-0373; Entnazifizierungsakte Heinrich Willemsen, NW1010-6739 und NW1010-17424. Vgl. hierzu allgemein: Marcel Boldorf/Jonas Scherner (Hrsg.), Handbuch Wirtschaft im Nationalsozialismus, Berlin/Boston 2023.
70 Niederschrift über die außerordentliche Generalversammlung am 31.10.1933, Archiv Thywissen, Nr. 23, Fasz. 6.
»GLEICHSCHALTUNG«
Nach der Zerschlagung der Parteien und Gewerkschaften rückt das nationalsozialistische Regime ab 1934 die vollständige »Gleichschaltung« der Wirtschaft in den Fokus.
Das am 27. Februar 1934 erlassene Gesetz zur Vorbereitung des Organischen Aufbaus der Wirtschaft ermächtigt den Reichswirtschaftsminister, bestimmte Verbände als Alleinvertreter ihrer Branche anzuerkennen, Wirtschaftsverbände zu errichten, aufzulösen oder sie miteinander zu vereinigen sowie die Zwangsmitgliedschaft anzuordnen. Damit wird das Verbandswesen vollständig den Interessen des Staates unterworfen.
In der Reichsgruppe Industrie wird die Wirtschaftsgruppe Lebensmittelindustrie eingerichtet, die sich wiederum in 16 Fachgruppen gliedert, denen teilweise noch Fachuntergruppen zugeordnet sind. Die Fachgruppen bzw. Fachuntergruppen treten an die Stelle der Branchenverbände.
In dieser streng hierarchischen, dem »Führerprinzip« verpflichteten Ordnung werden die deutschen Ölmühlen innerhalb der Fachgruppe Öle und Fette zur Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie zusammengefasst. Dies hat mit einer freiwilligen und unabhängigen Interessenvertretung nichts mehr zu tun.
ZWANG REGIERT
Alle Elemente der Selbstverwaltung sind aus der Satzung der Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie entfernt, das »Führerprinzip« ist vollständig umgesetzt: Der Wirtschaftsgruppenleiter setzt den Fachuntergruppenleiter ein. Dieser nimmt die Weisungen des Fachgruppenleiters entgegen und führt die Fachuntergruppe »im Sinne des nationalsozialistischen Staats«. Die Mitgliederversammlung dient nur noch der »Unterrichtung und Aussprache«, ansonsten haben die Mitglieder den Weisungen des Leiters zu folgen.71
Die Mitgliedschaft in der Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie wird zum Zwang: Alle Unternehmen, die pflanzliche Öle und Fette, Walöl und Fischöle, neutrales Schweineschmalz, Ölkuchen und Extraktionsschrote herstellen, müssen künftig der Fachuntergruppe angehören. Die »Gleichschaltung« ist vollzogen.
71 Satzung der Fachuntergruppe Ölmühlen-Industrie, in: Archiv Thywissen, Nr. 23, Fasz. 6.
KONTINUITÄTEN
Auch personell hinterlässt die nationalsozialistische Machtübernahme Spuren im VDOe. So wird beispielsweise das Präsidiumsmitglied Ernst Possel von den Nationalsozialisten gezwungen, alle Ämter und Aufsichtsratsmandate niederzulegen. Der Grund: Der Kaufmann, Journalist und bestens vernetzte Lobbyist ist ehemaliger Parteisekretär der SPD Greifswald.72
Kontinuität überwiegt jedoch: Arnold und Heinrich Willemsen bleiben als Leiter bzw. Geschäftsführer der Fachuntergruppe weiterhin in Schlüsselpositionen. Sie genießen das Vertrauen sowohl der Mitglieder als auch der neuen Machthaber. Und Letztere setzen eher auf Kooperation als auf Konfrontation.
Der VDOe selbst führt in den nächsten Jahren eine Art Schattenexistenz, er besteht eigentlich nur noch auf dem Papier. Noch 1936 erscheint sein Name in Klammern auf dem Briefkopf der Fachuntergruppe – ein Hinweis auf die enge Verwandtschaft und einen Rest von Selbstbewusstsein, mehr aber nicht. Denn eines ist klar: Die Fachuntergruppe ist keine Interessenvertretung, sondern ein Transmissionsriemen, mit dem der NS-Staat seine wirtschaftspolitischen Ziele und Vorgaben in jeden einzelnen Betrieb hineinbringen will. Diese Aufgabe erfüllen Arnold und Heinrich Willemsen bis 1945 in zentraler Position.
ÖLSAATEN IM AUTARKEN WIRTSCHAFTSRAUM
Die grundsätzlichen Probleme, vor welche sich der VDOe bzw. die Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie gestellt sieht, bleiben bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs ähnlich. Nichts liegt der nationalsozialistischen Außenhandelspolitik ferner als die Rückkehr zum freien Welthandel mit Ölsaaten, die Industrie und Verbraucher so dringend benötigen. Die knappen Devisen werden vielmehr verwendet, um auf dem Weltmarkt Rohstoffe einzukaufen, die für die Rüstungsproduktion unentbehrlich sind. Denn spätestens mit dem Zweiten Vierjahresplan 1936 wird klar: Das Ziel ist der Krieg. Die Außenwirtschaft wird auf bilaterale Handelsverträge mit politisch und militärisch schwächeren Ländern in Kontinentaleuropa umgestellt. In einem deutsch-dominierten, blockadesicheren Wirtschaftsraum werden Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien zu bevorzugten
72 https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Possel; Deutsche Wirtschaftsführer 1929, Sp. 1730.
Handelspartnern, mit denen Kompensationsgeschäfte (ausländische Rohstoffe gegen deutsche Industrieprodukte) abgewickelt werden.
So ist für die deutsche Industrie der Bezug von Ölsaaten aus Europa nur noch eingeschränkt möglich. Als außereuropäische Handelspartner gewinnen vor allem der befreundete Achsenstaat Japan und die von ihm besetzte Mandschurei an Bedeutung. Von hier gelangt insbesondere Soja in die deutschen Ölmühlen.73
DEUTSCHE ÖLMÜHLEN-ROHSTOFFE GMBH
Mit einem Stammkapital von 40.000 RM wird am 9. November 1934 die Deutsche Ölmühlen-Rohstoffe GmbH (DOR) gegründet. Alleiniger Geschäftsführer ist Heinrich Willemsen.
Der Name der GmbH erinnert nicht von ungefähr an die Kriegsgesellschaften des Ersten Weltkriegs, denn die Aufgaben sind ähnlich: Die DOR übernimmt, so das Handelsregister, den »Ein- und Verkauf sowie die anderweitige Beschaffung und Verwertung von Rohstoffen für die deutsche Ölmühlenindustrie«.74
Konkret bedeutet dies, dass die erworbenen oder beschafften Rohstoffe innerhalb der Branche nach einem festen Schlüssel aufgeteilt werden. Hierzu handelt die DOR mit den Ölmühlen Verträge aus, in denen – abhängig von der jeweiligen Betriebsgröße – Bezugskontingente definiert sind.
IN BESTER LAGE
Die neue Gesellschaft hat ihren Sitz in einem mehrstöckigen Gebäude in der Roonstraße 3 (heute: Konrad-Adenauer-Straße), im ehemaligen Alsenviertel in Berlin-Tiergarten. Laut Berliner Adressbuch befinden sich hier seit 1931 auch die neuen Büros des VDOe und die Wohnung ihres Geschäftsführers Heinrich Willemsen.75 Nahe dem Reichstagsgebäude und dem Regierungsviertel hat der VDOe erneut einen Sitz in bester Lage. Das heute nicht mehr bestehende Quartier ist als Botschaftsviertel bekannt: Im 19. Jahrhundert entsteht hier eine ganze Reihe prächtiger Villen und Wohngebäude und
73 Margarete Muths, Die deutsche Fettlücke und die Möglichkeit ihrer Schließung durch die Rückgewinnung der ehemaligen deutschen Kolonien, Bottrop 1938, S. 35ff.
74 Deutsche Ölmühlen-Rohstoffe Gesellschaft mbH, 62 HRB 56933, Landesarchiv Berlin A Rep. 342-02, Nr. 60738.
75 Berliner Adreßbuch 1931, hier: IV. Band, S. 848.
bis in die 1930er Jahre siedelt sich ein gutes Dutzend Botschaften und Konsulate an, darunter die Landesvertretungen von China, Argentinien und Rumänien sowie Südafrika, Ägypten und Schweden.
ERNSTFALL
Für die Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie und die DOR droht bereits im Winter 1935/36 der Ernstfall: Der Zusammenbruch der Fettversorgung zeichnet sich ab. Das NS-Regime muss zusätzlich 12,4 Millionen RM an Devisen für die Einfuhr von Ölsaaten aufbringen. Beschafft und verteilt werden sie durch die DOR.
Kurzfristig lässt sich damit zwar die Bewirtschaftung vermeiden, doch schon 1937 ist es so weit: Um den Verbrauch um 25 % gegenüber 1935 zu reduzieren, wird der Bezug durch die Einführung von Fettkarten rationiert. Dieses bürokratische System ruft Erinnerungen an die Kriegswirtschaft des Ersten Weltkriegs wach.76
Vom Wohlstandsversprechen des NS-Regimes bleibt wenig übrig, im Gegenteil: Verbraucher und Industrie müssen sich bereits vor dem Krieg mit der Mangelverwaltung abfinden.
EINE FLUT VON FORMULAREN
In der Zuteilungswirtschaft explodiert der bürokratische Aufwand. Die Fachuntergruppe übernimmt immer mehr Verwaltungsaufgaben und versinkt in einer Flut von Formularen. So ist sie zum Beispiel für die Bemessung der Exportförderungsabgabe zuständig, die Branchen zu entrichten haben, die auf Importe angewiesen sind. Mit der Abgabe werden Exporte gegen konvertible Währungen subventioniert, die wiederum die Bezahlung dringender Importe ermöglichen sollen.77
MIT VON DER PARTIE
Ein probater Weg, die Fettlücke unter Schonung der Devisenreserven zu verringern, scheint sich im Walfang aufzuzeigen. Deutschland ist Mitte der 1930er Jahre der größte Verbraucher von Walöl
76 Reinhold Reith, »Hurrah die Butter ist alle!« »Fettlücke« und »Eiweißlücke« im Dritten Reich, in: Michael Pammer, Herta Neiß, Michael John (Jh.), Erfahrung der Moderne, Stuttgart 2007, S. 385-402, hier S. 404f.; Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 1968, S. 32f.
77 Zum Beispiel musste Henkel mit der Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie und der Wirtschaftsgruppe Öle und Fette einen zähen Kampf gegen die Doppelbelastung des Eigenverbrauchs an Ölen und Fetten durch die Exportabgabe führen (vgl. Konzernarchiv Henkel, Acc. 272/11).
weltweit.78 Allein 1935 werden 50 % des weltweit gewonnenen Walöls eingeführt, eine Abhängigkeit, die im Rahmen der deutschen Autarkiepolitik den Ruf nach einer eigenen Walfangflotte79 immer lauter werden lässt.
Der Margarinefabrikant Walter Rau, Unilever und die Firma Henkel investieren massiv in den Aufbau eigener Walfangflotten. Der auf den deutschen Fabrikschiffen gekochte Tran soll die notwendigen Importe kompensieren und Deutschland autark machen.
Auch die DOR ist mit von der Partie: Sie verteilt nicht nur die Walölkontingente, sondern bei ihr liegt auch die Geschäftsführung des Ölmühlen-Walfang-Konsortiums, bald Gesellschafterin der Hamburger Walfang-Kontor GmbH. Mit vier eigenen und gecharterten Schiffen jagt und verarbeitet das Walfang-Kontor die großen Meeressäuger in der Antarktis.80
Der Wiederaufstieg Deutschlands in die Riege der großen Walfangnationen ist zwar verhältnismäßig erfolgreich, die produzierten Mengen an Tran reichen aber bei weitem nicht aus, um die Fettlücke zu beseitigen. Zudem macht der Kriegsbeginn im Jahr 1939 alle Ambitionen auf einen Schlag zunichte.81
KANONEN STATT BUTTER
Die viel zitierte Aussage von Propagandaminister Joseph Goebbels im Jahr 1936, dass man »zur Not ohne Butter«, aber »niemals ohne Kanonen« auskommt, wird im Zweiten Weltkrieg auf die Probe gestellt. Denn ohne Fette und Öle ist die deutsche Bevölkerung auch in diesem Weltkrieg nicht zu ernähren. Die Produkte erhalten vielmehr höchste Priorität.82
Auf einer berühmt-berüchtigten Besprechung der deutschen Generalität sieben Wochen vor dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 heißt es, dass »zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns
78 Frank Amoneit, Von der Fettlücke zum metabolischen Syndrom. 75 Jahre Fettforschung in der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft (1936-2011), hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft e. V., Frankfurt a. M. 2010, S. 18.
79 H. Wegener, Die Bedeutung des Walfanges für die deutsche Ernährung, in: Fette und Seifen, Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Fette und Fettprodukte, Organ der der Deutschen Gesellschaft für Fettforschung e. V., Januar 1938 (Heft 1), S. 17-18.
80 Ole Sparenberg, »Segen des Meeres«: Hochseefischerei und Walfang im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik, Berlin 2012, S. 294f.
81 Vgl. hierzu: Gerit Menzel, Deutscher Walfang: Das »Schließen der Fettlücke« auf See, in: Hansa –International Maritime Journal, 158 Jg. 2021, Heft 12.
82 Tim Schanetzky, Kanonen statt Butter. Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich, München 2015, S. 9.
das Notwendige aus dem Land herausgeholt wird«. Und weiter: »Am wichtigsten ist die Bergung und Abtransport von Ölsaaten, Ölkuchen, dann erst Getreide.«83
Die Strategie und die Folgen der deutschen Aggression sind eindeutig: Die Deutschen und ihre Wehrmacht werden auf Kosten der besetzten, insbesondere der polnischen und sowjetischen Gebiete versorgt, ohne Rücksicht auf den Nahrungsbedarf der Unterworfenen. Die Verteilung der geplünderten und der bei den verbündeten Staaten gekauften Ölsaaten an die Ölmühlen liegt bei der DOR.
PLÜNDERUNGEN
Kurzfristiges Raub- und Beutedenken dominiert. Eine Aufstellung der Vierjahresplanbehörde aus dem Jahr 1942 zeigt aber auch, dass in den ersten neun Monaten in den besetzten Gebieten der Sowjetunion nur 47.200 Tonnen Fett erbeutet bzw. erwirtschaftet werden. Über die ursprünglichen »Vertragslieferungen« hätte das NS-Reich immerhin 29.000 Tonnen Fett erhalten, denn bis zum Tag des Überfalls pflegen die beiden Diktaturen rege Handelsbeziehungen. Auch in den folgenden Kriegsjahren werden die besetzten Gebiete nicht zu der Nahrungsmittelkammer des NS-Reiches, von der die Kriegs- und Eroberungsstrategen träumen. Insgesamt jedoch geht das grausame Kalkül auf. Die deutsche Bevölkerung kämpft lediglich mit Versorgungsengpässen und Mangel, in den besetzten Gebieten hingegen hungern Menschen und viele sterben an Unterernährung.84
83 Aktennotiz über Ergebnis der heutigen Besprechung mit den Staatssekretären über Barbarossa, 2. Mai 1941, Staatsarchiv Nürnberg, KV-Anklage Dokumente Fotokopien PS 2718, https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0227_ hun&object=abstract&st=&l=de.
84 Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 1968, S. 144.
1945 – 1990: NEUBEGINN UND KONTINUITÄT
NEUGRÜNDUNG
Samstag, 18. Januar 1947. Ganz Deutschland wird von einer extremen Kältewelle heimgesucht, es herrschen eisige Temperaturen. Der harte Winter wird als Hungerwinter in die Geschichte eingehen. Doch trotz aller Not, für den VDOe ist dieser 18. Januar ein großer Tag. In Wiesbaden, in der amerikanischen Besatzungszone, gründen die Ölmühlen, die den Krieg überstanden haben, ihren Verband neu. Mit einer neuen Satzung knüpfen sie dabei sowohl inhaltlich als auch organisatorisch an die Zeit der Weimarer Republik an: Freiwillige Mitgliedschaft und demokratische Wahlen sind unabdingbar, der Verband soll wieder zu einer selbstbewussten und vor allem selbstbestimmten Interessenvertretung werden.
INTERMEZZO
Fachverband der Ölmühlen-Industrie e. V. – der Name steht für ein anderes, dezidiert unpolitisches Selbstverständnis. Vereinssitz ist Wiesbaden, die Adresse lautet Abeggstraße 2a, in der Wohnung des neuen Geschäftsführers Karl Schnurre.
Name und Sitz bleiben jedoch ein Intermezzo: Am 3. November 1949 bestimmt der Deutsche Bundestag die Stadt Bonn zum vorläufigen Sitz von Parlament und Bundesregierung und damit faktisch zur Hauptstadt der wenige Monate zuvor gegründeten Bundesrepublik Deutschland.
Wo Politik gemacht wird, muss der VDOe präsent sein. Deshalb zieht es auch ihn 1950 an den Rhein. Im Bonner Stadtteil Bad Godesberg, in der Koblenzer Straße 89, werden Büroräume angemietet.
SELBSTBEWUSST
Ein neuer Name signalisiert neues Selbstbewusstsein: Aus dem Fachverband wird kurz und bündig der Verband Deutscher Oelmühlen e. V., ein Name, den er mehr als 50 Jahre lang tragen wird.
Selbstverständlich sieht sich der VDOe in der Tradition des Verbands der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen: Im Hotel Excelsior, dem ersten Haus am Platz im nahegelegenen Köln, wird noch im selben Jahr das 50-jährige Bestehen nach der Gründung im Jahr 1900 gefeiert.
PROVISORIUM
Aller Anfang ist schwer. Dies gilt für die personelle ebenso wie für die räumliche Ausstattung des VDOe in der frisch gekürten Bundeshauptstadt. Im Hinblick auf die Zahl der Mitarbeitenden eher schlank aufgestellt, geht es in der bescheidenen Geschäftsstelle tatkräftig an die Arbeit. Neben dem Hauptsitz in Bonn gibt es übrigens auch ein Büro des VDOe in Hamburg, seit 1946 Sitz der Deutsche Ölmühlen-Rohstoffe GmbH. Die Zweigstelle besteht noch eine ganze Weile weiter, bis schließlich 1959 eine Zusammenführung unter neuer Adresse in der Bonner Adenauerallee nahe dem Deutschen Bundestag erfolgt. »Das Provisorium hat nun ein Ende«, betont der Geschäftsbericht des Jahres 1959.85
KRONPRINZENSTRASSE
Die Aufgaben und Herausforderungen nehmen zu. Dies schlägt sich auch in den Personalkosten nieder, die zwar bis weit in die 1950er Jahre hinein auf gleichem Niveau verbleiben, dann aber stark zulegen und sich bis etwa 1970 sogar mehr als verdoppeln. Dies lässt sich nur zum Teil auf steigende Gehälter zurückführen; ganz offensichtlich verstärkt sich der VDOe auch personell und stellt nach und nach neue, qualifizierte Mitarbeitende ein.
Als das Raumangebot in der Adenauerallee an seine Grenzen stößt, erwirbt der Verband 1963 ein ehemaliges Postgebäude in der Kronprinzenstraße 24 in Bonn-Bad Godesberg. Die großzügigeren, moderneren Räumlichkeiten bleiben bis zum Umzug nach Berlin im Jahr 2000 für fast vier Jahrzehnte fester Sitz des VDOe.86
KONTINUITÄT
An der Verbandsspitze setzt der VDOe auf Kontinuität. Der Unternehmer Arnold Willemsen und der Rechtsanwalt Heinrich Willem-
85 Geschäftsbericht 1959.
86 Geschäftsbericht 1999/2000, S. 25; Geschäftsbericht 2000/2001, S. 21-22
sen werden im Entnazifizierungsverfahren als »politisch unbelastet« eingestuft. Beide waren zu keiner Zeit Mitglied der NSDAP oder einer ihrer angegliederten Organisationen und können sich uneingeschränkt betätigen.
Der bei Kriegsende 73-jährige Arnold Willemsen wird zum Ehrenvorsitzenden bestimmt, das Amt des Vorsitzenden geht an seinen jüngeren Bruder Heinrich über. Als Heinrich Willemsen 1957 sechs Jahre nach Arnold stirbt, endet die nahezu sechs Jahrzehnte währende Ära Willemsen, in der die beiden Brüder die Arbeit des VDOe entscheidend prägen.
KARL SCHNURRE
Als Geschäftsführer fungiert ab Ende der 1940er Jahre der promovierte Jurist Karl Schnurre. Der ehemalige Topdiplomat ist für außenwirtschaftliche Fragestellungen fachlich bestens qualifiziert, politisch allerdings belastet: 1936 übernimmt er im Auswärtigen Amt die Leitung des Referats Osteuropa, ab 1944 leitet Schnurre gar die gesamte Handelspolitische Abteilung.
Während des Krieges ist Schnurre somit in wichtiger Position an der wirtschaftlichen Ausbeutung des besetzten Europas beteiligt. Im Kriegsverbrecherprozess gegen die Leitung des Auswärtigen Amtes wird Schnurre als Zeuge geladen, selbst jedoch nicht angeklagt. Statt in den Auswärtigen Dienst zurückzukehren, kommt er beim VDOe unter.87
WIEDERGUTMACHUNG
Anfang der 1950er Jahre muss sich der VDOe als Rechtsnachfolger der Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie einem Wiedergutmachungsverfahren stellen.88
1938 erwirbt die Deutsche Ölmühlen-Rohstoff GmbH (DOR) eine repräsentative Immobilie im Berliner Bezirk Tiergarten, ein fünfstöckiges Haus in der Landgrafenstraße 17. Der Hintergrund: Die DOR und die Fachuntergruppe müssen ihre Geschäftsräume in der Fürst-BismarckStraße 2 und in der Roonstraße 3 räumen. Die Häuser sollen abgebro-
87 Vgl. hierzu: Schnurre, Karl, in: Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 18711945, Band 4, Paderborn – München – Wien – Zürich 2012, S. 141f.; https://de.wikipedia.org/wiki/ Karl_Schnurre.
88 Die offizielle Bezeichnung lautet »Fachuntergruppe«. Die Kurzbezeichnung »Fachgruppe« verwendet jedoch sowohl die DOR in ihrem Schriftverkehr mit den Mitgliedern während des Kriegs als auch der VDOe und DOR-Anwalt Schurre im Wiedergutmachungsverfahren.
chen werden, um Platz für Hitlers gigantomanische Hauptstadtpläne zu schaffen.89
Nachdem einige Wohnungen zu Büroräumen umgewandelt sind, beziehen die Fachuntergruppe und die DOR am 1. Mai 1939 die neuen Räumlichkeiten.90 Dort residieren sie, bis ein Luftangriff im November 1943 das Haus zerstört und sie nach Hamburg ausweichen.
Bei der Finanzierung des Immobiliengeschäfts arbeiten DOR und Fachuntergruppe eng zusammen. Laut Mitteilung der DOR an die Mitgliedsfirmen werden 100.000 RM durch einen verzinslichen Kredit der Fachuntergruppe an die DOR aufgebracht, die restlichen 113.000 RM anteilig auf die Mitglieder umgelegt und ebenfalls verzinst.91
Eigentümer des Hauses in Tiergarten ist seit 1910 die Familie des jüdischen Fabrikanten und Kunstsammlers Ludwig Silten, dessen Witwe Sophie das Haus im Jahr 1938 verkauft. Ihr Erbe, der von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertriebene Professor der TU Berlin, Martin Igel, der sich während des Kriegs als Aushilfsinspektor in einer Oxforder Fabrik durchschlägt,92 beantragt 1949 die Rückgabe. Als er verstirbt, übernimmt seine Ehefrau Charlotte Igel das Verfahren. Antragsgegner sind sowohl die DOR GmbH als auch der VDOe.93
Der Rückerstattungsanspruch begründet sich daraus, dass Sophie Silten das Haus ohne die rassische Verfolgung durch die Nationalsozialisten nicht verkauft hätte.94 Die Familie ist bereit, den Teil des Kaufpreises, über den sie verfügen konnte, zurückzuzahlen. Der Kaufpreis selbst war scheinbar angemessen, er wird jedenfalls nicht angefochten.
89 Eidesstattliche Erklärung Heinrich Willemsen für das Kammergericht Berlin vom 16.3.1954, Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-03 Nr. 4002/50, Bl. 120.
90 RA Schnurre an Wiedergutmachungskammer Berlin vom 23.2.1952, ebd., Bl.37. VDOe und DOR lassen sich in dem Prozess durch den renommierten Berliner Rechtsanwalt und Notar Adolf Schnurre vertreten. Ob dieser mit dem VDOe-Geschäftsführer Karl Schnurre, der zu diesem Zeitpunkt bereits die Geschäfte der DOR (mit-)führt, verwandt oder verschwägert ist, ist bislang ungeklärt.
91 Deutsche Ölmühlen-Rohstoffe GmbH an. C. Thywissen, vom 21.6.1940, Unternehmensarchiv C. Thywissen Nr. 23, Fasz. 6.
92 Rechtsanwalt Wergin an das Kammergericht Berlin vom 27.2.1954, Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-03 Nr. 4002/50, Bl. 109. Ein kurzer Lebenslauf findet sich auf der offiziellen Website der TU Berlin, https:// cp.tu-berlin.de/person/1596.
93 Der Gesellschaftervertrag der DOR ist uns nicht überliefert, ebenso ist unbekannt, aus welcher Quelle das Grundkapital stammt. Im Wiedergutmachungsverfahren agiert jedoch der VDOe wie der einzige Gesellschafter. Vorbehalte in Bezug auf andere Eigentümer (z. B. die öffentliche Hand) werden an keiner Stelle und von keiner Seite gemacht.
94 Beschluss 154. Zivilkammer (Wiedergutmachungskammer), vom 9.7.1953, Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-03 Nr. 4002/50, Bl. 85ff.
Das Verfahren zieht sich bis 1954. Der Prozessbevollmächtigte der DOR bestreitet zunächst die Berechtigung des Anspruchs überhaupt, dann versucht er, den zurückzuzahlenden Betrag möglichst hochzuschrauben. Das Widerspruchsverfahren bleibt jedoch erfolglos, sodass DOR und VDOe das brachliegende Trümmergrundstück letztlich zurückgeben müssen und dafür 21.260 DM erhalten.95
WAISENKORN
Wie ist es eigentlich in den ersten Nachkriegsjahren um die Ölmühlen bestellt? Die Frage lässt sich relativ klar beantworten: Die Lage ist schwierig. Die Einfuhrbeschränkungen bei Ölsaaten machen den Betrieben das Leben schwer, gleichzeitig ist die Versorgungslage mit Fett und Eiweiß prekär. Immer wieder werden neue Wege gesucht, um die neuerliche Fettlücke zu schließen.96 So muss beispielsweise importierter Mais herhalten, um den großen Mangel abzuschwächen. Der Mais wird bis zur »letzten Schale für die menschliche Ernährung verarbeitet«, berichtet das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL im Jahr 1947: »Selbst die extrahierten Maiskeime, die im Ausland nur noch als Viehfutter dienen, werden der deutschen Nährmittelindustrie zur Verarbeitung zugewiesen.«97 Die Fettlücke könne nur durch den Import von Pflanzenölen oder Ölsaaten geschlossen werden. Gegen deren Fettgehalt, so DER SPIEGEL, sei das Maiskorn nämlich nur ein »Waisenkorn«.
SIGNAL
Als Devisen zur Verfügung stehen, schrumpft zwar die Fettlücke, aber die Ölmühlen profitieren kaum. Die Schwierigkeiten der Hansa-Mühle in Hamburg-Harburg geben aus der Sicht des Magazins DER SPIEGEL gar »das Signal zum großen Oelmühlensterben«. Der Grund: Die Bundesrepublik importiert 1950 vornehmlich billige Öle und Raffinate, Deutschland »ertrinkt« förmlich im Öl.98 Die Lagerbestände sind so reichlich, dass die Margarineindustrie auf Monate hinaus versorgt werden kann.
95 15. Zivilsenat des Kammergerichts Berlin, Beschluss im Widerspruchsverfahren vom 25.8.1954, Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-03 Nr. 4002/50, Bl. 126.
96 L. Winterhoff, Das Problem der Fettlücke – Ölkuchennutzung als neue Möglichkeit, in: Zeit, Nr. 17/1947.
97 Fettlückenbüßer, in: DER SPIEGEL 30/1947.
98 Den Untergang aufhalten, in: DER SPIEGEL 17/1950.
KONZENTRATION
Die VDOe-Mitgliederstruktur ändert sich in der Bundesrepublik gewaltig. Im Jahr 1954 hat der Verband insgesamt 38 Mitgliedsfirmen, also gerade einmal 40 % des Standes von 1925. Zugleich bleibt die Zahl bis heute die höchste nach 1945.
Viele Unternehmen überstehen die Weltwirtschaftskrise und den Krieg nicht, sie gehen insolvent oder der Wiederaufbau ist nicht rentabel. Hinter der sinkenden Mitgliederzahl steht in den späteren Jahren zudem der säkulare Trend der Industrie zu Konzentration und Internationalisierung. Der Kostendruck ist hoch, die Produktionsprozesse ermöglichen erhebliche Skaleneffekte: Je größer und moderner die Anlagen, desto geringer der Anteil der Fixkosten für Kapital und Arbeit. Wer bei diesem Investitionswettlauf nicht mithalten kann, scheidet aus oder wird übernommen.
EINGEPENDELT
Der Standort und die infrastrukturelle Anbindung sind gerade bei den Ölmühlen zentrale Erfolgsfaktoren. Nur Mühlen, die per Schiff beliefert werden können, haben so niedrige Transportkosten, dass sie langfristig überleben. Alle heutigen Mitglieder befinden sich an Ost- und Nordsee oder an einer der großen Wasserstraßen.
Globale, finanzstarke internationale Konzerne spielen im Ölsaatenmarkt eine immer größere Rolle. Manch ein traditionsreicher Standort ist mittlerweile Teil eines multinationalen Konzerns. Als Ergebnis dieses Konzentrationsprozesses pendelt sich die Zahl der VDOe-Mitgliedsfirmen bis Mitte der 1980er Jahre bei etwa 20 ein.
LANGERSEHNT
Während die Geschäfte in der Nachkriegszeit eher schlecht laufen, folgt nun Schritt für Schritt die langersehnte Besserung. Auf dem Kongress des Internationalen Ölmühlenverbandes in Brüssel berichten die deutschen Vertreter im Juni 1958, dass die Ölmühlenindustrie insgesamt gut beschäftigt ist, die Belieferung des deutschen Marktes mit Rohstoffen reibungslos erfolgt und die Ausnutzung der Produktionskapazitäten zunimmt.99
99 Berichte über die Entwicklung der deutschen Ölmühlenindustrie im Jahre 1957, in: Vorträge und Berichte vom Kongress der Internationalen Ölmühlenverbandes in Brüssel vom 3. bis 6. Juni 1958, überreicht durch die Margarine-Union AG, Hamburg, vgl. Anhang, S. 2.
ZEITGEIST
Seit der Gründung nimmt die Zollpolitik beim VDOe großen Raum ein. Die Grundlinie des Verbandes: zollfreie Importe von Ölsaaten, Zollschutz vor verarbeiteten Ölen. Mitte der 1950er Jahre erkennt der VDOe, dass dies nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, denn das wirtschaftspolitische Klima wandelt sich:
»Die allgemeine Tendenz ist die Herabsetzung der Zölle. [...] Wir haben größte Schwierigkeit mit unserem Antrag auf Erhöhung des Zolls für rohe pflanzliche Öle von 6 auf 8 %. Es besteht z. Zt. keine Aussicht auf Verwirklichung.«
Beim VDOe setzt sich die Auffassung durch, dass Saaten – und zunehmend auch Schrote – viel mehr als Öle weltweit gehandelt werden, und dass für die Ölmühlen die Chancen des Freihandels deutlich überwiegen.
In den folgenden Jahren verlagert sich das zollpolitische Spielfeld mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), dem General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) und dem Blair-House-Abkommen ohnehin auf die weltweite bzw. europäische Ebene.
HISTORISCHER SCHRITT IN EUROPA
In den Römischen Verträgen gründen Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Italien und Luxemburg im Jahr 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Ihr Ziel ist die europäische Integration durch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik.
Der VDOe reagiert mit Gelassenheit auf den historischen Schritt: Der damals geschäftsführende Vorsitzende Theo Dreschers ist 1957 der Auffassung, dass die Industrie dem gemeinsamen Markt »ohne große Befürchtungen entgegensehen könne, im Gegensatz zur Ölmühlenindustrie Frankreichs und Italiens, bei denen die Probleme ungleich schwieriger seien«.
DAS SCHARFE SCHWERT FEDIOL
Wer die internationalen Verhandlungen mitgestalten will, braucht Einfluss und Durchschlagskraft. Dieser Erkenntnis folgen rasch Taten. Schon 1958 gründen die Ölmühlenverbände der EWG-Staaten in Brüssel den Verband der europäischen Pflanzenöl- und ProteinmehlIndustrie (FEDIOL).
Über FEDIOL stimmen sich die Verbände künftig intensiv ab, sodass sie gemeinsam und wirkungsvoll auf der europäischen Ebene agieren. Dem schlagkräftigen Spitzenverband gehören auch im Jahr 2024 alle zehn nationalen Ölmühlenverbände der Europäischen Union (EU) an.
INTERNATIONALER NETZWERKER
Die Zusammenarbeit mit FEDIOL hat für den VDOe von Anfang an hohe Priorität. Im Juli 1967 kommt mit dem Juristen Hanno Jühe als neuer Geschäftsführer des VDOe ein geschickter internationaler Netzwerker an Bord. Bis 1993 leitet Hanno Jühe die Geschäftsstelle und repräsentiert den VDOe in vielen nationalen und internationalen Gremien. Als ständiger Vertreter des VDOe sitzt er auch im Außenhandelsausschuss des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Hanno Jühe setzt auf die konsequente Internationalisierung der Verbandspolitik. Er fördert die Zusammenarbeit mit FEDIOL, stärkt die Verbindungen zu den europäischen Ölmühlen, initiiert USA-Reisen und intensiviert die Kontakte zu den Abgeordneten des Bundestags wie zur Bundesregierung. Besonders geschätzt wird er für seinen gewandten Umgang mit Politikern und Wirtschaftsvertretern in Deutschland, Europa und Nordamerika.
MILCHSEE UND BUTTERBERG
Ende der 1960er Jahre ändern sich die Herausforderungen gravierend. Fast übergangslos gleitet Europa von der Mangelwirtschaft in den Überfluss. Statt mit einer Fettlücke kämpft die Industrie nun mit Milchseen, Butterbergen und der EWG-Fettmarktordnung. Die EWG-Kommission will Importe erschweren und strebt ein »Weltfettabkommen« an, um die Fettüberschüsse abzubauen. Agrarpolitik wird also nicht mehr nur europäisch, sondern weltweit gedacht. Nun zahlt sich aus, dass der VDOe über FEDIOL auch auf europäischer Ebene bestens vernetzt ist.
SUBVENTIONEN
Hinter dem Fettüberschuss steht eine Besonderheit der europäischen Agrarpolitik. Der Agrarsektor verliert in den europäischen Volkswirtschaften zunehmend an Bedeutung, Industrialisierung, Globalisierung und internationale Arbeitsteilung setzen kleine und mittlere Betriebe
unter Druck. Die Folge: Agrarprodukte werden günstiger, aber unwirtschaftliche Höfe müssen aufgeben.
Die Antwort darauf lautet Stützung der Preise und Subvention der Produktion. Die Landwirte erhalten die Subventionen direkt über den Preis, zu dem die Ölindustrie ihre Produkte einkauft. Dieser Aufschlag wird den Mühlen dann wiederum rückerstattet.
Bis zur neuen Agrarmarktordnung, die im Jahr 1992 von produktionsbasierten auf Flächensubventionen umstellt, besteht ein großer Teil der Arbeit des VDOe darin, seine Mitglieder im Hinblick auf Abrechnungsmodalitäten zu beraten sowie anstehende Änderungen praktikabel und zeitgemäß zu gestalten.
STANDBEIN FUTTERMITTEL
Ölmühlen verarbeiten Saaten und Früchte zu Öl und Schrot. Diese beiden Koppelprodukte – das eine gibt es nicht ohne das andere – entwickeln sich seit den 1960er Jahren sehr unterschiedlich. Während der Fettbedarf im Ernährungssektor allmählich gesättigt ist und der Verbrauch von Pflanzenölen eher stagniert, wächst der Fleischkonsum mit steigendem Wohlstand lange ungebremst. Die Erträge lassen sich nur durch Stallhaltung und hochwertigeres, proteinreiches Futter steigern. Wichtigste Proteinlieferanten sind die Schrote und Kuchen von Soja, Sonnenblumen und Raps. Futtermittel werden seit den 1960er Jahren zum bedeutendsten Standbein der Ölmühlenindustrie.
AUF DER
ANDEREN
SEITE DES ATLANTIKS
Sojaschrot ist aus der Fleischproduktion kaum mehr wegzudenken, in der weltweiten Geflügelmast sogar nahezu unersetzbar. Dies ist nicht immer so. Vor dem Zweiten Weltkrieg spielt Soja als Futtermittel eigentlich nur in den USA eine wichtige Rolle. Dort ist der Fleischkonsum höher, die Stallhaltung verbreiteter, der Bedarf an Futtermitteln deutlich größer.
Als die US-amerikanische Landwirtschaft Mitte der 1950er Jahre unter der Überproduktion von Soja leidet, soll das Problem unter anderem durch den Export nach Europa gelöst werden. Während die Ölmühlen großes Interesse daran haben, Sojabohnen mit ihrem vergleichsweise hohen Schrotanteil von 80 % zu verarbeiten, hadern die europäischen Landwirte noch. Sie müssen erst überzeugt werden.
AUFBAUARBEIT
Bei Soja ist in Deutschland damals noch jede Menge Aufbauarbeit zu leisten. Der VDOe macht sich Ende der 1950er Jahre zum Partner der amerikanischen Exportstrategie. Ein befristeter, 1960 um zwei Jahre verlängerter Vertrag mit dem staatlichen U. S. Soybean Export Council (SEC) stattet den VDOe mit einem großzügigen Budget aus, um bei deutschen Landwirten für Soja als Futtermittel zu werben.
Aus dem Werbetopf, in den übrigens auch die Mitgliedsfirmen einzahlen, werden Inserate, Messeauftritte, Werbefilme und -prospekte, aber auch Fütterungsversuche und wissenschaftliche Studien finanziert. Die Kasse ist 1961 reichlich gefüllt, die Geldmittel sind in diesem Jahr fast doppelt so hoch wie das gesamte Jahresbudget des VDOe.
KONZERTIERT
Die gemeinsame, von den Amerikanern angestoßene Absatzwerbung ist in mehrfacher Hinsicht erfolgreich. Einmal etablieren sich Sojaextraktionsschrot und -kuchen als fester Bestandteil der Tiernahrung, andererseits erkennen der VDOe und seine Mitglieder, wie produktiv, ja geradezu geboten konzertiertes Vorgehen bei der Etablierung neuer Produkte oder Rohstoffe ist. Die Besonderheit der Ölmühlenprodukte trägt das ihrige dazu bei: Öle, Schrote oder Kuchen – sei es für die Ernährung, für chemische Produkte oder Futtermittel – müssen den weiterverarbeitenden Kunden in einer einheitlichen, homogenen Qualität geliefert werden. Die Ölmühlen müssen deshalb ihre Produktionsprozesse und Qualitäten untereinander abstimmen. Da ist es nur naheliegend, dass sich daraus ein gemeinsames Marketing entwickelt. Der OVID-Futtermittelausschuss spielt auch heute eine bedeutende Rolle bei der Einführung neuer oder verbesserter Produkte.
IM BEREICH DER PHANTASIE
Der VDOe, die Ölmühlen und mit ihnen immer mehr Landwirte setzen auf Soja. Umso härter trifft sie im Jahr 1973 das amerikanische Soja-Embargo. Die Auslöser sind vielfältig: Die Sowjetunion kauft auf dem Weltmarkt Soja in großem Maßstab, die amerikanische Ernte fällt schlecht aus, peruanisches Fischöl wird knapp. Der Weltmarkt ist leergefegt, die Futtermittelversorgung der amerikanischen Farmer ist bedroht.
Kurzerhand verhängen die USA als größter Sojaproduzent ein Exportverbot. Unglücklicherweise überlagert sich diese Maßnahme mit der Ölpreiskrise, die durch den Konflikt zwischen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und den westlichen Staaten ausgelöst wird. Im VDOe-Geschäftsbericht 1973/74 heißt es:
»Dominierende Ereignisse des Berichtszeitraums waren das USSojabohnen Embargo und die daran anschließende Ölversorgungskrise […]. Es versteht sich von selbst, dass diese nicht vorhersehbaren und in ihren weitreichenden Konsequenzen nachhaltigen Erscheinungen den Konjunkturverlauf für die Ölmühlenindustrie in entscheidender Weise beeinflusst haben. Die Preise für die Ölmühlenrohstoffe, die schon im vorausgegangenen Berichtszeitraum eine außergewöhnliche Steigerung erfahren hatten, kletterten teilweise in Höhen, die auch von erfahrenen Kennern des Marktes bei dem Versuch einer Vorausschau in den Bereich der Phantasie verwiesen worden wären.«100
Die Endprodukte werden so teuer, dass die »Grenze der Abnahmebereitschaft« der Kunden erreicht wird. Kapazitäten liegen brach, Mühlen stehen still, Abnehmer gehen insolvent. Die Lage ist dramatisch.
VERTRAUENSKRISE
Das Embargo dauert zwar nur einen Monat, doch der Schaden ist groß und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Krise erschüttert das Vertrauen in den amerikanischen Handelspartner und den Welthandel insgesamt, wie der Geschäftsbericht unterstreicht: »Die Rohstoff-abhängigen [sic!] Länder haben erkannt, in welche Gefahr sie sich damit begeben, wenn sie nicht mit allen Mitteln danach trachten, ihren Abhängigkeitsgrad soweit nur irgend möglich zu verringern. Dabei spielt die bestürzende Tatsache eine besondere Rolle, dass selbst unter befreundeten Nationen eingegangene Verpflichtungen gebrochen wurden. Die dadurch ausgelöste Vertrauenskrise dürfte noch jahrelang auf alle internationalen Verhandlungen ausstrahlen.«101
100 Geschäftsbericht 1973/74, Teil I, S. 1-2.
101 Geschäftsbericht 1973/74, Teil I, S. 8.
NEUE BEZUGSQUELLEN
VDOe und FEDIOL machen sich fortan für ein Rohstoffabkommen mit den USA stark, um den Bezug zu sichern. Aber sie verlangen auch verpflichtende Sojabohnen-Notvorräte für Krisensituationen und die Förderung des heimischen Anbaus.
Vor allem aber halten alle Ausschau nach neuen Bezugsquellen, um die Abhängigkeit von US-amerikanischen Importen abzufedern. In der Folge weiten Brasilien und andere südamerikanische Staaten den Sojaanbau aus und machen den USA Konkurrenz. Im Jahr 2019 verweist Brasilien die USA auf den zweiten Platz der weltweiten Sojaproduzenten.
POLITISCHE MÄRKTE
Lebensmittelmärkte sind immer auch politische Märkte. Seit 1945 ist die internationale Gemeinschaft in Verhandlungen. Über GATT, die World Trade Organisation (WTO) und die Food and Agricultural Organization (FAO) der UN versuchen Industrie- und Entwicklungsländer, ihre Bedürfnisse und Ansprüche aufeinander abzustimmen. Marktbarrieren werden ebenso hartnäckig verteidigt wie Subventionen oder Dumping; die Schritte zur Gleichberechtigung aller Akteure und zur Liberalisierung des Weltmarktes sind vielfältig, die Wege häufig verworren, die Positionen widersprüchlich.
1990 – 2025: NEUE PARADIGMEN
WIEDERVEREINIGUNG
Der Mauerfall und die Wiedervereinigung verändern das wirtschaftliche und politische Koordinatensystem, in dem der VDOe agiert. Große Investitionen fließen im Laufe der 1990er Jahre in die Ölmühlenindustrie der fünf neuen Länder: Neue Unternehmen und Standorte werden gegründet, bei manchen bestehenden Betrieben gelingen Rettung und Modernisierung. Insgesamt sind der VDOe und die Mitgliedsunternehmen in den neuen Bundesländern, die als Produzenten von Winterraps bald eine herausragende Rolle spielen, gut aufgestellt.
Die dramatischen Veränderungen bleiben bei weitem nicht auf Deutschland beschränkt. In den 1990er Jahren entsteht ein neues Welthandelssystem mit neuen Paradigmen und Akteuren. In dieser dynamischen Umwelt müssen sich die ölsaatenverarbeitende Industrie und der VDOe behaupten, sie können sie aber auch gestalten.
DURCHBRÜCHE
Faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle – für diesen Grundsatz kämpfen VDOe und FEDIOL an allen Fronten. Anfang der 1990er Jahre endlich gelingt fast gleichzeitig die grundlegende Reform des europäischen Agrarmarktes und des internationalen Handelssystems.
Die neue, liberalisierte Ölsaatenmarktordnung der EU von 1992 ist aus der Sicht des VDOe ein Erfolg, der die »kühnsten Erwartungen der Industrie«102 übertrifft, auch weil die Betriebe von der überbordenden Bürokratie entlastet werden. Auf internationaler Ebene ist ebenfalls ein Durchbruch zu verzeichnen: Im GATT 1994 einigen sich die Staaten auf die Prinzipien des ungehinderten, diskriminierungsfreien Marktzugangs für jeden, auf den Abbau von Preissubventionen und auf ein Konfliktregelungssystem bei Streitigkeiten.
PARADIGMENWECHSEL
Nach der erfolgreichen Umsetzung von GATT und Blair-House-Abkommen kehrt Ruhe ein, die Lage scheint sich zu entspannen. Doch
102 Geschäftsbericht 1991/1992, S. 4.
kaum sind die Märkte etwas entpolitisiert, vollzieht sich ein regelrechter Paradigmenwechsel.
Dreht sich die Tätigkeit des VDOe seit seiner Gründung im Jahr 1900 vor allem um die Handels- und Zollpolitik – beides beherrscht die Verbandsarbeit bis in die 1990er Jahre hinein –, drängen im Vorfeld der Jahrtausendwende nach und nach völlig andere Themen auf die Tagesordnung.
DROHENDER EKLAT
Die amerikanischen Sojabohnenproduzenten und der Chemiekonzern Monsanto überraschen im Jahr 1995 die Ölmühlen und die Futtermittelindustrie Europas. Ihnen wird mitgeteilt, dass die kommende Sojabohnenernte etwa zwei Prozent gentechnisch veränderte Bohnen enthalten werde. Eine weitere Vorbereitung auf die Markteinführung der ersten genetisch modifizierten Ölsaaten (GMO) in Europa scheint den Amerikanern nicht erforderlich. Dem VDOe ist klar: Tauchen die neuen Sojabohnen einfach so in Europa auf, droht ein Eklat. Die Gefahr besteht, dass sich Öffentlichkeit und Politik gegen die Einfuhr wenden – mit verheerenden Auswirkungen auf den Futtermittelmarkt, der auf Sojaschrot nicht verzichten kann. Und für die sojaverarbeitenden Ölmühlen wäre, da das Produkt nun einmal in der Welt ist, der diskriminierungsfreie Zugang zum Weltmarkt gefährdet.
SENSIBEL
Der VDOe wird sich bei diesem sensiblen Thema schließlich aus der Deckung wagen, denn es geht um viel. Ziel ist es, Position zu beziehen, die Markteinführung der GMO zu begleiten und für Akzeptanz zu werben.
Damit tritt der bislang in der Öffentlichkeit nur wenig bekannte Verband plötzlich gegen schlagkräftige Nichtregierungsorganisationen (NGOs) an, die das Thema Gentechnik für sich entdecken und zunehmend vereinnahmen.
OFFENER DIALOG
Der VDOe setzt auf eine kooperative und effiziente PR-Strategie. Die neue Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit organisiert deutschlandweit
Pressekonferenzen, veranstaltet Diskussionsrunden, veröffentlicht Positionspapiere und gründet mit anderen Akteuren aus der BiotechBranche und der Nahrungsmittelindustrie Arbeitskreise zu Grüner Gentechnik, die mit eigenen Aktionen auf sich aufmerksam machen. Politiker sowie andere Multiplikatoren aus Wirtschaft und Gesellschaft werden im direkten Gespräch überzeugt. Der VDOe sucht auf allen für ihn relevanten Themenfeldern einen offenen, sachlichen Dialog mit Nicht-Fachleuten, ohne zu polarisieren und zu emotionalisieren. Mit diesem Ansatz setzt der Verband auf das richtige Pferd: Das Vorgehen zeigt Wirkung und bewährt sich.
RENOMMIERT
Wissenschaftliches Know-how spielt bei der Diskussion um die Grüne Gentechnik eine ausschlaggebende Rolle. Dabei werden die Pround Contra-Argumente, die Einschätzungen von Auswirkungen auf Mensch und Natur zum größten Teil aus der Bio- oder Ernährungswissenschaft bezogen.
Technisch sehr spezielle Fragestellungen aus der Analytik, beispielsweise zu Nachweisbarkeitsschwellen von Proteinfragmenten, erhalten in der öffentlichen Diskussion und im Ringen um Richtlinien, Verordnungen und Gesetze höchste Bedeutung.
Eine Kooperation mit dem Institut für Biochemie der Technischen Hochschule Darmstadt versachlicht die Diskussion erheblich. Darüber hinaus weiß sich sein renommierter Leiter, Professor Hans Günter Gassen, an das breite Publikum zu wenden und über die Vorteile und Chancen ebenso wie über die Risiken der Biotechnologie aufzuklären.
EMOTIONEN
»Krisensituation infolge Ölmühlenbesetzung gemeistert«: So lautet eine der Überschriften im VDOe-Geschäftsbericht 1997/98.103 Was ist passiert? Das Thema Gentechnik ist in aller Munde und beunruhigt die Öffentlichkeit. Im November 1997 leitet Greenpeace im »Spiel mit den Emotionen« eine neue Runde ein, indem Aktivisten öffentlichkeitswirksam die Mühle eines VDOe-Mitglieds besetzen. Die Behauptung: Es sei nicht auszuschließen, dass dort GMO-Soja verarbeitet und weiterverkauft werde.
103 Geschäftsbericht 1997/98, S. 12.
Greenpeace will durch die spektakuläre Aktion Druck auf das Unternehmen ausüben, damit es öffentlich macht, für wen seine Erzeugnisse bestimmt sind. Das Kalkül: Die Abnehmer und deren Produkte anprangern, um so einen öffentlichen Verzicht auf Lebensmittel aus GMO-Soja zu erzwingen.
KRISENSZENARIO
Schon länger vermutet der VDOe, dass Greenpeace bereit sein könnte, die ohnehin aufgeheizte Stimmung zu eskalieren. Sojaverarbeitenden Mitgliedsunternehmen stellt der Verband deshalb eine Art Set im Krisenmanagement zur Verfügung, das sich als geeigneter Handlungsleitfaden für solch kritische Situationen erweist.
Dass die Mühlenbesetzung im November 1997 verhältnismäßig gut gemeistert wird, liegt nicht zuletzt an der sorgfältigen Vorbereitung durch den VDOe: Die betroffene Ölmühle bleibt standhaft, denn ein seriöser Kaufmann, so betont der Geschäftsbericht 1997/98, »verrät« selbst unter Druck seine Kunden nicht.104
Das Thema Gentechnik bleibt ein Dauerbrenner. Aber weitere NGOAktionen dieser Art erzielen in den Folgejahren wesentlich weniger öffentliche Resonanz – ein Erfolg, den der VDOe auch seiner professionellen und auf Dialog ausgerichteten Kommunikation zuschreiben kann.
SPIELREGELN
Dass die Kampagnen der NGOs zunächst erfolgreich sind, so das Resümee des VDOe, liegt auch an der rudimentären Gesetzgebung in Brüssel zur Kennzeichnung genetisch verbesserter Produkte. Diese Lücken laden förmlich dazu ein, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und auch zu manipulieren, um Regelungen im Sinne des jeweiligen Akteurs zu erreichen. Dabei fallen die Interessen sehr heterogen aus und erweisen sich manchmal als genauso dynamisch wie das neue Produktfeld.
MEGATRENDS
Für die Branche stehen zu Beginn des neuen Millenniums neue, wichtige Herausforderungen vor der Tür; der VDOe und seine Mitgliedsfir-
104 Geschäftsbericht 1997/98, S. 13.
men sind gefordert, Lösungen und Antworten auf eine Vielzahl drängender Fragen zu finden. Nachhaltigkeit und Ökologie, Digitalisierung, Gentechnologie und Bioenergie sind die Megatrends, die über Produkte, Prozesse und Standards der Industrie entscheiden – und über den Zugang zu neuen, lukrativen Zukunftsmärkten.
Hinzu treten ein verändertes Ernährungsverhalten und Anspruchsdenken von Verbrauchern, die – begleitet durch innovative analytische Methoden – mit ganz neuen Anforderungen an die Produkte der Ölmühlen verbunden sind.
Die wachsende Nachfrage nach vielfältigen und hochwertigen Lebensmitteln sowie der Proteinbedarf bei der Nutztierfütterung sind und bleiben wichtige Absatzfaktoren. Biodiesel wird zu Beginn des 21. Jahrhunderts zunehmend nachgefragt, um den CO2-Fußabdruck des Verkehrs zu senken. Oleochemische Grunderzeugnisse gewinnen größere Bedeutung für die Herstellung von Alltagsprodukten: Kosmetika, Waschmittel, Medikamente, Hightech-Materialien.
BERLIN
Mit der Wiedervereinigung wird Berlin wieder Hauptstadt und Zentrum der deutschen Politik. Dort nehmen Bundesregierung und Ministerien 1999 ihre Arbeit auf, dort muss auch der VDOe präsent sein. Er schließt sich, so der Geschäftsbericht 1999/2000, dem »Strom der Wirtschaftsverbände«105 an, die der Bundesregierung folgen. Seit dem 1. Oktober 2000 befindet sich der Sitz der VDOe wieder in Berlin, in der Stadt, in der er 100 Jahre zuvor gegründet wurde. Auch in Berlin wird Eigentum erworben, der Verband kauft eine Etage im zweiten Stock des neu errichteten Verbändehauses Handel, Dienstleistungen, Tourismus am Weidendamm 1a in Berlin-Mitte. Das neue Domizil zeichnet sich nicht nur durch die besondere Lage mitten im Berliner Regierungsviertel und die perfekte Verkehrsanbindung aus. Der Geschäftsbericht 2000/2001 hebt zudem hervor, dass man »infolge der Nähe zu anderen handelsorientierten Verbänden von technischen und inhaltlichen Synergieeffekten profitieren kann«.106
105 Geschäftsbericht 1999/2000, S. 25.
106 Geschäftsbericht 2000/2001, S. 21-22.
RUNDER GEBURTSTAG
Das Jahr 2000 markiert für den VDOe ein besonderes Jubiläum. Am 19. April 1900 im großen Sitzungssaal der ehemaligen Berliner Börse ins Leben gerufen, begeht der VDOe 100 Jahre später den runden Geburtstag an seinem Gründungsort. Doch der Umzug nach Berlin strapaziert das Budget, sodass nach einer kleinen »Abschiedsparty« in Bonn »angesichts finanzieller Engpässe« auf das ursprünglich angedachte große Jubiläumsfest verzichtet wird.
Der VDOe präferiert eine kleinere Lösung: 107 Der Geburtstag wird praktischerweise mit den Eröffnungsfeierlichkeiten des Verbändehauses verknüpft, zu denen am 25. September 2000 rund 1.500 Gäste aus »Regierung, Medien und befreundeten Verbänden« erscheinen.108
VERZAHNUNG
Bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit fließen politische und wissenschaftlich-technische Gesichtspunkte immer mehr zusammen. Ihre Verzahnung ist komplex und anspruchsvoll. Ob Umweltstandards, Grenzwerte oder gentechnische Möglichkeiten, ob Analysemethoden, Emissionshandel oder CO2-Bilanzen: Die direkten oder mittelbaren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten der Mitgliedsunternehmen sind immens. Dies schlägt sich natürlich auch in den Geschäftsberichten und Protokollen nieder, die bis heute von diesen Themen dominiert werden.
WISSENSCHAFTLICH
Die enge Verknüpfung führt auch zu steigendem Beratungsbedarf aufseiten der Mitglieder. Es ist gute Praxis des VDOe, hier mit anwendungsorientierten wissenschaftlichen Einrichtungen zu kooperieren. Diesen Partnern muss der VDOe kompetent begegnen, um Aufträge präzise zu formulieren und die Ergebnisse verwerten zu können. Mitte der 2000er Jahre verstärkt der VDOe daher gezielt das Team der Mitarbeitenden, um gerade wissenschaftlich-technische Themen noch intensiver begleiten zu können.
107 Geschäftsbericht 1999/2000, S. 22.
108 Geschäftsbericht 2000/2001, S. 22.
NEUAUFSTELLUNG
Vor dem Paradigmenwechsel vollzieht sich die Lobbyarbeit zumeist in einem sehr begrenzten öffentlichen Raum: Adressaten sind Politik und Verwaltung in Brüssel, Bonn bzw. Berlin; auseinanderzusetzen hat man sich vielleicht noch mit anderen Verbänden, die wiederum Branchen mit einer ganz eigenen Interessenlage repräsentieren.
Nun aber treten neue Akteure auf den Plan: bestens organisierte, international vernetzte NGOs, die in der Lage sind, über gut recherchierte und teils emotionalisierende Kampagnen die Öffentlichkeit zu mobilisieren.
Zielobjekte sind nicht selten die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie. Die Wucht der ersten Kampagnen überrascht den VDOe. Schnell wird den Beteiligten klar, dass sich der Verband für die Zukunft besser wappnen muss.
KLARES IMAGE
Petra Sprick, seit 1993 Geschäftsführerin des VDOe, treibt die Neuaufstellung energisch voran. Ihre Vision ist eine Industrie, an der niemand vorbeikommt, die von der Öffentlichkeit gehört und mit einem klar konturierten Image wahrgenommen wird.
Doch dafür braucht es einen Wandel: Der VDOe muss sich verändern, er muss lernen, anders zu denken und zu arbeiten. Schrittweise baut Petra Sprick eine leistungsfähige PR-Abteilung auf, die die Positionen des Verbandes zielgerichtet kommuniziert. Hinzu kommt ein eigener Internetauftritt – in den 1990er Jahren noch lange keine Selbstverständlichkeit – auf dem sich Interessierte über die Industrie und den Verband informieren können.
EIN NEUER NAME
Ein Rebranding kennzeichnet im Jahr 2008 das neue Selbstbewusstsein: Aus dem VDOe, dem Verband Deutscher Oelmühlen e. V., wird der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e. V., OVID. Das klangvolle Akronym ist leicht zu merken und auch international eingängig.
Vielleicht noch wichtiger ist der begriffliche Wechsel von »Ölmühlen» hin zu »Industrie«. Die Branche ist zwar stolz auf ihre Tradition, im Verbandsnamen klingt der Terminus Mühle jedoch eher nach Handwerk
oder Kleinbetrieb. Kaum jemand assoziiert mit dem Begriff moderne, innovative Industrieunternehmen, die oft Milliardenumsätze erzielen.
PRODUKTIONSSICHERHEIT
Produkte der ölsaatenverarbeitenden Industrie müssen sicher sein. Die entsprechenden Vorgaben und Standards definieren das Lebensmittel- und Futtermittelrecht. Auch werden zunehmend weitere sensible Einsatzbereiche für die Oleochemie erschlossen, zum Beispiel verdrängen Pflanzenöle die Mineralöle in körpernahen Produkten wie Kosmetik, Seifen oder Reinigungsmitteln.
Sorgfältige Kontrollen entlang des gesamten Herstellungsprozesses sorgen für höchste Qualität. Sich wandelnde Ansprüche an Produktsicherheit und eine verfeinerte Analytik bewirken, dass sich die gesetzlichen Vorgaben stetig ändern.
Die Aufgaben von OVID erschöpfen sich jedoch nicht darin, die jeweiligen Änderungen an die Mitglieder zu kommunizieren und sie bei der technischen Umsetzung zu beraten: Vielmehr wird OVID auch selbst aktiv.
INFORMIERT
OVID informiert seine Mitglieder beispielsweise regelmäßig über neu auftauchende Bedrohungen und Gefahren für die Produktsicherheit.
Wenn – wie in der Vergangenheit geschehen – plötzlich giftige Stechäpfel oder Mineralölreste in Ölsaaten gefunden werden, alarmiert OVID seine Mitglieder umgehend und warnt vor einzelnen Lieferanten oder gar ganzen Lieferländern.
In den 2010er Jahren wird ein gesundheitsschädlicher Stoff entdeckt, der bei der Raffination in der Mühle entstehen kann: 3-MCPD-Fettsäureester wird 2011 durch die Weltgesundheitsorganisation als karzinogen eingestuft. OVID begleitet das Thema intensiv mit wissenschaftlichen Studien. Es zeigt sich, dass die Entstehung des Schadstoffs vermieden werden kann, indem Prozesstemperaturen und die Dauer der Verarbeitung modifiziert werden.
BIOKRAFTSTOFFE
Flüssige Energieträger aus nachwachsenden Rohstoffen erhalten Mitte der 1990er Jahre in der Branche zunehmend Aufmerksamkeit. Chemisch ist der Prozess – die Verwandlung von Pflanzenölen in Biodiesel
durch Umesterung – seit 1937 bekannt. 1977 wird das erste industrielle Verfahren patentiert.
AKZEPTANZ
Der Biodiesel wird für den VDOe früh zum großen Thema, tut sich hier doch für die Ölmühlen und die Landwirtschaft ein neues, vielversprechendes Geschäftsfeld auf: Landwirte können die durch die EU-Agrarpolitik stillgelegten Flächen nutzen, Mühlen können größere Mengen durchsetzen.
Allerdings ist Biodiesel in den 1990er Jahren längst kein Selbstläufer: Die Politik muss vom alternativen Kraftstoff überzeugt werden, vor allem aber muss bei den Automobilherstellern um Akzeptanz geworben werden, denn die Konzerne zögern, ihre Fahrzeuge hierfür freizugeben.
NEUE PLAYER
Für die VDOe-Mitglieder spielt Biodiesel in den 1990er Jahren eine sehr unterschiedliche Rolle. Die einen haben hiermit gar nichts zu tun, für andere steigt der Umfang der zu verarbeitenden Saaten erheblich an, wieder andere investieren direkt in Biokraftstoff-Anlagen. Gleichzeitig treten ganz neue Player auf den Markt, die nicht der Ölmühlenindustrie entstammen. Sie betreiben zum Beispiel lediglich Biodieselanlagen und kaufen das Rapsöl zu, oder sie setzen Altspeisefette bzw. tierische Fette als Rohstoff ein. Hieraus entsteht eine neue Branche mit eigenen Anliegen.
VERBUNDEN
Es erscheint zielführend, die Interessen der beiden Branchen durch eigene Verbände vertreten zu lassen. Im Jahr 2001 wird auf Initiative einer der größten Mitgliedsfirmen aus dem VDOe heraus der Verband der deutschen Biodieselindustrie e. V. (VDB) gegründet. VDOe und VDB bleiben zunächst eng verbunden. Bis 2008 führt Petra Sprick die Geschäfte beider Verbände, und auch beim Präsidenten gibt es eine Personalunion. Thematisch sind sich VDOe und VDB häufig nahe, in manchen Punkten gehen die Interessen hingegen auseinander, wie beispielsweise im Jahr 2008 unterschiedliche Positionierungen zur Palmölbeimischung beim Biodiesel zeigen. Es ist also durch-
aus sinnvoll, dass die beiden Verbände befreundet, aber unabhängig voneinander agieren.
SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT
Nachwachsende Rohstoffe sollen nachhaltig produziert werden.
Landnutzungsänderungen für den Anbau von Ölpalmen oder Soja, die in Biokraftstoffe oder Tierfutter fließen, widersprechen diesem Ziel. Es ist nicht hinzunehmen, dass in den Anbauländern Naturlandschaften vernichtet oder den dort lebenden Menschen die Nahrungsgrundlagen entzogen werden. Alle Stakeholder müssen an einen Tisch. Deshalb beteiligt sich OVID sowohl an dem vom World Wildlife Fund (WWF) im Jahr 2004 gegründeten Roundtable on Sustainable Palm Oil als auch am 2006 gegründeten Roundtable for Responsible Soy. Die daraus entstandene Idee der Nachhaltigkeitszertifizierung von Lieferketten unterstützt OVID durch seine Mitarbeit an der Entwicklung von Nachhaltigkeits-Zertifizierungssystemen. Soziale Nachhaltigkeit tritt seit den 2010er Jahren neben die ökologische. Unfreie Arbeit, Kinderarbeit und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen haben keinen Platz im Anbau der weltweit gehandelten und in deutschen Ölmühlen verarbeiteten Rohstoffe.
ZERTIFIZIERUNG
Die allermeisten OVID-Unternehmen partizipieren an der International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) oder einem vergleichbaren Zertifizierungssystem. ISCC steht für nachhaltige Lieferketten, in denen hohe Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Und auch bei den Sozialstandards setzt sich OVID für ein level playing field ein, also für die Gewährleistung gleicher und fairer Wettbewerbsbedingungen. Dies soll dafür sorgen, dass die deutsche ölsaatenverarbeitende Industrie nicht durch überbordende nationale oder europäische Anforderungen gegenüber ausländischen Mitbewerbern ins Hintertreffen gerät.
ALLIANZEN
Grüne Zukunftstechnologien, CO2-Reduktion, globale Nachhaltigkeit, European Green Deal, Welthandel, Lieferketten, Verbraucherschutz –diese Themen betreffen die ölsaatenverarbeitende Industrie als global
wirkende Vermittlerin zwischen Produzenten und Konsumenten im 21. Jahrhundert in vielfältiger Weise.
Die ölsaatenverarbeitende Industrie ist jedoch nur ein kleiner Teil der Agrarwirtschaft. Es gehört daher zu den selbstverständlichen Aufgaben von OVID, Allianzen zu schmieden. Manche dieser Bündnisse sind naturgemäß temporär: Denn Verbände, die bei einem Thema an einem Strang ziehen, können sich in anderen Zusammenhängen durchaus als Kontrahenten gegenüberstehen.
GRAIN CLUB
Synergien nutzen und bei den großen Fragen, die alle bewegen, gemeinsam Position beziehen: Diesen Ansatz verfolgt der 2005 gegründete Grain Club. Auf Initiative von VDOe schließen sich sechs Agrarverbände, von denen gut 20 Jahre später noch vier im Grain Club aktiv sind, zu einer Allianz aus allen Stufen der Getreide-, Ölsaaten- und Futtermittelwirtschaft zusammen. Die Zielsetzung der Verbände: besseres Gehör bei Multiplikatoren, Politikern und in der Öffentlichkeit zu finden. Kräfte zu bündeln, ist wichtig und zukunftsweisend. Politische Prozesse arbeitsteilig und verschlankt zu begleiten, schafft Effizienzen in einer komplexen Regulatorik mit zunehmender Themendichte und kurzen Reaktionszeiten. Der Grain Club wird von diesen modernen Leitgedanken angetrieben.
WIRKSAMKEIT
Die Aktivitäten dieser »Allianz des Agribusiness« sind vielfältig, die gemeinsame Arbeit ist erfolgreich. Grain Club und OVID besetzen wichtige Themen. So können sie zum Beispiel im Jahr 2012 das Dachthema »Welternährung – Wie ernährt man das globale Dorf?« sehr gut platzieren und es der Anti-Sojakampagne einiger NGOs entgegensetzen. Mit dem Trendbrief besitzt der Grain Club seit 2016 ein eigenes Medium, in dem anerkannte Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen Stellung beziehen. Den offenen und sachlichen Austausch fördern auch Formate wie die Veranstaltungsreihe »Dialog Genome Editing«, die der Grain Club mit anderen Verbänden durchführt.
Vor Bundes- und Europawahlen gehen die vier Mitgliedsverbände Der Agrarhandel e. V. (DAH), Der Deutsche Raiffeisenverband e. V. (DRV), der Deutsche Verband des Großhandels mit Ölen, Fetten und Ölroh-
stoffen e. V. (Grofor) und OVID e. V. regelmäßig mit abgestimmten Positionen an die Öffentlichkeit und entfalten so eine Wirksamkeit, die auf die gesamte Agrarwirtschaft ausstrahlt.
26 JAHRE
Am 1. November 2019 schließt sich ein bedeutendes Kapitel der Verbandsgeschichte: Petra Sprick, seit 1993 Geschäftsführerin von VDOe bzw. OVID, tritt in den Ruhestand.
Mehr als ein Vierteljahrhundert führt sie den Verband mit Weitblick, Mut und Engagement durch wechselvolle Zeiten, gibt ihm ein neues, moderneres Gesicht und wappnet ihn für die vielen neuen Herausforderungen.
Jaana Kleinschmit von Lengefeld, seit Mai 2018 Präsidentin von OVID, würdigt Petra Sprick auch als Vorreiterin. Tatsächlich ist sie in den 1990er Jahren »eine der ersten Frauen in der deutschen Verbandsszene«, die einem Industrieverband der Agrar- und Ernährungswirtschaft vorsteht.109
DOPPELSPITZE
OVID stellt sich für die Zukunft auf: Seit dem 1. September 2019 leiten Dr. Momme Matthiesen und Dr. Gerhard Brankatschk als neue Geschäftsführer die Geschicke des Verbands. Erstmals in seiner langen Geschichte wird OVID von einer Doppelspitze geführt. In einer immer komplexer werdenden Welt und unter dem Eindruck eines zunehmend spannungsgeladenen weltpolitischen Klimas erweist sich diese Konstellation als richtungsweisend.
KRISEN ALS NEW NORMAL
Wie sich bald zeigt, starten die beiden Geschäftsführer unter schwierigsten Bedingungen. Vor ihnen liegt eine Zeit multipler Krisen – nicht nur für die ölsaatenverarbeitende Industrie, sondern für alle Volkswirtschaften, Gesellschaften und Staaten weltweit. Seit Langem ist klar, dass der Klimawandel und die notwendige Transformation der Industrie eine Herkulesaufgabe bedeuten, insbesondere für die Ölmühlen, die für ihre Produktionsprozesse sehr viel Energie benötigen. Zu
109 OVID-Pressemeldung, Berlin, 02.10.2019, https://www.ovid-verband.de/artikel/meldungen/neuedoppelspitze-bei-ovid.
Beginn der 2020er Jahre kommen zwei historische Krisen hinzu: die Corona-Pandemie und – zwei Jahre später – der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022.
BEDROHTE MÄRKTE
Globale Störungen von Lieferketten, volatile Preisentwicklungen für Lebensmittel und Agrarprodukte sowie unmittelbar drohende Engpässe bei der Strom- und Gasversorgung sind Auswirkungen, die auch die Ölmühlen in Deutschland vor immense Herausforderungen stellen. Vor allem die angespannte und vielfach ungewisse Lage auf den Energiemärkten bereitet der Branche nachhaltige Sorgen. Die verstärkte Polarisierung der Welt mit zunehmenden handelspolitischen Spannungen und protektionistischen Reflexen bedroht den Warenverkehr zusätzlich.
VERSORGUNGSSICHERHEIT TROTZ WELTKONFLIKTEN
Die russische Invasion bringt die global bedeutenden ukrainischen Ölsaatenexporte beinahe zum Erliegen. Da schlechte Ernten und die Corona-Pandemie die Märkte bereits stark belasten, kommt es im Winter und Frühjahr 2022 kurzfristig zu Lieferengpässen und Preissprüngen bei Speiseölen in Deutschland.
Bilder von leeren Supermarktregalen rücken die Ölmühlen über Wochen ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Folgezeit zeigt jedoch, dass der freie Markt funktioniert und sich Warenströme bei Bedarf schnell und effizient neu ausrichten können. »Die Politik sollte dies stärker berücksichtigen, statt durch immer neue Vorgaben die Lieferketten über Gebühr zu belasten«, mahnt OVID-Präsidentin Jaana Kleinschmit von Lengefeld in einem Rückblick auf das Jahr 2022.110 Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Adressaten dieses Appells sind die Bundesregierung und mehr noch die EU: Beide sollen ihren Regulierungsdrang zügeln.
110 OVID-Pressemeldung, Berlin, 23.02.2023, https://www.ovid-verband.de/artikel/meldungen/versorgung-mit-speiseoel-trotz-ukraine-krieg-stabil.
EPILOG: MIT OPTIMISMUS IN DIE ZUKUNFT
Die Ölmühlen schaffen es selbst in diesen stürmischen Zeiten immer wieder, die Versorgung mit guten Lebensmitteln, hochwertigen Futtermitteln sowie klimaschonenden Biokraftstoffen und vielfältigen oleochemischen Grunderzeugnissen aufrechtzuerhalten. Dies spricht für ihre Leistungsfähigkeit und ihre Resilienz. Beides sind prägende Faktoren nicht nur der letzten Jahre, sondern der gesamten industriellen Geschichte der ölsaatenverarbeitenden Wirtschaft in Deutschland. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist über Jahrzehnte durch Prosperität und Wachstum gekennzeichnet. Immer wieder stehen die Branche und der Verband aber auch vor tiefgreifenden Umbrüchen, Kriegen, Krisen und Verwerfungen. Doch dank Beharrlichkeit und Innovationskraft haben sich die Ölmühlen durch diese Höhen und Tiefen hindurch in Deutschland bis heute behauptet. Lässt man im Jahr 2025 die 125-jährige Geschichte des Verbandes und seiner Mitgliedsunternehmen Revue passieren, so gibt es trotz der tiefgreifenden Umwälzungen und der oft beängstigenden Entwicklungen der Gegenwart viel Anlass, optimistisch in die Zukunft zu schauen – vorausgesetzt, Deutschland bleibt als Industriestandort attraktiv.
Die ökonomischen sowie ökologischen und sozialen Zukunftsaufgaben sind vielfältig und anspruchsvoll. Die Stärkung des heimischen Rapsanbaus, die Etablierung neuer Züchtungstechniken, die Stärkung moderner Bioökonomie, die Entwicklung nachhaltiger und zugleich stabiler Lieferketten, die Aufrechterhaltung freier Märkte sowie die klimaschonende Sicherung der Energie- und Lebensmittelversorgung – das sind einige der zentralen Handlungsfelder, auf denen sich OVID in den kommenden Jahrzehnten im Dienst der deutschen ölsaatenverarbeitenden und pflanzenölraffinierenden Unternehmen engagieren wird. OVID ist heute einer der ältesten und zugleich modernsten Akteure der deutschen Verbandswelt. Für die Bewältigung der zukünftigen Aufgaben bietet die lange und bewegte Geschichte wichtige Orientierungen.
Literatur
Weiterführende Literatur und Quellenverzeichnis
Stand: Dezember 2024
175 Jahre Vereinigte Ölfabriken Hubbe & Farenholtz 1763 bis 1938, Magdeburg 1938. 25 Jahre Stettiner Oelwerke, Stettin 1935.
Amoneit, Frank, Von der Fettlücke zum metabolischen Syndrom. 75 Jahre Fettforschung in der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft (1936–2011), hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft e. V., Frankfurt a. M. 2010.
Berichte über die Entwicklung der deutschen Ölmühlenindustrie im Jahre 1957, in: Vorträge und Berichte vom Kongress des Internationalen Ölmühlenverbandes in Brüssel vom 3. bis 6. Juni 1958, überreicht durch die Margarine-Union AG, Hamburg 1958.
Berliner Adressbücher, 1900–1945.
Boldorf, Marcel/ Scherner, Jonas (Hrsg.), Handbuch Wirtschaft im Nationalsozialismus, Berlin/Boston 2023.
Brechtken, Magnus, Die nationalsozialistische Herrschaft 1933-1939, Darmstadt 2012.
Bührer, Werner, Geschichte und Funktion der deutschen Wirtschaftsverbände, in: Wolfgang Schroeder/ Bernhard Weßels (Hrsg.), Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Wiesbaden 2017, S. 53–83.
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Hrsg.), Bericht zur Markt- und Versorgungslage: Ölsaaten, Öle und Fette 2023, Bonn 2023.
Casey, Christopher A., Nationals Abroad – Globalization, Individual Rights, and the Making of Modern International Law, Cambridge 2020.
Caspar Thywissen 1839–1989, Neuss 1989.
Christiansen, C., Die deutschen Walfangreedereien, in: Fette und Seifen, Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Fette und Fettprodukte, Organ der der Deutschen Gesellschaft für Fettforschung e. V., Januar 1938 (Heft 1), S. 39-41.
Connemann, Wilhelm, 200 Jahre Firmengeschichte, Leer 1950.
Davidsohn, J./H. Stadlinger, Hilfsbuch für das Gebiet der Fette und Fettprodukte, Leipzig 1930.
Darlegungen der Margarine-Industrie zum Beimischungszwang, Berlin 1933.
Etges, Andreas, Wirtschaftsnationalismus: USA und Deutschland im Vergleich (1815–1914), Frankfurt a. M./ New York 1999.
Feld, Ernst, Die deutsche Margarine-Industrie, Diss. Marburg 1922.
Fette und Seifen. Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Fette und Fettprodukte, Organ der der Deutschen Gesellschaft für Fettforschung e. V., Januar 1938 (Heft 1).
F. Thörl AG (Hrsg.), 75 Jahre Thörl, Hamburg 1958.
Fieldhouse, D. K., Unilever Overseas. The Anatomy of a Multinational 1895–1965, London 1978. Göhl, Walter, Mancherley Öl ich zubereit … Geschichte und Funktion einer ländlichen Ölmühle, Bonn 1991. Goss, W. H., The German Oilseed Industry, Washington 1947.
Gustav Hubbe, Hundert Jahre Magdeburger Kaufmannsfamilie, Magdeburg 1940. Hamburger Adressbücher 1947–1960.
Hansa-Mühle GmbH (Hrsg.), Soja. Ein Beitrag zur Kenntnis des Wertes der Sojabohne und ihrer Produkte für die deutsche Volkswirtschaft, Hamburg 1929.
Harburger Oelwerke Brinckman & Mergell. HOBUM (Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen Forschungsstelle Hamburg Bd. 15), Hamburg 1956.
Hefter, Gustav, Technologie der Fette und Öle. Handbuch der Gewinnung und Verarbeitung der Fette, Öle und Wachsarten des Pflanzen- und Tierreiches, II. Band: Gewinnung der Fette und Öle, spezieller Teil, Berlin/Heidelberg 1908.
Hein, Oskar, Meine Lebensgeschichte. 235 Jahre Ölmühle mit drei Generationen, Goldbach 2000. Hoff, Hans, Wirtschaftsgeographische Grundlagen, Entwicklung und heutige Standorte der Öl- und Margarine-Industrie in der Bundesrepublik Deutschland, Diss. Münster 1962. Hoffmann, Solveig, Bundeskanzler und Tüftler. Wie Konrad Adenauer vor 100 Jahren die Sojawurst erfand, in: https://www.geo.de/wissen/19165-rtkl-bundeskanzler-und-tueftler-wie-konrad-adenauer-vor100-jahren-die-sojawurst-erfand. Abgerufen am 15.12.2023.
Hoffmann, W. G., 100 Years of the Margarine Industry, in: J. H. van Stuyvenberg (Hrsg.), Margarine. An Economic, Social and Scientific History 1869–1969, Liverpool 1969, S. 9–36. Höh, Hartmut, Weltmarkt für Ölsaaten und Ölschrote. Analyse von Struktur und Verlauf, Diss. Gießen 1989. Kaiser, Bernd, Die Implikationen wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen für die Rohstoffbeschaffung internationaler Industrieunternehmen und sich hieraus ergebende Unternehmensstrategien am Beispiel der Henkel-Gruppe, Diss. Nürnberg 2009.
Kemper, Claudia/Rentschler, Hannah, Handlungsspielräume und Verantwortlichkeiten der Handelskammer Hamburg während der NS-Zeit. Einordnungen und biografische Annäherungen, Berlin 2023.
Klein, Benedikt, Der Kampf gegen das Margarine-Monopol. Eine Streitschrift für die Freiheit der Wirtschaft und das Wohl des deutschen Einzelhandels, Köln 1930.
Kleinfeld, Ralf, Die historische Entwicklung der Interessenverbände in Deutschland, in: Thomas Winter/ Ulrich Willems (Hrsg.), Interessenverbände in Deutschland, Wiesbaden 2007, S. 51–83.
Knips, Achim, Deutsche Arbeitgeberverbände der Eisen- und Metallindustrie 1888–1914, Stuttgart 1996. Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette (Hrsg.), Wirtschaftsgesetzgebung auf dem Gebiete der pflanzlichen und tierischen Öle und Fette während der Kriegsjahre 1915/16 abgeschlossen am 1. April 1916, Berlin 1916.
Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1915. Streng geheim, Berlin [1916].
Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1916. Streng geheim, Berlin [1917].
Langthaler, Ernst, Völkischer Produktivismus. Nationalsozialismus und Agrarmodernisierung im Reichsgau Niederdonau 1938-1945, in: Zeitgeschichte 45. Jg. 2018, S. 293–318.
Leibold, Wilfried/Poss, Richard, Die Mühlhauser Ölmühle, Mühlhausen 1996.
Lennerts, Leonhard, Ölschrote, Ölkuchen, pflanzliche Öle und Fette, Hannover 1984.
Menzel, Gerit, Deutscher Walfang: Das »Schließen der Fettlücke« auf See, in: Hansa – International Maritime Journal, 158 Jg. 2021, Heft 12.
Modest, Werner, Das Recht der Öl- und Fettwirtschaft, Berlin 1938. Muchow, Heinz, Wie sich das Ackerbürgerstädtchen Wittenberge zu einer Industriestadt entwickelte. Die wichtige Etappe der Stadtgeschichte vom 19. Jahrhundert bis etwa Mitte des 20. Jahrhundert, o. O. 2001. Münkler, Herfried, Der Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918, Berlin 2013. Muths, Margarete, Die deutsche Fettlücke und die Möglichkeit ihrer Schließung durch die Rückgewinnung der ehemaligen deutschen Kolonien, Bottrop 1938.
Noblee & Thörl, 28.11.1855 bis 28.11.1955 Harburg, Hamburg 1955.
Noblee & Thörl, 7 Jahre Wiederaufbau bei Noblee & Thörl, ms. o. J. [1956].
Die deutsche Oelmühlen-Industrie: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V., Berlin 1925.
Otting, Arnold, Die Stellung Hamburgs in der Organisation des Welthandels mit pflanzlichen Ölrohstoffen und den Erzeugnissen der Ölmüllerei, Berlin 1925.
Pammer, Michael/ Neiß, Herta / John, Michael (Hrsg.), Erfahrungen der Moderne, Festschrift für Roman Sandgruber zum 60. Geburtstag, Stuttgart 2007.
Petzina, Dietmar, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 1968. Pfister, Ulrich, Die Bildung des ersten deutschen Nationalstaats und der Übergang zum modernen Wirtschaftswachstum, in: Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs ab 1871 – Lehren für die heutige Zeit?, in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg. 2021, Heft 4, S. 247–250.
Plumpe, Werner, Ein wilhelminisches Wirtschaftswunder?, in: Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs ab 1871 – Lehren für die heutige Zeit? , in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg. 2021, Heft 4, S. 250–253.
Possel, Ernst, in: Georg Wenzel, Deutsche Wirtschaftsführer, Leipzig u. a. 1929, S. 1730f. Reader, W. J., Fifty Years of Unilever 1930-1980, London 1980.
Reith, Reinhold, „Hurrah die Butter ist alle!“ „Fettlücke“ und „Eiweißlücke“ im Dritten Reich, in: Michael Pammer/Herta Neiß/Michael John (Hrsg.), Erfahrungen der Moderne, Festschrift für Roman Sandgruber zum 60. Geburtstag, Stuttgart 2007, S. 402–426.
Rickmers, Peter F., Die Öle und Fette in Wirtschaft und Technik, Augsburg 1951.
Rohlack, Momme, Kriegsgesellschaften (1914–1918). Arten, Rechtsformen und Funktionen in der Kriegswirtschaft des Ersten Weltkrieges, Frankfurt a. M. 2001.
Röver, Carl, Deutscher Walfang, in: Fette und Seifen, Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Fette und Fettprodukte, Organ der der Deutschen Gesellschaft für Fettforschung e. V., Januar 1938 (Heft 1), S. 17–18. Schanetzky, Tim, Kanonen statt Butter. Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich, München 2015. Schroeder, Wolfgang/Weßels, Bernhard (Hrsg.), Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Wiesbaden 2017.
Schüttauf, Werner, Die Margarine in Deutschland und in der Welt, 5. Auflage, Hamburg 1969.
Shurtleff, William/Akiko Aoyagi (comp.), History of Soybeans and Soyfoods in Germany (1712–2016). Extensively annotated Bibliography and Sourcebook, 2nd. ed. Lafayette/USA 2016. Skalweit, August, Die deutsche Kriegsernährungswirtschaft, Stuttgart u.a. 1927.
Sparenberg, Ole, „Segen des Meeres“. Hochseefischerei und Walfang im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik, Berlin 2012.
Spoerer, Mark/ Streb, Jochen, Guns and butter – but no margarine: The impact of Nazi economic policies on German food consumption, 1933-38, FZID Discussion Paper 23–2010. Thywissen, Caspar, der Mensch und sein Werk, aus Anlass der Hundertjahrfeier der Fa. Thywissen, Neuss 1939.
Van Stuyvenberg, J. H. (Hrsg.), Margarine. An Economic, Social and Scientific History 1869–1969, Liverpool 1969.
Verhandlungen des Reichstags, XII. Legislaturperiode, II. Session, Stenographische Berichte, Band 259, von der 23. Sitzung am 25. Januar 1910 bis zur 43. Sitzung am 24. Februar 1910, Berlin 1910.
Vorträge und Berichte vom Kongress der Internationalen Ölmühlenverbandes in Brüssel vom 3. bis 6. Juni 1958, überreicht durch die Margarine-Union AG, Hamburg o. J. [1958].
Wegener, H., Die Bedeutung des Walfanges für die deutsche Ernährung, in: Fette und Seifen, Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Fette und Fettprodukte, Organ der der Deutschen Gesellschaft für Fettforschung e. V., Januar 1938 (Heft 1), S. 5–7.
Wiedenfeld, Kurt, Die Organisation der Kriegsrohstoff-Bewirtschaftung im Weltkriege (Schriften zur kriegswirtschaftlichen Forschung und Schulung. Bd. 11), Hamburg 1936.
Wiesbadener Adressbuch, 1950.
Willemsen, Heinrich, Die Entwicklung der deutschen Oelmühlenindustrie in der neueren Zeit, in: Die deutsche Oelmühlen-Industrie: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V., Berlin 1925, S 59–99.
Wilson, Charles, The History of Unilever. A Study in Economic Growth and Social Change, Volume I & II, London 1954.
Wilson, Charles, The History of Unilever. A Study in Economic Growth and Social Change, Volume III, London 1964.
Wimmer, Florian, Die völkische Ordnung von Armut. Kommunale Sozialpolitik im nationalsozialistischen München, Göttingen 2014.
Winter, Thomas/Willems, Ulrich, Interessenverbände in Deutschland, Wiesbaden 2007.
Wolf, Nikolaus, Deutschland in der ersten Globalisierung, in: Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs ab 1871 – Lehren für die heutige Zeit?, in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg. 2021, Heft 4, S. 254–258.
Zimmermann, Hans-Georg, Die Sonnenblume, Berlin 1958.
Zeitschriften (1900–1960)
Allgemeine Zeitung für Mitteldeutschland
Bergischer Landbote
Berliner Börsen-Courier
Berliner Börsen-Zeitung
· Berliner Tageblatt
Der Spiegel
Die Zeit
Die Glocke
Essener Allgemeine Zeitung
· Essener General-Anzeiger für Groß-Oberhausen und das nord-westliche Industrie-Gebiet
Hakenkreuzbanner
Hamburger Fremdenblatt
Hamburger Tageblatt
Hamburgischer Correspondent
· Handelsblatt des Berliner Tageblatts
· Herforder Kreisblatt
· Kölnische Zeitung
Mitteldeutsche Wirtschaftszeitung
Reichsanzeiger
Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung
· Stuttgarter NS-Kurier
Südwestdeutsche Handels- und Wirtschafts-Zeitung
Tecklenburger Landbote
· Volkswacht
· Wittener Volks-Zeitung
· Wittgensteiner Kreisblatt
OVID-Archiv
· Geschäftsberichte, Mitgliederversammlungen
1. Ordner 1-3/1
Protokolle Mitgliederversammlung Verband Deutscher Ölmühlen e.V., VDÖ (MV, in der Regel 2 x p. J) per Rundschreiben (RS) Jährliche Geschäftsberichte per RS 1950–1966
2. Ordner 1-3/1
Protokolle Mitgliederversammlung VDÖ per RS
Jährliche Geschäftsberichte VDÖ per RS 1967–1974
3. Ordner 1-3/1
Protokolle Mitgliederversammlung VDÖ per RS
Jährliche Geschäftsberichte VDÖ per RS 1974–1982
4. Ordner 1-3/1
Protokolle Mitgliederversammlung VDÖ per RS Jährliche Geschäftsberichte VDÖ per RS 1983–1988
5. Ordner 1-3/1
Protokolle Mitgliederversammlung VDÖ per RS
Jährliche Geschäftsberichte VDÖ per RS 1988–1995
6. Ordner 1-3/1
Protokolle Mitgliederversammlung VDÖ per RS
Jährliche Geschäftsberichte VDÖ per RS 1995–2000
7. Ordner 1-3/1
weitere Protokolle Mitgliederversammlung VDÖ per RS weitere jährliche Geschäftsberichte VDÖ per RS
Allgemeiner Schriftverkehr 1997–2000
Vorstand
1. Ordner 1- 3/2
Vorstandsprotokolle VDÖ per RS 1972–1990
2. Ordner 1- 3/2
Vorstandsprotokolle VDÖ per RS 1990–2000
3. Ordner 1- 3/2
Vorstandsprotokolle VDÖ per RS Sonstige RS 1998–1999
1. Ordner B
Protokolle, Schriftverkehr, Organisatorisches Vorstand/MVs VDÖ per RS 1992–1993
2. Ordner B
Protokolle, Schriftverkehr, Organisatorisches Vorstand/MVs VDÖ per RS 1993–1994
Ordner
Vorstandssitzungen – Anlagen, div. Schriftverkehr, Materialien, Übersichten 2009–2014
Ordner
Vorstandssitzungen/Workshops – Anlagen, div. Schriftverkehr, Materialien, Übersichten 2012–2016
Ordner
Vorstandssitzungen – Anlagen, div. Schriftverkehr, Materialien, Übersichten 2017–2019
Filmprojekte
Ordner 1-7/6
Konzepte, Organisatorisches 1978 bis 1989
Ehrungen
Ordner 1-47/4-1 Ehrungen H. Jühe
· Fotografien
Album
50-jähriges Jubiläum des VDÖ, 26.10.1950
Album
“Verbandsfotoalbum” (50-jähriges Jubiläum des VDÖ, 26.10.1950), inkl. Liste der abgelichteten Personen
Album
58th Congress of Int. Assoc. of Seed Crushers, Mai 1982, München, inkl. Liste der abgelichteten Personen
Album (nur z. T. gefüllt)
Verbandshaus Kronprinzenstraße Bonn Bad Godesberg: Mitarbeiter, Geschäftsführung, Betriebsausflüge 80er-Jahre, inkl. Liste der abgelichteten Personen
Mappe
75 Jahre VDÖ e.V. 1975, inkl. Liste der abgelichteten Personen
Album
20 Jahre für OVID: W. F. Thywissen, Mai 2018
· Videos
Die Ölmühlenindustrie, VDÖ VHS
Öle – Fette – gesunde Ernährung (Didaktik), VHS 1994.
Sonstiges
Ordner
Verbandsbezogene Unterlagen und Korrespondenz von A. F. Mergell 1970–1992
Ordner
mit einigen verstreuten Presseausschnitten, Notizen, Korrespondenz, Fotos zur Verbandsgeschichte aus dem Privatbesitz von Vorstandsmitgliedern 1958–2000
Ordner
FEDIOL-Generalversammlung (überwiegend Organisatorisches), Dresden 1994
Ordner
Versammlungen International Assoc. of Seed Crushers, IASC 1997–2001
Broschierte Geschäftsberichte: VDÖ/OVID, 1994 bis 2011
Broschierte Jahresberichte: OVID Gemeinschaftswerbung Futtermittel, 2009 bis 2014
Diverse lose Blätter / nicht veröffentlichte Druckschriften / Exposees: Textbausteine zur Geschichte des Verbandes (2 Seiten)
100 Jahre VDÖ, Hier geht‘s rund, Event-Ideen, Köln 2000.
Geschichte der Ölmühlen (Brökelmann, ca. 40 Seiten: Zeitleiste)
CD-ROM: Geschichte der Ölmühlen Willemsen
Das Verbändehaus (Juli 2000, anlässlich der Eröffnung)
Kommunikationskonzept an den VDÖ: Analyse und Empfehlungen, abgeleitet von explorativen Interviews, Dez. 1988.
Rechtsgutachten im Auftrag des VDÖ zu einer Verfassungsbeschwerde, April 1964. VDÖ-Übersicht: Klein-Ölmühlen in Deutschland, April 2021.
Verbands- und Unternehmensbroschüren mit historischem Bezug: Otto Aldag GmbH, Firmenbroschüre
25 Jahre UFOP, Berlin 2015.
Geschenk der Sonne: Pflanzliches Öl, hrsg. v. VDÖ, o.J.
Kurzporträt Soya Mainz.
Natur und Technik. Die deutsche Ölmühlenindustrie, hrsg. v. VDÖ 1981. Ölpflanzen, Pflanzenöle, Margarine, Vom Rohstoff zum Verbraucher, 1980.
Die Struktur der dt. Ölmühlenindustrie, DLG, 3/1997 (Sonderdruck)
Die Struktur der Rapsverarbeitung in Deutschland, hrsg. v. VDÖ, o.J.
Die Walter Rau Gruppe, o.J. Zukunft tanken. Weiter geht’s. Jubiläumsbroschüre 20 Jahre VDB, 2011.
Weitere Archive
Amtsgericht Bonn
Vereinsregisterauszug Verband Deutscher Oelmühlen e. V., VR 22938 Nz Amtsgericht Charlottenburg
Vereinsregisterauszug Verband Deutscher Oelmühlen e. V., VR 2175
· Unternehmensarchiv C. Thywissen GmbH, Neuss
Nr. 3, Faszikel 4
Nr. 6, Faszikel 3
Nr. 34, Faszikel 6
Nr. 23, Faszikel 6
· Konzernarchiv Henkel AG & Co. KGaA
Acc. 5, Nr. 1030
Acc. 205, Nr. 261
Acc. 272, Nr. 11
Acc. 572, Nr. 3087
· Landesarchiv Berlin
A Rep. 342-02, Nr. 60738, Handelsregistereintrag Deutsche Ölmühlen-Rohstoffe GmbH
B_Rep_025-03, Nr. 4002/50, Wiedergutmachungsverfahren Sophie Silten geb. Igel/Deutsche ÖlmühlenRohstoffe GmbH, betr. Rückgabe Grundstück Landgrafenstraße 17
Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland
NW 1010, Nr. 3710, Entnazifizierungsakten Willemsen, Arnold
NW 1010, Nr. 6793, Entnazifizierungsakten Willemsen, Heinrich
NW 1010, Nr. 17424, Entnazifizierungsakten Willemsen, Heinrich Staatsarchiv Ludwigsburg E 170 Bü 1812