

 Natalie J. Kohler
Natalie J. Kohler






 Natalie J. Kohler
Natalie J. Kohler



14 Sinnbild Biene
Eine mythologische Reise
108 Hofstaat & Untertanen
Der Geschlechterkampf
124 Alle lieben Maja
Faszination Biene Maja
138 Was wir von den Bienen lernen können
152 Einsteins weise Worte
Das Bienensterben
168 Die Sprache des Tanzes
Von der Kommunikation unter Bienen
184 Die Biene in Architektur, Kunst & Design
19 Eine Bienenkarriere
31 Honigmet-Rezept
45 Propolis - Erfindung der Mumie
57 Wachs - Kaugummi der Antike
65 Ein Bienenjahr
75 Süsser Bienenstich
83 Honig - Heilkraft & Stresskiller
95 Bienengift als Heilmittel
104 Gelée Royale - königliche Nahrung
110 Die Königin
114 Die Arbeiterin
118 Der Drohn
121 Der Bien
131 Biene Maja - Eine Namensanalyse
164 Imkerei für Beginner
173 Düfte als Wegweiser
« D ie Welt ist ein Bienenstock; wir treten alle durch dieselbe Tür ein, aber leben in verschiedenen Zellen.» Sprichwort
Im Lauf der letzten paar Jahre ist das Interesse an der Biene stetig gestiegen. Prominente wie David Beckham posten stolz ihr erstes Bienenhaus und den selbstgeschleuderten Honig. Gerade unter jungen Leuten entwickelt sich der Drang, mehr über die Natur und die Welt, in der wir leben zu erfahren. So zähle auch ich mich dazu und möchte mit diesem Buch meinen Beitrag leisten.
Wie die Bienen und ich zueinanderfanden? Vermutlich liegt der Ursprung zwei Generationen zurück, damals, als mein 18-jähriger Grossvater beschloss eigenhändig ein Bienenhaus zu bauen. Sein Vater war wenig begeistert und das Geld war kurz nach Kriegsende knapp. Doch das hielt ihn nicht davon ab und so schenkte ihm der Nachbar sein erstes Bienenvolk. Unzählige Male fuhr er abends mit seinem Drahtesel an die Treffen des örtlichen Imkervereins. Nicht lange blieb es bei nur einem Bienenvolk. Teilweise fanden bis zu zehn Völker in seinem Häuschen Platz. So zieht sich diese Beziehung über mehrere Jahrzehnte hinweg bis sie das Alter und die Gesund -
heit nicht mehr zuliessen. Notgedrungen sprang die nachfolgende Generation ein und war wenig später ebenfalls im Bann der Bienen gefangen. Ob Schicksal oder Zufall, wurde meine Mutter mit meiner Schwester schwanger und konnte den einjährigen Bienenkurs nie beenden. Doch knapp sechzehn Jahre später übernahm dies meine Schwester.
Während sich meine Schwester schon früh mit Leidenschaft dem Imkerhandwerk widmete und gerne selbst mit den Händen anpackte, nahm ich mehr und mehr die Rolle des stillen Beobachters ein. In einem viel zu grossen Bienenanzug stand ich bewundernd daneben und versuchte durch das Gitternetz vor meinen Augen etwas zu erkennen. Schliesslich wollte ich die reale Biene Maja sehen, mit der ich mich doch so sehr identifizierte. So war es auch die Biene Maja, die mich in die kunterbunte Welt des Filmes, der Kunst und der Literatur führte.
Den meisten unter uns dürfte der 2012 erschienene Film «More than Honey» von Markus Imhoof ein Begriff sein. Mehr als Honig, diese Worte erfassen die Seele und das Ziel dieses Buches glänzend. Denn die Honigbiene ist mehr, als nur Lieferant des süssen Genusses, der in unseren Supermarktregalen zu finden ist. Nur ist die Biene zu bescheiden, um uns ihre volle Pracht vorzuführen, wie es vielleicht der Pfau gerne tut. Um die filigranen und sensiblen
Wesen besser verstehen zu können, muss man schon etwas genauer hinschauen und sich hin und wieder Zeit lassen – egal, ob bei einem sonnigen Spaziergang oder beim Lesen dieses Buches. Es wird sich lohnen!
Sie haben uns Vieles voraus, egal, ob in ihrer Politik oder der erstklassigen Baukunst. Selbst ihre historische Präsenz in unzähligen Überlieferungen längst vergangener Zeiten ist enorm. Über kaum ein anderes Tier wurde so ausführlich dokumentiert, philosophiert, musiziert, sinniert oder am Lagerfeuer rezitiert. Ganze Völker und Stämme ehrten sie, im Wissen ihrer bedeutenden Rolle in der Natur und der Abhängigkeit des Menschen von der Biene. Unseren Vorfahren war also trotz häufig fehlender Wissenschaft sehr wohl bewusst, wie wichtig die Biene für uns Menschen ist und was sie uns alles geben kann, wenn wir ihr nur ein wenig Raum gewähren. Da ist es doch etwas beunruhigend, wie wenig Menschen sich heutzutage im Vergleich zu früher um die Bienen interessieren, obschon es noch nie so einfach war an dieses Wissen zu gelangen oder Forschung zu betreiben.
Und exakt an dieser Stelle soll nun dieses Buch seinen Auftritt erhalten. Es dient als eine Einleitung in die wichtigsten Gebiete der Kunst- und Kulturgeschichte der Honigbiene. Auf Seite 238 befindet sich eine Literaturliste mit ausgewählten Büchern für die besonders Wissensdurstigen unter uns.

Wer versucht, Mythen mit rational-logischem Verstand zu fassen, kann genauso gut einem Blinden die Farben erklären. Mythen sind weder im naturwissenschaftlichen Sinn zu verstehen, noch können sie in unser Zeitverständnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingeordnet werden. Vielmehr sprechen sie durch die entstehenden Gedankenbilder und knüpfen Brücken zu unserer Gefühlswelt - zeitlose Seelenbilder des menschlichen Lebens.
Aber was genau ist ein Mythos? Selbst bei dieser einfachen Frage trifft man auf erhebliche Definitionsprobleme, die Bücher füllen. Wie der griechische Gott Proteus, kann der Mythos die verschiedensten Gestalten annehmen und bleibt doch immer ein und derselbe – der Versuch, die Entstehung des Wunders Natur zu ergründen.
Die vielen Künste und Gaben der Biene verleitete den Menschen schon früh zu tiefer Verwunderung und den Drang, dieses Wunderwesen zu verstehen. Die Vermutung eines göttlichen Ursprungs lag dabei nahe. Die Faszination der Biene war so gross,
dass unzählige Hochkulturen und Völker – von den alten Ägyptern, den gebildeten Griechen bis hin zu den im Norden sesshaften Wikingern - unabhängig voneinander begannen, die Wichtigkeit dieser zu erkennen und sie in höchster Form zu ehren. So entstanden die sonderbaren, fantastischen Legenden und Mythen früherer Zeit.
Auf den folgenden Seiten wird das mystische Türchen zu den bekanntesten mythologischen Formen der Biene einen Spalt weit geöffnet.


Yggdrasil, der Lebensbaum, auch Lärad genannt, hat in der nordischen Mythologie eine bedeutende Rolle inne. Meist wird er als Esche, manchmal auch als Eibe verstanden. Er stellt die Weltenachse dar, denn um ihn dreht sich der gesamte Kosmos. Somit eignet er sich optimal als Startpunkt unserer mythologischen Reise.
Mit seinen Zweigen, die bis weit in den Himmel emporrecken, umgibt er die Welt und verbindet so deren lichten wie auch dunklen Bereiche. Seine drei Wurzeln sind tief in der Erde verankert und halten den Baum aufrecht.
Die erste Wurzel reicht zum Himmel der Asen an den Fluss Äsir, wo sich der heilige Brunnen Urds befindet, die Gerichtsstätte der nordischen Götter. Daneben steht das Haus der drei Nornen – Urd, Skuld und Verdani. Sie bestimmen die Lebenszeit jedes Menschen.
Die zweite Wurzel bildet eine Verbindung zum Ort der Frostriesen, den Hrimthursen. Dort befindet sich ebenfalls ein Brunnen, der Brunnen Mi -
mirs. Odin schenkte dem alten Mimir einst sein rechtes Auge als Pfand und erlangte so die Weisheit Mimirs und Einsicht in die Geheimnisse der Welt. Was genau Mimir mit Odins Auge vorhatte, will man vermutlich lieber nicht wissen. Bei alten Männern, die scharf auf Augäpfel sind, sollte man sowieso vorsichtig sein.
Die dritte Wurzel des Yggdrasil erreicht das Reich der Toten – Niflheim. Niflheim beherbergt Hwergelmir, die Quelle aller Flüsse, welche von dem Drachen Nidhöff von unten angenagt wird. Wie genau man im Stande ist, Wasser anzunagen, weiss vermutlich nur dieser Drache. Holzwürmer schaffen das bekanntlich nur bei Holz.
Im Stamm des Yggdrasil hauste vor geraumer Zeit das erste Bienenvolk. Die drei Schicksalsgöttinnen schöpften Wasser aus dem heiligen Brunnen unter dem Bienenvolk und sprengten es über die Blätter des Lebensbaumes. Und vielleicht veranstalteten sie hin und wieder eine Wasserschlacht. Die Tage können auch bei den Göttern lang sein.
Der Tau oder auch das Lebenswasser, das von Yggdrasil auf die Welt tropfte, wurde Honigfall genannt. Von ihm ernährten sich die Bienen und so auch die beiden ersten Menschen, die dem Yggdrasil entsprungen sind. Daher gilt der Honig in der nordischen Mythologie als Saft der Fruchtbarkeit und Urnahrung der ersten Menschen.
Auch eine einfache Honigbiene fängt klein an. Erst als Putzhilfe und Kindermädchen, weiter zum Bauarbeiter und zur Polizei, bis sie schlussendlich als heldenhafte Pilotin hinaus in die grosse Welt darf und die Spitze der Karriereleiter erklommen hat.
Tag 1-2
Frisch geschlüpft und schon heisst
es Zellen putzen und Brut wärmen.
Tag 3-5
Füttern der älteren Larven, die kleinen vertraut man ihr noch nicht an. Milch zubereiten will schliesslich gelernt sein.
Tag 6-11
In der Babystube. Füttern der jüngsten Larven.
Tag 12-17
Karriere auf der Baustelle. Futterumtragen, Wachserzeugung und Wabenbauen.
Tag 18-21
Passierschein, bitte!
Fluglochwache.
Tag 22-35
Guten Flug!
Blütenbesuch mit Blütenbestäubung und Sammeln von Nektar, Pollen, Kittharz und Wasser.
Tag 36-45
Lebensende.

« E ine Esche weiss ich, heißt Yggdrasil, Den hohen Baum netzt weißer Nebel; Davon kommt der Tau, der in die Täler fällt. Immergrün steht er über Urds Brunnen.
Davon kommen Frauen, viel wissende,
Drei aus dem See dort unterm Wipfel.
Urd heißt die eine, die andre Verdandi: Sie schnitten Stäbe; Skuld hieß die dritte.
Sie legten Lose, das Leben bestimmten sie
Den Geschlechtern der Menschen, das Schicksal verkündend. »
Edda
Met ist eines der ältesten alkoholischen Getränke, sogar älter als Bier und Wein. Zu seiner Zubereitung wurde Honig mit Wasser und Pflanzenteilen oder Wurzeln vermengt und gegärt - Experimentalküche direkt aus dem Wald. Das Verfahren zur Herstellung ist den Menschen bereits seit ältester Zeit bekannt.
Die spontane Verwandlung von Honigwasser in ein äusserst geschmackvolles Getränk mit der berauschenden Wirkung des Alkohols machten den Met in der germanischen/nordischen Mythologie zum Geschenk der Götter - auch Asen genannt.
Aufgrund dieses spontanen Gärungsprozesses muss der Imker peinlich genau kontrollieren, dass der geerntete Honig keinen zu hohen Wassergehalt hat.
Der Met galt als Trank der Götter und ehrwürdiger Helden. Durch ihn erlangte man Weisheit und die Unsterblichkeit der Seele. Ihm wurde eine solch grosse Bedeutung zugesprochen, dass er in vielen skandinavischen Legenden erwähnt wird. In Skandinavien erzählte man sich – natürlich im züngelnden Licht des Lagerfeuers – dessen Entstehung folgendermassen:

Kwasir, der Überbringer göttlicher Weisheit, wurde von den beiden Zwergen Fialar und Galar kaltblütig ermordet (an dieser Stelle tanzen die Schatten des Lagerfeuers bedrohlich entlang der Baumstämme).
Sein Blut sammelten die Beiden in drei Schalen, die sie Geisteskraft, Erinnerung und Botschaft nannten.
Sie mischten das Blut (die göttliche Weisheit) mit Honig (der himmlischen Schönheit) und stellten daraus Met her. Wer nun von diesem trank, erlangte nicht nur Weisheit, sondern erhielt auch die Gabe des Gesangs und der Dichtkunst. Die Riesen setzten daraufhin die Zwerge unter Druck und zwangen sie, ihnen den Met zu übergeben. Die Zwerge hatten aufgrund des massiven Grössenunterschieds keine andere Wahl. Die Riesen hielten auch nicht viel von Chancengleichheit. Die Riesen waren jedoch keine begnadeten Denker und wussten nicht, was sie nun mit dem Trank anfangen sollten. Also versteckten sie ihn in einer Kristallhöhle in den Bergen. Gunnlöd, die Tochter des Riesen Baugi, musste von diesem Tag an die Höhle bewachen.
Der Mythos Ödrörir erzählt von dem Vorhaben Odins den Dichtermet nach Asgard - dem Reich der Götter - zu bringen. Odin begehrte den Met als Gott der Dichtkunst sehr und wollte ihn unbedingt in seine Heimat holen. Wie in fast allen Sagen, Legenden und Geschichten gestaltete sich dieses als schwieriges Unterfangen und forderte viel Einfalls -
reichtum seitens Odin. Um an den Met zu gelangen, reiste er, als Landstreicher verkleidet, zum Riesen Baugi und dessen Familie. Diese waren im Besitz eines Bergs mit der Metquelle. Jedoch wurde kein einziger Tropfen des Mets an Fremde vergeben und so musste sich Odin etwas geistreiches einfallen lassen. Doch er wäre nicht Odin, wenn ihm dies nicht gelang. Zunächst versuchte er sich als Knecht bei Baugi zu verdingen. Dafür hetzte er die beiden Knechte des Baugi aufeinander, welche sich kurz darauf gegenseitig töteten. Odin wurde Baugis Knecht und schuftete über ein Jahr lang so hart, wie es nur neun Knechte vermochten. Als Lohn versprach ihm Baugi einen Schluck des Dichtermets aus dem Berg. Der letzte Tag kam und Baugi führte Odin zu seinem Bruder, der den Zugang zur Kristallhöhle mit dem Dichtermet bewachte. Dieser wollte ihm jedoch keinen Tropfen abgeben und verwehrte ihm den Einlass. Der listige Odin überredete daraufhin den ratlosen Baugi, mit Hilfe eines Bohrers ein Loch in den Berg zu bohren. Baugi gehorchte. Kaum war das Loch gebohrt, verwandelte sich Odin in einen kleinen, zierlichen Wurm und verschwand durch das Loch ins Innere des Bergs. Der Kessel mit dem Dichtermet aber wurde von Gunnlöd, der Tochter von Baugi, bewacht. Wieder war Odins Verstand gefragt. So verwandelte sich Odin in seine eigentliche göttliche Gestalt zurück und umwarb Gunnlöd mit
seinem Charme. Gunnlöd verneigte sich ehrfürchtig vor ihm und freute sich über den Besuch, denn Felswände sind nicht sonderlich geschprächig. Drei Liebesnächte verbrachten Odin und Gunnlöd miteinander. Als Dank reichte sie ihm drei Schalen mit Met. Sogleich verwandelte sich Odin in einen prächtigen Adler und flog aus dem Kristallsaal. Der Bruder des Riesen ahnte den Diebstahl und jagte ihm nach, es gelang ihm jedoch nicht, Odin einzufangen. Odin kehrte erfolgreich nach Asgard zurück, wo bis zum heutigen Tag mit Met gefüllte Kelche aufbewahrt werden.
Sollte es also jemandem gelingen, nach Asgard zu finden, wird er garantiert keinen Durst leiden und bestimmt die ein oder andere Party feiern.
Der Honigmet wurde nicht nur auf Festen in rauen Mengen getrunken, sondern er diente auch kultischen Handlungen, da er ja als Trank der Götter galt. So war natürlich der ausschweifende Genuss von diesem alkoholischen Getränk gleichzeitig auch Götteropfer. Wie praktisch!
Die Edda enthält detaillierte Beschreibungen von diversen Saufgelagen und den Folgen am nächsten Tag. Die Gelage waren wegen des göttlichen Hintergrundes aber eben nicht nur Besäufnisse, sondern zeitgleich auch Opferhandlungen. Prinzipiell unterschied man damals zwischen Opfergabe und Feier einzig, wem man die verspeisten Lebensmittel
« R asch im Fluge die Freud‘ umarmen, leise nur den Mund ihr berühren, wie die Biene Nektarblumen berührt, o Freund, versetzt uns unter die Götter.»
Friedrich von Matthisson
widmete. Nicht selten sprach man auf jeden einzelnen der Götter einen Toast aus. In der nordischen Mythologie sind das mehr als fünfzig.
Equipment:
1 Wasserkocher
1 Wasserglas
1 Eimer, 12 Liter
1 Trichter
1 Schneebesen
1 Gärverschluss
1 Gärballon 10 – 15 Liter
Zutaten:
3 kg Honig
1,5 Liter Apfelsaft naturtrüb
5 Liter Wasser abgekocht
5 Tabletten Hefenährsalz 0,8 g
5 g Reinzuchthefe / Trockenhefe
Etwas Kieselsol aus der Apotheke
1. Zunächst wird das Equipment mittels kochendem Wassers desinfiziert.
2. Anschliessend wird die Hefekultur angesetzt. Dafür nimmt man ¼ Liter von dem naturtrüben Apfelsaft, gießt diesen in ein steriles Glas und rührt vorsichtig die Hefe ein, deckt das Ganze ab und lässt es ca. 1 ½ Stunden an einen warmen Ort gehen.
3. In der Zwischenzeit das Wasser abkochen. ACHTUNG, wichtig dabei ist, dass das Wasser erneut auf max. 25° Celsius abgekühlt ist, da die Hefe höhere Temperaturen nicht überlebt.
4. Das abgekühlte Wasser, den Honig und den restlichen Apfelsaft in den sterilen Eimer geben und gut vermischen.
5. Die Hefekultur unterheben und unter zu Hilfename des Trichters in den sterilen Gärballon geben.
6. Den Gärballon mit einem Gärverschluss verschließen und an einem warmen Ort gären lassen.
7. Ab diesem Zeitpunkt ist es wichtig, den Ballon jeden Tag mindestens einmal zu schwenken, damit sich die Hefe nicht absetzt. Nach 4 Wochen den Ballon nicht mehr schwenken.
8. Nach ca. 8 Wochen ist die Gärung beendet. Dies wird daran erkennt, dass keine Blasen mehr im Gärröhrchen aufsteigen. Falls doch noch Blasen aufsteigen unbedingt noch warten!
9. Ist es so weit, fügt man das Kieselsol hinzu, dieses sorgt dafür, dass die Hefe ausschlackt und zu Boden sinkt.
10. Mit Hilfe eines Weinhebers, oder auch unter zu Hilfenahme eines Läuterschlauches, kann der Met in Flaschen abgefüllt werden.
11. Der Met ist jetzt ca. drei Monate haltbar.
Es handelt sich hier um einen trockenen Met, wer es süßer mag kann nach dem Abziehen von der Hefe mit etwas Honig nachsüßen.
Wichtig: Aufgrund der Gasbildung darf man einen Gärbehälter niemals luftdicht verschliessen!
Die zahlreichen Belege der Bienenzucht im alten Ägypten liess die Wissenschaft vermuten, dass die Ägypter die Bienenzucht erfunden hätten. Jedoch zeigte sich in den fünfziger und sechziger Jahren, dass diese Annahme falsch war. Man fand besonders auf dem Gebiet der heutigen Türkei Einrichtungen, die belegen, dass die Hausbienenhaltung schon wesentlich älter ist. Ihre Ursprünge liegen in den frühneolithischen Dorfkulturen Zentralasiens. Die Grundkenntnisse über die allgemeine Haltung von Haustieren breitete sich vermutlich schon im Verlauf der «neolithischen Revolution» im 6. und 5. Jahrtausend v. Chr. von Asien über Unterägypten aus. Erst im 4. Jahrtausend v. Chr. kam es zu einer allgemeinen Verbreitung der Bienenzucht im Nildelta und gleichzeitig zur Erhebung der Biene zum Wappentier von Unterägypten, was ihre hohe Bedeutung zu dieser Zeit unterstreicht.
Honig war im vorderen Orient, vor Allem in Ägypten, ein unglaublich wichtiges Produkt. Deshalb hatte die Biene seit Beginn der ägyptischen


«Bei einem furchtbaren Unheil, das über die Erde kam, weinten Götter, Menschen und Tiere. Auch der Sonnengott Re weinte. Tränen flossen von seinem Auge zur Erde. Sie verwandelten sich in Bienen. Durch das Werk der Bienen entstanden Blumen und Bäume. Das ist der Ursprung des Wachses und des Honigs aus den Tränen des Gottes Re.»
Ausschnitt eines ägyptischen Weltschöpfungsmythos aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.
Kultur eine entscheidende Rolle inne. Neben Öl und Weihrauch wurden Wachs und Honig als Opfergaben verwendet.
Laut einer ägyptischen Legende soll die Biene aus den Tränen des Sonnengottes Re entstanden sein und ihm dabei geholfen haben, die Welterschaffung zu vervollständigen. Deshalb lassen sich oftmals Abbildungen von Bienen in Heiligtümern ägyptischer Tempel finden.
Die Bienenhieroglyphe, die sich an vielen Tempeln, Monumenten und Gräbern findet, hat jedoch nichts mit der Imkerei zu tun. Sie war Teil des Pharaonentitels, genauer gesagt, stand sie als Symbol für den König von Unterägypten. So wurde auch häufig der Beiname «Fürst Biene» dem Königsnamen vorangestellt und stand im späteren Verlauf als allgemeines Symbol der Ahnenkönige.

Die Pharaonen übertrafen sich an Opfergaben für die Götter und so wurde Honig aufgrund des unglaublichen Verbrauches zu Mangelware. Und Ägypten war kein kleines Land. Die Tempelpriester selbst hielten Bienenbeute und trotzdem musste Honig aus Syrien, Mesopotamien und Kanaan – von dem es
wohl nicht umsonst schon damals hiess, es sei das Land in dem Milch und Honig fliesse – importiert oder in Raubzügen erobert werden. Der Honig gehörte zu den Luxusgütern und hatte einen so hohen Wert, dass er auf der gleichen Preisebene wie ein Rind oder ein Esel stand. Teilweise wurde Honig höher gehandelt, als heutzutage der Kaviar.

Eine Beamtenlaufbahn garantierte Zugang zu Honig. Schon unter Ramses II genoss diese Berufsgruppe so manche Privilegien, zu denen unter anderem die Auszahlung eines Teils ihres Gehaltes in Form von Honig gehörte. Auch die Bauern entrichteten einen Teil ihrer Steuern in Form von Honig. Heute erscheint das undenkbar, doch zur Regierungszeit Ramses war das üblich, denn dieses Naturprodukt war kostbar und besass einen heute kaum mehr vorstellbaren Stellenwert in Ernährung und Medizin. Auch damals war Honig schon die Grundlage für wertvolle Kosmetika. Nofretete, eine Mitregentin unter Echnaton, bewahrte ihre legendäre Schönheit unter anderem mit reinem Honig. Mit Aloe Vera vermischt nutzte sie ihn als Hautpflegemittel. Ausserdem badete sie in Milch und Honig.

Die ägyptisch-griechische Legende der Bienengeburt aus dem Stier war eine der bekanntesten im alten Ägypten. Sie besagt, dass aus rituell getöteten Stieren Bienen geboren werden, welche als Sinnbild der Wiedergeburt galten. Der Stier war für die alten Ägypter ein heiliges Tier, denn er verkörperte nicht nur die Naturkraft, sondern auch die göttliche Kraft und das schöpferische Wort. Auserwählte Stiere wurden an jährlich stattfindenden rituellen Festen den Götter geopfert.
Der römische Dichter Vergil (70-19 v.Chr.) schrieb die Legende nieder. Er erzählte davon, wie Euridike, die Frau des Orpheus, auf der Flucht vor Aristaios den Tod fand. Aristaios war der Sohn des Gottes Apollo und Gott der Imkerei, Jagd sowie der Schafzucht. Zur Strafe verlor Aristaios all seine Bienen. Gemeinsam mit der Hilfe der Nymphen und seiner Mutter Kyrene, der Jagdgöttin, fand er zu einem Ungeheuer. Aristaios siegte über das Ungeheuer und bekam von ihm den Rat Stiere zu opfern, um den Tod Euridike zu sühnen. Aus den Tierkadavern stiegen Bienen empor, welche Aristaios einsammelte und so seine Position als Gott der Imkerei zurückerlangte.
Der heilige ägyptische Stier hiess Apis. Interessant ist, dass Apis heute der wissenschaftliche Name der Honigbiene ist. Es ist aber nicht geklärt, ob zwi -

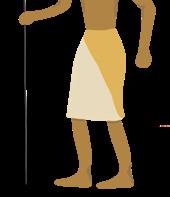





































































































































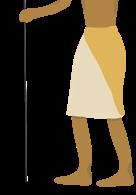




















schen den beiden eine Verbindung besteht. Die Ansichten bezüglich des Ursprungs des Namens Apis für Honigbienen gehen weit auseinander. Jedoch weisen auch die Sternbilder am Himmel auf eine Beziehung zwischen Stier und Biene hin. Wenn die Sonne im Mai im Sternbild des Stieres steht, schwärmen die Bienen.
Der Stier und die Biene stehen nebst der Weisheit auch als Zeichen der Fruchtbarkeit. Der Stier ist die Verkörperung der geballten, gefährlichen Naturkraft, welche sich vor dem Pflug als nützlich erweist. Der kräftige Stier ermöglicht Ackerbau, birgt aber auch Gefahren. Die zierliche Biene ist jedoch mit ihrer Bestäubung genauso wichtig für die Landwirtschaft. Ihre Natur- und Schöpferkraft ist im Vergleich zum Stier aber nie zerstörerisch. Aus diesem Grund verkörpert die Biene das Sinnbild der idealen Menschenkultur.
Auf der abgebildeten Gemme – ein geschnittener Schmuckstein – ziehen anstelle der zwei Ochsen zwei Bienen den Pflug. Vermutlich sollte damit die Weisheit und «Harte Arbeit – Süsser Lohn» verbildlicht werden. Dort, wo die Biene pflügt (bestäubt), ist das Land in doppeltem Sinne fruchtbar, es gedeiht Agrikultur sowie Menschenkultur.
Ein aus dem Mittelalter stammenden Deutungsansatz sieht darin die drei guten Prinzipien des menschlichen Lebens:
Die Herrschaft des Weisen, die Pflege und Bewirtschaftung des Landes und die Erholung und Süssigkeit des Honigs.

Aus der Zeit des alten Reiches, das um 2635 v. Chr. begann und zu einer Blütezeit in der ägyptischen Kunst führte, liegen zahlreiche bildliche Zeugnisse zur ägyptischen Imkerei vor und zeigen ihren hohen Entwicklungsstandard.
Die Bienen wurden in aufeinandergestapelten Tonröhren gehalten, die mit Nilschlamm verschlossen und anschliessend mit dem Finger mit einem kleinen Flugloch versehen wurden. Aus diesen Röhren entnahm man den Honig nach Ausräuchern des Volkes, ohne die Bienen dabei zu töten – man wollte schliesslich den Sonnengott nicht erzürnen. Zur Vorratshaltung wurde der Honig in speziellen Gefässen versiegelt.
Ein Flachrelief aus dem Sonnenheiligtum des Pharaos Ne-user-Re zeigt eine sehr ausführliche
Imkerszene, bei der man die verschiedenen Arbeitsschritte von der Entnahme des Honigs aus den Tonröhren über die Reinigung der Vorratsgefässe bis zur abschliessenden Versiegelung von Kugeltöpfen sehen kann.

Drangen in die Bienenstöcke Mäuse ein, taten die Bienen, was sie auch heute noch tun: Sie opferten ihr eigenes Leben zum Schutz des Bienenvolks und töteten die Eindringlinge mit Hunderten giftiger Stichen. Nun sind die Mäusekörper zu schwer, um von den Bienen aus dem Nest geschafft zu werden. Doch wenn sie im Stock verwesen, bringen sie die Gesundheit des gesamten Volkes in grösste Gefahr. Was tun die Insekten? Sie stoppen den Verwesungsprozess, indem sie den Körper mit einer luftdichten Schicht aus Wachs und Propolis überziehen. Das beobachteten die ägyptischen Imker, und vielleicht kam so die Idee der Mumie in die Welt.
Bäume scheiden über ihre Knospen, Blätter und Zweige einen Harz aus, um sich vor Infektionen zu schützen. Diesen nutzen die Bienen indem sie ihn sammeln, verarbeiten und Spalträume im Bienenstock damit abdichten. Propolis wirkt antibakteriell, antiviral und fungizid und dient deshalb als Desinfektionsmittel, mit dem die Bienen die Waben und Mäuse oder andere tote Tiere im Stock desinfizieren. So werden diese durch die Propolisschicht mumifiziert und das Bienenvolk geschützt. Dementsprechend wird das griechische Wort Propolis aus pro (vor) und polis (Stadt) zusammengesetzt und heisst wörtlich: vor der Stadt, Stadtmauer, Stadtschutz.








« D ie Geizigen teilen das Los der Biene: sie arbeiten, als ob sie ewig leben würden.»
Demokrit


460-370 v. Chr.


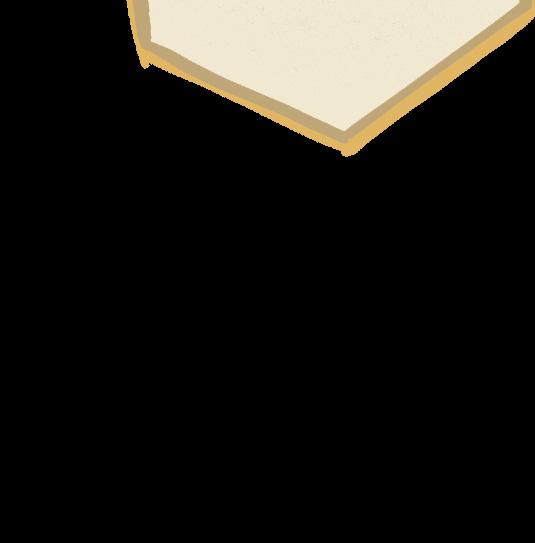





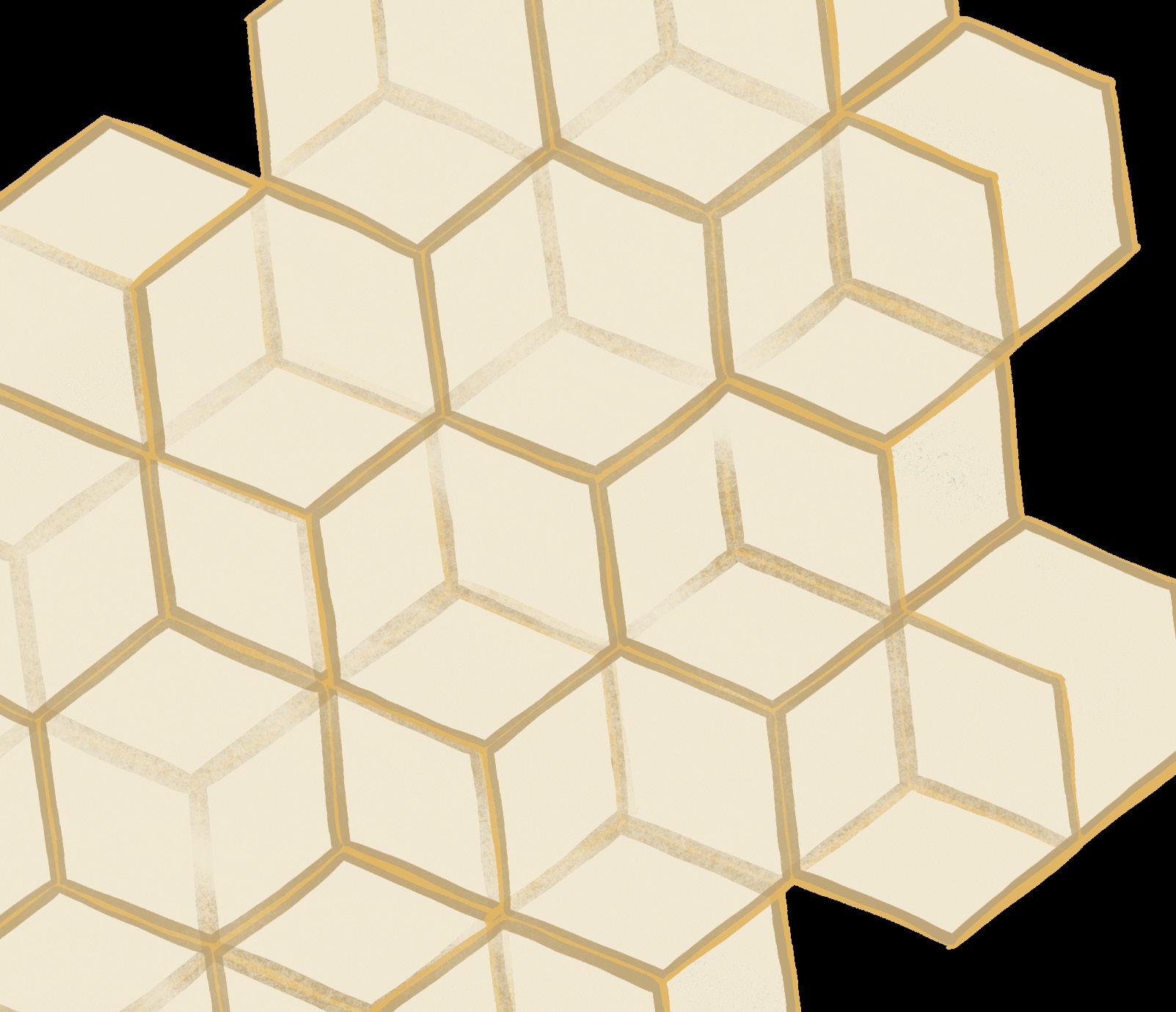


Ägyptens Nachfolger als Kulturzentrum der westlichen Welt war Griechenland. Die Griechen der Antike waren die ersten, die sich theoretisch mit dem Wesen der Biene, der Staatenbildung und der Honiggewinnung auseinandersetzten. Bereits 600 vor Chr. gab es in Griechenland eine voll entwickelte und gesetzlich geregelte Imkerei.
Laut griechischer Mythologie gab es die Bienen und den Honig schon immer, der Mensch kam erst später auf die Welt. Dasselbe sagt auch die heutige Naturwissenschaft nach den neusten Erkenntnissen.
Selbst als die grossen Götter Zeus und Dionysos geboren wurden, waren die Bienen bereits da. Der Honig nährte und beruhigte die Götterkinder.
Dionysos, Sohn des Zeus, war Gott der Fruchtbarkeit und des Weinbaus sowie des aufblühenden Frühlings. Auch er wurde von Honig genährt.
Ein weiterer Mythos berichtet davon, dass er auf einer Reise «herumirrende Bienen gezähmt» und in eine Baumhöhle gewiesen hat. Diese Erzählung bedeutet zweierlei:

Zum einen hatte Dionysos den Menschen gezeigt, wie man die Bienen zähmt, also wie geimkert wird. Ebenso symbolisieren die «herumirrenden» oder auch schwärmenden Bienen eine auswandernte Menschengruppe, die eine neue griechische Kolonie gründet und von Dionysos mit Honig belohnt wird. Noch heute bedeutet «La colonie» im Französischen «das Bienenvolk».
Auswandernde Menschen, die ihre einstige Heimat aufgrund von Hungersnot verlassen mussten, folgten oftmals schwärmenden Bienenvölkern. Denn wo diese sich niederliessen, dort war die Erde fruchtbar.
Auf altgriechischen Münzen aus Dyrrhachion –heute Durres in Albanien - Wurde das Sinnbild einer Kuh, einer Biene und eines Bienenstocks geprägt. Alle drei symbolisieren das «gelobte Land, wo Milch und Honig fliessen». Die Milch, sprich die nährende Kuh, verbildlicht, dass die Menschen sesshaft werden und die Landwirtschaft gedeiht. Der Honig (Biene und Bienenstock) besagen, dass Menschenkultur erblüht.

Der grosse Begründer der Bienenzucht war Aristaios. Er war der Sohn des Gottes Apollon und der Nymphe Kyrene. Es waren ebenfalls die Nymphen, die Aristaios in die Bienenhaltung einführten. Nymphen werden auffallend viel als Honignährerinnen und Bienenlehrerinnen der Götter beschrieben.
Nymphen waren grosse, weibliche Naturgottheiten, die die Erde beseelten und deren Bäume, Quellen und Brunnen.
In der heutigen Imkerei wird das schneeweisse Puppenstadium der heranwachsenden Biene kurz vor dem Schlüpfen als Nymphe bezeichnet.
Aristaios lehrte den Menschen nicht nur das Handwerk der Imkerei, sondern auch das Herstellen von Käse und den Anbau von Oliven. Den neusten Funden zu urteilen, nahm die Käseherstellung ihren Ursprung vor etwa 11‘000 Jahren, zu jener Zeit also, als die Menschen begannen sesshaft zu werden. Man nimmt an, dass damals auch die Bienenhaltung begann.
Bei den Griechen war die Biene ein Symbol der Reinheit, weil sie alles Unreine meidet und ihre Nahrung nur aus Blüten sammelt. Ausserdem symbolisierte sie Fleiss, Wohlstand und Unsterblichkeit. Bienen verliehen Beredsamkeit und Gesang. Sie waren die Vögel der Musen, denn das Summen wurde oftmals mit dem Gesang gleichgesetzt und stellte eine Verbindung zu den Musen her, welche

«Die grosse Muttergöttin Rhea versteckte ihren neugeborenen Sohn Zeus in einer Höhle auf der Insel Kreta, um ihn vor seinem hungrigen Vater Kronos zu schützen. Nymphen, weibliche Naturgottheiten, nährten den Göttersohn mit Ziegenmilch und Honig. Sie hiessen Amaltheia, die Ziege, und Melissa, die Biene.»
oftmals auch Nymphen waren. Bienen die sich auf dem Mund eines Menschen niederliessen, waren ein Zeichen oder in Bildern ein Symbol für Beredsamkeit. Vielen Dichtern wurde ein solches Erlebnis nachgesagt. Einige Dichter behaupteten sogar, dass sie als Kind von Bienen ernährt worden seien und dies der Ursprung ihrer Weisheit sei.
Pausanias, ein griechischer Schriftsteller und Geograph, berichtet eine Legende, deren zufolge die Bienen den Tempel Apollos bauten. Es war eine Hütte aus Wachs und Federn. Apollo war als Sonnengott Garant für den Frühling und Bruder der Artemis, dadurch stand er der Demeter, der Fruchtbarkeits- und Erdgöttin, nahe.
Die Priesterin oder das Orakel von Delphi wurde Biene genannt, ebenso die Priesterinnen des Demeter-Heiligtums in Eleusis und der Artemis-Kultstätte in Ephesos, Sizilien. Die Priesterinnen wurden vermutlich deshalb so genannt, weil sie wie die Bienen «Dienerinnen und Gesandte der Götter» waren und über hellsichtige Begabungen verfügten. Ihre Weissagungen waren angeblich so rein wie Honig.
Doch die Bienen sind nicht nur lieblich und unschuldig, wie die Menschen erfahren haben. Sie können auch rauben, stechen und töten. Jedoch wurde das Rauben und Stechen nicht als Böse abgetan, sondern als reinigend empfunden. Der Bienenstich wurde als Warnung für ein persönliches
Fehlverhalten verstanden. Das war wohl auch der Grund, weshalb die Imker in der griechischen Mythologie sehr strenge Verhaltensregeln befolgen mussten. So durften sie zum Beispiel vor der Arbeit mit den Bienen keinen Alkohol konsumieren und mussten fasten sowie sexuellen Kontakt meiden.
In Volkstümlichen Bräuchen leben einige dieser Verhaltensregeln weiter. So sagt der schweizerische Volksmund:
«Wer flucht, schwört beim Bienenstand, den sticht die Biene in die Hand.»
Betrachten wir die Bienenkulturentwicklung des alten Griechenlands, muss ein bedeutender Name genannt werden: Aristoteles (384-322 v. Chr.). Es gibt vermutlich kaum eines der wichtigsten wissenschaftlichen Gebiete, mit dem er sich nicht befasst hatte. So war es auch Aristoteles, der uns in seinem Werk «Historia Animalium» die ersten Einblicke in das Leben der Biene liefert und beschreibt dort den äusseren Bau und die Sinnesorgane, die Lauterzeugung, die Reproduktion und Entwicklung der Brut.
Obwohl er die verschiedenen Stadien von der Made bis zur schlüpfenden Jungbiene sehr genau beschrieb, gelang es ihm nicht, die Geschlechter der Bienen zu bestimmen oder eine Königin bei der Eiablage zu beobachten. Denn für Aristoteles waren
« A ls Amor in den goldnen Zeiten
Verliebt in Schäferlustbarkeiten Auf bunten Blumenfeldern lief,
Da stach den kleinsten von den Göttern Ein Bienchen, das in Rosenblättern,
Wo es sonst Honig holte, schlief.
Durch diesen Stich ward Amor klüger.
Der unerschöpfliche Betrüger
Sann einer neuen Kriegslist nach:
Er lauscht in Rosen und Violen; Und kam ein Mädchen sie zu holen, Flog er als Bien heraus, und stach.»
Gotthold Ephraim Lessing
die stachellosen keine männlichen Tiere, betrachtete er doch den Stachel als Waffe und somit ein männliches Merkmal.
Umgekehrt erkannte er die stachelbewehrten Arbeiterinnen nicht als Weibchen, obwohl sie für die Brutpflege verantwortlich waren.
Das neunte Buch seiner «Historia Animalium» stammt aber nicht aus seiner Feder, sondern von einem unbekannten, aber offenbar erfahrenen Imker. Dieser beobachtete, dass in einem Bienenstock normalerweise nur eine Königin lebt, dass das Volk zugrunde geht, wenn die Königin stirbt und keine weitere nachgezogen werden kann.
Aristoteles Interesse galt der Biene als Lebewesen und weniger dem Imkerhandwerk, deshalb erfährt der Leser auch nichts über die damalig gebräuchlichen Bienenhäuser. Aber es liegt nahe, dass auch die Griechen die Tonröhren benutzten.
Auch andere berühmte Philosophen befassten sich ausgiebig mit der Honigbiene, deren Wesen und Haltung. Um einige der bekanntesten zu nennen:
Pythagoras, Demokrit, Epikur von Samos, Heraklit, Platon, Sokrates und Thales von Milet.
Anknüpfend an das Wissen und die Kultur der Griechen übernahmen die Römer viele Erkenntnisse, die die Imkerei betrafen und erhielten so vieles des antiken Wissens am Leben.
Entstehung: Mit Hilfe des selbstproduzierten Wachs bauen Bienen die vollkommen gleichmässigen Waben, die sie als Honig-, Brut-, Pollen- und Wärmespeicher benutzen. Nach 21 Tagen besitzt die Arbeiterin auf der Bauchseite ihres Hinterleibes vier spezialisierte Hautdrüsenpaare - die Wachsdrüsen - in denen das Wachs produziert wird. Diese Wachsdrüsen schwitzen das flüssige Wachs aus, das an der Luft sofort zu feinen, weissen Wachsplättchen erkaltet. Diese Plättchen bearbeitet die Biene mit ihrem Mundwerk bis es die richtige Konsistenz hat und vermischt es mit einem Drüsensekret.
Rohstoffe & Produktion: Die wichtigsten Rohstoffe für die Wachsbildung sind Honig oder Zuckerwasser und Pollen. Pollen muss unbedingt vorhanden sein damit die Jungbienen Energie tanken können, sonst wird in ihrem späteren Leben die Wachsproduktion darunter leiden. Während der Wachstumsphase des Volkes zwischen April und Juni wird das meiste Wachs produziert. Die Wachsproduktion eines Volkes ist eine enorme Energieleistung. Für ein Nest
mittlerer Grösse bauen die Bienen ca. 100‘000 Brutund Vorratszellen. Dafür benötigen sie 1200 Gramm Wachs. Klingt nach erstaunlich wenig, jedoch sind für 100 Gramm Wachs schlappe 125‘000 Schuppenplättchen notwendig.
Farbiger Wachs: Erst ist der Wachs nahezu weiss. Später – nachdem die fleissigen Bienen mit ihren Blütenpollen übersäten Beinchen darüber gehastet sind – wird er hellgelb bis dunkelgelb. Durch Propolis und Pollenaromastoffe erhält der Wachs seine wohlriechende Duftnote. Ist der Wachs dunkelbraun bis schwarz, sind die Waben alt und durch viel Larvenkot verschmutzt und müssen vom Imker eingeschmolzen werden.
Inhaltsstoffe: Zwei Drittel des Bienenwachses bestehen aus Fettsäuren, Alkoholen (Estern), Kohlenwasserstoffen und freien Säuren sowie geringen Spuren anderer Substanzen. Das andere Drittel besteht aus Melissinsäure, gesättigten Kohlewasserstoffen und Aromastoffen. Die Zusammensetzung dieser Inhaltsstoffe können von Bienenvolk zu Bienenrasse unterschiedlich sein.
Exakt im Lot: Mit dem Wabenbau wird am Höhlendach begonnen und Schicht für Schicht die genau lotrecht hängende Wabe gebaut. Die feinen Sinnes -
häärchen an den Beinen zeigen ihr die exakte Richtung der Schwerkraft. Sozusagen ein eingebautes Lot.
Das IPad der Griechen: Bienenwachs war in der Antike für die Schreibkunst unentbehrlich. So schrieben die Schüler, Gelehrten, Kaufmänner bis hin zum Politiker allesamt mit einem Griffel in das Wachstäfelchen. Papyrus und Pergament waren Luxus und für Bücher bestimmt, so war das Täfelchen im Alltag allgegenwärtig. Es war das Notizbuch der Antike und bot bestimmt auch schon damals Platz für Kritzeleien gelangweilter Schüler. Dieses entzückende Schreibutensil hatte vermutlich sogar Aristoteles beim Sortieren seiner vielen Gedanken geholfen.
Kaugummi der Antike: Aus einigen Quellen ist zu entnehmen, dass oftmals Gelehrte während schwerer Denkprozesse den Wachs in kleinen Kügelchen gekaut haben.
Wachsmalerei: Wachs wird in der Malerei als Bindeoder Befestigungsmittel genutzt. Enkaustik bezeichnet das Einschmelzen des Wachses in die Fläche des Bildes mit Hilfe eines heissen Eisens.
Produkte: Kerzen, Lippenstift, Gummibärchen

Auch bei den Römern rankten sich zahlreiche Mythen um den Honig. Eine davon ist die des neugeborenen Jupiters, der in einer Höhle vor Saturn versteckt wurde, damit dieser ihn nicht hinunterschlingen und töten konnte. Es waren die Bienen, die ihn im Schutz der Höhle mit Honig versorgt und ihn so vor dem Hungertod bewahrt hatten. Zum Dank schenkte Jupiter den Bienen die Fähigkeit, den Honig in Wachstafeln als Winterfutter zu verwahren.
Wie zuvor schon erwähnt, beriefen sich die Römer oftmals auf das Wissen der Griechen in Sache Imkerhandwerk und entwickelten es weiter. So berichten verschiedene Schriftsteller von der Bienenhaltung, aus der Zeit kurz vor und nach Christus. Unter ihnen Varro (116-27 v.Chr.), Vergil (70-19 v. Chr.) und Lucius Columella (bis 70 n. Chr.).
Gesprochen wurde von grossen Imkereien, die teilweise bis zu fünftausend Kilogramm in einem einzelnen Jahr Ertrag hervorbrachten.
Zum Vergleich: ein einzelnes Bienenvolk produ -
ziert durchschnittlich pro Jahr zwischen 20 bis 80 Kilogramm.
Obschon die gehobenen Stände der römischen Gesellschaft auf ihren Ländereien Imkereien betrieben und Kenntnisse über Bienen besassen, irrten sie sich in einigen wichtigen Punkten, die die Ökologie und das Verhalten der Biene betreffen. So behaupteten Plinius und andere, dass die Königin über keinen Stachel verfüge. Ausserdem waren sie der festen Überzeugung, dass der Honig vom Himmel fiel! Und von dort in die Blüten fand, aus denen dann die Bienen den Honig sammelten. Weiter schrieben sie, dass die Biene das Wasser im Haarkleid und nicht im Honigmagen sammelt.
Abgesehen von diesen Irrtümern, überlieferten die Römer durchaus fortschrittliche und nützliche Tipps und Tricks zur Bienenhaltung.
Columella berichtet über verschiedene Beuten und gibt den dringenden Rat, die Beuten nicht zu kaufen, sondern selbst herzustellen, um der Verbreitung von Krankheitserregern entgegenzuwirken. Er bevorzugte Beuten aus Schilf und Kork, da sie in den heissen Sommermonaten für eine optimale Abkühlung und im Winter für die entsprechende Wärme sorgten.
Er verneint hingegen den Gebrauch von Gefässen aus Ton, wie es üblicherweise die Ägypter taten, da sie im Sommer viel zu hohe und im Winter zu tiefe
Temperaturen verursachten und empfahl die etwas bessere Alternative aus Weidengeflecht oder auch hohlen Baumstämmen.
Wer nicht auf die uns bereits bekannten Mäusemumien im Stock treffen will, weist er daraufhin, dass die Fluglöcher nicht grösser sein sollten, als eine Biene, im Sommer auch mehrere nebeneinander, damit sich die Flugbienen in grösserer Zahl schneller hinein- und hinausbewegen konnten.


« W as dem Schwarm nicht nützt, das nützt auch der einzelnen Biene nicht. »
röm. Kaiser Marc Aurel
Januar
Die Bienen befinden sich in der Winterruhe und bilden eine Wintertraube, eine kugelförmige Traube aus Bienen, in der sie mit Hilfe ihrer Flugmuskulatur und Futter als Brennstoff heizen. Damit erreichen sie bis zu 25 Grad. Auch Bienen kuscheln auf ihre Weise. Alle paar Wochen macht der Imker einen Kontrollgang und überprüft anhand des ruhigen Brausens den Gesundheitsstand des Volkes.
Februar
Sobald die Aussentemperatur erstmals
12 Grad erreichen, machen sich ein paar Bienen zu ersten Reinigungsflügen auf. Der Imker sorgt für eine saubere Umgebung im und um das Bienenhaus. Zusätzlich wird im Umkreis von 200 Metern eine Wassertränke bereitgestellt.
Der Frühling erwacht aus der winterlichen Starre und so auch das Bienenvolk. Eifrig wird der Betrieb im Stock wieder aufgenommen und Waben für den Nachwuchs errichtet. Auch hier unterstütz sie der Imker, indem er ihnen alte, gefüllte Futterwaben und vorbereitete Brutwaben in den Stock hängt.

April
Der Nachwuchs floriert wie die Blüten auf der Frühlingswiese. An einem Tag schlüpfen um die 300 junge Bienen. Der Imker vergrössert das Bienenhaus und bietet ihnen mehr Platz für Brut und Honigeinlagerungen. Die grosse Anzahl an Drohnenbrut wird durch herausschneiden verkleinert, um den Befall durch Varroamilben zu reduzieren.
Die Zeit der Schwärme beginnt. Das Volk teilt sich auf, eine Hälfte zieht mit der alten Königin los, die andere verbleibt mit der frisch geschlüpften Königin im Stock. Der Imker siedelt ausgeschwärmte Völker mittels Schwarmkiste in einem leeren Bienenhaus an.
Das Bienenvolk erreicht seine volle Stärke und das Honiglager ist prall gefüllt. Die Ernte des Blütenhonigs kann nun erfolgen und mittels einer Honigschleuder aus den Waben gewonnen werden.
Innerhalb eines Monats hat das unermüdliche Bienenvolk die Lager erneut komplett ausgelastet. Die Blüten auf den Wiesen verschwinden und die Zeit des dunklen Waldhonigs bricht an. Gegen Ende des Monats kann meist ein zweiter Schleudertag stattfinden.
wird gelegt. Die Varroabehandlung wird durchgeführt. Die Bienen werden aufgefüttert, damit sie möglichst gesunde Winterbienen heranziehen können und gestärkt in die kälteren Monate starten können.
Nach Abschluss der zweiten Varroabehandlung wird das Auffüttern beendet. Die Hauptarbeit des Imkers in diesem Jahr ist getan.

Oktober
Der Platz im Bienenstock wird wieder verkleinert und das Flugloch wird zum Schutz vor Mäusen, die vor der Kälte in den warmen Stock flüchten, auf 7 Millimeter zurückgestellt.
Eine Oxalsäure Behandlung gegen die Varroamilbe wird durchgeführt. Alte, verschmutzte oder zerstörte Waben werden eingeschmolzen und gesäubert, um mit dem Wachs neue Wabenwände zu giessen.
Die Winterruhe tritt ein und die Arbeit bei den Bienen pausiert bis auf die wenigen Kontrollgänge. In den stillen Wintertagen wird Material für das kommende Jahr vorbereitet und der Weihnachtsverkauf des Honigs beginnt. Sinken die Temperaturen weit unter null Grad, wird das Bienenheim mit wärmenden Isolationsmatten oder Pferdehaarkissen eingepackt.

Im Mittelalter erlebte die Bienenhaltung eine Hochblüte. Zwischen 300 bis ca. 1500 n. Chr. hatte ein Bienenvolk erneut den gleichen Wert wie eine Kuh oder ein Esel erreicht, was das letzte Mal einige Jahrhunderte zuvor bei den Ägyptern der Fall war.
Die Bienen hatten zu dieser Zeit einen Prominenten Verehrer; Karl den Grossen. Karl hatte ein besonderes Auge auf die Bienenhaltung in seinem Reich. So wurde aufgrund einer Initiative Karls sogar die Todesstrafe auf Bienendiebstahl verhängt, hinzu kam eine neunfache Schadensersatzzahlung. Hier wird schnell klar, welchen Stellenwert die Biene im Mittelalter inne hatte. Karl erliess aber nicht nur scharfe Strafgesetze, sondern setzte sich auch aktiv für die Förderung der Bienenhaltung ein. Beispielsweise mussten auf jedem kaiserlichen Grundstück Bienen gehalten und durch einen professionellen Imker betreut werden. Wer sich wei -
gerte, konnte sich auf einen unangenehmen Besuch der Regierung gefasst machen.
Neben der Haltung im Bienenhaus war die Honigjagd, also das Sammeln von Wildhonig, sowie die Wildbienenzucht weit verbreitet. Honigjäger –Zeidler genannt – sammelten gewerbsmässig Honig von wilden oder halbwilden Bienen und waren sehr angesehene Personen in der mittelalterlichen Gesellschaft. So sehr, dass sie sogar Waffen auf sich tragen durften. Der Beruf des Zeidlers erforderte besonderen Mut, schliesslich stellte man sich meist ohne jegliche Schutzkleidung einem wütenden Bienenvolk. Das Wort «Zeidler» stammt von dem Lateinischen Wort «excidere» ab, was so viel wie herausschneiden bedeutet. Das Herausschneiden bezieht sich darauf, dass Zeidler – oftmals in den Bäumen hängend – die Waben aus dem Stock herausschnitten. Anders als die Imker achteten die Zeidler nicht darauf, dass der Fortbestand des Bienenvolkes gewährleistet war. Es ging ihnen ausschliesslich um die Gewinnung von Honig und Wachs. Letzteres fand einen grossen Abnehmer in der katholischen Kirche, doch dazu später mehr. Der Zeidler besass das Recht, in einem ihm zugeteilten Waldstück geeignete Bäume mit seinem Zeidelbeil auszuhöhlen, um Nistmöglichkeiten für Wildbienen zu schaffen.
Für das Zeideln wurde den Bäumen die Wipfel abgeschnitten, dies hatte zur Folge, dass die Stamm- 72 -
dicke zunahm und sie zugleich von Blitzschlägen verschont blieben. Diese Behausungen nannte man Klotzbeute. Sie stellte die einfachste Form der Bienenbehausung dar.
In der Schweiz wurde jedoch nicht diese weiterentwickelte Form der Zeidlerei betrieben, sondern die einfache Honigjagd. Auf die unhandlichen Klotzbeuten wurde verzichtet. Anstelle dieser nutzte man unter anderem Strohkörbe oder Rutenkörbe. Die Menschen schienen keine grosse Angst vor den Bienen zu haben, denn sie stellten die Körbe nahe an die warme Hauswand. Und im Winter, wenn es kalt wurde, trugen sie sie in die Scheune oder in die Besenkammer. An wärmeren und sonnigen Wintertagen nahmen sie die Körbe sogar mit nach draussen, damit die Bienen für ein paar Stunden ausfliegen konnten. Man hielt sie wie Haustiere.
Es war nicht nur Karl der Grosse, der die Bienenhaltung dermassen florieren liess. Einen weiteren grossen Beitrag leistete die katholische Kirche. Bereits 400 n. Chr. wurde Bienenwachs als «heiliger Stoff» in die Kirche aufgenommen und für den Gottesdienst als obligatorisch befunden. Da zu dieser Zeit noch niemand den Begattungsakt einer Biene beobachten konnte, ging man davon aus, dass die Bienen jungfräulich sind. Aufgrund dessen war Wachs das Sinnbild für Christus, den seine Mutter Maria jungfräulich geboren hatte.
Der Bienenstaat wurde rege von den Katholiken als Muster für die Gläubigen angepriesen. In einer Vielzahl von Lobesliedern findet sich die Biene wieder. So schrieb im 13. Jahrhundert der heilige Antonius:
«Christus, unser König, flog zu uns aus seinem Bienenstock, welcher die Brust seines Vaters ist. Ihm sollten wir folgen wie gute Bienen.»
Auch in den Schriften finden sich mehrere Worte zu der Biene. In den Offenbarungen der heiligen Birgitta heisst es:
«Ich bin Gott der Schöpfer der Welt. Ich bin der Herr und Besitzer der Bienen. Aus meiner glühenden Liebe und mit meinem Blut gründete ich meinen Bienenstock, der die Heilige Kirche ist. In ihr sollen sich die Christen versammeln und in gemeinsamen Glauben und gegenseitiger Liebe verweilen.»
So findet sich auch die Bienengeburt nicht nur bei den Ägyptern und Griechen, selbst in der Bibel erscheint sie. Samson tötete auf dem Weg zu seiner Braut einen jungen Löwen. Einige Zeit später kehrte er zum Löwenkörper zurück und fand darin ein Bienenvolk. Samson ass vom Honig und stellte den - 74 -
Wie der bekannte Kuchen wohl zu seinem stacheligen Namen kam? In der Stadt Andernach am Rhein kennt die Bäckerjungensage jedes Kind und wird auch heute noch gerne von den Einheimischen vorgetragen. Laut dieser soll im Jahr 1474 ein Streit zwischen den Andernachern und den Linzern vom gegenüberliegenden Rheinufer entfacht sein. Die Linzer waren sauer, weil der Kaiser ihnen den Zoll der Rheinschifffahrt entzogen und ihn stattdessen Andernach zugesprochen hatte. Die Andernacher waren bekannt für ihr nächtelanges Feiern und kamen morgens entsprechend spät aus ihren Federn. Man nannte sie deshalb auch «Siebenschläfer». So griffen die gewitzten Linzer in den frühen Morgenstunden an. Jedoch wollten auch die beiden Bäckerjungen Fränzje und Döres die Gunst der verschlafenen Stunde nutzen. Nach dem Brotbacken hatten sie noch Lust auf etwas Süsses und so kletterten sie im Dunkeln auf die Stadtmauer, wo der Nachtwächter seine Bienenkörbe aufgestellt hatte. Wie erschraken die beiden Strolche, als sie vor den Toren der Stadt plötzlich klirrende Schwerter hörten. Ohne Zögern warfen sie die Bienenkörbe auf die Angreifer, welche sogleich schreiend Reissaus nahmen.
Natürlich wurden die beiden Bäckerjungen nicht fürs Naschen beschimpft, sondern als Helden gefeiert. Zur Feier des Tages wünschten sie sich einen Kuchen, der von da an «Bienenstich» heisst.
Hochzeitgästen das berühmte Rätsel:
«Vom Fresser ging Speise aus, Süsse vom Starken.»
Der Wachsverbrauch stieg von Jahrhundert zu Jahrhundert stetig, was dazu führte, dass Wachs zu wertvoller Mangelware wurde. Der enorme Verbrauch kam daher, dass in nahezu jeder Kirche Tag und Nacht eine grosse Anzahl Kerzen brannten. Zu Ostern herrschte ein regelrechtes «Feuerwerk».
Die steigenden Wachspreise liessen die Bienenhaltung florieren. Zeitweise konnten Zinsen an die Klöster und Grossgrundbesitzer sogar mittels Wachs statt Geld bezahlt werden. Doch nicht nur Zinsen, auch Strafen konnten mit Wachs beglichen werden.
Die sogenannten Wachszinsler waren Bauern, die ihre Lehenszinsen in Form von Wachs bezahlten und eine äusserst wichtige Einnahmequelle für den Gutsherrn darstellten. So genossen diese Wachszinsler bald einen besonderen Status mit Rechten. Dadurch war die Wachsproduktion gesichert und die Imker geschützt.
Mit der Sicherheit kamen eine Vielzahl neuer Berufe hervor, wie der Lebkuchen- & Honigbäcker, der Wachsgiesser, der Seifensieder und der Metsieder. Mit dieser Entwicklung stieg natürlich auch die Nachfrage nach Literatur und Wissen. Ebenso
wurden neue Erfahrungen im Gebiet der Imkerei gemacht. So kam 1576 das erste deutschsprachige Bienenbuch auf den Markt; «Gründlicher und nützlicher Unterricht von Wartung der Bienen. Aus wahrer Erfahrung zusammen getragen.» Das Buch vom Imker Nikel Jacob war ein Kassenschlager und schaffte es zu sage und schreibe fünfzehn Auflagen - zu dieser Zeit eine Sensation.
Wie es bei einer Hochblüte logischerweise der Fall ist, schwächte auch der «Bienenboom» im 17. Jhd. ab. Die Imkerei verlor an Bedeutung. Einer der Gründe war die fortschreitende Reformation, bei der der Wachsverbrauch in Kirchen massiv gesenkt wurde und den Wachshandel schwächte. Auch der dreissigjährige Krieg von 1618 bis 1648 forderte vieles an Handwerkswissen, unter den Gefallenen befanden sich viele Imker und Bauern. Heute ist man davon überzeugt, dass vieles des damaligen Wissens für immer verloren ist. Die Kriegssteuer und damit verbundene Wachssteuern zwangen die Wachszinsler dazu ihren Bienenbestand massiv zu verkleinern. Hinzu kamen natürlich die Pest und die neu erschlossenen Handelswege nach Asien, Afrika und Amerika, von wo günstiger Importwachs & -honig nach Europa kamen. Auch der Met wurde durch Wein und Bier abgelöst. Den Zeidlern wurde vieler Orts das Betreten von Waldstücken verboten, da das Holz für die aufstrebende Industrie - 78 -
verwendet wurde. Der Status von Wachs und Honig sank, mit ihnen der der Bienen. Unter all diesen Umständen litt schlussendlich auch die Beziehung zwischen Mensch und Biene. Wo man einst viel Zeit in das Auffüttern schwacher Völker investiert hatte, herrschte nun Ungeduld und man beschäftigte sich nur noch mit grossen, ertragreichen Völkern. Jeweils im Herbst wurden viele Bienenvölker durch Verbrennen getötet, um möglichst viel Honig und Wachs ernten zu können. Die Romanze von Mensch und Biene fand hiermit ein jähes Ende. Erst gegen Ende der Romantik, anfangs des 20. Jhd., bahnte sich die Biene erneut ihren Weg in die Herzen der Menschheit. Wobei die 1912 erschienene Biene Maja bestimmt nicht unbeteiligt war.
«Der Honig ist Christuswort.
Das geschmolzene Gold seiner Liebe. Das Jenseits des Nektars.
Mumie des Lichts im Paradies.
Der Bienenstock ist ein keuscher Stern, Brunnen von Bernstein, der den Rhythmus nährt all der Bienen.
Weiblicher Schoß der Felder, zitternd von Aromen und Summen.
Der Honig ist das Epos der Liebe, Stofflichkeit des Unendlichen.
Seele und leidendes Blut der Blumen, verdichtet durch einen anderen Geist.
So ist der Honig des Menschen die Poesie, die aus seiner schmerzenden Brust strömt, aus einer Wabe mit dem Wachs der Erinnerung, geformt von der Biene des Intimen.

Der Honig ist die ferne Zuflucht des Hirten, Schalmei und Olivenbaum. Schwesterbruder der Milch und der Eicheln, höchster Königinnen



des Goldenen Zeitalters.
Der Honig ist wie die Sonne am Morgen, er besitzt alle Anmut des Sommers und die alte Frische des Herbstes.
Er ist das welke Blatt und der Weizen.
O göttlicher Likör der Demut, heiter wie ein urtümlicher Vers!
186
Fleischgewordene Harmonie bist du, der geniale Extrakt des Lyrischen.
In dir schläft die Melancholie, das Geheimnis des Kusses und des Schreis.
Süssester. Süsser.
Das ist dein Eigenschaftswort.
Süss wie die Bäuche der Tierweibchen.
Süss wie die Kinderaugen.
Süss wie die Schraffur der Nacht, süss wie eine Stimme oder eine Lilie.


Für den der die Mühsal und die Leier trägt
bist du die Sonne, die den Weg erhellt.
Du kommst allen Schönheiten gleich, der Farbe, dem Licht, den Tönen.
O göttlicher Likör der Hoffnung,

wo in vollendetem Gleichgewicht Seele und Materie eine Einheit sind wie in der Hostie – Christi Leib und Licht!
Und die höchste Seele ist die der Blumen.
O Likör der du diese Seelen vereint hast!
Wer dich kostet weiß nicht dass er den goldenen Extrakt des Lyrischen schluckt.»
Federico García Lorca Übertragung Ralph Dutli

Bei sonnigem Wetter fliegen die Sammlerbienen los und saugen den Blütennektar mit ihrem feinen Saugrüsseln auf. Den Nektar speichern sie in ihrer Honigblase und tragen ihn zurück zum Bienenstock. Die Stockbienen übernehmen den Nektar und reichen ihn untereinander stetig weiter, dadurch wird er mit körpereigenen Säften versehen und optimal entwässert. Der Honig erhält so die ureigene Zusammensetzung aus Enzymen und verschiedenen Zuckerarten.
Inhaltsstoffe: Vitamine der B-Gruppe, Vitamin K & C, zahlreiche Mineralstoffe, Magnesium & Calcium, Spurenelemente wie Eisen & Zink sowie Aminosäuren in verschieden starker Konzentrationen, Glucose & Fructose.
Ein Glas Honig, ein Lebenswerk vieler: Hinter einem Glas Honig stecken Unmengen an Arbeitsstunden. Wie viele das sind, wird einem erst klar, wenn man folgendes bedenkt: Ein Glas mit 500 Gramm Honig entspricht einer Lebensarbeit von
150 – 200 Bienen. Eine einzelne Biene müsste also für ein Glas 3,5 Mal um den Globus fliegen, und das obwohl allein eine Biene bereits bis zu 8‘000 Kilometer in ihrem Leben zurücklegt.
Haltbarkeit: Die Honigfunde in den ägyptischen Pyramiden bezeugen die lange Haltbarkeit des Honigs. Auch nach mehreren Tausend Jahren war Honig, der in Violettglas verpackt entdeckt wurde, noch immer geniessbar. Honig wird auch heute oftmals als Zusatzstoff in Lebensmittel genutzt. Neben dem Süssen, verhindert seine antioxidative und keimhemmende Wirkung den frühzeitigen Verderb.
Blütenhonig: Nektar ist die Grundsubstanz, die Bienen benötigen, um in ihren Honigblasen Honig herzustellen. Nektar wird in den Nektardrüsen der Blüte hergestellt und besteht hauptsächlich aus einer Lösung verschiedener Zucker. Aus Nektar stellen die Bienen später den Blütenhonig her.
Waldhonig: Im Wald sammeln Bienen den sogenannten Honigtau, Ausscheidungen von Läusen, den sie nach der Aufnahme mit Hilfe ihres Speichels zu Bienenbrot fermentieren. Daraus entsteht dann der bekannte Waldhonig mit seiner dunklen Farbe.
Giftiger Importhonig: Leider schrecken uns immer wieder Meldungen auf, dass bei Lebensmittelkontrollen, vor allem in importierten Honigen, Giftstoffe gefunden wurden. Bienen tragen diverse Bestandteile von - in der Schweiz längst verbotenen - Pestiziden, Fungiziden und Pflanzenschutzmitteln in den Honig ein. Deshalb ist es ratsam, auf den Honig aus folgenden Ländern zu verzichten: Japan, Australien, Neuseeland, ehem. Sowjetunion, einigen Staaten der USA und der Türkei.
Heilkraft und Stresskiller: Die historischen Quellen über die Anwendung von Honig in der Medizin sind oftmals nicht eindeutig oder unvollständig. Sie müssen aus wissenschaftlicher Sicht also mit Vorsicht behandelt werden. In den meisten Fällen fehlen exakte Beschreibungen und ein standardisierter Honig, sodass belastbare, wissenschaftliche Aussagen kaum zu treffen sind. Eine Ausnahme bildet jedoch der UMF- und MGO-Manuka-Honig. UMF steht für Unique Manuka Factor, MGO für Methylglyoxal, der Stoff der für die antibakterielle Wirkung des Honigs verantwortlich ist. Prof. Thomas Henle von der Universität Dresden gelang es, den Honig anhand des UMF und MGO medizinisch zu standardisieren. Auch wenn die meisten Honige nicht standardisiert werden können, weist alles darauf hin, dass der Honig positive Auswirkungen auf
die Gesundheit hat. Die Honigenzyme unterstützen die Verdauung und seine Kohlenhydrate gelangen rasch vom Darm ins Blut. Deshalb ist er ein äusserst beliebter Energielieferant für Sportler, besonders Marathonläufer. Auch beim Kochen stellt der Honig eine deutlich gesündere Alternative zum herkömmlichen Haushaltszucker dar, da in der Industrie oftmals alle gesunden Inhaltsstoffe zerstört wird. Die verschiedenen Zuckerarten im Honig haben zudem einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel. Bei Stress sinkt der Glucosespiegel im Blut, wodurch der Kohlenhydratstoffwechsel entgleist. Die regelmässige Einnahme von Honig wirkt diesen negativen Effekten entgegen und hilft dem Körper das Gleichgewicht wieder herzustellen. Durch seinen niedrigen PH-Wert und seine unterschiedlichen Zuckerarten hemmt der Honig das Wachstum vieler krankheitserregender Keime.
Dopingmittel: Honig wurde von den olympischen Athleten in der Antike gerne & oft als Dopingmittel genutzt, um schneller wieder bei Kräften zu sein.
Medizinmänner: Schon die Ureinwohner Neuseelands und Amerikas wurden auf den Honig aufmerksam und nutzten ihn zur Heilung verschiedener Krankheiten. Dabei wurde der Honig bei Entzündungen wie auch als Desinfektionsmittel eingesetzt.

die dem Menschen unterworfen sind. Ob Schwach ist sie an Kraft, aber stark durch sprenkelte Winter sein graues Haar ablegt
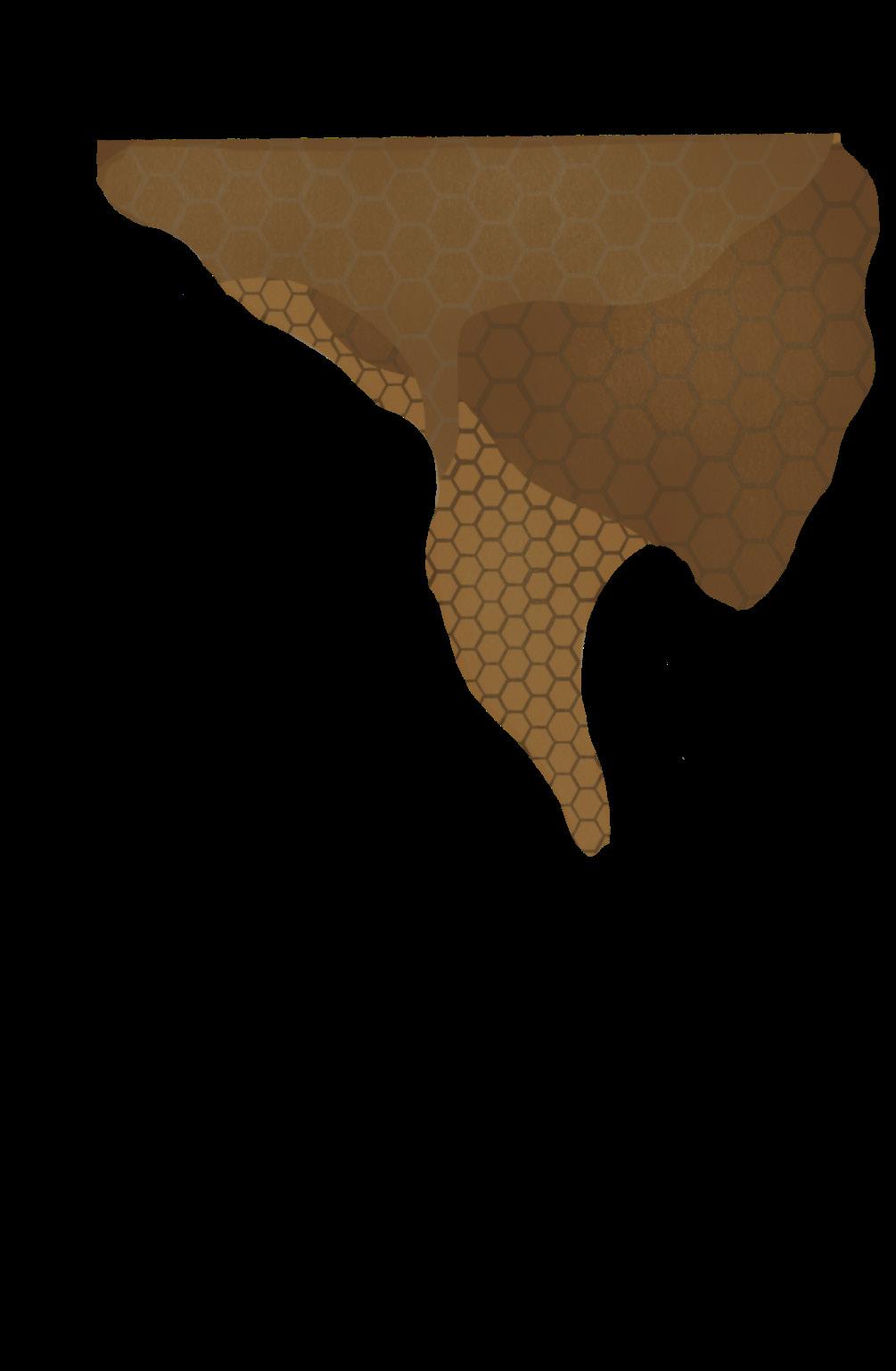
Eis zum Schmelzen gebracht hat, dann machen sich die Bienen sofort zu ihrer Arbeit auf. Sie verteilen sich über die Fluren, schwingen zart die Flügel, hängen sich mit ihren Beinchen an und setzen sich nieder. Ein Teil liest mit dem Munde die Blüten ab. Und beladen mit der Nah -




rung kehren sie zu ihrem Lager zurück. Dort bauen andere mit unbeschreiblicher Kunst Zellen mit zähem Leim; andere häufen den flüssigen Honig auf; andere wandeln den Blütenstoff in Wachs; andere bilden mit dem Munde die Brut; andere schliessen den von den Blättern gesammelten Nektar ein. O wahrhaft wunderbar ist die Biene! Ihr Geschlecht wird nicht von Manne verletzt, nicht von der Brut gestört, ihre Keuschheit nicht von den Kindern weggenommen. So hat auch die heilige Maria als Jungfrau empfangen, als Jungfrau geboren und ist Jungfrau geblieben.» Der heilige Ambrosius, 339-397 n. Chr.

In den Vorstellungen der indianischen Bevölkerung vor allem in Mexiko, Mittel- und Südamerika – dazu gehörten unter anderem die Maya, Zapoteken, Olmeken, Huaxteken, Arawaken und Chavin-Indianer – herrschte der Glaube vor, dass nur wer tanzt, singt und rituelle Handlungen vollzieht, über eine Kultur verfügt. Aber zu tanzen und singen, lernen die Menschen durch die Beobachtung der Bienen.
So glaubten sie, das Ur-Bienenvolk lebe im Innern der Erde, in einer fruchtbaren und paradiesischen Unterwelt. Geschichten erzählen von mythischen Helden, die dank göttlicher Führung zu diesem Bienenvolk gelangten und ihren Mitmenschen brachten. Bei den Mayas waren es die bekannten Zwillinge Hunahpu und Xbalanque. Erst von da an begann für die Menschen an der Oberfläche eine lohnenswerte Existenz. Hingegen galt der Verlust der Bienen als Rückfall in unfruchtbare, unglückliche Zeiten.
Die Indianer verstanden das Schwärmen des Bienenvolkes als sehnsüchtiger Aufbruch in ihre Heimat im Herzen der Welt, um sich dort mit dem Urvolk
wieder zu vereinen.
In Kolumbien herrschte vor der Ankunft der Europäer die Vorstellung, dass die Bienen von Bienengöttern geleitet würden. Diese Götter waren zugleich auch Ordnungshüter von Raum und Zeit sowie des gesamten Universums. Deshalb wurde den Göttern an Festtagen gehuldigt, indem sie Honig als Zeichen der Verehrung und Verbundenheit geopfert und den Königen geschenkt haben.
Später verlangten die Könige Honigtribute von den Sklaven und Untertanen. Als Gabe der Götter wurde stets ein gewisser Anteil des geernteten Honigs im Bienenstock zurückgelassen. Allgemein war der Honiggenuss und -handel sehr streng geregelt, so durfte Honig nur bei rituellen Handlungen verspeist werden. Unter diese Regeln fiel auch das Verbot des Verkaufs von Honig, er durfte ausschliesslich nur Getauscht oder verschenkt werden.
In der indigenen Bevölkerung ist die Heilkraft des Honigs tief verankert und das Wissen darüber geht auf viele Jahrtausende zurück. So waren sie der Überzeugung, dass der Honig bei Fieber den Kranken von innen heraus wärmte und so das Temperaturgleichgewicht wieder herstellte.
Wie die Germanen kannten die Indianer ebenfalls den süssen Met, den sie wie den reinen Honig selbst verehrten. Der einzige Unterschied zu den sauffreudigen Germanen war jedoch, dass die Indianer ihn


«
N ichts gleicht einer Seele so sehr wie eine Biene, sie geht von Blume zu Blume wie eine Seele von Stern zu Stern, und sie bringt den Honig zurück wie die Seele – das Licht.»Victor Hugo, 1874
mit mehr Mass genossen. Met durfte nicht zu jeder Gelegenheit und vor allem nicht von jedem getrunken werden. Met konnte nur bei bestimmten Festen und Zeremonien zu sich genommen werden und das ausschliesslich von Männern, meist sogar nur von Kriegern. Da sich durch den reichlichen Genuss bei diesen Anlässen Träume und Visionen bei den Konsumenten einstellten, glaubte man an eine Offenbarung des Götterwillens.
Leider wurde durch die europäischen Eroberer die Westliche Honigbiene eingeführt und die ursprüngliche verdrängt. Im Lauf der Zeit wurden die Bienengötter durch christliche Schutzheilige ersetzt, die rituellen Handlungen verschwanden, da die eingeführte ausländische Biene als nicht heilig angesehen wurde. Die Zeremonien verloren ihre mythische Kraft und zerfielen schliesslich ganz. Die Biene wurde zum Nutztier degradiert und der Honig einzig ein kommerzielles Produkt. Später wurde auch der Met von christlichen Missionaren verboten und als sündhaft abgetan.
Jedoch verschwand die symbolische Kraft der Biene auch in der christlichen Kulturgeschichte nicht, wie das vorangegangenen Kapitel gezeigt hat. So hatte sie auch in den späteren Jahrhunderten immer wieder einen wichtigen Auftritt in Politik und der Monarchie. Besonders in Frankreich erlebte sie durch Napoleon Bonaparte einen kulturellen Aufschwung.
Die Wirkung von Bienengift war bereits den alten Griechen bekannt, wie das «Corpus Hippocratium» deutlich macht. In der «westlichen» Welt erinnerte man sich im 19. Jahrhundert an die Wohltaten des Giftes und wendete es vorwiegend bei Gicht, Gelenkrheuma und Arthritis an. Der bedeutendste Inhaltsstoff stellt das Protein Melittin dar. Dieses lagert sich in Zellmembranen ab und macht sie so für gelöste Ionen durchlässig. Höhere Dosen rufen Entzündungen und Schmerzen hervor, hemmen die Blutgerinnung, senken den Blutdruck und sind antibakteriell wirksam. Bei sehr geringer Dosis hingegen wirkt das Bienengift entzündungshemmend, immunstimulierend und schützen vor den Folgen von Bestrahlung. Auch heute setzt man es bei der sogenannten Apitherapie medizinisch ein. Unter anderem gegen Rheuma, aber auch zur Desensibilisierung bei einer Allergie. Dies geschieht meist mittels Injektionen oder lebenden Bienen.
In Frankreich spielt das Sinnbild der Biene seit vielen Jahrhunderten eine gewichtige Rolle und ist eng mit dem kulturgeschichtlichen Erbe Frankreichs verbunden. So lohnt es sich, einen tieferen Blick in die goldenen und prächtigen Seiten der französischen Biene zu werfen.
Ein gesunder Geschmack für Kleidung ist immer von Vorteil, das war bereits den wohlgenährten adligen Herren Frankreichs bewusst. Im 16. Jahrhundert war die Gutmütigkeit in der Staatstheorie von grosser Bedeutung, deshalb bezog sich Ludwig XII - auch König von Orléans genannt - auf die Bienen. So entführte er das herzliche Wesen kurzerhand in die Politik und verband es zugleich mit seiner prunkvollen Kleidung. «Bei seinem Einzug in Genua 1507 trug er ein weisses Gewand, welches mit einem von goldenen Bienen umgebenen Bienenkönig geschmückt war. So wollte er den Genuesen zeigen, dass er ihnen ihre Rebellion vergab.» Somit wird klar, dass die Biene schon früh in der Monarchie ihren Einsatz fand.


«Die Staatenbildung der Bienen galt schon in den alten Hochkulturen als Idealbild menschlicher Gesellschaft und in Übereinstimmung mit den monarchischen Gesellschaftsstrukturen avancierte sie schon früh zum Symboltier komplexen menschlichen Zusammenlebens. Sie wurde als fast göttliches Wesen angesehen.» , so Engels in seinem Werk «Ursprung und Wandel der Bienensymbolik bei Napoleon I und Napoleon III».
Selbst auf den ältesten Überlieferungen aus Mesopotamien zeigt sich, dass Bienen schon damals als Symbol des Königs genutzt wurden. «Die semiotische Interpretation der Biene als eines politisch, wie religiös bedeutsamen Symboltieres reicht bis zur Staatenbildung altorientalischen Hochkulturen.»
Man fand sogar Münzen mit einer Biene, die die Stadt Ephesos – in der Nähe der heutigen Stadt Selçuk an der Ägäisküste – im 6. Jahrhundert vor Chr. herausgegeben hatte.
So nutzte auch Voltaire die Bienen in seinen Sätzen, mit denen er seine Kritik an den Missständen des Absolutismus und der Feudalherrschaft sowie am weltanschaulichen Monopol der katholischen Kirche äusserte. Er galt als einer der einflussreichsten Autoren der französischen und europäischen Aufklärung und war einer der wichtigsten Wegbereiter der Französischen Revolution. Seine beste Waffe waren ein präziser und für die Allgemein -
heit verständlicher Stil sowie sein Sarkasmus und seine Ironie. Er verglich die Geistlichen seiner Zeit, welche seiner Meinung über jegliche Verhältnisse lebten und herrschten, als gierige Hummeln, die zum Wohle der Bienen zu vernichten seien.
Im Grab des Merowingerkönigs Childerich I. aus dem Jahr 482 fand man beim Öffnen 1653 nebst unzähligen weiteren Grabbeigaben dreihundert goldene, almandinverzierte Darstellungen eines geflügelten Insekts.
Aufgrund ihrer summarischen Darstellung können diese nicht wirklich identifiziert und einem spezifischen Insekt zugeordnet werden. Man vermutet jedoch, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Grillen oder mehr noch um Bienen handelt.
Beide Insekten verkörpern das Symbol der Unsterblichkeit und wurden häufig zu dieser Zeit in Europa für ein Weiterleben nach dem Tod mitgegeben. Sie bezogen sich also nicht alleine auf Childerich I. als Person.
Aufgrund eines – hollywoodreifen - Diebstahls im November 1831 sind seither nur noch zwei Exemplare vorhanden und werden in der Bibliothèque Nationale verwahrt. Die beiden verbliebenen Exemplare konnten kurz nach dem Diebstahl aus der Seine gefischt werden und sind - nebst den beim Fund des Grabes angefertigten Stichen - nahezu das einzige was von dem achtzig Kilo Goldschatz
« W enn nicht der Feldherr gleicht dem Bienenstock, dem alle Schwärme ihre Beute zollen, wie hofft ihr Honig?»
William Shakespeare
übriggeblieben ist. Der sensationelle Reichtum des Childerichs Grabs löste sich in einer Nacht in Luft auf und vermutlich wenig später in geschmolzenes Raubgold. Der Raub konnte nie ganz aufgeklärt werden und gilt noch heute als einer der grössten Raube der menschlichen Geschichte.
Bei der Schaffung einer neuen Herrschaftslegitimation, stiess Napoleon I. nicht zufällig auf die Biene. Er interessierte sich lebhaft für den Childerich-Schatz und liess sich von den dreihundert goldenen Bienen auf dem Königsmantel grosszügig inspirieren.
Das Wahrzeichen sollte einzig für seine neu geschaffene Dynastie stehen und das alte französische Königssymbol – die weisse Lilie – komplett ersetzen. Napoleon selbst kam aus einer eher bescheidenen Herkunft, deshalb war er nahezu besessen vom Bienensymbol, das an die Königswürde der Merowinger und Karolinger anknüpfte.
So zierten wenig später die Biene sämtliche Wappen, Fahnen, Teppiche sowie Geschirr, Tischdecken und Münzen, bis hin zu seinem Krönungsmantel von 1804, den er reichlich mit goldenen Bienen besticken liess, wie sein Vorgänger Childerich es bereits getan hatte.
Napoleon verlieh die Biene vielen Stadtwappen, unteranderem Mainz und Bremen, als Auszeichnung. Diese Städte erster Ordnung - Bonne ville de
l’Empire français genannt - hatten gemäss napoleonischer Heraldik drei Bienen im roten Hauptschild. Während der napoleonischen Kaiserzeit wurde eine grosse Anzahl an Wappen geändert. Die Franzosen machten es sich dabei einfach. Meist ersetzte man die Lilie - das wohl bekannteste Symbol der französischen Monarchie - durch die bonapartische Biene, welche im Grunde nichts anderes als eine umgedrehte Lilie war. Oder war die Lilie schon immer eine abstraktere Darstellung einer Biene? Verschwörungstheorien sind willkommen.
Das kostbarste Produkt eines Bienenvolkes ist Gelée Royale. Dabei handelt es sich um den königlichen Futtersaft, der von der Ammenbiene produziert wird und der Bienenkönigin durch deren Hofstaat ihr Leben lang verfüttert wird. Möglicherweise liegt in diesem Futter das Geheimnis ihres hohen Alters von drei bis fünf Jahren, während alle anderen Bienen eine Lebenserwartung von gerademal ein paar Wochen oder Monaten haben. Die Ernte von Gelée Royale ist äusserst aufwändig, denn um eine genügende Menge ernten zu können, muss der gesamte Imkereibetrieb auf die Königinnenzucht ausgelegt sein. Obschon wissenschaftliche Studien von Gelée Royale noch in den Kinderschuhen stecken, schwört man besonders in Asien auf das gelbliche und leicht bittere Produkt. Deshalb wird gerade dort die Forschung an dessen Wirkung stark vorangetrieben. In Tierexperimenten zeigten sich keim- und krebshemmende Wirkungen sowie die Beeinflussung der Regulation von Blutzucker und Blutdruck. Wie bei allen Bienenprodukten sollte vor der Einnahme immer ein Allergie-Test gemacht werden.


« Die Lilie blüht, ich bin die fromme Biene, Die in der Blätter keuschen Busen sinkt, Und süßen Tau und milden Honig trinkt, Doch lebt ihr Glanz, und bleibet ewig grüne
So ist dann selig mein Gemüt
Weil meine Lilie blüht!
Die Lilie blüht, Gott, lass den Schein verziehn,
Damit die Zeit des Sommers langsam geht,
Und weder Frost noch andre Not entsteht,
So wird mein Glück in dieser Lilie blühn, So klingt mein süßes Freudenlied:
Ach, meine Lilie blüht! »
Clemens Brentano 1778-1842


In der Zeit (und bereits lange davor), als die katholische Kirche noch in ihrer vollen Macht erblühte, war jedermann überzeugt, dass im Bienenstaat ein männliches Oberhaupt regierte. Erst als der holländische Wissenschaftler Jan Swammerdam seine gesellschaftserschütternde Entdeckung unter dem Mikroskop machte, begann ein Umdenken. Begleitet durch ausufernde Debatten bis hin zur kompletten Hinterfragung der Monarchie und Gesellschaftsordnung. Mit der Entdeckung der Eierstöcke beim Bienenkönig kam die totale Überforderung, was nun mit dieser Information anzufangen sei. Schliesslich hatten bereits die alten Griechen von einem König gesprochen und diese irrten sich bekanntlich nicht.
Daraus resultierend brachte der Geschlechterkampf lustige Irrtümer hervor. So verdanken wir dem griechischen Dichter und Ackerbauer Hesiod, um 700 v. Chr., einen vorzüglichen Witz der Kulturgeschichte. Er gilt, neben den Werken Ilias und Odyssee von Homer, als einer der bedeutendsten Überlieferer der griechischen Mythologie. In He -

Anzahl pro Volk: 1
Entwicklungszeit: 16 Tage
Alter: 3-4 Jahre
Grösse: 18-22mm
Gewicht: 200mg
Aufgabe: Eierlegen
Die Königin schlüpft aus einer besonders grossen Zelle (Weiselzelle). Ihr Leben lang ist sie von ihrem Hofstaat umgeben, wird gehegt & gepflegt und kommt in den Genuss von Gelée Royale. Nachdem Sie auf ihrem Hochzeitsflug von ca. 20 Drohnen begattet wurde, legt sie bis zu 2000 Eier täglich. Sie ist die einzige, die Eier legen kann. Damit alle Untertanen stets über Anwesenheit & Zustand der Königin informiert sind, produziert sie einen Duft, den ihre Hofstaatbienen aufnehmen und weitergeben. Mit abnehmender Fruchtbarkeit nimmt der Duft ab und das Volk wird sie durch eine neue Königin ersetzen.
siods Lehrgedicht «Werke & Tage» schildert er sein alltägliches, bäuerliches Leben. Es enthält aber auch die ersten Seiten der Ratgeberliteratur. So schrieb er Ermahnungen an die Adresse seines Bruders Perses, der sein Erbteil verschleudert hatte und nun Hesiods Anteil beanspruchte. Hesiod ruft ihn zur Besinnung, verweist auf ehrliche und harte Arbeit und warnt vor Falschheit, Rücksichtslosigkeit und Anmassung, wie es in diesem «Eisernen Zeitalter» der Fall sei. Weiter schreibt er in einem – anzunehmenden - Wutanfall (Theogonie, Vers 570-616) über den Mythos der Pandora, der ersten Frau, welche hinterlistig durch Zeus geschaffen wurde. Unter zu Hilfenahme eines «Beweises» wütet er über die nichtsnutzigen Drohnen – von denen er allerdings annahm, es seien Weibchen:
«Von ihr kommt das schlimme Geschlecht, stammen die Scharen der Weiber, ein grosses Leid für die Menschen (...) Wie in gewölbten Stöcken die Bienen Drohnen ernähren, die sich einig sind in jeder Bosheit, jene aber sich den ganzen Tag bis Sonnenuntergang ständig mühen und weisse Waben bauen, während die Drohnen drinnen bleiben im hohlen Stock und sich fremde Mühe in den Bauch stopfen, gerade so schuf der hochdonnernde Zeus zum Übel der sterblichen Männer die Frauen, die einig sind im Stiften von Schaden.»
Fleissige, hartarbeitende Männer, faule, verfressene Weiber. Den Fakt, dass es im Bienenstock gerade andersherum ist, lieferte erst der Forscher Jan Swammerdam im 17. Jahrhundert und hätte den armen Hesiod bestimmt aus den Socken fahren lassen. Immerhin hatte er sich unbewusst damit selbst das komplette Gegenteil seines angeblichen Beweises aus der Natur geliefert. Fleissige Arbeiterinnen und träge, männliche Drohnen.
Der vermeintliche inexistente Königinnen-Sex und der jungfräuliche Bienen-Eros hat die Menschheit über eine lange Zeit gehörig verwirrt.
In der Antike und bis ins Mittelalter war man der felsenfesten Überzeugung, dass das Bienenoberhaupt ein König war – ein «Weisel». Schliesslich hatte dies bereits Aristoteles behauptet und an dessen Worte zweifelt man bekanntlich nicht.
Das Bild der antiken Autoren vom Bienenstaat als eine perfekte Monarchie mit einem edlen König erhielt in der Renaissance einen erneuten Aufschwung. Erasmus von Rotterdam (1467-1536) schrieb, dass der Herrscher der Bienen der Mächtigsten von allen sei, weil er seine Untertanen nicht unterdrücke, sondern ihr Wohltäter sei. Die Bienen liebten ihn und sollen mit grosser Freude für ihn gearbeitet haben.
Jedoch gegen Ende der Renaissance geriet die aristotelische Auffassung, dass der Bienenstaat von
einem König regiert würde, in starkes Wanken. Für den ersten Aufruhr sorgte der Spanier Luis Mendez de Torres, im Jahr 1586. Er behauptete, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie «la maestra» Eier legte. Somit könne sie nicht männlichen Geschlechts sein.
Dreiundzwanzig Jahre später veröffentlichte der Engländer Charles Butler, ein Priester und Imker, sein Werk «The Feminine Monarchie» und meinte, dass die Bienen von einer Königin regiert würden. Beweise konnte aber auch er nicht liefern. Dennoch gilt Butlers Werk als Meilenstein in der Bienenliteratur, da sich unzählige Wissenschaftler auf einmal darum interessierten. Darunter auch der schwedische Forscher Marten Triewald, der fälschlicher Weise von einem «Engländer namens Carl Butter» schreibt.
Zu dieser Zeit war die Theorie einer Königin auch gar nicht mehr allzu abwegig, denn Elizabeth I. hatte bereits fünfundvierzig Jahre erfolgreich über England geherrscht.
Erst dem Holländer Jan Swammerdam gelang es, unter dem Mikroskop die nötigen Beweise zum Geschlecht des Bienenoberhauptes zu liefern und jegliche Spekulationen aus dem Weg zu räumen –zumindest bildete er einen Anfang.
Aus König wurde Königin. Klingt simpel. Alles andere als simpel waren die Wellen die diese revolutionäre Entdeckung Swammerdams in der damaligen

Anzahl pro Volk: 40‘000-80‘000, Winter 8‘000
Entwicklungszeit: 21 Tage
Alter: 2-6 Wochen, Winter 6-8 Monate
Aufgaben: Bauen, Schützen, Unterhalt, Vorrat
Grösse: 12-15mm
Gewicht: 82mg
Die Mehrheit im Volk bilden die Arbeiterinnen, sterile Weibchen. Sie füttern und beschützen die Königin sowie den Stock und halten den gesamten Betrieb am Laufen. Sie bestimmen die zu treffenden Entscheidungen durch Kommunikation auf vielen verschiedenen Ebenen. Zu unterscheiden sind bei den Arbeiterinnen Winter- & Sommerbienen. Die Einen erleben Frühjahr/Sommer und sind für den Wintervorrat verantwortlich. Sie haben ein äusserst anstrengendes Arbeitsleben, deshalb leben sie deutlich kürzer, als ihre Kolleginnen im Winter. Diese müssen einzig die Königin wärmen und die Stocktemperatur auf 25 Grad halten.
Gesellschaft des 17. Jahrhunderts auslöste. Die Stützen des Geschlechterkampfes begannen zu bröckeln, denn nun brachte die Natur selbst ein schwerwiegendes Argument, dass der weibliche Verstand sehr wohl in der Lage war, eine Führungsposition inne zu haben. Nein, gar dazu im Stande war, fast ausschliesslich ohne jeglicher männlichen Hilfe einen ganzen Staat zu führen. Das Überleben des gesamten Volkes, der gesamten Gattung einzig an der Königin und deren tüchtigen Untertanen hing.
Trotz der Beweise – Swammerdams blieben nicht lange die einzigen – blieb die Frage das ganze 18. Jahrhundert äusserst brenzlig. Die damalige Gesellschaft war tief vom christlichen Glauben geprägt. Der Bienenstaat galt als ein von Gott geschenktes Vorbild der Monarchie.
Der Krieg von Aufklärung und Wissenschaft gegen Theologie und Monarchie war entfacht. Mit ausufernden Debatten wurde über das Geschlecht des Bienenkönigs Diskutiert und niemand wusste mehr wirklich, was denn jetzt der richtige Regent oder das richtige Regime war.
Wie verunsichernd dieses Thema war zeigt sich an folgendem Beispiel. Im «Spectacle de la Nature» (1732) von Noel-Antoine Pluche fragt ein Graf einen bienenkundigen Priester, ob es denn stimmen könne, dass die Bienen keinen König sondern ein Königin als Oberhaupt hätten:
Le Chev:
Le Pr:
Graf:
Priester:
«Est-il vrai, Monsieur, que les abeilles ont un Roi?»
«Il est certain que dans une ruche on distingue trois fortes d’abeilles (…) n’être ni mâles ni femelles : elles ont toutes une trompe pour le travail, & un éguillon contre l’ennemi(…)»
«Ist es wahr, dass die Bienen einen König haben?»
«Sicher ist, dass man innerhalb eines Bienenstocks zwischen drei Bienentypen unterscheidet (…) weder männlich, noch weiblich: Sie alle haben einen Rüssel für die Arbeit, & einen Stachel gegen Feinde(…)»
Der Priester antwortet auf die Frage über mehrere Seiten mit einer langwierigen und verwickelten Erklärung und fordert am Schluss den Grafen dazu auf, selber zu entscheiden. Das Gespräch war vermutlich nicht besonders hilfreich für den verwirrten Grafen. Aber man erkennt, dass selbst die Priester nicht genau wussten, was sie jetzt mit diesen Beweisen anfangen sollten.
Swammerdam schilderte in seinem grossen Werk «Bibel der Natur» in den «Abhandlungen von den Bienen» seine Entdeckung ausführlich. Mit Hilfe
eines selbstgebauten Mikroskop und eigens konzipierten Glasröhrchen untersuchte er die inneren Bestandteile der Biene. Unteranderem stiess er dabei auf die unterschiedlichen Genitalien der Drohnen und der Königin – die Arbeiterinnen bezeichnete er weiterhin als Geschlechtsneutral. Er entdeckte bei dem vermeintlichen Bienenkönig Eierstöcke und Eileiter und erkannte in ihr die Mutter des Volkes. Denn nur die Königin ist in der Lage, Eier zu legen.
Weiter schreibt er von der Fähigkeit der Bienen aus Arbeiterinnenbrut eigenständig eine Königin heranzuziehen.
Die eigentliche Begattung konnte Swammerdam nicht beobachten. Aufgrund der Grösse der Geschlechtsorgane der Drohne nahm er an, dass die Königin durch den männlichen Geruch, den «auraseminalis» befruchtet wird. Oje, zu dieser Zeit konnte man also noch über den Geruch schwanger werden!
René-Antoine Ferchault de Réaumur war es, der knapp siebzig Jahre später einen weiteren Aufschrei in der Gesellschaft verursachte, indem er die Arbeiterbienen nun ebenfalls als weiblich definierte und die männlichen Drohnen als träge Geschöpfe entlarvte, die dem Volk ausser der Königinnenbegattung absolut keinen Nutzen bringen. Ein Skandal!
Darauf beruhend wurden die Bienen im späteren Verlauf der Geschichte auch noch zu Kronzeuginnen für das Matriarchat. Der aus Basel stammende

Anzahl pro Volk: 300-5000
Entwicklungszeit: 24 Tage
Alter: Frühsommer - Herbst
Aufgabe: Begattung der Königin
Grösse: 17-20mm
Gewicht: 230mg
Drohnen sind die männlichen, stachellosen Bienen, die aus unbefruchteten Eiern schlüpfen. Also keine Angst, diese trägen Kerlchen sind komplett wehrlos.
Drohnen sind kräftiger und grösser als Arbeiterinnen und verfügen über leistungsstärkere Facettenaugen, um die Jungkönigin beim Hochzeitsflug im Freien besser zu erkennen. Sie leben so lange bis sie eine Jungkönigin befruchtet haben oder nutzlos geworden sind. Am Ende der Paarungszeit - bei der sogenannten Drohnenschlacht - werden sie von den Arbeiterinnen aus dem Stock geworfen oder niedergestochen, da sie unfähig sind für jegliche Arbeiten im Stock sowie sich selbst zu ernähren.
Jurist und Altertumsforscher Johann Jakob Bachofen nutzte 1861 die von der Natur gegebene Form des Bienenstaates als optimal passendes Modell für seine Matriarchats-Theorie:
«Das Bienenleben zeigt uns die Gynäkokratie in ihrer klarsten und reinsten Gestalt (...) so stammen alle Glieder des Stocks von Einer Mutter, aber von einer grösseren Anzahl Väter (...) Ist die Königin tot, so lösen sich alle Bande der Ordnung (...) Durch diese Eigenschaften ist der Bienenschwarm das vollständigste Vorbild der ersten menschlichen, auf der Gynäkokratie des Muttertums beruhenden Vereinigung (...) Daher erscheint nun die Biene mit Recht als Darstellung der weiblichen Naturpotenz.»
Frauenrechtlerinnen oder auch Dichter bezogen sich nur allzu gerne auf Bachofens Theorie. Somit wird klar, dass selbst in der Geschichte des Geschlechterkampfs die Biene einen wichtigen Bestandteil bildet. Um einen, wie auch immer gearteten Kampf der Geschlechter vorzubeugen, sollte angefügt werden, dass jedes Lebewesen der drei Bienenarten seine ganz speziellen Aufgaben hat. Einem Bienenstock ohne Drohnen fehlt es an jeglicher Motivation. Jede Biene, ob jetzt männlich, oder weiblich, dient immer dem ganzen Wesen Bien.





Wie viele oftmals fälschlicherweise meinen, handelt es sich beim Begriff «Bien» nicht um die männliche Biene, die Drohne. Vielmehr beschreibt es eine Gesamtheit. Der Imker Johannes Mehring (1815-1878) erklärte, dass das Bienenvolk ein «Einwesen» sei. Die Arbeiterinnen bilden den Gesamtkörper, seine Organe zu dessen Erhalt und Kreislauf, die Drohnen das männliche und die Königin das weibliche Geschlechtsorgan.
Der «Bien» bezeichnet also das unteilbare Ganze des Bienenvolkes, mit anderen Worten ein «Superorganismus». Und tatsächlich spricht vieles dafür, dass der Superorganismus Bien in vielen Eigenschaften und Fähigkeiten nicht nur mit dem Wirbeltier, sondern sogar dem Säugetier gleichkommt. Also ein Säugetier bestehend aus Insekten?
« E chte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen!»
Sprichwort

«In einem unbekannten Land
Vor nicht allzu langer Zeit
War eine Biene sehr bekannt
Von der sprach alles weit und breit
Und diese Biene, die ich meine nennt sich Maja
Kleine freche schlaue Biene Maja
Maja fliegt durch ihre Welt
Zeigt uns das was ihr gefällt
Wir treffen
heute uns`re Freundin Biene Maja
Diese kleine freche schlaue Maja
Maja alle lieben Maja
Maja (Maja) Maja (Maja)
Maja erzähle uns von dir»
Florian Cusano, Karel Svoboda
Karel Gott
Sparsamkeit, Fleiss, Tugend, Keuschheit, die katholische Kirche, Zusammenhalt, die perfekte Monarchie, Kaisertum, Vorbilds Staat – Ende des 19. Jhd. könnte man gewiss meinen, die Symbolkraft der Biene
sei ausgeschöpft. Doch derjenige, der dies behauptet, irrt sich – und zwar gewaltig. Nach einer kurzen Erschöpfungspause meldeten sich die Bienen zurück, genauer gesagt eine ganz bestimmte Biene. Am 27. August 1912 wurde eine unscheinbare Anzeige im deutschen Buchhandelsblatt gedruckt, welche den bald erscheinenden Roman «Biene Maja und ihre Abendteuer» des Autors Waldemar Bonsels ankündigte. Maja ist also schon stolze 108 Jahre alt und hat noch kein Stück ihres Charmes verloren.
Den Meisten unter uns dürfte die Biene Maja bekannt sein. Kaum eine Kindheit wurde ohne sie verbracht. Aber was genau macht Maja so besonders, so faszinierend? Das Phänomen Bienen Maja wird von Wissenschaftler gerne und oft untersucht. Harald Weiss, ein deutscher Forscher, befasst sich sogar in mehreren Büchern intensiv mit ihren Hintergründen und Auswirkungen. Eines davon: «100 Jahre Biene Maja – Vom Kinderbuch zum Kassenschlager».
Für echte Biene Maja Liebhaber, aber auch für Pädagogen und Historiker ein höchst interessantes Buch. Um der Frage nach ihrer Faszination auf die Spur zu kommen, lohnt sich ein Blick auf den Inhalt der Geschichte.
Maja ist eine junge Biene, die sich nicht in die strenge Ordnung des Bienenstaates fügen will und deshalb alleine in die weite Welt hinauszieht. Auf ihrer Heldinnenreise trifft sie auf viele Lebewesen mit ganz
unterschiedlichen Eigenschaften und Ansichten. Sie findet Freunde, aber auch Feinde, wie die Spinne Thekla. Je mehr die mutige Biene sieht und erlebt, desto mehr plagt sie das Heimweh und fühlt sich einsam. Schliesslich gerät sie in die Gefangenschaft der Hornissen und erfährt von den Plänen eines Angriffs gegen die Bienen. Maja besinnt sich auf ihr Zuhause und bricht kurzerhand aus. Wieder im heimatlichen Bienenstock warnt sie ihr Volk und kehrt so als Heldin in die Stockgemeinschaft zurück. Von da an bleibt sie und wird Lehrerin, um ihre Abenteuer und ihr Wissen an die neue Generation Bienen weiterzugeben. Eine Musterbiene. Sie ist selbständig und zugleich ihren Wurzeln gegenüber loyal.
Anfangs des 20. Jhd. begann eine Zeit, in der das einzelne Individuum immer mehr ins Zentrum rückte und die Biene Maja diente mit ihrer selbständigen und freiheitsliebenden Art als geeigneter Vorbote.
Der Aspekt der Loyalität und der des Abenteuers waren auch der Grund, weshalb die Biene Maja sogar als spezielle Feldausgabe für die Soldaten des Ersten Weltkriegs erschien. Maja sollte für eine gute Stimmung im Schützengraben sorgen und die Laune aufrechterhalten. In den zwei Jahren zwischen der Buchveröffentlichung und dem Beginn des Ersten Weltkriegs wurden kaum mehr als viertausend Ex -
emplare verkauft. Jedoch mit dem Beginn des Krieges und insbesondere nach dessen Ende steigt das Interesse und die Auflagezahl explodiert. Schnell wurde das Buch zum Bestseller. 1926 kam bereits die erste Filmadaption der Biene Maja in die Kinos. Dabei handelte es sich um ein Dokudrama mit echten Bienen in den Hauptrollen. Zusätzlich wurde der Stummfilm mit Texteinlagen ergänzt.
Der Autor selbst gerät immer mehr in den Schatten der Marke Biene Maja. Waldemar Bonsels war wie seine Maja ein aufgeschlossener und abenteuerlustiger Mensch. Er befand sich ständig auf Reisen und blieb selten lange an einem Ort wohnen. Vor allem jedoch war er ein Lebemann, was das unschuldige Bild der Biene Maja etwas bröckeln lässt. So war er vier Mal verheiratet, hatte Unmengen an Affären und genoss seinen damaligen Status als Bestsellerautor in vollen Zügen. Er führte sogar Buch über seine Frauenbekanntschaften. Archiviert ist dieses übrigens im Münchener Stadtmuseum.
Seine Schwester Ilse Bonsels berichtete folgende Anekdote:
«Waldemar betrat, die Braut im Arm, die erste und vornehmste Conditorei in Elberfeld. Er selber im weissen Flanellanzug, in roten Lederhandschuhen den runden Strohhut auf den Locken, Teta im weissen Spitzenkleid, Halbhandschuhen und Pom -
padour. [...] Auf der Anrichte der Conditorei standen Gebäcke, Süssigkeiten und Torten aufgereiht [...] ohne den Lederhandschuh abzuziehen fuhr Waldemar quer mit dem roten Zeigefinger über eine der Torten hin, häufte die Schlagsahne auf seinem Lederfinger und fuhr damit seiner Braut vom linken Ohr bis zum rechten, als sei das die Art, den Geschmack der Ware zu prüfen. Er sagte ernsthaft: ,Probier`mal, Schnauz!’ – Dann warf er einen Zehnmark-Schein auf die Anrichte (zu dieser Zeit sehr viel) und floh zu aller Erstaunen aus der Conditorei, die erschrockene Braut nachsichziehend [!]. Beide rannten um die nächste Ecke, wo Waldemar dann die Schlagsahne aus dem Gesicht seiner Braut fortschleckte und dazwischen meinte: ,Ausgezeichnet – vorzüglich – etwas zu süss – was meinst Du?’»
Da Bonsels in den 1920er Jahren eine Person des öffentlichen Lebens war, wurden auch fleissig Klatschblätter über sein öffentliches Auftreten gefüllt. Hauptsächlich wurden dabei seine Frauengeschichten thematisiert, welche von Einigen nicht ganz gebilligt wurden. Der Schriftsteller Franz Blei schrieb dazu folgendes amüsantes Zitat:
«DAS BONSELS. Englische, sehr bewegliche Windhundrasse, die nur männlich, aber mit star -
ken weiblichen Merkmalen behaftet vorkommt.
Daher liebt es der Bonsels, auch ausserhalb der läufigen Zeit nach weiblichen Hunden zu jagen, um dadurch die Männlichkeit seines Geschlechts auffälliger zu machen.»
Waldemar Bonsels war ein Überlebenskünstler und passte sich immer optimal an die jeweilige Situation an, zumindest so, dass sie am angenehmsten für ihn war. Damit kam er auch im nationalsozialistischen Deutschland gut durch. Aufgrund dessen, dass die Biene Maja als Propaganda umfunktioniert werden konnte, wurde sie glücklicherweise vor den zahlreichen Buchverbrennungen verschont und überstand als eines der wenigen Märchen diese Zeit.
Wenn der Name Biene Maja fällt, denkt man oftmals weniger an das Buch, als an die Animationsserie aus den 70er Jahren. Viele mögen sich bis hier gefragt haben, wo den der treuherzige Bienenjunge Willi und der Grashüpfer Flip abgeblieben sind. Was Viele nicht wissen, die beiden Freunde sind keine Charaktere aus dem eigentlichen Buch, sondern die Kreation der Animatoren der Fernsehserie. Allgemein wurde die Handlung der Serie den moderneren Gesellschaftsansprüchen angepasst und kinderfreundlicher gestaltet. Das Erstaunliche heutzutage; das Buch war bei seiner Erscheinung 1912 als Kinder- wie auch als Erwachsenenlektüre gedacht.
Während einige Figuren in der Geschichte rund um die kleine Biene Maja dem Autor entsprechend typisch deutsche und europäische Namen tragen, haben andere wiederum Namen, die der altgriechischen Mythologie und Epik entsprungen sind. Diese sagen bei genauerem Hinschauen einiges über den jeweiligen Charakter der Figur aus. Sie wurden vermutlich nicht zufällig vom Autor gewählt und waren nur für besonders aufmerksame Leseraugen bestimmt.
Maja: Frühling, der Wonnemonat Mai, Fruchtbarkeit, stellt durch ihre Fähigkeit des Fliegens eine Verbindung zwischen Erde und Himmel her. Kassandra, Majas Lehrerin : Derselbe Name wie die Seherin aus Troja, Wie die Kassandra in Homers Werk Ilias kann sie zukünftige Dinge vorausahnen.
Helene VIII., die Bienenkönigin : die schöne Helena Tochter der Leda und des Zeus, die Auslöser für den trojanischen Krieg war.
Grille Iffi: Abkürzung von Iphigenie, verweist auf die Tochter des Agamemnons, die als Priesterin in Abgeschiedenheit auf Tauris lebte. Wie Iphigenie lebte die verwitwete Iffi abgeschieden von anderen Tieren und kann sich nicht entschliessen, dem Werben des Mistkäfers nachzugeben, weil sie sich nicht dem Gerede anderer Insekten ausliefern möchte.
Tausendfüssler Hieronymus: Er lebte wie sein Namensvetter, der Kirchenvater Hieronymus, das genügsame Leben eines Einsiedlers und ist zum Grübeln und Zweifeln veranlagt.
Spinne Thekla: Ihr Name bedeutet wortwörtlich «Ruhm Gottes», Sie wird als boshaft und hinterlistig charakterisiert. Mit ihrem einschmeichelnden Reden überlistet sie die in ihrem Netz gefangene Biene, lügt ihr ins Gesicht und benimmt sich keinesfalls wie ein Lebewesen, das dem Ruhm Gottes dient.
Weberknecht Hannibal: Ist weder besonders mutig noch listenreich, wie man ihn aufgrund des Namens des berühmten Feldherrn von Karthago vermutet.
Erst die Fernsehserie machte sie zur reinen Kinderunterhaltung. Viele Eltern störten sich an der fremden Anime-Ästhetik und von literaturwissenschaftlicher Seite wurde die fehlende Nähe zur Buchvorlage kritisiert. Doch das hinderte die Serie nicht an ihrem bahnbrechenden Erfolg. Durch die bunte und fröhliche Animationsserie wurde Maja, die fortan den Künstlernamen Maya trug, zum Weltstar. Auch heute noch. Es gibt sie als Puzzle, Computerspiel, Plastikspielzeug, Vorhänge, Partyballon und sprechende Plüschpuppe. Mittlerweile gibt es sogar ein ganzes Maya Land mit Achterbahnen und diversen Attraktionen. Selbst im Bildungsbereich wird Maja eingesetzt, um Kinder besser zu erreichen. Das Buch und sein Autor geraten mit den Jahren immer mehr in Vergessenheit.
Über vierzig Jahre lief die Serie mit sehr gutem Erfolg, zum letzten Mal vom 27. April bis 19. September 2012. Danach entsprach sie nicht mehr den technischen Standards von 9:3 und HD-Qualität. Die 70er Maya wurde durch eine 3-D Maya ersetzt. Die Presse und viele Eltern äusserten sich dazu erneut kritisch, besonders was die 3-D-Ästhetik betraf. Doch Kinder kamen bisher kaum zu Wort, deshalb widmet sich die aktuelle IZI-Studie «Klassiker des Kinderfernsehens aus Kindersicht» ihnen und hat 95 Kinder Bilder zur Biene Maja zeichnen lassen. Ersichtlich wurde dabei, was genau die Kinder an
Biene Maja fasziniert. Die Zeichnungen zeigten jeweils zu einem Drittel «Maja allein», «Maja und Willi» und Maja in einer bestimmten Situation, manchmal mit Willi. Es ist also die selbständige, intelligente, hilfsbereite und mutige Maja und ihre enge Freundschaft zu Willi, was für die Kinder im Mittelpunkt steht. Sie sehen Maja als Vorbild und stellen sich oft vor, Maja zu sein. Fantasiewelten in einer Welt voller Harmonie und mit dem Wunsch, Harmonie zu erleben und zu erhalten. Ein schöner und zugleich lehrreicher Gedanke.

« E s ist freilich eine schwere Sache, sich selbst zu vergessen und so in ein Kinderköpfchen hinein sich zu denken, da sich umzuschauen, was alles darin und nicht darin sei. Aber wer es versteht, das Kinderherz sich offen zu erhalten, sieht auch in den Kopf hinein und erkennt, was er bedarf. Und zu seiner Ausfüllung arbeitet er dann stets vorsichtig wie die Biene in ihrem Korbe, die mit bewundernswürdiger Kunst erst die Waben anzuheften, dann die Zellen aufzubauen und dann endlich mit Honig.»
Jeremias Gotthelf«Hier greifen nun die Weisheit, der Instinkt, der Geist des Bienenstocks oder die Masse der Arbeitsbienen mit einer geheimnisvollen Entscheidung ein. Am überraschendsten ist es, wenn man den Gang dieser Ereignisse in einem Bienenstock mit Glaswänden mit den Augen verfolgen kann. Denn man gewahrt nie das geringste Zeichen von Zwist und Streit. Eine vorherbestimmte Einmütigkeit herrscht überall; es ist dies der Dunstkreis des Bienenstaats und jede Biene scheint im Voraus zu wissen, was die anderen denken werden.»
Maurice Maeterlick, 1911Die historische Vielfalt in der Mythologie, der Geschichte und den Bräuchen sowie die Genialität ihrer baulichen und ästhetischen Fertigkeiten lassen die Honigbiene in einem völlig neuen Licht erscheinen. Wir lassen uns von ihr inspirieren und sie als Vorbild dienen. Doch diese Erkenntnisse sind menschliche Auffassungen und äussere Beobachtungen, kaum stehen sie in Verbindung mit dem Inne -


ren, dem Leben im Bienenstock. Was genau sagen sie uns, was können wir von ihr lernen?
Beim genaueren hinhören und -schauen, erkennt man so manch kluges Verhalten im Umgang untereinander.
Eines davon; die Bienendemokratie. Am ersichtlichsten wird diese am Beispiel des Schwarmverhaltens und der Rolle der Kundschafterbiene. Das Schwarmverhalten der Bienen zeigt eindrückliche Entscheidungsprozesse, welche im Kollektiv getroffen werden. Die Kundschafterbiene hat die Aufgabe, Ausschau nach möglichen neuen Nistplätzen für das ausschwärmende Volk zu halten. Indes macht sich das Volk im Bienenstock auf den Auszug bereit, indem es Honig als Proviant aufnimmt. Findet die Kundschafterbiene einen geeigneten Ort, gibt sie ein Signal zum Aufbruch mit ihren Flügeln. Der Schwarm lässt sich erst an einem nahen Ast nieder und wartet. Worauf sie warten? Hier setzen nun die spannenden demokratischen Prozesse ein. Jetzt werden weitere Kundschafterbienen ausgesendet, welche die potenzielle neue Wohnung genauestens inspizieren und vermessen und nach anderen, vielleicht sogar noch besseren Möglichkeiten Ausschau halten. Die Arbeiterinnen verfügen über ein angeborenes Wissen, was genau ein optimales Zuhause ausmacht und können es nach Qualitätslevel beurteilen. Ihre Meinung von der besichtigten Behau -
sung gibt sie nach ihrer Rückkehr zum Ast in einem spezifischen Schwänzeltanz ab. Sie informiert die anderen über den Qualitätsstatus, wie Grösse oder Form. Bruchbude oder Villa? Je mehr Umdrehungen sie bei ihrem Tanz vollführt, desto besser ist die Behausung.
Jetzt beginnt sie für ihre Wahl zu werben. Auch die anderen ausgesendeten Kundschafterbienen werben und tanzen was das Zeug hält für ihre Funde und Meinung. Um erfolgreich zu sein, muss sie die Mehrheit des Schwarms überzeugen. Einige Arbeiterinnen folgen ihr zu ihrem Fund. Gefällt ihnen, was sie sehen, schliessen sie sich der jeweiligen Kundschafterbiene an und beginnen ebenfalls für diese Unterkunft zu werben. So entstehen mit der Zeit verschiedene Gruppen mit Unterstützerinnen für die eine oder andere Behausung. Durch die wachsende Anzahl individueller Inspektionen sinkt auch die Gefahr «Fake news» auf den Leim zu gehen. Die Kundschafterin, deren Unterschlupf als Unzureichend empfunden wurde, zieht sich zurück und fügt sich dem Mehrheitsentscheid.
Bienen lassen sich für einen anderen Nistplatz umstimmen und nach und nach für eine bessere, alternative Möglichkeit überzeugen. Es ergibt sich also folgendes Verhalten:
Damit die Unterstützerinnen des angeblich besten Ortes erfolgreich sind und das gesamte Volk ihnen
zustimmt, müssen sie am meisten Anhängerinnen gewinnen.
Was sagt uns dieser Entscheidungsprozess nun? Es mag vielleicht etwas weithergeholt erscheinen, dieses Beispiel auf den Menschen zu beziehen. Doch es hat sich gezeigt, dass Bienen wie auch Menschen besonnene Gruppenmitglieder benötigen, die nicht stur an ihren Ansichten festhalten, sondern sich auch zurückziehen und zum Wohl aller entscheiden können. Bienen sind in der Lage schlagartig auf die Unterstützung oder Durchsetzung einer Ansicht zu verzichten, wenn sich diese als nicht tragfähig für das Volk erweist und eine bessere Alternative zur Verfügung steht.
Bienen lehren uns, wie ihre «Gremien» Entscheidungen treffen, die dann vom gesamten Schwarm unterstützt werden. Schliesslich ist das Überleben des Volkes daran gebunden, dass sie alle beisammen bleiben. Somit müssen auch alle Mitglieder die Entscheidung für den richtigen Nistplatz tragen.
Während bei den Bienen die Kundschafterin ein gemeinsames Interesse verfolgt, das Finden einer geeigneten Wohnung, folgen Menschen oftmals unterschiedlichen und sich widersprechenden Interessen innerhalb eines Entscheidungsprozesses. Schlussendlich wird dann nach dem Mehrheitsprinzip entschieden. Jeder Anwesende hat eine Stimme und der Vorschlag mit den meisten Stimmen gewinnt. Egal,



ob alle dahinterstehen können.
Und trotzdem weisen die Demokratie der Bienen und die der Menschen viele Gemeinsamkeiten auf. In Beiden spiegeln sich in jeder Entscheidung die freiwillig beigesteuerten und gleichgewerteten Beiträge mehrerer hundert Individuen wider. Die Meinungsbildung wird von vielen mitgestaltet und nicht von einem oder mehreren einzelnen Anführern. Der Vorteil; die Gruppe kann so ein Problem durch viele Individuen untersuchen und die Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und verarbeiten, wozu eine einzelne Biene oder Mensch gar nicht in der Lage wäre. Je breiter die lösungsorientierte Diskussion, desto grösser die Wahrscheinlichkeit darunter die bestgeeignetste Lösung zu finden.


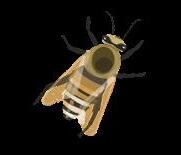




« A lle Menschen sind bestechlich, sagte die Biene zur Wespe.» Sprichwort

So lassen sich auch nützliche Anregungen aus dem Schwarmverhalten der Bienen ziehen. Der amerikanische Verhaltensbiologe Thomas D. Seeley veröffentlichte in seinem Bestseller Buch «Bienendemokratie: Wie Bienen kollektiv entscheiden und was wir davon lernen können» folgende Ansätze:
1. Die Gruppe der Entscheidungsträger sollte aus Individuen mit gemeinsamen Interessen, die sich gegenseitig respektieren, zusammengestellt sein.
2. Der Einfluss des Gruppenführers auf die Meinungsbildung der Gruppe sollte so gering wie möglich gehalten werden.
3. Man sollte für ein möglichst breites Spektrum an Lösungsoptionen für ein Problem sorgen.
So diente der Bienenstaat als Ganzes auch Michael O’Malley, Imker und Professor an der Columbia Business School, als Vorbild bei der Frage, wie ein Unternehmen geführt werden soll. Er betonte in seinem Buch «The Wisdom of Bees, 2010» die Dezentralisierung von Entscheidungsfindungen, die Weitsicht, die Arbeitsrotation, die Deutlichkeit, ein
funktionierendes Feedback und feste Routinen als inspirierende Schlüssel zum Erfolg. Weiter schreibt er, dass der wichtigste Punkt sei, wie die Honigbiene stets das zu tun, was für den Bienenstock – das Unternehmen – am besten sei. Das ist eines der Geheimnisse, um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Also richtiges «Bee-siness».
Auch Shakespeare verglich die Menschen mit den Bienen und entdeckte viele Ähnlichkeiten. Er lieferte dazu folgende Passage in seinem Stück
Heinrich V., Erster Akt, Szene 2:
«So tun die Honigbienen, Kreaturen, die durch die Regel der Natur uns lehren zur Ordnung fügen ein bevölkert Reich.
Sie haben einen König und Beamte
Von unterschiednem Rang, wovon die einen Wie Obrigkeiten, Zucht zu Hause halten, Wie Kaufleut andre auswärts Handel treiben, Noch andre, wie Soldaten, mit den Stacheln Bewehrt, sie samtnen Sommerknospen plündern Und dann den Raub mit lustgem Marsch nach Haus
Zum Hauptgezelte ihres Kaisers bringen.»
(Übersetzung von August Wilhelm Schlegel)
Natürlich - wie so oft – musste die Biene als Beispiel der Natur auch für das absolute Gegenteil der Demokratie herhalten; die «gottgegebene» Monar -
chie. So veröffentlichte Ferdinand Joseph Gruber im Jahr 1834 ein Buch, indem er genau das tat. Zu dieser Zeit war ganz Europa im Umbruch, ausgelöst durch die Französische Revolution einige Jahre zuvor. Das Streben nach einer freiheitlich-demokratischen Ordnung war allgegenwärtig und stiess unter all den Befürwortern auch auf Widerstand. Grubers Vergleich ist – wie der Text von Hesiod über die faulen Drohnen – aus heutiger wissenschaftlicher Sicht völlig absurd, da er den Bien als autoritäres System bezeichnet, dass einzig und allein auf das Oberhaupt – die Königin – fixiert sei. Dennoch ist es kulturgeschichtlich äusserst interessant und sollte hier erwähnt sein:
«Ein kluger Weisel hatte in einem Bienenstocke lange Zeit mit allgemeinem Beyfall geherrscht; denn unter seiner Regierung war Recht und Gerechtigkeit streng gehandhabt worden, es hatte Fried’ und Ruhe gewaltet, und bei dem Wohlstande des Ganzen hatte sich jeder Einzelne wohl befunden. Auf einmal brach eine allgemeine Empörung aus. Warum? – Einige träge und doch ehrgeizige Bienen, die lieber geniessen als arbeiten, lieber herrschen als gehorchen wollten, bemerkten mit grossem Missfallen, dass der Weisel nicht wie sie Honig sammeln dürfte, indess sie zu steter Arbeit gezwungen, alle ihre Kräfte anstrengen und ihm
gehorchen müssten. ,Warum’, sprachen sie zu den andern, ,sollen wir denn so emsig arbeiten, indes unser Weisel im schändlichen Müssiggange nur von unserm Fleisse lebt? Warum wollen wir nicht lieber bloss für uns eintragen? Brauchen wir ihn doch gar nicht, und noch weniger seine lästigen Befehle und Anordnungen. Lasst uns doch lieber unsere eigene Herren seyn, und leben, wie wir wollen!’ Diese törichte Rede fand leider offne Ohren und Herzen; alle Bienen verschworen sich wider ihre Königin, fielen sie an; und ermordeten sie. – Aber mit ihr war auch die Glückseligkeit des unklugen Völkchens dahin, und bald nahm Verwirrung und Zwietracht überhand. Jeder wollte sein eigener Herr seyn; alle wollten befehlen, Niemand gehorchen. Alle öffentlichen Arbeiten unterblieben, alle gemeinnützigen Anstalten wurden vernachlässigt, Schätze und Vorräthe vergeudet. Kein anders Gesetz galt als die eigne Lust, der eigne Vortheil; nirgends war Ruhe, nirgends Sicherheit. Es bildeten sich Partheien; eine befehdete und vernichtete die andere, und die siegende zerfiel wieder in sich selbst, und rieb sich selbst auf. Ehe noch der Winter kam, war der ganze Stock zerstört, und was sich noch aus der allgemeinen Verwüstung gerettet hatte, musste durch Hunger und Kälte verderben, oder wurde die Beute auswärtiger Feinde. So ergeht es auch in einem Völkerstaate, wo die
Parthei der Unzufriedenen die Oberhand gewinnt, der rechtmässige Beherrscher seiner menschenbeglückenden Macht beraubt, und der Ungerechtigkeit, Zwietracht und Raubsucht Thor und Thüre geöffnet wird.»
Klar ist nun, wir können vieles über und von den Bienen lernen, doch wie stehen wir – als Menschen – im Zusammenhang mit ihnen? Was verbindet uns und ist ein Leben auf dieser Welt ohne sie überhaupt möglich?
« W enn man beim Stiche der Biene oder des Schicksals nicht stille hält, so reisset der Stachel ab und bleibt zurück.»
Jean Paul
«Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.»
Verfasser unbekannt
Wie bereits der Quelle oben zu entnehmen ist, wird dieses weltbekannte Zitat von den Meisten fälschlicher Weise Albert Einstein zugeordnet. Jedoch hat der Wissenschaftler nie etwas im Zusammenhang mit den Bienen gesagt, noch hat er sie genauer erforscht.
«Skepsis ist nicht nur bei den «grossen» Lehren (oder Pseudolehren) wie Astrologie, Homöopathie oder UFO-Landungen und Weltuntergängen angebracht, sondern auch im täglichen Leben und im Kleinen, im gepflegten Smalltalk: Nahezu harmlose Beispiele liefern häufig die Zitate berühmter Leute, mit denen Artikel, Reden und Vorträge geschmückt werden, um die Argumente des Autors zu untermauern – und dabei nie von der Person gesagt wurden, oder ganz anders gemeint waren. Aber es sind wert -



volle kleine Lehrstücke über den Umgang mit Wahrheit (und Unsicherheit) in unserer Gesellschaft und damit von uns allen und dass wir skeptisch sein sollten.», so Walter Hehl.
Doch bevor wir uns in den Weiten dieser langwierigen Diskussion der Pseudo-Albert-Einstein-Quote verlieren, widmen wir uns nunmehr der eigentlichen Aussage, als dem Verfasser selbst. Wer sich dennoch mehr für die Autorschaft interessiert, der kann dieses Buch nun zur Seite legen und sich in den Tiefen des Internets damit vergnügen – angefangen bei der eigenen Wikipediaseite bis hin zu Verschwörungstheorien ist alles dabei.
Aber was heisst denn jetzt «wenn die Biene verschwindet, hat der Mensch noch vier Jahre zu leben»? Den meisten von uns dürfte vermutlich bekannt sein, dass die Biene einen wesentlichen Bestandteil in unserer Umwelt und bei der Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Wie genau das jedoch aussieht, wissen nur wenige. Die genaue Wechselwirkung zwischen Biene und Blume läuft folgendermassen ab:
Blütenpflanzen locken Honigbienen mit einzigartigen Farben und Düften an, um ihnen danach einen Tauschhandel anzubieten. Die Bienen bekommen Pollen und den süssen Nektar, bestäuben wiederum als Gegenleistung die Blüte, indem sie Pollen von den Staubbeuteln auf die Narbe der
Blüte überträgt. Natürlich tut die Biene das nicht bewusst. Die Blüten sind so von der Natur angelegt, dass die zierlichen Insekten beim Ernten die Narbe berühren und an deren klebrigen Oberfläche Pollenstaub abstreifen muss. Ursprünglich war der Nektar ein Abfallprodukt, doch im Laufe der Evolution hat die Blüte gelernt, wie wichtig er als Tauschmittel gegen die Bestäubung ist. Mittlerweile bieten sie den Nektar möglichst so für die Bienen an, dass sie ihn mühelos aufnehmen kann. Einige Blüten haben ihre Blätter so geformt, dass sie als geeignete Landeplattform dienen. Oftmals weisen sie sogar hilfreiche ultraviolette Muster als Landemarkierungen auf.
Auch die Bienen haben sich auf die Blütenpflanzen eingestellt. Über den Lauf der Zeit haben sie ein geeignetes Mundwerkzeug entwickelt und im Hinterleib haben sie zudem einen Darmabschnitt als Tank ausgebildet, den sogenannten Honigmagen. Die Honigbiene kann bis zu einer Menge von 40 Milligramm Nektar laden, was beinahe der Hälfte ihres eigenen Körpergewichts entspricht. Das wäre also wie wenn wir mit 30 bis 60 Kilogramm Gewicht durch die Gegend fliegen würden – wenn wir denn fliegen könnten. Eine durchaus eindrückliche Leistung. Später wandert das gesammelte Material durch ein winziges Ventil vom Honigmagen in den Darm. Nur einen kleinen Teil ihrer Beute verbraucht die
Biene für sich selbst, den Rest bringt sie in den Stock zu ihren Schwestern, wo sie die Fracht wieder Hochwürgt – aus dem Darm! – und mit für uns sehr gesunden Enzymen vermischt. Die Abnehmerbienen verstauen das Produkt in den Wabenzellen und verarbeiten ihn später zum eigentlichen Honig weiter.
Ein ziemlich ausgeklügeltes System also. Mehr als 85% der weltweiten Bestäubung findet so über die Bienen statt. Nun fällt es leicht, die weitreichenden Hintergründe dieses Zitates zu verstehen.
Bienensterben; ein Wort, dass in den vergangenen paar Jahren vermehrt in Film, Fernsehen, Zeitung und Co. auftaucht. Und oftmals auch der Auslöser für das gesteigerte Interesse der Allgemeinheit an den Bienen. Doch, was genau bedeutet es eigentlich? Um diese Fragen zu beantworten, richten wir den Blick auf die Dinge, die die Bienen krank machen und was sich in den letzten Jahren verändert hat, damit das Bienensterben überhaupt so rapide ansteigen konnte.
Eines der grössten Probleme für die Honigbiene ist die vor rund 30 Jahren eingeschleppte Varroamilbe. Diese nistet sich in der Wabenzelle einer Larve ein, legt Eier und ist pünktlich zu der Zeit ausgewachsen, wenn die junge Biene anfängt zu schlüpfen. Kurz nach dem Schlüpfen beisst sich die Varroa am Rücken der Biene fest und ernährt sich von nun an von deren Blut. Das Grössenverhältniss zwischen
Milbe und Biene entspricht etwa einem Kaninchen und einem Menschen. Eine riesige Belastung also.
Aber auch die vom Menschen stark geprägte Umwelt macht der Biene stark zu schaffen, denn blütenreiche Lebensräume sind selten geworden. Landwirtschaft wird intensiver als noch vor 60 Jahren betrieben und Siedlungsflächen breiten sich aus. In der Folge leiden Bienen Hunger und Wildbienen finden kaum mehr Nistplätze. Viele Pestizide für Pflanzen töten die Biene sofort, andere schädigen sie längerfristig. Folgeschäden treten auf, so kommt es vor, dass die Biene ihren Orientierungssinn verliert, den Weg zum Stock nicht mehr findet und verhungert.
Aber was können wir dagegen tun, wie können wir den Bienen helfen? Nicht jeder muss, um den Bienen helfen zu können, mit dem Imkern beginnen. Bereits kleine Dinge im Alltag machen einen Unterschied. Zum Beispiel kann ein Wildbienenhaus aus simplen Materialien wie Holz, Bambusstäben und Ziegelsteinen mit Hilfe eines Bauplanes aus dem Internet im Garten errichtet werden. Dieses kann weitestgehend sich selbst überlassen werden und bietet Wildbienen und diversen anderen bedrohten Insektenarten einen geeigneten Unterschlupf.
Oder das Pflanzen von Bienenfreundlichen Blumen auf dem Balkon – Stadtbienen freut das besonders.
Auch das Verzichten von Pestiziden macht einen erheblichen Unterschied und unterstützt die Bienen bei ihrer Haus- und Nahrungssuche.
Zu viel Ordnung ist doch langweilig! So darf es auch gerne im Garten etwas unordentlicher sein. Verabschieden sie sich von ihrem englischen Rasen, der mühsam gehegt und gepflegt werden muss. Pflanzenstängel, Totholz, leere Schneckenhäuser und nicht intensiv gepflegte Stellen können sogar Bienenleben retten. Hier hat die Faulheit endlich ihren nützlichen Zweck gefunden!
Den grössten Einfluss erzielt man aber als Konsumentin oder Konsument indem man lokale Produkte aus bienenfreundlicher Landwirtschaft einkauft und die regionalen Imker mit dem Kauf ihres Honigs unterstützt.
In der Schweiz will auch die Regierung mit gezielten Massnahmen wirksamer gegen die Bekämpfung von Bienenkrankheiten vorgehen. So besteht seit dem 1. Januar 2020 in der Schweiz eine kantonale Meldepflicht aller Bienenhaltungen im Land. Zusätzlich muss das Verbringen von Bienenvölkern von einem Inspektionskreis in einen anderen gemeldet werden. Weiter wird eng mit dem Zentrum für Bienenforschung (ZBF) zusammengearbeitet. Ökowiesen wurden gesetzlich verankert und bereits zahlreich umgesetzt. Wer sich genauer achtet, bemerkt erste Erfolge und sieht vermehrt auf solchen
Wiesen seltene Tierarten.
Doch ein Problem bleibt – was tun, gegen die Varroamilbe? Vielleicht sollte die Frage umgeformt werden und so lauten: Warum kommen unsere hiessigen Bienen so schlecht mit der Varroa klar? Eine grosse Anzahl an Wissenschaftler weltweit setzt sich mit dieser Frage auseinander und sind bereits auf einige mögliche Erklärungen gestossen. Da jedoch dieses Gebiet und die Erkenntnisse dieser jungen Forschung den Rahmen des Buches sprengen würden, beschränkt sich unser Fokus auf einige wenige Ansätze.
In den meisten europäischen Ländern besteht eine Behandlungspflicht gegen die Varroa. Dies geschiet mehrmals jährlich mittels Ameisen- oder Milchsäure. Da dies aber schlecht kontrolliert werden kann, gibt es immer wieder Imker, die aus Kostenspargründen die Behandlung nicht oder nicht vollständig durchführen. Da aber Bienen bekanntlich schwärmen, tragen befallene Völker die Milben in einem Umkreis von 10 Kilometern zu anderen, gesunden Völkern. Desshalb ist es von grosser Wichtigkeit, dass jeder Imker die Behandlung regelmässig und pflichtbewusst ausführt.
Doch auch bei dieser Methode zeichnen sich Nachteile für die Gesundheit des Volkes ab. Zwar dämmt es die Varroamilbe ein, gleichzeitig stresst und schadet es den Bienen. Deshalb ist man in der






« I ch bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will»
Forschung bemüht, eine geeignetere Alternative zu finden. Zum Beispiel in der Form einer von der Natur aus resistenteren Biene.
Anscheinend sind Bienen auf anderen Kontinenten deutlich resistenter gegenüber der Varroa. Sie müssen also Methoden gefunden haben, gegen diese anzukommen. Dieser Ansatz klingt plausibel, denn die Varroamilbe ist kein Parasit aus unseren Breitengraden, sondern wurde 1977 für Forschungszwecke gemeinsam mit asiatischen Bienen eingeschleppt. Forschern fiel nach einiger Zeit auf, dass die Grösse der Wabenzellen sich zwischen den asiatischen und europäischen Bienen unterscheidet. Während die einheimischen Bienen Zellen mit dem Mass von 5,1 bis 5,5 Millimetern bauen, betragen die aussereuropäischen 4,6 bis 4,9. Weshalb das relevant ist?
Die Varroa nistet sich in den Wabenzellen ein und schlüpft gemeinsam mit der Jungbiene. Ist also diese Zelle kleiner, könnte es zu eng für die Varroa werden und sie kann sich schlechter fortpflanzen. Vielleicht sollte noch hinzugefügt werden, dass es bis ca. 1930 das kleinere Zellenmass bereits gab. Doch in den 30er-Jahren kam die Überzeugung auf, dass die Bienen, die mit dem grösseren Zellmass ausgestattet seien, länger flögen und mehr Honig einbringen. Die Industrie bot die fertigen grossen Mittelwände mit den aufgeprägten Wabengrundriss an und die damaligen Imker hinterfragten dieses
künstliche Eingreifen nicht. Die kleineren Zellen bringen diverse Vorteile mit sich. Zum einen, haben mehr Zellen auf einer Wabe platz und es kann dementsprechend eine grössere Anzahl Bienen herangezogen werden, was zu einem stärkeren Volk beiträgt. Zum anderen, verkürzt sich damit die Entwicklungszeit einer Biene um einen Tag und die Varroamilbe ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit zum Schlüpfen. Dass es gar keine Varroamilben mehr in den Zellen hat, wird jedoch von keinem der Wissenschaftler behauptet. Man geht davon aus, dass durch die grössere Menge an Bienen auf einer Wabe mehr putzen und eine höhere Hygiene und Bekämpfung herrscht.
Die Forschung in der Bekämpfung der Varroamilbe steckt noch in den Kinderschuhen und der goldene Mittelweg zwischen Schaden und Nutzen gegenüber den Bienen muss erst entdeckt werden.
Doch wir wissen nun, dass jeder von uns seinen kleinen Teil zum Erhalt der Bienen beitragen kann, seien es die eigene Imkerei, die Balkonblumen oder das bisschen Unkraut im Rasen. Das alles macht bereits einen grossen Unterschied für die freundlichen Bienen aus der Nachbarschaft.

Imkerausrüstung:
Besen
Tabak
Schleier
Lötlampe
Rauchboy
Stockmeissel
Schwarmkasten
Bummihandschuh
Kl. Bunsenbrenner
Kasten:
Wabendraht
Futtergeschirr
Magazin (2 Stk.)
Mittelwände (2kg)
Drahteinschmelzer
Brutrahmen (24 Stk.)
Honigrahmen (48 Stk.)
Varoabehandlung:
Ameisensäure
Dispenser (2 Stk.)
Honig:
Sieb
Abfüllkessel
Refraktometer
Honigschleuder
Entdeckelungsmesser
Bienenvölker:
Futter
Kunstschwärme
Startkapital rund 2500.-
« S chwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene.»
Muhammad Ali, Boxer

E s waren einmal zwei Bienen, die sassen am Eingang ihres Bienenkorbs in der Sonne. Lange Zeit hatte ein heftiger Sturm gewütet. Seine Gewalt hatte alle Blumen weggefegt und die Welt verwüstet.
«Was soll ich noch fliegen» , klagte die eine Biene. «Überall herrscht ein wüstes Durcheinander. Was kann ich da schon ausrichten!» Und traurig blieb sie sitzen.
«Blumen sind stärker als der Sturm» , sagte die andere Biene. «Irgendwo müssen noch Blumen sein, und sie brauchen uns, sie brauchen Besuch. Ich fliege los.»
Phil Bosmans




Bienen haben ihre ganz eigene Art untereinander zu sprechen - sie tanzen. Ihre Sprache besteht aus präzisen Rhyhtmen, kreisenden Hüften und schlagenden Flügeln. Mal gerade aus – mal im Halbkreis. Seit mehr als 2500 Jahren beschäftigen sich Philosophen und Forscher mit diesem Phänomen und doch gelang es erst im späten 20. Jhd., hinter die Kulissen der Tänzerinnen zu schauen. Aber bevor wir uns in die Tiefen des alten wie auch sehr jungen Gebiet vorwagen, eine honigsüsse Erzählung von der Entdeckung der tanzenden Bienen:
«Da wundert sich Aristoteles. Ein attischer Imker hat ihn zu einem seiner Bienenkörbe geführt, um ihm ein eigentümliches Schauspiel vorzuführen. Es ist ein warmer Frühlingstag, ringsherum blühen die Obstbäume. Hunderte ja tausende Bienen sausen um Aristoteles‘ bärtigen Kopf, und er fürchtet schon den einen oder anderen Stachel. Auf dem
Weg zu den Bienenkörben durch die blühenden Wiesen beobachtete er das muntere Treiben der kleinen Tierchen auf den Blüten. Sie scheinen zu wissen, wie sie den Nektar aus der Tiefe heraussaugen und den Pollen aus den Staubgefäßen schütteln und kehren. Er läuft hinter der einen und der anderen Biene hinterher. Dabei macht er eine Entdeckung, die er dem belustigt zusehenden Imker zuruft. So eine Biene lande ja nicht beliebig auf jeder beliebigen Blüte, sondern suche sich immer die gleiche Blüte aus. Die eine Biene die blauen Veilchen, die andere den gelben Hahnenfuß, wieder eine andere bleibt nur den Kirschblüten und noch eine andere beschäftigt sich nur mit Löwenzahnblüten. Der Imker scheint gelangweilt. Das wusste er längst, und er kann nicht sehen, warum das den Philosophen so aufregt. Etwas viel Eigentümliches will er ihm zeigen, muss aber erst einmal zusehen, wie sein Philosoph quer durch die Wiesen den Bienen nachrennt. Dann nähern sie sich einem Bienenkorb. Der Imkerfreund hat einen Korb ausgesucht, bei dem besonders viel Flugverkehr herrscht und sich außerdem viele Bienen vor dem Einflugschlitz versammelt haben. Beim genaueren Hinsehen beobachtet Aristoteles ein merkwürdiges Verhalten: Eine Biene dreht sich im Kreis, wackelt hin und her, und wird dabei von zahlreichen anderen Bienen genau beobachtet. Sie - 170 -
tasten mit ihren Fühlern nach ihr und weichen nur ein Stückchen zurück, wenn sie die „tanzende“ Biene um sich selbst dreht.
Einige Tage später wird Aristoteles zu seinen Schülern sagen: «Bei jedem Ausflug setzt sich die Biene nie auf artverschiedene, sondern nur auf artgleiche
Blüten, fliegt zum Beispiel von Veilchen zu Veilchen und rührt keine andere an, bis sie in den Stock zurückgeflogen ist. Sobald sie in den Stock kommen schütteln sie ihre Last ab, und einer jeden Biene folgen drei oder vier andere. Was diese in Empfang nehmen ist schwer zu sehen, auch ist noch nicht ihre Arbeitsweise beobachtet worden...»
Erst tausende Jahre später kam die Antwort auf das Rätsel. 1973 machte der Österreicher Karl von Frisch die Entdeckung, dass die Bienen Informationen von der Tänzerin entgegennehmen und ihr eigenes Verhalten jeweils danach richten. Er lieferte die Entschlüsselung der Bienentanzsprache. Eine wahre Sensation – bis heute. Frisch bekam dafür den Nobelpreis verliehen.
Vor seiner Entdeckung wurde wild darüber diskutiert, weshalb die Bienen wohl tanzen. Dass es zur reinen Vergnügung und Unterhaltung diente, klang plausibel. Schliesslich müsse die Biene auch hin und wieder ihre Schwestern aufmuntern, so schwer wie die Bienen schuften.
Möglicherweise gehören solch menschliche Empfindungen auch zum Empfindungsspektrum der Biene - wer weiss - , doch, so unromantisch es klingt, das Tanzen hat nichts mit einer Unterhaltungsshow zu tun. Der Tanz hat eine klare Funktion und unterliegt einer Choreografie mit bestimmten Symbolen und Bewegungen.
Bei uns Menschen gibt es die unterschiedlichsten Tanzarten. Angefangen beim klassischen Ballett, Stepptanz oder Tango über HipHop, Breakdance, Jazz bis hin zu diversen Riten- und Volkstänzen.
Jeder Tanz steht für etwas anderes, wie Eleganz, Rebellion oder das Überliefern von Geschichten und Kultur.
Ähnlich ist es bei den Bienen. Zwar schwingen sie nicht das Salsabein, haben aber genauso wie wir verschiedene Tänze, die einer genauen Botschaft und Situation zugeteilt sind. Bisher unterteilt man in fünf Tänze. Der Schwänzeltanz, Rundtanz, Zittertanz, Schütteltanz und Schwirrtanz. Klingt alles ein wenig nach “ Wirr hier“ und “ , doch es bestehen klare Unterschiede.
So benutzt die Biene den Schwänzeltanz, um ihren Schwestern den Weg zu einer Blume zu erklären. Der Tanz folgt dabei den Linien einer zusammengedrück ten Acht.

Honigbienen lassen sich hervorragend trainieren und zeigen dabei in ihrem Lernverhalten eine Spitzenleistung. Forscher haben eine Honigbiene in eine ihr unbekannte Umgebung gesteckt und ihr nur mit Hilfe von Düften den Weg kommuniziert. Ein einziger Kontakt mit einem Duft genügt und sie kann ihn sich ihr Leben lang ohne grössere Probleme merken. Ziemlich clever also. Und nach ein bis zwei Trainingsläufen erkennen sie ihn sogar zu hundert Prozent fehlerfrei wieder. Bienen gewinnen so enorm schnell an Sicherheit beim Erkennen von Formen und Farben in ihrer Umwelt. Neben der Beherrschung einer einfachen Art des Zählens – wenn das nicht schon phänomenal genug ist – sind sie in der Lage, aus Erfahrungen Verhaltensregeln zu abstrahieren und diese auf vollkommen neue Situationen zu übertragen. So können sie sich anhand zuvor erlernter Zeichen –wie «rechts» oder «links» - sogar in Labyrinthen zurechtfinden, in denen sie nie zuvor gewesen sind.
Der Rundtanz dient ebenfalls der Wegbeschreibung, jedoch für eine Blume mit einer maximalen Entfernung von 100 Metern. Hier tanzt die Biene einen Kreis und wechselt nach jeder Runde mit einem Hakenschlag die Richtung.
Hat die Sammlerbiene einen vollen Honigmagen und niemand im Stock kommt, um ihr die Ware abzunehmen, beginnt sie mit ihrem ganzen Körper zu zucken und zu zittern. Die anderen werden dadurch aufgeschreckt und eilen ihr zügig zur Hilfe. Diesen nennt man Zittertanz.
Etwas direkter geht es zu, wenn die Bienen den Schütteltanz praktizieren. Mit ihrer Beinmuskulatur erzeugt sie Vibrationen. Stellt sie sich nahe an eine andere, geht die Vibration über und rüttelt sie wortwörtlich wach. Jedenfalls verrichtet diese dann dieselbe Arbeit, wie die Tänzerin.
Der letzte der bekannten Tänze ist der Schwirrtanz. Dieser kommt zum Einsatz, wenn sich ein Volk zum schwärmen bereit macht. Dabei rennen einzelne Bienen im wilden Zickzack durch die Menge und rempeln dabei ihre Kolleginnen an, damit auch wirklich jede weiss, dass es gleich Abflug heisst.
Der Bienentanz klärt auch die Frage, weshalb Waben senkrecht hängen. Damit die Tänzerin ihren Kolleginnen die genaue Himmelsrichtung angeben kann, richtet sie sich an der Sonne. Nur ist es im Bienenstock «stockfinster». Hier kommt die senk- 174 -
rechte Wabe ins Spiel. Dank der Schwerkraft weiss die Biene immer wo die Sonne ist - trotz Dunkelheit. Reckt die Tänzerin ihren Schwanz senkrecht in die Höhe, ist er also genau zur Sonne gerichtet. Das heisst für die anderen: fliegt Richtung Sonne. Zeigt er nach unten: fliegt entgegengesetzt der Sonne. So kann die Biene mit verschiedenen Winkeln die Himmelsrichtung angeben. Klever! Wer gerne selbst die Botschaft einer tanzenden Biene entschlüsseln möchte, kann mit dieser Anleitung einen Bienentanzkompass herstellen.

Seit neuestem weiss man auch, dass in der Bienenwelt verschiedene Dialekte existieren. Ja, Dialekte! Karl von Frisch hatte diese Dialekte unter den verschiedenen Bienenarten bereits entdeckt, doch war lange umstritten, ob es diese wirklich gibt. Vor kurzem konnten es der Forscher Patrick Kohl und seine Kollegen tatsächlich beweisen. Unter Bienenfreunden ist dies momentan das Gesprächsthema Nummer Eins.
Es handelt sich um feine Details in einer bestimmten Bewegung, die bereits zu erheblichen Kommunikationsschwierigkeiten führen. Während die Biene der einen Art zwei Sekunden ihre Hüften schüttelt, schüttelt sie die andere Bienenart für dieselbe Distanz nur eine Sekunde. Wenn also eine westliche Biene einer afrikanischen Biene den Schwänzeltanz vorführt, dann versteht diese die Botschaft sehr wohl, fliegt aber statt der eigentlich gemeinten 1000 Metern gleich 10’000 Meter.
« L iebe ist das Tanzen der Biene bei ihrer Suche nach Nahrung.»
Irina Rauthmann

Bienen tanzen. Menschen tanzen. Doch was entsteht, wenn zwischen diesen beiden Welten eine Brücke geschlagen wird. Tanzen stellt ohnehin eine universelle Sprache dar.
Crystal Pite ist zur Zeit eine der innovativsten und aufregendsten Choreografinnen im klassischen, wie im zeitgenössischen Tanz. Auch sie wurde in den faszinierenden Bann der Bienen und Insekten gezogen. So kreierte sie im Auftrag des National Ballet of Canada ein choreografisches Original Werk. Dieses sollte Teil des Programmes «Innovation» der Saison 2008/09 werden, in welchem neue Werke kanadischer Choreografen und Künstler gezeigt wurden. Das Endresultat von Pite, Emergence, liess das Publikum unter tosendem Applaus auf die Füsse springen - und das nach jeder Aufführung. Die Faszination der Insekten begeisterte immer mehr Leute im Land, wie auch international. So gewann sie mit Emergence gleich vier Dora Mavor Moore Awards für herausragende Produktion, herausragende neue Choreografie, herausragende Performance und herausragende Komposition & Sound Design.
Doch worum geht es in dem Stück? Innerhalb einer Ballettcompagnie besteht eine klare Hierarchie, die sich meist in verschiedene Stufen gliedert. Die Opera Garnier in Paris – um ein Beispiel zu nennen – verfügt über fünf solcher Stufen, angefangen beim niedrigsten Rang der «quadrille» über die «coryphée» - 178 -
und das «sujet» bis zum «premier danseur» (1. Tänzer). Die höchste Stufe, die des «étoile» (Solotänzer), erlangt man jedoch nur auf Empfehlung des künstlerischen Leiters und per Nominierung durch den Operndirektor.
Die Rollenverteilung wird häufig strikt nach dieser Rangordnung zugeteilt und es ist ein harter Weg, sich als Tänzer nach oben zu tanzen - wenn man es denn überhaupt schafft. Aktuell – in der Saison 20/21 – befinden sich etwas mehr als 150 Tänzer in der Compagnie und nur je 20 davon sind 1. Tänzer oder Solisten. Also ein ziemlich hoher Konkurrenzdruck.
Pite widmete sich der Frage, ob eben diese hierarchische Struktur einer klassischen Ballettcompagnie auch in der Natur zu finden ist. «Zuerst habe ich mich einen Bienenschwarm als mögliches Modell ins Auge gefasst» , so Pite. Sie war bei ihrer Recherchearbeit auf die Schriften eines Verhaltensbiologen und Imkers gestossen. Dieser hatte die Charakteristika der Schwarmintelligenz formuliert und mit Wesensmerkmalen intelligenter kollektiver Lebensformen in Verbindung gesetzt. Pite war fasziniert davon, dass in der Natur die Entscheidungen eher im Kollektiv getroffen werden, als dass einzelne Individuen die Führung übernehmen. «Nahezu die gesamte Population trägt mit Informationen zum koordinierten Verhalten bei. Jedes Individuum, das
sich an der kollektiven Debatte beteiligt, bringt seine sachkundige und unabhängige Einschätzung ein. Bei den Bienen werden solche Debatten äusserst lebhaft und wetteifernd geführt, bis die Einzelbeiträge zu einer Synthese verschmelzen. Von Hierarchie also keine Spur. Eine Bienenkönigin <regiert> nicht.»
Die Choreografin machte sich daran, die Strukturen in der Natur zu verstehen und genauer darüber nachzudenken. Strukturen, die den Eindruck erwecken «ein Wesen, ein Bewusstsein, ein Gehirn» zu sein. Sie suchte nach Parallelen in der Ballettcompagnie und nach Möglichkeiten diese Strukturen auf den Tanz zu übertragen. Doch abgesehen vom Element des gegenseitigen Konkurrierens liessen sich zunächst kaum welche finden. Erst als sie sich noch tiefer mit der Materie befasste und sich ihren Tänzern gegenüber öffnete. Sie bat jeden Tänzer, sich als bienengleichen kollektiven Körper zu reflektieren und die Strukturen zu ergründen, die aus einer Interaktion mit anderen Tänzern entstehen. Sie alle kamen zur Erkenntnis, dass jeder einzelne Tänzer zur übergeordneten Struktur der Choreografie beiträgt und auf gewisse Impulse eines anderen der Gruppe eingeht – eine Gruppendynamik entsteht. «Ich richte meinen Körper an diesen fünf Kollegen aus, schlage jene Richtung ein, löse die Bewegung unseres Systems auf ein bestimmtes musikalisches Signal hin aus und so fort.» - 180 -
Ihre Arbeit, das hat Pite wiederholt betont, ist von dem Versuch geleitet, einem individuellen Wesen in der Natur sowie seiner Eingliederung in einen grösseren Zusammenhang oder ein Ökosystem nachzuspüren. Sie ist überzeugt davon, dass der Mensch Gefallen an dem Phänomen der Synchronizität findet sowie sich mit einem grösseren Ganzen zu verbinden. Die Bilder und die Ästhetik eines Schwarms fasziniert den Menschen, berührt ihn. Die Eleganz eines Fischschwarms, wie er sich im Ozean in einer grossen Traube fortbewegt oder auch die Koordination der Vögel, wenn sie gemeinsam Richtung Süden ziehen. All das zieht uns in den Bann. Und so entwickelte sich nach und nach Emergence.


Musik und Tanz sind eng miteinanderverbunden was die Sprache der Bienen betrifft. So «singt» die junge Königin kurz vor ihrem Schlüpfen, um auf sich aufmerksam zu machen und die anderen Königinnen in ihren Zellen zu warnen. Wer hinhört, nimmt Laute wahr, die als Tüten und Quaken beschrieben werden. Oftmals ist das «Tüüt-tüt», das an einen elektronischen Wecker erinnert, für Menschen noch einige Meter vom Bienenstock entfernt zu hören! Es dient dazu Zweikämpfe zwischen Jungköniginnen zu vermeiden, denn meist zieht das Volk mehrere Königinnen gleichzeitig heran.
Schlüpfen zwei oder mehr zur selben Zeit kommt es zum Kampf, in welchem nur eine als Siegerin hervorgeht. Mit dem Tuten verhindert die Natur das ineffiziente Blutbad, schliesslich soll das aufwändige Heranziehen mehrerer Königinnen nicht umsonst gewesen sein und widerspricht natürlich dem optimalen Einsatz von Ressourcen, den der Bien üblicherweise pflegt. Die erstschlüpfende Königin warnt ihre Genossinnen, welche sich anschliessend ruhig verhalten und mit ihrem eigenen Schlüpfen noch warten bis diese mit einem Teil des Volkes den Stock verlassen hat und die Luft wieder rein ist. Die alte Königin ist bereits eine Woche vor dem Schlüpfen mit einem eigenen Schwarm fortgezogen, um den jüngeren Platz zu machen.
Im Grunde sind es gar nicht die Töne, worauf - 182 -
die anderen reagieren. Es sind die Vibrationen der Flügel, mit denen die schlüpfende Königin fleissig flattert. Diese werden dann über die Wabenkonstruktion in den gesamten Stock versendet. Der Ton ist lediglich das Nebenprodukt, das dabei entsteht. Die noch ungeschlüpften Königinnen antworten meist mit einem Quaken, fast so, als wollen sie ihr antworten, dass sie verstanden haben und ihr den Vortritt gewähren.
Nachdem Jan Swammerdam unter seinem Mikroskop weibliche Geschlechtsmerkmale bei der Königin festgestellt und die gesellschaftlichen Ansichten revolutioniert hatte, erschien zwischen 1734 und 1742 das Hauptwerk des französischen Naturforschers
René-Antoine Ferchault de Réaumur unter dem Titel «Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des insectes». Die Honigbiene genoss einen hohen persönlichen Stellenwert und er widmete ihr darin gleich mehrere Kapitel. Neben seiner Entdeckung der Gliederung in Königin, Drohnen und Arbeitsbienen widmete er sich erstmals der geometrischen Struktur der Wabenzelle. Gemeinsam mit dem Mathematiker König untersuchte er deren Form und wies nach, dass eine sechseckige Zelle die ökonomischste Form ist. Sie benötigt im Verhältnis zum Fassungsvermögen die geringste Wachsmenge.
Bereits einige Jahrhunderte früher, genauer gesagt in den zwanziger Jahren des 6. Jahrhunderts v. Chr., beschäftigten sich die sogenannten Pytha -

«
U nd all die wackern Handwerksleute, Die hauen, messen stillvergnügt, Bis dass die Seite sich zur Seite Schön sechsgeeckt zusammenfügt.»
Wilhelm Busch
goräer intensiv mit Mathematik, Zahlen und Zahlensymbolik. Ihnen werden diverse mathematische Erkenntnisse zugeschrieben, unteranderem der Pythagoräische Lehrsatz.
In der religiös-philosophischen Schule in Unteritalien, unter der Führung des Gründers Pythagoras von Samos, hatte man, laut dem Wissenschaftler Walter Burkert, einen sehr kosmologisch-symbolischen Zugang zu Zahlen und keinen wissenschaftlichen – andere Forscher behaupten wiederum das genaue Gegenteil.
«Alles ist Zahl» dies bedeutet, dass die Zahl als das konstituierende Urprinzip der Welt der Erscheinung gegolten hat. Das Sechseck, das die Bienen in ihren Waben bildeten, war ihnen heilig und galt als Symbol der Göttin Aphrodite. Der Wissenschaftler B. G. Walter meinte: «Sie verehrten die Bienen als heilige Tiere, weil sie es verstanden, in ihren Waben vollkommene Sechsecke zu bilden. Im Aphrodite Tempel von Eryx – eine kleine Stadt im Westen Siziliens, heute Erice – hiessen die Priesterinnen Melissae oder «Bienen». Die Göttin selbst trug den Namen Melissa und galt als die Bienenkönigin. Ihr zu Ehren wurde stets eine goldene Honigwabe aufgestellt. Die Pythagoräer, die die Geheimnisse der Natur durch die Zahl zu verstehen versuchten, meditierten über das unendliche Dreiecksnetz, das nur sechzig Grad Winkel enthält und dann entsteht,
wenn man die Seiten aller Sechsecke verlängert, bis diese Linien sich im Zentrum der danebenliegenden Sechsecke treffen. Für die Pythagoreer enthüllte sich darin die elementare Symmetrie des Kosmos.»
Einige Quellen sprechen sogar davon, dass sie die Bienen so sehr verehrten, dass sie sich über mehrere Wochen fast ausschliesslich von Honig ernährt haben sollen. Ob man dieser Erzählung glaubt, ist jedem selbst überlassen. Die Vorstellung jedoch ist durchaus ein Schmunzeln wert.
Während des zweiten Weltkriegs wurde die «Paper Honeycomb» eingeführt und von den Alliierten für den Bau des Flugzeugtyps Douglas Dakota genutzt. Dieses war ein äusserst beliebter Begleiter und wurde an vorderster Front und auch später noch im Militärdienst eingesetzt. Nach dem Weltkrieg diente die Paper Honeycomb vorwiegend als Baumaterial für den Wiederaufbau in Europa. Aufgrund ihrer Stabilität und den – im Vergleich zu den knappen Baumaterialien Holz und Ziegel – sehr kostengünstigen Konditionen wurde die Paper Honeycomb zu einer exzellenten Alternative.
So wird auch heute noch reger Gebrauch von der verbrauchsfreundlichen Wabenstruktur gemacht, und das immer mehr. Durch die extrem hohe Stabilität, da sich die Belastung auf dem gesamten Wabenbau verteilt, und dem zugleich äusserst geringen Gewicht und Material, eignet sie sich hervorragend
für diverse Konstruktionen. Das Gewichtsersparnis beträgt dabei bis zu 80%. Beim Material über einen Drittel!
Vor allem in der Architektur, dem Möbeldesign sowie in der Luft- und Raumfahrt findet die sogenannte «Honeycomb-Struktur» grossen Anklang. Materialarme Bauteile eignen sich besonders für grossflächige Anwendungen, wie es bei der Innenfüllung von Türen oder Schreibtischplatten, Verpackungen oder auch Snowboards der Falls ist. Meist werden die «menschgemachten» Honeycomb-Struktur-Materialien so angefertigt, dass eine Wabenstruktur in der Mitte platziert und sie jeweils an beiden Seiten mit dünnen Schichten verleimt wird. Durch dieses Sandwich-Prinzip entstehen vielseitig nutzbare Platten.
Die Continental AG entwickelte sogar einen Winterreifen mit Wabenstruktur, da diese eine deutlich höhere und bessere Haftung auf vereister Strasse ermöglicht und zusätzlich den Bremsvorgang verbesserte. Allgemein kann man heutzutage in der Automobilindustrie die Wabenstruktur kaum mehr wegdenken. BMW nutzt sie, um das Material an Stellen, bei denen es grosser Hitze ausgesetzt ist (z.B. Katalysator), durch die Wabenstruktur hitzeresistenter zu machen. Aufgrund der besseren Verteilung der Hitze auf die Wabenoberfläche verbiegt sich das Material deutlich weniger, ist langlebiger und er -
möglicht einen geringeren Materialverbrauch, was wiederum zu weniger Gewicht und einem energieeffizienteren Fahrzeug führt. Deshalb kam es auch 1990 beim Hubble Space Telescope der NASA zum Einsatz. Auch bei dem neuen James Webb Space Telescope, dass 2021 ins All geschossen wird, nutzt die Technik der Wabenform. Dieses gilt als das leistungsstärkste Teleskop überhaupt. Stationiert wird das Teleskop etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite des Sonnensystems. Dort soll es Aufnahmen von weitentfernten Bereichen des Universums machen. Da dies einen besonders fein einstellbaren Brennpunkt erfordert und in absoluter Dunkelheit erfolgt, wurden an der Teleskopaussenseite grosse bewegliche Spiegel in Wabenform angebracht. Durch die sechseckige Form kann jedes der achtzehn Segmente individuell ausgerichtet werden und ermöglicht so eine optimale Bildschärfe. Zusätzlich kann die Spiegelfläche bei Bedarf möglichst klein zusammengefaltet werden, wie es zum Beispiel der Raketenstart erfordert.
 J.W.
J.W.
Im Bereich der Bautechnik setzt man zunehmend auf strukturierte Ziegelsteine, die ähnlich wie bei Verpackungsmaterialien wabenförmige Hohlräume aufweisen. Auf diese Weise sind die Ziegel wesentlich leichter, weisen jedoch dieselbe Stabilität wie massive Bauelemente auf. Die eingeschlossene Luft verbessert zudem die Schall- und Wärmeisolierung. Um die Klimawirkung noch zu steigern, kann bei Bedarf warme oder kalte Luft durch die porosierten Hauswände geleitet werden. So findet sie auch schon länger in der Lüftungstechnik Verwendung, wo häufig Aluminiumrohre mit der Wabenstruktur versehen werden.
Selbst in der Waschmaschinen-Branche dient die Biene als Vorbild. Bei der Firma Miele wird die Oberfläche der Waschmaschinentrommel mit der Wabenstruktur überzogen. Dies sorgt dafür, dass später die Wäsche auf einem Wasserfilm gleitet und so beim Schleudern weniger stark strapaziert wird.
Auch in der Leuchtmittelindustrie profitiert man von der Wabenform. So hat Siteco eine Hexalleuchte entwickelt, die durch ihre Aluminiumwaben das Licht breit streut und dadurch kaum Reflexionen verursacht und die Lichtausbeute erhöht. Gerade im Bereich des Lampendesign finden sich viele Vertreter der «Honeycomb». Die Designer des mehrfach Preisgekrönten Studios Habits in Italien brachten 2010 ein Beleuchtungssystem auf den Markt, das
durch das Prinzip des Wabenbaus individuell ausgebaut und optimal an den jeweiligen Raum angepasst werden kann. Und das kinderleicht. Die sechseckigen Module von Honeycomb lassen sich wie die Zellen der Bienenwabe beliebig zu einer Hängelampe aneinanderreihen und sind mit kleinen Kunststoffklammern untereinander befestigt, so dass eine selbsttragende Struktur entsteht.
Um einen noch tieferen Einblick in die Herstellung und genaue Nutzung der Wölbestruktur in der Designbranche zu erhaschen, lohnt es sich, den Kurzfilm «Binomische Wölbstrukturen – Die Natur als Vorbild für Ressourceneffizienz» auf dem Youtubekanal des VDI Zentrums Ressourceneffizienz «Ressource Deutschland» oder auf deren Website www.ressource-deutschland.tv anzusehen.

Es wird klar, dass die Wabenstruktur hinsichtlich der Ressourceneffizienz (massive Reduktion von Treibhausgasen) und der damit verbundenen Umweltschonung ein überaus interessantes Material darstellt und auch in der Zukunft weiter an Anerkennung gewinnen wird. Ein Dank an die Handwerkskunst der Bienen!
Die Struktur der Waben fasziniert nicht nur Mathematiker und Ingenieure, auch die alten Meister und zeitgenössische KünstlerInnen fanden und finden an ihr grossen Gefallen. Die kanadische Künstlerin Aganetha Dyck hat sich die Angewohnheit der Bienen überall ihre Waben zu bauen zu Nutzen gemacht und lässt ganze Skulpturen von der geometrischen Meisterleistung einhüllen. Die Reize der aussergewöhnlich ästhetischen Regelmässigkeit der Wabengeometrie im Zusammenspiel mit den Porzellanfiguren lässt eine Vielzahl von Assoziationen und Faszinationen zu. Kunst und Natur, Luxus und Notwendigkeit.
Weitere zeitgenössische Künstler sind unteranderem Garnett Puett, Nancy Macko, Squeak Carnwath oder Tomas Libertiny. Letzter lässt ebenfalls wie Aganetha Dyck Figuren von den Bienen einhüllen, arbeitet jedoch zusätzlich mit Farbstoffen. Besonders zu erwähnen ist hier Joseph Beuys. Beuys war Bildhauer, Zeichner, Maler, Aktionskünstler, Kunsttheoretiker und Professor an der - 193 -
Kunstakademie Düsseldorf. Er gilt als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jhd. und Bahnbrecher für die heutige zeitgenössische Kunst. Über Beuys eröffnet sich ein sehr interessanter Aspekt von Bienen in der Kunst. In vielen seiner Arbeiten setzte er Honig und Wachs sowie das Motiv der Biene ein.

Ebenfalls lohnt es sich, die Arbeit des Designers Thomas Heatherwick genauer anzuschauen. Er und sein Team entwarfen ein sechzehnstöckiges Gebäude einzig bestehend aus 154 Treppen, nahezu 2‘500 Stufen und 80 Zwischenplattformen. 2019 wurde es am Hudson Yard von New York errichtet und soll als Aussichtplattform dienen, mit einer Sicht über die Stadt, den Hudson River und weiter, aber auch als Begegnungsort mitten in der Stadt. Das Konstrukt ist komplett begehbar und ähnelt durch seine Wabenform einem gigantischen, runden Bienenstock. Mittlerweile gilt es als eine architektonische wie auch ästhetische Meisterleistung.


« E ine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister.
Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut.»
Karl MarxNatürlich trugen die Gesänge und harmonischen Laute die Biene auch in das Reich der Musik und Komposition. Insekten und Musik? Mal abgesehen vom weltberühmten Hummelflug von Nikolai Rimski-Korsakow gibt es einige weitere äusserst interessante Notationen und Stücke, inspiriert durch die Bienen. So notierte 1609 Charles Butler in seinem Bienenbuch «The Feminine Monarchie» die Geräusche der schlüpfenden Bienenkönigin (siehe: Kapitel Tanz). Dazu ein Madrigal, Melissomelos, mit vier Stimmen, aus denselben Bienenlauten. Damit es mehrere Stimmen zeitgleich singen können, wurde das Stück gleich doppelt auf je zwei Seiten gedruckt. Unten findet sich eine Aufnahme des Stückes. Ab der Minute 2:22 imitiert die Sängerin den Gesang der Bienenkönigin.
 MELI S S O M ELOS
MELI S S O M ELOS


Umschlag eines Notenhefts, 1915
Nach Hollywood schaffte es die sogenannte «Killerbiene». Eine hybride Bienenart, welche 1955 brasilianischen Wissenschaftlern aus dem Labor entwischte und sich rasant in Richtung der USA ausbreitete.
Natürlich dauerte es nicht lange und die absurdesten Schlagzeilen zierten diverse Zeitschriften und scheuerten gehörig Angst in der Bevölkerung Amerikas. Die Boulevardpresse berichtete zeitweise sogar täglich über die neusten Bienenangriffe. In den 1970ern entstand eine ganze Reihe von Filmen, die das Motiv der Killerbienen mit den Genremuster des Invasionsfilms und des Katastrophenfilms mischten.
Bereits 1966 datiert der erste Film, The Deadly Bees, der das Motiv der im Schwarm Menschen angreifenden Bienen auch in die Filmgeschichte importierte.
Der Film The Savage of the Bees von 1976 versetzte die Amerikaner bereits in Schrecken, bevor die Killerbienen die USA überhaupt erreichten. In dem Film töten die Bienen alles, was ihnen über den Weg läuft und bedrohen die Ortschaft Mardi Gras in New Orleans.
Wie üblich blieb es bei solch verlockendem Thriller Material nicht bei wenigen Filmen. Ein Jahr darauf folgte auch schon der nächste. Mit The Swarm – auf deutsch der tödliche Schwarm –
marschierten die Mörderbienen in Texas ein und verschonen auch da keinen. Apokalyptische Stimmung vom feinsten!
Die US-amerikanische Tierhorrorfilme in den 60er- und 70er-Jahren verängstigte die Leute dermassen, dass Forscher aufwändige Aufklärungsarbeit betreiben mussten, was diese Bienenart betrifft. Genaueres zu der Killerbiene und deren Entstehung findet man auf Seite 234 bis 237.
Dass einer «bienenfleissig» seiner Arbeit nach geht, das Körperideal der «Wespentaille», dass zwei sich «spinnefeind» sind oder dass man «Schmetterlinge im Bauch» hat, wenn man verliebt ist – die Sprache ist voller Metaphern und Bilder, die auf die Welt der Insekten und der Spinnen sowie anderer Kleinlebewesen zurückweisen. Die «Insektoiden», etwa im Film, haben oftmals kaum mehr etwas mit der eigentlichen Tierart zu tun und kreieren einen komplett anderen Bedeutungshorizont, der gegenüber der Realität der Tiere etwas ganz Falsches behauptet. So, wie es bei den Killerbienen der Fall war, welche durch die Filmindustrie komplett aufgeblasen und überdramatisiert wurden.
Für die Arbeit der populären Fantasien bilden Insektoiden einen kaum ausschöpfbaren Schatz von modell- und bildhaften Stereotypen und Klischees, die nicht nur in den Sprachgebrauch und die Bildung von Vergleichen und Metaphern eingehen



können, sondern die auch der Ausgangspunkt für zahllose fantastische Erfindungen in Literatur, bildender Kunst, Comic und Film sind. Viele Künstler, Drehbuchautoren oder Computerspieleentwickler bedienen sich nur allzu gerne aus dem Inspirationstopf der Insekten.
Das bekannteste Beispiel bilden vermutlich die Alien-Wesen in Film und Fernsehen. Alien werden nahezu immer nach dem morphologischen Vorbild von Insekten gestaltet. Ihre dürren, vier-, acht- oder mehrbeinigen Gliedmassen und langen Fühler sind dabei beliebte Merkmale. Und bei ausreichender Vergrösserung werden auch die Waffen, wie Stachel oder Mundzangen, zur überdimensionierten tödlichen Bedrohung. Gerade die Waffen wurden zahlreich in der Comic- und Filmgeschichte bei den sogenannten «big bugs» eingesetzt. Das sind – manchmal bizarr anmutende – Charaktere, die heute in zahlreichen Computerspielen stetig neu animiert werden.
Wer es weniger mit gigantischen Bienenbestien und Horrorfilmen am Hut hat, aber trotzdem gerne in die Welt der Computerspiele tauchen möchte, für denjenigen eignet sich das nächste Kunstwerk – Der Bienen Simulator! Ja, das gibt es tatsächlich, zumindest seit dem Jahr 2019. Um was es darin geht? Nun, der Name ist Programm. In diesem Computerspiel schlüpft man in die Rolle einer Honigbiene,
die gemeinsam mit ihrem Volk in einer fiktionalen Welt, angelehnt an den New Yorker Central Park, lebt. Dort führt man ein glückliches, unbeschwertes Dasein bis ein Mensch mit einer Motorsäge für ein jähes Ende der heiteren Pollenparty sorgt. Man zieht mit der Aufgabe ein neues Zuhause zu finden los und fliegt dabei über diverse Picknickdecken, Zoos und Vergnügungsparks. In Minispielen tritt man ein Wettfliegen mit anderen Insekten an und kann gegen Wespen oder Hornissen kämpfen. Der Simulator fühlt sich wie eine Mischung aus «Die Sendung mit der Maus» und einem Disney Animationsfilm an. Das Spiel wurde konzipiert, um auch die jüngste Generation für die Bienen zu begeistern und zugleich aufzuklären. Man erlebt Sachgeschichten in einer freundlichen Umgebung und lernt dank wissenschaftlich korrekter Darstellungen vieles über das Leben der Bienen. Das Spiel ist für Kinder sowie als Familienspiel geeignet und bildet eine hervorragende erste Annäherung in die Welt der Honigbienen.

« D ie Vernunft liefert uns den Honig ihres Bienenstocks, in ihre geheime Werkstatt lässt sie uns aber niemals blicken.»
Wolfgang Menzel











Name:
Apis nuluensis
Herkunft:
Malaysia, Borneo
Merkmale:
gelbe, dünne braune Ringe
Besonderes:
Sie lebt ausschliesslich in Bergwäldern ab 1800 bis 3400 m, wo keine anderen Honigbienen mehr vorkommen.

Name:
Apis dorsata
Herkunft:
Indien, Südostasien
Merkmale:
bernsteinfarbenes Hinterleib, Königin schwarzes Hinterleib
Besonderes:
Sie ist die zweitgrösste Honigbienenart und hat etwa die Grösse einer europäischen Hornisse.

Name:
Apis laboriosa
Herkunft:
Nepal, Tibet
Merkmale:
schwarze Ringe mit weisser Linie
Besonderes:
Die Kliffhonigbiene ist eine der beiden Riesenhonigbienen und ist mit bis zu 3 cm die größte der weltweit neun Arten. Aufgrund von Honigjägern ist sie vom Aussterben bedroht.

Name:
Apis florea
Herkunft:
Persischer Golf
Merkmale:
zwei Ziegelrote Bänder, 11mm Körpergrösse, weisse Querstreifen
Besonderes:
Sie ist halb so gross wie die westliche Honigbiene und baut nur eine einzelne, handtellergrosse Wabe im Freien.

Name:
Apis andreniformis
Herkunft:
Südostasien
Merkmale:
dunkler Hinterleib, kleiner Körperbau
Besonderes:
Sie ist mit ihren 6mm weltweit die kleinste Bienenart.
Sie baut nur handgrosse Waben an versteckten Zweigen.

Name:
Apis koschevnikovi
Herkunft:
Borneo, Süden Thailand, Sumatra
Merkmale:
rötliche Grundfärbung, graue Flügel
Besonderes: Sie lebt vorwiegend in Regenwälder.

Name:
Apis nigrocincta
Herkunft:
Philippinen
Merkmale:
gelbe Stirnplatte
Besonderes:
Diese Biene verschliesst die Wabenzelle der Drohnenbrut nicht mit einer Wachskappe, sondern lässt sie offen.

Name:
Apis cerana
Herkunft:
Ostasien, Himalaya, Russland
Merkmale:
Hinterleib filzig behaart
Besonderes:
Sie gilt als ursprünglicher Wirt der Varroamilbe.
Name:
Apis mellifera
Die Westliche Honigbiene wird meist einfach als Biene oder Honigbiene bezeichnet und stammt urpsrünglich aus Europa, wird aber mittlerweile weltweit für die Imkerei genutzt. Es gibt etwa 25 Unterarten, von denen einige in der Schweiz anzutreffen sind. Um einen besseren Überblick von den Honigbienen zu erhalten, die in unseren schweizer Gärten umherfliegen, werden nachfolgend drei der typischen Unterarten vorgestellt.

Name:
Apis mellifera mellifera
Herkunft:
Alpennordseite, Schweiz, Deutschland
Merkmale:
schwarzer Panzer, dunkelbraune Behaarung
Besonderes:
Sie ist die einzige auf der Alpennordseite ursprünglich einheimische Honigbiene und der Urtyp aller Honigbienen. Sie gilt als nicht die Zahmste im Umgang und erfordert fast immer Schutzkleidung. Eine robuste Biene mit einem kleinen Dickschädel.

Name:
Apis mellifera carnica
Herkunft:
Balkan, Österreich
Merkmale:
schlanker und langer Körperbau, gräulich, helle Ringe
Besonderes:
Sie gilt als sanft und ist eine der beliebtesten Rassen, da sie sich für kleinere Imkereien eignet. Es gibt Hinweise darauf, dass die Carnica im nationalsozialistischen Reich als alleinig zuchtwürdig angesehen wurde. Dies trug massgeblich zu der Beinahe-Ausrottung der heimischen dunklen Biene bei. Aus dieser Zeit stammen diverse Methoden, um die Carnica und die dunkle Biene besser unterscheiden zu können (z.B. Kubitalindex – Verhältnis der Länge bestimmter Flügeladern).

Name:
Buckfast
Herkunft:
England
Merkmale:
helle Ringe, sehr sanftmütig
Besonderes:
Die Buckfastbiene ist keine natürlich entstandene Bienenunterart. Der Benediktinermönch Bruder
Adam züchtete diese Biene ab 1916 im englischen Kloster Buckfast. Diese Züchtung gilt als widerstandsfähiger, fleissiger & friedlicher als andere Bienen.
Viele Profi-Imker arbeiten mit dieser Art, da sie sehr Trachtreich ist.

Name:
Apis mellifera scutellata Lepeletier
Herkunft:
brasilianisches Labor
Lebensraum:
tropische & subtropische Zonen Amerikas
Merkmale:
Äusserlich unterscheidet sich die Killerbiene kaum von friedlicheren Bienenarten, sie zeigt jedoch eine grosse Angriffslust. Der Unterschied zu anderen Arten liegt darin, dass bei einer Bedrohung nicht nur die Wächterbienen angreifen, sondern gleich das ganze Volk. Sie stechen bereits bei geringster Provokation und verfolgen ihre Opfer über sehr lange Distanzen. Brasilianische Imker haben mit der Zeit gelernt, mit den Verhaltensbesonderheiten umzugehen und erreichen jährlich hohe Honigerträge. Brasilien stieg damit in der Liste der honigproduzierenden Länder von Platz 27 (1956) auf Platz 5 (1990).
Besonderes:
Ende der 50er-Jahre beauftragte das brasilianische Agrarministerium den Genetiker & Insektenforscher
Warwick Estevam Kerr mit der gezielten Züchtung einer, an das brasilianische Klima angepassten sowie leistungsstarken Bienenart. Daraufhin brachte
Warwick ca. 120 Königinnen von Afrika nach Brasilien, mit dem Ziel, zu testen, ob diese Tropenbienen sich besser für Brasilien eignen, als die bisherigen spanischstämmigen Bienen. Letztere produzierten kaum Honig und konnten ohne die Hilfe des Menschen kaum überleben.
Was als harmloses Experiment begann, geriet schnell ausser Kontrolle. Das Experiment startete auf einem Imkergelände nahe der Hauptstadt Brasiliens, São Paulo. Warwick kreuzte die afrikanische Biene mit der europäischen. So sollte die Angriffslust herausgezüchtet werden und eine sanftmütige Bienenart entstehen, die auch im tropischen Gebiet Brasiliens einen hohen Honigertrag erwirtschaften konnte. Nach neun Monaten kam es dann zum grossen Desaster, trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen und isolierten Bedingungen. An den Fluglöchern des Bienenstocks war zu Beginn des Experiments jeweils ein Gitter angebracht worden, welches das Volk vom Ausschwärmen abhalten sollte. Ein Angestellter, welcher nicht richtig informiert worden war und dachte, dass diese fälschlicher Weise an -
gebracht worden waren, entfernte die Gitter. Insgesamt entkamen 26 der Bienenschwärme mit afrikanischen Königinnen und entflohen in die Wildnis Brasiliens.
Das grosse Übel war, dass sie sich rasend schnell vermehrten – es bestand keine Möglichkeit mehr, sie irgendwie einzufangen. Es dauerte nicht lange und sie gelangten bis nach Nordamerika, wo sie erstmals als Killerbienen auftraten. Als solche, griffen sie Menschen & Tiere an und verdrängten sogar einheimische Bienenarten.
Das Gefährliche: Dadurch, dass gleich das gesamte Volk angreift, ist die tödliche Dosis an Bienengift (Erwachsener 1000 Stiche) schnell erreicht.
Die Furcht vor diesen «Mörderbienen» ist in den USA weit verbreitet – Hollywood sei Dank! Jedoch gibt es jährlich fünfmal mehr Verkehrstote, als Tote durch Stiche der Killerbiene. Die afrikanisierten Bienen werden, wie bei Unfällen mit Haien, von den Medien für reisserische Schlagzeilen missbraucht. Wäre auch Schade, diese sprudelnde Inspirationsquelle nicht zu nutzen.
Adam, B.: Auf der Suche...nach den besten Bienenstämmen, Imkerei-Technik-Verlag 2018
Das schweizerische Bienenbuch – Natur- und Kulturgeschichte der Honigbiene, Verein deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde, VDRB 2019

Dutli, R.: Das Lied vom Honig. Eine Kulturgeschichte der Biene, Wallstein Verlag 2012
Glock, J.P.: Symbolik der Bienen in Sage, Dichtung, Kultus, Kunst und Bräuchen der Völker, Hansebooks GmbH 2016
Hainbuch F.: Bienen. Was Menschen und Bienen einander bedeuten, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG 2019
Hainbuch F.: Das lautlose Sterben der Bienen. Ursachen und Konsequenzen-Auswege, VerlagsKG Wolf 2014
Hainbuch, F.: Bienen. Wie sie helfen, wie sie heilen, F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH 2019
Imhoof, M.: Lieckfeld, C.-P.: More than honey. Vom Leben und Überleben der Bienen, Orange Press GmbH 2013
Maeterlink, M.: Das Leben der Bienen, Unionsverlag 2013
Menzel, R., Eckholdt, M.: Die Intelligenz der Bienen. Wie sie denken, planen, fühlen und was wir daraus lernen können, Albrecht Knaus Verlag 2016
Menzel, R., Eckholdt, M.: Inspiration Biene, Aurelia Stiftung, Berlin und Klett MINT GmbH 2020
Schneeweis, B.: Der Mensch und der Bien. Wissen, Assoziationen und Bilder zum Themenkreis des komplexen Lebewesens «Biene» im Lauf der Geschichte, VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG 2011
Seeley, T. D. : Bienendemokratie: Wie Bienen kollektiv entscheiden und was wir davon lernen können, S. Fischer Verlag 2014

Tautz, J., Hülswitt, T.: Das Einmaleins der Honigbiene. 66x Wissen zum Mitreden und Weitererzählen, Springer-Verlag GmbH 2019

Weiss, H.: 100 Jahre Biene Maja – vom Kinderbuch zum Kassenschlager, Universitätsverlag Winter GmbH 2014
Weiss, H.: Der Flug der Biene Maja durch die Welt der Medien. Buch, Film, Hörspiel und Zeichentrickserie, Harrassowitz Verlag 2012
Das Mutterrecht - Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Krais und Hoffmann 1861
Engels, D.: Ursprung und Wandel der Bienensymbolik bei Napoleon I und Napoleon III. Kulturgeschichtliche Beiträge zur antiken Bienensymbolik und ihrer Rezeption, Georg Olms 2008
Gruber, F.J.: Erzählungen und Gedichte belehrenden erbauenden und erheiternden Inhaltes, 1834
http://www.bienenzuchtverein-sulzbach-rosenberg.de/fileadmin/ daten_40812/Bienen_im_Antiken_Griechenland.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/bienen.html Zugriff: Juni 23, 2020
https://www.skeptiker.ch/skepsis-im-kleinen-falsche-zitate-einstein-und-das-sterben-der-bienen/ Zugriff: Juni 13, 2020
Kümmerling-Meibauer, B.: Nicht nur «ein Märchen für Kinder»
Die Biene Maja als Crossover Literatur, Weiss, H.: 100 Jahre Biene Maja – vom Kinderbuch zum Kassenschlager, Universitätsverlag Winter GmbH 2014
Pluche, N.: Le spectacle de la nature, 1754
Powell, B.B.: Einführung in die klassische Mythologie, SpringerVerlag GmbH Deutschland 2009
Swammerdam, J.: Historia insectorum generalis (Bibel der Natur), Verlag Meinardvs van Drevnen 1669
www.kochbar.de Zugriff: August 20, 2020
www.opernhaus.ch Zugriff: Oktober 1, 2020
www.ressource-deutschland.tv Zugriff: August 17, 2020
Engels, D., Nicolaye, C., (Hrsg.): Ille operum custos. Kulturgeschichtliche Beiträge zur antiken Bienensymbolik und ihrer Rezeption (= Spudasmata. Bd. 118), Olms, Hildesheim u. a. 2008
Bodenheimer, F.S.: Materialien zur Geschichte der Entomologie bis Linné, Springer-Verlag 2013
Zerbst, M.: Das grosse Lexikon der Symbole, E.A. Seemann Verlag 2003
Genzmer, F.: Die Edda. Götterdichtung, Spruchweisheit und Heldengänge der Germanen. Vollständige Ausgabe in der Übertragung von Felix Genzmer, Diederichs Verlag 1981
Simek, R.: Lexikon der germanischen Mythologie, Kröner 2006
Bessler, J.G.: Geschichte der Bienenzucht. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, Nachdruck Topos Verlag AG 1978
Mit Illustrationen von Natalie J. Kohler
197 The Moire Rare Book Collection
198 Notenumschlag Never Let The Same Bee Sting You Twice, 1915
201 (links) Switchlade Pictures (rechts) Warner Bros (unten) FremantleMedia
« D er Künstler ist die blühende Blume. Der Interpret die Biene.»
Sigbert Latzel


den Bienenpharaonen des alten Ägyptens, den gelehrten Griechen, dem Bienenballett, der Kinoleinwand und Architektur, bis hin zur weltbekannten Biene Maja.
Mit Hilfe zahlreicher Steckbriefe & Illustrationen erlebt man dieses faszinierende Wesen ganz neu.
Inklusive der 9 Artenportraits.