

Kunst lagern? Aber sicher!






Sammel- & Einzellagerung
VdS-Sicherheitsklasse SG3 & GRASP-Zertifizierung 24/7-Videoüberwachung & Alarmaufschaltung
Zutrittskontrolle & Sicherheitscodes
Geothermie für höchste Energiee zienz
Kunstlagerung – sicher und professionell
hasenkamp bietet Ihnen über 120.000 qm hochsichere Lagerfläche an erstklassigen Standorten wie Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München sowie international in Amsterdam, Wien und Madrid. Immer mehr unserer Depots werden energiee zient und nachhaltig betrieben – mit Geothermie, Photovoltaik und grünem Strom. Ihre
Objekte finden bei uns einen klimastabilen Lagerplatz (20-22°C bei 50-55% Luftfeuchtigkeit) entweder auf der Sammellagerfläche oder in abschließbaren Einzelboxen.
Unsere zertifizierten Lager entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen. Neben maßgeschneiderten Verpackungslösungen, insbesondere für die Langzeitlagerung, bietet hasenkamp auch spezielle Zollgutlagerung an. Zudem stehen Ihnen Präsentations- und Restaurationsräume zur Verfügung. So verbinden wir modernste Sicherheitsstandards mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise!
Heimat im Museum – 4 Das Ruhr Museum auf Zollverein
Bahnpark Augsburg präsentiert 16 View From Above
Wanderausstellungen leicht gemacht 24 Die Ausstellungsbörse für Museen
Deutsches Museum Nürnberg 30
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte 48
Das neue Kutschenmuseum 62 auf Schloss Augustusburg
"GRABRAUB" im Franziskanermuseum 78 in Villingen-Schwenningen
Barrierefreiheit in Museen – 86 Kultur für alle, Schritt für Schritt
Carl Schuch und Frankreich 88 Städel Museum, Frankfurt
RRuhr Museum
Die Entwicklung der Museen in der Bundesrepublik Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Ihre reine Zahl hat sich in den letzten fünfzig Jahren von weniger als zweitausend auf knapp siebentausend fast vervierfacht und auch die Zahl der Besucherinnen und Besucher liegt seit Jahren konstant bei weit über einhundert Millionen pro Jahr. Auch wenn die Zahl der Neugründungen in den letzten Jahren weitgehend zum Stillstand gekommen ist, kann man sagen, dass das Museum zu den erfolgreichsten Kultureinrichtungen in Deutschland gehört.
Ihnen kommt in einer immer komplexeren Welt stärker als anderen Museumstypen eine orientierende Funktion zu, die sie zu einem Ort der Reflexion über die eigenen Ursprünge und die eigene Geschichte, eben die „Heimat“ machen. Insofern spielen sie in der Museumsentwicklung eine besondere Rolle, die viel mit Identifikation und letztendlich auch mit Identität zu tun hat.
Ich möchte dies in diesem Heft an einem Beispiel deutlich machen, das man zunächst einmal schon wegen seiner Größe und seiner Verortung gar nicht als Heimatmuseum identifiziert, nämlich dem Ruhr Museum auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein, dem ich über mehr als ein Jahrzehnt bis Anfang kommenden Jahres als Direktor vorstehen durfte.
Titelseite: Astronomische Kunstuhr © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte Fotos: René Gaens
Einen großen Anteil an dieser Entwicklung haben die sogenannten Heimatmuseen, wobei darunter nicht nur das klassische Dorfmuseum, sondern auch die zahlreichen Stadt- und Stadtteilmuseen und weitere Geschichtsmuseen zu verstehen sind, die vor allem im Ausgang des letzten Jahrhunderts zahlreich entstanden sind.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre die gleiche Freude, die ich in all den Jahren dieser Tätigkeit gespürt habe.
Glückauf Ihr
Prof. Heinrich Theodor Grütter

Prof. Heinrich Theodor Grütter (Direktor Ruhr Museum auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen), Foto: © Ralf Schultheiß


Heimat im Museum –Das Ruhr Museum auf Zollverein
Das Ruhr Museum in Essen, beheimatet in der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein, heute UNESCO-Welterbe der Menschheit, ist eine Stiftung der Stadt Essen, des Landschaftsverbandes Rheinland und des Landes Nordrhein-Westfalen. Insofern vereinigt es in seiner Trägerschaft sämtliche Gebietskörperschaften
des Landes und muss unterschiedlichen politischen Einheiten und Identitäten gerecht werden, von der lokalen des engeren Umfeldes der Zeche Zollverein im Essener Norden über die kommunale der Stadt Essen, die landsmannschaftliche des Rheinlandes bis hin zum gesamten Land Nordrhein-Westfalen.
Hinzu kommt eine regionale Klammer, die im Ruhr Museum institutionell nur indirekt verankert ist, da der Regionalverband Ruhr sich auf Zollverein nur am VisitorCenter Ruhr, das aber gleichzeitig das Besucherzentrum der Stiftung Zollverein ist, beteiligt. Diese regionale Verankerung taucht aber schon im Namen des Museums auf und stellt seinen

eigentlichen kulturpolitischen Auftrag dar: Das Ruhr Museum ist das Regionalmuseum des Ruhrgebietes, gleichsam das Heimatund Geschichtsmuseum eines der größten altindustriellen Ballungsräume in Europa.
Dabei ist der Begriff „Heimat“ sicherlich irritierend und zunächst irreführend. Mit
Heimatmuseum verbinden wir die Kochstelle und den Dreschflegel, das Dorf und den Stadtteil sowie die Zeit vor der Industrialisierung, die durch diese beendet wurde. Die Heimatmuseen sind überhaupt erst entstanden, damit man sich an die vormoderne, die gute heile Welt vor der Industrialisierung erinnern konnte. Insofern
stellt das Ruhr Museum – wie der berühmte Museologe Gottfried Korff einmal gesagt
Linke Seite, Oben: Kohlenwäsche Eingang Rolltreppe
Unten: Ruhr Museum, Außenansicht
Rechte Seite: Ruhr Museum, Daueraustellung
Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González
hat – ein Heimatmuseum neuen Typs dar, das sich vom alten Heimatmuseum insofern unterscheidet, als es die neuere Geschichte, in unserem Fall die Industriegeschichte, miteinschließt und sie zu einem Teil der eigenen Geschichte macht.
Das macht Sinn, denn mit den Zechenschließungen und dem Ende der Schwerindustrie ist die Montanindustrie im Ruhrgebiet nicht mehr lebendige Gegenwart, sondern Geschichte. Sie hat das Leben der Menschen über Generationen geprägt und ist insofern existentieller Bestandteil der eigenen Lebenserfahrung.
Diesem Umstand verdankt im Übrigen das Ruhr Museum, das es in dieser Form als Regionalmuseum bis Ende 2007 überhaupt noch nicht gab, seine Existenz und nicht nur das Ruhr Museum, sondern auch eine Reihe privater oder halboffizieller lokaler Bergbaumuseen und in gewisser Weise auch die zahlreichen Industriemuseen in ganz Nordrhein-Westfalen, die die Erinnerung an einzelne Sparten der Industrie oder bestimmte regionale und lokale Industriezweige am Leben halten. Vor dreißig Jahren hat es noch keines dieser Museen gegeben, inzwischen sind es landesweit weit über hundert.
Bei der Pflege der lokalen und regionalen Identität, die diese Museen ausüben und zu denen natürlich noch die alten Heimatund Stadtmuseen treten, die ihrerseits die jeweils lokale Industriegeschichte in ihre Ausstellungen integriert haben, spielt naturgemäß die persönliche Erinnerung eine weit größere Rolle als in anderen Museen, wie dem Kunstmuseum, dem technischen oder gar dem ethnologischem Museum.
In dem Maße, in dem das Museum diese Erinnerungen der Besucherinnen und Besucher bemüht und damit auf deren Erfahrungen anspielt, ist es – bewusst oder unbewusst – an deren historischer Selbstvergewisserung und Identitätsbildung beteiligt. Hier entpuppt sich das Museum, zumindest das historische Museum, als "dentitätsfabrik", um es mit dem noch immer gültigen
Linke Seite, Oben: Ruhr Museum, Dauerausstellung, Geräusche. Foto: © Ruhr Museum / Brigida González
Unten: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums, 17-Meter-Ebene, Mythos
Foto: © Ruhr Museum / Foto: Andrea Kiesendahl
Rechte Seite, Oben: Ruhr Museum, 17-Meter-Ebene, Zeitzeichen
Unten: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 17-Meter-Ebene, Phänomene. Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González





Begriff von Gottfried Korff und Martin Roth auszudrücken. Dabei sollte man auf den Terminus „Identitätsstiftung“ lieber verzichten – denn das ist die Aufgabe z.B. der Museen des Vaterländischen Krieges in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion oder in anderen totalitären oder zumindest chauvinistischen Regimen – aber in dem Prozess der Identitätsbildung ist das historische und vor allem das Heimatmuseum unmittelbar beteiligt.
Das Ruhr Museum tut dies mit seiner Dauerausstellung in der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein mit ca. 6000 Exponaten auf 4500 qm Ausstellungsfläche. Der Parcours erfolgt vom Besucherzentrum, das die Besucherinnen und Besucher über eine beeindruckende Rolltreppe auf die sogenannte 24-Meter-Ebene erreichen und ein ebenso imposantes Treppenhaus absteigend über drei Etagen, die der ehemaligen Funktion des Industriegebäudes folgend als (Arbeits)Ebenen bezeichnet werden.
Die erste, die sogenannte 17-Meter-Ebene, zeigt die Gegenwart des Ruhrgebietes: Zunächst mit großen Fotoprojektionen, die Mythen und Klischees vom Ruhrgebiet,
die längst nicht mehr Realität sind aber eine seltsame Vertrautheit mit dem Ruhrgebiet herstellen. Es sind Bilder im Kopf und die Ausstellung zeigt sie auch als solche, nämlich als Projektionen, die wieder verschwinden und in einer Endlosschleife neuen Bildern und Vorstellungen vom Ruhrgebiet Platz machen.
Eine zentrale Rolle spielt die Erinnerung der Besucherinnen und Besucher in dem direkt anschließenden Hauptbereich der ersten Etage, der die reale Welt, die gegenwärtigen Phänomene des Ruhrgebietes, zeigt; von der Industriekultur über den Strukturwandel, die verschiedenen Religionen im Ruhrgebiet bis hin zum Fußball, insgesamt zwei Dutzend solcher aktueller Phänomene. In den über fünfhundert präsentierten Fotos sehen die Besucherinnen und Besucher Orte, Gebäude und Situationen ihres unmittelbaren alltäglichen Umfeldes, verbunden mit Objekten, die diese versinnbildlichen. Diese Fotos und Objekte geben den Gästen das Gefühl, Teil der Erzählung des Museums zu sein und das Museum merkt, wie intensiv sie diese wahrnehmen, weil sie sich häufig stundenlang in dieser Abteilung aufhalten.


Linke Seite, Oben: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums. Foto: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl
Mitte: Eingang Ruhr Museum, Dauerausstellung 17-Meter-Ebene
Rechte Seite, Oben/Mitte: Treppenhaus
Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González
Unten: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums
Foto: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl




DAS BESONDERE. UNSER STANDARD!
ArchiBALD plant, entwickelt und liefert individuelle Depoteinrichtungen. Ob Regalsysteme für unterschiedlichste Anwendungen, Zugwandsysteme für die Lagerung von Gemälden oder Schränke für Ihr Schaudepot, unser breites Produktportfolio bietet Lösungen für alle Bereiche.
Erfahren Sie mehr: www.archibald-regalanlagen.de

Museum Abteiberg Mönchengladbach, Szenographie: Paul Wenert
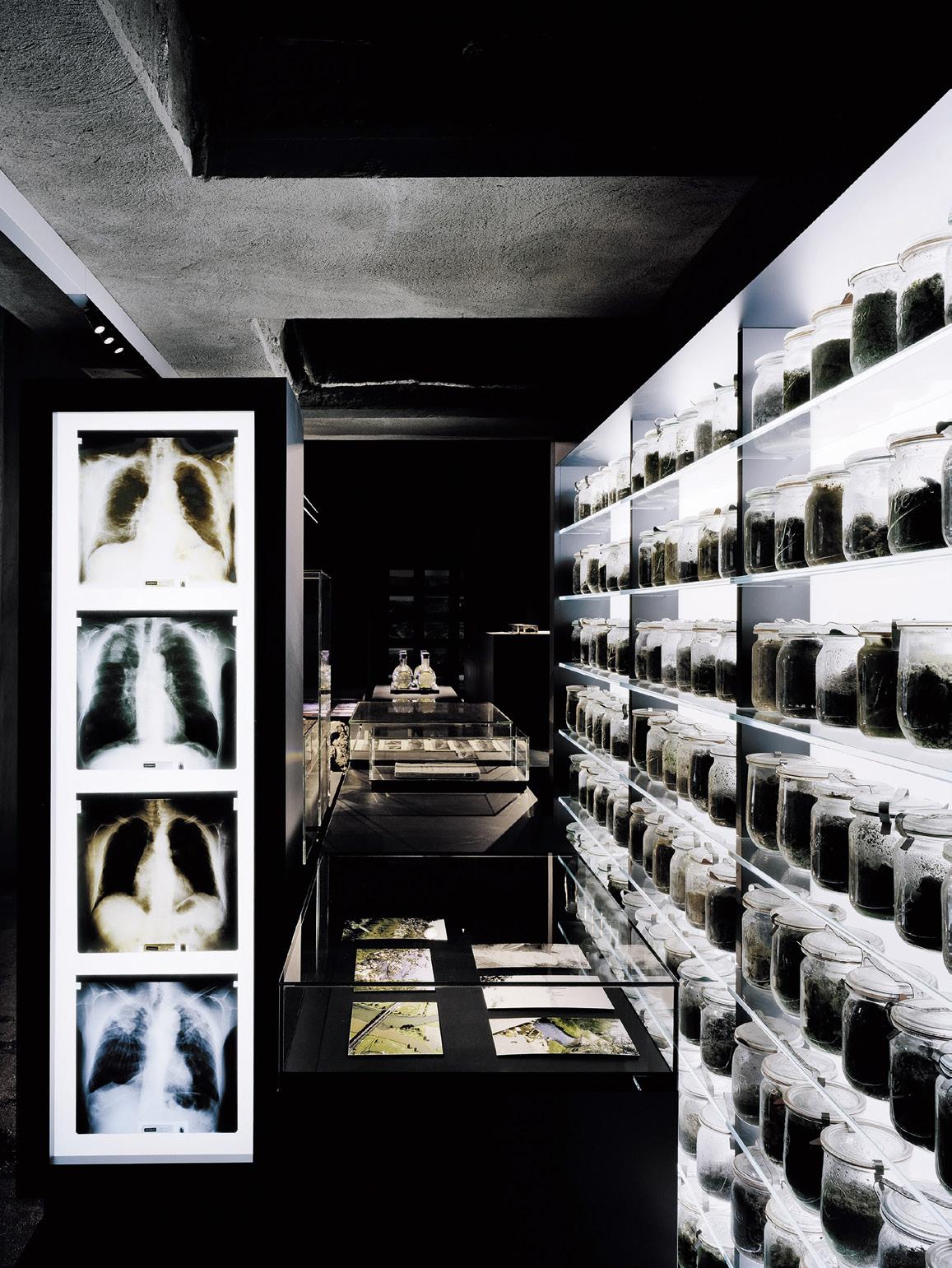

Diese Phänomene verdichten sich im letzten Teil der Ausstellungseinheit in Objekten, die als eine Art Musée Sentimental beispielhafte Geschichten und Erfahrungen der Region in sich vereinigen. So erzählt die berühmte Steinstaublunge von der enormen Belastung unter Tage und der Helm mit Hitzeschild von der harten Arbeit am Hochofen.
Die nächste Etage, die sogenannte 12-Meter-Ebene, widmet sich dem kulturellen Gedächtnis der Region und definiert die Industrieregion als Schauplatz auch der antiken und mittelalterlichen Geschichte. Sie zeigt Exponate aus der Prähistorie, der Römerzeit, von mittelalterlichen Klöstern und Burgen, die den Gästen nicht aus der eigenen Erfahrung, sondern höchstens aus dem Geschichtsunterricht bekannt


sind und sein Bild von der eigenen Heimat erweitern und bereichern. Wer hätte gedacht, dass das spätere Ruhrgebiet das Aufmarschgebiet der Römer auf dem Weg zur Varusschlacht, die Keimzelle der Missionierung und Christianisierung Nordwestdeutschlands und die Region mit der größten Dichte an Hansestädten war?
Linke Seite: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 17-Meter-Ebene, Umweltzerstörung
Rechte Seite, Oben: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 12-Meter-Ebene, Klosterwelten
Mitte und Unten: Dauerausstellung, 12-Meter-Ebene, Flora und Fauna
Unten: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 12-Meter-Ebene, Traditionen
Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González

Linke Seite: Ruhr Museum, Dauerausstellung 6-MeterEbene. Foto: © Ruhr Museum / Brigida González
Rechte Seite, Oben: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums, 6-Meter-Ebene
Foto: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl
Unten: Dauerausstellung, 6-Meter-Ebene, Urbanisierung
Foto: © Ruhr Museum / Brigida González
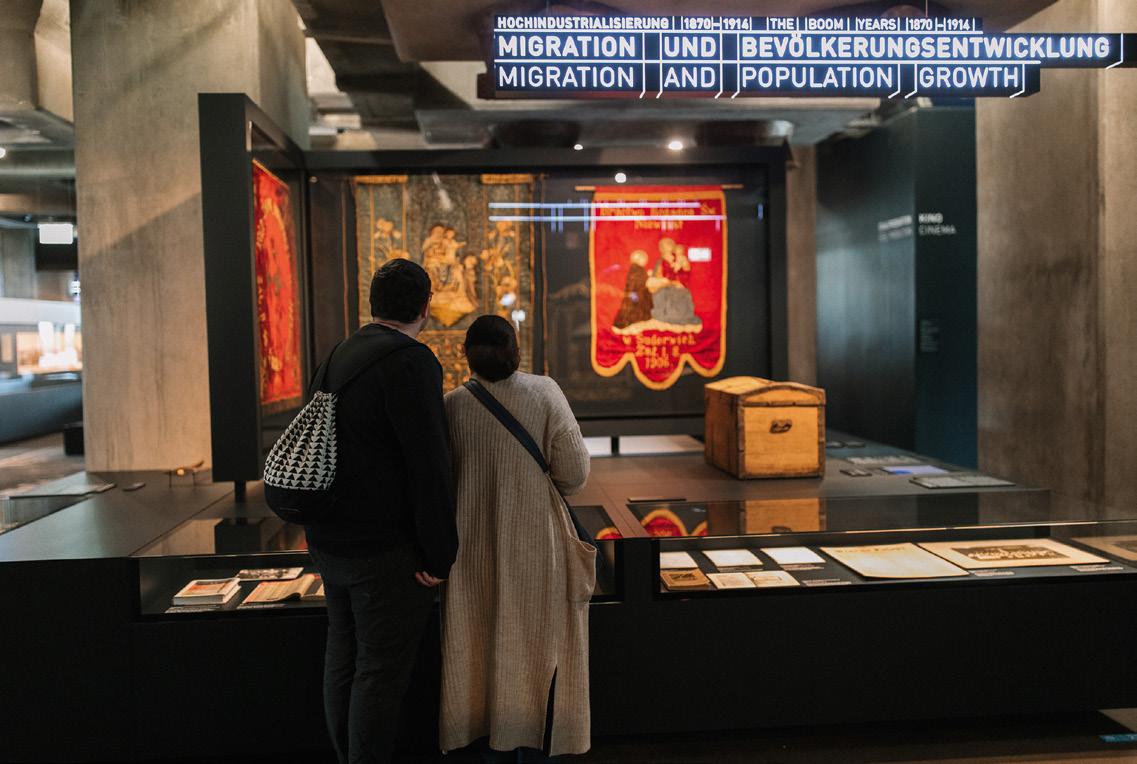


Oben: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums, 6-Meter-Ebene. Unten: Führung. Fotos: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl
Diese Verschiebung der Perspektiven setzt sich auf der dritten Etage des Museums zur Geschichte des Ruhrgebietes im Industriezeitalter fort. Sie nimmt ihren Ursprung in der erdgeschichtlichen Entwicklung vor Millionen von Jahren mit der Entstehung der Kohle und beschreibt den dramatischen Industrialisierungsprozesses im Ruhrgebiet als Teil der europäischen Geschichte, der in Fragen der Migration und der weltweiten Energieversorgung mündet. Hier nehmen die Besucherinnen und Besucher ihre Heimat als Teil größerer nationaler, internationaler, ja globaler Zusammenhänge wahr und erfahren eine grundlegende Perspektivenerweiterung.
Die Dauerausstellung des Ruhr Museums wurde seit ihrer Eröffnung zur Kulturhauptstadt RUHR.2010 von mehr als fünfzig Sonderausstellungen begleitet, die viele Aspekte der Ruhrgebietsgeschichte von den Anfängen in der Spätantike und im Frühmittelalter über die Reformation und den Adel im Ruhrgebiet, die großen Industriemythen wie Krupp und das Zeitalter der Kohle bis hin zu den Weltkriegen, der Metropole Ruhr und den modernen Phänomen wie Fußball, Rock und Pop und das Kino und den Film beleuchteten.

Gemeinsam mit der Dauerausstellung zählten die Ausstellungen des Ruhr Museums seit seinem Bestehen über vier Millionen Besucherinnen und Besucher, das sind 250.000, also eine Viertelmillion pro Jahr. Dabei ist auffallend, dass die Zahl der Besucherinnen und Besucher vor allem in der Dauerausstellung nicht – wie es zu erwarten wäre – im Laufe der Jahre abnimmt, sondern im Gegenteil, immer noch leicht steigt. Die Menschen im Ruhrgebiet
scheinen im Ruhr Museum ihre Heimat gefunden zu haben.
Ruhr Museum in der Kohlenwäsche UNESCO-Welterbe Zollverein
Gelsenkirchener Str. 181 45309 Essen
Tel. +49 (0)201 24681 444 besucherdienst@ruhrmuseum.de www.ruhrmuseum.de
IM DIENST DER KUNST UND KULTUR
LICHTWERKZEUGE FÜR PROFIS: IN ZERTIFIZIERTER QUALITÄT, BUDGETFREUNDLICH UND 100% KOMPATIBEL
Dimmbare Zoomstrahler
Dimmbare Konturenstrahler
Dimmbare Flächenstrahler
Dimmbare Wallwasher NEU
Fernbedienbare Zoomstrahler
Vitrinenbeleuchtung NEU
Full-Custom-Lösungen
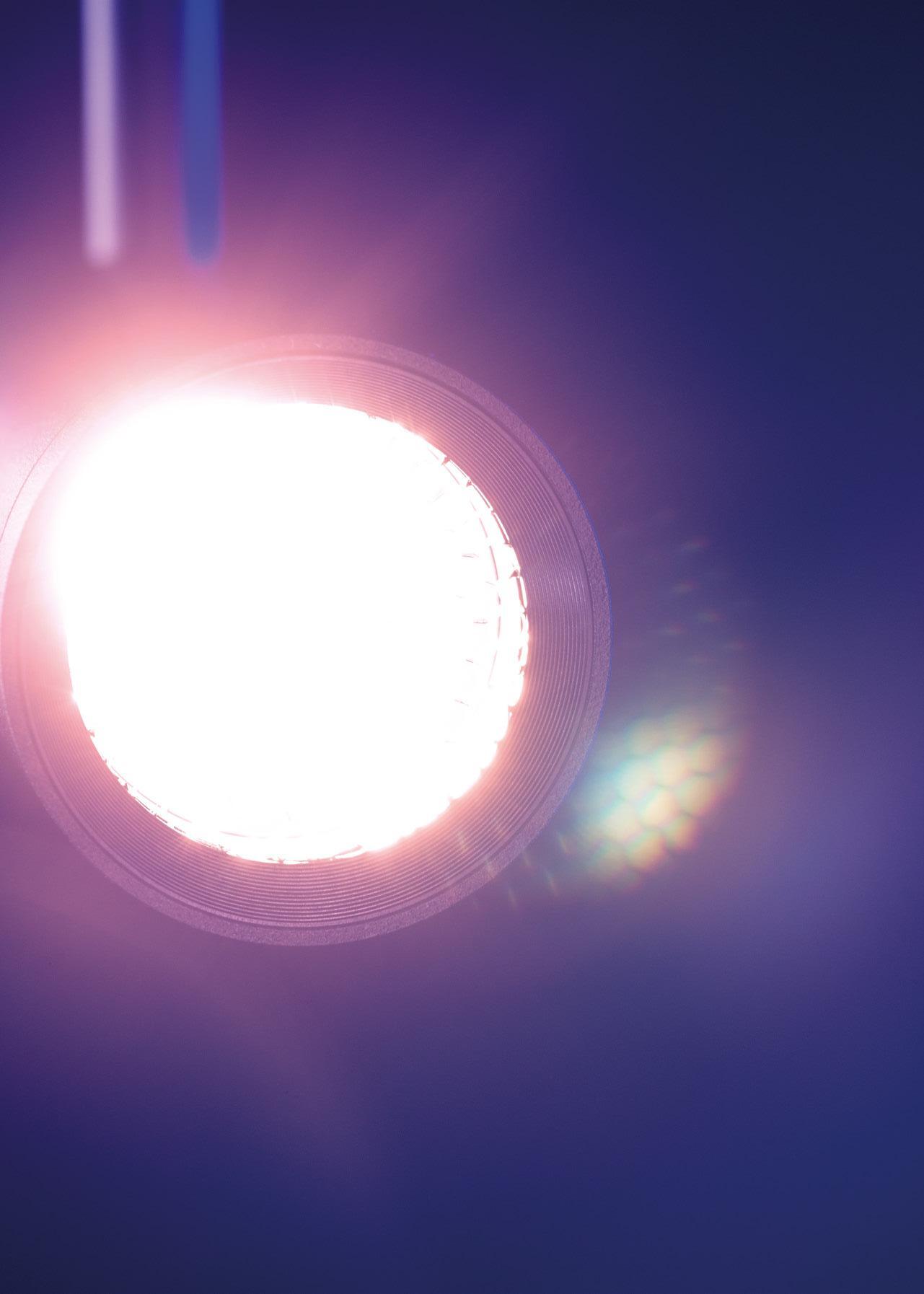
CREATE LIGHT ist ein junges, innovatives Unternehmen aus Süddeutschland mit Handschlagsqualität –hochspezialisiert, auf die perfekte Inszenierung von Kunst und Kultur. In mehr als 300 Projekten, haben wir weltweit über 10.000 unserer professionellen Lichtwerkzeuge erfolgreich im Einsatz. Gebaut für den anspruchsvollen Museumsalltag, werden unsere hocheffizienten LED-Strahler von Kulturschaffenden und Lichtprofis in Museen, Ausstellungen und Galerien in der ganzen Welt sehr geschätzt. Unsere Lichtspezialisten liefern Ihnen maßgeschneiderte Lichtsysteme, sowie eine fachgerechte Beleuchtung der kostbaren Exponate – budgetfreundlich und effizient: info@create-light.de oder +49 751 185 277 20
CREATE-LIGHT.DE

Von der Drehscheibe in die Umlaufbahn: der Bahnpark Augsburg präsentiert
VIEW FROM ABOVE
Augsburg. Sonderausstellungen sind dann stark, wenn sie die DNA eines Hauses sichtbar machen und zugleich neue Horizonte öffnen. Genau das leistet View From Above – die großformatige Fotografieschau mit Bildern des NASA-Astronauten Terry Virts – seit dem 24. Mai im Bahnpark Augsburg.
Die Präsentation bespielt die historische Dampflokhalle (über 800 m²) und stellt der

letzten in Deutschland gebauten Dampflok ein Gegenüber aus der Raumfahrt zur Seite.
Der technikhistorische Kontrast wirkt unmittelbar: 1957 rollt eine Spitzenleistung der Dampftechnik aus der Werkhalle, nur zwölf Jahre später betritt der Mensch den Mond – zwei Kapitel einer von Innovation getriebenen Mobilitätsgeschichte, die sich im Bahnpark eindrucksvoll begegnen.

Warum Raumfahrt im Bahnpark funktioniert
Aus Sicht von Geschäftsführer Markus Hehl fügt sich die Ausstellung nahtlos in das Profil des Hauses: Eisenbahn war immer Hochtechnologie – mit denselben Fragen nach Material, Energie, Geschwindigkeit und Navigation, die die Raumfahrt auf eine neue Stufe hebt.
View From Above übersetzt diesen Ingenieursgeist in ein visuelles Erlebnis: Rund 150 großformatige Fotografien, aufgenommen aus und in der Internationalen Raumstation ISS, zeigen Wetterphänomene, Landschaften, Städtebilder und die
Infrastruktur des modernen Lebens aus der Perspektive des Alls. Der kuratorische Ansatz setzt auf Klarheit, Dunkelraum und präzises Licht – Technik wird Bühne für staunendes Sehen.
Kuratiert und veranstaltet wird das Format von Gottfried Eisenberger (The Art Fair Guy; Feromontana.art Exhibition GmbH). Für den Bahnpark ist das mehr als eine temporäre Ergänzung: Das Publikum wird spürbar diverser – zu den Stammgästen der Eisenbahnkultur stoßen Fotografie-, Design- und Wissenschaftsinteressierte, Familien und Schulklassen. Diese Durchmischung stärkt den Bahnpark als Technik- und Kulturort der Stadt.
Audio statt Label-Wand
Ein zentrales Element ist der scan.art Audioguide: Ohne zusätzliche QR Codes erhalten Besucherinnen und Besucher Hintergrundinformationen zu Motiven, Mission und Entstehung – mehrsprachig und direkt von Terry Virts eingesprochen. Seine ruhige, präzise Stimme erzeugt das Gefühl, selbst an Bord der ISS zu schweben, während er neben einem steht und die Geschichten zu den Bildern erzählt. Die Nutzung erfolgt als Audio oder Text über das eigene Smartphone. Das senkt Hürden, verlängert die Verweildauer und erleichtert Gruppensowie Schulbesuche, weil Inhalte skalierbar und jederzeit aktualisierbar sind.






Infrastruktur auf Museumsniveau
Für Häuser, die eine starke Sonderausstellung ohne Baustelle integrieren möchten, ist der Ansatz schlicht: View From Above bringt Wände und Licht selbst mit. Das flexible Mila-Wall System mit LED-Schienenspots benötigt im Kern nur eine freie Fläche und eine Steckdose. Je nach Setup werden 750 bis 1 500 m² bespielt. Im Bahnpark war die komplette Infrastruktur in drei Tagen installiert, das Wandsystem – dank werkzeugarmer Steck-/Click-Verbindungen – mit sechs Personen in etwa acht Stunden gestellt. Das reduziert Eingriffe in den Betrieb, vermeidet Staub und Entsorgungsaufwand gegenüber Bauten aus Holz und MDF – und macht die Ausstellung schnell, sauber und flexibel anpassbar.





Aufbau im Bahnpark Augsburg
Fläche:
ca. 820 m² in der historischen Dampflokhalle
Infrastruktur:
ca. 200 lfm modulare Mila-Wall (MBA-Design), LED-Licht auf Schienensystem, Bilderhängung mit Galerieschienen
Aufbauzeit insgesamt:
3 Tage – 5 Tage
Aufbauzeit Stellwandsystem
Der Aufbau des Stellwandsystems selbst nahm dabei lediglich einen Tag in Anspruch – und das trotz unebenem Boden. Dank des eingespielten Teams von sechs Personen verlief alles reibungslos und zügig.
Betrieb:
Dunkelraum-Konzept, präzises Spot-Licht, scan.art Audio Guide ohne Zusatzbeschilderung
Scannen Sie bitte den QR-Code, um sich den Film zum Aufbau der Ausstellung anzuschauen


Dunkelraum, Präzisionslicht, klare Wege
Der Rundgang erzählt eine Mission – vom ersten Schritt bis zur Landung: Wie Terry Virts über die Air Force zur NASA kam, das Training, der Start ins All, das Leben an Bord der ISS, Außenbordeinsätze und schließlich der atemberaubende Blick auf unsere Erde.
Am Ende führt die Inszenierung mit der Rückkehr auf die Erde bewusst wieder auf den Boden der Realität. Die große Halle wird zum Dunkelraum, Akustik und Licht sind reduziert, die farbkräftig und hochwertig gedruckten Bilder tragen. Terry Virts sagte bei seinem ersten Besuch sichtbar bewegt: „Viel näher an das, was man da oben sieht, wenn man aus dem Fenster schaut, kommt
man nicht heran – als bei dieser Ausstellung.“ Die Themen sind so inszeniert, dass View From Above zum Muss für Technikfans, Fotografiebegeisterte, Weltraumfans, Familien sowie künftige Astronautinnen und Astronauten wird – und für alle zugänglich bleibt, unabhängig vom Vorwissen.
Mehrwert für Museen
View From Above ist mehr als ein Besuchermagnet, es eröffnet tragfähige Programmlinien und zusätzliche Erlöse. Im Bahnpark Augsburg hat die Ausstellung die klassische Eisenbahnszene spürbar um Fotografie, Design und Wissenschaft erweitert; Führungen, Schulklassen und Expertengespräche mit Astronauten las-

sen sich unmittelbar an die vorhandene Sammlung anbinden und verbinden die Dampflok mit der Beobachtung der Erde. Abendformate für Tech Communities und Kooperationen mit lokalen Partnern steigern die Reichweite, ein kuratierter Shop mit signierten Büchern, Editionen und Fine Art Prints schafft Zusatzumsatz. So entsteht ein inhaltlicher und wirtschaftlicher Mehrwert, der sich auf andere Häuser übertragen lässt.
Fazit aus Sicht des Bahnparks
Für Häuser, die eine starke, schnell integrierbare Sonderausstellung suchen, zeigt das Augsburger Beispiel: View From
Alle Fotos: © Martin Schönbauer

Above erweitert Zielgruppen, passt in den Betrieb – und macht Technikgeschichte im Dialog mit Raumfahrt neu erfahrbar.
www.bahnpark-augsburg.de service@bahnpark-augsburg.eu
View From Above
www.viewfromabove.art office@viewfromabove.art
Scannen Sie bitte den QR-Code, um sich den Film zur Ausstellung anzuschauen
MBA-Design & Display Produkt GmbH Siemensstrasse 32 72766 Reutlingen
Tel: +49 7121 1606-0 info@mba-worldwide.com www.mila-wall.de
Wanderausstellungen leicht gemacht
Die kostenlose Ausstellungsbörse für Museen – exemplarisch erläutert an der Ausstellung "View from Above"
Autor: Uwe Strauch, museum.de
Museen stehen heute vor der Herausforderung, Besucherinnen und Besucher kontinuierlich zu begeistern – insbesondere das lokale Publikum, das die ständige Sammlung oft schon kennt.
Jede eigene Sonderausstellung zu kreieren, ist personal- und kostenintensiv: Konzeptentwicklung, Recherche, Leihanfragen, Aufbau, Begleitprogramm – all das bindet Ressourcen. Hier bieten Wanderausstellungen eine attraktive Lösung. Sie bringen frischen Wind in die Häuser, eröffnen neue Themenperspektiven, ermöglichen den Austausch zwischen Museen und reduzieren gleichzeitig den Aufwand für die Ausstellungsgestaltung.
Direkte Vermittlung zwischen den Museen – kostenlos
Vor neun Jahren hat museum.de deshalb exklusiv für Museen die Ausstellungsbörse ins Leben gerufen. Sie erleichtert das Leihen und Verleihen von Wanderausstellungen deutlich: Museen können ihre Angebote detailliert beschreiben und anderen Häusern

unkompliziert zugänglich machen. Dabei greift museum.de nicht redaktionell ein und erhebt keine Gebühren – weder vom Leihgeber noch vom Leihnehmer.
Registrierte Museumsadministratoren finden auf ihrer Profilseite die Rubrik „Ausstellungsbörse“ mit den Optionen:
l Ausstellungen leihen l Ausstellungen verleihen
www.museum.de/exhibitions
Alle angebotenen Wanderausstellungen sind hier abrufbar – aber auch ohne Login können Interessierte die Ausstellungen unter www.museum.de/exhibitions einsehen. Für das Anlegen eigener Wanderausstellungen ist ein kostenloses Login erforderlich. Museen, die bereits Daten einpflegen, sind startklar. Neue Häuser oder Museen ohne Administrator können sich unter www.museum.de/register anmelden. Pro Museum kann genau ein Administrator die Datenpflege übernehmen. Ein Administrator kann aber umgekehrt mehrere Museen unter seinem Login betreuen.
Die Plattform ermöglicht die strukturierte Eingabe von Wanderausstellungen. Jede Ausstellung erhält eine eigene Seite mit Titel, ansprechendem Foto sowie Kurz- und Langbeschreibung. Über das horizontale Menü werden die wichtigsten Angaben thematisch gegliedert:
Beschreibung
l Ausstellungsbild
l Titel der Ausstellung
l Name des Leihgebers
Name des Museums, Stadt
l Kurzbeschreibung
l Langbeschreibung
Kenngrößen
l Leihgebühr pro Woche
l Transportkosten
l Aufbaukosten
l Stellfläche in m² (mindestens und maximal)
l Mindest- und Maximaldauer der Leihe
l Lieferumfang in Stichworten
Anforderungen
l Mindest-Raumhöhe
l Besondere Anforderungen
(z.B. Gewicht, Lichtempfindlichkeit, Zerbrechlichkeit)
l Energieversorgung
l Bedingungen zur UV-Belastung
l Klimabedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)
l Aufsichtspersonal
l Haftung und Versicherung
l Sonstiges
Details, Transport, Montage
l Transport
l Lagerbedarf für Transportkisten
l Anforderungen für Auf- und Abbau
Programm, Material
l Bereitgestelltes Werbematerial (Flyer, Ausstellungskatalog, Pressebilder)
l Pädagogisches Angebot (Referenten, Workshops, Führungen)
Weitere Infos
l Liste bisheriger Leihnehmer
l Sperrzeiten der Ausstellung
l Upload von PDFs (Broschüren, Pressestimmen)
l Kontaktinformationen
Ein praktisches Beispiel:
Wan„View From Above“
Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt die Ausstellung „View From Above“ des Bahnparks Augsburg. Die großformatige Fotografieschau von NASA-Astronaut
Terry Virts verbindet Fotografie, Technikgeschichte und Raumfahrt – und lässt sich dank modularer Konzeption problemlos als Wanderausstellung einsetzen.
Lieferumfang:
l 80–140 hochwertige ChromaLuxeDrucke auf Alu-Dibond
l Audioguide mit Originalkommentaren von Terry Virts, in über zehn Sprachen verfügbar
l Mila-Wall Stellwände von MBA für flexible und nachhaltige Präsentation
l Professionelles Beleuchtungssystem
l Hintergrundmusik & Soundscape mit Originalklängen aus dem All
Alle Fotos: © Martin Schönbauer
l Merchandise-Shop mit Büchern, Drucken und Editionen
l Service & Unterstützung: Mitarbeiterund Tour-Guide-Briefings, Auf- und Abbauanleitungen, Beschilderung
Anforderungen:
l Witterungsunabhängig: Drucke extrem robust, optional auch im Freien einsetzbar
l Raumgestaltung: abgedunkelte Räume für optimale Wirkung
l Flexibel: Modularer Aufbau passt sich je der Location an, von klassischen Museumsräumen bis hin zu Hallen, Industriebauten oder Outdoor-Bereichen
Die Ausstellung liefert ein schlüsselfertiges Konzept: Museen benötigen nur die passende Location – alles andere ist bereits im Ausstellungskonzept berücksichtigt.
Planungssicherheit beginnt mit der richtigen Auswahl der Ausstellung
Für Museen bedeutet das: Alle wichtigen Parameter – von Stellfläche über Kosten bis zu Klimabedingungen und pädagogischem Angebot – lassen sich übersichtlich in der Ausstellungsbörse hinterlegen. Potenzielle Leihnehmer können so prüfen, ob ihre Räume geeignet sind, und bei Interesse direkt Kontakt aufnehmen. Gleichzeitig entsteht Transparenz über Leihgebühren, Transport- und Aufbaukosten, Personalbedarf und Versicherung.
Die Ausstellungsbörse ist damit ein praxisnahes, kostenfreies Werkzeug, um Wanderausstellungen erfolgreich im direkten Kontakt zwischen den Museen zu vermitteln, Zielgruppen zu erweitern und Häuser für neue Themen zu öffnen – ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand und mit maximaler Flexibilität.
Übersicht angebotene Ausstellungen: www.museum.de/exhibitions
Rechts: Für das Anlegen einer Wanderaustellung ist ein Login bei museum.de erforderlich. Exemplarisch für "View from Above". Weitere Angaben erfolgen über die Auswahl im waagerechten Menü über dem Ausstellungsbild.
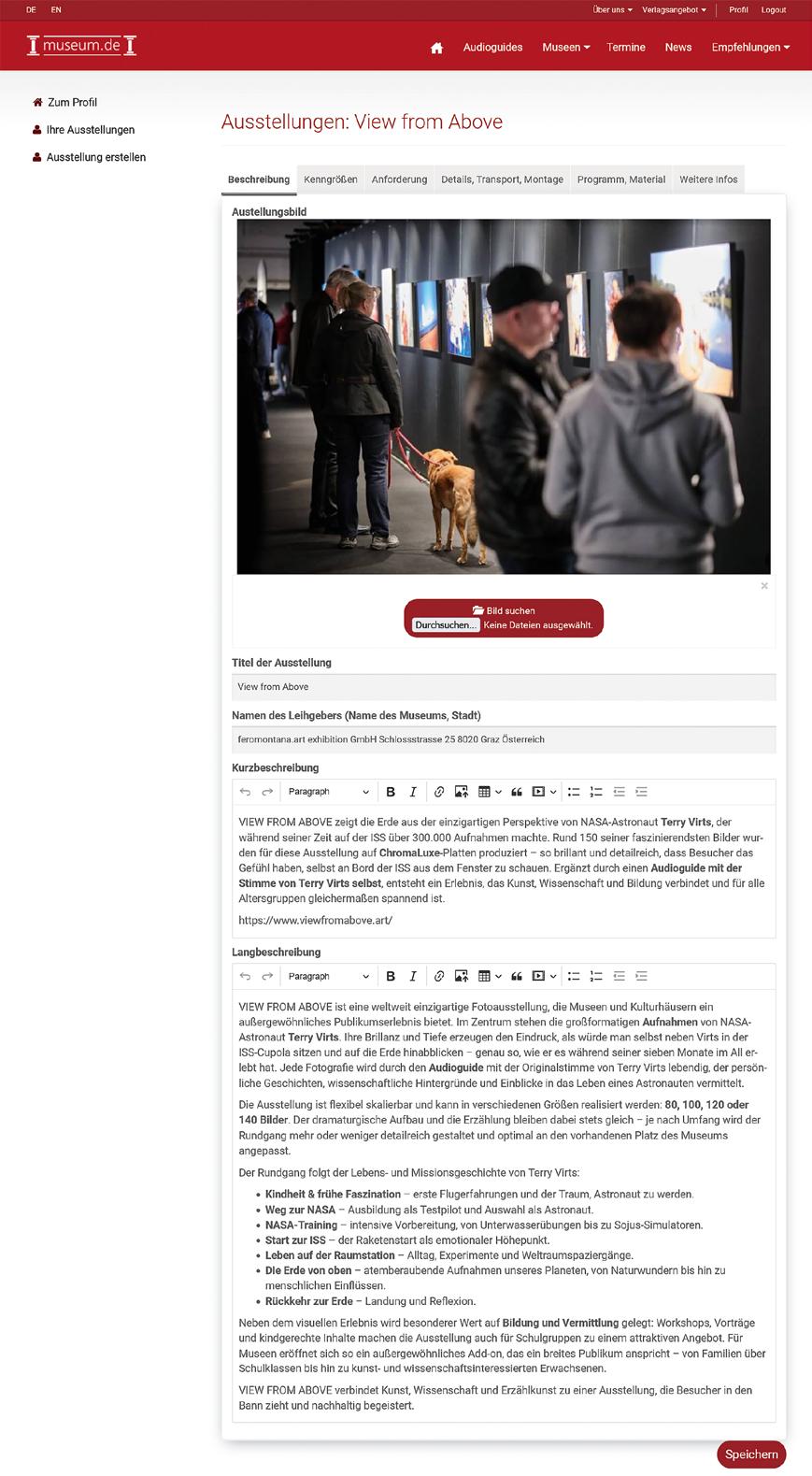


Niederländische Geschichte in neuem
Licht: „Macht – 800 Jahre Binnenhof“
Wenn Geschichte erstrahlt
Wie bringt man 800 Jahre Politik, Macht und Zeremoniell so zum Leuchten, dass Besucher nicht nur sehen, sondern erleben?
Das Historische Museum Den Haag gibt die Antwort – mit einer Ausstellung, die sorgfältig kuratierte Inhalte, stimmungsvolles Licht und einen Ort vereint, der selbst Teil der Geschichte ist.
Während der Renovierung des Binnenhofs präsentiert das Museum die Schau Macht – 800 Jahre Binnenhof. Direkt am Korte Vijverberg gelegen, mit Blick auf Hofvijver und Binnenhof, beleuchtet sie in vier Themenräumen die Architektur, politische Debatten, Faszination der Macht und Zeremonien des niederländischen Regierungssitzes.
© Macht – 800 Jahre Binnenhof (Historisches Museum Den Haag)
Design: Perspekt Studios
Audio-visuell: Moetwil en Van Dijk
Produktion:
Perspekt Studios
Lichtplanung:
50LUX NL – Frank Hulsebosch
CLS-Distributor: Lichtpunt
Verwendete Leuchten: Jade Expo Local Dim / W-DMX, Jade Zoom Local Dim, Focus HP 230V | 3000K
Gefördert von: VriendenLoterij
Fotografie: Gerrit Schreurs
CLS LED B.V. Bijsterhuizen 2523
NL-6604 LM Wijchen
Tel. +31 (0) 26 326 36 76 info@cls-led.com
Für das Lichtkonzept engagierte das Museum das auf Ausstellungsbeleuchtung spezialisierte Büro 50LUX, empfohlen von Perspekt Studios. Ziel war eine stimmungsvolle und zugleich objektschonende Ausleuchtung. Die über 30 Jahre alten Halogenstrahler wurden durch moderne LED-Leuchten von CLS ersetzt – finanziell unterstützt von der VriendenLoterij. Zum Einsatz kamen Modelle der Serien Jade und Focus: leistungsstarke Zoom-Strahler für hohe Räume, präzise Spots für empfindliche Exponate und budgetfreundliche Varianten für Durchgangsbereiche.
Montiert an bestehenden und ergänzten 3-Phasen-Stromschienen, bot die neue Beleuchtung hohe Flexibilität. Gesteuert wurde überwiegend über Local Dim für schnelle Anpassungen, teils ergänzt durch Wireless DMX für synchronisierte Videopräsentati-
onen. Filter, Torblenden und Zoom-Linsen erweiterten die Einsatzmöglichkeiten – ein Plus für zukünftige Wechselausstellungen.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit setzte sich bei der Ausstellung Klein, Kleiner, Am Größten: Die Puppenhäuser von Lady Lita de Ranitz fort. Hier kamen kompakte CLS Focus Micro-Leuchten zum Einsatz, unauffällig in Wandschränken integriert und millimetergenau ausgerichtet, um filigrane Miniaturdetails perfekt hervorzuheben. Die präzise Installation in engen Räumen erforderte Erfahrung und Fingerspitzengefühl – eine Aufgabe, der sich das Team von 50LUX mit Begeisterung stellte.
Das Ergebnis: Licht, das Geschichten erzählt und Objekte zum Strahlen bringt – ein Gewinn für Museum, Besucher und die niederländische Geschichte.







Deutsches Museum Nürnberg –
Das Zukunftsmuseum
Zukunft denken, erleben, gestalten. Autoren: Claudia Luxbacher / Robert Moors
Humanoide Roboter, Fleisch aus dem Labor, fliegende Taxis, genetisch designte Babys und ein Leben auf dem Mond – was klingt wie Science-Fiction ist bereits Realität oder eine Möglichkeit der nahen Zukunft. Doch was bedeutet dieser technische Fortschritt für uns als Menschen? Für unser Zusammenleben, unsere Werte, unseren Alltag?
Technik und Ethik
Das Deutsche Museum Nürnberg zeigt zukunftsweisende Technologien und stellt ethische Fragen: Ein Museumskonzept, das in dieser Form einzigartig ist. Auf 2.900 Quadratmetern Ausstellungsfläche öffnet sich ein dichter, interaktiver Dialograum,
der Zugang zu Technik, Wissenschaft und gesellschaftsrelevanten Fragen bietet. Jedes Exponat ist mit der Frage verbunden: Welche Technologie wird eingesetzt und welche Auswirkungen hat jene. Es geht um technisches Möglichkeiten und um Verantwortung. Aufgespannt zwischen Wissenschaft und Fiktion gliedert sich die Dauerausstellung in die Bereich „Arbeit und Alltag“, „Körper und Geist“, „System Stadt“, „System Erde“ sowie „Raum und Zeit“.
Interaktive Stationen ermöglichen einen intuitiven Zugang zu teils abstrakten Inhalten. Simulierte Szenarien bringen ethische Fragen in den Raum und führen zu Diskussionen. Letztlich geht es um die Frage: wie
wollen wir in Zukunft leben. Wie gestalten wir die Zukunft – als Individuen, als Gesellschaft, als Menschheit? Und zwar im Hier und Jetzt. Die Entscheidungen von heute prägen das Morgen.
Museum – mitten im Leben
Das Zukunftsmuseum, 2021 als Zweigstelle des Deutschen Museums eröffnet, liegt unweit des Nürnberger Hauptmarkts im Augustinerhof. Der Neubau von Volker Staab Architekten fügt sich in das Stadtbild ein. Er bietet eine einladende, offene Grundstruktur. Große Fensteröffnungen holen die Stadt ins Museum – und lassen umgekehrt das Museum nach außen strahlen.

Baulich und inhaltlich-gestalterisch ist das Museums als inklusiver Ort gedacht. Herzstück des Gebäudes ist das Forum: ein zentraler Ort mit Tribünentreppe, LED-Newstickern und einem kinetischen Medienkubus – der ideale Raum für Vorträge, Diskussionen, Performances und Interaktion.
Das Angebot des Hauses erreicht Menschen mit verschiedenen Voraussetzungen und Bedürfnissen. Die Programme sind dialogisch aufgebaut. Klassischen Führungen: Fehlanzeige. Das Museum bietet Denktouren an. Abhängig vom Input der Teilnehmenden entstehen jeweils unterschiedliche Wege durch die Ausstellung.
Seine Angebote im digitalen Raum fasst das Museum unter dem Titel „Zukunftsmuseum EXTENDED“ zusammen. Aktuell zählen dazu ein VR-Moonwalk oder ein virtueller Besuch auf dem Jahrmarkt. Eine HoloAudioTour steht blinden und sehbehinderten Menschen zur Verfügung. Sie ermöglicht mittels akustischer Signale, die eine AR-Brille einspielt, einen selbständigen Ausstellungsbesuch.
Hochwertig ausgestatte Besucherlabore sind ein Alleinstellungsmerkmal. Bei Laborkursen, Qualifizierungsprogrammen und offenen Angebote geht es um MINT-Themen, angeleitet von wissenschaftlichem
Fachpersonal mit besonderer Expertise in der Vermittlung.
Auf der Ausstellungsfläche sind F-Coms – „Future Communicators“, die ersten Ansprechpersonen der Museumsgäste. Sie sind besonders geschult, um Denkanstöße zu geben und das Museum als Diskussionsraum erlebbar zu machen.

Linke Seite: Außenansicht Deutsches Museum Nürnberg © Deutsches Museum Nürnberg (Abk. DMN), Foto: Daniel Karmann
Rechte Seite, Oben: VR Moonwalk © DMN, Foto: Boris Brackrock
Unten, Links: HoloAudioTour für Blinde und Sehbehinderte © DMN, Foto: Simone Voggenreiter
Rechts: Forum © DMN, Foto: Daniel Karmann


Fünf Themenbereiche – vom eigenen Körper bis ins All
Die Dauerausstellung zählt rund 180 Stationen mit herausragenden Objekten - vom humanoiden Roboter AMECA über einen CO2-Sauger für die Nürnberger City bis zum Penguin Suit von Alexander Gerst.
Im Bereich „Arbeit und Alltag“ geht es um die Digitalisierung unseres Lebens. Wie verändert sich unser Verhältnis zu Arbeit, Kommunikation und Sicherheit?
Werden Maschinen uns ersetzen – oder unterstützen? Welche Rolle spielen Daten, KI und Automatisierung?


„Körper und Geist“ richtet den Blick auf unseren Körper, unsere Gesundheit und unsere Gedanken. Die Ausstellung zeigt Bioprinting, Neuroimplantate und genetischer Diagnostik – zwischen medizinischem Fortschritt und ethischen Grenzgängen. Wo endet Therapie – und wo beginnt Optimierung?
Oben: Laborkurs
© DMN, Foto: Simone Voggenreiter
Mitte: „Körper und Geist“, Embryonen-Brüter
© DMN, Foto: Daniel Karmann
Unten: „Arbeit und Alltag“, Social-Media Daten-Strudel
© DMN, Foto: Simone Voggenreiter

GEMÄLDEAUFBEWAHRUNG
in Museen, Galerien, Kunstdepots
Maßgeschneiderte Lösungen für:
· Gemälde-Depotanlagen
· Schaudepots
· Statische Gemäldelagerung

· Transport- und Arbeitshilfen
· Arbeitstische
· Lagertrennwände

„System Stadt“, © DMN, Foto: Daniel Karmann



„System Stadt“ thematisiert das urbane Leben von morgen. Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie organisieren wir Verkehr, Wohnen, Energie und Gemeinschaft in einem wachsenden, vernetzten Raum? Und wie lassen sich Freiheit, Fortschritt und Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren?
Als Großobjekt bleibt der Pop.Up NEXT in Erinnerung: ein elektrisch betriebenes, autonomes Mobilitätskonzept, das Auto und Flugtaxi verbindet.
Der Ausstellungsbereich „System Erde“ zeigt ein globales Bild. Es geht um Res-

Ideal für Raumklima-Monitoring





sourcen, Klima, Energie. Präsentiert werden technologische Lösungen ebenso wie gesellschaftliche Dilemmata – etwa die Frage, wem Rohstoffe gehören und wie wir mit Umweltfolgen umgehen, die global wirken, aber auf lokalen Entscheidungen beruhen. Ein medial bespielter Globus mit drei Metern Durchmesser steht sinnbildlich für die globalen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. Er prägt den Luftraum über dem Ausstellungbereich und ist umgeben von Weltraumschrott.
Im Bereich „Raum und Zeit“ geht es schließlich um den Menschheitstraum der Raumfahrt, um Zeitreisen und um die Zukunft im All. Zu den Highlights zählen das Modell einer Mondbasis-Station und ein bereits historisches Objekt: Eine russische Foton-Kapsel, die seit 1985 für wissenschaftliche Experimente im All genutzt wird. Ausgestellt ist die erste Kapsel, die 12 Tage lang die Erde umrundete.
Linke Seite, Oben: „System Stadt“
© DMN, Foto: Daniel Karmann
Unten: „System Erde“
© DMN, Foto: Daniel Karmann
Rechte Seite: „System Erde“
© DMN, Foto: Ludwig Olah





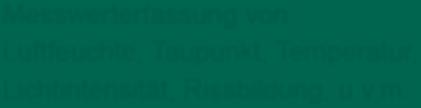
Messwerterfassung von: Luftfeuchte, Taupunkt, Temperatur, Lichtintensität, Rissbildung, u.v.m.




























Datenlogger ALMEMO® 710 zur Erfassung aller Messdaten

Für Depots, Archive, Museen, zur Baudiagnostik in Denkmalschutz und Altbau



Fragen Sie uns!












Tel: 08024 300 70
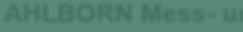




































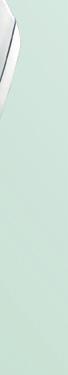




Konzept: Science and Fiction
Ein Leitmotiv und methodischer Ansatz des Zukunftsmuseums ist die Gegenüberstellung von Science und Fiktion. Fiktion trifft auf Forschung – und Visionen auf Verantwortung. Oft sind es fiktionale Ideen, die Forschung inspirieren und wissenschaftliche Entwicklungen, die aus Fiktion Realität werden lassen. So steht der Communicator aus Star Trek (1966) neben dem ersten

Klapphandy (1996). Ebenfalls aus der Serie stammt die Idee eines „Medical Tricorders“ – ein nichtinvasives medizinisches Diagnosegerät. Dies entspricht heutigen smarten Sensoren und KI-gestützter Telemedizin. An einer Computer-Hirn-Schnittstelle wird aus medizinischen Gründen geforscht, wobei der Wunsch, Gedanken lesen zu können, seit langem in Literatur und Film präsent ist. In der Ausstellung dienen fiktionale Elemente – vielfach durch die großformatige Einspielung von Ausschnitten aus Science Fiction-Filmen präsent – als Reflexionsfläche, Diskussionsanstoß und kritische Perspektive.
Die Präsentation folgt einem gestalterischen Konzept, bei dem die Farbe Weiß der Ausstellungsdisplays für Wissenschaft, angewandte Technologien oder marktreife Produkte steht, während die Farbe Schwarz Fiktion, Spekulation und Vision verdeutlichen. Dieses System zieht sich durch alle Themenbereiche. Eingeordnet sind die Displays in ein räumlich gedachtes Grid. Dieses Raster ist in der Bodengrafik ablesbar, wo es sich vom geordneten, wissenschaftlichen Weiß bis hin zur Fiktion immer weiter auflöst.
Oben: „Raum und Zeit“
© DMN, Foto: Daniel Karmann
Mitte und Unten: „Raum und Zeit“
© DMN, Foto: Ludwig Olah

Die Sichtbetonwände und die klare Ausstellungsgestaltung betonen den technischen Charakter des Hauses. Farben, Materialien und Formen stehen für technische Systematisierung. Die Museumsinhalte erscheinen sinnlich erlebbar im Raum. Es ist ein offener Raum, der zum Denken, Diskutieren und Mitgestalten anregt.
Unsere Zukunft ist gestaltbar. Am Anfang steht die Neugier – und die Bereitschaft zum Dialog. Das Deutsche Museum Nürnberg lädt dazu ein. Zukunft ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess in Bewegung.
Deutsches Museum Nürnberg –Das Zukunftsmuseum
Augustinerhof 4, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 - 21548 880
besucherservice-dmn@deutsches-museum.de
www.deutsches-museum.de/nuernberg
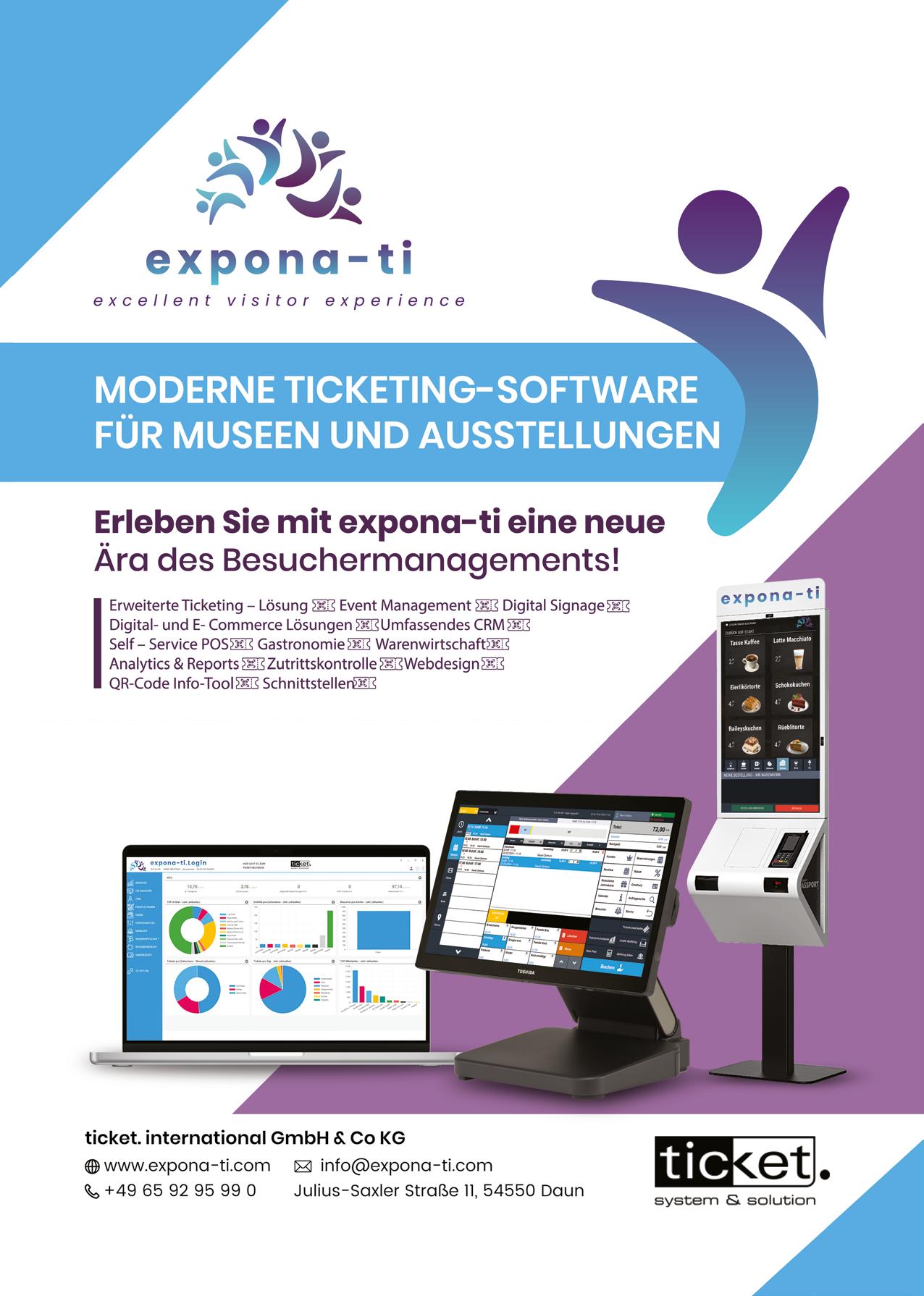
SCHLOSS WILHELMSHÖHE
Kulturdenkmal von Weltrang trifft auf moderne Luftbefeuchtungstechnik

Der Schutz von Kunstwerken hat in Museen höchste Priorität. Im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel, Heimat von Rembrandts „Jakobssegen“ und vielen anderen Meisterwerken, war die bisherige Luftbefeuchtungsanlage veraltet. Der Sanierungsbedarf war offensichtlich, die Lösung nicht. Wir werfen einen Blick darauf, wie man mit moderner Hochdruckbefeuchtung historischem Gemäuer gerecht wird.
Die Bedeutung des Raumklimas für Kulturgüter
Das übergeordnete Ziel eines jeden Museums ist die Bewahrung seiner Sammlung.
Dabei steht das Raumklima im Mittelpunkt, denn es ist der entscheidende, wenn auch oft unsichtbare, Faktor für den Erhalt von Kulturgütern. Insbesondere Kunstwerke aus organischen Materialien wie Holz, Textilien und Papier reagieren extrem sensibel auf ihre Umgebung. Temperaturschwankungen und, noch gravierender, Veränderungen der relativen Luftfeuchtigkeit können zu irreversiblen Schäden führen.
Holztafeln und Rahmen: Bei zu trockener Luft schrumpfen Holzfasern. Dies führt zu Spannungen, die Risse und Verformungen verursachen können. Ist die Luftfeuchtigkeit hingegen zu hoch, quillt das Material auf, was ebenfalls zu Schäden führen kann.
Leinwand und Malschichten: Eine stabile Luftfeuchte ist essenziell, um die flexible Verbindung zwischen der Leinwand und der Malschicht zu erhalten. Schwankungen führen zu mechanischen Spannungen, die Risse, Abplatzungen oder sogenannte „Krakelee“-Effekte (feine Rissnetze) verursachen. Schimmelbildung: Eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit, insbesondere in Kombination mit mangelnder Luftzirkulation, fördert die Bildung von Schimmelpilzen. Diese können Kunstwerke irreversibel schädigen.
Fachleute weltweit sind sich einig: Ein konstantes Raumklima ist die beste Präventivmaßnahme. Empfehlungen, wie sie die europäische Norm EN 15757 oder die


ASHRAE-Richtlinien aussprechen, sehen daher vor, die relative Luftfeuchte in einem engen konservatorisch sicheren Korridor zu halten. Im Schloss Wilhelmshöhe wurde ein Sollwert von 45 % r. F. festgelegt, um die wertvollen Exponate optimal zu schützen.
Die Herausforderung: Historisches Gebäude und veraltete Technik
Historische Gebäude wie das Schloss Wilhelmshöhe stellen besondere Ansprüche an die Anlagentechnik. Als eines der herausragendsten Museen von Hessen Kassel Heritage, einer der größten Kunst- und Kulturinstitutionen Deutschlands, beherbergt
es unter anderem die Gemäldegalerie Alte Meister mit unschätzbar wertvollen Werken von Rembrandt, Rubens und Frans Hals. Massive Mauern, wechselnde Außentemperaturen und der tägliche Besucherstrom beeinflussen das Innenklima kontinuierlich. Die veraltete Befeuchtungsanlage im Schloss war nach Jahrzehnten am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und konnte diese einzigartigen Schätze nicht mehr ausreichend schützen. Ersatzteile waren kaum noch verfügbar, und die Regelgenauigkeit entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es brauchte eine zuverlässige, langlebige Lösung, die sowohl den Denkmalschutz als auch die hohen konservatorischen Standards erfüllt.
Die Lösung: Präzision und Effizienz durch adiabatische Hochdruckbefeuchtung
Gemeinsam mit unserem Partner, der Friedrich Hertel Kälte-Klimatechnik GmbH & Co. KG, haben wir eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt: zwei Jetvap®-basic Hochdruckdüsensysteme von Lavair. Im Gegensatz zu Dampfbefeuchtern, die viel
Li. Schloss Wilhelmshöhe. © Branko Srot. stock.adobe.com
Rechts: Jetvap®-basic Hochdruckdüsensysteme von Lavair sorgen für konstante relative Luftfeuchte
Foto: © Lavair AG Klimatechnik

Energie verbrauchen, nutzt dieses System das Prinzip der adiabatischen Kühlung.
Das System beruht auf einem technisch eleganten Prinzip, das maximale Präzision mit minimalem Energieaufwand verbindet. Es handelt sich um ein Durchlaufwassersprühbefeuchtungssystem, bei dem das Wasser nicht rezirkuliert, sondern nach der Verdunstung als Verwurf dem Abwassersystem zugeführt wird. Dadurch werden Ablagerungen und Verkeimung von vornherein verhindert.
Höchste Hygiene durch Frischwasserprinzip: Eine leistungsstarke Hochdruckpumpe presst das Wasser mit bis zu 80 bar durch spezielle Düsen. Das eingespritzte Wasser stammt stets aus einer Frischwasserquelle und wird nicht wiederverwendet.
VDI 6022-konforme Spül- und Entleerungszyklen sichern den hygienischen Betrieb zusätzlich ab.
Feinste Zerstäubung und schnelle Verdunstung: Das Wasser wird durch die Anti-Tropf-Düsen in einen ultrafeinen Nebel zerstäubt. Der integrierte mikro -
bakterielle Agglomerator fängt diesen auf und verdunstet das gleichbleibend optimale Sprühbild schnell und effektiv im Luftstrom der raumlufttechnischen Anlagen (RLT). Chemische Zusätze sind hierfür nicht erforderlich.
Maximale Präzision: Die Regelung der Befeuchtungsleistung erfolgt stufenlos über eine frequenzgeregelte Pumpensteuerung. Ein patentiertes Regelungskonzept ermöglicht dabei eine extrem präzise Regelgenauigkeit von ± 0,5 % r. F., was für die Konservierung sensibler Kunstwerke unerlässlich ist.
Robuste, langlebige Komponenten: Alle wasserführenden Teile des Systems sind aus nicht korrodierenden Materialien wie Edelstahl, Kunststoff oder Keramik gefertigt, was eine hohe Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität garantiert.
Hocheffizienter Betrieb: Für Dampfluftbefeuchter wäre im Schloss eine deutlich höhere elektrische Anschlussleistung erforderlich gewesen, die dort nicht verfügbar war. Es werden höchst effiziente Pumpen
eingesetzt, die nur alle 8.000 Betriebsstunden eine Überprüfung benötigen und vor allem öl- und silikonfrei sind. Die adiabate Hochdrucktechnik verbraucht im Vergleich deutlich weniger Energie, was die Betriebskosten senkt und die Lösung besonders nachhaltig macht.
Umsetzung im laufenden Betrieb und das Ergebnis
Eine der größten Herausforderungen war die Installation ohne Schließung der Gemäl-
Oben: Die Gemäldegalerie "Alte Meister" mit über 500 Werken – unter anderem von Rubens, van Dyck und Frans Hals. Besonders bekannt ist Rembrandts Spätwerk "Der Jakobssegen", das heute zu den Höhepunkten der Sammlung zählt
Foto: © Mirja van Ijken, Bildquelle: Hessen Kassel Heritage
Rechte Seite, Links: Steuerungsbox und hocheffiziente Wasserpumpe: Platzsparende Montage und wartungsarmer Betrieb
Rechts: Die Anti-Tropf-Düsen im Luftkanal der raumlufttechnischen Anlage
Unten: Sebastian Vittinghoff | Alfred Kaut GmbH & Co. Abteilungsleiter Luftbefeuchtungstechnik
Fotos: ©: Alfred Kaut GmbH & Co.


degalerie. Die Arbeiten wurden in enger Absprache mit der Museumsleitung geplant und abschnittsweise ausgeführt. Die alten Anlagen wurden demontiert, die neuen Jetvap ® -basic-Stationen installiert und die Edelstahlleitungen zu den RLT-Geräten verlegt. Die neue Technik wurde nahtlos in die bestehende Gebäudeleittechnik integriert, was eine klare Bedienung und transparente Betriebsdaten ermöglicht.
Heute profitiert das Schloss Wilhelmshöhe von einer hochmodernen Befeuchtungslösung, die:
• die Kunstwerke zuverlässig schützt, indem sie die Luftfeuchte im konservatorisch empfohlenen Korridor hält.
• den Betrieb sicherer macht, dank automatischer Hygieneprogramme nach VDI 6022.
• die Betriebskosten senkt, durch deutlich geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu Dampfanlagen.
• die Wartung vereinfacht, da Spülungen und Entleerungen automatisiert ablaufen.
Das Projekt im Schloss Wilhelmshöhe ist ein Paradebeispiel dafür, wie Denkmalschutz und innovative Technik Hand in Hand gehen können. Es steht für die handfeste Betriebssicherheit und den messbaren Schutz von Kulturgütern. So bleibt das Schloss Wilhelmshöhe auch in Zukunft ein sicherer Ort für Meisterwerke von Weltrang – und für die Menschen, die sie sehen wollen.
Ihr Vorteil: Unsere Erfahrung
Seit über 60 Jahren sind wir bei Alfred Kaut GmbH Ihr verlässlicher Partner für präzise Luftbefeuchtung. Vom klassischen Dampf bis zur energieeffizienten adiabatischen Kühlung, wie sie im Schloss Wilhelmshöhe erfolgreich eingesetzt wurde – wir beraten, planen, liefern und betreuen. Jede Anwendung ist einzigartig. Deshalb liefern wir alle Befeuchtungssysteme und finden in enger Absprache mit Ihnen die optimale Lösung. Ob Wasserzerstäubung, Verdunstung, Ultraschall oder Dampf: Unser Ziel ist ein effizienter und wartungsfreundlicher Betrieb, der den Wert Ihrer Exponate dauerhaft sichert. Profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Alfred Kaut GmbH & Co.
Windhukstr. 88 | D-42277 Wuppertal Tel. +49 (0)202-2682-0 www.kaut.de info@kaut.de
Autor
Sebastian Vittinghoff | Alfred Kaut GmbH & Co.
Abteilungsleiter Luftbefeuchtungstechnik Tel. 02 02 / 26 82 135 sebastian.vittinghoff@kaut.de

wob³walls –
das Wandsystem für die Kunst

Was vor 30 Jahren als interne Lösung für Ausstellungsinszenierungen im Kunstmuseum Wolfsburg begann, hat sich heute zu einem international gefragten System etabliert: wob³walls – ein modulares Stellwandsystem, das in über 100 Kunstmuseen und Kulturhistorischen Museen und Ausstellungshäusern weltweit im Einsatz ist.
Die wob³walls gGmbH – eine gemeinnützige Tochtergesellschaft – entwickelt, produziert und installiert das System heute mit einem eingespielten, erfahrenen Team aus Tischlern, Schlossern und Malern. Gemeinsam schaffen sie ein Produkt, das sich durch Ästhetik, Flexibilität und Nachhaltigkeit auszeichnet – und damit den Anforderungen zeitgenössischer Ausstellungsgestaltung in jeder Hinsicht gerecht wird.
Mehr als eine Wand: Architektur im System
Die wob³walls sind modular aufgebaut und ermöglichen variable Wandkonfigurationen – von einfachen Stellwänden bis hin zu komplexen Raum-in-Raum-Konstruktionen. Egal ob Türstürze, Wandnischen, Vitrineneinbau, Medientechnik oder verdeckte Revisionsgänge: Die Architektur bleibt anpassbar, wandelbar und funktional.
Die Wandkörper selbst sind begehbar und können als Stauraum für Technik, Kabelwege oder Revisionsräume genutzt werden.
Ihre glatte, homogene Oberfläche bietet beste Voraussetzungen für hochwertige Gestaltung und Präsentation – sei es durch Farbe, Stoff oder individuelle Beschichtung.
Effizient, leicht, nachhaltig
Was Ausstellungshäuser, Museen und Galerien besonders schätzen, sind die prakti-

schen Vorteile der wob³walls:
Modularität: beliebig kombinierbare Einzelteile
Leichtigkeit: geringes Eigengewicht erleichtert Handling
Schneller Auf-/Abbau: spart Zeit und Kosten
Platzsparend: zerlegbare Module ermöglichen kompakte Lagerung
Nachhaltig: wiederverwendbare Konstruktion spart Ressourcen
Anwendungsfreundlich: einfache Montage nach kurzer Einweisung
Variantenreich: individuelle Anpassungen problemlos möglich
Gordon Matta-Clark. SA Eesti Kunstimuuseum Foto: © Stanislav Stepashko
Von Wolfsburg in die Welt
Ob in der Schweiz, in Skandinavien, den USA oder Fernost – die wob³walls haben sich längst bewährt:
l Kunsthaus Zürich
l Platforme 10 in 3 Museen, Lausanne
l Museum der Moderne, Salzburg
l Munch Museum und Nationalmuseum, Oslo
l ARoS Aarhus Kunstmuseum (DK)
l City University of Hong Kong School of Creative Media
l K20 / K21, Düsseldorf
l Museum Frieder Burda, Baden-Baden
l … oder unter Kuppel des Reichstags in Berlin für Fotos von Bryan Adams
Insgesamt sind die Wände in über 100 Institutionen weltweit im Einsatz.
Drei Grundelemente.
Unzählige Möglichkeiten
Grundleitern aus Aluminiumprofilen und mit höhenverstellbaren Füßen
Quertraversen zur stabilen Verbindung
Holzbeplankung für teils oder ganz geschlossene Wände
Die Verkleidung erfolgt mit Tischlerplatten auf Holzleisten – mit gespachtelten, glatten Übergängen, die eine nahezu fugenlose Fläche ergeben.
Technik trifft Gestaltung
wob³walls-Aluminiumteile werden ohne Schrauben oder Nägel montiert und sind ebenso einfach wieder lösbar – dauerhaft wiederverwendbar.




Mobilität durch Innovation –die Wall Mover
Zur Minimierung von Umbaukosten und Aufbauzeiten hat wob³walls ergänzend mobile Verschiebesysteme entwickelt: Wall Mover (manuell): für Wände bis 10 Meter
Wall Roller: für kleine Wände per Hubwagen
Diese Systeme ermöglichen es, komplette Wandstrukturen ohne Demontage zu verschieben – eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, insbesondere bei Wechselausstellungen.
Links: Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“
Rechts: Ausstellung „Die Kunst der EntschleunigungBewegung und Ruhe in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Ai Weiwei“.
Mitte: Ausstellung „Empowerment“ © Kunstmuseum Wolfsburg, Foto: Marek Kruszewski
Fazit: Eine Wand, die mehr kann
Die wob³walls sind mehr als ein Stellwandsystem – sie sind ein Instrument für kuratorische Freiheit, architektonische Qualität und wirtschaftliche Effizienz. Ein System, das mitdenkt. Eine Konstruktion, die bleibt. Eine Lösung, die weltweit überzeugt.
wob³walls gGmbH
Heinenkamp 11 38444 Wolfsburg Tel 0049 | 5361 | 2669910 info@wob3walls.de www.wob3walls.de

Glashüttes Meisterwerk wird 100 Jahre alt
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte zeigt Sonderausstellung zu seiner Astronomischen Kunstuhr. Autor: Michael Hammer
Anzeige


Zum 100. Geburtstag seiner Astronomischen Kunstuhr hat das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte im September 2025 eine Sonderausstellung eröffnet, die sich
der Kunstuhr widmet. Unter dem Titel ZEITSPRUNG können sich die Besucherinnen und Besucher in die Zeit der Entstehung der Uhr hineinversetzen.
Links: Bereits am Museumseingang wird auf die neue Sonderausstellung hingewiesen
Rechts: Uhrenmuseum Außenansicht. Foto: René Gaens © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Sonderausstellung „ZEITSPRUNG“
Wer das Deutsche Uhrenmuseum im sächsischen Glashütte betritt, erblickt gleich nach Durchschreiten des Eingangsportals eines der bedeutendsten Exponate der Sammlung und wird unweigerlich in seinen Bann gezogen. Die Astronomische Kunstuhr von Hermann Goertz beeindruckt nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch die Vielzahl an Anzeigen, die einen ausgeklügelten Mechanismus hinter dem prächtigen Zifferblatt vermuten lassen.
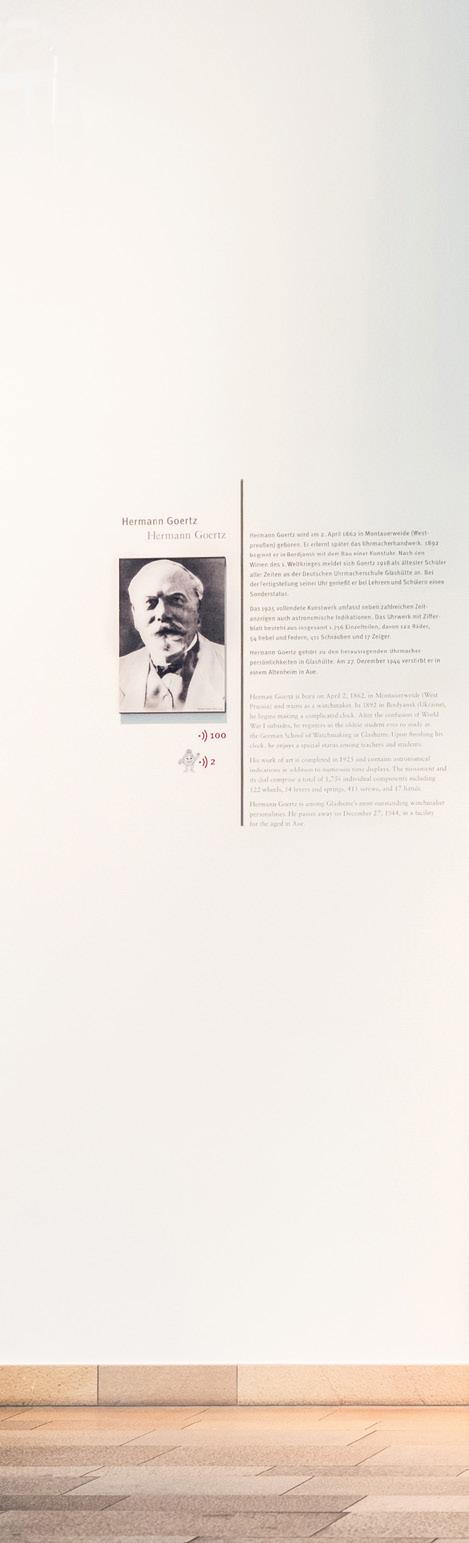
In diesem Jahr feiert das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte den 100. Geburtstag seiner Astronomischen Kunstuhr. Im Oktober 1925 wurde sie von ihrem Erbauer Hermann Goertz nach reichlich drei Jahrzehnten Bauzeit fertiggestellt. Aus diesem Anlass hat das Uhrenmuseum im September eine Sonderausstellung eröffnet, die sich der Kunstuhr widmet. Unter dem Titel ZEITSPRUNG begeben sich die Besucher darin auf eine Zeitreise ins Jahr 1925, als die Uhr vollendet wurde.
Links: Sternenhimmelscheibe der Astronomischen Kunstuhr Rechts: Die Astronomische Kunstuhr steht im Foyer des Uhrenmuseums © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos: René Gaens


Anhand unterschiedlicher Themen werden die technischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit erlebbar gemacht und gezeigt, welche Herausforderungen Hermann Goertz bei den Arbeiten an seinem Meisterwerk zu bewältigen hatte. Darüber hinaus gibt die Ausstellung anschaulich dargestellte Einblicke ins Innere der Uhr. Als zentrale Elemente wurden dafür beispielsweise der ewige Kalender, die astronomischen Funktionen oder die beim Bau des Uhrwerkes verwendeten Materialien ausgewählt.
Begleitet wird die Ausstellung durch eine eigene App. Audiodateien zu den einzelnen Themenschwerpunkten ermöglichen es, sich noch besser in die Zeit der Entstehung der Uhr hineinzuversetzen. Passend dazu können kleine Rätselaufgaben gelöst werden. Auch sonst ist Aktivität gefragt: sei es beim Erstellen einer technischen Zeichnung am Zeichentisch oder beim Ausprobieren eines 3D-Modells des ewigen Kalenders der Kunstuhr.
Oben: Astronomische Kalenderuhr von Christoph Jäckle
Mitte: Animation des ewigen Kalenders der Kunstuhr
Unten, Rechte Seite: Blick in die Sonderausstellung
© Deutsches Uhrenmuseum Glashütte
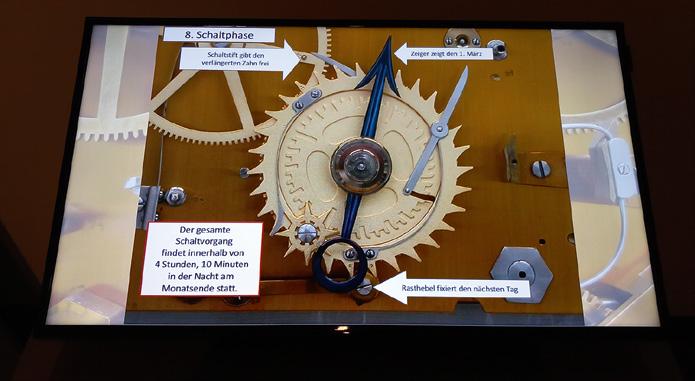
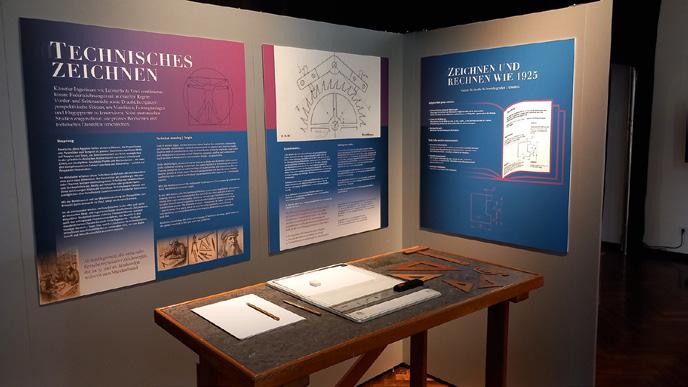




EXZENTER

G40 CLASSIC
G40 CLASSIC
Wandsysteme?




Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.

Wandsystem stark, für , Showrooms und Büro. In Modulbauweise Exzenterverbindern aufzuWandsys40mm und umlaufend mit Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
Wandsysteme?


Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.
Wandsysteme?

G40 QUICK

EXZENTER







modulares für Büro und Messe. Die einzelnen Moduindividuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug,



Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern

. Ideal für Stadthallen, Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabschnell zusammenste, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für













G40 QUICK
G40 CLASSIC
G40 CLASSIC
Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.
Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.

RAUMBOX®
G40 QUICK
RAUMBOX®

G40 QUICK
Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.










Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.
Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
G19 YOGA
G19 YOGA
RAUMBOX®
19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration. RAUMBOX®
Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.

G19 EDGE
G19 YOGA
G19 EDGE

G19 YOGA
Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.




Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.
19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
G40 MÖBEL
G19 EDGE
G40 MÖBEL
G19 EDGE
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.
Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.
G40 MÖBEL
G40 MÖBEL
in
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Museum, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Rufen Sie uns an +49 (0)8076 88 575 0 oder schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de
Leichtbau
Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Museum, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Rufen Sie uns an +49 (0)8076 88 575 0 oder schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de
Wir sind Hersteller von Wandsystemen für MuseMessebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir








Faszination Zeit – Zeit erleben
Unter dem Motto „Faszinalion Zeit – Zeit erleben“ begrüßt das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte seit dem Jahr 2008 seine Gäste im repräsentativen Gebäude der ehemaligen Deutschen Uhrmacherschule Glashütte.
Auf rund 1000 Quadratmetern zeigt die Dauerausstellung über 500 teils einmalige Glashütter Zeitmesser sowie zahlreiche weitere Exponate, die den Besuchern die Entwicklung der sächsischen Kleinstadt
Glashütte zu einem der weltweit führenden Uhrenzentren näherbringen. Ihren Anfang nahm die Glashütter Uhrengeschichte am 7. Dezember 1845, wird in diesem Jahr also 180 Jahre alt. Zahlreiche Persönlichkeiten und Firmen prägten die Entwicklung in dieser langen Zeit, viele davon werden mit ihren Leistungen und Produkten in der Ausstellung vorgestellt. Dazu gehören auch die heutigen Manufakturen. Elf Hersteller zählt die ansässige Uhrenindustrie derzeit.
Linke Seite
Links 1,2: Führungen im Uhrenmuseum
Links 3: Historische Glashütter Taschenuhren
Rechts: Älteste Glashütter Uhr in der Ausstellung
Unten: Blick in den Raum „Neuzeit“ mit Vitrinen der heutigen Glashütter Uhrenhersteller
Rechte Seite
Oben: Historische Glashütter Taschenuhren
Links, Rechts: Blick in die ständige Ausstellung © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos René Gaens


Hintergrund: Historischer Uhrmachertisch im Uhrenmuseum
Rechts: Schauwerkstatt mit Besuchern
© Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos René Gaens


Ergänzend zu den historischen Themen liefern mehrere interaktive Stationen im Museum interessante Informationen zu den Themen Zeit und Zeitmessung. So gibt es beispielsweise ein begehbares Lexikon, das zahlreiche Begriffe aus der Uhrenwelt erklärt. Darüber hinaus vermittelt ein überdimensionales Uhrenmodell auf anschauliche Weise die wesentlichen Funktionen einer mechanischen Uhr. Im historischen Atelier der Manufaktur Glashütte Original, welche einer der Stifter des Uhrenmuseums ist, kann man Uhrmachern bei der Restaurierung von historischen Glashütter Uhren über die Schulter schauen.

Auch für die jüngsten Besucher hat das Uhrenmuseum einiges zu bieten. Über einen speziellen Kinder-Audioguide werden die wichtigsten Themen und Exponate der Ausstellung kindgerecht erklärt. Und wer möchte, kann während des Rundgangs sein Wissen in einem Museums-Quiz testen.

Das Uhrenmuseum und die Sonderausstellung können zu den regulären Öffnungs-
Oben: Historischer Uhrmachertisch
Mitte: Glossar der Zeitmessung
Unten: Interaktives Uhrenmodell
© Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos René Gaens
zeiten, Mittwoch bis Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Mögliche zusätzliche Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Uhrenmuseums bekanntgegeben.
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte Schillerstraße 3 a 01768 Glashütte/Sachsen
Tel. +49 (0) 35053 4612102
info@uhrenmuseum-glashuette.com www.uhrenmuseum-glashuette.com
... die Kunst zu bewahren


Dienstleistungen
• Vitrinenwartung
• Dichtigkeitsmessungen
• Emissionsmessungen
• Schadstofffilterung mittels REIER-Filterbox
Vitrinen- und Glasbau
REIER GmbH
J.-S.-Bach-Str. 10 b 02991 Lauta
www.reier.de
info@reier.de
Die Vitrinenmanufaktur
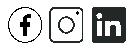

Vitrinenspektrum
• Standardvitrinen
• Spezialvitrinen
• voll- und teilklimatisierte Vitrinen
• Wechselausstellungsvitrinen
• Verleihvitrinen
Seminare
• Konstruktionslösungen
• Materialauswahl
• Sicherheitstechnik
• Klimatisierung
• Filtertechnik

FOTOBODEN™ –
Ein Boden, der mehr erzählt
Gestaltung, Vermittlung und Nachhaltigkeit in Kultureinrichtungen
Museen, Galerien und Kultureinrichtungen sind heute mehr denn je gefordert, Informationen nicht nur zu bewahren, sondern sie erlebbar zu machen. Sie berichten über die Vergangenheit, vermitteln komplexe Zusammenhänge und greifen aktuelle Herausforderungen auf. Ein innovatives Medium hilft dabei, diese Aufgaben eindrucksvoll zu erfüllen: der Boden selbst. Mit FOTOBODEN™ wird er zu einem kuratorischen Werkzeug – für Informationsvermittlung und gelebte Nachhaltigkeit dank Biorenyl.
Geschichte, die man fühlen kann
Um historische Inhalte greifbar zu machen, braucht es Installationen, die Atmosphäre schaffen. Ein Beispiel: die fotorealistische Nachbildung eines Höhlenbodens. Risse, Strukturen und Farbnuancen wirken so authentisch, dass sich Besucher mitten in einer prähistorischen Stätte wähnen.

Oben: Höhlenboden: FOTOBODEN™ macht Szenen erlebbar – hier eine fotorealistische Nachbildung eines Höhlenbodens. Foto: © FOTOBODEN™
Links: Stammbaum: Der Boden als Exponat. FOTOBODEN™ visualisiert komplexe Zusammenhänge und macht sie auf einzigartige Weise erlebbar.
Ausstellungsansicht Frankfurter Kunstverein, 2019
Foto: Norbert Miguletz, © Frankfurter Kunstverein
Rechts: Grafik Biorenyl: Ökologische Merkmale von Biorenyl
Anzeige

Hier erzählt der Boden selbst Geschichte und wird zum integralen Bestandteil der Inszenierung – nicht nur als Fläche, sondern als Medium, das zum Entdecken einlädt.
Vom Wissen zum Verständnis
Kultureinrichtungen sind mehr als Archive der Vergangenheit – sie sind Orte der Reflexion über Gegenwart und Zukunft. Der Frankfurter Kunstverein nutzte die vielfältigen Möglichkeiten von FOTOBODEN™ in der Ausstellung „Trees of Life – Erzählungen für einen beschädigten Planeten". Dort wurde der Boden selbst zum Exponat: Komplexe Stammbäume des Lebens wurden in großem Maßstab visualisiert. Die schiere Dimension der Grafik macht die Relativität des Menschen eindrucksvoll spürbar. So entstand eine Brücke zwischen Kunst, Wissenschaft und Besucherwahrnehmung.
Nachhaltigkeit als Haltung
Kunst und Kultur können nicht losgelöst von ökologischer Verantwortung betrachtet werden. Das Material Biorenyl von FOTOBODEN™ verbindet Gestaltung und Nachhaltigkeit: Das PVC enthält zu 100 % biozirkuläre Öle – Nebenprodukte aus Lebensmittel- und Holzindustrie. Fossiles Öl wird ersetzt, der CO2-Ausstoß im Produktionsprozess um rund 40 % reduziert. Die Biorenyl-Grafik zeigt: FOTOBODEN™ ist vollständig recycelbar, wird in Köln mit 100 %
Solarstrom produziert und unterstützt die Kreislaufwirtschaft.
Qualität, die bleibt
Neben den gestalterischen und ökologischen Vorteilen überzeugt FOTOBODEN™ auch technisch: Er bietet eine hohe Brandschutzklasse (Bfl-s1), Rutschhemmung (R10), Strapazierfähigkeit und Farbbeständigkeit. Er ist schnell verlegt, schützt empfindliche Untergründe und kann mehrfach verwendet werden. Ab dem kommenden Jahr wird auch die langlebigste Qualität FB43 auf Biorenyl umgestellt.
Damit bestehen zukünftig alle Qualitäten aus nachhaltigem Material:
l Temporäre Qualität FB02 – für Ausstellungen und Events, leicht zu verlegen und wiederverwendbar.
l Objektqualität FB32 & FB43 – robust und und langlebig für dauerhafte Installationen.
FOTOBODEN™ ist somit ein Boden, der Kultur nicht nur trägt, sondern sie zum Leben erweckt – nachhaltig, individuell und zukunftsweisend.

FOTOBODEN™ by visuals united AG Anna-Lindh-Straße 14, 50829 Köln
Tel. +49 (0) 221 340 269 - 44 info@fotoboden.de www.fotoboden.de
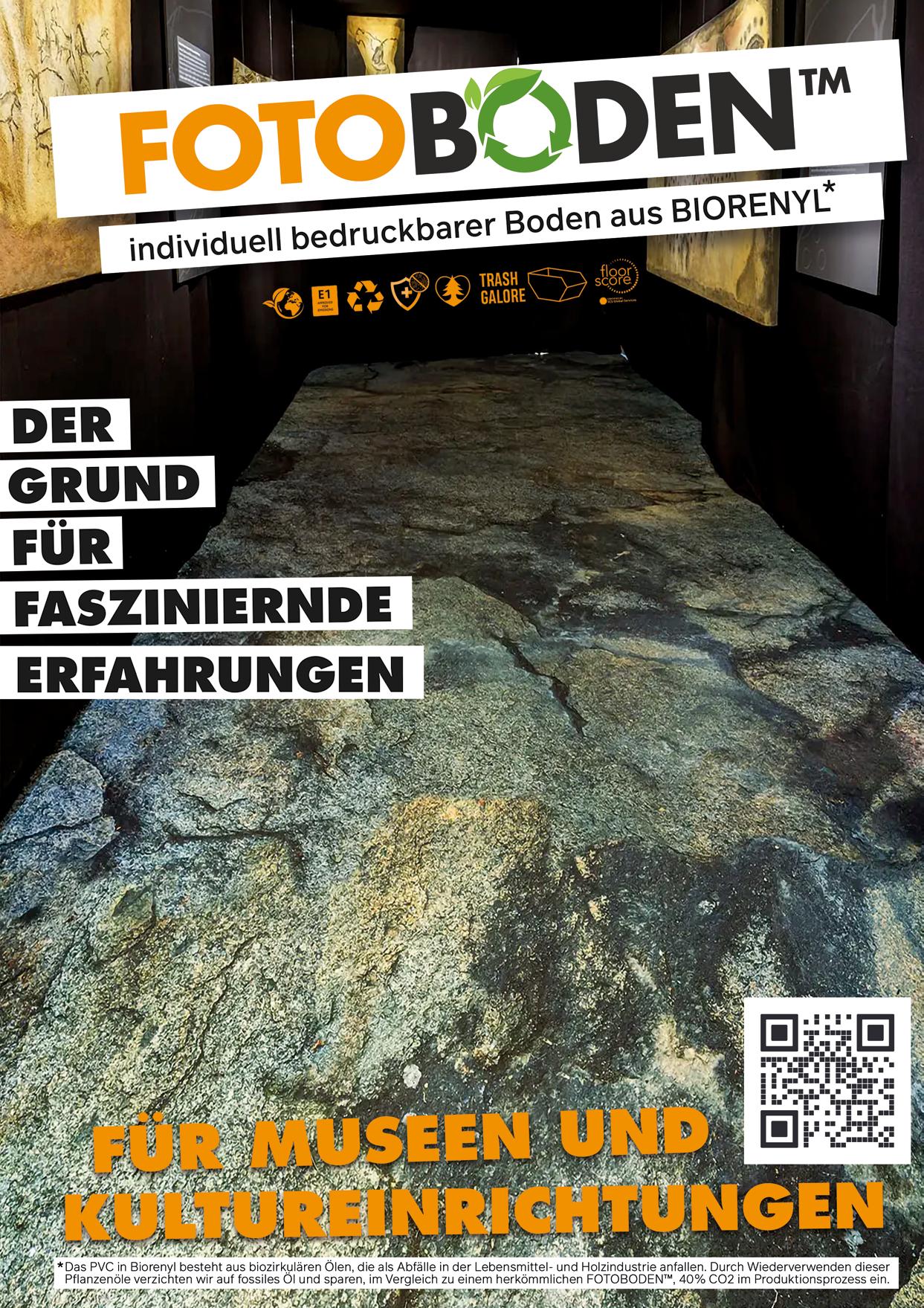

Das neue Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg
Ein museales Panorama vom höfischen Staatswagen bis zum bäuerlichen Arbeitsgerät

Mit der Wiedereröffnung des Kutschenmuseums auf Schloss Augustusburg im September 2025 erhält die deutsche Museumslandschaft einen bemerkenswerten Neuzugang. Drei Jahre lang wurde geplant, saniert und kuratiert – nun präsentiert sich das Museum mit einem vollständig überarbeiteten Konzept, in erweiterten Räumen und mit einem klaren Anspruch: nicht allein Kutschen auszustellen, sondern Mobilitätsgeschichte als sozialen, technischen und kulturellen Wandel erfahrbar zu machen.
In einer rund 1.100 Quadratmeter großen Dauerausstellung werden 25 historische Kutschen und Schlitten aus dem 18. bis frühen 20. Jahrhundert gezeigt. Ergänzt wird die Sammlung durch interaktive Stationen, szenische Inszenierungen und ein breites Vermittlungsangebot – darunter ein eigens entwickelter Kutschensimulator. Die Schau verbindet technisches Wissen, historische Tiefe und sinnliche Zugänglichkeit zu einem lebendigen Panorama vorindustrieller Mobilität.
Ein kulturpolitisches
Signal
Zur Eröffnung am 26. September 2025 würdigte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz das Projekt als „herausragend für Kultur und Region“. Insgesamt 9,1 Millionen Euro flossen in das Vorhaben – darunter rund sieben Millionen Euro für die Sanierung und bauliche Erweiterung des Museums im historischen Stallgebäude des Schlosses sowie 2,1 Millionen Euro für die Ausstattung der Ausstellungsräume. Die Maßnahme wurde mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts finanziert und unter der Leitung der Chemnitzer Niederlassung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement umgesetzt.
Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg / Scharfenstein / Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, bezeichnete die Wiedereröffnung als die Erfüllung eines langgehegten Wunsches – sowohl auf Seiten der Besucher als auch des Teams: „Architektur und Exponate fügen sich harmonisch in eins.“

Rechts: Patrizia Meyn, Geschäftsführerin Augustusburg/ Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, sowie Tonio Schulze, Leiter Sammlungsmanagement der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, bei den letzten Vorbereitungen im neuen Kut-
schenmuseum auf Schloss Augustusburg. Foto: © Uwe Meinhold/ ASL Schlossbetriebe gGmbH
Links: Drohnenaufnahme Schloss Augustusburg. Foto: © Sebastian Theilig

Prunkvoller Staatswagen von 1790
Foto: © Lutz Zimmermann


Räume schaffen – für Objekte und Zusammenhänge
Mit dem Umbau wurde das Museum nicht nur räumlich neu strukturiert, sondern auch inhaltlich grundlegend überarbeitet. Die Fläche des neuen Kutschenmuseums ist mehr als doppelt so groß wie die der Vorgängerausstellung. Die Zahl der gezeigten Fahrzeuge blieb jedoch bewusst begrenzt:
Statt Quantität steht nun der kuratierte Zugang im Vordergrund. Jedes Exponat erhält Raum zur Wirkung – nicht nur als Objekt, sondern als Teil einer erzählten Geschichte.
Ein zentrales Ziel des neuen Konzepts ist es, den Wandel der Mobilität in seinem gesellschaftlichen Kontext sichtbar zu machen. Kutschen sind nicht nur Transportmittel, sondern Ausdruck sozialer Ordnung, technischer Entwicklungen und kultureller Praktiken. Die neue Ausstellung inszeniert diese
Oben: Umsetzen des Galawagens von 1876/77 ins neugestaltete Kutschenmuseum
Foto: © Tina Kurz / ASL Schlossbetriebe gGmbH
Unten: Detailaufnahme des Galawagens von 1876/77
Foto: © Lutz Zimmermann

Zusammenhänge mit erzählerischer Tiefe und einem breiten didaktischen Spektrum.
Das historische Stallgebäude, in dem das Museum untergebracht ist, bildet mit seiner offenen Holzkonstruktion einen atmosphärisch stimmigen Rahmen für die Ausstellung. Die sichtbare Substanz des Gebäudes wird nicht überdeckt, sondern bewusst in die
Gestaltung integriert – ein Ensemble von Objekt und Raum.
Sieben Themenräume –Sieben Perspektiven auf Mobilität
Die Ausstellung ist in sieben thematisch gegliederte Räume unterteilt, die jeweils eine bestimmte Facette der Mobilitätsgeschichte beleuchten:
1. Repräsentation und Macht
Im Mittelpunkt stehen hier die Staats- und Galawagen des sächsischen Hofes. Darunter befindet sich der Galawagen von 1876/77, gefertigt vom Dresdner Hofwagenbauer Heinrich Gläser, mit reicher Verzierung und auffälliger Gestaltung. Er wurde 1878 zur Silberhochzeit von König Albert von Sachsen und Carola von Wasa-Holstein-Gottorp eingesetzt. Ebenfalls gezeigt wird die Staatsberline von 1790, hergestellt von Johann Christian Ginzrot aus Straßburg. Sie diente Kurfürst Friedrich August I. bei der Kaiserkrönung in Frankfurt als Gesandtschaftswagen – ein Symbol höfischer Selbstdarstellung.

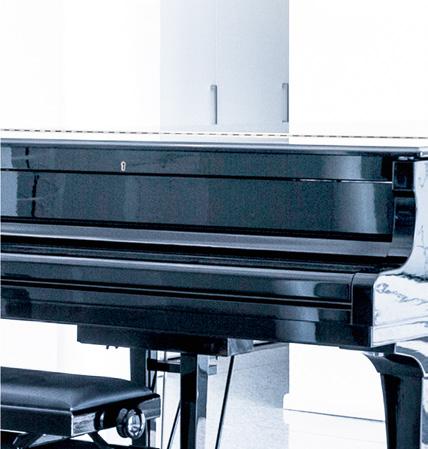







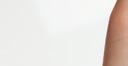









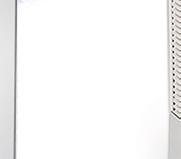


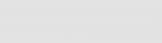
























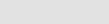


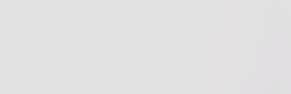





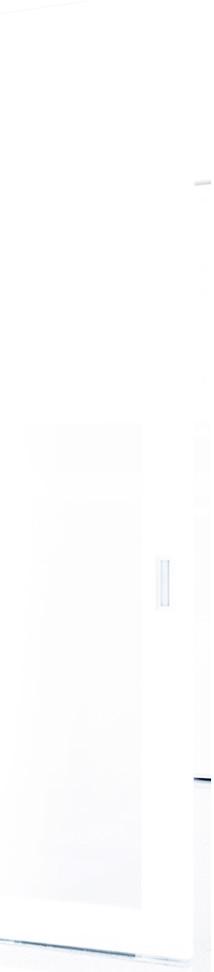



von 1876/77 im neugestalteten Kutschenmuseum
Galawagen
Foto: © Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH

2. Gesellschaft und Stadtleben
Stadt- und Gesellschaftswagen wie der Landauer oder der Rockaway stehen exemplarisch für bürgerliche Mobilität. Eingebettet in städtische Alltagsszenen zeigen sie, wie sich im 19. Jahrhundert neue Formen gesellschaftlicher Teilhabe und Repräsentation entwickelten.
3. Alltag und Arbeit
In diesem Themenraum stehen funktionale Fahrzeuge im Mittelpunkt: ein Posttransportwagen, ein Bäckerwagen, ein einfacher Spazierwagen. Sie geben Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt jenseits höfischer Repräsentation – Mobilität als Notwendigkeit.
4. Kinder und Familie
Kinderkutschen und -schlitten zeigen die kleinen Seiten der großen Mobilität. Sie werfen einen Blick auf Erziehungsideale und bürgerliche Lebensformen des 19. Jahrhunderts.

5. Trauer und Erinnerung
Ein Leichenwagen aus der Gemeinde Hohndorf – genutzt bis in die 1950er Jahre – steht im Zentrum dieses Raums. Verzierungen wie Engel, Urnen, Palmwedel sowie verglaste Seitenwände geben Aufschluss über zeittypische Vorstellungen von Tod und Übergang.
Exponate im Kutschenmuseum Schloss Augustusburg Fotos: © Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH


6. Handwerk und Technik
Ein Explosionsmodell veranschaulicht den Aufbau einer Kutsche. Szenen mit Stellmachern, Wagenschmieden und Sattlern würdigen die handwerkliche Kunst, ohne die die Kutschenkultur nicht denkbar wäre.
7.
Interaktion und Perspektivwechsel
In diesem Raum wird das Publikum aktiv: Ein digitaler Kutschensimulator ermöglicht das Steuern einer Kutsche durch eine virtuelle Stadt. Zusätzlich können Besuchende Kutschensitze ausprobieren, an einem Kutschenrennen teilnehmen oder Reiseberichte hören. Eine Besonderheit: Die Gäste werden einer von vier Rollen zugewiesen – Kutscher, Hofdame, Kaufmann oder Wagner – und können die Ausstellung aus dieser Perspektive erleben.
Region und Geschichte
Ein Bereich widmet sich der lokalen Geschichte: Gezeigt wird unter anderem eine Handdruckfeuerspritze von 1807, gefertigt für das Schloss selbst. Sie wurde von acht Personen bedient und vermutlich beim Brand des Brunnenhauses im Jahr 1831 eingesetzt.


Besucher bei der Eröffnung vom Kutschenmuseum Schloss
© Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH

Augustusburg Fotos:


Die Sammlung – Vielfalt der Formen und Funktionen
Die Auswahl der Fahrzeuge spiegelt die gesamte Breite der historischen Kutschennutzung wider. Neben den genannten höfischen Prunkwagen gehören dazu Schlitten, Kinderkutschen, Hochzeitskutschen, ein Leichenwagen sowie funktionale Nutzfahrzeuge. Jede Kutsche erzählt nicht nur von Fortbewegung, sondern auch von gesellschaftlichem Stand, Lebensweise und Zeitgeist.
Durch die Einbettung in inszenierte Szenen – von der Stadt über das Dorf bis hin zum Handwerksbetrieb – werden die Fahrzeuge in ihrem ursprünglichen Nutzungskontext erfahrbar. Der Besuch erschöpft sich nicht im Betrachten, sondern lädt zur Auseinandersetzung mit vergangenen Lebenswelten ein.
Vermittlung mit Tiefe
Das neue Kutschenmuseum versteht sich nicht als statisches Schaumagazin, sondern
Blick in die Ausstellung vom Kutschenmuseum Schloss Augustusburg Fotos: © Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH
als offenes Angebot zur Wissensaneignung. Die Kombination aus Objekt, Raum, Szene und Interaktion erlaubt unterschiedliche Zugänge – ob als Fachinteressierte, Familie oder Schulklasse. Der Einführungsfilm am Beginn bietet einen niederschwelligen Einstieg, die Rollenvergabe eröffnet Perspektivwechsel, und vertiefende Stationen fördern individuelle Interessen.
Die zurückhaltende Gestaltung vermeidet Überinszenierung und lässt der historischen Substanz den Vorrang. Der Vermittlungsansatz folgt nicht einem linearen Pfad, sondern ermutigt zu eigenem Entdecken.
Schloss Augustusburg – Mobilitätsgeschichte im Ensemble
Mit dem neuen Kutschenmuseum erweitert Schloss Augustusburg sein kulturelles Angebot um ein weiteres museales Highlight. Die Anlage bei Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas 2025, gilt als eines der schönsten Renaissanceschlösser Europas. Neben dem Schloss selbst mit seiner Schlosskirche –ausgestattet mit Altar und Kanzel aus der Werkstatt von Lucas Cranach dem Jüngeren – gehören der älteste Treibgöpel Sachsens, der zweittiefste Burgbrunnen des Landes
und das bereits etablierte Motorradmuseum mit über 170 Exponaten zur Anlage.
Die Verbindung von Kutschen- und Motorradmuseum eröffnet einen einzigartigen Blick auf 300 Jahre Mobilitätsgeschichte –von der Pferdekraft zur Pferdestärke, von der höfischen Karosse zum Industriefahrzeug.
Geschichte erfahren – als Bewegung durch die Zeit
Das neue Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg lädt dazu ein, die Geschichte der Fortbewegung in ihren vielen Facetten zu erkunden – sachlich fundiert, atmosphärisch dicht und zugänglich vermittelt. Es zeigt Mobilität nicht nur als technischen Fortschritt, sondern als Teil eines kulturellen Gedächtnisses.
Augustusburg / Scharfenstein / Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH
Schloss 1
09573 Augustusburg
Tel: +49 (0) 37291 / 38 00
www.augustusburg-schloss.de service@asl-schloesser.de

Luft konditionieren. Kunstschätze erhalten.
Seit über 130 Jahren sorgen wir für eine optimale Raumluft. Unsere Klimasysteme befeuchten, entfeuchten, heizen, kühlen und schützen in Museen und Galerien wertvolle Kunstwerke vor irreversiblen Schäden, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft entstehen können.
Welches System bei Ihnen eingesetzt wird, entscheiden Sie nach unserer eingehenden Beratung. Lassen Sie uns genau damit beginnen. Bei Ihnen vor Ort.
Ihr Partner für individuelle Klimatisierungskonzepte Luftbefeuchtung | Luftentfeuchtung | Heizung | Kühlung
Effizienz trifft Kultur – alles aus einer Hand
Die smarte Softwarelösung für Museen
De Haan IT: Digitale Innovation für den Museumsalltag
Museen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Besucherkomfort, Wirtschaftlichkeit und moderne Technik in Einklang zu bringen. De Haan IT unterstützt Kultureinrichtungen dabei, diesen Spagat zu meistern. Von der Ticketbuchung bis zur Buchhaltung – unsere maßgeschneiderten Softwarelösungen optimieren sämtliche Abläufe im Museumsbetrieb: effizient, transparent und zukunftssicher.
Alles in einem System
l Ticketverkauf online und vor Ort
l Gastronomie- und Souvenirverwaltung inklusive Bestandsführung
l Zutrittskontrolle für Besucher, Gruppen und Sonderausstellungen
l Gruppenführungen und Events einfach planen und buchen
l Berichte und Auswertungen, die keine Fragen offenlassen
l Rabattaktionen gezielt steuern und auswerten
l Einbindung, Verwaltung und Vermietung von Schließfachanlagen
l Mehr Überblick, weniger Aufwand
Alle Daten fließen zentral zusammen und können über detaillierte Berichte abgerufen werden – ideal für Buchhaltung und Steuerberatung. Die Software erfüllt selbstverständlich alle rechtlichen Anforderungen und wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Neue Dimension der Kontrolle
Mit der neuen App-Plattform stehen statistische Daten jederzeit und überall zur Verfügung. So lassen sich Besucherströme, Umsätze und Trends gezielt analysieren –für eine präzise Planung und nachhaltige Kosteneinsparungen.
Entlastung durch Automatisierung
Unsere Selbstbedienungskioske ermöglichen den Verkauf von Tickets oder Gastronomieartikeln direkt durch die Besucher – eine
Anzeige

ideale Lösung zur Entlastung des Personals oder als vollautomatisierte Alternative.
Persönliche Betreuung inklusive
Ein fester Ansprechpartner begleitet jedes Projekt – von der Analyse der aktuellen Situation bis zur individuellen Angebotserstellung. Viele Anliegen lassen sich bequem per Fernwartung lösen.
Eigener Webshop
Verzichten Sie zukünftig auf Drittanbieter und integrieren Sie unser System direkt auf Ihre Website als tatsächlichen Webshop. Es kann alles online angeboten werden und ist nicht abhängig von einem Provider.
Skalierbar und flexibel
Unsere Zahlungssysteme bieten eine vielfältige Funktionalität und sind einfach zu bedienen und nach Ihren Wünschen erweiterbar. Gerne denken wir diesbezüglich mit Ihnen mit. Weiter stehen wir Ihnen 24 Stunden an Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr sowohl remote als auch mit Vor-Ort-Support zur Verfügung.
So ermöglichen wir Ihnen sich ganz auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
Kassensystem, Ticketing, Zugangskontrolle und mehr
Vom regionalen Museum zur globalen Attraktion: Das Besuchererlebnis steht im Vordergrund. Bieten Sie Besuchern benutzerfreundliche Lösungen für Bestellung, Zahlung, Zugang und mehr. Kundenkarten scannen, Abonnements anbieten, Daten verwalten und Steigerung der Besucherbindung. De Haan IT hilft Ihnen dabei als „One-Stop-Shop“.
Jetzt Zukunft gestalten
In einem unverbindlichen Gespräch werden die Möglichkeiten für Ihr Museum analysiert und ein maßgeschneiderter Lösungsvorschlag präsentiert.
De Haan IT Deutschland GmbH Alt-Heerdt 104 40549 Düsseldorf kontakt@dehaanit.com www.elli-museum.de
Fotos: © canva.com
Zutritt
Zutritt
Zutritt
Zutritt




Zugangskontrolle über Drehkreuze
Zugangskontrolle über Drehkreuze
Zugangskontrolle über Drehkreuze
Zugangskontrolle über Drehkreuze
Parken
Parken
Parken
Parken
Problemloses Öffnen von Schranken Ihres Parkplatzes mit Barcode- oder Abo-Karte, Kennzeichenerkennung
Problemloses Öffnen von Schranken Ihres Parkplatzes mit Barcode- oder Abo-Karte, Kennzeichenerkennung
Problemloses Öffnen von Schranken Ihres Parkplatzes mit Barcode- oder Abo-Karte, Kennzeichenerkennung
Problemloses Öffnen von Schranken Ihres Parkplatzes mit Barcode- oder Abo-Karte, Kennzeichenerkennung
Statistiken
Statistiken
Statistiken
Statistiken
Umfassende Echtzeitdarstellung über z.B. Umsatz und Besucherzahlen
Umfassende Echtzeitdarstellung über z.B. Umsatz und Besucherzahlen



Umfassende Echtzeitdarstellung über z.B. Umsatz und Besucherzahlen
Umfassende Echtzeitdarstellung über z.B. Umsatz und Besucherzahlen
Rabatt-Aktionen
Rabatt-Aktionen

Rabatt-Aktionen
Rabatt-Aktionen
Rabatt als Betrag oder Prozentsatz, auch nach Debitoren
Rabatt als Betrag oder Prozentsatz, auch nach Debitoren
Rabatt als Betrag oder Prozentsatz, auch nach Debitoren
Rabatt als Betrag oder Prozentsatz, auch nach Debitoren

Gruppenbuchungen
Gruppenbuchungen
Gruppen einfach buchen
Gruppenbuchungen
Gruppenbuchungen
Gruppen einfach buchen
Gruppen einfach buchen
Gruppen einfach buchen
Selbstservice
Selbstservice
Selbstservice
Selbstservice
Selbstständig Zutritt oder Artikel erwerben und bezahlen
Selbstständig Zutritt oder Artikel erwerben und bezahlen
Selbstständig Zutritt oder Artikel erwerben und bezahlen
Selbstständig Zutritt oder Artikel erwerben und bezahlen
Gastronomie und Souvenirverkauf
Gastronomie und Souvenirverkauf
Gastronomie und Souvenirverkauf
Jahres- & Monatskarten
Jahres- & Monatskarten
Gastronomie und Souvenirverkauf
Jahres- & Monatskarten
Jahres- & Monatskarten
Ticketing
Ticketing
Ticketing
Ticketing
Online Ticketing mit direkter Anbindung an Ihr Kassensystem und optionaler Schnittstelle zu Dritten
Online Ticketing mit direkter Anbindung an Ihr Kassensystem und optionaler Schnittstelle zu Dritten
Online Ticketing mit direkter Anbindung an Ihr Kassensystem und optionaler Schnittstelle zu Dritten
Online Ticketing mit direkter Anbindung an Ihr Kassensystem und optionaler Schnittstelle zu Dritten
SCHNELL EINGEARBEITET SIND


GRABRAUB –Spurensuche durch die Jahrtausende
Retrospektive zur Sonderausstellung im Franziskanermuseum in Villingen-Schwenningen. Autor: Peter Graßmann
Warum werden Gräber geöffnet – und von wem? Diesen Fragen widmete sich das Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen in seiner großen Sonderausstellung „GRABRAUB – Spurensuche durch die Jahrtausende“, die von April bis Juli 2025 zu sehen war. Ausgangspunkt für die Themenwahl war der frühkeltische Großgrabhügel Magdalenenberg, dessen monumentale, 48 Quadratmeter große Zentralgrabkammer bereits in der Eisenzeit geplündert wurde und heute zu den zentralen Exponaten des Museums zählt. Die Beraubung wurde durch einen interkulturellen und interdisziplinären Vergleich in größere Zusammenhänge gestellt. Ziel war es, das vielschichtige Phänomen der Grabmanipulation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Der thematische Bogen
spannte sich von der mitteleuropäischen Ur- und Frühgeschichte über historische Plünderungen in Ägypten, China und Peru bis hin zu modernen Graböffnungen im ethnologischen und archäologischen Kontext.
Nach einer Einführung durch „Indiana Jones“, der stellvertretend für die Populärkultur ins Thema Grabfrevel einstimmte, begaben sich die Besucher auf eine chronologische Entdeckungsreise. In Ägypten begegneten sie Kanopengefäßen, Ushebtis und typischem Beutegut wie Schmuckbeigaben und lernten die „Grabräuber-Papyri“ der 20. Dynastie kennen. Aus ihnen lässt sich auf Täter und Motive schließen: Oft handelte es sich um Handwerker und Künstler, die selbst am Ausbau der Grabanlagen beteiligt waren. Auch in Mitteleuropa ver-
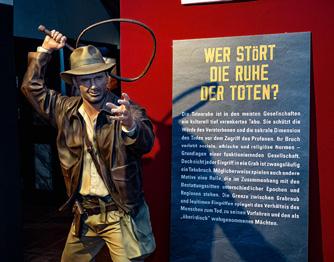
Linke Seite: Replik eines Terrakottakriegers aus China
Oben: Blick in den ägyptischen Ausstellungsbereich mit Leihgaben der Universität Tübingen und des Badischen Landesmuseums
Unten: Indiana Jones begrüßt die Museumsbesucher Fotos: © Hans-Jürgen Götz


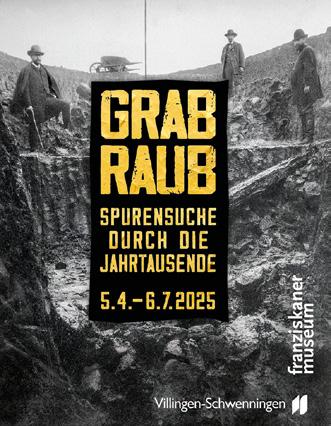
dichten sich seit der Mittleren Bronzezeit (ca. 1550–1300 v. Chr.) die Hinweise auf Grabraub. Funde aus geplünderten und ungeplünderten Bestattungen, etwa in Radolfzell-Güttingen oder Orsingen-Nenzingen, belegen dies. Ein Höhepunkt des Eisenzeit-Bereichs war der „Unlinger Reiter“, die älteste Reiterdarstellung Süddeutschlands, die 2016 im beraubten Zentralgrab von Grabhügel 3 bei Unlingen entdeckt wurde.
Nach einem Intermezzo in China – wo ein Terrakottakrieger über das legendäre Grab des Kaisers Qin Shihuangdi wachte – führte die Schau weiter in die römische Kaiserzeit und das Frühmittelalter.
Aus dieser Epoche stammen die eindrücklichsten archäologischen Belege für Grabraub. Besonders betroffen waren reiche Bestattungen der Merowingerzeit (5.–7. Jahrhundert); in manchen Gräberfeldern liegt der Anteil sekundärer Öffnungen bei über 90 Prozent. Spuren an Knochen aus Herrenberg und Remseck-Pattonville zeugen vom Einsatz langer Metallstangen, mit denen nach Hohlräumen sondiert wurde.
Links: Peruanische Grabgefäße der Chancay-Kultur, Leihgaben des BASA-Museum Bonn
Foto: © Hans-Jürgen Götz
Rechts: Plakatmotiv der Ausstellung

Doch nicht jeder Eingriff ins Grab ist ein Akt des Raubs. Dies verdeutlichte der ethnologische Vergleich. So pflegen die Toraja auf Sulawesi ebenso wie die Maya auf Yucatán die Tradition der Sekundärbestattung. Die Öffnung des Grabes dient hier nicht der Plünderung, sondern gilt als Ausdruck besonderer Ehrerbietung. Auch die übermodellierten Schädel aus Papua-Neuguinea sind in diesem Zusammenhang zu verstehen. Müssen vielleicht auch Eingriffe in ur- und frühgeschichtliche Gräber stärker unter rituellen und religiösen Gesichtspunkten betrachtet werden…?
Das letzte Ausstellungskapitel widmete sich dem Spannungsfeld zwischen Archäologie und Grabraub vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. In Peru konkurrieren bis heute Huaqueros und Denkmalschützer um begehrte Fundplätze, und mancher Schamane beschafft sich Zeremonialgefäße
Oben: Geplünderte Gräber beim Friedhof von Chauchilla, Peru. Foto: © Hans-Peter Grumpe
Rechts: Leichenräuber ("Body Snatchers") auf einem englischen Friedhof, 19. Jh.. Bild: Chris Hellier / Alamy Stock
Rechte Seite, Oben: Apothekengefäße Mumia © Dt. Apotheken Museum-Stiftung, Heidelberg. Foto: Claudia Schäfer, Mannheim
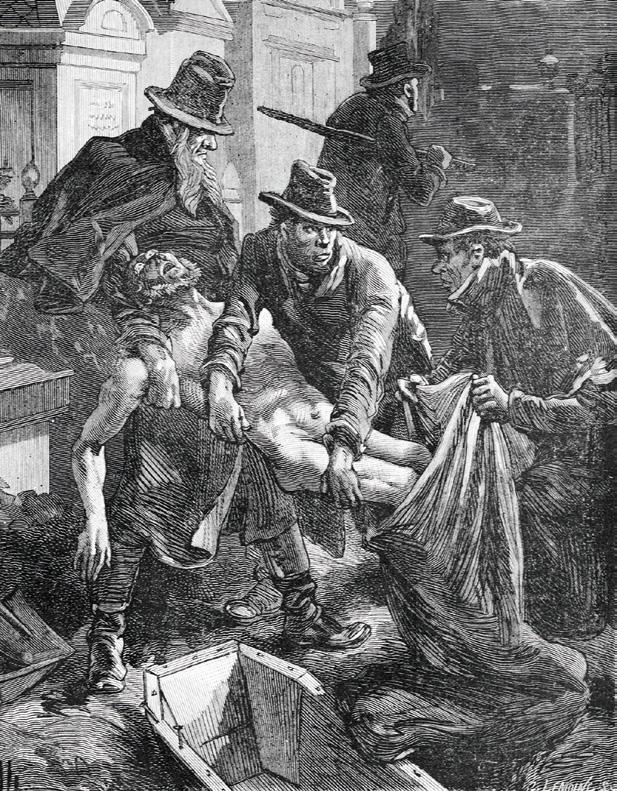
aus den Gräbern seiner Ahnen. In Italien agieren die „Tombaroli“ bandenmäßig und im großen Stil. Und auch in Deutschland sind nach Schätzungen bis zu 50.000 „Sondengänger“ aktiv, vor denen kaum ein Bodendenkmal sicher ist.

KI-AUDIOGUIDE von museum.de
Ein komplexes Thema also, das intensive Recherche und umfangreiche konzeptionelle Arbeit erforderte. Umso erfreulicher war es, dass sich der Audioguide, den Besucher kostenlos mit dem Smartphone herunterladen konnten, vergleichsweise schnell und kostengünstig realisieren ließ.
Das Franziskanermuseum hatte seinen Audioguide für die Dauerausstellung bereits auf die Server von museum.de übertragen und konnte daher das Angebot unkompliziert um die Sonderausstellung erweitern. Besonders eindrucksvoll war die sekundenschnelle Umwandlung von Texten in Audiobeiträge, die von KI-Stimmen eingesprochen und auf Wunsch automatisch übersetzt wurden.
So konnten auch Gruppen – etwa Schulklassen – die Schau selbstständig erkunden und zusätzliche Informationen abrufen.
Die Bedienung über QR-Codes und WLAN oder mobile Daten erwies sich als unkompliziert. Das Feedback war entsprechend positiv: Viele Besucher empfanden den Audioguide als große Bereicherung, zumal
die Lesbarkeit der Texte in den bewusst dunkel gehaltenen Räumen mit punktueller Beleuchtung nicht immer optimal war. Fest steht: Ohne das Angebot von museum.de hätte es wohl keinen Audioguide gegeben. Dank der unkomplizierten Umsetzung und der fairen Konditionen konnte er noch in der Schlussphase der Konzeption realisiert werden – als den Ausstellungsmachern zwischen Räubern, Plünderern, Schätzen, Fallen und Flüchen ohnehin schon der Kopf schwirrte.
Zur Sonderausstellung „GRABRAUB – Spurensuche durch die Jahrtausende“ erschien ein Begleitbuch, das die Themen aufgreift und vertiefend behandelt. Es ist zum Preis von 19 Euro über das Franziskanermuseum erhältlich.
Franziskanermuseum Rietgasse 2 78050 Villingen-Schwenningen Tel. 07721 / 82-2351 franziskanermuseum@villingen-schwenningen.de

l KI-Audioguides mit ultrarealistischen synthetischen Stimmen: Flexibel, wirtschaftlich und über das Backend von museum.de einfach zu erstellen
l Audioguide Hosting mit bereits bestehenden Audiofiles (Umzug)
l Virtuelle Museumsrundgänge in 3D kombinierbar mit Audioguide/Quiz
Wir beraten Sie gerne: museum.de / contact@museum.de Tel. 02801-9882072

Das Franziskanermuseum ist mit seinem bestehenden Audioguide auf die Plattform museum.de umgezogen. Für die aktuelle Sonderausstellung hat das Museumsteam in kurzer Zeit eigenständig einen zusätzlichen KI-Audioguide mithilfe der integrierten KI-Vertonung realisiert. Foto: © Franziskanermuseum




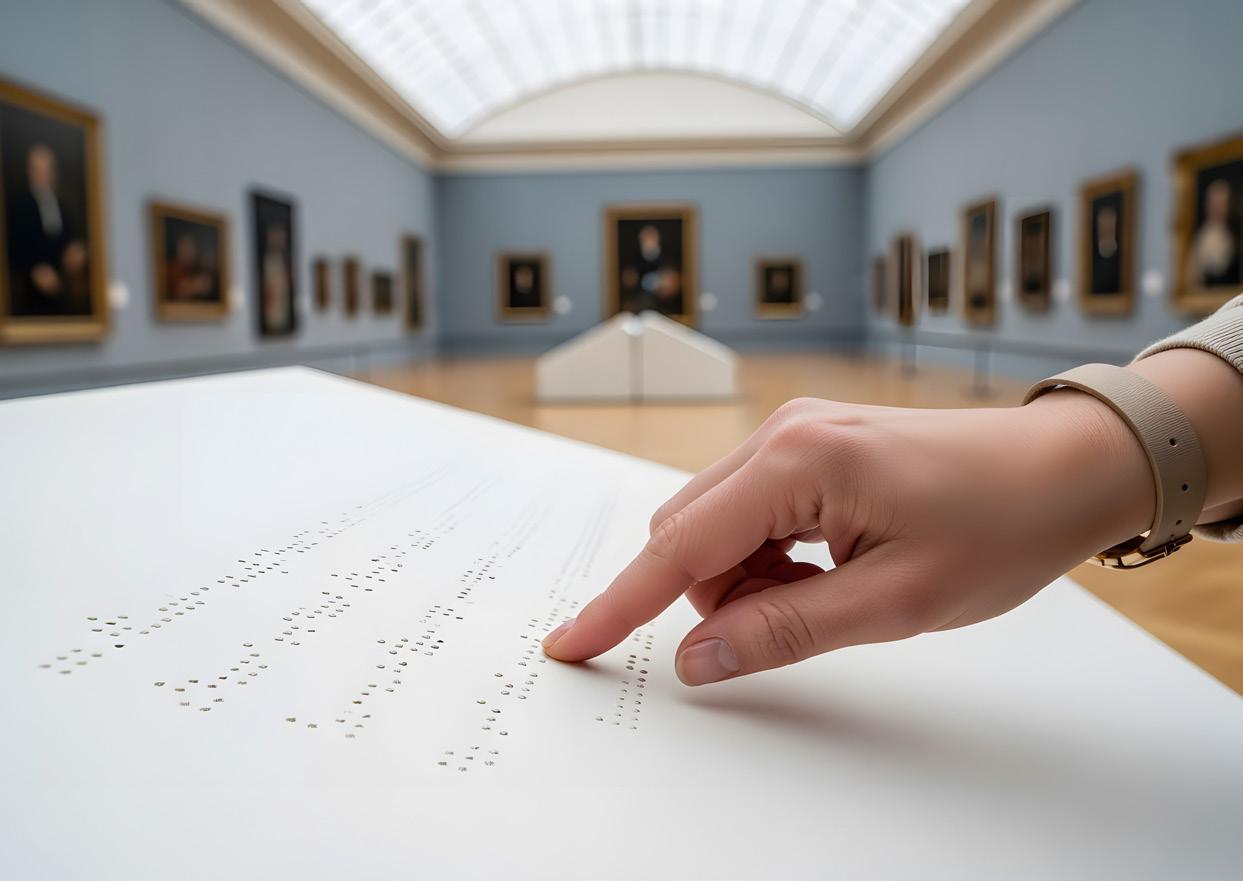
Barrierefreiheit in Museen –Kultur für alle, Schritt für Schritt
Ein Gemeinschaftsprojekt von der Deutschen Bahn und museum.de
Autor: Uwe Strauch, museum.de
Museen sind Orte, die Menschen zusammenbringen. Sie erzählen Geschichten, öffnen Horizonte und machen kulturelles Erbe erlebbar. Doch noch immer stoßen viele Besucherinnen und Besucher auf Hindernisse: Stufen am Eingang, fehlende Aufzüge, unverständliche Beschriftungen. Für Menschen mit Behinderungen bedeutet das oft, dass sie gar nicht erst am kulturellen Leben teilhaben können.
Deutsche Bahn und museum.de
Damit sich das ändert, haben die Deutsche Bahn und museum.de vor acht Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, das Barrierefreiheit in Museen sichtbar und planbar macht. Herzstück ist ein klar strukturierter Online-Fragebogen im Datenpflegebereich von museum.de, mit dem Museen ihre Angebote erfassen können.
Einfach und übersichtlich –ohne externe Hilfe
Ein wichtiger Vorteil: Der Fragebogen ist so gestaltet, dass er von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums selbst beantwortet werden kann. Es braucht keine externen Gutachter oder Dienstleister. Schritt für Schritt führen die Fragen durch alle relevanten Bereiche – von Eingängen über Ausstellungen bis hin zu Führungen.
Gerade diese Übersichtlichkeit macht es möglich, dass Museen unabhängig und unkompliziert ihre Daten pflegen können. Und das Beste: Der Zugang zum Backend von museum.de ist für alle Museen kostenlos.
Später können weitere Schritte folgen: taktile Leitsysteme, Beschriftungen in Braille, Führungen in Gebärdensprache. Der Fragebogen spiegelt genau diesen Weg wider – er ermöglicht es, bestehende Angebote transparent darzustellen und zukünftige Entwicklungen sichtbar zu machen.
Ein Nachschlagewerk, das mitwächst
Alle Angaben der Museen fließen in ein umfassendes Nachschlagewerk zur Barrierefreiheit ein. Dieses ist keine einmalige Drucksache, sondern wird als PDF in
Von der Rampe zum Gesamtkonzept Barrierefreiheit ist kein Zustand, den man von heute auf morgen vollständig herstellen muss. Vielmehr ist sie ein Prozess, der mit kleinen Maßnahmen beginnt. Vielleicht ist es zuerst nur eine Rampe am Eingang, die Menschen im Rollstuhl oder Eltern mit Kinderwagen den Zugang erleichtert.
regelmäßigen Abständen neu generiert. Dadurch bleibt es stets aktuell und bildet die neuesten Entwicklungen ab.
Mittlerweile umfasst das Nachschlagewerk bereits über 2.000 Seiten und steht sowohl bei der Deutschen Bahn als auch bei museum.de zum kostenlosen Download bereit. Besucherinnen und Besucher erhalten damit eine verlässliche Grundlage für ihre Reiseund Museumsplanung.
Und: Die Erhebung hat sich bewährt. Seit acht Jahren besteht sie nun und ist von Anfang an langfristig geplant. Barrierefreiheit ist kein Modethema, das einmal in den Schlagzeilen auftaucht und wieder verschwindet. Es ist und bleibt ein dauerhafter Auftrag an uns als Gesellschaft – und Museen leisten hier einen zentralen Beitrag.
Der Fragebogen im Überblick
Abgefragt werden unter anderem:
A. Allgemeine Voraussetzungen
l stufenloser Zugang oder Rampe
l Türbreiten
l Leitsysteme für sehbehinderte Menschen (taktil/akustisch)
l Bodenindikatoren, Markierungen von Stufenkanten
l Aufzüge mit akustischer Ansage oder taktiler Schrift
l barrierefreie Toiletten
B. Spezifische Voraussetzungen
l Beschriftungen in Piktogrammen oder Braille
l akustisch oder taktil zugängliche Exponate
l Printmaterialien in Braille oder Großdruck
l Tast-/Hörführungen, Führungen in Gebärdensprache
l taktile Bodenleitsysteme oder spezielle Audioguides
l pädagogische Programme für Besucher mit Lernschwierigkeiten
Was Barrierefreiheit für Menschen bedeutet
Für Menschen mit Behinderungen macht ein barrierefreier Museumsbesuch den entscheidenden Unterschied: Teilhaben statt ausgeschlossen sein. Kultur wird erlebbar, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Das stärkt Selbstbewusstsein, schafft Normalität und ermöglicht Begegnungen auf Augenhöhe.
Für Familien mit Kindern, ältere Menschen oder Besucher mit temporären Einschränkungen sind dieselben Maßnahmen ebenfalls eine enorme Erleichterung. Barrierefreiheit ist deshalb nicht nur eine Unterstützung für einige, sondern ein Gewinn für alle.
Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Mit dem Online-Fragebogen und dem Nachschlagewerk setzen Deutsche Bahn und museum.de ein deutliches Zeichen: Barrierefreiheit ist machbar, wichtig und für jedes Museum erreichbar.
Es geht nicht darum, sofort alles perfekt umzusetzen. Es geht darum, anzufangen – vielleicht mit einer Rampe – und den Weg Schritt für Schritt weiterzugehen. Jede Angabe im Fragebogen ist ein Beitrag zu mehr Transparenz, mehr Teilhabe und mehr Kultur für alle.
Download als PDF unter www.museum.de und www.bahn.de/service/individuelle-reise/barrierefrei/reiseziele
Foto Links: © Thomas Söllner - stock.adobe.com

Museen mit barrierefreien Angeboten
Inhaltsverzeichnis [3] Editorial [2] Museen [115] Updates [2013]
C. Sonstiges
l zusätzliche textuelle Hinweise, die über den Fragenkatalog nicht abgedeckt werden
Kooperationspartner
Anzahl Museen 1898
Anzahl Seiten 2014 Erstelldatum 06.10.25 11:41
Herausgeber museum.de Ostwall 2 46509 Xanten, Germany www.museum.de contact@museum.de Tel: +49 (0)2801-9882072
IC Bus - barrierefreier Einstieg über eine mitgeführte Rampe © Deutsche Bahn AG / Ralf Braum

Eine Ausstellung im Städel Museum vom 24. September 2025 BIS 1. Februar 2026
Carl Schuch und Frankreich
Carl Schuch (1846–1903) gehört zu den stillen Stars der Kunst des 19. Jahrhunderts – und doch ist er vielen unbekannt.
Seit dem 24. September beleuchtet das Städel Museum in der Ausstellung „Carl Schuch und Frankreich“ sein Werk im Kontext der französischen Malerei des Realismus und

Impressionismus. Schuch war ein rastloser Kosmopolit, der sich früh von nationalen Zuschreibungen löste und die Malerei zu seinem Lebensinhalt machte. Zwar blieb er zu Lebzeiten weitgehend unbeachtet, doch nach seinem Tod erkannte die Kunstwelt schnell die Qualität seiner
Arbeiten – bevor sie später beinahe wieder in Vergessenheit gerieten.
Ausstellungsansicht „Carl Schuch und Frankreich“ Foto: © Städel Museum – Norbert Miguletz
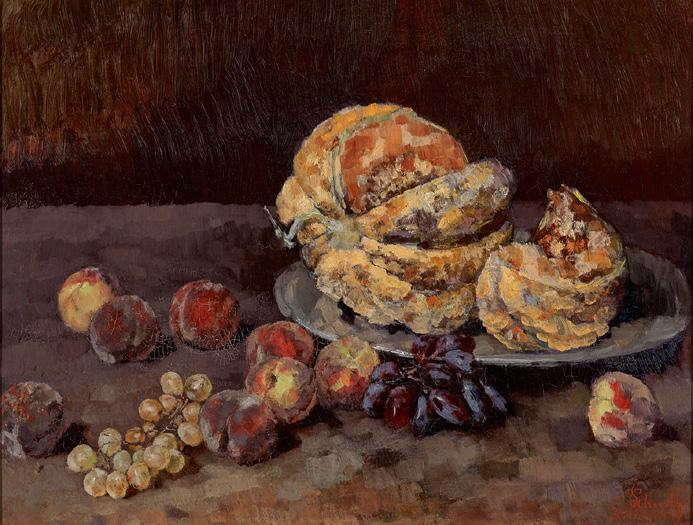



In der Ausstellung treten rund 70 seiner Gemälde in den Dialog mit etwa 50 Werken französischer Künstler wie Paul Cézanne, Camille Corot, Gustave Courbet, Édouard Manet und Claude Monet. Besonders eindrucksvoll sind Schuchs Pariser Jahre von 1882 bis 1894, die seine künstlerisch prägendste Phase markieren. Seine Arbeiten faszinieren durch stille Intensität: fein abgestufte Farbnuancen, ein sensibles Gespür für Licht und Atmosphäre und das konsequente Streben nach künstlerischer Wahrheit. Schuch blieb stilistisch frei und entwickelte eine unverwechselbare Bildsprache, die seine Werke sofort erkennbar macht.
Die Ausstellung zeigt Schuch nicht nur als herausragenden Maler, sondern auch als eigenständigen Beobachter Europas. Neu-
este kunsttechnologische Untersuchungen geben Einblicke in seine Arbeitsweise, machen die Entstehung seiner Kompositionen nachvollziehbar und öffnen frische Perspektiven auf sein Schaffen. Besucherinnen und Besucher können so Schuchs Leidenschaft für Farbe und seine akribische Suche nach Ausdruck und Tiefe hautnah erleben.
Die Ausstellung wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe, der Deutschen Leasing AG, der Frankfurter Sparkasse, dem Sparkassen-Kulturfonds des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, der Fontana-Stiftung, Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH sowie dem Städelschen Museums-Verein mit den Städelfreunden 1815. Weitere Förderung kommt von der Aventis Foundation und der Rudolf-August Oetker-Stiftung.
Philipp Demandt, Direktor des Städel Museums: „Carl Schuch zählt zu den eigenständigsten Künstlern des 19. Jahrhunderts. Er entzog sich jeder stilistischen Einordnung und hinterließ ein Werk von leiser, aber eindrucksvoller Energie. Seine Stillleben und Landschaften entfalten eine außergewöhnliche Anziehungskraft.
Links: Carl Schuch
Kürbis, Pfirsiche und Weintrauben, um 1884–1897
Öl auf Leinwand, 62 x 81 cm, Belvedere, Wien
Unten: Carl Schuch
Äpfel auf Weiß, mit halbem Apfel, um 1886–1894
Öl auf Leinwand, 63 × 79,5 cm, Frankfurt am Main, Städel Museum
Rechts: Ausstellungsansicht „Carl Schuch und Frankreich“
Foto: Städel Museum – Norbert Miguletz

Seine Malerei ist ein Fest für die Sinne, ein betörendes Wechselspiel aus Licht und Farbe. Schuchs kompromissloser Anspruch an die Kunst, sein Streben nach Tiefe und Wahrhaftigkeit, standen für ihn stets über öffentlicher Anerkennung.
Mit ‚Carl Schuch und Frankreich‘ präsentieren wir einen Künstler, der sich zeitlebens eingehend mit der französischen Malerei beschäftigte. Seine Gemälde behaupten sich mühelos neben Werken von Courbet, Manet oder Cézanne. Diese Ausstellung geht weit über eine Hommage hinaus. Carl Schuchs Malerei ist eine Entdeckung.“
Kuratoren Alexander Eiling, Juliane Betz und Neela Struck: „Carl Schuch verfolgte mit großer Be -

Ausstellungsansicht „Carl Schuch und Frankreich“ Foto: © Städel Museum – Norbert Miguletz harrlichkeit seinen künstlerischen Weg. In seinem Werk verbinden sich deutsch-österreichische Prägung und eine langjährige, intensive Auseinandersetzung mit der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts. Die Ausstellung lädt zum intensiven Schauen und Entdecken ein. In der Gegenüberstellung mit der französischen Moderne erschließen sich Schuchs befreiter Einsatz von Farbe und seine unverwechselbare Handschrift. Beides macht seine Malerei zu einer lohnenden Entdeckung. Carl Schuchs Motto lautete: ‚Selbst sehen und selbst finden‘ – dazu möchten wir auch die Besucherinnen und Besucher ermutigen.“
Ausbildung & Italien
Carl Schuch (1846–1903) entschied früh, Maler zu werden. Nach kurzem Studium an der Wiener Akademie lernte er beim Landschaftsmaler Ludwig Halauska, mit dem er ins Salzkammergut reiste. Erste Werke zeigen sein Gespür für Licht und Farbe. 1869 zog er nach Italien, wo der Kontakt zu Edmund Kanoldt seine Palette wärmer und toniger werden ließ – der Beginn einer eigenständigen Malweise.
München & Wanderjahre
Ab 1870 lebte Schuch in München, einem Zentrum realistischer Malerei. Hier begegnete er Wilhelm Trübner und Wilhelm Leibl. Der „Leibl-Kreis“ orientierte sich an Gustave Courbet und betonte einfache Motive und offene Pinselführung. Schuch unternahm zahlreiche Reisen und zeigte 1876 mit Äpfel und Birnen erstmals ein Stillleben öffentlich. Ende desselben Jahres zog er nach Venedig.
Venedig 1876–1882
In Venedig lebte Schuch mehrere Jahre zurückgezogen in einem Atelier in Dorsoduro. Dort entstanden detailreiche Stillleben wie Hummer mit Zinnkrug und Weinglas Er analysierte Werke anderer Maler und bereitete den Schritt nach Paris vor.
Mark Brandenburg
Gemeinsam mit seinem Freund Karl Hagemeister malte Schuch in den Sommern 1878–1881 in Ferch bei Potsdam. Die schlichte Landschaft erlaubte ihm, sich auf Licht, Raum und Komposition zu konzentrieren.
Begegnung mit französischer Kunst
Schon in Wien sah Schuch Werke der Schule von Barbizon. Später vertiefte er in Museen und Ausstellungen seine Kenntnisse moderner französischer Malerei, etwa von Courbet, Monet oder Millet. Auch weniger bekannte Künstler wie Jules Bastien-Lepage beeinflussten ihn.
Paris 1882–1894
In Paris experimentierte Schuch intensiv mit der Stilllebenmalerei. Obst, Gemüse oder Gefäße dienten ihm, um Farbklänge und Kontraste zu untersuchen. Wiederholt griff er das Motiv des Spargelbündels auf. Werke wie Atelier in Paris zeigen seine Konzentration auf die Malerei selbst.

Stillleben & Moderne
Schuch orientierte sich an Strömungen von akademischer Malerei bis Impressionismus. Ab 1885 sprach er von „coloristischen Handlungen“ – spannungsvolle Kontraste wie das Orange einer Melone gegen kühles Blau illustrieren seine Suche nach idealen Farbwerten.
Schuch & Cézanne
Zeitgleich zu Cézanne entwickelte Schuch ähnliche Stillleben-Kompositionen. Beide untersuchten Farbe und Form, unterschieden sich aber in der Malweise: Cézanne baute Flächen klar auf, Schuch malte freier und weicher.
Arbeitsweise
Schuch überarbeitete Bilder oft mehrfach. Analysen zeigen verborgene Bildschichten und Variationen – ein Beleg für seine experimentierende Arbeitsweise.
Jagdstillleben
In Venedig begonnen, entwickelte Schuch in Paris zahlreiche Jagdstillleben. Durch Austausch einzelner Objekte veränderte er gezielt die Farbwirkung. Er folgte damit einer Tradition, die Chardin und Manet geprägt hatten.
Am Saut du Doubs
Ab 1886 arbeitete Schuch in der FrancheComté. Hier entstanden monumentale Landschaften wie Waldinneres beim Saut du Doubs (1886–1893), die Licht und Farbe zu dichten Kompositionen verdichten – ein Höhepunkt seines Schaffens.
Wilhelm Leibl
Der Maler Carl Schuch, 1876 Öl auf Leinwand 58,5 x 50,5 cm München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, neue Pinakothek © bpk | Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Oben: Edouard Manet
Blumen in einer Kristallvase, ca. 1882 Öl auf Leinwand, 32,7 x 24,5 cm
Washington, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection. © Courtesy National Gallery of Art, Washington
Mitte: Carl Schuch
Waldinneres beim Saut du Doubs, um 1886-1893 Öl auf Leinwand, 150 x 200 cm, Belvedere, Wien
Unten: Carl Schuch
Der Rhododendronkorb („Der grüne Krug“), 1886–1894 Öl auf Leinwand, 61 x 78 cm
Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Neue
Meister, Dresden
© Albertinum | GNM, Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Jürgen Karpinski
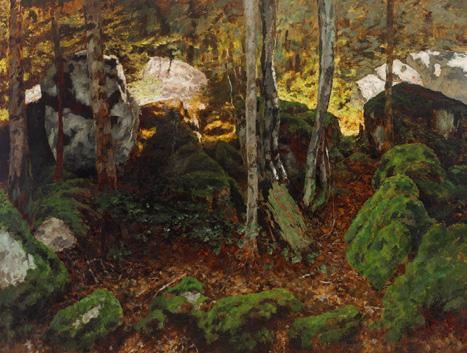





Oben: Ausstellungsansicht „Carl Schuch und Frankreich“
Foto: © Städel Museum – Norbert Miguletz
Links: Carl Schuch
Spargelbund, Glas und Tonkasserolle, um 1886–1894
Öl auf Leinwand, 79 × 63 cm
München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, neue Pinakothek
© bpk | Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Rechts: Gustave Courbet
Der Bach der Brême, 1866
Öl auf Leinwand
114 x 89 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Ein Rundgang durch die Ausstellung
Die Schau beginnt mit Schuchs intensiver Auseinandersetzung mit der französischen Kunst. Gegenüberstellungen mit Courbet, Cézanne und Monet zeigen, welche Impulse er aus Frankreich aufgriff und wie er sie für seine eigene Bildsprache nutzte.
Im ersten Abschnitt steht Schuchs Werdegang im Mittelpunkt. Nach kurzem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien nahm er Privatunterricht bei Ludwig Halauska. Ab 1869 reiste er durch Italien, Frankreich, Belgien und die Niederlande,
begegnete auf seinen Stationen Künstlern wie Wilhelm Trübner und Wilhelm Leibl und vertiefte sein Wissen um Landschaft und Licht. Zwischen 1876 und 1882 lebte er in Venedig, wo er ein großzügiges Atelier einrichtete und sein Können weiterentwickelte.
Der zweite Teil der Ausstellung beleuchtet Schuchs Pariser Jahre (1882–1894). In fünf Themenräumen werden seine bedeutendsten Werkgruppen präsentiert. Nach seiner Rückkehr nach Wien 1894 blieb er der Malerei treu, bis zu seinem Tod 1903. Die Ausstellung zeigt, dass Schuch sein Leben lang die französische Malerei studierte –

nicht nur die bekannten Künstler seiner Zeit, sondern auch heute kaum beachtete wie Jules Bastien-Lepage, Théodule Ribot oder Antoine Vollon. Werke von Schuchs Weggefährten, etwa aus dem Leibl-Kreis, ergänzen die Präsentation.
Der Blick auf die französische Moderne macht Schuchs Entwicklung als Maler deutlich: In Paris wurde sein Stil freier, offener und experimentierfreudiger in Farbwirkung und Komposition. Moderne kunsttechnologische Untersuchungen verdeutlichen seine analytische, präzise Arbeitsweise und die akribische Entwicklung seiner Bildideen. Die Ausstellung folgt Schuchs konsequenter Beschäftigung mit Farbe und zeigt die zentralen Stationen seines Werdegangs als Kolorist.
Städel Museum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt am Main Tel. 069-605098-200 info@staedelmuseum.de www.staedelmuseum.de
Oben: Ausstellungsansicht „Carl Schuch und Frankreich“
Foto: © Städel Museum – Norbert Miguletz
Unten, Kunst der Moderne, Städel Museum: Alexander Eiling (Sammlungsleiter)
Juliane Betz (stellv. Sammlungsleiterin), Neela Struck (wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Foto: © Städel Museum – Norbert Miguletz

ERSTELLEN SIE PROFESSIONELLE APPS FÜR BILDUNG UND VERMITTLUNG MIT DEM KULDIG AppCreator
FÜR iOS, ANDROID ODER ALS PWA
ÜBER 90 MODULE ZUR AUSWAHL, z.B. TOUREN, GAMIFICATION, AUGMENTED REALITY etc.
JETZT KOSTENFREI EINE APP MIT TOUR ODER RALLYE ERSTELLEN UND ALS PWA VERÖFFENTLICHEN.
