Arbeitspapier Künste & Demokratie
Ein Beitrag zur Entwicklung einer Programmatik für die Open Embassy for Democracy @ American Club
Von Evelyn Moser 1
Zusammenfassung:
Auf welche Weise lassen sich Demokra�e und Künste analy�sch aufeinander beziehen und zusammendenken? Der vorliegende Beitrag lotet dies aus, indem er die Inhalte von zwei Expert*innengesprächen mit Kunstschaffenden auswertet und reflek�ert, in denen das Konzept der Betä�gungsdemokra�e des poli�schen Philosophen Pierre Rosanvallon aus der Perspek�ve der Künste disku�ert wurde (Teil III). Vorbereitend zu dieser Auswertung erfolgt ein kurzer Überblick über die einschlägige Literatur zum Verhältnis zu Künsten und Demokra�e (Teil I), eine Einführung in die Grundbegriffe und Zusammenhänge des theore�sch-philosophischen Werks Rosanvallons und eine Erläuterung der hier relevanten Prinzipien Lesbarkeit, Verantwortung, Responsivität und Authen�zität (Teil II).
Inhalt:
I. Künste und Demokra�e: Varianten einer ambivalenten Beziehung 2
II. Das Konzept der Betä�gungsdemokra�e: Zum Verhältnis von Regierenden und Regierten 5
A. Theore�scher Kontext und Grundbegriffe 5
B. Betä�gungsdemokra�e als Aneignungs- und Vertrauensdemokra�e 7
III. Die Betä�gungsdemokra�e als Perspek�ve auf die Künste: Ein intellektuelles Experiment 10
A. Auswertung der Expert*innengespräche Künste 10
B. Reflexion zu Künsten und Demokra�e(theorie) 21
I. Künste und Demokra�e:
Varianten einer ambivalenten Beziehung
Fragt man nach Berührungspunkten und Rela�onen von Demokra�e und Künsten, offenbart sich eine Vielzahl an Beziehungsvarianten, die ebenso vielschich�g wie ambivalent sind. Zur Illustra�on genügt ein kursorischer Blick auf die einschlägige analy�sche Literatur, die sich entlang von zwei Leitaspekten ordnen lässt: Erstens dreht sich ein umfassender Literaturkorpus um die Leistungsbeziehungen zwischen Demokra�e (Poli�k) und Künsten. Im Fokus steht dabei die Frage, welche Leistungen – im weitesten Sinne – und demensprechend welchen Nutzen beide wechselsei�g füreinander tatsächlich erbringen, poten�ell erbringen sollten und/oder mit guten Gründen voneinander erwarten können.
Vor allem die Arbeiten, die sich mit Leistungen der Künste für die Demokra�e befassen, sind zahlreich und divers: Die Kunst, so wird dargelegt, lenkt Aufmerksamkeit auf Themen und gesellscha�liche Probleme, sie formuliert Ansprüche und Kri�k gegenüber der Poli�k. Kunstschaffende schlüpfen dazu in poli�sche Opposi�onsrollen oder versuchen, die Öffentlichkeit für poli�sche Ideen zu mobilisieren (vgl. die historische Rekonstruk�on in von Beyme 1998)
Durch die Kunst werden soziale Konflikte als Appell (auch) an die Poli�k ausgestellt. Bes�mmte Kuns�ormen sehen ihren wesentlichen und teils ihren primären Zweck im poli�schen Ak�vismus und inszenieren sich als poli�sche Interven�on (vgl. Sholete 2022; eine besonders radikale Posi�on vertrit Kikol 2023) Neben spezifischen Ar�kula�ons- und Mobilisierungsleistungen tragen künstlerische Prak�ken und ästhe�sche Erfahrungen zum Au�au einer demokra�schen Kultur bei. Den analy�sch-philosophischen Rahmen dazu entwarf Dewey 2 (2021 [1937], 2021 [1939]), der dabei speziell Kuns�ormen jenseits elitärer Ins�tu�onen hervorhebt. Entsprechende performa�ve und par�zipa�ve Formate beschreibt Zybok (2010). Kunst soll demokra�efördernde Beobachtungsweisen anregen (so etwa Brosda 2020) oder gar demokra�sche Erziehungsarbeit leisten (exemplarisch: Beuys). Rosanvallon (2015) benennt narra�ve Prak�ken als wich�ges Mitel, um erlebbare Gemeinscha�en zu schaffen, in denen der/die Einzelne als Individuum wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Diese Gemeinscha�en wiederum bilden das Fundament demokra�scher Ordnung.
Analysen zu jenen Leistungen, die umgekehrt die Demokra�e für die Kunst erbringt, lesen sich etwas nüchterner: Kunst braucht die Öffentlichkeit als Erscheinungsraum, so lautet hier ein zentrales Argument. Zugleich ist die Kunst aus sich heraus jedoch nicht in der Lage, diese Öffentlichkeit abzusichern oder gar gegen Übergriffe zu verteidigen. Diese Aufgabe weist Arendt (2016 [1968]) bereits mit Blick auf die An�ke der Poli�k zu. In der modernen Gesellscha� erfolgt dies durch entsprechende rechtliche Rahmungen, die Freiheitsräume für die Kunst definieren, absichern und im Zweifelsfall verteidigen (vgl. von Beyme 1998). Der Staat übernimmt in vielen na�onalen Kontexten mit Förderprogrammen, öffentlichen Kunsteinrichtungen u.ä. eine wich�ge Rolle für die Finanzierung von Kunst. Und schließlich scha� staatliche Poli�k in
2 John Dewey (1859-1952), amerikanischer Philosoph und Pädagoge und wichtiger Vertreter des Pragmatismus. Seine Arbeiten zu Kunst und Demokratie zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass er der unmittelbaren (ästhetischen und politischen) Alltagserfahrungen von Menschen einen herausragenden Stellenwert einräumt.
Form von Eigentums- und Schutzrechten die ins�tu�onellen Rahmenbedingungen für Verwertungszusammenhänge der Kunst (vgl. Becker 1982: Kapitel 6)
Ein zweiter Korpus empirischer und analy�scher Studien blickt weniger auf das Dazwischen, sondern vielmehr auf die Verschachtelungen von Demokra�e und Künsten. Entsprechende Arbeiten loten aus, auf welche Weisen Kunst und Demokra�e wechselsei�g ineinander vorkommen und welche Implika�onen sich daraus ergeben. Als Momente des Poli�schen in der Kunst lassen sich beispielsweise die wiederkehrenden Sezessionsbewegungen beschreiben, aber auch Selbsthema�sierungen und -reflexionen, wie sie beispielsweise Rancière (2009) für das Theater skizziert.
Andersherum finden sich in demokra�sch verfassten poli�schen Systemen Kunstmomente –dies fügt sich in Arendts (2016 [1968]) Beobachtung, dass Poli�k stets auf eine hergestellte (materielle) ästhe�sche Umwelt angewiesen ist, damit sie sta�inden kann. Auf diesem thema�schen Feld bewegt sich beispielsweise Reben�sch (1997) mit ihren theore�schen Überlegungen zum ästhe�schen Moment in der Poli�k. Stärker gegenstandsbezogen fragt Schönberger (2022) nach Varianten der theatralischen Inszenierung staatlicher Macht durch die Gestaltung von Parlamenten Scheuerle (2009) untersucht unter Kunstgesichtspunkten die Selbstdarstellungen deutscher Kanzler im Fernsehen. Schließlich lässt sich in diesem Zusammenhang noch ergänzen, dass Fik�onen – das Ausdrucksmitel der Kunst – durchaus ein übliches Element der Poli�k ist (Arendt 2016 [1969]) Dies gilt für jede poli�sche Ordnungsform, wird jedoch dann bedrohlich, wenn etwa in totalitären Regimen die Fik�on nicht mehr mit der Wirklichkeit rechnet und die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit verschwimmt (Arendt 2016 [1969]: 361)
Das große Verdienst der hier genannten Analysen und theore�schen Ansätze besteht zweifellos darin, dass sie Licht auf die vielfäl�gen Faceten des Verhältnisses von Kunst und Poli�k werfen, Spannungen benennen und damit wich�ge analy�sche Akzente in der Debate setzen. Der Zugriff auf die Beziehung erfolgt dabei jedoch meist asymmetrisch, Demokra�e und die Künste werden von Vornherein implizit oder explizit in ein Hierarchieverhältnis gesetzt. Eine ausgearbeitete Theorie, die sich das Verhältnis von Kunst und Poli�k zum Hauptanliegen macht und dabei beide konsequent symmetrisch aufeinander bezieht, fehlt bislang. Nach einen solchen Zugriff verlangt jedoch die Programma�k der Open Embassy for Democracy, um sie als einen Ort zu konzipieren, der Künste und Demokra�e auf Augenhöhe zueinander ins Verhältnis setzt und sich dabei sichtbar von der Vielzahl vergleichbarer Ins�tu�onen auf diesem Feld unterscheidet. 3
Vielversprechende Impulse aus der poli�schen Philosophie dazu finden sich in Arendts Aufsatz zu Kultur und Poli�k (Arendt 2016 [1968]). Wich�ge gesellscha�stheore�sche Denkanstöße bietet darüber hinaus das Werk Luhmanns, in dessen differenzierungstheore�schen Ansatz der systema�sche, symmetrische Vergleich von Kunst und Poli�k bereits architektonisch angelegt ist (Luhmann 1995, 2008). Beide – Arendt und Luhmann – werden im Folgenden eine Rolle
3 Vgl. z.B. die Zusammenschau bestehender Demokratiezentren in der Konzeptstudie Demokratiezentrum Paulskirche „Haus der Demokratie“ in Frankfurt am Main (Deitelhoff et al, https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/Konzeptstudie_Demokratiezentrum_Paulskirche_barrierefrei.pdf).
II. Das Konzept der Betä�gungsdemokra�e: Zum Verhältnis von Regierenden und Regierten
Rosanvallons demokra�etheore�sches Denken bewegt sich in einer Theorietradi�on, die unter anderen auf Arendt (2019 [1972], 1993) und Lefort (1990b) zurückgeht. Daraus folgen einige grundbegriffliche Besonderheiten, die zu klären sind (Abschnit A), um im Anschluss daran Rosanvallons Perspek�ve nachzuvollziehen (Abschnit B).
A. Theore�scher Kontext und Grundbegriffe
Poli�k & das Poli�sche, Öffentlichkeit, Pluralität // Ein wich�ger Schlüssel zur Analy�k Rosanvallons ist ein Verständnis des Poli�schen, das in der jüngeren poli�schen Theorie als „poli�sche Differenz“ Widerhall findet und dessen Ursprung (auch) bei Arendt 5 zu finden ist. Das Wesen der Poli�k, so die Grundidee, lässt sich nur in einer Doppelbedeutung angemessen erfassen, die in der begrifflichen Trennung von der Poli�k (la poli�que) und dem Poli�schen (le poli�que) gründet. Die Politik umfasst den ins�tu�onalisierten Teil poli�scher Systeme, d.h. vor allem Staatlichkeit und formalisierte Herrscha�sstrukturen. Das Politische trägt der Beobachtung Rechnung, dass sich Poli�k nicht in Formalstrukturen erschöp�, sondern jenseits dessen immer auch eine „Existenzweise des Zusammenlebens als auch eine Form kollek�ven Handelns“ ist (Rosanvallon 2011: 47; vgl. auch Lefort 1990a). Arendts (1993: 11) Verständnis des Poli�schen entspricht dieser Doppelbedeutung und rückt nicht den Staat, sondern die Menschen selbst in den Mitelpunkt: „Es gibt [.] keine eigentlich poli�sche Substanz. Poli�k entsteht im Zwischen und etabliert sich als der Bezug.“ In Anlehnung an das Ideal der an�ken Polis en�altet sich für Arendt das Poli�sche, wenn Menschen in ihrer Pluralität als Gleiche aufeinander treffen und sich mit Blick auf die Gestaltung des Gemeinsamen (oder Gemeinwesens) – in Abgrenzung zum Privaten – mit unterschiedlichen Perspek�ven und Meinungen argumenta�v auseinandersetzen, ohne dass spezifische Posi�onen oder Kriterien im Vorhinein als dominierend feststehen (Arendt 1993: 38f). Poli�sches Handeln vollzieht sich öffentlich auf einer „immerwährende[n] Bühne“ (Arendt 2019 [1972]: 249), auf der alle Beteiligten füreinander erkennbar sind und auf der das, was geschieht, für alle sichtbar und hörbar ist. Nur dem Öffentlichen kommt für Arendt Wirklichkeit zu, nur dort können sich im Prozess der öffentlichen Diskussion und des Austauschs Meinungen bilden. Das Private hingegen bleibt im Schaten und außerhalb des weltlich Gemeinsamen (Arendt 2019 [1972]: 62ff).
Freiheit und Notwendigkeit // Nach Arendts Auffassung ist das Poli�sche kein Instrument zur Erfüllung extern verordneter Zwecke, sondern der Inbegriff von Freiheit, die Arendt vor allem als Freiheit zur Poli�k und damit zur (Mit-)Gestaltung des Gemeinwesens versteht. Diese Freiheit endet, wo Gehorsam und im Extremfall Zwang an die Stelle der argumenta�ven und gewal�reien Auseinandersetzung treten (Arendt 1993: 38f). Gestaltungsräume werden in dieser
5 Hannah Arendt (1906-1975), jüdische deutsch -amerikanische politische Theoretikerin und Philosophin. Eine kompakte und allgemeinverständliche Zusammenfassung von Arendts Politikverständnis bietet Llanque (Llanque 2020).
Perspek�ve durch nicht verhandelbare Notwendigkeiten begrenzt, die das Poli�sche durch die Herrscha� von Sachzwänge beschränken oder ganz verdrängen: je umfassender und zwingender die Kriterien für kollek�v verbindliches Entscheiden aus Notwendigkeiten abgeleitet werden, desto deutlicher werden Pluralität und Konflikte, die den Kern des Poli�schen ausmachen, zu Störfaktoren.
Demokra�e // Vor diesem Hintergrund versteht Rosanvallon Demokra�e nicht nur als Regierungsform, d.h. als ein Set formaler poli�scher Ins�tu�onen samt rechtlich fixierter Spielregeln. Vielmehr begrei� er sein eigenes theore�sches Werk als Suchbewegung in Richtung eines erweiterten Demokra�ebegriffs, wobei er von Demokra�e als einer Gesellscha�sform ausgeht. Maßgeblich für demokra�sche Gesellscha�en war ursprünglich (d.h. Anfang des 19. Jahrhunderts) vor allem die Gleichheit der Rechte (Schulz 2016: 105f). Inzwischen – und „origineller“ – beschreibt Rosanvallon Demokra�e als eine Gesellscha� der einander Ähnlichen, deren Mitglieder unter eben dieser Prämisse zueinander in Beziehung treten und sich poli�sch miteinander auseinandersetzen. Welche Formen im Prozess dieser Auseinandersetzung entstehen, sich transformieren, wieder zerfallen und durch andere ersetzt werden, ist grundsätzlich offen. Demokra�e, auch dies betont Rosanvallon, ist ein strukturell unabgeschlossenes Unterfangen (Schulz 2016: 105f; vgl. auch Rosanvallon 2019): Sie ist unablässig auf der Suche nach sich selbst, befragt sich permanent zu ihrer eigenen Unvollständigkeit und versucht diese zu bekämpfen. Wesentlich ist, dass dabei stets Selbstwiderspruch zugelassen wird, der sich wiederum auf vielfäl�ge Weise ins�tu�onalisieren kann (vgl. zur Selbstwidersprüchlichkeit von Demokra�e auch Teubner 2018). Akzep�ert man mit Rosanvallon die Unbes�mmtheit als kons�tu�ves Moment der Demokra�e, folgt daraus, dass sich das eine rich�ge Modell demokra�scher Ordnung niemals fixierten lässt – ihre Stabilität findet die demokra�sche Gesellscha� im Wandel und in ihrer Fähigkeit, unablässig aus der eigenen Vergangenheit Reflexions- und Lernpoten�al für die Zukun� zu schöpfen.
Regierung und kollek�v bindendes Entscheiden // Mit ihrer eigenen Unbes�mmtheit, so lässt sich ergänzen, fügt sich die demokra�sche Ordnung in die Grundstruktur der Moderne, die ihrerseits von Perspek�venvielfalt, Konfliktha�igkeit und Unbes�mmtheit geprägt ist (vgl. Rasch 2005: Kapitel 1) Demokra�e versucht, in dieser Unbes�mmtheit ordnend zu wirken, indem Kontroversen über das Gemeinsame ausgehandelt und diese Aushandlungen in kollek�v verbindende Entscheidungen münden. Der Regierung trit dabei als im besten Fall als Reflexionsinstanz in Erscheinung, die dazu beiträgt, die Vielheit auf eine Einheit zu bringen und „jegliche Form des Antagonismus, des Unverständnisses, des Missverständnisses in der Gesellscha� zu überwinden oder ihnen eine auf Dauer gestellte Form zu verleihen“ (Rosanvallon in Schulz 2016: 115). Ihre Entscheidungen können herausgefordert oder zum Ausgangspunkt für neue Konflikte und Aushandlungen werden, stellen jedoch temporäre Fixierungen unter der Bedingung von Unbes�mmtheit dar.
Kunst // An dieser Stelle lässt sich zwanglos eine analy�sche Verbindung zur Kunst herstellen. Die Kunst steht für Rosanvallon selbst nicht im Fokus seiner Überlegungen, ist für seinen theore�sch-philosophischen Zugang aber gleichwohl wich�g, wie zum Beispiel in seinen Überlegungen zur narra�ven Demokra�e erkennbar ist (Rosanvallon 2015) Als analy�sche Ergänzung
bietet sich die Perspek�ve Luhmanns 6 (1995, 2008) an, dessen gesellscha�stheore�scher Zugang unterschiedliche Gesellscha�sbereiche gemeinsam und vergleichend in den Blick nimmt und systema�sch aufeinander bezieht. Mit Blick auf die Kunst fällt dabei zunächst eine Parallele zur Demokra�e (oder demokra�schen Poli�k) auf: Auch für die Kunst, so betont Luhmann, ist Unbes�mmtheit kons�tu�v In einer Gesellscha�, in der es keine allgemeinverbindliche Darstellung der Welt (mehr) gibt, d.h keine für alle gül�ge Gesamterzählung und keinen einheitlichen Standort der Weltbeobachtung, schär� die Kunst die Sensibilität für die Beobachtungen anderer Beobachter (Luhmann 2008: 313ff) Und ebenso wie die Poli�k operiert die Kunst in ihrem Umgang mit Unbes�mmtheit mit temporären Fixierungen: Das Kunstwerk steht am Ende einer Entscheidungskete des Künstlers oder der Künstlerin und präsen�ert sich einem Publikum.
Zugleich zeigt sich speziell im Umgang mit Unbes�mmtheit eine wich�ge Differenz der Kunst zu Poli�k und Demokra�e: Die Kunst möchte ihre gesellscha�liche Umwelt nicht ordnen. Statdessen spielt sie mit Unbes�mmtheit und erzeugt am Kunstwerk unablässig neue Ungewissheit. Die Kunst muss sich auf nichts festlegen, sondern darf und soll experimen�eren und überraschen – S�lrichtungen, Techniken etc. können verwendet, variiert und wieder verworfen werden, ohne dass dies Folgen erzeugt. Was hat die Kunst der modernen Gesellscha� dabei zu sagen? Sie bietet weder Imita�on noch Kri�k, so betont Luhmann (2008: 426ff). Schließlich würde beides voraussetzen, dass sich die Gesellscha� in einer Idealform s�lisieren lässt und die Kunst um diese Idealform weiß – mithin: dass Ungewissheit negiert wird. Die Funk�on der Kunst ist radikaler. Mitels ihrer Fik�onen konfron�ert sie die Gesellscha� mit Möglichem. Sie produziert und präsen�ert Modelle der Gesellscha� und die Gesellscha� realisiert dann ihrerseits das, „was in der Kunst exemplarisch und in gewisser Weise geschützt durch Folgenlosigkeit vorgestellt wird“ (Luhmann 2008: 427). Die sinnliche und kogni�ve Wahrnehmung kann die Kunst dabei als „Sicherheitsspende“ nutzen, indem sie gesellscha�lich etablierte (und kulturell variierende) Wahrnehmungsprak�ken und -erwartungen für ihre Kommunika�on in Anspruch nimmt. Der Rezipient, die Rezipien�n weiß um die künstlerische Fik�on, aber „es ist eben, wie wir es sehen“ (Luhmann 2008: 423). Im Effekt wirkt die Kunst als Entzifferung der Gesellscha�, wodurch Gesellscha� ihrerseits zugleich geformt (irri�ert) wird und in Erscheinung trit.
B. Betä�gungsdemokra�e als Aneignungs- und Vertrauensdemokra�e
Ausgangspunkt und Mo�va�on für die Gedanken zur gegenwär�gen Demokra�e, die Rosanvallon in seinem Werk „Die gute Regierung“ entwickelt, ist die Beobachtung einer (fak�schen) Präsidialisierung demokra�scher Regime (Rosanvallon 2016: 99ff). Seit Jahrzehnten, so die These, zeichne sich ein Paradigmenwechsel demokra�schen Regierens ab, im Zuge dessen die
6 Niklas Luhmann (1927-1998), deutscher Soziologe, Gesellschaftstheoretiker und ein Hauptvertreter der soziologischen Systemtheorie. Luhmanns gesellschaftstheoretischer Ansatz zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass er ein begriffliches Instrumentarium entwickelt, um einzelnen Gesellschaftsbereiche (Kunst, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft etc.) sowohl jeweils separat in ihren eigenen Rationalitäten und Strukturen zu rekonstruieren als auch im Verhältnis zueinander zu reflektieren.
Legisla�ve schleichend an Bedeutung verliere und von der Exeku�ve dominiert werde. Auch ohne formale Präsidialisierung sei die vollziehende Gewalt diejenige, „von der die Bürger und Bürgerinnen erwarten, dass sie die Bedingungen ihres beruflichen und privaten Lebens posi�v gestaltet. Sie verlangen also von ihr, dass sie „sowohl tatkrä�igen Einsatz zeigt als auch für ihre Handlungen einsteht” (Rosanvallon 2016: 14) Die „Ursprungsvision der modernen Demokra�e” (Rosanvallon 2016: 15), deren Kern die Gesetzgebung und die Repräsenta�on der Bürger in der Legisla�ve ausmachen, kehre sich damit in ihr Gegenteil um. Demokra�etheore�sch erfordert diese Entwicklung eine Aufmerksamkeitsverschiebung. Zwar en�ällt keinesfalls die Bedeutung von Wahlen als Mechanismus demokra�scher Herrscha�slegi�ma�on. Eine Sakralisierung der Wahl, die nach wie vor den demokra�etheore�schen Blick prägt, erscheint jedoch zunehmend unangemessen, um sich der Wirklichkeit demokra�scher Ordnungen auf angemessene Weise zu nähern. Gute Regierung, so Rosanvallons Argument, lässt sich nicht mehr allein über das Konzept einer Genehmigungsdemokra�e erfassen, die sich primär um die Erteilung von Mandaten durch Wahlen und damit um das Verhältnis von Repräsentanten und Repräsen�erten dreht. Eine Demokra�e kann vielmehr nur dann funk�onieren, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger durch die formale Poli�k gesehen, gehört und wahrgenommen fühlen – eine Form von Anerkennung, die sich durch Wahlen und repräsenta�onsgebundene demokra�sche Legi�mität allein nicht einlösen lässt. Neben den Bürgern als Wählern, die über die Auswahl von Personen und Themen für die Poli�k entscheiden, braucht es folglich ein Instrumentarium, dass die Bürger als Regierte erfasst, die von Regierung und staatlichen Verwaltungsorganisa�onen behandelt werden (vgl. auch Luhmann 2009 [1980]: 148). Rosanvallon schlägt an dieser Stelle die Ergänzung der Genehmigungsdemokra�e um das Konzept einer Betä�gungsdemokra�e vor, welche das Verhältnis von Regierenden und Regierten in den Vordergrund rückt. Entsprechend seiner Perspek�ve einer Ex-Post-Norma�vität – der Herleitung norma�ver Standards auf historischem Umweg – emergiert dieses Konzept aus der Suche nach Prinzipien, die sich aus der Vergangenheit der Demokra�e selbst des�llieren lassen (Rosanvallon 2019: 24). Sie lassen sich wiederum an die gegenwär�ge Situa�on und den jüngsten Wandlungsprozess herantragen. Die Absicht und das Ziel bestehen darin, diesen Prozess im Sinne einer demokra�schen Gesellscha� zu reflek�eren und zu gestalten – und wohlgemerkt nicht: ihn im Hinblick auf einen imaginierten Idealzustand demokra�scher Ordnung rückgängig zu machen. Aus diesen Überlegungen heraus en�altet Rosanvallon die Betä�gungsdemokra�e in zwei (Teil-)Dimensionen: Als Aneignungsdemokra�e und als Vertrauensdemokra�e.
Drei norma�ve Prinzipien, die sich auf das Verhältnis von Regierenden und Regierten richten, fasst Rosanvallon unter dem Begriff der Aneignungsdemokra�e zusammen: Lesbarkeit, Verantwortlichkeit, Reak�vität.
- Das Prinzip der Lesbarkeit setzt Informa�on, Sichtbarkeit, Transparenz und häufig auch Messbarkeit voraus, erschöp� sich darin jedoch nicht. Vielmehr steht Lesbarkeit im Verhältnis von Regierenden und Regierten für ein ak�ves Interpreta�onsverhältnis. Nur lesbare Poli�k können sich die Regierten aneignen, Unlesbarkeit führt hingegen zu En�remdung, Ablehnung und Pseudora�onalisierungen.
- Verantwortung ist die „Schuld, die das Vermögen jeder Macht ausgleicht” (Rosanvallon 2016: 227). Gegenüber der Vergangenheit nimmt Verantwortung die Form von Rechenscha�spflichten an, gegenüber der Zukun� erscheint sie im Ausdruck des Willens und der Fähigkeit, Veränderungen herbeizuführen. Als Fik�on, die dazu beiträgt, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu bewahren, ist poli�sche Verantwortung in Demokra�en nicht vollumfänglich formalisierbar und impliziert stets ein moralisches Moment.
- Das Prinzip der Reaktivität bezeichnet die Fähigkeit der Regierenden, sich in das gesellscha�liche Bedürfnissystem einzufühlen und selbst zum Teil dieses Bedürfnissystems zu werden. Reak�ves Regieren macht sich das Volk in der Vielfalt seiner sozialen Lagen präsent und scha� dafür gezielt formale Mechanismen und Interak�onsräume (Rosanvallon 2016: 267f). Unter Verweis auf Waldenfels (2015, 1994) lässt sich Reak�vität mit dem phänomenologischen Konzept der Responsivität verbinden, das ein Antworten bezeichnet, welches „auf Fremdes eingeht und dem Abweichenden und Abwesenden Raum gewährt“ (Waldenfels 1994: 77). Von responsivem Verhalten gehen vor allem dann interessante Impulse aus, wenn es den von der Frage implizierten Bezugsrahmen überschreitet oder wenn Antworten auf Fragen formuliert werden, die (noch) nicht gestellt wurden (vgl. das Konzept des außerordentlichen Antwortens in Waldenfels 2015).
Eine zweite Dimension der Betä�gungsdemokra�e ist für Rosanvallon die Vertrauensdemokra�e. Hier geht es nicht um das Dazwischen, das prak�zierte Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten. Im Fokus stehen komplementär dazu die Qualitäten der Regierenden selbst, auf deren Grundlage ein Vertrauensverhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt erst gedeihen kann: Integrität und Wahrsprechen
- Mit Wahrsprechen bezeichnet Rosanvallon „eine radikale Form des Einsatzes für ein Gemeinwesen, der Verknüpfung zwischen einer privaten Existenz und einem kollek�ven Schicksal“ (Rosanvallon 2016: 306) – oder niederschwelliger und bezogen auf normale, nicht-schicksalha�e Zeiten: die Aufrich�gkeit der Regierenden. Als Selbstzweck in Demokra�en steht das Wahrsprechen betont im Gegensatz zur Rhetorik als Kunst der Rede und Mitel zum Zweck, um ein Publikum zu überzeugen, mit Worten zu fesseln, seinen Geist zu beherrschen (Rosanvallon 2016: 294f). Gegenpol des Wahrsprechens ist das Falschsprechen, das bewusst eine verzerrte Welt erzeugt, die Zuhörer von der Realität en�remdet und auf diese Weise den Verfallsprozess des Poli�schen befördert.
- Die Integrität steht für die persönliche und moralische Eignung einer Person für ein poli�sches Amt und die Glaubwürdigkeit, dass im Sinne des Gemeinwohls gehandelt wird. Für die Beurteilung von Integrität brauche es „instrumentelle Transparenz“, das Recht der Bürger auf Kontrolle der Regierenden, das jedoch stets vom „Recht des Idividuums auf Intransparenz“ und dem Schutz der Privatsphäre zu trennen ist – auch dann, wenn die Grenze in der Praxis schwer zu bes�mmen sein mag (Rosanvallon 2016: 327ff).
III. Die Betä�gungsdemokra�e als Perspek�ve auf die Künste:
Ein intellektuelles Experiment
Rosanvallon zielt mit seinem Konzept der Betä�gungsdemokra�e auf die Reflexion demokra�scher Ordnung angesichts einer zunehmenden Dominanz der Exeku�ve. Als Reflexionsinstrument taugt es jedoch auch für die Kunst. Dafür sprechen die oben angedeuteten Wesensähnlichkeit beider, ihre inhärente Unbes�mmtheit und zugleich ihre �efe Verankerung in Prozessen der Selbstbeobachtung und Selbsthema�sierung von Gemeinwesen auf der Suche nach einer inneren Ordnung – auch wenn beide, Demokra�e und Kunst, dabei deutlich unterschiedliche Perspek�ven einnehmen und verschiedene Effekte zei�gen. Ergänzen lässt sich, dass für Demokra�e und Kunst die Beziehungen zu ihren jeweiligen Publika wesentlich ist: In der Demokra�e in Form des Verhältnisses von Regierenden und Regierten, in der Kunst über Rela�onen zwischen Kunstschaffenden und Rezipienten. Dies führt unmitelbar zu der Frage einer fruchtbaren und konstruk�ven Gestaltung dieser Beziehungen – und zu der Beobachtung, dass Aneignung, wechselsei�ges Vertrauen und ein ak�ves, interven�onsbereites Publikum in Demokra�e und Kunst gleichermaßen vorgesehen und erwünscht sind.
Nicht obwohl, sondern gerade weil Rosanvallons Prinzipien und Begriffe nicht mit Blick auf die Kunst entworfen wurden, versprechen sie ungewöhnliche Lernimpulse und produk�ve Irrita�onen jenseits eingeübter Debaten. Im besten Fall ergibt sich ein Verfremdungseffekt für beide – Kunst und Demokra�e –, der dabei hil�, Neues sichtbar zu machen und bislang wenig Beachtetes hervorzuheben und auf diese Weise Anhaltspunkte für konkrete Projekte zu benennen. Und schließlich bilden die Prinzipien der Betä�gungsdemokra�e einen Rahmen, innerhalb dessen sich Kunst und Demokra�e symmetrisch zueinander in ein Verhältnis bringen lassen, ohne dabei Hierarchie vorauszusetzen. Dies wiederum ist die Bedingung für Distanzvaria�onen, Dialog und wechselsei�ge Irrita�onen auf Augenhöhe, die nicht in einsei�gen Belehrungen münden, sondern Lerngelegenheiten für beide bereithalten. Gerade hieraus ergibt sich das große Poten�al der Prinzipien Rosanvallons als inhaltliche Bojen für die Programma�k der Open Embassy for Democracy
A. Auswertung der Expert*innengespräche Künste
Um einen ersten Bogen von der Theorie in die Praxis zu schlagen und dieses Poten�al zu konkre�sieren, wurde die Anschlussfähigkeit von Rosanvallons Konzept der Betä�gungsdemokra�e in den Künsten im Rahmen von zwei Expert*innengesprächen mit Kunstschaffenden aus verschiedenen Bereichen ausgelotet. Dazu wurden die Begriffe Lesbarkeit und Verantwortung direkt aus der Theorie Rosanvallons übernommen, Reak�vität wurde durch den analy�sch umfassenderen Begriff der Responsivität ersetzt, Wahrsprechen und Integrität wurden im Begriff Authen�zität gebündelt. Die Aufgabenstellung für die Beteiligten sah vor, die vier Begriffe aus der Perspek�ve der Kunst zu reflek�eren, Bezüge zum eigenen künstlerischen Schaffen herzustellen, Deutungsvarianten zu disku�eren und Implika�onen für die Kunst zu erörtern. Niemand von den Beteiligten war zuvor mit der poli�schen Theorie Rosanvallons vertraut, so dass
der Austausch in dieser Hinsicht unvoreingenommen erfolgte und nicht an Interpreta�onsvorgaben anknüp�e.
In einem ersten Gespräch am 19. Oktober 2022 kamen drei Vertreter*innen der bildenden Künste in der Montag S��ung Kunst und Gesellscha� zusammen und tauschten sich in einem vierstündigen Gespräch über die Begriffe aus. Die zentralen Inhalte der Diskussion wurden in einem schri�lichen Protokoll und graphisch festgehalten. Das zweite Expert*innengespräch bezog ausdrücklich die Bereiche jenseits der bildenden Künste in die Diskussion ein. Am 31. Januar 2023 folgten dazu zwölf Kunstschaffende aus allen künstlerischen Bereichen der Einladung der MKG in die Zentrifuge in Bonn. In einer dezentralen Gesprächsanordnung wurden die Prinzipien in Kleingruppen disku�ert und No�zen, Audioaufnahmen und ein graphic recording dazu erstellt.
Die folgende Auswertung erschließt sich die Resonanz der Prinzipien Lesbarkeit, Verantwortung, Responsivität und Authen�zität in einem zusammenfassenden Überblick der einzelnen Gesprächsrunden. Dazu wurden die Diskussionen in den Kleingruppen inhaltlich kondensiert und entlang von Kategorien systema�siert, die allein aus dem empirischen Material heraus sichtbar wurden. Auf diese Weise lassen sich aus dem umfangreichen Material Schwerpunkte und inhaltlichen Leitlinien der Gespräche des�llieren. Zugleich treten Widersprüche und Spannungen hervor, die sich teils unmitelbar im Interak�onsverlauf, teils erst in der Zusammenschau der vier Gesprächsrunden ergaben. Die Reihenfolge der Darstellung ist zufällig gewählt, da die Gespräche der vier Kleingruppen parallel sta�anden. Um die Gesprächsinhalte nicht zu verzerren, wird zunächst bewusst auf theore�sche Einordnungen verzichtet. Erst in einem separaten Folgeschrit (Abschnit B) erfolgen die Kontextualisierung und Reflexion der Diskussionsinhalte vor dem Hintergrund der demokra�etheore�schen Analy�k.
Lesbarkeit
Lesbarkeit als Wahrnehmung & Verstehen // Lesbarkeit in der Kunst bedeutet, dass ein Publikum erreicht wird – über diesen kleinsten gemeinsamen Nenner besteht erkennbar Konsens. Davon ausgehend lässt sich Lesbarkeit in zwei separate Prozesse differenzieren: Zum einen erreicht ein Kunstwerk ein Publikum, indem es wahrgenommen, gesehen, erlebt wird, ohne dass es dabei zwingend begrei�ar sein muss. Zum anderen und daran anschließend kann das Werk kogni�v und/oder sinnlich verstanden werden. Verstehen bedeutet, auch dazu finden sich im Material zahlreiche übereins�mmende Äußerungen, dass der Betrachter oder die Betrachterin sich selbst zur Kunst ins Verhältnis setzt und einen Bezug zur eigenen Person herstellt: Er oder sie erkennt sich selbst in der Kunst wie in einem Spiegel und nimmt im Verstehen die Aufforderung zur Posi�onierung an – wobei diese Aufforderung von den Rezipien�nnen und Rezipienten immer auch abgelehnt werden kann.
Jede Posi�onierung erfolgt individuell und als subjek�ver Akt, die Kunst wird damit gleichsam zum Spiegel gesellscha�licher Pluralität. Spannung entsteht, wenn die Vielfalt individueller Lesarten mit den Inten�onen der Kunstschaffenden kollidieren: Bisweilen gehegte Erwartun-
gen oder Wünsche über eine „rich�ge“ Lesart prallen auf Wahrnehmungs- und Auslegungsspielräume. Kunstschaffende müssen „hegemoniale“ Deutungsansprüche kontrollieren und plurale und widersprüchliche Lesarten ihrer Werke aushalten.
Lesbarkeit als Prozess // Hinzu kommt: Lesbarkeit ist kein Zustand, sondern ein dynamischer und offener Prozess, der sich in der Sozial- und in der Zeitdimension abspielt: Die Kunst setzt Impulse, auf die das Publikum reagiert, und Lesbarkeit vollzieht sich als Wechselspiel im Dazwischen, das auf diese Weise entsteht. Die Impulse (oder auch: die Irrita�onen), die von den Künsten ausgehen, müssen bei den Betrachtenden wirken und dafür braucht es Zeit (Inkuba�onszeit). Der Kunst und den Kunstschaffenden verlangt dies unter Umständen Geduld ab –und dies umso mehr, je ambi�onierter die gesellscha�lichen Wirkungsansprüche oder die an ein Werk geknüp�e Botscha� sind und je kurzfris�ger die Erwartung von gesellscha�lichen Antworten auf das Werk ausfällt.
Schließlich impliziert ein prozessuales Verständnis von Lesbarkeit auch, dass Lesbarkeit sich nicht endgül�g herstellen und fixieren lässt, sondern permanent mit der Möglichkeit ihres Scheiterns rechnen muss. Beobachten oder gar quan�fizieren lassen sich weder das Gelingen noch das Scheitern von Lesbarkeit. Einhellig gewarnt wird vor der einschlägigen Deutung vermeintlich naheliegender Indikatoren wie Follower,- Klick- oder Besucherzahlen, die sich stets an der Grenze zur Kommerzialisierung von Kunst bewegen. Vielmehr wird von Kunstschaffenden gefordert, je eigene Techniken zu entwickeln, um ihr Publikum und dessen Leseerfahrungen ihrerseits lesen zu lernen.
Anforderungen an das Kunstwerk // Auf welche Weise können Kunstschaffende und die Gestaltung des Werks Lesbarkeit begüns�gen? Mit Blick auf die Form des Kunstwerks werden über alle Künste hinweg verschiedene Anforderungen genannt, die sich unter dem Kriterium der S�mmigkeit zusammenfassen lassen: Um Lesbarkeit zu ermöglichen sollte das Werk über eine innere Logik und eigene Syntax verfügen, ein Narra�v muss erkennbar sein, es braucht Tonalität und Rhythmus, der gewählte S�l ist sichtbar durchzuhalten. Chaos und (scheinbare)
Beliebigkeit sind nicht lesbar, das Werk braucht eine „innere Wahrheit“. Offen bleibt in den Gesprächen, ob dieses Verstehen eher durch eine gegenständliche Gestaltung oder vielmehr durch Abstraktheit begüns�gt wird. Auch zur Überlegung, ob die Neugier der Betrachtenden auf das Werk durch komplexitätsreduzierende Vermitlung von Kunst gesteigert oder zerstört wird, stehen gegensätzliche Posi�onen im Raum.
Lesbarkeit im Entstehungsprozess // Eine bemerkenswerte Diskrepanz entsteht in den Gesprächen, sobald die Überlegungen zu Lesbarkeit auf den Entstehungsprozess des Kunstwerks bezogen werden. Zwar besteht Konsens darüber, dass die vor allem handwerkliche Kompetenz von Kunstschaffenden eine wesentliche Voraussetzung bildet, um ein s�mmiges Werk zu schaffen und Lesbarkeit grundsätzlich zu ermöglichen. Daran anschließend spalten sich jedoch die Posi�onen: Auf der einen Seite finden sich starke Plädoyers dafür, dass Lesbarkeit im Herstellungs-/Entstehungsprozess eines Werks für den Künstler oder die Künstler*in selbst tunlichst keine Rolle spielen sollte und gerade nicht bewusst angestrebt wird. Vielmehr sollten Kunstschaffende in ihrem Tun ausschließlich „bei sich“ sein, so dass sich persönliche Erfahrungen und die individuelle Situa�on möglichst unverzerrt in den Entstehungsprozess einprägen
können. Die weniger vehement vorgetragene, aber dennoch deutlich ar�kulierte Gegenposi�on fordert von Kunstschaffenden, die (Lese-)Fähigkeit des Publikums im Schaffensprozess mitzudenken und Lesbarkeit des Werks bereits bei der Entstehung bewusst zu reflek�eren und anzustreben.
Lesefähigkeit des Publikums // Ob und inwieweit die Lesbarkeit von Kunst überhaupt spezielle Kompetenzen seitens des Publikums voraussetzt, wird ebenfalls kontrovers beurteilt. Lesefähigkeit, so die eine Posi�on, hängt ab von Übung, Bildung und Sozialisa�on (oder Erziehung) –einer Alphabe�sierung im weiteren Sinne, die durch die Kunstschaffenden berücksich�gt und/oder durch kunstexterne Faktoren (Bildungseinrichtungen) gezielt gefördert werden kann. Besonders interessante Leseeffekte, so jedoch die Gegenthese, entstehen gerade dann, wenn Rezipient*innen über keine (spezifische) Alphabe�sierung verfügen und das Kunstwerk unvoreingenommen und erwartungsfrei betrachten.
Räumlich-kulturelle Kontexte und Inklusion // Einigkeit besteht in allen Gesprächsrunden, dass der kulturelle Kontext die Lesbarkeit in der Kunst entscheidend beeinflusst. Lesbarkeit ist niemals universell, sondern variiert kontextabhängig und mit den unterschiedlichen Lese- und Betrachtungsgewohnheiten der jeweiligen Publika. Gegebenenfalls sind Übersetzungshilfen nö�g. Im Zusammenspiel von unterschiedlichen kulturellen Kontexten muss aber auch Unlesbarkeit zugelassen und toleriert werden. Große Verantwortung bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen von Lesbarkeit tragen die Kuratorinnen und Kuratoren, die durch Raumgestaltung und die Kombina�on von Werken Lesbarkeit lenken. Ob es möglich und wünschenswert ist, einen Raum ohne Lesbarkeitsanspruch herzustellen, wird als relevante Frage aufgeworfen, bleibt aber ungeklärt. Kunst, so wird mit Blick auf Maßnahmen zur Gestaltung oder Förderung von Lesbarkeit wiederholt betont, sollte nicht elitär sein und niemanden ausgrenzen. Zugleich lässt sich Lesbarkeit nicht für alle Teile des Publikums gleichermaßen herstellen und kontrollieren (z.B. begrenzte Wirksamkeit von leichter Sprache).
Widersprüchliche gesellscha�liche Erwartung // Als kaum lösbar wird in diesem Zusammenhang die Ambivalenz der gesellscha�lichen Erwartungen an die Kunst in Bezug auf Lesbarkeit verhandelt: Einerseits fühlen sich Kunstschaffende mit dem gesellscha�lichen Anspruch konfron�ert, die Welt verständlich zu machen und schlüssige Geschichten präsen�eren – und Lesbarkeiten entsprechend zu lenken und moderieren. Anderseits werde von der Kunst gefordert, ihr Publikum ernst zu nehmen und vielfäl�ge Lesarten und sogar Unlesbarkeit zu tolerieren.
Verantwortung
Die Bedeutung von Verantwortung wird in den Gesprächen über drei Bezüge verhandelt, die wiederholt und kontrovers au�auchen: Verantwortung & Freiheit, Verantwortung & Wirken, Verantwortung & Macht.
Verantwortung & Freiheit // An die Freiheit der Kunst, so die eine Posi�on, koppelt sich unauflöslich ihre Verantwortung. Wenn Kunst Freiheit für sich beansprucht, beinhaltet dies zwingend die Verantwortung dafür, wie diese Freiheit genutzt wird. Die Ablehnung von Verantwor-
tung gilt entsprechend als Missbrauch der Kuns�reiheit. Die Gegenposi�on betont die Kon�ngenz des Zusammenhangs von Verantwortung und Kuns�reiheit: Gerade weil die Kunst frei ist, kann sie Verantwortung für Themen übernehmen, muss dies aber nicht zwingend tun. Jede Verpflichtung zur Verantwortung wäre dementsprechend eine Beschränkung der Kuns�reiheit. Ohnedies stehen Freiheit und Gemeinwohl, auf das sich Verantwortung bezieht, zueinander im Widerspruch
Verantwortung & Wirken // Die Verantwortung der Kunst gründet auf ihrem Wirkungsanspruch. Kunst möchte einen Unterschied machen und weil sich ihr Wirken nicht auf das Private richtet, sondern sich öffentlich und in Bezug auf das Gemeinsame vollzieht, ha�et der Kunst stets ein poli�sches Moment an: Die Kunst ist ein unablässiger Kommunika�ons- oder Austauschprozess mit ihrem Publikum, in dessen Verlauf sich die Künstler*innen in einer Gemeinscha� bewegen. Und ähnlich: Die Kunst vollzieht sich als Dialog aus Frage und Antwort – und die Antwort wiederum steckt als (begrifflicher) Kern in der Verantwortung. Im Sinne eines solchen weiten Begriffs des Poli�schen ist unpoli�sche Kunst schlicht nicht denkbar.
Hinzu kommt: Verantwortung, die aus dem Wirken oder dem Wirkungsanspruch der Kunst folgt, ist stets nur par�ell. Gerade weil Kunst auf ihr Publikum wirken will, muss sie auf vollständige Kontrolle der Rezep�on durch das Publikum verzichten und kann aus diesem Grund auch niemals vollumfänglich Verantwortung übernehmen; ebenso wie Lesbarkeit hängt auch Verantwortung vom (kulturellen) Kontext ab.
Verantwortung & Entscheidungen/Macht // Speziell mit Blick auf das organisa�onale Moment von Kunst ist Verantwortung verbunden mit (Entscheidungs-)Macht. Macht folgt aus der Beteiligung an Entscheidungsprozessen und/oder der formalen Zuweisung oder fak�schen Inanspruchnahme von Entscheidungskompetenzen. Im Umkehrschluss heißt das auch: Sobald Macht durch Par�zipa�on verteilt wird, verteilt sich auch Verantwortung. Was jedoch organisa�onsintern an geteilter Verantwortung denkbar ist, findet meist seine Grenze in der Außendarstellung der Organisa�on – speziell dann, wenn Verantwortung ak�v demonstriert werden muss oder eingefordert wird (in diesem Zusammenhang taucht immer wieder das Beispiel der jüngsten Documenta auf). Entscheidungen können par�zipa�v gehandhabt und durch kollek�ve Aushandlungsprozesse getroffen werden, die Verantwortung bündelt sich letztlich und vor allem aus Sicht der der Umwelt dennoch in einer Führungsperson oder -gruppe (Wer hat den Hut auf? Wer hält den Kopf hin?). Werden Entscheidungsstrukturen zu komplex und dezentral, führt dies zu Diffusion und schließlich zum Verschwinden von Verantwortung, weil keine Zurechnung mehr möglich ist – und dies wiederum schlägt nega�v auf die Kunst zurück.
Verantwortungspraxis in der Kunst // Neben den inhaltlichen Bezügen des Verantwortungsbegriffs drehten sich die Diskussionen um verschiedene Aspekte der Verantwortungspraxis in der Kunst:
- Wer übernimmt Verantwortung (Subjekt)?
- Wem gegenüber wird Verantwortung getragen (Adressat)?
- Was wird verantwortet? Wofür trägt die Kunst Verantwortung (Objekt oder Gegenstand)?
- Wie wird Verantwortung übernommen (Verfahren)?
Grundsätzlich wird die Verantwortung der Künste entlang dieser Aspekte in zwei Dimensionen thema�siert: Die Verantwortung der Künste richtet sich einerseits nach innen, d.h. auf die Kunst als Sinnkontext, durch den sie operieren. Andererseits richtet sie sich aber auch nach außen, d.h. auf die Gesellscha� als Umwelt, in der und auf die die Künste wirken (wollen) Binnenverantwortung der Künste // Erstere, die Binnenverantwortung der Künste, bezieht sich auf Strukturen, Handeln, Werte künstlerischen Schaffens. Diese Verantwortung wird als zwingend befunden und nimmt alle Künstler*innen gleichermaßen in die Pflicht. Prak�sch übersetzt sie sich in vielfäl�ge Formen und Adressatenkreise: In der künstlerischen Praxis (der Herstellung und/oder öffentlichen Präsenta�on eines Werks) besteht Verantwortung gegenüber anderen Künstlerinnen hinsichtlich der Gestaltung der Zusammenarbeit, die überwiegend sehr prak�sche, unmitelbare Formen annimmt (Arbeitsbedingungen, rechtliche Fragen u.ä.). Ähnlich konkret ist die Verantwortung von Künstler*innen gegenüber Veranstaltern (z.B. Museen, Theatern u.ä.) in Form von Zuverlässigkeit. Gegenüber dem Publikum tragen Kunstschaffende die Verantwortung, dass jene Erwartungen eingelöst werden, die zuvor durch eigene Ankündigungen geweckt wurde – die Rede ist hier von einem „san�en Vertrag“ mit dem Publikum. Als weniger grei�ar, aber dennoch relevant wird auch die Verantwortung des Künstlers oder der Künstlerin gegenüber sich selbst genannt, die vor allem darin besteht, den eigenen Ansprüchen zu genügen.
Kontroverse Posi�onen finden sich zur Rolle des Werks im Verantwortungsgefüge: Einerseits wird gefordert, dass die Kunstschaffenden vollumfänglich die Verantwortung für das Werk übernehmen, das nach außen getragen wird. Diese Verantwortungsübernahme wir� vor allem dann Klärungsbedarf auf, wenn ein Kollek�v die Autorscha� übernimmt. Andererseits wird betont, dass das Werk stets für sich selbst die Verantwortung trägt, weil die Kunstschaffenden auf die Rezep�on ohnehin nicht durchgreifen können – umso mehr, wenn das Werk über die Grenzen kultureller Kontexte hinweg wirken soll.
Kurator*innen und Veranstalter*innen werden ebenfalls als Verantwortungssubjekte benannt, spielen jedoch im Vergleich zu den Kunstschaffenden eine nachgeordnete Rolle. Neben Bemerkungen zu rechtlich-formalen Fragen (z.B. Gebäude, Veranstaltungsort) werden vier Aspekte disku�ert: Erstens sind Organisa�onsstrukturen (z.B. interne Hierarchien und Entscheidungskompetenzen) ein relevanter Faktor mit Blick auf die Verantwortung von Veranstalterinnen. Wich�g ist dabei, dass die Zurechenbarkeit zu konkreten Personen und Stellen gewahrt bleibt. Zu komplexe Strukturen und eine zu breite Diffusion von Kompetenzen lässt Verantwortung verschwinden oder ungrei�ar werden. Zweitens sollten Veranstalter Verantwortung (auch) durch eine ak�ve Gastgeberrolle übernehmen, zentral dafür sind die Präsenz und Ansprechbarkeit bei Veranstaltungen. Dritens steht die Intendanz für den Transfer von Verantwortung in Bezug auf die Künstlerinnen: Sie muss bereit und in der Lage sein, für die Künstlerinnen und die gezeigten Werke „den Kopf hinzuhalten“. Viertens verkörpert die Person des Kurators oder der Kuratorin in besonderer Weise die Spannung zwischen persönlicher und ins�tu�oneller (poli�scher/rechtlicher) Verantwortung.
Bemerkenswert ist schließlich, dass auch vom Publikum erwartet wird, Verantwortung in der Kunst und für die Kunst zu übernehmen: Es muss und soll nicht alles akzep�eren, was es sieht
und erlebt, sondern kann durch „Aufstehen und Gehen“ Verantwortung demonstrieren. Weitergehende Posi�onen zur (Selbst-)Ermäch�gung des Publikums sehen die Rezipienten selbst in der Rolle von Handelnden bei der Entstehung von Werken oder der Konzep�on von Veranstaltungen, wofür gezielt Rollen gestaltet werden können („Prosumenten“). Offen bleibt die Frage, wie weit Mitbes�mmung geht und welche Grenzen gezogen werden
Umweltverantwortung // Die Umweltverantwortung der Künste – d.h. die Verantwortung für und gegenüber Gesellscha� und/oder Poli�k – wird weniger ausführlich besprochen als die zahlreichen Faceten Binnenverantwortung und gilt im Unterschied zu dieser nicht als zwingend, sondern kon�ngent. Auffällig ist außerdem, dass sich im Vergleich zur Binnenverantwortung deutlich stärkere Widersprüche und offene Enden abzeichnen. Konsens besteht unzweifelha� darüber, dass die Kunst mit Blick auf ihre Umwelt Verantwortung für den Erhalt jener Grundwerte übernehmen muss, innerhalb derer Vielfalt ausgehalten und Konflikt ausgetragen wird – und dies schließt die Angrei�arkeit der Künste selbst ein. Kontrovers wird hingegen die Frage von Inklusion und Exklusion verhandelt: Wer darf aus Konflikten ausgeschlossen werden und welche Gründe sind dafür legi�m? Wer entscheidet über die Grenzen von Foren, die durch die Künste geschaffen werden – und nach welchen Kriterien sind dabei angemessen? Wie weit darf der Anspruch auf poli�sche Posi�onierung von Künstler*innen reichen? Und mehr noch: Können und/oder müssen Künstler*innen für die poli�sche Situa�on in ihren Herkun�skontexten Verantwortung übernehmen (aktuell: Russland)? Wich�g ist dabei die Unterscheidung von rechtlicher und ethisch-moralischer Verantwortung: Eine wich�ge Funk�on der Kunst speziell in Bezug zur Demokra�e besteht darin, dass sie Fragen zur moralischen Dimension poli�sch-rechtlicher Verantwortung aufwerfen kann (z.B. durch körperliche/physische Präsenz in einem Raum).
Responsivität
Was ist Responsivität? // Die inhaltliche Bes�mmung zum Begriff Responsivität erfolgt als ein Herantasten über verwandte Konzepte: Responsivität verbindet sich mit Rela�onalität (rela�onale Ästhe�k) und Netzwerken, mit Resonanz, „Call and Response“ und dem Sender-Empfänger Modell. Responsivität bedeutet Antworten und Antwortbereitscha� auf Fragen – darunter auch auf solche, die (noch) nicht gestellt wurden (Verweis auf Picasso: „Ich suche nicht – ich finde.“). Und: Die Künste stellen selbst Fragen und fordert zu Antworten auf: Sie formulieren Behauptungen, stellen Thesen auf, entwerfen Szenarien und öffnen dadurch Gedankenräume. In jedem Fall vollzieht sich Responsivität als Dialog und beinhaltet ein dialek�sches Moment. Als unmitelbar anschlussfähig erweist sich der Responsivitätsbegriff im Tanz: Der „responsive body“ ist standig in Bewegung, wach und bewusst im Moment; er reagiert auf Kontexte, agiert intui�v, in der Improvisa�on werden Antworten und Lösungen gefunden.
Voraussetzungen für Responsivität // Responsivität ist in den Künsten nicht automa�sch vorhanden, sondern basiert auf Voraussetzungen, die bewusst zu schaffen sind: Es braucht Offenheit für Veränderung und für die Aufnahme von Impulsen; die Bereitscha� zum Zuhören und gezieltes Hineinhorchen in eine Gruppe oder einen Kontext sind wich�g; Responsivität erfordert Beweglichkeit (Agilität), um eigene Posi�onen im Verhältnis zum Kontext momentha� zu
reflek�eren und anzupassen; Responsivität setzt die Fähigkeit und die Bereitscha� zum Lernen voraus. Responsivität ist eine Atmosphäre, in der alles ständig aufeinander antworten und reagieren kann – das bedeutet auch, dass der (physische) Raum eine wich�ge Rolle spielen kann. Zeit und Tempo spielen dabei eine wich�ge Rolle: Responsivität beinhaltet die Fähigkeit, spontan und unmitelbar auf Impulse und/oder Veränderungen zu reagieren, Tempo und Schnelligkeit stehen jedoch möglicherweise im Konflikt mit dem Rhythmus eines Werks, der dadurch irri�ert oder gestört wird. Betont wird aber auch, dass Responsivität nicht zwingend Ak�vismus impliziert, vielmehr kann auch S�llhalten oder Schweigen eine Antwort sein.
Responsivität vs. Autonomie // Kontroverse Äußerungen finden sich auf die Frage, ob Responsivität (oder auch Resonanzfähigkeit) und Autonomie der Künste zueinander im Widerspruch stehen oder sich gar ausschließen. Einerseits, so wird betont, gilt „L’art pour l’art“ weiterhin als Autonomieformel und darf nicht durch Responsivitätsansprüche eingeschränkt werden. Autonome Kunst ist als Suchprozess zu verstehen, der ergebnisoffen verläu�, Vertrauen in den Prozess selbst verlangt und die Bereitscha� voraussetzt, auch Scheitern zu akzep�eren. Andererseits ist Kunst grundsätzlich kontextuell, ihre Agenda hängt stets (auch) von ihrer gesellscha�lichen Umwelt ab – und ist damit responsiv. Kunst möchte wirken und ist dementsprechend ohne Antworten der Betrachtenden nicht denkbar Auch wenn Kunst nicht primär von Demokra�e handelt, kann sie auf diese Weise zu demokra�scher Empfindsamkeit beitragen, ohne ihre Autonomie aufzugeben.
Wo findet Responsivität stat? // Die Frage, wo und wie Responsivität in der Kunst sta�indet, wird in den Gesprächen schnell heruntergebrochen auf par�elle Kontexte. In Varia�onen tauchen regelmäßig drei Kontexte auf, für die nicht nur unterschiedliche Strukturen und Erscheinungsformen von Responsivität disku�ert werden, sondern zu denen auch je eigene Grenzen thema�siert und Zweifel geäußert werden: Erstens das Zentrum oder der Kern des Kunstsystems selbst, d.h. die Prozesse der Entstehung von Kunstwerken und die Beziehungen zwischen Kunstschaffenden; zweitens das Wechselspiel von Zentrum und Peripherie innerhalb der Kunst, d.h. das Verhältnis von Künstler*innen und Publikum/Betrachter*innen; und dritens die Umweltverhältnisse der Kunst, d.h. das Wechselspiel der Kunst mit anderen Gesellscha�sbereichen wie – vor allem – der Poli�k (poli�sche Demokra�e), aber auch der Wirtscha� (Markt). In diesem Zusammenhang geht es außerdem um die Relevanz von gesamtgesellscha�lichen Problemen (in der sozialwissenscha�lichen Literatur auch bekannt als Grand Challenges) als Faktor im künstlerischen Schaffen.
Responsivität im Zentrum der Kunst // Prozesse und Strukturen des Herstellens von Kunstwerken und die Beziehungen von Kunstschaffenden untereinander bilden den einzigen Kontext, für den Responsivität einhellig posi�v betrachtet wird. Responsivität spielt bei der Entstehung eines Werks unmitelbar vor allem dann eine Rolle, wenn Kunstschaffende als Gruppe agieren. Was besonders deutlich für den Tanz zutri�, gilt in ähnlicher Weise auch für jede Form par�zipa�ver Kunst: Kollabora�ve Prozesse verlangen, dass die Tänzerinnen und Tänzer untereinander responsiv sind und permanent aufeinander reagieren, was nicht nur die Bereitscha� voraussetzt, sich auf diesen Prozess einzulassen, sondern auch die Kompetenz bedingt,
Kontexte zu lesen (oder lesen zu lernen). Die Entstehung des Werkes beinhaltet das Hineinhorchen in die Gruppe, Aufmerksamkeit für jedes einzelne Mitglied, die Sensibilität für Pluralität und die Fähigkeit zum Antworten aufeinander.
Aber auch jenseits par�zipa�ver Prak�ken schließt künstlerisches Schaffen Responsivität ein: Responsivität bedeutet auch, dass der Künstler oder die Künstlerin auf sich selbst hört, „bei sich ist“ und auf sich selbst (Impulse, Intui�onen) antwortet. Bei der Entstehung eines Werks stellen Kunstschaffende sich selbst – d.h. den eigenen Körper, ein Instrument, individuelle Fähigkeiten) der Kunst zur Verfügung und reagieren auf die Kunst.
Responsivität zwischen Zentrum und Peripherie // Im Verhältnis von Künstler*innen, Werk und Publikum beinhaltet der Anspruch der Kunst, sich auf die jeweiligen Gegebenheiten (z.B. die Besonderheiten des Ortes, die Reak�onen der Rezipien�nnen) einzulassen, ein responsives Moment. Auf welche Weise und wie unmitelbar reagiert werden kann, hängt dabei jedoch stark vom jeweiligen Genre ab (z.B. Tanz vs. Film) Unabhängig vom Genre darf Responsivität jedoch nicht heißen, dass die Kunst sich ihrem Publikum „anbiedert“, etwa indem das Streben danach, spezifischen Publikumserwartungen zu entsprechen, zum primären Prinzip künstlerischen Schaffens wird. Unter anderem kann das bedeuten, dass Künstlerinnen Überlegungen zur Resonanz auf das Werk und mögliche Antworten des Publikums im Schaffensprozess bewusst ausklammern (z.B. indem Kri�ken und Rezensionen gezielt nicht gelesen werden). Quoten und Zuschauer-/Besucherzahlen werden einhellig als Indikator für die Resonanz eines Kunstwerks abgelehnt. Ohnehin ist die Responsivität durch das Publikum weder planbar noch kontrollierbar. Hinzu kommt, dass die Publikumserwartungen von vielfäl�gen Faktoren beeinflusst werden (darunter die Kri�k). All dies macht es der Kunst schwer, aus den Antworten der Publikum Rückschlüsse für sich selbst abzuleiten.
Solche skep�schen Vorbehalte in Bezug auf Responsivität entbinden die Kunst jedoch nicht vom Anspruch (oder sogar der Verpflichtung), ihrerseits Voraussetzungen für ein responsives Publikum zu schaffen: Kunst sollte danach streben, Lust auf Vielfalt unter den Rezipien�nnen anzuregen und in Dialog zu treten (z.B. durch entsprechende Programmgestaltung). Das schließt für die Kunstschaffenden die Bereitscha� ein, widersprüchliche Antworten zuzulassen und keinen Konsens oder gar Homogenität zu erzwingen.
Responsivität in den Umweltverhältnissen der Kunst // Für die Verhältnisse der Kunst zu ihren gesellscha�lichen Umwelten (Poli�k, Wirtscha� u.a.) meint Responsivität zum einen die die Bereitscha� und Fähigkeit der Künste, Themen und Probleme aufzugreifen und mit künstlerischen Miteln zu reflek�eren. Eine solche Reak�onsfähigkeit gegenüber gesellscha�lichen Themen und die Umsetzung über künstlerische Impulse wird explizit als Anspruch an die Open Embassy formuliert. Die Antworten, die dabei in der und durch die Kunst gefunden werden, können und sollen divers und widersprüchlich sein. Zum anderen verweist Responsivität auf gesellscha�liche Reak�onen auf die Kunst, gegenüber denen die Kunst aufgeschlossen und neugierig sein sollte.
Eine besonders interessante Form externer Responsivität ist Kunst im öffentlichen Raum, bei der die künstlerische Praxis versucht, in Beziehung zu Menschen, Problemen und gesellscha�lichen Themen zu treten und sich selbst als prak�ziertes Zuhören versteht. Kunst, so die eindrückliche Metapher, fungiert als gesellscha�liche Akkupunkturnadel
Authen�zität
Was ist Authen�zität? // Die inhaltliche Annäherung an das Konzept der Authen�zität erfolgt assozia�v über ein Bündel von verwandten Begriffen und Gegenbegriffen. Demnach steht Authen�zität in enger Verbindung mit Eigengesetzlichkeit (Autonomie), Wahrha�igkeit, Ehrlichkeit, Originalität und S�mmigkeit. Authen�zität impliziert Verletzlichkeit und ist die Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit (street credibility) eines Werks oder einer Künstlerin.
Authen�zität steht in Widerspruch zu Kommerzialität und Mark�örmigkeit, industrieller Produk�onsweise, Oberflächlichkeit, Verlogenheit, Kopie/Fake und Fremdbes�mmtheit. Unvereinbar mit Authen�zität ist auch jede Form von Instrumentalität, bei der die Kunst als Mitel zum Zweck (z.B. individuelles Pres�ge) oder als Hintergrundfaktor (z.B. Kau�ausmusik) fungiert.
Spannungen und Schwierigkeiten // Spannungen und Unbehagen im Zusammenhang mit Authen�zitätserwartungen gegenüber der Kunst zeigen sich in dreierlei Hinsicht: Geäußert wird erstens ein grundsätzliches Unbehagen mit dem Begriff der Authen�zität: Authen�zität als universeller Impera�v, der von allen Seiten an die Kunst herangetragen wird (Anspruch der Kunstschaffenden an sich selbst, durch das Publikum, durch die gesellscha�liche Umwelt, darunter z.B. der Kunstmarkt). Diese Universalität macht es schwierig, diesem Anspruch gerecht zu werden. Hinzu kommt zweitens eine konzep�onelle Spannung zwischen einem Verständnis von Authen�zität als intrinsischer Eigenscha� eines Werks einerseits und der Auffassung von Authen�zität als externer und damit beobachterabhängiger Zuschreibung andererseits. Drittens ha�et Authen�zität unausweichlich ein soziales Risiko an: Wer Authen�zität angestrebt, darf keine Angst davor haben, wie das eigene Werk gelesen wird, und sollte den Vorwurf poli�scher Unkorrektheit nicht fürchten.
Authen�zität des Künstlers // Die Forderung nach Authen�zität in der Kunst kennt zwei Bezugspunkte: Den Künstler und das Werk. Die Authen�zität des Künstlers steht in direktem Zusammenhang mit persönlicher Iden�tät, die sich entwickelt und aus der sozialen Umwelt heraus beobachtet wird. Als innere Haltung von Kunstschaffenden beinhaltet Authen�zität Leidenscha� und Hingabe an das Werk. Ein Künstler ist in seinem Schaffen authen�sch, wenn er einen eigenen Standpunkt gefunden hat. Er ist ehrlich gegenüber sich selbst, hat verstanden, worum es im Entstehungsprozess eines Werks geht, und hat die eigene Rolle oder den eigenen Beitrag dabei reflek�ert (dies gilt vor allem für kollabora�ve/kollek�ve Prozesse, z.B. für Schauspieler in einem Theaterstück oder Film).
Was aber bedeutet Authen�zität, wenn Kunstschaffende nicht allein in Bezug zur Kunst betrachtet werden, sondern wenn die Pluralität sozialer Rollen und gesellscha�licher Kontexte
Berücksich�gung finden? Kontextabhängig agiert jedes Individuum in einer Vielzahl unterschiedlicher Rollen, so dass Authen�zität immer nur par�ell und mit Blick auf spezifische Sprecherposi�onen möglich ist. Nicht die Person in ihrer Gesamtheit kann authen�sch sein, sondern nur die Person in einer spezifischen Rolle und in Bezug auf einen konkreten Kontext Angesichts dessen bedeutet Authen�zität das Einlassen auf den Moment. Authen�zität entsteht durch die Iden�fika�on mit dem Handeln in einer konkreten Situa�on
Kontrovers verhandelt wird die Frage, welche Fähigkeiten von Kunstschaffenden Authen�zität voraussetzt: Sind Erfahrungen, Wissen und handwerkliche Kompetenz eine Bedingung für Authen�zität oder ist die Mo�va�on der Künstlerin grundsätzlich wich�ger als Professionalität, so dass auch künstlerische Laien authen�sche Werke schaffen können?
Authen�zität des Werks // Die Authen�zität des Werks besteht in seiner Originalität und Einzigar�gkeit – ein authen�sches Werk ist keine Kopie, es ahmt nichts nach, darf aber Vorhandenes aufgreifen und damit arbeiten. Als wich�ges Authen�zitätskriterium gilt die S�mmigkeit des Werks, die sich jedoch in unterschiedlichen Dimensionen betrachten und problema�sieren lässt:
- Prozessual-intrinsische S�mmigkeit: Die Authen�zität des Werks ergibt sich aus der Dynamik und inneren Logik des Entstehungsprozess und der Konsequenz der Entscheidungen, die in dessen Verlauf getroffen werden. Ein Werk ist authen�sch, wenn es auf Entscheidungen beruht, die frei, zwanglos und ohne Berechnung (mit Blick auf externe Faktoren wie Profit, Publikumserwartungen o.ä.) getroffen wurden. Bei der Entstehung eines authen�schen Werks muss die Unkontrollierbarkeit des Entstehungsprozess akzep�ert werden. Ein in diesem Sinne authen�sches Werk entwickelt aus sich heraus Überzeugungskra�.
- Historisch-zeitliche S�mmigkeit: Die Authen�zität eines Werks liegt nicht im einzelnen Werk und kann zu Beginn einer künstlerischen Karriere noch nicht gegeben sein, vielmehr ergibt sich Authen�zität aus der Vergangenheit. Sie entsteht rela�onal im Zeitverlauf und im Horizont des Gesamtwerks: Das einzelne Kunstwerk ist authen�sch, wenn es sich kohärent in das Gesamtwerk der Künstlerin einfügt und in die Wahrnehmung durch das Publikum passt. Die Authen�zität des Werks ist in dieser Hinsicht eng verknüp� mit der Authen�zität des Künstlers.
- Räumlich-kontextuelle S�mmigkeit: Das Werk ist authen�sch, wenn es zur Umgebung und zum Ort passt, an dem es sta�indet oder präsen�ert (inszeniert oder ausgestellt) wird.
Raum als Authen�zitätsfaktor // Ohnehin gilt der (physische und/oder ins�tu�onelle) Raum durchweg als wich�ge Rahmenbedingung für Authen�zität: Raum kann durch die passende Gestaltung von Regeln zu authen�schem künstlerischem Schaffen einladen. Wohlgemerkt kann das auch bedeuteten, dass bes�mmte Regeln, Erwartungen oder Ansprüche, die außerhalb gelten, innerhalb eines Raumes bewusst und kontrolliert außer Kra� gesetzt werden. Im Zusammenspiel von einem Raum (u.U. als Teil einer Ins�tu�on mit eigener Programma�k) und
den Kunstschaffenden können sich Authen�zitätsdilemmata ergeben: Damit beide ihre Authen�zität wahren, braucht es nicht nur Leitlinien oder ein Regelwerk, sondern auch die Bereitscha� zu Austausch, Selbstreflexion und zum Aushalten von Widersprüchen
Mit Blick auf die Open Embassy als authen�schem und glaubwürdigem Raum (Ort) knüpfen sich an diese Überlegungen verschiedene Forderungen: Historische Bezüge sollten in der neuen Gestaltung reflek�ert werden (z.B. Embassy und Skater); die Embassy muss die eigenen Ansprüche öffentlich darstellen und sie einlösen; sie sollte transparent agieren, klar und verständlich kommunizieren und Hinterbühnen vermeiden.
B. Reflexion zu Künsten und Demokra�e(theorie)
Aus dem Facetenreichtum der Diskussionen und der Fülle des empirischen Materials einen einheitlichen Befund abzuleiten, ist nur begrenzt möglich. Vier resümierende Beobachtungen möchte ich abschließend dennoch herausstellen: Erstens lässt sich in der Zusammenschau beobachten, dass alle vier Prinzipien, die aus einem in mehrfacher Hinsicht kuns�remden Kontext an die Künste herangetragen wurden, in den Expert*innengesprächen durchweg anschlussfähig waren und Zus�mmung gefunden haben. Bisweilen war diese Zus�mmung gepaart mit Skepsis, auf Ablehnung traf jedoch keines der Prinzipien. Auffällig betont wurde jedoch immer wieder die Kon�ngenz aller Prinzipien für die Kunst: Sie werden als Prämissen und/oder Maßstäbe für künstlerisches Schaffen akzep�ert, jedoch nicht als Notwendigkeit betrachtet. Deutlich wurden über die verschiedenen Diskussionsrunden hinweg außerdem sowohl die enge Vernetzung der Begriffe untereinander als auch Spannungen, die nicht durchweg, aber doch wiederkehrend mit unterschiedlicher Intensität zwischen den vier Prinzipien zum Ausdruck kamen. In einem Schaubild lassen sich die auffälligsten dieser Spannungen s�chpunktar�g visualisieren, weitere ließen sich ergänzen. Als Konsequenz für die Programma�k der Open Embassy for Democracy ließe sich daraus ableiten, dass diese Spannungen zu berücksich�gen und zu akzep�eren sind. Indem aber die vier inhaltlichen Bojen lose gekoppelt und zueinander in ein dynamisches Verhältnis gebracht werden, lassen sich Reibungsflächen und Widersprüchlichkeiten konstruk�v und krea�v nutzen.
Zweitens lassen sich die Expert*innendiskussionen angesichts der Verbindung aus grundsätzlicher Akzeptanz, der Betonung von Kon�ngenz und der Sichtbarkeit von Spannungen (auch) als Ausdruck einer Suchbewegung innerhalb der Kunst deuten. In den Gesprächen zeigt sich das (Selbst-)Verständnis einer Kunst, die sich ihrer gesellscha�lichen Wirkung sehr bewusst ist. Erwartungen und Ansprüche aus der gesellscha�lichen Umwelt werden bereitwillig registriert und häufig begrüßt – die Kunst möchte interagieren. Dazu gehören auch die Wahrnehmung und die Wertschätzung eines Publikums, das nach ak�ver Einbindung sucht und Par�zipa�on fordert (vgl. dazu die gesellscha�stheore�schen Befunde in Gerhards 2001).
Zugleich pocht die Kunst auf ihre Eigengesetzlichkeit: Interak�onen mit diversen Kontexten verlangen nach bewusster Gestaltung, gesellscha�liche Ansprüche werden moderiert und reflek�ert. Kurz: Die Künste ringen um ein Konzept von Autonomie, das anspruchsvolle, ak�v
betriebene Umweltverhältnissen nicht ausschließt, sondern diese explizit beinhaltet und berücksich�gt.
Bemerkenswert ist die Gleichzei�gkeit von Akzeptanz, Kon�ngenz und wechselsei�gen Spannungen der Prinzipien dritens umso mehr, wenn man die empirischen Befunde zu den Künsten in den Horizont der eingangs skizzierten Theorieüberlegungen zur Betä�gungsdemokra�e rückt und auf die Wesensähnlichkeiten und -differenzen von Kunst und Demokra�e bezieht: Für die Demokra�e lassen sich keine Spannungen zwischen den Prinzipien feststellen, vielmehr scheinen sich Lesbarkeit, Verantwortung, Authen�zität und Responsivität sogar wechselsei�g in einem Unterstützungs- und Steigerungsverhältnis befinden. Und auch Kon�ngenz taucht im Zusammenhang mit Demokra�e nicht auf. Statdessen leiten sich, wie Rosanvallon eindrucksvoll vor Augen führt, alle vier Prinzipien schlüssig und beinahe zwingend aus der historischen Entwicklung demokra�scher Gesellscha�en ab.
Dass dies für die Kunst gerade nicht im selben Maß zutri�, führt zurück zu den eingangs skizzierten Unterschieden der Bedeutung von Ungewissheit in Kunst und Demokra�e. Diese Unterschiede prägen sich unter anderem in die Art und Weise ein, wie beide auf ihre gesellscha�lichen Kontexte wirken (wollen): Demokra�e versucht Ungewissheit mit Blick auf Strukturen und Regeln verständlich zu machen und zu ordnen Vielheit wird durch gutes Regieren im besten Fall zu einer Einheit gebracht und mündet in kollek�v bindende Entscheidungen, ohne dabei Konflikt zu unterdrücken. Zugleich zwingt Unbes�mmtheit demokra�sche Regime dazu, ihre eigenen Prämissen und Prozesse immer wieder zu reflek�eren und anzupassen. Im Gegensatz dazu grei� die Kunst Unbes�mmtheiten auf, spielt mit ihnen und erzeugt unablässig neue Ungewissheit. Sie möchte ihre gesellscha�liche Umwelt nicht ordnen, sondern strebt nach konstruk�ven Irrita�onen und will kontroverse Diskussionen erzeugen Insofern alle vier Prinzipien mindestens vorübergehende Festlegungen beinhalten – auf Themen, Rela�onen oder Deutungsvarianten –, fügen sie sich nahtlos in eine demokra�sche Ordnung, können von der Kunst aber immer nur temporär erfüllt werden und werden unweigerlich immer wieder durchbrochen
Hinzu kommt, dass demokra�sche Gesellscha�en Mechanismen der Selbstvergewisserung über Zus�mmung oder Ablehnung des Publikums ins�tu�onalisiert haben, um Ungewissheit zu reduzieren und Legi�mität zu erzeugen. Die Kunst hingegen operiert auch diesbezüglich mit Ungewissheit – dies umso mehr, da quan�ta�ve Indikatoren als Erfolgsnachweise abgelehnt werden und die Wirkung, die ein Werk anstrebt, gerade auch in Provoka�on und Widerspruch bestehen kann. Demokra�sche Aushandlungsprozesse, die in Entscheidungen münden, werden ex post ra�fiziert. In der Kunst müssen die Bedingungen des Weitermachens immer wieder aufs Neue ausgelotet werden.
Viertens verweisen diese Überlegungen zu Ungewissheit auf die unterschiedlichen Erzeugnisse in Poli�k und Kunst, d.h. auf poli�sche Entscheidungen und auf Kunstwerke, und ihr jeweiliges Verhältnis zu den herstellenden Personen, d.h. Poli�kerinnen und Künstlerinnen. Für Demokra�en gilt, dass sich die Prinzipien guter Regierung mit unterschiedlicher Intensität einerseits auf poli�sche Entscheidungen beziehen (Maßnahmen, Regeln oder Gesetze, die auf die Bürger angewendet werden) oder sich andererseits an Poli�kerinnen als Personen richten.
Während Lesbarkeit und Responsivität primär (aber nicht ausschließlich) Sachkriterien sind, werden Authen�zität und Verantwortung stärker (aber nicht ausschließlich) von Personen erwartet. Wich�g ist, dass sich beide Zusammenhänge in aller Regel gleichsinnig verhalten. In der Kunst – oder genauer: mit Blick auf Künstlerinnen und ihr Werk – zeigt sich hingegen ein anderes Bild und ein Schlüssel dazu dür�e in der unterschiedlichen Reichweite von Öffentlichkeit in Kunst und Poli�k liegen. Dies klingt bei Arendt (2016 [1968]) an, die hervorhebt, dass Poli�k ausschließlich im Bereich des Öffentlichen sta�indet – jeder Poli�ker ist in seiner Rolle und mit seinem Tun eine öffentliche Person. Für die Kunst markiert das Kunstwerk die Grenze zwischen dem (verborgenen) Privaten und dem Öffentlichen: Das Herstellen des Werks ist selbst per se kein öffentlicher Akt, erst mit seinem Erscheinen trit das Werk in die Öffentlichkeit und tri� auf sein Publikum. Das Werk selbst, so betont Rancière (2009), gehört niemandem und steht im Idealfall in einer symmetrischen Beziehung zu Künstler und Publikum. Im Unterschied zur Poli�kerin ist der Künstler folglich nicht zwingend eine öffentliche Person, auch wenn er durch sein Werk zum Publikum spricht und damit zumindest indirekt als Person in Erscheinung trit. Letzteres gilt umso mehr, je stärker ein Werk nicht im klassischen Sinne hergestellt wird, sondern – wie im Fall performa�ver Kunst – zu einem erheblichen Teil oder gar vollständig aus Handeln (im Sinne Arendts) besteht und nur im Moment seines Vollzugs Bestand hat. Die Komplexität dieser Gemengelage spiegelt sich in den Expert*innengesprächen, in denen die Reflexion der Prinzipien mit Blick auf Künstler und Werk häufig ambivalent ausfällt und teilweise widersinnig ausfällt (z.B. soll das Werk lesbar sein, der Künstler aber keine Lesbarkeit anstreben). Auch diese Ambivalenz sollte bei der Verwendung der vier Prinzipien als Bojen für eine Programma�k der Open Embassy for Democracy Berücksich�gung finden.
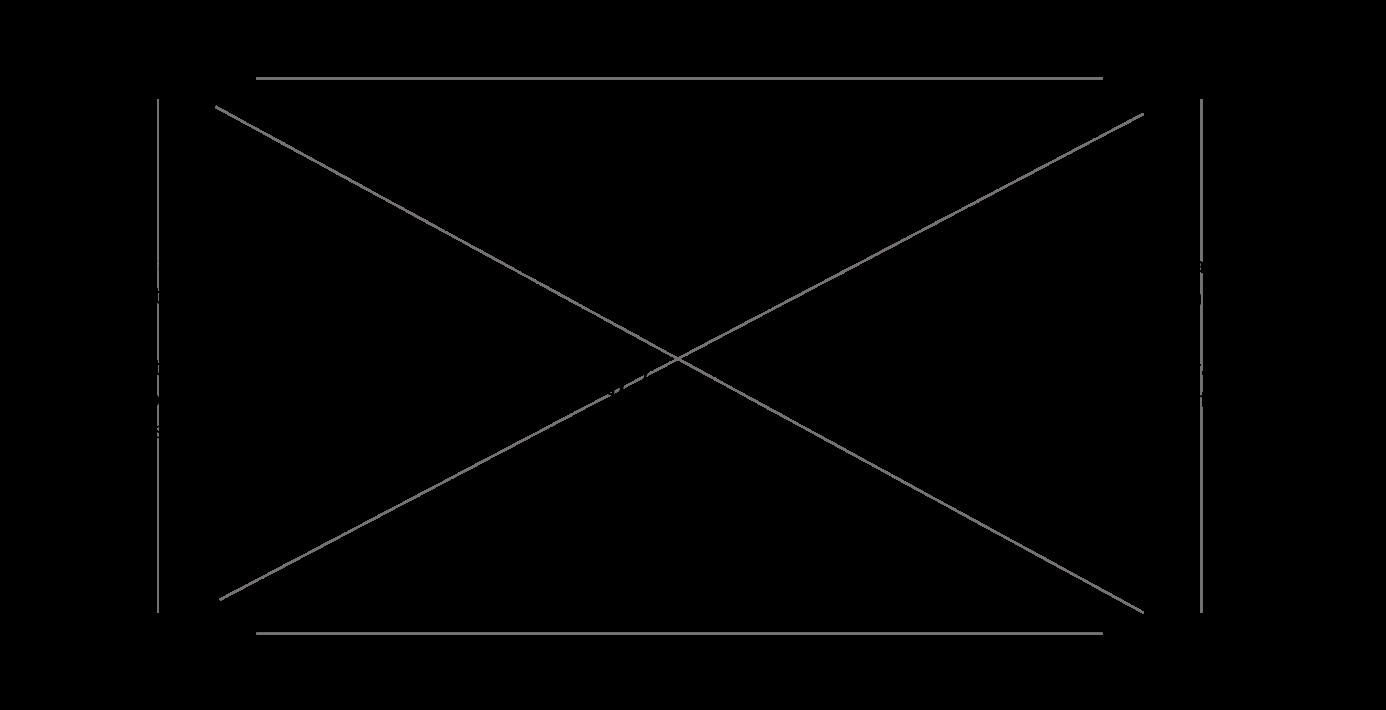
Literatur
Arendt, Hannah (1993): Was ist Poli�k? , München: Piper.
Arendt, Hannah (2016 [1968]): »Kultur und Poli�k«. In: Hannah Arendt (Hg.), Zwischen Vergangenheit und Zukun�. Übungen im poli�schen Denken I, München: Piper, S. 277-304.
Arendt, Hannah (2016 [1969]): »Wahrheit und Poli�k«. In: Hannah Arendt (Hg.), Zwischen Vergangenheit und Zukun�. Übungen im poli�schen Denken I, München: Piper, S. 327-370.
Arendt, Hannah (2019 [1972]): Vita ac�va oder Vom tä�gen Leben, München: Piper.
Becker, Howard S. (1982): Art Worlds, Berkeley: University of California Press.
Brosda, Carsten (2020): Die Kunst der Demokra�e, Hamburg: Hoffmann und Campe.
Dewey, John (2021 [1937]): »Democracy Is Radical«. In: John Dewey (Hg.), America’s Public Philosopher. Essays on Social Jus�ce, Economics, Educa�on, and the Future of Democracy, New York: Columbia University Press, S. 19-23.
Dewey, John (2021 [1939]): »Crea�ve Democracy - The Task Before Us«. In: John Dewey (Hg.), America’s Public Philosopher. Essays on Social Jus�ce, Economics, Educa�on, and the Future of Democracy, New York: Columbia University Press, S. 59-65.
Gerhards, Jürgen (2001): »Der Aufstand des Publikums. Eine systemtheore�sche Interpreta�on des Kulturwandels in Deutschland zwischen 1960 und 1989«, in: Zeitschri� für Soziologie 30 (3), S. 163-184.
Kikol, Larissa (2023): Nutzt die Kunst aus! Eine Einladung, Bönen: Verlag Ketler.
Lefort, Claude (1990a): »Die Frage der Demokra�e«. In: Ulrich Rödel (Hg.), Autonome Gesellscha� und libertäre Demokra�e, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 281-297
Lefort, Claude (1990b): The Poli�cal Forms of Modern Society. Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism, Cambridge: MIT Press.
Llanque, Marcus (2020): »Arendts Poli�kverständnis und seine Relevanz für das 21. Jahrhundert«. In: Doris Blume, Monika Boll und Raphael Gross (Hg.), Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert, München: S. 237-247.
Luhmann, Niklas (1995): Die Kunst der Gesellscha�, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Luhmann, Niklas (2008): Schri�en zu Kunst und Literatur, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Luhmann, Niklas (2009 [1980]): »Machtkreislauf und Recht in Demokra�en«. In: Niklas Luhmann (Hg.), Soziologische Au�lärung 4. Aufsätze zur funk�onalen Differenzierung der Gesellscha�, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 148-158.
Rancière, Jacques (2009): The Emancipated Spectator, London: Verso.
Rasch, William (2005): Konflikt als Beruf. Die Grenzen des Poli�schen, Berlin: Kadmos.
Reben�sch, Dieter (1997): »Mäzenatentum - Ein Leitmo�v der Frankfurter Stadtgeschichtsschreibung«. In: Bernhard Kirchgässner und Hans-Peter Becht (Hg.), Stadt und Mäzenatentum, Sigmaringen: Thorbecke, S. 9-14.
Rosanvallon, Pierre (2011): »Für eine Begriffs- und Problemgeschichte des Poli�schen. Antritsvorlesung am Collège de France, Donnerstag, den 28. März 2002«, in: Mitelweg 36 2011 (6), S. 43-66.
Rosanvallon, Pierre (2015): Das Parlament der Unsichtbaren, Wien: Edi�on Import/Export.
Rosanvallon, Pierre (2016): Die gute Regierung, Hamburg: Hamburger Edi�on.
Rosanvallon, Pierre (2019): »The Poli�cal Theory of Democracy«. In: Oliver Flügel-Mar�nsen u.a. (Hg.), Pierre Rosanvallon’s Thought. Interdisciplinary Approaches, Bielefeld: Transcript, S. 23-38.
Scheuerle, Christoph (2009): Die deutschen Kanzler im Fernsehen. Theatrale Darstellungsstrategien von Poli�kern im Schlüsselmedium der Nachkriegsgeschichte,
Bielefeld: Transcript.
Schönberger, Christoph (2022): Auf der Bank. Die Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments, München: C. H. Beck.
Schulz, Daniel (2016): »›Die Unbes�mmtheit der Demokra�e‹ Ein Gespräch mit Pierre Rosanvallon«, in: Zeitschri� für Poli�sche Theorie 7 (1), S. 105-119.
Sholete, Gregory (2022): The Art of Ac�vism and the Ac�vism of Art, London: Lund Humphries.
Teubner, Gunther (2018): »Quod omnes tangit: Transna�onale Verfassungen ohne Demokra�e«, in: Der Staat 57 (2), S. 1-24.
von Beyme, Klaus (1998): »Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. Künstler in poli�scher Opposi�on«. In: Klaus von Beyme (Hg.), Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 145-179.
Waldenfels, Bernhard (1994): »Response und Responsivität in der Psychologie«, in: Journal für Psychologie 2 (2), S. 71-80.
Waldenfels, Bernhard (2015): "Responsivität und Kor-responsivität aus phänomenologischer Sicht." Unveröffentlichtes Manuskript.
Zybok, Oliver (2010): »Zum Verhältnis von Kunst und Demokra�e«, in: Kuns�orum 205, S. 3059.
