Stress im Trend
BACHELORARBEIT 1
Eine theoretische und empirische Untersuchung der Stressursachen und möglichen Auswegen aus Sicht der Millennials
Zur Erlangung des akademischen Grades
„BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS“
Verfasser: Matej Maryska
Personenkennzeichen: 1910431022
Vorgelegt am 15.2.2021
Betreuer: Prof. Dr. Dominik Walcher
Bachelorstudiengang:
Design- und Produktmanagement
Wintersemester 2022/23
Fachhochschule Salzburg

Kurzzusammenfassung
Schlüsselwörter: Millennials, Stress, Stressbewältigung, digitale Umwelt, Naturerfahrung
Neue Entwicklungen bringen neue Herausforderungen mit sich. Angesichts des rapiden Komfortanstiegs durch ein sich ständig weiterentwickelndes Mehr an technologischen Hilfsmitteln mag es überraschen, dass die Zufriedenheit unter den Nutznießer*innen dieser modernen Errungenschaften nicht gleichermaßen wächst. Trotz aller modernen Entlastungen ist die mentale Gesundheit der Menschen im 21. Jahrhundert nicht gesichert und beschäftigt die Forschung sowie die Gesellschaft zunehmend als zentrale gesundheitliche Herausforderung. Was also belastet diejenigen, die alles zu haben scheinen?
Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, das Stresserleben von Millennials zu beleuchten, um besser verstehen zu können, welche Belastungen zu Stress führen und welche Strategien dagegen angewandt werden. Im Theorieteil findet zunächst eine Auseinandersetzung mit der Generationskohorte und ihren Besonderheiten statt, bevor der Begriff Stress erläutert und wichtige Wirkmechanismen der menschlichen Anpassungsreaktionen thematisiert werden. Anschließend werden die Entstehung der digitalen Umwelt und ihre Verflechtung mit dem Alltag der Millennials anhand der Geschichte von Marktforschung und des modernen Marketings beleuchtet Dies ist insofern für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant, als es sich bei der digitalen Umwelt um eine Quelle neuartiger Belastungen handelt. Abschließend stehen die Natur und ihre Wirkung auf die menschliche Gesundheit im Fokus.
Im zweiten Schritt, der Empirie, werden qualitative Tiefeninterviews mit Vertretern der Kohorte entlang eines an den Forschungsfragen orientierten Frageleitfadens durchgeführt. Die erhobenen Daten werden dokumentiert und anschließend im Rahmen qualitativer Inhaltsanalyse kategorisiert, codiert und ausgewertet.
Anhand der zusammengetragenen Daten wird ersichtlich, dass neben sozialen und existenziellen Fragen vor allem eine neue Dimension – die digitale Umwelt – Millennials in ihrem Stresserleben prägt. Als Kehrseite dieses Phänomens lässt sich eine voranschreitende Naturentfremdung beobachten, während es gleichzeitig expliziten Bedarf an Natur als Ort für Entschleunigung und Stressbewältigung gibt. Die Qualitäten, die an natürlichen Landschaften geschätzt werden, lassen sich im Grunde als Absenz dessen verstehen, was im Alltagsleben der Millennials zur Generierung von kognitivem Stress führt. Darüber hinaus fördert natürliche Umgebung Entspannung durch Ruhe, Wiederherstellung von Aufmerksamkeit durch sanfte Faszination und dank der wenigen expliziten Möglichkeiten dem FOMO-Effekt (Fear Of Missing Out) kaum eine Grundlage. Gleichzeitig bieten Naturlandschaften schier unendliche Vielfalt und die damit verbundenen impliziten Möglichkeiten für kreatives Erforschen, Beobachten, Lernen und Entdecken. Die Komponente der physischen Bewegung, die mit Naturerfahrungen meist einhergeht, kann zusätzlich zur nachhaltigen Stressbewältigung beitragen.
Abstract
Keywords: millennials, stress, stress management, digital environment, nature experience
New developments bring new challenges. In view of the rapid increase in comfort due to a constantly evolving increase in technological aids, it may come as a surprise that satisfaction among the users of these modern achievements does not grow equally. Despite all the modern relief provided by comfort, the mental health of the beneficiaries is not secured and increasingly concerns research and society as a central health challenge. So, what burdens those who seem to have everything?
This work aims to shed light on the stress experience of millennials in order to better understand which burdens lead to stress and which strategies are used to cope with it. In the theoretical part, a discussion of the generational cohort and its peculiarities takes place before the term stress is explained and its important mechanisms are discussed. Subsequently, the emergence of the digital environment and the interdependence with the everyday life of millennials is dealt with based on the history of market research and modern marketing, as it is one of the main sources of new burdens, which is relevant for answering the research questions. Finally, the focus is on nature and its effects on human health.
In the second step, the empirical study, qualitative in-depth interviews with representatives of the cohort are conducted along a questionnaire based on the research questions. The collected data is then documented, categorized, coded and evaluated as part of a qualitative content analysis. The collected data shows, that in addition to social and existential questions, a new dimension - the digital environment - is shaping millennials' stress experience. As a flip side of this phenomenon, a progressive alienation of nature can be observed, while at the same time there is an explicit need for nature as a place for deceleration and stress management. The qualities that are valued in natural landscapes can basically be understood as the absence of what leads to the generation of cognitive stress in the everyday life of millennials. Moreover, natural environment fosters relaxation by tranquility, restoration of attention by opportunities for soft fascination and disables the FOMO-effect (Fear Of Missing Out) thanks to few explicit possibilities. At the same time, it offers almost infinite diversity and the associated implicit possibilities for creative exploration, observation, learning and discovery. The component of physical movement, which is usually associated with natural experiences, can also contribute to sustainable stress management.
I. Einleitung
1.1 Hintergründe
Diese Arbeit entspringt einem Projekt, welches gemeinsam mit meinem Studienpartner Michael Tschallener für einen Ideenwettbewerb entwickelt wurde. U:Holz ist die Idee eines Netzwerks einfach buchbarer, minimalistischer und naturnaher Unterkünfte (siehe Abb. 1)
Im Kontext des ersten österreichweiten Corona-Lockdowns 2020 wurde uns bewusst, wie wichtig die Funktion der Natur als Rückzugsort zur Regeneration von alltagsbedingtem Stress ist Natürliche Umgebung entschleunigt, bietet vielerlei Möglichkeiten für Aktivität, Inspiration und sanfte Faszination, ohne dabei durch Aufdringlichkeit Druck zu erzeugen. Demnach war der Lösungsansatz des Projektes, den Zugang zur Natur zu erleichtern, extensives Verweilen in natürlicher Umgebung zu ermöglichen und eine legale Grundlage für längere Naturerfahrungen

Der erste Platz beim Open Innovation Ideenwettbewerb führte zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Idee. Schlussendlich wurde das U:Holz Projekt aufgrund baurechtlicher Herausforderungen auf Eis gelegt bzw. von Michael Tschallener in Richtung minimalistischer Unterkünfte an Bio-Bauernhöfen weiterentwickelt. Meinerseits blieb das Bedürfnis aufrecht, das Stresserleben der eigenen Generation näher zu untersuchen und einerseits bestehende Strategien zur nachhaltigen Stressbewältigung zu dokumentieren, sowie andererseits neue zu entwickeln.
1.2 Relevanz des Themas
Befinden ist ein aufschlussreicher Ausdruck, impliziert er doch eine örtliche Komponente und dient gleichzeitig als Bezeichnung unseres psychophysiologischen Zustands. Der Zusammenhang ist einerseits klar und wirkt doch überraschend. Ist in diesem Sinne die Ortswahl eines der mächtigsten Instrumente, die ein Mensch hat, um Stressbelastungen und ihren Folgen vorzubeugen (siehe instrumentelles Stressmanagement S. 23)? Lassen sich Architektur und Design als Versuch, Mängel eines Standortes zu kompensieren, verstehen? Bedingt eine unpassende Umgebung ein Mehr an Lösungen, während eine passende mit weniger Lösungen eine vergleichbare Wirkung entfaltet?
Angesichts dieser Fragen scheint die Relevanz der Themas aus der gestalterischen Sicht des Designs begründet. Die direkte Fragestellung nach der passenden Umgebung ist jedoch zu vielen subjektiven Variablen unterworfen und eignet sich demnach nicht für eine wissenschaftliche Studie. Es bedarf einer konkreteren Ausgangslage.
1.3 Gesellschaftlicher Kontext
Trotz der Tatsache, dass Menschen in Mitteleuropa in einer Umgebung aufzuwachsen, welche viele physische Gefahrenquellen durch zivilisatorischen Fortschritt, Regulierungen und Gesetze minimieren konnte, klagen viele über Stressbelastungen. Stress scheint sich als hinzunehmende Begleiterscheinung unserer Gesellschaft etabliert zu haben.
Zukunftsängste, wie die vor bevorstehenden Klimakatastrophen, vor dem sich anbahnenden Pensionsdilemma oder der Gefahr von antibiotikaresistenten Bakterien rücken näher – nicht zuletzt durch die technologischen Möglichkeiten, niederschwellig und eindrucksvoll zu kommunizieren. Manche Gefahren werden hingegen unterschätzt, wie der Vergleich von Umfragen und Statistiken zeigt. Laut einer Umfrage (Österreich, 2019a;b;c) gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, die Sicherheit für Leib und Leben in Österreich hät te abgenommen, 44 % der Befragten haben Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden und 16 % fürchten sich explizit vor Mord. Im gleichen Jahr sterben in Österreich 56 Personen durch von Anderen verursachte Gewalt, während 1113 Menschen infolge sich selbst bewusst zugefügter Verletzungen ihr Leben verlieren (WHO, o.J.a;b;c). Demnach ist es rund 20-mal wahrscheinlicher, Opfer seiner
eigenen Gewalt zu werden, als der Gewalttaten anderer Chronische Stressbelastungen, auch lediglich kognitiver Art wie akademischer Stress, stehen bewiesenermaßen im Zusammenhang mit Entwicklung von Depressionen und suizidalen Gedanken (Ang & Huan, 2006; Rosiek et al., 2016).
In einer von Konnektivität geprägten Lebensweise sind schier unendliche Möglichkeiten stets mit in der Hosentasche und nur einen Knopfdruck entfernt. Der Sog, der aufgrund dieses niederschwelligen Angebots entstehen kann, nimmt nicht selten suchtähnliche Gestalt an. Trotz ihres Potenzials scheint die digitale Umwelt nicht immer hilfreich zu sein (vgl. Kapitel 2.3.2). Allzu oft bleiben ein müder oder gar gestresster Mensch und ein fahler Geschmack vergeudeter Zeit als Begleiterscheinung hoher Bildschirmzeit übrig (vgl. Erkenntnis 3.1, S. 57) Eine Studie des Fraunhofer Instituts kommt zum Schluss: „Übermäßiger digitaler Stress wirkt negativ auf die Arbeitsleistung, das Wohlbefinden und die Gesundheit … (Gimpel et al., 2018, S. 41)“
Mit zunehmenden Möglichkeiten bei begrenzten Kapazitäten nimmt der Anteil dessen, was man nicht tun kann, zu. Das Resultat dieses Phänomens ist als Fear Of Missing Out bekannt und trägt zur kognitiven Stressbelastung bei Während man argumentieren könnte, dass sich auch unsere Kapazitäten dank technischen Fortschritts weiterentwickeln, lassen sich mit dieser Entwicklung einhergehende Einbußen der wohl wichtigsten Komponenten zum Wahrnehmen von Möglichkeiten beobachten: Aufmerksamkeit und die subjektiv empfundene Menge an verfügbarer Zeit schwinden.
Digital Detox, ein Trend des bewussten und freiwilligen Entzugs der digitalen Umwelt, lädt als Gegentrend zur näheren Betrachtung des kontroversen digitalen Phänomens ein (Horx, 2021, S. 9), während sich Natur – durch die per Definition abwesende Technologie – als alternative Umgebung ebenfalls für eine Untersuchung anbietet.
1.4 Entstehung der Forschungsfragen
Vor dem geschilderten Hintergrund stellt sich aus der Sicht des Space Designs die Frage nach möglichen Lösungsansätzen in Form von geeigneten Umgebungen für Stressbewältigung
Umgebung lässt sich wählen, gestalten – oder auch akzeptieren. Wenden wir uns der Frage nach einer förderlichen Umgebung für Stressbewältigung zu, gilt es zunächst zu akzeptieren, dass eine völlige Absenz von Stress keine Möglichkeit repräsentiert, denn Reize, innere als auch äußere, stellen einen grundlegenden Teil unserer menschlichen Funktionsweise und damit unserer Existenz dar (vgl. Kapitel 2.2). Anschließend ist es notwendig, der Frage nachzugehen, welche Stressquellen es im Alltag gibt und welche Herausforderungen bzw. Belastungen jeweils damit einhergehen, um entsprechend dieser Erkenntnisse eine andere, zweckmäßig sinnvollere Umgebung aufsuchen und/oder gestalten zu können. Eine Betrachtung möglicher Umgebungsszenarien und deren Wirkungen auf das subjektive Stressempfinden stellt den nächsten Schritt dar. Aufgrund der Vorarbeit zu dieser Studie wurden zwei kontrastierende Umgebungen zur näheren Untersuchung ausgewählt; die natürliche und die digitale Umwelt.
Die Hauptthese, Natur könne zur erfolgreichen Stressbewältigung beitragen, dient als Grundlage für die Formulierung der kohortenspezifischen Hauptforschungsfrage:
Wie beliebt ist natürliche Umgebung für Stressbewältigung unter Millennials?
Unterstützend werden folgende Unterforschungsfragen gestellt und beantwortet:
1. Welche charakteristischen Merkmale definieren Millennials?
2. Was sind die wichtigsten stressverursachenden Faktoren in dieser Kohorte?
3. Welche Stressbewältigungs-Strategien lassen sich bei Millennials erkennen?
Diese dienen der Komplexitätsverteilung und sollen Hintergrundinformationen bieten, um eine elaborierte Beantwortung der Hauptforschungsfrage zu ermöglichen. Während Frage 1 durch Theorierecherche beantwortet wird, fließen in die Beantwortung der Fragen 2 & 3 sowohl empirische als auch theoretische Erkenntnisse mit ein.
1.5 Vorgehensweise
Im Theorieteil werden durch Recherche bereits vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie durch gelegentliche Einbeziehung von nicht wissenschaftlichen Quellen wie Zeitungsartikeln, Radiosendungsinhalten etc. Informationen zu den Themen Millennials (2.1), Stress (2.2), Marketing (2.3) und Natur (2.4) zusammengetragen und diskutiert.
Anschließend wird im Rahmen der Empirie der methodische Hintergrund der durchgeführten Tiefeninterviews erläutert (Kapitel 3.1), die Interviewer-Teilnehmer*innen (3.2.1) porträtiert und die Erkenntnisse präsentiert (3.2.2).
Im letzten Teil dieser Arbeit findet die Beantwortung der Forschungsfragen (4.1) statt, ein zusammenfassendes Fazit (4.2) wird formuliert und allfällige Limitationen der Studie sowie der weitere Forschungsausblick (4.3) werden thematisiert.
Ein persönlicher Epilog schließt die Arbeit ab.
II. Theorie
2.1 Millennials
Diese Studie befasst sich mit der Kohorte, die in der Forschung, aber auch Alltagssprache als Generation Y (Gen Y), Digital Natives, Connected Generation oder Millennials bezeichnet wird (Hershatter & Epstein, 2010, S. 212; Reynolds et al., 2008) Der Autor hat sich für die Verwendung des letzteren Begriffs entschieden, da die Bezeichnung Generation aufgrund der engen Bindung ans Geburtsjahr der Betroffenen zu kurz greift. Dennoch ist die zeitliche Einordnung der untersuchten Zielgruppe entscheidend; diese ist zwischen der Generation X und der momentanen, den Millennials nachfolgenden Generation Z, zu verorten. Obwohl verschiedene zeitliche Definitionen vorliegen, orientiert sich diese Arbeit an den Geburtsjahrgängen 1980 bis 2000 (Junker et al., 2016).
Der ursprünglich sozialwissenschaftliche Begriff Kohorte bezieht neben den persönlichen Merkmalen auch externe Einflussfaktoren ein, sogenannte „defining moments (Schewe, 2004, S. 51)“. Finden prägende, kollektive Erfahrungen im Prozess des Erwachsenwerdens statt, bilden diese „cohort effects (Schewe, 2004, S. 52)“ die Grundlage der langfristigen Werte und Motivationen der jeweiligen Gruppe. Im Sinne des globalen Dorfes McLuhans (1962, S. 31), der stets verbundenen und dadurch schrumpfenden Welt, können Ereignisse Ortsunabhängig zu solchen defining moments werden. Voraussetzung ist eine gute Internetverbindung (oder ein anderes Kommunikationsmedium) und kulturelle bzw. ideologische Nähe.
Der Titel von Harald Koissers Buch (2009) Wieso es uns so schlecht geht, obwohl es uns so gut geht bringt ein schwer fassbares doch sehr wohl spürbares Dilemma einer ganzen Generation auf den Punkt. Europäische Millennials wachsen privilegiert auf. Frieden bedeutet für sie nicht mehr die bloße Absenz des Krieges, sondern das Schüren nachhaltig positiver Beziehungen zwischen benachbarten Gesellschaften im ökonomischen und sozialen Sinne (Woodhouse, o.J.). Die Europäische Union hat, bei aller berechtigten Kritik, für vorangegangene Generationen unbekannte Möglichkeiten geschaffen: Vor allem neue politische Zusammenarbeit, persönliche Freizügigkeit und freien Warenverkehr. Auch gemessen an Parametern wie der „durchschnittlichen Lebensdauer, Kindessterblichkeit, sozialen Sicherheiten, Bildungsmöglichkeiten, Einsatz körperlicher Arbeit für eine konkrete Sache (jegliche Erzeugnisse, Gebäude…), Zugang zu Nahrungsmitteln, Menge an Freizeit (Kolář, 2021, S. 13, Übersetzung durch Autor)“ befinden sich Millennials in einer Hochzeit unserer Zivilisation. Trotz all dem ist ihnen jedoch Zufriedenheit nicht sicher.
Die Menge an Möglichkeiten birgt neue Herausforderungen wie Unentschlossenheit, Reizüberflutung, oder das Fear Of Missing Out Phänomen, die zu Überforderung führen können. Laut dem Global Burden of Disease Report ist Depression „the leading cause of years of life lived with
disability (Lopez et. al., 2006)“. Mentale Gesundheit stellt auch laut der ehemaligen österreichischen Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat eine wesentliche Herausforderung dar. Ein Bericht des Ministeriums zum Anlass der Gründung des World Health Day on Mental Health der WHO im Jahre 2001 kommt unter anderem zu folgendem Schluss: „Mental health problems constitute a major burden on individual sufferers, their families and friends, and on society as a whole. (Katschnig, 2003, S. 5)“. Im selben Jahr sterben in Österreich 302 der 15–35-Jährigen an den Folgen sich selbst beabsichtigt zugefügter Verletzungen – das entspricht 22% aller Todesfälle in dieser Altersgruppe. Lediglich 10 Menschen dieser Gruppe fallen im selben Zeitraum Gewalttaten zum Opfer (WHO, o.J.a;b;c).
Um die Millennials in ihrem Kontext zu verstehen, werden drei relevanten Ebenen betrachtet: die Persönlichkeitsmerkmale, defining moments sowie die Bedeutung der Zielgruppe für Wirtschaftstreibende. Diese Ebenen sind als voneinander abhängig zu verstehen.
2.1.1 Persönlichkeitsmerkmale
Charakteristiken von Millennials werden in der Forschung als kontrovers erachtet, gelten einerseits Hedonismus, Materialismus, Selbstbezogenheit bzw. Narzissmus als Hauptmerkmale, andererseits aber auch Loyalität (gegenüber Personen, nicht Marken), Teamworkfähigkeit und das Einstehen für Werte und Ideale (Alexander & Sysko, 2013; Stein, 2013, S. 1/9; Barmparas et al., 2019; Bolton et al., 2013, S. 252; Hershatter & Epstein, 2010). Sie sind bereit, Leistung zu erbringen, erwarten dafür jedoch „sofortige Belohnung und Anerkennung (Alexander & Sysko, 2013; Übersetzung durch Autor).“ Diese Ungeduld und das Selbstverständnis dieser Gruppe, berechtigt zu sein, etwas zu tun oder etwas zu besitzen bzw. Anspruch darauf zu haben (entitlement; Cambridge University Press, o. J.b, Allen et al., 2015) sind weitere spezifische Merkmal der Zielgruppe (Lloyd & Harris, 2007). Bei studierenden Millennials wird teilweise ein Überschätzen der eigenen Leistungen und daraus resultierende, unberechtigte Ansprüche auf gute Noten festgestellt (Wilson & Gerber, 2008, S. 38).
2.1.2 Defining moments
Ein technischer Quantensprung (siehe Kapitel 2.3.3) bedeutet für Millennials als erste Generation das Aufwachsen mit digitalen Technologien im Alltag. Sie machen sich diese Technologien und die damit verbundenen Dienstleistungen zu eigen und adoptieren sie als „their sixth sense“ (Hershatter & Epstein, 2010, S. 213). Daraus ergeben sich einerseits Möglichkeiten (bspw. digital nomads; ein Ortsunabhängiger Lebensstil durch Erwerbsarbeit via Internet), andererseits auch Herausforderungen wie Beschleunigung oder ständige Erreichbarkeit. So wünschen sich laut einer Umfrage 76% der Österreicher*innen Entschleunigung, 70% fühlen sich mindestens einmal pro Woche „von Reizen bzw. Informationen überflutet … (Schwabl, 2018)“.
Es lassen sich Effekte beobachten, die in der Nutzung dieser Technologien begründet sind und sich im Alltagsleben wiederfinden; bspw. Veränderung der Sprache durch verbale Verwendung von Chat-Kürzeln, wie LOL, OMG, oder WTF Auch die Erwartungshaltung: „all necessary
information can be gathered with the touch of a button on a 24/7/365 basis (Hershatter & Epstein, 2010, S. 213)“ findet weite Verbreitung und lässt sich in der technologisch bedingtem Gewöhnt sein an ständige Verfügbarkeit begründen.
Eine Streitfrage scheint hier der Einfluss der Technologie auf das Ausbildungsniveau bzw. die Kenntnisse der Millennials darzustellen. Einerseits genießt ein im Vergleich mit früheren Kohorten überproportionaler Teil der Millennials höhere Bildung (Deal et al., 2010, S. 193) und hat dank dem Internet mehr Informationen zu Verfügung als die Generationen zuvor. Deshalb werden Millennials unter anderem als die gebildetste Generation getitelt (Radojka & Filipović, 2017, S. 6; Wieck, 2008, S. 27). Andererseits beobachtet Jeremy P. Tacher (2008; zitiert nach Walesh, 2009) in seinem kontroversiellen Buch The Dumbest
Generation – How The Digital Age
Stupefies Young Americans And Jeopardizes Our Future zunehmenden Missbrauch von digitalen Technologien auf der Jagd nach Aufmerksamkeit und Selbstinszenierung. Der damit verbundene Verfall des Intellekts hat laut
Tacher Auswirkungen wie Desinteresse an der heutigen Welt, der Geschichte, Defizite im kritischen Denken und sprachlichen Verfall
Auch innerhalb der Kohorte lässt sich Unbehagen erkennen. Der überwiegende Teil der 13.416 befragten Millennials (Abb. 2) attestiert der eigenen Nutzung Sozialer Medien negative Effekte.
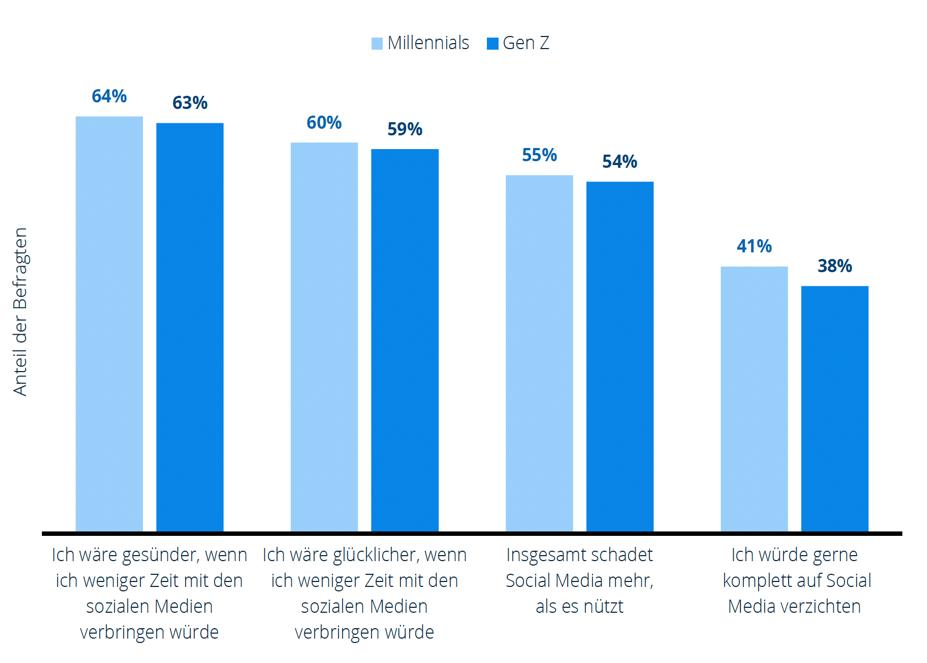
Helicopter Parenting; die um 1990 entstandene Metapher beschreibt einen „Erziehungsstil, bei dem der Elternteil ein überbehütendes Verhalten gegenüber dem Kind auf kontrollierende Weise zum Ausdruck bringt (Vigdal & Brønnick, 2022; Übersetzung durch Autor)“ – laut den Autoren der Studie ein allgegenwärtiges Phänomen. Die freigesetzten Ressourcen der Eltern durch den vorhergegangenen wirtschaftlichen Aufschwung lassen sich als Grundlage dafür begreifen. Indizien sprechen für potenziell negative Konsequenzen dieser Erziehungsmethode wie Angststörungen (Spokas & Heimberg, 2009) oder Depressionen (Schiffrin et al., 2014). Grund dafür ist die „reduced autonomy and competence (Schiffrin et al., 2014)“ des Nachwuchses, die auch im pejorativen Titel “Generation Whine (Hershatter & Epstein, 2010, S. 211)” zum Ausdruck kommt.
Die Klimakrise, sozusagen ein Erbe der vorangegangenen Generationen, begleitet Millennials als ein latentes, apokalyptisches Szenario. Diese schwer fassbare, existenzielle Bedrohung (Kemp et al., 2022) schürt einerseits Ängste und Unsicherheiten, bietet andererseits auch
Orientierung sowie ein wichtiges Motiv für nachhaltige Lebensweisen, die als modernes Distinktionsmerkmal fungieren. Die gesellschaftlich eingeforderte intergenerationelle Verantwortung wiegt jedoch schwer und erwartet von den Millennials Beschränkung, Verzicht und Reduktion (Golub, 2013, S. 269) um zu versuchen ein Problem zu beheben, welches sie zum größten Teil nicht verursacht haben.
Internationaler Terrorismus, vor allem die dramatischen Bilder des einstürzenden World Trade Centers im Jahr 2001, der darauffolgende Krieg gegen den Terror und die damit einhergehende, massive Erhöhung der Sicherheitsstandards an öffentlichen Plätzen wie zB. Flughäfen stellt ein prägendes Ereignis dar. Die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen allgemein steigt signifikant an, Sicherheit wird auf Kosten von (persönlicher) Freiheit ausgebaut Millennials tragen diesen Wandel in ihren prägenden Jahren mit (Bartl, 2016).
Die globale Wirtschaftskrise (2008) traf einen Teil der Millennials während ihres Einstiegs in die Arbeitswelt. Der Kontrast zwischen verwöhnter Jugend und den verschärften Arbeitsmarktbedingungen stellt eine besondere Herausforderung dar. Das ökonomische Sicherheitsempfinden leidet auch an der berechtigten Skepsis gegenüber dem Pensionssystem (Kettunen & Kriikkula, 2020, S. 66, Finnland; Thomas, 2022, Österreich).
2.1.3 Bedeutung für Wirtschaftstreibende
Am Beispiel des amerikanischen Marktes lässt sich die Dimension der Kohorte verstehen. Quantitativ umfasst sie rund 83.000.000 potenzielle Kunden und ist somit um 10% größer als die ihr vorhergegangenen Generation X (Heo & Muralidharan, 2019, S. 3). In Deutschland ist sie mit über 19 Mio. als zweitgrößte Kohorte knapp hinter der Generation X angesiedelt (Statistisches Bundesamt, 2022). Shopping als Hobby bzw. Unterhaltung begleitet sie seit der Kindheit (IfD Allensbach, 2022; Ladhari et al., 2019, S. 113) und viele von ihnen haben gelernt, ihr ausgeprägtes Verlangen nach Distinktion durch Konsum materieller (Luxus-)Güter zu stillen (Eastman & Liu, 2012). Dank der digital vernetzten Lebensweise sind sie für Marketers deutlich einfacher identifizierbar und erreichbar (vgl. Kapitel 2.3.3), was sie zu einem besonders attraktiven Markt macht. Während sich klassische E-Shops bereits früher etabliert haben, kaufen Millennials vermehrt digital und mobil via Smartphone (Ladhari et al., 2019, S. 113). Allerdings bringt die Vernetzung auch neue Ansprüche der potenziellen Kunden an Anbieter von Produkten und Dienstleistungen: Millennials schenken ihren Glauben nicht einfach der (offiziellen) Werbung, sondern überprüfen gegebenenfalls die Reputation des Anbieters, die Rezensionen der Dienstleistungen bzw. die Produktreviews und Preise der Konkurrenz via Social Media, bevor sie sich zum Kauf entscheiden. Allerdings sind sie vor dem Value-Action Gap Dilemma nicht gefeit und lassen sich sehr wohl zu Impulskäufen verleiten Diese können wegen des Selbstverständnisses als bewusster*bewusste Konsument*in eher zu schlechtem Gewissen führen als bei anderen Gruppen (Varella, 2022). Sie wollen verstanden werden, eine breite
Auswahl haben, persönlich bedient bzw. unterstütz werden. Außerdem ist ihnen äußerst wichtig als populär oder cool auf Sozialen Medien wahrgenommen zu werden (Ordun, 2015, S. 47).
Passend dazu wird Social Media, der Millennials natürliche Umgebung, im Kontrast zu früheren Web-Communities, als ein „personal network (ego centric network) (Barbera et. al, 2009, S. 34)“ beschrieben. Weiter wird in der Studie festgestellt:
These characteristics may be related to specific personality traits of the new generation. A recent research shows that students (Generation Y) are more narcissistic and self-absorbed than any previous generation. … More recent studies have investigated identity performance in less anonymous online setting, such is Facebook. The findings suggest that the Facebook selves appear to be highly socially desirable identities individuals aspire to have offline: Facebook users may exaggerate the part of their possible selves that are socially desirable but not emphasized in brief offline relationships, such as one’s character, intelligence, and other important inner qualities. Concurrently, they may seek to hide the part of themselves they regard as socially undesirable, such as shyness, overweight, or stuttering. (Barbera et. al, 2009, S. 34).“
Für Ordun stellen Soziale Medien hinsichtlich Millennials eine wichtige Vermarktungsmöglichkeit dar; „the chance to connect their social network as a trusted source … [is] the chance to guide their behavior

2.2 Stress
In einer aktuellen Umfrage berichten 44% der in Deutschland Befragten, Stress zu erleben (AXA, 2022). Was ist aber Stress, wieso erlebt ihn jeder Mensch, wie funktioniert er und wieso kann er als Nährboden für gesundheitliche Risiken fungieren?
Stress beschäftigt die Forschung in verschiedensten Bereichen, wie der Physiologie, Psychologie, Pädagogie, Soziologie sowie vielen anderen interdisziplinären Ausrichtungen und stellt damit eins der „am häufigsten untersuchten Phänomene der letzten Jahrzehnte (Starke, 2000, S. 2)“ dar. Dennoch gilt es als nicht definitiv erforscht; es koexistieren zahlreiche Theorien bzw. Konzeptionen um seine Entstehung und Wirkmechanismen. Ein „chamäleonartiger Begriff (Haller, 2010, S. 170), der auch außerhalb der Wissenschaft dermaßen viel Verwendung findet, dass er sich heute als stellvertretender Ausdruck für den Effekt der Leistungsgesellschaft etabliert hat (Kury, 2012, S. 9). Folglich kann in diesem Kapitel lediglich versucht werden, einen der Arbeit adäquaten Überblick über das Thema zu bieten, um weitere Zusammenhänge bestmöglich nachvollziehen zu können. Dabei wird besonders dem Erkennen von Stressoren Raum gegeben, da es im Hinblick auf Reizüberflutung als modernes Phänomen von Bedeutung ist. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht erhoben werden. Das wäre dem Autor zu stressig (beispielhafte Verwendung des Begriffs in der Alltagssprache).
Für eine differenzierte Auseinandersetzung ist es notwendig, sich von der dominierenden, negativen Konnotation (Jessen, 2006, S. 17) von Stress zu trennen. Denn obwohl darunter im allgemeinem ein „intensiver, unangenehmer Spannungszustand in einer stark aversiven Situation verstanden werden[kann], dessen Vermeidung als subjektiv wünschenswert erlebt wird (Schmidt, o. J.)“, handelt es sich bei dieser Definition bereits um eine besondere Art von Stress; Disstress. Außerdem lässt sie die Entstehung von Stress außer Acht und greift damit zu kurz, denn sie suggeriert Stress als einen eindeutig erkennbaren, binären Zustand, der entweder vorhanden ist oder nicht.
Eine rein defensive Haltung gegenüber dem Phänomen (also Schutz zu suchen, ihm auszuweichen etc.) ist zudem laut Pavel Kolar keine reale Möglichkeit. In seinem Buch Stärkung durch Stress
ein Weg zur Widerstandsfähigkeit (2021; Übersetzung durch Autor) betrachtet Kolar
Stress als unabdingbare Grundlage zur Ausbildung von Resilienz – der Widerstandskraft, welche das psychophysiologische Geleichgewicht des Menschen schützt.
Objektiv betrachtet ist Stress „ein Zustand erhöhter Aktivierung des Organismus (verbunden mit einer Steigerung des emotionalen Erregungsniveaus) (Brockhaus, o. J.e)“. Es stellt sich also die Frage, welcher Stress, wie viel davon und in welchem Kontext ist förderlich, wann wirkt er belastend?
Um dies beantworten zu können, wenden wir uns zunächst der Entstehung von Stress und den damit einhergehenden Prozessen zu.
2.2.1 Stressoren
Grundsätzlich sind Stressoren „alle externen Störgrößen, die das psychische und physische Gleichgewicht einer Person in irgendeiner Form gefährden können (Gerber & Schilling, 2018, S. 144)“. Aus subjektiver Sicht sind es Sinneswahrnehmungen, die zur erhöhten Aktivierung (vgl. Kapitel 2.3.3) des Organismus führen. Dabei ist Wahrnehmung als „aktiver Konstruktionsprozess, bei dem mithilfe von Gestaltprinzipien … und unter Mitwirkung des Gedächtnisses … eine zweckmäßige Repräsentation der Umwelt und der Rolle des eigenen Körpers darin aufgebaut wird (Brockhaus, o. J.f)“, zu verstehen. Wahrnehmung kann unterbewusst oder bewusst geschehen, was bedeutet, dass wir mitunter eigenen Sinneswahrnehmungen ausgesetzt sind, die sich unserem bewussten Erleben entziehen (Brockhaus, o. J.f; Kolar, 2021, S. 33). Außerdem umfasst Wahrnehmung als Teil des Erkenntnisprozesses neben Sinneseindrücken der äußeren Umwelt sowie des eigenen Körperempfinden auch „Vorstellungen, Vergegenwärtigtes, und Nachbilder (Dorsch, 2021)“. Es folgt ein Überblick der gängigen Reizarten, angelehnt an das situationsspezifische Stresskonzept laut Brockhaus (o. J.e) und ergänzt durch die Arbeit von Gerber & Schilling (2018, S. 144):
Physikalische Reize sind Licht, Temperatur, Geräusche, haptische und olfaktorische Stimuli, Schmerzen oder unmittelbare Gefahrensituationen.
Situationen, in denen Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Schlaf oder Bewegung nicht gestillt werden können, stellen für das Individuum Stressoren dar.
Leistungsdruck und verwandte Faktoren wie Zeit, Multitasking, Teamwork, Versagen, Erfolg, Kritik, Ablenkung oder Erholungsphasen können zur (Ent-)Spannung bzw. zur (Über-)Forderung beitragen.
Soziale und Psychosoziale Stressoren sind Isolation, Konkurrenz, zwischenmenschliche Konflikte, Trennung, Verlust, Gruppendynamik oder gesellschaftliche Normen und Erwartungen.
Psychische Herausforderungen, bspw. Unkontrollierbarkeit, Ungewissheit und innere Konflikte sind als Stressoren zu berücksichtigen.
Auch intern entstehende, kognitive Reize, wie Antizipationen (Vorfreude, FOMO, Erwartungshaltung) oder Erkenntnisse durch Kontemplation wirken auf den Menschen.
Reize sind grundsätzlich neutral und definieren sich erst in der subjektiven Wahrnehmung der Betroffenen als angenehm oder unangenehm, förderlich oder belastend. Dabei spielt der situative Kontext (Steak an Pfefferrahmsauce vs. Türsteher*in mit Pfefferspray), die Intensität und Frequenz (Reizdeprivation bis Reizüberflutung) sowie die Fähigkeiten und Ressourcen der Stimulierten eine Rolle. Des Weiteren ist die Berücksichtigung der individuellen Verfassung,
also des psychophysiologischen Gesamtgleichgewichts notwendig, um die effektive Auswirkung der Ausgleichsreaktion auf Reize (eine weitere Umschreibung für Stress) bewerten zu können. (Brockhaus, o. J.e; Kolar, 2021, S. 14).
Daraus ergibt sich eine komplexe, algorithmisch anmutende Abfolge von Prozesse, die gegenseitige Interdependenzen aufweisen. Die Mannigfaltigkeit des Stressor-Evaluierungsprozesses soll durch Abb. 4 veranschaulicht werden.
Diese Komplexität erklärt auch weshalb idente Ereignisse für verschiede Betroffene zu völlig anderen Reaktionen führen können. Außerdem wird ersichtlich, welcher Aufwand seitens des Organismus betrieben wird, um lediglich zu entscheiden, ob es sich bei einem Ereignis um eine relevante Bedrohung bzw. Herausforderung handelt und demnach eine adäquate Stressreaktion zur Leistungssteigerung eingeleitet werden muss, oder ob es sich um ein irrelevantes Event handelt. Die schwarzen Pfeile stellen Dysfunktionen (Missinterpretationen) dar, welche bei Überlastung oder mangelnder Aktivierung auftreten können. Je mehr Situationen/Stressoren evaluiert werden müssen, desto weniger Kapazität ist für den jeweiligen Prozess verfügbar. Die Notwendigkeit nach Abkürzungen (schnelles Denken; direkte Interpretation der Situation als positiv oder negativ) steigt – ebenso die Fehlerquote.

Abb. 4: Stressor-Evaluierungsprozess-Schema (eigene Darstellung angelehnt an Burisch, 2014, S. 82; Gerber & Schilling, 2018, S.145; Brockhaus, o. J.e)
Der mit der Bewertung potenzieller Stressoren an sich verbundene Aufwand stellt den Ursprung der sogenannten und viel diskutierten Reizüberflutung dar. In einer Epoche der konstanten Beanspruchung durch gezielte, künstliche Reize (Aktivierung, siehe Kapitel 2.3.3) ist die Summe vieler winziger Herausforderungen zum schwer fassbaren, jedoch nicht minder großen Problem geworden.
2.2.2 Stresskonzept der Allostase und Allostatic Load
Dieses Kapitel beruft sich zum überwiegenden Teil auf das gleichnamige Werk von Schulz, Heesen und Gold (2005) und ist insofern relevant, da es den Aspekt der Kumulation von kleinen Stressmengen mit Folgeerscheinungen in Zusammenhang bring, welche wiederum als Grundlage für weitere Beschwerden identifiziert werden können.
Allostase bildet das aktive Gegenstück zur Homöostase. Während zweiteres „für die Stabilität von Systemen, die lebenswichtige physiologische Parameter betreffen (z. B. ph−Wert, Körpertemperatur, Sauerstoffpartialdruck), reserviert wird, bezieht sich ,Allostase´ auf das Netzwerk von Mediatoren, die solche Systeme repräsentieren, die diese Stabilität durch Aktivitätsveränderungen aufrechterhalten (McEwen, 2004; zitiert nach Schulz et al., 2005, S. 453)“. Während also die Körpertemperatur einem Langstreckenläufer gleicht, der das Tempo halten muss, ist die Stressreaktion mit einem Volleyballspieler vergleichbar, der abwechselnde Phasen von situationsspezifischen Leistungen und Ruhephasen erlebt.
Eustress und Flow-Effekt
Dabei vermag die Sportmetapher einen weiteren Punkt zu erklären: Den positiven Aspekt von Stress. Denn, entspricht die Leistungsanforderung den Ressourcen des*der Athleten*Atlethin, sind Motivation und Ruhephasen ausreichend vorhanden und wird die Anstrengung als positive Erfahrung gewertet, so kann man von Eustress sprechen. Dieser ist die „positive Komponente des Stresses mit fördernden Auswirkungen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden (Brockhaus, o.J.a)“ und kann bis zu Euphorie führen.
Gelingt es über eine längere Zeit Anforderung und Fähigkeit im Gleichgewicht zu halten, spricht man vom Flow-Zustand. Der Ablauf der Tätigkeit wird als spontanes, ununterbrochenes und glattes Übergehen einer Phase in die folgende erlebt. Bewusste Konzentration ist nicht notwendig, sie stellt sich von selbst ein. Das Zeitempfinden wird stark verzerrt, man taucht in die Tätigkeit ein, ist sich seiner selbst nicht mehr voll bewusst (Rheinberg, 2010, S. 380).
Disstress ist zwar das dazugehörige Antonym, kann jedoch nicht als lineares Gegenstück zu Eustress gesehen werden, da er nicht per se pathologisch wirken muss. Als „Impfung durch Stress (Kolar, 2021, S.15; Übersetzung durch Autor) bzw. Training der Resilienz (sowie des
Immunsystems als ein Teil davon) sind regelmäßige, nicht dauerhafte unangenehme Situationen (normale Stressreaktionen; vgl. Abb. 5) sogar ein fester Bestandteil der Entwicklung zum widerstandsfähigen Menschen. Eine übertriebene Abneigung zum Unangenehmen, Ungemütlichen, führt daher sogar zum paradoxen Effekt der „Schwächung durch Komfort [und Wohl-
stand] Kolar, 2021, S.12)“ und bildet somit die Grundlage von sogenannten Zivilisationskrankheiten, die sich als „Folge[n] der durch technischen Fortschritt und Umweltbedingungen hervorgerufenen Änderung des Lebensstils und der Ernährung (Brockhaus, o. J.g)“ definieren lassen.
Abb. 5: Normale Stressreaktion – auf Aktivierung folgt Erholung; einfache (links) und sich wiederholende Begegnung mit Stressoren (Schulz et al., 2005, S. 454)

Die Summe der Aufwendungen des Systems für Reaktionen auf Stressoren wird als Allostatic Load bezeichnet und muss dem dynamischen Wechselspiel von Aktivierung und Entspannung folgen. Wird stets neuen Stressoren begegnet, oder gelingt keine Habituation, welche die Stressantworten auf Bekanntes schrittweise vermindert (vgl. Abb. 6), droht auch einem gut funktionierenden allostatischen System die Überlastung (Reizüberflutung) durch zu häufige Reaktionen. Verschiedene Dysfunktionen, wie verspätetes oder gänzlich ausbleibendes Abstellen der Reaktion bzw. die unzureichende Aktivierung (vgl. Abb 7) stellen weitere Risiken dar. Betrachtet man allostatische Ausgleichsreaktionen isoliert, so treten primäre Effekte auf. Diese stellen „eine Vielzahl zellulärer Ereignisse … [wie] die Aktivierung von Enzymen, Rezeptoren, Ionenkanälen oder Strukturproteinen …[dar] (Schulz et al., 2005, S. 455)“. Kaskadenartig kumulieren sich bei langfristiger Überbeanspruchung diese Effekte und führen zu sekundären und tertiären Effekten
Abb. 6: Wiederkehrende normale Reaktion mit Habituation (Schulz et al., 2005, S. 454)


Abb. 7: Überschießende und unzureichende Stressantwort (Schulz et al., 2005, S. 454)

2.2.3 Chronischer Stress, Symptome und Auswirkungen
Sekundäre Effekte beschreiben Auswirkungen kumulierter Ansprüche, die sich aus häufig auftretenden primären Effekten ergeben. Erhöhter Blutdruck oder Einbußen kognitiver Leistungsfähigkeit sind Beispiele dafür.
Tertiäre Effekte sind wiederum Auswirkungen kumulierter Ansprüche langfristig auftretender sekundärer Effekte und können etwa bei langfristig erhöhtem Blutdruck zu einem Myokardinfarkt führen oder bei anhaltenden Einbußen kognitiver Leistung eine Alzheimer-Erkrankung zur Folge haben.
In seiner breiteren Betrachtung der Beziehung von chronischem Stress und Krankheit identifiziert Steptoe (1991) zwei grundsätzliche Wege, die zu effektiven Gesundheitsrisiken führen können: Einerseits die eben beschriebene Kausalkette, die sich direkt im chronischen psychophysiologischen Stressgeschehen begründet. Hierzu gibt es eine Vielzahl an aussagekräftigen Studien, die neben körperlicher Leiden (Everson-Rose et al., 2014; Machado et al., 2014, S. 797; Steptoe & Kivimäki, 2013, S. 348) vor allem auch geistige Krankheitsbilder wie Depression oder Burnout mit chronischem Stress in Verbindung bringen (McGonagle & Kessler, 1990, S. 703704; Steinhardt et al., 2011, S. 426 ).
Andererseits weist er auf die Kognitiv-behavioristischen Auswirkungen von Stress (Coping) hin. Diese können zu gesundheitlich kontraproduktiven Reaktionen als Lösungsansätze führen, wie zB. hohe Risikobereitschaft, erhöhter Alkoholkonsum, Rauchen, falsche Ernährung etc. (Steptoe, 1991, S. 637-641; Walker & Walker, 1988, S. 15 ) Diese Verhaltensweisen führen ihrerseits
zu spezifischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Krankheiten, Unfällen oder Tod. Diese These mag trivial anmuten, weitet sie doch das ohnehin große, pathogene Potenzial der Stressbelastung unter Einbeziehung solch umfangreicher Themen wie Unfallverhütung, Süchte etc. enorm aus. Zum besseren Verständnis der Relevanz kann aber beispielsweise die Magersucht, Schlafmittelabhängigkeit oder Suizid angeführt werden; Aus gesundheitlicher Sicht allesamt fehlgeschlagene Lösungsansätze für subjektiv akute (Stress-)Belastungen.
Coping Strategien im engeren Sinne sind intuitive Reaktionsmuster bei akuter Stressbelastung und lassen sich in emotionsorientierte (Umdeutung, Abwertung von Zielen, Verleugnung) oder problemorientierte (konstruktive Lösungsansätze) unterteilen. Grundsätzlich wenden alle Menschen situationsabhängig beide Muster an (Burisch, 2014, S. 83).
Im weiteren Sinne, und für diese Arbeit von größerer Bedeutung, sind proaktive Strategien zur Vorbeugung bzw. dem Abbau von sich akkumulierender Stressbelastung, bevor sie nachhaltig unsere Allostase beeinträchtigt. Kaluzas Model des instrumentellen Stressmanagements stellt eine Möglichkeit dafür dar: „Instrumentelles Stressmanagement setzt an den (potenziellen) Stressoren an, mit dem Ziel, diese zu reduzieren oder ganz auszuschalten … [und] eine möglichst stressfreie Gestaltung eigener Arbeits- und Lebensbedingungen [zu etablieren] (Gerber & Schilling, 2018, S.145-145).“
In einer anderen Studie kommen Taylor, Repetti und Seeman (1997, S. 439).) unteranderem zu zwei grundsätzlichen Erkenntnissen: Individuen, die einer ungesunden Umgebung ausgesetzt sind (Umgebung, die chronischen Stress verursacht, toxische Beziehungen) und/oder in kein funktionierendes soziales Umfeld eingebunden sind (diese bietet Sicherheit und Möglichkeit zur sozialen Integration), haben ein deutlich höheres Risiko für psychologisch bedingte gesundheitliche Komplikationen. Ein gesundes soziales Umfeld sowie das Vermeiden von ungesunden bzw. das Verweilen in gesunden Umgebungen lässt sich daraus als Strategie ableiten.
Als gesunde Umgebung im österreichischen Kontext wird traditionell der Wald (Spazieren gehen), die Berge (Wandern, gesunde Bergluft) oder der See (ein Tag am See) angesehen. Aus internationaler Sicht lassen sich positive Effekte auf Menschen feststellen, die auf Aufenthalte am Meer zurückzuführen sind. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Belegen für diese natürlichen Strategien, mit Stress umzugehen, finden im Kapitel 2.4 statt. Die im Rahmen dieses Kapitels über Stress zusammengetragene Theorie lässt folgende Schlüsse zu: Ausbildung von Resilienz durch angemessene Stressimpulse, adäquate Ruhephasen, bewusste (Stress-)Wahrnehmung sowie den persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen angepasste Leistungsanforderung können die Gesamtbelastung durch Stress (Allostatic Load) effektiv vermindern. Außerdem kann eine proaktive (Um-)Gestaltung der eigenen Umwelt zu besseren Voraussetzungen führen, mit Stressoren umgehen zu können. Nicht nur die Reduktion von Stressreaktionen an sich, sondern vor allem mäßiger Kontakt mit potenziellen Stressquellen (und den damit verbundenen Bewertungsprozessen) kann Ressourcen für tatsächliche Herausforderungen freisetzen.
Dies lässt sich auch mit der Trend-Gegentrend Dialektik nach Horx (2021, S. 8-9) im Einklang bringen, wonach sich im Trend der stetigen Technologisierung der Gegentrend Digital Detoxing begründet, welcher wiederum mit dem Bedürfnis nach mehr Achtsamkeit in Beziehung steht.
Ergänzend ist festzuhalten, dass Alltagsstress und seine Wirkmechanismen, wie bisher in diesem Kapitel dargestellt, das Basismaterial dieser Arbeit formen, das mit den Themenbereichen Millennials, Marktforschung sowie Natur verflochten wird. Dabei werden relevante Schnittstellen beleuchtet und diskutiert. Außerordentliche Formen von Stress wie die Posttraumatische Belastungsstörung (PTB) werden trotz klarer Indikationen für immense mentale Herausforderungen nicht in die Betrachtung miteinbezogen. Obwohl sie zusätzliche Belastung für Betroffene bedeuten, ist es schwierig, prophylaktische Maßnahmen dagegen zu erarbeiten. Um so wichtiger scheint es, durch angebrachte, alltägliche Begegnungen mit Stress an der eigenen Resilienz zu arbeiten. Unfallverhütung und gesunde Lebensweise stellen pauschale Möglichkeiten dar (Mayer & Steil, 1998).
2.3 Marketing
Dieses Kapitel erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Übersicht der Materie an sich, sondern widmet sich einer Abfolge von Entwicklungen der systematisch demoskopischen Marktforschung und Werbestrategien, welche potenziell zu negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Menschen führen können. Denn wo betriebswirtschaftliches Interesse, Daten zu ermitteln und Werbung zu betreiben, auf das Recht auf Privatsphäre und Unversehrtheit trifft, ergibt sich eines der großen Spannungsfelder unserer Zeit. Auf dieses Konfliktpotenzial reagiert die Europäische Union mit der Datenschutzgrundverordnung (2018) als regulierendem Eingriff, der als Schutz der Rechte der Bürger*innen anzusehen ist. Schutz gegen Instrumente einer Industrie, die zunehmend in Kritik gerät, zur Unzufriedenheit (Kross et al., 2013) oder gar Erkrankungen derer beizutragen (Peterka-Bonetta et al., 2019), in deren Interesse sie behauptet zu handeln. Mehr zu problematischen Verflechtungen von Marktforschung und Social Media ist im Gliederungspunkt 2.3.3 Gegenwart zu finden.
Die Kontroverse der Möglichkeiten durch intensive Datenerhebung im Alltag und den damit verbundenen Risiken lässt sich einleitend folgendermaßen zusammenfassen:
„Der Begriff »Big Data« lässt unweigerlich an »Big Brother«, also an Überwachung und Kontrolle durch Internetgiganten und Technologiekonzerne, an eine Welt ohne Geheimnisse und Privatsphäre denken (Brockhaus, o. J.b)“.
Manfred Hüttner (2019) definiert in seinem vielfach zitierten Werk Grundzüge der Marktforschung den Begriff Marktforschung als „systematische[n] Prozeß der Gewinnung und Analyse von Daten für Marketingentscheidungen“.
Für die Diskussion von potenziellen Stressoren von Millennials ist zunächst wichtig, den Begriff weiter einzugrenzen, da nicht alle Instrumente der Marktforschung relevant sind. Explizit liegt das Augenmerk auf einem Bereich der Datengewinnung bei Endverbrauchern; der originären Datenermittlung, wobei besonders die Entwicklung der psychografischen Forschung von Interesse ist. Um den Einfluss moderner Marktforschender und ihrer Instrumente auf die Kohorte der Millennials sowie das Ausmaß und Beschaffenheit dieser Beziehungen zwischen Mensch und datenerhebenden Unternehmen beurteilen zu können, ist es hilfreich, die Geschichte und Entwicklungsmeilensteine dieser Industrie zu betrachten. Dieser Beitrag soll einerseits die grundsätzliche Legitimität von Forschungsinteressen seitens der Betriebe darstellen, diese aber andererseits im Kontext des seelischen Gleichgewichts der Forschungssubjekte betrachten und zu einer differenzierten, ethischen Diskussion über die Methoden und Instrumente vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Marktforschungspraxis einladen.
2.3.1 Anfänge der Marktforschung
Spätestens seit der Entwicklung von marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaften ist es für Verkäufer von Vorteil, Informationen über potenzielle Kunden in Erfahrung zu bringen. Im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage lassen sich so gewonnene Erkenntnisse in verschiedene betriebswirtschaftliche Bereiche einbinden, beispielsweise die Produktentwicklung, Vertriebs- oder Preispolitik, um das Angebot besser auf die Nachfrage auszurichten. Dies verspricht einen Wettbewerbsvorteil für die am besten informierten Betriebe und lässt eine Anlehnung an die heute allgemeingültige Auslegung der Anpassungsthese der Darwin’schen Evolutionstheorie zu, wonach auch hier „der am besten [an die Kundenbedürfnisse] angepasste [betriebswirtschaftlich] überlebt (Devriese, 2018; Übersetzung und Adaption durch Autor)“
Es wird begonnen, Daten für diesen Zweck zu erheben. Laut dem Cambridge Academic Content Dictionary unterscheidet sich data von information durch die Intention zum Beobachtungszeitpunkt. Daten sind demnach Informationen, die gezielt mit der Absicht einer späteren Verwendung gesammelt werden. (Cambridge University Press, o.J.a;c)
Ohne das Wissen um die „auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung aufbauende Theorie der Stichproben [ist dieses anfängliche Sammeln der Daten] gekennzeichnet durch die Befragung möglichst großer Massen … [da man sich] ein um so genaueres Ergebnis … [erwartet], je größer die Befragungsmasse ist.“ (Hüttner, 2019, S. 6)
Dieser rein quantitative Ansatz war nicht zuletzt wegen der begrenzten Rechenkapazität vorerst zu mäßigem Erfolg verurteilt. IBM ist zu dieser Zeit noch für ihre „special purpose maschines for sorting“ (Knuth, 1970) bekannt – Computer sind noch nicht existent Im frühen 20. Jahrhundert finden die systematische Datenerhebung und Analyse vermehrt Anerkennung als neuer, eigenständiger Geschäftszweig. Der amerikanische Begründer der kommerziellen Marktforschung, J. George Frederick, schätzt jedoch, dass 1910 weniger als 50.000 USD für die Sammlung von Marktinformationen ausgegeben wurden (Lockley, 1950, Seite 734). Der Aufstieg dieses neuen Geschäftsfeldes zum Industriesektor mit über 47.000.000.000 USD Umsatz in den USA bzw. 73 Mrd. USD weltweit im Jahr 2019 (ESOMAR, 2020 & 2021) scheint zu dieser Zeit undenkbar, denn es fehlen einige entscheidende Entwicklungen, um die Datenermittlung sowie Analyse systematischer und skalierbar zu gestalten
Als 1946 die Entwicklung des „ENIAC (Electric Numerical Intergrator and Computor)“ (Knuth, 1970, S. 249), dem entfernten Vorläufer des heutigen Computers, abgeschlossen ist, wiegt der Prototyp 30 Tonnen, verfügt über eine Speicherkapazität für 20 Wörter und stellt für Frederik und seine Fachkollegen noch keine Unterstützung beim Datenmanagement, geschweige denn bei deren Ermittlung oder Analyse, dar.
Ein anderer wichtiger Meilenstein der modernen Marktforschung, die Formulierung der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Kolmogoroff, 2013), ist zu dieser Zeit 10 Jahre jung.
Es ist eine Phase des Strebens nach besserem Verstehen der menschlichen (Konsum-)Bedürfnisse. Die eingesetzten Mittel begrenzen sich auf „primitive and biasing [questionnaire] by today‘s standards“ (Lockley, 1950, Seite 735).
2.3.2 Methodologische und Technologische Entwicklung
Mit dem Aufkommen zunehmend leistungsstärkerer Rechner kommen in der zweiten Hälfte des 19. Jhd. neue Möglichkeiten auf, Daten zu verarbeiten. Der heute allgemein geläufige Begriff EDV steht für Elektronische Datenverarbeitung; ein bis dato kaum bewährter Prozess, der mit dem IBM 650 erstmals Verbreitung unter Forschenden findet. Die dazu entwickelte Vertriebsstrategie der Firma IBM sieht vor, dass Universitäten, welche entsprechende EDVunterstützte Kurse anbieten und bewerben, ein bis zu 60 prozentiger Nachlass auf die hohen Anschaffungskosten gewährt wird (Galler, 1986)
Abseits der akademischen Wissenschaft wird das Potential auch in Marktforschungskreisen erkannt und erste EDV-gestützte Methoden entwickelt. Diese sind zwar fortschrittlich und werden früh auch zur Datenerfassung, nicht nur zur Verwaltung, Verarbeitung und Analyse, adaptiert, jedoch sind sie stets auf die freiwillige Hilfe von Umfrageteilnehmern angewiesen. Eine Orwell’sche Dystopie und den ihr immanenten, bedrohlichen Aspekt der Technologieentwicklung vermag zu dieser Zeit zwar bereits ein Einzelner vorherzusehen (Orwell, 1949), die Ansicht stößt bei seinen Zeitgenoss*innen jedoch auf Unverständnis (Lucas, 2003, zitiert nach Diglin, 2014, S. 609). Von personalisierten Werbeinhalten im heutigen Sinne, deren Treffsicherheit teils als beunruhigend wahrgenommen wird (Bock, 2017) ist man weit entfernt. Im Jahre 1972 versteht man unter „Einsatzmöglichkeiten des Computers zur persönlichen Gestaltung der Direktwerbung“ (Bidlingmaier, 2013, S. 184) noch lediglich, dass „innerhalb der Mitteilung Name und/oder Adresse des Empfängers benutzt werden, d. h. das Verkaufsangebot einen persönlichen Charakter bekommt“ (Bidlingmaier, 2013, S. 184).
Diese Phase der Markforschungsentwicklung zeichnet sich einerseits durch das konstruktive Streben nach einer einfacheren, niederschwelligen Datenermittlung aus. Diese soll durch ihre erhöhte Effizienz beiden dienen; den Forschenden sowie den Forschungssubjekten. Es werden dafür verschiedenste Gerätschaften entwickelt. Darunter mobile Anlagen, welche „Antworten über eine numerische Tastatur (zur Beantwortung geschlossener Fragen) oder eine alphanumerische Tastatur (zu Beantwortung offener Fragen)“ (Zentes, 2013, S. 6-7) erfassen und für die Auswertung speichern können. Auch ganze Räumlichkeiten, in denen „bis zu 40 Personen gleichzeitig interviewt werden … [und] Das Unternehmen [dadurch] an einem Vormittag … 500 bis 600 Interviews durchführen und auswerten [kann] werden verwirklicht (Zentes, 2013, S. 6).
Andererseits wird hier bereits technisches Potenzial zur Generierung von Metadaten (Daten über Daten, Brockhaus, o. J.c), erkannt und für eine Erweiterung der Datenausbeute genutzt. Dies geschieht beispielsweise durch die Messung von Reaktions- und Antwortzeiten während der Befragungen (Zentes, 2013, S.7).
Da die Erfassung relevanter Daten der relevanten Individuen die Kapazitäten der Forschenden übersteigt, entwickelt man zunehmend Kategorien, an denen man sich orientieren will. Ein Beispiel dafür sind die VALS (Values and lifestyle; Mitchell, 1983) und LOV (List of values; Kahle et al., 1986) Methoden, welche in ihrer Entwicklung die damals demografisch orientierte Marktforschung erstmals systematisch um psychografische Fragen ergänzt haben. Und obwohl ihre Aussagekraft zukünftiges Kundenverhalten einzuschätzen als unzuverlässig beschrieben wird (Yankelovich & Meer, 2006, S. 2) repräsentieren sie den Wandel der modernen Marktforschung insofern, dass sie Menschen mit ähnlichen Charakteristiken zu Gruppen zusammenfassen. Das Interesse am Muster-Individuum wächst über seine äußeren Gegebenheiten (demografische Daten) hinaus (bzw. hinein) in die Psyche der Forschungssubjekte als neue Datenquelle; Werte, Überzeugungen, Aspirationen, Interessen und Aktivitäten (Cugh, 2020, S. 1965) sind nun im Fokus. Mithilfe dieser Daten wird der Markt segmentiert und die Konzeption entsprechender, prototypischer Personas wird zur gängigen Praxis. Datensätze bekommen somit eine Projektionsfläche, der man als Dienstleister bzw. Konsumartikelproduzent empathisch begegnen kann; sie werden lebendig (Kahle et al., 1986, S. 406).
Im Zuge stetiger Optimierung von Methoden erkennt man, dass Forschungssubjekte selbst eine mögliche Fehlerquelle darstellen. Das teils bewusste, teils unterbewusst Bedürfnis nach sozialer Erwünschtheit kann Ergebnisse der Marktforschung verfälschen (Michelis, 2014, S. 112). Bis dato sind Marktforschende bei Datenerhebungen auf Aufrichtigkeit sowie Freiwilligkeit der Teilnehmenden angewiesen. Dies stellt eine Limitation dar, da angenommen werden kann, dass einerseits lediglich ein Teil der Bevölkerung überhaupt bereit ist, an einer Befragung teilzunehmen (Gefahr der Selbstselektion; Ruso, 2007, S. 528) und dieser andererseits zB. intime Beweggründe, illegale Absichten oder verpönte Handlungsmotive kaum angeben wird.
Aus der Perspektive der Marktforschung aus betrachtet, ist man demnach von freiwilligen, bewusst getätigten (Datenab-)Gaben abhängig. Eine alternative zur qualitativen Befragung stellt die qualitative Beobachtung dar. Diese Methode „beschreibt und interpretiert Verhalten direkt ohne den kognitiven Umweg der Verbalisierung durch die handelnde Person“ (Ruso, 2007, S. 527) und eliminiert dadurch eine der zwei Limitationen der Methode der Befragung. Die Freiwilligkeit und Unterrichtung eines Forschungssubjektes darüber, das Daten erhoben werden, sind Merkmale der sogenannten offenen Form einer Beobachtung. Dagegen ist es laut Ruso ethisch zulässig, in stark frequentierten öffentlichen Räumen die verdeckte Form der qualitativen Beobachtung zu praktizieren. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Subjekte später aufgeklärt werden und ein entsprechendes Einverständnis eingeholt werden kann. (Ruso, 2007, S. 532).
Ein völlig neuartiger, bald stark frequentierter öffentlicher Raum, das Internet, entsteht 1969 (University of California, o. J.) und entwickelt sich, dank korrespondierender technologischer Erfindungen, schrittweise nicht nur in alle denkbaren Bereiche des menschlichen Lebens, sondern auch zum bevorzugten Medium moderner quantitativer und qualitativer Markforschung (Binder & Weber, 2015, S. 32; GreenBook, 2021).
Die Meilensteine dafür sind: 1975 die Gründung von Microsoft, 1976 der erste Personal Computer (PC) von Apple, 1991 die Entwicklung der HTML-Webseite und Internetsuchmaschinen (Browser), 1994 die Gründung von Amazon, ein Jahr später die Entstehung von Google, 2004 die Gründung von Facebook und schließlich der Beginn der Smartphone-Ära, die 2007 durch das erste iPhone begründet wird (Montag, 2021, S. 30-31).
Die Fülle an modernen Medien und die damit diversifizierte Mediennutzung (in Kontrast zu traditionellen Kanälen wie TV, Radio und Druck) scheint für die Marktforschung anfangs eine noch nie dagewesene Herausforderung darzustellen, breitenwirksame Werbung zu vertreiben (Valentine & Powers, 2013, S. 598). Scott Galloway beschreibt in seinem Bestseller The Four jedoch eindrücklich, wie die einstige Bandbreite genutzter Medienkanäle durch den rasanten Aufstieg von Apple, Amazon, Google und Facebook (The Four) geschmälert und schließlich auf einige wenige verteilt wird. Er kommt außerdem zum Schluss, dass die Voraussetzung für außerordentliches wirtschaftliches Wachstum zwischen 2010 und 2015 Firmenunabhängig auf die Verbindung zweier Komponenten zurückzuführen ist: Nutzer*innen(-daten) und Algorithmen. Erstere nennt er „receptors“, zweiteres „intelligence“ (Galloway, 2017, S. 97).
Erste wissenschaftliche Studien greifen das Thema Social Media-Sucht bereits ab dem Jahr 2007 auf. Zwei Jahre später erscheint Social network and addiction (Barbera et. al, 2009), eine Zusammenfassung des damaligen Forschungsstandes des neuen, exponentiell wachsenden
Phänomens der Social Media-Nutzung. Die Autoren weisen in ihrer Konklusion auf die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit diesem Forschungsfeld hin und kommen unter anderem zu den folgenden Erkenntnissen:
„Signs of possible social network addiction included frequently visiting the site for long time, experiencing negative psychological or physical effects when the activity wasn’t available, and scheduling other activities around online time (Barbera et. al, 2009, S. 35)”
Am 6. Oktober 2014 berichtet das renommierte Finanzmagazin Forbes über die Übereinkunft von Facebook und WhatsApp: Erstgenannter übernimmt zweitgenannten um 19 Mrd. USD.
Eine Firma, die in den Augen der Nutzer*innen ihrer Produkte eine Gratisdienstleistung anbietet, kauft, 10 Jahre nach ihrer Gründung, eine Firma, die in den Augen ihrer Nutzer*innen eine Gratisdienstleistung anbietet. Um 19.000.000.000 US-Dollar. Diese Aussage ist scheinbar leicht als naiv zu enttarnen. Allerdings kommt die Studie (n=1016) der Universität Wien zum Ergebnis, dass nur 1% der befragten Facebooknutzer*innen tatsächlich weiß, in „welche Arten der Datenverarbeitung sie eingewilligt haben (Rothmann & Buchner, 2018, S. 5)“. Werden sie mit den konkreten Datenverarbeitungsarten konfrontiert, würden ihnen lediglich 3% freiwillig zustimmen (Rothmann & Buchner, 2018, S. 5).
2.3.3 Gegenwart – Go big or go home
Werbung hat stets zwischen Menge und Zielgenauigkeit wählen müssen (Galloway, 2017, S. 92). Meta, Alphabet und Co. bieten mittlerweile beides, enorme Reichweiten bei hoher Präzision (Stichwort: Micro-Targeting). Die als unentgeltliche Dienstleistung getarnte Datenerhebung (vgl. weiter oben) liefert nicht nur die Daten, sondern stellt gleichzeitig das Medium zur Distribution der personalisierten Werbung dar. Laut einer im September 2021 entstandenen Studie sind die fünf reichweitenstärksten Webseiten Österreichs Google, YouTube, Amazon, WhatsApp und Facebook gefolgt von Wikipedia und Instagram (Reppublika, 2021). Im Vergleich mit der kombinierten Reichweite aller Tageszeitungen (einschließlich Gratisblätter), welche in Österreich pro Tag ca. 4,5 Mio. Leser*innen umfasst (Statistik Austria, 2022a), erreicht alleine das Unternehmen Alphabet täglich ca. 6,75 Mio. per Google und knapp 6 Mio. per YouTube (Eurostat, 2021; Reppublika, 2021; Statistik Austria, 2022b).
Außerdem stellt für Fichter (2018, S. 103) die Evaluierung der Wirksamkeit „die Gretchenfrage der Werbebranche“ dar. Dank zunehmender Zahl an Onlinekäufen bei gleichzeitiger Beschattung des Onlineverhaltens durch sogenannte Cookies der Vermittlermedien scheint diese Frage zunehmend beantwortet zu sein. Das disruptive Potenzial neuer, interaktiver Medien für die Werbebranche ist enorm – so wie die damit einhergehende Verantwortung. Noch nie waren Menschenleben mit digitalen Diensten so eng verwoben (vgl. Kapitel 2.1.2).
„Wer Werbung betreibt, bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Manipulation und Information“, heißt es im Lehrbuch Wirtschaftspsychologie für Bachelor (Fichter, 2018, S. 115). Wurden im Namen des Profits Grenzen verschoben, um an ausreichend Daten – „das Öl des 21. Jahrhunderts (Horx, 2021, S. 20)“ – zu gelangen?
Der Meta Konzern (Facebook & Co) gibt für das Jahr 2021 Gesamteinnahmen von rund 118 Milliarden USD an (Meta Platforms, 2022). Laut dem Internet Advertising Revenue Report (IAB, 2021, S. 9-13) belaufen sich die Gesamteinnahmen der Online-Werbeindustrie auf rund 190 Milliarden USD. Außerdem stellt der Bericht zunehmenden Datenschutz (strengere iOS-Datenschutzbestimmungen) als Risikofaktor dar und prophezeit dem Meta Konzern zweistellige Milliardeneinbußen. Im Oktober 2022 wird Meta wegen des Umgehens dieser iOS-Datenschutzänderung zu einer Strafe von 402 Millionen USD verurteilt (Wadhwani, 2022a). Das ist kein Einzelfall: insgesamt wurden 2022 gegen den Konzern in fünf Fällen Strafen in einer Gesamthöhe von rund 786 Mio. USD verhängt (Wadhwani, 2022b). Diese Summen verdeutlichen nicht nur den immensen monetären Wert der Daten an sich, sondern auch der Infrastruktur zu deren Erhebung, welche unter Inkaufnahme derart hoher Strafen weiter betrieben wird.
Psychoinformatik als Instrument der Marktforschung
Psychoinformatik, die: Automatisierte psychologische Forschung unter Anwendung moderner Informatik (Montag et al., 2016, S. 2).
Soziale Medien haben einerseits die Qualität einer (neuartigen und digitalen) Räumlichkeit, in der konventionelle Methoden der Marktforschung eingesetzt werden können. Andererseits sind Soziale Medien als Instrument anzusehen, da die Betreiber letztendlich absolute Kontrolle über diesen Raum haben und Parameter verändern, Funktionen hinzufügen oder entfernen können. Dies entspricht im Grunde der Definition des wissenschaftlichen Experiments als Marktforschungsmethode (Michelis, 2014, S. 113). Für Fichter (2018, S. 114) ist das Experiment „die Königsmethode der Psychologie (2018, S. 114).“
Dabei lässt sich die jeweilige Applikation (Facebook, Google, Instagram etc.) auch als eine Weiterentwicklung des im Kapitel 2.3.2 beschriebenen mobilen Gerätes zur Dateneingabe verstehen. Die Schwelle zur Dateneingabe wird durch effektive Verknüpfung mit alltäglichen Handlungen derart gesenkt, dass die Datenabgabe nichtmehr als solche wahrgenommen wird (Rothmann & Buchner, 2018, S. 5).
Das Soziale Medium wird aus dieser Perspektive zu einer von Technologie mediierten, großangelegten, automatischen, (halb)verdeckten Art der Beobachtung. Gleichzeitig vereint es aber die Vorteile der offenen Art der Beobachtung, z.B. Möglichkeiten, besondere Vorlieben oder Abneigungen zu akzentuieren. Als Facebooknutzer*in macht man dies bspw. durch das „Liken“ bzw. die Verwendung der Reaktionsfunktionen unter Beiträgen – mit der Absicht, das Publikum wissen zu lassen, was einem wichtig ist. Während das Publikum in konventionellen, offen Arten der Beobachtung die Forschenden sind, ist es im Falle Facebooks, aus der Sicht der User, der digitale Freundeskreis. Dies lässt die Überlegung zu, ob es sich bei Sozialen Medien überhaupt noch um öffentliche Räume handelt –aus ethischer Sicht eine Voraussetzung für die verdeckte Art der qualitativen Beobachtung. Eine pauschale Einwilligung zur Datenermittlung im Vorhinein (wie im Fall von Sozialen Medien durch Akzeptieren der AGBs) entspricht nicht einer verantwortungsvollen Praxis der Marktforschung (Ruso, 2007, S. 532).
Die enormen Datenmengen stellen laut dem Marketing-Review der Universität St. Gallen zwar eine Chance dar, gleichzeitig sind sie jedoch eine Herausforderung. Denn Menge, Geschwindigkeit und insbesondere die Vielfalt (strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten) von Big Data übersteigt die Verarbeitungskapazitäten konventioneller Marktforschender (Binder & Weber, 2015, S. 33). Allerdings sind Kosten für Speicherung von Daten in den vergangenen 25 Jahren auf ca. 0,5% gefallen (McCallum, 2022). Das Rennen um die Deutungshoheit dieser Ressourcen ist längst im vollen Gange (vgl. Abb. 8), erstes Zwischenergebnis liegt vor.
Abb. 8: Paradigmenwechsel; Entwicklung von Interesse an klassischer Marktforschung versus an Big Data (Binder & Weber, 2015, S. 32).

Der sogenannte Cambridge Analytica Skandal verdeutlicht das Potenzial großer Datenmengen (Big Data) in Kombination mit Psychoinformatik: Mit einem Datensatz von 270.000 Personen wird ein Code-Schlüssel angefertigt, der aufgrund von Online-Verhalten Dritter auf deren Persönlichkeitsmerkmale schließen lässt. Damit wird im Anschluss entsprechende Werbung entwickelt und gezielt eingesetzt, um die Abstimmung über den EU-Austritt Englands bzw. die US-amerikanische Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Die Grenzen der Analysekapazitäten werden damit weiter verschoben; 50 Millionen Facebook-Profile lassen sich im Jahr 2015 mit der Cambridge Analytica Methode um 1 Million USD verarbeiten (Cadwalladt & Graham-Harrison, 2018).
Das Geschäftsmodell mit Haken
Es ist grundsätzlich anzuerkennen, dass das Social Media-Konzept bei seinen Nutzer*innen erfolgreich ist, da es an grundlegende menschliche Bedürfnisse (Wunsch nach Anerkennung, sozialem Vergleich, Gesellschaft, Neuigkeiten, Unterhaltung etc.; Festinger, 1954; Wood, 1989) ankoppelt. Das Angebot appelliert, je nach dem, an hedonistische und/oder utilitaristische Motivationen. Vereinfacht gesagt hängt der Erfolg Sozialer Medien davon ab, ob es der*die Nutzer*n als a) unterhaltsam, b) nützlich oder c) unterhaltsam und nützlich wahrnimmt.
Soweit die Interessen und Motivationen seitens der Konsumenten. Der wirtschaftliche Erfolg von diesen Medien hingegen hängt von Werbeeinnahmen ab. Werbeeinnahmen sind abhängig von Reichweite und Wirksamkeit. Wirksamkeit verlangt Daten, Reichweite hingegen Masse und
Zeit bzw. Frequenz. Facebook Gründer Mark Zuckerberg versichert vor dem US-Kongress, dass eine süchtig machende Wirkung des Dienstes nicht beabsichtigt sei und er diese auch nicht erkennen kann (Bloomberg, 2020).
Anders als Social Media Addiction (SMA; Sun & Zhang, 2021) wird 2022 Gaming Disorder offiziell als Krankheitsbild in die ICD-11 Liste der World Health Organisation (WHO, 2022) aufgenommen. Es scheint in gleicher Kategorie wie Gambling Disorder auf und wird wie folgt definiert:
… impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, duration, termination, context); 2. increasing priority given to gaming to the extent that gaming takes precedence over other life interests and daily activities; and 3. continuation or escalation of gaming despite the occurrence of negative consequences. The pattern of gaming behaviour may be continuous or episodic and recurrent. The pattern of gaming behaviour results in marked distress or significant impairment in personal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning (WHO, 2022)
Zahlreiche Studien lassen darauf schließen, dass ähnliche Aspekte der Veränderung des menschlichen Verhaltens von Facebooknutzer*innen selbst oder von Forschenden beobachtet werden (Moreno et al., 2013, S. 6; Ryan et al., 2014, S. 145; Sun & Zhang, 2021, S. 7). Darüber hinaus gibt Neymans Arbeit A survey of addictive software design (2017, S. 12-14) einen Überblick der angewandten Strategien von Betreibern Sozialer Medien, die dazu dienen, User immer weiter an den jeweiligen Dienst zu binden und Interaktion sowie Nutzungszeiten zu verlängern (Vgl. Abb. 9) und stellt auch die korrespondierenden, psychologischen Aspekte bzw. konkrete Experimente vor. Eine andere Studie kommt gar zum folgenden Schluss: „The dopamine is most responsible for pleasure feeling. Social media dopamine loop is explained which is a similar version of drug addicted dopamine loop (Macït et al., 2018).
Außerdem stehen Geständnisse früherer Mitentwickler im Widerspruch zur eben erwähnten Aussage Zuckerbergs. So wird Sean Parker, ehemaliger Gründungspräsident von Facebook, in einem Interview mit The Guardian so zusammengefasst: „Facebook’s founders knew they were creating something addictive that exploited `a vulnerability in human psychology’ from the outset (Solon, 2017)“. Justin Rosenstein und Leah Pearlman, Entwickler des Facebook-Like Buttons, berichten ihrerseits über Probleme, sich der süchtig machenden Wirkung ihrer eigenen Schöpfung zu entziehen und geben an, deshalb jeweils Hilfe von Dritten organisiert zu haben, die sich statt ihnen um ihre Sozialen Kanäle kümmern. The Guardian fasst Nir Eyal, den Verfasser von Hooked: How to Build Habit-Forming Products, der im Silicon Valley jahrelang seine Lehre des manipulativen App-Designs unterrichtet haben soll, folgendermaßen zusammen:
… subtle psychological tricks … can be used to make people develop habits, such as varying the rewards people receive to create `a craving’, or exploiting negative emotions that can act as `triggers’. `Feelings of boredom, loneliness, frustration, confusion and indecisiveness often instigate a slight pain or irritation and prompt an almost instantaneous and often mindless action to quell the negative sensation’. (Lewis, 2017)
Rückblickend betrachtet Nir Eyal die mit seiner Hilfe entstandenen Produkte als Zwänge, wenn nicht gar als vollwertige Süchte. Auch Loren Brichter, der Designer der Pull-To-Refresh Funktion, bezeichnet seine Erfindungen als süchtig machend und bereut (Lewis, 2017).
Abb 9: Analyse süchtig machenden Strategien verschiedener Dienste (Neyman 2017, S. 15)
Fichter stellt in seiner Arbeit (2018, S. 100) den potenziell problematischen Zusammenhang von Wissenschaft und Werbung folgendermaßen dar:
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Werbepsychologie die wohl kontroverseste Disziplin der Wirtschaftspsychologie ist. Kein Wunder, schließlich dient Werbung dazu, Einstellungen, Emotionen und Verhalten von Konsumenten zu beeinflussen, und die Werbepsychologie bietet das Werkzeug dazu, indem sie Wahrnehmung, Denken, Affekt

und Gedächtnis der Empfänger von Werbebotschaften untersucht … Im Fall von kommer-
zieller Werbung dient diese Beeinflussung dazu, uns zum Kauf zu bewegen.
Auch Daniel Michelis beschreibt im Kapitel Determinanten des Kaufverhaltens das SOR-Modell (Stimulus – organismusinterne Vorgänge – Reaktion) und die daraus resultierende Notwendigkeit der Aktivierung, die einen „Erregungszustand im Inneren eines Menschen (Michelis, 2014, S. 52 & 55)“ auszulösen hat. Dieser Zustand soll der „effizienteren Verarbeitung von Botschaften (Michelis, 2014, S.56)“ dienen. Wie in Abb. 10 dargestellt, wirkt sich Aktivierung anfangs positiv, nach Überschreiten eines Zenits jedoch negativ auf die Leistungsfähigkeit eines Menschen aus. Das deckt sich auch mit der Erkenntnis Fichters, der feststellt: „Aber weil die Grenze zwischen nützlicher Aktivierung und schädlicher Belastung schmal ist, wird heute unter Stress in der Regel nur die negative Bedeutung verstanden (2018, S. 141).“
Abb. 10: Das Verhältnis von Aktivierung und Leistungsfähigkeit (Michelis, 2014, S. 56)
Außerdem stellt Hellbrück & Kals fest: „Im Allgemeinen profitieren einfache, wenig strukturierte Aufgaben von einer höheren Aktivierung, während bei schwierigen, komplexen Aufgaben hohe Aktivierung eher zu einer Leistungsverschlechterung führt (2012, S. 59)“. Ein Impulskauf stellt demnach einen einfachen, wenig strukturierten Ausweg aus dem Zustand erhöhter Anspannung in Folge einer hohen Aktivierung. Ein rationales Abwägen der Vor- und Nachteile einer Kaufentscheidung aufgrund finanzieller, ökologischer, gesundheitlicher oder anderer Kriterien fällt in Folge der erhöhten Aktivierung wiederum schwer.
Von Sonderformen wie reiner Imagewerbung abgesehen, will Werbung in der Regel zum Handeln animieren (Kauf(-vertragsabschluss), Verhaltensänderung ect.) und muss daher durch

Aktion eine Reaktion auslösen. Sie muss also aktivieren. Bewusste Aufmerksamkeit ist dabei nicht unbedingt notwendig, denn Werbung wirkt auch unterbewusst. Diese als subliminale Werbung bezeichnete Strategie ist laut Fichter (2018, S. 104) unethisch. „Zwar ist auch überschwellige Beeinflussung durch normale Werbung ein Beeinflussungsversuch – aber er ist ‚immerhin als solcher erkennbar, und man kann sich ihm im Prinzip entziehen (Fichter, 2018, S. 115)“, behauptet er außerdem, ohne näher auf die Möglichkeiten, sich den Beeinflussungsversuchen der Werbung zu entziehen, einzugehen.
Im Vergleich mit traditioneller Werbung in traditionellen Medien ist dies im digitalen Zeitalter zunehmen schwieriger; Werbung tritt immer weniger in klar identifizierbaren Blöcken auf (TVWerbeblock, Anzeigeseite in der Zeitung), sondern wird mit anderen Formaten (Information, Unterhaltung etc.) vermengt und ist oft nicht mehr als Werbung zu erkennen. Below-the -LineKommunikation ist ein Fachterminus für unkonventionelles Marketing abseits der etablierten Massenmedien und mitunter der Versuch „von den Konsumenten nicht immer direkt als Werbemaßnahmen wahrgenommen zu werden (Esch, o. J.)“
Kann man also heutzutage tatsächlich unerwünschter Werbung ausweichen? Hat ein Mensch ein Recht darauf, von aktivierender Werbung und den damit einhergehenden Manipulationsversuchen verschont zu bleiben? Oder haben die Werbenden das Recht, die menschliche Psyche gezielt zu reizen – sofern man unentgeltlich bereitgestellte Dienste nutzt bzw. sich im öffentlichen Raum bewegt?
Letzteres sieht die südböhmische Hauptstadt nicht so. In einer Kampagne namens Kultiviertes Budweis (Übersetzung durch Autor) klärt die Stadtverwaltung über visuellen Smog auf und ruft zu einem verantwortlichen Umgang mit Werbeträgern in der Innenstadt auf. Die pathologisch wirkende Verschmutzung mit aufdringlichen Werbebotschaften soll vermieden werden, denn sie führe zu „mentaler Ermüdung (Übersetzung durch Autor; Landa, 2022, S. 9)“. Landa stellt außerdem fest, dass es nicht möglich ist, der Werbung auszuweichen und widerspricht der zuvor angeführten Aussage Fichters (Übersetzung durch Autor; Landa, 2022, S. 9)“.
Im digitalen Zeitalter ist auch bei Online-Aktivitäten die Praktikabilität dieser Möglichkeit, Werbung als solche zu erkennen und sich ihrer Wirkung zu entziehen, kritisch zu betrachten: Obwohl laut einer Studie ein Jahr werbefreie Internetnutzung in Deutschland theoretisch lediglich € 67,- pro Person kosten würde, bieten nicht alle Dienste (bspw. Google, Facebook und Instagram) Premium-Leistungen ohne Werbeeinschaltungen an (Brandt, 2014).
Nicht zuletzt führen äußere Umstände wie die COVID-19 Pandemie und die mit ihr einhergehenden Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen dazu, dass die digitale Umwelt an Bedeutung gewinnt. Die Frage, ob seitens der Nutzer*innen ein ausreichendes Bewusstsein über die problematischen Methoden der werbefinanzierten Angebote besteht, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet. Angesichts der Studie von Rothmann & Buchner (2018, S. 5) ist dies jedoch stark zu bezweifeln – lediglich 1% der Befragten wissen, wozu sie im Rahmen der Facebook AGBs eingewilligt haben.
Moderne Technologie findet zunehmend auch im Digital Health Bereich ihre Anwendung; einer Strömung, welche laut Horx (2021, S. 20) die Trends Gesundheit, Konnektivität, Sicherheit, und Silver Society vereint. Intensive Datenermittlung via Smartphone & Smartwatch, bei der Metadaten mit biologischen Messwerten und persönlichen Gesundheitsangaben kombiniert werden und somit auf komplexe Gesundheits- bzw. Krankheitsbilder schließen lassen, bergen großes Potenzial. Das beweist unteranderem die Zusammenarbeit des Psychologen Wolfgang Lutz mit dem Smartwatch-Hersteller Garmin; Sie wollen übermäßige Stressbelastung frühzeitig erkennen, psychischen Erkrankungen vorbeugen und zu mehr Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung beitragen (Hilbrecht, 2021).
Gleichzeitig sind Gesundheitsdaten, so wie traditionell durch die ärztliche Schweigepflicht, aus gutem Grund geschützt. Denn „Health information is perhaps the most intimate, personal, and sensitive of any information maintained about an individual“ stellt Nass und Kollegen (2009, S. 454) fest. Auch hier bringt Big Data also einerseits großes Potenzial, andererseits auch enorme Verantwortung mit sich.
Laut Psychotherapeutin Petra Klampfl (2023) birgt die vermehrte Nutzung von technischen Hilfsmitteln zur Selbstüberwachung des Körpers und seiner Funktionen, dem sogenannten Selftracking, ihre Tücken. Es drohe der zunehmende Verlust des eigenen Körpergefühls bzw. der eigenen Körperwahrnehmung und damit die Auslagerung der Verantwortung über den eigenen Körper.
2.4 Natur
Two thirds of the population of the European Region live in towns and cities. Urban areas are often unhealthy places to live, characterized by heavy traffic, pollution, noise, violence and social isolation for elderly people and young families. People in towns and cities experience increased rates of noncommunicable disease, injuries, and alcohol and substance abuse, with the poor typically exposed to the worst environments. (WHO, o.J.d)
Obwohl der Mensch als Homo Sapiens in aufgeklärten Gesellschaften eindeutig der Natur zuzuordnen ist, erstreckt sich dieses Verständnis nicht unbedingt auf seine zivilisatorischen Werke, seit Aristoteles Technik und Natur als Gegensatz formulierte. Natürlich sei ihm zufolge, was „das Prinzip seiner Bewegung, also seiner Entwicklung wie auch seiner Reproduktion, in sich habe (zitiert nach Brockhaus, o. J.d).“. Technisch sei dagegen das, „dessen Bewegungsprinzip durch den Menschen gesetzt und das deshalb auch auf den Menschen für seine Produktion und Reproduktion angewiesen sei (zitiert nach Brockhaus, o. J.d)“ Passend dazu spricht Kattman (o. J., S. 6) von einer „Doppelrolle des Menschen als Teil und Gegenüber der Natur“.
Aus räumlicher Sicht unterscheidet man traditionell zwischen Kultur- und Naturlandschaft Letzteres gäbe es strikt genommen „eigentlich nicht mehr. Stäube und Gase anthropogenen Ursprungs sind mehr oder weniger an allen Punkten der Erde nachweisbar Der Unterschied zwischen Naturlandschaft und Kulturlandschaft ist ein gradueller (Hellbrück & Kals (2012, S. 48)“. Aus österreichischer Perspektive lässt sich der breite Begriff Natur entsprechend der Definitionen für Flächeninanspruchnahme des Umweltbundesamts (UBA) eingrenzen. Zieht man die als Dauersiedlungsraum (im Sinne von Flächen, die der Mensch dauerhaft für sich beansprucht) ausgewiesenen Flächen ab, bleiben Alpen, Wälder, Krummholzflächen (Latschen), Forststraßen, fließende und stehende Gewässer, Gewässerrandflächen und Feuchtgebiete sowie vegetationsarme Flächen, Fels- und Geröllflächen oder Gletscher als Naturlandschaften übrig (UBA, o. J.). Aus internationaler Sicht gehört diese Auflistung um das Meer und die dazugehörigen Küstengebiete als natürlicher Raum ergänzt.
Eingangs sei hier die Biophilie-Theorie erwähnt, in der Kellert und Wilson (1993, S. 33) die Hypothese der tiefen, evolutionsbegründeten Verbindung des Menschen mit allen lebenden Organismen formulieren und unter anderem dadurch veranschaulichen, dass auch der moderne Mensch weitaus mehr Respekt bzw. Angst vor Schlangen hätte als vor heutzutage unvergleichbar relevanteren Gefahrenquellen wie bspw. Autos oder elektrischen Leitungen. Im Angesicht der schwindenden Biodiversität und schrumpfenden natürlichen Umgebungen stellen sie auch die Frage: „What … will happen to the human psyche when such a defining part of
the human evolutionary experience [Kontakt mit natürlicher Umgebung; Anmerkung des Autors] is diminished or erased (Kellert & Wilson, 1993, S. 35)?“.
Obwohl laut Gebhard (2001, S. 79) diese Frage nicht abschließend geklärt werden kann, liefert die Umweltpsychologie mögliche Antworten. Sie bezieht – im Gegensatz zum zweidimensionalem Persönlichkeitsmodell der Psychologie – neben der sozialen auch die nichtmenschliche Umweltdimension als ebenbürtige Einflussgröße mit ein. Gebhard bietet dazu in seinem Werk Kind und Natur (Gebhard, 2001, Kapitel 5) einen extensiven Überblick der Bedeutungen dieser dritten Dimension (vor allem der natürlichen Komponente) auf die Kindesentwicklung.
Im Sinne der Hauptforschungsfrage werden im weiteren Verlauf jeweils die Bereiche Berg, Wald und Meer auf ihre potenziell förderlichen Effekte auf die menschliche Verfassung anhand vorhandener Sekundärliteratur untersucht. Diese Effekte müssen nicht unbedingt den ausgewählten Lokalitäten exklusiv eigen sein; die Relevanz dieser Landschaftstypen begründet sich in der Funktion als stellvertretender Rahmen für Gegebenheiten und deren Zusammenwirken, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit eben dort anzutreffen sind. Ein Beispiel dazu ist eine Umfrage, die Sonne und Natur für deutsche Urlauber*innen als die entscheidenden Erfolgsparameter für Erholung identifizieren (DAK, 2017). Es ist selbstverständlich, dass die Erholung an weitaus mehr Parameter gebunden ist. Sonne und Natur im Rahmen des Waldes, der Berge oder am Strand klingt vielversprechend. Sonne und Natur inmitten einer Wüstenregion schon eher bedrohlich. Nur Sonne wird für Großstadtbewohner regelmäßig zum Alptraum, wohingegen nur Natur den Teilnehmer*innen der erwähnten Umfrage auf längere Sicht höchstwahrscheinlich keine rein erholende Wirkung bescheren wird.
Die Exklusivität dieser Effekte besteht darin, dass sie sich im Kontrast zur menschlich dominierten Umgebung begründet. Während also Städte und Gebäude Schutz vor manchen Gefahren (Wind, Regen, Kälte, etc.). bieten, birgt eine überwiegend in Innenräumen stattfindende Lebensweise wiederum spezifische Risiken: Eine von der Firma VELUX in Auftrag gegebene Studie stellt fest, dass es der „Indoor Generation (VELUX Press, 2018)“ vor allem an frischer Luft und Tageslicht mangelt, da Menschen heutzutage 90% des Tages in Gebäuden, Transportmitteln oder anderen künstlichen Anlagen verbringen. Dieser Mangel mache nicht nur 15 % der Befragten an sich traurig, sondern bringt auch konkrete gesundheitliche Risiken mit sich, wie bspw. Belastung durch Schimmel, konzentriertes Aufkommen von Allergenen, erhöhtes Risiko für Asthma und leichtere Übertragung der Erreger von Atemwegserkrankungen (Fisk, 2000, S. 539-546). Letzteres gelangte neuerdings in Folge der COVID-19 Pandemie verstärkt ins gesellschaftliche Bewusstsein.
Indizien für mögliche Vorteile einer naturnahen Lebensweise gegenüber wenigen bzw. keinen Naturerfahrungen liegen vor und werden im Rahmen dieses Kapitels beleuchtet. Es ist an dieser Stelle jedoch festzuhalten, dass Effekte je nach Landschaftsuntertyp (bspw. verschiedene Waldtypen, Bergregionen oder Küstenarten), Jahres- und Tageszeit sowie dem situationsbedingten Zustand der Subjekte unterschiedlich ausfallen und nicht pauschal beurteilt werden können.
Ein Beispiel saisonale Effekte ist die im normalen Sprachgebrauch als Herbstdepression bezeichnete Seasonal Affective Disorder. Durch abnehmende Lichteinwirkung auf den menschlichen Körper steigt die Melatonin-Produktion, wodurch die Leistungsfähigkeit sinkt
bei gleichbleibenden Leistungsanforderungen eine problematische Lage, die zur psychischen Belastung beiträgt (Hellbrück & Kals, 2012, S. 57).
Im Vergleich zum Fensterplatz im Inneren eines Gebäudes, wo tagsüber Beleuchtungsstärken von 3.000 LUX auftreten, können unter freiem Himmel bis zu 100.000 LUX gemessen werden (VELUX Press, 2018). Entsprechend förderlich sind Outdoorzeiten für den körpereigenen Melatonin-Haushalt.
2.4.1 Wald
Shinrin-yoku: Der japanische Begriff lässt sich als Waldbaden übersetzten und steht für eine Kultur der bewussten Waldaufenthalte zum Zwecke der Gesundheitsförderung, die in Japan seit 1982 praktiziert wird (Tsunetsugu et al., 2010, S. 28).
Green spaces: Definieren sich laut Maas und Kolleg*innen als „nature as an environment where they can rest and recover from daily stress (Maas et al., 2006)“ Ein Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsempfinden und der Nähe zu Naturräumen von städtischen Bewohner*innen konnte in der gleichen Studie (n= 250 782) bewiesen werden.
Forschungsergebnisse aus Japan legen nahe, dass sich ein Aufenthalt im Wald positiv auf Laune, Gesundheit und das Immunsystem des Menschen auswirken kann. Im letzteren Fall führen ätherische Öle und Terpentine zu einer signifikanten Erhöhung der Aktivität von sogenannten Killer-Zellen; Zellen, die den menschlichen Körper gegen Krankheitserreger schützen. In der gleichen Studie kommen die Forschenden außerdem zu zwei weiteren Erkenntnissen: An Tagen, an denen Proband*innen einen natürlichen Wald besuchten, wurde nachweislich mehr positive und weniger negative Empfindungen dokumentiert als an Kontrolltagen ohne Waldaufenthalt – wobei der Effekt größer war, je höher das selbst berichtete Stresslevel ausfiel. Außerdem verursacht die Berührung von naturbelassenem Zedernholz weniger Stress als das Berühren eines lackierten Zedernholzstücks oder einer Metallplatte (Tsunetsugu et al., 2010, S. 32-34).
Gesundheitsförderliche Zusammenhänge gehen jedoch über eine taktile Erfahrung von Naturmaterialien sowie die chemische Zusammensetzung der Waldluft hinaus: Rein visueller Kontakt zu Bäumen wirkt nachweislich positiv. Bereits 1984 berichtet ein Artikel im renommierten Journal Science, dass Patient*innen mit Ausblick auf „a natural scene had shorter postoperative hospital stays, received fewer negative evaluative comments in nurses' notes, and took fewer potent analgesics than 23 matched patients in similar rooms with windows facing a brick building wall (Ulrich, 1984)“.
Das sich eine hauptsächlich gebaute Umwelt nachteilig auf den Entwicklungsprozess von Kindern auswirken kann, beschreibt auch Häfner und stellt unter anderem fest, dass vor allem „Erfahrungsmöglichkeiten von Kindern (2003, Kapitel 2.2.2)“ zunehmend beeinträchtigt werden. Als entsprechender Gegentrend stellen Waldkindergärten eine immer beliebtere Alternative dar, die dieser Entwicklung entgegenwirken kann. Die natürliche Umgebung und die Absenz vorgefertigter Spielzeuge und definierter Räume fördere neben dem Immunsystem auch Selbstständigkeit, Fantasie, Kreativität und Sprachentwicklung und „trägt maßgeblich zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden der Kinder bei (Häfner, 2003, S. 35)“.

Während die positiven Auswirkungen von Waldaufenthalten objektiv messbar sind und bereits nach wenigen Minuten auftreten sowie auch langfristige Zusammenhänge zwischen naturnahen Wohnorten und besserem subjektiven Gesundheitszustand dokumentiert sind (siehe Abb. 11), ist die Ermittlung einer richtigen Dosis Naturkontakt trotz wissenschaftlichen Bemühungen noch nicht absehbar. Allerdings kommen Shanahan und Kolleg*innen (2015, S. 482) zum Schluss, dass eine weitere Urbanisierung der menschlichen Lebensweise gesundheitliche Risiken mit sich bringt, welchen mit sogenannten nature-based health interventions zu begegnen sein wird. Diese können entweder auf individueller Ebene – also durch gezielte Naturaufenthalte, oder auf stadtplanerischer Ebene – durch gezielte Implementierung von Naturräumen in Städten Eine solche ausgewogene Kombination von Stadt und Natur fordern bereits Christopher Alexander et al. (1995, S. 23) und benennen dieses Muster Stadt-Land-Finger
Auch das österreichische Bundesforschungszentrum für Wald hat die gesundheitsfördernden Aspekte von Waldaufenthalten für sich entdeckt und beschäftigt sich im Rahmen des Projektes zur Diversifizierung der Nutzung von forstwirtschaftlichen Flächen namens Green Care WALD mit neuen Möglichkeiten, Naturaufenthalte niederschwellig zu gestalten und zu fördern (Cervinka et al., 2014).
2.4.2 Berg
Natürliche akustische Reize, wie bspw. das Rauschen eines B ergbachs, wirken im Vergleich zu technischen Geräuschkulissen neutral. Der Blutdruck bleibt im ersteren Falle unverändert, während er im letzteren Szenario signifikant ansteigt (Mishima et al., 2004, S. 56).
Eine weitere Entspannungsfördernde Funktion eines Aufenthalts in den Bergen kann nach der Prospect-Refuge-Hypothese abgeleitet werden; Aus- bzw. Überblick und Rückzugsmöglichkeit spielen hierbei eine Schlüsselrolle für das evolutionsbedingte Sicherheitsempfinden des Menschen (Hellbrück & Kals, 2012, S. 49). Bereits mittelalterliche Bauherren erkennen diese strategischen Vorteile von Anhöhen und Bergen, weshalb sie Burgen und Schlösser bevorzugt dort errichten (Lepage, 2010, S. 133).
Hellbrück und Kals (2012, S. 53-54) unterscheiden außerdem zwischen drei Klimate und deren spezifischen Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden. Während die Hochgebirgsregion mit drastischen Wetterveränderungen als Reizklima eingestuft und zur Stärkung des Immunsystems empfohlen wird (entspricht der These Kolars von einer Impfung durch Stress; vgl. Kapitel 2.2), gilt das Mittelgebirge als Schonklima und stellt eine geeignete Umgebung für Rehabilitation dar. Die Grundlage dafür sind einerseits mildere Wetterereignisse als im Hochgebirge, andererseits der Abstand vom im Tal vorkommenden Belastungsklima, welches sich durch hohe Konzentration von Schadstoffen aus Industrie und Straßenverkehr oder inversionsbedingtem Schlechtwetter auszeichnet. Hinzukommt auch die Tatsache, dass „es einfacher [ist], sich vor Kälte zu schützen als vor großer Hitze … (Hellbrück & Kals, 2012, S. 52)“. Das Mittelgebirge kann also aufgrund leichter kontrollierbarer Bedingungen eine bessere Ausgangslage für das menschliche Bedürfnis nach adäquater Temperatur bieten. In Angesicht klimawandelbedingter Erwärmungen ein wichtiger Faktor, denn physischer Komfort als auch Leistungsfähigkeit und Stimmung stehen mit Außentemperaturen im Zusammenhang.
Die Psyche des Menschen profitiert im Mittelgebirge laut der Savannen-Theorie durch die „Kombination von sicherheitsinduzierenden Merkmalen (Schutz, kleine Baumgruppen, Wasser, Gras) einerseits und Explorationsanreizen andererseits (Gebhard, 2001, S. 128)“ – beides existenzielle Bedürfnisse des Menschen.
Nicht zuletzt wird der Berg- bzw. Alpenluft eine gesundheitsförderliche Wirkung nachgesagt. Wissenschaftler konnten dies bestätigen und begründen diese Wirkung der Höhenluft in der Kombination von geringerem Luftdruck und niedrigeren Sauerstoffsättigung als in tieferen Lagen. Leistungssportler haben das erkannt und wenden das Höhentraining gezielt an, um „zum einen die Sauerstofftransportkapazität durch Vergrößerung des Blutvolumens und zum
anderen die Sauerstoffausschöpfung in der Peripherie durch Anpassungsreaktionen in der Skelettmuskulatur zu verbessern (Friedmann & Bärtsch, 1997, S. 987)“.
Auch laut Matos-Wasem und Reichler (2008, S. 57) stellt „Bergluft ein unentbehrliches Element der symbolischen Ökonomie (im Gegensatz zur materiellen Wirtschaft) der Schweizer Alpenregionen und ein wesentliches Reisemotiv dar“, welches auch im Tourismusmarketing regelmäßige Betonung erlebt. Dabei gehe dieser gute Ruf auf historische Behandlungsmethoden für Lungentuberkulose (Aero- und Heliotherapie) zurück und erlebt aufgrund zunehmenden Interesses an Gesundheit und Wohlbefinden (Wellness) aber auch wegen der zuvor angesprochenen Klimaerwärmung eine Renaissance. Das haben sich gleich mehrere Schweizer Unternehmen zu Nutze gemacht: Sie vertreiben die in Dosen verpackte, teils komprimierte Bergluft international (vergleiche: swiss-air-deluxe.ch; mountainair-info.ch) und exportieren somit ein ortsgebundenes physikalisches Phänomen – aus Sicht des Autors ein Widerspruch.
Bergbewohner*innen wird außerdem ein verringertes Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Schlaganfall attestiert (Faeh, 2011), was mit den eben erwähnten landschaftsspezifischen Eigenschaften, aber auch mit der häufig mit Bergaufenthalten einhergehenden körperlicher Betätigung zusammenhängen kann.
Weitere Beweislast direkter medizinischer Vorteile eines Aufenthaltes in den Bergen hält sich in Grenzen. In Anlehnung an die drei Klimate nach Hellbrück und Kals (2012, S. 53-54) scheint jedoch der Schluss zulässig, dass vor die meist mit abgeschiedenen Berglagen einhergehende Reduktion von Luftverschmutzung einen weiteren positiven Aspekt darstellt. Sind Menschen langfristig verschmutzter Luft ausgesetzt, stellt dies eine Gefahr für Atemwege, das Herz-Kreislauf-System, Nervensystem, den Verdauungstrakt und Harnsystem der Betroffenen selbst oder gar für die Gesundheit deren ungeborener Kinder dar. Dabei ist in allermeisten Fällen die Luftverschmutzung im Anthropozähn auf industrielle Tätigkeit des Menschen zurückzuführen. Vergleichsweise tragen Naturphänomene wie Vulkanausbrüche und Vorgänge in Ozeanen lediglich 2% zur gasförmigen Verunreinigung der Luft bei (Kampa & Castanas, 2008, S. 363-365).
2.4.3 Meer
Eine aktuelle Umfrage (n = 4199) zeigt, dass Küstenregionen die bevorzugte Landschaft für Kurzurlaube sind. Knapp ein Viertel der Befragten entscheidet sich für Sonne & Strand bzw. Küste & Meer (European Travel Commission, 2022).
Eine mögliche Erklärung dafür bietet die Attention Restoration Theory (Basu et al., 2018, S. 17).
Konzentration ohne Anstrengung (soft fascination) ermöglicht demnach Reflexion und damit die Auflösung innerer Unruhe. Das beugt mentaler Erschöpfung vor und federt zukünftige
Aufmerksamkeitsanforderungen ab. Abbildung 12 zeigt die Voraussetzung dafür; es ist die Kombination aus geringem Aufmerksamkeitsaufwand und großer mentaler Bandweite. Eben diese Parameter scheint das Meer und die dazugehörige Küstenlandschaft durch die Fülle unaufdringlicher Reize bestens erfüllen zu können. So beschäftigt sich eine wissenschaftliche
Untersuchung der Küste als therapeutische Landschaft mit den „captivating multisensory elements of the coastal setting (Bell et al., 2015, S. 16)“. Dabei spielt die räumliche Dimension eine Rolle; die Weite und der Meereshorizont stehen im Kontrast zum eingeschränkten Raumgefühl im Alltag (Stadt und Innenräumlichkeiten), was zu Gefühlen der Freiheit führen kann. Andererseits können einer Studienteilnehmerin zufolge eigene Probleme im Angesicht solch großer Zusammenhänge, als deren Teil man sich wahrnimmt, kleiner und unbedeutender erscheinen (Bell et al., 2015, S. 21). Diese Verbundenheit mit der Natur deckt sich mit der zuvor erwähnten Biophilie-Hypothese und ist möglicherweise „ein Element für das von Erikson so genannte ,Urvertrauen‘ (Gebhard, 2001, S. 80)“. Dieses Urvertrauen kann als Produkt langanhaltender, zuträglicher Bedingungen während der Kindheit verstanden werden, wobei, sowohl laut Gebhard (2001, S. 7) als auch im Sinne der Umweltpsychologie, neben des menschlichen Umfelds auch das nichtmenschliche Umfeld auf die Psyche des Menschen wirkt – und sich damit auch als potenzieller Vertrauenspartner qualifiziert. So kann Naturlandschaft rein durch Authentizität positiv wirken – sie wirkt (über Generationen hinweg) vertrauenswürdig und dadurch subtil beruhigend.
Die Weitläufigkeit und entfernte, niedrige Horizonte von Meeresgebieten erlauben intensive Sonneneinstrahlung. Diese bietet tendenziell nicht nur eine höhere Melatonin-Ausbeute und trägt damit effektiv zu einem gesunden Schlafrhythmus bei, sondern birgt im Zusammenspiel mit dem Element Wasser großes Faszinationspotenzial. Dynamische Spiegelungen und graduelle Farbverläufe sowie Farberscheinungen aufgrund der Lichtfilterfunktion des Wassers sowie die fluiden Eigenschaften und die rhythmischen, repetitiven Bewegungen und Klänge haben

das Potenzial, Menschen in ihren Bann zu ziehen und sie somit ihrer alltäglichen Gedanken zu entledigen. Außerdem bietet die Schnittstelle zwischen Land und Meer einen Schauplatz für die teils beeindruckende Kraft der Wassermassen, zugleich aber auch bei wenig Bewegung ständige Veränderungen und damit vielfältige Beobachtungs- und Entdeckungsmöglichkeiten (Bell et al., 2015, S.17).
Abb. 12: Aktivitäten und Attention Restoration Theory (Basu et al., 2018, S. 7)
Diese zu Aktivitäten einladende Rolle von Küstenlandschaften spiegelt sich auch in einer großangelegten neuseeländischen Studie (n= 12.529) wider. Sie zeigt eine positive Korrelation zwischen Bewegungsmangel und der Entfernung des Wohnorts der Proband*innen von der Küste. Interessanterweise lässt sich ein solcher Zusammenhang nicht bei urbanen Parkanlagen nachweisen (Witten et al., S. 302). Physische Aktivität bildet laut Gascon und Kolleg*innen (2015, S. 4369) eine wichtige Determinante für mentale Gesundheit Aus aktuellem Anlass wurde kürzlich der lockdownbedingte Bewegungsmangel bei gleichzeitigem Anstieg des Konsums digitaler Inhalte untersucht und ein signifikant erhöhtes Risiko mentaler Probleme bei österreichischen Jugendlichen festgestellt (Humer et al., 2022).
III. Empirie
3.1 Methodik
Laut Mey/Mruck (2011, S. 259) ist die Konzeption eines qualitativen Interviews entsprechend der Forschungsziele und entlang der Parameter Grad der Strukturierung, Standardisierung bzw. der erwünschten Textsorte der erwarteten Ergebnisse im Vorhinein zu spezifizieren. Ebenso wirkt die Rolle der Interviewenden und muss deshalb bewusst beschlossen und ausgeführt werden, um die erwünschte Datenqualität zu erhalten. Abhängig von Ausprägungen der angeführten Parameter ist eine Vielzahl von Arten der qualitativen Interviews möglich, eine strikte Unterteilung hingegen aufgrund möglicher Mischformen oft schwierig. Kombinationen, Anpassungen oder Modifizierungen unterschiedlicher Interviewverfahren können sinnvoll bzw. erforderlich sein (Mey & Mruck, 2011, S. 265).
Das Interviewverfahren für die Zwecke dieser Arbeit orientiert sich an dem problemzentrierten Vorgehen nach Witzel (1985, S. 236) wobei auf einen Kurzfragebogen in Hinblick auf eine zukünftige, quantitative Studie, sowie die pandemiebedingte Durchführung per Videoanruf bewusst verzichtet wird.
Um einerseits Erzählungen Platz einzuräumen, andererseits auch themenbasierte Berichte zu generieren werden Elemente des narrativen (erzählgenerierende Fragen, immanente Nachfragen) sowie des diskursiv-dialogischen Interviewstils (allgemeine und spezifische Sondierungen, Reflexionen) im Sinne von Mey/Mruck (2011, S. 261-262) eingesetzt.
Ein strukturierender Frageleitfaden (Anhang V) wird verwendet, um die Validität hinsichtlich der Forschungsfragen zu steigern. Außerdem soll er eine unvoreingenommene Herangehensweise an die Themenfelder seitens der Interviewten durch sorgfältige Auswahl von Begriffen und deren Ersterwähnungszeitpunkten seitens dem Interviewenden gewährleisten sowie die Reliabilität der Daten Interviewübergreifend sichern. Eine weitere Funktion des Leitfadens besteht darin, die konkreten Forschungsfragen durch induktive Verfahrensweise zu diskutierfähigen Alltagsthemen umzuformen und auszuweiten, um den qualitativen Aspekt der Forschung zu fördern. Das Forschungsdesign wird in Abbildung 13 dargestellt.
Von einer Standardisierung wird mit wenigen Ausnahmen (6.1 Frequenz von Naturaufenthalten; 9. Nutzungsmotivation Sozialer Medien) abgesehen, um den freien Fluss der Aussagen und die subjektive Interpretation der Fragen bzw. Themen durch Antwortkategorien nicht einzuschränken. Als Einstieg in jeweilige Themenfelder werden freie Assoziationen erbeten, um einen unverfälschten Abdruck der subjektiven Beziehung zum jeweiligen Begriff bzw. dem dazugehörigen Themenfeld zu dokumentieren.
Abb.
Auswahl der Kandidat*innen
Entsprechend der Zielgruppensetzung dieser Studie wurden drei Angehörige der Generationskohorte Millennials (vergl. Kapitel 2.1) interviewt. Um trotz der kleinen Anzahl von Interviews möglichst objektive Erkenntnisse generieren zu können, wurde bei der Rekrutierung der Interview-Partner*innen auf eine möglichst ausgewogene Verteilung an äußeren bzw. persönlichen Merkmalen geachtet, wie Tabelle 1 anhand von vereinfachenden binären Polen zeigt So sollen die Untersuchungsthemen Stress, Strategien gegen Stress und die Rolle der Natur aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten werden, um eine valide Grundlage für die künftige qualitative Forschung zu generieren
Geschlecht Weiblich II I Männlich
Wohnort Stadt I II Land
Beruf Angestellt I II Selbstständig
Lebensstil Konventionell I II Alternativ
Abb. 14: Verteilung von Lebensrealitäten der Interview-Partner*innen

Qualitative Inhaltsanalyse
Nach der Erhebung und Sicherung der Rohdaten per Tonaufzeichnung werden die Gespräche vollständig transkribiert und durch Zeilennummerierung zitierfähig aufbereitet. Dabei werden die Aussagen der Interviewteilnehmer*innen in >Spitze Klammern gesetzt< während die des Autors um 1,25cm nach rechts eingerückt werden, um bessere Orientierung im Dokument zu gewährleisten (vgl. Abb. 15). Dialektbedingte Sprachverfärbungen werden an die Standardsprache angepasst, ohne dabei die Kernaussagen zu verändern. Interjektionen sowie Füllwörter hingegen werden im Originaldokument mit transkribiert, um die Nachvollziehbarkeit der Aussagen und deren Entstehung zu unterstützen.
315 >Ich danke dir!<
316 Darf ich fragen: Wie war das Interview?
317 >Ja, also, sehr spannend. Ich habe das Gefühl, ich habe mich selber noch besser
318 kennengelernt. Ich habe vorher so nie wirklich über Stress nachgedacht. Sondern bin
319 eher immer im großen Bogen um das Thema herum gegangen.<
Abb. 15: Exemplarischer Transkript-Auszug
Bei anschließender Erstlektüre werden relevante Aussagen isoliert, um die Validität der Daten sicherzustellen. Diese werden im weiteren Verlauf den im Frageleitfaden etablierten thematischen Kategorien und Unterkategorien zugeordnet. Die so entstehende Zitaten-Datenbank (elektronisch an Betreuer übermittelt) bildet die Grundlage für anschließende Analyse und Interpretation und ermöglicht einen Direkten Vergleich der Reaktionen der Befragten zu den unterschiedlichen Themen
Für die abschließende Auswertung der Ergebnisse wird außerdem eine zusammenfassende Codierung vorgenommen. Durch farbliche Markierung der Transkripte werden Aussagen zu den breitgefächerten Themen der Interviews im Sinne der Unterforschungsfragen
2. Was sind die wichtigsten stressverursachenden Faktoren in dieser Kohorte?
3. Welche Stressbewältigungs-Strategien lassen sich bei Millennials erkennen?
beziehungsweise der Hauptforschungsfrage
Wie beliebt ist natürliche Umgebung für Stressbewältigung unter Millennials?
in vier Kategorien zusammengefasst. Die ersten zwei, I. Disstress fördernd und II. Disstress abbauend, beziehen sich auf die Wirkung von Handlungen, Routinen oder Umgebungen auf das subjektive Stressempfinden der Interview-Partner*innen. Die Kategorien III. Digitales und
IV. Natur ergänzen die Analyse um die Ortskomponente und sollen Zusammenhänge zwischen psychischem und örtlichem Befinden aufzeigen.
Auf Basis der Fragestellungen des Leitfadens werden außerdem entsprechende Einleitungen herangezogen, um einen persönlichen Steckbrief eines*einer jeden Interviewten (Anhang I) anhand der in folgender Abbildung dargestellten Struktur zu generieren:
Stress ist für mich
Ursache für Stress ist ………………………………………………………………………………………………………..
Energie kostet mich
An Ruhe hindert/hindern mich …………………………………………………………………………………………
Gegenteil von Stress ist
Bei Stress hilft mir ………………………………………………………………………………….…………………………
Meine Energiequelle/n ist/sind
Ruhe ist für mich ………………………………………………………………………………….………………………..…
Meine Screen Time
Motivation für Smartphone Nutzung
Natur ist für mich …………………………………………………………………………….……………………….………
Voraussetzungen für gelungene Naturerfahrung sind
Abb. 16: Steckbrief Struktur
Da sich diese Kategorien zum Teil überschneiden, werden Aussagen gegebenenfalls zweifarbig codiert, wobei die Hintergrundfarbe das jeweils besprochene Themengebiet markiert und die Textfarbe den inhaltlichen Zusammenhang mit einer anderen Kategorie.
Der vollständigkeits- und nachvollziehbarkeitshalber wird stets aus den Original-Transkripten zitiert. Die Zeilennummer wird in Klammern am Ende eines jeden Zitates vermerkt und verweist auf die entsprechende Textstelle.
Statistische Analysen
Ergänzend zur qualitativen Inhaltsanalyse werden unter Anwendung statistischer Verfahren, auf die durch Transkription und Codierung erhaltenen Datensätze, weitere Erkenntnisse gesichert. Einerseits wird die Häufigkeit einzelner Wörter der Interviews ausgewertet (mit browserling.com/tools/word-frequency und wortwolken.com), andererseits werden anhand thematischer Überschneidungen Beziehungen zwischen den jeweiligen Kategorien analysiert.
3.2 Interview Ergebnisse
Statistik I
Die jeweiligen Überschneidungen der Umgebungskategorien (Digital bzw. Natur) mit der subjektiv empfundenen Wirkung auf das Stressempfinden der Interview-Partner*innen (Disstress fördernd bzw. Disstress abbauend) werden in Tabelle 1 dargestellt und geben Aufschluss über die interkategorischen Beziehungen.
Tabelle 1: Positive und negative Konnotationen der digitalen bzw. natürlichen Umwelt
digitale Umwelt natürliche Umwelt
Disstress fördernd 24x 7x
Disstress abbauend 15x 30x
Es zeigt sich eine vorwiegend positive Konnotation der natürlichen und eine vorwiegend negative Konnotation der digitalen Umwelt, wobei letztere mit 38% positiver Konnotation trotz ihrer offensichtlich negativen Aspekte gleichzeitig auch wertgeschätzt wird. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den teils widersprüchlichen und äußerst kontroversen Aussagen über Smartphone, Soziale Medien usw. wider (Kapitel 3.2.2 bzw. Anhang II).
Die Ergebnisse der Statistik I sind allerdings als schwache Indikatoren zu verstehen, da sie auf Interpretationen von Interviewzitaten seitens des Autors basieren und dadurch Gefahr laufen, den höchsten Ansprüchen an Objektivität als Qualitätskriterium wissenschaftlicher Verfahrensweise nicht gerecht zu werden.
Statistik II
Die am häufigsten verwendeten Wörter der Interview-Teilnehmer*innen werden als WordCloud im jeweiligen Steckbrief dargestellt. Diese Methode erlaubt eine schnelle Einschätzung der thematischen Gewichtung der Interviews und porträtiert somit die Interview-Partner*innen und ihre Aussagen. Die dazu verwendeten Wortschatzlisten werden elektronisch an den Betreuer übermittelt.
Eine Auswertung der am häufigsten verwendeten Begriffe aller Interviews (siehe Tabelle 2) zeigt, dass neben den eigentlichen thematischen Schwerpunkten entsprechend des Interviewleitfadens (wie beispielsweise Stress, Ruhe) vor allem die Begriffe Zeit (Platz 2), Stunde(n) (Platz 4), Tag und Arbeit/Business (beide auf Platz 5) die Häufigste Verwendung fanden. Um alle
Befragten gleichermaßen zu repräsentieren und die teils großen Unterschiede in absoluten Wortbeträgen der Teilnehmer*innen zu kompensieren, werden für diese Auswertung die 8 häufigsten Begriffe je Gesprächspartner*in ermittelt und in einer Gesamtübersicht zusammengeführt. Dabei werden die jeweiligen Platzierungen entsprechend gewichtet, um ein für alle Gesprächspartner*innen repräsentative Übersicht zu erhalten.
Eine Kontrollauswertung der Wortwahl des Autors in Tabelle 2 zeigt, dass der Begriff Zeit seitens der Interview-Teilnehmer*innen tatsächlich überproportional oft gebraucht wurde. Seitens des Autors rangiert er mit nur 9 Erwähnungen auf Platz 10 der häufigsten Begriffe. Auch andere mit der Zeit verwandten Begriffe wie Stunde(n), Tag und Minuten fanden seitens der Befragten sehr häufige Anwendung.
Interessant ist, dass der Begriff Wald in den Top 10 zu finden ist, während Natur vergleichsweise wenig Erwähnungen aufzuweisen hat. Berücksichtigt man jedoch die geographische Herkunft der Teilnehmer*innen ist es naheliegend, dass Wald die gängigste Naturlandschaftsform in ihrer direkten Umgebung darstellt und somit als Vertreter der Natur fungiert. Seitens des Autors wurde der Begriff Natur über weite Strecken der Interviews bewusst vermieden, um dieses Schlüsselthema dieser Arbeit nicht künstlich in den Mittelpunkt zu stellen und dadurch möglicherweise den Verlauf der Interviews und die Aussagen der Befragten zu beeinflussen.
Die persönlichen Top 8 der am häufigsten verwendeten Begriffe (Tabelle 3) machen einerseits deutlich, welche Themen die jeweiligen Gesprächspartner*innen beschäftigt haben und veranschaulicht andererseits die interpersönlich dominierenden Themenbereiche.
Tabelle 3: Die häufigsten Begriffe der jeweiligen Interview-Partner*innen
3.2.1 Interview-Partner*innen im Kurzportrait
Auszüge der jeweiligen Steckbriefe (Anhang I) und die persönliche Wortwolke ergänzt durch prägnante Zitate vermitteln Einblicke in das Stresserleben der Teilnehmer*innen.
Anselm
„Harmonie, das ist ja nochmal ein Faktor zur Natur, die ist irgendwie – gerade weg von Straßen und Dergleichen – einfach automatisch da. Weil Natur Harmonie aufzeigt. … Apfelbaum … der wird nicht 1000 Meter hoch. Das ist auch harmonisch zu meinem Körperverhältnis, zu meiner Kraft (501-507).“
Abb. 17 (rechts): Anselms Wortwolke (wortwolken.com)

Stress ist für mich „Verkopftheit (96).“
Ursache für Stress ist „fast immer Zeitmangel. (39)“
An Ruhe hindert mich „fehlendes Vertrauen, dass die Lösung nicht jetzt sein muss (304).“
Gegenteil von Stress ist „Spiel … dann mache ich etwas, um es auszuprobieren (101-102).“
Ruhe ist für mich „Natur. Natürliche Klänge (260).“
„Und eigentlich brauche ich auch immer die zweite Nacht [in der Natur]. Also der Tag nach der ersten Nacht ist oft so la la. Und dann der zweite und natürlich auch der dritte Tag, die können sehr frei … sein und schön, es fühlt sich dann fast normal an, dass man jetzt weg ist, das ich jetzt weg bin (439-442) “
Meine Screen Time:
„Bei mir hat das den Programpunkt ,Wohlbefinden und´ noch was. ,Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung´. So. Mhm hm. Oha. Gestern waren es 3h7m (556-557)“.
„
… ich brauche meine Me-time. Tönt sehr egoistisch, aber ich finde, das ist auch sehr wichtig für Menschen, dass man auch seinen Raum hat Und nicht nur Raum für diese Ruhe, oder für diese Sachen die man tut, sondern auch Platz, ja allgemein das zu tun, was man gerade möchte (126-129).“
Abb. 18 (rechts): Claras Wortwolke (wortwolken.com)

Stress sind für mich „hohe Erwartungen (21)“.
Ursache für Stress ist „Zeit. … Wenn ich zu wenig Zeit habe … (38-39).“
Energie kosten mich „Große Städte … Es ist sehr stressig in einer großen Stadt (87 -95).“
Meine Energiequelle „ist für mich Sonne. (83).“
Ruhe ist für mich „eine Stunde Spaziergang alleine in der Natur (139).“
„Ich mag sehr Höhlen. im Wald, so alte Höhlen von Fuchsen oder sowas Also so größere, wo man sich verstecken kann, das mag ich ganz gern (176-180) “
Meine Screen Time:
„Also ich verbringe täglich tatsächlich, wow, 3h 50min [am Handy] (213).“
Wenn man gestresst ist und zur Ruhe kommen will und dann hast die ganze Zeit, weißt eh, schaust trotzdem aufs Handy, weil du es einfach tust, oder keine Ahnung. Weil das schon irgendwie so in unserem Hirn drinnen ist, dann hindert mich das eigentlich auch, dass ich zur Ruhe komm. Weil dann sehe ich das wieder, dann lese ich wieder irgendeinen Artikel, dass Omikron jetzt die ganze Menschheit ausrotten wird, jetzt überspitzt gesagt, aber das, das hindert mich dann eigentlich auch, zur Ruhe zu kommen (213-219).“
Abb. 19 (rechts): Evelyns Wortwolke (wortwolken.com)

Stress ist für mich „Ratlosigkeit. Wenn man nicht genau weiß, wie es jetzt weiter geht (4-5).“
Ursache für Stress ist „Da wäre Zeit die Komponente (114).“
Meine Energiequelle ist „Natur auf jeden Fall, der Wald (133).“
Natur ist für mich „Stressbefreit, irgendwie auch langsam im Gegensatz zum Alltag (250-251).“
Ruhe ist für mich „Aufstehen … ohne, dass ich auf die Uhr schauen muss (226-227).“
„ was mich zur Ruhe bringt, sind auf jeden Fall Gespräche. Also wenn ich gestresst bin, dann kann mich eigentlich fast nur ein Gespräch, egal mit wem, zur Ruhe bringen. Weil ich dann da drüber reden muss, und das beruhigt mich dann. (174-176).“
Meine Screen Time: „Tagesdurchschnitt: 2 Stunden und 51 Minuten. Na habe die Ehre (337)!“
3.2.2 Erkenntnisse Empirie
Nach intensivem Studium der Interview-Ergebnisse werden zusammenfassende und interpretierende Erkenntnisse formuliert, wobei dafür folgende Voraussetzungen zu erfüllen sind:
• Kernaussage wiederholt sich
• kommt mindestens in zwei der drei Interviews vor
• ist für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant
Folgende Erkenntnisse wurden formuliert:
1. Mangel an Zeit führt zu Stress.
2. Bewusst verbrachte Zeit wirkt Stress entgegen.
3. Digitales Umfeld wirkt kontroversiell:
3.1 Digitale Möglichkeiten führen zu Kontrollverlust über Zeitgestaltung.
3.2 Digitale Möglichkeiten helfen, Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen.
4. Natur hilft, Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen.
4.1 Positive Wirkung von Naturerfahrungen setzt Authentizität voraus.
5. Sozialer Kontakt hilft, Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen.
5.1 Ständige soziale Aktivität wirkt kontraproduktiv.
6. Intrinsische Motivation – ein Schlüsselaspekt für erfolgreiche Stressbewältigung.
7. Weitere Strategien der Stressbewältigung sind
7.1 Akzeptanz der Gegebenheiten,
7.2 Rückzug bzw. Flucht,
7.3 physische Aktivität oder
7.4 die Gestaltung der eigenen Umgebung.
Jede dieser Erkenntnisse begründet sich in dokumentierten Interview-Zitaten. Um den Lesefluss nicht zu behindern, werden nachfolgend lediglich drei repräsentative Zitate pro Aussage angeführt. Die vollständige Zitatensammlung, die als Grundlage für das Formulieren dieser Erkenntnisse herangezogen wurde, findet sich im Anhang II
Erkenntnis 1: Mangel an Zeit führt zu Stress.
„Es ist immer eigentlich Zeitmangel und damit dieser mangelnde Raum an Hingabe für das, was eigentlich gerade jetzt passiert. Also Stress ist Projektion in die Zukunft … mit dem gegenwärtigen Defizit von Zeit (Anselm, 46-49).“
„Es war also wirklich eine vorgegebene Zeit für die Videos, die sehr kurz war eigentlich. Und ich dann die Produzenten briefen müssen habe, was sie sprechen, und die natürlich auch nervös waren, und wir aber nur ganz wenig Zeit haben, dass sie vor den Dreh kommen. Das heißt, da ist generell schon immer so a Unruhe in der Luft gewesen, weil einfach so wenig Zeit war. Da wäre Zeit die Komponente (Evelyn, 110-114).“
„Wenn ich zu wenig Zeit habe und alles auf den letzten Moment mache. Das stresst mich mega. Also die Zeit, diese Schnelligkeit. Ich bin manchmal nicht so schnell wie, wie ich sein sollte und das stresst mich sehr (Clara, 38-41).“
Erkenntnis 2: Bewusst verbrachte Zeit wirkt Stress entgegen.
„Also weil Ruhe für mich nicht bedeutet, dass ich nichts mehr höre, sondern einfach in dieser Leichtigkeit, diesem Glück bin, in der Anwesenheit, würde ich sagen: Das Schlüsselelement war Zeit. Und Präsenz (Anselm, 335-337).“
„Ja und auf jeden Fall auch Momente, die was man bewusst wahrnimmt, und sich Zeit nimmt einfach. Und einfach Mal durchschnaufen. Also ja, das, wofür man sich dann bewusst Zeit nimmt, das ist glaub ich Ruhe für mich (Evelyn, 177-179).“
„Die Zeit für mich selbst finden, und dann ist der Stress dahin. Also sehr viel Me-Time. Also sehr viel Zeit für mich. Das löst meinen Stress immer auf (Clara, 34-35).“
Erkenntnis 3: Digitales Umfeld wirkt kontroversiell: Erkenntnis 3.1: Digitale Möglichkeiten führen zu Kontrollverlust über Zeitgestaltung.
„Wenn ich mir vorstelle, ich verbringe 3 Stunden am Handy – die 3 Stunden könnte ich wo anders auch nutzen (Evelyn, 353-354).“
„Weil ich Social Media eigentlich nicht mag und weil ich da meine reale Zeit verliere. Sehr, sehr viel von meiner realen Zeit verliere. Ja, das macht mich traurig. Das stresst mich auch (Clara, 235-236)“!
„ … ich will nicht abends mein Handy checken und mache es nach wie vor, auch nach 22 Uhr (Anselm, 515-516).“
Erkenntnis 3.2: Digitale Möglichkeiten helfen, Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen.
„ … mein erster Griff mein Telefon, um abzuchecken, welche Räume sind grad noch da, welche Menschen, die gerade was Aktives tun, die irgendwo sich hinbewegen, stehen zur Verfügung. Also bei mir ist dann so ein Rund-um-schau-charakter da. Ähm von Aktivitäten, von OutdoorAktivitäten (Anselm, 382-385).“
„ … weil ich dadurch meine Information bekomme, da, da ich mein Business machen kann und da ich mit meiner Familie, mit meinen Freunden, und auch mit dir kommunizieren kann (Clara, 310-311).“
„ … eine schnelle Kommunikation zwischen deinen Liebsten, das ist eine positive [Seite der digitalen Umwelt] (Evelyn, 394-395).“
Erkenntnis 4: Natur hilft, Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen
„Ich denke es sind Klänge. Gefühlt sind es Klänge, die mir immer mehr vertrauter sind als Klänge in Häusern, und ich weiß nicht, woher dieses Vertrautheitsgefühl kommt. Dann, der Horizont, das Wandlose, das Fensterlose. Oft das Gefühl, hier geht es in alle Richtungen natürlich. Also der Horizont, diese weite Entfernung. Ähm. Was mich auf der Reise insbesondere beruhigt hat, war, waren Tiere und Abläufe zu beobachten und darauf auf mich auch zu schließen. Ähm, um meine eigene Merkwürdigkeit, wenn wir das Wort schon nochmal aufgreifen, irgendwie nachvollziehen zu können, meine Getriebenheit, meine Reaktion mit Angst, Starre, oder Aktivität. Also, mit, ich gehe in Angst, und entweder greife ich an, ich gehe in Starre, oder ich gehe in Rückzug, Und ob man nun Vögel, oder auch Pflanzen beobachtet, da sehe ich dann einfach viele Facetten, um mein Eigen zu, zu benennen. Und das ist vielleicht auch die Form der Inspiration, die ich an der Natur sehr gerne mag (Anselm, 402-413).“
„Ich habe das Glück jetzt die letzten zwei Jahre, dass ich die Ruhe täglich draußen mit meinem Hund am Meer suchen kann. … wenn ich die Ruhe aufsuche … reicht einfach eine Stunde Spaziergang alleine in der Natur. Das … ist das, was ich aufsuche. Immer draußen. Natur (Clara, 136-140).“
„Energiequelle. … Wandern, Schneeschuhe gehen … Ja und Natur auf jeden Fall, der Wald (Evelyn, 129-133).“
Erkenntnis 4.1: Positive Wirkung von Naturerfahrungen setzt Authentizität voraus
„ … sehr schwierig war das z.B. in Berliner oder in tschechischen Wäldern, tatsäch lich, weil die nichtmehr naturell sind. … die Bäume werden ja, ähm, eingepflanzt … Und die sind alle so richtig gerade und [das] stresst mich auch. Ich bin so ein kleiner Monk und ähm, das sind so Linien, die, das wirkt wie die Großstadt für mich. Also das, das hat mich, das hat mich gestresst. Das
war kein schöner Spaziergang. Ja. Also es muss ein wilder, oder ein sehr alter Wald sein, damit ich mich wohlfühle (Clara, 155-161).“
„Und die Formen beruhigen mich. Dass einfach nichts gerade ist … Das Spiel der Farben und der Formen (Anselm, 413-415).“
„Weg von Straßen. Also das ist auf jeden Fall für mich, das Autolärm ganz schwierige Sache ist (Anselm, 452-453).“
Erkenntnis 5: Sozialer Kontakt hilft, Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen.
„Dann Kommunikation, also Harmonie. Das Gefühl, ich bin verbunden wieder mit Menschen und auch gemocht. Das hilft bei mir. Und Berührung. Hautkontakt. Ist bei mir auch ein wahnsinnig hilfreiches Mittel gegen Stress und ähm wahrscheinlich aber auch das Gefühl: Ich bin akzeptiert. Blicke, Hautkontakt, Kommunikation (Anselm, 167-171).“
„Ich denke, wenn ich, wenn ich sozial lebe, also so, mit, mit, eine nette Umgebung für mich ist sehr wichtig. … Also wenn ich meinen Hund neben mir hab, meinen Partner, oder eine Person, mit der ich gut reden kann, dann ist das für mich sehr wichtig (Clara, 60-65).“
„Ja und auf jeden Fall, was mich zur Ruhe bringt, sind auf jeden Fall Gespräche (Evelyn, 174).“
Erkenntnis 5.1: Ständige soziale Aktivität wirkt kontraproduktiv.
„Was hindert mich an der Ruhe? Naja, das sind, das kann einerseits ich selber sein, andererseits können es natürlich auch andere Leute sein (Evelyn, 198-199).“
„Ja wieder, es sind die Mitmenschen. Also … wenn man in einem Kollektiv lebt, und wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, dann findet man tatsächlich keine Ruhe (Clara, 110-113).“
„Die Gemeinschaft, in der ich wohne. Also Geräusche, Ablenkung, ähm, tatsächlich Menschen [hindern mich daran, zur Ruhe zu kommen] (Anselm, 317-318).“
Erkenntnis 6: Intrinsische Motivation ist wichtig für erfolgreiche Stressbewältigung.
„Nein, also ich fahre jetzt nicht absichtlich zur Erholung in den Wald, sondern, gibt es eigentlich nicht. … Das ist situationsbedingt, also wenn wir am Sonntag im Wald spazieren gehen, dann ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, weil wir jetzt zur Ruhe kommen wollen. Überhaupt nicht. Sondern, weil wir gerne draußen etwas machen wollen (Evelyn, 256-261).“
„Das Gegenteil von Stress kann für mich Spiel bedeuten. Also dann mache ich etwas, um es auszuprobieren. … Interesse. Ich glaube ganz stark das Gegenteil von Stress ist Interesse, Hingabe … (Anselm, 101-104).“
„… auch Platz, ja allgemein das zu tun, was man gerade möchte und wenn man das täglich nicht bekommt, dann kommt es zu Stress, weil man … keine Zeit für sich selbst, oder für seine Hobbies [hat] (Clara, 229-231).“
Erkenntnis 7: Weitere Strategien der Stressbewältigung sind:
7.1 Akzeptanz der Gegebenheiten;
„ … manchmal hilft es mir, demütig zu werden. Also einfach diese Hinnahme von Situationen, die so sind. Das Loslassen von dem Wunsch das hinzukriegen, zu verändern, anzupassen, zu perfektionieren. Das hat für mich eine Demut, zu akzeptieren (Anselm, 284-286).“
„ … Vertrauen, dass die Lösung nicht jetzt sein muss (Anselm, 307).
„Beruhige dich. Jetzt ist es schon egal (Evelyn, 205).“
7.2 Rückzug bzw. Flucht;
„Ich mag sehr Höhlen. … Also so größere, wo man sich verstecken kann, das mag ich ganz gern (Clara, 176-180).“
… mein kleines Köfferchen packe und auf eine Radtour oder so fahre, für eine Nacht, oder zwei. Also das wäre schon eine kleine Flucht in einen ruhigeren Ort (Anselm, 387-388).“
„Ins Bett (Evelyn, 234).“
7.3 physische Aktivität;
„Also Bewegung … richtig extreme Bewegung. Also diese Auslastung des Körpers hilft bei mir sehr. Um … Stress quasi zu besänftigen, auch zu heilen (Anselm, 165-167).“
„Ich muss, ich muss kurz immer so ausatmen. Das heißt für mich: Mit dem Hund rausgehen, Spazieren gehen, Sport treiben, Meditieren (Clara, 32-43).“
„ … Wandern, Schneeschuhe gehen (Evelyn, 129).“
oder 7.4 die Gestaltung der eigenen Umgebung;
„Ich habe mich von ziemlich vielen Aufgaben befreit, dann erst gemerkt, wie leicht das eigentlich geht und was es auslöst und dann war Ruhe da, Freude, ähm, und alles was ich mag ist dann so passiert wieder. Vieles von dem, was ich mag. Das lustige ist, ich musste dafür nicht wegfahren. Ich konnte das hier erleben, wo ich bin. Also ich glaube früher habe ich oft gedacht, Ruhe ist, wenn ich abhaue. Aber Ruhe geht auch hier, wo ich bin (Anselm, 340-345).“
„
… nette Umgebung für mich ist sehr wichtig. … ich habe immer gedacht, das wäre Reisen, oder gutes Geld, oder gute Arbeit. Aber ich habe gemerkt, dass die Umgebung, wenn sie gut ist, dann ist das das Beste für mich. Also wenn ich meinen Hund neben mir hab, meinen Partner, oder eine Person, mit der ich gut reden kann, dann ist das für mich sehr wichtig (Clara, 60-65).“
IV. Schluss
Die bisherigen Erkenntnisse aus Theorie und Empirie liefern die Grundlage zur anschließenden Auseinandersetzung mit den Forschungsfragen. Die formulierten Unterforschungsfragen dienen dazu, die Komplexität der Hauptforschungsfrage in verschiedene Teilbereiche aufzulösen, dadurch den Erkenntnisgewinn zu steigern und die Beantwortung der Hauptforschungsfrage im Kontext verwandter Themenbereiche nachvollziehbarer zu gestalten. Sie werden deshalb als erstes abgehandelt.
Etwaige Limitationen der Studie werden im Rahmen dieses Kapitel ebenso erläutert wie der weitere Forschungsausblick und persönliche Reflexionen zur Arbeit.
4.1 Beantwortung der Forschungsfragen
Welche Hauptmerkmale definieren die Kohorte der Millennials?
Das Hauptmerkmal, welches den Großteil dieser Kohorte seit Kindestagen nachhaltig prägt, ist die regelmäßige Interaktion mit digitalen Dienstleistungen und Produkten im Alltag
Während andere als typisch erachtete Persönlichkeitsmerkmale wie Hedonismus, Materialismus, Narzissmus, Werteloyalität oder Teamfähigkeit mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf Mitglieder der untersuchten Kohorte zutreffen, steht es außer Frage, ob sie unter dem Einfluss ihrer neuartigen, digitalen Umwelt stehen.
Die technologische Disruption steht zumindest in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Kohortenentwicklung, wobei es auch für eine Wechselwirkung zwischen dem Aufstieg von Sozialen Medien, deren Plattformen und den soeben angeführten vorherrschenden Persönlichkeitsmerkmalen der Millennials Indizien gibt (S.16).
Die Analyse der Interviews führt zum Schluss, dass diese digitale Umwelt auf die Befragten sehr kontroversiell wirkt und somit Fluch und Segen zugleich darstellt. Allerdings überwiegen die negativen Erwähnungen, wie eine quantitative Auswertung der positiven und negativen Konnotationen von digitalen Technologien im Gespräch über das individuelle Stresserleben zeigt Der Kampf um die Hoheit der Selbstbestimmung im Sinne der bewussten Kontrolle über eigene Zeitgestaltung ist im vollen Gange Tendenzen zur Rationierung bzw. Errichtung künstlicher Hürden lassen sich beobachten (Anselm, 579 & 637-640; Clara, 270-276). Eine Teilnehmerin nimmt die für Smartphone Nutzung aufgebrachte Zeit als Konkurrenz zur realen Zeit wahr (Clara, 235-236), benennt Social Media als gefährlich und merkt gleichzeitig an, dass sie die Plattformen aus beruflichen Gründen trotzdem nutzt bzw. nutzen muss. Eine weitere Gesprächspartnerin vermutet nachhaltige neuronale Veränderungen im Gehirn der Smartphone Nutzer*innen, nachdem sie beobachtet, dass sie selbst aufgrund starker Gewohnheit regelmäßig – auch in ungünstigen Situationen zum Handy greift, obwohl sie dieses Verhalten retrospektiv betrachtet für kontraproduktiv hält (Evelyn, 213-219) während ein dritter
Teilnehmer seinerseits von Kontrollverlust und dem starken Interesse an Möglichkeiten der Einschränkung bzw. Erschwerung der Nutzung von digitalen Angeboten berichtet (Anselm, 515, 579, 637-642).
Was sind die wichtigsten stressverursachenden Faktoren in dieser Kohorte?
Anhand der Interviews lässt sich feststellen, dass hauptsächlich über kognitiven Stress berichtet wird. Als Ursache dafür lässt sich der Verlust von Kontrolle über die eigene Zeitgestaltung feststellen. Konkret bedeutet das oft erhöhten Leistungsdruck bei gleichzeitigem Mangel an Zeit (S. 57). Zeit, als zentraler Begriff der Leistungsgesellschaft, wurde seitens der Befragten nach dem Kernbegriff Stress am zweithäufigsten verwendet, um ihr subjektives Stresserleben zu erläutern (S. 51-52).
Des Weiteren zeigt diese Studie, dass die digitale Umwelt und die damit einhergehenden Möglichkeiten zu einer Beschleunigung und neuen Produktivitätsansprüchen führen. Dies kollidiert mit den natürlichen Kapazitäten der Befragten und erhöht dadurch die subjektive Stressbelastung. Geleichzeitig ist anzunehmen, dass sich die regelmäßige Nutzung digitaler, werbefinanzierter Angebote (Kapitel 2.3.3) und die damit verbundenen Aktivierungsversuche insgesamt belastend auf die Allostatic Load (S. 35) auswirkt und somit Kapazitäten der Stressbewältigung mindert. Während auch positive Aspekte der digitalen Umwelt, wie niederschwellige Kommunikation oder Informationsbeschaffung thematisiert wurden, offenbart die Auswertung der Konnotationen eine überwiegend negative Wirkung auf die Teilnehmer*innen (S. 50)
Weitere erwähnte Stressquellen sind einerseits physiologische Reize wie Lärm (menschlichen bzw. technischen Ursprungs) und Feuchtigkeit (in der Natur), oder Existenzsorgen sowie soziale Stressoren – wobei die beiden letztgenannten auch eher projiziert werden, dadurch belastende Wirkung entfalten und deshalb auch als kognitive Eigenleistung verstanden werden können.
Welche stressabbauenden Strategien lassen sich bei Millennials erkennen?
Zunächst gilt es entsprechend der Erkenntnisse des Kapitel 2.2 festzuhalten, dass Stress grundsätzlich ein neutraler Begriff ist und einen natürlichen und notwendigen Teil allen Lebens darstellt. Die unvermeidbare Konfrontation mit Stressoren regt zur Aktivität an. Was bei angemessenen Herausforderungen im Wechselspiel mit Ruhephasen die Leistungsfähigkeit steigert und Ausbildung von Resilienz ermöglicht, bedeutet bei Überbelastung hingegen negative Konsequenzen von Disstress bis hin zur Leistungsunfähigkeit bzw. Burnout. Ein Schutz vor Stress ist demnach nicht nur unmöglich, sondern auch nicht wünschenswert. Es geht demnach vielmehr darum, eine an die subjektiven Kapazitäten angemessene Stressroutine zu gestalten.
Seitens der Interview-Partner*innen geht hervor, dass bewusst verbrachte Zeit akutem Stress entgegenwirken und diesem bei entsprechender Routine auch prophylaktisch vorsorgen kann (S. 57). Das Wiedererlangen der Kontrolle über die eigene Zeitgestaltung wirkt sich positiv auf
das Stresserleben aus Wichtig dafür scheint die eigene Entscheidung zu sein, sich Zeit zu nehmen (Erkenntnis 7.4; S. 61) sowie die intrinsische Motivation (Erkenntnis 6; S. 59).
Außerdem gibt es laut Interviewaussagen geeignete Umgebungen, wo präsent sein besonders gut geling; das sind vor allem natürliche Landschaften wie Wälder, Berge und Küstengebiete (Erkenntnis 4; S. 58). Eine Voraussetzung dafür scheint die Authentizität der natürlichen Landschaft zu sein. Zivilisatorischer Lärm oder sichtbare, strukturierende Eingriffe des Menschen werden als störend empfunden.
Soziale Interaktion, vor allem in Form von Gesprächen, stellt eine weitere wichtige Strategie zur Stressbewältigung dar (Erkenntnis 5; S. 59), wobei gleichzeitig von kontraproduktiver Wirkung ständiger sozialen Aktivität berichtet wird. Soziale Medien können zwar teilweise unterstützend wirken und reale Begegnungen ermöglichen (Erkenntnis 3.2; S. 58), diese aber laut Aussage eines Teilnehmers nicht ersetzen (Anselm, 178-188). Alle Befragten berichten überwiegend von negativen Wirkungen der digitalen Umwelt, wie im vorherigen Punkt ausgeführt.
Auch Akzeptanz der Gegebenheiten, Rückzug bzw. Flucht oder körperliche Aktivität finden als Strategien für Stressbewältigung Anwendung (Erkenntnis 7, S. 60).
Wie beliebt ist unter Millennials die Natur als Rückzugsort, um mit Stress umzugehen?
Natürliche Landschaften wie der Wald, Meeresküsten oder die Berge gehen aus den Interviews eindeutig als beliebte Umgebungen zur Ruhefindung bzw. Stressbewältigung hervor (Erkenntnis 4, S. 58) Alle Befragten führten natürliche Umgebung(en) spontan als wohltuend bzw. stressmindernd an, bevor der Begriff Natur seitens des Interviewenden verwendet wurde. Die Frequenz von Naturerfahrungen hängt einerseits stark von Jahreszeiten ab, wobei eindeutig der Sommer präferiert wird, und anderseits von der aktuellen Lebenssituation. So berichtet ein Gesprächspartner über mehr als 3000 Übernachtungen in der Natur, sowie monatelangen naturnahen Reisen am Stück (Anselm, 486). Beide anderen Personen geben an, bei günstiger Witterung an jedem zweiten Tag Zeit in der Natur zu verbringen (Clara, 148; Evelyn, 246).
Die berichteten Gründe für das Verweilen bzw. Aufsuchen natürlicher Orte deckt sich zum Großteil mit der Attention Restoration Theory (S. 44), die eine sogenannte sanfte Faszination als notwendige Grundlage für die Wiederherstellung von Aufmerksamkeit definiert, welche in weiterer Folge die Kapazitäten für erfolgreiche Stressbewältigung begünstigt. Bestimmte Aussagen (Anselm, 402-413, 501-507; Clara, 150-152, 155-161, 178-180) zeugen von einer tiefen Beziehung mancher Befragten zur Natur (im Sinne der Biophilie-Theorie; S. 38). Interessanterweise geben zwei der drei Befragten explizit an, die Wirkung sei an die Bedingung der Naturbelassenheit der natürlichen Umgebung geknüpft – Grünflächen bzw. Kulturlandschaft dominiert von sichtbaren menschlichen Eingriffen (geraden Linien, bekannte Formen) oder z.B. Autolärm werden als kontraproduktiv empfunden (Erkenntnis 4.1, S. 58)
Während eine Person angibt, eine gewisse Zeit zu benötigen (mindestens drei Tage), um in der natürlichen Umgebung anzukommen (Anselm, 439-442), gibt eine andere zu bedenken, dass
sie nicht bewusst aus Gründen der Stressbewältigung oder Suche nach Ruhe in den Wald geht, sondern nennt Interesse und Freude an Outdooraktivitäten als Motivation (Evelyn, 256-261).
Der Aspekt der Neugierde, der Hingabe und intrinsischer Motivation als Erfolgskriterium findet sich auch in anderen Aussagen wieder (Erkenntnis 6, S. 59) und wirft die Frage auf, ob von außen veranlasste bzw. im Sinne von individuellen nature-based health interventions (S. 41) verschriebene Naturaufenthalte zur erhofften Wirkung führen können.
4.2 Fazit
Die Umgebung steht zweifelsfrei im Zusammenhang mit dem subjektiven Stressempfinden. Der Umweltpsychologie (Hellbrück & Kals, 2012, S. 13) zufolge lässt sich das, was Menschen umgibt, in drei Kategorien aufteilen; die natürliche, die soziale und die kulturell-zivilisatorische Umwelt
Die Auswertung der Interviews zeigt, dass vor allem das soziale Umfeld hier von Relevanz ist; es bietet einerseits wichtige Möglichkeiten der Stressbewältigung, andererseits hat es auch enormes Stresspotenzial inne. Kommunikation und Gesellschaft sind hierbei die wichtigsten Schlagwörter
Die natürliche Umwelt ist der Studie nach beliebt und stellt auch einen beträchtlichen Teil des Alltagslebens der Befragten dar. Gründe für bewusste Naturerfahrungen sind Entschleunigung, Stressbewältigung oder Rekreationszwecke. Eine gesundheitsfördernde als auch stresssenkende Wirkung von Naturlandschaften auf den Menschen gilt als bewiesen. Es ist dabei allerdings zu bedenken, dass durch die bewussten und begrenzten Aufenthalte in der Natur negative Aspekte großteils vermeidbar sind und die positiven Effekte überwiegen Das kann eine Idealisierung der Natur beflügeln. Die richtige Menge und Art von Naturaufenthalten ist derzeit noch nicht abschließend erforscht (S. 41), es ist jedoch anzunehmen, dass es einen tipping point gibt, an dem die Nachteile und der damit verbundene Stress die positiven Effekte der natürlichen Umgebung übersteigen, was wiederum den Bedarf an kulturell-zivilisatorischer Umgebung steigern würde.
Die kulturell-zivilisatorischen Umgebung belastet Menschen derzeit durch Verschmutzung, Reizüberflutung, Leistungs- und Produktivitätsdruck. Die vielen Vorzüge, welche aufgrund stetiger Präsenz zur Selbstverständlichkeit wurden, sind schwer wertschätzbar. Eine Tendenz von idealisierten Wahrnehmungen von Natur als gut und der kulturell-zivilisatorischen Umgebung als störend, oder gar schlecht, lässt sich im Zuge dieser Arbeit über Stressbewältigung beobachten. Das deutet darauf hin, dass die Befragten unter einem Mangel an natürlicher Umwelt und einem Überfluss an sozial-kultureller Umwelt leiden.
Vor allem eine scheinbar neue Umgebungsform, welche Eigenschaften der sozialen und kulturell-zivilisatorischen Umwelt vereint – die digitale Umwelt – stellt ein polarisierendes Thema dar. Ihre durch technologischen Fortschritt von Zeit und Ort losgebundene Natur erzeugt eine neuartige Umwelt, wo bewährte Lösungsansätze (z.B. souveräne Zeiteinteilung, Orientierung, etc.) und Stressbewältigungsstrategien (z.B. fight or flight, Kommunikation, etc.) nicht wirksam
zu sein scheinen. Gleichzeitig kollidiert die schier unendliche Menge an Möglichkeiten mit den begrenzten Ressourcen der Menschen, wie beispielsweise Zeit, Aufmerksamkeit und Energie. Dies kann zu Überforderung führen. Bei längerfristiger Überlastung steigt die akkumulierte Stressbelastung im Sinne der Allostatic Load Theorie (Kapitel 2.2.2), was in weiterer Folge die Leistungs- und Widerstandsfähigkeit beeinträchtigt. Bei unveränderter Überforderungssituation kann dies zur problematischen Entwicklung führen – man findet sich vor der gleichen Herausforderung wieder, hat jedoch weniger Mittel zur Verfügung, um sie zu meistern. Sich dieser Situation zu entziehen, fällt schwer, nicht zuletzt aufgrund der Errungenschaften der Psychoinformatik. Gezielt werden psychologisch begründete und digital ausgeführte Aktivierungsversuche unternommen, um die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen zu ergattern und eine Reaktion – beispielweise einen Kauf bzw. ein Like – zu provozieren (S 35). Außerdem geht durch die engmaschige Verflechtung der sozialen sowie kulturell-zivilisatorischen mit der digitalen Umwelt ein Verzicht auf die letztere mit empfindlichen Auswirkungen in den beiden vorhergenannten Bereichen einher.
Die präzedenzlose Abhängigkeit zweier essenzieller Umwelten des Menschen – der sozialen und der kulturell-zivilisatorischen – von einer neuen, potenziell pathogenen digitalen Umwelt, stellt die Millennials und wohl auch nachfolgende Generationen vor große Herausforderungen.
Naturlandschaften können einerseits als alternative Umwelt durch die Absenz von Stressoren punkten, die den anderen Umgebungen eigen sind, andererseits bieten spezifische Qualitäten Abhilfe für akuten Stress bzw. beugen chronischem Stress vor. Allen voran können implizite Möglichkeiten sanfter Faszination (Kapitel 2.4) helfen, Aufmerksamkeit zu regenerieren und bilden damit die Grundlage für qualitativ hochwertiges (Er-)Leben.
4.3 Limitation der Studie und Forschungsausblick
Die geringe Anzahl der Interviewten (n: 3) bedingt derzeit eine limitierte allgemeine Aussagekraft der Studie. Im weiteren Forschungsverlauf soll eine quantitative Online-Umfrage auf Basis dieser qualitativen Erkenntnisse helfen, tieferes Verständnis für das Thema zu erlangen sowie die Schlussfolgerungen dieser Arbeit zu verifizieren bzw. falsifizieren.
Eine weitere Limitation stellt die pandemiebedingte Abwicklung der Interviews per Video-Anruf dar. Bestimmte Instrumente der qualitativen Forschung, wie z.B. Beobachtung oder Interaktivität durch Kurzfragebogen, die im weiteren Gesprächsverlauf als Leitfaden fungieren, wurden erheblich erschwert. Zudem wurde durch Netzwerkprobleme und unerwünschte Audioeffekte der natürliche Gesprächsfluss immer wieder unterbrochen, was eventuell eine weniger konzentrierte Auseinandersetzung mit den eigentlichen Inhalten zufolge hatte.
Ebenso stellt der begrenzte Umfang dieser studentischen Arbeit eine Limitation dar. Vor allem hinsichtlich der Komplexität von Teilbereichen der Stressentstehung und deren Ursachen, wie beispielsweise die zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinreichend erforschten Langzeiteffekte von
der sich ständig wandelnden digitalen Umwelt, welche weiter an Bedeutung in unseren Lebensrealitäten gewinnt.
Während die erwähnte Belastung der Allostatic Load durch regelmäßige Konfrontation mit Werbung während der Smartphonenutzung aufgrund der theoretischen Erkenntnissen dieser Studie als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist, bleibt die Frage nach etwaigen Habituationseffekten unbeantwortet. Insbesondere wäre von Interesse, inwiefern sich Toleranz gegenüber Reizbelastung erhöht bzw. noch weiter erhöhen lässt, ob die Rolle von Ignoranz als konstruktiver Lösungsweg bei Überbeanspruchung durch Reize an Bedeutung gewinnt und welche Gefahren eine solche Entwicklung bergen könnte. Erleben wir möglicherweise bereits die Orwell’sche Prophezeiung vom Aufstieg der Ignoranz zur neuen Stärke in einer unter Reizüberflutung leidenden Informationsgesellschaft?
Epilog
Als Designer will ich wissenschaftliche Erkenntnisse, wie die im Rahmen dieser Arbeit zusammengetragenen und erhobenen, zur Orientierung für mein weiteres Wirken nutzen. Im vollen Bewusstsein darüber, dass diese Studie lediglich einen Ausschnitt der Realität rund um das Stresserleben von Millennials einzufangen vermag, möchte ich an diese Erkenntnisse auf praxisorientierte Art und Weise anzuknüpfen.
Während die anfängliche, problemorientierte Sicht und die damit einhergehenden Recherche nach den Ursachen von Stressbelastungen die digitale Umwelt als einen der stärksten Indikatoren für die Entstehung von negativ empfundenem Stress zu identifizieren geholfen hat, wurde die Naturerfahrung als hypothetischer lösungsorientierter Ansatz einer förderlichen Umgebung in ihrer Wirkung als auch Beliebtheit bestätigt. Gleichzeitig lässt sich einerseits ein Mangel bzw. Bedarf an authentischen Naturerfahrungen, andererseits ein Überdruss an der digital verbrachten Zeit, beobachten.
Auf dem Weg zur Gestaltung einer konkreten Antwort – eines Produktes bzw. einer Dienstleistung
auf die erkannte Problemstellung gilt es meiner Meinung nach zunächst eine grundlegende Entscheidung für einen der folgenden methodischen Ansätze zu treffen: Das Problem zu bekämpfen, das Problematische neuzugestalten, oder Alternativen auszubilden.
Ich entscheide mich für den letztgenannten Ansatz, da ich von dessen nachhaltigen Wirkung überzeugt bin. Folgende Fragen werden mich beim weiteren Vorgehen begleiten:
Lassen sich die Erkenntnisse dieser Arbeit mit quantitativen Methoden verifizieren?
Wie ist es um das Stressbewusstsein in der Öffentlichkeit bestellt?
Wie hoch ist der Bedarf an authentischen Naturerfahrungen?
Welches Format bietet authentische und wirksame Naturerfahrungen?
Welche Arten des Digital Detox gibt es und wie wirksam sind sie?
Welche attraktiven Möglichkeiten der Zeitgestaltung mit digitalem Entgiften als beiläufigen Effekt gibt es?
V. Quellenverzeichnis
Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., FIKSDAHLKING, I., AN-GEL, S., & CZECH, H. (1995). Eine Muster-Sprache. Städte, Gebäude. Konstruktion, 2
Alexander, C. S. & Sysko, J. M. (2013). I'M GEN Y, I LOVE FEELING ENTITLED, AND IT SHOWS. Academy of Educational Leadership Journal, 17(4), 127-131. https://www.proquest.com/scholarly-journals/im-gen-y-i-love-feeling-entitled-shows/docview/1462525731/se-2
Allen, R. S., Allen, D. E., Karl, K., & White, C. S. (2015). Are Millennials Really an Entitled Generation? An Investigation into Generational Equity Sensitivity Differences. Journal of Business Diversity, 15(2).
Ang, R. P., & Huan, V. S. (2006). Relationship between academic stress and suicidal ideation: Testing for d epression as a mediator using multiple regression. Child psychiatry and human development, 37, 133-143.
AXA. (2022, 25. Jänner). Prevalence of anxiety, depression, and stress in selected European countries as of 2022 [Graph]. In Statista Zugriff am 26.11.2022, von https://www-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistics/1339498/feelings-of-anxiety-depression-andstress-in-europe/
Barbera, L. D., Paglia, L. F., & Valsavoia, R. (2009). Social network and addiction. Stud Health Technol Inform, 144, 33-36.
Barmparas, G., Imai, T., Gewertz, B., (2019) The Millennials are Here and They Expect More From Their Surgical Educators!. An nals of Surgery: December 2019 - Volume 270 - Issue 6 - p 962-963 https://journals.lww.com/annalsofsurgery/fulltext/2019/12000/the_millennials_are_here_and_they_expect_more_from.7.aspx
Bartl, G. (2016). Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen als soziale Reflexion des Ve rhältnisses zwischen Freiheit und Sicherheit?. Zeitschrift Für Außen-Und Sicherheitspolitik, 9(2), 243-262.
Basu, A., Duvall, J., & Kaplan, R. (2019). Attention restoration theory: Exploring the role of soft fascination and mental bandwidth. Environment and Behavior, 51(9-10), 1055-1081. https://doi.org/10.1177/0013916518774400
Bell, S. L., Phoenix, C., Lovell, R., & Wheeler, B. W. (2015). Seeking everyday wellbeing: The coast as a therapeutic landscape. Social Science & Medicine, 142, 56-67. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.08.011
Bidlingmaier, J. (Ed.). (2013). Modernes Marketing Moderner Handel: Karl Christian Behrens zum 65. Geburtstag. Springer-Verlag.
Binder, J., & Weber, F. (2015). Data Experience Marktforschung in den Zeiten von Big Data. Marketing Review St. Gallen, 32(2), 30-39. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11621-015-0525-5.pdf
Bloomberg Technology (2020, 17. November). Zuckerberg Says He Doesn’t Want Facebook to Be Addictive [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DmdCZ_ArQ2w
Bock, F. (2017, 19. November) Gerüchte reißen nicht ab. ORF Nachrichten. https://orf.at/v2/stories/2413878/2413879/
Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., ... & Solnet, D. (2013). Understandin g Generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of service management
Brandt, M. (2014, 26. September). Zahlenspielerei: Wie viel ein werbefreie s Netz kosten würde [Digitales Bild]. Zugriff am 06. Dezember 2022, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/infografik/2759/kosten-eines-werbefreien-webs/
Brockhaus, (o. J.a). Eustress. Zugriff am 27.11.2022, von http://brockhaus.at/ecs/enzy/article/eustress
Brockhaus, (o. J.b). Informationsgesellschaft. Zugriff am 30.11.2022, von http://brockhaus.at/ecs/enzy/article/informationsgesellschaft
Brockhaus. (o. J.c). Metadaten. Zugriff am 21.11.2022, von http://brockhaus.at/ecs/enzy/article/metadaten
Brockhaus, (o.J.d). Natur. Zugriff am 13.12.2022, von http://brockhaus.at/ecs/enzy/article/natur
Brockhaus. (o. J.e). Stress. Zugriff am 26.11.2022, von https://brockhaus.at/ecs/permalink/BD22EC31295332F8CF76B4C5B86CD740.pdf
Brockhaus, (o. J.f). Wahrnehmung. Zugriff am 27.11.2022, von http://brockhaus.at/ecs/enzy/article/wahrnehmung
Brockhaus, (o. J.g). Zivilisationskrankheiten. Zugriff am 27.11.2022, von http://brockhaus.at/ecs/enzy/article/zivilisationskrankheiten
Burisch, M. (2014). Das burnout-syndrom. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi-org.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/10.1007/978-3-642-36255-2
Cadwalladt, C. & Graham-Harrison, E. (2018, 17. März). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. The Guardian. https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-uselection
Cambridge University Press (o. J.a). Data. In Cambridge Academic Content Dictionary. Zugriff am 20.11.2022, von https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data
Cambridge University Press (o. J.b). Entitlement. In Cambridge Academic Content Dictionary. Zugriff am 20.11.2022, von https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/entitlement
Cambridge University Press (o. J.c). Information. In Cambridge Academic Content Dictionary. Zugriff am 20.11.2022, von https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information
Cervinka, R., Höltge, J., Pirgie, L., Schwab, M., Sudkamp, J., Haluza, D., ... & Ebenberger, M. (2014). BFW-Berichte.
Cugh, P. (2020). Effect of values and life style on consumer online purchase intention. Mukt Shabd Journal, 9(6), 1965-1969. http://shabdbooks.com/gallery/198-june-2020.pdf
DAK. (2017, 24. August). Was hat dazu beigetragen, dass Sie sich im letzten Sommerurlaub gut erholt haben? [Graph]. In Statista. Zugriff am 13. Dezember 2022, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/595503/umfrage/umfrage-zuerholungsfaktoren-im-sommerurlaub-nach-alter-und-geschlecht/
Deal, J. J., Altman, D. G., & Rogelberg, S. G. (2010). Millennials at work: What we know and what we need to do (if anything) Journal of business and psychology, 25(2), 191-199.
Deloitte. (2019, 20. Mai). Welchen Aussagen über soziale Medien stimmen Sie zu? [Graph]. In Statista. Zugriff am 10. Februar 2023, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/1024646/umfrage/millennials-und-die-generation-z-zu-negativen-auswirkungen-von-social-media/
Devriese, L., (2018) “Variation, a precious lesson. Why we need to keep in mind the origin and meaning of to vet, to fit and “survival of the fittest””, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 87(5), 297-299. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v87i5.16063
Diglin, G. (2014). Living the Orwellian Nightmare: new media and digital dystopia. E-Learning and Digital Media, 11(6), 608-618. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/elea.2014.11.6.608
Dorsch, (2021). Wahrnehmung, In Markus Antonius Wirtz (Hrsg.), Dorsch Lexikon der Psychologie. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/wahrnehmung
Eastman, J.K. & Liu, J. (2012), "The impact of generational cohorts on status consumption: an exploratory look at generational cohort and demographics on status consumption", Journal of Consumer Marketing, Vol. 29 No. 2, pp. 93-102.
https://doi.org/10.1108/07363761211206348
Esch, F-R. (o.J.). Below-the-Line-Kommunikation. Zugriff am 10. Februar 2023, von https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/below-line-kommunikation-30531/version-254109
ESOMAR. (2020, September 21). Revenue of market research companies in the United States from 2009 to 2019 (in billion U.S. dollars) [Graph]. In Statista. Zugriff am 20.11.2022, von https://www-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistics/491581/us-market-research-revenue/
ESOMAR. (2021, December 31). Global revenue of the market research industry from 2008 to 2021 with forecasts for 2022 (in billion U.S. dollars) [Graph]. In Statista. Zugriff am 20.11.2022, von https://www-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistics/242477/globalrevenue-of-market-research-companies/
European Travel Commission. (2022, 26. Oktober). Share of Europeans planning to take a leisure overnight trip domestically or in Europe in the next six months as of September 2022, by type of trip [Graph]. In Statista. Retrieved December 20, 2022, from https://www-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistics/1230484/europeans-planning-trips-domestically-or-in-europe-by-traveler-type/ Eurostat. (2021, 16. Dezember). Anteil der täglichen Internetnutzer in ausgewählten Ländern in Europa im Jahr 2021 [Graph]. In Statista. Zugriff am 06. Dezember 2022, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/39082/umfrage/anteil-derinternet-nutzer-die-taeglich-online-sind/
Everson-Rose, S. A., Roetker, N. S., Lutsey, P. L., Kershaw, K. N., Longstreth Jr, W. T., Sacco, R. L., ... & Alonso, A. (2014). Chro nic stress, depressive symptoms, anger, hostility, and risk of stroke and transient ischemic attack in the multi-ethnic study of atherosclerosis. Stroke, 45(8), 2318-2323.
Faeh, D. (2011). Begehrt das Herz Bergluft? Einfluss der Meereshöhe auf das Herz-Kreislauf-Risiko. Praxis (16618157), 100(18).
Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations 7(2), 117–40.
Fichter, C. (Ed.). (2018). Wirtschaftspsychologie für Bachelor. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54944-5
Fisk, W. J. (2000). Health and productivity gains from better indoor environments and their relationship with building energy efficiency. Annual review of energy and the environment, 25(1), 537-566. https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.energy.25.1.537
Friedmann, B., & Bärtsch, P. (1997). Höhentraining: Sinn, Unsinn, Trends. Der Orthopäde, 26, 987-992.
Galler, B. A. (1986). The IBM 650 and the Universities. IEEE Annals of the History of Computing, 8(1), 36 –38. doi:10.1109/mahc.1986.10019
Galloway, S. (2017). THE FOUR: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google. Portfolio Penguin, New York.
Gascon, M., Triguero-Mas, M., Martínez, D., Dadvand, P., Forns, J., Plasència, A., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2015). Mental health benefits of long-term exposure to residential green and blue spaces: a systematic review. International journal of environmental research and public health, 12(4), 4354-4379.
Gebhard, U. (2001). Kind und Natur. Westdt. Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21276-6
Gerber, M., & Schilling, R. (2018). Stress als Risikofaktor für körperliche und psychische Gesundheitsbeeinträchtigungen. In Handbuch Stressregulation und Sport (pp. 93-122). Springer, Berlin, Heidelberg.
DOI: 10.1007/978-3-662-49322-9_5
Gimpel, H., Lanzl, J., Manner-Romberg, T., & Nüske, N. (2018). Digitaler Stress in Deutschland: Eine Befragung von Erwerbstätigen zu Belastung und Beanspruchung durch Arbeit mit digitalen Technologien.
Golub, A., Mahoney, M., & Harlow, J. (2013). Sustainability and intergenerational equity: do past injustices matter?. Sustainability science, 8(2), 269-277. https://doi.org/10.1007/s11625-013-0201-0
GreenBook. (2021, 28. Jänner). Share of traditional qualitative methods used in the market research industry worldwide in Q4 2020 [Graph]. In Statista. Zugriff am 23.11.2022, von https://www-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistics/875985/market-researchindustry-use-of-traditional-qualitative-methods/
Häfner, P. (2003). Natur-und Waldkindergärten in Deutschland: eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung (Doctoral dissertation).
Haller, L. (2010). Stress, Cortison und Homöostase. NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin, 18(2), 169195.
Hellbrück, J., & Kals, E. (2012). Umweltpsychologie. Wiesbaden: Springer VS. DOI 10.1007/978-3-531-93246-0
Heo, J., & Muralidharan, S. (2019). What triggers young Millennials to purchase eco-friendly products?: the interrelationships among knowledge, perceived consumer effectiveness, and environmental concern. Journal of Marketing Communications, 25(4), 421-437. DOI: 10.1080/13527266.2017.1303623
Hershatter, A., & Epstein, M. (2010). Millennials and the world of work: An organization and management perspective. Journal of business and psychology, 25(2), 211-223.
Hilbrecht, H. (2021, 17. September). Psychische Erkrankungen: Stress senken, das Risiko reduzieren. Garmin. https://www.garmin.com/de-CH/?utm_source=beatyesterdayorg&utm_medium=headerfooter&utm_campaign=beatyesterdayorgtogarmincom&utm_content=https%3A%2F%2Fde.beatyesterday.org%2Fhealth%2Fbody-soul%2Fpsychische-erkrankungen-stress-senken-dasrisiko-reduzieren
Horx, T. (2021). Megatrend Dokumentation. Zukunftsinstitut.
Humer, E., Probst, T., Wagner-Skacel, J., & Pieh, C. (2022). Association of Health Behaviors with Mental Health Problems in More than 7000 Adolescents during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15), 9072.
Hüttner, M. (2019). Grundzüge der Marktforschung. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
IAB. (2022). Internet Advertising Revenue Report Full-year 2021 results. https://www.iab.com/wp-content/uploads/2022/04/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_Full_Year_2021.pdf
IfD Allensbach. (2022, 21. Juni). Generationen in Deutschland nach Freizeitbeschäftigungen, die häufig oder ab und zu ausgeübt werden nach Generationen im Jahr 2022 [Graph]. In Statista. Zugriff am 10. Februar 2023, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/1136748/umfrage/umfrage-zu-beliebten-freizeitbeschaeftigungen-nach-generationen/
Jessen, M. (2006). Einfluss von Stress auf Sprache und Stimme. Unter besonderer Beruecksichtigung polizeidienstlicher Anforderungen. Schulz-Kirchner Verlag GmbH, Idstein.
Junker, F., Walcher, D. & Blazek, P. (2016) "Acceptance of online mass customization by generation Y." 7th International Conference on Mass Customization and Personalization In Central Europe. 2016.
Kahle, L. R., Beatty, S. E., & Homer, P. (1986). Alternative Measurement Approaches to Consumer Values: The List of Values (LOV) and Values and Life Style (VALS). Journal of Consumer Research, 13(3), 405. doi:10.1086/209079
Kampa, M., & Castanas, E. (2008). Human health effects of air pollution. Environmental pollution, 151(2), 362-367. DOI: 10.1016/j.envpol.2007.06.012
Katschnig, H., (2003). Mental health Austria. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Sektion III, Wien
Kattmann, U. (o. J.) Der Mensch in der Natur Die Doppelrolle des Menschen als Schlüssel für Tier-und Umweltethik 1.
Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (1993). The biophilia hypothesis.
Kemp, L., Xu, C., Depledge, J., Ebi, K. L., Gibbins, G., Kohler, T. A., ... & Lenton, T. M. (2022). Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(34), e2108146119. https://doi.org/10.1073/pnas.2108146119
Kettunen, M., & Kriikkula, S. (2020). Preparing for the future: Millennials' means of seeking financial security.
Klampfl, P. (2023, 31. Jänner). Was kränkt, macht krank [Radiobetrag]. Radiokolleg, ORF Ö1. https://oe1.orf.at/player/20230131/706698
Knuth, D. E. (1970). Von Neumann's first computer program. ACM Computing Surveys (CSUR), 2(4), 247-260.
Koisser, H. (2009). Warum es uns so schlecht geht, obwohl es uns so gut geht. Orac/Verlag Kremayr &Scheriau KG, Wien
Kolář, P. (2021). Posilování stresem: cesta k odolnosti. Euromedia Group.
Kolomogoroff, A. (2013). Grundbegriffe der wahrscheinlichkeitsrechnung (Vol. 2). Springer-Verlag.
Kross, E., Verduyn, P., Demiralp, E., Park, J., Lee, D. S., Lin, N., ... & Ybarra, O. (2013). Facebook use predicts declines in subjective wellbeing in young adults. PloS one, 8(8), e69841.
Kury, P. (2012). Der überforderte Mensch: Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout (Vol. 66). Campus Verlag.
Ladhari, R., Gonthier, J., & Lajante, M. (2019). Generation Y and online fashion shopping: Orientations and profiles. Journal of retailing and Consumer Services, 48, 113-121. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698918304508?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1
Landa, F. (2022). Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích Českých Budějovic. Statutární město České Budějovice. http://301188.w88.wedos.ws/wp-content/uploads/2022/07/manual_vizusmog_NET.pdf
Lepage, J. D. G. (2010). Castles and fortified cities of Medieval Europe: an illustrated history. McFarland.
Lewis, P. (2017, 6. Oktober). 'Our minds can be hijacked': the tech insiders who fear a smartphone dystopia. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/smartphone-addiction-silicon-valley-dystopia
Lloyd, J., & Harris, R. (2007). THE TRUTH ABOUT GEN Y. Marketing, 112(19), 13-20. https://www.proquest.com/trade-journals/truthabout-gen-y/docview/227195062/se-2
Lockley, L. C. (1950). Notes on the History of Marketing Research. Journal of Marketing, 14(5), 733 –736. doi:10.1177/002224295001400511
Lopez, A. D., Mathers, C. D., Ezzati, M., Jamison, D. T., & Murray, C. J. (2006). Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. The lancet, 367(9524), 1747-1757. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68770-9
Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., De Vries, S., & Spreeuwenberg, P. (2006). Green space, urbanity, and health: how strong is the relation?. Journal of epidemiology & community health, 60(7), 587-592.
Machado, A., Herrera, A. J., de Pablos, R. M., Espinosa-Oliva, A. M., Sarmiento, M., Ayala, A., ... & Cano, J. (2014). Chronic stress as a risk factor for Alzheimer’s disease. Reviews in the Neurosciences, 25(6), 785-804.
Macït, H. B., Macït, G., & Güngör, O. (2018). A research on social media addiction and dopamine driven feedback. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 882-897. DOI: 10.30798/makuiibf.435845
Matos-Wasem, R., & Reichler, C. (2008). Die Alpenluft. Kulturgeschichte der Alpenluft und ihrer Bedeutung für die Landschaftswahrnehmung der Alpenreisenden.
McCallum, J. C., (2022). Historical cost pf computer memory and storage. Zugriff am 06. December 2022, von https://ourworldindata.org/grapher/historical-cost-of-computer-memory-and-storage?time=1999..latest&country=~OWID_WRL
McGonagle, K. A., & Kessler, R. C. (1990). Chronic stress, acute stress, and depressive symptoms. American journal of community psychology, 18(5), 681-706.
McLuhan, M. (1962). The Gutenberg galaxy: The making of typographic man. University of Toronto Press.
Meta Platforms. (2022, 02. Februar). Meta (formerly Facebook Inc.) revenue and net income from 2007 to 2021 (in million U.S. dollars) [Graph]. In Statista. Zugriff am 02.12.2022, von https://www-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistics/277229/facebooks-annualrevenue-and-net-income/
Mey, G., & Mruck, K. (2011). Qualitative Interviews. In Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis (pp. 257-288). Gabler.
Meyer, C., Steil, R. (1998). Posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. Unfallchirurg 101, 878–893. https://doiorg.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/10.1007/s001130050354
Michelis, D. (2014). Marktforschung. In Der vernetzte Konsument (pp. 103-119). Springer Gabler, Wiesbaden.
Mishima, R., Kudo, T., Tsunetsugu, Y., Miyazaki, Y., Yamamura, C., & Yamada, Y. (2004). Effects of sounds generated by a dental turbine and a stream on regional cerebral blood flow and cardiovascular responses. Odontology, 92(1), 54-60. https://doi.org/10.1007/s10266004-0039-0
Mitchell A. (1983). The nine american lifestyles : who we are and where we're going (Warner books). Warner Books.
Montag, C., Duke, É., & Markowetz, A. (2016). Toward psychoinformatics: Computer science meets psychology. Computational and mathematical methods in medicine, 2016.
Montag, C. (2021). Du gehörst uns. Die psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat & Co-und wie wir uns vor der großen Manipulation schützen. München: Blessing.
Moreno, M. A., Kota, R., Schoohs, S., & Whitehill, J. M. (2013). The Facebook influence model: a concept mapping approach. Cyberpsychology, behavior and social networking, 16(7), 504–511. https://doi.org/10.1089/cyber.2013.0025
Nass, S. J., Levit, L. A., & Gostin, L. O. (2009). The value and importance of health information privacy. In Beyond the HIPAA Privacy Rule: Enhancing Privacy, Improving Health Through Research. National Academies Press (US).
Neyman, C. J. (2017). A survey of addictive software design. https://core.ac.uk/reader/84280170
Ordun, G. (2015). Millennial (Gen Y) consumer behavior their shopping preferences and perceptual maps associated with brand loyalty. Canadian Social Science, 11(4), 40-55. http://www.flr-journal.org/index.php/css/article/view/6697
Orwell, G. (1950). 1984. A Signet Book / The New American Library, New York
Österreich. (2019a, 23. Februar). Haben Sie Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden? [Graph]. In Statista. Zugriff am 06. Februar 2023, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/980932/umfrage/angst-vor-verbrechen-in-oesterreich/
Österreich. (2019b, 23. Februar). Wie hat sich die Sicherheit für Leib und Leben in Österreich Ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren verändert? [Graph]. In Statista. Zugriff am 06. Februar 2023, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/980876/umfrage/sicherheit-fuer-leib-und-leben-in-oesterreich/ Österreich. (2019c, 23. Februar). Wovor fürchten Sie sich am meisten? [Graph]. In Statista. Zugriff am 06. Februar 2023, von https://destatista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/980942/umfrage/angst-vor-verbrechensarten-in-oesterreich/
Peterka-Bonetta, J., Sindermann, C., Sha, P., Zhou, M., & Montag, C. (2019). The relationship between Internet Use Disorder, depressi on and burnout among Chinese and German college students. Addictive behaviors, 89, 188-199. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.08.011
Radojka, K., & Filipović, Z. (2017). Gender differences and consumer behavior of millennials. Acta Economica Et Turistica, 3(1), 5-13. DOI: 10.1515/aet-2017-0002
rawpixel (o. J.). Friends on social media, Zugriff am 09. Februar 2023, von https://www.freepik.com/free-photo/friends-social-media_4191298.htm#from_view=detail_alsolike
Reppublika. (2021, 20. Oktober). Ranking der Top 10 reichweite nstärksten Websites in Österreich im September 2021 [Graph]. In Statista. Zugriff am 06. Dezember 2022, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/874592/umfrage/reichweite-der-beliebtesten-websites-in-oesterreich/
Reynolds, L., Bush, E. C., & Geist, R. (2008). The Gen Y Imperative. Communication World, 25(2), 19-22. https://www.proquest.com/trade-journals/gen-y-imperative/docview/210199185/se-2
Rheinberg, F. (2010). Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In: Heckhausen, J., Heckhausen, H. (eds) Motivation und Handeln. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi-org.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/10.1007/978-3-642-12693-2_14
Rosiek, A., Rosiek-Kryszewska, A., Leksowski, Ł., & Leksowski, K. (2016). Chronic stress and suicidal thinking among medical students. International journal of environmental research and public health, 13(2), 212.
Rothmann, R., & Buchner, B. (2018). Der typische Facebook -Nutzer zwischen Recht und Realität. Datenschutz und Datensicherheit-DuD, 42(6), 342-346.
Ruso, B. (2007). Qualitative Beobachtung. In Qualitative Marktforschung (pp. 525-536). Gabler. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-8349-9258-1_33
Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal of behavioral addictions, 3(3), 133-148. DOI: 10.1556/JBA.3.2014.016
Schewe, C. D., & Meredith, G. (2004). Segmenting global markets by generational cohorts: determining motivations by age. Journal of Consumer Behaviour, 4(1), 51–63. doi:10.1002/cb.157
Schiffrin, H. H., Liss, M., Miles-McLean, H., Geary, K. A., Erchull, M. J., and Tashner, T. (2014). Helping or hovering? The effects of helicopter parenting on college students' well-being. J. Child Fam. Stud. 23, 548–557. doi: 10.1007/s10826-013-9716-3
Schmidt, L.R., (o. J.). Stress, In Markus Antonius Wirtz (Hrsg.), Dorsch Lexikon der Psychologie. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/stress#search=920bac00bf5ee1f31f5c312c119c6c55&offset=0
Schulz, K. H., Heesen, C., & Gold, S. M. (2005). Das Stresskonzept von Allostase und Allostatic Load: Einordnung psychoneuroimmunologischer Forschungsbefunde an Beispielen zur Autoimmunität und Onkologie. PPmP-Psychotherapie· Psychosomatik· Medizinische Psychologie, 55(11), 452-461.
Schwabl, T., (2018). Reizüberflutung im Alltag der Österreicher. Marketagent.com. http://www.marketagent.com/webfiles/MarketagentCustomer/pdf/c8396a1e-d6a0-4b3c-8a3e-c5c852ad0a7b.pdf
Shanahan, D. F., Fuller, R. A., Bush, R., Lin, B. B., & Gaston, K. J. (2015). The health benefits of urban nature: how much do we need?. BioScience, 65(5), 476-485.
Solon, O. (2017, 9. November). Ex-Facebook president Sean Parker: site made to exploit human ‚vulnerability‘. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/09/facebook-sean-parker-vulnerability-brain-psychology
Spokas, M., Heimberg, R.G. (2009). Overprotective Parenting, Social Anxiety, and External Locus of Control: Cross-sectional and Longitudinal Relationships. Cogn Ther Res 33, 543 https://doi.org/10.1007/s10608-008-9227-5
Starke, D. (2000). Kognitive, emotionale und soziale Aspekte menschlicher Problembewältigung: Ein Beitrag zur aktuellen Stressforschung. LIT Verlag Münster.
Statistik Austria. (2022a, 20. Jänner). Nettoreichweite von Tageszeitungen in Österreich von 2009 bis 2020 (in Millionen Lesern pro Ausgabe) [Graph]. In Statista. Zugriff am 06. Dezember 2022, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/512822/umfrage/reichweite-von-tageszeitungenin-oesterreich/
Statistik Austria. (2022b, 31. Mai). Statistik des Bevölkerungsstandes. Zugriff am 06. Dezember 2022, von https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/bevoelkerung-im-jahresdurchschnitt
Statistisches Bundesamt. (2022, 20. Juni). Verteilung der Einwohner in Deutschland nach Generationen am 31. Dezember 2021 [Graph]. In Statista. Zugriff am 10. Februar 2023, von https://de-statista-com.ezproxy.fh-salzburg.ac.at/statistik/daten/studie/1131021/umfrage/generationenanteile-in-deutschland/
Stein, J. (2013). Millennials: The me me me generation. Time magazine, 20, 1-8. https://www.manasquanschools.org/cms/lib6/NJ01000635/Centricity/Domain/174/millennials_themememegeneration.pdf
Steinhardt, M. A., Smith Jaggars, S. E., Faulk, K. E., & Gloria, C. T. (2011). Chronic work stress and depressive symptoms: Assessing the mediating role of teacher burnout. Stress and health, 27(5), 420-429.
Steptoe, A. (1991). Invited review. Journal of Psychosomatic Research, 35(6), 633–644. doi:10.1016/0022-3999(91)90113-3
Steptoe, A., & Kivimäki, M. (2013). Stress and cardiovascular disease: an update on current knowledge. Annual review of public health, 34, 337-354.
DOI:10.1146/annurev-publhealth-031912-114452
Sun, Y., & Zhang, Y. (2021). A review of theories and models applied in studies of social media addiction and implications for future research. Addictive Behaviors, 114, 106699. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106699
Taylor, S. E., Repetti, R. L., & Seeman, T. (1997). Health psychology: what is an unhealthy environment and how does it get under the skin?. Annual review of psychology, 48.
Thomas, T. (2022, 30. November). Ohne Zuwanderung schrumpft die Bevölkerung [Radiobetrag]. Mittagsjournal, ORF Ö1. https://oe1.orf.at/player/20221130/698884/1669807012000
Tsunetsugu, Y., Park, B. J., & Miyazaki, Y. (2010). Trends in research related to “Shinrin-yoku”(taking in the forest atmosphere or forest bathing) in Japan. Environmental health and preventive medicine, 15(1), 27-37. https://doi.org/10.1007/s12199-009-0091-z UBA (o.J.). Definitionen zur Flächenanspruchnahme. Zugriff am 13. Dezember 2022, von https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/boden/flaecheninanspruchnahme/definition -flaechen
Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. science, 224(4647), 420-421.
University of California. (o. J.). Timeline / The Internet’s First Message Sent from UCLA. Zugriff am 23.11.2022 von https://100.ucla.edu/timeline/the-internets-first-message-sent-from-ucla
Valentine, D. B., & Powers, T. L. (2013). Generation Y values and lifestyle segments. Journal of consumer marketing. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCM-07-2013-0650/full/html
Varella, S. (2022, 1. Juni) Individuals who are impulsive buyers in the UK in 2017 [Infographic]. Statista. https://www.statista.com/statistics/790391/individuals-who-are-impulsive-buyers-in-uk/
VELUX Press (2018). THE EFFECTS OF MODERN INDOOR LIVING ON HEALTH, WELLBEING AND PRODUCTIVITY. https://press.velux.com/download/542967/theindoorgenerationsurvey14may2018-2.pdf
Vigdal, J.S. & Brønnick, K.K. (2022). A Systematic Review of “Helicopter Parenting” and Its Relationship With Anxiety and Depression. Front. Psychol. 13:872981. doi: 10.3389/fpsyg.2022.872981
Wadhwani, S., (2022a, 23. September). Meta Faces Second Class-Action Lawsuit for Violating User Privacy on iOS. Spiceworks. https://www.spiceworks.com/it-security/security-general/news/meta-class-action-lawsuit-for-bypassing-ios-att/
Wadhwani, S., (2022b, 29. November). Meta Fined $275M for Failing to Protect the Data of 533M Facebook Users. Spiceworks. https://www.spiceworks.com/it-security/security-general/news/meta-275m-gdpr-privacy-fine/
Walesh, S. G. (2009). The Dumbest Generation How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future: . Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York, 2008; 978-1-58542-639-3 (Vol. 9, No. 2, pp. 100-100). American Society of Civil Engineers.
Walker, J. L., & Walker, L. J. (1988). Self-reported stress symptoms in farmers. Journal of Clinical Psychology, 44(1), 10-16.
WHO. (2022). QE84 Acute stress reaction. In International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1448597234
WHO. (o.J.a). Mortality Database. Causes of death explorer. Intentional injuries. Zugriff am 13. Dezember 2022, von https://platform.who.int/mortality/themes/theme-details/topics/topic-details/MDB/intentional-injuries
WHO. (o.J.b). Mortality Database. Causes of death explorer. Self-inflicted injuries. Zugriff am 06. Februar 2023, von https://platform.who.int/mortality/themes/theme-details/topics/indicator-groups/indicator-group-details/MDB/self-inflicted-injuries WHO. (o.J.c). Mortality Database. Causes of death explorer. Violence. Zugriff am 06. Februar 2023, von https://platform.who.int/mortality/themes/theme-details/topics/indicator-groups/indicator-group-details/MDB/violence
WHO. (o.J.d). Urban health. Zugriff am 13. Dezember 2022, von https://www.who.int/europe/health-topics/urban-health#tab=tab_1
Wieck, K. L. (2008). Managing the millennials. Nurse Leader, 6(6), 26-29.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.mnl.2008.09.002
Wilson, M., & Gerber, L. E. (2008). How generational theory can improve teaching: strategies for working with the millennials. Currents in teaching and learning, 1(1), 29-44. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=4aecf98b4cd5c7dad19e27f1bd85d5befd3e3121
Witten, K., Hiscock, R., Pearce, J., & Blakely, T. (2008). Neighbourhood access to open spaces and the physical activity of residents: a national study. Preventive medicine, 47(3), 299-303.
Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte interview (pp. 227-255). Beltz.
Wood, J. V. (1989). Theory and Research Concerning Social Comparisons of Personal Attributes. Psychological Bulletin 106(2), 231–48.
Woodhouse, T., (o. J.). A brief history of peace. https://www.visionofhumanity.org/a-brief-history-of-peace/ Yankelovich, Daniel; David Meer (2006, 6. Februar). "Rediscovering Market Segmentation" (PDF) Harvard Business Review: 1–11. https://viewpointlearning.com/wp-content/uploads/2011/04/segmentation_0206.pdf
Zentes, J. (Ed.). (2013). Neue Informations-und Kommunikationstechnologien in der Marktforschung: Informationstagung
18. Januar 1983, Frankfurt veranstaltet vom Gottlieb Duttweiler Institut für wirtschaftliche und soziale Studien Rüschlikon-Zürich (Vol. 9). SpringerVerlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-93256-4_1







































