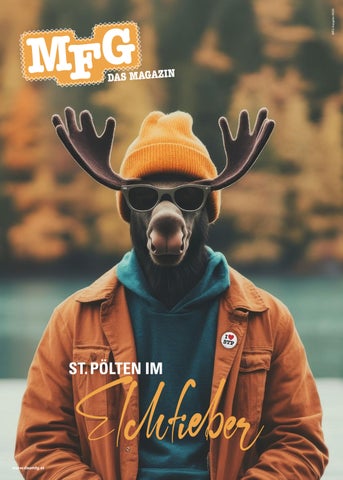ST. PÖLTEN IM












Leben.
Kraftstoffverbrauch: 5,1 – 7,0 l/100 km. CO₂-Emissionen: 116 - 160 g/km. Symbolbild. Stand 04/2025.
Seit 68 Jahren die Nr. 1 in Österreich
3100 St. Pölten
Breiteneckergasse 2
Telefon +43 505 91123
www.porscheinterauto.at

EMIL, EIN SOMMERMÄRCHEN
Es war einmal ein kleines, beschauliches Städtchen, das wurde alljährlich vom berühmt-berüchtigten Sommerloch heimgesucht. Dann stöhnten die Leute „Ach, es ist so gar nichts los. Es ist soooooo fad“, obwohl ihnen das insgeheim gar nicht so schlecht gefiel. Aber so sind die Menschen – immer sehnen sie sich nach dem, was sie gerade nicht haben. Denn war einmal etwas los, rollten sie mit den Augen und klagten ganz leidend: „Ich halte das alles nicht mehr aus, ich bekomme ein Burnout!“ Aber diesen Sommer passierte dann doch etwas, was das Sommerloch ganz schnell verscheuchte: Emil, der Elch tauchte auf. So mir nichts dir nichts war er auf einmal da – mitten in der Stadt! Und veränderte sie ein bisschen … Alle wollten den Emil sehen. Und so konnte es schon vorkommen, dass die Leute wie an einer Kette aufgefädelt entlang eines Zaunes lehnten und dem Emil dabei zuschauten, wie er in einem Garten das tat, was er am liebsten machte: essen. Da stand die Frau Anwalt neben dem Schichtarbeiter, ein junger Syrer neben einem Bauern aus dem Pielachtal, ein Skater im Schlabberlook neben einer elegant gekleideten Lady, eine Veganerin neben einem gestandenen Biker und so weiter. Ein richtig bunter Haufen war das. Nur ab und zu schauten sie auf, und wenn sich ihre Blicke trafen, mussten sie unvermittelt lächeln und fühlten sich einander irgendwie verbunden. Das machte der Emil, der auf seine Art auch ein Zauberer war, obwohl er das glaub ich gar nicht wusste. Natürlich gab es auch die Miesepeters, die mit erhobenem Zeigefinger schimpften „Lasst den Elch in Ruhe“ oder sich mokierten „So ein Theater um einen Elch“ – interessanterweise wussten die aber immer ganz genau Bescheid, wo der Emil gerade steckte und was er wieder für Schabernack getrieben hatte. Die Schaulustigen wollten dem Emil bestimmt nichts Böses, ganz im Gegenteil hielten alle brav Abstand, wie es der Tierschutzverein empfohlen hatte. Sie wollten ihn nur ein bisschen beobachten, so von der Ferne aus und, okay, vielleicht auch das ein oder andere Selfie
schießen – „ein Elch in St. Pölten“, flüsterten sie einander dann selig zu, und wieder spürten sie eine Art Einverständnis. Emil machte im Übrigen nicht wirklich den Eindruck, als ob ihn dieser Hype großartig stören würde. Der trabte einfach nur munter drauf los, wohin ihn gerade seine Hufe trugen, tauchte mal in einer Siedlung auf, ein andermal mitten auf der Straße, und war er einmal für ein paar Stunden verschwunden, weil er wahrscheinlich ein Nickerchen hielt oder so, titelten die Zeitungen sofort panisch „WO IST EMIL?“ Einmal setzte er sich sogar auf die Gleise der Westbahn – das war dann vielleicht nicht sooooo super, aber selbst das verziehen ihm die meisten. „Naja, der Emil halt!“, sagten sie nachsichtig, „was soll man da machen?!“ Die ÖBB informierten nur ihre Kunden, dass der Verkehr „wegen Tieren im Gleisbereich (Emil)“ gesperrt sei. Die brauchten tatsächlich nur seinen Namen erwähnen, und schon wussten alle „Ah, Emil der Elch!“, so berühmt war er! Sogar eine eigene FacebookGruppe hatte er mit Tausenden Followern, und oft wurde er – wie ein Superstar – von der Polizei eskortiert, die ein bisschen auf ihn aufpasste. Immerhin wusste ja keiner so recht, ob der Emil einen Führerschein hatte und die Verkehrsregeln kannte – seinem Verhalten nach eher nicht. So war das mit dem Emil, und dann, von einem Tag auf den anderen, war er so schnell fort wie er aufgetaucht war. Die Reihen der Schaulustigen lösten sich auf, jeder ging wieder seiner eigenen Wege, und bald machte sich nicht nur das Sommerloch wieder breit, sondern auch eine gewisse Kälte. Wo man sich eben noch in Verbundenheit angelächelt hatte, beäugte man einander wieder misstrauisch und grantelte vor sich hin … Schade eigentlich. Und Emil? Wenn er nicht gestorben ist – wie es am Ende jedes ordentlichen Märchens heißen muss – dann wandert er hoffentlich noch immer froh und munter durch die Gegend und bringt die Leute zusammen. Vielleicht sitzt er ja gerade beim Heurigen, oder er blockiert die Franz-JosefsBahn … wer weiß das schon. Der Emil halt!
Offenlegung nach §25 Medien-Gesetz: Medieninhaber (Verleger): NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH, MFG - Das Magazin, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten. Unternehmensgegenstand: Freizeitwirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen. Herausgeber/GF: Bernard und René Voak, in Kooperation mit dem Kulturverein MFG. Grundlegende Blattlinie: Das fast unabhängige Magazin zur Förderung der Urbankultur in Niederösterreich. Redaktionsanschrift: MFG – Das Magazin, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten; Telefon: 02742/71400-330; Internet: www.dasmfg.at, Email: office@dasmfg.at Chefredakteur: Johannes Reichl Chefredakteur-Stv.: Michael Müllner Chefin vom Dienst: Anne-Sophie Müllner Redaktionsteam: Thomas Fröhlich, Sascha Harold, Johannes Mayerhofer, Althea Karoline Müller, Michael Müllner, Andreas Reichebner, Thomas Schöpf, Beate Steiner, Thomas Winkelmüller Kolumnisten: Thomas Fröhlich, Michael Müllner, Tina Reichl, Roul Starka, Beate Steiner, Thomas Winkelmüller Kritiker: Helmuth Fahrngruber, Thomas Fröhlich, David Meixner, Michael Müllner, Clemens Schumacher, Manuel Pernsteiner, Maximilian Reichl, Christoph Schipp, Robert Stefan, Thomas Winkelmüller Karikatur: Andreas Reichebner Bildredaktion: Anja Benedetter, Matthias Köstler Cover: Adobe Stock Art Director & Layout: a.Kito Korrektur: Anne-Sophie Müllner Hersteller: Walstead NP Druck GmbH Herstellungs- und Verlagsort: St. Pölten Verlagspostamt: 3100 St. Pölten, P.b.b. Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2. Urheberrechtsgesetz, sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für den Inhalt bezahlter Beiträge ist der Medieninhaber nicht verantwortlich.




3 Editorial
6 In was für einer Stadt leben wir
URBAN
7 Shortcut Urban
8 Am Ballermann in Völtendorf
14 Deponie: Aufräumarbeiten
16 Matthias Stadler – „Stillstand wäre nichts für mich!“
22 Zukunft des Elektro-LUP
24 Bernd Pinzer – ein neuer pinker Anlauf
MFG GRATIS PER POST
SPIELZEIT 25/26

30 Gestaltungsbeirat
34 11 Millionen Euro, bitte!
40 Von Radln, Rollern & Scootern
44 Momentaufnahme in schwarz-weiß
50 Chronisch krank
52 Leben und Reisen mit Weitblick
KULTUR
54 Shortcut Kultur
56 Linda Partaj
60 Der Künstlerbund-Reiseleiter
JOIN US ON FACEBOOK
PREMIEREN
Die eingebildete Kranke nach Molière
Inszenierung Leander Haußmann Premiere Fr 12.09.25
Das NEINhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn In einer Fassung von Raoul Biltgen Inszenierung Verena Holztrattner Premiere Fr 19.09.25
Das Schloss von Franz Kafka Inszenierung Gernot Grünewald Premiere Sa 27.09.25


SZENE
62 Shortcut Szene
64 Joschi – „Die Legende!“
SPORT
70 SKN: Dietmar Wieser
74 Kritiken
75 Veranstaltungen
76 Außensicht
78 Karikatur
NÄCHSTES MFG
Österreichische Erstaufführung Angabe der Person von Elfriede Jelinek Inszenierung Sara Ostertag Ab Fr 17.10.25
Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch von Michael Ende Inszenierung Felix Metzner Premiere Fr 07.11.25
Die Möwe von Anton Tschechow Inszenierung Max Lindemann Premiere Fr 28.11.25
Österreichische Erstaufführung Der blinde Passagier von Maria Lazar Inszenierung Mira Stadler Premiere Fr 13.03.26
Uraufführung
Speed – Auf den letzten Metern von Sarah Viktoria Frick, Martin Vischer und Ensemble Inszenierung Sarah Viktoria Frick, Martin Vischer Premiere Do 30.04.26
Und vieles mehr!
LINDA PARTAJ – Seite 56
JOSCHI „DIE LEGENDE!“ – Seite 64
DIETMAR WIESER – Seite 70







IN WAS FÜR EINER STADT LEBEN WIR EIGENTLICH ...

in der die Personalrochade des SPÖ-Vizebürgermeisters bei manchen Politikern für Hitzewallungen sorgte. Abgesehen davon, dass es einigermaßen drollig anmutet, wenn man sich um Personalentscheidungen anderer Parteien sorgt, dabei dem scheidenden Mandatar (wie häufig verlogene Usance in der Politik) nach Jahren des Infights plötzlich zum Abgang Rosen streut, echauffierte sich der VP-Stadtparteigeschäftsführer zudem, dass nunmehr ein „roter Parteipolitiker“ folge. Das ist nun tatsächlich ein Skandal – ein SPÖ Mandatar, der ein roter Parteipolitiker ist! Das wäre in etwa so krass, wie wenn ein ÖVP-Stadtparteigeschäftsführer ein schwarzer Parteipolitiker wäre. Ganz als solcher und nicht Sachpolitiker – so war die Spitze gemeint – entpuppte sich freilich der Absender selbst, prangerte er doch den zur Wahl einberufenen Sonderparteitag an. „Statt in budgetär schwierigen Zeiten zu sparen […] will die SPÖ wohl ihr Sommertheater nun schnellstmöglich vergessen machen.“ Blöd nur, dass § 96 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz vorschreibt, dass der neue Vizebürgermeister innerhalb von zwei Wochen gewählt werden muss.
Kleiner Tipp an die Politiker sämtlicher Couleur: Mit etwas gutem Willen gehen Sachpolitik und Parteipolitik durchaus wunderbar zusammen – man muss nur Respekt vorm Gegenüber haben –und vorm Wähler.

in der allen Ernstes der Live Stream des Gemeinderates eingespart werden soll – Kostenpunkt 16.000 Euro. Wenn man bedenkt, dass sich selbst kleine Kommunen wie etwa St. Andrä-Wördern diesen Service leisten, ist das Ansinnen der Landeshauptstadt, die ach so gerne auf ihre Modernität und Vorreiterrolle verweist, an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Vor allem ist es aber ein verheerendes Zeichen im Hinblick auf Transparenz und niederschwelligen Politik-Zugang. Auf das Vorhaben angesprochen erklärt der Bürgermeister, dass „die Streichung des Live-Streams einer der Konsolidierungs-Vorschläge war, die wir dann politisch übernommen haben, weil er ein kleineres Übel darstellt gegenüber Bereichen, wo man vielleicht direkt oder indirekt bei Personen einsparen müsste.“ Hinter vorgehaltener Hand wird zudem auf die maue Live-StreamRate hingewiesen, wobei die youtube-Zahlen gar nicht so schlecht sind: Im ersten Halbjahr gab es 2767 Aufrufe! Vielleicht sollte man diesen Punkt daher noch einmal überdenken. Und sollten sich wider Erwarten aus dem Pool von potenziell weiteren sechs Millionen Euro herausgefiltertem Sparpotenzial tatsächlich keine 16.000 Euro herauspicken lassen, könnten doch die im Gemeinderat vertretenen Parteien im Schulterschluss die Finanzierung stemmen – als Bekenntnis zu gelebter Demokratie, Bürgernähe und Transparenz!

in der das Open Air Kino am Rathausplatz eine Sternstunde mit St. Pöltner Lokalkolorit erlebte. So wurde erstmals „Die schwarze Garde marschiert“ gezeigt, ein Werbefilm (samt Krimiplot!) aus dem Jahr 1937 über den Pressverein St. Pölten in der Linzer Straße. Gehoben wurde der Schatz, der verteilt im Stadtarchiv und am Dachboden des NÖ Pressehauses geschlummert hatte, von Stadtmuseumsleiter Thomas Pulle und Archivar Lukas Kalteis. Im Zuge ihrer einleitenden Doppelconference, in der sie sich als wahre Entertainer entpuppten, erzählten die beiden launig, wie sie – Sherlock Holmes & Watson gleich – die Filmrollen wieder zusammenführten, akribisch Personen und Orte nachrecherchierten und das Machwerk auf abenteuerliche Weise digitalisierten.
Das Publikum war vom Endergebnis jedenfalls angetan, nicht zuletzt auch dank der Livemusik von Stummfilmpianist Gerhard Gruber. Schnell war daher klar – das ruft nach Wiederholung!
Wenn Sie also mehr über das St. Pölten der 30er-Jahre, das Druckereiwesen anno dazumal sowie über die kriminelle Energie von Thomas Pulles Lieblingsfilmfigur – den Schlingel Jack – erfahren möchten, sollten sie unbedingt am 4. November ins Cinema Paradiso kommen. Gerhard Gruber wird wieder live spielen, und selbstverständlich sind auch Holmes & Watson mit dabei. Ganz großes Kino!
PLATZ DA!

Als die „Kindergartenoffensive 2024“ ausgerufen wurde, gerieten manche ins Schwitzen. Das Land versprach allen Zweijährigen einen Kindergartenplatz, immerhin endet auch die Elternkarenz nach zwei Jahren. Doch im September 2024 hatten viele Gemeinden schlicht zu wenig freie Plätze, auch in St. Pölten bekamen rund 60 Zweijährige keinen Kindergartenplatz. Neue Gruppen mussten erst gebaut und Personal eingestellt werden. Zudem verbesserte sich der Betreuungsschlüssel, in
den bestehenden Gruppen wurden weniger Kinder betreut. Seither sind 500 Betreuungsplätze dazugekommen, womit das Bild ein Jahr später anders aussieht: Allen eingeschriebenen Kindern konnte ein Kindergartenplatz angeboten werden. Im Stadtgebiet stehen 1.994 Betreuungsplätze in Kindergärten und 55 Plätze in Tagesbetreuungseinheiten (TBE) für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung. Dazu kommen noch private Anbieter. Die Ausbauoffensive läuft noch bis 2027 weiter.
WAHLKAMPFGAG?
Die Gemeinderatswahl wirft ihre Schatten voraus. Neben Dauerbrennern wie S 34, LUP, Wachstum & Co., kam zuletzt in der Bevölkerung die Frage: Was wurde eigentlich aus dem „Südsee“ – nur ein Wahlkampfgag 2020? Der Bürgermeister verneint: „Das Projekt ist voll im Laufen. Wir haben dafür schon verschiedene Grundstücke aufgekauft.“ Ein Thema sei aktuell der Hochwasserschutz „aber keines, das nicht lösbar wäre – das hatten wir auch beim Viehofner See damals.“ Angesichts des Wachstums der Stadt werde eine derartige Einrichtung „die sicher

mehr Sinn macht als der Betrieb eines teuren zusätzlichen Freibades“ über kurz oder lang notwendig „und wer kann von seiner Stadt schon behaupten, dass er in die ‚Südsee‘ baden geht?“

VERSTECKT DIE TRUPPE!
In St. Pölten geht es nach dem Willen von Bürgermeister Matthias Stadler. Und der will die Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen ab 2026 einstellen. Dann können wir nicht mehr im Internet nachschauen, was die gewählten PolitikerInnen im Stadtparlament machen. Das spart jährlich 16.000 Euro – und ist meiner Meinung nach eine Sauerei. Die öffentlichen Sitzungen sind jene Bühne, auf der politische Entscheidungsträger und die Stadtverwaltung Rechenschaft ablegen. Dort argumentiert man unterschiedliche Standpunkte und erklärt seine Entscheidungen. Man steckt berechtigte und unberechtigte Kritik ein und zeigt, dass man einen geraden Satz formulieren kann, dass man Manieren im Umgang mit anderen hat. Wer diese Öffentlichkeit einschränkt, zeigt mangelnden Respekt vor demokratischen Institutionen und trägt zum Politikerverdruss bei. „Dann geh halt hin und schau es dir vor Ort an!“ Das ist präpotent und kommt meist von Leuten, die Überstunden schreiben, während sie vor Ort sitzen. Wir haben 2025 und die Leute ein Recht auf zeitgemäße Transparenz. „Aber die Kosten!“ Wir schütten jährlich 149.600 Euro an „Schulungsgeldern“ an 42 Gemeinderäte aus, das sind über 3.500 Euro pro Kopf. Zusätzlich zu deren Bezügen. Wenn jeder 380 Euro für die Übertragung abtritt, wäre diese finanziert. Wäre ich Bürgermeister würde ich meine Truppe nicht verstecken. Sie sollte einer breiten Masse zeigen, wofür sie steht und woran sie arbeitet. Doch Matthias Stadler glaubt den Kampf um die Deutungshoheit seiner Politik woanders zu gewinnen. Man wird sehen.
KOLUMNE MICHAEL MÜLLNER

AM BALLERMANN IN VÖLTENDORF
Mit Ballermann assoziieren die meisten von uns feucht-fröhliche Stunden auf Mallorcas Partymeile Nummer 1. Beileibe nicht leise, aber man ist ja freiwillig dort, um zu feiern.
Mit einem „Ballermann“ ganz anderer Natur sehen sich dahingegen seit einigen Jahren die Nachbarn der Schießstätte Völtendorf konfrontiert – und zum Feiern ist ihnen ganz und gar nicht zumute.
Der Schießplatz in Völtendorf besteht dabei laut Verteidigungsministerium seit Ende der 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts und war damals, wie man seitens des Bundesministeriums für Landesverteidigung betont, im wahrsten Sinne des Wortes – von einigen Bauernhöfen abgesehen – weit weg vom Schuss. „Dies bot für die Errichtung des Schießplatzes sehr gute Voraussetzungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aber immer näher an den Schießplatz herangebaut.“ Kurz gesagt bzw. unterschwellig suggeriert: Nicht der Schießplatz ist das Problem, sondern die Leute, die sich in dessen Nähe im Laufe der Jahrzehnte angesiedelt haben. Abgesehen davon, dass – wenn man in dieser Argumentationslinie bliebe – bestenfalls die offizielle Raumplanung vergangener Jahrzehnte, die im Nahbereich Siedlungstätigkeit zugelassen hat, „schuld“ wäre (ähnlich widersinniger Baulandwidmungen im Überschwemmungsgebiet), läuft sie im konkreten Fall ins Leere. Denn – wie praktisch alle „alten“ Nachbarn bestätigen – die ersten 80 Jahre bis weit in die 2010er-Jahre hinein lebte man in friedlicher Koexistenz mit dem Schießplatz. „Es gab keine Probleme!“ Diese traten erst auf, als sich der Betrieb am Schießplatz selbst wandelte – sowohl hinsichtlich der Frequenz als auch hinsichtlich der Intensität, womit man bei der Binsenweisheit landet: „Die Dosis macht das Gift!“
Fast 200 Schießtage im Jahr Dazu muss man wissen, dass am Militärareal Völtendorf nicht etwa nur das Bundesheer selbst und der Heeres-Schützenverein trainieren, sondern seit geraumer Zeit, wie das Verteidigungsministerium bestätigt, „der Schießplatz durch eine Kooperation mit anderen Ministerien –wie dem BMI/Polizei – genutzt wird; daraus ergibt sich auch eine hohe Auslastung des Schießplatzes.“ In den Augen der Anrainer eine mittlerweile „viel zu hohe“, wobei das „Übel“ ab 2017 herum mit dem

BELASTUNG. Gut 80 Jahre lang hatten die Nachbarn kein Problem mit dem Schießplatz, erst seit 2017 herum seien Betrieb und Intensität enorm gestiegen.
Ausrollen des Sturmgewehrs STG 77 für alle Polizei-Exekutivbeamten seinen Ausgang nahm und die Lärmsituation in Folge, wie es ein Anrainer formuliert „aus dem Ruder zu laufen begann.“ Nachdem sich die bestehenden Polizei-Einsatzzentren Süßenbrunn und Traiskirchen für den Trainingseinsatz des Sturmgewehrs als weitest ungeeignet erwiesen – die Geschossschutzfänge halten der Geschoßwucht des STG auf Dauer nicht Stand – wird alternativ am Militärschießplatz in Völtendorf trainiert – und das nicht zu wenig. „Gegenwärtig wird von der Landespolizeidirektion Niederösterreich in Völtendorf für den Einzugsbereich ‚Westen‘ – zirka 1.000 Bedienstete – neun Mal pro Monat, nur wochentags zirka drei Stunden in der Zeit zwischen 08:30 bis 17:30 trainiert. Dazu kommt noch einmal pro Monat eine Ausbildung für Spezialkräfte, auch nur wochentags zwischen 08:30 und 17:30 Uhr“, erläutert hierzu Oberst Robert Klaus von der Niederösterreichischen Landespolizeidirektion. Verschärfend für die Anrainer kam zuletzt hinzu, dass aufgrund des letztjährigen Hochwassers aktuell auch die Polizei-Schießanlage am Europaplatz außer Betrieb ist und daher ebenso die Polizeischüler vermehrt
in Völtendorf üben. „Da derzeit 12 Klassen ausgebildet werden, beträgt die Ausbildungszeit am Schießplatz Völtendorf zweimal pro Woche je 8 Stunden in der Zeit zwischen 07:30 und 15:30 Uhr, nur wochentags“, führt Oberst Klaus aus, betont aber, dass mit Wiederinbetriebnahme des Europaplatzes „mindestens zwei Drittel Ausbildungszeiten in Völtendorf wegfallen werden, da diese Ausbildungszeiten die Faustfeuerwaffe Glock betreffen.“ Die hochwasserbedingte Mehrnutzung durch die Polizei wird aber ohnedies erst in der nächstjährigen Statistik durchschlagen, die Zahlen der Gesamtnutzung durch alle Protagonisten – Bundesheer, Polizei, Justizwache, Heeressportverein – sind aber schon jetzt gewaltig. Zählte man, wie das Verteidigungsministerium mitteilt, 2020 coronabedingt 38 Schießtage, so waren es „2021 138 Schießtage –davon 1 Samstag; 2022 244 Schießtage – davon 4 Samstage; 2023 180 Schießtage – davon 4 Samstage, und 2024 186 Schießtage – davon 4 Samstage“
1.600 Unterschriften
Die Anrainer reagierten bereits 2019 auf den immer stärkeren Betrieb und dem intensivierten Einsatz bestimmter Waffengattungen
– Stichwort Sturmgewehr, das wie Maschinengewehr und Pistole am Schießplatz erlaubt sind – mit einer Petition, die über 1.600 (!) Unterstützer fand. Dabei ging es ihnen nie um Fundamentalopposition – „Wir sind ausdrücklich nicht gegen den Schießplatz, sondern befürworten die gute Ausbildung von Bundesheer und Polizei“ – sondern man erwartete vom Ministerium, dass man die offensichtlich geänderten Rahmenbedingungen mit dementsprechenden Gegenmaßnahmen abfedert, um so den zuvor 80 Jahre lang funktionierenden Status der friedlichen Koexistenz wiederherzustellen.
Tatsächlich kam in Folge auch einiges in Bewegung. So verweist das Verteidigungsministerium darauf, dass „in den letzten fünf Jahren an keinem Sonntag oder Feiertag der Schießplatz genutzt wurde.“ Zudem habe man den Betrieb zwischen Weihnachten und Neujahr eingestellt und die allgemeinen Schießzeiten reduziert: „Die Nutzung des Schießplatzes wird im Normalfall in den Zeiten von Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr und Samstag 8 Uhr bis 13 Uhr getätigt. Über den „Normalfall“ lässt sich freilich offensichtlich streiten, denn wie meint ein Nachbar kopfschüttelnd: „Bei allem Respekt – das ist ein Witz! Noch 2019 war hier – mit wenigen Ausnahmen für Nachtschießen – um 16 Uhr Schluss. Heute wird manchmal nach wie vor sogar bis 22 Uhr geschossen. Samstag ist auch erst meist um 16 Uhr herum Schluss. Und auch die versprochene Sonntagsruhe wurde schon gebrochen.“ Was vor allem an den Nerven zerrt „ist diese stete emotionale Belastung – während der Schusszeiten ist ja an ein Rausgehen nicht zu denken, keine Gartenarbeit, keine Freunde, die du einladen könntest, weil du dich bei dem Lärm schlicht nicht unterhalten kannst. Und du wartest immerzu hin … um 18 Uhr, 18 Uhr 15 denkst du dir, ah, das wars jetzt, und dann geht es auf einmal um 7, ½ 8 wieder aufs Neue los, manchmal bis ¼, ½ 10 –wir hatten auch Zeiten, da fiel der

LÄRMSCHUTZ. Die Anrainer schlagen Rasterkassettendecken als Lärmschutz vor. Laut Hersteller könnte damit der Lärmpegel um gut 15db gesenkt werden.
LÄRMSCHUTZ – DIE RECHTSLAGE
„Ich begreife nicht, dass es entlang der Autobahn für jeden Kilometer Geld für sündteure Lärmschutzwände gibt, rigorose Lärmschutzvorgaben bei Flugplätzen bestehen und für jede kleine Pimperl-Veranstaltung, aber offensichtlich nicht bei einem Schießplatz“, schüttelt ein Anrainer den Kopf. Tatsächlich ist Lärmschutz in Österreich eine sogenannte Querschnittmaterie, wie auch auf der Homepage des Umweltbundesamtes nachzulesen ist: „Es gibt kein allgemeines Gesetz zum Schutz vor Lärm, sondern zahlreiche Bestimmungen über Lärmemissionen und Lärmimmissionen. Je nach Rechtsmaterie liegt auch die Zuständigkeit bei unterschiedlichen Behörden.“ Darauf stößt man etwa in Bauordnungen, Veranstaltungsgesetzen, der Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung etc. Was es auf übergeordneter europäischer Ebene seit 2002 freilich sehr wohl gibt – und mittlerweile auch in nationales Recht gegossen – ist die EU-Umgebungslärmrichtlinie, die darauf abzielt, „schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.” In Artikel zwei wird ihr Geltungsbereich wie folgt definiert. „Diese Richtlinie betrifft den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, Krankenhäusern und an deren lärmempfindlichen Gebäuden und Gebieten ausgesetzt sind.“ Soweit, so gut. Allerdings gibt es auch Ausnahmen – so gilt die Richtlinie explizit nicht für „Lärm, der auf militärische Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzuführen ist“. „Ein Schießplatz des Heeres“, so lässt uns Europarechtsexperte Univ. Prof. Walter Obwexer auf Anfrage wissen „ist wohl als militärisches Gebiet einzustufen; das Areal ist in der Regel als militärisches Gebiet gekennzeichnet. Damit ist eine der beiden Voraussetzungen für die Ausnahmeregelung gegeben.“ Die zweite – militärische Tätigkeit auf diesem militärischen Gebiet – sieht er ebenfalls erfüllt. „Schießübungen des Heeres zählen ohne jeden Zweifel dazu. Schießübungen der Polizei und der Justizwache sind zwar keine Tätigkeiten des Militärs, können aber als militärisch eingestuft werden. Ob Schießübungen des Heeresschießvereins noch davon umfasst sind, ist hingegen fraglich.“ Das heißt aber nicht, dass diese nicht – wie auch generell heeresfremde Organisationen – am Areal trainieren dürften, denn die Richtlinie „verbietet es nicht, den Schießplatz des Heeres an Organisationen zu vermieten, die keine militärische Tätigkeit ausüben (z. B Sportschützen). In diesem Fall müssen allerdings die Umgebungslärm-Grenzwerte eingehalten werden.“
Ich begreife nicht, dass es entlang der Autobahn für jeden Kilometer Geld für sündteure Lärmschutzwände gibt, aber offensichtlich nicht bei einem Schießplatz!
letzte Schuss exakt um 21 Uhr 59 Minuten und 57 Sekunden.“ Nicht nur, dass man sich daher den „Normalfall“ tatsächlich als solchen, nämlich fix eingehaltene Regel ohne Ausnahmen wünscht, hofft man zudem auf eine weitere Reduktion der Betriebszeiten analog zum HeeresSchießplatz in Stammersdorf. Dort wurde – auch über Vermittlung der Volksanwaltschaft, die auch die St. Pöltner Petitions-Initiatoren ehemals eingeschaltet haben – etwa im Rahmen der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ diesen Mai mitgeteilt, dass die Landespolizeidirektion Wien ihre Trainings auf die Zeit von Montag bis Donnerstag 8 bis 15 Uhr (mit wenigen Ausnahmen am Freitag) eingeschränkt hat. „Außerdem wäre eine bessere Kommunikation eine große Hilfe. Das Bundesheer könnte uns etwa via WhatsApp Bescheid geben, wann sie wirklich fertig sind, dann fiele zumindest dieses belastende Zuwarten weg. Außerdem wäre es toll zu wissen, an welchen Tagen gar nicht geschossen wird, weil dann könnten wir unsere Aktivitäten danach ausrichten –Freunde einladen, den Garten genießen, Ruhe tanken!“
Effektiver Lärmschutz
Der andere eingeforderte Hebel betrifft technischen Lärmschutz. Diesbezüglich verweist das Bundesministerium auf bereits getätigte Maßnahmen wie zum Beispiel Schießtunnel beim 200 m Stand, außerdem wurden „die Schießwälle erhöht und Bäume sowie Sträucher gepflanzt. Der Lärmschutz sollte sich durch den immer stärker werdenden Bewuchs verbessern.“
Seitens der Initiative würdigt man diese Aktivitäten, aus der bisherigen Erfahrung „muss man aber sagen, dass sie leider nicht ausreichen, zumal der neue Erdwall um den sogenannten Pistolenschießstand auch nach Osten offen ist – so wie der
alte. Erdwälle lenken aber den Schall nur um und tragen so gut wie gar nichts zur Reduktion des Schallpegels bei. Was wichtiger ist, ist die Absorption von Schall.“ Die Anrainer haben daher dem Bundesheer eine Einhausung des Schießstandes oder die Umsetzung einer sogenannten Rasterkassettendecke vorgeschlagen, die diesem Prinzip Rechnung tragen. „Das wurde schon vielfach umgesetzt, daher wissen wir, dass diese Vorschläge realisierbar und wirkungsvoll sind!“ Dies bestätigt auch Wolf-Dieter Hohn vom deutschen Unternehmen WDH, welches mit webra Lärmschutz derlei Systeme umsetzt: „Ja, unsere Rasterdecke ist auf allen offenen Schießanlagen umsetzbar.“ Die Kosten dafür hängen von den jeweiligen Baulichkeiten der Bahn und ihrer Breite ab, bei einer Anlage mit 100 m Länge und 8 m Breite – um ein Beispiel zu nennen – kommt man „auf ca. Euro netto 135.000“. Der Quadratmeterpreis dürfte sich also, je nach Gegebenheiten, zwischen 150 bis 200 Euro bewegen. Dafür sei das Ergebnis „fantastisch“, wie Hohn betont. „Wir haben Referenzanlagen, wo man die Möglichkeit hat, Hörtests zu machen – wenn die Leute da vorort sind und den Unterschied hören, bleibt ihnen schlicht der Mund vor Staunen offen.“ Was das hinsichtlich des konkreten Lärmschutzes bedeutet? „Die Pegelminderung durch diese Schalldämmmaßnahme liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 15 (dB) oder etwas darüber!“ Das Verteidigungsministerium kennt übrigens die Expertise von WDA. „Das Bundesheer in Österreich hat die Schießstätte in Glanegg schallgedämmt, allerdings nicht mit einer Rasterdecke, sondern durch Beplankung von Hochblenden und Wänden“, so Wolf-Dieter Hohn.
Ob für das Verteidigungsministerium auch in Völtendorf – über die bereits getätigten Lärmschutz-
maßnahmen hinaus – eine Rasterkassettendecke oder weitere Schalldämmung im obigen Sinne denkbar sind bzw. diese zumindest geprüft werden, lässt man trotz mehrmaliger Nachfrage unbeantwortet, hält aber fest: „Das Wohl der Bevölkerung hat für das Bundesministerium für Landesverteidigung stets höchste Priorität. Wir evaluieren und planen laufend Maßnahmen, um die Situation sowohl für die Anrainerschaft als auch für den Betrieb unserer Infrastruktur weiter zu verbessern. Sobald konkrete Pläne vorliegen, werden diese veröffentlicht.“
Tatsächlich konkreter nimmt sich dahingegen ein anderer Hoffnungsschimmer in Sachen Lärmreduktion aus. So wird im Zuge des neuen Polizeisicherheitszentrums auf der Schanze auch ein neues Einsatzzentrum realisiert. „Dieses wird mit zwei Schießbahnen ausgestattet, wobei eine Schießbahn für die Polizeischüler reserviert werden wird“, erläutert hierzu Oberst Robert Klaus und bestätigt zudem – wichtig für die Schießplatz-Nachbarn in Völtendorf – dass „im Einsatztrainingszentrum St. Pölten Schneckengeschoßschutzfänge eingebaut wer-

HOHE AUSLASTUNG. In Völtendorf trainiert nicht nur das Heer, sondern über eine Kooperation auch die Polizei.
KOLUMNE BEATE STEINER

JETZT IST JETZT
Manche Wörter mag ich nicht – die erzeugen unangenehme Bilder in meinem Kopf. „Nett“, zum Beispiel. Das ist so fließend – zwischen angenehm und akzeptabel. Oder „emotional“. Na, wie denn? Glücklich und quietschvergnügt oder traurig und schockiert – das sind doch alles emotionale Zuständ‘.
Oder „bewahren“ – da kommt sofort die Assoziation „nix verändern“ oder „früher war’s besser“. Schrecklich! Eh klar, dass wir unsere Barockgebäude nicht mit wildem Wein bewachsen lassen oder den Dom mit bunten Fliesen bekleben. Aber: Warum dürfen auch weniger markante Bauwerke nicht an die Bedürfnisse der Jetztzeit angepasst werden? Wer sein geschütztes Haus thermisch sanieren will, plant ein hochpreisiges Langzeitprojekt. Sonnenenergie darf nur nutzen, wer nicht in „bewahrten“ Zonen wohnt. Fassaden dort müssen gestaltungsgenehm sein. Wenn unsere Vorfahren auch so gedacht hätten, dann wär‘ der Dom nicht barockisiert worden und es gäbe kein Stöhr-Haus im Jugendstil. Schön, dass Jahrhunderte lang umgebaut und aufgebaut wurde – nach den ästhetischen Kriterien und technischen Möglichkeiten der jeweiligen Zeit. Weil sonst müssten wir wie unsere steinzeitlichen Ahnen in hölzernen Pfahlbauten an der Traisen hausen oder in feucht-kalten Höhlen in der Kellergasse.
Früher ist früher und jetzt ist jetzt. Früher sind wir durch einen ungepflegten Beserlpark um eine b’soffene Marille auf den Rummelplatz gepilgert. Der Vergnügungspark samt b’soffener Marille ist übersiedelt, aus dem Raucherpark für Schüler ist ein grünes Paradies für Kinder geworden. Erneuerung, die mag ich!
Mit Inbetriebnahme des Einsatztrainingszentrums wird seitens der Polizei in Völtendorf nicht mehr geschossen.

den, die auch für unsere Langwaffen geeignet sind.“ Kurzum, für das Sturmgewehr-Training muss dann nicht mehr nach Völtendorf ausgewichen werden. Auf den Realisierungshorizont angesprochen erklärt Oberst Klaus: „Das Thema SchießAusbildung in Völtendorf wird erst Anfang 2030 Geschichte sein, da mit der Inbetriebnahme des Einsatztrainingszentrums St. Pölten seitens der Polizei in Völtendorf nicht mehr geschossen wird.“
Ob dann umgekehrt – was eine weitere Entlastung des Betriebs in Völtendorf bedeuten könnte – das Bundesheer seinerseits teilweise die Polizeiinfrastruktur auf der Schanze mitnutzt, ist noch offen, wie man seitens des Verteidigungsministeriums ausführt. „Es gibt Pläne und Planungen bezüglich Kooperation mit der zukünftigen Schießanlage der Polizei; es kann aber hierzu noch keine Detailaussage getroffen werden.“
Die Situation am „Völtendorfer Ballermann“ bleibt also vage, das Gefühlsspektrum der Anrainer schwankt dementsprechend zwischen Skepsis („Dass das PolizeiEinsatzzentrum eine nachhaltige Entlastung bringt, glaube ich erst,
wenn die Polizei 2030 wirklich aus Völtendorf abzieht“) und Hoffnung, „dass es wieder so wird wie bis vor zirka 10 Jahren.“ Einen dementsprechenden Hoffnungsschimmer mag – so grotesk es klingt – die Entwicklung des echten Ballermann auf Mallorca geben, der verschiedene Phasen durchlief: von ursprünglichem „Normalbetrieb“ über völligen Exzess und Laissez-Faire bis hin zu nunmehr immer strikteren Eindämmungsmaßnahmen, die ein vernünftiges Zusammenleben mit der Bevölkerung wiederherstellen sollen. Am Ende des Tages hängt vieles vom gegenseitigen Goodwill und einem positiven Einvernehmen ab, wie es 80 Jahre lang gut funktioniert hat. Die Phrase „Der Platz war schon immer da und ein Schießplatz macht eben Lärm!“ lassen die Anrainer jedenfalls nicht gelten. „Entlang unserer Autobahnen gab es früher auch keine Lärmschutzwände. Diese wurden erst mit der gestiegenen Belastung notwendig und werden jetzt flächendeckend umgesetzt. Das wünschen wir uns auch für den Schießplatz in Völtendorf – auch hier ist die Belastung enorm gestiegen und macht daher effektive Gegenmaßnahmen erforderlich!“
HOFFNUNG 2030. Das neue Polizeisicherheitszentrum wird auch ein Einsatztrainigszentrum umfassen, das für das Schießtraining mit dem Sturmgewehr geeignet sein soll.




Ich finde, du könntest ruhig einen höheren Beitrag für uns Menschen leisten.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen 60 % Anteil an der Wertschöpfung. Sie zahlen aber 80 % aller Steuern!
Stimmt.


AUFRÄUMARBEITEN

Seit Dezember ist die Deponie am Ziegelofen wegen unsachgemäßer Müllablagerungen geschlossen. Nun soll ein Sanierungsverfahren die Probleme beheben, über die Dauer ist noch nichts bekannt.
Zunächst war im Frühjahr davon die Rede, dass die Mülldeponie am Ziegelofen vollständig geräumt werden muss. Nun hat das Land Niederösterreich verfügt, dass die festgestellten Probleme im Rahmen eines Sanierungsverfahrens gelöst werden sollen. Der Zöchling Abfallverwertung GmbH bleibt Spielraum bei der Wahl der Maßnahmen. Seit dem Frühjahr habe sich allerdings nichts an der Position des Landes geändert, betont Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Anlagenrecht des Landes NÖ. „Das bei der Sanierung in den einzelnen Sektoren ausgehobene Material muss zunächst untersucht werden. Ergibt die Prüfung, dass es den gesetzlichen Vorgaben entspricht, kann es in der Deponie belassen werden. Werden hingegen Abfälle jener Qualität vor-
gefunden, wie sie im Rahmen der Probeschürfkampagne im Dezember 2024 nachgewiesen wurden, sind diese jedenfalls nachzubehandeln”, so Schalhas. Kontrolliert werden soll alles engmaschig, mittels Drohnen und regelmäßigen Vor-Ort-Kontrollen. Zur zeitlichen Perspektive kann noch nichts gesagt werden, seitens Zöchling heißt es, dass man derzeit Maßnahmen ausarbeite und diese der Behörde vorlegen wolle. Wie bewertet man die aktuelle Situation beim Verein Hauptstadt Luft, der Bürgerinitiative, die sich seit mehreren Jahren kritisch mit der Deponie auseinandersetzt? Vereinsobmann Wilhelm Maurer ist skeptisch: „Nachdem die Schließung der Deponie uns einen ‚Sommer wie damals‘ – ohne Geruchsbelastung und Fliegenplage – beschert hat, sind wir
natürlich besorgt, wie lange die Sanierung der Anlage dauern und wie viel an Geruchsbelästigung die Öffnung der Deponie mit sich bringen wird.“ Den Grund für den Rückgang der Geruchsbelastung sieht er vor allem im aktuell leeren Zwischenlager, vom Land fordere Maurer eine strikte Kontrolle.
Politisch und rechtlich sind die Folgen für die Deponie am Ziegelofen noch offen. Nach einer Anzeige des Betreibers durch Greenpeace ist ein Verfahren aktuell bei der Staatsanwaltschaft Wien anhängig. Bis Redaktionsschluss gab es noch keine Informationen zum aktuellen Stand. Die Betreiberfirma Zöchling hat im Sommer mit einem Gutachten aufhorchen lassen, das festhält, dass von der Deponie keine akute und generelle Umweltgefährdung ausgehe. Ob das Konsequenzen hat, darf bezweifelt werden, ging es bei den Einschätzungen des Landes doch nie um eine potenzielle Umweltgefährdung, sondern um falsche Ablagerungen.
Politisch forderten die St. Pöltner Grünen die Einrichtung einer Sonderkommission, nachdem Greenpeace von unbehandelten Industrieabfällen auf der Deponie geschrieben hatte. Damit wolle man auf Stadt- und Landesebene für Transparenz sorgen, heißt es. Dass eine solche Kommission aber Realität wird, scheint unwahrscheinlich. Das Rathaus verweist auf das Land als zuständige Behörde. „Eine Pseudo-Kommission einzuberufen, die nichts entscheiden kann, bringt niemandem etwas und kann höchstens der politischen Profilierung dienen. So etwas kann nur auf Landesebene Sinn machen!”, so Bürgermeister Matthias Stadler. Klar scheint aktuell, mit Blick auf das juristische Verfahren und das laufende Sanierungsverfahren, dass das Thema Deponie die Stadt noch länger begleiten wird.



















Unfallsversicherung? Besser jetzt.
gemeinsam besser leben









Gleich abschließen –persönlich oder online.











WARUM ST. PÖLTEN »IM FLOW« IST?
Weil nicht nur die öffentlichen Duschen und Sanitäranlagen in der Stadt top gewartet sind, sondern auch über 320 Kilometer an Kanälen. Danke an unser Team in der Abwasserentsorgung!



„STILLSTAND WÄRE NICHTS FÜR MICH!“

Über 20 Jahre ist Matthias Stadler nunmehr Bürgermeister von St. Pölten –nur Franz Xaver Schöpfer saß am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert länger im Sattel, musste sich aber keiner Wahl stellen. Für Stadler ist es im kommenden Jahr wieder soweit. Als Treffpunkt für unser Gespräch hat er den Alumnatsgarten vorgeschlagen „weil er ein gutes Symbol für die Zukunft und positive Entwicklung unserer Stadt ist, für die gestiegene Wohnund Lebensqualität.“ Genau darüber und einiges mehr haben wir mit ihm inmitten von Rosenbeeten und Platanen geplaudert.
Sie gehen nächstes Jahr in ihren fünften Wahlgang. Fühlt sich das heute anders an als früher? Sind Sie selbst ein anderer geworden? Macht‘s noch Spaß?
Als Person habe ich mich glaube ich nicht gravierend verändert, ich bin noch immer derselbe Matthias Stadler wie damals. Was sich laufend geändert hat, sind die Rahmenbedingungen – die waren, wenn man an die verschiedenen Krisen der letzten Jahrzehnte wie Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Covid, die aktuelle Wirtschaftskrise etc. denkt, nicht immer leicht. Wir haben sie aber gut gemeistert, weil wir die Stadt gut aufgestellt haben und alle an einem Strang ziehen. Das ist es auch, was Freude macht, ebenso, dass das Bürgermeisteramt nie zum „Alltagsgeschäft“ wird – Stillstand wäre nichts für mich. Es ist schon beachtlich, was sich in den letzten Jahren alles zum Positiven hin gewandelt hat.
Weniger positiv war die Aufforderung der NÖ Gemeindeaufsicht zur Budgetkonsolidierung. Hat St. Pölten die Finanzen aus dem Ruder laufen lassen?
Nein. Wir sind mit dieser Situation auch nicht alleine, wie weithin bekannt ist – fast alle Kommunen haben aktuell aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage Probleme, Bund und Länder nicht minder. Unser Konsolidierungsbedarf – rund 11 Millionen Euro – entspricht dabei praktisch jenen Mitteln, die wir entgegen der Prognose seit 2022 weniger aus den Bundesertragsanteilen bekommen haben. In unserem Fall kam zuletzt noch hinzu, dass wir die Folgen des letztjährigen Hochwassers zu stemmen haben, wofür wir ein Sonderbudget aus den Rücklagen aufgestellt haben. Trotzdem ist es uns gelungen – wir haben die Konsolidierung ja schon von uns aus im Vorjahr eingeleitet – den Rechnungsabschluss 2024 sogar mit einem leichten Plus abzuschließen. Das heißt die Maßnahmen greifen.
Die Opposition macht aber nicht zuletzt teure „Prestigeprojekte“
für die Schieflage mitverantwortlich – da werden dann Beispiele wie der Windfänger, das KinderKunstLabor oder die Tangente genannt?
Ich muss über den Begriff „Prestigeprojekte“ immer schmunzeln. Was soll das bitte heißen – sind dann auch das Frequency, die Ansiedlung von Blum oder die Schaffung neuer Kindergartenplätze, wo wir zuletzt 30 Millionen Euro allein in die Infrastruktur investiert haben, „Prestigeprojekte“? Die Frage ist doch vielmehr, warum machen wir diese Dinge? Um die Stadt voranzubringen! Um die Lebensqualität zu steigern – in allen Bereichen. Bleiben wir etwa beim KinderKunstLabor. Das haben wir gemeinsam mit dem Land hochgezogen, auf Basis von Bürgerbeteiligung, im Zuge dessen die Leute gesagt haben: Wir brau-
Ich muss über den Begriff „Prestigeprojekte“ immer schmunzeln. Was soll das bitte heißen?
MATTHIAS STADLER
chen kein nächstes Theater, sondern etwas für Kinder und Familien. Heute beneiden uns andere Städte um diese Einrichtung und fragen, ob sie sie kopieren dürfen. Es geht da, wie auch im Fall der Tangente, ganz klar um Positionierung, um Image, Förderung des Tourismus, auch des eigenen Selbstwertgefühls über das Vehikel von Kunst und Kultur, wie das auch Linz erfolgreich vorexerziert hat.
Und ein Projekt wie der Windfänger am Europaplatz, der gut 860.000 Euro gekostet hat? Also ich wüsste nicht, dass irgendjemand der alten Verkehrssituation am Europaplatz nachweint. Wir haben hier gemeinsam mit dem Land eine komplett neue, bei weitem sicherere Kreuzungslösung ge-
schaffen. Der Wunsch vieler Menschen war schlicht, dass auch auf der neuen Kreuzung – nachdem der Brunnen in der Mitte weggefallen ist – wieder ein künstlerischer Akzent gesetzt wird, immerhin ist der Europaplatz ja in gewisser Weise das Tor zur Innenstadt. Daher wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, der Windfänger als – im Vergleich zum alten Brunnen nunmehr zugängliches – Ensemble ausgewählt, weil er Symbolik und Nutzen verknüpft. Wind ist ein typisches Element St. Pöltens, das Thema Wasser wurde als Anknüpfung zum ehemaligen Brunnen aufgegriffen, die Ziegel als Element der Kühle in Zeiten des Klimawandels. Dazu wurde ein Trinkwasserbrunnen geschaffen, und das alles eingebettet inmitten von Bäumen – wir haben am Europaplatz so viele Bäume wie nie zuvor.
Aber sitzt dort auch jemand? Das ist ja ein Kritikpunkt, im Übrigen auch am Grünen Loop, dass diese neuen Einrichtungen nicht angenommen werden. Man muss den Dingen einfach Zeit geben – reden wir in fünf, sechs Jahren weiter, wenn alles gewachsen ist. Wobei der Grüne Loop schon jetzt immer besser angenommen wird. Ich sehe Kinder bei den Spielgeräten – die es vorher gar nicht gegeben hat, was aber immer eine Forderung der Innenstadt-Bevölkerung gewesen ist. Ich sehe Leute im neuen Schanigarten von KHIM sitzen. Die Beete zum Selbstanbauen könnten wir zigfach vergeben, so begehrt sind sie – auch das ein komplett neues Angebot. Der Promenadenring wird sich also positiv weiterentwickeln. Aber vielleicht müssen wir einmal einen der grundsätzlichen Kernpunkte des Projekts wieder in Erinnerung rufen: In den letzten Jahren sind gut 1.450 Bürger neu in die City zugezogen! Für diese Wohnbevölkerung, ebenso für jene, die in der Innenstadt arbeiten, müssen wir eine dementsprechende Wohn- und Lebensqualität gewährleisten – der Grüne Loop ist da ein ganz wichtiger Mosaikstein! Zugleich ist er
eines der größten Klimaschutzprojekte – wir reden da immerhin von einer Gesamtlänge von 2,3 Kilometern am Ende des Tages, die wir im Vergleich zur ehemaligen Promenade gewaltig entsiegeln.
Das heißt, der Grüne Loop wird wie geplant umgesetzt? Zuletzt tauchten ja Zweifel auf, weil er im Zuge der Budgetkonsolidierung quasi auf Standby geschalten wurde. Kein Rückzug? Politiker haben die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen und Dinge, von denen sie überzeugt sind, dass sie dem Wohl der Stadt dienen, auch umzusetzen. Da darf man nicht feig sein oder sich ständig nach dem Wind drehen, sondern muss im Fall der Fälle Überzeugungsarbeit leisten. Zugleich darf man aber auch nicht stur sein, deshalb nehmen wir Kritik sehr ernst und lassen vieles, was man an Erfahrungen sammelt, auch laufend in Adaptierungen einfließen. Ich kann mich jedenfalls noch gut erinnern, welcher Gegenwind mir entgegen geblasen ist, als wir die Fußgängerzone um Franziskanergasse, Brunngasse, das letzte Stück der Kremsergasse erweitert haben. Oder als im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofes die Fahrbahn – die ja früher mitten durch den Bahnhof gelaufen ist – 100 Meter versetzt wurde: Da war sofort vom Tod der Innenstadt die Rede. Heute könnte sich keiner mehr vorstellen, dass es anders ist – und das wünscht sich auch keiner mehr!
Nicht vom Tod der Innenstadt, aber vom „Platz des Todes“ hat einmal der Kurier in Sachen Domplatz gesprochen. Zuletzt wurde er von Greenpeace für den „Betonschatz“ nominiert. Nervt Sie das mittlerweile? Wie zufrieden sind Sie eigentlich selbst mit der Umgestaltung? Für mich zeigt das vor allem wunderbar die Ambivalenz, in der man in der Politik oft steckt. Beim Domplatz hat man uns für den „Betonschatz“ nominiert, für den Grünen Loop nur wenige Meter entfernt

wurden wir mit dem VCÖ Mobilitätspreis ausgezeichnet und als best practice Beispiel genannt. Diskutiert wird beides. In einer Stadt besteht eben oft ein Spannungsverhältnis verschiedener Interessen und Ansichten, ebenso wie öffentliche Flächen verschiedene Funktionen zu erfüllen haben. Und vieles, wenn man etwa an die oft geforderten Baumpflanzungen denkt, geht dort schlicht wegen des Denkmalschutzes nicht – wir predigen das immer wieder, aber irgendwie scheint das nicht durchzudringen. Und wir haben uns bewusst für Multifunktionalität entschieden, wofür es eines befestigten Untergrundes bedarf. Bin ich mit der aktuellen Situation zufrieden? Nein, noch nicht! Ich wünsche mir etwa zusätzliche Gastronomieangebote am Platz, er könnte sicher auch noch mehr Ver-
anstaltungen vertragen, auch zusätzliche Marktaktivitäten wären wünschenswert – vielleicht sogar in Richtung eines täglichen Marktes wie am Herrenplatz. Ich bin aber überzeugt – da kommen wir wieder zum Faktor Zeit, die es zum Entfalten von Projekten braucht – er wird sich gut entwickeln. Was wurde der Rathausplatz nicht alles geschimpft, als man ihn autofrei gemacht hat. Heute geht er an lauen Sommerabenden regelrecht über, dass manche schon wieder sagen „Es ist zu viel los!“ (lacht)
Teile der Opposition hegen aber eher die Befürchtung, dass – v. a. für den stationären Handel – zu wenig los ist in der City. Verantwortlich machen Sie dafür auch den Wegfall von Parkplätzen, nicht nur am Domplatz, sondern
AUSBLICK. Bürgermeister Stadler steht vor seinem fünften Gemeinderatswahlkampf. Einmal mehr wird dabei wieder das Match um die Absolute angepfiffen.
auch durch den Grünen Loop, der wie eine Art Barriere wirke. Also alle Zählungen – mittlerweile digital unterstützt – weisen eine starke Frequenz der City aus! Natürlich ist die bestmögliche Erreichbarkeit der City essentiell – sowohl über den öffentlichen Verkehr, für Fußgänger und Radfahrer, ebenso aber unbedingt auch für Autofahrer. Und hier stimmt halt der Befund, es gäbe keine Parkplätze oder zu wenige, schlicht nicht. Im Gegenteil ist das Parkraumangebot gestiegen! St. Pölten hat – hochgerechnet auf die Bevölkerung – den höchsten Anteil an Tiefgaragenplätzen der Landeshauptstädte. Und stimmt schon, die Rathausplatz-Tiefgarage ist oft voll, aber schon die Garagen in unmittelbarer Nähe verfügen über genug Kapazitäten. Trotzdem halten wir auch an der Realisierung der Domgarage fest. Und wir haben ganz bewusst im Sinne der Innenstadtförderung in den letzten Jahren weder die Parkgebühren erhöht, noch die gebührenpflichtige Kurzparkzone über die Innenstadt hinaus erweitert, wie es Experten empfohlen hatten.
Womit wir beim Verkehr gelandet sind. Da feiert ja die S 34 nach dem Abgang von Ministerin Leonore Gewessler fröhliche Urständ. Ist die SPÖ nach wie vor uneingeschränkt dafür? Ich lade alle Gegner ein, sich einmal in eine Wohnung oder ein Haus entlang der Mariazellerstraße in St. Georgen und Spratzern zu setzen, damit sie einen Eindruck von der Situation bekommen. Wir müssen hier einfach etwas tun, dazu fühle ich mich als Bürgermeister den Anrainern gegenüber verpflichtet, ebenso den Bürgern entlang der Ausweichrouten – die können ja nicht die Descheks sein! In welcher Größenordnung die S 34 letztlich realisiert wird, müssen die Experten wissen, aber Faktum ist, es handelt sich um ein komplett abgeschlossenes Projekt, das man sofort ausrollen kann – alles neu auszuschreiben würde dahingegen wieder Jahrzehnte dauern. Diese Zeit haben wir für die
Wir haben in St Pölten bereits ein Areal, das im Hochwassergebiet steht: das Regierungsviertel.
MATTHIAS STADLER
Leute aber nicht mehr, zumal der Verkehr in diesem Stadtteil durch Zuzug in St. Georgen selbst, ebenso aber etwa auch in Wilhelmsburg nicht weniger werden wird!
Gegner fordern statt der Schnellstraße aber einen stärkeren Ausbau der Öffis. Wir brauchen beides! Man muss die Gesamtverkehrssituation begreifen. Wir haben – dank der Realisierung von Kerntangente Nord und Nordbrücke – eine gute Aufteilung der Verkehrsströme in der Ost-WestAchse. Wir haben zu deren Entlastung auch die S33 – man möge sich bitte einmal vorstellen, dieser Verkehr würde wie früher über die Kremser Landstraße hereinfließen –es gäbe einen Verkehrskollaps. Was uns aber fehlt ist eine Entlastung der Nord-Süd-Achse und, wie es alle großen Städte ja nicht aus Zufall haben, ein geschlossener Entlastungsring um die Stadt. Daher die S34, in welcher Größenordnung auch immer. Deshalb unbedingt auch der Ausbau der Bahn – da hat die letzte Verkehrsministerin Gewessler ja leider genau gar nichts geleistet, im Gegenteil – es wurden sogar Haltestellen reduziert– das ist ja absurd! Wir brauchen einen zweigleisigen Ausbau der Traisentalbahn, mindestens bis Traisen hinein, ebenso die versprochene Elektrifizierung und den Ausbau der Strecke bis nach Krems. Schließlich einen überregionalen LUP, der die großen Orte rund um St. Pölten in einem attraktiven Takt mit der Landeshauptstadt verbindet. Vorbild dafür ist die Wiener Zone 100 rund um die Bundeshauptstadt. Das ist auch ein Muss für die Region St. Pölten!
Bleiben wir im Nahbereich der S 34, die auch für das nahe Betriebsansiedlungsbiet relevant wäre. Dort soll in Hart
auf 200.000 Quadratmetern ein neues REWE Zentrallager entstehen, das aufgrund seiner Dimension und Lage im Überschwemmungsgebiet schwer umstritten ist. Steht die SPÖ nach dem letztjährigen Hochwasser nach wie vor hinter dem Standort? Wie ist der aktuelle Projektstatus?
Um vielleicht vorneweg ein Beispiel zur besseren Einordnung zu bringen: Wir haben in St Pölten bereits ein Areal, das im Hochwassergebiet steht: das Regierungsviertel. Zum REWE-Areal bzw. prinzipiell zum Betriebsansiedlungsgebiet NÖ Central: Die Flächen dort sind seit der k.u.k. Monarchie als Betriebsgebiet gewidmet. Möchte man etwas realisieren, muss dort ein Hochwasserschutz umgesetzt werden, der sehr wohl – weil das bisweilen anders dargestellt wird – auch die benachbarten Einrichtungen mitumfassen wird. Es geht gesetzlich gar nicht, dass man quasi für sich selbst Hochwasserschutz umsetzt und dann anderswo jemand anderer dadurch

Nachteile erfährt – die Gesamtbilanz muss stimmen. Aktuell befindet sich REWE im Stadium der Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes. Erst danach kann ein Gesamtprojekt eingereicht werden. Dies ist aber noch nicht passiert.
Kritiker des REWE-Projektes bezweifeln aber auch den Nutzen für die Stadt, weil dort gar nicht so viele Arbeitsplätze entstehen würden. Wie ist da der generelle Zugang in der Betriebsansiedlungspolitik der Stadt?
Das ist eine verzerrte Darstellung: Um bei REWE zu bleiben. Das Unternehmen hat in St. Pölten bereits ein Lager – da reden wir von 400 Arbeitsplätzen, die wir durch die Umsetzung des neuen Zentrallagers erhalten können. Dazu kommen dann noch die neuen Beschäftigten – wir müssen also schon von der Gesamtsituation sprechen. Wenn REWE woanders baut, garantiert uns niemand, dass die Arbeitsplätze des bestehenden Lagers erhalten bleiben. Um ein Gespür für die Größenordnung zu bekommen: Mitkonkurrent Spar hat in seinem Zentrallager in Spratzern rund 1.200 Mitarbeiter und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt überhaupt! Und genau darum geht es
uns in der Betriebsansiedlungspolitik: Arbeitsplätze halten und Arbeitsplätze schaffen – und zwar so viele wie möglich, idealerweise in verschiedenen Branchen und Segmenten, hoch- und niedrigqualifizierte, in Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben. Dieser Mix gelingt uns als Stadt bisher ganz gut, weshalb wir im Vergleich zu anderen Städten auch ganz gut durch die Krisen der letzten Jahre gekommen sind und selbst schmerzhafte Verluste wie zuletzt etwa bei kika/Leiner oder der Walstead Druckerei abfedern können. Gerade angesichts der aktuellen finanziellen Lage, wo wir von äußeren Faktoren wie den bereits erwähnten sinkenden Ertragsanteilen betroffen sind, muss jedem klar sein, dass die Gelder, die wir selbst lukrieren können – etwa aus der Körperschaftssteuer, die ja unmittelbar von den Arbeitsplätzen abhängt – umso wichtiger sind. Dank unserer erfolgreichen Betriebsansiedlungspolitik konnten wir hier die letzten Jahre ein stetes Wachstum erzielen.
Wachstum ist ein gutes Stichwort: St. Pölten hat kürzlich die 60.000 HauptwohnsitzerMarke übersprungen – in den Augen von Teilen der Opposition wächst die Stadt zu schnell, die

Infrastruktur halte nicht mit. Also wir müssen bitte die Kirche im Dorf lassen. Wir sind die letzten Jahre im Durchschnitt um 1 % gewachsen, da ist genau gar nichts „bedrohlich“, wie es teils suggeriert wird. Vielmehr ist es ein gesundes Wachstum, das unseren Wohlstand sichert, und auf das wir dank unserer vorausschauenden Planungen auch gut vorbereitet sind. Schauen wir uns etwa an, wie schnell wir –weit vor anderen Städten – jetzt tastsächlich die Kindergartenbetreuung für alle Zweijährigen ausrollen. Wir reden da bitte allein von über 20 neuen Kindergartengruppen und fünf Tagesbetreuungseinrichtungen, die wir innerhalb kürzester Zeit geschaffen haben. Wir haben auch alle dafür notwendigen Kingergartenhelferinnen und -helfer angestellt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ebensowenig, dass bei uns alle Kinder – weil uns das im Sinne der Lebensqualität für die Familien ein Anliegen ist – in ihrem eigenen Grätzel einen Kindergartenplatz bekommen. Möglich ist das alles, weil wir vorausschauend Grundstücke gekauft haben und kaufen. Ebenso haben wir die Wasserversorgung schon vor einigen Jahren auf 80.000 Bürger ausgelegt, selbiges gilt für die Abwasserreinigung, wir machen unsere Aufgaben in Sachen Verkehr etc. Wir sind also gut aufgestellt.
Trotzdem, wenn man auch einen Blick in die diversen Social Media-Foren wirft, kommt da in Sachen Wohnbau immer wieder mal der Vorwurf „Der Stadler betoniert alles zu!“
Also ich als Bürgermeister betoniere gar nichts zu. Ich verstehe, dass Menschen oft jahrelang eine grüne Wiese am Nachbargrundstück haben und das schätzen – aber oft sind diese Grundstücke als Bauland gewidmet, und wenn der Besitzer dann irgendwann baut und sich dabei an die Gesetze hält, habe ich als Stadt genau gar keine Handhabe. Wir würden uns als Kommunen durchaus in manchen Bereichen – wenn ich etwa an die Leerstandsabgabe

Als Bürgermeister musst du einfach anerkennen, dass du es nicht jedem recht machen kannst.
MATTHIAS STADLER
denke – bessere Lenkungsmöglichkeiten wünschen, die müssten aber auf übergeordneter Ebene gesetzlich beschlossen werden, und da besteht oft kein politischer Konsens. Worauf wir drängen, so wir Einfluss nehmen können, ist eine Verdichtung bestehender gewidmeter Areale in der Kernstadt anstatt Neuwidmungen auf der grünen Wiese. Der Wohnbau der letzten Jahre war jedenfalls wichtig und hat gewährleistet, dass bei uns – im Gegensatz zu anderen Städten – die Immobilienpreise nicht komplett durch die Decke gegangen sind. St. Pölten ist auch nach wie vor die preiswerteste Landeshauptstadt in Sachen wohnen. Und eine Situation wie Ende der 90er-Jahre, als allein bei der Stadt 1.000 Wohnungssuchende gemeldet waren, weil es kein Angebot gab, will ich sicher nicht mehr erleben.
Ärgern Sie sich dann über Claims wie „St. Beton“ bzw. denken Sie sich manchmal, jetzt haben wir endlich das geschafft, was Ihr immer gefordert habt – eine pulsierende Hauptstadt –und jetzt ist es auch nicht recht? Nein, ich ärgere mich nicht. Über die Opposition – wir wissen wer
„St. Beton“ erfunden hat – schon gar nicht. Als Bürgermeister musst du einfach anerkennen, dass du es nicht jedem recht machen kannst. Mein Maßstab muss stets das Gesamtwohl der Stadt sein. Es ist vielleicht auch der Zeitgeist – und zutiefst menschlich – dass man sich halt oft selbst der nächste ist. Nehmen wir das Beispiel Bäume: Wenn wir fragen, sollen wir mehr Bäume pflanzen, beantworten das 90 % klar mit Ja. Wenn wir aber im nächsten Schritt sagen, wir pflanzen neue Bäume, dadurch würde aber der Parkplatz unmittelbar vor Ihrer Türe wegfallen, sind plötzlich 76 % dagegen – im Übrigen auch in der jungen Altersgruppe.
Wer sich sehr wohl ärgert, ist die Opposition, die der SPÖ vorwirft, „über alles drüberzufahren.“ Deshalb hat man zuletzt auch geschlossen die Beteiligung am Konsolidierungskonzept verweigert, weil man die Jahre zuvor bei der Budgeterstellung auch nicht eingebunden gewesen sei. Ebenso beklagt man, dass Ihre Partei praktisch alle im Gemeinderat von der Opposition eingebrach-
ten Anträge abschmettert. Wie passt das aber zusammen? Sie beschweren sich, dass sie nicht eingebunden werden, schlagen aber eine Einbindung bei etwas so Wichtigem wie dem Konsolidierungskonzept, wo sie politisch mitbestimmen können, aus? Und es stimmt auch nicht, dass wir alle Anträge ablehnen – einige haben wir unterstützt. Aber mein Eindruck ist halt, dass oft Anträge um des Antrags willen gestellt werden, rein für die Show und den schnellen Applaus. Wir bekommen Dringlichkeitsanträge meistens eine halbe Stunde vorher, manchmal sind es auch nur 10 Minuten, oder sie werden überhaupt erst direkt in der Sitzung eingebracht – wie soll ich da bitte seriös darüber entscheiden? Das ist ja nicht Larifari, was da beschlossen werden könnte, sondern da geht es oft um rechtliche Materien, Fragen von Haftungen, Folgekosten, der finanziellen Deckung etc. Ich glaube, da bedenken die Einbringenden oft nicht, was das in Konsequenz nach sich ziehen kann. Wenn wir die Anträge früher bekommen würden, um sie seriös vorzuprüfen, könnte man sicher auch über Etliches reden.
Glauben Sie, dass Sie das nach der nächsten Gemeinderatswahl vielleicht ohnedies mit einem Koalitionspartner machen müssen? Das Brechen der absoluten Mehrheit ist ja das erklärte Ziel der Opposition, Ihres umgekehrt wohl das Halten derselben? Also wir haben ja noch nicht einmal einen Wahltermin, daher werden wir diesbezüglich – im Gegensatz zu anderen – auch keinen Frühstart hinlegen. Aber natürlich werden wir uns zu gegebener Zeit unsere Gedanken machen und wieder mit einem konkreten Programm in die Wahl gehen. Wie diese dann ausgeht, entscheiden letztlich die Bürger, das habe ich immer mit Demut genommen, wie es kommt. Ich bin jedenfalls dankbar für das Vertrauen, das mir in den letzten Jahren entgegengebracht wurde und auch überzeugt, dass wir gute Arbeit geleistet haben.

REKORDZAHLEN. 2024 transportierte der LUP auf 13 Linien rund 5,3 Millionen Fahrgäste.
ZUKUNFT DES ELEKTRO-LUP NOCH UNGEWISS
Der LUP wurde bisher dank Drittelfinanzierung von Bund, Land und Stadt ermöglicht. Die Akteure verhandeln aktuell über die Weiterführung dieses Modells. Vom Ergebnis hängen die LUP-Elektrifizierung und langfristig auch die Idee eines Regional-LUP ab.
Ohne den LUP ist das St. Pöltner Stadtleben nicht mehr denkbar. Im Jahr 2006 eingeführt, verzeichnet das Busservice immer wieder Fahrgastrekorde, wie zuletzt im Vorjahr: 5,3 Millionen Menschen nutzten 2024 den LUP! Das Angebot wurde über die Jahre sowohl hinsichtlich der Linien, als auch der Taktung ausgebaut. Die Kosten dafür konnte und kann St. Pölten freilich nicht alleine stemmen. Der Bund und das Land NÖ steuern beim LUP im Rahmen der sogenannten Drittelfinanzierung
Geld bei. Ob das in Zukunft so weiter geht und wenn ja in welchem Ausmaß ist gerade Gegenstand von Verhandlungen zwischen den drei Ebenen. Verhandlungsmasse sind mehrere Millionen Euro: 2024 wurden durch Ticketverkäufe 4,3 Millionen Euro eingenommen, während sich die Gesamtkosten auf 9,8 Millionen Euro beliefen. Aufgrund der aktuellen nationalen Sparziele ist der finanzielle Gürtel auf allen Verwaltungsebenen eng gestellt. Die Stadt hält sich über den Verlauf der Verhandlungen aber sehr bedeckt.
Klar ist jedenfalls, dass einige Weiterentwicklungen des Stadtbusses vom positiven Ausgang der Gespräche abhängen: Das neue LUPSystem, welches ab 2027 eingeführt wird, muss gemäß einer EU-Richtlinie bis 2030 schrittweise elektrifiziert werden. Für den Fall, dass die Drittelfinanzierung negativ ausfällt, so wurde vonseiten St. Pöltens bereits angedeutet, werde man wohl an den Dieselbussen festhalten müssen und der Regional-LUP wird eine nette Utopie für später bleiben.
Enge Budgemittel
Auf den aktuellen Stand der Verhandlungen angesprochen bestätigt Bürgermeister Matthias Stadler, „dass wir in den Endverhandlungen sind, da werde ich niemandem etwas über die Medien ausrichten“, fügt
aber hinzu „Ehemals mussten wir auch Überzeugungsarbeit leisten, die Notwendigkeit wurde aber schließlich von unseren Partnern Bund und Land erkannt, und ich hoffe, das ist auch diesmal der Fall.“ Der LUP sei jedenfalls ein „absolutes Erfolgsmodell. Wir haben die Fahrgastzahlen von 900.000 auf bald 5,4 Millionen Fahrgäste pro Jahr gesteigert!“ Die neuen Ausschreibungskriterien im Hinblick auf E-Mobilität machten es aber schwierig. „Wir reden da von einer Vervierfachung der Kosten – der Betrieb würde von 5 Millionen auf rund 19 Millionen steigen! Das können wir unmöglich alleine stemmen!“ Zugleich hält er an seiner Forderung nach einem Regional-LUP fest und gibt sich kämpferisch: „Ich werde weiter an diesen harten Brettern bohren! Das ist ein Muss für St. Pölten!“
Für die Grünen ist das Thema Öffentlicher Personennahverkehr nicht zuletzt aus ökologischer Sicht ein Kernthema. „In den letzten Jahren hat die SPÖ viele Millionen für Prestigeprojekte ausgegeben, sodass jetzt die Mittel für absehbare Investitionen fehlen“, kann sich Stadträtin Christina Engel-Unterberger einen Seitenhieb nicht verkneifen. Ihr ist bewusst: „Eine dringend notwendige Angebotsverbesserung, insbesondere eine Taktverdichtung, sowie die allgemeine Kostensteige-
rung erfordern einen finanziellen Kraftakt.“ Durch die seit Juli 2021 vorgeschriebenen emissionsfreien Fahrzeuge entstünden zusätzliche Kosten. Engel-Unterberger zufolge gäbe es zwar seitens des Bundes eine Finanzierungszusage von 4,5 Millionen Euro jährlich, „der zuständige NÖ-Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) verweigert jedoch jede Zusage.“ (Ob dies zutrifft war auf Anfrage im Büro Landbauer bis Redaktionsschluss leider nicht zu erfahren., Anm.) Zudem beklagen die Grünen ein Informationsdefizit. „Leider wurden weder der Stadtsenat noch der Gemeinderat bisher in die Gespräche eingebunden.“ Sollte es ab 2027 zur LUP-Elektrifizierung kommen, müsse jedenfalls sichergestellt werden, dass es zu keiner Monopolbildung kommt. „Die Betreiber von Ladestationen und die Busunternehmen dürfen wirtschaftlich nicht verbunden sein!“
Regionaler LUP
„nicht machbar“?
Die Grünen, denen bisweilen ökologische Traumtänzereien vorgeworfen werden, zeigen sich beim Thema Regional-LUP realpolitisch: „So sehr wir uns eine Angebotsverbesserung für den gesamten Zentralraum wünschen, halten wir einen Regional-LUP ab 2027 für unrealistisch.“ Ein solches Projekt müsste laut En-
gel-Unterberger aufgrund der langen Vorlaufzeiten bereits 2025 ausgeschrieben werden. Da es bis heute aber nicht mehr als eine Idee sei „wird sich das zeitlich nicht mehr ausgehen.“ Grundsätzlich streben die Grünen für den Stadt LUP eine Taktverdichtung auf 15 Minuten, gute Haltestelleninfrastruktur mit digitalen Fahrplananzeigen, Nachtbusse auf stark frequentierten Linien und Schnellbusverbindungen nach Pottenbrunn, Harland, St. Georgen und Radlberg an. Florian Krumböck, ÖVP Landtagsabgeordneter und St. Pöltner Stadtrat formulierte in den vergangenen Jahren immer wieder Forderungen bezüglich des LUP. Auch er hält die Idee eines Regional-Busses zwar für richtig, bis 2027 allerdings nicht für machbar. „Was wir brauchen, ist eine Verdichtung in den dichter besiedelten Stadtteilen und passgenaue Angebote für alle anderen. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Dörfer und Siedlungen am Rande der Stadt dürfen keine Stadtbürger zweiter Klasse sein“, so der ÖVP-Politiker. Von den Verhandlern erwartet sich Krumböck „zumindest eine Verlängerung der bestehenden Vereinbarungen, eine Drittelfinanzierung mit Deckel seitens des Landes und des Bundes.“ Stadt-FPÖ sowie Neos lieferten bis Redaktionsschluss keine Antworten.

3100 St. Pölten, Oberwagram
n Geförderte und freifinanzierte Wohnungen
n Miete mit Kaufoption
n Terrasse/Eigengarten oder Balkon/Loggia
n PKW-Stellplatz
n Bezug: Winter 2026
verkauf@alpenland.ag www.alpenland.ag

BERND PINZER
PINZER UND EIN NEUER PINKER ANLAUF
Bernd Pinzer ist bei den Neos ein Urgestein, in St. Pölten aber noch ein Jungspund. So wie es aussieht, wird er die liberale Truppe in die nächste Gemeinderatswahl führen. Der bisherige Neos-Gemeinderat Nikolaus Formanek kandidiert nicht mehr. Einen bleibenden
Eindruck hat er eher nicht hinterlassen. Es sieht also wiedermal nach einem pinken Neuanfang in der Landeshauptstadt aus.
Sie möchten das St. Pöltner Neos-Team in die kommende Gemeinderatswahl führen. Wie sind Sie zur Politik gekommen? Mit der Geburt meiner Tochter entstand der Wunsch nicht nur zu sudern, sondern mich politisch zu beteiligen. Mittlerweile ist sie sechzehn Jahre alt, ich habe also schon etwas Erfahrung. Ich erinnere mich noch, als ich damals am Wohnzimmerboden die Programme von allen Parteien aufgelegt hatte. Das von der FPÖ konnte ich rasch ausschließen. Bei den anderen fand ich den für mich entscheidenden Punkt dann schon in den Präambeln, sozusagen den Einleitungstexten der jeweiligen Parteiprogramme: ÖVP und SPÖ hatten alle eine Form von Kollektiv im Zentrum ihres Weltbilds. Beim Liberalen Forum hingegen stand der Mensch als selbstbestimmter Gestalter seiner eigenen Lebensbedingungen im Mittelpunkt – das ist für mich auch heute noch der springende Punkt in der Politik. Das Liberale Forum hat dann mit den Neos fusioniert, so kam ich in die Politik. Einerseits als Funktionär auf lokaler Ebene, andererseits
als Klubsekretär im Nationalrat, als Wiener Büroleiter der EU-Abgeordneten Angelika Mlinar oder jetzt im niederösterreichischen Landtag.
Nach Ihrem Grundwehrdienst sind Sie der Landesverteidigung treu geblieben?
Ja, während des Grundwehrdienstes habe ich das große Potential im
Die fünf verwordagelten, mobilen Bäume braucht jedenfalls keiner.
BERND PINZER
Bundesheer gesehen und blieb dort. Zuerst als Ausbildner bei der Pioniertruppe, dann im Bundesministerium für Landesverteidigung – insgesamt 23 Jahre. Ich kenne also das Leben als öffentlich Bediensteter, war in der internationalen Verrechnung von Auslandseinsätzen des Bundesheeres tätig oder später eineinhalb Jahre im Innenministerium
für die Erlassung von Erstbescheiden im Asylwesen.
Befindet man sich nicht gerade als liberaler Mensch mit einem stark ausgeprägten Bewusstsein für die Idee universeller Menschenrechte in einem Spannungsfeld, wenn man Asylbescheide schreibt?
Stichwort: politischer Wille? Ich habe meine Bescheide aufgrund der Gesetze erlassen, demnach haben sie auch im Instanzenzug gut gehalten. Aus dieser Zeit nimmt man natürlich sehr viele Fallgeschichten dieser Menschen mit. Wir haben in Europa definitiv einen gravierenden Mangel an legalen Möglichkeiten der Migration. Die Menschen, die sich auf den Weg machen, sind meiner Meinung nach oft getragen vom Wunsch nach dem liberalen Streben nach einem freieren, besseren Leben. Das kann auch eine Chance sein.
Aber wieso stellt uns die Integration dieser Menschen, die ja gerade diese Freiheit unserer Gesellschaft anstreben, dann oft im Alltag vor Probleme?

SPITZENKANDIDAT? Erst im Oktober oder November wählen die Neos die Kandidaten auf ihrer Wahlliste.
Das ist ein Kernthema für uns Neos, es ist eine Bildungsfrage. Wenn man in seinem Leben ein einziges Buch in der Hand hatte und das ist religiös motiviert, dann müssen wir bei der Integration dieser Menschen sehr stark das Thema Bildung mitdenken. Nur auf Emotionen abzuzielen, wie es die Populisten machen, löst dabei nichts. Es braucht die komplexeren, schwierigeren Antworten – aber dann ist das auch lösbar. Ich selber sehe mich auch als konstruktiven, pragmatischen Menschen, so sollte man auch Politik machen und dem zunehmenden Vertrauensverlust der Menschen in die Politik entgegenwirken.
Woher kommt diese oft wahrgenommene, allgemeine Politikverdrossenheit?
Sie ist jedenfalls eine große Gefahr. Zuerst verlieren die Menschen das Vertrauen in die Politiker, dann in die politischen Institutionen selbst. Ich sehe dafür die Hauptursache in der Besonderheit der Zweiten Republik, dass alles in zwei Machtblöcke aufgeteilt wurde. Für jede Lebenslage gibt es einen roten und einen schwarzen Verein, vieles muss nach diesem Proporz gedacht und besetzt werden – dann beschäftigt sich Politik mehr mit den Institutionen als mit den Menschen. Das sogenannte Dritte Lager konnte seine Position in Österreich unter diesen Voraussetzungen leicht ausbauen, andere Parteien taten sich schwerer. International sieht man, dass gerade die Schwäche der Konservativen oft zum Erstarken der Populisten führt. Für uns als Neos ist die richtige Antwort das Gespräch an der Haustür, das bildet das Kernformat in unserem Wahlkampf, weil wir dabei echte Anliegen der Menschen erfahren, die sich gerade auf der lokalen Ebene ergeben. In der Fußgängerzone spricht man mehr über die allgemeine Politik. Aber im Gespräch
an der Haustüre erfahren wir, wofür wir uns im Gemeinderat für die Menschen einsetzen sollen.
Was sind das für Themen? Wo drückt in St. Pölten der Schuh? Sich für die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner einzusetzen ist sicher eine fordernde Aufgabe, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Ich sage immer: Man braucht nur einen funktionierenden Taschenrechner und die Website der Statistik Austria. Dann kann ich mir ausrechnen, wie viele Betreuungsplätze ich in den nächsten Jahren zusätzlich brauche, egal ob für Kleinkinder oder pflegebedürftige Senioren. Wenn ich einen Kassenvertrag mit einem Arzt abschließe, weiß ich wann er in Pension geht. Dass man immer wieder vom demografischen Wandel überrascht wird, lasse ich nicht gelten. Für die Stadt denke ich, dass sich mit dem Wachstum der letzten Jahre vieles zum Positiven verändert hat, bei einem zweiten Blick sieht man aber schon, dass die Infrastruktur nicht mitwächst und man den Eindruck hat, es wird zu wenig in den Bestand investiert, aber dafür zieht man neue Prestigeprojekte hoch. All die Hochglanzmagazine über Zukunftsvisionen sind mir zu wenig, ich erwarte vom Bürgermeister konkrete Projektpläne und Prioritätenlisten, was wir wann mit welcher Priorität in der Stadt umsetzen wollen – und was es uns kostet. Denn vieles von den Errungenschaften der letzten Jahre hatte seinen Preis, einen stark gestiegenen Schuldenstand der Stadt. Und jetzt, wo die Ertragsanteile nicht mehr wie verrückt anwachsen, brennt plötzlich der Hut?
Wie beurteilen Sie denn den beschlossenen Konsolidierungskurs der Stadt?
Das ist ein kompletter Blödsinn, wie wenn man den Struppi auf die Wurst
aufpassen lässt, das hat noch nie funktioniert! Einen Abteilungsleiter zu fragen, wo er einsparen kann –das ist ja ein Irrsinn. Darf man das sagen? Wir hätten uns einen ehrlichen Kassasturz erwartet, Transparenz auch bei allen ausgelagerten Gesellschaften. Und dann muss man sich externe Profis holen, vom Landesrechnungshof, vom Bundesrechnungshof oder von ausgewiesenen Experten, die unabhängig aufzeigen, wie man einsparen kann.
Den Stadtrechnungshof haben Sie nicht genannt. Der wäre ja ein Organ des Gemeinderates, der immer wieder unabhängig Vorschläge macht, die der Gemeinderat dann umsetzen könnte.
Sobald ich im Gemeinderat bin, schau ich mir gerne die Arbeit des Stadtrechnungshofes an, ob er denn seinen Namen verdient und wirklich unabhängig arbeitet. Die sollen mich bitte überzeugen. Ich merke schon, dass ich dahingehend unvoreingenommen und unabhängig bin. Ich bin nicht in St. Pölten zur Schule gegangen, ich bin mit niemandem verwandt, ich bin niemandem was schuldig, ich brauche weder eine Förderung noch einen Job.
Was ist denn das Wahlziel?
Wir übergeben derzeit die Aufgaben laufend an das neue Team. Rund zehn Personen sind bereits unterwegs, gehen von Tür zu Tür, sprechen mit den Menschen und betreuen unsere Stände in der Innenstadt. Mit rund 20.000 Euro ist unser Budget bescheiden – aber transparent. Bei der Gemeinderatswahl möchten wir zumindest zwei Mandate erreichen – als Einzelkämpfer ist es immer viel schwieriger, als wenn du gemeinsam arbeiten kannst. Das Potential von Neos ist in St. Pölten groß, das wissen wir
BERND PINZER
aus den vergangenen Ergebnissen bei Landes- und Bundeswahlen.
Wird die SPÖ ihre absolute Mehrheit verlieren? Wären Sie offen für eine Zusammenarbeit? In Österreich kommen absolute Mehrheiten zwar demokratisch zustande, aber sie behindern dann die demokratische Kultur, weil sie den Kompromiss ausschalten. Natürlich wollen wir nach der Wahl mitgestalten und zum Positiven verändern können, demnach sind wir auch gesprächsbereit – aber über Inhalte und Zukunftspläne, nicht vorrangig über Funktionen oder Positionen. Die SPÖ wird wohl Stimmen verlieren, ob sie die Absolute halten kann, lässt sich heute noch nicht abschätzen. Unabhängig davon gehe ich davon aus, dass es zwischen allen Fraktionen regelmäßige Treffen geben wird, in denen alle Gemeinderatsmitglieder informiert und eingebunden werden. (Lacht.) So oder so, ich freue mich jedenfalls schon riesig auf die regelmäßigen Jour fixes mit dem Bürgermeister, im Zuge dessen er laufend alle Gemeinderatsfraktionen informiert und es zu einem regen Austausch kommt.
Schauen wir uns die NeosStandpunkte zu strittigen Themen in der Stadt an. Soll das REWE-Zentrallager wie geplant kommen?
Es ist richtig, dass man als Stadt an die wirtschaftliche Entwicklung denkt. Aber ich glaube nicht, dass der Standort für dieses Riesenprojekt geeignet ist – das Hochwasser im Vorjahr hat das bewiesen. Wir führen schon jetzt die Rankings beim Zubetonieren an, da wäre eine weitere Flächenversiegelung in dieser Größenordnung wirklich kein Renommee.
Braucht es die S 34?
Wenn wir über die Mobilität der Zukunft nachdenken, dann werden wir bei jedem Antrieb Straßen brauchen. Also eine Straße an sich ist ja nicht schlecht. Auch die S 34 soll gebaut werden. Aber das aktu-

elle Bauvorhaben basiert auf völlig veralteten Planungen und gehört redimensioniert – und womöglich auch über Gemeindegrenzen gedacht. Generell zum Verkehr: Wir wollen den öffentlichen Verkehr forcieren und – plakativ formuliert – einen Ausgleich schaffen zwischen den Ökoträumern am Lastenfahrrad und den Gewerbetreibenden in der Innenstadt. Kleinere Transporteinheiten könnten da flexibler und kostengünstiger sein, sie müssen aber auch für Leute einfach funktionieren, die nicht mit digitalen Lösungen großgeworden sind – ähnlich dem Anrufsammeltaxi-System. Diese großen Ideen müssen aber auch Hand in Hand mit kleinen Lö-
sungen im Alltag gehen. Eine ältere Dame erzählte mir, wenn sie mit dem Taxi zum Arzt in der Innenstadt will, bräuchte sie einen Behindertenausweis. Das kann es doch nicht sein! Einerseits sperren wir die Taxis aus, andererseits steigen die Kosten für Krankentransporte, weil die Leute mit dem Roten Kreuz zum Arzt fahren.
Heftig umstritten sind auch der neue Domplatz und die Umgestaltung der Promenade zum „Grünen Loop“. Was halten Sie davon?
Auch da fehlt mir eine transparente Prioritätenliste. Was sind die Aufgaben der Stadt? Welche Leistungen
ZUR PERSON
Bernd Pinzer wurde 1968 in Villach geboren, seit 1988 lebt er in Wien bzw. Niederösterreich. Mit den Neos zog er 2015 in den Gemeinderat von Zwentendorf an der Donau ein. Seit 2018 arbeitet er als Klubdirektor der Neos im NÖ-Landtag. Seit drei Jahren lebt er in St. Pölten. Für die nächste Gemeinderatswahl wird er für die Neos an vorderster Front kandidieren.
wünschen sich die Bürger und welche Budgetmittel braucht man dafür? Bevor man als Prestigeprojekt die Promenade umbaut, sollte man mehr Stützkräfte in die St. Pöltner Schulen schicken, damit Junglehrer nicht ins Burnout schlittern. Ich denke da an die Londoner School Challenge, bei der gezielt jene Schulen mit mehr Mitteln gefördert wurden, in denen es Probleme gab, die Kinder schlechter abschnitten. Das löst rasch Probleme und schafft bessere Chancen für die Jungen. Zum Domplatz: Ich trage eine Smartwatch und habe sie an einem Sonnentag Ende August zwanzig Zentimeter über den Domplatz-Boden gehalten – es kam eine Warnmeldung ich soll den Ort verlassen und in den Schatten gehen, hier sei es gefährlich. Ich verstehe ja, dass der Denkmalschutz gewisse Vorgaben nötig macht, aber diese Betonwüste will keiner. Die Stadt sollte jetzt Expertenmeinungen von außen holen, die sollen Möglichkeiten ausloten, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Das stellt man dann den Bürgerinnen und Bürgern vor und die Mehrheit soll entscheiden, was umgesetzt wird. Ich verstehe nicht, wieso dieses Problem seit Jahren nicht gelöst wird. Die fünf verwordagelten, mobilen Bäume braucht jedenfalls keiner.
Was wären Ihnen denn Herzensanliegen und wo würden Sie einsparen? Zwei Themen sind mir besonders
KOLUMNE TINA REICHL

BRIEF AN MEINEN SOHN
Lieber Sohn, du bist 15, hast dein erstes Ferialpraktikum hinter dir, bist verliebt und hast sogar mit dem Führerschein begonnen. Und während du mit jedem Schritt erwachsener wirst, erwarten mich in meiner Gehirn-App 10.000 Schritte an Loslass-Momenten. Während du mir von deinen Fahrstunden erzählst, seh ich dich auf dem blauen Laufrad, ich an deiner Seite neben dir herlaufend. Und jetzt hältst plötzlich du das Steuer in der Hand. „Das crazy“, wie du sagen würdest. Dieses Loslassen ist voll „tuff“. Du stellst dir selbst deinen Wecker, kochst dir selbst und spielst dich frei von Ritualen. Immer öfter schläfst du bei deiner Freundin, am Frühstückstisch bleibt ein Platz leer. Du sagst: „Es ist alles nicht so deep, chill, alles easy, checkst du?“ Und ich nicke. Ja ich checks, du gehst deinen eigenen Weg. Wie der Elch Emil! Ich halt etwas Abstand, mach hin und wieder ein Foto von dir und verfolge deine Richtung! Wie geht´s wohl der Emil-Mama? Loslassen bedeutet dich ziehen zu lassen, dir nicht mehr jeden Ratschlag ungefragt reinzudrücken, dir nicht mehr heimlich deinen Schulrucksack von verschwitztem Sportgewand zu leeren oder von alten Jausenresten. Dir nicht unauffällig das Lateinbuch auf den Tisch zu legen, damit du nicht vergisst, es einzupacken.
Ich habe verstanden, wenn ein Teenager sagt, er macht es, dann macht er es. Man muss ihn nicht alle zwei Monate daran erinnern ;-) Und trotzdem bin ich immer für dich da: Als Beifahrerin, als Zuhörerin, als Backup, wenn du mal kurz anhalten musst.
Ich hab dich lieb, deine Mama
Einen Abteilungsleiter zu fragen, wo er einsparen kann – das ist ja ein Irrsinn!
BERND PINZER
wichtig. Das ist zum einen der Bildungsbereich. Da kann die Stadt im Bereich von Schulsozialarbeit beispielsweise ganz viel selber machen, auch wenn man den Mut hat die sogenannten Brennpunktschulen ehrlich zu benennen und sich ihrer anzunehmen. Wir brauchen eine zusammenwachsende Bevölkerung und keine sich spaltende. Wenn wir in Bildung investieren, die Kinderbetreuung ausbauen, dann hilft uns das auch beim Problem der weiblichen Altersarmut. Der zweite Bereich betrifft die Transparenz. Wenn ich höre, dass Sitzungen des Gemeinderates nicht mehr aufgezeichnet werden und die Bürger nicht mehr unkompliziert nachschauen können, was in diesem Gremium besprochen und beschlossen wird, dann frage ich mich: Cui bono? Wem nützt das? Natürlich der SPÖ, die anderen Argumenten und Meinungen keine Plattform bieten will und deren Mandatare nur dort sitzen, um im richtigen Moment die Hand zu heben. Das kann doch nicht ernsthaft geplant sein, dass man diese Übertragungen einstellt? Ich will sogar weitergehen und ein Wortprotokoll einführen, es soll einfach transparent sein, wer sich in diesem Gremium wofür einsetzt. Das schaffen andere Städte ja auch.
Und wo würden Sie sparen?
Klar definieren, was die städtischen Aufgaben sind und dann schauen, was man sich leisten kann. Die Prestigeprojekte der letzten Jahre sind ja bekannt. Das aus Trotz hochgezogene Tangente-Festival hat ja super geklungen, aber nach dem Auftakt beim Straßenfest habe ich nichts von ihm mitbekommen. Oder das Kinderkunstlabor – hätte man das Geld in ein Seniorenprojekt gesteckt oder würde man damit den Bildungsund Sozialbereich stärken, es würde

VERDOPPELN. Wählen ihn die Neos zum Spitzenkandidaten, will er für zwei Sitze im Gemeinderat kämpfen.
wohl mehr Menschen zugutekommen. Bei zukünftigen Investitionen muss also die Auswirkung auf die Stadtfinanzen mitbeurteilt werden. Ein schönes Beispiel ist ja die Linzerstraße, die ich auch als Anrainer sehr gut kenne. Da wird herumexperimentiert ohne die Beteiligten zu fragen, die aktuelle Begegnungszone braucht kein Mensch und ansässigen Gastronomen verwehrt man sogar einen Schanigarten.
Was passiert, wenn Sie den Einzug in den Gemeinderat nicht schaffen?
Auch auf die Gefahr hin, wie ein Politiker zu klingen: Wir werden ihn schaffen. Aber es gibt ja Gemeinden, in denen Neos nicht im Gemeinderat sitzt. Dort machen wir dann Politik vor dem Rathaus – so gut es eben geht. Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz haben wir ja glücklicherweise auch etwas bessere Möglichkeiten auf Transparenz zu achten.
ST. PÖLTEN

Der Tiguan




*Alle Preise/Boni sind unverbindl. empf., nicht kartell. Richtpreise/Nachlässe inkl. NoVA u. MwSt. und werden vom Listenpreis abgezogen, nur für Privatkunden. Preis bereits abzgl.: € 1.500,- Eintauschbonus bei Eintausch eines Gebrauchten und Kauf eines neuen VW PKW Modells (Verbrenner). Die Aktion ist limitiert u. kann pro Käufer nur einmal in Anspruch genommen werden. € 1.500,- Porsche Bank Bonus bei Finanzierung über die Porsche Bank (Verbrenner). € 1.000,- Versicherungsbonus bei Finanzierung und Abschluss einer KASKO Versicherung über die Porsche Bank Versicherung, sowie € 1.000,- Servicebonus bei Finanzierung und Abschluss eines Service- oder Wartungsproduktes über die Porsche Bank. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis. Angebot gültig bis 28.11.2025 (Kaufvertrags-/Antragsdatum). Kraftstoffverbrauch: 0,4 – 9,7 l/100 km. Stromverbrauch: 16,9 – 23,9 kWh/100 km. CO₂-Emissionen: 9 – 220 g/km. Symbolbild. Stand 06/2025.
Seit 68 Jahren die Nr. 1 in Österreich
3100 St. Pölten
Breiteneckergasse 2 Telefon +43 505 91123

ST. PÖLTEN MACHT GESTALTUNGSBEIRAT ZUM „INSIDE JOB“
2020 wurde der unabhängige Gestaltungsbeirat installiert. Mit der Konsolidierung der Gemeindefinanzen sollen nun 50.000 Euro bei dem Gremium eingespart werden. Zeit für ein Résumé seiner bisherigen Arbeit und die Frage: Wie geht es weiter?
Als Landeshauptstadt ist St. Pölten, was Bautätigkeit und Stadtwachstum angeht, ein dynamisches Pflaster. Um „nachhaltigen und funktionalen Städtebau“ zu ermöglichen, wurde vom Gemeinderat im Jahr 2020 der Gestaltungsbeirat ins Leben gerufen. Ein unabhängiger dreiköpfiger Expertenkreis aus Architekten, Raum-, und Stadtplanern mit beratender Funktion. Er sollte Empfehlungen bezüglich geplanter Bauprojekte zur Sicherstellung der architektonischen Qualität abgeben. Die Richtschnur
für seine Urteile waren und sind das NÖ Raumordnungsgesetz 2014, die NÖ Bauordnung 2014 sowie das Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadt St. Pölten. Der grobe Ablauf: Relevante Bauprojekte werden beim Gestaltungsbeirat eingereicht, seine Geschäftsstelle macht eine Vorbegutachtung. Unvollständige Unterlagen müssen ergänzt, widerrechtliche Projekte abgeändert werden. Bauwerber können anschließend ihr Projekt beim Gestaltungsbeirat vorstellen, auch sind Projektbesichtigungen durch die
Experten vorgesehen. Die finale Abstimmung bezüglich eines Projekts erfolgt unter Ausschluss der Projektwerber.
140 Projekte, 47 Sitzungen, 317 Protokolle
Was hat der Gestaltungsbeirat die vergangenen knappen fünf Jahre geleistet, auf welchen Mehrwert kann man verweisen? „In diesem Zeitraum gab es 47 Sitzungen des Gestaltungsbeirats“, erklärt Wolfgang Lengauer, der Leiter der Baudirektion des Magistrats. 140 Projekte
wurden behandelt, 317 Protokolle wurden erstellt – folglich befasste sich der Gestaltungsbeirat 317-mal mit Projekten! Von diesen wurden ca. 95% mit Auflagen positiv beurteilt worden.“ Der Diplomingenieur kontert damit die Kritik, dass es aufgrund hoher Fluktuation im Gestaltungsbeirat zu Verzögerungen seiner Arbeit kam. „Es wurden im Durchschnitt fast sieben Projekte behandelt.“ Unter der Berücksichtigung des Aufwands pro Projekt (Vor-OrtBesichtigung, Vorbesprechung und Vorstellung des Projekts seitens der Planer sowie der Erstellung des Protokolls) sei die Kritik aus Lengauers Sicht unberechtigt.
Wie viel Macht hat der Gestaltungsbeirat tatsächlich auf die baurechtlichen Entscheidungen? Zwar ist die Gruppe wie oben erwähnt nur beratend tätig. Bei Projekten, welche in den Geltungsbereich der Bebauungsbestimmungen für Schutzzonen fallen, kann die Baubehörde aber
nur nach expliziter positiver Beurteilung des Gestaltungsbeirats die Baubewilligung erteilen. „Ein weiteres Thema ist, wenn Projektanten Ausnahmen von den geltenden baurechtlichen Bestimmungen wollen, und das sind die allermeisten“, schildert Lengauer. „Auch in solchen Fällen kann eine Abweichung nur durch den Gestaltungsbeirat als qualifiziertes Gremium geschehen.“
Private und gewerbliche Bauherren ziehen Fazit
Das Projekt von Helmut Waigmann war ein solcher „Fall“. Der ramponierte Altbau seiner Schwiegereltern in der Fuhrmannsgasse 12 war nach der Schutzzonenverordnung als „für das Ensemble bedeutsamer Bau“ eingestuft. „Unser Projekt war mit eines der ersten privaten Bauprojekte, die durch den im Jahr 2020 neu installierten Gestaltungsbeirat der Stadt St. Pölten genehmigt werden musste“, erklärt der pensi-

140 PROJEKTE. Baudirektor Wolfgang Lengauer ist zufrieden mit der Produktivität des Gestaltungsbeirats.
onierte Baumeister. Der zuvor dort stehende Altbau wurde mit baubehördlicher Genehmigung abgerissen. Die Baupläne für ein neues Wohnhaus, in enger Abstimmung ausgearbeitet vom Architekten Helmut


Haiden, wurde dem Gestaltungsbeirat vorgelegt. Der Ablauf war aus Waigmanns Sicht zumindest am Beginn kritikwürdig: „Damals hat die COVID19-Pandemie zu stark verzögerten Beiratssitzungen geführt. Jedenfalls wurde der erste Planungsentwurf vom Gestaltungsbeirat stark beeinsprucht, sodass eine komplette Neuplanung nötig war“, erzählt der St. Pöltner. Andere Vorstellungen hatte das Gremium unter anderem in Bezug auf die Fenster, die Lage einer Rampe ins Tiefgeschoss, die Fassadenfarbe, der Belichtung et cetera. Er und seine Frau seien als Bauherren in dieser ersten Sitzung nicht eingeladen worden. „Wir konnten daher unsere Planungswünsche zu diesem Zeitpunkt nicht persönlich erläutern.“ Die nötigen Umplanungen wurden in folgenden Sitzungen des Gestaltungsbeirats ausdiskutiert und verbessert. Der Bauherr spricht davon, dass „Missverständnisse ausgeräumt“ werden mussten. Unterm Strich kam es zu Verzögerungen und Mehrkosten. Dennoch zeigt sich Waigmann, der selbst als Baumeister unter anderem Verantwortung für Bauarbeiten im St. Pöltner Regierungsviertel trug, mit dem Ergebnis zufrieden. Heute steht in der Fuhrmannsgasse 12 ein
von seiner Familie genutztes Haus mit zwei Wohneinheiten, einer Tiefgarage für vier Autos, einem kleinen Schwimmbecken, einer PV-Anlage und Wärmepumpe. Aus Sicht Waigmanns und des Gestaltungsbeirats fügt es sich harmonisch in die Umgebung ein.
Überaus positive Erfahrungen mit dem Gestaltungsbeirat machten Leo und Sohn Andreas Graf vom gleichnamigen Dreisterne-Hotel und Gasthaus am Bahnhofplatz 7. Der Betrieb, der seit 1953 besteht, 35 Zimmer umfasst und knapp 20 Mitarbeiter beschäftigt, soll im Bereich der Brunngasse 16 erweitert werden. „Geplant ist ein neues Gebäude mit Zimmern, Apartments und Geschäften. Das ehemalige Geflügelhaus Wech und das China-Restaurant „Happy Family“ sollen zu dem Zweck abgerissen werden“, erklärt Leo Graf. Fünf Sitzungen mit dem Gestaltungsbeirat haben Andreas und Leo Graf bereits absolviert. Sie bestätigen die hohe Fluktuation. „Mit jedem neuen Experten kommen natürlich neue Themen auf. Jeder Architekt sieht Dinge anders.“ Das sehen die beiden allerdings nicht negativ, ganz im Gegenteil. „Von denen kamen wirklich gute Vorschläge, auf die man selber gar nicht gekommen wäre.“ Dabei fokussiert der Beirat auf alle Aspekte, die für die Außenwirkung und das Stadtbild von Relevanz sind. So lieferte der Beirat den Grafs Ideen bezüglich der Dachrinne, der Fassade, der Platzierung von Fenstern und so weiter. Losgehen soll das Bauprojekt idealerweise im Frühjahr 2026.
Externe werden durch interne Experten ersetzt Welche Änderungen stehen beim Gestaltungsbeirat nun an? Im Juli 2025 beschloss der St. Pöltner Gemeinderat ein Sparpaket 2025/26 im Volumen von 21,5 Millionen Euro. 50.000 Euro sollen demnach beim Gestaltungsbeirat eingespart werden. Konkret ist vorgesehen, die bisherigen externen Fachleute durch interne zu ersetzen. Die Kosten des Gremiums sind sehr davon abhän-
gig, wie viel gebaut wird. So gab St. Pölten im Jahr 2023 gut 88.000 Euro für diesen Posten aus, 2024 waren es gut 48.000 Euro. Die Begründung: „In dem Jahr war Bausperre in der Innenstadt. Das bedeutet weniger Arbeitsstunden für die Experten“, erläutert Lengauer. Die Honorarkosten der Fachleute bilden fast eins zu eins die Kosten des Beirats ab. Daher halte man das Einsparungspotential von 50.000 für 2026 für sehr realistisch. Die Gefahr, dass durch die interne Besetzung die Unabhängigkeit des Beirates passé sei oder politische Besetzungen vorgenommen werden, sieht die Stadt nicht. „Politische ‚Hawara‘ werden dort nicht landen, weil keine politischen ‚Hawara‘ dort eingebunden sind“, stellt Lengauer klar. Die internen Amtssachverständigen müssen eine einschlägige Hochschul- oder Universitätsausbildung mit langjähriger Expertise im Gebiet der Architektur, Konservierungsarchitektur, Denkmalpflege und des Städtebaus in gewachsener historischer Struktur nachweisen. Auch die Hoteliers Andreas und Leo Graf sehen den geplanten Neubesetzungen optimistisch entgegen, glauben auch nicht, dass Leute „politisch“ ins Amt gehievt werden. „Außerdem“, so eine Bemerkung Leo Grafs , „glaube ich nicht, dass sich jemand um diesen Job reißt.“

HOTEL GRAF. Andreas (links) und Leo Graf blicken optimistisch und unaufgeregt auf die Beirats-Neubesetzung.
NEUBAU. Helmut Waigmann baute in der Fuhrmannsgasse ein neues Wohnhaus, der Beirat beriet ihn dabei.


DAS GEHEIMNIS DER GEMEINDEALPE
DER ERSTE ESCAPE TRAIL IM MARIAZELLERLAND!
Eine rätselhafte Story, Spannung und frische Luft verbinden sich zu einem einzigartigen Outdoor-Erlebnis: Schritt für Schritt führt der Trail auf den Spuren eines alten Geheimnisses von der Mittelstation bis ganz nach oben.
Ein neues Abenteuerformat für Rätselfans, Naturgenießer und Entdecker.





11 MILLIONEN EURO, BITTE!
Die Gemeinderatswahl steht vor der Tür und da fällt Sparen besonders schwer. Dennoch beschloss die SPÖ-Mehrheit im St. Pöltner Gemeinderat im Juni 2025 ein umfangreiches Sparpaket, mit dem die Stadtfinanzen langfristig wieder ins Lot gebracht werden sollen. Wo will die Stadt mehr einnehmen? Wo will sie Kosten sparen? Und welche Ideen kommen womöglich als Nächstes zur Beschlussfassung?
Österreichweit stehen Gemeinden zunehmend unter Spardruck. Während die Ausgaben ungebremst steigen, stagnieren aufgrund der Wirtschaftsrezession die Ertragsanteile. Das sind jene Geldmittel, die Gemeinden aus dem Finanzausgleich erhalten, also aus den Steuertöpfen des Bundes und der Länder. Wenn die Einnahmen nicht mit den Ausgaben mitwachsen, muss man sparen. Im St. Pöltner Rathaus wurde ein Volumen von rund 11 Millionen Euro ausgemacht, das in den Jahren 2025 und 2026 jeweils eingespart werden muss. Doch wo soll gespart werden? Die städtischen AbteilungsleiterInnen erarbeiteten in Summe 281 Vorschläge, 236 davon betrafen ausgabenseitige
Maßnahmen, 45 die Einnahmenseite. Rund die Hälfte der Vorschläge wurde als „unpolitisch“ eingestuft und sofort in Angriff genommen. Die anderen Punkte wurden von einer politischen Steuerungsgruppe diskutiert und beschlossen – alle Gemeinderatsfraktionen waren dort vertreten, die Beschlüsse wurden jedoch nur von Mandataren der SPÖ-Fraktion beschlossen. Wir listen hier auf, welche Maßnahmen das „Sparpaket“ umfasst und wie sie sich auf das laufende Budget 2025 sowie das Budget im nächsten Jahr 2026 auswirken werden. Zudem listen wir auf, an welchen Ideen derzeit im Rathaus noch gebastelt wird – was also noch nicht beschlossen, aber in Ausarbeitung ist.
VON DER VERWALTUNG BESCHLOSSENE, „INTERNE“ MASSNAHMEN
Dafür wurde nicht der Gemeinderat befasst. Sie bringen einerseits an zusätzlichen Einnahmen im Jahr 2025 rund 2.752.980 Euro, im Jahr 2026 rund 3.880.364 Euro, andererseits reduzieren sie die Ausgaben im Jahr 2025 um 3.910.012 Euro und im Jahr 2026 um 2.453.642 Euro.
Was wurde beschlossen? Auswirkung 2025 in Euro Auswirkung 2026 in Euro Haftungsprämie bei Darlehen. Wenn die Stadt für Darlehen städtischer Gesellschaften haftet, verrechnet die Stadt dafür teilweise Prämien. Die Kosten kommen also der Stadt zugute, belasten aber die städtischen (Töchter-)Gesellschaften.
Tariferhöhungen bei AquaCity und CitySplash.
KIG-Mittel als direkte Finanzzuweisung statt Zweckzuschuss. Dies ist eine einfacher abzuwickelnde Liquiditätsunterstützung vom Bund an Gemeinden, aufgeteilt auf die Jahre 2025 bis 2028.
Höhere Transfers vom Land an die Musikschule. Erreicht werden soll das durch erfüllte, geförderte Stunden und volle Ausschöpfung der Punktförderung.
Zusätzliche Fördergelder für neue Gruppen bei Kindergärten und Tagesbetreuungseinheiten. Ab 15. Oktober 2025 gelten hier neue Gruppenzahlen.
Förderung für die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels bei Kindergärten. Zuschüsse in Höhe von 15.000 Euro pro zusätzlich beschäftigter KinderbetreuerIn.
Erhöhung der Dividende der Fernwärme St. Pölten. Die Tochtergesellschaft von Stadt St. Pölten und EVN schüttet um 520.000 Euro mehr Gewinn an die Stadt aus. Maßgeblich für den Gewinn der Fernwärme sind die vom Kunden bezahlten Tarife.
Kurzfristige Veranlagung. Bereits aufgenommene Darlehen werden rund sechs Monate bis zur tatsächlichen Inanspruchnahme auf einem Festgeldkonto zwischengeparkt und dort verzinst.
Diverse kleinere Maßnahmen mit einer Wirkung von je unter 10.000 Euro summieren sich auch.
Verlängerung der Laufzeit bei langfristigen Darlehen. Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren werden um fünf Jahre verlängert, dadurch reduziert sich die jährliche Annuität (Rückzahlung).
Reduktion der Darlehensaufnahme – Investitionskürzungen. Ab 2025 werden deutlich weniger Investitionen getätigt, dadurch steigen Tilgungsrate und Schuldenstand ab 2026 weniger stark an als in früheren Planungen.
Einsparung aufgrund von Nicht-Nachbesetzungen von Dienstposten. In den Abteilungen Personal, Stadtprokuratur, Präsidiale, Finanzen, Kultur, Schulverwaltung, Stadtplanung, Baudirektion, Städtische Betriebe.
Einsparung von elf Ferialpraktikanten. Die Anzahl wurde von 84 im Jahr 2024 auf 73 im Jahr 2025 reduziert.
Einsparung von Überstunden. In den Abteilungen Präsidiale, Märkte, Kultur und Städtische Betriebe.
Stadtgärtnerei. Verkürzung der Saison, Reduktion der Saisonarbeiter.
Kürzung der Sachausgaben um 20 Prozent. Quer durch alle Abteilungen, etwa durch weniger externe Beratungen und Rechtskosten, weniger Software-Lizenzen, verlängerter Nutzungsdauer bei IT-Geräten, reduzierten Versicherungsleistungen, Reduktionen bei der Stadtsportanlage sowie allgemein weniger Sachkosten im Sinne von Druckkosten, Wärmeverbrauch, Medien, Formulare, Zeitungen und Papier.
Reduktion der Postsendungen. Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten reduzieren Druck- und Portokosten durch weniger Postsendungen.
Reduktion der Parkraumüberwachung. Mit 1. März wurde die Stundenanzahl der Parkraumüberwachung von 160 auf 120 Wochenstunden reduziert. Ab Sommer 2025 erfolgt eine Reduktion auf 80 Wochenstunden.
Reduktion von Landesumlagen. Die NÖKAS-Umlage wird geringer ausfallen als ursprünglich prognostiziert und budgetiert.
Ausgrabungen. Einsparungen bei Grabungen der Stadt-Archäologie.
Sportsubventionen und -patronanzen. Umstellung auf einheitliches Fördermodell, keine Neigungsgruppen bei Fußball, Reduktion bei Patronanzen.
Marketing St. Pölten GmbH. Der Zuschuss der Stadt an die städtische Marketing GmbH reduziert sich, womit diese weniger Aktivitäten setzen wird.
Landestheater. Reduktion der Förderung des Landestheaters durch Minderverbrauch, sprich der Abgang des Theaters soll reduziert werden.
Was wurde beschlossen?
Auswirkung 2025 in Euro Auswirkung 2026 in Euro Immobilien St. Pölten GmbH & CO KG. Die Immobilien-Tochter der Stadt besetzt drei offene Stellen nicht. Unmittelbar wirkt sich das nicht auf das Stadtbudget aus. IT-Abteilung und Netzwerktechnologie. Die Nutzungsdauer von Batterien zur unabhängigen Stromversorgung (USV) von Netzwerkschränken wird verlängert und Ausbauten werden verzögert.
Mobiler Hochwasserschutz. Es werden nur 300 Meter und nicht wie geplant 500 Meter mobiler Hochwasserschutz durch die Präsidiale angeschafft.
Bürgerservice. Es werden weniger neue Büromöbel angeschafft.
Stadtgärtnerei. Diverse Reduktionen sollen Einsparungen bringen.
Wertstoffsammelzentrum Pottenbrunn. Der Baustart und somit die Zahlungen verzögern sich und werden nicht vollumfänglich 2025 schlagend (wohl erst 2026).
VON DER STEUERUNGSGRUPPE UND LETZTLICH VOM GEMEINDERAT BESCHLOSSENE, „POLITISCHE“ MASSNAHMEN
Gemeinsam mit den bereits beschlossenen „internen“ Maßnahmen der Verwaltung bringen diese somit insgesamt das angestrebte Volumen: Im Jahr 2025 Mehreinnahmen von rund 2.826.801 und reduzierte Ausgaben von 8.259.837 Euro. Im Jahr 2026 summieren sich die Maßnahmen auf Mehreinnahmen in Höhe von 4.075.046 Euro und reduzierte Ausgaben in Höhe von 6.301.017 Euro.
Was wurde beschlossen? Auswirkung 2025 in Euro Auswirkung 2026 in Euro Einführung einer Gebühr für Straßenkunstdarbietungen. Einhebung einer Gebühr in Höhe von 18,90 Euro.
Preis für Kopien anheben. Rund 2.300 Kopien werden jährlich angefertigt, die Kosten von 50 Cent pro Blatt werden angehoben.
Fundsachen verkaufen. In Zukunft werden nicht abgeholte Fundgegenstände nicht mehr wie bisher gespendet, sondern verkauft (beispielsweise als „Überraschungs-Box“).
Fundgeldbetrag dem Budget zuführen. Fundgeld (und Fundschmuck) wurden bisher intern verwahrt, nun werden sie nach Ablauf der gesetzlichen Fristen dem allgemeinen Budget zugeführt.
Fundschmuck verkaufen. Gefundener Schmuck im Tresor des Fundamts soll nach Ablauf der gesetzlichen Frist verkauft oder versteigert werden.
Musikschule, Saalmiete erhöhen. Die Miete für die Musikschule bei Trauungen wird von derzeit 100 Euro auf 150 Euro angehoben.
Schanigärtengebühr. Die Gebrauchsabgabe für Schanigärten soll von 16,64 Euro auf 30 Euro pro zehn Quadratmeter je angefangenen Monat angehoben werden.
Impfungen. Kostenbeiträge für Impfungen durch die Gesundheitsverwaltung der Stadt – für Materialkosten und als Kostenbeitrag für Impfberatungen.
Erhöhung der Marktgebühr. Eine Grundsatzentscheidung zur Gebührenerhöhung wurde getroffen, die konkrete Höhe und somit der Budgetbeitrag war noch unklar – die Maßnahme führt explizit die Gefahr an, dass „weitere Beschicker wegfallen könnten“, da die Attraktivität durch eine Gebührenerhöhung nachlässt.
Essen auf Räder. Der Essenspreis wird um 5 Prozent angehoben, im Jahr 2025 erfolgte zuvor keine Erhöhung.
Erhöhung des Schulgelds der Musikschule. Das Schulgeld im Schuljahr 2026/27 wird um 10 Prozent erhöht.
Erhöhung des Portionspreises der Mittagsverpflegung. In den St. Pöltner Bildungseinrichtungen steigt der Portionspreis von 2,90 Euro auf 3,20 Euro.
Verrechnung unentschuldigter Fehltage. Meldet man sich für den Ferienbetrieb in den St. Pöltner Bildungseinrichtungen nur „sicherheitshalber“ an und nimmt gewisse Tage letztlich nicht in Anspruch, werden diese dennoch verrechnet. Derzeit sind 25 bis 30 Prozent der Anmeldungen sogenannte „Sicherheitsanmeldungen.“
Wintereinlagerung von Pflanzen. Wenn Private ihre Pflanzen während der Wintermonate bei der Stadtgärtnerei einlagern, ist dies zukünftig kostenpflichtig. 15.000 Arbeiten in Folge von Baumaßnahmen Privater. Muss zukünftig in Folge privater Baumaßnahmen ein Lichtmasten, ein Wartehäuschen oder dergleichen versetzt werden, verrechnet die Gemeinde diese Kosten dem Privaten.
Keine Angabe. Keine Angabe.
Transparente anbringen. Das Anbringen von Werbetransparenten durch die städtische Beleuchtung ist zukünftig nur mehr für städtische Einrichtungen bzw. Veranstaltungen kostenlos, andere Veranstalter müssen zahlen. 10.000
Politische Subventionen. Die Schulungsbeiträge für politische Parteien im Gemeinderat werden in den Jahren 2026 und 2027 nicht erhöht, sondern bleiben auf dem Niveau von 2025, das sind 149.603,40 Euro. Umgesetzt wird diese Maßnahme mittels eines „Paktums“ zwischen den Gemeindevertreterverbänden. 3.800
Einstellung Livestream Gemeinderat. Die Gemeinderatssitzungen werden nicht mehr im Internet live übertragen bzw. als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. 16.000
Freiwillige Mitgliedschaften kündigen. Betrifft unter anderem das Urban-Forum, das KDZ, die Juristische Gesellschaft, das Armutsnetzwerk, den Kreditorenverband und Erwachsenenschutz.
Ehrungen durch die Stadt. Sämtliche Verleihungen und Veranstaltungen im Rahmen von städtischen Ehrungen werden bei reduzierter Verpflegung zusammenlegt. Für zwei Ehrenringträger und dreizehn Ehrenzeichenträger wird es nur mehr eine gemeinsame Veranstaltung im Gemeinderatssaal mit ein bis zwei Begleitpersonen geben, kein Essen, nur ein Stehempfang mit Sekt und wenigen Brötchen.
Sportogo-Automaten einstellen. Die vier digitalen Leih-Automaten zur kostenlosen Ausgabe von Sportgeräten werden als „nice to have“ eingespart. Bisher wurden die Automaten von einem privaten Betreiber angemietet.
Reduktion der Sportsubventionen. Die gesamten Sportsubventionen werden um 15 Prozent reduziert.
Inserate in Magazinen von Sportvereinen. Reduktion der Inserate ab 2026.
Pokale und Werbegeschenke reduzieren. Das Budget für Pokal oder repräsentative Geschenke für Vereinsveranstaltungen wie Siegerehrungen oder Tombola werden um 20% reduziert.
St. Pölten Konkret. Das Amtsblatt erscheint bei den Bezirksausgaben nur mehr im Verteilungsgebiet des früheren Bezirks (P und PL), nicht im ganzen politischen Bezirk St. Pölten-Land.
Werbung reduzieren. Aus dem Budget des Medienservice werden weniger Inserate bzw. Werbung in TV/Radio geschalten. 2024 betrug das Budget 36.000 Euro.
Reduktion der Vereinssubventionen. Vereine ohne Erwerbszweck erhalten um 15 Prozent weniger Subvention.
Ecopoint/Masterplan. Der Masterplan wird vorrübergehend (für das Jahr 2026) ausgesetzt weshalb die jährlichen Auszahlungen der Stadt dann wegfallen.
Marketing St. Pölten GmbH. Der Rotstift wird bei mehreren Stellen angesetzt. Ab 2026 werden 31.000 Euro in der Position ecopoint/Wirtschaft eingespart, 32.000 bei Großprojekten, 101.000 im Tourismus-Marketing, 100.000 im Innenstadtmarketing. Schon ab 2025 wird beim Christkindlmarkt die Bühne eingespart, das bringt 40.000 Euro. Reduzierte Werbemaßnahmen im Wirtschaftsmarketing sparen heuer auch 13.000 Euro.
Mitarbeiter-Apfel. Das kostenlose Obst für Magistratsbedienstete wird eingespart.
Büro für Diversität. Schon im Vorjahr wurde das Budget um ein Viertel gekürzt, 2025 wird nochmals ein Viertel gestrichen, gewisse Veranstaltungen werden eingestellt.
Schließung der Beratungsstelle für Alkoholprobleme. Die rund sechs Beratungen im Monat im sozialmedizinischen bzw. ärztlichen Bereich werden abgeschafft, andere Institutionen sollen eventuell besser diese Leistungen abdecken können.
Erwachsenensozialarbeit. Betrifft vor allem ältere Menschen zum Beispiel bei Verwahrlosung. Hier wird rund ein Drittel der Leistung reduziert, da ein Dienstposten mit 40 Wochenstunden nach einer Pensionierung nicht nachbesetzt wird.
Streunerkatzen. Die Subventionierung der Streunerkatzen-Kastration im Stadtgebiet wird eingestellt.
Längerfristige Sparpläne. Wo bis 2026 keine Maßnahmen möglich sind, beispielsweise aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sind ab 2027 Änderungen beschlossen. Um 10% werden die Förderungen reduziert: für die Landestheater NÖ Betriebs GmbH ab 2028, für das Kinderkunstlabor ab 2029, die NÖ MuseumsBetriebs GmbH (betreibt die Ehemalige Synagoge) ab 2028, die KUSZ Betriebs GmbH ab 2028 sowie die „KUSZ-Zusatzvereinbarung für Kulturprojekte ab 2025“ ab 2028. Ferienbetreuung. Mehrstunden sollen vermieden werden durch bessere Planbarkeit in Folge kostenpflichtiger Stornogebühren bei unentschuldigtem Fernbleiben. 33.000 LUP-Fahrplanhefte. Die Fahrplanhefte werden nicht mehr wie bisher gedruckt und kostenlos verteilt.
7.000
Was wurde beschlossen? Auswirkung 2025 in Euro Auswirkung 2026 in Euro Stadt-/Dorferneuerung. Projekte auf Basis der Landesförderungen zur Unterstützung von Dorf- bzw. Stadtteilinitiativen laufen aus.
Europäisches Netzwerk zur Förderung des Eisenbahnausbaus auf der Strecke Paris-Budapest. Die Mitgliedschaft bei „Main Line for Europe, Magistrale für Europa“ wird gekündigt. 3.500
Reduktionen bei aktiver Mobilität. Die Infrastruktur für aktive Mobilität wie Radabstellanlagen, Leitsysteme, Verkehrszählinfrastruktur und dergleichen werden weniger bereitgestellt bzw. gewartet.
Reduktion Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat. Der Gestaltungsbeirat soll teilweise magistratsintern besetzt werden, wodurch Aufwandsentschädigungen für externe Mitglieder des Beirats entfallen. Dies greift erst 2026, weil 2025 noch Zusagen bestanden.
Pflasterung Wiener Straße. Die weitere Neu-Pflasterung der Wiener Straße in der Fußgängerzone wird auf 2027 verschoben.
Kürzungen im Straßenbau-Budget. Das jährliche Straßenbau-Budget wird gekürzt.
Bus-Wartehäuser. Die Errichtung neuer LUP-Bus-Wartehäuschen samt Fundamenten wurde 2025 eingespart.
Steganlagen. Durch die Stadtgärtnerei werden keine Neuankäufe getätigt. 5.000 Friedhofsmauer St. Georgen. Die Sanierung der Mauer am Friedhof St. Georgen wird um ein Jahr verschoben.
Klimakoordination. Einsparungen bei diversen Projekten wie Forschungsförderungsprojekten, Weiterbildungsseminaren oder Projekten zur Förderung der Biodiversität.
Reduktion der Förderung von Energieeinsparung. Förderungen für Privathaushalte werden eingespart.
Instandhaltung der Amtsgebäude. Die Immo-Gesellschaft der Stadt reduziert die laufenden Instandhaltungskosten der Amtsgebäude auf das Mindestmaß.
Überdachung Karmeliterhof. Das Projekt der Überdachung des Karmeliterhofs wird verschoben.
Berta von Suttner Privatuniversität. Der Zuschussbedarf der städtischen Hochschulen-Holding an ihre Privatuni soll in den kommenden Jahren unter den ursprünglichen Plänen liegen.
Reduzierte Leistungen der Hochschulen-Holding. Transfers für zusätzliche Leistungen wie KI-Projekte oder Change Prozesse werden reduziert.
WAS KOMMT DENN NOCH?
Etliche Maßnahmen wurden vom Gemeinderat noch nicht beschlossen, die Fachabteilungen wurden jedoch beauftragt detaillierte Konzepte zur konkreten Umsetzung auszuarbeiten. Folgende Ideen könnten im Rahmen des Konsolidierungsprozesses noch folgen:
• Die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet, also beispielsweise von Park- und Halteverboten oder die Benutzung von Behindertenparkplätzen, könnte von der Landespolizeidirektion an die Stadt übertragen werden. Der dafür zuständige Personalpool könnte durch Einsparungen in anderen Abteilungen oder Geschäftsbereichen geschaffen werden.
• Radarmessungen auf Gemeindestraßen könnten in Kooperation mit der Landespolizeidirektion ausgebaut werden, beispielsweise zur Überwachung von 30er-Zonen oder vor Schulen, die Geräte könnten von der Stadt angekauft werden und die Landespolizeidirektion würde zur Umsetzung der Überwachung Personal von der Stadt gestellt bekommen.
• Nachmittagsbetreuung in Pflichtschulen: Die Tarife
wurden seit 2010 nicht erhöht, im Raum steht nun eine Erhöhung um 10 Prozent, bei einer Vollbetreuung somit von 100 auf 110 Euro im Monat. Die Mehrerlöse könnten 33.956 Euro im Jahr 2025 und 67.913 Euro im Jahr 2026 bringen.
• Nachmittagsbetreuung in Kindergärten: Zur Diskussion steht eine Wertsicherung bzw. jährliche Anpassung des Betreuungsbetrages anhand des Verbraucherpreisindex. 4.879 Euro im Jahr 2025 bzw. 9.758 Euro im Jahr 2026 würde das bringen.
• Erhöhung des Einheitssatzes für die Berechnung der Aufschließungsabgabe von 510 Euro auf 1.000 Euro.
• Liegenschaftsverkäufe: Die Immo-Gesellschaft der Stadt prüft Verkäufe leerer Grundstücke in der Amtsstraße sowie der Maria-Emhart-Straße sowie den Verkauf des ungenutzten Amtsgebäudes in der Prandtauerstraße 3, der ehemaligen Stadtbücherei.
• Neujahrsempfang für Mitarbeiter: Überlegt wird neben der kompletten Streichung auch eine Neukonzeption als günstigere Alternative.

• Wahlbeisitzer und Wahllokale: Der Stundenlohn der Wahlbeisitzer könnte auf das gesetzliche Minimum reduziert werden, das Einsparungspotential wären rund 6.150 Euro. Zudem könnten elf Wahlsprengel zusammengelegt werden, wodurch sich die Anzahl der Wahllokale reduzieren würde, das Einsparungspotential wären rund 13.790 Euro. Eine Reduzierung der Kosten für die Reinigung der Wahllokale von aktuell 50 auf zukünftige 30 Euro könnte Einsparungen in Höhe von 1.500 Euro bringen. Die Reduktion der Öffnungszeiten um eine Stunde könnte Einsparungen in Höhe von rund 6.500 Euro bringen.
• Reduktionen diverser Subventionen des Bereichs Gesundheit und Soziales: Oma/Opa-Dienst des Katholischen Familienverbands, Kunsttherapie für Kinder und Jugendliche, Garbarage (Arbeitsvorbereitung bzw. Training für Menschen mit Handicap), Streetwork bzw. offene Jugendarbeit des Vereins Jugend & Lebenswelt, Verein Younus mit Mentoring für Kinder und Jugendliche, die Einladung der Pflegeeltern zum Volksfest, unterstützende Tätigkeiten für das Armutsnetzwerk im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung von LGBTIQ+ Personen durch Courage, Beratung von Personen mit Migrationshintergrund durch
Beratungsstelle FAIR, Beratung und Psychotherapie für Frauen durch Verein Frauenzentrum, Unterbringung von von Gewalt betroffenen Frauen im Haus der Frau, günstige Bestellung von „abgelaufenen“ Produkten durch Verein SAM/soogut, die Unterstützung bei Wohnraumschaffung durch Verein Wohnen.
• Mehr betreubares Wohnen im Seniorenwohnheim: Die wegen Personalmangel gesperrte Bettenstation könnte umgebaut werden, 40 Betreuungsplätze in Form betreubaren Wohnens könnten entstehen.
• Die Subvention für das Kulturzentrum Löwinnenhof in der Höhe von 190.000 Euro könnte ab 2027 nicht mehr in dieser Höhe budgetiert werden.
• Die Auslagerung der technischen Betreuung der Pflichtschulen, Kindergärten, Tagesbetreuungseinrichtungen sowie der schulischen Nachmittagsbetreuung soll wieder intern durch das Magistrat erfolgen, ab 2026 könnte das 50.000 Euro Einsparung bringen.
• Verschiebung Neubau und Generalsanierung Allgemeine Sonderschule Nord. Die ASO-Nord soll erst ab 2028 umgebaut und 2029 fertiggestellt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach sonderpädagogischen Schulplätzen müssen alternative Lösungen für die Übergangszeit gesucht werden.
• Das Anrufsammeltaxi (AST) wird eingestellt, der Vertrag mit Taxi Rittner gekündigt. Alternativ wird eine Tariferhöhung angedacht, zumal die Zoneneinteilung veraltet ist und Preise zuletzt 2016 angepasst wurden.
• Die Reinigung der Innenstadt soll günstiger werden, durch eine Umstellung der Arbeitszeit auf einen Turnusdienst sollen Überstunden eingespart werden. 2026 könnte das 25.000 Euro bringen.
• Kaputte Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen sollen durch die Stadtgärtnerei abgebaut und nicht mehr erneuert werden. Zudem sind neue SpielplatzKonzepte in Ausarbeitung. Bringen würde das rund 60.000 Euro im Jahr 2025.
• Im CitySplash wird der Aufbau der Traglufthalle evaluiert, Einsparungen von 100.000 Euro wären für 2026 denkbar. Zudem sollen AquaCity und CitySplash durch flexiblere Dienstpläne Kosten sparen.

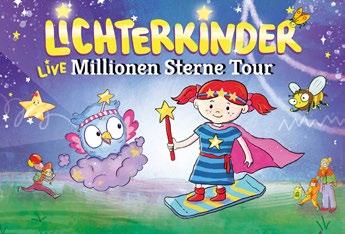




& VON RADLN, ROLLERN SCOOTERN

Die einen rollen elektrobetrieben leise durch die Fußgängerzone, bringen Packerl, Post und Essen. Die anderen bringen rasantes Chaos in den Stadtverkehr.
Sie sind Teil des St. Pöltner Stadtbilds, und das seit vielen Jahren: Andy Grubner und seine beiden Fahrradkuriere Alex und Stefan düsen durch die Straßen und liefern aus – Prospekte & Packerl, Suppen & Sträuße, Hochzeitsgäste & Hometrainer. „Wir erledigen alles, wo Not am Transport ist. Jeder kann uns buchen, können wir nicht, gibt’s nicht“, sagt der 35-Jährige, der vor seiner Karriere als Rad-Transportunternehmer aufstrebender Rockmusiker war und wegen einer Europatournee seinen Job als Holztechniker an den Nagel hängte. „Radfahren und alles, was dazugehört, ist jetzt mein Leben.“
In die „Selbstständigkeit geschlittert“ ist Andy Grubner vor zehn Jahren, als er zunächst mit dem damaligen Rad-Lieferanten Peter Kaiser kooperierte, Prospekte verteilte und etwas später den Rad-Job von Kaiser übernahm. Das schnelle und zuverlässige Lieferservice des
immer freundlichen und fröhlichen Radlers hat sich rasant herumgesprochen. Auch Andys ausgezeichnetes Netzwerk im Kulturbetrieb hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen rasch gewachsen ist, zwei Mitarbeiter mitradeln und Andys Frau, eine stressresistente gelernte Krankenschwester, das Büro übernommen hat. Seit fünf Jahren kooperiert der Fahrradkurier mit DPD und hat damit die riesigen Transporter aus der Fußgängerzone verdrängt. „Seither bekomme ich immer mehr Anfragen von Privatpersonen, nicht nur Firmen“, freut sich Grubner auch über beste Google-Rezensionen im Netz. Nicht selten füllen an die 250 Packerl am Tag die Lastenräder, „zu Weihnachten waren es 500 Pakete pro Tag.“ So ein Lastenrad kann 250 Kilo schleppen, daher können die Fahrradkuriere auch ungewöhnliche Wünsche erfüllen und zum Beispiel einen Hometrainer vom Sportgeschäft zum Käufer liefern, bei Casa Moda aktuelle Hängeware
abliefern oder dem Stadtarchäologen Ronald Risy beim Übersiedeln seiner 80 Kisten mit Büchern behilflich sein.
Bei Festen ist ein besonderes Fahrradkurier-Fahrzeug im Einsatz – die Rikscha. Ein elegant gekleideter Andy Grubner kutschiert dann etwa Braut und Bräutigam zur Hochzeitstafel, führt beim Höfefest Gäste von einem Kulturevent zum nächsten oder bringt StadtLandFlussBesucher von der Innenstadt zur Traisen – „die Leute waren begeistert!“. Daher will der Fahrradkurier im nächsten Jahr das touristische Angebot mit zwei zusätzlichen Rikscha-Taxis ausweiten.
Heuer wird aber noch gefeiert. Andy bittet zum Jubiläumsfest „10 Jahre Fahrradkurier“ ins Cinema Paradiso, am Freitag, 17. Oktober, ab 22 Uhr, natürlich mit Top-Musik. „Jeder ist herzlich eingeladen.“
Fußgängerzone ist großer Radweg
Der Fahrradkurier und auch die Postler dürfen mit ihren Lastenrädern jederzeit durch die St. Pöltner Fußgängerzone fahren, denn die ist ein Riesen-Radweg. Den auch immer mehr elektrobetriebene einspurige Fahrzeuge nutzen – aber manche vielleicht nicht mehr lange dürfen. Im Herbst soll ein neues Gesetz kommen, das Regeln für E-Roller und E-Mopeds sowie E-Scooter, das sind die elektrischen Tretroller, bringen soll. „Grundsätzlich funktioniert das Zusammenleben zwischen den

FAHRT MIT DER RIKSCHA. Beim Höfefest kutschiert der Fahrradkurier keine Packerl, sondern die Gäste durch die Gegend.

Stadt der Tat*

WARUM ES SICH IN ST. PÖLTEN SO GUT LEBT?
Weil die Stadt auf sich und ihre Menschen schaut: mit sauberen Straßen. Mit glasklarem Trinkwasser. Und mit einem großen Herz für alles, was wächst und blüht!
rundum


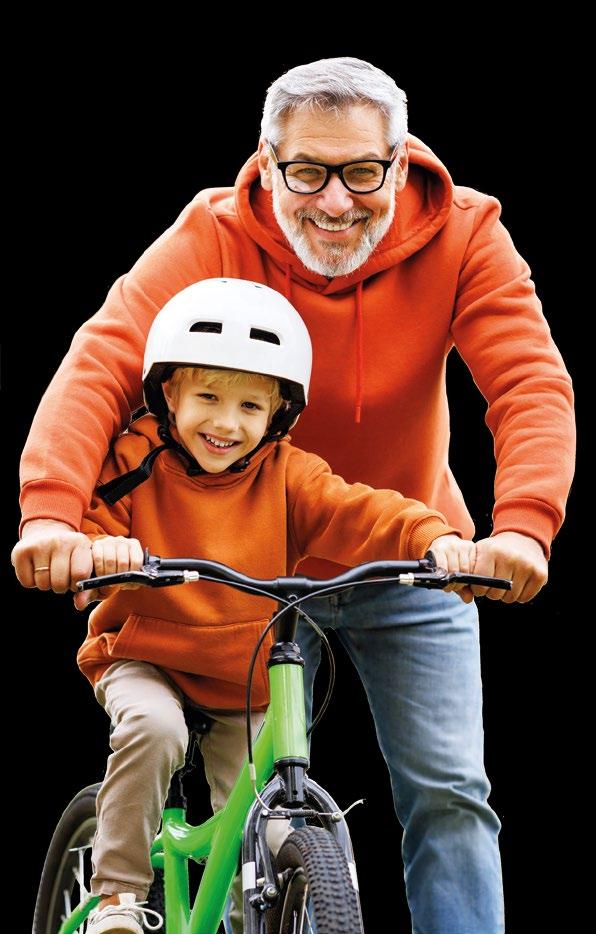


ESSENSBOTEN. Die bunt gewandeten Rollerfahrer werden in der Fußgängerzone wieder aufs Rad umsteigen müssen.
Radfahrern sowie den E-Scooter und E-Roller-Nutzern – wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen“, sagt Raphael Rech von der Mobilitätsplanung im Magistrat. Brenzlige Situationen würden am ehesten zwischen Fußgängern und Scooter-Fahrern entstehen, „weil schnelle Scooter-Fahrer nicht schnell genug reagieren“, so Rech. Das bestätigt auch die Polizei. „In der Innenstadt von St. Pölten gelten E-Scooter durchaus als Problem, besonders in Relation zu Fußgängern und Fußgängerinnen im dicht frequentierten öffentlichen Raum“, bestätigt Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizei NÖ und bringt Beispiele: Im September 2024 wurde ein neunjähriges Mädchen in der Fußgängerzone von einem E-Scooter-Fahrer – unter Einfluss von Alkohol und Drogen – angefahren. Das Kind trug schwere Verletzungen davon und der Fahrer wurde im April 2025 wegen schwerer Körperverletzung gerichtlich verurteilt. Oder: Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer fuhr im Februar 2025 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Josefstraße, ignorierte polizeiliche Anhaltezeichen und flüchtete in rücksichtsloser Weise. Dabei gefährdete er mehrere Passanten. Der Lenker stand unter Drogeneinfluss. Technisch wurde bestätigt, dass sein E Scooter bis zu 50 km/h erreichte – deutlich mehr als die erlaubten 25 km/h.
Übrigens: Österreichweit starben im vergangenen Jahr sieben Menschen bei E-Scooter-Unfällen, über 7.500 landeten im Krankenhaus.
Die Vorfälle zeigen, so Johann Baumschlager, dass die E-Scooter-Lenker besonders in Fußgängerzonen erhebliche Gefahren darstellen. Das Stadtpolizeikommando St. Pölten hat daher die Kontrollen in der Fußgängerzone verstärkt und stellt immer wieder fest, dass sich die Lenker von E-Scootern nicht an Regeln halten und teilweise durch Suchtmittel beeinträchtigt sind und die
E-Scooter zum Teil deutlich schneller unterwegs sind als erlaubt. Die Novelle des Infrastrukturministeriums wird wahrscheinlich nichts an den Konflikten zwischen Scooter-Lenkern, Fußgängern und der Polizei ändern, vermutet der St. Pöltner Radexperte Rech: „Scooter dürften weiterhin als Fahrrad betrachtet werden.“ Die Resolution des St. Pöltner Gemeinderats aus dem Juli 2024, die Scooter aus der Fußgängerzone verbannen will, indem sie diese den Fahrrädern nicht gleichstellt, dürfte sich in einer veränderten Straßenverkehrsordnung nicht finden: „Details müssen wir abwarten.“
Essenslieferanten auf E-Mopeds
Fehlverhalten von E-Bike-Fahrern ist Mobilitätsplaner Rech nicht bekannt. „Da muss ich die eigene Kraft einsetzen, muss in die Pedale treten – das ist psychologisch etwas anderes, als nur Gas zu geben wie beim Scooter.“
Der E-Scooter-Boom ebbt übrigens gerade etwas ab, bestätigt Martin Lackner, Geschäftsführer von XXXLutz: „2023 war das beste Jahr – seither geht der Verkauf zurück.“ Die Gründe: Die Mitbewerber sind mehr geworden, Leih-Scooter sind angesagt und es gibt einen Trend hin zu E-Rollern.
Und die – noch wenigen – E-Roller-Nutzer verhalten sich grundsätzlich korrekt. Sie dürften nach den neuen Regeln allerdings von den Radwegen und damit auch aus der Fußgängerzone verschwinden. Betroffen davon werden hauptsächlich die Essenslieferanten sein – einige Foodora-Fahrer sind in der Innenstadt statt auf Rollern schon auf Rädern unterwegs. „Wir begrüßen die Gesetzesnovelle,“ erklärt dazu Alexander Gaied, Geschäftsführer des Lieferdienstes Foodora. Denn: „Klare Regeln und Sicherheitsstandards sind für alle Verkehrsteilnehmer essenziell.“ Foodora verfolge ein umfassendes Sicherheitskonzept, welches die aktive Zusammenarbeit mit den Städten und der Polizei einschließt. Alexander Gaied: „Derzeit bereiten wir die Einführung digitaler Geozonen vor. Diese informieren Fahrer und Fahrerinnen in Echtzeit über sensible Gebiete, wie etwa solche mit bestehenden Fahrverboten oder Fußgängerzonen.“
Die Arbeitswege der Essenslieferanten von Foodora und auch vom Konkurrenten Lieferando werden allerdings grundsätzlich über GPS kontrolliert, sie erhalten via Apps ihre Aufträge, und sie müssen sich ihren Elektro-Roller oder ihr Fahrrad selbst kaufen. Denn sie sind als freie Dienstnehmer tätig und haben als solche keinen Anspruch auf Weihnachts- oder Urlaubsgeld und kein Einkommen im Krankheitsfall. Seit einigen Jahren machen protestierende Boten auf ihre prekären Arbeitsverhältnisse aufmerksam. Foodora hat im vergangenen Jahr reagiert. „Unsere Dienstnehmer sind sozialversichert“, bestätigt Alexander Gaied. Und die Regierung hat jetzt mit der „Lex Lieferando“ die Regelungen für die freien Dienstverhältnisse adaptiert. Ab dem kommenden Jahr gelten für freie Dienstnehmer fairere Arbeitsbedingungen mit geregelten Mindestentgelten und Kündigungsfristen von mindestens vier Wochen.
Konto, Sparen, Investieren: Alles in einer App. Mit George.

Investitionen bergen Risiken und Chancen.
Aktuelle Ausstellung:
Aufwachsen zwischen 1938 und 1955


MOMENTA IN SCHWA
„Schleich dich raus, du Negerweib!“ Mit diesem vollkommen unerwarteten Schlachtruf begrüßen mich 1994 in unserer Hauptschule in St. Pölten-Land ein paar Buben, die ich bis dahin zu meinen Freunden gezählt habe. Mit denen ich mich bis dahin sicher und wohlgefühlt habe. In Erinnerung geblieben ist mir diese Anekdote als schmerzhafte Spitze des rassistischen Eisbergs meiner Kindheit, Jugend – und auch früheren Erwachsenenzeit.
Über drei Jahrzehnte hat es aus heutiger Sicht in Summe gedauert, bis ich lerne, meine halbasiatische Herkunft und dunklere Haut anzunehmen – und als selbstverständliches „Ich bin ich“ wertzuschätzen. Es hat somit auch persönlich etwas Befreiendes, hier und heute fürs mfg loszuziehen, um beruflich jenes Thema zu erkunden,

das mich mein halbes Leben lang verfolgt hat – und sicher mein ganzes Leben lang begleitet: Rassismus. Dazwischen liegen Etappen von Hass(aktionen) gegen mich und auch andere, um mich selbst besser zu fühlen. Von sinnlosen Versuchen, „weißer“ zu sein. Und vom beständigen Verfluchen meiner Wurzeln. Tolle Menschen und unzählige Coachings & Co. führen über viele Jahre hinweg zu neuen Einsichten und damit auch Erlebnissen. Heute fühle ich mich in meiner Haut –meistens – sicher und wohl.
Rassistisches System
Und nein, es beginnt nicht so, dass ich mit drei Jahren wackelig vorm Spiegel stehe und selbstkritisch mit meiner dunkelbraunen Haut, den tiefschwarzen Haaren und dunklen Augen hadere, weil ich das alles hässlich finde. Vielmehr lerne ich Rassismus von klein auf durch meine Umgebung, meinen engsten und weiteren Mikrokosmos.
Aufgewachsen in einer sozusagen „weißen“ Pflegefamilie, bin ich für andere die übertrieben bestaunte kleine Exotin. Später die, die eine „andere Mutter“ hat und deshalb „anders ausschaut“. In den Achtzigern, gebettet im auch damals schon eher multikulturell geprägten Wien, geht das ja noch. Ab 1989, im ländlichen Umfeld von St. Pölten, sind die Sprüche dann mitunter weniger nett. Nach dem erwähnten Hauptschul-Erlebnis etwa versuche ich jahrelang, nicht zu sehr „nachzubräunen“. Und meide bewusst die Sonne. Es ist mir peinlich, hervorgehoben zu werden – ob positiv oder negativ. Es ist mir unangenehm, dass alle immer alles wissen wollen und ich mich im Zugzwang fühle, auch immer brav meine Herkunftsgeschichte auszurollen vor Menschen, von denen ich im Gegenzug nichts erfahre. Das sind ja auch ganz normale Österreicher:innen. Nicht so wie ich – zwar in Wien geboren, aber eben dunkel. Das muss erklärt werden. Entschuldigt werden. Im besten Fall vertuscht werden. Über die Jahre wächst der Selbsthass. Als Jugendliche und junge Erwachsene entwickle ich eine Über-
KEIN MÄRCHEN. Für ihre Black Pearl Lounge ging Leonora Marie Gomez de Pappenberger einen weiten Weg.
UFNAHME RZ-WEISS

FRIEDLICHES AMBIENTE. Black Pearl Lounge in der St. Pöltner Eybnerstrasse 18a ist täglich von 11:00 bis 1:00 Uhr geöffnet. (www.facebook.com/black.pearl.lounge.2024)
empfindlichkeit und Ängste, wenn ich auf meine „Herkunft“ angesprochen werde. Rassistische Bemerkungen, die ich immer wieder mal aufschnappe – oder Anfang 20 von einem Neonazi ins Gesicht geschleudert bekomme – nähren meine Selbstzweifel. Meine spätere Gothic-und Metal-Affinitität kommt dem Versteckenwollen meiner im wahrsten Sinne Dunkelheit make-up-technisch zwar entgegen. Heute gruselt es mich aber vor den alten Fotos mit meinem oft viel zu
hell geschminkten Antlitz auf braunen Schultern. Menschen von den Philippinen haben halt dunkle Haut. Und lange konnte ich das nur schwer ertragen.
Ich empfinde es als großen Segen, dass sich dieses Selbstbild wandeln durfte. Aber wie geht es anderen Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe damit? In St. Pölten?
Schwarze Perle in St. Pölten
Die redaktionelle Reise starte ich bei Leonora Marie Gomez de Pappen-
berger. Lachend, mit Putz-Utensilien in der Hand, strahlt sie mich an, als ich in ihr St. Pöltner Lokal, die Black Pearl Lounge in der Eybnerstraße, komme. In einer Stunde sperrt sie auf – und an manchen Tagen macht sie als Chefin halt alles, das anfällt. Stört sie nicht. Denn sie ist ein außergewöhnlich starker Mensch.
Geboren im mittelamerikanischen Nicaragua, verbringt Leonora etwa aufgrund eines familiären Notfalls als Neunjährige einige Jahre bei ihrer Tante. „Meine Schwester war sehr krank“, erzählt sie, „und unsere Mutter hat viel Zeit mit ihr im Krankenhaus verbracht. Da war ich bei meiner Tante untergebracht.“ Und die hält sie „wie eine Sklavin“: Das Mädchen muss sich um den gesamten Haushalt und auch das Baby der Tante kümmern. „Aber das Leben ist wie eine Autobahn“, funkelt mich Leonora, heute 54 schöne Jahre alt, schelmisch an, „und auch, wenn es stark regnet und du Angst hast, dann fährst du weiter, hörst du? Du darfst nicht stehenbleiben, du musst weiterfahren!“ Und das tut sie. Immer.
Über ihre Cousine, die bereits länger im Raum St. Pölten lebt, wird ihr als junger Frau der Besuch in Österreich ermöglicht. Sie lernt einen spannenden Mann kennen, sie kommt wieder, sie heiratet ihn, er adoptiert ihre drei Söhne. Das perfekte Märchen. Ist genau das: Nur ein Märchen. Die Realität sieht anders aus, sie verbringt zwei Jahre auf den Cayman Islands und schickt so

NULL
TOLERANZ. Wenn es um seine Kinder geht, lässt David rassistischen Sprüchen keinen Spielraum.
viel Geld als möglich nach Hause. Nach Niederösterreich. Den Kindern dort geht es nicht gut, sie kehrt zurück, bald bricht alles auseinander. In einer winzigen Wohnung mit den Kids startet Leonora neu, findet einen Job als Reinigungsdame.
All die Jahre – wo sie die Sprache lernt, ihr Netzwerk aufbaut, arbeitet und die Gegebenheiten für ihre Buben und sich zu optimieren versucht – verliert sie nie den Glauben an ein gutes Leben für ihre Familie. Ihre offene Art öffnet nach und nach Türen: zu einem eigenen Kiosk, einer größeren Wohnung, schließlich dem ersten eigenen Lokal am Mühlweg – ihrer „ersten Black Pearl“. Rassistischen Angriffen ist sie selbst während dieser langen Reise nicht ausgesetzt.
Die Kinder mussten sich viel anhören
„Ich habe mich ja auch überwiegend in meiner eigenen Community, wie bei meiner Cousine, aufge-
halten“, überlegt sie. „Aber meine Kinder – die haben sich immer viel anhören müssen. Ob in der Schule, beim Fußballspielen oder beim Fortgehen.“ Nicht in St. Pölten, sondern in einem anderen niederösterreichischen Verein rutscht einem ihrer Buben die Hand aus: Konkret, als er von einem Sportkollegen mit den Worten begrüßt wird, ob er als Neger denn in der Kokosnuss-Schale dahergeschwommen wäre. „Bestraft wurde damals nur mein Sohn“, konstatiert Leonora sachlich, „weil er der Schläger war. Dem Beleidiger ist nichts passiert.“ Selbst heute hört sie von ihren längst erwachsenen Söhnen immer wieder von rassistischen Angriffen. „Manchmal sind es Kinder, einfach Kinder, die auf den erwachsenen schwarzen Mann hinschimpfen“, erzählt sie. „Hier müsste mit den Eltern geredet werden, denn sie sind es, von denen Kinder ein solches Verhalten überhaupt erst lernen. Oder die es zumindest nicht mit ihnen besprechen, wie es sich gehören würde.“
„Darf ich mal deine Haare anfassen?“
Dazu weiß auch Martina Eigelsreither einiges zu berichten. Als Leiterin vom Büro für Diversität am Magistrat St. Pölten befasst sie sich häufig damit, womit Menschen rassistisch konfrontiert sind. Eingerichtet wurde die Kompetenzstelle vor gut 13 Jahren für aktives Vielfaltsmanagement. Seitdem fördern und stärken Martina und ihr eingespieltes, engagiertes Team unsere Gleichbehandlung und das Zusammenleben in unserer Unterschiedlichkeit.
„Darf ich deine Haare anfassen? Wie hast du so gut Deutsch gelernt? Woher kommst du wirklich? – Das Gefühl des Angekommenseins ist einfach nicht da, wenn man immer wieder so angesprochen wird“, führt Martina aus. „Solidarität und ein zi-
Direkte Fragen sind immer noch besser als Blicke und Gesten im Vorbeigehen. DAVID
vilcouragiertes Verhalten von Dritten sind entscheidende Faktoren, die Betroffene dazu ermutigen, gegen rassistische Diskriminierung vorzugehen. Um diese Solidarität und dieses Verhalten zu fördern, ist es wichtig, die gesamte Gesellschaft für Rassismus zu sensibilisieren.“
Immer gefragt: Zivilcourage! Genau die von Martina angeführten Fragen und Respektlosigkeiten sind auch David (48) bestens bekannt. „Wobei ich grundsätzlich sehr gut aufgewachsen bin und nie frontal oder gar körperlich angegriffen worden bin“, fügt der St. Pöltner in unserem Interview nachdrücklich hinzu. „Was ja wiederum eigentlich auch selbstverständlich sein sollte“, relativiert er nach einigen nachdenklichen Sekunden.
Der Vater von ihm und seinem jüngeren Bruder stammt aus Ghana und ist bereits seit den 1960erJahren in Österreich. David wird in der Heimat der Mutter geboren: in Südtirol. Als die Familie schließlich nach St. Pölten siedelt, sind die Kinder noch klein. „Ich erinnere mich natürlich an Gesten oder Blicke“, erzählt uns David heute, „und wir Kinder wussten, dass das wegen unserer dunklen Hautfarbe ist, aber wir waren ja sehr gut integriert und hier in Österreich geboren. Ich will gar nicht wissen, wie es Menschen geht, wo das nicht so ist, und die vielleicht tagtäglich angefeindet werden.“ Direkte Angriffe erlebte er nicht wirklich, bloß beim Fußballspielen kamen aus dem Publikum schon öfters mal blöde Meldungen, die sich auf seine Hautfarbe bezogen. „Weder der Trainer noch wir Spieler hatten da groß Zeit, um auf solche Beschimpfungen einzugehen. Aber wenn meine Freunde mit im Publikum waren und sowas mitbekommen haben, haben sie denen natürlich schon immer die Meinung gesagt!“ Genau wie vor den Türen so mancher Location, wenn es bei David plötzlich „Geschlossene Gesellschaft“ hieß, um ihn nicht reinzulassen. „Hier in St. Pölten war ich ja – auch übers Fußballspielen – gut
LASST UNS AKTIV ANTIRASSISTISCH SEIN!
Das im Jahr 2012 eingerichtete Büro für Diversität bündelt am Magistrat in Niederösterreichs Landeshauptstadt die Aufgabenbereiche Frauen/Gleichstellung, Menschen mit Behinderung(en), Sexuelle Identität sowie Weltanschauung und -religionen und Menschen anderer Herkunft. Als Leiterin der besonders engagierten und bereits mehrfach ausgezeichneten Kompetenzstelle teilte Martina Eigelsreiter gerne ihre Expertise zum Thema Rassismus mit uns.

Was kommt euch als Kompetenzstelle am meisten beim Thema „Rassismus in St. Pölten“ in den Sinn? Wo liegen die Schmerzpunkte, auch in St. Pölten? Rassismus ist strukturell – in Österreich und somit auch in St. Pölten: Er ist in unserer Gesellschaft verankert und betrifft nahezu alle Lebensbereiche. Diskriminierung lässt sich auch gut belegen. Alle, die als offensichtlich ‚nicht österreichischer Herkunft‘ eingeordnet werden, brauchen solche Belege vermutlich nicht, sondern haben zahlreiche eigene Erfahrungen. Dabei ist Rassismus historisch gewachsen – und kommt überall vor: im Alltag, in offiziellen Institutionen, in (sozialen) Medien. Wir finden Nachweise für diesen strukturellen Rassismus am Wohnungsmarkt, bei der Jobsuche, bei Opfern von Straftaten, bei der medizinischen oder psychotherapeutischen Versorgung. Rasse ist ein soziales Konstrukt. Das heißt, der Rassegedanke existiert fortwährend und bestimmt den sozialen Alltag. Auch wenn es keine (menschliche) Rasse gibt, gibt es Rassismus. Und gerade, weil es für Rasse keine wissenschaftliche Grundlage gibt, ist die Einteilung in ‚wir‘ und ‚die anderen‘ nicht konkret und objektiv definiert. Aber wir wissen alle, wer gemeint ist, wenn in einer Talk-Show über ‚Ausländer:innenkriminalität‘ diskutiert wird. Da denkt wohl niemand an weiße Brit:innen oder Schweizer:innen. Gleichzeitig nimmt man Österreicher:innen, die nicht weiß sind, immer wieder als Ausländer:in wahr. Deshalb ist die Diskussion um Auländer:innen, Herkunft und Kultur noch sehr stark mit Rassismus verknüpft. Unser gesamtes gesellschaftliches System ist von strukturellem Rassismus durchdrungen. Wir sind alle mit rassistischen Narrativen und Vorurteilen aufgewachsen. Wir haben sie verinnerlicht. Ich auch.
Daher ist es so enorm wichtig und notwendig, Rassismus sichtbar zu machen – besonders für alle, die selbst keine rassistischen Erfahrungen machen. Weiße Menschen profitieren nicht nur von rassistischen Strukturen, sondern haben auch die Möglichkeit, sich dem Thema zu entziehen und sich nicht (selbst)kritisch damit auseinanderzusetzen. Wir können nichts für bestehende rassistische Strukturen, aber es ist unsere Verantwortung, diese aktiv abzubauen, weil wir sonst reproduzieren und somit Teil des Problems sind. Deshalb reicht es nicht, nicht rassistisch zu sein. Wir müssen aktiv antirassistisch sein! Übrigens: Die Bezeichnung Weiß ist auch ein politischer Begriff. Kein Mensch ist weiß im Sinne der Farbe Weiß. Der Begriff bezieht sich auf Menschen, die Privilegien, nämlich Weiße Privilegien haben.
Was empfiehlst du Menschen, die rassistisch denken und handeln?
Auch in scheinbar harmlosen Alltagsfragen verstecken sich oft Vorurteile. Ich bin doch kein:e Rassist:in, heißt es dann oft – und die Diskussion wird abgewehrt. Aber Rassismus abzulehnen darf nicht bedeuten, dass er ignoriert oder verdrängt wird. Gerne kommt dann auch oft: „Aber, was ist denn mit...!“ Das ist sogenannter Whataboutism: Statt über das eigentliche Thema zu sprechen, wird der Vergleich mit anderen tatsächlichen oder manchmal auch nur angeblichen Missständen oder Problemen gesucht. So wird vom Ereignis abgelenkt, beziehungsweise wird so getan, als relativiere es sich. Eine besonders zynische Form dieser Taktik ist dann noch die Täter:innen-Opfer-Umkehr – also, wenn man dem Opfer ein problematisches Verhalten nachweisen oder andichten kann, um es so aussehen zu lassen, als sei das Opfer selbst schuld.
Büro für Diversität, Magistrat St. Pölten
Facebook: www.facebook.com/diversity.stp
Instagram: https://www.instagram.com/diversity.stp
TIPP vom Büro für Diversität
Der Verein ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit setzt sich für Zivilcourage, eine rassismuskritische Gesellschaft und einen respektvollen Umgang miteinander ein. In den ZARA-Beratungsstellen erhalten alle Betroffenen und Zeug:innen von Rassismus und Hass im Netz Unterstützung und (rechtliche) Beratung. Die Beratung ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Auf der Website gibt es ein Online-Formular, um Rassismus zu melden. Weiters ist dort ein aktueller Rassismus-Report zu finden.
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
Telefon: 01 929 13 99, www.zara.or.at
vernetzt, da war das abends kein Problem beim Fortgehen“, erinnert sich der heute verheiratete Familienvater, „aber in Locations weiter weg kannten mich die Leute ja nicht, und da ist das schon öfter mal vorgekommen. Für meine Freunde war dann immer klar, wenn ich nicht reindarf, gehen sie auch nicht rein. Und: Dort fahren wir auch sicher nicht mehr hin.“
Mittlerweile sind seine beiden eigenen Kinder bereits im Teenager-

AUFRÄUMEN MIT VORURTEILEN.
Johann Baumschlager von der LPD NÖ kennt die Fakten dazu.
Alter. Hier setzt David punkto Rassismus auf absolut null Toleranz: „Bei ihnen ist es etwas anderes. Bei mir selbst stört mich mal eine Bemerkung nicht so. Aber bei unseren Kindern gibt es keinen Spielraum, hier akzeptieren wir keine Form von Angriff!“ So zieht die rassistische Beleidigung einer – übrigens erwachsenen – Person seinem Sohn gegenüber aktuell rechtliche Konsequenzen nach sich. „So etwas darf man nicht einfach so passieren lassen. Das muss man sich nicht gefallen lassen“, sagt David fest, „hier muss eingeschritten werden.“
Hat er auch eine der anderen Formen von Rassismus erlebt, nämlich, indem gerade Babys und Kinder mit dunkler Haut oft wie Puppen bestaunt und sogar angetatscht werden? Tatsächlich erinnert er sich: „Unsere Tochter hatte als Baby ganz viele Locken. Es ist wirklich öfters vorgekommen, dass ihr da fremde Menschen einfach so in die Haare gefahren sind – so schnell konnten meine Frau und ich gar nicht dazwischengehen. Es ist sicher nie böse gemeint gewesen, aber…“ Aber – respektlos. Auf die Frage, was er sich im Umgang miteinander wünschen würde, jetzt und in Zukunft,
WORKING IN A WORLD OF DIFFERENCE
Wie steht unsere Polizei dem Thema Rassismus gegenüber? Wir baten Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich um eine Stellungnahme.
Ist Rassismus in St. Pölten spürbar im Sinne von Anfragen und Anzeigen?
Es gibt in St. Pölten keine Rassismusvorwürfe, weshalb ich Ihnen weder Beispiele noch Statistiken übermitteln kann.
Die Medien zeigen häufig Bilder von Polizeigewalt gegen People of Color. Wie arbeiten Sie intern hier in Niederösterreich bzw. in St. Pölten mit diesem Thema? Gibt es Sensibilisierungsmaßnahmen oder Weiterbildungen hinsichtlich interkultureller Strömungen in Stadt und Land? Polizistinnen und Polizisten werden bereits in den Grundausbildungslehrgängen zum Thema Menschenrechte geschult. Das für alle Polizei-Bedienstete nach der Grundausbildung verpflichtende mehrtägige Schulungsmodul ‚A World of Difference‘ ist außerdem ein Eckpfeiler der menschenrechtlichen Ausbildung und vermittelt Basis-Kompetenzen im professionellen Arbeiten in einer diversen, demokratischen Gesellschaft.
und vor allem für seine Kinder, rät er: „Bei Unsicherheiten und Ängsten lieber direkt aufeinander zugehen, und wenn eine:n etwas irritiert, einfach nachfragen.“ Die auch ihm wohlbekannte Frage „Wo kommst du her – also wirklich?“ findet er deshalb wenn, dann vielleicht ein wenig lästig, aber ansonsten gar nicht so schlimm: Lieber sieht er sich direkt mit solchen Fragen konfrontiert, als im Vorbeigehen mit spitzen Blicken und Fingern diskriminiert zu werden.
Nach dem Gespräch mit David suche ich nach einem gedanklichen Kuli, um das Gesagte zu unterschreiben. Gerade jetzt, wo der politische Wind wieder verstärkt in Richtung Hass und Spaltung tendiert, wären solche kleinen und großen Annäherungsschritte hilfreich für die Gemeinschaft. Die Wertschätzung von Vielfalt und ein angstfreies Miteinander sind schließlich ein Nutzen für jede Gesellschaft.
Apropos Gesellschaft, apropos Drogen
Einen offenbar omnipräsenten Punkt in dem großflächigen Thema wollen wir auch noch beleuchten: People of Color werden nach wie vor häufig mit Drogenkriminalität in Verbindung gebracht – oft „ung’schaut“, sprich: unreflektiert, spontan und in der Sekunde. Was aber sagt die Polizei auf Basis ihrer Fakten und Statistiken dazu?
Befragt wird Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Und der weist dieses Vorurteil ganz sachlich in seine Schranken: „Es ist ein Klischee, zu glauben, Drogenkriminalität sei primär ein Problem von ‚People of Color‘“, kontert er auf meine Anfrage sofort, denn: „Im Suchtmittelbericht 2024 des Bundesministeriums für Inneres waren im gesamten Bundesgebiet 13.654 fremde Tatverdächtige bei Drogenstraftaten erfasst, das war ein Anstieg von +15,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Das häufigste Herkunftsland der Tatverdächtigen in Zusammenhang mit der Suchtmittelkrimi-



nalität war dabei Syrien, gefolgt von Deutschland und Serbien.“
Zurück zu Leonora im Black Pearl, weiß auch sie einiges zu Drogen und zur Polizei in St. Pölten zu berichten: „Mein erstes Black Pearl-Lokal war leider bald Treffpunkt auch für Menschen, die gerne Mist gebaut haben“, erinnert sie sich wehmütig. „Ich hatte als Lokalbetreiberin mehr und mehr Probleme – und es war herausfordernd, die schwierigen Gäste vom Haus fernzuhalten. Im Endeffekt ist aber alles natürlich trotzdem auf mich als Wirtin zurückgefallen: Plötzlich hieß es, ich würde Drogen verkaufen – ja, ich würde sogar mit Menschen handeln! Ich meine: Wie und wo hätte ich das jemals tun sollen? Aber die Leute haben geredet.“
Eines Tages in dieser stürmischen Zeit sitzt sie eher zufällig wegen einer anderen Angelegenheit einem Polizisten auf der St. Pöltner Wache gegenüber. Hatte er eine rassistische Einstellung? Leonora schaut mich mit großen Augen an. „Was? Nein! Überhaupt nicht. Die Polizei hat mich überhaupt immer gut unterstützt. Wenn ich im damaligen Lokal Hilfe brauchte, sind die immer sofort gekommen.“
Und der Beamte auf der Wache? „Auch der wollte mir helfen. Er hat mich darauf hingewiesen, dass die Leute in der Stadt schlecht über mich reden. Dass sie sagen, mein Lokal solle geschlossen werden. Er hat mich gefragt, ob das denn wahr
Noch nie in meinem Leben habe ich Drogen verkauft!
LEONORA MARIE GOMEZ DE PAPPENBERGER
wäre. Ich wusste, er will mir nur helfen – und ich habe es ihm so gesagt wie jetzt dir: Dass ich die Gerüchte kenne. Und dass ich aber noch nie in meinem Leben Drogen verkauft habe und auch sonst keine Verbrechen begehe.“
Neue Anfänge, alte Freundschaften
Über einige glückliche Zufälle erhält sie vor drei Jahren den Zuschlag für das Lokal, in dem wir jetzt, im August 2025, einen Kaffee trinken. Die neue Black Pearl Lounge – mit Gastgarten-Zeile zur Straße hin und kleinem, feinen Separée inklusive coolem DJ-Pult – wird Ende 2023 eröffnet. Das „Pilot-Lokal“ am Mühlweg wird geschlossen. Jetzt freut sich die Wirtin mit Herz über ein stressfreies Ambiente. „Meine Gäste sind vor allem untertags oft ältere, freundliche Menschen, die in Ruhe Kartenspielen oder plaudern wollen.“ Abends finden u. a. monatliche Karaoke-Events in Kooperation mit einem Ratzersdorfer Verein statt. Oder auch mal private Feiern wie Klassentreffen und Geburtstage – „… dann koche ich groß auf!“
Ganz zum Schluss unseres Gesprächs fällt Leonora ein, doch ab
und zu auf der Straße das N-Wort zu hören, quasi im Vorbeigehen, und wenn, dann meist von älteren Leuten. „Jaaa“, grinst sie, „das höre ich natürlich. Dann gehe ich aber einfach weiter, das ignoriere ich.“ Mit ihren Gästen im Black Pearl hat sie keine rassistischen Auseinandersetzungen. „Schwarze Menschen kommen fast nicht zu mir, die meisten sind Österreicher:innen oder Latinos. Probleme hatte ich vielleicht zweimal“, sinniert sie, „und das waren religiöse Diskussionen wegen Kreuz und Marienstatue im Lokal.“ Auch das sei aber nicht weiter tragisch gewesen.
Laut Web-Recherche hat FPÖStadtrat Klaus Otzelberger letztes Jahr seinen Stammtisch in ihrem Lokal abgehalten. Wie kommt es, dass gerade von dieser Partei ... aber „Leo“ schneidet mir das Wort lachend ab. „Den Klaus“ kenne sie schließlich schon viele, viele Jahre: als Mensch und als immer höflicher, respektvoller Gast.
Nach dem Interview kommen mir im Auto auf der Mariazellerstraße ungeplant ein paar eigene alte Erinnerungen hoch. Ich habe sie an den Anfang dieses Artikels gepackt. Selbst wenn wir Angst haben, dürfen wir nicht stehenbleiben.
CHRONISCH KRANK
Die Corona-Pandemie ist aus der öffentlichen Debatte weitgehend verschwunden, doch gibt es zahlreiche Menschen in Österreich, die nach wie vor unter den Folgen einer Covid-Infektion leiden. Manche so sehr, dass wir das Interview nur via Telefon führen können, weil sie die meiste Zeit im Bett verbringen müssen.
Monika Krampl ist 75 Jahre und kämpft seit fünf Jahren mit den Folgen einer Covid-Infektion. „Von einem Tag auf den anderen hat sich mein Leben verändert. Mein Alltag ist geprägt von anhaltender und nicht erholsamer Müdigkeit, von Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, meiner geringen Belastbarkeit und körperlichen Beschwerden im Wechsel wie Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, um nur einige meiner Symptome zu nennen. Seit fünf Jahren lebe ich das Leben einer Behinderten“, so Krampl. Seit zwei Jahren könne sie außerdem nur noch mit Unterstützung eines Gehstockes gehen, am Abend fortzugehen käme nicht in Frage, dadurch seien auch die sozialen und kulturellen Kontakte weggebrochen, was zu einer sozialen Isolation führt, unter der auch viele andere Long CovidPatienten leiden. Ihr Zustand ist seit Beginn der Erkrankung unverändert, über soziale Netzwerke habe sie Kontakt mit anderen Gruppen und Einzelpersonen aufgenommen, denen es ähnlich geht und dabei festgestellt, dass nur die wenigsten Hilfe erhalten. Über die letzten fünf Jahre hat sie außerdem Tagebuch über ihr Leben geführt und will das Erlebte jetzt in Buchform veröffentlichen, um Aufmerksamkeit für die Erkrankung zu schaffen. „Ich habe Kontakt mit einigen Verlagen aufgenommen und hoffe auf eine positive Rückmeldung im September“, erzählt sie.
Die Definition von Long Covid ist grundsätzlich sehr breit und umfasst alle Symptome, die mehr als vier Wochen nach dem Beginn einer Covid-Erkrankung fortbestehen
oder neu auftreten. Eine US-Studie aus dem Vorjahr geht davon aus, dass weltweit etwa 400 Millionen Menschen davon betroffen sein könnten. Christian Neuhauser ist Facharzt für Neurologie und mit der Behandlung von Covid-Patienten schon seit dem Beginn der Pandemie vertraut. Die Probleme, mit denen viele heute zu kämpfen hätten, seien grundsätzlich nicht erst seit Corona bekannt: „Post virale Syndrome sind grundsätzlich nichts
Seit fünf Jahren lebe ich das Leben einer Behinderten!
Neues, sondern können auch nach anderen Viruserkrankungen, etwa dem Epstein-Barr-Virus, auftreten. Der Game Changer in der Pandemie war, dass es eine so große Anzahl an Menschen gibt, die gleichzeitig krank wurden. Dazu kamen bei Long Covid Besonderheiten hinzu, etwa dass die Lunge der Patienten stark angegriffen war“, so der St. Pöltner Arzt. Heute begreife man Covid als eine Multisystemerkrankung, bei der neben körperlichen auch geistige Einschränkungen vorliegen können.
Generell müsse man aber festhalten, so Neuhauser weiter, dass die Rehabilitationschancen bei den meisten Menschen mit Long CovidSymptomen sehr gut seien. „Die Erkrankung hat aus sich selbst heraus

MONIKA KRAMPL
eine deutliche Heilungstendenz. Es ist zwar keine psychosomatische Erkrankung, aber wenn Menschen sehr lange krank und körperlich am Ende sind, dann leidet irgendwann auch die Seele darunter. So ein mentaler Zusammenbruch kann auch eine der Ursachen für die Chronifizierung einer Erkrankung sein“, erklärt Neuhauser. Wichtig sei deshalb ein soziales Umfeld, das bestärke und ein gesellschaftliches Umfeld, das die Menschen ernst nehme. Neuhauser: „Ich sehe das Soziale als wesentliches Problem. Wie werden diese Menschen abgesichert und versorgt? Wir müssen aus dem Stigma herauskommen, dass es bei Long Covid nur um ein psychiatrisches Problem geht.“
Gerade bei Menschen, die dauerhaft unter den Folgen einer Infektion leiden und dadurch teils im Dauerkrankenstand sind, braucht es verbesserte Rahmenbedingungen. „In gutachterlichen Fragen werden diese Patienten deutlich diskriminiert. Dem Patienten wird kommuniziert, dass er nur ein psychiatrisches Problem hat, was Auswirkungen auf finanzielle Absicherung hat. Ich kenne Fälle bei denen Gutachten beim Ar-

Wir müssen aus dem Stigma herauskommen, dass es bei Long Covid nur um ein psychiatrisches Problem geht.
DR. CHRISTIAN NEUHAUSER
beitsgericht beeinsprucht werden, um vom selben Experten geprüft zu werden, der das Gutachten geschrieben hat – das ist empörend“, fasst Neuhauser zusammen. Hier sei auch die Politik gefordert, die für gesetzliche Anerkennung sorgen müsse, so der Arzt.
Einen Sonderfall unter den möglichen Langfolgen einer CovidInfektion stellt die sogenannte Myalgische Enzephalomyelitis/ Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/ CFS) dar, bei der Menschen unter großer körperlicher und geistiger Erschöpfung leiden – wie das etwa bei Krampl der Fall ist. Eine USStudie aus dem Jahr 2020, also noch vor Beginn der Pandemie, geht davon aus, dass etwa 0,89 Prozent der Menschen davon betroffen sind. Der genaue Zusammenhang zwischen Long Covid und ME/CFS ist noch nicht geklärt, bei den Symptomen zeigen sich aber deutliche Überlappungen – auch wenn die Rehabilitationschancen bei ME/CFS schlechter stehen. Johanna Mittermaier ist 23 Jahre alt und bekam 2023 die Diagnosen Post-Covid-Syndrom und ME/CFS. „Ich bin jetzt seit fünf Jahren krank und habe nach einigen Verschlechterungen die letzten zwei Jahre fast nur in meinem Zimmer im Bett verbracht. Selbst Dinge wie ab und zu duschen oder lange Gespräche haben mich da teils in eine schlechtere Verfassung gebracht“, erzählt sie.
Vor ihrer Erkrankung war die Niederösterreicherin sozial aktiv, hatte etliche Hobbys und gerade ein Studium in Wien begonnen. All das sei in den letzten Jahren Schritt für Schritt weggefallen. „Das Wegfallen
all dieser Dinge, die meine Identität ausgemacht haben und das Leben für mich lebenswert gemacht haben, das war wirklich schlimm. Es fühlte sich an, als wäre ich in eine tiefe Schlucht gefallen, aus der ich jeden Tag versucht habe hinauszukommen.“ Medizinisch wird Mittermaier dabei von zahlreichen Spezialisten betreut, darunter zwei Immunologen, einem Neurologen, Endokrinologen und Kardiologen. Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel stehen ebenfalls an der Tagesordnung. „Meine sozialen Kontakte sind eingeschränkt, meine engsten Freunde sehe ich etwa alle zwei Monate und mein Freund kommt meist einmal die Woche. Dabei achten wir wegen meines Immundefekts auf Infektionsschutz. Ich habe einen Rollstuhl, der mir ermöglicht, dass ich auf Spaziergängen geschoben werden kann und hatte diverse Therapieversuche – einige mit enttäuschendem Ergebnis, aber manche haben auch geholfen“, so Mittermaier.
Derzeit hat die junge Niederösterreicherin wieder eine bessere Phase, kann kleinere Dinge erledigen und konnte heuer sogar ihren Geburtstag mehr feiern, auch wenn sie sich die Kraft für solch größere Aktivitäten über längere Zeit „zusammensparen“ und danach meist Konsequenzen tragen müsse. Im Zuge ihrer Erkrankung hat Mittermaier begonnen Lieder zu schreiben „um mit der Trauer und Verzweiflung umzugehen und mir Hoffnung zuzusprechen. Mein Ziel ist es, jetzt langsam andere daran teilhaben zu lassen. Vielleicht gibt es ja mehr Leute, denen solche Lieder gut tun“.
Es fühlte sich an, als wäre ich in eine tiefe Schlucht gefallen, aus der ich jeden Tag versucht habe hinauszukommen.
JOHANNA MITTERMAIER
LEBEN, REISEN UND WIRTSCHAFTEN MIT WEITBLICK
Der Lebensart Verlag mit Sitz in der St. Pöltner
Innenstadt steht seit 20 Jahren für Nachhaltigkeit und lösungsorientierten Journalismus — mit den Magazinen LEBENSART, LEBENSART REISEN UND BUSINESSART.
Im Frühjahr 2005 entwickelten
Christian Brandstätter und Roswitha Reisinger für die beiden Organisationen, für die sie damals tätig waren, das Konzept für ein nachhaltiges Magazin. Das Urteil des Wirtschaftsgutachters der Organisationen fiel vernichtend aus: „Das ist hinausgeschmissenes Geld“ – denn Nachhaltigkeit war am Werbemarkt kein Thema.
Das Ehepaar BrandstätterReisinger war trotzdem überzeugt: „Die Zeit war reif für ein Magazin, das über ein gutes Leben für alle informiert.“ Mental bekräftigt von Roswithas ehemaligem Chef, einem Unternehmensberater („Familienunternehmen sind seit Jahrtausenden ein Erfolgsrezept“) und unterstützt von Partnern, die an das Konzept geglaubt haben, gründeten Christian Brandstätter und Roswitha Reisinger gemeinsam mit zwei Freunden den Lebensart Verlag.
Mitte September 2005 erschien die erste Ausgabe der LEBENSART, mit Berichten über nachhaltige Lebenskultur.
Die Lebensart „Nachhaltig zu leben, das ist für uns Lebensfreude, Respekt, Fairness und Diskurs“, sagt Roswitha Reisinger.
Nicht Verzicht oder Verbote sind das Thema, sondern das Verbinden von scheinbaren Gegensätzen. „Wir sind auch nach 20 Jahren noch überzeugt, dass es möglich ist, Genuss und Verantwortung, Individualität und Gemeinschaft, Leistungsorientierung und Toleranz, Stabilität und Wandel zusammenzubringen.“
Selbstverständlich müsse auch die Berichterstattung der Nachhaltigkeit entsprechen. „Unsere Information soll die Leser und Leserinnen mündig machen. Daher berichten wir über Probleme niemals skandalisierend oder auf Klicks schielend. Wir zeigen Lösungswege auf – das ist für uns lösungsorientierter Journalismus“, so Reisinger.
Selbstverständlich finanzieren sich auch die Magazine des Lebensart Verlags durch Werbeeinschaltungen. Was aber bedeutet es, nachhaltig zu werben? „Bei uns darf kein Unternehmen werben, das den Richtlinien der Nachhaltigkeit widerspricht“, betont Christian Brandstätter und gesteht: „Es tut schon wirtschaftlich weh, Werbung ablehnen zu müssen.“ Ein Blick auf einen der Erfolgsparameter des Unternehmens bestärkt den Verleger: „Unsere Glaubwürdigkeit ist enorm, sie ist unser großes Kapital.“
Die Zeit war reif für ein Magazin, das über ein gutes Leben für alle informiert.

Die Businessart
Glaubwürdigkeit und Authentizität der beiden Protagonisten sind zwei Konstanten für die gelungene Entwicklung der LebensartMedien. „Das Rollenverständnis ist wichtig“, weiß Roswitha Reisinger, „wir sind ein Ehepaar und beide Geschäftsführer – diese Rollen darf man nie vermischen. Natürlich sind wir manchmal unterschiedlicher Meinung, aber das hat sich nie negativ ausgewirkt.“ Jeder habe seinen Bereich, in dem er werkt. Er verkauft, sie ist besser im Entwickeln von Dingen, er bringt die Innovation auf den Boden. „Ich habe mir nie vorstellen können, Unternehmerin zu sein. Dabei ist das das Beste für mich. Ich konnte mich in dem Job
verwirklichen. Ohne Christian hätte ich das allerdings nicht geschafft“, ist die ehemalige Umwelt und Unternehmensberaterin überzeugt. „Wie funktionieren Unternehmen –das ist meine große Leidenschaft.“ Die den Lebensart Verlag 2009 vor
BusinessNewsletter begonnen, mit wichtigen Nachhaltigkeitsnews für Organisationen und Unternehmen. Dieser war so erfolgreich, dass daraus das Magazin BUSINESSART entstanden ist – ein Printmagazin trotz des Trends zu OnlineMedien.

den Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise 2008 bewahrt hat. „Ich wollte zeigen, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehen, wenn Manager und Unternehmerinnen das wollen. Daraus ist die Idee zur Auszeichnung ‚Nachhaltige Gestalter*innen Österreichs‘ entstanden.“ Über 300 kreative Köpfe sind in den vergangenen Jahren schon vor den Vorhang geholt worden. Sie alle bieten Lösungen in den Bereichen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Kommunikation, Gesundheit, Wirtschaftssystem, Vernetzung und Kultur. 2009 hat Roswitha Reisinger auch mit einem
„Die inhaltliche Teilung hat uns großes Renommee gebracht“, bestätigt die Herausgeberin und Chefredakteurin, „vorher waren wir als lieb und nett bekannt, dazu ist das Standing gekommen: ‚Die kennen sich ja aus.‘“
Lebensart Reisen
Seit 2010 widmet sich der Lebensart Verlag noch einem weiteren Themenbereich – dem Reisen. „Immer mehr Menschen nutzten das Internet, um sich über Urlaubsziele zu informieren. Wir launchten LEBENSART REISEN, das Portal für nachhaltiges Reisen und sanften
Tourismus“, erzählt Christian Brandstätter. Als Vorreiter, denn erst seit 2017, seit die UNO den Tag des nachhaltigen Tourismus ausgerufen hat, reagiert die Branche. „Österreich ist gut aufgestellt, in den meisten Tourismusverbänden gibt es Nachhaltigkeitsbeauftragte.“ Seit 2024 erscheint das Magazin LEBENSART REISEN.
Und wie ist das mit dem ökologischen Fußabdruck, zum Beispiel beim Fliegen? „Die Begegnung mit anderen Kulturen muss möglich sein, bringt neben Erholung und Aktivität auch einen Blick über den eigenen Horizont hinaus“, lädt Brandstätter dazu ein, für sich selbst passende Ideen für ein nachhaltiges Leben zu entwickeln – der EinTagesflug zum Shoppen nach London gehört definitiv nicht dazu.
In 20 Jahren Lebensart Verlag gab es nur ein Produkt, das nicht mehr existiert. „Die LEBENSART für MigrantInnen ist nicht gelungen“, bedauert Roswitha Reisinger. „Wir hatten viele Ideen und sind dafür sogar ausgezeichnet worden. Aber die Finanzierung des regionalen Projekts war unmöglich.“
Die Zukunft
Warum aber hat sich ein Verlag mit österreichweiten Magazinen in St. Pölten angesiedelt? „Wir wohnen in St. Pölten, genießen die gute Lebensqualität, mit dem großen Kulturangebot und der Nähe zu den Seen, zu den Bergen, zur Donau. Wir wollten nicht nach Wien pendeln, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen“, sagen die Gründer, die nach 20 Jahren die Übergabe an die nächste Generation geschafft haben. Michaela Reisinger ist jetzt inhaltliche Geschäftsführerin des Verlags sowie Herausgeberin und Chefredakteurin der LEBENSART, Florian Leregger ist kaufmännischer Geschäftsführer. Roswitha Reisinger hat im September die Chefredaktion der BUSINESSART an Martina Madner übergeben. Und Christian Brandstätter widmet noch einige Jahre seinem liebsten Medium, der LEBENSART REISEN.
DAS LEBENSART-TEAM. Martina Madner, Roswitha Reisinger, Florian Leregger, Michaela Reisinger, Christian Brandstätter und Sylvia Resel vom Kundenservice feierten den 20. Geburtstag des Verlags. www.lebensart.at
KOLUMNE THOMAS FRÖHLICH

SOMMERSNEIGE
Sommersneige. Wer – wie der Schreiber dieser Zeilen – sein Leben nicht nach Jahren, sondern nach Sommerzeiten bemisst, tut sich heuer schwer. Ein durchwachsener Sommer tritt ab – kulturell dürfen wir auf Höhen und Tiefen zurückblicken. In Wagram etwa gab’s wieder den famosen Sommer Theater Park, unter anderem mit hervorragenden Darbietungen des Europa-Balletts und einer furiosen Abschluss-Gala mit Natalia Ushakova, einem Gesangs-Vulkan, der auch Nicht-Opernfreunde mitreißt. Dass Wagram gastronomisch allerdings eher bescheiden aufgestellt ist, wurde leider wieder einmal unter Beweis gestellt, als das nahe gelegene Restaurant nach besagter Gala nur Plätze für Künstler (einzusehen!) und Politiker (hüstel!) anbot – das (zahlende) Fußvolk durfte sich mit einer Bierdose in den Park setzen oder gleich heimgehen.
Apropos Gastronomie – hier die ganz schlechte Nachricht: Das „Underground“ steht vor dem Aus. Was schon einige Zeit in der Gerüchteküche brodelte, hat sich bewahrheitet: Walter Göbel, Schrittmacher und „Papa“ der heimischen „Schwarzen Szene“ (und darüber hinaus) muss seine mit Herzblut gehegte Lokalität schließen. Ein Fixpunkt für Nachtschwärmer, in dem Musik kein Beiwerk, sondern eine Haltung darstellt („Mei Religion!“, so Walter), verglüht. Doch hat sich eine Crowdfunding-Gruppe (unter https://gofund. me/99631d8dc) gegründet, die eine Wiedereröffnung anstrebt. Wir wünschen innigst hohe Spendenfreudigkeit und gutes Gelingen!
„Und die Sonne versinkt am Hügel / Schon winkt zur Sternenreise die Nacht“ schreibt Georg Trakl in „Sommersneige“. Es herbstelt.
BLOW YOUR MIND!

Magie boomt – wie lange nicht mehr. Während die Oldies schon bei Bobby Lugano im Kinderfernsehen in Ekstase gerieten, wenn er – assistiert von seinem Hund Strolchi – mit einer einzigen Prise „Zaubersalz“ ein Kaninchen aus dem Hut hervorzaubert, geht es die junge Garde bedeutend energiegeladener, spritziger und origineller an. Egal ob es sich nun um Local Heroes wie „Queen Of Hearts & der Eduard“ oder Weltstars wie Thommy Ten
& Amélie van Tass handelt. Nun kommt der nächste Rising Star nach St. Pölten: Mellow, der deutsche Meister der Zauberkunst, gastiert am 7. November im VAZ mit seiner atemberaubenden Show „Blow Your Mind“. In deren Zuge erweckt er Polaroid-Fotos zum Leben, bringt Metall zum Schmelzen, lässt Glühwürmchen durch den Raum fliegen oder schwebt in einer Seifenblase davon. Was ist echt, was ist Illusion? So oder so, ein Riesenspaß!
FEST³
Großkampftag im positiven Sinne am 20. September in der St. Pöltner Innenstadt – dann gehen nämlich gleich drei Feste vonstatten und ineinander über: Beim mittlerweile 26. Höfefest öffnen sich wieder die oftmals versteckten Innenhof-Kleinode der City für Kunst und Kultur. Das LinzerStraßenFest erfährt eine Fortsetzung und quasi einmal Um-, eigentlich Hineinfallen weiter feiert der Löwinnenhof* hochoffiziell seine Eröffnung. Höfefestorganisatorin Patrizia Liberti streicht die Besonderheit ihres Festes hervor. „Das Höfefest ist das einzige Festival dieser Art und Größe in St. Pölten und Umgebung, das Kunst und Kultur frei zugänglich anbietet – und das soll auch so bleiben.“ www.hoefefest.at

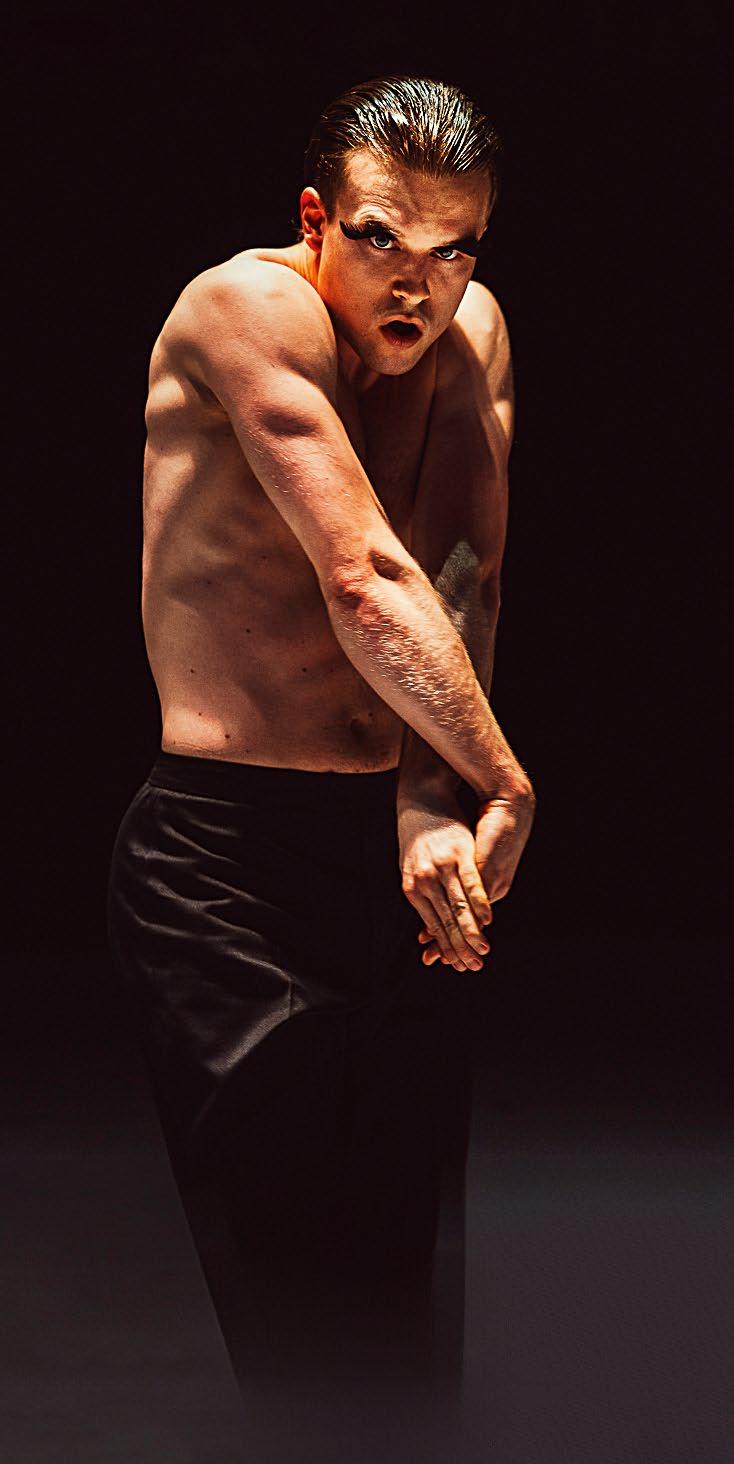
LET‘S START!
HAND IN HAND
26/27 SEP 2025
MARCOS MORAU . BALLET
NACIONAL DE ESPAÑA:
Afanador
... Saisoneröffnung mit surreal schön getanzten Bilderwelten aus Andalusien
03 OKT 2025
TOMATITO Y GRUPO
... Flamenco Nuevo at its best
11 OKT 2025
PINA BAUSCH .
MERYL TANKARD: Kontakthof – Echoes of ´78 ... das Meisterwerk der Tanz-Ikone in der Originalbesetzung von 1978
16 OKT 2025
KINGA GŁYK
... die junge Jazz-Bassistin präsentiert ihr Soloalbum Real Life

Bühne, Hof & Straße frei! Beim Höfefest sind 30 Konzerte zu erleben und das LinzerStraßenFest feiert die künstlerische Vielfalt der Stadt. In der Bühne im Hof gehts mit den beiden Nachwuchsstars Romeo Kaltenbrunner und Katie La Folle voi klass her (Sa., 20.09.). Ein Mann, fünf Gitarren und ein magischer Klangkosmos zwischen Paco de Lucia und Jimi Hendrix: Vorhang auf für Mario Berger und seine „Guitarras Magicas“ (Fr., 26.09.). „Auf dem roten Stuhl“ nimmt Herbert Prohaska Platz: Das Schneckerl der Nation erzählt aus seinem Leben und greift auch mal zum Mikro (Sa., 27.09.).

Selten so gelacht hat man mit den „Rouladen“ von Christoph Grissemann & Robert Stachel (Mi., 08.10.). Möchte man dann noch etwas Kernöl drauf, empfehlen sich die beiden Amazonen Caroline Athanasiadis & Gudrun Nikodem-Eichenhardt (Do., 09.10.). Das (fast schon) traditionelle Zirkusfest garantiert beste Unterhaltung für Groß und Klein (Do., 16. - So., 19.10.), Roland Düringer praktiziert die hohe Kunst des Geschichtenerzählens (Do., 23.10.) und die Poxrucker Sisters kumman so jung nimma zaum (Sa., 25.10.).
Herbert Prohaska © Bernhard Egger
Zirkusfest © Maze Zimer
LINDA PARTAJ
DAS INNERSTE NACH AUSSEN STÜLPEN
SEELENSUCHE. Linda Partaj blickt mit ihren Großformaten tief in die menschliche Seele.
Ihre neuen, teils noch nie gezeigten, großformatigen Malereien werden nun über eine Woche lang in einer großen Einzelausstellung im Kesselhaus der Glanzstoff zu betrachten sein. Dabei wird sich dieser einzigartige Raum, lavierend zwischen ehemals augenscheinlicher, industrieller Großartigkeit und seines, aufgrund der ursprünglichen Bestimmung enthobenen Verfalles, als perfekte Bühne für die aktuellen, größtenteils in diesem Jahr entstandenen Exponate, zeigen. „Die Idee ist, die Bilder in die bestehende Infrastruktur, in den Raum einzubetten, etwa mehrere Formate in unterschiedlichen Höhen zu hängen. Geplant ist auch eine mittig platzierte große Installation, die wie ein Kartenhaus, Bild an Bild, ohne Stellwände, funktionieren soll. Die Bilder werden sich gegenseitig halten“, erzählt die Künstlerin, „die Halle gefällt mir, sie hat Charme und Stimmung, sie transportiert Dinge, die mich in meiner Kunst beschäftigen, sehr eindringlich mit.“
Ausgangspunkt der großen Einzelschau ist dabei eine vierteilige Werkserie „Die Seele meiner Zeit“, ihr im März begonnener Malereizyklus. Schon der Titel lässt Rückschlüsse auf die Arbeitsweise, das Kunstschaffen der 33-jährigen Künstlerin zu. Linda Partaj ist tief ergriffen von der Psyche des Menschen, ihr liegt die Bereitschaft, Menschen zu lesen, zu reflektieren, in ihrer künstlerischen DNA. „Mich interessieren das Verhalten, die Charakterzüge eines Menschen, wie er auftritt, wie er sich verhält, was er vermittelt, sehr. Das sind Inspirationen für meine Bilder“, so die freischaffende Künstlerin. Obwohl ihre Werke auf den ersten Blick der figür-

Fasziniert von der Psyche der Menschen, begibt sich die St. Pöltner Künstlerin Linda Partaj bei ihren, an die figürliche Gestalt gebundenen Arbeiten auf eine fortwährende, analytische Seelenreise in das Innerste humaner Gedanken und Verhaltensweisen.
lichen Gestalt verpflichtet sind, wird im Zuge der Betrachtung schnell erkennbar, dass es ihr nicht um das bloße, äußere Erscheinungsbild geht, sondern um den analytischen Blick auf die komplexe menschliche Seele, die Gefühlswelt. Der Körper wird zur Projektionsfläche für Emotionen.
Sensibler und subtiler Blick Ihre Vorgangsweise ist die einer sensiblen und sehr subtilen Beobachte-
rin. „Inspirationen hole ich mir von Menschen, denen ich begegne und Geschichten, welche sie erzählen. Persönliche Erlebnisse prägen den Menschen und sein Auftreten. Haltung, Blicke, Posen, Farben, Kompositionen, ... fange ich mit Skizzen oder Fotos ein und verwende Ausschnitte daraus“, erklärt Linda Partaj den Beginn ihrer künstlerischen Arbeit. Das Festgehaltene dieses Augenblickes wird fragmentiert, aufge-
löst, überlagert und entwickelt sich zu etwas Neuem. Partaj ist fasziniert von der Wucht, die jeder Mensch in sich trägt. Nicht um das Spezifische, sondern um die Symbolkraft des ganzen Mensch-Seins, geht es dem St. Pöltner Künstlerbund-Mitglied. Die Endlichkeit des Lebens, der Gedanke der Vanitas, ist ihr dabei nicht fremd, aber auch die Verletzlichkeit der Menschen, ihr fragiles Sein und die Sensibilität versucht sie, in ihren Bildern, sichtbar zu machen. Es steckt viel Liebe, aber auch viel kritische Verarbeitung und ihre eigene Gefühlswelt in ihren aktuellen Werken. Schön wäre es für die Künstlerin, wenn „die Nachdenklichkeit, die meinen Bildern eingeschrieben ist, reflektiert wird, wenn stärkere Empathie entsteht, über Themen intensiv nachgedacht wird.“
Warum sie sich aktuell den Großformaten zugewandt hat? „Ich wollte mich herausfordern, gerade für die Abschlussarbeit an der Akademie. Es hat mich gereizt, das Großformat für mich zu entdecken, mich der Frage zu stellen: Kann ich es bewältigen?“
Nach außen stülpen
Die Antwort findet sich in den 200x150 cm großen Ölgemälden, die mit faszinierenden, harmonischen Kompositionen und einem famosen durchscheinenden Farbauftrag glänzen. Ja, es ist ihr gelungen, die Auseinandersetzung mit dem Großformat. Lasierende Schichten übereinander stellen Schnittstellen zwischen Körpern dar, stellenweise, durchsichtige Farben durchstoßen schnell die Außenhaut und machen das Innere sichtbar, Körperteile werden subtil in Farbfelder zerlegt. Dabei verwendet Partaj eine erdige, der Natur entnommene Farbpalette. Frida Kahlo trifft auf Francis Bacon könnte man meinen. Zuerst fertigt die Künstlerin kleine, mono-

INFO
Eröffnung am Donnerstag, 25. September: Beginn Vernissage um 18 Uhr im Kesselhaus der Glanzstoff, Herzogenburgerstraße 69, St. Pölten.
Abschluss am 4. Oktober ab 19 Uhr mit einer Finissage und einem Live-Konzert der Band „Gravögl“ (Konzertbeginn ca. 20 Uhr) – danach gibt es ein VinylSet von DJ Robert Trömer.
Die Ausstellung ist von 25. September bis zum 4. Oktober zu sehen. Infos zur Ausstellung und Kontaktaufnahme über www.lindapartaj.at
chrome Skizzen an, mit denen sie Kompositorisches auf ihre Tragfähigkeit überprüft. „Aber manchmal funktioniert etwas in der grafischen Skizze, aber malerisch dann nicht, oder auch umgekehrt. Auf der Leinwand entwickelt sich da vieles zu etwas anderem“, gibt sie Einblick in ihre Arbeitsweise. Die Grafik findet sie aber durchaus auch als eigenständiges, starkes Ausdrucksmittel.
Inspiriert wird Linda Partaj, wie sie selbst erzählt, auch „von Textpassagen aus Liedern.“ Auch Literatur, etwa von Hesse, Kafka oder Seethaler, hat in ihren Werken Einzug gehalten. Jedes Bild hat einen besonderen Titel, der aber nicht erklärend ist, sondern eine neue künstlerische Ebene eröffnet.
Schon als Kind war das ständige „Kritzeln“ allgegenwärtig, kein Wunder, wuchs sie doch in einem durch und durch inspirierenden Umfeld – Papa Hari selbst bildender Künstler und BE-Professor und Mama Hanna begnadete Fotokünstlerin – auf. „Ich bin voll reingewachsen in diese Welt, umgeben von künstlerischen Ausdrucksformen, besonders präsent war die bildende und angewandte Kunst, sowie Musik. Meine Eltern waren ein großes Vorbild, wir haben viel geredet, reflektiert und ich habe sehr von ihnen gelernt“, weiß Linda um die Bedeutung von Rückhalt, der sie, neben ihrer intensiven Arbeit an ihrer Kunst, nun zu einem Punkt als ernstzunehmende Künstlerin, deren Wirkung sich in Zukunft nicht nur auf lokaler und nationaler Ebene beschränken wird, gebracht hat.
Mich beschäftigt die Endlichkeit des Lebens und ich bin fasziniert von der menschlichen Psyche mit ihrer Verletzlichkeit und Sensibilität.
LINDA PARTAJ
BÜHNE FREI FÜR DEN KULTURHERBST
Der Sommer mag vorbei sein, doch das laufende Jahr hat noch immer viel zu bieten. Von großen Open-AirKonzerten über Literatur- und Lesefestivals bis zu Klassik-Highlights, einem Festival für Sakralmusik und offenen, kunsterfüllten Höfen reichen im Herbst die zahlreichen Kulturevents in der Stadt.

Von Punk Cabaret und Indie-Rock bis zu Elektro-Exzess reicht das Programm des Konzertes mit der wohl spektakulärsten Kulisse der Stadt. Beim Pop am Dom krönen The Dresden Dolls das Lineup – mit expressiver Wucht und theatralischem Furor. Jehnny Beth bringt düsteren Art-Rock und elektronische Energie auf die Bühne, Dry Cleaning liefern britischen Post-Punk mit feiner Sprachakrobatik – und die St. Pöltner Laundromat Chicks sorgen mit hymnischen Indie-Songs für einen fulminanten Auftakt.
HÖFE- UND LINZERSTRASSENFEST

Die Höfe der Innenstadt öffnen im September wieder ihre Tore und warten mit zahlreichen Unterhaltungen auf. Zudem gibt es abwechslungsreiche Mitmachaktionen beim zweiten LinzerStraßenFest, das wieder gleichzeitig veranstaltet wird, und auch die Eröffnung des neuen Kulturzentrums Löwinnenhof* verspricht Vielfalt pur. Über 30 Konzerte bringen die Innenstadt zum Klingen. Von 14 bis 23 Uhr heißt es daher: Mitschwingen, Austauschen, Tanzen und einfach Dabeisein.
13. SEPTEMBER

20. SEPTEMBER

21. SEPTEMBER BIS 12. OKTOBER

Das Festival für Sakralmusik holt Künstler aus sechs Nationen – von Armenien über Tschechien bis Deutschland – für sieben Konzerte und drei musikalische Gottesdienste nach St. Pölten, Herzogenburg und Lilienfeld. Das erste Konzert im Dom hält eine Überraschung bereit. Die Philharmonie aus Brünn eröffnet gemeinsam mit dem Kammerchor Stuttgart und der Domkantorei den Konzertreigen. Weiters warten das Naghash Ensemble, das Vokalensemble Amarcord oder die Regensburger Domspatzen.

MUSICA SACRA
BLÄTTERWIRBEL

KIJUBU-FESTIVAL

MEISTERKONZERTE

1. BIS 31. OKTOBER
Der Herbst lässt die Blätter in St. Pölten wirbeln. Am Mittwoch, dem 1. Oktober eröffnet der Salzburger Essayist und Kritiker KarlMarkus Gauss um 19 Uhr das Literaturfestival im Stadtmuseum. Seine Texte feiern das Glück, lehren das Staunen und erzählen von besonderen Orten und Menschen in Europa. Bis 31. Oktober warten zahlreiche Höhepunkte, wie Lesungen von Wolf Haas, Vea Kaiser sowie Präsentationen von Etcetera, Ungebunden, Die Brache und vielen mehr.

4. BIS 9. NOVEMBER
Das 22. Internationale Kinder- und Jugendbuchfestival (KIJUBU) bietet vom Gruselspaß und Krimis bis zum Tonstudioworkshop, vom Theater über Lesungen bis zum Bilderbuchkino vielfältige Veranstaltungen für junge Menschen im Alter von drei bis 18 Jahren rund um das Thema Lesen. Durch die vielen Standorte verwandeln sich der Kulturbezirk und die City der Landeshauptstadt in ein Wimmelbuch. Für das Familienprogramm des Festivals ist keine Anmeldung erforderlich.

AB 12. NOVEMBER
Die Klassik-Musikreihe feiert ihr 30-jähriges Jubiläum mit Robert Lehrbaumer als künstlerischem Leiter. Zu diesem Anlass stehen ab 12. November wieder hochkarätige Konzerte mit einer Mischung aus Klassik, Schlager, Pop und Jazz auf dem Programm. Den Auftakt übernimmt der Intendant gemeinsam mit internationalen Solist:innen selbst bei einem „Tribute to Johann Strauß“-Konzert. Zu Weihnachten wartet mit einem Auftritt des Song-Contest-Gewinners JJ ein stimmungsvoller Abend in der Josefskirche.
VERANSTALTUNGSTIPPS
Landestheater
12. September
Die eingebildete Kranke –Premiere
27. September
Das Schloss – Premiere
19. September
Das NEINhorn – Premiere
Festspielhaus
26. & 27. September
Marcos Morau.
Ballet Nacional de España
16. Oktober
Kinga Głyk
22. November
Ballett Zürich. Cathy Marston & Tonkünstler-Orchester
Freiraum
26. & 27. September STP Metalweekend
24. Oktober
My Ugly Clementine
8. November Nucleus Mind Abschiedskonzert

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter events.st-poelten.at
3. & 4. Oktober Beislfest St. Pölten
4. Oktober Lange Nacht der Museen Europaballett ab 10. Oktober Schwanensee
www.facebook.com/stpoelten www.instagram.com/st.poelten

donhofer.
DER REISELEITER
In seinem 79. Jahr erhielt der St. Pöltner Künstlerbund eine neue Leitung: Der gebürtige St. Pöltner donhofer. (sic!) übernahm den Obmannsessel. Als Komfortzone sieht er diesen nicht: ganz im Gegenteil!
Aktionskünstler und Maler donhofer. polarisiert. Mit seinen Performances schaffte er sich bis dato nicht nur Freunde, ob er nun anlässlich des Wiener Burgtheater-Skandals vor selbigem „Gras drüber wachsen“ ließ, in St. Pölten – als Kommentar zur krisenhaften Situation von Künstlern – „Wir leben noch. Die Künstler*innen“ plakatierte oder in Erfurt in roten Holzlettern das Wort „Demokratie“ aufstellte und anschließend zersägte, um auf die Fragilität besagter Staats- und Gesellschaftsform
Scheitern ist nichts Schlechtes –daran wächst man. donhofer.
hinzuweisen. donhofer. (auf die Schreibweise legt er Wert, genauso wie auf die Farbe Rot in Werk und Auftritten) ist keiner, der die große Geste scheut. Für den ehemaligen Werbe- und Marketingfachmann ist mediale Präsenz immer Teil sei-
ner Kunst. Soeben aus New York zurück ist er maßgeblicher Teil der aktuellen Künstlerbund-Vernissage unter seiner Obmannschaft: „Blue Moods“, eine Beschäftigung mit der Farbe Blau und ihrer assoziativen Kraft, die sowohl in St. Pölten wie auch in Baden bei Wien präsentiert wird.
Warum er überhaupt die Position beim Künstlerbund annehmen wollte? „Ich hebe einen Goldschatz“, meint donhofer. begeistert: „Nächstes Jahr wird der Künstlerbund 80. Es ist eine Perle im Dorn-
röschenschlaf.“ Nun darf man zum „Dornröschenschlaf“ geteilter Meinung sein, aber dass donhofer. jede Menge vorhat, ist evident: „‘Meet the artist‘ etwa – also Studio- und Atelierbesuche, bei denen die Besucher Teil der Kunst werden. Zudem möchte ich den St. Pöltnern auch das Kunstsammeln nahebringen – etwa: wie gehe ich eine Kunstsammlung an. Und dann werde ich auch den Austausch zwischen den Künstlern selbst intensivieren – das kann unglaublich inspirierend sein – für alle Seiten!“ Und er ergänzt: „Bei unserer ersten gemeinsamen Ausstellung ‚Voyage‘ hab‘ ich diese unglaubliche Energie gespürt. Wohin die Reise geht …?“ Auf jeden Fall hat „Reiseleiter“ donhofer. einige Ziele im Hinterkopf. Denn der Künstlerbund befinde sich auf internationalem Niveau, was vielleicht in der Vergangenheit zu wenig gesehen worden sei. Und er gräbt, wie man auch auf den Fotos unschwer erkennen kann, so Manches um.
Wobei es ja nicht so ist, als wäre davor wenig geschehen. Gegründet 1946 vom Maler Adolf Peschek (nach dem auch jetzt noch der anlässlich der jeweiligen Jahresausstellungen vergebene AdolfPeschek-Preis benannt ist) war die Ausrichtung des St. Pöltner Künstlerbundes von Anfang an nicht ausschließlich lokal sondern sollte weit über die Stadt hinausstrahlen – bis heute ist ein Gutteil der aktiven Mitglieder (derzeit 32, darunter klingende Namen wie J. Friedrich Sochurek, Eva Bakalar, Mark Rossell, Hermann Fischl, Kurt Schönthaler oder Margareta Weichhart-Antony) nicht in St. Pölten beheimatet. War der Künstlerbund anfänglich eher traditioneller Kunstauffassung zugeneigt, bemühte sich ab 1973 Friedrich Martin Seitz als Obmann um einen Ausgleich zwischen den divergierenden Richtungen (also Tradition und Moderne). Sein Nachfolger wurde 2006 Ernest A. Kienzl, der seit den 1970er-Jahren Mitglied war, an der Hochschule für Angewandte Kunst studiert hatte und den Brotberuf des Bildnerischen

Erziehers am Gymnasium der Englischen Fräulein ausübte. Nicht zuletzt aufgrund seiner langjährigen Mitgliedschaft sorgte er für die nötige Kontinuität, verstärkte aber gleichzeitig die junge, mehr experimentelle Ausrichtung – und das mit einem hohen Qualitätsanspruch. Nach ihm kam das prononciert woke, ansonsten eher glücklose Duo Mars & Blum, dem offensichtlich seitens der Mitglieder wie auch des Publikums nicht der Zuspruch gezollt wurde, den es sich wahrscheinlich erwartete – das kunstaffine St. Pöltner Basecamp konnte offenbar mit ihnen nicht gar so viel anfangen. Und nun also donhofer., der das unter Kienzl-Ägide zum vereinseigenen Ausstellungsraum „eingemeindete“ KUNST:WERK bespielen darf und das mit Verve auch tut. „Ich kann durch die Obmannschaft sehr viel lernen und an den Dingen wachsen.“ Wie er seine Zeit einteilt? „Meine Werbeagentur habe ich 2016 geschlossen.“ Doch hat er vielleicht durch diese seine ehemalige Tätigkeit gelernt, mit der Zeit hauszuhalten. „Ich mache viel – bin aber grad einmal bei 70 Prozent. Ich hab‘ Power – und wenn man etwas mit Freude macht, dann hilft das. Ich mach‘ im Grunde das, was mir Spaß macht.“ Zudem: „Ich komm‘ grad aus New York zurück – der
Mit dem Künstlerbund hebe ich einen Goldschatz. donhofer.

Herzschlag dort geht in eine andere Temperatur. Da wird nicht lange herumgeredet – da werden Dinge umgesetzt.“ Keine Frage: Das gefällt donhofer., genauso wie sein Kunstanspruch einer ist, der mit dem Aufzeigen von Dingen, die schiefgehen, Hand in Hand geht – Kunst kann und soll provozieren: „Kunst muss anecken, Kunst muss dagegen sein.“ Doch wolle er seine Haltung nicht Anderen überstülpen: „Auch rein ästhetische Positionen haben ihre Berechtigung.“ Es sollte halt nicht aalglatt sein und stattdessen Emotionen auslösen – „im besten Fall eine Reaktion!“ Mögliches Scheitern darf durchaus einkalkuliert werden. Da irritiert es allerdings doppelt, wenn die „Blue Moods“Aussendung des Künstlerbundes in ein von so Manchen als recht plump empfundenes, der Eröffnungsrede donhofer.s entnommenes Freiheitlichen-Bashing mündet. Aber offenbar gehören gebetsmühlenartig vorgetragene Statements gegen ein diffuses „rechts“ derzeit zum guten Ton nahezu aller Kunstveranstaltungen. Schade. Es bleibt spannend.
KOLUMNE THOMAS WINKELMÜLLER

PRÜGEL UND PREDIGT
Letzte Woche war nicht ganz ohne für mich. Eigentlich bin ich ja ein notorischer Langschläfer, ausnahmsweise aber läutete mein Wecker am 4. September um Punkt sieben Uhr. Ich wollte das Ö1 Morgenjournal diesmal live hören. Denn gemeinsam mit meiner Kollegin Christine Baumgartner vom ORF habe ich eine – man kann es nicht anders sagen – entsetzliche Geschichte auf den Boden gebracht. Vielleicht haben Sie etwas davon mitgekommen.
Es geht darin um Markus Streinz. Der 37-jährige Oberösterreicher ist Lebenscoach und hat eine sektenartige Gemeinschaft um sich gebaut. Dort predigt er Gewalt an Frauen als den besten Weg zu deren Heilung und persönlichen Transformation. Streinz behauptet, wenn er Frauen würgt, schlägt oder gewaltvoll mit ihnen schläft, geschehe das immer im Einvernehmen. Meine Recherchen in DATUM zeigen etwas anderes: Streinz scheint sich eine menschenverachtende Glaubenswelt aufgebaut zu haben, in der seine Anhänger und er Frauen systematisch Gewalt antun. Bei aller journalistischen Distanz hat auch mir diese Recherche einiges abverlangt. Und sie lässt mich unbefriedigt zurück. Wir haben kaum eine Handhabe gegen sektenartige Gemeinschaften. Manipulation ist nicht strafbar. Wir haben uns als Gesellschaft dazu entschieden, Freiheit so groß zu schreiben, dass manche Menschen dadurch unter die Räder geraten. Klar, das bringt viele Vorteile für uns alle. Und Freiheit einschränken? Wer will das schon? Aber auch Menschen wie Markus Streinz wissen das. Und sie nutzen es unverschämt aus.
BANANA!

Was es mit der Banane auch immer auf sich haben mag, an Wortwitz macht man dem jungen Verein Bad Banana Boardgames so schnell nichts vor. Wer dahinter steckt verrät Mitglied Johannes Forstreiter augenzwinkernd so: „Wir sind ein bunter Haufen begeisterter Brettspielerinnen mit einer besonderen Vorliebe für gelbe, tropische Früchte – aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit.“ Die ganze ist, dass man sich jeden dritten Mittwoch im Monat im BarRock zum gemeinsamen Spielen trifft, „um Menschen wieder gemeinsam an den Tisch zu bringen –ganz analog!“, was so viel heißt, dass
alle interessierten Spielafficionados herzlich willkommen sind! Auf die freut man sich auch im Zuge der ersten „Brettspiel Con“ am 22./23. November in Pyhra (Kyrnbergerstraße 4). Auf der Brettspielmesse warten „die heißesten Neuheiten direkt von der Spielemesse in Essen, über 100 Spiele zum Ausprobieren, Gewinnspiele, Flohmarkt, Zaubershow, Live Plays uvm.“, verspricht Forstreiter „und natürlich Spielespaß bis zum Abwinken!“ Wir finden das alles gar nicht Banane, sondern halten es ganz mit dem Schlachtruf der Minions: „Banana – auf zur Brettspiel Con!“ www.badbananaboardgames.com
WAREHOUSE BLEIBT EVENTLOCATION
Nach wie vor brodelt die Gerüchteküche um das Warehouse gewaltig, das im Frühjahr seine Pforten geschlossen hat. Nun meldet sich Herbergsgeber VAZ-Geschäftsführer René Voak zu Wort, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen: „Also das Warehouse bleibt als Eventlocation erhalten. Es wird nicht – wie in grauer Vorzeit und ja namensgebend – wieder in eine Lagerhallte rückverwandelt.“ Voak verweist dabei auf eine Reihe von Veranstaltungen wie Frequency Festival, Hauptstadtball das 88,6 Fest, wo das Warehouse jedenfalls bespielt wird. Und da mag wohl in Zukunft wieder mehr kommen. Immerhin wird die Location „in den nächsten Wochen renoviert“, also sogar auf Vordermann gebracht.

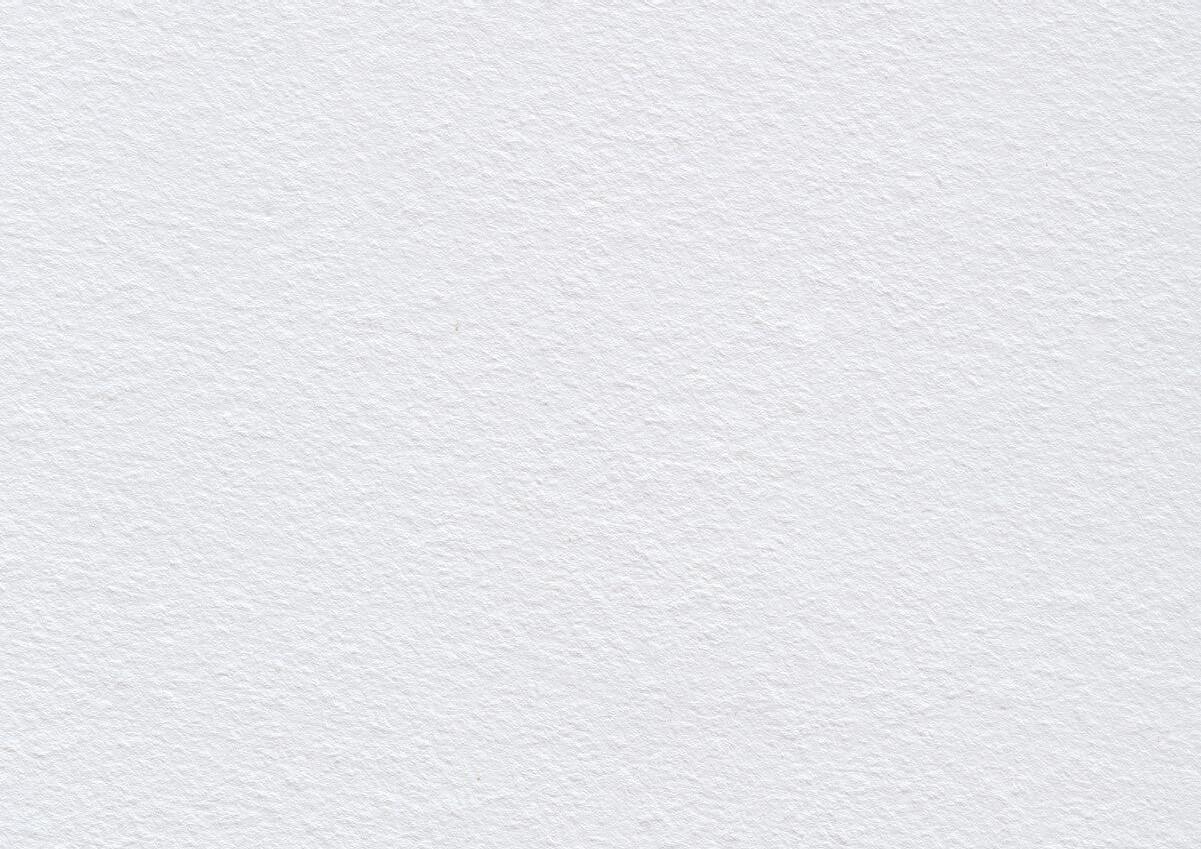


„DIE LEGENDE!“
Seit bald einem Vierteljahrhundert fotografiert Joschi Haiden das niederösterreichische Nachtleben. Mit seinen TikTok-Videos ging er nun viral.
Eine Nacht auf Tour mit Österreichs vielleicht bekanntestem Partyfotografen.
Kremser Volksfest, 23:30 Uhr
Joschi Haiden dreht sich. Das Handy in seiner rechten Hand, hochgestreckt zur Bierzeltdecke. Um seinen Hals eine pinke Krawatte. Er blickt stoisch in die Innenkamera seines Smartphones und beginnt zu filmen. Hinter ihm hebt gerade ein Bursche die Hälfte einer durchbrochenen Heurigenbank in die Höhe, als wäre sie ein Fußballpokal. DJ Schranzi aus dem Zillertal spielt „Cotton Eye Joe“. Die Menge grölt. Es riecht nach verschüttetem Bier und frischem Schweiß. Für Joschi Haiden ist das normal. Es hat ihn sogar ein bisschen berühmt gemacht.
Seit bald einem Vierteljahrhundert fotografiert Haiden Landfestl und Clubbings in ganz Niederösterreich. Wenn ein Event mit dem Auto erreichbar ist, war er wahrscheinlich schon einmal dort. Haiden arbeitet
für die Foto-Plattform nitelife.at – gegründet 2008 und später von der NÖN übernommen. Gegen eine monatliche Pauschale besucht er möglichst viele Partys, macht dort Fotos und stellt sie für die Allgemeinheit ins Internet.
Nach über 3.000 Veranstaltungen und gut 200.000 Fotos kennen den 42-Jährigen deshalb gleich mehrere Generationen von Partygehern. Auch wenn sich nicht alle daran erinnern, von ihm abgelichtet worden zu sein. Manche fürchten ihn deswegen. Seine Fotos haben Leute schon ihre Anstellung gekostet. Andere haben ihn lieben gelernt. Sogar seine Frau hatte er zuerst fotografiert, bevor er sie später heiratete.
Und auch wenn er selbst es gern abstreitet: Zumindest unter jungen Leuten ist Joschi zu Österreichs bekanntestem Partyfotograf aufgestiegen. Aber warum eigentlich?

Ein Parkplatz in der Kremser Innenstadt, 21:30 Uhr Haiden sitzt leicht über das Lenkrad seines VW-Caddys gebeugt und versucht seine Krawatte zu binden. Auf der Rückbank hinter ihm ein Kindersitz. Er nimmt einen Schluck aus seinem Red Bull – pro Abend trinkt er eine Dose, um wach zu bleiben. Dann packt er seine Fotoausrüstung zusammen. Während andere freitags um diese Uhrzeit bereits ausgelassen am Volksfest feiern, beginnt für Haiden die Arbeit erst.
Vom Parkplatz sind es fünf Minuten zum Stadtpark. Die grellen Lichter im Nachthimmel und ein wummernder Bass kündigen die Schaustellerhäuschen und Ringelspiele bereits von der Ferne an. Am Weg dorthin sagt Haiden: „Du wirst gleich merken, meine Zielgruppe ist mittlerweile halb so alt wie ich.“
Einmal am Volksfest angekommen, bahnt er sich seinen Weg von Stand zu Stand durch die feuchtfröhlichen Menschenmassen. Die Leute hier tragen große, silberne Kübel voller Bacardi-Cola und bunten Strohhalmen mit sich herum, essen Langos oder Zuckerwatte.
Und tatsächlich dauert es keine Minute, bis die ersten Jugendliche rufen: „Oh mein Gott, Joschi, mach ein Foto von uns.“ Haiden hebt seine Kamera und schießt einen grellen Blitz aus ihr. Zwei Mädchen nebenan beobachten die Szene und beginnen zu tuscheln. „Schau, das ist der von TikTok.“ Es bildet sich eine Menschentraube um Haiden. Die jungen Leute darin nennen ihn „Legende“, „Ficker“ oder einfach „den Geilsten“. Und sie wollen Fotos. Nicht einfach von Haiden, sie wollen Fotos mit ihm. Haiden

schießt an diesem Abend gut zwei Dutzend Selfies mit seiner Kamera. Ein paar Besucher ziehen gleich ihr eigenes Handy aus der Tasche, lehnen sich an ihn und laden die Schnappschüsse selbst ins Internet. Haiden ist offenbar ein Promi geworden.
wesen. Frauen anzusprechen? Das ging gar nicht. Und dann kam seine Chefin im Club auf ihn zu und sagte: Wir bezahlen dich nicht nur fürs Fahren, auf die Tanzfläche mit dir und schau, dass sich der Floor füllt. „Die ersten fünf Minuten waren die Hölle“, so Haiden. „Aber ich hab dabei ziemlich schnell gelernt, meine Schüchternheit abzulegen.“

Obwohl er mittlerweile zwei Jahrzehnte älter ist als die Menschen, die er fotografiert, ist Haiden bekannter denn je. Grund dafür sind Szenen wie die vom Bierzelt in Krems. Wenn sich Haiden während seiner Arbeit mit ernster Miene mitten im Saufgelage filmt, lädt er die Aufnahmen auf TikTok. Und aus irgendeinem Grund dürfte den Leuten das gefallen. Vor zwei Jahren ging Haiden damit viral. Manche seiner Videos wurden seither fast eine halbe Million Mal

angeschaut. TikTok hob ihn aus der Provinz aufs nationale Tanzparkett. Junge Menschen aus ganz Österreich kommentieren seine Aufnahmen. Sie nennen Haiden dabei „Legende“ oder „Ehrenmann“ und bitten ihn, bei ihren Festen, Bällen und Clubbings Fotos zu machen. Dabei begann seine Karriere alles andere als vielversprechend. „Lern was Gescheites“, rieten ihm seine Eltern. Haiden begann seine Ausbildung in einem Elektrikerbetrieb und er hasste es. Ihm fehlte das Talent, einer der Gesellen in seiner Lehrstelle war Choleriker, der andere verprügelte Haiden.
Er wechselte deshalb nach seiner Lehre zu einem lokalen Radiosender. Gegen wenig Geld arbeitet Haiden als Fahrer und transportierte Equipment für Liveübertragungen von DJ-Sets in eine Disko. Haiden sagt, er sei damals ein schüchterner Bursche ge-
Eines Abends drückte ihm die Chefin eine Digitalkamera in die Hand, um Fotos für die Website zu schießen. „Weil die Bilder nicht so leiwand ausgeschaut haben, hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und ich habe mir meine erste Kamera, eine Casio, gekauft.“
Als Johannes Bramreiter ein paar Jahre später 2008 die Website nitelife.at gründete, holte er auch Haiden als Fotografen dazu und überließ zwei Kollegen und ihm letztlich die Rechte zur Marke. Rentabel war das nicht. Haiden lebte von Ein-Euro-Tiefkühlpizzen, wohnte bei seinen Eltern und häufte Schulden an. Erst als die NÖN nitelife.at übernahmen, war die Seite – sowie Haidens Einkommen – gerettet. Und seine Karriere nahm Fahrt auf.
Mit der pinken Krawatte und dem ernsten Blick wurde Haiden damals ein Meme, bevor es Memes überhaupt so richtig gab. Verkaterte und deren Freunde klickten sich auf nitelife.at durch Partyfotos vom Vorabend. In Niederösterreich kannte ihn deshalb praktisch jeder. Bald hatte er sogar seine eigene Eventreihe namens „Joschi-Mania“. Die pinke Krawatte samt eiserner Miene wurden Haidens Markenzeichen. Und sind es bis heute. Für viele ist Haiden deshalb nicht bloß jemand, der eine Party mit seinen Fotos festhält. Er ist fixer Teil vieler Events geworden. Eine Art Einlage, die Mal auftaucht und Mal nicht.

Kremser Volksfest, 23:00 Uhr „Warum lachst du nie auf deine Fotos?“, schreit ein hörbar betrunkener Mann Haiden vor dem Bierzelt ins Ohr. Der DJ spielt „Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?“ auf voller Lautstärke. „Ich lach doch eh auf den Bildern“, antwortet ihm Haiden. Dann, sagt der Betrunkene, wolle er jetzt ein Selfie mit breitem Lachen von Haiden. Die beiden strecken ihre Köpfe zusammen, Haiden dreht seine Kamera um – und senkt seine Mundwinkel. Warum aber wirklich der ernste Blick? Haiden hat sich ein paar Geschichten dafür zurechtgelegt. Eine geht so: Immer wieder würden Frauen auf seinen Selfies sehr nah kommen, manche ihm sogar ein Busserl auf die Wange geben. „Meiner Frau ist das nicht so recht. Also schau ich auf jedem Bild gleich unbeeindruckt.“
Die Krawatte sei laut Haiden die Idee der damaligen Grafikerin bei nitelife.at gewesen. „Und das Ding ist bis heute saupraktisch“, sagt er. „In Discos fall ich auf und auf Bällen komm ich immer noch einigermaßen ordentlich daher.“
Was man nicht von all den Besuchern hier am Volksfest behaupten kann. Dort nimmt ein angetrunkener Mann einen kräftigen Schluck aus einem halbzerbrochenen Bier-
glas und grinst. Ein paar Tische weiter kann ein anderer Mann kaum noch sprechen. Seine Freunde holen trotzdem eine neue Flasche Wodka auf Eis. Etwa 150 Fotos hat Haiden zu diesem Zeitpunkt geschossen. Es ist nach Mitternacht und er sagt: „Ich glaub, wir schauen zum nächsten Festl.“ Wohin er an so einem Abend fährt, hängt von mehreren Dingen ab. Riesenevents wie das Kremser Volksfest oder der HTLBall sind Pflicht. Spezielle Veranstaltungen wie der Lack-und-Leder-Ball bringen Klicks. Und wenn mehrere kleine Feste gleichzeitig stattfinden, schaut Haiden auf Instagram und Snapchat, wo am meisten los ist. Seine Recherche an diesem Tag er-
gibt: Das Landjugendfest in Weinburg, etwa 30 Minuten von hier.
Ein Heustadel im Flutlichtschein, 01:00 Uhr
Der Regen hat den Boden hier matschig gemacht. Die meisten Leute haben noch wenig Bart, dafür aber schon viel Bier im Bauch. Von einer im Stadel aufgebauten Bühne aus spielt der DJ „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten, direkt gefolgt von Böhse Onkelz. Dann „All the Things she said”, aber den Gabber-Remix. Von da an wird die Musik noch härter und schneller.
Nach all den Jahre hat Haiden von Techno bis Dubstep alle möglichen Genres kommen und gehen – und auch wieder kommen gehört. Was wird in ein paar Jahren in den Clubs gespielt werden? „Die Musik ist gerade so brutal schnell, dass nur etwas ruhiges nachkommen kann“, sagt Haiden. „Recht viel härter geht es ja nicht mehr.“ Und auch die Art, wie junge Menschen feiern, hat sich geändert. Früher habe Haiden noch vier Tage die Woche bis zu zehn Partys fotografiert. „Mittlerweile sind es meistens nur noch zwei Tage und vielleicht fünf Festl, die sich lohnen“, sagt er. „Es gibt weniger zum Fortgehen und die jungen Leute feiern seltener.“
Selina Janker sieht das ein bisschen differenzierter. Die 18-Jährige leitet die Landju-


gend hier im Ort und hat das Fest organisiert. „Uns fehlt der Nachwuchs“, sagt sie. „Und damit gehen uns auch die Helfer auf dem Festl aus.“ Manche Landjugenden hätten sich sogar aufgelöst, Partys wie diese gebe es daher immer seltener. „Uns jungen Leuten am Land bleiben also immer weniger Chancen fortzugehen.“
Und doch: Joschi Haiden kennen hier alle. „Der kommt jedes Jahr“, sagt sie. Wenig später bildet sich auch in Weinburg eine Menschentraube um ihn. Jugendliche drängen sich an seine Seite, wollen Selfies, lallen ihm ins Ohr – bis es ihm irgendwann genügt.
Eine Wiese in Weinburg, 3:00 Uhr Als Haiden gerade zu seinem Auto gehen möchte, passen ihn vor dem Festgelände zwei 18-jährige Mädels ab. Sie haben ihr Shuttle verpasst und wollen mit ihm nach St. Pölten fahren. Ob sie Haiden überhaupt kennen? „Sicher, von Nitelife eben“, sagt eine. Und jetzt fahren
alter Typ, der auf Partys 16-Jährige fotografiert“, sagt er. „Da reden die Leute nun einmal deppat.“
Die zwei Mädels sagen von Haidens Rücksitz aus: „Wir haben jedenfalls keine Angst vor dir, Joschi:“ Irgendwann kommt das Gespräch im Auto auf Haidens Bekanntheit. Ohne Kamera und Krawatte, meint er, würde ihn keiner bemerken. „Jeder sagt, Superman hat nur eine Brille auf und keiner erkennt ihn, das sei unrealistisch. Ich kann bestätigen, es ist sehr realistisch, auch wenn ich kein Superheld bin.“
„In meinem TikTok-Feed bist du schon“, sagt ein Mädchen und fügt hinzu, „sogar meine Mama kennt dich noch von früher.“ Haiden lacht laut auf. „Wenn mich dann irgendwann einmal die Omas kennen, sollt ich vielleicht aufhören.“
Bevor die Mädchen in St. Pölten aussteigen, kramt Haiden noch sein Handy hervor. Auf dem Bildschirm: Entwürfe für T-Shirts. Darauf er selbst, mit seiner pinken Krawatte. Auf die Idee sei er gekommen, als er ein Foto auf nitelife.at sah. Ein anderer Fotograf hatte es geschossen. Haiden zeigt das Bild her. Ein junger Mann steht in einer Freundesgruppe auf einem Fest und trägt ein selbstgebasteltes T-Shirt. Darauf zu lesen: I <3 Joschi Haiden. „Findets ihr das sehr peinlich?“, fragt Haiden. „Na“, rufen die Mädels. Und eine sagt: „Das würd ich sofort anziehen, Joschi!“

sie mit einem fast fremden Mann mit? „Wir wissen ja, dass der Joschi ein normaler Mann ist. Er hat zwei Kinder.“ Haiden lacht laut auf und lässt sie einsteigen. Früher habe er öfter Leute mitgenommen, mittlerweile mache er das kaum noch. Im Internet würde er manchmal als Pädophiler beschimpft. „Ich bin ein
Dann verschwinden die beiden in die Nacht und Haiden macht sich weiter auf seinen Weg nachhause. Den nächsten Abend wird er wieder am Kremser Volksfest sein. Er wird wieder seine pinke Krawatte anlegen, seine Mundwinkel nach unten ziehen und sich filmen. Und ganz bestimmt wird sich Haiden dabei wieder drehen. Warum? Das weiß er selbst nicht so genau. Aber ziemlich viele Leute werden ihn dafür lieben.
„DIE

3/4 TAKT UND HOSE
Zunächst: Ich liebe St. Pölten. Ich liebte kurze Hosen von 1962 bis 1974, dann wurde ich Mann und lernte in Italien, dass dort speziell im Süden Männerbuben warten, bis sie 12 Jahre alt sind und endlich lange Hosen anziehen dürfen. In St. Pölten lernte ich, dass man männlich ist, wenn man – angeblich – vor nichts Angst hat, viele gesunde Watschen bekommen hat, sich mit dem Auto überschlägt (ab fünfmal Minimum wird man im Klub akzeptiert) und regelmäßig vor lauter Rausch auf den Löwenkeller-Parkplatz speibt. Am Wochenende auch auf die B1 Richtung Wien, Pottenbrunn, Club Maquie, auf die B20 Richtung Mariazell, Wilhelmsburg, Jolly Joker. In allen drei Lokalen war ich DJ, ich hab natürlich nie dorthin gespieben, ich schwör’s! (ui zwick)
Die Zeit vergeht, herzsüditalienisch, seelenrömisch, geistvenezianisch, gfrastsacklneapolitanisch und mühsamveronesisch wie ich bin, geh ich stolzarrogant baucheingezogen bei 35° Grad Celsius in langen Hosen durch die Welt. Hauptberuflich verspotte ich Männer in DreiviertelHosen und deren kaugummikauende Puppis im Dreiviertel-Haut-zu-Tattoo. Dumme Menschen erkennt man an ihrer Kleidung. Kombination aus praktisch in scheußlichen Farben. Je rechtsideologischer desto türkis-violett-schwarz-rosa. Dazu ihr Gekrächze. Sie alle sind mir ein täglicher Juckreiz in Auge und Ohr. Ich glaube, Gott trägt Dreiviertel- oder Jogginghose, weil es „so gemütlich“ ist. Dazu ein T-Shirt wo „Gott, oida!“ draufsteht und hat am Handy statt WhatsApp ein WhatsRabbiat. Ah ja, ich sitz grad beim ‚Hager‘, in einer kurzen Hose aus Jogginghosenstoff, es ist so gemütlich.
KOLUMNE ROUL STARKA
LET THE GAME BEGIN
Vom Kindergeburtstag zum Betriebsausflug oder einfach als sportlicher Freizeitspaß. NXP Lasertron in St. Pölten bietet abwechslungsreiche Action für kleine und große Gruppen.


Seit über 15 Jahren ist Europas einzige Multilevel Cybersport-Arena mit dem USOriginal LASERTRON in St. Pölten ein Fixpunkt für Freunde des Laser-Tag-Sports. Mit Bowlingbahnen und Billardtischen steht Entertainment für jeden Anlass am Programm.
NXP Lasertron
www.lasertron.at
Bimbo Binder Promenade 15, 3100 St. Pölten
Laser-Tag auf zwei Ebenen
Zwölf Bowlingbahnen
Billardtische und Airhockey
Getränke und Snacks






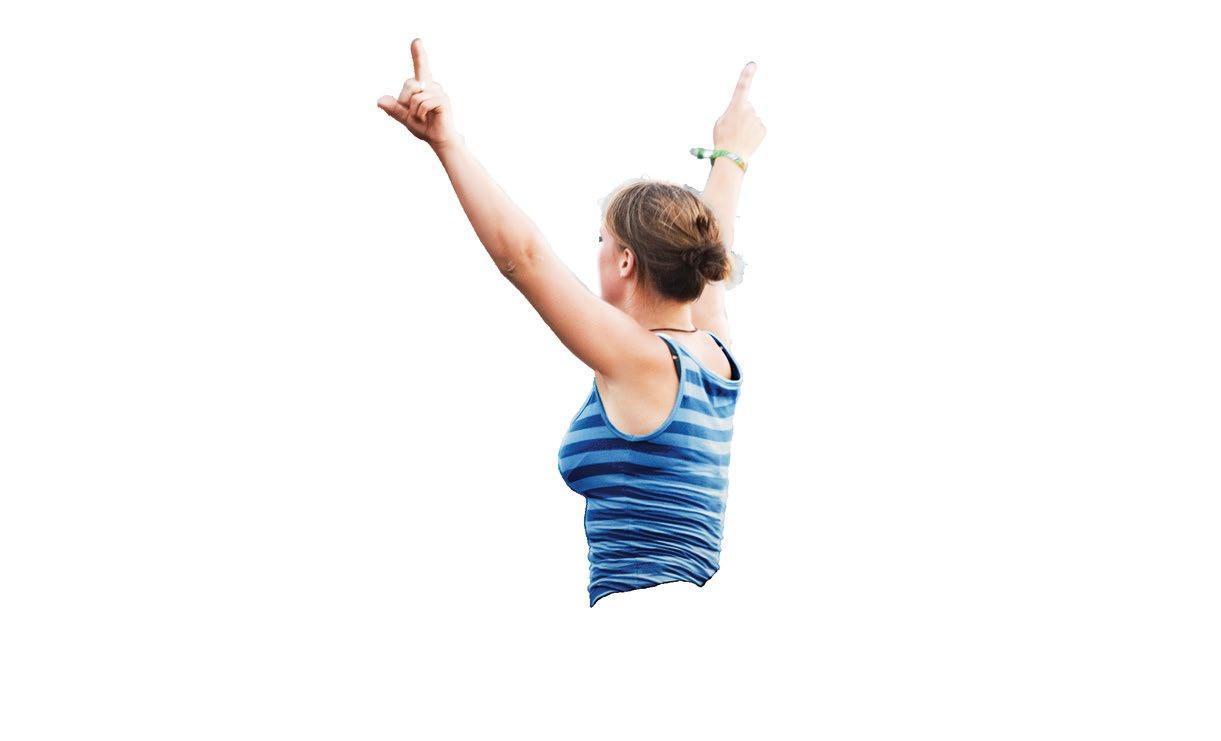

„DA
ENTSTEHT ETWAS!“
Was haben wir nicht schon alles erlebt beim SKN St. Pölten: ChampionsLeague-Fantasien, Abstieg, Aufstiegsdruck, Finanzprobleme, Transfersperre, Handgreiflichkeiten unter Spielern, schwindelerregendes Trainerkarussell oder zuletzt mit Paul Francis einen hochgejazzten Investor, der genauso schnell verschwand wie er aufgetaucht war.
Die – für den Verein auch existenzbedrohende – Lücke füllt seit dem Frühling u. a. Dietmar Wieser, zunächst mit Geld, v. a. aber mit unternehmerischem wie sportlichem Hausverstand, die er sowohl in seiner Rolle als Miteigentümer als auch Neo-Vizepräsident einbringt. Sein wohltuendes Credo: Nachhaltigkeit und Regionalität.
Woher kommt Ihre Leidenschaft zum Fußball und wie sind Sie beim SKN gelandet? Also mein Leben dreht sich seit ich sechs bin ganz, ganz stark um das
Thema Fußball. Damals habe ich vereinsmäßig zu spielen begonnen, hab auch mit meinem älteren Bruder gekickt. Bei Kilb hab ich über 30 Jahre im Amateurbereich verbracht – als Spieler, Trainer und Funktionär quasi alles durchgemacht. Es war letztlich auch die Fußballbegeisterung, die mich völlig ungeplant in die Selbstständigkeit geworfen hat. In Folge hab ich im Fußball, im
Sport insgesamt gute Netzwerke aufgebaut – auch mit dem SKN bestand über 11teamsports eine berufliche Partnerschaft, und ich hab schon vor gut einem Jahr signalisiert, dass ich mich im Verein engagieren möchte. Als es diesen Frühling mit dem Absprung von Paul Francis akut wurde, ist Matthias Gebauer an mich herangetreten und ich musste nicht lange überlegen, einzusteigen.
Wir möchten eine unverwechselbare DNA schaffen, wo die Niederösterreicher sagen: „Das ist unser Klub!“
Haben Sie nicht die bisherigen Turbulenzen abgeschreckt – was reizt Sie an der Sache?
Mich reizen einfach Herausforderungen, wo Leidenschaft im Spiel ist, und ich bin überzeugt vom Standort, von St. Pölten – der Verein hat hier wahnsinnige Möglichkeiten. Deshalb habe ich als Außenstehender früher nie verstanden, warum man diese nicht besser nutzt, sondern – wie es den Anschein hatte –nur von einem Fettnäpfchen ins andere hüpft und ununterbrochen nur am Reagieren ist anstatt zu agieren. Andere Vereine, mit teils deutlich schlechteren Rahmenbedingungen, haben ja vorgezeigt, wie es gehen kann, und ich bin überzeugt, dass auch wir das hier in St. Pölten schaffen werden, weil das ein unglaublich gutes Pflaster für einen Fußballverein ist – das will ich mir auch selbst beweisen. Ob ich damit richtig liege, (lacht), kann ich euch dann in ein paar Jahren sagen.
Wo gilt es für eine Erfolgsgeschichte anzusetzen?
Im Prinzip hast du in vielen Bereichen die gleichen Themen wie sie etwa auch in einem kleinen Amateurverein wie Kilb bestehen, nur dass sie in der Bundesliga intensiver sind und die finanzielle Größenordnung eine andere ist. Aber hier wie dort brauchst du ein klares Bild der Situation, eine klare Vision, wo du hin willst und an der du auch festhältst. An den eingeschlagenen Weg zu glauben, auch wenn es Rückschläge gibt, hat mir beim SKN in den letzten Jahren oft gefehlt. Da wurde bisweilen mit Panik reagiert und alles auf einmal über den Haufen geworfen. Letztlich geht es aber um Nachhaltigkeit. In Kilb haben wir etwa vor einigen Jahren beschlossen, wir spielen ohne Legionäre – da haben auch viele gemeint, da werdet ihr aber keinen Erfolg haben, und es gab auch schwere Zeiten, wir sind uns aber treu geblieben und habens durchgezogen –mittlerweile spielen wir das 7. Jahr in der Landesliga! Zudem ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass wir
hier in St. Pölten einen regionalen Weg gehen. Da ist enormes Potenzial vorhanden. Neben der großen Stärke des SKN – der Infrastruktur – bist du hier zugleich ja auch in der Landeshauptstadt, kannst also in gewisser Weise für dein ganzes Bundesland stehen. Die Nähe zu Wien ist dabei kein Nachteil, sondern ein großer Vorteil, wenn ich an Spieler denke oder auch potenzielle Sponsoren! Wir möchten jedenfalls eine unverwechselbare DNA schaffen, wo die Niederösterreicher sagen: ‚Das ist unser Klub!‘
Wie haben eigentlich die Leute in ihrer Heimatregion, in Kilb und Mank, auf Ihr Engagement beim SKN reagiert? (lächelt) Das war natürlich ein großes Thema! Die meisten haben sich gefreut und waren auch da und dort ein bisschen stolz auf die Region. Schön finde ich zudem, wie viele Bekannte und Freunde aus meiner Heimat jetzt auf einmal ins SKN-Stadion kommen und wie viele Kinder aus Kilb sich in den letzten Wochen schon eine SKN-Dress gekauft haben. Ich hoffe, dass uns das auch mit anderen Vereinen gelingt, wir sie für den SKN begeistern können. Ich denke da natürlich an die Stadtvereine, an Ratzersdorf, Pottenbrunn etc., auf die wir aktiv zugehen möchten. Das Gute ist ja: Das Interesse am Verein ist ungebrochen, ob nun positiv oder – durch manch Fehler in der Vergangenheit – mitunter negativ. Aber Faktum ist, der Verein lässt niemanden kalt – das heißt wir haben die Chance, die Leute wieder für den Verein zu begeistern und von unserem Weg zu überzeugen.
Wie sehen Sie eigentlich Ihre persönliche Rolle im Verein, abgesehen von der Vizepräsidentschaft: Investor oder Mäzen? Miteigentürmer trifft es am besten. Investor passt überhaupt nicht. (hält kurz inne) Ja, am Anfang musst du etwas reinschießen, übernimmst Haftungen etc. – das gehört dazu und war wichtig. Aber mittelfristig
soll der Verein so aufgestellt sein, dass er sich selbst finanziert. Vielleicht war ich also anfangs für ein paar Tage Investor, wenn man so will. Jetzt gilt es aber für alle, die sich im Verein engagieren, diesen in wirtschaftlich gute Gefilde zu führen.
Bei den Transfers von Claudy Mbuyi zu Rapid und Ramiz Harakate zum GAK, unter Francis geholt, wurden ja noch gute Einnahmen lukriert. Hat sich das in etwa die Waage gehalten? (die Miene sagt nein) Zum einen sind noch viele wichtige Gelder von

ZUR PERSON
Der Kilber Dietmar Wieser, 43 Jahre, studierte Medieninformatik und Informatikmanagement an der TU Wien. Als Unternehmer gründete er www.fanreport.com und baute den Österreicher-Ableger von 11teamsports auf. Als Geschäftsführer betreut er u. a. über 600 Vereine in Österreich – darunter auch zahlreiche aus der Bundesliga. Selbst begeisterter Fußballer ist Wieser bis heute als Funktionär beim SCU Kilb tätig, als Vorstand für Marketing & Sponsoring. Beim SKN ist er seit dem Frühling über die SKN Investor GmbH Miteigentümer, außerdem wurde er zuletzt als Vize-Präsident sowohl in den Vorstand der Männer als auch jenen der Frauen gewählt.
Faktum ist, der SKN lässt niemanden kalt – das heißt wir haben die Chance, die Leute wieder für den Verein zu begeistern.
DIETMAR WIESER

Paul Francis geflossen, andererseits hatte man ja auch ein Kostenkonstrukt aufgebaut, für das man verantwortlich war. Da ist das Mindeste, dass ich erwarten kann, dass diese Gelder auch fließen. Jedenfalls können wir dadurch auf lange Sicht eine gute finanzielle Basis schaffen. Wir sind, wenn man so will, noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.
Wie wichtig ist der sogenannte „Österreicher-Topf“? Auf diese Fördergelder seitens der Bundesliga hatten ihre Vorgänger ja verzichtet, jetzt setzt man dahingegen darauf – weil man finanziell muss?
Kurzfristig war die Teilnahme durchaus auch eine finanzielle Notwendigkeit, aber sie deckt sich vollkommen mit unserem langfristig geplanten Weg, auf heimische Spieler, vor allem aus der Region, zu setzen. Es ist für uns essentiell, dass die Region mitzieht und sich mit den Spie-
lern identifizieren kann. Das ist das Kernargument für diesen Weg!
Ein regionales Zeichen hat man auch durch die stärkere Zusammenführung von Wölfinnen und Wölfen gesetzt? Jetzt hat man sogar das Logo gemeinsam.
Operativ werden wir noch viel stärker zusammenwachsen, ob das nun Buchhaltung, Ticketing oder die Geschäftsführung betrifft. Auch im Social Media Bereich nutzen wir schon gewisse Ressourcen für beide, und die Logo-Änderung war ein ganz wichtiger Schritt! Wir wollen auch gemeinsame Sponsoringpakete angehen, mit diesen zwei tollen Assets. Früher hatte man ja jeweils Angst, dass man dem anderen etwas wegnimmt, ich bin dahingegen überzeugt, dass wir gemeinsam viel attraktiver und stärker sind.
Da profitieren die Männer zur Zeit wohl eher von den Frauen,
DER VORSTAND
Vorstand SKN St. Pölten Frauen
Präsident: Wilfried Schmaus
Vizepräsidentin: Christina Wieser
Vizepräsident: Dietmar Wieser
Finanzreferent: Wolfgang Ammerer
Finanzreferent Stv: Katharina Ehart
Schriftführerin: Martina Haag
Schriftführer Stv: Herbert Bugl
Schriftführer Stv: Stefan Schrittwieser
Betreuerstab und Kapitänin Wölfinnen
Sportdirektorin: Tanja Schulte
Trainerin: Lisa Alzner
Co-Trainer: Lukas Noga, Peter Ganster
Torfrauentrainer: Eryilmaz Ömer
Videoanalyst: Marco Roll
Athletik-Trainer: Alexander Fleckter
Kapitänin: Jennifer Klein
Vorstand SKN St. Pölten
Präsident: Helmut Schwarzl
Vizepräsident: Dietmar Wieser
Kassier: Wolfgang Ammerer
Schriftführer: Gottfried Schellmann
Weitere Vorstandsmitglieder: Herbert Bugl, Mario Lenz, Stefan Schrittwieser
Betreuerstab und Kapitän Wölfe
Sportdirektor: Christoph Freitag
Trainer: Cem Sekerlioglu
Co-Trainer: Mark McCormik, Daniel Schütz
Individualtrainer: Simon Zehethofer
Tormanntrainer: Thomas Vollnhofer
Kapitän: Stefan Thesker
die ein sehr positives Image haben und auf nationale sowie internationale Erfolge verweisen können?
Die Männer sind aus meiner Sicht aktuell ganz klar die Nutznießer. Aber auch die Frauen werden von den Männern auf Sicht profitieren. Es wird Zeit brauchen, die lange getrennten Welten zusammen zu führen, aber ich bin überzeugt, dass dieser gemeinsame Weg, diese gemeinsame Geschichte für die Marke
TOGETHER: Die Vorstände der Wölfinnen rund um Präsident Wilfried Schmaus und der Wölfe um Präsident Helmut Schwarzl arbeiten nun eng zusammen.
insgesamt einen Mehrwert bringt, dass sie vor allem auch für die Wirtschaft attraktiv ist. Frauen und Männer im Paket werden Sponsoren und Partner ansprechen, die man je für sich sonst gar nicht erreichen würde. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir manche Unternehmen, die sich ehemals engagiert haben, zurückgewinnen können.
Um bei den Frauen zu bleiben: Die sportliche Herausforderung wird nicht geringer, andere Klubs rüsten im Frauenfußball gehörig nach.
Die Liga wird sicher enger zusammenrücken. Die Austria etwa wird uns schon heuer das Leben schwer machen. Auch Rapid steht vor der Tür und Salzburg wird sich auf Dauer, mit ihrer Akademie dahinter, nicht mit einem fünften, sechsten oder siebenten Platz zufriedengeben. Das ist aber nicht negativ, sondern wird die Liga insgesamt attraktiver machen und voranbringen. Die nächsten zehn Jahre werden wir also vielleicht nicht mehr Serienmeister sein, aber wir werden von den Entwicklungen trotzdem profitieren, weil wir uns durch unsere bisherige Arbeit Vorteile erarbeitet haben.
Wie sind aktuell die Bande mit der Akademie St. Pölten?
Diese galten in Vergangenheit ja mitunter, um es nett zu formulieren, als durchwachsen?
Wir haben unser eigenes Leistungszentrum und jetzt auch einen sehr, sehr guten Austausch mit der Akademie St. Pölten. Wir sind der Bundesliga-Verein in der Stadt, in der die Akademie ist. Die Spieler gehen hier zur Schule, da sollte die Bindung zum SKN am größten sein! Aus meiner Sicht ist das für beide Seiten eine tolle Möglichkeit noch intensiver zusammen zu arbeiten, davon können wir als SKN sehr stark profitieren und sind dementsprechend dahinter. Die ersten Spieler haben wir ja auch schon verpflichtet.
Was ja eine klare Signalwirkung hatte?

Jeder, der schon mal selbst gekickt hat, weiß, dass man einen Aufstieg nicht erzwingen kann.
DIETMAR WIESER
Absolut. Wir haben schon ein klares Zeichen gesetzt, in welche Richtung es gehen soll – nämlich viele Österreicher zu verpflichten, auf die Region zu setzen. In der nächsten Transferperiode können wir diesbezüglich vielleicht noch einen weiteren Feinschliff vornehmen. Das macht absolut Sinn! Du siehst ja, wie viel Leidenschaft da in den ersten Spielen schon am Platz war, unabhängig vom Erfolg. Die Art und Weise, wie wir auftreten, die taugt uns, und stimmt uns zuversichtlich. Das Herz am Platz lassen, das ist das, was wir bieten wollen.
Wenn man Ihnen zuhört, hat man das Gefühl, Sie sind gekommen, um zu bleiben. Wie geht’s konkret weiter?
In den nächsten drei Jahren ist unsere Aufgabe ganz klar: Zum einen wollen wir dem Verein eine klare, regionale DNA verpassen, so dass sich die Fans mit uns und unserem Weg identifizieren können. Zugleich müssen wir in dieser Phase den Verein stabilisieren, also wirtschaftlich konsolidieren und ins positive Eigenkapital bringen. Sportlich möchten wir eine gute Rolle spielen. Vom Budget her sind wir unter den „Top
Fünf“ der Liga, daher ist es unser sportlicher Anspruch, auch in diesem Bereich mitzuspielen. Danach wollen wir mittelfristig konstant vorne mitspielen und dann soll irgendwann der Aufstieg „passieren“. Ich sag ganz bewusst „soll“ und nicht „muss“, denn jeder, der schon mal selbst gekickt hat, weiß, dass man einen Aufstieg nicht erzwingen kann – da muss so viel zusammenspielen. Andererseits wollen wir unseren Weg nachhaltig so anlegen, dass wir irgendwann aufsteigen können – und der Verein, der Standort hat wirklich alles, um auch einmal in der Bundesliga zu bestehen.
Sportlich läuft es ja gerade hervorragend. Was war bislang Ihr persönliches Highlight?
Ganz klar das Siegtor gegen die Vienna in der 95. Minute. Deshalb macht man das (strahlt) – diese Emotionen, dass sich alle in den Armen liegen, egal ob auf der VIP oder auf Ost. Das hat es lange nicht mehr gegeben in St. Pölten. Es war auch eine Riesenfreude für uns, dass die Fanklubs bei der Doppelveranstaltung nach den Männern auch unsere Frauen unterstützt haben. Da entsteht etwas!
ZUM HÖREN
Manshee | mikeSnare | Thomas Fröhlich | Thomas Winkelmüller | Rob.STP | Maximilian Reichl (von links nach rechts)
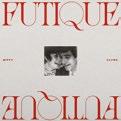
FUTIQUE
Wie schon der fusionierte Albumtitel (Future + Antique = Futique) verrät, verschmelzen meine Musikhelden im neuen Longplayer Zukunft und Vergangenheit zu einem Thema und machen uns auf die Veränderung der Erinnerungskultur im digitalen Zeitalter aufmerksam. Musikalisch bleiben Biffy Clyro ihren massiven Gitarren-Granaten und den perfekt kantigen Rhythmen treu, die mit einem hymnischen Refrain dekoriert sind.
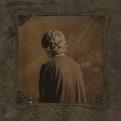
WILLOUGHBY TUCKER, I‘LL ALWAYS LOVE YOU
ETHEL CAIN
Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Ethel Cain liefert auf ihrem zweiten Studioalbum „Willoughby Tucker, I‘ll Always Love You“ die Art von Storytelling, von der man nur schwer genug bekommen kann. Es geht um das Erwachsenwerden im Süden der United States, familiäre Konflikte, Konservatismus und Liebe, verpackt in eine konkrete Geschichte. Einfach toll.
ZUM SCHAUEN
Manshee | Clemens Schumacher
DER KLIMPERCLOWN
HELGE SCHNEIDER
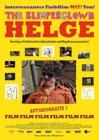
Helge Schneider, musikalischer Clown, Jazzmusiker und lustigster Mensch auf dem Planeten, setzt sein Leben als Patchwork zu einem bunten Filmabenteuer zusammen. Mit Originalaufnahmen, gespielten Sketches und RealityFotos verbindet der Film geschickt die Gegenwart mit verschiedenen Stationen in Helges Karriere.
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
PAUL THOMAS ANDERSON

One Battle After Another erzählt von einem ehemaligen Widerständler (Leonardo di Caprio), der vor 16 Jahren von der Bildfläche verschwand. Nun muss er jedoch wieder auftauchen, um seine Tochter zu retten. Eine irrwitzige Mischung aus Action, schwarzem Humor und Surrealität – spektakulär, unkonventionell und ganz anders als alles zuvor.
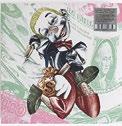
THE COLLAPSE OF EVERYTHING
ADRIAN SHERWOOD
13 Jahre ließ uns der Logenmeister des Dubs im Echoraum schmoren, doch jetzt brutzelt es wieder. Zehn Songschnitzel kommen nun auf die Hörer zugeflogen – in gewohnter Panier: locker, luftig und mit typischem Wellenwurf. „Spaghetti Best Western“, „Dub Inspector“ und „Body Roll“ seien als drei besondere Schmankerl eines rundum gelungenen Menüs zu erwähnen....ähnen....ähnen....ähnen.

SIENTELO
MEFJUS & CAMO & KROOKED
Sota & Circadian, hinter letzterem Pseudonym versteckt sich der ehemalige Mastermind der Prototypes, haben eine wuchtige Neuinterpretation von Mefjus & Camo & Krooked’s Track „Sientelo“ abgeliefert. Das Original wurde 2021 bei den Drum&Bass-Awards zum „Best Track of the Year“ gekürt und ich lehne mich mal soweit aus dem Fenster und behaupte, dass der Remix um nichts nachsteht.
ZUM SPIELEN
Christoph Schipp
HELL IS US
ROGUE FACTOR
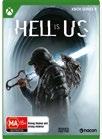
„Hell Is Us“ überzeugt mit bedrückender Kriegsatmosphäre und geheimnisvollen Kreaturen, die du ohne Karte oder Marker entdeckst. Rätsel und Souls-ähnliche Kämpfe fordern Geduld, während der innovative Heilmechanismus neue Spannung bringt. Trotz packender Stimmung wirkt die Story bruchstückhaft und die Technik unausgereift.
MAFIA: THE OLD COUNTRY
HANGAR 13
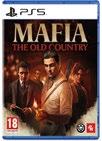
Das Game überzeugt mit packender Mafia-Atmosphäre, spannenden Schießereien und stimmungsvollen Verfolgungsjagden auf Pferd und Auto. Die cineastische Story sorgt für Drama, doch altmodisches Stealth mit nervigen Instant-Fails, steifes Gunplay und wiederholende Missionen trüben den Spielfluss. Ein stilvolles, aber nicht fehlerfreies Gangster-Abenteuer.

THE ROOTS OF DEEP PURPLE
THE COMPLETE EPISODE SIX
Einer der legendärsten (noch lebenden) RockSänger, Ian Gillan, feierte dieser Tage seinen 80er. Dass sein Oeuvre weit über Deep Purple (und deren „Smoke on the Water“) hinausging, beweist nicht zuletzt diese Compilation mit Songs seiner ersten Band: eine fulminante Mischung aus Psychedelic Rock, Pop und 60s-Soul. Brit-Flower Power vom Feinsten – simply groovy!
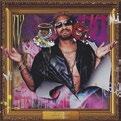
DRUNTER & DRÜBER
Maxwell haut mit Drunter & Drüber ein starkes Album raus. Harte Beats treffen auf „deepe“ Refrains, dazu Texte, die mal Straßenleben, mal persönliche Gedanken spiegeln. Man merkt, dass er seinen Sound verfeinert hat, ohne seine Wurzeln zu der Bande 187 zu verlieren, mit der er ehemals viel Anerkennung einheimste. Ein ehrliches, heftiges Release, das Kraft hat, definitiv hängen bleibt und wert ist anzuhören.
ZUM LESEN
Helmuth Fahrngruber | Michael Müllner
PATRIOT

– MEINE GESCHICHTE
Eine Mischung aus Autobiografie, Tagebuch und Abschiedsbrief des im Februar 2024 in Haft ermordeten russischen Oppositionspolitikers. Einblicke in den Alltag der Straflager voller Brutalität, Schikanen und Absurditäten gemahnen an das GULAG-System der UdSSR. In Putins totalitärem Russland wird politisch Andersdenkenden die Luft zum Atmen genommen.
VIENNA FALLING
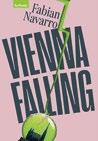
Renate und Jürgen urlauben in Wien, als sich plötzlich vor dem Stephansdom die Erde öffnet und Jürgen spurlos verschwindet. Die Wiener Polizei ist keine Hilfe, somit sucht Renate selbst nach ihrem Mann und entdeckt Geisterjäger, die Wiener Unterwelt sowie ein jahrhundertealtes Komplott – sprich einen irrwitzigen Trip durch Wien.
ALEXEJ NAWALNY
FABIAN NAVARRO
HIGHLIGHT
VAZ St. Pölten
HOLLY JOHNSON
27. SEPTEMBER The one & only Holly Johnson, von der TIMES als „Eine der großen Stimmen des Pop“ gefeiert, geht anlässlich des 40-jährigen Geburtstages des ikonischen Debütalbums seiner ehemaligen Band „Frankie Goes To Hollywood“ auf große Europa-Tournee und gastiert im VAZ St. Pölten. Mit im Gepäck hat er alle großen Kulthits von „Frankie Goes To Hollywood“ wie „Relax“, „Welcome To The Pleasuredome“, „The Power Of Love“, „Two Tribes“ uvm. sowie jene seiner Solokarriere, etwa „Americanos“, „Love Train“, „Heavens Here“ oder „Atomic City“.
MNOZIL BRASS
19. SEPTEMBER 30 Jahre ist es nun schon her, dass ein paar rotzfreche Musikstudenten mit philharmonischen Ambitionen im Gasthaus Mnozil in Wien den Verlockungen der Wirtshausmusik nachgaben und fortan den Globus im Auftrag der angewandten Blasmusik bereisten. Der Blechgeburtstag wird in Form einer Jubiläumsshow gefeiert: Jubelei!
GRAFENEGG | KONZERT
CONNI – DAS MUSICAL
4. OKTOBER Conni hat Geburtstag, und da hat sie so einiges vor: Spielen, toben, tanzen, singen, mit ihren Freunden die weltbeste Schokotorte „Conni-Super-Selber-Spezial!“ backen, und mit ihrem Teddy und Kater Mau kuscheln. Die Besucher können Conni und ihren Freunden helfen, Connis Geburtstag zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.
VAZ ST. PÖLTEN | KINDERMUSICAL
SERENADE DES EXILS
26. OKTOBER Anlässlich des heurigen Gedenkjahrs zu 80 Jahre Kriegsende und Befreiung der Überlebenden findet in der in neuem Glanz erstrahlenden Ehemaligen Synagoge eine Serenade statt, die vorrangig Werke von Komponisten in den Fokus stellt, die im „Dritten Reich“ als „entartet“ galten oder aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ins Exil gehen mussten.
EHEM. SYNAGOGE | KONZERT
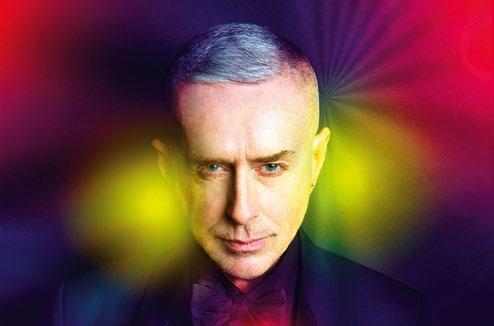
DAS SCHLOSS
27. SEPTEMBER Der Roman „Das Schloss“ zählt zu Kafkas unvollendeten Werken, doch sein Verleger Max Brod hat Kafkas Gedanken zum fehlenden Ende preisgegeben. Das Werk zeigt den typischen Kafkaesken Kampf des Einzelnen gegen unerreichbare Macht. Regisseur Gernot Grünewald wird den Roman zu einem sinnlichpoetischen Erlebnis machen.
LANDESTHEATER | THEATER
MIRA LU KOVACS
10. OKTOBER Mira Lu Kovacs ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten in der österreichischen Musikszene. Ihr neues Album möchte man zur Beruhigung am liebsten in Endlosschleife hören: Jedes Detail ist gefinkelt gearbeitet. Minimalistische Dichte, ausgefuchstes Timing und High-End-Sound mit analogem Charakter. Satt, immer warm, rund und sehr nahe.
BÜHNE IM HOF | KONZERT
MELLOW
7. NOVEMBER Der sympathische Magier im Kapuzenpulli ist Deutscher Meister der Zauberkunst (Parlor-Magic) und stellt mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling die Welt auf den Kopf. Neuartige holographische Videoeffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen. Eine Zaubershow für die ganze Familie.
VAZ ST. PÖLTEN | MAGIE-SHOW
30. SEPTEMBER Dietmar „Hasi“ Haslinger hat sein zweites Buch geschrieben – mit St.-Pölten-Bezug und einer realen Person im Zentrum. Leonardo da Vinci und ein Mönch des 15. Jahrhunderts spielen darin eine große Rolle. Im Cinema Paradiso präsentiert „Hasi“ sein Buch, Georg Wandl liest und das Alta Early Music Ensemble führt eine Weltpremiere auf.
CINEMA PARADISO | LESUNG
3. OKTOBER Bereits mit 15 Jahren wurde Tomatito von der Flamenco-Legende Camarón de la Isla entdeckt. Über dreißig Jahre später zählt er selbst zu den ganz Großen seiner Kunst. In seinem Programm spielt sich Tomatito Seite an Seite mit Sohn José del Tomate durch mitreißende Klassiker des Flamenco Nuevo. Feurige Flamenco-Tanzeinlagen nicht ausgeschlossen!
VAZ ST. PÖLTEN
KONZERTE | EVENTS | MESSEN | KONGRESSE
FR 10.10.25 // 19:30 OMAR SARSAM
SA 11.10.25 // 20:00 THE CHIPPENDALES
DO 06.11.25 // 19:30
KLAUS ECKEL
SA 08.11.25 // 19:30
MANUEL RUBEY & SIMON SCHWARZ
FR 21.11.25 // 20:00
FALCO IN CONCERT

FR 19.12.25 // 18:00 SINGLE BELLS
Tickets im VAZ St. Pölten, ticket@nxp.at, www.vaz.at, 02742/71 400 in allen Raiffeisenbanken, Geschäftsstellen von www.oeticket.com und unter www.noen.at/ticketshop

DIETMAR HASLINGER
AUSSENSICHT
E-MOBILITÄT AUF ZWEI RÄDERN –FLUCH ODER SEGEN?

GEORG RENNER
Der Wilhelmsburger ist freier Journalist und betreibt den Podcast „Ist das wichtig?“.
„Der St. Pöltner Weg: Wo niemand unterwegs ist, passieren keine Unfälle.“
Ist E-Mobilität auf Radwegen eher Teil des Problems oder Teil der Lösung? Man kann beides argumentieren: Einerseits sind Roller, E-Mopeds, E-Bikes und Co. gleichzeitig leise und – trotz 25-km/h-Deckels – so schnell unterwegs, dass sie eine Gefahr für Kinder und andere Fußgänger darstellen. Vor allem, wenn berufsbedingte Eile dazukommt – siehe Fahrradboten – ist Arbeit für die Unfallchirurgie vorprogrammiert.
Auf der anderen Seite sind solche Fortbewegungsmittel ein perfekter Auto-Ersatz. Gerade in Städten mit gut ausgebauter Rad-Infrastruktur wie St. Pölten (mit dem Traisen-Radweg als Rad-Highway quer durch die ganze Stadt) sind sie ein günstiger, schneller und gesunder Ersatz fürs Auto. Ein Verbot bzw. die Pflicht, auf die Straßen auszuweichen, würde ihre Attraktivität beachtlich schmälern – und damit die PKW-Lawine vergrößern.
Was aber jedenfalls klar ist: Wo es die Möglichkeit gibt, sollten Städte ihre Verkehrsflächen so bauen, dass sich die Wege der einzelnen Verkehrsteilnehmer nicht kreuzen. So, dass es also Gehsteige für Fußgänger gibt, Radwege für Radfahrer und Straßen für motorisierte Verkehrsteilnehmer aller Art.
Ein Anspruch, an dem gerade die Landeshauptstadt mit ihren jüngsten Projekten grandios scheitert. Der auf mehrere Arten fragwürdige Umbau des Promenadenrings – fragen Sie mich bitte nicht, was ich von dem täglichen, vorsätzlich herbeigeführten Verkehrschaos zwischen Linzer Tor und Neugebäudeplatz halte – hat ohne jede Not ein gut funktionierendes Modell kaputt gemacht: Gehsteige außen, zwei Fahrspuren für Autos, in der Mitte ein Radweg, alles unter Bäumen – ein Traum.
An seine Stelle hat man was gesetzt? Richtig, einen „shared space“, auf dem sich forthin Fußgänger, Radfahrer, Rollerfahrer und andere – mit oder ohne E-Motor – gegenseitig über den Haufen schubsen können. Dass das bisher nicht passiert, liegt daran, dass diese Flächen bisher kaum genutzt werden – wo niemand unterwegs ist, können auch keine Unfälle passieren.
So gesehen: Auch eine Lösung.

JAKOB WINTER
Aufgewachsen in St. Pölten, emigriert nach Wien, Digitalchef beim „profil“.
„Schützt die E-Scooter-Fahrer –vor sich selbst.“
Sie sind gekommen, um zu nerven: Die E-Scooter. Egal, ob sie auf dem Gehsteig, dem Radweg oder der Straße rollen – irgendwer fühlt sich garantiert von den Gefährten gestört. Außer den Nutzern natürlich.
Wobei: Am meisten gefährden die E-Scooter-Fahrer ohnehin sich selbst. Viele unterschätzen die hohen Geschwindigkeiten der Roller: Allein im Vorjahr landeten 7.500 von ihnen mit Verletzungen im Spital.
Da wäre der Ruf nach einem Verbot nur allzu nachvollziehbar – könnte man meinen. Doch das wäre genau der falsche Weg. Denn wir sollten E-Scooter nicht nur als rollende Risikofaktoren betrachten, sondern auch die verkehrspolitische Chance sehen. Wer etwa vom Bahnhof oder der Busstation mit dem E-Scooter nach Hause rollt, nutzt genau jene „letzte Meile“ zwischen Wohnort und Öffi-Station, die sonst viele Menschen dazu bringt, gleich ins Auto zu steigen. Scooter sind handlicher als ein Fahrrad, leichter zu verstauen, schnell zur Hand –und für manche, die körperlich eingeschränkt sind, eine relativ neue Möglichkeit, mobil zu bleiben.
Ganz anders verhält es sich übrigens mit den EMopeds. Diese Gefährte waren durch ihre Größe nie für Rad- und Gehwege ausgelegt und haben dort auch nichts verloren. Das geplante Verbot der Regierung ist richtig. Ab auf die Straße – Moped bleibt Moped.
Die Scooter hingegen haben neben Fahrrädern ihre Berechtigung und können mithelfen, dass weniger Menschen ins Auto steigen – genau das sollte ein Ziel von kluger Verkehrspolitik sein.
Bleibt das Sicherheitsproblem, das sich lösen lässt. Niemand versteht, warum Radfahrer Strafen zahlen, wenn Reflektoren oder Bremsen fehlen, E-Scooter-Fahrer dagegen weitgehend unreguliert herumrollen dürfen.
Was spricht eigentlich gegen ein Tempolimit für EScooter von etwa 20 km/h, eine Helmpflicht und klare rechtliche Standards wie Licht, Klingeln und Bremsen zur Erhöhung der Sicherheit?
Die Zahl der Unfälle zeigt, dass man die Fahrer auch vor sich selbst schützen muss.


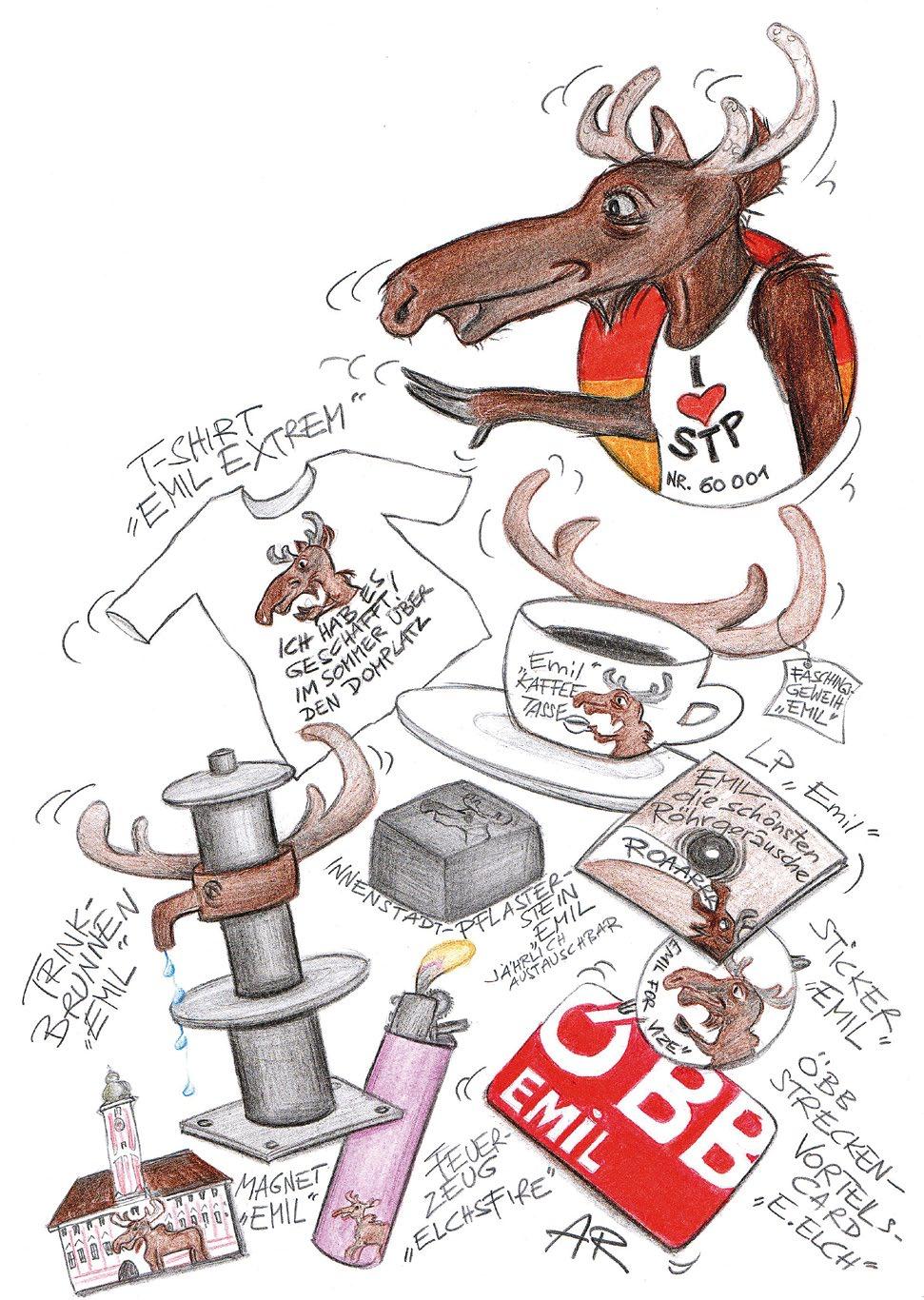
EMIL-MANIA: Elch Emil war da … und löste in der Landeshauptstadt einen regelrechten Hype aus, den sich auch findige Geschäftemacher rasch zu Nutze machten
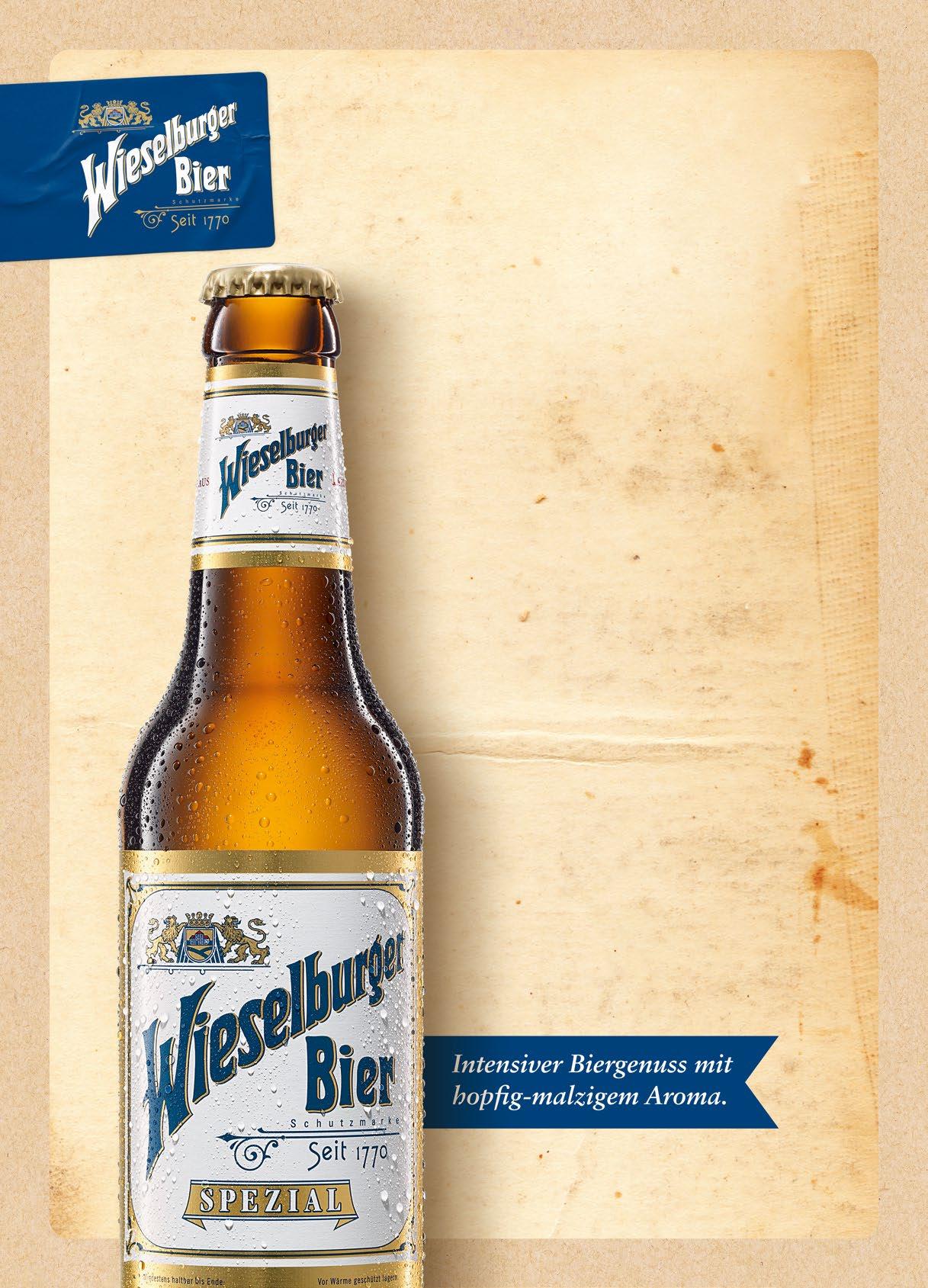
SpezialEinsatz in St. Pölten!


NEIDLING - Griechenberg - Enikelberg
DOPPELHÄUSER PRÜCKELMAYRWEG
Dort,
wo der mystische Dunkelsteinerwald sich zum schönen Traisental neigt, der Blick bis zum Horizont unglaubliche Distanzen erfasst, dort errichten wir moderne, leistbare Doppelhäuser auf Basis unseres gemeinnützigen Handelns.
Beste Qualität, beste Aussicht, beste Finanzierung!
wenn man Wert auf zukunftsweisendes Wohnen legt.
Heimische Handwerksfirmen garantieren gute Ausführung
Ein Schmankerl, Wir,
mit unserer über 100jährigen Erfahrung auf dem Gebiet des sozialen gemeinnützigen Wohnbaus, garantieren bestes, sicheres Wohnen

Die Doppelhäuser haben jeweils eine Wohnnutzfläche von knapp 140 m² und verfügen zusätzlich über großzügige Dachterrassen und Eigengärten
Perfekt für alle, die Wert auf Komfort, Energieeffizienz, Lebensqualität und Leistbarkeit legen
Wir beraten Sie gerne! Telefonisch oder persönlich: 02742 77288 14
Frau Bettina Hoheneder Praterstraße 12 wohnungsgen.at St. Pölten