
12 minute read
Tracht & Tradition
Michael Selb
Die Bodenseeregion ist Trachtenland.
Länderverbindendes Element ist die Radhaube aus Goldlaméspitze. Früher konkurrierte die Damenwelt darin, wer das größte Rad hat. Heute wird die Bodensee-Radhaube von Trachtenvereinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz getragen.
Die Bregenzerwälder Frauentracht ist in ihrer ursprünglichen Form die älteste Tracht im Alpenraum. Die Juppe mit ihrem plissierten Kleid wird auch von jungen Frauen wieder gern getragen, besonders zu festlichen Anlässen. Sie sind stolz auf den vererbten „Bleatz“ oder das „Schappele“, das schon Generationen von Frauen vor ihnen getragen haben. Der traditionelle Juppensto aus Glanzleinen wird nur in der Juppenwerkstatt Riefensberg erzeugt – hier werden auch noch Juppen hergestellt.

Festlich, fi ligran und einzigartig: Die Bodensee-Radhaube in Laméspitze
Keine Krone könnte im Sonnenlicht schöner glänzen als der Kopfschmuck einiger Trachtenvereine rund um den Bodensee: die goldene Bodensee-Radhaube. Seit 2010 ist sie immaterielles UNESCO-Kulturgut, 2020 schmückte sie eine Briefmarke der Österreichischen Post und in diesem Jahr steht sie im Mittelpunkt einer Ausstellung im Stadtmuseum Radolfzell.
Einer, der sich mit diesem außergewöhnlichen Kulturgut auskennt, ist der Vorarlberger Michael Selb. In vielen hundert Stunden hat er recherchiert, sich mit Geschichte und Machart auseinandergesetzt und dieses Kunsthandwerk belebt. Unterstützt von der Trachtengruppe Feldkirch hat er sich um die Aufnahme der Bodensee-Radhaube in Laméspitze in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich bemüht. Inzwischen hat Michael Selb nicht nur einige der kunstvollen Goldhauben selbst hergestellt, sondern seine Erkenntnisse und Erfahrungen in einem Buch „Die goldene Bodensee-Radhaube“ (erschienen im Bucher-Verlag) zusammengefasst. Darin beleuchtet er die Herkunft der kunstvollen Kopfdeckung aus verschiedenen einfacheren Vorgängermodellen ebenso wie die aktuellen Fertigungsmethoden. Geschichte und Geschichten zur Bodensee-Radhaube fi ndet man auch auf Michael Selbs Website https:// bodensee-radhaube.jimdosite.com/. „Alles hat seine Geschichte. Die Radhaube hat eine ganz besondere ... eigentlich sind es zwei Geschichten. Zum einen die Geschichte der Goldspitze, die bei den aufwendigen Hauben verwendet wird, zum anderen die Entwicklung der eigentlichen Radhaube“, so Michael Selb.
Haube mit Geschichte
Die Radhaube an sich entwickelte sich aus einfacheren Hauben ohne das heute typische Rad. Als eines der Vorgängermodelle gilt die Becherhaube, die sich zu einer Zeit durchsetzte, als Damen in ganz Europa darum konkurrierten, wer wohl die größten und aufwendigsten Hauben hätte. Der Rand der Becherhaube wurde immer größer und kunstvoller gestaltet und so entstand am Anfang des 19. Jahrhunderts die Radhaube.
Die Bodensee-Radhaube wurde in unterschiedlichen Techniken und aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. Die aufwendigste und am schwierigsten zu fertigende Haube ist die Radhaube in Laméspitze. Die Geschichte der auch „russischer Klöppelschlag“ genannten Spitze lässt sich von mittelalterlichen, spanischen Königsgewändern über jüdische Festtagskleidung in Galizien bis zur Bodensee-Radhaube verfolgen. „Zur Fertigung des kostbaren Ornaments aus Gold- und Silberfäden ist eine besondere Technik erforderlich, da das Ornament ähnlich einer Häkel- oder Klöppelarbeit von beiden Seiten sichtbar sein und von beiden Seiten die gleiche Ausführungsqualität aufweisen muss“, erklärt Michael Selb. Jede
Haube ist ein Unikat. In Feldkirch und wohl auch in anderen Städten rund um den Bodensee hatten Familien „ihr“ Motiv. Sehr viele Hauben sind mit Blumenmotiven gearbeitet, aber auch Tiere und Früchte zieren die aufwendige Spitze.
Brauchtum lebt
Schriftliche Anleitungen oder Aufzeichnungen zur Anfertigung der Hauben liegen nicht vor. Heute gibt es nur mehr wenige Haubenmacher in Österreich, der Schweiz, Italien und Deutschland. Es sind die Trachtenvereine, die dieses außergewöhnliche Kulturgut der Bodenseeregion weitertragen – ob in Süddeutschland, der Ostschweiz oder in Vorarlberg, das Brauchtum lebt. In Vorarlberg wird die Bodensee-Radhaube in Laméspitze vom Trachtenverein Feldkirch gefertigt und getragen. Auch andere Trachtenvereine wie Bludenz und Bregenz tragen goldene Radhauben, fertigen sie aber nicht selber. So ist sie Teil der Frauentracht der Trachtengruppe Bregenz. Die historische Bregenzer Tracht hat sich aus den Bekleidungsbräuchen des Patrizierstandes im späten Mittelalter bis in die Zeit des Biedermeier entwickelt. Die BodenseeRadhaube kann man bei den zahlreichen Auftritten der Trachtengruppe bewundern – diese ist übrigens auf der Suche nach tanz- und trachtbegeistertem Nachwuchs. „Tracht ist Ausdruck von Identität und Heimatverbundenheit. Tanzen verbindet, ist Begegnung, ein Ausdruck von Lebensfreude. Beides positive Ausblicke für die Zeit nach Corona“, wirbt die Obfrau der Trachtengruppe Bregenz Carmen Vallazza.
Ausstellung in Radolfzell
Auch im Stadtmuseum Radolfzell kommt die Radhaube aktuell ganz groß raus. Aus Anlass des 100-jährigen Gründungsjubiläums der Trachtengruppe Alt-Radolfzell widmet das Stadtmuseum der Radolfzeller Tracht unter dem Titel „Trachten Leben“ bis zum 20. Februar 2022 eine unterhaltsame Sonderausstellung. Wie lebendig die Tracht als regionales Brauchtum ist, zeigt eine großformatige Videoinstallation: Trachtenträgerinnen und -träger berichten von ihren Gefühlen und Erlebnissen mit der Tracht. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Ausstellung dem herausragenden Merkmal der Frauentracht, der Radhaube, und der mit ihrer Herstellung verbundenen Kunstfertigkeit. Denn in jeder Radhaube stecken rund 600 Arbeitsstunden!
Es wird eine Übersichtskarte des Bodensees präsentiert, auf der die Trachtengruppen abgebildet sind, die eine Radhaube tragen. Auf diese Weise bekommt der Museumsbesucher einen visuellen Eindruck von der Vielfalt und Pracht der Radhauben im Zusammenspiel mit den unterschiedlichen Trachten. Besucher können sich zudem im Klöppeln üben oder in Trachtenbüchern schwelgen.




Nenn mich nicht Dirndl! Über die Besonderheiten der Tracht
Tracht, Dirndl, Landhausmode – ist doch alles das Gleiche, oder nicht? „Nein“, sagt Ulrike Bitschnau, Obfrau vom Vorarlberger Landestrachtenverband. Eine Tracht hat immer einen historischen Hintergrund und ist in einer bestimmten Region heimisch. „Außerdem ist die Tracht immer für den oder die Trachtenträger(in) maßgeschneidert. Beim Dirndl hingegen ist alles erlaubt“, bringt Ulrike Bitschnau die Unterschiede auf den Punkt.
„Tracht“ kommt eigentlich vom Wort „tragen“. Ursprünglich verstand man darunter die Kleidung, die in einer bestimmten Zeit und Gegend im Alltag getragen wurde. Seit dem 18. Jahrhundert wurde Tracht vermehrt als ländlich-bäuerliche Kleidung gedeutet und seit dem 19. Jahrhundert zunehmend als etwas Regionales verstanden. „Dirndl“ geht auf die Verkleinerungsform von „Dirn“ zurück und bezeichnet ein junges Mädchen, war aber die gebräuchliche Bezeichnung für eine Magd. Aus ihrer Kleidung dem „Dirndlgwand“ wurde dann irgendwann das „Dirndl“.
Alte Traditionen
Vorarlberg ist „Trachtenland“ – hier werden Trachten aus beinahe allen Stilepochen getragen, angefangen von der ältesten Tracht des Alpenraums, der Bregenzerwälder Tracht über die vom Barock inspirierte Montafoner Tracht und die Städtetrachten aus dem Biedermeier bis zu erneuerten Trachten.
„Vorarlberg hat die ältesten historischen Trachten im deutschsprachigen Raum, die noch viel getragen werden: Das ist so zu verstehen: Es gibt überall historische Trachten, bei uns werden diese aber eben noch sehr oft zu festlichen, kirchlichen und weltlichen Anlässen getragen“, erklärt Ulrike Bitschnau. Ihre Schneiderin Isolde Moosbacher pfl egt zu sagen: „Eine Tracht ist die billigste Kleidung, weil man scha t sie nur einmal an und kann sie zu jeder Gelegenheit tragen.“ Zur Herstellung werden nur hochwertige Materialien verwendet wie reine Wollsto e und Seide.
Gelebtes Brauchtum
Der 1957 gegründete Vorarlberger Landestrachtenverband hat 60 Mitgliedsvereine und ca. 4600 Mitglieder. Es gibt Volkstanzgruppen, Chöre, Volksmusikgruppen, Schuhplattergruppen, Trachtenträgervereine und einen Schützenverein. Dazu kommen noch die Musikvereine, die auch vielfach Tracht tragen. In den letzten Jahren haben vor allem in den Talschaften sehr viele Privatpersonen Trachten angescha t. Auch das Kunsthandwerk hat einen großen Raum. „Wir sind derzeit mit einem Buch über Vorarlberger Trachten beschäftigt. Dort sollen alle Trachten abgebildet und beschrieben werden“, verrät die Verbandsobfrau.



Bilder: Gottfried Brauchle Schreinerin bei Handwerksvorführungen auf dem Museumsfest.


Geschichte erfahren und erleben –Bauernhausmuseum Wolfegg
Auf seinem 15 Hektar großen Freilichtgelände zeigt das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg anhand historischer Bauernhäuser und ihrer Bewohnergeschichten die ländliche Kulturgeschichte Oberschwabens und des westlichen Allgäus.
Für alle Generationen gibt es hier viel zu entdecken: historische Lebens- und Arbeitsformen, Traditionen und Bräuche, aber auch ungeahnte Perspektiven auf das Hier und Heute!
Eine spannende Reise in die Vergangenheit
28 originalgetreu eingerichtete Bauernhäuser und Wirtschaftsgebäude sind Zeugen der früheren Lebens- und Arbeitsumstände der Landbevölkerung. Jedes Haus erzählt eine besondere Geschichte und trägt die individuellen Lebensspuren seiner früheren Bewohner(innen). In der kostenlosen Museums-App berichten diese selbst, was sie mit dem Haus verbindet und was sie dort erlebt haben. Ein reich bebilderter Museumsführer und ein Kinderführer mit Mitmachheft vervollkommnen den Rundgang durch die Geschichte des Landlebens.
Bauerngärten mit fast vergessenen alten Gemüsesorten, heimischen Blumen und Kräutern, artenreiche Wiesen, Weiden und Äcker, Gehölze und Hecken sowie 330 Streuobstbäume laden zum Entdecken und Flanieren ein. Zwei multimediale Dauerausstellungen „Die Schwabenkinder“ und „kommen – scha en – bleiben“ machen das Thema der ländlichen Migrationsgeschichte für Groß und Klein eindrücklich erfahrbar.
Alte Traditionen, alte Bräuche – hautnah
Bekannt und beliebt ist das BauernhausMuseum auch wegen seiner besonderen Veranstaltungen und Vermittlungsangebote, die Geschichte ganz unmittelbar erlebbar werden lassen.
Beim Apfel- und Karto eltag im Oktober, bei den „Auf ins Museum“-Erlebnistagen, beim Ferienprogramm oder an den sonntäglichen ö entlichen Führungen wird Vergangenes für die ganze Familie auf anschauliche Weise lebendig.
Weitere Infos auf unserer Webseite:
www.bauernhaus-museum.de
Tradition und Brauchtum sind nicht nur unsere Wurzeln, sondern stehen auch für Gemeinschaft und Zusammenhalt.
Thomas Wolf

Von Falten und Schnallen – Genusszeit in der Juppenwerkstatt Riefensberg
Die Juppenwerkstatt Riefensberg ist nicht nur ein Haus für Trachtenliebhaber. Besucher aus aller Welt lassen sich hier in altes Textilhandwerk einführen oder kommen im Rahmen von Architekturexkursionen.
Die Bregenzerwälder Juppe ist eine der ältesten Trachten Europas. Der tiefschwarze, glänzende und gefältelte Sto für ihre Herstellung wird nur noch in der Juppenwerkstatt Riefensberg nach uralter Veredelungskunst erzeugt. Am Leimtag liegen vor dem Haus die Sto e zum Trocknen in der Sonne. Die Maschinen, auf denen gearbeitet wird, sind über 100 Jahre alt. Heuer präsentiert das Haus parallel drei Sonderausstellungen. Im Rahmen angemeldeter Führungen ist es möglich, einer Kunsthandwerkerin beim Arbeiten über die Schulter zu sehen.
Sonderausstellungen
„Falten, Krausen, Plissee. Trachten vor und hinter dem Arlberg“ ist eine spannende Schau, die die Kreativität der Faltenbildung zum Inhalt hat und zeigt, wie sehr sie mit Lebensfreude, dem Repräsentationsbedürfnis von Menschen, aber auch mit einer eigenen Sitzkultur zu tun hat. Wie setzt sich eine Wälderin auf ihren steifen Rock? Welche Lösung haben die Kleinwalsertalerinnen gefunden? Warum setzen sich Frauen im Fassatal schräg auf die Kante eines Stuhls?
Textiles im weitesten Sinn haben auch jene Ausstellungen zum Inhalt, in deren Rahmen Künstler eingeladen werden, ihre Arbeiten zu präsentieren. Heuer sind Transferdrucke und Prägungen der aus Schwarzenberg stammenden Ulrike Maria Kleber zu sehen. Die Kuratorinnen sind glücklich darüber, sie ausstellen zu können, da die Arbeiten kaum bekannt sind. Es sind Werke, die Fragmente der traditionellen Bekleidungskultur des Bregenzerwaldes erkennen lassen. Mitunter werden sie als Sequenzen einer Druckabfolge gezeigt, die dem Zufall Raum geben. Die Suche nach Nu-


Bilder: Juppenwerkstatt
ancen erfordert die Pfl ege des Sich-ZeitNehmens. Die Juppenwerkstatt bietet einen guten Rahmen dafür.
Statussymbol Gürtelschließe
Passend zum Thema wirft die Ausstellung „GLANZ und STOLZ. Die Gürtelschließen der Wälderinnen“ einen Blick auf die faszinierende Goldschmiedekunst der Talschaft. In einer Reihe von Werkstätten entstanden im Laufe von Jahrhunderten zahlreiche Unikate höchster Qualität: meist in Silberfi ligrantechnik, mitunter vergoldet. Die schönste Schließe gehörte nicht zwingend den reichsten Mädchen, wird im Rahmen einer Führung erklärt. Es war immer auch eine Frage der Wertigkeit. Gar manches Mädchen sparte sich die Schnalle vom Mund ab. Schließen sind Teil eines in der regionalen Trachtenkultur gepfl egten Zeichensystems – wie vieles, das mit Tracht zu tun hat.
Der Gürtel ist ein altes Kleidungsstück. Er hält das Gewand in Form, betont die Silhouette und ist modisches Zubehör. Wer eine Bregenzerwälder Juppe trägt, benötigt auch einen Gürtel. Gürtel mit ihren wertvollen einteiligen oder dreiteiligen Schließen sind der Stolz der Frauen und zugleich Statussymbol. Viele der heute getragenen Schnallen sind Erbstücke, die über Generationen weitergegeben wurden und so die Erinnerung an Mütter, Großmütter oder Urgroßmütter wachhalten. Schnallen werden zu besonderen Anlässen gekauft, verschenkt oder wechseln ihre Besitzerin als Abgeltung für eine erbrachte Leistung. Früher waren Schließen beliebte Firmgeschenke „guter“ Patinnen.
Generationen von Goldschmieden stellten Schnallen für die Bregenzerwälderinnen her und gaben ihr Wissen innerhalb ihrer Familien weiter. Im Rahmen der diesjährigen Ausstellung wurde in Kooperation mit der Egger Ethnologin Anneliese Schneider und auf der Grundlage ihrer Forschung sechs Handwerkergenerationen nachgespürt. Am Beginn der namentlich erfassten Männer und Frauen steht ein „Silberkrämer“, der 1801 aus Waldsee bei Isny nach Lingenau übersiedelte und den Bregenzerwald mit der luxuriösen Handelsware versorgte.
Gürtelschnallen werden noch immer im Bregenzerwald oder von Bregenzerwäldern erzeugt. Heute werden mehr Schnallen renoviert als neu gefertigt. Der Wunsch der „Jüpplerinnen“ nach Schließen in Silberfi ligranarbeit ist seit Generationen ungebrochen. Hinter den handwerklich meisterhaften Stücken steht eine aufwendige Technik, deren Perfektionierung viel Geduld und Übung erfordert. Sie verbindet den Bregenzerwald mit anderen Kulturräumen.
Neu auf dem Markt sind vereinzelt Schließen, die formal Rückgri e auf bestehendes Formengut erkennen lassen, aber auf einem Verfahren beruhen, das eine Preisreduktion ermöglicht: dem Vakuumguss. Die Wälderinnen stehen Experimentellem in Bezug auf ihre Trachtenkultur grundsätzlich ambivalent gegenüber. Im Rahmen der Ausstellung wurde auch dieses Segment mit einer hochwertig gearbeiteten – gestrickten und vergoldeten – Silberschnalle bedient.
DIE JUPPENWERKSTATT RIEFENSBERG
ist von Mai bis Oktober für Besucher geöff net. Alle Infos fi ndet man unter www.juppenwerkstatt.at
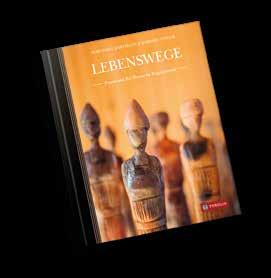
Gewinnspiel
Unter allen vielfarbig-Leser(inne)n werden drei Exemplare von „Lebenswege – Frauen und ihre Heimat im Bregenzerwald“ verlost. Die Gewinnfrage lautet:
Wie heißt die Wirtin vom Sonntagsgasthof in Großdorf?
Wenn Sie die Antwort wissen, dann schicken Sie diese mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an: daniela.erath@russmedia.com
Sie können auch online mitspielen unter www.vielfarbig.at/gewinnspiel. Teilnahmeschluss ist der 27. September 2021.
Frauenpower im Bregenzerwald
Vierzehn Frauen, junge und ältere, aus unterschiedlichen Berufen, mit ganz verschiedenen Lebenswegen, alle fest verwurzelt in ihrer Heimat, haben Dorothee Hartmann und Barbara Toillié in ihrem Buch „Lebenswege“ porträtiert. Herausgekommen ist eine Liebeserklärung an den Bregenzerwald und seine Menschen.
Starke Frauen sind im Bregenzerwald kein Phänomen des 20./21. Jahrhunderts. Man denke nur an Angelika Kau mann, eine der berühmtesten Malerinnen des 18. Jahrhunderts, deren Familie aus Schwarzenberg stammt. „Verwurzelt und geerdet im Bregenzerwald, zugleich welto en und neugierig auf alles Neue“, diese Charakteristik gilt auch für die Vertreterinnen, die wir in den „Lebenswegen“ kennenlernen.
In der Reihenfolge ihres Auftritts spielen mit: Hedi Berchtold vom Käselädele in Schwarzenberg, Ina Rüf, die in ihrer Werkstatt schöne Schuhe von Hand fertigt, die Heilpfl anzenexpertin Anne Marie Bär, die uns in die Geheimnisse des Räucherns einführt, Töpferin Petra Raid, von der die Juppenträgerinnen auf dem Buchtitel stammen, Irma Renner, Wirtin im Sonntagsgasthof in Großdorf, Blumenhändlerin Belinda Ortmans, die ihr Geschäft für Blumen und Dekoratives inzwischen geschlossen hat, Evelyn Fink-Mennel, die der Bregenzerwälder Volksmusik auf den Grund geht, Erna Metzler, Seniorchefi n des Hotel-Gasthofs Schi in Hittisau, Leuchten-Designerin Anna Claudia Strolz, Jutta Frick, Chefi n des Gesundhotels Bad Reuthe, Martina Mätzler, Bewahrerin der Juppe, Landschaftsarchitektin Maria-Anna Schneider-Moosbrugger und die Malerin Ulrike Maria Kleber. Jede der Frauen hat auch einen persönlichen Tipp für den Bregenzerwald beigesteuert.
Für die vielfarbig-Leserschaft stellen die Autorinnen drei Bücher zur Verfügung. Wer bei der Verlosung kein Glück hat, bekommt sein Exemplar im Buchhandel.





