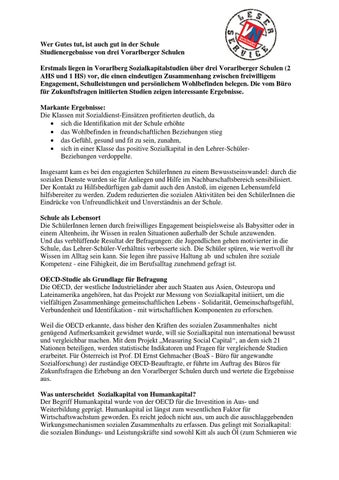Wer Gutes tut, ist auch gut in der Schule Studienergebnisse von drei Vorarlberger Schulen Erstmals liegen in Vorarlberg Sozialkapitalstudien über drei Vorarlberger Schulen (2 AHS und 1 HS) vor, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen freiwilligem Engagement, Schulleistungen und persönlichem Wohlbefinden belegen. Die vom Büro für Zukunftsfragen initiierten Studien zeigen interessante Ergebnisse. Markante Ergebnisse: Die Klassen mit Sozialdienst-Einsätzen profitierten deutlich, da • sich die Identifikation mit der Schule erhöhte • das Wohlbefinden in freundschaftlichen Beziehungen stieg • das Gefühl, gesund und fit zu sein, zunahm, • sich in einer Klasse das positive Sozialkapital in den Lehrer-SchülerBeziehungen verdoppelte. Insgesamt kam es bei den engagierten SchülerInnen zu einem Bewusstseinswandel: durch die sozialen Dienste wurden sie für Anliegen und Hilfe im Nachbarschaftsbereich sensibilisiert. Der Kontakt zu Hilfsbedürftigen gab damit auch den Anstoß, im eigenen Lebensumfeld hilfsbereiter zu werden. Zudem reduzierten die sozialen Aktivitäten bei den SchülerInnen die Eindrücke von Unfreundlichkeit und Unverständnis an der Schule. Schule als Lebensort Die SchülerInnen lernen durch freiwilliges Engagement beispielsweise als Babysitter oder in einem Altenheim, ihr Wissen in realen Situationen außerhalb der Schule anzuwenden. Und das verblüffende Resultat der Befragungen: die Jugendlichen gehen motivierter in die Schule, das Lehrer-Schüler-Verhältnis verbesserte sich. Die Schüler spüren, wie wertvoll ihr Wissen im Alltag sein kann. Sie legen ihre passive Haltung ab und schulen ihre soziale Kompetenz - eine Fähigkeit, die im Berufsalltag zunehmend gefragt ist. OECD-Studie als Grundlage für Befragung Die OECD, der westliche Industrieländer aber auch Staaten aus Asien, Osteuropa und Lateinamerika angehören, hat das Projekt zur Messung von Sozialkapital initiiert, um die vielfältigen Zusammenhänge gemeinschaftlichen Lebens - Solidarität, Gemeinschaftsgefühl, Verbundenheit und Identifikation - mit wirtschaftlichen Komponenten zu erforschen. Weil die OECD erkannte, dass bisher den Kräften des sozialen Zusammenhaltes nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet wurde, will sie Sozialkapital nun international bewusst und vergleichbar machen. Mit dem Projekt „Measuring Social Capital“, an dem sich 21 Nationen beteiligen, werden statistische Indikatoren und Fragen für vergleichende Studien erarbeitet. Für Österreich ist Prof. DI Ernst Gehmacher (BoaS - Büro für angewandte Sozialforschung) der zuständige OECD-Beauftragte, er führte im Auftrag des Büros für Zukunftsfragen die Erhebung an den Vorarlberger Schulen durch und wertete die Ergebnisse aus. Was unterscheidet Sozialkapital von Humankapital? Der Begriff Humankapital wurde von der OECD für die Investition in Aus- und Weiterbildung geprägt. Humankapital ist längst zum wesentlichen Faktor für Wirtschaftswachstum geworden. Es reicht jedoch nicht aus, um auch die ausschlaggebenden Wirkungsmechanismen sozialen Zusammenhalts zu erfassen. Das gelingt mit Sozialkapital: die sozialen Bindungs- und Leistungskräfte sind sowohl Kitt als auch Öl (zum Schmieren wie
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.