Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin


Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Wertvolle Treffen mit Wacker und Wurm
Warum die Generation Z auseinander driftet
Voilà, Glaskunst mit Vorarlberger Charme
Special: Nachhaltigkeit, mehr als ein Trend
Der Marsianer aus der Montfortstadt

Gesundes Wachstum, nachhaltige Ernte.
Sicher, kompetent und persönlich –unsere Werte sind so bewährt wie aktuell. Sie schaffen den Boden für nachhaltiges Vertrauen.
Zeitgemäßes Private Banking verlangt exzellentes Wissen ebenso wie Vernunft, maßgeschneiderte Lösungen sowie den Blick für das richtige Maß. raiba-privatebanking.at

Eiskalte Geschäfte garniert mit Stärke
Es sind oft die außergewöhnlichen, die kreativen Ideen, die am Ende zum Erfolg führen wie etwa eine Kartoffel-Fabrik inmitten der alpenländischen Bergwelt, die aber ziemlich gut läuft, weil hier mit viel Geschick und nachhaltigem Denken tiefgefrorene Spezialitäten für den Weltmarkt hergestellt werden.
Doch nicht nur im wirtschaftlichen Bereich braucht es Neugierde, Pioniergeist, Mut und natürlich das nötige Know-how. Bewiesen hat das auch Erwin Wurm, der heute zu den bekanntesten internationalen Gegenwartskünstlern zählt und dessen umfassende Retrospektive wir – zusammen mit vielen weiteren namhaften Künstlern – im Rahmen eines großen Ausstellungsrundgangs besichtigt haben. Oder der Astrophysiker Michel G. Breitfellner, der einst aus Feldkirch auszog, um als Teil der ESA-Satellitenmission „Mars Express“ den roten Planeten zu erforschen oder die Sopranistin Annette Dasch, die wagemutig die Lohengrin-Vorstellung in der Mailänder Scala rettete – getreu des US-amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Emerson der einst schrieb: „Sei nicht schüchtern oder überempfindlich, was deine Aktionen angeht. Das ganze Leben ist ein Experiment.“ Am Ende sind das die schönsten Geschichten, die das Leben schreibt.
Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr „kontur“-Redaktionsteam
Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Russmedia Verlag GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1
Redaktionelle Leitung: Christiane Schöhl von Norman, christiane.norman@russmedia.com
Redaktion:
Sabine Carotta, Christa Dietrich, Marion Hofer, Elisabeth Längle, Franz Muhr, Andreas Scalet, Angelika Schwarz
Artdirection: Bernadette Prassl, bernadette.prassl@russmedia.com
Anzeigenberatung: Russmedia GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Patrick Fleisch, Thorben Eichhorn, Gabriel Ramsauer, Roland Rohrer
Druck:
Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, A-6850 Dornbirn, Schwefel 81 Erscheinungstag: 15. November 2024; Nächste Ausgabe: 9. April 2025




Seite 06 | 11er. Die Kartoffel ist eine Diva
Seite 11 | ESA. Der Marsianer aus der Montfortstadt
Seite 14 | Zukunft. Was die KI über einen KI-Experten weiß
Seite 18 | Der richtige Ton. Auf Knien rutschen hinterlässt Spuren
Seite 24 | Rechtsprinzip. Starkes Gespür für Ungerechtigkeiten
Seite 31 | Bahnbranche. Präziser Zug zur Effizienz
Seite 34 | Unter Strom. Wie der Vater so der Sohn
Seite 38 | Special. Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor
Seite 56 | Longines. Daniel Hug über Pioniere und Patente
Seite 61 | Lalique. Französische Glaskunst mit Vorarlberger Flair
Seite 66 | BMW 520d xDrive Touring. Was die Länge alles bringt
Seite 68 | Tristan Horx. Von Chauvinismus und Matcha Latte
Seite 72 | Landestheater. Zu diesem Jubiläum kommt ein Popstar
Seite 79 | Vintageboom. Die Suche nach Stil
Seite 82 | Literaturhaus. Wo Sprache wirken darf
Seite 87 | Ausstellungen. Wertvolle Treffen mit Wacker und Wurm



Freude am Fahren. 100% Elektrisch.






Stiglingen 75, 6850 Dornbirn
Telefon 05572/23286-0


Bundesstraße 96, 6710 Nenzing
Telefon 05525/6971-0

info.dornbirn@unterberger.bmw.at www.unterberger.bmw.at

info.nenzing@unterberger.bmw.at www.bmw-unterberger-nenzing.at



Alle detaillierten WLTP-Werte der gezeigten Fahrzeuge abhängig der Motorisierung unter bmw.at.
* Angebot der BMW Austria Leasing GmbH, BMW Select Leasing für den BMW iX xDrive40, Anschaffungswert höchstens € 79.309,32, Anzahlung € 23.600,00, Laufzeit 48 Mon., Leasingentgelt 539,– mtl., genaue Höhe abhängig von Sonderausstattung und Zubehör gem. individueller Konfiguration, 10.000 km p.a., Restwert € 31.560,62, Rechtsgeschäftsgebühr € 498,85, Bearbeitungsgebühr € 260,–, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, eff. Jahreszins 1,45%, Sollzins fix 0,99%, Gesamtbelastung € 81.791,47. Beträge inkl. NoVA und MwSt. Angebot freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gilt für sämtliche Fahrzeuge der Elektropalette von BMW bei Vertragsabschluss von Kauf- und Leasingvertrag von 01.10.2024 - 31.12.2024, Auslieferung bis 30.06.2025, solange das Angebot reicht. Aufgrund begrenzter Verfügbarkeit kann es zu einer vorzeitigen Beendigung der Aktion kommen. Ausgenommen von der Aktion ist die Modellbaureihe BMW i7. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die teilnehmenden BMW Partner zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit anderen Leasing-Angeboten. Angebot gültig bei allen teilnehmenden BMW Partnern. Für Konditionen für Gewerbetreibende stehen Ihnen die teilnehmenden BMW Partner zur Verfügung.






Starkes Team. Flo Gstrein (Mitte) ist der „Chef de Cusine“ im 11er Genuss Bus und hat u.a. auf den Virgin Islands schon für Stars wie Bono von U2 oder Robert DeNiro gekocht.
Warum die gelbe Knolle ganz schön zickig sein kann? Wie sich ihre Schale als Sprit für den Tank nutzen lässt und wieso die Rolle als Nischenplayer durchaus vielversprechend ist? „kontur“ hat Thomas Schwarz, Geschäftsführer beim Nenzinger
Familienunternehmen 11er zum Interview getroffen – eine Geschichte über „eiskalte“ Geschäfte, die Liebe zum Job und ganz viel tüftlerisches Know-how.
TEXT VON CHRISTIANE SCHÖHL VON NORMAN
Rösti, Kroketten, gefüllt oder pur, Pommes Frites und Wedges – man könnte auch sagen: das Beste aus dem „Hördöpfl“, denn der Vorarlberger Kartoffel-Spezialist produziert mit seinen rund 300 Mitarbeitern ein breites Sortiment an Erdäpfel-Produkten und beliefert damit sowohl Gastronomiebetriebe als auch den Lebensmittelhandel in ganz Europa.
An Oalfa. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Unternehmens im Jahr 1941, als Wilhelm Grabher in Lustenau gemeinsam mit seinen Brüdern einen kleinen, mobilen Obst- und Gemüsehandel gründete, um mit Ross und Wagen die umliegenden Dörfer zu beliefern. Damals firmierte der Betrieb noch unter dem Namen Wilhelm Grabher & Co. „In den 70er-Jahren wurde schließlich die Entscheidung getroffen, eine Marke zu kreieren. Da war es naheliegend, den Hausnamen 11er zu nehmen, der auf der Anzahl der Kinder beruht, welche die Familie Grabher vor Generationen hatte“, erzählt Thomas Schwarz und führt näher aus: „In Lustenau gab es viele Böschs, Grabhers und Hämmerles. Damit man diese verschiedenen Zweige unterscheiden konnte, bekam jede Familie einen Hausnamen. Somit war klar, wenn einer „an Oalfa isch“, dann stammt er von der Linie der Grabhers mit den 11 Sprösslingen. Bei diesem Hausnamen ist man bis heute geblieben.“
Am falschen Platz. Der Fokus auf Innovationen und Nischenprodukte war und ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens, das auf einem hart umkämpften Markt in Konkurrenz zu großen Konzernen seine Nische gefunden hat. „Wir sitzen im Grunde am denkbar ungünstigsten Platz auf der Welt, um eine Kartoffelfabrik zu betreiben – zwischen dem Bregenzerwald, dem Montafon und den Schweizer Bergen, einem Platz, wo es keine großen Anbau-
Flächen gibt“, holt der studierte Wirtschaftswissenschaftler mit einem charmanten Schmunzeln aus. „Egal ob zu Zeiten des EUBeitritts oder im abgeschotteten Österreich-Markt in der Zeit davor – wir standen immer vor Herausforderungen, die uns gezwungen haben, unsere Position neu zu überdenken. Deshalb ist unser USP die Kartoffelspezialitäten.“ Soll heißen: Klassische Pommes gibt es natürlich auch im Sortiment, der Schwerpunkt liegt aber auf Kroketten und Röstis, die in verschiedensten Größen, Formen und mit unterschiedlichsten Füllungen produziert werden. „Wir punkten mit unseren Spezialprodukten, die für große Konzerne nicht so interessant sind, weil diese hauptsächlich Pommes in riesigen Mengen, extrem kosteneffizient, produzieren wollen – da können wir schwer mithalten. Aber bei den Spezialitäten ist unsere Größe goldrichtig und wir sind auf internationaler Ebene konkurrenzfähig“, erklärt Thomas Schwarz. Mit einer Exportquote von fast 70 Prozent sind die Hauptmärkte Österreich, Deutschland, Italien, UK, Benelux, Frankreich, Skandinavien – doch auch in viele weitere europäische sowie internationale Länder wird geliefert. Besonders die Gastronomie profitiert von den haltbaren Convenience-Produkten, die sich ohne Qualitätsverlust schnell zubereiten lassen – ein Vorteil, angesichts des wachsenden Personal- und Zeitdrucks in der Branche.
Wir sitzen am denkbar ungünstigsten Platz auf der Welt, um eine Kartoffelfabrik zu betreiben.
Leitung. Mag. Thomas Schwarz (rechts) ist seit dem Jahr 2015 Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. Zusammen mit Dr. Clemens Grabher steht er an der Spitze des Unternehmens

Klein, aber fein. Doch 11er punktet nicht nur mit seinen Kartoffelspezialitäten, sondern mit Flexibilität und Schnelligkeit, innerhalb kürzester Zeit Aufträge mit kleineren Produktionsgrößen oder Sonderwünsche zu bewerkstelligen. So wurde etwa die Anfrage eines weltweit agierenden Großkonzerns in Rekordzeit umgesetzt: „Das gewünschte Produkt war so nicht mehr zu bekommen, deswegen hat sich der Kunde an uns gewandt. Zwei Monate später haben wir die Kartoffelspezialität in nicht unbeträchtlichen Mengen produziert und in Hochsee-Containern nach Asien verschifft – mittlerweile hat sich daraus eine nun schon zwei Jahre andauernde, erfolgreiche Geschäftsbeziehung entwickelt“, erinnert sich Schwarz.
Die Sache mit den Rohstoffen. Wie bei allen Nahrungsmittelherstellern ist auch bei 11er die Kostensteigerung ein Thema. Durch die Folgen des Ukraine-Krieges ist die Energie für alle Hersteller um ein Vielfaches teurer geworden. Auch die Rohstoffe aus der Landwirtschaft wie Kartoffeln und Sonnenblumenöl haben sich im Einkauf teilweise extrem verteuert. Logistik, Mitarbeitergehälter und Verpackungen kommen als Kostentreiber hinzu. „In Summe steigen die Kosten. Wir können aber momentan nicht alles an den Markt 1:1 weitergeben, weil der Wettbewerb groß ist“, ergänzt der Marketingund Vertriebsprofi. So erzielte die 11er Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 135 Millionen Euro.
Nicht in Schönheit sterben. Nachhaltige Innovationen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Markenidentität. Ein Schlüssel dafür ist die sinnvolle Verwertung von Produktionsabfällen. So werden in der 2017 erbauten Biogasanlage Kartoffelschalen zu Treibstoff verarbeitet. Dieser „Kartoffelsprit“ wird genutzt, um LKWs sowie firmeneigene Autos und Stapler zu betanken. Auf diese Weise können jährlich rund 3300 Tonnen CO2 eingespart werden. Beeindruckend ist, dass die erste Biogasanlage bereits im Jahr 1983 errichtet wurde – einer Zeit, in der die Themen Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz noch nicht in aller Munde waren. Der nächste richtungsweisende Schritt folgte 2014, als der Seniorchef die Klimaneutralität des Unternehmens ausrief. Womit sich wieder einmal zeigt: Damit Betriebe das Unterfangen der ökologischen Wende angehen, braucht es visionäre Menschen an der Spitze.
Heute zieht sich der Nachhaltigkeitsgedanke wie ein roter Faden durch die gesamte Unternehmensstrategie. Mit einer der größten Investitionen in der Firmengeschichte treibt 11er aktuell mehrere wegweisende Projekte voran mit dem Ziel, Ressourcen effektiv zu nutzen, CO2-Emissionen zu minimieren und die Abhängigkeit von Erdgas zu reduzieren. „Bevor wir eine Investition tätigen, führen wir immer einen Nachhaltigkeitscheck durch. Es gilt, eine Balance zwischen Effizienz, Kosten und Rentabilität zu finden, um gleichzeitig die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten – in Schönheit, sprich klimaneutral, zu sterben, weil man sich an den Kosten überhoben hat, bringt keinem etwas“, formuliert Schwarz überspitzt.
Zwischen 2015 und 2020 haben wir die CO2-Emissionen um 17 Prozent senken können.

Eine Kartoffelfabrik inmitten der alpenländischen Bergwelt, die gut läuft, weil hier mit viel Geschick, strategischer Planung und nachhaltigem Denken quasi „Fries for Future“ hergestellt werden.
Der „Weg“ ist noch lange nicht zu Ende: Um in den kommenden Jahren weitere Reduktionen beim Energieverbrauch zu erzielen, werden heute schon zukunftsweisende Vorbereitungen getroffen.
Nicht von Pappe? Wenig überraschend zeigt sich das Unternehmen, immer unter der Prämisse der Lebensmittelsicherheit, auch bei den Verpackungen innovativ. So wurde in den letzten zwei Jahren die Folienstärke reduziert, um den Verbrauch zu verringern. Gleichzeitig werden fast ausschließlich Kartonagen aus Recyclingmaterialien verwendet, die vom Nachbarbetrieb bezogen werden, denn die Regionalität ist 11er ein Anliegen. „Wir versuchen Projekte und Aufträge immer mit heimischen Unternehmen umzusetzen. So ist unser neuestes Tiefkühlhaus, das wir letztes Jahr eröffnet haben, zu über 90 Prozent mit Vorarlberger Bauunternehmen ausgeführt worden. Bei den Rohstoffen leben wir Regionalität dort, wo es möglich ist. Gewisse Produkte wie das High Oleic Sonnenblumenöl, bis vor zwei Jahren ist der Weltmarkt mit einem Anteil von 70 Prozent aus der Ukraine bedient worden, gibt es bei uns einfach nicht.“ Regionalität dort, wo es Sinn macht, lässt sich zusammenfassend festhalten.
Wohlfühltemperatur. Die größten Herausforderungen sieht Thomas Schwarz im Fachkräftemangel, den Preissteigerungen sowie dem Klimawandel, denn die Kartoffel mag es nicht zu heiß, sprich nicht über 30 Grad und vor allem nicht zu nass. „Deswegen kann sie auch jetzt schon ziemliche Zicken machen. Man will es nicht glauben, es ist nur eine einfache Kartoffel, die in jedem Garten wachsen kann. Rudi Grabher, der Seniorchef, hat einmal zu mir gesagt: Jetzt beschäftige ich mich seit 40 Jahren mit dem Thema, aber kein Jahr war wie das andere und es ist wirklich so. Gerade gab es die Überflutungen in Ostösterreich. Durch diese starke Feuchtigkeit kommen die Kartoffeln bakteriell belastet bei uns an und wir wissen nicht, ob sie lagerfähig sind, denn das sieht man von außen nicht. Auch wenn es zu trocken ist, wachsen sie nicht, denn die Kartoffel ist eine Diva“,


beschreibt Schwarz die Herausforderungen im Bereich der Qualitätssicherung. Seit nunmehr 10 Jahren ist der gebürtige Kennelbacher beim Kartoffelspezialisten tätig, seit dem Jahr 2015 in der Geschäftsführung. Auf die Frage nach seinem Resümee zeigt er sich bescheiden. „Wenn ich auf meine Anfänge zurückblicke, kann ich sagen, es hat einfach perfekt gepasst, weil ich das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, größtenteils erfüllen konnte. Wenn ich heute den Seniorchef treffe, sind wir uns einig, was für ein Glück es war, dass er mich kennengelernt hat und ich antworte dann immer, was für ein Glück für mich, dass die Stelle frei war und ich mich beworben habe. Das ist irgendwie schön. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, wir haben tolle Mitarbeiter(innen) und können etwas weiterbringen.“
„Pimp your Fries“. Apropos Weiterbringen: Weil „Rösti-Liebe“ durch den Magen geht und Streetfood derzeit hoch im Kurs steht, kurvt seit sieben Jahren der 11er Genuss Bus durch Europa, um den Menschen die kulinarischen Kartoffelspezialitäten aus dem Ländle näherzubringen. Honoriert wurde das bereits mit zwei Auszeichnungen: 2019 als bester Foodtruck Österreichs sowie 2023 als bester Foodtruck Europas. „Flo Gstrein, der Chef hinter der Theke, hat das Ganze wahnsinnig weiterentwickelt, etwa mit speziellen Gerichten wie dem Alpendöner. Wir haben mittlerweile eine richtige Fangemeinde, die wissen will, wann der Bus in ihrer Nähe wieder Station macht.“ Die Frage, wie der Vater von drei Kindern seine Pommes am liebsten mag, ist in diesem Fall obligatorisch: „Ich esse sie meistens plain, also ohne alles, bzw. wenn ich im Genuss Bus bin, mit unseren Gewürzmischungen für die Pimp your Fries. Mein Lieblingsgewürz ist übrigens das mit Knoblauch, Limette, Rosmarin.“ Eine abenteuerliche Kombination, so wie eine Kartoffelfabrik inmitten der alpenländischen Bergwelt, die aber gut läuft, weil hier mit viel Geschick, strategischer Planung und nachhaltigem Denken quasi „Fries for Future“ hergestellt werden.

Streetfood. Der 11er Genuss Bus
seit 2017 durch Europa.

In einem Unternehmen, das nah bei den Menschen ist. Bestens erreichbar • Sozial engagiert • Familienfreundlich

Von Feldkirch bis zum Mars ist nicht gerade der nächste Weg. Der Astrophysiker Michel G. Breitfellner wirft dennoch täglich einen Blick auf den roten Planeten. Der Feldkircher ist Teil der Satellitenmission „Mars Express“ der Europäischen Weltraum Agentur ESA, die unter anderem auch den roten Planeten erforscht.
Völlig ungeklärt: Noch weiß niemand, wie Menschen auf dem Mars überleben können.
ch muss einen Weg finden, Essen für vier Jahre anzubauen... auf einem Planeten, auf dem nichts wächst.“ – Als Mark Watney im Blockbuster „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ diese Worte ausspricht, ahnt er, dass es bis zu seiner Rettung dauern könnte. Denn die Entfernung von der Erde zum Mars variiert zwischen 56 und 400 Millionen Kilometer. Klar, dass eine Reise erfolgt, wenn der Abstand am geringsten ist. Trotzdem würde es bei heutigem Stand der Technik allesamt 34 Monate dauern: je neun Monate für den Hinflug und Rückflug und dazwischen einen Aufenthalt von 16 Monaten bis zur nächsten günstigen Erde-Mars-Konstella-
tion. Offen bleibt die Frage, wie Menschen diese Zeitspanne auf dem Mars überleben können, denn das ist bis dato noch völlig ungeklärt.
Ausgesprochen schwierige Landung. Davon abgesehen, gilt auch die Landung als äußerst schwierig. In den vergangenen 64 Jahren starteten 47 Missionen zum Mars, davon haben 21 eine Landung auf der Marsoberfläche versucht. Nur zehn waren erfolgreich. „Das liegt an der Mars Atmosphäre. Sie ist einerseits so dicht, dass die Reibungswärme ein Hitzeschild notwendig macht, andererseits zu dünn, dass Fallschirme in einer akzeptablen Geschwindigkeit
Mars Express. Europas erste Mission zum roten Planeten startete am 2. Juni 2003 in Baikonur, Kasachstan.

auf die Oberfläche treffen“, erklärt Astrophysiker Michel Breitfellner. Zwar seien in der Vergangenheit passive Landungssysteme wie Airbags erfolgreich eingesetzt worden. Für schwere Rover allerdings sei ein aktives Landesystem mit Bremsraketen erforderlich. „Das Problem ist die Verzögerung des Funksignals von drei bis 22 Minuten“, informiert der Feldkircher. „Eine ,live‘ Steuerung ist unmöglich, die Landung muss ferngesteuert erfolgen.“
Erfolgreiche Mission Mars Express. „Mars Express hingegen kann als eine der erfolgreichsten Mars-Missionen bezeichnet werden“, freut sich Breitfellner, der vorab Erfahrungen bei den Weltraumteleskopen „Infrared Space Observatory“, „XMM-Newton“ und der Mission „Venus-Express“ sammelte. Mit seiner Familie lebt der Vorarlberger deshalb seit drei Jahrzehnten in Boadilla del Monte, ein Vorort von Madrid, Spanien. Seinen Arbeitsplatz im Europäischen Zentrum für Weltraumastronomie „European Space Astromomy Centre“ der ESA in Villafranca del Castillo erreicht er mit dem Auto in nur 13 Minuten. Von dort werden Kameras, Spektrometer, Magnetometer aller europäischen Satelliten gesteuert, die unser Sonnensystem und das Universum erforschen. Etwas weiter westlich Richtung Avila befindet sich eine der drei 35-Meter-Parabol-Antennen, die sicherstellen, dass jederzeit Kontakt zu einem Satelliten hergestellt werden kann, um Telekommando zu senden und Daten zu empfangen.
Michel Breitfellner ist als Science Operations Engineer und Archive Scientist seit vielen Jahren Teil des Projektteams für die Mission Mars Express. „Die Hauptaufgaben liegen in der vollständigen Kartografierung des Mars‘ in 3D und in der Erforschung seiner Atmosphäre, der Reste seines zusammengebrochenen Magnetfeldes und seiner Materialbeschaffenheit an der Oberfläche“, sagt der 60-Jäh-

Astrophysiker. Michel Breitfellner vor einer Radioparabol Antenne, die zur Kommunikation mit Satelliten und Raumsonden und zur Unterstützung von Raketenstarts dient.
Werden eines Tages Exobiologen privater Firmen auf dem Mars nach außerirdischem Leben suchen?
rige. Außerdem verfügt Mars Express über ein spezielles Radarinstrument, das die Dichte der Marskruste bis zu einer Tiefe von vier Kilometern bestimmen kann“, beschreibt er die mindestens noch bis 2026 dauernde Forschungsmission.
Großes Puzzle. Der Feldkircher Astrophysiker zählt zu jenen Menschen, die sich ganz besonders für die „großen Zusammenhänge“ interessieren. „Schon vor Jahrtausenden hat uns die Beobachtung des Sternenhimmels dazu angeregt, uns als Teil des Universums zu sehen“, sagt Breitfellner. „Die Erkenntnisse, die die Menschheit auf den Forschungsmissionen in die Weiten des Weltraums gewinnen, sind ein unbezahlbarer Beitrag zum weiteren und tieferen Verständnis, wie das Universum, unser Sonnensystem, die Erde und damit auch wir Menschen entstanden sind und uns im Laufe von Millionen und Milliarden von Jahren entwickelt haben und weiter entwickeln werden.“ Darin liegt die Faszination für Breitfellner.
Dabei hatte er sich als junger Student hauptsächlich deshalb für Astronomie entschieden, weil es damals einen neuen Computer an der Universitätssternwarte gab. „An der Haupt-Uni hingegen wurde noch mit einer CDC Cyber Maschine mit Lochkarten-Programmierung gearbeitet“, verrät Breitfellner lachend. „Dass der Aufbau der Galaxis interessanter als Festkörperphysik ist, habe ich dann schnell erkannt und bin im Studienfach geblieben.“
Ob Meteorologie, Telekommunikation oder die Anwendungen von GPS und Erdbeobachtung, Satellitendaten, sie sind für die Wirtschaft längst von großer Bedeutung. Die Konsequenz: Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk zum Beispiel investieren in den Weltraumsektor, während staatliche Weltraumorganisationen an der Bürokratie ersticken.
Weltraumsektor im Umbruch. Nach der Diplomarbeit folgte unmittelbar eine Einladung ans „Observatoire de Haute Provence“ in Frankreich, um dort zu dissertieren. Danach folgte eine Stelle als „postdoc“ am „Institut d´Astrophysique“ in Paris und schließlich 1994 der Wechsel ans „European Space and Technology Centre (ESTEC)“ der ESA in Noordwijk in den Niederlanden als Kalibrationswissenschaftler für das „Infrared Space Observatory“. Ein Jahr später übersiedelte das gesamte Team nach Madrid. „Das war damals die goldene Zeit der staatlich organisierten und finanzierten Weltraumfahrt“, sagt Breitfellner rückblickend. Die 1975 als Europäisches Pendant zur NASA gegründete ESA erfüllte damals bravourös ihren Auftrag, Expertise und Technologien zu entwickeln, um Europa einen unabhängigen Zugang zum Weltraum und dessen Erforschung und Nutzung zu ermöglichen.
Wirtschaftliche Bedeutung. Das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert. Ob Meteorologie, Telekommunikation oder die Anwendungen von GPS und Erdbeobachtung, Satellitendaten, sie sind für die Wirtschaft längst von großer Bedeutung. Die Konsequenz: Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk zum Beispiel investieren in den Weltraumsektor, während staatlich, Weltraumorganisationen an der Bürokratie ersticken. Außerdem fehlen Visionen für die Zukunft. „Die Auswirkungen sind bereits sichtbar: SpaceX bietet mit der Falcon 9 und der Falcon Heavy bereits wiederverwendbare Raketen zum Transport ins All an und besitzt mit der Dragon 2 eine funktionieren-

de Raumkapsel für die Reise von Astronauten zur Internationalen Raumstation“, weiß der Astrophysiker. Dagegen basieren das NASA Space Launch System (SLS) und die Orion-Raumkapsel auf alter „Wegwerf“-Technologie und sind trotz 23-jähriger Entwicklungszeit und mehr als 26 Milliarden Dollar Entwicklungskosten immer noch nicht einsatzbereit.
Technologie veraltet. „Aber auch ESA‘s neue Ariane 6 Rakete basiert auf derselben nicht wiederverwendbaren Technologie wie ihr Vorgänger die Ariane 5“, ist diese Tatsache für Breitfellner unverständlich. „Wird die Expansion der Menschheit in unser Sonnensystem, sollte sie jemals stattfinden, in Zukunft von privaten Unternehmen vorangetrieben werden?“, stellt Breitfellner kritische Fragen: „Werden eines Tages Exobiologen privater Firmen auf dem Mars nach außerirdischem Leben suchen?“ Eine erste Antwort wird Elon Musk in zwei Jahren geben. Dann nämlich sollten seine unbemannten Raumschiffe sicher auf dem Mars landen. Klappt das, werden in vier Jahren Menschen folgen. NASA und ESA hingegen zeigen ihre Erfolge weiter in Hollywood. Da ist alles möglich. Denn es ist schließlich die Fiktion, die dem Irrsinn der Realität auf das schönste widerspricht. Auch wenn die Tatsachen eine andere Sprache sprachen.

Vielzahl an Kratern. Michel Breitfellner an seinem Arbeitsplatz. Aonia Terra liegt im südlichen Hochland des Mars unweit des Polarkreises und ist bekannt für seine Vielzahl an Kratern. Alle sieben Stunden umkreist die europäische Raumsonde Mars Express einmal den Mars und hat bisher etwa 1,2 Milliarden Kilometer zurückgelegt.

Florian Buehler ist Experte für Marktforschung, Konsumentenverhalten und Künstliche Intelligenz (KI) an der Fachhochschule Vorarlberg. Für ihn lautet die entscheidende Frage: Wie gehen wir als Menschen mit KI um und wie nutzen wir sie zu unserem Vorteil?
Wie wunderbar sich das anhört. Gerade wenn die Zeit drängt, ist jede Hilfe willkommen. Warum also nicht den virtuellen Kollegen starten, um die Recherche für das bevorstehende Interview zu erleichtern. Mal schauen, was das Programm ChatGPT über Florian Buehler weiß. Bestimmt spuckt es sämtliche Infos binnen Sekunden aus, für die sonst eine stundenlange aufwendige Suche einzuplanen wäre.
Folgende Nachricht wird gesendet:
Ich: Wer ist Dr. Florian Buehler, Fachhochschule Vorarlberg?
ChatGPT: Dr. Florian Buehler ist ein Akademiker, der an der Fachhochschule Vorarlberg tätig ist. Er ist in der Regel in den Bereichen Ingenieurwissenschaften oder verwandten Disziplinen aktiv und könnte auch in der Forschung oder Lehre involviert sein. Um genauere Informationen über seine spezifischen Forschungsinteressen oder Lehrtätigkeiten zu erhalten, wäre es am besten, die offizielle Website der Fach-
hochschule Vorarlberg zu besuchen oder seine Publikationen zu durchsuchen.
Ich: Was weiß Dr. Florian Buehler über KI?
ChatGPT: Dr. Florian Buehler hat, wie viele akademische Fachleute, wahrscheinlich Kenntnisse über Künstliche Intelligenz (KI) in Bezug auf seine Forschungs- oder Lehrtätigkeiten. Dies könnte Bereiche wie maschinelles Lernen, Datenanalyse oder die Anwendung von KI in Ingenieurwissenschaften umfassen. Für spezifische Informationen über seine Expertise oder Veröffentlichungen im Bereich KI wäre es am besten, direkt seine akademischen Profile oder Publikationen zu konsultieren.
Die Antwort ist alles andere als befriedigend. Sie macht nicht schlauer und hilft auch nicht weiter. Aber warum gleich aufgeben. Nachhaken scheint das Gebot der Stunde zu sein.
Ich: Sag mir bitte mehr über Dr. Florian Buehler.
ChatGPT: Leider habe ich keine spezifischen Informationen über Dr. Florian Buehler
und seine Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz. Er könnte in verschiedenen Aspekten der KI tätig sein, wie z. B. in der Entwicklung von Algorithmen, der Anwendung von maschinellem Lernen oder der Erforschung ethischer Fragen rund um KI.
Um mehr über seine speziellen Forschungsprojekte oder Veröffentlichungen zu erfahren, empfehle ich, die Webseite der Fachhochschule Vorarlberg zu besuchen

Wir müssen uns mit der KI auseinandersetzen, wie wir lesen und schreiben lernen. Ich bin im Ganzen sehr positiv gestimmt.
oder akademische Datenbanken zu durchsuchen, in denen seine Arbeiten veröffentlicht sein könnten. Dort findest du möglicherweise auch Informationen über aktuelle Projekte oder Vorträge.
Ich: Du bist mir keine Hilfe. Schade. Habe mir mehr erwartet.
ChatGPT: Es tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte, wie du es dir gewünscht hast. Wenn du noch andere Fragen hast oder etwas Bestimmtes benötigst, lass es mich wissen. Ich bin hier, um zu helfen!

Florian Buehler.
Alter: 37 Jahre
Wohnorte: Dornbirn und Stuttgart
Auslandsaufenthalte: in England studiert, in den Niederlanden promoviert
Beruf: Hochschullehrer an der FH Vorarlberg, Experte für Marktforschung, Konsumverhalten und KI
Hobbys: Mountainbiken, Rennrad fahren, Lesen am liebsten darüber wie Mensch bzw. Maschine zusammenpassen, Essen
Sinnlose Zeitvergeudung. Sehr ärgerlich! Das Motto bleibt wohl: Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner! Will heißen, alles bleibt beim althergebrachten Frage- und Antwortspiel zwischen Redakteur und Interviewpartner. Der Gesprächstermin findet zum vereinbarten Zeitpunkt auf der Video-Plattform Teams statt.
Ein junger Mann, sportlich und mit süddeutschem Akzent erscheint am Bildschirm. Die Beweggründe des Baden-Württembergers nach Vorarlberg zu ziehen, scheinen klar.
Bestimmt sind es die Berge und tatsächlich erzählt er, dass Mountainbiken sein Hobby ist. Und essen. Was wiederum eher überraschend ist, weil man dem Schwaben davon überhaupt nichts ansieht. „Wegen des Sports“, erklärt er schmunzelnd. Und damit zurück zum eigentlichen Thema, der künstlichen Intelligenz. Eines der Fachgebiete des 37-jährigen Hochschul-Dozenten. Denn durch die enge Verknüpfung der Fachhochschule Vorarlberg (FHV) mit der heimischen Wirtschaft, steht Buehler Unternehmen zur Seite, die sich dazu

Wichtig ist für die Zukunft, ein Technikverständnis und kritische Digitalkompetenzen zu vermitteln. Sprich: zu verstehen, was Künstliche Intelligenz kann und was die Auswirkungen sind.
entschieden haben, KI künftig zu nutzen. Und das wollen immer mehr. Obwohl die Skepsis in Österreich nach wie vor überwiegt. Denn in Zahlen vor Augen geführt, waren es lediglich elf Prozent im Jahr 2023, die die Technologie auch tatsächlich nutzen. Das ergab eine Erhebung von Statistik Austria. Doch die Alpenrepublik kann sich damit im europäischen Raum mit anderen Ländern vergleichen. Eine Ausnahme bildet Dänemark. Das Königreich im Norden Europas liegt mit 15,2 Prozent an der Spitze.
Auch Buehler macht in Gesprächen immer wieder die Erfahrung, dass KI erschreckend wenig Anwendung in der Praxis findet. „Die Manager sind zurückhaltend“, bestätigt er. „Zum einen haben sie andere Aufgaben, als sich ständig über KI zu informieren, zum anderen ist es auch ein Generationenthema.“ Selbst großen Unternehmen fehlt mitunter die Offenheit dafür. Die Gefahr, die der Experte aus der Verhaltenheit herauskommen sieht, ist, dass diese Unternehmen ersetzt werden, durch Unternehmen, die die Technologie nutzen. Denn die Entwicklung geht extrem schnell voran. „An der FHV versuchen wir deshalb auch zu erforschen und herauszufinden, wo zum Beispiel ChatGPT sinnvoll und verantwortungsvoll eingesetzt werden kann.
Im Hinblick auf die Möglichkeiten, die uns die Technologie bietet, aber auch auf die Kompetenzen, die wir dafür brauchen wie beispielsweise kritisches Denken.“
Erste Studien sagen bereits voraus, dass bis zu 80 Prozent der Jobs auf irgendeine Art und Weise von Künstlicher Intelligenz betroffen sein werden und zwar schon in

Wirtschaft. Florian
Buehler arbeitet mit Unternehmen zusammen, die KI einsetzen möchten.
sehr naher Zukunft. „Das können Jobs sein, die die KI direkt übernehmen kann, bei denen sie assistieren kann oder sie übernimmt die Aufgaben des Vorarbeiters zur Unterstützung“, zählt Buehler Beispiele auf. Er selbst lässt die KI die E-Mail checken, bei Terminen den Kalender abgleichen und einen Vorschlag für die Beantwortung machen. Das spare Zeit und sei durchaus eine Unterstützung.
Für die Unternehmen in Vorarlberg sieht er durchaus Chancen, vor allem was den Fachkräftemangel betrifft. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. Allerdings müssen die Unternehmen mit der neuen Art zu arbeiten auch erst klar kommen. „Obwohl wir uns die Zukunft nicht ausmalen können, ist klar, es wird nicht mehr ohne KI gehen“, sagt der KI-Experte voraus. „Also reg di net uf, Zefix. Mach‘s ghörig.“ Das gilt auch für die vorangegangenen Rechercheversuche in ChatGPT.
Ich: Das nächste Mal werde ich dir einfach die richtigen Fragen stellen.
ChatGPT: Das klingt nach einem guten Plan! Ich bin hier, um dir zu helfen, egal welche Fragen du hast. Ich freue mich auf deine nächsten Fragen! Fotos:
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.
Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.
Regional. Weitsichtig. Respektvoll.
Regional. Weitsichtig. Respektvoll.
Regional. Weitsichtig. Respektvoll.
Regional. Weitsichtig. Respektvoll.
Regional. Weitsichtig. Respektvoll.
Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.
Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.
Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.
Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.
Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.
Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.
Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz. Telefonisch
Persönlich
Persönlich
Persönlich
Persönlich
Persönlich
Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Persönlich
Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Persönlich
Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch
Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Telefonisch
+43 (0)50 882 2000
+43 (0)50 882 2000
+43 (0)50 882 2000
+43 (0)50 882 2000
Telefonisch
+43 (0)50 882 2000
+43 (0)50 882 2000
E-Mail private-banking@vvb.at
+43 (0)50 882 2000
E-Mail private-banking@vvb.at
E-Mail private-banking@vvb.at
E-Mail private-banking@vvb.at
E-Mail private-banking@vvb.at
E-Mail private-banking@vvb.at
E-Mail private-banking@vvb.at
volksbank-vorarlberg.at/private-banking
volksbank-vorarlberg.at/private-banking
volksbank-vorarlberg.at/private-banking
volksbank-vorarlberg.at/private-banking
volksbank-vorarlberg.at/private-banking
volksbank-vorarlberg.at/private-banking
volksbank-vorarlberg.at/private-banking
ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene,
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.
weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoerklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.
Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.

IN EINEM GANZ NEUEN LICHT
Ein ewiger Klassiker, der niemals aus der Mode kommt – Sonnenbrillen im Piloten-Style. Auch Gucci greift diese Saison darauf zurück und interpretiert die Shades der Jahreszeit entsprechend in einem schwarz gespritzten Rahmen mit dunkelbraunen Gläsern.
gucci.com

SÜSSE VERWICKLUNG
Mehrreihige, bunte Leder-Armbänder verleihen der Mini DolceVita einen lässigen Touch. Vor allem dieses pinkfarbene Modell mit diamantbesetztem Gehäuse setzt ein strahlendes Statement gegen die Tristesse kalter Wintertage.
longines.com

EINFACH WIE GEDRUCKT
Inspiriert von den goldenen Lorbeerblättern der Secessions-Kuppel, das Wahrzeichen des Wiener Jugendstils, wurden die federleichten Ver Sacrum Ohrgehänge im 3D-Verfahren gedruckt. Innovation und Tradition verbinden sich so auf raffinierte Weise.
mymagpie.at

WIE VIOLETTER RHABARBER
Rhabarber und Bernsteinholz vereinen sich mit Vanille zu einem extravaganten, blumigen Duft. Der Flakon ist von Marc Jacobs Leidenschaft inspiriert, Elemente des Alltags so zu kombinieren, dass etwas Faszinierendes und völlig Neues daraus entsteht. Pure Lebensfreude
marcjacobs.com

BUBBLES AUS BOUZY
Bouzy ist die Heimat des Champagnerhauses Clouet. Hier tüftelt man jedes Jahr aufs Neue an exquisiten Spezialitäten wie dem Brut Rosé Spiritum 96 Grand Cru, der die Jugendlichkeit eines jungen Rosé-Champagners mit der Dosage-Liqueur aus dem Jahr 1996 verbindet.
andreclouet.com

DER ZAUBER HAWAIIS
Inspiriert vom hawaiianischen Aloha-Spirit kreierte Declaré eine nachhaltige und verträgliche Pflegelinie aus wertvoller Moai Alge und edlem Safran, die sensible Haut in tiefe Gelassenheit versetzt und gleichzeitig eine Anti-Aging-Wirkung verspricht.
declare-beauty.com
Kreativität bedeutet, etwas Neues zu schaffen. Das „Neue“ kann alles Mögliche bedeuten und hat viele Facetten. Diese Brands strahlen mit ihren Neuheiten pure Lebensfreude aus – von Aloha bis Ver Sacrum.

Weltweit zählt Annette Dasch zu den führenden Sopranistinnen und ist Gast der bedeutendsten Opernhäuser und Festivals – Mailänder Scala, Salzburger Festspiele oder aktuell die Wiener Volksoper. Doch so sehr die Berlinerin auf der Bühne bejubelt wird, abseits davon präsentiert sie sich lässig, lustig, bodenständig. Ein Interview über Almas Fatsuit, spontane Rettungsaktionen und den richtigen Ton.
TEXT VON CHRISTIANE SCHÖHL VON NORMAN
Du singst aktuell die Alma Mahler-Werfel in der gleichnamigen Oper von Ella Milch-Sheriff an der Volksoper Wien. Was zeichnet deine Rolle aus?
Das Stück ist entstanden, weil Ella sich intensiv mit dieser Frau beschäftigt hat. Beide haben eine ähnliche Geschichte: Ella war selbst lange mit einem in Israel sehr berühmten Dirigenten und Komponisten verheiratet. Als junge Frau arbeitete sie als Sängerin und Komponistin. Nach der Hochzeit hat sie das alles aufgegeben – nicht, weil ihr Mann es von ihr verlangt hätte, sondern aus Respekt vor seinem Genie. Erst als er verstorben ist, hat sie wieder angefangen zu komponieren. Die „Alma“ ist ihr Lebenswerk. Dieser Aspekt ist deswegen so interessant, weil Alma Mahler einst in ihrem Tagebuch notierte, dass sie irgendwann eine Oper schreiben wird, die die Welt verändert. Dieser Anspruch einer jungen Frau ist sehr beeindruckend. Das Stück ist so aufgebaut, dass wir in der Zeitgeschichte rückwärts gehen. Zu Beginn spiele ich eine alte, verbrauchte Frau, trage einen Fatsuit, rauche auf der Bühne und blicke mit meiner Tochter Anna, – sie ist die einzige ihrer Kinder, die überlebt hat
Stark. „Alma“ wird an der Volksoper Wien uraufgeführt.


Mythos, Muse oder Monster? – Anna, die einzige von Almas vier Kindern, die bis ins Erwachsenenalter überlebte, tritt als Bühnenfigur in einen Dialog mit ihrer Mutter, um der hochkomplexen Psyche ihrer „Tigermami“ auf den Grund zu gehen.
und viele Jahre als Künstlerin in Wien aktiv war – zurück auf die Lebensgeschichte: von Mann zu Mann, Beerdigungen der drei Kinder, Abtreibung des Kokoschka-Fötus. Die Oper endet mit der Hochzeit von Alma und Mahler, der ihr abverlangt hat, mit dem Komponieren aufzuhören. Für mich ist es eine spannende Aufgabe, diese „Timeline“ rückwärts zu spielen. Bei manchen Rollen muss ich, wie mit einem sehr feinen Pinsel, alle Charaktermerkmale ausarbeiten, bei „Alma“ habe ich dagegen das Gefühl, dass ich eine Art Medium bin, d. h., ich, Annette, stehe zur Verfügung und alle wollen etwas von Alma – sei es in ihrer Rolle als Mutter, Geliebte von Kokoschka, der forderte „Du gehörst nur mir und keiner hat dich jemals so befriedigt wie ich“ oder als Ehefrau von Mahler, der ihr abverlangte „Du musst dich mir ganz hingeben und meine Musik wird deine Musik sein“. Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich gar nichts machen muss. Ich gehe durch das Stück und es passiert einfach.
Anna bezeichnete ihre Mutter als Tigermama. Bist du auch eine? Für Alma standen vor allem ästhetische Ansprüche im Vordergrund. Deswegen hat sie bevorzugt Manon, ihre arische Tochter von Walter Gropius, gerne hergezeigt. Tatsächlich war sie auch stark antisemitisch geprägt und hat sich deswegen immer ein bisschen für ihre jüdischen Männer geschämt. Manon wurde, gerade aus heutiger Sicht, auf beklemmende Weise zur Schau gestellt, u.a. durch furchtbare Familienfotos, auf denen sie als kleines Mädchen immer nackt abgebildet ist. Ich bin mit Leib und Seele Mama und mein oberster Anspruch ist, meinen Kindern Authentizität zu vermitteln und nicht, dass sie mir als Herzeige-Objekt dienen müssen. Ich versuche sie so zu stärken, dass sie ihre eigenen Wege gehen können.
Anna Mahler haftet der wenig schmeichelhafte Nimbus der männerverschlingenden Femme fatal an Gerade in Wien kennt jeder diese Frau und ihre gängige Bezeichnung ist Monster, Man Eater oder Femme fatale. Ich finde es spannend, dass es sich eine Komponistin und eine Regisseurin zur Aufgabe machen, dieses Moment aufzugreifen und dagegen anzugehen. Wäre Alma ein Mann, wäre ihr Verhalten kein Thema – im Gegenteil, man würde sagen, ein Lebemann, Genussmensch, Playboy. Niemand käme etwa auf die Idee, Picasso wegen seiner vielen Frauen zu verurteilen. Alma hat monströse Züge und deswegen muss man sie am Ende des Stücks auch nicht mögen, aber vielleicht besser verstehen.
Was würdest du als den wichtigsten Moment deiner Karriere bezeichnen? Ich denke an zwei Debüts: dein Einspringen 2019 für Anna Netrebko bei den Bayreuther Festspielen in der Oper Lohengrin als Elsa und 2012 in der Mailänder Scala, ebenfalls Lohengrin, und wieder als krankheitsbedingter Ersatz, als du den Saisonauftakt in letzter Sekunde gerettet hast. Ich bin ein sehr inhaltlich denkender Mensch, was meine Rollen betrifft und Einspringen ist auch immer so eine Sache. Aber auf meinen Einsatz in der Mailänder Scala bin ich schon stolz, weil es eine sehr komplizierte und tolle Arbeit von Klaus Guth war und ich es innerhalb von nur vier Stunden geschafft habe, meine Rolle so zu präsentieren, dass der Abend gut stattfinden konnte. Für mich lehrreich war aber 2010 der Bayreuther Lohengrin mit Hans Neuenfels und Andris Nelson.
Du hattest nur vier Stunden Zeit zur Vorbereitung? Wie lief das ab? Ich saß zu Hause in Frankfurt, meine Tochter war gerade
ein halbes Jahr alt, als der Anruf kam. Spontan bin ich in den Flieger gestiegen und nach Mailand geflogen, meine Mutter kam zum Babysitten aus Berlin. Nach einer sehr kurzen Ruhephase im Hotel, ging es schon ab zur Scala, wo mir auf einem Laptop die Inszenierung gezeigt wurde, während um mich herum fünf Näherinnen das Kleid angepasst haben. Als sie fertig waren, gab es noch eine kurze Bühnenbegehung, ich habe das Kind noch schnell gestillt und die Vorstellung ging los. Ich hatte nicht mal mehr Zeit, um mich einzusingen. Das war rückblickend eine verrückte Geschichte.
Ganz schön mutig … Ja. Ich bin mutig, geradezu risikofreudig, würde ich sagen.
Auf jeden Fall scheinst du schicksalhaft mit der Elsa verbunden zu sein. Gibt es eine andere Figur, die dir besonders liegt? Ich habe die Rolle der Elsa einfach sehr oft gesungen. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich nach vielen, vielen Jahren in denen ich u. a. Pamina, Gräfin, Elsa und Elisabeth etc. interpretiert habe, irgendwann merkte, dass ich auch andere Frauenrollen verkörpern möchte, denn das immer auf den Knien rutschen, von irgendwelchen Männern gedemütigt werden und am Ende entseelt zu Boden sinken, hinterlässt seine Spuren. Ich wollte gerne die Komödiantin in mir rauslassen, von der ich immer wusste, dass es sie gibt. In meinem lyrischen Sopranfach kam diese Seite von mir aber nie zum Tragen, weswegen ich mich entschieden habe, auch Operetten zu singen oder die Jenny in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Hier einen Gegenpol zu finden, hat mir gutgetan.
Ab Dezember singst du an der Volksoper die Wirtin Josepha Vogelhuber „Im weißen Rössl“. Ist das auch eine Art Ausgleich zum Opern-Genre? Absolut. Nach Alma ist die Rösslwirtin genau das Richtige. Das putzt mich dann wieder frei.
Ist eine Operette leichter zu singen wie eine Oper? Ja, aber es gibt Operetten, die wirklich sehr schwer zu singen sind, etwa die Rosalinde in der Fledermaus oder die lustige Witwe, das muss man erst mal „wuppen“. Die Rösslwirtin hat keinen so großen Gesangspart, vielmehr geht es um die schauspielerische Herausforderung.

In der Schauspielerei beklagen viele Darsteller(innen), dass sie immer in der gleichen Schublade besetzt werden. Ist das in der Oper auch so? Total. In den letzten Jahren wird zwar versucht, das hie und da aufzubrechen und z. B. mal eine etwas kräftiger gebaute Frau als jugendliche Liebhaberin einzusetzen, aber in Wirklichkeit ist es an den meisten Häusern bis heute so, dass es zunächst nach der Optik geht. In den Köpfen von Regisseuren und Publikum ist immer noch verankert, dass eine Königin der Nacht oder ein Barbier von Sevilla so oder so auszusehen hat. Klar spielen auch parallel dazu noch die Gesangskünste eine Rolle, aber die Zuordnung zu einer Rolle erfolgt sehr stark über das Aussehen.
Es gibt Lieder, die stellen hohe Ansprüche an die Gesangstechnik: komplizierte Sprache, rascher Wechsel der Tonhöhen, schauspielerisches Talent – macht es die 1. Liga aus, all das zu vereinen? Das wäre das Ideal. In erster Linie braucht es eine ansprechende Stimme. Hinzu kommen Technik und ein natürliches Verhältnis zum Performen. Das i-Tüpfelchen ist, wenn man den Text wirklich versteht, dann bin ich als Zuhörerin beglückt. Ich
Annette Dasch zählt zu den führenden Sopranistinnen.


Ich wollte gerne mal die Komödiantin in mir rauslassen, weswegen ich mich entschieden habe, auch Operetten zu singen.
glaube nicht, dass es allen auffällt, aber ich merke für mich, wenn der Level auf der Bühne unter einer gewissen Marge ist, dann können die Leute um mich herum begeistert sein, aber ich bin es nicht.
Weil die Sänger(innen) es nur runter singen und nicht verstehen, was sie zum Besten geben? Genau, das gibt es oft. Letztlich retten sie sich mit einer Aufführungstradition, d. h., bei bestimmten Stücken wie Verdi oder Belcanto, wird viel mit Händen und Gestik ausgeglichen. Für mich ist es die absolute Königsdisziplin, dass jeder, der auf der Bühne steht, zu jedem Zeitpunkt genau weiß, in welcher Situation sich seine Figur gerade befindet, also was der Text tatsächlich aussagt. Die Schwierigkeit in der Oper besteht darin, dass man eine Phrase nicht nur einmal singt wie bei Wagner, wo das Stück syllabisch komponiert ist. In vielen anderen Opern, wie Mozart, Rossini oder Bellini, wird oft ein Satz zehn Minuten lang verhandelt. Da sollte man es schaffen, die Dramaturgie wie eine kleine Flamme immer weiter lodern zu lassen. Das ist eine große Aufgabe. Es braucht Seele und Intellekt beim Gesang. Es gibt einige Opernsänger(innen), die das großartig umsetzen und zu Recht sehr erfolgreich sind.
Darf eine erfolgreiche Opernsängerin ein bisschen divenhaft sein? Persönlich empfinde ich Divenhaftigkeit als peinlich, bei mir selbst und bei anderen. Das Entscheidende ist, dass so ein Abend

Facettenreich. Annette Dasch als Rosalinde in der Fledermaus.
Man sollte es schaffen, die Dramaturgie wie eine kleine Flamme immer weiter lodern zu lassen.

Rückblick. Auf das legendäre Leben von Alma Mahler-Werfel.
im Theater stattfinden kann. Dazu ist jeder Einzelne wichtig: seien es die Musiker im Orchestergraben, der Chor, die Techniker hinter der Bühne, Maskenbildner etc. – jeder ist mit seiner speziellen Aufgabe unersetzlich. Deswegen finde ich es unangenehm, wenn jemand glaubt, er könnte mit anderen schlecht umgehen, nur weil er/sie vorne steht. Das entspricht nicht meinem moralischen Kompass. Es gibt Kolleg(inn)en, die unter einem sehr viel höheren Druck stehen als ich, z.B. Anna Netrebko. Bei jemandem, der so exponiert ist wie sie, habe ich vollstes Verständnis, dass sie höhere Ansprüche stellt.
Beim Wort Diva denkt man immer zuerst an eine Frau. Sind manchmal Dirigenten oder Kollegen die größeren Diven? Das ist geschlechterunspezifisch und hat viel mit dem Druck zu tun, der auf den Beteiligten lastet. Es kostet einen viel, diese Arbeit auf einem hohen Niveau jeden Tag, auch an einem Dienstagvormittag um 10 Uhr, abzuliefern. Erst recht, wenn man am Vorabend eine Vorstellung hatte oder gerade angereist und müde ist. Dieses Leben muss man erst einmal bewältigen und sich couragiert ständig wechselnden Konstellationen sowie Situationen stellen. Es gibt kein 08/15 in unserem Job. Wenn ein Regisseur sagt, ich möchte, dass die Szene so gespielt wird, dann sollte man so selbstsicher sein und es ausprobieren. Im Rahmen einer Produktion kommen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus verschiedenen Definitionen von Theater und Oper zusammen – da prallen manchmal Welten aufeinander.
Tauchst Du in die Rolle ab? Ich bemühe mich, ein Zentimeterchen Abstand zu halten, weil eine Überidentifikation zu keinem künstlerischen Mehrwert führt. Sobald ich das Theater betrete und geschminkt werde, widme ich mich aber meiner Rolle mit Haut und Haar.
Du stammst aus einer musikbegeisterten Familie. Was ist das Wichtigste, das dir deine Eltern mitgegeben haben? Ganz viel Enthusiasmus und das Gefühl, dass man alles dafür gibt, dass ein Abend oder eine Aufführung abfliegt.

V.L.: CHRISTIANE SCHWALD-PÖSEL, DAVID BREZNIK, MARTINA KÖBERLE, THOMAS HASCHBERGER, DANIEL REIN UND KERSTIN POLZER
Immer aktuell auf vorarlberg.ORF.at

Wie kommt Recht zustande? Wie viel unsichtbare Arbeit ist notwendig, damit jene Arbeit geleistet werden kann, die gesehen und bezahlt wird? Welche Bedingungen ermöglichen eine geschlechtergerechte Arbeitsteilung? Warum wird Arbeit trotz der Gleichheit als Rechtsprinzip unterschiedlich bewertet? Die Liste der Fragen, die bei einem Gespräch mit Maria Sagmeister virulent werden, ließe sich noch lang fortsetzen.
TEXT VON CHRISTA DIETRICH
Die Rechtswissenschaftlerin ist derzeit bei der Forschungsplattform GAIN an der Universität Wien tätig und wurde für ihre Arbeiten und Publikationen bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor Körner Förderpreis.
An der Forschungsplattform GAIN (Gender: Ambivalent In_Visibilities) sind sechs Fakultäten beteiligt. Diese Plattform widmet sich insbesonders den komplexen Prozessen intersektional vergeschlechtlichter Unsichtbarkeiten. Maria Sagmeister hat Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften studiert. Die Affinität zu Kunst
ist ihr quasi in die Wiege gelegt worden. Die Eltern – Kathleen Sagmeister-Fox und Rudolf Sagmeister – sind Kunsthistoriker, die Familienurlaube wurden oft mit Ausstellungsbesuchen geplant, was sie „immer als sehr spannend“ erlebt hat. „Wie gerne schon kleine Kinder Bilder anschauen, das sehe ich jetzt auch bei meiner Tochter.“ Die Weltoffenheit der Eltern und das zweisprachige Aufwachsen in Vorarlberg hat, wie sie sagt, „den Horizont erweitert“ und in ihrer Sozialisierung eine Rolle gespielt.
Konkret etwas tun. Anwältin hat sie sich als Kind als „tollen Beruf“ vorgestellt, sie war als Jugendliche bei der Aktion kriti-

scher Schülerinnen und Schüler aktiv, hat ein Gespür für Ungerechtigkeiten entwikkelt und sich das Jus-Studium als sinnvollen Weg ausgemalt, um konkret etwas tun zu können. Sie schloss in Wien dann aber zuerst das Studium der Kunstgeschichte ab, definiert Kunst als etwas Wirkmächtiges in der Gesellschaft und hat während des JusStudiums festgestellt, wie sehr sie vor allem die Theorie und die Rechtsphilosophie begeistern. Auch ihre Lehrtätigkeit empfand sie deshalb so erfüllend, weil sie den jungen Studentinnen und Studenten, die an der Uni die ersten Hürden zu durchlaufen hatten, dabei ein kritisches Nachdenken über das Recht mit auf den Weg geben konnte.
Maria Sagmeister. ist in Vorarlberg aufgewachsen. Sie hat das Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien sowie das Studium der Kunstgeschichte jeweils mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie ist Universitätsassistentin bei der Forschungsplattform GAIN am Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien. Zu den Auszeichnungen für ihre Arbeiten zählen der Theodor Körner Förderpreis, der Johanna Dohnal Förderpreis und der Förderpreis der Wiener Juristischen Gesellschaft. Maria Sagmeister ist zudem Redaktionsmitglied der kritischen juristischen Fachzeitschrift „Juridikum“.

Ihre Diplomarbeit in Kunstgeschichte ist durchaus im Kontext ihrer Arbeit im Bereich des Rechts zu sehen. Sie hat anhand von Werken der Künstlerinnen Cathrine Opie, Verena Jaekel und Zanele Muholi untersucht, wie das Porträt als fotografisches Medium bzw. auch als Repräsentationsmedium funktioniert. Untersucht wurde dabei auch die mögliche ermächtigende Funktion der Fotografie. Etwa wenn eine Regenbogenfamilie klassische Familienporträts nachahmt.
Diversität und Quotierung. Stellt sich die Frage, wie Maria Sagmeister die Sichtbarkeit oder Präsenz von Künstlerinnen in Ausstellungshäusern und Museen generell beurteilt? „Wenn ich mich wieder mit Kunstgeschichte beschäftigen würde, wäre meine erste Frage, wie der Kunstkanon überhaupt zustande kommt.“ Es ist eine mühsame, aber wichtige Arbeit, das Schaffen von Künstlerinnen, die lange vergessen wurden, zu eruieren und sichtbar zu machen. Als Beispiel nennt sie die Fotografin Lee Miller, deren Wirken als Kriegsreporterin und Zeugin der Befreiung der Konzentrationslager in Dachau und Buchenwald nun durch einen Film wieder der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Es sei eine gute Entwicklung, wenn feststeht, dass es nicht mehr geht, ein Jahresprogramm eines Ausstellungshauses nur mit Künstlern zu konzipieren. „Diversität hat einen Wert, es werden nicht immer die gleichen Positionen ausgestellt, was auch ein Gewinn für das Publikum

ist. Man darf aber genauso fragen, wo denn die politischen Philosophinnen sind. Es gibt weniger, weil sie patriarchalische Strukturen ausgeschlossen haben. Frauen sind erst seit gut hundert Jahren an den Universitäten, es braucht noch Maßnahmen, um dieser langen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken.“ In der Quotierung sieht Sagmeister da durchaus solche Maßnahmen.
Im Rahmen ihrer aktuellen Forschungsarbeit, zu der ein Buch erscheinen soll, befasst sich Maria Sagmeister mit den theoretischen Grundlagen, die zu rechtlichen Bedingungen der oft unsichtbaren Arbeiten führten, nämlich jener in den Haushalten.
Personenbetreuung. Konkret geht es dabei auch um die Personenbetreuung, die in Österreich von rund 60.000 Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa geleistet wird. Diese Arbeit hat einen Sonderstatus, wobei Gesetze zur Anwendung kommen, die benachteiligend sind. Im seit 2007 bestehenden Hausbetreuungsgesetz sind beispielsweise für Betreuerinnen und Betreuer, die 14 Tage in Österreich arbeiten und dann 14 Tage nach Hause fahren, sehr lange Arbeitszeiten vorgeschrieben. Nach ihren Untersuchungen werden die Arbeitszeitgrenzen voll ausgeschöpft, zudem können fast die gesamten 14 Tage abseits weniger Ruhezeiten als Bereitschaftszeit definiert werden, wobei die Betreuerinnen und
An der Universität Wien waren weibliche Studierende erstmals 1897 zugelassen, Rechtswissenschaften dürfen Frauen dort erst seit 1919 studieren.
Betreuer auch tatsächlich viel zum Einsatz kommen. „Entgegen der üblichen Systematik des österreichischen Arbeitsrechts und auch entgegen der EU-Arbeitszeitrichtlinie sieht das Hausbetreuungsgesetz für ausufernde Bereitschaftszeiten keine Bezahlung vor.“ Häufig müssten zudem Arbeiten getätigt werden, für die die Betreuerinnen und Betreuer an sich nicht zuständig sind. Wie Maria Sagmeister erläutert, geht es auch darum, dass diese Tätigkeit meist als rechtlich weniger geschützte selbstständige Arbeit definiert wird, obwohl sie das in ihrem Wesen nicht ist.
Geschlechtergerecht. Zur Beantwortung der Frage, welche Mechanismen notwendig sind, damit die wichtige, notwendige sowie unbezahlte Sorgearbeit gerechter verteilt wird, sind in ihrem Buch „Geschlechtergerechte Arbeitsteilung“ zahlreiche Anregungen zu finden. Für Maria Sagmeister ist es ein wesentlicher Punkt, die Karenzregelungen so zu gestalten bzw. mit dem Recht stärker so einzugreifen, dass beide Elternteile das Recht haben, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Und: „Es muss für Frauen die gleiche Möglichkeit geben, am Erwerbsleben zu partizipieren. Mein Vorschlag ist es, dass es nicht nur beim Anspruch beider Elternteile auf Karenzzeit bleibt, sondern dass diese zumindest großteils unübertragbar ist.“ Ein neuer Bericht vom Rechnungshof zeige auf, dass die Zahl der Väter, die in Karenz gehen, wieder zurückgegangen ist.
Das Thema ist komplex, auch im Gespräch mit Maria Sagmeister geht es um soziale Erwartungshaltungen, Geschlechterrollen und um die Problematik der sich deshalb stets reproduzierenden ökonomischen Verhältnisse: Es ist schließlich eine Tatsache, dass die Übernahme der Hauptverantwortung für die Sorgearbeit durch die Frauen zu großen Nachteilen in deren Erwerbstätigkeit führt, zu einem geringeren Lebenseinkommen und einer geringeren Pension.
Bezüglich der geschlechtergerechten Arbeitsteilung geht es auch darum, wie das Arbeitsrecht Entscheidungen von Menschen lenkt.



Mit der Eröffnung des neuen Standorts Wien bringen die Dornbirner Wirtschaftsanwälte juristische Expertise und Vorarlberger Geschäftssinn nach Ostösterreich.
TWP begleitet Unternehmen in beide Richtungen – ein Brückenschlag zwischen Wien und Vorarlberg, Süddeutschland und der Schweiz.
Dass Inhaus immer schon etwas anders war, weiß man seit der Gründung.
Statt auf Konkurrenz wurde auf Kooperation gesetzt: Drei ehemalige Mitbewerber entschlossen sich, gemeinsam das Unternehmen Inhaus zu gründen.
„Ein echter Neubeginn mit allen Konsequenzen,“ erinnert sich Geschäftsführer
Robert Küng. Inzwischen ist Inhaus der führende Anbieter von Bad- und Energielösungen und als überregionale Inhaus Gruppe stark gewachsen –der Spirit von damals ist aber heute noch der Erfolgsmotor des Unternehmens.

Der Energy-Carport auf dem Kundenparkplatz verbindet Energiegewinnung und Wetterschutz.
Der neue Bäderpark in Hohenems überzeugt mit seinem hochwertigen Sortiment in jeder Preisklasse mit bewährter Inhaus-Beratung.
Ein Gespräch mit Robert Küng vermittelt Aufbruchsstimmung und Optimismus. Gerade wenn die Marktseite einmal nicht so gut läuft, brauchen wir eine klare Zielsetzung und die Bereitschaft, an unserer Vision festzuhalten, meint Robert Küng. Was heißt das aber im Unternehmensalltag? Die Philosophie von Inhaus ist so einfach wie anspruchsvoll: „Das Thema Qualität setzt sich immer durch – egal in welcher Beziehung. So schaffen wir Stabilität und ein solides Fundament.“
Die Inhaus Strategie orientierte sich von Anfang an der Idee, anders, besser und innovativer zu sein. Dies gilt für die Führung des Unternehmens genauso wie für die vielen kleinen und großen Aufgaben im Arbeitsalltag jeder und jedes einzelnen Mitarbeitenden. Diesen hohen Quali-

tätsanspruch zu leben, erfordert Mut und Konsequenz: Bei der Gründung von Inhaus wurde das Projekt von Brancheninsidern mit Skepsis beobachtet. Fusionen wurden vor allem als Möglichkeit gesehen, Kosten zu senken und Mitarbeitende abzubauen. Es irritierte daher, dass bei Inhaus genau das Gegenteil geplant war. Ein Zusammenschluss von drei regional etablierten Unternehmen mit allen Mitarbeitenden zu einem völlig neuen gemeinsamen Ganzen passte nicht in die gängigen unternehmerischen Konzepte.
GEMEINSAMER ERFOLG VERBINDET
Die Fusion von drei gleichberechtigten Unternehmen auf Augenhöhe war einzigartig und hat sich als nachhaltig erfolgreich erwiesen. Robert Küng: „Entscheidend war, dass wir gemeinsam ein neues Unternehmen auf der grünen Wiese gegründet ha-
Mit Michel Bäder bietet Inhaus zwei einzigartige Showrooms in Hohenems und München.

„Wir wollen unsere Kunden glücklich machen!“ Robert Küng ist stolz auf den neuen Bäderpark in Hohenems, mit der größten Auswahl an Bad- und Wellness-Angeboten im Bodenseeraum.

ben – ohne Rücksicht auf mögliche interne Befindlichkeiten und mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden. Inhaus wurde für alle die gemeinsame neue Marke. So hatte keiner der Mitarbeitenden der einzelnen Unternehmen das Gefühl, etwas von seiner bisherigen Kultur oder Identität aufgeben zu müssen. Es gab für alle gleich viel zu verlieren, aber auch für alle gleich viel zu gewinnen.“
Auch heute agiert Inhaus nach dem Prinzip des Gemeinsamen und Verbindenden. Ein Beispiel dafür sind die langjährigen Partnerschaften mit heimischen Installateuren und Bauträgern, die oft über Generationen vertrauensvoll gepflegt werden. Stabilität bedeutet auch, mit Lieferanten und Partnerbetrieben langfristig zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam für die Kunden weiterzuentwickeln.

Als Chef des „Drei Länder Marathons“ motiviert Robert Küng erfolgreich das InhausMarathon Team zum Mitlaufen.
Eine Führungskraft ist immer auch Vorbild: Was ich von anderen fordere, verlange ich auch von mir.
Großinvestitionen in Technologie und Nachhaltigkeit prägten die letzten Jahre bei Inhaus. Bereits Ende 2021 wurde das gesamte Unternehmen auf erneuerbare Energiesysteme mit Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen umgerüstet – ein echter Mehrwert für das Unternehmen und gleichzeitig für unser Klima. Mit einem weiteren Investitionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro wurden die digitalen Prozesse und die Logistikkapazität ausgebaut. Mit dem modernsten Kleinteilelagersystem Vorarlbergs bietet Inhaus seinen Kunden Wettbewerbsvorteile mit einer deutlich schnelleren und zuverlässigen Auslieferung.
Eine besondere Beziehung verbindet Inhaus mit den Mitarbeitenden. „Menschen sind kein Kostenfaktor, sondern der zentrale Bestandteil unserer vielfältigen Leistungen, und genau so werden sie von uns auch geschätzt und behandelt.“ Diese Haltung
INHAUS GRUPPE:
n Inhaus Handels GmbH (AT) und Inhaus AG (CH): Heizung, Energie, Sanitär, Wellness und Bad, www.inhaus.at, www.inhaus.swiss
n SST: Solarthermie, Photovoltaik, Ladestationen & Energiespeicher, www.sst-energy.com
n Michel Bäder: Premium Bäder mit Showrooms in München und Hohenems, www.michel-baeder.com
KENNZAHLEN 2023
n 265 Mitarbeitende, davon 15 Lehrlinge
n Umsatz: 94 Mio. Euro (wie 2022)
n Eigenkapital: 32,2 Mio. Euro (Eigenkapitalquote 55,6 Prozent)
schafft gegenseitiges Vertrauen und ein starkes Fundament im Unternehmen. Das Team gibt diese Werte in Form von Flexibilität, Einsatz und Loyalität zurück.
Robert Küng: „Wir schaffen einen Mehrwert über Qualität und Leistung, aber auch über die Freude an unserem Tun – unsere Kunden und Mitarbeitenden sind gleichermaßen zufrieden. Dann sind wir als Unternehmen einzigartig, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre individuelle Art diesen Anspruch täglich leben können.“
BEGEISTERUNG IST ANSTECKEND Als passionierter Marathonläufer weiß Robert Küng, dass niemand 42 Kilometer läuft ohne Krisen zu durchleben. 28 Grad und Gegenwind oder Regen und Kälte –das alles gehört dazu, genauso wie man akzeptieren muss, dass man eventuell einmal langsamer durchs Ziel kommt. Auch im Unternehmen gilt, sich nicht von Krisen oder scheinbar schnellen Erfolgen abzulenken, sondern den langfristigen Fokus im Auge zu behalten.
Robert Küng kennt die Parallelen zwischen Sport und Unternehmen aus intensiver eigener Erfahrung: Es braucht konsequentes Training und Vorbereitung, die Freude in guten Teams zu arbeiten, Begeisterung und kritische Distanz, Anpassungsfähigkeit und Dranbleiben. Vor allem aber die Überzeugung, langfristig auf dem richtigen Weg zu sein – denn wer zweifelt, verliert.

ORSON WELLES WAR SCHON MAL DA
Ein klangvoller Name und ganz viele prominente Gäste: Seit dem Jahr 1912 empfängt das Astoria in der Kärtner Straße Schauspieler, Aristokraten, Diplomaten sowie Kunst- und Filmschaffende wie Orson Welles oder die gesamte „Der dritte Mann“-Crew. Nach einer etwa einjährigen Revitalisierungsphase öffnet das Hotel nun wieder seine Pforten, um Gäste aus der ganzen Welt zu empfangen. Rund 15 Millionen Euro flossen in den Umbau des 125-Zimmer-Hauses, das auch eine 70 Quadratmeter große Beletage-Suite mit Balkon bietet. Herzstück ist die Lobby mit Bar, deren Art-Deco-Ambiente beeindruckt. •
astoria-wien.com

NICHT DAHEIM UND DOCH ZU HAUSE
Die Lobby eines 5-Sterne-Hotels als erweitertes Wohnzimmer? Eine luxuriöse Vorstellung, die im 1. Wiener Gemeindebezirk peu a peu Formen annimmt. So entsteht aktuell im ehemaligen Gebäude des früheren Handelsgerichts das Luxushotel Mandarin Oriental – inklusive prachtvoller Residenzen in den oberen Stockwerken. Zukünftige Besitzer der privaten Räumlichkeiten dürfen sich dann nicht nur über eine äußerst mondäne Ausstattung freuen, sondern auch auf den 24-Stunden-Service des Hotels zurückgreifen. Muss ja nicht, wie im Fall von Sänger Pharrell Williams, gleich ein ganzes Hotel sein. •
mo-residencesvienna.com

VOM BEICHTSTUHL ZUM SOCIAL BUSINESS
Vintage und Nachhaltigkeit boomen auch in der Hotellerie. So wurde gerade ein ehemaliges Priesterwohnheim aus den 60er-Jahren vom Vorarlberger Künstler und Architekten Daniel Büchel sowie dem Architekturbüro BWM in ein Hotel umgestaltet. Das Magdas im 3. Wiener Gemeindebezirk wartet mit einem Mix aus alter und neuer Einrichtung auf: Vintage-Stücke wurden repariert und aufgemöbelt oder umfunktioniert. Das Social-Business-Hotel beschäftigt Menschen mit Migrationshintergrund und hilft ihnen, einen Beruf zu erlernen und in der Bundeshauptstadt Fuß zu fassen. • magdas-hotel.at
Der Vorarlberger Manager Stefan
Wehinger prägte die Bahnbranche in Österreich und ist jetzt als Unternehmer im Energiebereich erfolgreich.
TEXT VON ANDREAS SCALET
Wenn Stefan Wehinger am Bahnsteig steht – egal ob in Schruns, Feldkirch oder Wien – kann er auf wesentliche Eckdaten seiner ungewöhnlichen Laufbahn zurückblicken. Er war der Reihe nach Geschäftsführer der Vorarlberger Regionalbahn Montafoner Bahn, die freilich nicht nur auf der Schiene tätig war und ist, sondern neben der Abdeckung mit Bus und Bahn in der südlichsten Talschaft auch in der Elektrobranche und im Medienbereich eine wichtige Rolle spielt. Von dort wechselte Wehinger überraschend in den Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen. Der damalige Verkehrsminister und Vizekanzler Hubert Gorbach ist auf den jungen Geschäftsführer der Mo-Bahn aufmerksam geworden und setzte ihn auf die Shortlist für die Topjobs der ÖBB. „Dass ich für den Job genommen wurde, habe ich nicht erwartet“. Doch so kam es. „Ausschlaggebend war Niki Lauda, damals im Aufsichtsrat der ÖBB-Bahn, der sich für den Nüziger ins Rennen geworfen hat.
Genützt hat ihm dabei seine Erfahrung bei der kleinen Vorarlberger Bahn. „Die Firma ist klein, deshalb war ich als Chef für alles zuständig. Das war die interessanteste Schulung, denn so lernte ich alle Aspekte der Branche und die Branche selbst kennen“, erinnert er sich zurück. Als Vorstand des ÖBB-Personenverkehrs musste er liefern. Und das tat er mit dem Railjet. „Wir benötigten neue Züge und ich informierte mich darüber, wie wir möglichst schnell möglichst gute und günstige Zuggarnituren bekommen.“ Die damals angeschafften Railjet-Züge wurden 2008 in Betrieb genommen und sie kosteten pro Sitzplatz lediglich 28.000 Euro. Zum Vergleich: Ein Sitzplatz im ICE kostet 70.000 Euro. „Der Railjet ist zu 100 Prozent mein Zug“, freut er sich heute noch über die damalige Entscheidung.
Westbahn-Konzept by ÖBB. Doch die Zeit an der Spitze der ÖBB war endlich. Als der SPÖ-Politiker Werner Faymann Bundeskanzler wurde, wurde die traditionelle Rangordnung wieder hergestellt. Wehinger musste sein Büro räumen. Allerdings zahlte ihm die ÖBB einen mehrmonatigen Aufenthalt nach Wahl. Er wählte die renommierte kalifornische Stanford University und mach-

Der Nüziger punktet mit technischem Wissen und Physik-Kompetenz.

te ein MBA-Studium. Ironie der Geschichte: „Ich habe das Projekt Westbahn eingebracht und das Konzept dafür auf Papier gebracht.“ Damit schufen sich die Bundesbahner wenig später ihre eigene Konkurrenz.
Denn wenig später gründete Wehinger mit Bautycoon Hans-Peter Haselsteiner als Partner die erste private Konkurrenz für die ÖBB. Und was kaum jemand weiß: Die Westbahn heißt nicht etwa wegen ihrer Strecke in Richtung Westen so, sondern es sind die Anfangsbuchstaben von WEhinger STefan verrät der Vorarlberger. Und auch die Züge und das Design der Westbahn gehen auf den rührigen Manager zurück. Doch auch bei der Westbahn hielt es ihn nur einige Jahre, seither ist er auch immer wieder in beratender Funktion für Bahnunternehmen in ganz Europa tätig. Über die Expansion der Bahn mit Verbindungen von Wien nach Bregenz und Stuttgart wäre er anderer Meinung als das heutige Management: „Ich weiß nicht ob sich das rechnet, außerdem bieten die ÖBB sehr gute Verbindungen zwischen Vorarlberg und Wien an. Nach seinem Abschied von der Westbahn

Der Pionier. (2. v. l.) bei der Vorstellung seines Geschäftsplans für die erste private Bahngesellschaft.
legte Wehinger sein ganzes Engagement und sein Wissen als Dipl. Ing. und Physiker in ein Vorarlberger Unternehmen, in das er erst als Gesellschafter eintrat, im Jahr 2015 die Geschäftsführung und bis 2018 schließlich die Firma zur Gänze übernommen hat.
Die Kraft aus der Erde. Heute ist er Eigentümer und CEO der Energreen Gruppe mit Hauptsitz in Röthis, die aus der seit den frühen 80er-Jahren vom Bauunternehmen Nägele gegründeten Firma Enercret hervorgegangen ist. „Das Potenzial ist riesig und wir zählen zu den innovativsten und leistungsstärksten Anbietern in der Branche“, erzählt der Techniker, der sich binnen weniger Jahre ein breites Wissen in diesem Spezialgebiet erarbeitet hat und das Unternehmen mit internationalen anerkannten Fachleuten verstärkt hat, die heute in sechs Unternehmen (Enercret Installationen, Energreen Projektentwicklung, Enerplan Planung, Enerlink Produkte, Energiezukunft Schweiz, Enercret Großbritannien) ihre Leistungen anbieten. Leistungen, die die Cambridge University ebenso in Anspruch nimmt wie die Deutsche Bank, aber auch viele private Kunden, die sich auf Anlagen und Expertise aus Vorarlberg verlassen. Aber auch vor Ort und besonders im DACH-Raum wurden über tausend Anlagen in 26 Ländern, oft kombiniert mit anderen Energieträgern, konzipiert, geplant und realisiert. „Enercret ist einer der Weltmarktführer bei Baudienstleistungen im Bereich oberflächennaher Geothermie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden“, informiert der Unternehmer denn auch entsprechend stolz. Im Unternehmen, das er mit vier Mitarbeitern übernommen hat, arbeiten inzwischen über 50 Mitarbeiter, Tendenz weiter steigend.
Führend ist das Röthner Unternehmen inzwischen auch bei CADPlanung und BIM-Berechnungen, um die Effizienz zu verbessern, arbeite man mit den wichtigsten universitären Einrichtungen, zum Beispiel der TU Wien, zusammen. Gebaut werden auch eigene Messgeräte, die bodenphysikalische Parameter direkt und schnell in die Zentrale funken. Mit „Advanced TRT“ gelinge dies, deshalb plane man, diese Technologie ebenfalls auf den Markt zu bringen. Denn Energiesparen sei ein Gebot der Stunde, sagt der Techniker und Physiker mit Blick auf die Energiewende. Und wenn er sich etwas freischaufeln kann, will er sich auch in Zukunft der Eisenbahn widmen, sagt er und hat wohl schon konkrete Projekte in Planung.

Die Herausforderungen der Zukunft sind vielfältig: Nachhaltigkeit und Klimawandel, Künstliche Intelligenz (KI), Innovationen in Gesundheit und Biotechnologie, Urbanisierung und Smart Cities, Digitalisierung und Mobilität. Diese Themen spielen auch eine Rolle bei der Entwicklung moderner Standorte. Mit engagierten Konzepten und umfassendem Know-how arbeitet die PRISMA Unternehmensgruppe an der erfolgreichen Umsetzung zukunftsfähiger Standorte.

Der Millennium Park RHEINTAL vereint Arbeiten und Leben auf einzigartige Weise. Er bietet ein inspirierendes Umfeld für Innovation und Wachstum für nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Software, Produktion und Dienstleistungen. Im südlichen Bereich wird der Millennium Park erweitert – für die Zukunft: ein modernes Produktivquartier mit über 22.000 m².
Wir nennen es Orte gestalten.
Es mag wie eine Floskel klingen: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prägen ein Unternehmen.“ Doch Menschen wie Ferdinand Boss (90) sind der beste Beweis dafür, dass schöne Sprüche zur Realität werden können – und das über Generationen. Ein kleiner Blick zurück auf seine Karriere.
Eigentlich wollte ich erst noch in die Industrie“ – diese Gedanken gehen Ferdinand Boss im Dezember 1961 durch den Kopf, als er gebeten wird, sich doch bei den Vorarlberger Illwerken als junger Ingenieur mit Elektrotechnik-Studienabschluss in der Tasche zu melden. Mag es das berufliche Vorbild des Vaters Romed Boss oder die persönliche Verbindung aus Kindertagen zum Unternehmen gewesen sein: Nachdem er seine Zelte in Wien abgebrochen hatte, wurde Ferdinand Boss tatsächlich bei den Illwerken vorstellig, am 1. Februar 1962 trat er seinen ersten Arbeitstag an.
Im Kraftwerk daheim. Sein Weg führte ihn zunächst als Betriebsassistent ins Obervermuntwerk. „Dort war ich ein halbes Jahr stationär im Kraftwerk“, erinnert sich Ferdinand Boss zurück. „Wir haben Schichtdienst gemacht, Pläne korrigiert, gezeichnet. War eine interessante Tätigkeit.“ Und eine geselli-
ge Zeit. „Wir waren ein paar junge Burschen im Kraftwerk – und die Saarbrücker Hütte war nicht weit. So sind wir nach Dienstschluss manchmal hinaufgewandert und haben dem Hüttenwirt die Post gebracht. Dann wurde Karten gespielt, ein Bier getrunken und viel gelacht.“ Das Vermuntwerk sollte zwei Jahre lang die nächste Station sein, bevor es schließlich ins Rodundwerk ging, wo er nach zwei Jahren die Pensionsnachfolge des Betriebsleiters übernahm. Dort erwartete Ferdinand Boss eine sehr interessante Aufgabe. „Das Werk war ja 1943 in Betrieb gegangen und kriegsbedingt materiell nicht so gut ausgestattet. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern sollte ich das Kraftwerk – wie man heute so schön sagt – ‚fit für die Zukunft‘ machen. Transformatoren wurden erneuert, Maschinen revidiert ... eine spannende Herausforderung.“ Ebenso wie der Bau des Rodundwerks II und des Walgauwerks. Zu dieser Zeit war Ferdinand Boss bereits Leiter der Hauptabteilung

Wirkungsstätte. Das Rodundwerk I in Vandans in den 1970er-Jahren.
Betrieb und zuständig für den Betrieb der Anlagen im Montafon mit allem, was dazugehört, von Staumauern und Stollen bis hin zu Bachfassungen und Bahnen.
Ein umfangreiches Portfolio, das ohne eine gute Mannschaft wohl nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. „Meine Mitarbeiter haben mich zum Glück immer unterstützt.
Mein berufliches Vorbild war mein Vater. Schon als Bub nahm er mich mit auf die großen Baustellen der Illwerke.

Mit ehemaligen Kollegen wie Hannes Wiederin stöberte Ferdinand Boss (re.) anlässlich von „100 Jahre Energie aus Vorarlberg“ durch das Archiv der illwerke vkw. Ihre Erinnerungen hielten auch Einzug in das Buch und den Film zum Jubiläum.

Mittlerweile sind alle in Pension. Aber es gibt im Montafon einen Stammtisch, da werden Geschichten von früher ausgetauscht und es wird auch darüber gesprochen, was heute so passiert. Bei so manchem ist ja auch die nachfolgende Generation bei der illwerke vkw tätig.“ Die drei Töchter von Ferdinand Boss zog es hingegen allesamt in andere Bereiche. Dennoch: Ein Enkel ist heute bei vorarlberg netz tätig. Jakob Erne ist somit dem Beispiel von Opa und Ur-Opa gefolgt – und sogar dem von Ur-Ur-Opa Dr. Josef Mittelberger, der Mitbegründer der Vorarlberger Illwerke war.
Mit Ehrlichkeit. Zahlreiche Bilderalben hat Ferdinand Boss zu Hause in Lochau, durch die er immer wieder gerne blättert und zurückreist in die Kindheit im Montafon. Als er 1934 geboren wird, ist sein Vater Romed bereits bei den Illwerken und erster Betriebsleiter des Vermuntwerks. „Als kleiner Bub hat er mich mit auf die Baustellen genommen. Silvrettastaumauer, Obervermuntwerk … Bereits damals hat mich die Technik fasziniert und ich konnte viel für
mich mitnehmen.“ Auch, dass Ehrlichkeit an erster Stelle steht. „Das habe ich von meinem Vater übernommen. Er war ein strenger Mann, der aber immer das persönliche Gespräch mit seinen Mitarbeitern suchte. Diese schätzten das sehr und waren stets bereit, zu helfen.“ Auch Ferdinand Boss ist heute noch stolz auf das gute Verhältnis, das er ebenfalls zu seinen Mitarbeitern hatte: „Ich kann mich noch erinnern an einen Abend, an dem wir Faschingsball in Rodund feierten. Plötzlich gab es um 4 Uhr morgens eine Großstörung im Rodundwerk II – und sofort sind alle Männer ganz selbstverständlich los. In unseren Anzügen stiegen wir in die Maschine, um alles zu kontrollieren. Zum Glück war es nur eine Fehlauslösung der Schutzeinrichtung und wir konnten im Anschluss zurück zu unseren Frauen und bis in die Morgenstunden weiterfeiern.“
Eine schwierige Zeit. Doch Grund zum Feiern gab es im Montafon nicht immer. Es waren dunkle Stunden, die mit dem Zweiten Weltkrieg Einzug hielten. „Wir als Kinder haben nicht so viel mitbekommen. Ich
habe vor allem in Erinnerung, dass es im Frühjahr 1945 bei uns daheim sehr hektisch zuging.“ Grund dafür waren die Treffen der Widerstandsbewegung, die sein Vater gegen Ende der Kriegszeit mit einigen Mitarbeitern gegründet hatte. Sie wollten die Kraftwerke vor der Zerstörung durch das Deutsche Militär retten. „Die Werksanlagen sollten nämlich gesprengt werden, um sie nicht dem Feind zu überlassen.“ Es kam zu gefährlichen Aktionen und brenzligen Situationen. „Mein Vater hat damals sein Leben riskiert“, wurde es Ferdinand Boss viel später bewusst.
Es gäbe noch so manche Geschichte zu erzählen. Über die Studienzeit in Wien, in der er auch seine Frau kennengelernt hat, die damals schon weitsichtige Planung der Pioniere … Auch 27 Jahre nach Pensionsantritt lässt die illwerke vkw Ferdinand Boss nicht los, seine Begeisterung ist immer noch zu spüren. „Mein Träume haben sich erfüllt. Es war immer mein großes Ziel, wie mein Vater Betriebschef über die Kraftwerke zu werden. Dies ist mir gelungen.“

Kendlingers K&K Philharmoniker –hier im Konzerthaus Kopenhagen
Die K&K Philharmoniker bringen am 14. Jänner 2025 unter der Leitung von Max Kendlinger ein unwiderstehliches "Donau-so-blau-Gefühl" ins Feldkircher Montforthaus – ein musikalischer Hochgenuss für alle Sinne.

Weit über eine Million Besucher können ein Lied davon singen: Die Wiener Johann Strauß Konzert-Gala sprüht vor Elan, ist völlig frei von Altersfalten und verbreitet dieses unwiderstehliche „Donau-soblau-Gefühl“! Und dafür muss man nicht einmal nach Wien reisen – Wien kommt nach Feldkirch! Seit 1996 wissen die Fans des K&K-Klassikers, worauf sie sich von Mailand bis Oslo, von Lissabon bis Berlin verlassen können – auf bestes musikalisches Kaiserwetter!
Mit all seinem Schmäh, seinem Flair und Operettencharme, zieht das Original des Tausendsassas Matthias Georg Kendlinger mit seinen K&K Philharmonikern Publi-
kum und Presse in seinen Bann. Immer gut gelaunt agiert am Pult Filius Max Kendlinger. Freuen Sie sich auf Titel wie G’schichten aus dem Wienerwald, Wein, Weib und Gesang, Vergnügungszug und den Csárdás aus Ritter Pásmán und genießen Sie zum Konzert-Highlight mit Kultstatus ein ergötzendes Bad im Jungbrunnen der Strauß-Dynastie.
Programm-Details & Tickets: www.kkphil.at

Erleben Sie mit uns den Bodensee.


Betriebsausflüge und Firmenfeiern
Ideal für Ihre Weihnachtsfeier
Magic Christmas Cruise auf der Oesterreich

Firmenjubiläen

Kundenevents
Chartern Sie das elegante Art déco-Motorschiff Oesterreich oder das einzigartige Jugendstil-Dampfschiff Hohentwiel und wir sorgen für Erinnerungen, die ein Leben lang halten.
Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Doch was bedeutet es für Unternehmen tatsächlich konsequent ökologisch zu wirtschaften? – „kontur“ hat sich in einer kleinen Bestandsaufnahme versucht: von EU-Regularien, über sich wandelnde Konsumentenwünsche bis hin zu unternehmerischen Innovationen, Pionieren und ihrer Vorreiterrolle auf dem Markt der Konsumgüter.

Viele Unternehmen werben mit Nachhaltigkeit. Doch wohlklingende Lippenbekenntnisse reichen heute längst nicht mehr aus. Unternehmen müssen handeln – nicht nur um ökologischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen, sondern auch um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, denn der Druck von Regierungen, Konsumenten und Investoren wächst.
Die Dringlichkeit dieses Themas wird durch globale Probleme wie dem Klimawandel, steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie die Vermüllung der Meere deutlich. Die Vereinten Nationen haben aus diesem Grund mit den 2015 verabschiedeten Sustainable Development Goals (SDGs) eine Grundlage geschaffen, die ökologische und soziale Nachhaltigkeit für alle zur Pflicht macht –auch für Unternehmen. Diese 17 Ziele fordern
unter anderem Maßnahmen in den Bereichen Ernährung, Bildung, Energie, Umwelt etc., um eine nachhaltige Entwicklung bis zum Jahr 2030 zu gewährleisten.
Generell werden die regulatorischen Anforderungen in diesem Bereich immer weiter verschärft. In der EU gibt es beispielsweise seit 2023 das Lieferkettengesetz, welches Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten verpflichtet, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten, d. h., Schutz der Umwelt, keine Kinder- oder Zwangsarbeit, faire Löhne etc. Weitere Gesetze wie die EUTaxonomie und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) definieren, was als nachhaltige Wirtschaftsaktivität gilt und wie darüber berichtet werden muss. Diese Vorgaben erhöhen den Druck auf
Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen transparent abzubilden.
KONSUMENTEN UND KAPITAL
Doch die Regularien der EU sind nicht der einzige Antrieb für den Wandel (auf nationaler Ebene hat es sich Österreich zum Ziel gesetzt, bis spätestens zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein). Nachhaltigkeit ist im Mainstream angekommen, und immer mehr Verbraucher achten darauf, welche Produkte sie kaufen. Deswegen setzten Startups und etablierte Unternehmen auf nachhaltige Inhaltsstoffe, Verpackungen, vegane Lebensmittel, Recycling und Abfallentsorgung, denn die Konsumenten sind bereit, einen Aufpreis dafür zu zahlen.
Apropos Finanzen: Auch Investoren wollen zunehmend wissen, in welche Betriebe ihr
Ökonomisch und ökologisch tragfähig
Zahlreiche Vorarlberger Unternehmen beweisen mit viel Know-how und Innovationskraft, dass nachhaltige Lösungen machbar und auch profitabel sind.

Kapital fließt und legen Wert auf nachhaltige Investments. Banken berücksichtigen bei ihrer Kreditvergabe verstärkt diese Aspekte. Insgesamt gewinnt das Thema Sustainable Finance, also eine nachhaltige Finanzierung, in den letzten Jahren an Bedeutung.
WIRTSCHAFTLICHE CHANCEN
Doch das „Feld“ bietet nicht nur regulatorische Hürden, sondern auch wirtschaftliche Chancen. Unternehmen, die auf nachhaltige Geschäftsmodelle setzen, können ihre Marke stärken, neue Zielgruppen erschließen und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen z. B. Effizienzsteigerungen, durch das Recycling von Rohstoffen, sowie das Senken von (Energie-)Kosten. Im Idealfall winkt die Vorreiterrolle in der Branche, eine Art Leuchtturm im Meer der Konsumgütermarken. Doch die Transformation erfordert, dass Nachhaltig-
keit auf höchster Führungsebene verankert und in Innovationsprozesse eingebunden wird. Eine integrierte Strategie, die sowohl ökonomische als auch ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt, wird zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Zahlreiche Vorarlberger Unternehmen zeigen, dass nachhaltige Lösungen nicht nur machbar, sondern auch profitabel sind. Durch den Einsatz digitaler Technologien werden unter anderem Abfälle reduziert, Plastikmüll vermieden, regenerative Energiequellen oder CO2-emissions-reduzierende Technologien genutzt. Letztlich zeigt das politische Hickhack um Verbrenner-Aus & Co., wie stimmungsabhängig die Politik agiert und radikale Veränderungen durch die Regierung in punkto Nachhaltigkeit nur dort möglich sind, wo die Wirtschaft Lösungen bereithält, die technisch und ökonomisch tragfähig sind.
Im Idealfall winkt die Vorreiterrolle in der Branche – eine Art Leuchtturm-Funktion im „Meer“ konkurrenzierender Konsumgütermarken und Märkte.
Blum setzt in der Abfallwirtschaft und im Abfallmanagement auf digitale Lösungen für effizienten Umweltschutz und Ressourcenschonung.

Als metallverarbeitendes Industrieunternehmen ist sich der Höchster Beschlägehersteller seiner Verantwortung bewusst, mit den benötigten Ressourcen so nachhaltig und schonend wie möglich umzugehen. Die Maxime lautet „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Kreislaufwirtschaft ist bei Blum nicht nur ein Schlagwort, sie wird auch gelebt: „Wir denken bereits bei der Entwicklung unserer Produkte die Aspekte der Wiederverwendung und Recyclingfähigkeit mit. Das beginnt bei der Materialwahl und hört auch bei den Abfällen, die im Fertigungsprozess anfallen, nicht auf“, erklärt Laura Erhart, Abfallbeauftragte bei Blum. Eine umsichtige Abfallwirtschaft und ein effizientes Abfallmanagement spielen dabei entschei-

„96,72
% aller Abfälle,
die in unseren österreichischen Standorten 2023/2024 anfielen, konnten stofflich recycelt werden.”
Laura Erhart
Abfallbeauftragte bei Blum
Metallabfälle werden mittels Strichcodes sortiert. Über Füllstandanzeiger an den Silos disponiert der Entsorgungspartner die Abfälle selbstständig.
dende Rollen. Das betrifft die Vermeidung von Abfällen genauso wie die systematische Sammlung für eine nachfolgende stoffliche Verwertung. Vor diesem Hintergrund treibt Blum die Automatisierung und Digitalisierung des unternehmenseigenen Abfallwirtschaftssystems konsequent voran.
DURCHDACHTES SYSTEM
Am Standort 11 in Bregenz etwa werden die Abfälle – ob Verpackungskunststoffe, Papierverpackungen oder Restmüll – in Umleerbehältern gesammelt. Die Behälter werden, so Laura Erhart, „mittels eines eigens installierten Schienensystems vor drei 22-m3-Presscontainer geschoben und in diese entleert. Mit dem Schienensystem
sparen wir Zeit und erhöhen gleichzeitig die Arbeitssicherheit. Weil wir das Material verpressen, reduzieren wir außerdem das Volumen und vermeiden unnötige Transportfahrten. Die Presscontainer verfügen über Fernmelder, die das Entsorgungsunternehmen automatisch verständigen, sobald die Container geleert werden müssen.“ Ähnliches gilt für Metallabfälle, wie sie beispielsweise im Dornbirner Werk 8 anfallen. „Diese werden“, so die Expertin, „mittels Strichcodes sortiert und danach sortenrein in 12 Silos gesammelt. Unsere Entsorgungspartner haben über eine eigens entwickelte Software Zugriff auf den aktuellen Füllstand und können die Abholungen selbstständig disponieren und durchführen.“ Danach werden die Metallabfälle recycelt und können im Stoffkreislauf erhalten bleiben – ein gutes Beispiel für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.
DIGITALE ABFALLWIRTSCHAFT
Die Automatisierung findet bei Blum nicht nur im Bereich der industriellen Produktion statt – auch beim „normalen“ Müllsammeln greift das Familienunternehmen auf smarte, digitale Technologien zurück. So stehen auf dem Firmengelände solarbetriebene und mit Sensoren ausgestattete Mini-Container, in
denen Abfall gesammelt und verpresst wird. Die Sensoren ermöglichen es auch, die Füllstände per App zu überwachen.
Der Einsatz moderner Technik im Abfallmanagement macht nicht nur die Prozesse effizienter, sondern hat auch den Vorteil, dass die entsprechenden Daten besser ausgewertet werden können. Dadurch ist es leichter, Optimierungspotenziale zu erkennen und die unternehmensweiten Nachhaltigkeitsmaßnahmen laufend weiterzuentwickeln. „Die Auswertung unserer Abfallmengen bestätigt unsere Bemühungen: Im Wirtschaftsjahr 2023/2024 konnten 96,72 % aller Abfälle, die in unseren österreichischen Standorten anfielen, von unseren externen Partnern stofflich recycelt werden", fasst Laura Erhart zusammen.
Das entspricht über 50.000 Tonnen an Abfällen, die nicht die Umwelt belasten, sondern als Wertstoffe neuerliche Verwendung finden. Ein gutes Beispiel dafür, was ein Industriebetrieb zur Schonung von Ressourcen und damit zum Schutz unseres Planeten unternehmen kann. Das entsprechende Bewusstsein für eine effiziente Kreislaufwirtschaft vorausgesetzt.
Blum lebt Kreislaufwirtschaft. Bereits bei der Entwicklung werden Aspekte der Wiederverwendung mitgedacht.

Das Entleeren der Abfälle erfolgt mittels effizientem Schienensystem, das die Arbeitssicherheit erhöht.

Die Mini-Container für Restmüll haben Sensoren – der Füllstand wird per App überwacht.
• Presscontainer mit Schienensystem
• Strichcodes ermöglichen sortenreines Sammeln der Metallabfälle in Silos
• Eigene Software für Zugriff auf aktuellen Füllstand
• Entsorgungspartner disponiert Abholungen selbstständig
• 96,67 % aller Abfälle an österreichischen Standorten wurden 2023/2024 stofflich recycelt
JULIUS BLUM GMBH Industriestraße 1 6973 Höchst www.blum.com
Die Umsetzung von ESG-Konzepten bringt Unternehmen in eine bessere Marktposition. Ein Gespräch mit Topmanagerin Ana-Cristina Grohnert.
Die Hypo Vorarlberg hat mit Topmanagerin Ana-Cristina Grohnert eine Verfechterin eines neuen Verständnisses von wertschöpfendem und wertschätzendem Wirtschaften zum Business Frühstück beim Dorfinstallateur in Götzis eingeladen. In ihrem Vortrag motivierte sie Unternehmerinnen und Unternehmer, sich den komplexen Herausforderungen in der Umsetzung von ESGRichtlinien mit innovativen Lösungsansätzen zu stellen – erkenntnisreich und inspirierend zugleich! Wilfried Amann, Vorstand der Hypo Vorarlberg, im Gespräch mit Ana-Cristina Grohnert über eine ESG-Betrachtung abseits von Compliance-Anforderungen.
Amann: Wie können Sie Ihre ESG-Betrachtung kurz auf den Punkt bringen?

„Nachhaltigkeit
wirkt als Katalysator für Innovationen, erschließt neue Märkte und verbessert das Risikomanagement.“
Ana-Cristina Grohnert Unternehmerin
Grohnert: Traditionell zielten Unternehmen in erster Linie darauf ab, den Shareholder Value zu maximieren. Heute geht es verstärkt um den Stakeholder Value – sprich nicht nur die Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre, sondern auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kundinnen und Kunden, Gemeinden und der Umwelt sind zu berücksichtigen. Dieser Wandel vom Shareholder Value zum Stakeholder Value zeigt die wachsende Bedeutung von ESG-Kriterien in der Geschäftswelt. Allerdings bringt ESG auch eine komplexe Dynamik für Unternehmen mit sich. Bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien bewegen sich Unternehmen immer im Spannungsfeld zwischen Compliance und der Erschließung von Potenzialen.


Amann: Viele Unternehmen verbinden mit ESG hauptsächlich eine ComplianceOrientierung zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
Grohnert: Compliance ist aber nur der erste Schritt. Nachhaltigkeit bietet darüber hinaus weitreichende Potenziale: Sie wirkt als Katalysator für Innovationen, erschließt neue Märkte und verbessert das Risikomanagement. Und schließlich erhöht ein glaubwürdiges Nachhaltigkeitskonzept das Unternehmensimage sowie die Kundenbindung, was sich wiederum positiv auf die Vertriebseffizienz auswirkt.
Grohnert: Wie nehmen Sie als Bank dieses Thema wahr?
Amann: Wir stellen fest, dass eine gute Nachhaltigkeitsstrategie im Sinne der ESG-Kriterien ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der wesentlichen Wert- und Wachstumstreiber und damit auf den Unternehmenswert hat. Und in der jüngsten Krise ist deutlich geworden, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen in der Regel deutlich widerstandsfähiger sind. Im Falle von Unternehmenstrans-
aktionen ist zu beobachten, dass fehlende ESG-Strategien und -Konzepte mittlerweile zu erheblichen Abschlägen bei den Bewertungen führen. Bei vielen Unternehmen geht es daher um das rechtzeitige Planen und Umsetzen von Investitionen in die eigene Transformation. Wir als Bank können und sollen zudem unsere Datenkapazitäten und unser Risikoverständnis nutzen, um die Unternehmen bei der Erhebung und Analyse von Daten über die Nachhaltigkeit ihres Betriebs zu unterstützen.
Grohnert: Das bedeutet also, dass Sie nicht nur als ausgelagerte „Datenbüros“ auftreten?
Amann: Genau. Der Anspruch sollte darüber hinaus sein, Rahmenbedingungen, Leitlinien für Best Practices und Benchmark-Daten zur Verfügung zu stellen. Die Möglichkeiten, auf diese Weise Kundenbeziehungen deutlich zu verbessern und –für beide Seiten vorteilhafte – Wege der Zusammenarbeit zu finden, sind erheblich. Nachhaltig agieren bedeutet für uns auch Orientierung für Kundinnen und Kunden zu bieten. Klar ist: Die Nachfrage nach ESG-
Ein glaubwürdiges Nachhaltigkeitskonzept verbessert die Kundenbindung und das Unternehmensimage.
Dienstleistungen wird immer weiter steigen. Denn je mehr der Gesetzgeber die Unternehmen fordert, die Folgen ihres Handelns offenzulegen, desto größer ist der Anreiz für sie, korrigierend einzugreifen. Dies gilt auch für das KMU-Segment, das bisher noch nicht im Fokus des Gesetzgebers steht, aber sehr wahrscheinlich bei der Umsetzung wichtiger Maßnahmen Schritt für Schritt nachziehen muss.
Amann: Aber darauf zu warten, macht aus Ihrer Perspektive wenig Sinn, oder? Grohnert: Richtig. Denn wirksame Nachhaltigkeitsstrategien erfordern ein holistisches Verständnis, das über reine Compliance hinausgeht und die Chance erkennt, durch nachhaltiges Handeln Wettbewerbsvorteile und langfristige Werte zu schaffen. Nachhaltigkeit muss als Querschnittsmaterie verstanden werden, die das Engagement aller Unternehmensbereiche erfordert. Mit einer solchen integrierten Strategie können Unternehmen nicht nur ihren regulatorischen Verpflichtungen nachkommen, sondern auch aktiv an ihrer eigenen Zukunftsfähigkeit arbeiten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Mehr Eindrücke zum Business Frühstück der Hypo Vorarlberg finden Sie unter: www.hypovbg.at/newsroom
HYPO VORARLBERG
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz +43 50 414-1000 www.hypovbg.at
Die illwerke vkw investiert in nachhaltige Projekte und setzt dabei auf Wasserkraft und Innovation.

Die Energiezukunft steht im Zeichen der Nachhaltigkeit – und Vorarlberg ist bestens gerüstet, um eine führende Rolle in der klimafreundlichen Energieversorgung zu übernehmen. Die illwerke vkw setzt dabei auf ihre wichtigste Ressource: Wasserkraft. Als zukunftsorientierter Energiedienstleister verfolgt das Unternehmen klare Ziele, um Vorarlberg auf den Weg zur Energieautonomie zu führen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren.
LEUCHTTURMPROJEKT LÜNERSEE II
„Die Herausforderung unserer Zeit liegt in der Umstellung auf erneuerbare Energien. Während die Stromerzeugung mit Wind und Sonne stark schwankt, bietet die Wasserkraft eine flexible Lösung, um
die Lücken in der Versorgung zu schließen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Christof Germann. „Pumpspeicherkraftwerke wie das Kopswerk II und das Obervermuntwerk II, die als ‚Batterien der Alpen‘ bezeichnet werden, spielen eine zentrale Rolle in diesem nachhaltigen Energiesystem. Sie ermöglichen es, überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen – besonders in Zeiten, in denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.“ Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie 2040 der illwerke vkw ist die stetige Weiterentwicklung der Infrastruktur. Mit dem Leuchtturmprojekt Lünerseewerk II werden neue Maßstäbe in der europäischen Energieversorgung gesetzt.
Gleichzeitig plant das Unternehmen den Ausbau der Kleinwasserkraft und die Integration weiterer nachhaltiger Technologien wie Photovoltaik und Windkraft. Der gezielte Ausbau erneuerbarer Energien in Vorarlberg und die Beteiligung an Windkraftanlagen in Norddeutschland sind klare Schritte, um den Anteil an klimafreundlicher Energie weiter zu steigern.
WERTSCHÖPFUNG IN VORARLBERG Doch Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur saubere Energie. Die illwerke vkw investiert massiv in die Zukunftsfähigkeit des Energiesystems und in die Versorgungssicherheit für die Menschen in Vorarlberg. Bis 2040 werden rund 9 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, Infrastruktur und
Auch die Lehre ist für die illwerke vkw von großer Bedeutung. Geht es doch darum, die Fachkräfte von morgen auszubilden.
Dienstleistungen fließen. „Diese Investitionen stärken nicht nur die Energieversorgung. Ein Großteil der Wertschöpfung bleibt in Vorarlberg und der Region, tausende Arbeitsplätze werden in den nächsten Jahren durch diese Maßnahmen gesichert“, führt Vorstandsmitglied Gerd Wegeler aus. „Die Projekte sind also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nachhaltig – für die Bevölkerung und die lokale Wirtschaft.“
Mit weiteren Initiativen gestaltet die illwerke vkw die Zukunft der Energieversorgung aktiv mit und unterstützt Haushalte und Unternehmen dabei, ihre Energieeffizienz zu steigern. So bietet die illwerke vkw umfassende Dienstleistungen im Bereich Wärme, darunter mehrere Nahwärmeprojekte auf Basis von Biomasse. In der Elektromobilität wird die öffentliche Ladeinfrastruktur kon-

tinuierlich ausgebaut, um den Umstieg auf E-Autos zu erleichtern. Auch der Ausbau des Glasfasernetzes wird vorangetrieben, da schnelle und zuverlässige Datenverbindungen eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen Entwicklung der Region spielen.
DEN GRUNDSTEIN LEGEN
Während das Unternehmen auf eine 100-jährige Geschichte der Wasserkraft zurückblicken kann, liegt der Fokus klar auf der Zukunft. Nachhaltigkeit und Innovation sind die treibenden Kräfte, die die illwerke vkw dabei unterstützen, den Wandel aktiv zu gestalten. Die Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur sichern nicht nur die Versorgung von heute, sondern legen den Grundstein für eine klimafreundliche Energieversorgung von morgen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.illwerkevkw.at


Pumpspeicherkraftwerke wie das geplante Lünerseewerk II leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiezukunft in Europa.
ILLWERKE VKW AG
Weidachstraße 6 6900 Bregenz +43 5574 601-0 www.illwerkevkw.at









gemeinsam besser leben







Jetzt beraten lassen!


Machen Sie mehr aus Ihrem Geld, nutzen Sie die Chancen am Kapitalmarkt und starten Sie mit Ihrer grünen Veranlagung.




uniqa.at









Regionale Landwirte wie Esther und Andreas Bitschnau zeigen, wie sie Rindfleisch umweltverträglich und tierfreundlich produzieren.
Immer wieder steht der Genuss von Rindfleisch wegen mancher Haltungsform oder der CO2-Emissionen bei der Produktion in der Kritik. Dass es auch anders geht, zeigen viele regionale Bäuerinnen und Bauern.
Den Sommer haben die Rinder von Esther und Andreas Bitschnau auf der Alpe verbracht und sich von frischem Gras und saftigen Kräutern ernährt. Zurück am Hof werden sie mit bestem Heu gefüttert. Der BioBetrieb der Familie Bitschnau in Bartholomäberg hat sich für die Mutterkuhhaltung entschieden und stellt das Tierwohl in den Vordergrund. Wenn die Tiere dann geschlachtet werden, wird das Fleisch unter der Marke „BärgLand“ verkauft und trägt das Ländle Gütesiegel. Schließlich halten sich die Bitschnaus an die Richtlinien für Ländle Alprinder.
VORARLBERG ALS VORBILD
Dies entspricht so gar nicht dem vielmals in den Medien vermittelten Bild einer Massentierhaltung, die es leider in vielen Teilen der Welt auch gibt. Daher ist der Griff ins Regal des Supermarktes so entscheidend. Mit der Wahl des einen oder anderen Produkts wird auch das eine oder das andere System der Tierhaltung unterstützt.
Neben dem Tierwohl darf auch der KlimaAspekt nicht vernachlässigt werden, denn Fleisch ist nicht gleich Fleisch. In manchen Regionen der Welt wird auf riesige Rinderherden gesetzt, wo die Tiere häufig mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert werden, für dessen Anbau Regenwald gerodet wurde. In Österreich und insbesondere Vorarlberg ist im Gegensatz dazu der Grünlandanteil sehr groß, was dazu beiträgt, Futterimporte klein zu halten. Bei Fleisch mit Ländle Gütesiegel wird überdies gentechnikfreies Futter vorgeschrieben, um den Einsatz von Futtermitteln aus ehemaligen Regenwaldgebieten auszuschließen. Österreich weist bei Rindfleisch übrigens mit 14,2 kg CO2-Äquivalente den niedrigsten Fußabdruck in der EU aus (durchschnitt 22,2 kg) und belegt damit neben dem hervorragenden Geschmack auch hier die Spitzenposition.
Daher: Beim Kauf von Fleisch unbedingt auf regionale Produkte mit hohen Tierwohlstandards achten! Das hilft der Region, dem Klima und dem guten Gewissen. Und das Ländle Gütesiegel hilft Ihnen bei der Auswahl – sowohl im Supermarkt als auch direkt beim Landwirt, wie beispielsweise bei Familie Bitschnau aus Bartholomäberg.

LÄNDLE QUALITÄTSPRODUKTE MARKETING GMBH
Montfortstraße 11/7 6900 Bregenz +43 5574 400–700 www.laendle.at

Man kommt auf die Welt, um einen Porsche 911 zu fahren. Man kommt aber nicht unbedingt auf die Welt, um einen Porsche Macan zu fahren.

Insofern ist der Verkaufserfolg des Macan auf Menschen zurückzuführen, die genau wissen, was sie sich dabei überlegt haben. Zum Beispiel, weil sie Porsches erstes vollelektrisches SUV fahren wollen – als Superlativ des sportlichen Zugangs zum State of the Art angewandter Elektromobilität.
BEEINDRUCKENDE PERFORMANCE
Ungefährdetes Topmodell ist der Macan Turbo mit 430 kW/584 PS, der ein Drehmoment von 1130 Nm stemmt. Der Turbo schafft 260 km/h Spitze, der Macan 4
220 km/h. Jetzt verdoppelt Porsche das Modell-Angebot um einen reinen Hecktriebler namens Macan und um einen allradgetriebenen Macan 4S. Während beim Macan auf hohe Effizienz und Reichweite geachtet wird (641 km laut WLTP), verfügt der 4S ebenso wie die eingangs erwähnten Modelle über das elektronisch geregelte Porsche Traction Management (ePTM), das die Antriebskraft rund fünf Mal schneller zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt als ein konventionelles Allradsystem. Als Höchstgeschwindigkeit ist dem 4S
Tempo 240 eingeschrieben, die Reichweite laut WLTP beträgt 606 km. In nur 4,1 Sekunden schafft er es auf 100 km/h. Die neuen Modelle profitieren von der Porsche Premium Platform Electric, die eine effiziente DC-Ladeleistung bis an die 270 kW ermöglicht. Außerdem wurde ein Offroad Design Paket geschnürt. Damit erhöht sich die Bodenfreiheit um 10 mm, auch der vordere Böschungswinkel steigt dank modifizierter Frontstoßstange. Mit der Elektrifizierung des Macan hat Porsche auch ein neues Anzeige- und Steuerungssystem
eingeführt. Die Porsche Driver Experience umfasst eine Mischung aus digitalen und analogen Elementen, darunter ein 12,6-Zoll Curved Display und ein 10,9-Zoll Passenger-Display. Neu im Macan sind ein Head-up-Display mit AR-Technologie und eine Ambiente-Beleuchtung.
HIGH-TECHNOLOGY-FEELING
Der Elektro Macan ist dank seiner freien Proportionen, seiner geringen Überhänge, der flachen Fronthaube mit den definierten Kotflügeln und seiner ansprechenden Farben ein betörend gut aussehendes SUV, das sich innen als Ausstattungswunder erweist. So edel, so makellos sauber verarbeitet, dass man gerne über den etwas beschränkten Platz auf den Rücksitzen hinwegsieht, der dem sportlichen Dachverlauf geschuldet ist.
Den Macan 4S erkennt man gegenüber Macan und Macan 4 an den spezifischen Rädern, den Seitenscheibenleisten aus Silber und an den roten Bremssätteln. Serienmäßig in allen Modellen ist die neue Wel-


come- und Leaving-Inszenierung. Der Macan Turbo inszeniert sich optisch mit Kontrastmarkern in Schwarz hochglanz oder der Sonderfarbe Turbonit. Man erkennt ihn nachts an Matrix-Scheinwerfern und blind am Geruch des Lederpakets, wenn man sich in den 18-Wege-Sportsitz niederlässt, die Finger am heizbaren Lenkrad wärmt und dem BOSE Surround-Sound lauscht. Der breitenwirksame Innenraum des Macan orientiert sich grundsätzlich an den Designvorgaben des Taycan, ausgehend vom neuen 12,6 Zoll großen Cur-

ved Display. Neben dem 10,9 Zoll großen Zentraldisplay des DCM lässt sich noch ein gleich großes Beifahrerdisplay als Ausstattungsoption anordnen.
LEISES OFFROAD-WUNDER
Die Macan-Serie kann auch offroad. Originalton Porsche: „Mit der für Macan, Macan 4 und Macan 4S optionalen und für den Macan Turbo serienmäßigen adaptiven Luftfederung können die OffroadFähigkeiten jedes Modells noch gestärkt werden.“ Doch man muss nicht ins Gelände, um den Zeitgeist zu suchen. Dank modernster Technologien gelingt eine porschegerechte Fahrdynamik, die sich schon über das präzise, direkte und rückmeldende Lenkgefühl ausdrückt, das selbst einen 2,4 Tonner wie den Macan Turbo nicht nur zur Serpentinenpeitsche, sondern auch zum Kurvenflüsterer macht.
PORSCHE ZENTRUM VORARLBERG – RUDI LINS Bundesstraße 26d 6830 Rankweil +43 5522 77911 www.porschezentrumvorarlberg.at
Zentrum Vorarlberg - Rudi Lins
Wirtschaftskammer-Präsident Wilfried Hopfner: „Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit müssen Hand in Hand gehen.“
Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind nicht nur internationale Wirtschaftsthemen, sondern haben auch auf den Wirtschaftsstandort Vorarlberg zentralen Einfluss. Die EU verfolgt mit dem European Green Deal das Ziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Die Vorgaben sind für alle Mitgliedsstaaten verbindlich. Vor diesem Hintergrund muss auch Österreich seine CO2-Emissionen drastisch reduzieren und gleichzeitig nachhaltige Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln. Die Bundesregierung hat sich darüber hinaus das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Vorarlbergs Betriebe müssen sich auf all dies vorbereiten. Begleitet werden diese Zielvorgaben
mit einem ganzen Bündel an Regularien, die sowohl auf der Ebene der Unternehmen als auch auf Produktebene neue Standards und Offenlegungspflichten vorschreiben.
ORIENTIERUNG GEBEN
„Wir sehen uns als Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) in der Verantwortung, unseren Mitgliedern nicht nur Orientierung zu geben, sondern durch gezielte Maßnahmen und Programme auch konkret zur Erreichung dieser Ziele beizutragen und Hilfe bei der Bewältigung der Anforderungen anzubieten. Nachhaltigkeit wird dabei als strategisches Handlungsfeld verstanden, das nicht nur ökologischen, sondern auch wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert bieten

„Unternehmen in Vorarlberg stehen vor der Herausforderung, diese Ziele in ihre betrieblichen Prozesse zu integrieren.”
Wilfried Hopfner Präsident Wirtschaftskammer Vorarlberg

Photovoltaik-Anlage:
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg pflegt in Sachen Energie und Umweltschutz auch im eigenen Haus einen ambitionierten Umgang.

soll“, erklärt Wilfried Hopfner, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Mehr Anreize, weniger Bürokratie müsse das Credo lauten. So könne man Unternehmer(innen) ermutigen, ihre Firmenstrategie nachhaltig zu gestalten und dadurch ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu erlangen.
Dabei spielt die Dekarbonisierung – also die Umstellung auf CO2-arme und letztlich CO2-freie Technologien – eine zentrale Rolle. Unternehmen sind angehalten, fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdgas und Erdöl durch erneuerbare Energiequellen zu ersetzen. Neben der Steigerung der Energieeffizienz und dem Ausbau erneuerbarer Energien steht auch ein effizienter und regenerativer Umgang mit Ressourcen im Vordergrund. Das klassische lineare Wirtschaftsmodell – basierend auf dem Prinzip „Take-Make-Waste“ – stößt zunehmend an seine Grenzen, insbesondere in einer Welt mit endlichen Ressourcen und steigendem Druck zur Verringerung der Umweltauswirkungen.
Die Umstellung von einem linearen Produktionsmodell auf eine zirkuläre Wertschöpfung erfordert neue Geschäftsmodelle, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch neues Wachstumspotenzial für den Standort generieren. Dabei könnten vermehrt innovative Geschäftsmodelle Verbreitung finden. In Vorarlberg gibt es bereits Unternehmen, die dahingehend forschen und Projekte initiieren. Als Beispiele dafür nennt Hopfner „Product-asa-Service“-Konzepte und die Cradle-toCradle-Initiative.
Schon heute zeigt sich, dass Österreichs Unternehmen den Hauptanteil bei Umweltschutzausgaben tragen. Wie Daten von Statistik Austria zeigen, ist der Unternehmenssektor mit 12,6 Milliarden für rund 85 Prozent der Ausgaben verantwortlich. Die restlichen 15 Prozent verteilen sich auf den öffentlichen Sektor und private Haushalte.
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg arbeitet derzeit an einem neuen Service-
Ein Übergang zu einer kreislauforientierten Wirtschaft, die auf erneuerbaren Energien basiert, ist essenziell.
Angebot im Bereich der Nachhaltigkeit für ihre Mitglieder. Zentraler Bestandteil wird die Unterstützung der Betriebe durch Mitarbeiter(innen) bei der Umsetzung der Anforderungen und des Berichtswesens sein. Darüber hinaus setzt die Wirtschaftskammer auf Weiterbildung: Das WIFI bietet Schulungen und Trainings an, um die Mitarbeitenden der Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeitsmanagement, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft fit zu machen.
WIRTSCHAFTSKAMMER VORARLBERG Wichnergasse 9 6800 Feldkirch info@wko.at www.wko.at/vlbg
Printing on Demand, Programmatic Printing, Druck individualisierter oder kleiner Auflagen in bahnbrechender Geschwindigkeit. Was würdest du sagen, wenn das alles in Offsetdruckqualität möglich wäre? Lass uns darüber sprechen. –» 05572 24697-21
Eine neue Ära hat begonnen. Digitaldruck in Offsetqualität.
Offsetdruck | Digitaldruck | Lettershop | vva.at
vva.printworks
Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH

Wie wird das Büro zu einem Ort des Netzwerkens und der Zusammenarbeit?
Eine Frage, die sich viele Arbeitgeber und Unternehmen immer öfter stellen. Das Büro ist heute nicht einfach nur ein Ort, an den die Menschen kommen, um zu arbeiten; es ist ein Ort, an dem sie sich treffen, sich austauschen und durch Ideen Innovationen gemeinsam entwickeln können.
Um Arbeitnehmer anzuziehen, müssen Arbeitsplätze heutzutage sowohl ästhetisch als auch funktional ansprechend sein,“ sagt Ernst Holzapfel, Marketingleiter der Sedus Stoll AG. „Die Freiheit am Arbeitsplatz bedeutet nicht mehr nur, welchen Schreibtisch man wählt. Es bezieht sich jetzt auch auf die gesamte Arbeitsumgebung, -stimmung und -zeit. Inspiriert durch Dritte Orte wie Cafés, Restaurants, Hotellobbys, Bibliotheken oder Parks
erhält die Stadt nach und nach Einzug ins Büro und regt Unternehmen zur Realisierung attraktiver Räumlichkeiten mit viel Platz für unterschiedlichste Arbeitssituationen und Bedürfnisse an.“
Die Mischung macht`s! Nicht nur bei der Wahl der perfekten Kaffeebohnen, sondern auch beim Arbeitsplatz. Während früher Arbeitnehmer entweder im Büro oder
Work Café – Dritte Orte als fester Bestandteil der modernen Arbeitskultur.

zu Hause ihren festen Arbeitsplatz hatten, rücken heute immer mehr Dritte Orte in den Fokus der modernen Arbeitskultur. Dabei sticht ein Ort aus der Masse heraus: das Work Café.
Das Work Café ist ein sozialer Ort, an dem sich Menschen vernetzen, informell zusammenarbeiten und einen gemeinsamen Ankerpunkt finden. Animiert durch den Dreiklang „Work, Learn, Create“ entwickelt es sich so zu einem integralen Bestandteil der Arbeitslandschaft. Um dem Bedürfnis nach Flexibilität, Zusammenarbeit und Wahlfreiheit gerecht zu werden, müssen Arbeitgeber externe Standorte wie Cafés, Bibliotheken oder Parks als Teile eines Systems von Räumen betrachten, die nicht mehr in Konkurrenz zueinanderstehen.
„Das Büro steht heute im Wettbewerb mit den ‚Third Places‘,“ erklärt Holzapfel. „Unternehmen müssen daher das Büro zu einem attraktiven Ort machen. Die Rückkehr der Mitarbeiter ins Büro zu fördern, echte soziale Interaktionen zu ermöglichen und spontanen informellen Austausch zu unterstützen, sind zentrale Ziele moderner Work Cafés.“
Ein Möbelstück, das Kaffeehaus-Flair in jedes Office zaubert, ist der neue se:café wooden chair & lounge chair. Bei der Gestaltung der Massivholzstühle spielte die Historie von Sedus eine zentrale Rolle. Die lange Tradition in der Möbelfertigung, die sich durch handwerkliche Präzision und Innovationsgeist auszeichnet, war für Designer Konstantin Thomas ausschlaggebend. „Die Kombination aus Holzhandwerk und zeitgemäßem Design reflektiert die Balance zwischen historischem Erbe und zeitgenössischen Anforderungen“, erklärt Thomas. „Durch die bewusste Wahl von klaren Linien und funktionaler Eleganz spiegelt der Stuhl die Wurzeln von Sedus wider, während er gleichzeitig in die heutige Zeit passt.“
Bei der Neuinterpretation eines Kaffeehausstuhls standen die Prinzipien der Funktionalität und der Klarheit im Vordergrund. „Ich wollte einen Stuhl schaffen, der sowohl ästhetisch ansprechend als auch praktisch ist. Das bedeutet, dass die Form den Zweck des Stuhls direkt unterstützt und gleichzeitig ein minimalistisches, aber durchdachtes Design bietet.“


Das Büro ist heute nicht mehr einfach nur ein Ort, an den die Menschen kommen, um zu arbeiten. Es ist ein Ort, an dem sie sich treffen, sich austauschen und durch Ideen Innovationen gemeinsam entwickeln können. Während früher Arbeitnehmer entweder im Büro oder zu Hause ihren festen Arbeitsplatz hatten, rücken heute immer mehr Dritte Orte in den Fokus der modernen Arbeitskultur. Dabei sticht ein Ort aus der Masse heraus: das Work Café.

Paterno Bürowelt
Forachstr. 39 | A-6850 Dornbirn Tel. +43 (5572) 3747
info@paterno-buerowelt.at www.paterno-buerowelt.at Alles für das moderne Büro.
Paterno Bürowelt GmbH & Co KG
A-6850 Dornbirn | Forachstr. 39|+43 (5572) 3747 | Messepark | +43 (5572) 949799
info@paterno-buerowelt.at|www.paterno-buerowelt.at
Daniel Hug wacht als „Head of Brand Heritage“ über das Erbe von Longines. Wie man die Echtheit von Zeitmessern überprüft, was es mit „Fälschungen“ auf sich hat und wieso man sich auf verdienten Lorbeeren keinesfalls ausruhen sollte? – Ein Interview über Pioniere, Patente und die vielbeschworene Pünktlichkeit.
TEXT VON CHRISTIANE SCHÖHL VON NORMAN
Während andere Marken mit pompösen PREvents und fantasievollen Werbestrategien aufwarten, besinnt man sich bei Longines mit nonchalantem Charme auf das reiche uhrmacherische Erbe: 1832 in St. Imier gegründet, brachte die Manufaktur im Laufe ihrer Geschichte zahlreiche Patente wie etwa den Flyback-Chronographen oder die erste Armbanduhr mit einer zweiten Zeitzone auf den Markt. Dieses

Geschichte. Das Longines Museum in St. Imier in der Schweiz.
Know-how führte dazu, dass sich zahlreiche Pioniere und Prominente für Zeitmesser von Longines entschieden. Seit dem Jahr 2019 leitet Daniel Hug das Archiv und das firmeneigene Museum mit seiner langjährigen Expertise.
Sie kennen sich in der Geschichte von Longines aus, wie kaum ein anderer. Was ist für Sie der faszinierendste Aspekt? Es sind vor allem die herausragenden Persönlichkeiten. Wenn man die Geschichte dieser Menschen nachverfolgt, begibt man sich auf eine faszinierende Reise durch das 20. Jahrhundert. Sei es das Physikgenie Albert Einstein, der eine Longines Armbanduhr trug und diese seiner letzten Geliebten schenkte, die damit zurück nach Russland ging – woraus sich eine neue spannende Geschichte entfaltete – oder Aviatik-Pioniere wie Amelia Earhart, die 1932 als erste Frau über den Atlantik flog. Sie hatte einen Chronographen am Handgelenk. Oder nehmen wir Charles Lindbergh mit seinem Direktflug New York–Paris. Nach seiner Alleinüberquerung des Atlantiks kam er zu Longines und gab die Inspiration zum Bau einer speziellen Navigationsuhr. Oder Howard Hughes, der Mogul der Filmindustrie, der sich sehr für Aviatik interessierte und 1938 den schnellsten Flug rund um die Welt absolvierte. Das waren alles Entdecker und Wegbereiter für die nachfolgenden Generationen. Dass diese mutigen und begabten Menschen jeweils auf Longines vertrauten, ehrt uns und inspiriert zu neuen Projekten.


Pioniere. Amelia Earhart und Howard Hughes trugen Longines.

Pilotenuhr „Black Weems“ von 1934.


Der ehemalige Wirtschafts-Journalist leitet seit 2019 das Archiv sowie das firmeneigene Museum von Longines. Mit seiner langjährigen Expertise in der Uhrenbranche wacht der nicht nur über das uhrmacherische Erbe, sondern inspiriert zu neuen Projekten.
Ich fokussiere mich auf Erfindungen in der Geschichte der Marke, die heute noch Relevanz besitzen.
Erinnern Sie sich an einen „Wow“-Effekt, auf den Sie beim Durchforsten der Archive gestoßen sind? Das passiert mir häufig. Einerseits versuche ich, spannende Menschen zu finden, die eine Longines getragen haben, wie etwa die beiden Piloten Clyde Pangborn und Hugh Herndon. Die zwei Amerikaner schafften es 1931 als erste Menschen, den Pazifik nonstop zu überqueren. Dank eines ambitionierten Sammlers aus Deutschland wissen wir heute, dass sie als Instrument in ihrem Flugzeug eine spezielle Longines-Borduhr hatten, die zwei Zeitzonen anzeigte – und dies auf einer 24-Stunden-Skala. Ich habe gestaunt, als ich die große Uhr in ihrem Aluminiumgehäuse erstmals in meinen Händen halten durfte. Ich musste dabei an die beiden Piloten denken, die damals bei ihrem riskanten Flug von Japan in die USA rund 41 Stunden in der Luft waren und stets befürchteten, dass der Sprit nicht reichen wird. Auf der anderen Seite waren wir auch in der Sportzeitmessung überaus aktiv –und zwar an Orten, wo ich es gar nicht vermutet hätte. Vor zwei Wochen bin ich etwa auf Bilder von 1962 gestossen, die Longines als Zeitnehmer der berühmten Automobilrennen in Goodwood, England, zeigen.
Versuchen Sie solche „Schätze“ fürs Museum zurückzukaufen? Natürlich, aber in diesem speziellen Fall haben wir eine Leihgabe-Vereinbarung getroffen und die Uhr zwei Jahre ausgestellt. Mittlerweile ist sie wieder beim Sammler.
Inwiefern unterstützen Sie Longines, sich besser auf dem Markt zu positionieren? Was ist Ihre Aufgabe? Sie besteht darin, das Erbe der Marke auf einzigartige Entwicklungen, Patente und Modelle zu durchforsten. Wenn ich auf etwas stoße, unterbreite ich dem Team entsprechende Vorschläge, das die Produktentwicklung vorantreibt. Mich interessieren speziell die Erfindungen, die heute noch von Bedeutung sind und mit denen sich der rote Faden zwischen Geschichte und Gegenwart spannen lässt. Das können auch ästhetisch elegante Konstruktionen sein wie die Anzeige der Gangreserve durch sich drehende Scheiben, wie aktuell auf der Conquest. Die Idee stammt von einem Modell aus dem Jahr 1959. Es sind also nicht nur technische, sondern auch ästhetische Aspekte von Bedeutung … Ja, beides. 50 Jahre lang hat Longines keine Flyback-Chronographen mehr gebaut, obwohl wir im April 1935 das Patent dazu eingereicht hatten. Natürlich läuft ein solches Patent irgendwann ab und wird frei für die Konkurrenz, die es für sich nutzt. Als ErfinderMarke hat man dann nichts mehr davon, außer man lebt und pflegt diese Geschichte. Darum haben wir nun wieder einen Flyback-Chronographen entwickelt, der dank seiner Präzision auch als Chronometer zertifiziert ist.
Longines bietet den Service, dass sich Uhrenbesitzer einen Archivauszug schicken lassen können, weil jeder Zeitmesser, der ab 1867 die Fabrik verließ, katalogisiert wurde. Wie oft wird das verlangt? Sehr oft. Wir hatten letztes Jahr 12.000 Anfragen von Personen, die mehr über ihre Longines wissen wollten.
Schicken die Leute die Uhr ein oder reicht die Durchgabe der Seriennummer? Es gibt zwei Varianten. Sie können einen Archivauszug für ihre Uhr bestellen. Darauf ist aufgeführt, wann die Uhr unsere Fabrik verließ, an wen sie geliefert wurde, mit welchem Werk und Gehäuse sie ausgerüstet war. Für diese Auskunft reichen Fotos. Allerdings brauchen wir eines vom Uhrwerk, weil dort die Seriennummer eingraviert ist. Jede Anfrage wird individuell von meinem Team beantwortet und kostet 120 Franken. Für die zweite Variante, ein Echtheitzertifikat, müsste die Uhr eingeschickt werden.
Kommen Ihnen Fälschungen unter? Immer wieder, aber man muss differenzieren, was genau unter Fälschung zu verstehen ist. Der häufigste Fall sind ausgetauschte Zifferblätter bei teuren VintageUhren. Das heisst, dass bei einem etwa 70-jährigen Chronographen das stark patinierte, originale Zifferblatt durch ein besser erhaltenes ersetzt wurde, weil der Besitzer denkt, dass die Uhr dadurch wertvoller wird – was aber nicht der Fall ist. Wir überprüfen, ob das Zifferblatt zum spezifischen Modell passt und was in unseren Registern dazu notiert ist. Wenn etwas nicht passt, manchmal ist es auch ein falsches Gehäuse, können wir kein Echtheitszertifikat ausstellen. Dass die ganze Uhr gefälscht ist, kommt sehr selten vor.
In den letzten Jahren haben die Bereiche Brand Heritage und Second-Hand extrem an Bedeutung gewonnen. Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück und wie ist der Stellenwert von Longines auf dem Sammlermarkt? Wir gehören nicht zur Kategorie der spekulativ getriebenen Uhren. In den letzten Jahren gab es enorme Preissteigerungen, die jetzt wieder in sich zusammengefallen sind. Bei Longines sind die Werte viel konstanter, beispielsweise die Chronographen aus den 1930er-, 40er- und 50er-

Zeitzonen.
Die Spirit Zulu Time nimmt Bezug auf eine Uhr von 1925.
Jahren – vor allem die Modelle mit dem Uhrwerk 13ZN, das ist der Flyback-Chronograph – sind preislich sehr stabil geblieben, mit einem leichten Aufwärtstrend. Speziell gesucht ist die Variante mit den wasserdichten Drückern – auch das ein Patent von Longines – , weil dies technisch ein Meilenstein war und nur eine kleine Serie hergestellt wurde. Diese sportlichen Chronographen kosten in der Regel deutlich über 100.000 Euro und können bis 180.000 gehen. Parallel nimmt die Nachfrage nach den zeitlos eleganten Modellen z. B. der Conquest-Linie zu. Die Preise haben in diesem Bereich etwas angezogen, bewegen sich aber immer noch in einem sehr vernünftigen Rahmen. Das liegt auch daran, dass Longines von Sammlern zum Teil erst entdeckt wird, weil sie zu wenig über die Marke und ihre Geschichte wissen, etwa dass eine Longines aus den 1950er-, 60er-Jahren stets ein hoch qualitatives Manufakturwerk hat, welches in St. Imier hergestellt wurde, oder dass wir jede mechanische Uhr, auch wenn sie 100 Jahre alt ist, reparieren können, weil wir die alten Ersatzteile haben. Das ist ein Service, den nicht jede Marke bietet.
Sie verfolgen seit über 25 Jahren die Uhrenindustrie: Wo sehen Sie die größte Herausforderung? Wenn Sie die Entwicklung der Schweizer Uhrenmarken in den letzten 20 Jahren anschauen, dann ist ihr Erfolg u.a. auf die deutlich gestiegenen Preise zurückzuführen. Aber dadurch wird der Kreis der Käufer kleiner, die Volumen gehen zurück. Gerade bei jüngeren Leuten könnte die Armbanduhr deswegen an Relevanz einbüßen. Schweizer Uhren sollten erschwinglich bleiben, sonst überlässt man das Feld den Anbietern aus Asien oder den Smart Watches. Wir stehen für langlebige Analogtechnik und haben unsere Berechtigung, denn die Tradition des uhrmacherischen Handwerks ist einzigartig. Wir sind gehalten, sie weiterzuentwickeln und müssen die besten Werkstoffe sowie Technologien verwenden, um die Präzision und Widerstandsfähigkeit zu steigern. Gleichzeitig muss die Uhr auch ästhetisch attraktiv sein.
Longines hat diese Preissprünge nicht gemacht. Warum? Wir haben uns bemüht, preislich vernünftig zu bleiben und nicht in Exzesse zu verfallen. Die DNA von Longines war immer so, dass wir eher Uhren anbieten, die Understatement ausdrücken. Wir sind nicht die Prahler – das passt nicht zu unserer Geschichte.
Sind Ihre Trageuhren immer pünktlich und mit Datum eingestellt? Ich trage heute eine Ultra-Chron von 1968. Das ist meine persönliche Vintage-Longines. Sie ist exakt auf die korrekte Zeit gerichtet. Das Datum ist nicht nachgestellt, denn das nutze ich selten. Aber die Zeitangabe muss stimmen, sonst erfüllt die Uhr ihren Zweck nicht. Ich will ja pünktlich sein.


Vintage. Die Fliegeruhr „Majetek“ wurde ab 1935 für Militärpiloten gebaut. Fotos: Longines
















Der neue, rein elektrische Audi A6 Avant e-tron. This is Audi





6714 Nüziders Bundesstraße 4


Jetzt bei uns bestellbar.

6901 Bregenz Rheinstraße 76
Telefon: +43 5552 62185 www.autohaus-lins.at
Telefon: +43 5574 74320
Stromverbrauch (kombiniert): 15,6-20,0 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO₂-Klasse: A. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Symbolbild. Stand 09/2024.

MIT EINEM HANG ZUM ABSURDEN
Mit seiner „Short Bag“, eine in Bronze transformierte Hermès-BirkinTasche auf zwei Beinen, hinterfragt der Künstler Erwin Wurm unkonventionell und spielerisch die Gebrauchsfunktion von prestigeträchtigen Luxusgütern und kombiniert diese mit einem unverhohlenen, kritischen Seitenhieb auf die manipulativen Mechanismen unserer Konsumgesellschaft. Dadurch verschmelzen Gestaltungsparameter wie sein Hang zum Paradoxen, Selbstironie und Gesellschaftskritik zu einem Gesamtkunstwerk. Weitere ikonische Werke, die eine Art Zeitreise durch Wurms visionäres Oeuvre bilden, sind bei dieser Ausstellung zu bestaunen. •
galerie-albertina.at

EINZELN, GEPAART ODER GRUPPIERT
Amethyst, Grau, Grün, Rosalin, Citrin, Blau und klar – Die klassischen Lobmeyr Fish Bowl Vasen, entworfen im Jahr 1955 von Designer Stefan Rath, werden in vier verschiedenen Größen und mehreren subtilen Farbtönen hergestellt beziehungsweise aus hauchdünnem Musselin-Glas mundgeblasen, von Hand geschliffen und poliert. In verschiedenen Größen und Farben gruppiert sehen sie beinahe aus wie ein Schwarm bunter Seifenblasen. Aber auch einzeln oder gepaart sind die Kugelvasen ein Eye-Catcher. Der perfekte Rahmen für Bouquets und andere blumige Arrangements. •
www.lobmeyr.at

VON BLUMEN UND PLÜSCHTIEREN
Seit dem Jahr 2021 ist die Sängerin Miley Cyrus das Gesicht von #FloraFantasy – einer fröhlichen Traumwelt mit Kawaii-Charakter voller Blumen und Plüschtiere. Diese virtuelle Umgebung wird von einem Wechselspiel aus Traum und Realität bestimmt, inspiriert von der Gucci Flora Duftkollektion, bei der in jeder Komposition eine edle Blume im Mittelpunkt steht: Der pinkfarbene Flakon von Flora Gorgeous Gardenia ist ein zarter blumiger Duft mit starken fruchtigen Noten. Diese Essenz wird perfekt durch den Freigeist Miley Cyrus und ihre Welt verkörpert – voll von Rock'n'Roll und einer pastelligen Fantasiewelt. • gucci.com
Seit 1. Februar 2024 ist Nina Müller (55) aus Feldkirch CEO der Lalique Group SA Zürich. Auf dem Olymp von Luxus und Lifestyle verantwortet sie die weltweite Positionierung von Kristallobjekten, Parfums, Kosmetika, Restaurants und Hotels. Dafür ist ihre einschlägige internationale Expertise maßgeschneidert wie ein Kostüm der Haute Couture. Juste parfait!
TEXT VON ELISABETH LÄNGLE

Nina Müller
Ihre Karriere gestaltet sie als Tour de vision. Diese setzt eine klare Vorstellung voraus: welche Fähigkeiten und Erfahrungen bringt man für eine Aufgabe mit und wie fair kann man sie in Bezug auf Menschen, Umwelt und Ressourcen verwirklichen.
Montfortstadt. Entstanden um 1200 aus einer „Kirche bei den Feldern“ ist Feldkirch für Nina Müller ein Kraftplatz. Am Lehenweg steht ihr Elternhaus, im Montfortstädtle besucht sie Volksschule und Gymnasium, lehren sie Mama Elda und Vater Wilfried Freude und Erfolg mit unternehmerischen und sozialen Aktivitäten, teilt sie mit ihrem Bruder Alexander die Schönheit der Berge. Sie maturiert 1987 und inskribiert an der WU in Wien. Alexander entscheidet sich für Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau an der TU Graz und später Bienenzucht. In Feldkirch zählt Herold 81 Müller, aber nur eine Nina Müller.
Kaiserstädte. An der Wirtschaftsuniversität Wien wählt sie die Studienrichtung Handelswissenschaften. Vor dem Masterabschluss absolviert Nina Müller einen Lehrgang für Internationales Management (CEMS) an der Bocconi Universität in Mailand, eine der Top Five Unis in Europa und unter den Top Ten weltweit. Bocconi implementierte 1902 die erste akademische Wirtschaftsausbildung in Italien und baute ein weltweites Netzwerk mit Universitäten sowie mit Global Playern auf. „In meiner Studienzeit

Perfektion. Seit 1888 wird jedes Objekt in eigenen Werkstätten von Hand gefertigt.

Kult. Glasfiguren schmücken die Luxusmodelle von Bugatti und Rolls-Royce.
knüpfte ich zahlreiche internationale Freundschaften und Verbindungen, die bis heute fundamentale Elemente in meinem beruflichen und privaten Leben sind.“ 1994 hat sie den Master in der Tasche.
Seestadt. Bregenz am Bodensee ist Stammsitz der Wolford AG. 1995 verstärkt Nina Müller die Task Force Marketing im Hauptquartier. Ziel: Glamour für die Luxusmarke Wolford. Von Bregenz wechselt sie nach Mailand zu Wolford Italia. Die Tochter operiert in den Society Hubs von Mailand, Rom, Florenz, Venedig. Publicitywirksam wird der Markenglanz über Synergieeffekte mit Celebrities poliert.
Zwischenstopps. London, Lifestyle Mode von French Connection: Preppy Look im Mix von Travel- und Streetstyle für Damen, Herren, Wohnen, Accessoires. Next Stop: Mandarina Duck, Mailand. Lifestyle affine Travellers werden mit innovativen, leichtgewichtigen, Taschen, Koffern und Rucksäcken adressiert. Trotz Topbewertungen und Awards für Markenbotschaft und Produktinnovation kehrt Nina in das Luxusgenre der Lifestyle Welt zurück. Zwischenstopp in der Geschäftsleitung des Nobelkaufhauses Braun & Co am Graben in Wien. 1892 von Emanuel Braun gegründet, 2001 von Palmers gekauft, erweist sich das legendäre Shoppingparadies nicht als Hotspot für die oberen Zehntausend, die sich einst in den Filialen in Prag, Berlin, Southampton, Palm Beach die Kaschmirs aus den
Händen rissen. 2004 wird die museale Schönheit geschlossen. H & M zieht in das denkmalgeschützte Haus. Nur mehr das goldene Gästebuch erzählt von berühmten Stammkunden: Alma Mahler, Richard Strauss, Václav Havel, Eugène Ionesco...
Traumstadt. Ab 2005 arbeitet und lebt Nina Müller in Zürich. Mit Expertise und Passion gestaltet sie im Kristallkonzern Swarovski diverse Führungsaufgaben. Sie verantwortet das globale Retail Marketing und baut die Modeschmuckmarke „Lola und Grace“ auf. Nach rund zehn Jahren bei Swarovski übernimmt sie die Unternehmensleitung von Christ Uhren und Schmuck. Sie managt die Repositionierung der größten Schweizer Bijouterie Kette in der Gewinnzone. 2020 wird Nina Müller CEO des Luxuskaufhauses Jelmoli. Sie lenkt, prägt, erneuert eine legendäre Institution. Mit Verve kuratiert sie Luxusmarken für Mode, Schönheit, Wohnen, Gastronomie. Als die Eigentümerin SPS (Swiss Prime Site) die Zukunft von Jelmoli auf ein einträglicheres Immobiliengeschäft zuschneidet, scheidet Nina Müller im Juni 2023 auf eigenen Wunsch aus.


Lalique. Im Zeitalter der Belle Époche formt René Jules Lalique das Schöne. Er kreiert ungewöhnliche Schmuckdesigns, herausragende Glas- und Kristallkunst sowie Flacons für die Luxuswelt. Sarah Bernhardt trägt Lalique Schmuck. Die Luxuskarossen von Bugatti wie Rolls-Royce zieren Kühlerfiguren aus Glas. Die imposanten Ozeanschiffe Ile de France, Paris, Normandie... beeindrucken mit Fensterscheiben von Lalique. Im Orientexpress ist die elegante Opulenz von Lalique ebenso unverzichtbar... Die Manufaktur in Wingen-sur-Moder folgt bis dato dem Prinzip höchster Kunstfertigkeit. Seit 2008 hütet, vermarktet, erneuert die Schweizer Gruppe Art & Fragrance SA das in der Lalique Group SA konzentrierte Erbe. CEO Nina Müller stellt mit Wissen, Gewissen und Leidenschaft auf drei zentralen Geschäftsfeldern (Pillars) die Weichen in eine glänzende Zukunft.
„Es ist meine Vision, Lalique als globale Luxusmarke zu etablieren, die Synergien der diversen Geschäftsfelder innovativ zu stärken und eine Unternehmenskultur zu
pflegen, die Respekt, Vielfalt, Nachhaltigkeit wertschätzt.“

Hospitality. L’art de vivre ist Kunst, Kulinarik, Wein, Whisky, Design und höchste Gastkultur.
I. Kristall. Herzstück der Lalique Group. Zusammenarbeit mit Weltkünstlern wie James Turrell oder Damien Hirst. Ergebnis: Glasobjekte mit Kultstatus. Business Plan: revolutionäre Innovationen + Erbe von René Lalique = Unikate, zeitlos, konkurrenzlos. Effekt: Atouts einer weltweiten Expansion. „Respekt vor den Menschen, ihren Wünschen, ihrem Können, ihren Schutz- und Lebensräumen sind wie grenzüberschreitende Kreativität, garantierte Nachhaltigkeit und ein schonender Umgang mit Ressourcen die elementaren Bausteine der Lalique Unternehmenskultur.“
II. Parfum/Kosmetik. Die Kreationen von Düften und Flakons finden olfaktorisch und haptisch vollendet zusammen. Höchstes Niveau gilt ebenso für den Bereich der Kosmetika. „Strategische Partnerschaften mit bekannten Marken wie Bentley, Jaguar und Brioni unterstreichen das Standing von Lalique in der Parfum- und Kosmetiksparte und kreieren Synergieeffekte.“ Die Zeichen stehen auf Innovation und Expansion.
III. Gastkultur. Das feinsinnig orchestrierte Zusammenspiel von Kunst, Design, Kulinarik, Hospitality, Architektur und Natur bietet unvergessliche Erlebnisse großer Gastkultur in den bislang drei mit mehreren Ster-

Erlebnis. Schlösser, Wein, Whisky, Glas, Sternerestaurants: Genüsse à la Lalique.


nen gekrönten Boutique Hotels und Restaurants im Elsass, in Bordeaux sowie in Schottland. 2025 hat Lebenskunst à la Lalique in der Villa Florhof in Zürich Premiere. Nina Müller’s Plan: „Mit Innovationen und Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen die Lalique Gruppe als Lifestyle weiter stärken.“
Nina privat. Laut Gault Millau ist sie eine leidenschaftliche Köchin, großartige Gastgeberin, versierte Sammlerin von Silberbesteck, Gläsern, Porzellan. Ihre kulinarische Passion teilt sie mit Familie und Freunden. Die Sportbegeisterte liebt Bergsteigen, Schifahren und jegliche Bewegung in der Natur. „Meine Energiequellen sind Sonne und Licht, Berge und Meer. Feldkirch ist meine zweite Heimat, in der ich tief verwurzelt bin, wo ich Kraft und Klarheit finde.“ So oft wie möglich kommt sie heim. Fremde Kulturen, authentische Menschen, schöne Dinge, Düfte, Früchte, Speisen, Wein, Natur... begeistern die Genießerin Nina. Ihr soziales Engagement stellt sie nicht ins Rampenlicht. Beispielhaft setzt sie sich für die Inklusion geistig und körperlich behinderter Kinder in Beruf und Gesellschaft ein. Seit Juni 2023 hat Nina Müller ein Mandat im Verwaltungsrat der Alnatura AG. Die Schweizer Gesellschaft vertreibt ökologische, regionale, gesunde Lebensmittel in über 20 Schweizer Alnatura Bio-Supermärkten sowie in Migros Supermärkten. Sie tritt aktiv für die Schonung natürlicher Ressourcen sowie für Inklusion und Diversität ein, um in der Gesellschaft positive Veränderungen nachhaltig zu stärken.

Mehr vom Guten – das ist das Motto des neuen Marenda. Mehr Brotkultur, mehr Handwerk und mehr Genuss. Egal ob im gemütlichen Café oder zuhause. Unsere Köstlichkeiten sorgen immer für besondere Geschmacksmomente.

Länge läuft. Das war schon den Urvätern des Automobilbaus klar. Ebenso deren Vorgängern, vermutlich. Auch die Erbauer des neuen 5er BMW finden Gefallen an dieser Weisheit. „kontur“ stellt hier die Touring-Version vor, angetrieben von einem Spar-Flüsterdiesel, vierzylindrig zur allgemeinen Überraschung.
Zurück zur lauffreudigen Länge. 5060 Millimeter! Zehn Zentimeter mehr als bisher. BMW gönnt dem neuen Fünfer das Gardemaß großer Limousinen. Während das Umfeld eher raumsparend baut, verwöhnen die Bayern speziell jene, die dienstlich, teils auch privat, sehr viele Kilometer zurücklegen. Diese Klientel wird garantiert ihre Freude haben am exzellenten Fahrkomfort des blau-weißen Longinus, der „oberen Mittelklasse“ entstammend, kombiniert mit Raum und nochmal Raum.
Viele Sorglos-Kilometer. Wer redet heute noch von „Mittelklasse“? Beim Anblick des Neo-5er Touring denkt man eher an „Gran Turismo“ und ähnliche Besonderheiten. Ja, er macht sich lang für lange bis

Der Vierzylinder erzeugt bis zu 197 PS und stemmt maximal
400 Newtonmeter Drehmoment. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgang-Automatik.
sehr lange Autobahnetappen. Man kann sie ohne Zittern in Angriff nehmen, denn das Mega-Display zeigt eine beruhigende Reichweite von über 1100 Kilometern.
Das sind echte Tausender-Überschreitungen, keine Fantasie-Reichweiten aus der Welt der Elektromobilität. Kein quälender Sparmodus hinter Lastwagen, damit es irgendwie weitergeht. Weit über 1000 Sorglos-Kilometer ohne PowerstationNervenkitzel. Und das in fast allen Ländern der zivilisierten Welt. Ob das E-Auto jemals dort ankommt?
BMW ist nicht auf dem Weg in frühere Zeiten, wenn es heute in diesem prestigeträchtigen Modell ein Dieseltriebwerk anbietet. BMW zählt vielmehr zu den Pionieren des Wasserstoffantriebs und man darf sich da noch einiges erwarten von den Bayern. Aber im Moment ist der Selbstzünder ein gewagter Schritt. 197 PS erbringt dieser Vierzylinder. Er werkt äußerst kultiviert und laufruhig. 11 PS spendiert der 48V-Mildhybrid als Startergenerator. Man merkt es nicht.
Wer braucht mehr. Aber das System ist ein weiterer Beitrag zur wahren Öko-Bilanz eines Autos, das sich mit einem elektrifizierten Konkurrenten unterm Strich sehr wohl messen kann. Es verbraucht zwischen 5 und 6,5 Litern. Seine knapp 200 PS sind zwar nicht atemberaubend, aber mehr als ausreichend in Zeiten wie diesen.
7,3 auf 100 und eine Endgeschwindigkeit von 228 km/h. Wer braucht heute mehr. Und wo, bitte?
Die Vielfahrer werden ihre Freude haben an dem stattlichen Prachtstück. Soll der neue 5er hingegen mehr für den privaten Bedarf dienen, ist zu bedenken: Er überragt die meisten anderen, schaut überall ein wenig frech hervor. Enge Alpenpässe sind nicht unbedingt sein Revier. Man geht sie am besten gelassen an und genießt die Umwelt. Auch im Winter. Man hat Allradantrieb. Entspannen, ruhig bleiben ist auch in engen Tiefgaragen angesagt. Kann nichts passieren, hat ja jede Menge wachsamer Sensoren der 5er. Sie veranlassen ein ganzes Konzert von Warntönen. Premiumsound in Engstellen. Mitunter zu viel des Guten.
Alles da. Überhaupt Premium das ganze Innenleben. Alles da, was man so erwarten darf in Premiumautos der Gegenwart. Abzurufen auf einem Touch-Screen, der alle Stückchen spielt und nach gesunder Fingermotorik verlangt. Damit die Jungen auch was haben vom schönen neuen 5er. Am besten als Beifahrer. Denn: Nichts ist unterhaltsamer auf der Langstrecke als ein digital versierter, einfühlsamer Co-Pilot.
Damit adieu, liebe, sich gerade schnell verändernde, heftig transformierende Autowelt. Stefan Pabeschitz, kompetenter Kollege und Hundefreund, setzt sich künftig fürs „kontur“ ans Volant.
BMW 520d xDrive Touring
Motor: Diesel (Mild-Hybrid), 1.995 ccm, 197 PS (145 kW), 400 Nm bei 1500 U/min
Antrieb: Allrad, Achtgangautomatik
Verbrauch: 5,7 bis 6,2 l, Testschnitt 5,9 l
Preis: 70.442 Euro, Testfahrzeug: 95.129

In weiten Teilen der entwickelten Welt polarisieren sich die Einstellungen junger Männer und Frauen. „kontur“ hat Zukunftsforscher Tristan Horx zu diesem Phänomen befragt – ein Interview über Imponiergehabe, mediale Echokammern und zu wenig Sex.
TEXT VON CHRISTIANE SCHÖHL VON NORMAN
Ein Leben zwischen Selbstverwirklichung, veganer Hafermilch und der Hoffnung auf eine bessere Welt – in der Generation Z, also die zwischen 1997 und 2012 Geborenen, weht der Gedanke der Rebellion und Progressivität: man klebt sich fest, um das Klima zu retten, trinkt Matcha Latte, wehrt sich gegen Erschöpfungszustände am Arbeitsplatz (Stichwort: Work-Life-Balance) und nutzt vornehmlich Insta und TikTok als Schlüsselloch für den Blick in die Welt. Klingt alles ziemlich nach Schublade, oder? Der Blick in die Realität relativiert das SchwarzWeiße-Denkmuster, offenbart aber dennoch ein sehr spannendes Detail, denn während vorhergehende Generationen in sich immer eher homogen waren, sprich, man wächst zusammen auf und teilt dieselben Ansichten, hat sich innerhalb der Generation Z eine Kluft aufgetan: während „Sie“ liberaler wird, wird „Er“ konservativer – das zeigt sich nicht nur in der politischen Einstellung, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
Primitiver Chauvinismus. Besonders deutlich werden die unterschiedlichen ideologischen Weltanschauungen im Wahlverhalten, aktuelles Beispiel Ostdeutschland: Junge Männer haben viel stärker die AfD gewählt als junge Frauen. Auch bei den jüngsten Urnengängen in Österreich zeigt sich dasselbe Szenario: „Mann“ wählt rechts, während „Sie“ ihr Kreuz eher links der Mitte setzt. Den zentralen Grund sieht Tristan Horx in der Bildung: „Junge Frauen haben die jungen Männer überholt. Je nach Land variiert das natürlich ein bisschen, aber generell lässt sich festhalten, dass Frauen prozentual höhere Bildungsabschlüsse haben. Alle soziologischen Studien belegen, dass gebildete Menschen liberaler sind – das ist moralisch wertfrei einfach eine Tatsache.“ In der EU ist der Anteil der Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren mit Hochschulabschluss zwischen 2002 und 2020 von 21 % auf 35 % geklettert. Bei den Frauen stieg er schneller, nämlich von 25 % auf 46 %*. „Dieses Bildungsgefälle führt zu einer gewissen Bedrohung der männlichen Rolle, denn das alte Modell mit starkem Versorger und holder Magd funktioniert nicht mehr. Es entsteht ein Vakuum, das wieder befüllt wird und da sind die alten Idealismen schnell wieder bei der Hand und zeigen sich z.B. im Talahon-Konzept, einer Ausformung des primitiven Chauvinismus – einem Ventil, mit dem junge Männer mit Migrationshintergrund ihrer Perspektivlosigkeit Ausdruck verleihen. Aber auch die Postmoderne mit ihren Kulturkämpfen und der Wokeismus spielen hier eine große Rolle“, erklärt der Zukunftsforscher, der selbst der Generation Y angehört. Der Mann in seiner Rolle sehnt sich offenbar in die Zeiten zurück, in denen alles noch einfacher erschien.
Insta-Einsamkeit und Blasenbildung. Gerade am Talahon-Beispiel zeigt sich, wie Insta & Co. als eine Art Beschleuniger wirken. Durch die sozialen Medien kann sich ein gesellschaftlich-kulturelles Meme oder ein Trend extrem schnell vervielfältigen, da keine Regulation von außen stattfindet. „Im realen sozialen Raum, überspitzt formuliert in einem Wirtshaus oder Vereinsheim, können die älteren Generationen ein Korrektiv anwenden. Im Internet fällt das weg, denn es gibt salopp formuliert keine Alten auf TikTok und keine Jungen auf Facebook.“ Die Mechanismen sind vorgezeichnet: Gleichgesinnte finden sich über diverse soziale Plattformen im World Wide
Web in ihrer eigenen Blase zusammen und bestätigen sich gegenseitig, was dazu führt, dass sich der Trend rasant ausbreiten kann. „Meine Hoffnung ist allerdings, dass sich das Ganze relativ schnell wieder gesellschaftlich ausverhandeln lässt. In der Realität wollen gerade Männer in diesem Alter einfach kaum etwas anderes als das andere Geschlecht anziehen, denn das ist das primärste Bedürfnis der Menschen“, prognostiziert Horx das Abebben des TalahonPhänomens mit der Referenz auf das „Incel Involuntarily Celibate“, die Selbstbezeichnung einer in den USA entstandenen InternetSubkultur heterosexueller Männer, die nach Eigenaussage unfreiwillig keinen Sex hatten, sich radikalisierten – Selbstmitleid und Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen und sexuell aktive Männer – und am Ende wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind.
Kamala Harris ist „brat“. Bei den „ Zlerinnen“ sind ebenfalls spannende Strömungen, quasi als Gegenpol zum eifrigen Liberalismus, in den sozialen Medien zu beobachten. Stichwort: BratGirl, Demure, Tradwife – Millionen junge Frauen adaptieren diese Trends. „Begonnen hat das diesen Sommer mit den Brat-Girls (Du bist „brat“, sprich eine freche, aber coole Göre): Junge Frauen, alle mit verwaschenem Make-up und ein bisschen freizügig angezogen, die das Motto zelebrierten: ich bin cool und sage, denke und tue, was mir Spaß macht“, so Tristan Horx. Die Sängerin Charli XCX gab mit ihrem kürzlich erschienen giftgrünen Album „brat“ die Inspiration zum „Brat-Girl-Summer“. Jetzt folgt darauf aktuell der „Demure“-Herbst, die Gegenbewegung zum vorigen Trend, in

Tristan Horx. Hat sich eingehend mit dem Auseinanderdriften der Geschlechter in der Generation Z beschäftigt.

dem alle anständig, bescheiden und süß sein wollen. Gestartet hat die neue Welle die Influencerin Jools Lebron mit einem Reel, in dem sie sich selbstironisch und betont brav, bedeckt und bescheiden für die Arbeit fertig macht. Inzwischen hat das Video über 30 Millionen Klicks. „Die Zuspitzung dieser Tendenz ist die Tradewife-Bewegung: Frauen auf TikTok, die sich Blumenkleider anziehen, Brot backen, kochen und verkünden, dass es ihre einzige Aufgabe sei, für den Mann da zu sein, von dem sie finanziell abhängig sind. Diese Videos haben über 10 Millionen Aufrufe und die Frauen verdienen mit diesem Content Geld. Das ist die Oberironie. Diese zugespitzten polarisierenden Rollenbilder zeigen sich somit auch bei den Frauen langsam wieder“, führt Horx aus. Die Bewegungen zeigen exemplarisch, wie Trends innerhalb von wenigen Tagen digital aufpoppen können, ihren Höhepunkt erreichen und dann durch etwas Neues abgelöst werden und abebben. Den Höhepunkt des Brat-Summers markierte übrigens die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, als sie sich einen Tweet der britischen Popsängerin „Kamala IS brat“ zu eigen machte und die Farbe ihres Wahlkampfaccounts zu brat-grün änderte. Ein kluger Schachzug, um junge weibliche Wählerstimmen zu generieren. Fest steht, die zwei Geschlechter haben auch im digitalen Raum unterschiedliche Welten, in denen sie sich bewegen, Content aufnehmen und kreieren.
„Der große Unterschied innerhalb der Generation Z: Die Männer haben weniger Sex als die Frauen, denn die können tendenziell im Alter nach oben daten, Männer in der Regel nicht.“
de im Vergleich nur rumgevögelt. Der große Unterschied innerhalb der Generation Z ist: Die Männer haben weniger Sex als die Frauen, denn die können tendenziell im Alter nach oben daten, Männer in der Regel nicht“, erklärt der 31-Jährige. Junge Männer werden also statistisch häufiger von gleichaltrigen potenziellen Geschlechts-Partnerinnen abgelehnt, haben dadurch weniger Sex, was verständlicherweise die Kluft weiter verstärkt: „Oft schließen sich diese jungen Männer zusammen und tauschen sich darüber aus, warum sie alle keine Freundin haben und geben sich gegenseitig Tipps, was dazu führt, dass sie noch weiter keine abbekommen. Das ist ein richtig schönes, selbsttypisches Modell. Deswegen scheitern diese Bewegungen am Ende auch immer – aber das braucht seine Zeit, weil man erst die verschiedenen Phasen der Trauer durchleben muss. Das ist jetzt gerade die Verleugnungsphase, in welcher der Mann der Frau die Schuld an der Misere gibt.“ Anzunehmen ist allerdings, dass sich dennoch Effekte im Familienbild zeigen, sprich, dass junge Leute eher allein bleiben und weniger Kinder bekommen. „Die Geburtenquote ist so niedrig wie nie. Wir müssen hoffen, dass sich Gegensätze anziehen. In Südkorea etwa ist die Geburtenrate noch niedriger und die Kluft zwischen den Geschlechtern noch größer“, zeichnet Tristan Horx ein düsteres Bild.
Kiss Kiss, bang bang. Das Bildungsgefälle sowie wirtschaftliche Faktoren führen somit zu unterschiedlichen Auffassungen in der Art und Weise, wie das ganze Leben, die Arbeit sowie romantische Beziehungen wahrgenommen werden. Fokussiert man sich auf den letztgenannten Punkt, denn „It´s all about love“, zeigt sich: Wenn „Sie“ sich auf den Dating-Markt begibt, muss sie wahrscheinlich feststellen, dass das Angebot an liberalen, gebildeten Männern ihres Alters nicht der Nachfrage entspricht, weil es viel mehr weibliche als männliche Hochschulabsolventen gibt. Die Auswirkungen sind wenig überraschend: „Die Generation Z hat sehr wenig Sex im Vergleich zu den vorhergehenden Generationen. Bei den Boomers wur-
Gefühl des Verlustes. Junge Männer haben aber nicht nur die Angst, in Liebesdingen zu kurz zu kommen, sondern empfinden auch den Abbau der Hürden beim Thema Gleichstellung als Bedrohung, weil sie mehr Wettbewerb, schlechtere Karriere- und Aufstiegschancen, womöglich geringere Löhne und Einkommen auf dem Arbeitsmarkt fürchten. Aktuelle Studien zeigen, dass dieses Gefühl besonders bei den Jüngeren ausgeprägt ist. Eh klar, die Boomer haben ihren Platz in der Arbeitswelt schon gefunden und ihre „monetären Schäfchen“ im Trockenen, während die Jungen am Anfang ihrer Karriere stehen. Und überhaupt: wer verzichtet schon gerne auf Privilegien. „Für eine Gruppe, die immer nur den Vorteil hatte, hinterlassen die Anfänge der Gleichberechtigung natürlich das Gefühl, dass ihnen
Zwei Welten. Haben sich nicht mehr viel zu sagen, weil „Sie“ liberaler wird und „Er“ konservativer

etwas weggenommen wird – was es auch wird und zu Recht. Dieses Moment des Verlustes, daraus entsteht ein Spannungsfeld. Entscheidend ist beim Thema Gleichberechtigung der Unterschied zwischen Equality und Equal Opportunity: Wir wollen nicht, dass die Resultate alle gleich sind, sondern dass alle dieselbe Chance haben. Ziel ist ein meritokratisches System, indem man, unabhängig vom Geschlecht, mit Kompetenz nach oben kommt, sei es politisch, gesellschaftlich, in Bezug auf Einkommen etc.“, unterstreicht der Zukunftsforscher.
Was Männer wollen. In früheren Zeiten war es zudem immer so, dass die Männer mehr verdient haben, weil sie durch mehr Muskelmasse und dichtere Knochen physikalisch überlegen waren. „Jetzt wird die menschliche Arbeitskraft von Maschinen ersetzt. Da geht unser USP, also das, was wir besser können als die Frauen, ein bisschen flöten. Egal ob Kohlenträger, Bergmann etc. – Physis war immer von Vorteil. Diese ganzen Jobs braucht heute keiner mehr. Auch durch diese Veränderung können sich junge Männer bedroht fühlen. Gleichzeitig sind wir die Hauptbevölkerungsgruppe im Knast, also die Gewalttätigen. Wir sollten schon mal hinterfragen, ob die Dominanz der Männer noch gegeben ist“, regt der Kosmopolit zum Nachdenken an und führt weiter aus: „Für mich in Konsequenz, ist die größte Überraschung zum Thema Gender Gap Generation Z die unglaubliche Ironie, dass ein Kult an Frauenhassern entsteht, der nichts Dringenderes will, als mit Frauen zusammen zu sein. Diese Paradoxie ist köstlich.“ Damit hat sich in den vielen Jahrzehnten zumindest evolutionstechnisch eines nicht geändert: Männer wollen Frauen anziehen – so einfach ist das, denn der Helden- und Jagdinstinkt ist immer noch da. Allerdings führen neue soziokulturelle Einflüsse wie aggressive Algorithmen, unterschiedliche Bildungsabschlüsse, viel weniger „Kohle“ zu einer Kluft – im Vergleich zu den Boomern haben die „Zler“ geringere finanzielle Mittel zur Verfügung. Die Folgen sind noch nicht absehbar, allerdings dürfte diese Entwicklung noch für viele Generationen Wellen schlagen. Apropos Wellen schlagen: Die Sommerhymne der Generation Z von Shirin David „Bauch Beine Po“ ist derzeit in unseren Breitengraden der virale Megahit im Netz: Junge Frauen UND Männer „mascherln“ sich augenzwinkernd für ihre Reels nach der Video-Vorlage auf und performen im Netz – zumindest hat Musik noch ein verbindendes Element darauf trinken wir einen „Champagnie“.





Mit fünf Uraufführungen in der aktuellen Spielzeit erweist sich das Vorarlberger Landestheater zu seinem 25Jahr-Jubiläum als starke Plattform für zeitgenössische Literatur und deren Autorinnen und Autoren. Auf „Aus seinem Leben“, dem Ergebnis der Beschäftigung des Tiroler Autors Felix Mitterer mit dem Werk des Bregenzerwälder Dichters, Bauern und So-
zialreformers Franz Michael Felder, sowie „Old White Clowns“, Max Merkers Sicht auf den Pantomimen Jean-Gaspard Deburau, folgt im Dezember „Toxic“. Dabei handelt es sich um die Auseinandersetzung der Vorarlberger Autorin Daniela Egger mit dem Popstar Britney Spears bzw. mit der Demütigung einer Künstlerin, die US-amerikanische Juristen als erfolgreiches Geschäftsmodell betrieben haben.
Sie verdient Millionen, konnte aber unter Vormundschaft gestellt werden. Das hat die Autorin Daniela Egger in der Biografie der Künstlerin Britney Spears interessiert. Für Regisseurin Agnes Kitzler zeigen sich hier auch allgemeine Frauenthemen. Spears ist eine Figur in einer der vielen Uraufführungen des Vorarlberger Landestheaters, das nun ein Jubiläum feiert.

Warum ein 25-Jahr-Jubiläum? Das Publikum nimmt das Vorarlberger Landestheater als Institution wahr, die seit 1945 existiert und in der einst die Ideen zur Gründung der Bregenzer Festspiele formuliert wurden. Dabei verlief die Geschichte anders. Nach wenigen Jahren war den Vorarlbergern ein auch so zu definierendes Landestheater unter der Leitung von Kurt Kaiser zu teuer, vielleicht auch zu fortschrittlich.
Text und Regie. Daniela Egger hat mehrere Stücke für das Vorarlberger Landestheater geschrieben. Nach „Von Mäusen und Menschen“ von Steinbeck (Szenenbild nebenan) inszeniert Agnes Kitzler die Uraufführung ihres neuen Stückes „Toxic“.
konzipiert waren, dass man sie nicht nur in Bregenz aufführen konnte. Mitte der 1990erJahre wurde das marod gewordene Haus am Kornmarkt endlich saniert und man überlegte, die Bühne zu einem landeseigenen Unternehmen auszubauen, in dem auch Vermittlungs- und Jugendarbeit anzubieten ist. Abgesehen davon, dass Felix gemeinsam mit Christoph Eberle begann, eine Opernproduktion pro Saison zu realisieren, wurde im Rahmen der Bregenzer Festspiele der Martinsplatz bespielt und es gab schon unter dem TfV-Logo Uraufführungen, darunter von Texten von Werner Grabher, Michael Köhlmeier und Jutta Rinner-Blum.
Die gelinde gesagt etwas unprofessionelle Handhabe der Politik bei der Transformierung des TfV zum Landestheater vor 25 Jahren wirkt auch angesichts eines erarbeiteten und wieder eingestellten Stufenplanes zur Erhöhung des Budgets bis heute nach. Nach Harald Petermichl und Alexander Kubelka erreicht Stephanie Gräve, Intendantin seit 2018, neue Publikumsschichten.
Nach „Who cares?“ und „Zwei Frauen, ein Leben“ ist „Toxic“ das dritte Stück von Daniela Egger, das am Vorarlberger Landestheater uraufgeführt wird.
Fritz Klingenbeck, Richard Wegeler und Alex Freihart hießen die weiteren Direktoren, die in Bregenz ein Berufstheater mit viel Engagement am Leben erhielten. Von 1970 bis 1999 leitete Bruno Felix das Theater für Vorarlberg als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, für das er jeweils um Subventionen anzusuchen hatte. Bei knappem Budget wurden pro Jahr etwa ein Dutzend Produktionen realisiert, von denen einige so
Stückaufträge mit Relevanz. Sie erteilte unter anderem Stückaufträge an Thomas Arzt, der sich des Vorarlberger Juristen, Künstlers und KZ-Überlebenden Max Riccabona annahm, an Maximilian Lang, der mit „Sprich nur ein Wort“ bereits ein literarisch hervorragendes Bühnenstück zu Franz Michael Felder schuf, und Daniela Egger. Die Vorarlberger Schriftstellerin widmete sich in „Zwei Frauen, ein Leben“ der Arbeit des aus der Türkei stammenden Lyrikers, Übersetzers und Rundfunkredakteurs Kundeyt S¸urdum und wählte dabei sehr klug die Perspektive seiner Frau Ays¸e. Es ist ein Stück, das auch in migrantischen Communities viel Beachtung erfuhr.
Nun ist es Britney Spears, der ihre Aufmerksamkeit gehörte. Und das, obwohl Daniela Egger keine besondere Vorliebe für die
Musik der Künstlerin entwickeln konnte. „Mich hat interessiert, mit einer kontroversen Frauenfigur zu arbeiten. Sie hat als sehr junge Künstlerin unglaublich viel geleistet, hat in Interviews reflektiert agiert, sich fantastisch gut verkauft, aber gegen die Probleme, die sich bei Superstars bzw. angesichts des enormen Arbeitspensums im Showbusiness verständlicherweise einstellen, wohl die falschen Drogenmischungen erhalten.“ Ihr Pech sei es gewesen, eine Familie zu haben, die sie aussaugt und zudem in einem Land zu leben, in dessen Rechtssystem sich höchst fragwürdige Aspekte zeigen. „Wenn sich jemand ein derartiges Millionenvermögen erarbeitet, aber gleichzeitig unter Vormundschaft gestellt werden kann und 13 Jahre nicht daraus entkommt, fragt man sich, was da abläuft.“ Beleuchtet wird auch wie die Pop-Industrie mit Frauen umgeht, welche Bilder die Medien schaffen oder auch wie Justin Timberlake, die beendete Beziehung zu seinem Ruhm nutzte.
Daniela Egger zählt zum Gründerteam der Literaturzeitschrift „miromente“, sie ist Obfrau von literatur.ist und damit im Leitungsteam des Literaturhaus Vorarlberg tätig, sie hat neben den Hörspielen und Bühnenstücken auch Prosawerke veröffentlicht und wurde heuer mit dem Kunst- und Kulturpreis der Vorarlberger Nachrichten und der Wiener Städtischen Versicherung ausgezeichnet. Mit ihrem Stück „Die Insel in mir“


Uraufführungen am Landestheater haben Regionalbezug, behandeln aber auch internationale Themen sowie bei „Toxic“ fragwürdige Rechtssysteme und die Rolle der Medien.
thematisierte sie kognitive Beeinträchtigungen von Menschen. Egger ist zudem Projektmanagerin der Aktion Demenz. In dieser Funktion entwickelt sie kulturelle Formate und schärft das Bewusstsein für ein Thema, von dem viele Menschen betroffen sind.
Eine Kriminalgeschichte. „Toxic“ wird von Agnes Kitzler inszeniert. Mit einer gestrafften Bühnenfassung von Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“ hat sie in Bregenz eine Regiearbeit mit großem Nachhall vorgelegt. Auch die Umsetzung „Der ideale Staat in mir“ von Bettina Erasmy zeugt von ihrer Fähigkeit, höchst komplexe Themen ohne Verluste in Bildern zu komprimieren. Agnes Kitzler hat in Wien unter anderem Theaterwissenschaft studiert und in England, wo das Studium auch die Theaterpraxis beinhaltet, ihren Hang zur Regiearbeit erfahren können. Nun nach Vorarlberg zurückgekehrt, ist sie am Landestheater auch im Bereich Dramaturgie tätig. Mit Britney Spears hat sie sich erst aufgrund des Regieauftrags intensiver befasst. „In der Person von Britney spiegeln sich viele Themen, die Frauen betreffen in vergrößer-
ter Form wider.“ Wenn man Kinder hat, werde man als Frau sehr verletzlich, da sei es schon fast egal, wie viel Geld man hat. Kitzler verweist im Gespräch auch auf interessante Parallelen in der allgemeinen Geschichte von Frauen. „Frauen die aufmuckten, wurden früher schnell einmal als hysterisch oder unzurechnungsfähig erklärt.“ In der Vormundschaftsthematik sieht die Regisseurin auch eine konkrete Kriminalgeschichte. „Es ist interessant, wie viele Anwälte am Vermögen mitverdienen wollten und wie sie dabei jede Moral verlieren.“
Die Ambivalenz im Bild von der Künstlerin zu dem auch die von Spears selbst gestalteten Videos zählen, hat der Regisseurin ordentlich zu schaffen gemacht, aber diese Herausforderung ist auch das, was sie reizt. „Es gibt kaum ein Stück, an dem ich nichts finde, was mich interessiert.“ Nach längerem Überlegen beantwortet sie die Frage nach einer besonderen Affinität zu einem Stück mit Shakespeares „Hamlet“. Da gelte es das Geheimnis zu knacken, warum er nicht zum Handeln kommt, wobei sie Hamlet als androgyne Figur sieht.


Gute Form zum attraktiven Preis. Mit Fokus auf modernes Wohnen und einem beeindruckenden Küchenstudio setzt Möbel und Küchen Block neue Maßstäbe in Sachen Stil und Funktionalität. Von Minimalistisch bis hin zu Cosy Living bietet das Sortiment für jeden Geschmack das Passende. Das Team von Block zeichnet sich durch echte Fachkompetenz und pure Leidenschaft für Inneneinrichtung aus.



Die
einzigartige Entertainment- und Dinnershow auf dem Bodensee ist zurück – vom 5. bis 9. Dezember 2024, ab den Häfen Bregenz und Konstanz.


MO Catering und die Vorarlberg Lines laden zu einem unvergesslichen Abend auf dem Bodensee ein. Tauchen Sie ein in eine der exklusivsten Eventlocations im Bodenseeraum und spüren Sie das Ambiente der Sonnenkönigin.
GOURMETMENÜ UND KLASSE SHOW
Freuen Sie sich auf eine spektakuläre Show mit Nina Fleisch, Chris Kiliano und weiteren nationalen und internationalen Showgrößen. Mit einem mehrgängigen Gourmetmenü und erstklassigen Service sorgt MO Catering für erlesene GenussMOmente, die keine Wünsche offenlassen. Sichern Sie sich noch heute Ihr Erlebnisticket unter www.sonnenkoenigin.cc
MO CATERING GMBH
Schwefelbadstraße 2, 6845 Hohenems christian.stadler@mo-catering.com
INFOS & BUCHEN: www.sonnenkoenigin.cc


Als Vintage kennzeichnen renommierte Weingüter einen alten, erlesenen Jahrgang. Die Vintage-Mode hat die vinophilen Kriterien Alter, Klasse, Herkunft kopiert. Rarität und Kennerschaft heizen Preise und Begierde an. Wer VintageWein trinkt oder VintageMode trägt, hat Stil. „Mode ist vergänglich, Stil ist ewig“, so Yves Saint Laurent. Sic!
TEXT VON ELISABETH LÄNGLE
Kaiserin Maria Theresia trieb eiserne Sparsamkeit zu Vintage. Coco Chanel fand in alten Herrenkleidern Inspiration und Provokation. 2001 trat Julia Roberts mit einer Valentino Robe von 1982 den Vintage Boom auf Hollywood´s rotem Teppich los. Medienwirksam laufen die Supermodels der 80er- und 90er-Jahre auf dem Society Parkett in Vintage Modellen. Sie tragen einträglich Einzigartigkeit und Unvergänglichkeit zu Markte. Naomi Campbells Vintage-Klamotten genießen in London Museumswürde. Victoria und David Beckham, die jüngst zur Silberhochzeit ihre alten
Hochzeitskleider von 1999 als Symbol ewiger Liebe auskramten, ziehen mit dem Coup neue Millionen Follower an. Den Vintage Boom befeuern Auktionen von Christies und Sotheby´s mit Promi-Kleidern. Für die Fashionistas der Modewelt ist die Schatzsuche nach Vintage Modellen Leistungssport. Dieser setzt Modewissen und Stilbewusstsein voraus. Im Fokus sind Modelle der 80er- und 90er-Jahre, die Mode mit Musik und Lifestyle zur Message „La vita e bella“ remixen. Die Suche nach Stil unterstützen Luxuslabels mit einem Auffrischungsservice für alte Originale oder kaufen sie zurück. Nach dem Motto „Zurück zum Ursprung“ wollen sie das größte Stück vom VintageKuchen. Nicht zur Freude der Online-Platt-
Glamour. Allzeitglitzer in der Mode, Gold, Silber, Pailletten, Strass, Spitzen, Stickereien, Samt, Seide sind zeitlose Zutaten für Glanz & Glamour.


formen für pre-owned und pre-loved Stükke. Im Sog des Vintage Boom blühen aller Orten Secondhand-Läden.
Secondhand Mode. Kleidung, Taschen, Schuhe und Accessoires aus zweiter Hand haben eigene Kriterien. Die gebrauchten Stücke erzählen andere Geschichten. Sie benötigen keine ID, die Jahrgang, Provenienz, Prominenz nachweist. Nicht einmal



die modische Relevanz entscheidet primär über Kauf und Ankauf. Die Motivation der Secondhand-Klientel ist ein Mix aus Öko-Bewusstsein, Geldknappheit, Sympathie für shaby Chic, aber auch Understatement, Differenzierung und Distanzierung von Modetussis, die blind dem letzten Schrei folgen. Die redlichen Motive der KäuferInnen matchen sich mit jenen der EinbringerInnen, deren abgelegte Kleidung in Secondhand-Läden die Chance auf ein zweites Leben hat. Dieses schont Umwelt und Brieftasche. Die riesigen Kleiderberge, die nicht einmal unter der heißen Sonne Afrikas verrotten, können niemanden kalt lassen. Nachweislich verringern Secondhand- und Vintage-Mode den CO² Abdruck. Vor allem die textile Massenindustrie

Cardin. Kein Designer kommt an diesem Großmeister der Mode vorbei. Er hat allem seine Handschrift gegeben. Sardinendosen, Champagner, Flugzeugen, Mode: den Beatles und Evita Perón.

zählt zu den größten Umweltsündern. Ihre Billigreise bezahlen wir alle mit der teuren Rettung unseres Planeten Erde.
Re-Edition von Ikonen. Das Modellarchiv ist das am besten gehütete Gedächtnis jedes Couture- und Designerhauses. Schatzhaus ikonischer Stücke. Modegeschichte zum Anziehen. Fundgrube recycelbarer Ideen, Silhouetten, Stile. Warehouse-size Hub der Luxusmode. Der Vintage Boom hat die Produktion von Re-Editionen ikonischer Designer Stücke zu Blue Chips gemacht. Es handelt sich um neue Ware nach alten Vorlagen. ReEditionen sind autorisierte Kopien von Originalen. Die Kelly Bag von 2024 sieht zwar aus wie jene Henkeltasche, der Grace Kelly ihren berühmten Namen gab, aber erreicht als Re-Edition weder den Preis noch die Attitude der Kellys aus alter Zeit. Letztere spielen in der Champions League des Stils.
Stil versus Mode. Mode kann man an allen Orten und zu jeder Zeit mit Geld kaufen. Im Global Village werden auch Bitcoins akzeptiert. Für den Einkauf von Stil reicht cold cash nicht. Es sind die Neureichen unserer Zeit, die teure Labels als Vermögenserklärung präsentieren. Coco Chanel, die nie akzeptieren konnte, dass man Kleider nach einer Saison wegwirft,

würde die Luxustanten der Oligarchie vulgär nennen. Im Gegensatz zum CEO von Cartier, der bekannte, lieber neureich als niemals reich zu sein. Stil fordert nicht Geld, sondern Haltung und Persönlichkeit, Geschmack wie Gefühl. Individuelles Styling entscheidet nicht das Was, sondern das Wie. Stil ist, wusste George Buffon schon im frühen 18. Jahrhundert, der Mensch selbst. Stilikonen vertrauen zeitlosen Klassikern, die sie je nach Anlass mit ungewöhnlichen Akzenten so variieren, dass ihr Erscheinen in Erinnerung bleibt. Im Alter von 103 Jahren bekannte die amerikanische Stilikone Iris Apfel, dass die Entwicklung eines eigenen Stils ein lebenslänglicher Prozess ist. Diesen verkürzen Stars mit Stilexperten. Fashionistas führt die Suche nach Stil in Vintage-Läden.
Vintage und Männer. In ihrem Fokus sind vor allem Uhren, Weine, Autos. Vintage as its best. Sie sind Sammler & Genießer. Vintage-Mode ist kein großes Thema. Mäntel, Sakkos, Pullover aus Kaschmir, Flanell- und Baumwollhosen hat die Snobiety im Kasten. Basics der Quality Labels. Der Hemdenschneider liefert Nachschub per Post. Weiß, Oxford, Button down funktionieren urbi et orbi, die handgemachten Schuhe noch beim Gang über den Hades. Pierre Cardin, der den Look der Beatles kreierte, die Crew vom Raumschiff Enterprise einkleidete und Madonna abblitzen ließ, hatte 4 Teile im Kasten. Grauer Flanellanzug, dunkelblauer Blazer, weißes Hemd, schwarze Krawatte. „Damit reise ich ein Leben lang um die ganze Welt.“ Pierre Cardin wurde fast 100 Jahre alt.

Erotik. Es waren Männer, die lange vor den Frauen ihre Anziehungskräfte mit Spitzen steigerten. Damit die männlichen Brusthaare sichtbar werden, wählten die Herren der Schöpfung transparente Spitzen.
Frischer Zeitgeist durchdringt die historischen Mauern der Villa Franziska und Iwan Rosenthal in Hohenems schon länger. Man kann es von außen bereits sehen – und bald endlich auch von innen: Als „Literaturhaus Vorarlberg“ öffnet sich für das altehrwürdige Gebäude im Frühling 2025 ein neues Kapitel in seiner bislang 135-jährigen Geschichte.
TEXT VON ANGELIKA SCHWARZ
Vorarlbergs Literaturlandschaft ist reich. Reich an namhaften und preisgekrönten Autor(inn)en, mit über 30 Einrichtungen auch reich an Kulturinstitutionen, die der Literatur einen Schwerpunkt widmen. Und sie ist reich an Literaturbegeisterten und an Schreibenden, von denen über 150 dem Autorenverband literatur:vorarlberg angehören.
Aus diesem Verband heraus hat sich vor knapp zehn Jahren ein Netzwerk etabliert, das – inzwischen zu einem Verein gewachsen – ein verbindendes Dach über diese Landschaft spannt. Mit dem Projekt „Literaturhaus Vorarlberg“ hat der Verein „literatur.ist“ nun nach jahrelanger Vorberei-
tung auch ein physisches Dach geschaffen. Und mehr: „Wenn das Literaturhaus etwas bieten kann, was an Sehnsucht noch nicht oder noch zu wenig erfüllt ist, dann macht es Sinn“, erklärt Kulturmanagerin und Geschäftsführerin Frauke Kühn den damaligen Ausgangspunkt, der heute zum erklärten Anspruch geworden ist: „Wir wollen nichts doppeln, was es schon gibt, sondern ergänzen.“ Außerdem sollen die historischen Türen niederschwellig in moderne Sprach- und Erlebnisräume führen und sich für alle öffnen, die Interesse daran haben, hindurchzugehen: „Wir wollten von Beginn an auch jene ansprechen, die sich noch kaum mit Literatur beschäftigt haben oder gar dachten, dass die Aus-

Die historischen Türen sollen sich für alle öffnen, die Interesse daran haben, hindurchzugehen
einandersetzung mit Sprache, Lesen und Schreiben nichts für sie ist“, ergänzt Jenny Spiegel, Kinderbuchautorin und im Verein

Sehnsüchtig. Der Verein literatur.ist freut sich nach jahrelanger, sorgfältiger Vorbereitung auf die Eröffnung des Literaturhauses im Frühjahr 2025.

„Nicht nur das fertige Buch ist spannend. Auch der Schreibprozess birgt schöne Geschichten, die es zu erzählen gilt.“
unter anderem für den Bereich Kinder- und Jugendliteratur verantwortlich. Mit diesen Grundpfeilern hat das Projektteam 2019 begonnen, sich an den inhaltlichen Aufbau von Vorarlbergs einzigem Literaturhaus heranzutasten. Mit viel Zeit und Bedacht durfte das Konzept Gestalt annehmen. Durch sorgfältiges Ausloten von Möglichkeiten und der zwischenzeitlichen Durchführung zahlreicher Veranstaltungen, Kooperationen und Projekte rund um die Villa und im öffentlichen Raum steht es heute auf einem starken, weil gewachsenen Fundament. Lange vor der eigentlichen Eröffnung haben die ersten inhaltlichen Spuren tiefe Wurzeln geschlagen: „Viele kennen uns schon und wissen daher, dass nicht wir alleine, sondern alle gemeinsam in dieses Haus einziehen.“
Alte Dame mit Ecken und Kanten. Gleichzeitig galt es, die Renovierung des seit 1988 unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes am Eingang zur historischen Innenstadt von Hohenems zu begleiten. Immerhin stehen

dem Trägerverein literatur.ist von den 1500 Quadratmetern Nutzfläche per Mietvertrag 360 Quadratmeter für das Literaturhaus zur Verfügung. Das Haus selbst ist seit 2018 im Besitz der Investorengruppe „Villa Rosenthal GmbH“, die den Hauptteil der Sanierung trägt. Zusätzliche finanzielle Fördermittel kommen von Stadt, Land und Bund. Als Architekt verantwortet Ernst Waibel die Revitalisierung der Villa. Für die Renovierung verantwortlich zeichnet als Projektentwickler die „Arbeitsgemeinschaft STC Development“, wobei die „Schadenbauer Projektund Quartierentwicklung“ bereits mehrere Sanierungsprozesse speziell in der Marktstraße und im Jüdischen Viertel von Hohenems erfolgreich abgewickelt hat.
Alle Beteiligten kennen und achten die historische Vergangenheit des Hauses, sind auch im Austausch mit den Expert(inn)en des nahegelegenen Jüdischen Museums. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der jüdischen Geschichte des Ehepaares Franziska und Iwan Rosenthal, das die Villa 1890 ge-
Unter Denkmalschutz.
Alle Beteiligten achten die historische Vergangenheit des Hauses.


staltet und in den 1930er-Jahren an seine Nichte Amalie Hess vererbt hat, steht allerdings noch aus. „Wir alle haben in diesem aufwändigen und sensiblen Renovierungsprozess viel gelernt“, erklärt Frauke Kühn. „Vor allem über die Eigenheiten des Hauses: Es hat sich uns wie eine alte Dame präsentiert. Mit Ecken und Kanten, die man nicht verbiegen kann, die aber eine eigene Atmosphäre mitbringen, welche ins Konzept mit eingebunden werden will.“ Die Räume wirken unterschiedlich: das Esszimmer bietet ein anderes Ambiente als die Kutscheneinfahrt, der Gartensalon, der Wintergarten oder das Musik- und Spielzimmer. „Jeder Raum wird künftig entsprechend literarisch bespielt“, erklärt Jenny Spiegel.
Ein Ort zum Tun. Die Räumlichkeiten werden zum einen Bühne für Autor(inn)en sein, „gerne auch für unbekanntere Formate der Darbietung, die auch Experimentiercharakter haben dürfen. Das Veranstaltungsdesign wird sich stets weiterentwickeln“, kündigt das Team an, das 2022 von der Inter-

Prägend. Iwan und Franziska Rosenthal mit ihrer Schwester Regine Hess und Nichte Amalie (Amelie) Hess in der Villa Rosenthal, um 1900.
nationalen Bodenseekonferenz für sein mutiges Kuratieren mit dem Förderpreis ausgezeichnet wurde. „Dazu wollen wir auch unsere Besucher(innen) ermutigen.“
Raum für Veranstaltungen, die zumeist am Abend abgehalten werden, ist das eine. Auf der anderen Seite wird das Haus tagsüber vor allem ein Ort sein, „an dem man ins Tun kommt. Ohne Anmeldung, ohne Eintrittsgeld, ohne literarische Vorkenntnisse kann man uns besuchen“, freuen sich die beiden auf regen Austausch: Das Haus steht offen für Gespräche, um zu verweilen, um sich auf Präsentationen vorzubereiten, um zu schreiben oder auch, um spontan an einem Workshop teilzunehmen. Die Besucher(innen) können ihren Aufenthalt selbst kuratieren, über verschiedene Impulse heraus gestalten, das Haus und seine Möglichkeiten auf eigene Faust entdecken. „Wir möchten mit dem Angebot immer wieder
Einladend. Es liegt viel Kraft in diesem alten Haus, es strahlt eine ganz besondere Atmosphäre aus.
Ohne Anmeldung. Das Literaturhaus wird tagsüber ein Ort sein, an dem man ins Tun kommt.

überraschen. Auch uns selbst“, betont Frauke Kühn. Der bewährte Podcast „Radetzkystrasse 1“, der die vielen Stationen und Begegnungen auf dem Weg zum Literaturhaus bisher dokumentiert hat, wird das Geschehen auch weiterhin hörbar machen.
Der Reiz des noch Unfertigen. Ein gewichtiger Schwerpunkt in der inhaltlichen Konzeptionierung liegt auf dem Blick hinter die Kulissen literarischen Schaffens, auf der Prozessbegleitung: Genauso wie die Restaurator(inn)en in der historischen Villa in behutsamer Handarbeit Stück für Stück die Geschichte des Hauses freilegen, werden die Besucherinnen und Besucher eingeladen, die sprachlichen Entstehungsgeschichten literarischer Werke zu erkunden. „Nicht nur das fertige Buch ist spannend. Auch das, was außerhalb des Textes liegt, hat seinen ganz eigenen Reiz. Der Weg, der oft unsichtbar ist und

den man als Leser(in) meist gar nicht mitbekommt, birgt viele schöne Geschichten, die es zu erzählen gilt“, schwärmt Frauke Kühn. „Dieser Prozess ist dem Leben an sich so ähnlich: mal fließt es, mal muss man verwerfen, umkehren, neu beginnen, abschließen. Wir haben gemerkt, dass dieser Ansatz einen ganz eigenen, sehr offenen Zugang zur Literatur bietet und wollen den Menschen anbieten, sich mit Expert(inn)en darüber zu unterhalten.“
Ein weiterer Schwerpunkt, den das Team vorab verraten kann, wird dem Thema Graphic Novel gewidmet sein. Nur so viel: „Unser Herz schlägt wie wild für Comics. In all seinen Facetten.“
Sicher ist auch: Das Literaturhaus wird überall da sein, wo es wirkt. „Wir werden weiterhin über Projektarbeit Sprache, Sprechen, Schreiben und Lesen zu den Menschen bringen.“ Vor allem junge Menschen zeigten sich von den langfristig ausgelegten Konzepten – wie etwa der writers:class an Schulen – begeistert. „Umgekehrt sind wir sehr anfällig für Impulse von außen. Es war und ist uns ein Anliegen, Institutionen und Menschen zu vernetzen“, betonen Frauke Kühn und Jenny Spiegel. „Nicht nur im Vierländereck, sondern im gesamten europäischen Raum. Diese Art der Literaturvermittlung, dieses Miteinander hat uns auf unserem bisherigen Weg gut vorangebracht: Das Projekt Literaturhaus ist wie ein unendlicher Text, der sich gemeinsam immer weiterschreiben lässt.“




















































































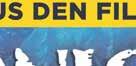


































































































WIENER HANDWERKSKUNST
Die Ludwig Reiter Manufaktur versteht sich auf die traditionsreiche handwerkliche Herstellung rahmengenähter Schuhe – die letzte ihrer Art in Österreich. Bereits 1885 gegründet, wird sie heute in vierter Generation weiterhin als Familienbetrieb geführt. Gefertigt wird exquisite Fußbekleidung im Wiener Stil wie etwa das Modell Touring: Der sportlich elegante Schnürschuh aus hydrophobiertem Veloursleder mit Lammfellfutter präsentiert sich diese Saison auf dem neuen Oskar Leisten. Eine rutschfeste Profilsohle sorgt für einen sicheren Halt bei Spaziergängen in der kalten Jahreszeit. •
ludwig-reiter.com
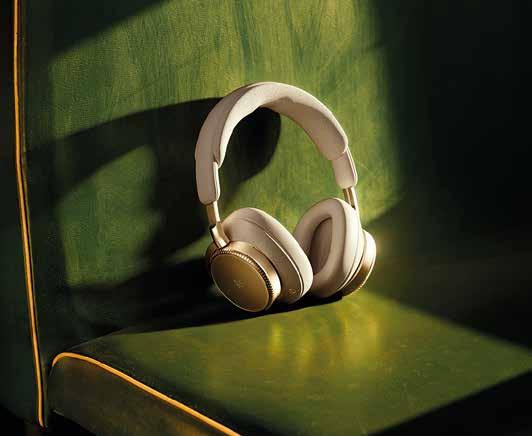
VON HELDEN, UFOS UND POPKULTUR
Was passiert, wenn zwei Ikonen aus den 70er-Jahren miteinander verschmelzen? – Dann schlägt diese Zusammenarbeit gewissermaßen eine Brücke zwischen Welten und Generationen wie im Falle von Tissot und dem Manga „UFO Robot Grendizer“ oder bei uns besser bekannt als „Goldorak“: Die Sonderedition der PRX kombiniert das Vintage-Design mit den Elementen der japanischen Anime-Serie, die in Europa im Jahr 1978 – dem Jahr der Erstauflage der Seastar, des Originalmodells der PRX – große Erfolge feierte. So außergewöhnlich wie das Design der Uhr ist auch die Box: Sie ist dem Goldorak UFO nachempfunden. •
tissotwatches.com

PERFEKT FÜR DIE LIEBLINGSMUSIK
Designtechnisch gesehen verkörpert der neue Kopfhörer Beoplay H100 die DNA von Bang & Olufsen: feinste Klangqualität, herausragende digitale Geräuschunterdrückung, eine neue modulare Konstruktion sowie ein ansprechendes ästhetisches Design. So verfügt er über eine kratzfeste Glasoberfläche an der Seite des Kopfhörers und Lammfell bezogene Ohrpolster. Zusammen mit den haptischen Drehreglern und taktilen Tasten sind alle wichtigen Bedienelemente leicht zugänglich. Mit seinen 40-mm-Treibern aus Titan, die sich hinter eleganten Aluminiumgittern befinden, liefert der Beoplay H100 Hi-Res-Sound. •
bang-olufsen.com/de/at
Was haben so unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler wie Rudolf
Wacker, Matisse, Chagall, Paula Rego, Gallen-Kallela, Rembrandt, Hoogstraten, Caroline Mesquita, Erwin Wurm und Tarek Atoui gemeinsam?
Es empfiehlt sich, ihnen in diesem Herbst und Winter zu begegnen.
TEXT VON CHRISTA DIETRICH
ls Mathias Poledna vor Jahren in seinem Projekt für die Biennale in Venedig ein Eselchen im Trickfilmstil der 1930er-Jahre tanzen ließ, war die Auseinandersetzung mit der Popkultur, aber auch mit der österreichischen Geschichte in Bezug auf den Bambi-Schöpfer Felix Salten augenscheinlich. Der aktuelle Film „My Favorite Shop“ des in Los Angeles lebenden Wiener Künstlers in der Halle für Kunst in Graz verbindet die Ästhetik einer Runway-Show mit klassischer und religiöser Ikonographie. Der Schönheitsbegriff und die Bildwirkung werden in ihrer Komplexität hinterfragt. Die Halle für Kunst, dieser Pavillon am Rande des Stadtparks, hat sich in den letzten Jahren als frei zugänglicher Ort zeitgenössischer Kunst positioniert.
Ab Mitte Dezember sind dort Skulpturen von Caroline Mesquita zu sehen. Die französische Künstlerin fiel vor zwei Jahren mit ihren Werken im Kunstforum Montafon in Schruns – dem hochinteressanten, aber unterbewerteten Unternehmen in Vorarlberg – auf. Das Naheliegende wird manchmal leider übersehen. Vor allem die Veranstaltungen in der eigenen Stadt stärker zu bewerben, diese Idee hat sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Graz auch noch nicht durchgesetzt. Es ist den Verantwortlichen für die Infoscreens jedoch nicht zu verdenken, dass dort nun laufend auf eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum in Wien hingewiesen wird, denn eine Sonderschau zu Rembrandt gab es im größten Museum Österreichs noch nie.
Meisterschaft. Insgesamt 57 Werke von Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) und seinem Schüler Samuel van Hoogstraten (1627–1678) dokumentieren nun bis 12. Jänner wie sich beide Künst-

sind kluge Kommentare zur Politik. Auch jene mit Kinderzeichnungen seines Sohnes Romedius.


In Basel und Wien: „Interieur mit Grammofon“ von Matisse und „Junge Frau im Bett“ von Rembrandt.
Nachdem es von Rudolf Wacker rund 400 Werke gibt, ist die Ausstellung im Leopold Museum in Wien mit 200 Exponaten die umfangreichste Präsentation des Schaffens des aus Vorarlberg stammenden Künstlers und kritischen Beobachters der fatalen Geschehnisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
ler der Herausforderung stellten, dem Motiv durch den Einfall des Lichts Spannung, Lebendigkeit, Tiefenwirkung oder gar den Anschein einer Dreidimensionalität zu verleihen. So wie sich Rembrandts „Mädchen in einem Bilderrahmen“ auf diesen stützt, schiebt Hoogstratens „Alter Mann im Fenster“ den Kopf zwischen Butzenscheiben ins Freie und angesichts seiner faszinierenden Trompe-l’œil-Motive erübrigt sich die Diskussion darüber, wer im Umgang mit Realität und Illusion größere Meisterschaft erreicht hat. Es lässt sich zwar schlussfolgern, dass Rembrandt in der Porträtmalerei – auch seine „Junge Frau im Bett“ aus Edinburgh ist vertreten – unangefochten bleibt, angesichts der Gegenüberstellungen und der Präsenz von Hauptwerken beider Künstler bietet KHM-Generaldirektorin Sabine Haag zum Ende ihrer Amtszeit jedoch ein fulminantes Ausstellungsprojekt.
Theoretische Erläuterung zur Wahrnehmung und Schaffung von Illusion nicht nur über das umfangreiche Katalogbuch anzubieten, sondern auch unaufdringlich in die Ausstellung zu integrieren, stellt einen weiteren Wert dar.
Der Platz für Rudolf Wacker. In seinen Tagebüchern reflektiere Wacker immer wieder Bedeutung, Zweck und Mittel seiner Malerei und auch seine Position im Ver-

gleich zu seinen Zeitgenossen, erklären die Kunsthistoriker Kathleen Sagmeister-Fox und Rudolf Sagmeister. In ihrem Katalogbeitrag zur Wacker-Ausstellung im Leopold Museum nehmen sie auf die kritischen Kommentare Wackers zu Politik und Kirche bzw. zum Austrofaschismus Bezug: „Mit der Geburt des Sohnes 1929 wurde die Angst vor den Auswirkungen nationalsozialistischer Politik, die direkte Bedrohung für Kinder und Jugend virulenter. Die Kinderzeichnungen in seinen zeitkritischen Stillleben warnen nicht nur vor drohender Gefahr, sondern appellieren auch an Mitgefühl und Engagement.“ Die beiden Kunsthistoriker haben über Jahrzehnte in Publikationen und Ausstellungen die starke Position des aus Bregenz stammenden, früh verstorbenen Malers und Zeichners Rudolf Wacker (1893–1939) in der Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdeutlicht. Im nur wenige Schritte vom KHM entfernten Leopold Museum wird sie bis 16. Februar mit rund 200 Exponaten dokumentiert. Der Ort neben Werken von Schiele, Klimt, Dix, Kokoschka oder auch Edmund Kalb sei der beste für Wacker, erklärt Rudolf Sagmeister.
Der Experte hat einst die Kalb-Präsentation im Leopold Museum mitorganisiert und beklagt zu Recht, dass Wacker im Vorarlberg Museum nicht adäquat präsent ist, obwohl er zu den wichtigen Vertretern der Neuen

„Das Fenster“ zählt zu den bekanntesten
Arbeiten von Rudolf Wacker.
Werke von Caroline Mesquita sind in Graz zu sehen.

Meisterliche Illusion bietet Samuel van Hoogstraten mit „Alter Mann im Fenster“.


Vielen

Sachlichkeit und des Expressionismus zählt. Mit einem zweisprachigen Katalogbuch wird nun die internationale Reputation von Rudolf Wacker betont.
Chagall und Matisse. Auch wer die aufschlussreiche Chagall-Ausstellung „Welt in Aufruhr“ vor zwei Jahren in der Frankfurter Schirn gesehen hat, kann der Wiederbegegnung mit dem Werk des Künstlers, die die Wiener Albertina bis 9. Februar bietet, einiges abgewinnen. Marc Chagall (geb. 1887 in Witebsk, gestorben 1985 in SaintPaul-de-Vence) war mehrmals existenziellen Bedrohungen ausgesetzt. Die Kindheit und Jugend in Witebsk, die Jahre in Paris, das Exil in New York, das Leben in Südfrankreich prägen das Schaffen. Neben der Beziehung des Menschen zur Natur sind Heimat, Geborgenheit, Identität, biblische Motive und Verfolgung, Trauer, aber auch Freude wesentliche Themen eines der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Obwohl Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder für seine letzte Ausstellung in der Albertina aufgrund von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine umdisponieren musste und die Leihgaben nun vor allem aus Deutschland, Frankreich, den USA, Italien und der Schweiz kommen, dokumentieren die rund hundert Exponate Chagalls OEuvre im Wesentlichen.
Der Künstler wird in der Bedeutung neben Picasso und Matisse gereiht. Letzterem widmet sich die Fondation Beyeler in Basel-Riehen bis 26. Jänner mit insgesamt 70 Werken. Die Auswahl mit einigen Leihgaben aus Paris, den USA und Privatsammlungen bietet Einblicke in alle Schaffensphasen von Henri Matisse (1869–1954),
wobei der Fokus auf der Verschmelzung von Kulturen, seiner Auseinandersetzung mit der Ornamentik, der Auflösung des Bildraumes, auf seine Einflüsse auf den Fauvismus sowie dem intendierten Gefühlsspektrum durch die Wahl der Farben liegt. „Badende mit Schildkröte“ (1907/8) aus dem St. Louis Art Museum zählt diesbezüglich zu den selten in Europa zu sehenden Exponaten und mit den Papierschnittbildern sind Ikonen der Kunst aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts präsent, ohne die sich die Pop Art nicht denken lässt. In den Landschaften, Porträts, Interieurs oder Aktszenen spiegeln sich auch seine weiten Reisen wider. Sie auch im übertragenen Sinn als eine Wahrnehmung dessen zu sehen, was uns die Welt an sich bereithält, darauf setzt die Fondation Beyeler in Basel-Riehen.
Wien und Basel. Bezüglich dieses Themas an Paul Gauguin (1848–1903) zu denken, ist naheliegend. Beyeler präsentierte erst vor einigen Jahren eine umfangreiche Retrospektive. Unter dem Titel „Gauguin unexpected“ setzt das Kunstforum Wien nun bis 19. Jänner mit rund 80 Werken auf Nachholbedarf in der Bundeshauptstadt, wo es seit mehreren Jahrzehnten keine Gauguin-Ausstellung gab. Es sind überraschende Beispiele aus dem impressionistischen Frühwerk vertreten und die Entwicklung zum Synthetismus wird nachvollziehbar, obwohl die großen Bretagne-Motive fehlen. Serien wie etwa die Illustrationen zu seinem dichterischen Bericht „Noa Noa“ sind der Auseinandersetzung mit seinem Leben auf Tahiti dienlich, Aspekte wie die kulturelle Aneignung sowie die Tatsache, dass viele der Südsee-Bildnisse eine

paternalistische Sichtweise repräsentieren, verlangen jedoch nach einer stärkeren Berücksichtigung als dies in der Ausstellung der Fall ist.
Die Schau ist nicht umfangreich, aber jene knapp 60 Werke von Akseli Gallen-Kallela (1865–1931), die bis 2. Februar im Unteren Belvedere in Wien zu sehen sind, repräsentieren das Schaffensspektrum des finnischen Künstlers. Die Darstellung von Land und Leuten in seiner Heimat, die Beschäftigung mit dem finnischen Nationalepos Ka-

levala, die im Zusammenhang mit den Bestrebungen des Landes nach Unabhängigkeit zu lesen ist, sein Beitrag zum Jugendstil bzw. zum Zusammenwirkung von Malerei, Architektur, Handwerk und Design werden erfahrbar. Dass der Blick bei den Seenlandschaften hängen bleibt, die einem Werk von Gustav Klimt gegenübergestellt sind, ist nachvollziehbar. Werke von Akseli GallenKallela waren zudem 1901 und 1904 in der Wiener Secession vertreten. Mit seinem Schaffen wird man demnächst auch in der Fondation Beyeler in Basel-Riehen konfrontiert. Bei der vom 26. Jänner bis 25. Mai 2025 angekündigten Ausstellung „Nordlichter“ steht Gallen-Kallela ebenso auf der Liste wie der Norweger Edvard Munch und die Schwedin Hilma af Klint.
Widerstandskraft von Frauen. Besuchern der hervorragend von Cecilia Alemani kuratierten zentralen Ausstellung der Biennale Venedig 2022 sind drastische Werke der portugiesisch-britischen Künstlerin Paula Rego (1935–2022) vermutlich gut in Erinnerung. Das Kunstmuseum Basel bietet bis 2. Februar die Konfrontation mit ihrem umfangreichen, kompromisslosen Schaffen, mit dem sie komplexe Machtdynamiken sowie die auch nach der SalazarDiktatur anhaltende Unterdrückung und die Gewalt gegen Frauen thematisiert. Bilder, die etwa die Heuchelei der katholischen Kirche thematisieren und Stereotype entlarven sind mitunter von einem tiefgründigen Humor gekennzeichnet und vermitteln die Widerstandskraft von Frauen.
Übrigens: Rudolf Wacker auch mit dem Kunsthaus Bregenz, den Ausstellungsort
Intensives Hinhören wird bei Tarek Atoui im Kunsthaus Bregenz zur besonderen Erfahrung.

für internationale zeitgenössische Kunst, in Verbindung zu bringen, ist für jene nicht überraschend, die den Werdegang dieser Institution kennen. Kurz nach der Eröffnung des Gebäudes im Sommer 1997 mit Arbeiten von James Turrell waren dort auch einmal Werke von Wacker, Albert Bechtold und Edmund Kalb zu sehen, also von Künstlern, deren internationale Bedeutung der Öffentlichkeit noch nahezulegen war. Das KUB war dazu ein guter Ort und konnte sich danach mit seiner zeitgenössischen Ausrichtung bestens positionieren. Die Ausstellungsliste der letzten 25 Jahre lässt die Berücksichtigung verschiedener Genres erkennen. Nach Susan Philipsz und Anri Sala sich erneut dem Hören und Hinhören zu widmen und dem französisch-libanesischen Musiker und Künstler Tarek Atoui die Räume zu überlassen, entspricht einer konsequenten Programmierung. Wasser, Wind und Baumaterialien aus verschiedenen Ländern inklusive deren politischer Kontextierung machen das KUB bis 12. Jänner nicht nur zu einem Forschungslabor, in dem die Beziehung zwischen Klang und den Elementen zu erkunden ist, sondern im Dialog mit der Architektur auch selbst zum einzigartigen Instrument.



WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Sie haben die Strategien und Ideen für nachhaltiges Wachstum. Wir unterstützen Sie zuverlässig bei der Umsetzung und finden gemeinsam Lösungen, die Ihr Unternehmen weiterbringen.
Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels, Salzburg und St. Gallen (CH). www.hypovbg.at