Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin


Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Zwei Freunde und ein kleiner Löwe
Ein Mann, ein Fürstentum und viele Yachten
Special: Kultursommer in Vorarlberg
Wo es um Hundertstel Millimeter geht
Das große Potenzial von kleinen Chips

„Der neue Präg. Weil Schönheit glücklich macht.“
Erleben Sie unser außergewöhnliches Ambiente und einen Ort mit den begehrtesten Schmuckstücken und edlen Zeitmessern. Wann nehmen Sie sich Zeit, um durch unsere neu gestalteten Räume zu flanieren und einen entspannten Drink an unserer Bar zu nehmen? Wir laden Sie ein zum Genießen und Staunen - und zu Begegnungen mit Schätzen von zeitloser Schönheit und unvergänglichem Wert.
Anna-Lena Hollfelder



JUWELIER PRÄG praeg.at juwelier.praeg

Gesundes Wachstum, nachhaltige Ernte.
Sicher, kompetent und persönlich –unsere Werte sind so bewährt wie aktuell. Sie schaffen den Boden für nachhaltiges Vertrauen.
Zeitgemäßes Private Banking verlangt exzellentes Wissen ebenso wie Vernunft, maßgeschneiderte Lösungen sowie den Blick für das richtige Maß. raiba-privatebanking.at

Eine bizarre Winterlandschaft mit einem halb versunkenen Dorf, garniert mit gruseligen Details und dämonischen Wesen – so gestaltet Regisseur, Bühnenbildner und Filmemacher Philipp Stölzl seine Kulisse für die Oper „Der Freischütz“ bei den diesjährigen Bregenzer Festspielen. „kontur“ hat sich von dieser düsteren Vision inspirieren lassen und dieses Setting kreativ für das Cover interpretiert.
Doch nicht nur auf der Bühne braucht es für den berühmten Blick über den Tellerrand Neugierde, Begeisterung, Mut und natürlich das nötige Know-how. Bewiesen haben das Pierre de Meuron und Jacques Herzog. Trotz ihrer kometenhaften Karriere suchen die beiden Architekten bis heute immer wieder einen neuen konzeptuellen Ansatz, um ihr visionäres Denken auf allen Ebenen voranzutreiben. Oder das Vorarlberger Getriebebauunternehmen Zimm, das mit seiner innovativen Technik die Welt bewegt, genauso wie Martin Messmer, der einst sein Auto vollpackte und mit dem Mut zur Veränderung in das Abenteuer seines Lebens Richtung Monaco aufbrach – getreu des französischen Schriftstellers Anatole France, der einst schrieb: „Wenn wir uns nicht verändern, wachsen wir nicht. Wenn wir nicht wachsen, leben wir nicht wirklich“. In diesem Sinne: Bleiben Sie neugierig.
Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr „kontur“-Redaktionsteam
Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Russmedia Verlag GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Redaktionelle Leitung: Christiane Schöhl von Norman, christiane.norman@russmedia.com
Redaktion:
Christa Dietrich, Ernest F. Enzelsberger, Gudrun Haigermoser, Marion Hofer, Elisabeth Längle, Franz Muhr, Angelika Schwarz
Artdirection: Bernadette Prassl, bernadette.prassl@russmedia.com
Anzeigenberatung: Russmedia GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Patrick Fleisch, Thorben Eichhorn, Sascha Lukic, Gabriel Ramsauer, Roland Rohrer Druck: Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, A-6850 Dornbirn, Schwefel 81 Erscheinungstag: 11. Juni 2024; Nächste Ausgabe: 15. November 2024




Seite 06 | Bregenzer Festspiele. Kein Problem mit dem Teufel
Seite 10 | Herzog & de Meuron. Zwei Freunde und ein kleiner Löwe
Seite 10 | Zimm Group. Es geht um Hundertstel Millimeter
Seite 17 | Photeon Technologies. Winzige Wunderwerke
Seite 20 | Martin Messmer. Den Wind in den Segeln
Seite 26 | Anna Irene Eberle. Beauty-Sheriff der Promis
Seite 34 | Special. Kultursommer in Vorarlberg


Seite 52 | Diamante. Fast perfektes Fußballmärchen oder frag doch Toni
Seite 57 | Stefanie Marik. Mikrokosmos mit Motto
Seite 60 | Gebrüder Zwing. Wenn Handwerk mit Ästhetik flirtet
Seite 65 | Paul Renner. Knochen, Schädel und magisches Licht
Seite 68 | Mercedes AMG GT. Fahren in eine andere Welt
Seite 70 | Luke Bereuter. Zurücklehnen ist keine Option
Seite 74 | Sound & Spritzer. Wo Albert Tina zum Feiern trifft
Seite 78 | Biennale. In Venedig könnten Fremde Freunde werden


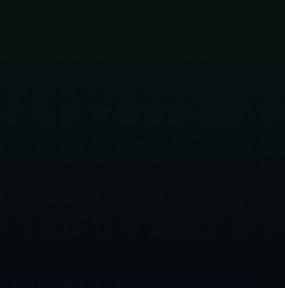
FÜR DEN BMW i5 TOURING.






Freude am Fahren. 100% Elektrisch.
1,99%* FIXZINSSATZ.



Stiglingen 75, 6850 Dornbirn Telefon 05572/23286-0 info.dornbirn@unterberger.bmw.at www.unterberger.bmw.at







Bundesstraße 96, 6710 Nenzing Telefon 05525/6971-0 info.nenzing@unterberger.bmw.at www.bmw-unterberger-nenzing.at
BMW i5 eDrive40 Touring: Verbrauch elektrisch, kombiniert WLTP in kWh/100 km: 16,7–19,3; Elektrische Reichweite, WLTP in km: 483 - 556



* Angebot der BMW Austria Leasing GmbH, BMW Select Leasing für den BMW i5 eDrive40 Touring, Anschaffungswert höchstens € 70.297,10, Anzahlung € 20.590,-, Laufzeit 48 Mon., Leasingentgelt € 469,- mtl., genaue Höhe abhängig von Sonderausstattung und Zubehör gem. individueller Konfiguration, 10.000 km p.a., Restwert € 30.370,94, Rechtsgeschäftsgebühr € 434,70, Bearbeitungsgebühr € 260,-, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, eff. Jahreszins 2,47%, Sollzins fix 1,99%, Gesamtbelastung € 74.167,64. Beträge inkl. NoVA und MwSt. Angebot freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gilt für sämtliche Fahrzeuge der Elektropalette von BMW bei Vertragsabschluss von Kauf- und Leasingvertrag von 07.02.2024 – 30.06.2024, Auslieferung bis 30.09.2024. Unterschiedliche Konditionen je nach Baureihe: 1,99% Fixzins bei BMW i5; 2,99% Fixzins bei BMW i4, iX3 und iX; 3,99% Fixzins bei BMW iX1 und iX2. Ausgenommen von der Aktion ist die Modellbaureihe BMW i7. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die teilnehmenden BMW Partner zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit anderen Leasing-Angeboten. Angebot gültig bei allen teilnehmenden BMW Partnern.

„Ich freue mich immer auf die Wolfsschlucht“, sagt Philipp Stölzl. Der Regisseur, Bühnenbildner und Filmemacher inszeniert bei den Bregenzer Festspielen heuer nicht nur die Oper „Der Freischütz“, er hat auch dieses bizarre Dorf entworfen, das samt einiger gruseliger Details nun zwei Jahre lang die Bühne auf dem See bildet. Es wird eine andere Sichtweise der Oper von Carl Maria von Weber geben, aber es wird auf jeden Fall höllisch.

Winterlandschaft. Die erste Präsentation des Konzeptes für eine neue Seebühneproduktion in Bregenz wird immer mit Spannung erwartet: Pressesprecherin Babette Karner, Intendantin
Elisabeth Sobotka, Festspielpräsident Hans Peter Metzler, Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl und Festspieldirektor Michael Diem.

Für das Gespräch über seinen Bregenzer „Freischütz“ unterbricht Stölzl die Filmarbeiten, für die er kurz vor Probenbeginn auf dem See auch einige Zeit in Budapest verbringt. Vor rund zehn Jahren kam seine Verfilmung des Romans „Der Medicus“ von Noah Gordon in die Kinos. Die spannende Geschichte über einen Heilkundigen erhält nun eine Fortsetzung, die Ende nächsten Jahres zu sehen sein wird. Einer seiner letzten filmischen Arbeiten war die „Schachnovelle“, in der er frei nach dem gleichnamigen Werk von Stefan Zweig Folter und Isolationshaft in der Nazi-Diktatur thematisierte.
Die Handlung von „Der Medicus“ ist im Mittelalter verankert. So weit braucht er sich nun nicht zurückzuversetzen, geht es nach dem Originallibretto, so befindet man sich bei der „Freischütz“-Geschichte in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, also im 17. Jahrhundert. Doch darauf sollte man sich nicht festlegen, Stölzl hat die umfangreichen Sprechpassagen in diesem Werk umarbeiten lassen.
Bregenzer Fassung. Auf dem See wird jede Oper ohne Pause gespielt, mehr als zwei Stunden soll sie nicht dauern, ohne Kürzungen geht somit nichts. „Ja, es gibt eine Bregenzer Fassung“, erklärt der Regisseur, „irgendwo muss man das Messer ansetzen, auch innerhalb der Musiknummern, aber mir ist die Problematik bewusst. Ich hätte gerne einmal eine gekürzte Fassung vom ,Ring des Nibelungen’ gemacht, es aber bleiben lassen, weil die Leute schon bei jedem Kürzungsvorschlag nahezu ausgezuckt sind.“
Den „Freischütz“ hatte er vor Jahren einmal am Theater in Meiningen inszeniert. Um die Ankunft jenes Eremiten zu verdeutlichen, der zum Finale immer ein wenig wie ein Deus ex machina auftritt und den Tod der von der Freikugel getroffenen Agathe verhindert, hatte er die unkomponierte Szene
aus dem Libretto, in der Agathe zum Eremiten geht, weil sie so quasi eine Vorahnung hat, als Sprechszene an den Beginn gestellt. Mitten im Spiel rief eine Zuschauerin „jetzt haben die doch glatt die Ouvertüre weggelassen.“ Die Dame hatte sich zu früh empört, denn die Ouvertüre erklang selbstverständlich gleich darauf und wer nun weiß, dass Stölzl für Bregenz ein wenig an den Musiknummern geschraubt, deren Zahl also reduziert hat, braucht sich nicht zu sorgen, dass man ihm gar den berühmten Jägerchor („Was gleicht wohl auf Erden .“) wegnimmt.
In der Wolfsschlucht fehlt schon einmal gar nichts. Wir erinnern uns: Max darf seine Verlobte Agathe erst ehelichen und damit eine Erbförsterei übernehmen, wenn er beim Probeschießen gut abschneidet. Aus Angst vor dem Versagen lässt er sich von Kaspar, einem Jäger, der von Agathe einst abgewiesen wurde und den Stölzl als ein Pendant des sich mit Mephisto eingelassenen Faust sieht, zum Gang an diese unheimliche Stelle überreden, wo Samiel für die rettende Munition sorgt. „Wir haben im ,Freischütz’ eben diese 19.-Jahr-

Fortsetzung folgt. Szene aus der erfolgreichen Romanverfilmung „Der Medicus“. Stölzl arbeitet zurzeit am zweiten Teil.
Mit Verdis „Rigoletto“ realisierte Philipp Stölzl eine der spektakulärsten Operninszenierungen auf dem See.

hundert-Moritat mit allen diesen moralischen Themen, wenn man sich als Regisseur nicht auf diese einlässt oder, wenn man keine Lust auf Schauergeschichten hat, dann muss man es eben bleiben lassen.“ Einer seiner Lehrer hatte ihm einmal gesagt, dass man sich erst dann Bühnenbildner nennen darf, wenn man die Wolfsschlucht einmal bewältigt hat.
Potenzprobleme? Philipp Stölzl wird sich nicht um die Geistererscheinungen drücken. Er freut sich immer und somit auch als Regisseur in Bregenz auf die Wolfsschlucht, erläutert aber, dass es in dieser Oper mit diesem Männer- und Jägerkult auch eine psychologische, freudianische Ebene, den Beweis der Potenz gibt. Max ist bei ihm auch kein Jägersbursch, sondern er bleibt jener Schreiber, der er im Gespensterbuch von Apel und Laun ist, aus dem der „Freischütz“-Librettist Friedrich Kind den Plot nahm und veränderte. In der 1821 uraufgeführten Oper stirbt Agathe nicht an der letzten, der in der Wolfsschlucht gegossenen Freikugeln, ein Eremit erscheint und lenkt die Kugel um, die dann Kaspar trifft.
Wer jetzt an „The Black Rider“ von Robert Wilson, Tom Waits und William S. Burroughs denkt, liegt richtig. Der Ursprung des Stoffs für dieses zum Hit gewordene, 1990 uraufgeführte Musiktheater ist derselbe, aber das Finale bleibt im Vergleich zum „Freischütz“ tragisch.
Was den erwähnten Eremiten betrifft, werde es die eine oder andere Überraschung geben, aber eines verrät Philipp Stölzl, der Figur des Samiels, dieses schwarzen Jägers in der Wolfsschlucht, verleiht er auf der Seebühne mehr Gewicht. Samiel tritt als Conférencier auf und ist mit allerlei Fähigkeiten ausgestattet, die zu Erscheinungen führen. Auch die Kirchturmuhr hat er in der Klaue.
Das Spektakel darf somit sein. Dass es Stölzl zu entfachen versteht, hat er in seiner „Rigoletto“-Inszenierung in Bregenz gezeigt, für die er einen riesigen Clownskopf in den See setzte, der sich getreu der düsteren Handlung nach und nach zum Totenkopf verwandelte.
In die Tiefe des Sees. Was die Szenerie betrifft, so geht er mit diesem halbversunkenen Dorf in die Breite, lässt bis an die erste Publikumsreihe spielen, wollte den See aber nicht verbauen. „Man wird viel davon sehen, auch die Tiefe.“
Während sich die Männer also am Schießstand beweisen, sitzen die Frauen zu Hause und flechten Kränze. Das Problem mit den weiblichen Figuren bzw. der passiven oder der sich opfernden Frauen in Opern, die man heute nicht mehr so erzählen kann, sei ihm bewusst, betont er eigens. Im Vergleich zu „Madama Butterfly“ mit ihrer geradezu hermetischen Partitur (jener Oper, die in der Inszenierung von Andreas Homoki in den Sommern 2022 und 2023 auf dem See gespielt wurde) biete der „Freischütz“ immerhin einige Möglichkeiten, die Figuren innerhalb des Kontextes zu modernisieren.
„Da muss man mit viel Fingerspitzengefühl drangehen, denn, wenn die Inszenierung etwas anderes erzählt als die Musik, dann entsteht eine Grätsche. Deswegen lasse ich die Gruselgeschichte eine solche sein, ich habe aber alles getan, was möglich ist, um die Frauen als solche zu zeigen, die durchaus aktiv sind und sich mit diesem Dorf herumschlagen.“ Ännchen und Agathe sind bei Stölzl somit auch Frauen, die sich trauen, ihr soziales Umfeld gegebenenfalls zu verlassen. „Mir ist die Thematik mehr als nur bewusst. Als Vater einer zehnjährigen Tochter stelle ich fest, dass selbst in moderneren Kinderbüchern, die mir lange durchaus lieb waren, noch Rollenstereotype vorkommen.“ Christa Dietrich

Die „Freischütz“Szenerie suggeriert erst einmal Kälte, aber es wird höllisch heiß.
Die
Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber wird in Bregenz erstmals auf dem See realisiert. Sie wird heuer ab 17. Juli insgesamt 28 Mal aufgeführt.

Pierre de Meuron und Jacques Herzog – ein preisgekröntes Architekten-Duo, charmanterweise noch dazu Freunde fürs Leben, die ihren Blick nicht nur auf prestigeträchtige Großprojekte richten, sondern auch in künstlerischen Kleinoden immer einen neuen konzeptuellen Ansatz suchen, um ihr visionäres Denken auf allen Ebenen weiterzuentwickeln.
Sie sind seit der 1. Klasse befreundet, kennen sich also fast ihr ganzes Leben, was vielleicht auch der Genialität der beiden zu pass kommt. Fest steht: Sie studieren gemeinsam an der renommierten ETH Zürich, eröffnen 1978 in Basel ein Studio und legen damit den Grundstein für ihre späteren „architektonischen Fußabdrücke“, die im Laufe der Jahre rund um die Welt immer mehr Spuren hinterlassen sollten. Der Erfolg kennt nur eine Richtung: Seit damals stoßen immer neue Partner hinzu – heute arbeitet Herzog & de Meuron mit über 500 Mitarbeitern an Projekten in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Zum Hauptsitz in Basel hat das Büro heute weitere Dependancen in Berlin, Hongkong, London, München, New York, Paris und San Francisco.
Architektonische Avantgarde. Im Laufe der Jahre entstehen Projekte auf der ganzen Welt. Die Bandbreite ist beeindruckend: Vom Bühnenbild und Einfamilienhaus bis hin zu Großprojekten wie Museen, Stadien, Wohn- und Bürohauskomplexen, aber auch städtebaulichen Wahrzeichen ist alles dabei – wie etwa die
Elbphilharmonie Hamburg, die wie eine gläserne Welle direkt an der Hafen-City mit 110 Metern in die Höhe ragt und ein Symbol für die Verbindung von geschichtsträchtiger Vergangenheit und Zukunft der Stadt darstellt, denn die beiden Architekten berücksichtigen bei ihrer konzeptionellen Arbeit immer das Setting, das die Welt um das Projekt herum definiert. Besonders spektakulär ist auch das Beirut Terraces, weil es durch seine spielerisch übereinander gelegten Plattformen die Vorstellung sowie das Verständnis von Hochhäusern neu definiert.
Die Aufzählung wäre beliebig fortsetzbar, denn Herzog & de Meuron gehören zweifellos zur architektonischen Avantgarde, sind vielfach preisgekrönt, und ihre Bauten sorgen regelmäßig für eine hohe mediale Aufmerksamkeit – und doch liegen den beiden auch die kleinen Projekte am Herzen wie etwa das Stadthotel „kleiner Löwe“, das mit seinem markanten Tonnendach am Kornmarkt in Bregenz thront und in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Büro-Partner Robert Hösl realisiert wurde, der übrigens auch an der Elbphilharmonie beteiligt war.

Das Erkennungsmerkmal von Herzog & de Meuron ist, gerade keinen typischen Stil zu haben.
Stadthotel. Der „kleine Löwe“ mit seinem markanten Tonnendach thront selbstbewusst am Kornmarktplatz in Bregenz.


Hochhaus. Das Beirut Terraces zeichnet eine schichtartige Struktur aus.

Konzerthaus. Die Elbphilharmonie Hamburg ragt wie eine imposante Welle in die Höhe.


Avantgarde. Pierre de Meuron und Jacques Herzog haben mit ihren Entwürfen rund um den Globus Wahrzeichen erschaffen.
Charakteristisch. Viel Holz, Glas, warme Farben und raffinierte Details zeichnen das Interieur des „kleinen Löwen“ aus.

Eine Art Gesamtkunstwerk. Der fünfgeschossige Neubau beherbergt ein kleines Hotel mit acht Zimmern, einen Salon sowie eine Privatwohnung mit Dachterrasse. Die Architektur ist unaufgeregt und gleichzeitig im wahrsten Sinne allumspannend: viel Glas, eine für das Stadtbild bereichernde und zugleich unaufdringliche Formensprache, die sich nahtlos in die Umgebung einfügt. Den Reiz dieses Objekts fasst Robert Hösl folgendermaßen zusammen: „Das Stadthotel ‚kleiner Löwe‘ ist zwar ein sehr kleines Projekt und insofern eher eine Ausnahme in unserem Portfolio. Es hat aber aufgrund seiner exponierten Lage am Kornmarktplatz eine hohe Relevanz für den Ort und es verknüpft darüber hinaus auf kleinstem Raum unterschiedlichste Aspekte: den Umgang mit historischer Bausubstanz, eine sehr anspruchsvolle, beengte Parzelle und ein spannendes und vielfältiges Raumprogramm mit einem öffentlichen Stadtsalon, einem kleinen Boutique-Hotel und einer exklusiven Maisonette-Wohnung. Auch sahen wir das Potenzial, mit unseren Innenarchitekten und un-


serer Abteilung für Möbeldesign H&dM Objects das kleine, maßgeschneiderte Hotel zu einer Art Gesamtkunstwerk zu verdichten.“ Auch der Name spannt einen Bogen: Das im 19. Jahrhundert errichtete Gebäude wurde zunächst als Bierbrauerei – mit angeschlossenem Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ – dann als Kino („Löwen Kinematograf“), Bank, Möbelhandel sowie in jüngerer Vergangenheit als Bar und Club genutzt und immer wieder erheblich umgebaut.
Expertise. Robert Hösl arbeitet seit dem Jahr 1994 bei Herzog & de Meuron. Seit 2004 ist er Partner und für zahlreiche Projekte wie die Allianz Arena in München oder den „kleinen Löwen“ in Bregenz verantwortlich.
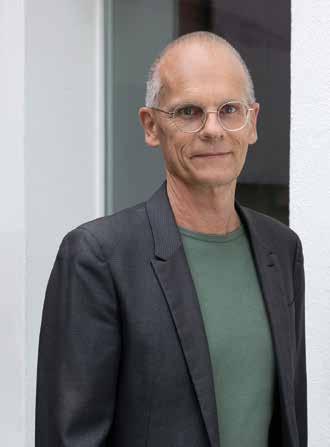
Ohne vorgefertigte Meinung. Die Arbeiten des Architekturbüros zeichnen sich generell durch einen explorativen Ansatz aus, neue Lösungen, Ideen und Denkweisen zu finden. „Das Erkennungsmerkmal von Herzog & de Meuron ist, gerade keinen typischen, wiedererkennbaren Stil zu haben. Alle unsere Projekte werden auf der Grundlage ihrer jeweils spezifischen Situation, der Aufgabe und den Erwartungen der Auftraggeber, dem soziokulturellen Hintergrund und vielen weiteren Einflussgrößen entwickelt und wir steigen ohne eine vorgefertigte Meinung in diesen Prozess ein. Gerade das auch für uns selbst anfangs völlig offene Ergebnis reizt uns und treibt uns voran“, beschreibt Robert Hösl den kreativen Schaffensprozess, der somit eine kontinuierliche Interaktion und Neuinterpretation der vorhandenen Gegebenheiten sowie die Einbeziehung der Umgebung beinhaltet. Das Streben nach einem einzigartigen künstlerisch-angehauchten architektonischen Ausdruck schwingt bei allen Arbeiten mit, denn Architektur bedeutet eben nicht nur möglichst ökonomisch sinnvoll zu bauen. Vielmehr stehen komplexe, dynamische Geometrien im Zentrum, welche das Potenzial haben, zu einem Wahrzeichen zu avancieren. Christiane Schöhl von Norman
Der neue vollelektrische Taycan.

Porsche Zentrum
Vorarlberg – Rudi Lins Bundesstraße 26d 6830 Rankweil Telefon +43 5522 77911 info@porschezentrumvorarlberg.at www.porschezentrumvorarlberg.at
Porsche Service
Zentrum Dornbirn Schwefel 77
6850 Dornbirn Telefon +43 5572 25310 www.autohaus-lins.at
Taycan – Stromverbrauch kombiniert: 16,7 – 19,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Stand 05/2024. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des neuen WLTP-Prüfverfahrens ermittelt.
Der international erfolgreiche Maschinenbauer Zimm entwickelt, produziert und verbreitet am Firmenhauptsitz in Lustenau qualitativ hochwertige elektromechanische Antriebe und Getriebe.
Der Betrieb, der 1977 von der Familie Zimmermann in Bregenz gegründet wurde, hat sich im Laufe der Jahre zu einem international agierenden Global Player weiterentwickelt. Heute ist die Zimm Group im Millennium Park in Lustenau beheimatet, mit allein 145 Mitarbeiter(inne)n in Vorarlberg und einer Exportquote von über 80 Prozent.
Eigenfertigung. Verantwortlich für diesen Erfolg ist das Produktportfolio: Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Hubsystemen sowie seit letztem Jahr auch elektromechanische Aktuatoren, hochwertige Gussgehäuse sowie Dreh- und Frästeile. Der umfangreiche Systembaukasten von Zimm beinhaltet bewährte Standardkomponenten sowie Sonderlösungen – beide Varianten mit moder-

ner CNC-Technik gefertigt, wie Geschäftsführer Gunther Zimmermann unterstreicht. Seit 12 Jahren steht er an der Spitze des Familienunternehmens. Ein hauseigenes Prüflabor sorgt darüber hinaus für eine lückenlose Qualitätssicherung. „Die gleichbleibend hohe Güte unserer Produkte erreichen wir durch eine hohe Eigenfertigung, einer Fertigung auf dem neuesten Stand, internen Mess- und Testanlagen, einem zeitgemäßen Qualitätsmanagement sowie einer konstruktiven Fehlerkultur“, erklärt der Chef des einzigen Getriebebau-Unternehmens in Vorarlberg.
Einsatzgebiet. Zum Einsatz kommen die Systeme dort, wo Gewichte von wenigen Kilogramm bis zu 100 Tonnen präzise gesteuert, kontrolliert und positioniert werden müssen wie etwa auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele. Die ausgefeilte

Technik ermöglicht wechselnde, sich bewegende Bühnenelemente sowie die Montage bzw. das Zusammensetzen schwerer Elemente. Auch das Mariinsky-Theater in St. Petersburg oder das Bolschoi-Theater in Moskau nutzen die innovativen, maßgeschneiderten Lösungen aus Lustenau für ihre tonnenschweren Bühnenbewegungen. Bei riesigen Parabolantennen, wie sie an Küsten, Bergen und in Wüsten betrieben werden, kommen die Getriebe ebenfalls zum Einsatz und sorgen für eine präzise, störungsfreie Positionierung der „Schüsseln“. „Unsere Technik stellt die Einstellung der entsprechenden Achsen bis in den Hundertstel-Millimeter-Bereich sicher“, weiß der Maschinenbauexperte und führt weiter aus: „Dadurch leisten wir einen wesentlichen Beitrag für die globale Kommunikation sowie die Raumfahrtkontrolle und -überwachung.“

Gunther Zimmermann steht seit dem Jahr 2012 an der Spitze des Unternehmens, das 2023 einen Umsatz von 30 Mio. Euro (+7,7 Prozent zum Vorjahr) generierte sowie Investitionen von 1 Mio. Euro tätigte.

Führung. Verkaufsleiter Peter Gridling (l.) mit Geschäftsführer Gunther Zimmermann (r.).
Global Player. Das Hauptquartier der Zimm Group ist im Millennium Park in Lustenau. Die Exportquote liegt bei über 80 Prozent.

Expertenteam. Sichergestellt wird die hohe Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit der Produkte vor allem durch eine intensive Weiterbildung der Mitarbeiter(innen) sowie durch eine vertiefte Lehrlingsausbildung. „Die Investition in die Ausbildung von Fachkräften ist eine Investition in die Zukunft, welche die Produktqualität sichert“, ist Gunther Zimmermann überzeugt. Deshalb legt das Unternehmen großen Wert auf eine hochwertige Lehraus-
bildung. Die 2022 eröffnete Werkstätte schafft ein Umfeld, in dem die Auszubildenden in den Bereichen Zerspanungstechnik, Maschinenbautechnik und Metallbearbeitung umfassend geschult werden. „Damit sie später alle nötigen Fähigkeiten beherrschen, um Getriebe bauen, testen und verfeinern zu können – müssen sie komplexe Abläufe erlernen. Daher arbeiten sie schon ab dem 2. Lehrjahr an Produktionsaufträgen und Sonderteilen
mit und lernen so von Anfang an, was es heißt, den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden“, so Zimmermann.
Belohnt wurde dieses Engagement mit dem Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“. Somit steht bereits die nächste Expertengeneration bei Zimm in den Startlöchern, die dafür sorgt, dass das Lustenauer Unternehmen die Welt weiter im Großen und Kleinen bewegt. Ernest F. Enzelsberger
„So individuell wie Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden, so vielfältig sind unsere Ein- und Aufstiegschancen“, ist Generali Vorstand Arno Schuchter überzeugt.
Welche Karrieremöglichkeiten bietet die Generali? Egal ob als Lehrling, Quereinsteiger(in) oder mit Berufserfahrung – innerhalb der Generali Österreich gibt es viele Chancen, um ein und aufzusteigen. Besonders im Vertrieb suchen wir laufend nach motivierten Kolleg(inn)en, die unser erfolgreiches Team verstärken. Um unseren Kund(inn)en eine optimale Beratung zu bieten, setzen wir einen starken Fokus auf die Aus und Weiterbildung unserer Mitarbeiter(innen). So stellen wir schon jetzt die Weichen für die Zukunft.
Haben sich die Anforderungen an den Arbeitsplatz geändert? Ja, wir nehmen vor allem den Wunsch nach mehr Flexibilität und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wahr. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen und sprechen mit dem Teilzeitmodell im Außendienst gezielt neue Zielgruppen an: Für die spannenden
Tätigkeiten in der Kundenbetreuung sollen speziell Eltern, die nach der Karenz nicht in ihren alten Job zurückkehren wollen, oder Quereinsteiger(innen) aus anderen Branchen gewonnen werden.
Was zeichnet die Generali als Arbeitgeberin aus? Wir möchten nicht nur für unsere Kund(inn)en, sondern auch den Mitarbeiter(innen) ein Lifetime Partner sein und ihnen in jeder Lebenslage zur Seite stehen. Neben einer hohen Flexibilität ist auch die attraktive leistungsbezogene Bezahlung für unsere Kundenbetreuer(innen) ein großer Pluspunkt. Dass wir mit diesen Ambitionen auf dem richtigen Weg sind, zeigen auch unsere zahlreichen Auszeichnungen als Arbeitgeberin. Seit 2012 nehmen wir am Audit „berufundfamilie“ teil und führen das staatliche Gütezeichen für eine familienfreundliche Personalpolitik.


Sie wollen mehr erfahren? App downloaden und Video ansehen!
Ute Faber, Kundenbetreuerin Wien

Arno Schuchter, Generali Vorstand für Marketing und Vertrieb.
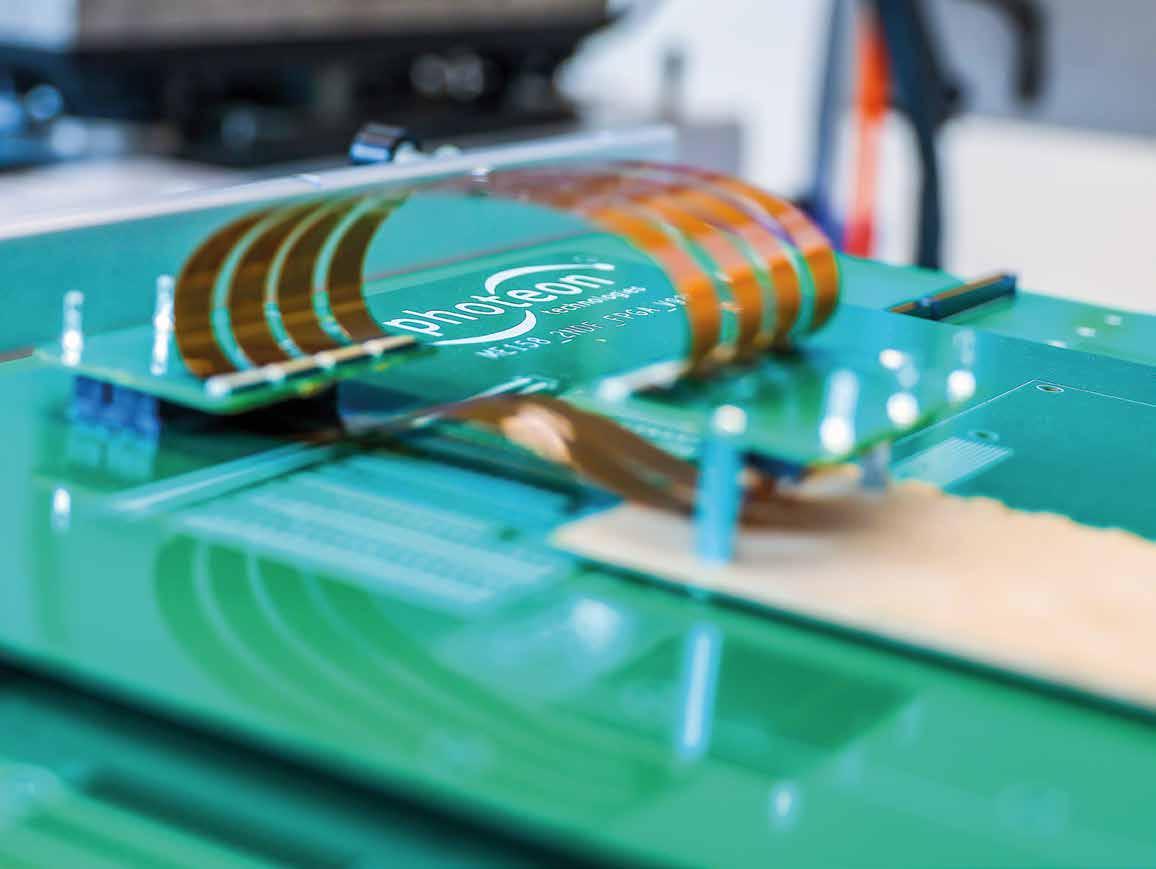
Photeon Technologies entwickelt am Campus V Mikrochips für weltweit führende Technologiekonzerne. Doch nur wenige kennen das HightechUnternehmen, denn das Know-how, das zwar allgegenwärtig ist, ist im Verborgenen in Anwendungen integriert oder Gegenständen verbaut. Beispiele sind Airbag-Sensoren, Audiochipsätze für Mobiltelefone, Mikrocontroller und Navigationssysteme für selbstfahrende Fahrzeuge.
Dass im Kleinen Großes entsteht, wird nirgendwo deutlicher als im vierten Stock des Campus V in Dornbirn. Dort befindet sich das Headquarter der Photeon Technologies GmbH, einer der weltweiten Marktführer in der Mikrochip-Entwicklung. Mikrochips gibt es in verschiedenen Größen, auch winzig klein, kaum zu erkennen. Einer, gerade mal so groß wie eine Wegameise, liegt unter dem Mikroskop. Auf dem Bildschirm erscheint der Winzling in 43-facher Vergrößerung. So lassen sich Details erkennen. Für den Laien sieht es zwar immer noch wie ein Insekt aus, wenn auch gepunktet und viereckig. Dabei erfüllen integrierte Schaltkreise, kurz ICs genannt, auf kleinster Fläche eine Vielzahl von Funktionen.
Allgegenwärtige Wunderwerke. Dass wir so wenig über die Wunderwerke wissen, liegt daran, dass sie in Gehäusen verborgen sind. Dennoch sind sie allgegenwärtig. Etwa in Smartphones, Autos sogar bis hin zum Kühlschrank. Ohne diese Chips würde vieles nicht funktionieren. In einem Smartphone beispielsweise sind zahlreiche Mikrochips verbaut, einer davon ist der Lautsprecher. Wer wäre auf die Idee gekommen, dass er ein Ländle-Produkt –„Entwickelt in Dornbirn“ – ist?
Rasch gewachsen. Der Mann hinter Photeon Technologies heißt Thomas Lorünser. Bis 2014 arbeitete der verheiratete Vater von drei Söhnen in führender Managementfunktion für den indischen Konzern Wipro Technologies. Dann startete er als CEO und alleiniger Eigentümer der Photeon Technologies GmbH. „Wir sind mit der Entwicklung anwendungsspezifischer integrierter Schaltungen (ASICs) sehr rasch gewachsen“, erzählt der 57-Jährige, der das Potenzial erkannte, das in der Chipentwicklung steckt.

Thomas Lorünser ist ein Visionär und ein Macher. Seine Entscheidungen sind nicht nur innovativ, sondern auch vom Mut zur Veränderung geprägt. Als er 2019 mit Photeon vom Millennium Park in Lustenau in den Campus V übersiedelte – die FH Vorarlberg zum Greifen nah –, tat er bereits einen wichtigen Schritt. „Entwicklung ist auch Ausbildung“, sagt Lorünser und stellt Praktikumsplätze für HTLer sowie Stipendien für Studierende zur Verfügung. Sein Zukunftsbild für das Jahr 2030: „Bis dahin soll hier in Dornbirn ein Halbleitercampus entstehen, mit dem Ziel, noch mehr Know-how ins Land zu bringen, um unabhängig zu werden.“ Das ist realistisch, denn inzwischen beschäftigt Photeon mehr als 100 Entwicklungsingenieure. Die Standorte in Pavia bei Mailand und in Novi Sad (Serbien) mit eingerechnet.
Bauplan jedoch Layout. „Das Designen der Layouts ist hochkomplex und bedarf mehrerer Schritte“, erklärt der leidenschaftliche Skifahrer und Kletterer, der auch der Berge wegen ins Ländle gekommen ist.
Monatelange Stresstests. Jeder Schritt erfordert Fachwissen und präzise Ausführung, damit aus der Idee ein fertiger Chip wird. Doch bevor dieser das Haus verlässt, prüft Eva Schreyer in Simulationen, ob die entwickelte Schaltung die volle Funktionalität erreicht, die gefordert wird. „Diese so genannten Stresstests dauern über Monate und beinhalten Tausende von elektrischen Tests unterschiedlicher Parameter über einen Temperaturbereich der in der realen Anwendung tatsächlich auftritt“, erklärt die Mechatronikerin, die an der FH Vorarlberg studierte.
Entwicklung ist Ausbildung. Bis 2030 soll in Dornbirn ein Halbleitercampus entstehen, für mehr Know-how im Land.
Von der Idee zum fertigen Chip. Dornbirn ist die Denkfabrik des Hightech-Unternehmens. Hier erhalten die Chips den Bauplan, der die Funktion definiert. Sie sind für die Geräte so ähnlich wie ein Gehirn. Dazu haben die Entwicklungsingenieure Millionen von Transistoren miteinander verknüpft bzw. verschalten und die entsprechenden Funktionen im integrierten Schaltkreis realisiert. Einer von ihnen ist Xiadong Fang aus Shanghai. Sein Bildschirm sieht aus, als plane ein Architekt eine Wohnanlage. Streifen, Kästchen und so weiter. Genannt wird dieser
Blitzschnelle elektrische Signale. Ist der Chip in einem Gerät verbaut, bekommt er die Anweisung durch digitale und analoge elektrische Signale. Das verarbeitet er blitzschnell und gibt es weiter. Ein Beispiel: Wer sein Kamera-Symbol auf dem Handy antippt, löst eine Kettenreaktion von elektrischen Signalen aus, die durch eine Reihe von Mikrochips verarbeitet werden und schlussendlich die Software dazu veranlasst, die App zu öffnen. Das dauert nur ein Sekundenbruchteil.
15 Millionen Haushalte. Im Erdgeschoß des Campus V gehen die Entwicklungen vorausschauend weiter. „Weil die gigantischen Datenserver, die es für die rasanten Entwicklungen der KI braucht, enorm viel Strom benötigen, arbeiten wir an effizienzoptimierten Stromversorgungschips für sogenannte Hyperscalare Mikroprozessoren“, erzählt Thomas Lorünser. „Wir wollen mittels integrierten Spannungsreglern eine Effizienzsteigerung auf zumindest 94 Prozent erreichen, was der Einsparung von 60.000 Gigawattstunden pro Jahr entspricht.“ Zur Vorstellung: Mit 60.000 Gigawattstunden können rund 15 Millionen Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. In Österreich, wo es vier Millionen Haushalte gibt, sind es sogar vier Jahre. Mikrochips sind mit diesem Potenzial nur drei mal drei Millimeter groß.
Fachkräfte aus 18 Nationen. Apropos Größenordnung: Sechs bis acht ASICEntwicklungsprojekte startet das Unternehmen im Jahr. In Dornbirn arbeiten dafür

rund 50 Entwicklungsingenieure. Die Hälfte kommt aus Vorarlberg, die anderen 50 Prozent setzen sich aus 18 Nationalitäten zusammen. Doch wie schafft es der engagierte Unternehmer, die Fachkräfte ins Ländle zu bringen? „Photeon hat in der Halbleiterindustrie einen weltweit anerkannten Ruf und natürlich die Berge und der See“, schmunzelt der in Braz aufgewachsene CEO.
Umwege. Manche Entwicklungen gehen auch anders aus wie ursprünglich angenommen. Ein Beispiel ist die E-Zigarette. „Da wird bei klassischen Verfahren im Verdampfer eine Flüssigkeit mit einer Heizspirale erhitzt, um den Dampf inhalieren zu können“, erklärt der Manager. „Aber es braucht auch die Mikroprozessoren, ohne die es keinen Dampf gäbe.“ Hier kommt Photeon ins Spiel. „Damit der Dampf keine Schadstoffe mehr beinhaltet, wurde eine Ultraschall-Technologie entwickelt, die einen Piezokristall zum Schwingen bringt.“ Dieser ist in Kontakt mit der Flüs-
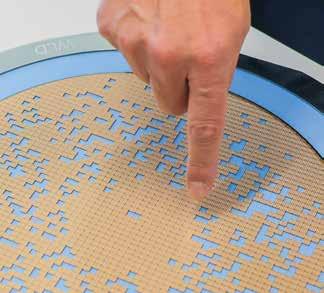
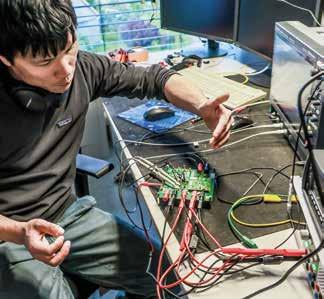
Dornbirn ist die Denkfabrik des HightechUnter nehmens. Hier erhalten die Mikrochips den Bauplan, der die Funktion definiert. Sie sind für die Geräte so ähnlich wie ein Gehirn.
sigkeit und zerstäubt diese. Dadurch entstehen keine Schadstoffe. Auf die Idee, dass die Medizin Interesse bekundet, kam Lorünser nicht. Erst durch Gespräche mit einem Pharmakonzern entstanden neue Ideen, etwa für die Behandlung von Asthma oder Covid-19.
Photeon-Campus. Dass der Branche durch die Digitalisierung und KI ein exorbitantes Wachstum prognostiziert wird, ist zwar wichtig, für Lorünser jedoch zweitrangig. „Der Photeon-Campus soll ein Mikroelektronikzentrum in Vorarlberg werden.“ Deshalb investiert der Branchenführer viel in die Entwicklung und Prüfung. Das neue Herzstück sind ein Waferprober und Wafertester für rund drei Millionen Euro. Wafer heißt aus dem Englischen übersetzt Waffeln, weil sie mit ihren vielen Vierecken ähnlich aussehen. In der Halbleiterwelt bezeichnet der Begriff hingegen eine kreisrunde Scheibe, die aus einem einzigen Siliziumkristall besteht. „Auf einem Wafer befinden sich bis zu 70.000 extrem kleine Chips“, hält er die Scheibe ins Licht, die aussieht wie eine Musik-CD aus den 90erJahren des letzten Jahrhunderts.
Ein Wafertester wiederum testet jeden Chip einzelnen durch und markiert die funktionierenden grün, die anderen rot. Dazu gibt es komplexe Testprogramme, die in der Lage sind, hohe Volumina exakt und in kürzester Zeit zu prüfen. „Ein eigens aufgebautes Team von Testingenieuren zeigt sich dafür verantwortlich.“ Als weiteren wichtigen Erfolgsgarant nennt Lorünser das Vertrauen der Kunden. „Es spielt eine ausgesprochen wichtige Rolle, denn bis die Unternehmen unsere eigens entwickelte Mikrochiplösung einsetzen können, vergeht relativ viel Zeit. „Ich spreche da von drei bis sieben Jahren.“ Während des gesamten Zeitraums erhält Photeon einen tiefen Einblick in die entwicklungsinterne Roadmap der Kunden. „Wir wissen schon im Vorfeld, welche Produkte in Zukunft auf den Markt kommen“, so der CEO und Alleineigentümer Thomas Lorünser.
Die Photeon Technologies packt die großen Fortschritte unserer Welt in winzige Mikrochips. Damit gilt wieder das Credo, dass Großes im Kleinen entsteht. Hinzuzufügen wäre allerdings noch das Unsichtbare, denn wer vermutet einen führenden Mikrochip-Entwickler im vierten Stock des Campus V? Bis dato fast niemand, aber das soll sich jetzt ändern. Marion Hofer

Martin Messmer startete seine Karriere als Skilehrer in Zürs. Von dort führte ihn sein Weg als Fotograf zum Yachtclub von Monaco. Seine Bilder von luxuriösen „Wellenreitern“ und Rennautos sind beeindruckend, genauso wie seine Einblicke in die pulsierende Szene des Fürstentums. Ein Interview über Lichtreflexe, zufällige Begebenheiten und die Lust am Leben.
In seinen Bildern verschmelzen glanzvolle Lichtreflexe, tobende Wellen und fluffige Wolken zu einer furiosen Komposition, um die Objekte, sprich die Boote, stärker herauszuarbeiten.
„Ich mag keinen blauen Himmel und Sonne, das ist zu perfekt“, sagt Martin Messmer, „Gerade mit ein bisschen Regen, vom Sturm aufgebauschten Wellen und wilden Wolkenkonstellationen ergibt sich eine reizvolle Stimmung und ein wirklich schönes Licht.“ In diesem Sinne knipst der gebürtige Bregenzer nicht nur ein Bild, sondern erschafft mit viel Liebe zum Detail kunstvolle, maritime Szenarien. Wenig überraschend sind sein saisonal-temporales Lieblingssetting der Winter sowie die atemberaubenden Sonnenaufgänge im Fürstentum. „Am Bodensee ist der Sonnenuntergang einmalig. Aufgrund der Berge ist es in Monaco gerade andersherum.“
Gesagt, getan. Seine wegweisende Karriere begann der Vorarlberger als Skilehrer in Zürs. „Das war definitiv meine schönste Zeit im Leben, weil ich über die Jahre so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. Diese Vielfalt an Persönlichkeiten macht es einfach aus – das ist in Monaco genauso.“ Wie es der Zufall oder das Schicksal will, ergab sich irgendwann der Kontakt zu einer Person aus dem Zirkel der monegassischen Fürstenfamilie, die ihm den Hinweis gab, dass bei Hofe soeben die Position des fürstlichen Yachtclub-Fotografens vakant sei. Martin Messmer überlegt nicht lange, sondern packt die Gelegenheit beim Schopfe: „Ich habe meinen Job bei einer Werbetechnikfirma gekündigt, mein Auto vollgepackt und bin nach Monaco aufgebrochen – ohne zu wissen, ob es überhaupt klappen wird.“ Doch sein Mut wird belohnt und er
bekommt die Stelle. „Ich hatte damals eine Fotografenausbildung an der Wirtschaftskammer absolviert und mir den Rest autodidaktisch beigebracht – aber meine Bilder wurden als die Besten beurteilt und ich habe den Job bekommen“, erinnert sich der passionierte Tennisspieler, der sich von diesem Zeitpunkt an darum bemüht, die nautische Welt mit seiner Kamera zu entdecken: Als er im November 2016 seine Stelle beim prestigeträchtigen Yachtclub beginnt, tauscht er motivmäßig die schneebedeckten Berge Vorarlbergs und die Sonnenuntergänge am Bodensee gegen die schwimmenden „Liner“ auf dem Mittelmeer ein.
Sein Aufgabengebiet. Er fotografiert hauptsächlich die spektakulären Segelboote der erlesenen Club-Community im Rahmen von Regatten und Großevents, dokumentiert in diesem Zusammenhang auch Auto-Rallys und berühmte Gäste aus den Bereichen Film, Sport, Musik, Politik und Wirtschaft wie Antonia Banderas, Rafael Nadal, Novak Djokovic oder David Guetta. Derzeit stehen automobiltechnisch drei Events ins Haus: Formel-1, Elektro-Grand Prix sowie der historische Grand Prix mit Oldtimern, der es Messmer besonders angetan hat.
„Der Yachtclub liegt genau an der Rennstrecke, sodass es einiges für mich zu tun gibt“, ergänzt er mit einem Schmunzeln. Aber auch die Monaco Classic Week im September, mit ihren zum Teil mehr als hundert Jahre alten Segel- und Motorbooten, ist beeindruckend. Ab und an „shippert“ er auf der berühmten Tuiga mit – das Boot wurde 1909 von William Fife & Son gebaut und ist quasi das Flaggschiff

In seinen Bildern verschmelzen glanzvolle Lichtreflexe, glitzernde Wellen und fluffige Wolken zu einer maritimen Komposition, welche die Boote des fürstlichen Yachtclubs gekonnt in Szene setzen – wie hier im Vordergrund die legendäre Tuiga.


des Yachtclubs –, hängt sich waghalsig über die Rehling und fotografiert von der Meerseite aus die anderen „Wellenreiter“ – aus Gründen des Wiedererkennungswerts meist mit Blick auf Port Hercule.
Kunstschatz und Kiel. Ob Martin Messmer auch Superyachten von innen ablichtet und einen Faible dafür entwickelt hat? Bei dieser Frage winkt der 47-Jährige entschieden ab, der im Rahmen verschiedener Delegationen zusammen mit Fürst Albert schon einigen Einladungen auf den verschiedensten schwimmenden Palästen folgen durfte: „Yachten wie die ‚Jubilee’ oder die ‚Fulk al Salamah’ vom Sultanat Oman sind schon beeindruckend, weil sie jeden erdenklichen Luxus bieten und ausgefallene Details wie einen Glaskiel, Perlmuttverzierungen sowie Kunstschätze wie echte Monets beherbergen und man, überspitzt formuliert, WhatsApp braucht, um sich auf den zahlreichen Decks zusammenzufinden – aber es ist nicht mein vornehmliches Metier, dass ich diese Superyachten fotografiere.“ Viel lieber knipst er dagegen Classic Yachten und Kinder: „Sie segeln mit Optimisten und bringen viel Eifer und Ehrgeiz mit –das fasziniert mich“, so Messmer bescheiden. Seine Bilder erzählen
Geschichten, man spürt den Augenblick. Aber auch Aufträge für die Vogue und Dior gehören zu seinem Oeuvre. Er hat den Drang, sich weiterzuentwickeln, ist neugierig auf das Leben.
Apropos, Delegation. Wie ist es für die Fürstenfamilie zu arbeiten? „Es ist natürlich eine Ehre und gleichzeitig ist es unglaublich spannend, denn es tut sich immer etwas – man lernt viele interessante Menschen kennen. Pierre Casiraghi hat beispielsweise vor einiger Zeit das Team Malizia rund um Boris Herrmann gegründet, der mit einer 60 Fuß langen Einrumpf-Segelyacht im November wieder die Vendée Globe segeln wird“, erzählt Messmer mit einer ansteckenden Begeisterung sowie unprätentiösen Nonchalance.
Was uns das am Ende sagt? Die Fotografie ist eine Art zu fühlen, zu berühren. Es ist aber genauso wichtig, mit Menschen zu „klicken“ – und weil das bei Martin Messmer so gut funktioniert, hat er am Mittelmeer eine zweite Heimat gefunden. Man könnte auch sagen: Er ist gekommen, um zu bleiben
Martin Messmer. Geboren 1977 in Bregenz
Werdegang: Absolvierte u. a. einen Sportjournalismus-Lehrgang an der Universität in Salzburg und arbeitete über 5 Jahre als Skilehrer in Zürs Sport: liebt Skifahren und Tennis (verbrachte quasi seine Jugend auf dem Tennisplatz in Bregenz)
Lebt und arbeitet seit November 2016 in Monaco
Schätzt dort am meisten: Meer, Berge und Menschen
Lebensmotto: Jeden Tag maximal genießen
Am liebsten fotografiere ich Classic Yachten und Kinder – ihr Eifer und Ehrgeiz sind einfach faszinierend.


Luxus. Der Yachtclub ist einem Transatlantikliner nachempfunden, mit Skippern wie Boris Herrmann/Team Malizia.


Der Yachtclub von Monaco ist renommiert für seine beeindruckende Flotte an „Luxus-Linern“, von denen ein Viertel zu den 100 größten Booten der Welt gehört. Er agiert getreu der Philosophie: Ein Team, eine Weltanschauung, ein Club.
egründet im Jahr 1953 von Fürst Rainier III., zählt der Yachtclub von Monaco heute über 2500 Mitglieder aus mehr als 81 Ländern. Er ist renommiert für seine beeindruckende Flotte an Luxusyachten, von denen ein Viertel zu den 100 größten Booten der Welt gehört, sein Engagement im Segelsport sowie für die Ausrichtung von Großveranstaltungen: Bedeutende Ereignisse wie der Rolex Cup und die Monaco Classic Week, ein einzigartiges Treffen klassischer Segel- und Motoryachten sowie die Monaco Yacht Show Ende September, die im Areal um den Hafen Port Hercule stattfindet, ziehen jedes Jahr zahlreiche internationale Besucher(innen) an, denn die Konzentration prestigeträchtiger Schiffe ist weltweit einmalig.
Ikonische Architektur. Das markante Clubgebäude, entworfen vom britischen Architekten Norman Foster und fertiggestellt im Jahr 2014, ist architektonisch bemerkenswert: Mit einer Höhe von 22 Metern und einer Länge von 204 Metern bietet es insgesamt 5000 m² Innenfläche sowie 4000 m² Terrassenfläche und erinnert an einen großen Transatlantikliner des letzten Jahrhunderts. Es thront
am Quai Louis II am Port Hercule und bietet eine spektakuläre Aussicht auf das Meer sowie die Skyline von Monaco. Auch der prestigeträchtige Innenbereich ist vom Feinsten und wurde vom berühmten französischen Innenarchitekten Jacques Grange gestaltet: Die Räume und Terrassen erinnern an Schiffsdecks, die alle von lokalen Tischlern aus europäischer Eiche gefertigt wurden. Die exklusivsten Bereiche, darunter Lounges, private Räume und Gästezimmer, sind mit Möbeln von Fendi Casa ausgestattet und in einer Palette aus sanften Pastelltönen und natürlichen Farben gehalten.
Adlige Patronanz. Fürst Albert II von Monaco ist seit dem Jahr 1984 Präsident des Yachtclubs, seine Neffen Pierre und Andrea Casiraghi sind die Vizepräsidenten. Um Mitglied im exklusiven Zirkel werden zu dürfen, muss man sich nicht nur als Kapitän eines luxuriösen „Wassergefährts“ ausweisen können, sondern auch mit den Werten und Traditionen des Clubs „dacore“ sein, sprich Respekt für die Etikette der Seefahrt zu Wasser und zu Lande sowie den Schutz der Umwelt aufbringen – getreu dem Motto: „Ein Team, eine Weltanschauung, ein Club“. Christiane Schöhl von Norman

Die österreichische Manufaktur ANREI fertigt Massivmöbel aus edlen Hölzern in einem zeitlosen klassischen Design. Aus edlem Holz gefertigt vereinen sich Design, Funktion und handwerklich beste Verarbeitung in formschönen Möbellinien. Massivholz verleiht Wohnräumen Wärme und Behaglichkeit. ANREI setzt bei all seinen Produkten auf höchste Standards und hochwertigste Materialien aus nachhaltiger Erzeugung. Alle Möbelstücke werden in umweltfreundlicher Produktion, mit natürlichen Wasserlacken, resscourcenschonend unter strengsten Umweltauflagen gefertigt.



Auf dem schwarzen Schminkmantel prangt der Bundesadler. In das Unikat schlüpft die Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kunst und Kultur, wenn Anna Irene Eberle (60) aus Egg sie für TV, Film, Fotos, Bühne verschönert. Den Code Sheriff verdankt sie ihrer Teenie Brosche. Längst ist er Referenz: sie sieht alles, was nicht ins perfekte Bild passt.
Mutter Margarethe geb. Sutterlüty legt den Grundstein für die gleichnamigen Ländlemärkte mit dem ersten Lebensmittelgeschäft samt Bäckerei im Sägewerk. Nach Heirat mit Franz Eberle managen sie gemeinsam Frühstückspension und Metzgerei. Das Paar hat fünf Kinder. 3 Töchter und 2 Söhne. Anna Irene ist die Jüngste.
Auf Volks- und Hauptschule folgen Fachschulen in Alberschwende und Dornbirn, dazwischen eine Drogistenlehre, bevor sie in München Visagisten Kurse besucht. Sie arbeitet in der Drogerie Wiesenegger in Dornbirn und leistet Beautydienste bei den von Herbert Gunz organisierten Misswahlen. 1991 zügelt sie mit dem Ziel nach Wien, Maskenbildnerin zu werden.
Topsi und Le Duigou. Im Parfümerie- und Schönheitsimperium von Topsi arbeitet sich Anna Irene Eberle als Visagistin und Verkäuferin in Führungspositionen hoch. Le Duigou verspricht den nächsten Karrieresprung. Sie springt und bleibt fünf Jahre im „schönsten Salon von Wien“. 2009 folgt der Sprung in die Selbstständigkeit. „Ich wollte mehr als einen fixen Job. Ich wollte Neues lernen und meine Kreativität leben.“ Im Alter von 45 Jahren fügt sie ihrer Ausbildung als Visagistin Fachwissen als Friseurin, Farb-, Stil- und Imageexpertin hinzu.
Ludwig „Guggi“ Rusch. Der Feldkircher Fotograf öffnet Anna Irene Eberle eine Vielfalt an Schauplätzen. Ihr Schminkmantel mit dem Bundesadler auf der Brust ist eine
In einem Gesicht gebührt der große Auftritt den Augen. Es sind die Augen, welche die klarste Sprache sprechen.

Eigenkreation. Gio Hahn schlüpft für eine Campagne der Wiener ÖVP hinein, Mathias Strolz für seinen Auftritt als Neos-Chef, der Künstler Erwin Wurm für eine ORF Produktion auf seinem Schloss, Museumschefs wie Moderatoren für die „Lange Nacht der Museen“ ebenso Sportreporter und Spitzensportler, Schauspieler(innen) und Sänger(innen). Parallel stylt sie CEOs für Auftritte und Geschäftsberichte, inszeniert für einen Nachkommen der Hörbiger-Dynastie Roadshows in Polen, Deutschland wie in der Schweiz und vergrößert ihr Netzwerk als Visagistin, Stilistin, Set-Designerin. Ab 2010 arbeitet sie für ORF und Sky.
Sport, Kunst, Kultur. Für den ORF fährt sie 2016 zur EURO nach Frankreich. Mit Marcel Koller und seinem 20-köpfigen Spielerkader hat sie viel zu tun. Fußball bleibt ein Schwerpunkt. Aktuell schminkt sie für SKY die Promis der Bundesliga- und Champions League-Spiele. 2019 legt sie für Thermomix einen Full Flash hin: Kochbuch, Set Design, Präsentation. 2022 begleitet sie im Auftrag von SFR, ARTE und Servus TV die Filmcrew für die Rekonstruktion des tödlichen Dramas auf der „Haute Route“ nach Zermatt. „7 Menschen sind nur 550 m von der rettenden Hütte entfernt ums Leben gekommen. Die filmische Rekonstruktion war eine spannende Arbeit in Eis und Schnee. Ich war auch als Kostümassistenz engagiert. Stundenlang habe ich einen Anorak in Gelb gesucht und endlich in Innsbruck gefunden.“ Nach Schloss Mittersill führt sie die „Winterrei- Foto: Ela Angerer
Haute Route. Der Film über die Tragödie in Eis und Schnee war eine Herausforderung.



se“ mit Kammersänger Michael Schade, eine Co-Produktion von ORF, ARTE und 3sat. Schloss Taggenbrunn von Alfried Riedl, Gründer der Uhrenmarke Jacques Lemans, ist die Location für eine ORFProduktion mit Asmik Grigorian und den Philharmonics. Sie war und ist auch bei den Bregenzer Festspielen aktiv. Aktuell als Beauty-Sheriff für die politische Prominenz. Unvergessen ist der Tag des Attentats im Jahre 2020. In der Remise wird „Denk mit Kultur“ gedreht. Erika Pluhar singt „Imagine“ als die schreckliche Nachricht hereinplatzt. „Nach Drehschluss hatten viele Angst, heimzufahren, Erika Pluhar nicht.“
Nebenher verschönert sie Coverstars für den Buchverlag Brandstätter wie Michael Häupl und Franz Welser-Möst.
Das Jahr 2024. Scarlatti Arts International engagiert sie für die Barockfestspiele Melk, die Musikproduktion „Klang der Berge“ sowie dem Festival „Hohe Tauern“ und ist an Bord der ORF-III-Doku „Stephansdom“ sowie beim „Fest der Freude“ am Heldenplatz.
Multitasking schreibt die Eggerin groß: Seit 10 Jahren stylt sie mit ihrem Team die Prominenz für den Ball der Vorarlberger.
Stift Melk. Drehort der Barockfestspiele. Für Produktionen wie „Klang der Berge“, „Hohe Tauern“, „Fest der Freude“, „Stephansdom“ ist sie u. a. 2024 gebucht.
Beautycoat. Im Schminkmantel Andi Herzog. Unser Ass als Goalgetter. Links die „Genussgeiger“. Sie spielen im Ländle auf der Genussmeile.

Nebenher macht sie Werbespots. Es entstehen Clips für Kelly Chips mit Herbert Prohaska, Spots für Nah & Frisch, Raiffeisenbank, ÖBB, AK, Erste Bank, American Express, KPMG...und viele mehr. Ans Set reist sie mit großem Gepäck: Umhängetasche, Rucksack, Koffer. „Die Produkte repräsentieren eine internationale Markenvielfalt. Es gibt keine Firma, die alles hat, was ich mir wünsche.“
Minenfeld Politik. Das Superwahljahr 2024 mit EU-Wahl und NR-Wahl ist besonders herausfordernd. „Damen wie Herren der Bundesregierung bereite
ich für Live-Auftritte und Shootings vor. Wenn ein Vertrauensverhältnis entsteht und Empathie besteht, wird meine Arbeit angenommen. Die moderne HD Technik ist gnadenlos. Sie macht Unebenheiten um ein Vielfaches sichtbar.“ Es sind viele Schritte bis zu einem kameratauglichen Gesicht: „Wichtig für eine schöne Haut ist die Grundierung, für die Strahlkraft der Augen sind es Augenbrauen und Wimpern. In jedem Gesicht sprechen Augen die deutlichste Sprache.“
Schauplatz Ländle. Am 25. August 2024 treten auf Initiative von Anna Irene Eberle die Genussgeiger aus Bad Ischl auf der „Genussmeile“ auf. „In Eggatsberg und Hammeratsberg sind die Vorsäße offen und es gibt in allen heimeligen
Hütten regionale Köstlichkeiten.“ Sie ist Mitglied des Vereins Dorfkultur, der das dörfliche Gasthaussterben stoppen will.
Traumplatz Zentralfriedhof. Aus der Liebe für Friedhöfe wurde ein Hobby. Seit 25 Jahren macht Anna Irene Eberle individuelle Führungen am Wiener Zentralfriedhof, Tor 1 bis 3. „Bei Tor 1 besuchen wir z.B. die Grabstätten von Friedrich Torberg und Viktor Frankl, bei Tor 2 das Grab von Otto Probst. 1964 war das sozialdemokratische Urgestein Verkehrsminister und provozierte die Fußach-Affäre. Bei Tor 3 liegen fernab der Prominenz Antonio Salieri, Peter Altenberg und Adolf Loos.“
Beauty Sheriff privat. Die Vielseitige ist eine Erscheinung. Lange, blonde Haare,
streng zu einem Rossschwanz gebunden, der bis zur Hüfte reicht. Blaue Augen, schwarz gerahmt, wenig Rouge, Lippen dezent. „Die häufigsten Schminkfehler sind zu grelle Lippen, zu dunkle Augenbrauen und zu viel Rouge“. Sie wohnt am Yppenplatz, am „buntesten Platz von ganz Wien“. Auf ihrer Terrasse gedeihen Rosen, Äpfel, Birnen, Beeren, Blumen, Wein. Der Ginko ist ihr Glücksbaum. Wein ihr Lieblingsgetränk. Im Ländle ist sie mindestens acht Mal im Jahr. Die Kunstfreundin schätzt die Fondation Beyeler in Basel, liebt Kulturreisen nach Italien und Frankreich. Heuer besucht sie das Museumsatelier „La Ribaute“ von Anselm Kiefer in Barjac. Danach folgt sie den Spuren des Bildhauers Constantin Brancusi in Rumänien. Dazu kommen Trips nach Krakau und Bad Ischl. Elisabeth Längle




Zentralfriedhof. Ihr Interesse gilt den Gräbern von Tor 1 bis Tor 3. Hier sind Führungen ihr Hobby. Im privaten Garten Eden wachsen Wein, Blumen, Obstbäume und ein Ginko.

V.L.: CHRISTIANE SCHWALD-PÖSEL, DAVID BREZNIK, MARTINA KÖBERLE, THOMAS HASCHBERGER, DANIEL REIN UND KERSTIN POLZER

Tagesaktuelle Bauprojektinfos –einfach, schnell, bedarfsgenau
Als größte Bauinformations-Datenbank in Österreich liefert www.documedia.at zuverlässige und wertvolle Infos über aktuelle und zukünftige Bauprojekte. So lassen sich in Zeiten mit guter Auftragslage Potenziale für später identifizieren. Die DOCUmedia.at GmbH versorgt seit 45 Jahren die österreichische Wirtschaft mit wesentlichen Informationen. Mithilfe des einzigartigen Netzwerkes und modernsten Technologien recherchiert DOCUmedia
Hochbauprojekte in ganz


Österreich. Jährlich stehen Informationen zu über 8500 neuen Bauprojekten bereit – egal welches Baustadium, welche Bauart oder Projektkategorie.
Umfassende und laufend
aktualisierte Produktdatenbank Seit dem Jahr 2014 stehen Architekturschaffenden mit der innovativen Produktplattform „nextroom Produkte“ aktuelle Infos zu den Angeboten der Bauwirtschaft und -industrie zur Verfügung. „Architekturschaffende sind auf aussagekräftige Infos der Bauindustrie angewiesen, www.nextproducts.at
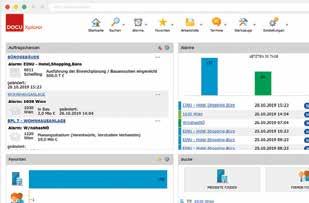
ist eine Schnittstelle zwischen beiden Welten“, so Tobias Braszkeit, Geschäftsführer DOCUmedia.at GmbH. Die ständig weiterentwickelten Produkte von DOCUmedia verknüpfen Angebot und Nachfrage der österreichischen Baubranche und schaffen ideale Voraussetzungen für eine direkte und gezielte Kommunikation. Über 1000 großteils langjährige Kunden profitieren bereits von diesem Angebot. DOCUmedia.at schafft mit den Portalen www.documedia.at und www.nextproducts.at direkte und gezielte Kommunikation in der Baubranche!
„Mit erfolgsentscheidend ist, dass die Angebote von DOCUmedia für Unternehmen in unterschiedlichsten Bereichen der Baubranche einen Nutzen bieten.“ Tobias Braszkeit, GF DOCUmedia.at GmbH


Mehr als nur Möbelstücke: Nachhaltigkeit, Design und Komfort vereint, bereichern den Arbeitsalltag und schaffen ein harmonisches Umfeld.
Unsere täglichen Entscheidungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt – das gilt auch für die Einrichtung unserer Wohn und Arbeitsbereiche. Hier vereint se:lounge light Komfort mit Design und bespielt gleichzeitig die Aspekte Nachhaltigkeit und Einfachheit. Dabei begeistert die Schale aus PETFilz besonders aus ökologischer Sicht: Zum einen besteht sie anteilig aus recyceltem Material, zum anderen ist sie zu 100 Prozent recyclebar. So gehen verantwortungsvolles Wirtschaften und Arbeiten Hand in Hand, um den ökologischen Fußabdruck zu
minimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren. Der Loungesessel vermittelt mit seiner fließenden Linienführung und der organischen Form Harmonie und Leichtigkeit.
GEMACHT FÜR WOHLFÜHLBEREICHE
New Work und zahlreiche digitale sowie mobile Tools bringen eine Menge Vorteile mit sich – Mitarbeitende können sich unabhängiger bewegen und ihren Arbeitsort flexibel wählen. Ob im Gemeinschaftsbüro oder zu Hause, im CoWorkingSpace oder in der Cafeteria, es ergeben sich

Ein inspirierendes Arbeitsumfeld lässt sich u. a. mit der Einrichtung sowie der Stoff- und Materialkombi erreichen.
viele verschiedene Möglichkeiten. Eins bleibt jedoch immer gleich: Der Wunsch nach einem Arbeitsplatz, und gleichzeitig auch einem Wohlfühlort, an dem die Balance zwischen Arbeit und Erholung möglich ist. In diesem Zusammenhang wird nicht nur die Produktivität gefördert, sondern auch die effiziente Zusammenarbeit und den Teamgeist. Das führt letztlich auch zu einer wertschätzenden und respektvollen Arbeitsatmosphäre.
FORM UND MATERIAL SORGEN FÜR KOMFORT se:lounge light überzeugt sowohl optisch als auch durch ergonomische Eigenschaften. Die Sitzschale aus PETFilz ist aus einem Stück gefertigt und besitzt eine integrierte Lordosenvorwölbung. Das Sitzpolster ist mit einer bequemen Mulde ausgestattet und an der Vorderkante schräg abfallend. Dazu kommen die Armlehnenflügel, die den seitlichen Abschluss bilden und entspanntes Ablegen der Arme ermöglichen. Optional kann ein Rückenpolster ausgewählt werden, das zusätzlichen Komfort bietet. Der Loungesessel ist in zwei praktischen Sitzhöhen – Loungeund Tischhöhe – vielseitig einsetzbar und lädt zum Verweilen ein.

Alles für das moderne Büro.
Paterno Bürowelt
Forachstr. 39 | A-6850 Dornbirn Tel. +43 (5572) 3747
info@paterno-buerowelt.at www.paterno-buerowelt.at

Das Büro ist so vielgestaltig wie nie: Touch-Down-Arbeitslplätze, Workshop-Bereiche, Lounge-Areas, Konferenzräume sowie vieles mehr bestimmen die vorhandenen Flächen. Dazu kommen Konzepte wie hybrides Arbeiten und das Home-Office, die die Arbeitswelt erobert haben. Dabei ist der Wunsch nach mehr Wohnlichkeit im Arbeits-Kontext sehr wichtig. se:flair macht‘s möglich: der Stuhl, der Wohnlichkeit, Komfort und Funktion vereint.

Paterno Bürowelt GmbH & Co KG
A-6850 Dornbirn | Forachstr. 39|+43 (5572) 3747 | Messepark | +43 (5572) 949799
info@paterno-buerowelt.at|www.paterno-buerowelt.at
Für Kunst und Kultur gibt es in Vorarlberg und in der Region keine Sommerpause. Das gilt für Bühnen unter freiem Himmel und unter Dach sowie für Ausstellungshäuser.
„Für mich bitte auch einmal abdrücken“, hieß es laufend und nach und nach wurden mir Fotoapparate nach oben gereicht. Die Tribüne vor dem „Wrapped Reichstag“ durften nur Inhaber von Presseausweisen oder sonstigen Genehmigungen betreten. Dass ich somit vielen, sozusagen unbefugten Leuten zu Aufnahmen aus gehobener Position verhalf, störte aber keinen der strengen Kontrolleure. Ich blieb lange und kam immer wieder, um die silbrig glänzende, riesige Skulptur von Christo und JeanneClaude zu jeder Tages und Nachtzeit auf mich wirken zu lassen. Ebenso wie die enorme Menschenmenge, die dieses Werk, sich selbst, die offene Mauer, das Leben und die Kunst feierte.
EUPHORIE STATT ERHABENHEIT
Das war im Frühsommer 1995 in Berlin. Nach spektakulären Inszenierungen von Jérôme Savary wagte sich der damalige Festspielintendant Alfred Wopmann in Bregenz gerade an Beethovens „Fidelio“ und etablierte mit David Pountney als Regisseur die neue Opernästhetik auf dem See. Das Kunsthaus nach Plänen von Peter Zumthor stand immerhin schon im Bau, in Lindau ging es jedoch noch beschaulich zu. Aber mittlerweile zählen die dortigen Blockbusterausstellungen zum Kultursommer in der Region. Klein, aber gut kuratiert, ist man heuer nach Picasso, Chagall, Münter, Klee, Miró, Warhol etc. bei Christo und JeanneClaude gelandet.

Geplant ist heuer auch eine
Der „Wrapped Reichstag“ steht selbstverständlich im Fokus, bezeichnet das Projekt, dem ein langjähriger Genehmigungsprozess vorausging, doch auch einen Teil deutscher Geschichte, die die älteren Besucherinnen und Besucher nun nacherleben und von der die jüngeren in dieser Ausstellung erfahren. Die „Floating Piers“, diese 2016 realisierten Wege auf dem norditalienischen IseoSee, haben viele vielleicht selbst beschritten. Die Fotos und Zeichnungen von diesen und anderen monumentalen Verhüllungsprojekten in Europa, den USA und Japan dokumentieren noch bis 13. Oktober die Beharrlichkeit eines Künstlerpaares bei der Umsetzung seiner Ideen. Sie dokumentieren auch die
Ich habe es gern, wenn man Kunst nicht nur ansehen, sondern auch berühren kann und ich denke, es ist gerade in Vorarlberg gut zu zeigen, dass Künstlerinnen und Künstler extrem fleißig sind.“
Tone Fink
Vergnügliches darf sein bei den hoffentlich hohen
Temperaturen. Die künstlerischen Projekte dürften aber kaum jemanden kalt lassen.
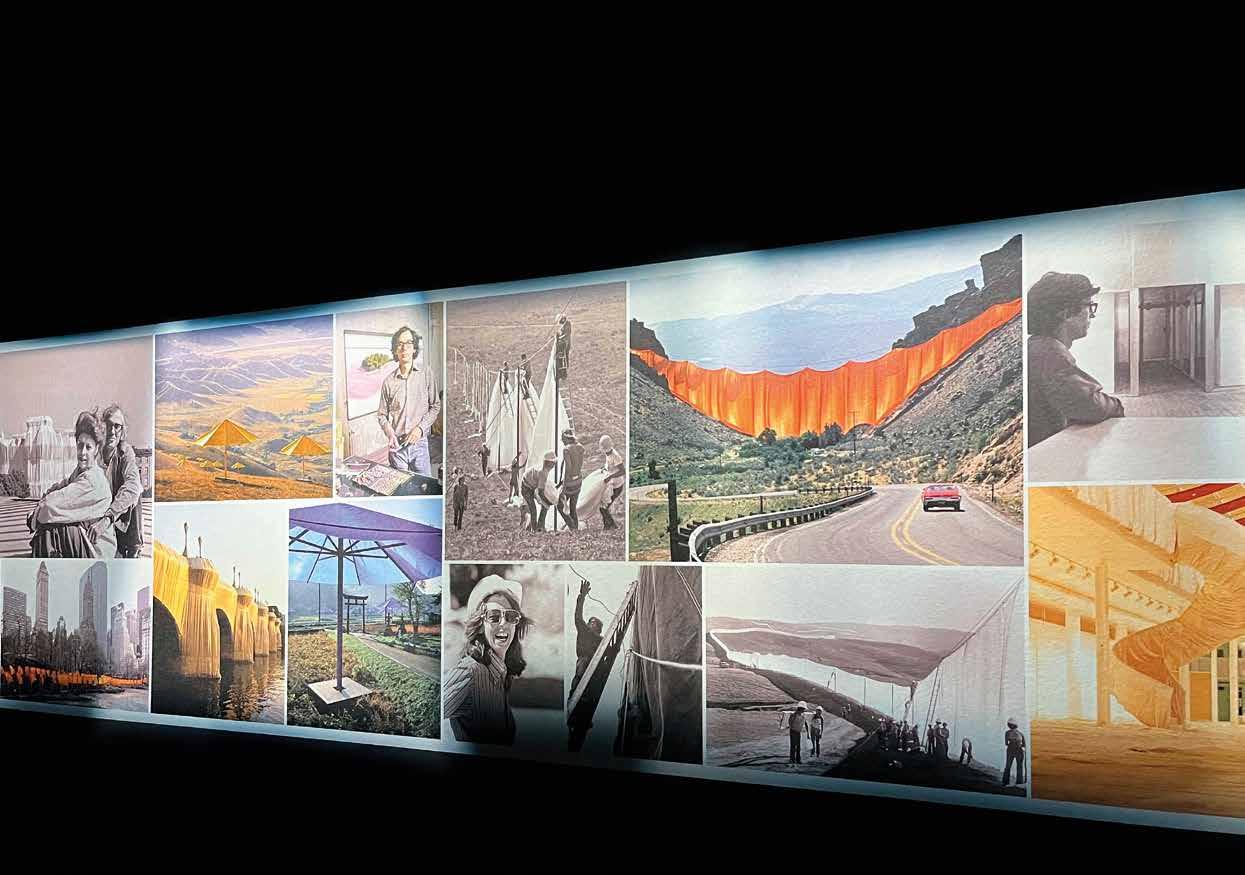
Konfrontation der Menschen mit Kunst, bei der Euphorie statt Erhabenheit sowie die Schönheit eine Rolle spielen.
URAUFFÜHRUNGEN UND OPERN
Dass es die Verhüllung eines Teils des Bodensees zumindest einmal als Vorstellung gab, wissen einige. Doch der Wellengang ist derart tückisch, dass es auch gut war, sich trotz diverser Ankündigungen von Theatermachern nicht auf ein Floß oder Ähnliches zu konzentrieren, sondern auf das Kornmarktgebäude, in dem Landestheaterintendantin Stephanie Gräve nun auch in der kommenden Saison einige Uraufführungen anbietet. Darunter „Toxic“, eine hoch interessante Auseinandersetzung der Vorarlberger Autorin Daniela Egger mit der PopIndustrie und der Gier. Mit Mozarts „Don Giovanni“ steht auch eine Oper auf dem Spielplan. Unver
zichtbarer Partner des Theaters ist dabei das Symphonieorchester Vorarlberg. Der Klangkörper, der in einer Abonnementreihe in Bregenz und Feldkirch auftritt, nimmt längst auch einen festen Platz im Programm der Festspiele ein. Intendantin Elisabeth Sobotka setzt auf der Seebühne mit „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber auf eine deutsche Oper und offeriert neben mehreren Uraufführungen am Kornmarkt mit Rossini und Puccini italienische Komödiantik. „Der Ehevertrag“ und „Gianni Schicchi“ entlarven trotz gesanglicher Höhenflüge übrigens auch niedere Instinkte.
SCHAUEN UND BEGREIFEN
Einem wichtigen gesellschaftspolitischen Aspekt ist in zwei Ausstellungen zu begegnen. Nicht nur Anne Imhof behandelt bis 22. September im Kunsthaus die ge
schlechtliche Identität von Personen, das Thema findet auch in einer neuen Arbeit von Tone Fink Berücksichtigung. Der vor allem in Wien tätige Vorarlberger macht das Künstlerhaus vom 14. Juli bis 1. September zum Schaudepot, zeigt zu seinem 80er Vielfarbiges und Reduziertes, Turbulentes, Ornamtentales, Figurales und Erotisches sowie Filme, Papierarbeiten und Möbel, die auch im wahrsten Sinne des Wortes zum Begreifen da sind. Und wer meint, dass die vor dem Haus errichtete Predigerkanzel ein Dozieren versinnbildlicht, der täuscht sich. Tone Fink aktiviert die Gehirnzellen und die Schaulust derart, dass die Räume in Bregenz nicht ausreichen. In Schwarzenberg, seinem Geburtsort, ist zu erfahren, wie alles begann – mit dem Zeichenstift und mit selbst im damals rigiden Schulsystem nicht zu bändigender Kreativität. Christa Dietrich
CASINO BREGENZ
In der Erlebniswelt findet sich alles, was zu einem gelungenen Abend gehört: Nervenkitzel, kulinarische Leckerbissen, Abwechslung und Freude.
Inmitten des Festspielbezirks gelegen, ist das Casino Bregenz das Highlight am Bodensee. Bereits beim Betreten des Casinos wird man von einer großartigen Atmosphäre und freundlichem Personal empfangen. Im großen Spielsaal wartet eine beeindruckende Auswahl an Spieltischen. Von Roulette, Black Jack und Poker über die modernsten Spielautoamten bis hin zur Xperience Zone – hier ist für jeden Spielertyp etwas dabei.
Neben den klassischen Spielen gibt es im Casino Bregenz auch Bars, an denen für Drinks, Snacks und außergewöhnliche Cocktails gesorgt wird. Eine Lounge mit Sitzmöglichkeiten und das HaubenRe
staurant Falstaff runden das Gesamtbild ab. Insgesamt bietet das Casino ein unvergessliches Erlebnis für alle, die nach Unterhaltung, Nervenkitzel und Abwechslung vom Alltag suchen: Ein Abend im Casino Bregenz ist in jedem Fall ein Gewinn!
ERLEBNIS DER BESONDEREN ART
Mit der Xperience Zone hat das Casino Bregenz einen aufregenden neuen Bereich geschaffen, der im Bodenseeraum einzigartig ist. Gäste spielen bei lockerer Clubatmosphäre und lässiger Partymusik mit Einsätzen ab einem Euro an Videoterminals, während die Croupiers bei Roulette die Kugel rollen lassen und bei Black Jack
Karten geben und zu Entertainern werden. Gerne erfüllen die Croupiers auch Musikwünsche und empfehlen exklusive Drinks.
CASINOS AUSTRIA AG
Platz der Wr. Symphoniker 3 6900 Bregenz bregenz@casinos.at www.bregenz.casinos.at



Bei „Hold Your Breath“ auf der Werkstattbühne ist das Publikum eingeladen, die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erleben.

Ein Arbeitsprozess der Komponistin, dem Regisseur und dem bildenden Künstler.
Von Beginn an spielt der Oktopus eine wichtige Rolle.
Ein immersives Erlebnis versprechen zahlreiche Computerspiele: Eintauchen in eine Welt, die uns mit sämtlichen Sinnen mitten ins Geschehen zieht. Ganz ohne AugmentedRealityBrille lädt im kommenden Sommer eine neue Oper auf der Werkstattbühne zu einer besonderen intensiven Erfahrung ein: Der Geschichte, die mit Musik und Spiel in einem einzigartigen Raum erzählt wird, kann das Publikum ganz nahekommen, um sie im nächsten Moment aus entfernter Perspektive zu verfolgen.
Wer für Hold Your Breath einen „Stehplatz – zum Wandeln und unmittelbar Erleben“ bucht, gibt sich selbst die Wahl, seine Wahrnehmung immer wieder zu verändern. Wie klingen live gespielte Töne und Klänge aus Lautsprechern im gesamten Raum? Welche Energien verströmen singende und tanzende Körper? Und wie wirkt ein visuelles Kunstwerk aus verschiedenen Blickwinkeln? Die Oper, die sich die Komponistin Éna Brennan, der bildende Künstler Hugo Canoilas sowie der Regisseur und Librettist David Pountney ausgedacht haben, handelt auch von einem Oktopus, jenem beeindruckenden Wesen, das mit seiner Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und komplexen Lebensweise die Menschen seit jeher fasziniert.

Im Stück werden acht Instrumente von Mitgliedern des Symphonieorchester Vorarlberg an verschiedenen Positionen im Raum gespielt: Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Elektronische Klänge erweitern dieses Spektrum. Fünf Sängerinnen und Sänger sowie drei Tänzerinnen und Tänzer erzählen eine Geschichte, die auch durch die Bewegung des umherwandelnden Publikums entsteht: In einer Gesellschaft, deren Leben emotionslos von einzelnen Akteurinnen und Akteuren organisiert wird, versucht eine junge Frau, die Erinnerung an ihre Großmutter wachzuhalten. Die Menschen finden sich plötzlich mit einer Kreatur konfrontiert, deren Bewegungen alle ergreift und verändert. Einige behaupten, dieses an einen geheimnisvollen Oktopus erinnernde Wesen geschaffen zu haben. Was hat dieses Geschöpf mit den Menschen selbst zu tun und haben sie sein Leben in der Hand?
Bereits zum dritten Mal mündet ein mehrjähriger Prozess gemeinsam mit dem Publikum in eine Uraufführung auf der Werkstattbühne. Premiere der 90minütigen Vorstellung in englischer Sprache ist am 15. August um 20 Uhr.
Platz der Wiener Symphoniker 1 6900 Bregenz www.bregenzerfestspiele.com



Ein hohes Maß an Ausdruckskraft? Einen Hang zum Dramatischem? Vielleicht Was sie aber alle definitiv eint: Sie sind mit ihren Werken und Geschichten Teil der Saison 2024/25 am Vorarlberger Landestheater in Bregenz.
Den Startschuss für die kommende Saison gibt der Liederabend „Weeping Songs” am Samstag, 7. September, bei dem Interpretationen von Nick CaveSongs und klassische Balladen zum Besten gegeben werden. Das erste Schauspiel der Saison widmet sich einer Vorarlberger Größe: „Aus seinem Leben” erzählt ab Samstag, 21. September, vom Leben und Wirken Franz Michael Felders, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts als Sozialreformer

Unter der Leitung von Stephanie Gräve, die mit der Spielzeit 2018/19 die Intendanz am Landestheater übernahm, bereichern auch auch innovative Theaterformen den Spielplan.

nicht nur Freunde im Ländle machte. Geschrieben hat das Stück ein ebenfalls bekannter Österreicher; Felix Mitterer, Autor der „PiefkeSaga“, zeichnet wegweisende Stationen des Vorarlberger Bauernsohns und Schriftstellers nach.
LITERATURVIELFALT
Ab Oktober geht es dann Schlag auf Schlag: „Old white Clowns” (jüngst zum Impulse Theater Festival eingeladen) erzählt angelehnt an die Figur des Pierrots und mit Mitteln der Pantomime von Tod, Männerwelten und Machtgefällen; „Fräulein Julie” behandelt dagegen als naturalistisches Trauerspiel Liebe, Begehren und Klassenunterschiede. Das Familienstück der Saison ist Erich Kästners (Kinder)Li
Konnten in der aktuellen Saison Publikum und Kritik überzeugen: „Das Fest des Lamms” und „Fabian”

„Old white Clowns“ beleuchtet mit vollem Körpereinsatz die dunklen Seiten der menschlichen Seele und der Gesellschaft.

teratur Klassiker „Emil und die Detektive”, der seit knapp 100 Jahren für Spannung bei Klein und Groß sorgt. „Fremde Seelen”, ein Stück, das den Suizid des vietnamesischen Pfarrers Franz Nguyen in den Freiburger Voralpen thematisiert, dürfte hingegen gleichsam dramatisch wie polarisierend werden.
Mit Goethes „Faust”. „Eine Tragödie”, eine weitere Inszenierung von Max Merker, und Mozarts Oper „Don Giovanni” reihen sich weitere absolute Klassiker der Literatur bzw. Musikgeschichte in den Spielplan des Vorarlberger Landestheaters ein. Nicht minder bekannt sind die Titel und Autor(inn)en, die die Theatersaison komplettieren: Elfriede Jelineks „Rechnitz”
(„Der Würgeengel”) und „Amerika” von Franz Kafka dürften nicht nur bei Theaterinsidern Vorfreude auslösen.
Die Box, das kleine Haus des Landestheaters, wartet mit ungewöhnlichen Projekten auf: „brütt Oder die seufzenden Gärten” ist eine interaktive Rauminstallation, die die Texte der Schriftstellerin Frederike Mayröcker in Bilder und Klänge übersetzt. „Toxic. Britney über Spears” kommt natürlich nicht ohne Musik aus und stellt die Frage, wie sich ein junger verletzlicher Mensch fühlt, dem zwar die ganze Welt zu Füßen liegt, der aber auch komplett von ihr vereinnahmt wird. „Schmerzambulanz”erforscht hingegen kritisch das System Krankenhaus
– und warum Management und Controlling ein nicht unerhebliches Wörtchen bei der Behandlung von Patient(inn)en mitreden.
Wer bei so viel Kunst noch auf der Couch sitzt, ist selber schuld.
VORARLBERGER LANDESTHEATER Seestraße 2 6900 Bregenz +43 5574 42870600 www.landestheater.org

Das Festival schaut auf eine Dekade innovativer Konzertformate zurück. Zu dem Anlass gibt es vom 3. November bis 4. Dezember viele Highlights.


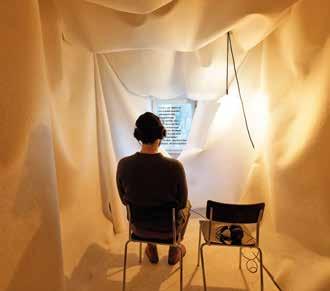
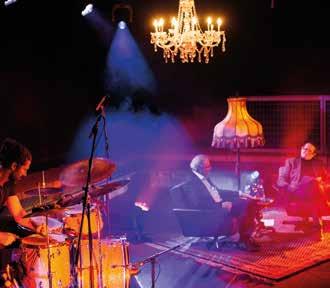
Die Montforter Zwischentöne lassen von Kapelle bis Gefängnis verschiedene Räume musikalisch aufleben.
„Warten”, „Entdecken”, „Erfinden”: Das sind nur drei Themen der letzten zehn Jahre, auf die die Montforter Zwischentöne zu ihrem diesjährigen Jubiläum zurückblicken können. Seit zehn Jahren bereichert das Kulturfestival das Konzertleben in Feldkirch. Dafür holen die beiden Künstlerischen Leiter Folkert Uhde und HansJoachim Gögl besondere Künstler(innen) aus aller Welt für ihre innovativen Konzertformate in die Stadt.
Dabei werden die unterschiedlichsten Räume bespielt und immer wieder ganz neue erschlossen: vom Montforthaus über die Stella Vorarlberg, vom Alten Hallenbad bis zu Kapelle und Dom – sogar das Gefängnis war schon Spielort der Zwischentöne.
KULTUR PAR EXCELLENCE
Viele Formate haben sich über die Jahre bei den Zwischentönen etabliert. Das Begräbnis ist eines davon. So wurden durch verschiedene renommierte Philosoph(inn)en schon die Fakten oder auch die Muße beerdigt – und zuletzt in 2023 mit Ariadne von Schirach der Anstand zu Grabe getragen. Auch zur Jubiläumsedition 2024 kann das Publikum auf das etablierte Format zählen. Genauso auf die Temporäre Universität, die mittlerweile eine feste Größe des Festivalkalenders ist, und bekannte Feldkircher(innen), die in der Welt Besonderes geleistet haben, zu einem Vortrag


HansJoachim Gögl und Folkert Uhde haben die künstlerische Leitung inne.
zurück in ihre Heimatstadt holt. Ebenfalls beliebt und Teil des Programms: das Morgenkonzert sowie die Aufführung der Gewinner des HUGOWettbewerbs für innovative Konzertformate, den die Montforter Zwischentöne jedes Jahr veranstalten.
Freuen können sich die Besucher(innen) des Festivals außerdem auf Programmpunkte wie die BrucknerMesse in hMoll im Dom und auf einen musikalischen Rundgang zu zehn bisher teils noch unentdeck
ten oder unerschlossenen Orten der Stadt. Zu den besonderen Highlights gehört sicher außerdem ein Format, bei dem die Schauspielerin Martina Gedeck im Mittelpunkt stehen wird.
Die Montforter Zwischentöne –ein Gegenentwurf zum globalen Festivalbetrieb.” Rasmus Peters, FAZ

Sie haben jetzt Lust auf mehr bekommen? Zur großen Jubiläumsmatinée haben Kulturinteressierte bereits am Sonntag, 15. September, um 10.30 Uhr, die Gelegenheit, im Feldkircher Montforthaus gemeinsam mit dem Leitungsteam des Festivals sowie zahlreichen prominenten Gästen auf zehn Jahre Montforter Zwischentöne zurückzuschauen und einen kleinen Ausblick auf das diesjährige Festival vom 3. November bis 4. Dezember 2024 zu erhalten. Festreden, Videos, Musik und noch vieles mehr begleiten die Gäste durch einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Vormittag.
Seien Sie dabei, wenn die Montforter Zwischentöne ihren großen Geburtstag feiern und stoßen Sie mit an – auf die vergangene und die nächste Dekade!
info@montforterzwischentoene.at www.montforterzwischentoene.at



Die Themen der renommierten Künstlerin Anne Imhof haben enorme gesellschaftspolitische Relevanz. Begriffe wie Chancengleichheit, Bedrohung, Sensibilisierung und Verantwortung bestimmen das Gespräch.
Während Österreich sich nicht dazu entscheiden konnte, den Pavillon auf der Biennale in Venedig des Jahres 2017 einer Künstlerin zu überlassen und für Werke von Brigitte Kowanz gar noch eine Dependance neben dem Gebäude errichtete, das von Erwin Wurm bespielt wurde, war man in Deutschland konsequent. Kuratorin Susanne Pfeffer überließ den gesamten Pavillon Anne Imhof, die für ihr dort realisiertes Projekt „Faust“ mit dem großen Preis der Biennale, dem Goldenen Löwen, ausgezeichnet wurde. Nun daran zu erinnern, dass die Österreicher bei der 1895 gestarteten, wichtigsten internationalen Kunstschau erst im Jahr 2019 mit Renate
Bertlmann den allerersten Soloauftritt einer Künstlerin gewährten, ist in diesem Zusammenhang angebracht. Die Präsenz von Künstlerinnen und Rollenstereotype zählen nämlich zu den komplexen Themen der Arbeiten von Anne Imhof.
„WISH YOU WERE GAY“
Die deutsche Künstlerin, geboren 1978 in Gießen, lebt und arbeitet in Berlin und Los Angeles. Eine große Ausstellung realisierte sie im Stedelijk Museum in Amsterdam, im Palais de Tokyo in Paris und in der Tate Modern in London. Sie war mit ihren Arbeiten unter
anderem in der Kunsthalle Basel und im Hamburger Bahnhof in Berlin vertreten. „Wish You Were Gay“ hat sie ihre Ausstellung im Kunsthaus Bregenz betitelt.
Obwohl schwul oder lesbisch zu sein, in den Medien anders verhandelt werde, sei die Ablehnung in der Gesellschaft und in den Familien da, nur eben still, erklärt Anne Imhof im Gespräch mit Kontur. „Die LGBTQICommunity ist immer noch eine Insel.“ Die Gegenwart zeige, dass diese Community die Rechte, die sie in einigen Ländern hat, auch wieder verlieren kann. „Die Gewalt gegen die LGBTQICommunity ist da. Dadurch, dass man aus der Schutzzone der Unsichtbarkeit hinausgeht, macht man sich auch zur Projektionsfläche.“ Die Rechte für Transpeople seien immer auch Rechte für Frauen, betont Imhof.
Wir sprechen über Gewalt gegen LGBTQIPersonen, von Hunderten Morden im Jahr. Wir sprechen von einer Zahl, die wohl höher ist als die offizielle, denn sie schließt ja nur jene Verbrechen mit ein, die auch angezeigt werden. Anne Imhof betont auch die Tatsache, dass über 90 Prozent der Ermordeten Transfrauen waren. Die Frage, ob wir immer noch nicht klüger oder sensibler geworden sind, beantwortet sie mit der Aufforderung, dass wir einander Rückhalt geben und unsere Kindern in einer sicheren Gesellschaft aufwachsen lassen sollten.
ARBEITEN UND LEBEN
Nachts habe sie gearbeitet und tagsüber war sie Mutter, erzählt die Künstlerin von einer Lebensphase, die in ihrer Ausstellung im Kunsthaus Bregenz thematisiert wird. Mit älteren, sehr persönlichen Videoarbeiten, die zeigen, dass Arbeiten und Leben einmal eng miteinander verbunden waren bzw. es immer noch sind. Zudem verdeutlichen sie, dass die Performance einen weiteren Bereich ihrer künstlerischen Tätigkeit einnimmt. Eine Bilderserie zeigt Atombombenexplosionen. Die Bedrohung erachtet Anne Imhof für sehr

Für ihr Projekt „Faust“, bei dem Akteure unter einem Glasfußboden agierten, wurde Anne Imhof mit dem Goldenen Löwen der Biennale Venedig 2017 ausgezeichnet.
real. „Im jetzigen Zustand der Welt und im Kräftemessen der Weltmächte ist die nukleare Bedrohung immer das letzte Ass im Ärmel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bedrohung in der Rhetorik verwendet wird, aber die nuklearen Sprengköpfe sind ja da und damit ist sie real.“ Es stelle sich auch die Frage, wie zurechnungsfähig die Entscheidungsträger sind. Es sei real, dass bei der nächsten Wahl in den USA jemand Präsident wird, der nicht zurechnungsfähig ist.
Wie den meisten der Künstlerinnen und Künstler, die zu einer Einzelausstellung ins Kunsthaus Bregenz geladen werden, steht auch Anne Imhof das ganze Haus, der ganze Bau von Peter Zumthor zur Verfügung. Das sei etwas ganz Besonders. Den identischen Grundriss der Räume bringt sie im Gespräch mit hoch interessanten Aspekten in Verbindung, nämlich mit der Demokratisierung und der Chancengleichheit. Hier könne kein Werk prominenter erscheinen als das andere und jeder ist erst einmal gleich, wenn er da reinkommt.
Der DeutschlandPavillon in Venedig bot damals ein intensives PerformanceErlebnis. Das Team von Anne Imhof agierte unter anderem unter einem Zwischenboden aus Glas. Es war ein Gefühl des Ein und Ausgeschlossenseins, das einem als Betrachterin überkam. Im Kunsthaus Bregenz gibt es auch Objekte und Gegenstände, die mit verschiedenen, universalen Bedeutungen aufgeladen sind. Was empfinden wir beim Blick in die leere Sportarena? Was sagt uns ein zurückgelassenes TShirt? Wie einsam sind wir wirklich? Christa Dietrich

Eine Bilderserie von Anne Imhof zeigt Atombombenexplosionen, eine reale Bedrohung.
Die Ausstellung
„Wish You Were Gay“ mit Werken von Anne Imhof ist bis 22. September im Kunsthaus Bregenz zu sehen
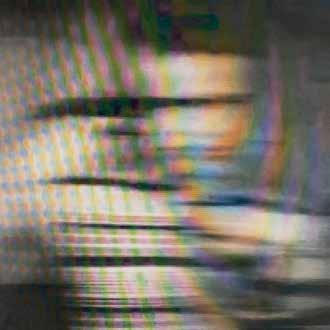
* Als Fern- oder Lesebrille. Gültig bis + – 6 dpt./2 cyl., in lagernden Durchmessern. Aufpreis für höhere Stärken/Durchmesser 18 Euro pro Glas. Aufpreis Prismen 23 Euro pro Glas. Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr
Sonnengläser in Ihrer Sehstärke!*







Der neue vollelektrische Porsche Macan ist der Sportwagen unter den elektrischen SUV.

Der Porsche Macan startet vollelektrisch in die neue Modellgeneration. Er glänzt durch zeitloses, sportliches Design, porschetypische Performance, und besonders durch die langstreckentaugliche Reichweite von bis zu 613 km kombiniert, oder sogar bis zu 784 km innerorts (WLTP). Nicht nur die Leistungsdaten von bis zu 639 PS und 1130 Nm Drehmoment begeistern: Das Fahrwerk mit Allradantrieb, Luftfederung und elektronischer Dämpferregelung überträgt die Leistung auf Wunsch dynamisch oder komfortabel auf die Straße. Dadurch
ergibt sich nun eine noch größere Bandbreite zwischen Komfort und Performance, und zum ersten Mal verfügt der Macan über eine optionale Hinterachslenkung, die im Stadtverkehr einen kompakten Wendekreis von 11,1 Metern ermöglicht.
BEEINDRUCKENDE AUSSTATTUNG
Mit einer Ladeleistung von bis zu 270 kW kann die 800VoltBatterie des Macan an einer geeigneten Schnellladesäule innerhalb von rund 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden.
Für alle Anlässe gerüstet ist der Macan durch die beiden Laderäume an Front und Heck, die bei umgelegter Rücksitzlehne bis zu 1348 Liter Laderaumvolumen bieten und bequem per Hand und Fußgeste geöffnet werden können. Wem das nicht reicht, dem bleibt noch die maximale Anhängelast von bis zu 2000 Kilogramm, um den hohen Nutzwert des Macan abzurunden.
Neu im Innenraum: Das Porsche Driver ExperienceCockpit, das im Macan aus einem 12,6 Zoll großen Kombiinstrument

Kraftstoffverbrauch/Emissionen
(WLTP) – Macan-Modelle:
Stromverbrauch kombiniert:
17,9 – 21,1 kWh/100 km
CO 2-Emissionen kombiniert: 0 g/km.

mit Curved Display, einem 10,9 Zoll Zentraldisplay sowie einem 10,9 Zoll BeifahrerDisplay besteht.
Unterstützt wird die Anordnung durch ein HeadupDisplay mit Augmented Reality Technologie, das virtuelle Elemente wie Navigationspfeile nahtlos in die reale Welt integriert während der Blick auf die Fahrbahn gerichtet bleibt.
Die neuen MacanModelle sind mit ihren modernen Technologien und Fahrassistenzsystemen demnächst in den österreichischen Porschezentren zu finden.
PORSCHE ZENTRUM
VORARLBERG – RUDI LINS
Bundesstraße 26d 6830 Rankweil +43 5522 77911 www.porschezentrumvorarlberg.at
Vom Bodensee bis zum Montafon – das SOV ist der „Klassiknahversorger“ auf höchstem musikalischen Niveau und spielt mit Leidenschaft für sein Publikum.

Seinen Auftrag als einziges großes Symphonieorchester im Ländle übernimmt das SOV mit Freude und großem Verantwortungsgefühl. Sechs bis sieben Abonnementkonzerte pro Saison werden in den größten Konzerthäusern des Landes aufgeführt, alle zwei Jahre kommt eine – von den Musikerinnen und Musikern geliebte – Opernproduktion im Vorarlberger Landestheater hinzu.
MUSIKALISCHE KOOPERATIONEN
Im Sommer gibt es Kooperationen mit den Bregenzer Festspielen, auch hier ist das SOV begeistertes Opernorchester: unter der Leitung von Chefdirigent Leo McFall werden heuer zwei heitere Einakter an einem Abend gegeben, und es läuft eine spannende Produktion im „Opernatelier“, die eigens für

„Es ist immer wieder wunderbar, mit diesem Orchester neue Werke zu erkunden – ich freue mich sehr auf die kommende Saison.”
Leo McFall Chefdirigent
die Festspiele geschaffen wird: Hold Your Breath. Tradition ist bereits der eröffnende Festgottesdienst und das große MatineeOrchesterkonzert am Ende des Festspielsommers – immer unter ChefdirigentenLeitung. Herbstlich gestimmt ist das SOV dann Teil des NeueMusikFestivals texte & töne, wo es zeigen kann, dass ihm auch die zeitgenössische Musik sehr am Herzen liegt.
Geschäftsführer Sebastian Hazod und Chefdirigent Leo McFall zeichnen für die sehr musisch entwickelten Konzertprogramme verantwortlich und kombinieren bedeutende klassische Werke der Orchesterliteratur mit spannenden, teils auch zeitgenössischen, Raritäten. Auch in der kommenden Saison 2024/25 darf das
Das SOV kombiniert bedeutende Werke der Orchesterliteratur mit spannenden, teils
zeitgenössischen Entdeckungen.
Publikum auf ein umfangreiches Angebot gespannt sein, in dem sich einige Künstlerinnen und Künstler auf ein Wiedersehen mit dem Vorarlberger Publikum freuen.
NEUE SAISON 2024/25
Das Konzert 1 im September leitet Roland Kluttig, ein spannender Dirigent, der in den letzten Jahren rundum immer wieder für Aufsehen gesorgt hat. Er lädt den Geiger Kolja Blacher ein, das Violinkonzert seines Vaters zu spielen und hat außerdem Mozarts Jupitersymphonie, die letzte und glanzvollste, im Programm. Ehrendirigent Gérard Korsten kommt im Oktober mit einem sehr persönlichen Lieblingsprogramm: Gustav Mahler, die spätromantische SchönbergKammersymphonie Nr. 2 und das Cellokonzert von Antonín Dvořák, welches die aufregende Harriet Krijgh interpretiert. Im November zum Konzert 3 freut sich Chefdirigent Leo McFall darauf, Bedřich Smetanas 200. Geburtstag zu begehen und dirigiert den gesamten Zyklus Má vlast, Mein Vaterland, aus dem Die Moldau weltberühmt wurde. Miniaturen von den Zeitgenossen Jimmi López und


Francisco Coll, dazu eine StrawinskySymphonie und ein RavelKlavierkonzert bilden das rasante und rhythmische Konzert 4, wiederum mit Leo McFall, im Februar.
Unter den Klängen von Don Giovanni werden die Mauern des Vorarlberger Landestheaters erzittern, Mozarts „Oper aller Opern“ geht dort im März über die Bühne. Daniel LintonFrance wird die Produktion leiten, Regie führt Andreas Rosar. Und im April wird ein junger ShootingStar, Giuseppe Mengoli, ein sehr impressionistisches Konzert 5 mit Werken von Claude Debussy, Lili Boulanger und Alexander Glasunows Saxophonkonzert dirigieren, Solistin ist Asya Fateyeva. Zum Saisonabschluss im Mai trifft Leo McFall die Mezzosopranistin Paula Murrihy wieder (Alban Bergs Sieben frühe Lieder) und tanzt Walzer mit Richard Strauss in der RosenkavalierSuite, wie auch mit Rachmaninow in den Symphonischen Tänzen
Die Nähe zu ihrem Publikum suchen die Musikerinnen und Musiker, die zum großen Teil aus der Region stammen, einmal im Jahr auf besondere Art, nämlich mit einem Konzert im öffentlichen Raum: am 7. Juni spielten Ensembles aus dem SOV beispielsweise am Bregenzer Wochenmarkt, und kamen da
mit Menschen ins Gespräch, die sich vorher noch nie mit Orchestermusik beschäftigt hatten. Außerdem bietet das SOV je zwei Schulen eine zweijährige Partnerschaft, in der Workshops und Probenbesuche am Programm stehen. Und: das SOV ist offen für weitere Vereinsmitglieder, welche mit ganz exklusiven Probeneinblicken und Künstler(innen)gesprächen besonders für ihre Treue belohnt werden.
• 6 Abonnementkonzerte
• Oper in Kooperation mit dem Vorarlberger Landestheater
• Konzerte und Opernaufführungen bei den Bregenzer Festspielen
• Festival texte & töne
SYMPHONIEORCHESTER VORARLBERG
Rathausstraße 11, 4. Stock 6900 Bregenz +43 5574 43447 www.sov.at
Wer wäre wohl prädestinierter über Fußball zu reden als Toni Polster? Der Stürmer und Jahrhundert-Torschütze, der dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feierte, war auf dem Rasen ein Star. Passend zur Europameisterschaft ist er im Film „Diamante Fußballgott“ auf der Leinwand zu sehen.
In den 80er/90er-Jahren zählte Toni Polster zu den erfolgreichsten Fußballern Österreichs, auch über die Landesgrenzen hinaus. Später arbeitete er als Trainer und Manager, versuchte sich als Sänger. In „Diamante“ erinnert er sich an seinen ehemaligen Austria Wien Team-Kollegen Rudi Varda, der trotz überragender fußballerischer Fähigkeiten mit allerlei Disziplinlosigkeiten aus der Reihe tanzte – ein Interview über Péle, Pfiffe und die Leidenschaft fürs runde Leder.
Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie die Stichworte WM und Brasilien hören? Bei der WM natürlich meine zwei Teilnahmen in den Jahren 1990 und 1998 sowie bei Brasilien ganz klar – Edson Arantes do Nascimento „Pelé“.
Im Film erinnern Sie sich an Ihre Begegnungen mit Rudi Varda. Hatten Sie beim Dreh eine reale Person im Kopf? Ihre schauspielerische Leistung kommt jedenfalls überzeugend rüber. Generell ist das Schauspielen nicht so mein Metier Ich hatte auch keine Person im Kopf, aber wenn es gut rüberkommt, dann freut es mich natürlich.
Gibt es in Ihrer Fußballkarriere Parallelen zum Leben von Rudi Varda? Die Pfiffe der Fans im Spiel gegen die DDR 1989 straften Sie mit drei Toren ab und das Spiel ging in die österreichische Fußballgeschichte ein . . . Diese Situation könnte man getrost als Parallele bezeichnen. Ich habe ganz deutlich 50.000 Leute gehört, die gepfiffen haben und heute sagen alle und jeder: „Herr Polster, ich war damals
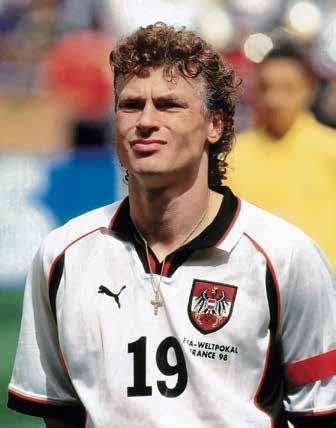
Toni Polster. Bei der Fußball-WM ´98 in Frankreich und im Film „Diamante“.

im Stadion und hab’ sie nicht ausgepfiffen!“ – Nur einer hatte den Mut und sich für seine Pfiffe entschuldigt. Ich habe ihm vergeben.
Was unterscheidet den heutigen Fußball von jenem, der zu Zeiten von Rudi Varda gespielt wurde? Das Tempo ist viel höher, die Spieler sind besser trainiert, haben somit einen höheren Fitnessgrad, und auch die Spielanlage mit z. B. Dreier-, Vierer-, Fünferkette ist eine ganz andere. Den VAR (Anm.d.Red.: Video Assistant Referee/Video Assistant Referee) gab es damals ebenfalls noch nicht.
Der Film zeigt zahlreiche Archivaufnahmen. Haben Sie eine fußballerische Lieblingsszene und was hat Sie an diesem Projekt besonders gereizt? Ich habe keine spezielle Lieblingsszene.
Wenn es sich um Fußball-Legenden dreht, ist der Reiz immer enorm bei mir!
Im Fußball war Ihr Spitzname „Toni Doppelpack". Wenn Sie einen Künstlernamen als Schauspieler wählen dürften, welcher wäre das? Toni Genio
Im Film wird der Angstgegner Österreichs thematisiert: Sie standen 1990 einer Amateurauswahl von Fischern, Arbeitern und Elektrikern im kühlen Norden gegenüber und hatten auf ein 10:0 für Österreich getippt, doch es kam anders. Sieht man manche Dinge nach 34 Jahren gelassener? Solche Tage gibt es, das zeigt der Fußball immer wieder – und das ist gut so! An diesem Abend hätten wir sogar aufs leere Tor schießen können und der Ball wäre nicht reingegangen.
In den 70er-Jahren kickte Rudi Varda als Jugendlicher für den pfälzischen Provinzclub FV Rübenach. Seine Torgefährlichkeit, Technik und Dynamik sind so herausragend, dass bald die Scouts der Profivereine auf den Stürmer aufmerksam werden – „Diamante“, eine Mockumentary und Hommage an die Ästhetik des Fußballs, garniert mit einer herzerwärmenden Brudersuche.

Rudi Vardas Karriere nimmt ihren Lauf und er wechselt vom deutschen Amateurfußball in den bezahlten europäischen Spitzensport: zunächst zu Fortuna Köln, später Bayer 04 Leverkusen, Stuttgarter Kickers sowie Austria Wien. Trotz seiner überragenden Fähigkeiten gelingt dem Ausnahmetalent nie der Durchbruch. Auf dem Platz agiert er eigensinnig, klebt am Ball, verweigert Defensivarbeit und tanzt mit zahlreichen Eskapaden abseits des Rasens aus der Reihe. 1982 verliert sich seine Spur, bis sein Bruder Ferdi, Platzwart beim FV Rübenach, den Hinweis erhält, dass sein Bruder in Brasilien unter dem Spitznamen „Diamante“ die Fans begeisterte und dort bis heute als „Magico“, als Ballzauberer, verehrt wird. Um seinen Bruder wiederzufinden, be-
gibt sich Ferdi auf eine mitreißende Odyssee – vom Aschenplatz in Rübenach auf den heiligen Rasen des Maracana-Stadions von Rio.
Originelle Idee. Der FV „Rheingold“ Rübenach bei Koblenz existiert tatsächlich, wie die anderen im Film erwähnten Fußball-Clubs und -Spiele z. B. die Schande von Gijon oder die Partie FK Austria Wien gegen Galatasaray Istanbul 1983, in der statt Felix Gasselich klarerweise Rudi Varda das entscheidende Tor schießt. Auch die österreichischen Fußballfans sind im echten Leben Anhänger des FK Austria Wien – alles andere ist in der charmanten Mockumentary frei erfunden. Aber auch diese Anteile wurden teilweise von der Realität beeinflusst, wie Drehbuchautorin Ines Häufler verrät: „In einer frühen Fassung hatte die

Ballzauberer. Ferdis Odyssee vom Rübenacher Ascheplatz ins MaracanaStadion von Rio.
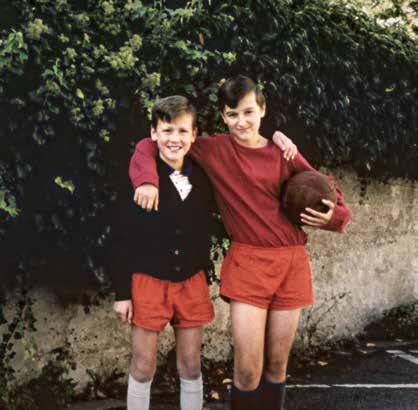

österreichische Freundin von Rudi Varda eine andere Hintergrundgeschichte. Als dann klar war, dass die ehemalige SchwimmStaatsmeisterin Andrea Steiner die Rolle spielen würde, haben wir die Figur an ihre echte Lebensgeschichte angepasst. Gerade diese Mischung aus Realem und Erfundenem ist beim Schreiben spannend: Die Realität gibt den Rahmen vor und das Fiktionale kann nur so weit gehen, wie es im echten Leben möglich wäre.“
Prominente.
Weggefährten äußern sich zu Rudi.
Interview. ExSpieler und -Trainer Erich Ribbeck.

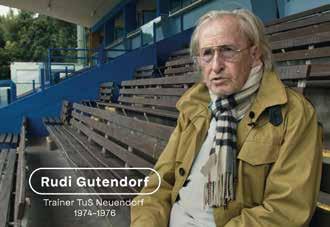

Experte. Fußballfunktionär Reiner Calmund.
Die Idee zum Film hatte Regisseur Georg Nonnenmacher übrigens bereits vor einigen Jahren: „Alles begann damit, dass mein Freund Celio, Brasilianer aus Rio, immer wieder die Schönheit des brasilianischen Fußballs pries und unendlich viele Spieler nannte, um dies zu belegen. Selbstredend vergaß er nicht, darauf hinzuweisen, wie unansehnlich dagegen der Deutsche Fußball war. So sehr mich das auch nervte, was sollte ich dem entgegenhalten? Er hatte Recht. Doch bevor mir mein Freund eine weitere Anekdote über einen Zauberfußballer erzählen konnte, unterbrach ich ihn und sagte: Celio, du Schlaumeier. Weißt du eigentlich, dass Anfang der 80er-Jahre unbekannterweise ein deutscher Spieler in eurer ersten Liga gespielt hat und dort sogar verehrt wurde? Celio stutzte für einen Moment und ad hoc fiel ihm dazu nichts ein. Das war der Moment, wo mir klar wurde, dass es evtl. möglich wäre, eine frei erfundene Geschichte, die auf haltlosen Behauptungen und Flunkereien basiert, filmisch zu erzählen, also in Form einer Mockumentary.“
Bewegungskunst. Abseits dieser originellen Grundidee beeindrucken die Ma-
cher (Georg Nonnenmacher, Ingo Haeb, Karin Berghammer, Ines Häufler) auch im Hinblick auf die Umsetzung und Zusammenstellung des dokumentarischen Materials: Zahlreiche Archivmitschnitte von Fußballspielen – Rudi Varda tänzelt meist in der Totale durchs Bild –, Schwarz-WeißBilder von seiner Kindheit oder der Sportschau, in der er mit einer Medaille für sein Tor des Monats ausgezeichnet werden soll, aber nicht auftaucht, stützen den Plot um Ferdi, verkörpert von Schauspieler Gerd Dahlheimer, realitätswirksam. Sahnehäubchen sind die vielen prominenten Weggefährten, die sich über den Kicker äußern: Reiner Calmund, Toni Polster, Guido Buchwald, Erich Ribbeck, Herbert Prohaska, Hans Meyer.
Die Faszination von „Diamante“? Er konzentriert sich, neben einer herzerwärmenden Story, auf die Ästhetik und das Verbindende am Spiel, abseits von aus den Fugen geratenen Werbedeals, Medienverträgen, hochbezahlten Legionären und eines inszenierten Spektakels: „Die große Fußballbühne von heute kommt im Film eigentlich nie vor, sondern wird nur in der Fußballhistorie und im Provinzfußball, für den der Protagonist Ferdi Varda steht, gespiegelt. Über diese Hauptfigur Ferdi, den Vereinswirt und Platzwart alter Schule, gerät „Diamante“ am Ende zu einem melancholischen Plädoyer für den Fußball als Bewegungskunst, bei der nicht nur Ergebnisse und Erträge zählen, sondern eben auch die Schönheit des Spiels“, unterstreicht Ingo Haeb und so fiebert man am Ende mit, ob es Ferdi tatsächlich gelingt, seinen kleinen Bruder wiederzufinden. Christiane Schöhl von Norman
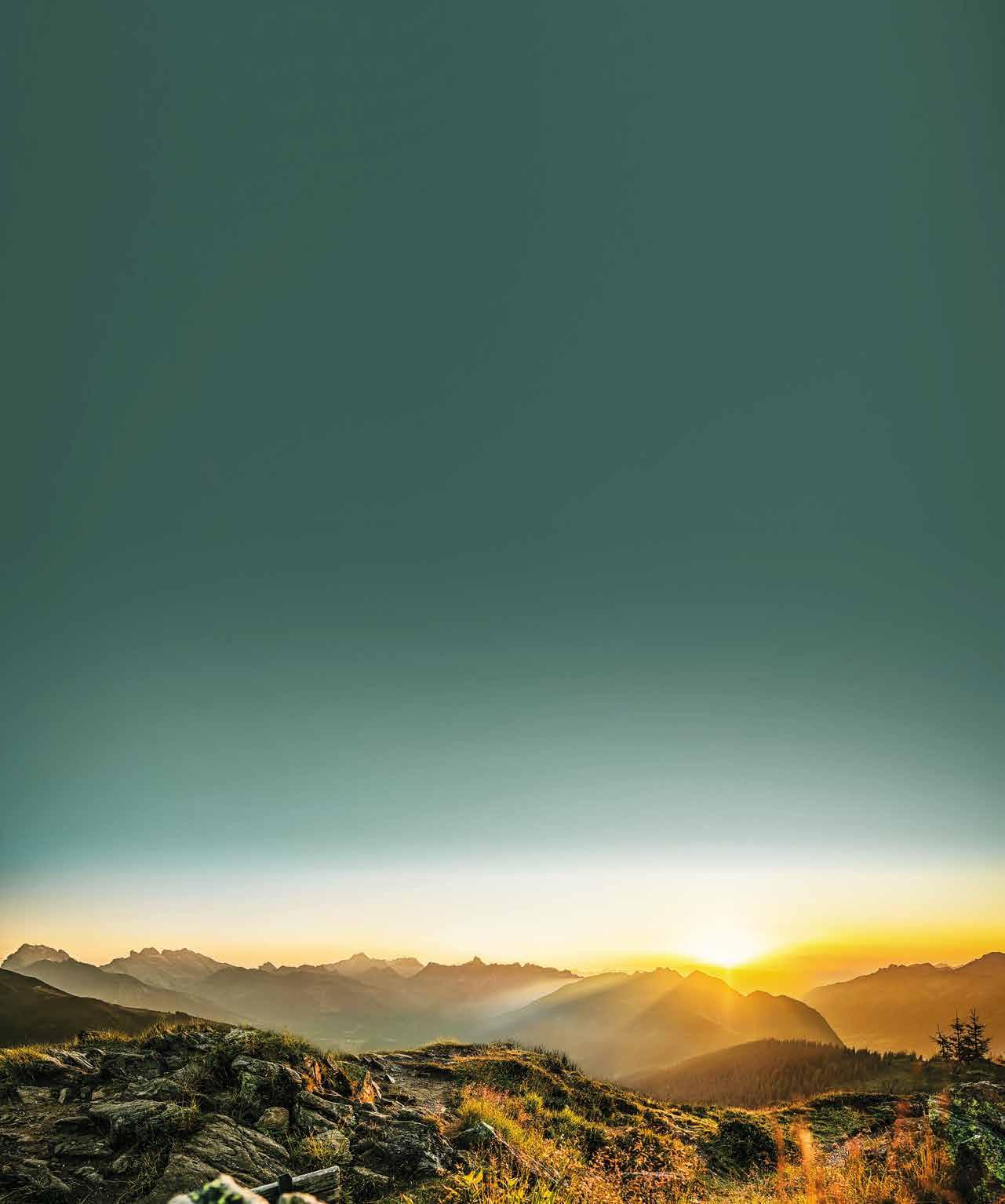



1881 versprochen. Frisch erfüllt.
Um „das beste Bier zu brauen” gründete Ferdinand Gassner 1881 die Brauerei Fohrenburg. Sein Versprechen von damals erfüllen wir täglich frisch, wie die höchsten Auszeichnungen der Bierwelt bestätigen.


Der Zauber aus dem Paris der 20er-Jahre, garniert mit Wiener
Lebensfreude und künstlerischer Extravaganz, sowie einer großen
Portion Herzlichkeit – Stefanie Marik ist die „Herzkönigin“ dieser wunderbaren Welt. Ein Interview über Moules Frites, wilde
Partynächte und die wahre Bedeutung von Gastfreundschaft.
Seit Anfang dieses Jahres ist Stefanie Marik Direktorin des Hotels Motto im Herzen des 6. Wiener Gemeindebezirks, direkt an der trubeligen Mariahilfer Straße. Was das Haus auszeichnet? Es ist ein facettenreicher Mikrokosmos für Menschen, die den Flashback ins Paris der 20er-Jahre, Crémant & Croque sowie atmosphärische Hospitality schätzen. In dieser Wunderwelt „regiert“ die Bludenzerin mit Zahlengeschick, Organisationstalent und ganz viel Herz. Ihr exklusives Refugium verfügt über 91 Zimmer sowie das Dachrestaurant Chez Bernard mit Rooftop-Terrasse, das eine Mischung aus französischer und österreichischer Küche serviert. Designtechnisch gibt es einiges zu entdecken: Der größte Teil der Möbel und Dekors wurde von
kleinen, lokalen Herstellern entworfen und gebaut. Andere Accessoires wie die alten Kronleuchter sind aus dem Ritz in Paris. Was die Motto-Welt sonst noch einzigartig macht, welche Relevanz die Wiener „Crowd“ hat und warum am Ende doch immer die Menschlichkeit zählt – dass alles und noch mehr hat uns die Vorarlbergerin im Interview verraten.
Wie hat dich dein Weg vom beschaulichen Bludenz, über die Arbeit bei einem Großkonzern, schließlich in die Privathotellerie geführt? Nach der Hotelfachschule habe ich zunächst in einem Familienbetrieb am Arlberg gearbeitet. Danach ging es, nach verschiedenen Zwischenstationen, 2008 zu Accor. Wien war damals nur als Zwischen-


station auf dem Weg ins Ausland geplant. Da sich bei Accor immer etwas Neues aufgetan hat, bin ich am Ende fast 17 Jahre geblieben. Mittlerweile habe ich den Traum von „Rausin-die-weite-Welt“ nicht mehr. Ich bin in Wien angekommen.
Im Juli 2021 hast du den neuen Job im Motto begonnen . . . Genau. Ich war sehr neugierig, als ich gehört habe, dass Bernd (Anm. d. Red.: Bernd Schlacher, Urgestein der Wiener Gastroszene) ein Hotel eröffnen möchte, denn ich mag seinen Stil und seine Art zu denken. Mir war sofort klar, dass dieses neue Projekt cool wird und deswegen habe ich mich beworben. Außerdem macht es mir Freude, etwas Neues von Beginn an mitzuentwickeln, Teams zusammenzustellen, meine Persönlichkeit einzubringen.
Was schätzt du an deiner Arbeit? Ich liebe die Arbeit mit den Menschen: Mit den Kollegen(innen), genauso wie mit den Gästen. Ansonsten mag ich die bunte Mischung an vielfältigsten Aufgaben, welche die Koordination aller Abteilungen, die Sicherstellung reibungsloser Betriebsabläufe sowie die strategische Ausrichtung des Hotels umfasst.
Liegt dein Handy immer empfangsbereit auf dem Nachtisch, sodass du in Notfällen 24/7 erreichbar bist? Ich habe zum Glück Mitarbeiter(innen), die sich trauen, eigene Entscheidungen zu treffen und wirklich nur in Notfällen durchklingeln. Aber ja, wenn es mal brennen sollte oder ähnliches, wäre ich jederzeit erreichbar.
Wie bist du denn so als Chefin? Schwierige Frage. Das müssen eigentlich die anderen beantworten. Mir persönlich sind vor allem Transparenz und Ehrlichkeit wichtig. Sicher bin ich auch sehr anspruchsvoll, aber meine Devise lautete: „Fördern und Fordern.“ Generell besprechen wir die verschie-
Flair. Mut, Neues zu wagen, Mix aus Punk und Avantgarde sowie viel Herzlichkeit zeichnen das Motto aus.
densten aktuellen Themen, Verbesserungsmöglichkeiten, Wünsche etc. offen im Team, um gemeinsam etwas Neues zu entwickeln. Wir haben den Mut, coole Ideen auch einfach mal auszuprobieren. Ein „Das-haben-wir-immer-schon-sogemacht“ gibt es bei uns nicht.
Was bedeutet für dich Gastfreundschaft? Herzlichkeit ist das Allerwichtigste, eine offene Kommunikation und das Gespür für das Gegenüber, sprich wenn Gäste etwa eine stressige Anreise hatten, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass sie sich in dem Moment nicht über das Nötigste hinaus unterhalten, sondern möglichst schnell in ihr Zimmer wollen. Diese Empathie für den Menschen ist für mich Hospitality. Das kann auch mal ein Gläschen Crémant sein, während wir an der Rezeption den Papierkram erledigen.
Die Mitarbeiter-Uniformen wurden von Lena Hoschek designt, den Champagner bekommt man in Schalen, den Crémant in Flöten serviert... abgesehen von dieser Detailverliebtheit – Was unterscheidet euch von anderen Hotels? Es ist der Charme der Menschen. Wir kommunizieren im Team, aber auch mit dem Gast auf Augenhöhe und zeigen ein ehrliches Interesse. Aus diesem Grund haben wir zahlreiche Stammgäste, sogar aus Übersee. Diese kommen aus beruflichen Gründen in ihr zweites Zuhause: Aus der turbulenten Mariahilfer Straße hinein in die kleine MottoWelt. Aus diesem Kosmos – bestehend aus Zimmer, Restaurant und Dachterrasse – muss man sich nicht mehr hinausbewegen, damit es einem gut geht. Ganz wichtig ist auch das Team, das eine gute Atmosphäre verbreitet. Da wir inhabergeführt sind, können wir, im Vergleich zu Großkonzernen, viel schneller und individueller auf Trends, Krisen und Feedbacks reagieren. Wir notieren uns Wünsche und setzen sie beim nächsten Besuch nach Möglichkeit gleich um.
Hat der Gast immer Recht? Nein, hat er nicht, denn auch der/die Mitarbeiter(in) oder ich haben nicht immer recht. Im besten Fall findet man eine Wahrheit in der Mitte. Gewissen Wünschen können wir auch nicht nachkommen, weil sie nach reiflicher Überlegung so nicht vorgesehen sind wie ein Telefon auf dem Zimmer. 90% unserer Gäste haben ein Mobiltelefon, weswegen wir uns bewusst dagegen entschieden haben.
Stichwort: Kuriosester Gästewunsch? Da muss ich kurz überlegen, denn mit der Zeit fühlt sich nichts mehr kurios an, weil man irgendwie schon alles erlebt hat. Wir hatten mal einen Gast, der wollte das komplette Interieur raushaben und seine eigenen Möbel mitbringen. Aus der Geschichte ist am Ende nichts geworden, weil wir das Zimmer hätten abreißen müssen, um diesem Wunsch zu entsprechen. Außerdem hatten wir mal einen Gast, der hat wahrscheinlich zu wild gefeiert – jedenfalls lag seine Kleidung in unserem Innenhof verstreut. Auch unter der Rubrik „Lost & Found“ wurden schon die verrücktesten Sachen vergessen, z. B. Rollstühle.
Seit der Eröffnung hat sich das Chez Bernard zu einem In-Treff für Einheimische entwickelt – was für ein Hotelrestaurant eher ungewöhnlich ist. War euch von Anfang an die lokale Community wichtig? Das hat viel mit der Bekanntheit von Bernd zu tun. Viele waren neugierig, wie sein neuestes Projekt wohl werden würde. Ich hatte gerade in der Anfangszeit sehr oft die Situation, dass Leute angerufen und gesagt haben, dass sie ein Zimmer buchen, wenn sie einen Tisch im Chez Bernard bekommen – so etwas habe ich bis dato noch nie erlebt. Das spricht für seine Persönlichkeit, aber auch für das Motto als Brand. Was viele Hotels versuchen, hat bei uns funktioniert: Das Chez Bernard wird als eigenständiges Restaurant wahrgenommen. Die sensationelle Qualität der Küche und des gesamten Teams spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Wir machen manche Dinge einfach anders: So haben wir kein klassisches BuffetFrühstück, sondern auch der Hotelgast bestellt à la carte. Die Hotelgäste schätzen es zudem sehr, wenn sie mitten unter der Wiener „Crowd“ sitzen. Die meisten wollen nicht als Touristen wahrgenommen werden, sondern quasi als „Einheimische“ die Stadt entdecken.
Lieblingsplatz? Ich probiere gerne Neues aus – Dachterrassen, Gärten und einen Gin Tonic.

Stefanie Marik. Geboren: Jänner 1986 in Bludenz Schätzt an Wien: Die bunte Mischung an Menschen und das Kleinstadtfeeling im Grätzel Arbeitet seit Juli 2021 im Motto: zunächst im Bereich Zimmerreservierung und Rezeption, seit Jänner 2024 als Hoteldirektorin; Vermisst aus Vorarlberg am meisten: ihre Familie
Moules Frites oder lieber Käsespätzle? Auf der Skihütte die Käsespätzle und wenn ich hier auf „Afterwork“-Treffen gehe, definitiv der Motto-Style. Christiane Schöhl von Norman

Markant. Ein Zeichen setzt die Glaskuppel, in der sich das Chez Bernard befindet.
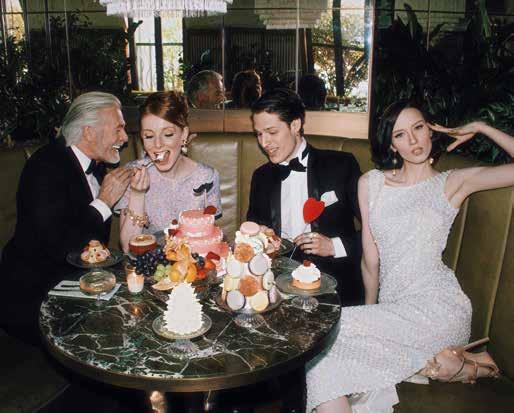
Manchmal betritt man einen Raum und spürt sofort eine besondere Atmosphäre. Wenn die Einrichtung eine Schönheit ausstrahlt, die über Funktionalität weit hinausgeht; wenn man berührt wird vom stimmigen Miteinander individuellen Stils und handwerklicher Qualität. Diesem ästhetischen Anspruch hat sich der textile Innenausstatter „Gebrüder Zwing“ verpflichtet – von Andreas und Tobias Zwing in dritter Generation geführt.
Sie haben zwar beide ihren jeweils ganz eigenen Stil, der sich auch in Auftreten, Kleidung und privatem Wohnraum ausdrückt. – „Aber“, betont Tobias Zwing, „während unserer Arbeit stehen die Kund(inn)en und deren Geschmack an erster Stelle. Unsere Aufgabe ist es, ihnen dabei zu helfen, ihren Stil zu erkennen, ihm mit textiler Gestaltung Ausdruck zu verleihen. Wir müssen mit einer puristischen Art genauso umgehen können wie mit der Atmosphäre eines prächtigen Chalets oder dem Stil einer traditionellen Villa. Wir bringen zwar unsere eigene Handschrift mit, aber letztendlich muss der Raum zu jenen Menschen passen, für
die wir ihn ausstatten.“ Und sein Bruder, Andreas Zwing, ergänzt: „Wir haben mittlerweile schon viel gesehen, durften in zahlreichen großartigen Räumen sein. Das war und ist sehr inspirierend, und ich habe gemerkt, wie auch der eigene Anspruch ans Wohnen immer weiter gestiegen ist.“
Unsere jeweiligen Talente haben wir für das Familienunternehmen gebündelt.

Herausragend. Qualität schafft Aufmerksamkeit.
Andreas (31) und Tobias (35) sind gemeinsam mit vier weiteren Geschwistern die jüngste Generation der Unternehmerfamilie Zwing aus Lochau. Ihre Großeltern haben 1949 zunächst mit der Erzeugung von Polstermöbeln und Matratzen einen erfolgreichen Grundstein gelegt. Und das buchstäblich: „Unsere Oma hat damals mit ihren eigenen Händen die Erde weggeschaufelt, um Leitungen auf dem Grundstück zu legen. Da können wir nur erahnen, welche Meisterleistungen unsere Großeltern vollbracht haben, um diesen Betrieb zu gründen.“ Mit der zusätzlichen Fertigung von Vorhängen und Teppichen haben ihre Eltern dann den Familienbetrieb erweitert und ihm zu jenem Namen verholfen, der heute auch über die Landesgrenzen hinaus für Qualität steht. „Unser Geschäft liegt in Vorarlberg, nicht im Zentrum einer Metropole. Unser Vater hat deshalb immer betont, dass es gerade deshalb wichtig ist, durch herausragende Qualität auf uns aufmerksam zu machen. Das hat er geschafft. Er hat uns ein Lebenswerk hinterlassen, das wir zu schätzen wissen und für das wir dankbar sind.“

Ästhetischer Anspruch. „Gebrüder Zwing“ verleihen individuellem Wohnstil Ausdruck.
Große Spuren und eigene Wege. Die Brüder waren von klein auf in den Betrieb eingebunden, erinnert sich Andreas, der bereits als Dreijähriger mit Werkzeug hantiert hat: „Ich habe schon früh meine Leidenschaft fürs Handwerk erkannt und immer irgendwo mitgewerkelt. Und wenn wir als Familie unterwegs waren, etwa in ein Gasthaus gegangen sind, dann war natürlich auch die Einrichtung Gesprächsthema – wo wurde sorgfältig gearbeitet, was hätte man besser machen können?“ „Andreas war schon immer ein hervorragender Handwerker“, lobt ihn sein Bruder: „Er konnte kaum richtig sprechen, da hat er zu Hause schon sämtliche Sockelleisten abmontiert. Einfach weil es ihn interessiert hat und er es konnte. Bei ihm ist das Talent tatsächlich angeboren“, schmunzelt Tobias. Er selbst ist der kreative Kopf der „Gebrüder Zwing“: Für die Berei-
che Planung, Beratung sowie Material- und Farbauswahl hat er das richtige Gespür und in betriebswirtschaftlicher Hinsicht das kaufmännische Talent – und die Ausbildung.
Es sollte allerdings eine gute Zeit dauern, bis den beiden bewusst war, dass ihre Fähigkeiten in Kombination eine ideale Firmenleitung ergeben und sie sich perfekt ergänzen würden. Zunächst wollte keiner der Geschwister das Geschäft übernehmen. Beide hatten andere berufliche Pläne abseits des Familienbetriebs. „Das war eine sehr wichtige Zeit für uns, weil wir uns frei entwickeln und unsere jeweiligen Stärken ausbauen konnten“, wissen sie im Rückblick. „Erst als wir die Idee hatten, uns zusammenzutun, unsere Talente zu bündeln, kam das Familienunternehmen wieder ins Spiel.“ Heute sind sie in der glücklichen Lage, dass
keiner von beiden seine berufliche Leidenschaft aufgeben muss – im Gegenteil. „Das ist sehr erfüllend und wir haben schnell erkannt, dass die Last der Verantwortung auf zwei Paar Schultern leichter zu tragen ist. Das nimmt unheimlich Druck weg, dem sich unser Vater als einzelner Geschäftsführer alleine stellen musste. Und es hat uns auch deutlich gemacht, dass wir nicht unbedingt in seine großen Fußstapfen treten müssen, sondern eigene Wege gehen und auf andere Art und Weise erfolgreich sein können.“ Und das setzen die „Gebrüder Zwing“ seit der offiziellen Firmenübergabe im Jahr 2022 nun gemeinsam mit ihren neun Mitarbeiter(inne)n in die Tat um.
An der Schwelle zum Kunstwerk. Das Team der „Gebrüder Zwing“ führt sämtliche handwerklichen Schritte in der Umset-
Manche Projekte haben den Anspruch, in ihrer Form komplett neu zu sein. Da müssen wir uns an eine Idee herantüfteln. Das Ergebnis ist mitunter so einzigartig, dass es vom Gebrauchsgegenstand zum Kunstwerk wird.

Handgemacht. Umsetzung in eigenen Werkstätten.


zung der textilen Inneneinrichtung selbst aus. Die Verarbeitung in den Bereichen Stoffe, Teppiche, Tapeten und Polsterung erfolgt in ihren eigenen Werkstätten. Und das soll so bleiben: „Wir wollen uns keinesfalls vergrößern“, bekräftigen sie unisono und Tobias Zwing betont: „Unser Ziel ist es, beste Qualität in Material und Ausführung zu bieten. Das beginnt bei der Auswahl der Stoffe, geht über die Beratung und die Umsetzung und endet bei der Montage. Und das funktioniert nur, wenn wir uns auch über kleinste Details austauschen und jedes Stück kennen, das unsere Werkstatt verlässt.“ Kurzweiligen Trends folgen die beiden Unternehmer nicht. „Unsere Arbeiten sind ja zum größten Teil längerfristig gedacht. Vorhänge etwa bleiben gut und gerne auch mal für Jahrzehnte. Sich hier einem Farbtrend hinzugeben, kann spannend sein, ist aber zeitlich sehr kurz gedacht. Zudem sind gerade Vorhänge Einrichtungsdetails, die meist erst auf den zweiten Blick auffallen – im Idealfall aufgrund ihrer besonderen Qualität.“
Natürlich hat immer auch die Architektur eines Raumes ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und gibt der Innenausstattung eine gewisse Richtung vor. „Eine allgemein gültige Regel für DEN Stil gibt es ohnehin nicht, dafür spielen zu viele individuelle Faktoren mit.“ Raum für ganz besonders ausgefallene Einzelstücke bleibt dennoch: „Wir arbeiten mit Architekten und Designern zusammen, die durchaus auch skurrilere
Ideen mitbringen“, erklärt Andreas Zwing. „Darunter finden sich Projekte, die den Anspruch haben, in ihrer Form komplett neu und einzigartig zu sein. Manchmal müssen wir uns an eine Idee geradezu herantüfteln.“ Und das Ergebnis ist dann mitunter so einzigartig, dass es vom Gebrauchsgegenstand zum Kunstwerk wird und mit dem „Austrian Interior Design Award“ ausgezeichnet wird. So geschehen 2023, als die „Gebrüder Zwing“ mit der Umsetzung einer von Künstler Mathias Garnitschnig entworfenen Sitzskulptur in der Kategorie „Polstermöbel“ überzeugen konnten.
„Wie man sich zu Hause einrichtet, sagt eine Menge über den Menschen aus“, davon sind die Brüder überzeugt: „Es zeigt, in welcher Atmosphäre eine Person sich wohlfühlt, aber schon auch, wie sie gerne gesehen werden möchte“, erklärt Tobias Zwing. Die Coronapandemie und den damit verbundenen Rückzug ins Eigenheim haben die „Gebrüder Zwing“ deutlich gespürt:
„Die Nachfrage nach hochwertigem Handwerk für die Innenausstattung hat nochmals einen Aufschwung erfahren und sich inzwischen auf hohem Niveau eingependelt.“ Daher müssen sie den Onlinehandel und die Konkurrenz aus der Billigmöbelbranche nicht fürchten: „Die Menschen, die uns beauftragen, wissen um den Wert des echten Handwerks und sind gerne bereit, mehr zu investieren – auch an Wartezeit. Denn eine ganz persönlich geschaffene Atmosphäre ist in jedem Fall einzigartig.“ Angelika Schwarz
Die Menschen, die uns beauftragen, wissen um den Wert des echten Handwerks.

Preisgekrönt. Sessel bis 2025 im vorarlberg museum ausgestellt.



Österreich Sieger 2024





























Wenn etwas gut geschrieben ist, liest man es umso lieber. Und wenn etwas gut gedruckt ist, dann erst recht. Sollen wir mal darüber sprechen?
–» 05572 24697
Offsetdruck | Digitaldruck | Lettershop | vva.at
vva.printworks
Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH

GOLDSTANDARD MIT GESCHWINDIGKEIT
Der Audi e-tron GT Prototyp steht für sportlich-elegantes Design und pure Performance. Interessantes Feature ist das aktive Fahrwerk, bei dem die hydraulischen Dämpfer Bodenunebenheiten ausgleichen, um die Karosserie waagrecht zu halten und das Fahrerlebnis zu optimieren. Dieses System macht sich nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Ein- und Aussteigen bemerkbar: Das E-Auto hebt sich automatisch um etwa fünf Zentimeter an. Trotz des zusätzlichen Energieverbrauchs der Hydraulikpumpen betonen die Audi-Techniker, dass der Verbrauch minimal ist, weil die Batterie eine hohe Kapazität aufweist. •
www.audi.at

ZWEI RAPPER IN PARIS
Louis Vuitton Kreativdirektor Pharrell Williams hat sich für die aktuelle Herren-Kollektion Unterstützung von seinem langjährigen Freund und Rapper Tyler, The Creator, geholt. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit kann sich sehen lassen: Die daraus resultierende Menswear-Capsule vereint die Universen beider Künstler und begeistert mit eleganten KeyPieces im Dandy-Stil, einer kräftigen Farbpalette und der Neuinterpretation des berühmten LV-Signets mit handgezeichneten Motiven als Craggy Monogram. So treffen pastellgelbe Mäntel und Fliegerjacken aus Wolle auf Monogramm-Kopfbedeckungen und Pilotenbrillen. •
www.louisvuitton.com

QUADRATISCH, PRAKTISCH, GUT
Designtechnisch gesehen verkörpert die Anatom die DNA von Rado: die für die Marke charakteristische Hightech-Keramik trifft auf ein futuristisches Design, das sich der Wölbung des Handgelenks wunderbar anpasst, während die Designelemente ineinander verschmelzen – und dabei hatte die Uhr mit dem quadratischen Gehäuse ihre Premiere bereits im Jahr 1983. Die Anatom hat somit eine lange Geschichte vorzuweisen, die in dieser Neuauflage nun ein Facelift erhält: bunte Zifferblätter mit Farbverlauf, minimalistisches Design, innovative Materialien und eine einzigartige anatomische Form sind die Zutaten. •
www.rado.com

Paul Renner zelebriert im barocken Beinhaus St. Peter mit Gebeinen, Schädeln und bemalten Lichtkästen ein sinnliches Memento Mori.
Beinhäuser. Herodes ließ in vorchristlicher Zeit die ersten Beinhäuser errichten, die der Bestattung einer Elite vorbehalten waren. In Europa entstanden Beinhäuser aus Platzgründen im Mittelalter. Schädel und Gebeine aus aufgelassenen Gräbern wurden in Beinhäusern verwahrt, wo sie eine zweite Bestattung erhielten. Ihre Blütezeit hatten die Beinhäuser im europäischen Barock. Die opulente Inszenierung von Tod und Vergänglichkeit schuf berühmte Beinhäuser. Das weltweit größte Beinhaus sind die Katakomben von Paris aus dem Jahre 1809 mit den sterblichen Überresten von Millionen Parisern. In Hallstatt präsentiert das Ossarium in der Michaels Kapelle 1200 in Reih und Glied gereihte Schädel, die im 19. Jahrhundert bemalt wurden. Das war die Blütezeit der Schädelmalerei.
Beinhaus St. Peter. Der schlichte Rechtecksbau im Rankweiler St. Peter Gässele ist 1627 im Zuge der Erbauung der St. Peterskirche entstanden. Der kunstsinnige Pfarrherr Dr. Walter Juen beauftragte den Künstler Paul Renner sowie den Architekten Bernhard Wüst mit der Aufgabe, das
Beinhaus in ein Memento Mori zu verwandeln, in dem die Reise vom irdischen ins ewige Leben mit allen Sinnen erlebbar wird.
Barockmensch Paul Renner. Seit drei Jahrzehnten beschäftigt sich der aus Dalaas gebürtige und in der weiten Kunstwelt aktive Künstler mit Beinhäusern. Sein Interesse gilt der ornamentalen, opulenten Inszenierung von Raum und Zeit im Sinne eines bildlichen und spirituellen Erlebnisses. „Im Beinhaus St. Peter wird die materielle Architektur aufgebrochen, um im Spiel von Licht und Schatten die Wegstrecke vom Jetzt in die Ewigkeit immateriell, im Sinne von metaphysisch und atmosphärisch, zu erleben. Am Boden sind zwei große, von mir mit Sedimenten bemalte Leuchtkästen installiert, die mit farbigem Licht von unten und weißem Licht von oben einen magischen Lichtvorhang erzeugen. Dieser ver- und enthüllt auf mystische Weise die vertikal mit Gebeinen und Schädeln ornamentierte Stirnwand.“
Das Gesamtkunstwerk Beinhaus St. Peter ist ab Ende Juni zu besichtigen. Der neue Kunstplatz verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis. Elisabeth Längle

Beinhaus. Das einfache Haus ist ein Erlebnisort für die mystische Reise vom Jetzt in die Ewigkeit.

Ornamentik. Die Stirnwand ist ein Ornament aus Schädeln und Knochen, das man wie ein Buch lesen kann.

Äußerlich hält sich das Beinhaus mit barocker Formensprache zurück. Im Inneren wird die Magie barocker Theatralik zur mystischen Erzählung über Endlichkeit und Ewigkeit.
Für so manchen ein Traum: Fahren wie in einem Boliden der Formel 1. Bei Red Bull geht das nicht. Bei Mercedes schon. In einem AMG GT erfüllt sich dieser Traum. Sehr weitgehend zumindest.

Mercedes AMG GT 63 4matic+
Antrieb: AMG 4,0-Liter-V8-Biturbomotor, 585 PS, 800 Nm, Spitze 315 km/h
Kraftübertragung: AMG-Speedshift-Neungangautomatik
Verbrauch: WLTP-Kraftstoffverbrauch kombiniert 14,1 Liter Preis: 256.800 Euro, Testfahrzeug 304.283,28 Euro
Vielleicht wird es ihn einmal geben, den Red Bull für die Straße. Mercedes hingegen hat schon so ein HightechHochleistungsgerät im Angebot. Und bewegt sich damit in einer Tradition wie keine andere Marke. Von den legendären Silberpfeilen bis hin zum Mercedes SL der Fünfzigerjahre erstreckt sich die Geschichte der Mercedes-Ikonen.
Herausragend: der Flügeltürer 300 SL. Als SLR gewann er viele große Rennen, unter anderem die Mille Miglia von 1955 mit dem unfassbaren Schnitt von 157 km/h. Stirling Moss saß am Steuer. Für Flügeltürer („Sportwagen des Jahrhunderts“) werden heute Millionenbeträge bezahlt. Das legendäre Uhlenhaut-Coupé SLR (Alu-Karosserie) wurde vor zwei Jahren um 135 Millionen Euro versteigert. Es waren Ableger von Mercedes-Rennwagen, die die Strahlkraft der deutschen Marke begründeten. Starke Marken werden eben aus Träumen geboren – und nicht aus Vernunft.
Das Bußgeld. Damit kommen wir gleich zu zwei profanen Themen. Der Preis unseres Mercedes AMG GT Coupés beläuft sich auf 304.283,28 Euro und ist damit Rekordhalter unter allen Kontur-Testwagen. Und der Verbrauch von 14,1 Litern im Schnitt wird bei Öko-Schützern keinen Beifall finden. Es darf allerdings gesagt werden, dass der AMG-GT-Eigner seinen Umweltfrevel gleich zum Start mit einer Normverbrauchsabgabe von 90.980,88 abbüßt.
Zurück zum Preis: Natürlich ist dieser Mercedes aus Affalterbach kein Monoposto, sondern ein bemerkenswert geräumiges zweisitziges Coupé, das man in seiner neuesten Version auch als Viersitzer ordern kann. Im Fond für „Personen mit einer Größe von max. 1,50 Meter“, wie Mercedes verschämt, aber ehrlich anmerkt.
Dieses faszinierende Automobil steckt derart voll an innovativer Ingenieursleistung, Hightech, sündteuren Werkstoffen und ausgetüftelter Triebwerksfertigung in der Affalterbacher Manufaktur, dass man mehrere Bücher darüber schreiben könnte. Geht aber nicht.

Das Wesentliche. Hier daher das Wesentliche: AMG schöpft aus dem 585 PS starken Bi-Turbo-Achtzylinder (wo findet man so was heute noch?) und allen seinen Assistenten ein Höchstmaß an hochdynamischen Eigenschaften. Im „Sport Plus“-Programm und so fühlt man sich an das martialische Motorengeräusch eines Silberpfeils erinnert, den Mercedes zu seinen (leider verblichenen) History Days aus dem Stuttgarter Museum an den Salzburgring gebracht hatte.
Aber „Rudern“ wie einst Juan Manuel Fangio braucht heute niemand mehr an so einem Power-Mercedes. Es ist alles da, was das Fahren sinnlich, mitunter auch richtig lustvoll macht – und sicher: der vollvariable Performance 4matic Allradantrieb, eine ausgefeilte, auch kostspielige Aerodynamik, die Wankstabilisierung und die aktive Hinterachslenkung, um nur das Wesentlichste anzuführen.
Optisch ist der AMG GT mit seiner tiefen, breiten Kühlerverkleidung und den Powerdoms auf der Motorhaube einfach eine Wucht, total unverwechselbar. Der aktive Heckspoiler ruht nahtlos in der großen Heckklappe. Unter der Klappe geht ordentlich was rein.
Innen: Luxus und Ambiente ganz nach Wunsch. Hochformatig angelegt das Infotainment-System mit den sechs Fahrprogrammen von der „Glätte“ über den „Sport“ bis zum „Race“. Mit an Bord: Track Pace, eine ultraschnelle Software für den Einsatz auf der Rennstrecke.
Alles für den Racer. Misst telemetrisch alles für den Rennfahrer. Runden- und Sektorzeiten werden festgehalten, es arbeiten Trainings- und Analyse-Tools, Kurvenwinkel und Bremspunkte werden angezeigt. Es geht ums Aufspüren der besten Linie. Damit wären wir wieder bei der Verwandtschaft zur Formel 1. Erst auf der Rennstrecke zeigt der AMG GT, was er wirklich kann. Abseits der Piste genießt man das Ambiente, vielleicht eine kleine Massage, lauscht dem Sound und übt sich in Zurückhaltung. Franz Muhr
Alles begann vor rund zwölf Jahren als „ein großer Spaß“. Heute ist der gebürtige Bregenzerwälder Lukas – genannt Luke –Bereuter immer noch Gastronom – gar einer der erfolgreichsten in Wien. Die Freude an der Arbeit und die Lust am Expandieren sind ungebrochen, nur läuft alles weit professioneller ab als in den studentischen Anfängen.
Locker und entspannt erscheint Luke Bereuter zum Gespräch in seinem Lokal Ludwig & Adele. Genauso wie sein Auftreten ist auch die Atmosphäre in dem gut besuchten Restaurant im Foyer des Stadtkinos, das im Wiener Künstlerhaus-Komplex im ersten Wiener Gemeindebezirk zu Hause ist. Seinen intensiven Arbeitsalltag sieht man dem 39-Jährigen, der mittlerweile gemeinsam mit seinem Team in allen gastronomischen Bereichen aktiv ist, nicht an. Und ein großes Hehl macht man darum auch nicht, ebenso wenig wie um all die Szene-Hotspots, die man in den letzten Jahren bereits bespielte.
Wir sind „wir“. „Ich habe mich über die Jahre breiter aufgestellt und die Agentur WIR gegründet“, erzählt Bereuter, der als hundertprozentiger Gesellschafter agiert. Die Gastronomie- und Eventagentur bildet das Dach für u. a. das Kollektiv BGW (steht für Bregenzerwald) mit dem Restaurant Ludwig & Adele, dem Catering Ludwig & Adele Unterwegs, dem Drei-Hauben-Lokal Hausbar, bald bespielt man auch den neuen Standort der Kinderstaatsoper kulinarisch, der im Herbst in den hinteren Gebäudeteil einzieht. Mit V-Style Events wickeln die Vorarlberger – mit dem V im Namen stellt man auch hier einen Bezug zum Ländle her – die gastronomische Gesamtorganisation großer Events wie des Nova Rock und des Frequency Festivals sowie des Wings for Life World Run in Wien ab. Damit nicht genug fördert man junge Künstler(innen) mittels „Kunst ab Hinterhof“ (KAH), einmal pro Monat lädt man bekannte Haubenköche unter dem Titel „Kunst & Kulinarik“ in ein altes Industriegebäude, feine Vorarlberger Spezialitäten vertreibt man über die Popup-Stores Käsmann.

Durch die Blume. Der großzügige Gastgarten vor dem Künstlerhaus lädt bei Schönwetter zum Verweilen ein.

Ein offenes Buch. Mittlerweile steht Bereuter also auf vielen (Stand)beinen, die er professionell und freundschaftlich führt – ein großes Aufsehen macht er getreu seinem Credo darum nicht. Dass der Kern des rund fünfzig Mitarbeiter(innen) umfassenden BWGTeams ihn bereits seit vielen Jahr begleitet, ist ein Zeichen dafür, „dass wir sehr familiär arbeiten und ich nicht als ‚abgehobener Chef‘ agiere“, so der 39-Jährige, der auch zu „99 Prozent der erste und der letzte im aktiven Dienst“ ist. Über ein „open book“ hat das Kernteam auch Zugang zu den Umsatzzahlen. Denn, „ein volles Lokal ist zwar die Voraussetzung für ein Überleben, aber es ist nicht einfach gleichzusetzen mit einer vollen Geldbörse. Und das muss auch allen Involvierten klar sein“, weiß Bereuter, der noch lange nicht ans Zurücklehnen denkt.
Kein Alien-Feeling. Nicht nur die Heimat-Bezüge in den Firmennamen zeigen, dass in Lukas Bereuter ein „geteiltes Herz“ schlägt: „Ich bin aktiv mit der Familie in Verbindung und extrem gerne in Vorarlberg, das entschleunigt mich einfach sehr. Außerdem vermisse
Jeder Tag ist anders. Der Elan von Luke Bereuter ist nach über zehn Jahren in der Gastronomie ungebrochen. „So lange ich Spaß an der Arbeit habe, mache ich weiter“, sagt der Unternehmer mit Bregenzerwälder Wurzeln, der mit seinem Firmennetzwerk in Wien und Umgebung von Á la Carte über Fine Dining bis zum Catering für Großevents so ziemlich alles bespielt.
Es war viel harte Arbeit, das ‚Werkel‘ nachhaltig in Schwung zu bringen.
ich tatsächlich die Berge.“ Ansonsten fehlt ihm in Wien nichts, es ist „eine klasse Stadt mit vielen coolen Möglichkeiten, die wir noch weiter ausschöpfen wollen. Und in der Gerüchten zufolge mehr Vorarlberger leben als in Dornbirn“. Über das Alien-Gefühl, das Sting in seinem Song „Englishman in New York“ besingt, kann er nach gut zwanzig Jahren in Wien also nicht berichten: Neben vielen privaten Kontakten pflegt er auch berufliche Vorarlberg-Netzwerke. Zum Beispiel zählt der in Dornbirn geborene, langjährige Chef der Ottakringer Brauerei, Siegfried Menz, zu einem wichtigen Mentor, auf dessen geschäftlichen Rat er gerne zurückgreift. Bis er „irgendwann vielleicht doch retour geht“, fungiert Luke Bereuter hier in Wien als lebendes Beispiel für eine Anekdote, die sich Vorarlberger Eltern zu erzählen pflegen.
Alles anders als gedacht. „Alle Vorarlberger, die nach Innsbruck zum Studieren gehen, kehren zurück. Diejenigen, die nach Wien gehen, bleiben dort“, lautet diese – und steht auch für Bereuters Lebensweg: Neben seinem Multimedia- und Grafik-Studium arbeitete er bereits in der Gastro: „Eine eigene Bar wäre was Cooles, haben ein paar Freunde und ich uns gedacht – und haben quasi in einer Hauruck-Aktion 2012 die Tonstube gegründet.“ Mit der legendären Bar nahe dem Naschmarkt legten er und seine Mitstreiter den Grundstein für eine Expansion, die im Nachhinein betrachtet „definitiv zu schnell ging“. Aus dem anfangs geplanten „Spaß-Jahr“ wurde schnell mehr, schon 2013 kam Ludwig & Adele im Künstlerhaus dazu, man übernahm u.a. das Buffet im Wien Museum und das Porgy & Bess, 2015 das Badeschiff. Dem nicht genug, managte

Durch den Ruf, den wir uns aufgebaut haben, haben wir das Personal-Thema gut im Griff.
Bereuter noch die Expansion der Rauch Juice Bars, wo er viel über Zahlen lernen durfte. „Wir sind in unserem jugendlichen Leichtsinn extrem schnell gewachsen – zu schnell, wie ich nüchtern betrachtet im Nachhinein feststellen muss“, reüssiert Bereuter über den regelrechten „Schneeballeffekt“, den man in den Anfangsjahren auslöste.
Mehr als ein Kinobuffet. Dass es seit dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder sehr gut läuft, ist der stärkeren Fokussierung und konkret im Ludwig & Adele u.a. der jüngsten Renovierung 2020 geschuldet. „Dass wir in einer Partnerschaft mit dem Stadtkino leben, war uns von Anfang an klar. Allerdings war es vor dem letzten Umbau für die Gäste oft nicht ersichtlich, wo das Restaurant anfängt und das Kinobuffet endet.“ Diese unterschiedlichen Ansprüche bekommt man durch eine bessere räumliche Trennung nun sehr gut unter einen Hut, ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Speisenangebot stand damals wie heute im Fokus. „Wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, an dem wir mit Stolz sagen dürfen, dass wir jeden Abend ausreserviert sind.“
Fine Dining mit Cocktailbegleitung. Zum „wirklich schön Essen“ sind die Gäste auf der anderen Seite des Künstlerhauses im Drei-Hauben-Lokal Hausbar bestens aufgehoben. Der Name verweist auf den ursprünglichen Zweck, dem man die Location widmen wollte. Aber auch hier kam so manches anders, als geplant. Und das war definitiv den Corona-Beschränkungen geschuldet, die das „wir“-Kollektiv wie so viele andere Gastronomen beinahe zum Aufgeben zwang. Eine Rückblende in die Vor-Pandemiezeit: HansPeter Haselsteiner beauftragte Bereuter im Zuge der KünstlerhausGeneralsanierung mit der Ausarbeitung eines ganzheitlichen Gastro-Konzeptes, das auch eine Cocktailbar beinhaltete. Nach vier Jahren „schwieriger Baustellenzeit“ war für den 11. März 2020 die Neueröffnung des Komplexes inklusive Albertina modern und der neuen Bar geplant. Dieser Plan fiel dann allerdings mit dem ersten Corona-Lockdown ab dem 16. März zusammen. „Als wir diese Botschaft erhielten, habe ich mir im ersten Moment gedacht: Jetzt stehe ich nicht mehr auf“, erinnert sich Luke Bereuter. Dieses Tief dauerte
Ein Chef auf Augenhöhe. Ein familiäres Miteinander im Team ist Luke Bereuter äußerst wichtig. Die Heads sind teilweise seit den Anfängen mit der legendären Tonstube gemeinsam am Werk.
allerdings nur kurz, die Vorarlberger krempelten die Ärmel hoch und entwickelten – eigentlich aus der Not heraus – die Idee, anstatt der Bar ein Fine Dining zu etablieren. Man startete im Mai 2020 mit einem fünfwöchigen Pop-up nach einem Konzept von Küchenchef Oliver Mohl und reüssierte mit diesem „kurzfristigen Überlebensplan“ bereits nach vier Monaten mit drei Gault-Millau-Hauben als höchster Neueinstieg, 2021/2022 wurde die Hausbar zur Restaurant-Bar des Jahres gekürt. Mittlerweile offeriert man eine siebengängigen Menüfolge mit Cocktailbegleitung, und „das funktioniert hervorragend“.
Den Kopf lüften. Dass ein derartiger Einsatz, meistens an sieben Tagen die Woche, nicht familienfreundlich ist, ist klar. Wie kann ein Privatleben dennoch funktionieren? „Ich habe die toleranteste Frau an meiner Seite und ich bin meiner Freundin sehr dankbar, dass sie mich so stark unterstützt“, so Luke Bereuter. Um nicht die Fehler der Anfangszeit zu wiederholen, prüfe man neue Projekte mittlerweile sehr genau: „Bei allem Engagement muss auch Zeit für Regeneration bleiben, vor allem nach einem intensiven Festivalsommer, wo ich schon mal drei Wochen am Stück am Feld verbringe.“ Um zwischendurch „den Kopf zu lüften, die Gedanken zu ordnen und fit für den anstrengenden Job zu bleiben“ liebt es Bereuter, durch die Stadt zu joggen. Gudrun Haigermoser

Familiäres Vorbild. Der erste Teil des wohlklingenden Doppelnamens Ludwig & Adele ist Bereuters Großvater Ludwig gewidmet. Der Seilbahnpionier aus dem BregenzerWald hat den Enkel „menschlich und was die Arbeit betrifft“, stark geprägt. Adele nimmt Bezug auf die althochdeutsche Bedeutung „edel“, die gut die vielen Möglichkeiten, die das Künstlerhaus unter einem Dach vereint, repräsentiert.

PERFEKTE MONDLANDUNG
Mit der Bioceramic MoonSwatch Mission to the Moonphase setzt die Marke seine legendäre Zusammenarbeit mit Omega fort. Das New Moon Modell ist in Schwarz gehalten und wer genau hinsieht, ertappt Snoopy bei einem Nickerchen auf dem Mond.
www.swatch.com

DIE KUNST DER FRAGILITÄT
Die „Wiener Rose“ mit grünem Rand, umrahmt von Knospen und Blattstreuern, zählt bis heute zu den beliebtesten Motiven der 1924 entstandenen Einzelblumenserie. Ein minimalistisches, farbenfrohes Design –subtil und dennoch stylish.
www.augarten.com

GOLDIGE VERWICKLUNG
Bei diesen Hängeohrringen sind fünf Ovale aus einer gedrehten Spirale, die mit der Coil-Technik gefertigt sind, durch eine Öse mit Diamantpavé im Brillantschliff miteinander verbunden. Die absichtlich unregelmäßige Form der Ellipsen verleiht besondere Raffinesse.
eu.marcobicego.com

DER URLAUB KANN KOMMEN
Die Serpenti Forever Top Handle aus Weidenholz verkörpert den Geist endloser italienischer Sommertage. Im Rahmen eines kunstvollen Handwerksprozesses wird das natürliche Material von Hand geflochten. Die Klappe und der Griff sind aus Kalbsleder in Ivory Opal gefertigt.
www.bulgari.com

AUF DEN HUND GEKOMMEN
Schon während ihres Designstudiums an der Goldsmiths University in London spezialisierte sich Sophia Schiebel auf Produktdesign und experimentierte mit umweltfreundlichen Materialien. Mit ihren Halsbändern, Leinen & Co. setzt sie ein trendig-nachhaltiges Statement.
de.pintu-design.com

MIT ULTRA-FRISCHEM GLOW
Die Geheimwaffe für das ultimative Glow-up: Die neue Gesichtsmaske Masque Confort Phyto Cellulaire bietet einen Super-Lift-Effekt und das ganz ohne Botox. Müdigkeitsfältchen vom täglichen Alltagsstress werden durch maximale Feuchtigkeitszufuhr geglättet.
www.sophies-garden.beauty
Ohrringe, Tasche, Schmuck und mehr! Diese sechs trendigen Must-haves verleihen jedem Style den perfekten Touch, sorgen für den ultimativen Glow oder präsentieren sich designverliebt, nachhaltig und sogar hundeverrückt.
Hast Du am Abend schon was vor?
In Wien gibt es zahlreiche Open-AirLocations wie Rooftop-Bars und Stadtgärten, die in lauwarmen Sommernächten für angesagte After-WorkPartys oder private „Sundowner“ genutzt werden. „kontur“ hat sich auf der Suche nach den derzeit gefragtesten Hotspots unter die feierwütige Menge gemischt.

BIS IN DIE FRÜHEN MORGENSTUNDEN
Eine der beliebtesten Outdoor-Szenetreffs der Bundeshauptstadt ist das legendäre Techno Café im Volksgarten. Bis Mitte September locken jeden Dienstag elektronische Beats, eine illustre Gästeschar und die einzigartige Gastgarten-Atmosphäre mit knorrigen alten Bäumen und dem von Oswald Haerdtl gestalteten Pavillon aus den 50er-Jahren. Gefeiert wird bis 4 Uhr Früh – da wird aus dem After-Work ganz schnell ein Before-Work. •
www.dastechnocafe.at

Nicht in Wien – diese Szenetreffs sorgen nach Büroschluss für Amüsement.

DIE AUSSICHT
GARNIERT DEN GIN Lichtdurchflutet, mit üppigen Grünpflanzen garniert, thront das Chez Bernard unter einer markanten Glaskuppel auf dem Hotel Motto. Auf der Speisekarte des Restaurants stehen moderne österreichische Gerichte mit französisch-mediterranen Einflüssen. Das kommunikative Herzstück ist die spektakuläre Dachterrasse mit Panoramablick. Angesagte DJs sorgen für den passenden Sound. Die perfekte Location für unvergessliche Sundowner. •
www.hotelmotto.at
GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN
In Wien gilt man nach drei Jahren als Tradition und nach vier Jahren als Institution, so jedenfalls Oliver Horvath, einer der Gründer des Kleinod im Stadtpark. Getreu diesem Credo startet die Open-Air-Bar bereits zum sechsten Mal in den Sommer, um kühle Drinks, heiße Sounds und neapolitanische Pizzen & Co. unter dem Blätterdach imposanter alter Bäume zu servieren – die perfekten Zutaten für unvergessliche Sommernächte unterm Sternenhimmel. •
www.kleinod-stadtgarten.wien


SOUND IM SKULPTURENGARTEN
Die Heidi Horten Collection feiert im Skulpturengarten, zwischen Albertina und Staatsoper gelegen, einmal im Monat ihr After-Work-Event. Wer Lust auf Kunst, Drinks und feine Beats hat, ist hier gut aufgehoben. Das Museum ist an diesen Abenden bei freiem Eintritt zugänglich. Es warten ikonische Werke von Andy Warhol, Gustav Klimt, Picasso und René Magritte. Bei Schönwetter gibt es Drinks, Snacks und DJ-Sound oder Live-Konzerte. •
www.hortencollection.com

DIENSTAG IST DER NEUE FREITAG
An einem bestimmten Dienstag im Monat lädt der Dachboden im 25 Hours Hotel zu seiner Sommerhoch-Eventreihe. Noch bis September können Feierwütige die coole Aussicht über die Lichter der Stadt, leckere Cocktails und eine gepflegte Konversation genießen. Den After-Work-Sound spendieren angesagte Wiener DJs mit einem sommerlichen Setup von 18 Uhr bis Mitternacht. Wer hungrig ist, kann sich durch die Küche des Hotels schnabulieren. •
www.sommerhoch.at
36 Grad und es wird noch heißer, mach den Beat nie wieder leiser . . . getreu diesem Song dreht Wien abends voll auf.
AUF DEN MAUERN
Auch in diesem Sommer verwandeln sich die Mauern der altehrwürdigen Albertina Bastei im Rahmen des Albert&Tina Events in eine angesagte Outdoor-Club-Location. Noch bis 18. September trifft man sich hier bei schönem Wetter immer mittwochs von 18 bis 23 Uhr bei kühlen Drinks und elektronischen Klängen zum gemütlichen After-Work. Kunstinteressierte können zudem die aktuelle Ausstellung von Gregory Crewdson besuchen. •
www.albertina.at


MIT ARISTOKRATISCHEM CHARME
Unter dem Namen Auersgarden zieht eine neue Freiluftveranstaltung in die historischen Gärten des Palais Auersperg. Der bekannte Wiener Gastronom Heinz Pollischansky – u. a. Betreiber des Centimeter, Vino Wien und der Stiegl Ambulanz – bespielt diesen Sommer erstmals das versteckte, 5000 m2 große Parkjuwel. Gäste erwarten edle Drinks, leckeres Soulfood, lässige Beats und eine coole Atmosphäre mit aristokratischem Charme. •
auersgarden.at


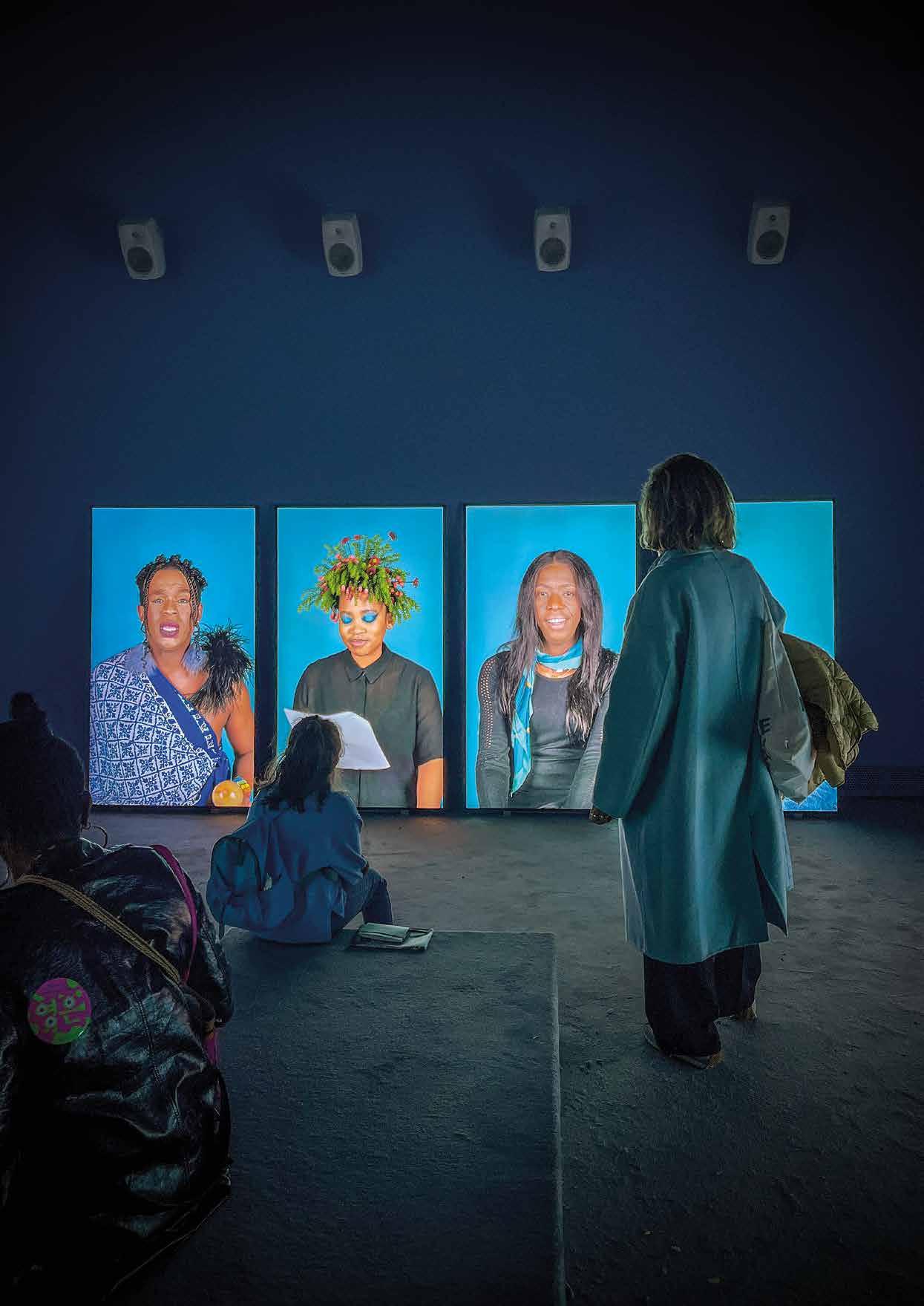
Werke von über 300 Künstlerinnen und Künstlern in der Hauptausstellung und über 80 Länderpavillons –das ist die Biennale Venedig 2024. In den Fokus rücken bis Ende November die Partizipation, die Begegnung mit Immigranten, Indigenen und Queeren sowie das Hinterfragen von Bewertungsmechanismen in der Kunst.
Begegnung.
Videoarbeit von Gabrielle Goliath (großes Bild links) und Malerei von Frida Kahlo.

Es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Für ihren Auftritt bei der Architekturbiennale im Jahr 2023 in Venedig, sahen das Kollektiv AKT und Hermann Czech vor, den Austria-Pavillon für alle zu öffnen. Nicht nur für die Besucher der Ausstellung. Da sich der Pavillon, errichtet nach Plänen von Josef Hoffmann und Robert Kramreiter, an der Grenze des Areals befindet, wäre nur ein kleiner Durchbruch in jener Mauer nötig gewesen, die die Stadtteile Castello und Sant’Elena voneinander trennt. Es sind Bezirke, deren Bewohnerinnen und Bewohner damit leben müssen, dass weite Teile des öffentlichen Raumes, nämlich die Giardini della Biennale, für sie nicht frei zugänglich sind. Die Umsetzung des Konzeptes von AKT und Czech wurde von den Behörden verhindert.
Errichtet wurde dann ein Aussichtsturm für den Blick über die Mauer und ein Miniaturmodell von Venedig machte deutlich, wie viele Plätze und Gebäude auch noch außerhalb des eigentlichen Biennalegeländes, der erwähnten Giardini und des Arsenale, jeweils von Ausstellern besetzt sind. Ein Vorteil für jene, die damit Mieteinnahmen lukrieren können, ein Gewinn für die Besucher, denen eine enorme Zahl von Kunstwerken und Performances geboten werden, aber auch ein Nachteil für die Venezianer, denen immer mehr Lebensraum abhanden kommt.
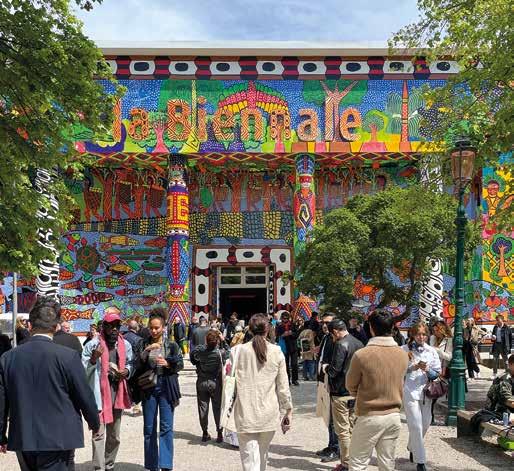

Entdeckt. „Fünferbandegestühl“ des Vorarlbergers Tone Fink in den Giardini della Marinessa neben dem Biennale-Areal.
Übrigens: Wer sich im Sträucherdickicht rund um den Austria-Pavillon umsieht, kann feststellen, dass da ein Loch in der Mauer gewesen sein muss, das von Schleichpfaden herrührt, die sich Menschen gegen die Ausgrenzung geschaffen hatten.
Davor in Bregenz. Der Beitrag Österreichs zur diesjährigen Kunstbiennale tangiert auch diese komplexe Thematik und ist von einem partizipativen Charakter gekennzeichnet. Zur 1895 gegründeten, heuer zum 60. Mal realisierten, wichtigsten internationalen Kunstausstellung hat Kuratorin Gabriele Spindler die Konzeptkünstlerin und Hochschulprofessorin Anna Jermolaewa eingeladen. Mit ihren „Famous Pigeons“, den Porträts mutiger Brieftauben, die etwa für Spionagezwecke zum Einsatz kamen, wurde Jermolaewa bereits im Jahr 2021 von der Bregenzer Kulturservice-Leiterin Judith Reichart ins Magazin 4 geholt. Direktor Thomas D. Trummer zeigte einige ihrer Arbeiten im vorigen Sommer im Kunsthaus Bregenz. Dabei waren auch Fotografien aus der Serie „Chernobyl Safari“, die entstanden sind nachdem Russland die Sperrzone zur Kriegszone erklärt hatte und die zudem Jermolaewas Einsatz für Flüchtlinge aus der Ukraine dokumentieren. Die Arbeit für Venedig schließt nicht nur hier an, mit ihrer Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart sowie mit ihrer politischen Kommentierung steht ihr Auftritt im Kontext der diesjährigen Hauptausstellung wie kaum eine zweite in den Länderpavillons.
Mehr als das. Neben der Biennale mit der heuer farbenprächtigen Hauptfassade ist die Ausstellung von Berlinde de Bruyckere in der Abtei San Giorgio Maggiore unbedingt besuchenswert. Mit ihren komplexen Arbeiten war die belgische Künstlerin auch in Bregenz vertreten.

Auch der Geruchssinn wird von Julien Greuzet im FrankreichPavillon geschärft.


Mit Ironie. Die Schweiz konfrontiert mit Eidgenossen-Klischees.

„Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere“ lautet das Motto des künstlerischen Leiters Adriano Pedrosa. Mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Arbeiten erstmals in Venedig ausstellen, wollte er dem Begriff entsprechen, zudem stehen auch die Erfahrungen und Schicksale von Immigranten, Emigranten, Angehöriger indigener Völker sowie der Queer-Community im Fokus.
Anna Jermolaewa, geboren 1970 in St. Petersburg, floh 1989 nach Österreich. Als Mitherausgeberin nicht systemkonformer Literatur war sie ins Visier des KGB geraten. Die ersten Nächte verbrachte sie auf einer Bank auf dem Westbahnhof. In einer Videoarbeit wird nachgestellt, wie sie damals versuchte, eine Schlafposition einzunehmen. Im Flüchtlingslager Traiskirchen, in dem sie einige Monate war, standen jene Telefonzellen, die nun nach Venedig geliefert wurden. Sie vermitteln etwas vom beklemmenden Gefühl der Menschen, die versucht hatten, Familienmitglieder in der Heimat zu erreichen, bzw. jener, die mit Hoffnungen nach Österreich gekommen waren und nicht wussten, was ihnen hier widerfährt. Anna Jermolaewa konnte an der Akademie der bildenden Künste und an der Universität Wien eine Ausbildung absolvieren und unterrichtet nun selbst.

Heilung der Erde. Yael Bartana bringt die Menschen im deutschen Pavillon ins All.
Ausgezeichnet wurde Archie Moore für seine Arbeit zu den Ureinwohnern Australiens.
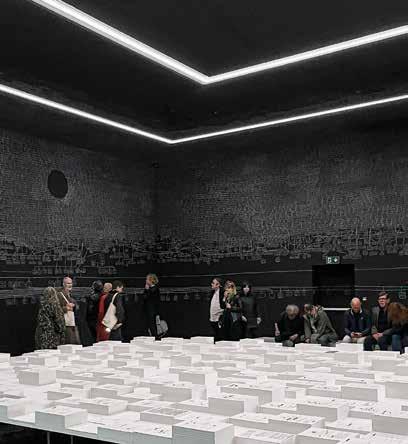
„Stop this war and get the hell out of Ukraine“, rief Anna Jermolaewa bei der Eröffnung des Austria-Pavillons.
Proben für den Regimewechsel. „Stop this war and get the hell out of Ukraine“, lautete ihre Botschaft an Putin im Rahmen der Eröffnungsrede, die das Publikum mit heftigem Applaus bekräftigte. Die zentrale Arbeit im Pavillon ist ein Video von einer „Schwanensee“Probe, das mit Oksana Serheieva, jener Tänzerin und Choreografin gedreht wurde, die aus der Ukraine flüchtete und bei Anna Jermolaewa Unterstützung fand. „Schwanensee“, das Ballett mit der Musik von Tschaikowsky, wurde darum gewählt, weil es einst vom sowjetischen Fernsehen – mitunter in Endlosschleife wie etwa beim Putsch von 1991 – als Ablenkung von der Regierungsinstabilität ausgestrahlt wurde. Nun proben die Tänzerinnen somit für den Regimewechsel in Russland.
Ob es die älteren Arbeiten auch noch gebraucht hat, nämlich „Ribs“ mit jenen unverdächtigen Röntgenbildern, die einst als Tonträger von verbotener Popmusik dienten, oder „The Penultimate“ mit Pflanzenarrangements, die auf die Nelken, Zedern-, Jasmin- bzw. Rosenrevolution verweisen, sei dahingestellt. Mit einer praktisch großen Stofftasche, die mit einer Zeichnung von einer Ballerina bedruckt wurde, verlassen wir den Austria-Pavillon.

Repression. Malerei von Sénèque Obin aus Haiti und eine Installation der türkisch-französischen Künstlerin Nil Yalter.

„Schwanensee“.
Die Arbeit von Anna Jermolaewa im Austria-Pavillon ist auf herausragende Weise politisch konnotiert.

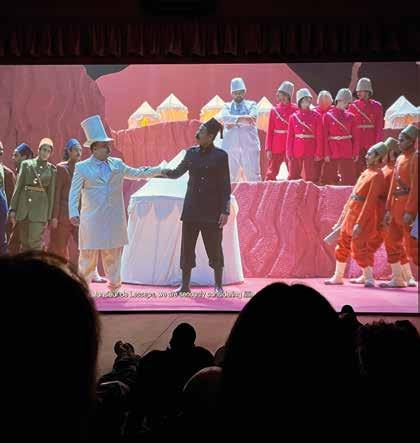
Aufstand. Wael Shawky, der einmal im KUB vertreten war, thematisiert ägyptische Geschichte.
Die unverwüstliche, offizielle Biennale-Tasche, die wir nach den regelmäßigen Besuchen in zahlreichen Grau- und Anthrazittönen besitzen, ist heuer übrigens knallgelb. Der Mann am Tresen unseres Lieblingsbacaro, einer der letzten echten Weinschenken, die wir beim abendlichen Gang durch die engen venezianischen Gässchen aufsuchen, erkennt uns stets auch daran. Seine Cicchetti sind keine belegten Brötchen wie in den Touristenbars, sondern Polpette aus Fleisch oder Fisch, frittierte Melanzani, Kürbisblüten, Krebschen, Sardinen oder Tintenfischchen, gefüllte Oliven, Arancini etc. Draußen prasselt ein kurzer Regenschauer, wir dürfen uns neben dem Topf mit den dampfenden Kutteln stellen, die es hier zudem gibt, bekommen unseren Ombra, den süffigen Hauswein, und lassen das Gesehene Revue passieren.
Ins All geschickt. Es reicht längst nicht mehr, einen Tag für die Giardini und einen für das Arsenale einzuplanen, über 80 Länder sind mittlerweile mit eigenen Pavillons vertreten, die zentrale Themenausstellung ist mit über 300 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern umfangreicher als zuvor. Filme und Performances bedingen lange Warteschlangen. So wie vor dem Deutschland-Pavillon, in dem Yael Bartana davon ausgeht, dass die Erde ohne Menschen Heilung erfährt und deren Bewohner deshalb ins All schickt. Neben dieser vielschichtigen Videoarbeit lässt Ersan Mondtag den Alltag von Arbeitsmigranten nachstellen. Doch damit ist es nicht getan, Besucher werden auch auf die kleine Insel La Certosa gelockt, wo etwa Klangkünstler Jan St. Werner mit Soundinstallationen in der Landschaft dem Deutschland-Thema, nämlich der Verwischung von Grenzen und Schwellen, nachkommt.

Indigenität. Im USAPavillon zeigt Jeffrey Gibson, dessen Familie den Cherokee und Choctaw angehört, seine Arbeiten.
Für diese Erfahrung braucht man reichlich Muße, im Frankreich-Pavillon kommt man rascher zum Ziel. Julien Creuzet schafft in bewegten Bildern, mit Skulpturen aus Stoff etc., mit Musik und olfaktorischen Elementen Verbindungen künstlerischer Prozesse in Frankreich und in seiner Heimat Martinique. Die bunten Arbeiten und Skulpturen von Jeffrey Gibson, der von den Choctaw und Cherokee abstammt, fordern im USA-Pavillon lustvolle Auseinandersetzung mit Indigenität. Archie Moore hat im Australien-Pavillon Stammbäume der Aborigines, denen er angehört, entworfen und wurde dafür mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet.
Feine Ironie. Auch vor ein paar Jahren, bei seinem Auftritt im Kunsthaus Bregenz, hat Wael Shawky mit den Kreuzzügen historische Fakten und die Mittel der Fiktion thematisiert. Im Ägypten-Pavillon zeigt er nun mit „Drama 1882“ einen Musiktheaterfilm rund um den Urabi-Aufstand gegen die britische Herrschaft im Land. Videoarbeiten zu Themen wie Klimakrise und koloniale Vergangenheit, die der Brite John Akomfrah zuletzt in der Schirn-Halle in Frankfurt präsentierte, erfahren in Venedig durch die Hinzufügung der Sounds und Unterwasserperspektiven quasi eine Vervielfältigung. Wir lassen die Kraft der faszinierenden Arbeiten im Großbritannien-Pavillon auf uns wirken. Der Schweizer Pavillon bietet Ähnliches. Dort vereint Guerreiro do Divino Amor alle Eidgenossen-Klischees in einer von feiner Ironie durchzogenen Videoarbeit. Auch jener westliche Chauvinismus wird unterstrichen, gegen den die Biennale mit zahlreichen Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlerin aus Lateinamerika, Afrika oder Neu-
Tief berührend. Im Polen-Pavillon begegnet das Publikum geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern.


Prämiert. Ein Künstlerinnen-Kollektiv mit Maori-Frauen schuf diese ausgezeichnete Installation.
seeland antritt. Von dort kommen die Künstlerinnen des Mataaho Collective, die für ihre Installation Maori-Flechttechniken verwenden und ebenso mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurden.
Die Mitglieder des Mahku-Kollektivs, die dem Amazonas-Volk der Huni Kuin angehören, haben die Fassade des zentralen Pavillons bemalt. Die bunten Tier- und Pflanzenmotive, denen oft zu begegnen ist, fordern dazu auf, Bewertungsmechanismen zu hinterfragen. Identität und Zugehörigkeit fokussiert die Malerin Moufouli Bello in ihren leuchtend blauen Frauenporträts im Pavillon des erstmals vertretenen Landes Benin neben den Plastiken aus Benzinkanistern von Romuald Hazoumè, der auch das Thema Sklaverei behandelt.
Kriegsgeräusche. Die Künstlerin Ruth Patir hat gemeinsam mit ihren Kuratorinnen beschlossen, den Israel-Pavillon erst zu öffnen, wenn ein Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln erreicht ist. Nach dem Regierungswechsel in Polen wurde auch die Neuausrichtung des Pavillons beschlossen. Die Open Group aus Lemberg hat sich mit geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern zusammengetan, die Kriegsgeräusche imitieren, die die Besucher nachmachen sollten. Niemand ist dazu in der Lage, die Videoarbeit geht unter die Haut. Christa Dietrich
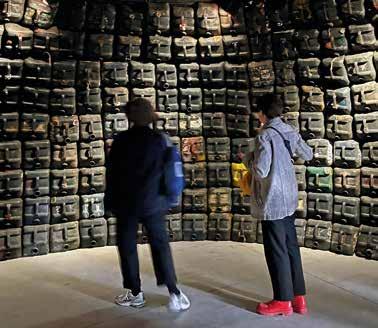
Stranieri Ovunque. Installation von Romuald Hazoumè aus Benin und von Claire Fontaine mit dem Schriftzug, der zum Motto wurde.




Wir servieren Ihnen Lebensfreude in Vorarlberg und im Bodenseeraum. Unsere Professionalität und unser Einsatz machen Ihre Veranstaltung zum vollen Erfolg.
EINTRETEN, STAUNEN, GENIESSEN
Wir bieten Räume für Begegnungen in Locations mit Stil, zeitloser Eleganz und mitreißender Unterhaltung.
Ob in der Otten GRAVOUR, dem KASCHMIR Club Bar oder dem gräflichen PALAST in Hohenems. Dem FREUDENHAUS in Lustenau oder auf der außergewöhnlichsten Eventlocation im Bodenseeraum, der


SONNENKÖNIGIN. Wir verwöhnen unsere Gäste mit perfektem Service, der Lebensfreude entfacht, in sorgfältig inszenierten Kulissen, umgeben von erlesenen Speisen.
Information und Buchung: MO Catering GmbH Schwefelbadstraße 2 6845 Hohenems office@mo-catering.com www.mo-catering.com


WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Sie haben die Strategien und Ideen für nachhaltiges Wachstum. Wir unterstützen Sie zuverlässig bei der Umsetzung und finden gemeinsam Lösungen, die Ihr Unternehmen weiterbringen.
Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels, Salzburg und St. Gallen (CH). www.hypovbg.at