Lesen Sie mehr unter www.landundgemeinde.info
Gemeinde der Zukunft
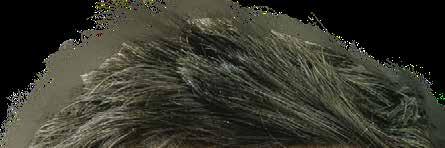
Dr.in Karoline Mitterer
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Wie geht es unseren Gemeinden finanziell?
Seite 04
DI Dr. Roman Neunteufel Die Herausforderungen hinter dem Wasserhahn
Seite 14

Wie bereiten Sie Ihre Gemeinde heute auf morgen vor?
Mag. Wolfgang Oberascher von KDZ über Digitalisierung als Lösung für Gemeindeherausforderungen in Österreich
Seite 06

Europas modernster Recyclinghof in Tirol
Innovativer Bürgerservice dank Digitalisierung + 24/7 autonome Abgabe von Wertstoffen + Viele Vorteile für Bürger:innen und Gemeinde

Artikel online lesen wiegon.at/gemeinde
IN DIESER AUSGABE
VORWORT
Ing. Anton Glasmaier
Wasser- und Hitzemanagement in Gemeinden: Vorbereitung, Betonlösungen, Mikroklima, energieeffiziente Gebäude
VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT DIESER AUSGABE:

Project Manager: Wiktoria Bieniek
Business Developer: Paul Pirkelbauer, BA
Sales Direktor: Florian Rohm, BA
Lektorat: Sophie Müller, MA Layout: Daniela Fruhwirth
Managing Director: Bob Roemké Fotocredits wenn nicht anders angegeben bei Shutterstock.
Medieninhaber: Mediaplanet GmbH, Bösendorferstraße 4/23, 1010 Wien, ATU 64759844 · FN 322799f FG Wien Impressum: https://mediaplanet.com/at/impressum/ Distribution: Der Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Druck: Mediaprint Zeitungsdruckerei Ges.m.b.H. & Co.KG
Kontakt bei Mediaplanet: Tel: +43 676847785227
E-Mail: hello-austria@mediaplanet.com ET: 04.06.2024
Bleiben Sie in Kontakt:
Mediaplanet Austria
@mediaplanet.austria
@DerUnternehmensratgeber
Ort: Wiener Neustadt

Weninger
Städte und Gemeinden sind der Motor für Wirtschaft und Zukunft
In den urbanen Räumen Österreichs leben 6,4 Millionen Menschen. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich hier. Die Städte und Gemeinden in Österreich stellen daher nicht nur wesentliche Dienstleistungen, die die Menschen jeden Tag nützen, zur Verfügung, sondern sind auch wichtige Impulsgeberinnen für Innovationen in der Wirtschaft, beim Klima und im Bereich der dringend notwendigen Energie- und Mobilitätswende.
In Österreich gibt es bereits zehn Großstädte (ab 50.000 Einwohner:innen) und 13 Kleinstädte (ab 10.000 Einwohner:innen), die als Vorreiterinnen ein gemeinsames Ziel haben: Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 im Mobilitäts- und Energiebereich. Unterstützt werden die Städte dabei vom Klimaschutzministerium und dem Klima- und Energiefonds. Bei der Energie- und Mobilitätswende geht es vor allem um die Dekarbonisierung der Flotten, den Ausbau der Öffis und die Schaffung von Infrastruktur. Erreicht Österreich die Klimaziele nicht, drohen nach Berechnungen des österreichischen Rechnungshofes Strafzahlungen von etwa neun Milliarden Euro. Unsere Städte stehen aber auch im Personalbereich und in der Elementarpädagogik vor großen Herausforderungen: Es braucht ausreichend Betreuungsplätze, gut ausgebildetes Personal und faire Entlohnung. Zudem kommen Umlagen hinzu,
deren Höhe vom jeweiligen Bundesland abhängt. Aktuellsten Schätzungen des KDZZentrums für Verwaltungsforschung zufolge könnte heuer jede zweite Gemeinde eine Abgangsgemeinde sein.
Daher fordert der Österreichische Städtebund vehement, Städte und Gemeinden bei der Twin-Transformation (Klimawandel und Digitalisierung) und ihren aktuellen Herausforderungen mit den notwendigen – rechtlichen – Rahmenbedingungen und finanziellen Ressourcen im Sinne eines nachhaltigen Gemeindefinanzpaketes zu unterstützen. Unsere Forderungen werden wir auch an die nächste Bundesregierung adressieren!
Eine angenehme Lektüre wünscht Ihr Thomas Weninger, Generalsekretär Österreichischer Städtebund
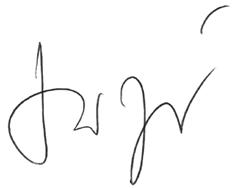
18.06.–19.06. 15. Österreichischer Vergaberechtstag
TRINK’WASSERTAG: „Bewusster Umgang mit Wasser“.
Schwierige Führungssituationen gelassen bewältigen Ort: Online www.weka-akademie.at/ schwierige-fuehrungssituationengelassen-bewaltigen/ 14.06.
Ort: österreichweit 12.09.
Bewerbungsgespräche professionell führen

17.09. Selbstmanagement für Führungskräfte
Ort: Hilton Vienna Plaza www.weka-akademie.at/ selbstmanagement-fuer-fuehrungskraefte/
17.09. Energieeffizienz im Gebäudemanagement
Ort: Online www.weka-akademie.at/energieeffizienzim-gebaeudemanagement/
Ort: Sans Souci Wien www.weka-akademie.at/bewerbung sgespraeche-professionell-fuehren/ 24.09. Mitarbeitergespräche professionell führen
02.10.
Bauverträge nach ÖNORM B 2110
Ort: Hilton Vienna Plaza www.weka-akademie.at/ bauvertraege-nach-oenorm-b2110/
14.11.
Erfolgreiche Führung im Generationenmix
Ort: Online www.weka-akademie.at/ erfolgreiche-fuehrung-im-generationenmix/
Ort: Hilton Vienna Plaza www.weka-akademie.at/mitarbeiter gesprache-professionell-fuhren/ 12.06. Spezialtag Nachhaltigkeitsrecht
Ort: DoubleTree by Hilton Schönbrunn | Wien www.imh.at/nachhaltigkeitsrecht
Ort: Hotel Bristol | Wien www.imh.at/vergaberechtstag
18.06.–19.06. Crashkurs ÖPNV
Ort: Wien www.imh.at/oepnv 04.11.–05.11. Wirkungsorientierte Revision im öffentlichen Sektor
Ort: Arcotel Wimberger | Wien www.imh.at/revision-oeffentlicher-sektor 11.11.–12.11.
Besteuerung der öffentlichen Hand
Ort: Arcotel Wimberger | Wien www.imh.at/besteuerung
Gemeinden als zentrale Schnittstelle für den neuen Einwegpfand
Mit dem 1. Jänner 2025 wird das österreichische Pfandsystem deutlich ausgeweitet. Was sich damit für Gemeinden und Bürger:innen ändert, erklären Alexandra Loidl und Ferdinand Koch von der VÖA-Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe.

Dr.in Alexandra Loidl
Vizepräsidentin VÖA

Dr. Ferdinand Koch
Geschäftsführer VÖA
FOTO:
@VÖA 2024
Was ändert sich mit dem Pfandsystem für PET-Flaschen und Dosen?
FOTO: @VÖA 2024
Alexandra Loidl: Diese Abfallmengen wurden bislang, je nach Gebiet, im gelben Sack oder in der gelben bzw. auch blauen Tonne getrennt gesammelt und fallen nun aus der Abfallsammlung heraus. Damit entsteht in den Sammelbehältern Platz – und den müssen wir für eine verstärkte Sammlung von Kunststoffverpackungen nutzen. Metall- und Plastikverpackungen werden zukünftig gemeinsam gesammelt und können in den Sortieranlagen effizient getrennt werden. Für die Gemeinden kann das bedeuten, dass man Abholintervalle anpassen muss. Diese Vereinfachung darf aber nicht den Eindruck erwecken, dass es egal sei – und man letztlich gar nichts getrennt sammeln muss. Um die Bemühungen der letzten Jahre und Jahrzehnte nicht zunichtezumachen, ist es wichtig, dass Gemeinden die Hintergründe solcher Systemumstellungen sowie anstehende Änderungen frühzeitig und umfassend kommunizieren. Nur so lässt sich die Bereitschaft für Müllsammlung und -trennung hochhalten und gegebenenfalls weiter ausbauen.
Ferdinand Koch: Die Gemeinden bedienen sich ja oftmals eigener Gesellschaften oder gemeindeübergreifender Abfallwirtschaftsverbände: Diese kümmern sich
um die praktische abfallwirtschaftliche Umsetzung und halten dafür Verträge mit Sammel- und Verwertungssystemen. Mit der Einführung des Einwegpfands kommt nun eine weitere Akteurin, die Einwegpfandgesellschaft, hinzu. Für die Bürger:innen sind aber immer die Gemeinde und deren Gesellschaft die zentrale Anlaufstelle, wenn etwas nicht funktioniert. Sie stehen an der Schnittstelle zwischen den Bürger:innen und den Sammel- und Verwertungsorganisationen sowie dem Pfandsystem. Diese Schnittstelle gut zu managen ist eine zentrale Aufgabe der Gemeinden. Das bedeutet: Top-Service für die Bürger:innen zur Verfügung zu stellen und sie gleichzeitig entsprechend zu informieren und motivieren, um eine möglichst effiziente Abfallsammlung zu ermöglichen. Diese emotionale Komponente wird dabei oft übersehen.
Mit der Textilstrategie der EU sind weitere Änderungen absehbar. Was kommt hier auf die Gemeinden zu?
Alexandra Loidl: Nicht zuletzt durch Fast Fashion fallen bei Textilien große Abfallmengen an. Aktuell fokussiert sich die Sammlung noch sehr stark auf Altkleider. Zukünftig sollen aber alle Textilien im Haushalt getrennt gesammelt werden. Hersteller:innen werden, wie bereits für Verpackungen, auch für diese Produkte verantwortlich sein. Die Aufgabe der Gemeinden wird darin bestehen, einheitliche Sammelstrategien zu entwickeln. Hier sollen auch sozialwirtschaftliche Betriebe mit ihren etablierten Sammel- und Vertriebssystemen mit ins Boot geholt werden. Als VÖA werden wir die Abfallwirtschaftsbetriebe der Gemeinden natürlich auch bei dieser Frage bestmöglich unterstützen.
Text Werner Sturmberger
EXPERTISE


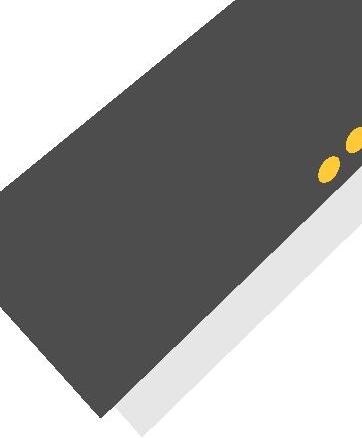

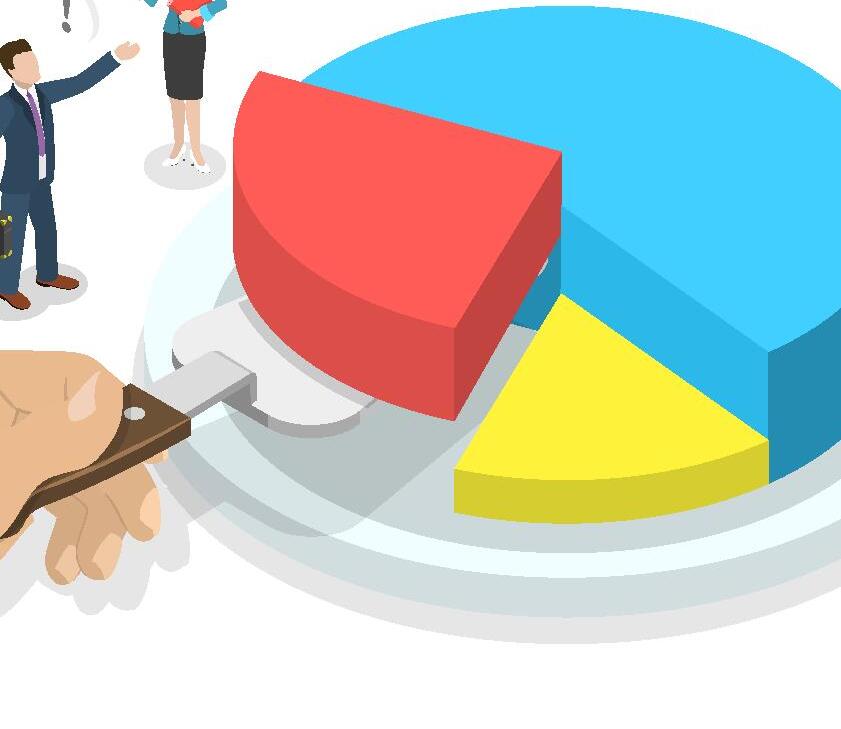



Zwischen Anspruch und Wirklichkeit:
Wie geht es den Gemeinden?

Dr. in Karoline
Mitterer
Expertin für öffentliche Finanzen und Föderalismus beim KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung
Seit 2024 gibt es einen neuen Finanzausgleich, der den Steuerkuchen auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt. Doch bereits kurz nach Abschluss scheint vielen Gemeinden das Geld auszugehen. Gemäß einer aktuellen Prognose des KDZ könnte heuer trotz neuer Mittel aus dem Finanzausgleich jede zweite Gemeinde eine Abgangsgemeinde sein. Diese Gemeinden haben also nicht genug Einnahmen, um ihre laufenden Ausgaben zu decken –und sind daher auf Finanzhilfen angewiesen. Wichtige Investitionen, etwa in die Elementarpädagogik oder den Klimaschutz, müssen nach hinten verschoben werden. Seitens des Bundes wird gerne kommuniziert, dass im Rahmen des neuen Finanzausgleichs zusätzliches Geld für die Gemeinden zur Verfügung gestellt wurde. Doch dabei darf nicht vergessen werden, dass deren Einnahmen durch die Steuerreformen der letzten Jahre weit weniger stark gestiegen sind als die Ausgaben der öffentlichen Hand. Was die Bürger:innen aufgrund der geringeren Steuerbelastung freut, stellt die öffentliche Hand also vor große Herausforderungen, da eine Gegenfinanzierung fehlt.
Teuerung und Energiekrise: Reformbedarf der Gemeindefinanzen steigt 2023 gingen die Einnahmen der Gemeinden aus dem allgemeinen Steuertopf sogar zurück, während die Ausgaben aufgrund der Teuerung und der Energiekrise stark anstiegen. Die seitdem aufgegangene Einnahmen-Ausgaben-Schere lässt sich ohne Hilfe von Bund und Ländern nicht mehr schließen. Der Ruf der Gemeindeebene nach zusätzlichen Mitteln sowie Reformen zur Stärkung der Gemeindefinanzen ist daher nachvollziehbar.
Der Reformbedarf ist ohnehin längst bekannt: So finanzieren die Gemeinden die aufgrund der Demografie stark steigenden Ausgaben der Länder für Gesundheit und Soziales mit. Damit verbleiben ihnen immer weniger Mittel für die eigentlichen kommunalen Aufgaben. Auch die Grundsteuerreform wartet auf Umsetzung.
Die Gemeinden stehen daher vor großen Herausforderungen. Sollten sich ihre Rahmenbedingungen nicht verbessern, stehen auch einzelne Leistungen der Gemeinden auf dem Prüfstand. Für das Beispiel der Kinderbetreuung könnte dies eingeschränkte Öffnungszeiten oder gar geschlossene
Gruppen bedeuten. Dies wäre ein Rückschritt, da viele Gemeinden die Kinderbetreuungsangebote bisher kontinuierlich ausgebaut haben. Auch im neuen Finanzausgleich wurden explizit Mittel für die Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt, um die Angebote zu erweitern. Ob sich das jedoch ausgehen wird, wird die Zukunft zeigen.
Lebensräume von morgen: Stärkung durch Nachhaltigkeits-, Klima- und Mobilitätsmaßnahmen Ein weiteres wichtiges Thema ist der Klimaschutz sowie die Klimawandelanpassung. Städte und Gemeinden können hier einen wichtigen Beitrag leisten, sofern sie ausreichend finanzielle Spielräume haben. Zu nennen sind etwa die thermische Sanierung von öffentlichen Gebäuden, Photovoltaikanlagen oder die Bereitstellung besserer Angebote bei Radwegen oder im öffentlichen Verkehr. Gemeinden passen weiters den öffentlichen Raum an die steigende Zahl der Hitzetage und die häufigeren Unwetterkatastrophen an, etwa durch Begrünungen in Ortszentren oder Entsiegelung.
Eine Stärkung der Gemeinden mit besseren Rahmenbedingungen ist wichtig, denn sie spielen eine zentrale Rolle in der Gestaltung der Lebensräume von morgen. Dies betrifft etwa die Kinderbetreuung, Schulen, Mobilität, Ver- und Entsorgung oder die gerechte Verteilung des öffentlichen Raums. Gemeinden können hier viel bewegen und sind bereit dazu, was sich in zahlreichen Initiativen zeigt. Diese Innovationskraft sollte daher weiter gestärkt werden.
Entgeltliche Einschaltung
Puchegger – Radarkabinen seit 1983
Für Gemeinden ist es seit Kurzem deutlich einfacher geworden, eigene Radargeräte aufzustellen, um die Verkehrssicherheit vor Schulen, in 30er-Zonen oder an Unfallschwerpunkten zu erhöhen. Und wo kommt das Radar hinein? In eine Box von Puchegger!
Ebenso wie Menschen, die rund um die Uhr im Freien arbeiten – im Sommer wie Winter, bei Regen, Streusalz, Hitze, Hagel oder Wind –, muss auch eine Radarbox richtig robust sein. Doch das allein reicht nicht aus, weiß man im Familienbetrieb Puchegger in Niederösterreich. Neben der Robustheit und Langlebigkeit sollte eine hochwertige Radarkabine auch einfach in der Handhabung sein. Das bedeutet: einfache Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten, problemlose Einstellmöglichkeiten für die Geräte und darüber hinaus leichte Transportierbarkeit.
Die Herstellung einer Radarkabine erfordert Fachwissen und

Präzision, wobei jede Komponente mit höchster Genauigkeit gefertigt wird, um sicherzustellen, dass sie den hohen Anforderungen der modernen Verkehrsüberwachung gerecht wird. Alle Kabinen von Puchegger sind außerdem made in Austria. Von der großen Stationärbox über die Mini Kabine bis hin zur tragbaren Multa Box ist für jede Anwendung die richtige Größe dabei. Und wie es sich für eine Manufaktur gehört, sind auch Sonderwünsche kein Problem – obwohl die Schutzkabinen standardmäßig schon für Geschwindigkeitsmessanlagen unterschiedlichster Hersteller:innen geeignet sind. Über die Montage der Radarkabine hinaus bietet Puchegger ebenso umfangreichen Support.
Des Weiteren gibt es bei uns auch Kabinenattrappen. Hinweise darauf finden Sie auf unserer Homepage www.pucheggerradarbox.com unter „Produkte“ und dann „Radarkabine Attrappe“

Entgeltliche Einschaltung
Klimawandel führt zu mehr Felsstürzen und Muren
Was das für Gemeinden bedeutet und wie diese darauf reagieren können, erklärt GEODATA-Eigentümer und Geschäftsführer Alexander Radinger.

Warum wird das Thema Naturgefahren für Gemeinden immer wichtiger?
Gerade im alpinen Österreich wirken sich Temperaturanstieg und die Zunahme von Extremwetterereignissen massiv auf Gemeinden aus. Abtauender Permafrost, verstärkt durch Starkregenereignisse, führt zu vermehrter Instabilität und damit zu mehr Felsstürzen und Murenabgängen. Die Gemeinden sind für die Sicherheit in diesen Lebensräumen verantwortlich. Ein Ansatz dafür sind unsere technischen Monitoring Lösungen, die wir an unserem Hauptsitz in Leoben produzieren.
Wie kann Sensorik dabei helfen die Risiken dieser Naturgefahren zu mindern?
Zur Überwachung von Felswänden und Steinschlagnetzen bieten wir Sensoren, um die Entwicklung von Rissen, Klüften und Spalten bzw.
Steinschlagaktivität überwachen zu können. Steinschlagnetze können mit dem GEODATA ARGOS Net Sensor automatisiert überwacht und bei einem Felssturz rasch bereinigt oder wiederhergestellt werden. Auch Murgang Sensoren können vollautomatisiert in ein Datenerfassungssystem integriert und mit Notfallmaßnahmen – wie der Sperre einer Straße per Ampelschaltung oder der Alarmierung der Einsatzkräfte – verknüpft werden. Als österreichisches Unternehmen verstehen wir uns als Anbieter von Gesamtlösungen. Von der Beratung über die individuelle Herstellung der passenden Sensorik, bis zur Installation der Geräte und der Beurteilung der Daten durch unser Fachpersonal, liefern wir alles aus einer Hand. Damit unterstützen wir Gemeinden und Bürgermeister bei der Bewältigung von Naturgefahren.
Werden Sie Teil von GEODATA!
Wir suchen laufend qualifizierte Mitarbeiter/innen zur Verstärkung unseres Teams! Mehr dazu auf unserer Homepage


Für mehr Job-Infos scannen Sie den QR-Code


Die digitale Gemeinde –besser heute als morgen!

Gemeindearbeit ist oft ein kreativer Drahtseilakt – das einbeinige Balancieren auf einer Slackline bei gleichzeitigem Jonglieren, würden Gemeinde-Mitarbeiter:innen sicher bestätigen. Die Aufgaben sind umfangreich: rechtsstaatliche Behördenagenden wie Baubewilligungen, umfassende und professionelle Betreuung der Bürger:innen auf Augenhöhe in allen Lebenslagen, Kulturveranstaltungen, Freibad, geräumte Straßen rund um die Uhr, Gebühren einheben, und, und, und. Hinzu kommt, dass sich die finanzielle Situation für Gemeinden in den vergangenen Jahren merklich verschärft hat – Entlastung eher nicht in baldiger Sicht. Und als wäre das nicht genug, befindet sich unsere Gesellschaft im Wandel: Alles sollte am besten sofort erfolgen, der hohe Kommunikationsbedarf ist allgegenwärtig. In dieser herausfordernden Zeit müssen sich Gemeinden anpassen, indem sie zusehends auf Digitalität setzen. Doch hier lauert der „Stolperstein“ Digitalisierung, der auch privatwirtschaftliche Unternehmen betrifft. Peter Drucker, Ökonom und Managementguru des letzten Jahrhunderts, formulierte spitzfindig: „Die größte Gefahr in Zeiten des Umbruchs ist nicht der Umbruch selbst, es ist das Handeln mit der Logik von gestern.“
Moderne Technik, New Work und KI als Grundbausteine für erfolgreiche Digitalisierung Für Österreichs Gemeinden heißt das, Digitalisierung bewusst und kritisch in Bezug zur Gegenwart zu reflektieren. Sie ist mehr, als vielerorts kolportiert und bedeutet nicht, Akten digital zu speichern oder Mails auszudrucken, um sie
mit Poststempel wieder einzuscannen. Digitalisierung setzt digital funktionierende Arbeit voraus: elektronische Aktenverwaltung, digitale Workflows, beispielsweise bei Genehmigungsabläufen, etc. Konkret heißt das, jetzt proaktiv die erforderlichen Grundlagen zu schaffen, und nicht auf wundersames Auflösen der Probleme oder Zufliegen einer Anleitung zu warten: Moderne Technik, eine zeitgemäße Arbeitsumwelt für Mitarbeiter:innen, zum Beispiel mit Homeoffice, und flexibles Arbeiten sind erst der Anfang. Es müssen die Gemeindeverwaltung geöffnet, digitale Kommunikationsmöglichkeiten ausgebaut und Partizipation ermöglicht werden. Und schließlich müssen die sich stetig weiterentwickelnden Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) und der Automation genützt werden – beides jedoch nicht als Ersatz, sondern vielmehr als zusätzliche Unterstützung, die den Mitarbeiter:innen der Gemeinden Zeitressourcen freispielt. Einzelne Arbeitsschritte werden abgenommen oder eine datenbasierte Entscheidungsfindung wird vorbereitet. KI-gestützte Tools werden zukünftig Einreichpläne auf die gesetzmäßige Übereinstimmung mit Normen prüfen können, Vorschläge für Stadtentwicklungs-
konzepte auf Basis von realen Entwicklungen liefern, Tourenpläne für die Müllabfuhr auf Basis des Auslastungsgrades von Abfallbehältern erstellen oder Gebäude auf Basis äußerer Einflüsse autonom steuern. Generell wird KI einen umfassenden Wissensschatz der Gemeinde managen: Sie wird relevante Informationen für Mitarbeiter:innen oder Bürger:innen zusammentragen und bedarfsgerecht bereitstellen; das heißt, die Strukturierung des Wissens und der Zugang zu ihm werden im Fokus liegen. All dies sind einzelne Möglichkeiten zur digitalen Gemeinde – die individuelle Umsetzung liegt an jeder Gemeinde selbst. Best Practices, erfolgreiche Beispiele und Pilotprojekte helfen dabei. Durch die schnelle Weiterentwicklung von KI müssen sich jedenfalls alle Gemeinden intensiv mit Digitalisierung und Co. beschäftigen, um am Puls der Zeit zu bleiben.
Entgeltliche Einschaltung

Ein neues System mit Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtert die Organisation von Sitzungen in kommunalen Verwaltungen.
Wer schreibt schon gerne Protokolle für Sitzungen oder Meetings? Richtig, niemand. Das Schreiben von Protokollen kostet Zeit, ist anstrengend und muss oft zusätzlich zur täglichen Verwaltungsarbeit in der Gemeinde erledigt werden. Die Digitalisierung erleichtert uns diesen Teil der Gemeindearbeit und verbessert ihn sogar. Mit PLENUM wird es einfacher.
Gemeinderatssitzungen sind
HARDWARE
Entgeltliche Einschaltung
wichtig für demokratische Entscheidungen vor Ort.
Sitzungsprotokolle sind die Basis für alle weiteren Schritte, die in der Gemeinde unternommen werden. Mit dem Einsatz digitaler Technologien wie Künstlicher Intelligenz kann dieser Prozess erheblich unterstützt werden, sodass Schriftführer:innen, Amtsleiter:innen und weitere Beteiligte erheblich entlastet werden. Es bleibt damit mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche zu
Modular erweiterbar für jede Anwendung
konzentrieren: die Gestaltung der Zukunft der Gemeinde. Genau das ist PLENUM – eine innovative Lösung, die unter anderem die Erstellung der Protokolle durch KI-Unterstützung revolutioniert. Gemeinden nehmen ihre Sitzungen in Bild oder Ton auf; der Rest wird von der digitalen Lösung erledigt. Das Ergebnis ist ein strukturiertes, automatisches Wortprotokoll, wo bereits der Großteil der Tipparbeit erledigt worden ist und zur Kontrolle bereitsteht. Das finale Sitzungsprotokoll ist so gut wie fertig.
Durch die Genauigkeit und schnellere Verfügbarkeit der KIgestützten Protokolle wird die Arbeit zeiteffizienter, was unter anderem Beschlüsse schneller voranbringt. Die Gemeindearbeit wird damit attraktiver und ist am Puls der Zeit. Mehr Informationen zu PLENUM, der einfachsten Lösung zur Sitzungsarbeit in Gemeinden erhalten Sie unter sitzungsmanagement-software.ai
Smartes Parken mit Verstand und grünem Daumen
Die Stadt der Zukunft benötigt intelligentes Parkmanagement: JJames liefert die entsprechenden Lösungen.
Städte ganz ohne Autoverkehr – dies ist nach wie vor eine utopische Vorstellung. Denn auch in Zukunft werden sich im urbanen Raum Menschen mit Autos fortbewegen (müssen). Anstatt sie also komplett zu verbieten, ist eine Reduktion des Verkehrsaufkommens in der Stadt bei besserer Nutzung vorhandener Ressourcen sinnvoller.
JJames, der Spezialist für optimierte Parkraumbewirtschaftung aus Linz, bietet für dieses Problem eine durchdachte Lösung: die holistische Plattform ermöglicht mit Hardware- und Software vor allem umweltbewussten Städten und tourismusintensiven Gemeinden ein intelligentes Parkmanagement, das sich auf digitale Verkehrsleitsysteme und automatisierte Parkabwicklung stützt. Apropos Digitalisierung: Die
wartungsfreien multifunktionalen Payment-Terminals funktionieren ohne Ticket durch automatisierte Kennzeichenerkennung, Zahlungsabwicklung und Parkraumüberwachung. Auf den großen 32“ Touch-Screens können auch CityInfo, Digital Signage und Werbung laufen, sowie Umwelt-Messdaten übermittelt werden.
JJames schafft es, Parkflächen für alle Beteiligten komfortabler und effizienter zu nutzen – Autofahrer: innen navigieren zum nächsten freien Parkplatz im Zielgebiet: Dadurch wird der innerstädtische Verkehr um bis zu 30 % reduziert. Azyklisch genutzte Parkflächen (z. B. Supermärkte, Stadien, Büros, …) werden durch effiziente Park-Sharing-Modelle besser genutzt – dadurch sind bis zu 50 % weniger Oberflächenparkflächen erforderlich.

Das stoppt voranschreitende Bodenversiegelung und schafft mehr Platz für Begrünung und Begegnungszonen. Verkehrsberuhigte Zonen („ZTL“) werden Datenschutz-konform umgesetzt.
So werden nicht nur Autofahrer:innen JJames danken, weil sich ihre Lebensqualität – und jene aller Bewohner:innen in den Städten – verbessert, sondern auch die Umwelt.
Sollte es für ein neues Parkmanagement- und Verkehrsleitsystem kein Budget geben, so kann JJames mit einem Contracting-Modell einspringen: JJames investiert und betreibt das Parkmanagement. JJames finanziert sich über die Einsparungen durch die Digitalisierung. Die Einnahmen verbleiben bei der Stadt.

Nahversorgung im Ort stärken, Lebensqualität erhöhen
Verkehrsberuhigung erhöht nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern stärkt auch Einzelhandel und Nahversorgung im Ort.

FOTO: VCÖ / RITA NEWMAN
neue Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister:innen, 40 neue Arbeitsplätze, Zuzug ins Zentrum: Was sich österreichweit jede Gemeinde und Stadt wünscht, ist Hohenems gelungen. Wie? Durch Reduktion des Kfz-Verkehrs im Zentrum. Die Vorarlberger Stadt mit ihren rund 18.000 Einwohner:innen hat im Jahr 2014 unter Einbeziehung der Bürger:innen ein Konzept zur Belebung der Innenstadt entwickelt. Im Zentrum wurde eine große Begegnungszone umgesetzt, wodurch der Autoverkehr im Vergleich zum Jahr 2012 um 75 % verringert werden konnte. Auf den Gemeindestraßen gilt flächendeckend Tempo 30 oder weniger. Der Radverkehrsanteil ist auf 25 % gestiegen.
Begegnungszone für soziales Miteinander und lokale Wirtschaft Das heißt, in der Begegnungszone wird die Straße wieder zum sozialen Ort. Insbesondere in der wärmeren Jahreszeit treffen sich die Anwohner:innen für einen Plausch vor dem Haus und die Kinder haben mehr Platz zum Spielen. Und auch die lokale Wirtschaft profitiert: „Seit der Umsetzung der Begegnungszone 2018 kommen viel mehr Kundinnen und Kunden“, berichtet eine Geschäftsfrau. Hohenems zeigt, dass die Verkehrsplanung ein zentraler Hebel ist, um Orte zu beleben und zu stärken. Wer Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt, fährt nicht
fort, sondern bleibt im Ort. Und wo viele Alltagswege zu Fuß gegangen werden, plaudern die Menschen mehr miteinander. Mehr Leben zieht wiederum mehr Menschen an, macht Gemeinden und Städte für Familien mit Kindern als Wohnort attraktiver.
Klimaverträgliche Mobilität fördern mit Radwegen und Co. Die Gemeinden und Städte sind dabei nicht von anderen abhängig, sondern können sich selbst stärken, indem sie eine Verkehrsplanung umsetzen, die das
Göfis wiederum gibt es dort, wo früher ein Pkw-Parkplatz war, ein belebtes Ortszentrum mit Sitzflächen, Café und einer Bühne für kulturelle Veranstaltungen.
Die Gartenstadt Tulln macht ihrem Namen alle Ehre und errichtet auf einem ehemaligen Parkplatz, der Platz für 200 Pkw bot, einen Park. Die Bevölkerung wurde hier miteinbezogen und hat sich in einer Befragung mit großer Mehrheit für jenes Konzept entschieden, bei dem die größte Anzahl an PkwAbstellplätzen durch Grünflächen ersetzt werden.
Gehen und Radfahren forciert. In Niederösterreich zeigt das unter anderem Wr. Neudorf: Die südlich von Wien gelegene Marktgemeinde hat im Vorjahr den VCÖ-Mobilitätspreis Österreich gewonnen. In Wr. Neudorf wurde in den vergangenen Jahren die Radinfrastruktur stark verbessert, außerdem wurde mehr Platz zum Gehen geschaffen. Zudem wurde auf der stark befahrenen B17, die durch den Ort geht, ein Fahrstreifen entsiegelt und begrünt.
Im 3.600-Einwohner:innen-Ort
Das Potenzial, österreichische Orte durch die Förderung von Zu-Fuß-Gehen und Radfahren zu beleben, ist groß. Die Mobilitätserhebungen zeigen, dass auch in kleineren Gemeinden jeder fünfte Alltagsweg in Gehdistanz liegt. Die Hälfte der Alltagswege ist kürzer als fünf Kilometer, eine Distanz, die gut mit dem Fahrrad gefahren werden kann.
Gemeinden und Städte, die im Ort gute Bedingungen zum Radfahren schaffen, werden von der Bevölkerung mit mehr Radverkehr belohnt. Und mit dieser klimaverträglichen Mobilität die Lebensqualität im Ort erhöhen und die Nahversorgung stärken – ja, das geht sehr gut.
Weitere Beispiele von Gemeinden und Städten sind in der Online-Datenbank des VCÖ auf www.vcoe.at öffentlich zugänglich.
Entgeltliche Einschaltung

Postbus Shuttle: Frischer Wind auf der ersten und letzten Meile
Mit der Mobilitätswende gewinnt der öffentliche Nahverkehr stetig an Bedeutung. Das Postbus Shuttle macht es Gemeinden einfach, bei dieser Entwicklung mit dabei zu sein.
Nicht nur im städtischen, sondern auch im ländlichen Raum besteht immer mehr der Wunsch nach öffentlichen Verkehrsmitteln – fehlende Verbindungen und Anschlüsse an bereits vorhandene Bus- und Bahnverbindungen stehen der Nutzung aber oftmals im Wege. Um diese Versorgungslücken mit einem individuellen Mobilitätsservice zu schließen, wurde das Postbus Shuttle mit durchdachtem Haltepunktesystems eingeführt. Es ist innerhalb von maximal 300 Metern ab der eigenen Haustür erreichbar – und Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, starten komplett barrierefrei direkt von zuhause. Die Haltepunkte erlauben es, Fahrten zu bündeln und Einzelfahrten zu vermeiden – Gemeinden können so clevere Mobilitätslösungen zu attraktiven Preisen anbieten. Damit lassen sich die Vorzüge individueller Mobilität unter Berücksichtigung vorhandener öffentlicher Verkehrsmittel effizient umsetzen, um einen lückenlosen Zugang zu Arbeit, Bildung und Freizeitaktivitäten sicherzustellen. Gebucht wird das Shuttle ganz einfach per App: Startpunkt und Reiseziel sowie die gewünschte Abfahrtszeit eingeben und Fahrt buchen – fertig!
Das Plus an Mobilität und Lebensqualität

Das klingt nicht nur in der Theorie gut, sondern ist auch praxistauglich: In fünf Bundesländern ist das Postbus Shuttle bereits erfolgreich im Einsatz, damit steht es aktuell mehr als 200.000 Bürger:innen in

über 70 Gemeinden zur Verfügung. Seit 2021 wurden mehr als 105.000 Fahrten absolviert, Tendenz weiter steigend, denn das Postbus Shuttle steht für alltagstaugliche und barrierefreie Mobilität – nicht nur für diejenigen, die sich kein eigenes Auto leisten können oder wollen. Auch ältere Personen, die nicht mehr selbständig mobil sein können, profitieren von der On-Demand-Mobilität. Für sie ist das Postbus Shuttle das Ticket zur Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in ihrer Heimat- sowie Nachbargemeinde.
Die Gemeinden leisten damit nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Wohlergehen ihrer Bürger:innen, sondern auch zur Lebendigkeit der Gemeinde als Ganzes: Das Postbus Shuttle stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe, nicht nur, weil es mit lokalen Verkehrsunternehmen kooperiert, sondern auch, weil die gesamte lokale Wirtschaft – Freizeitangebote und Gastronomie beispielsweise – von diesem Plus an Mobilität profitiert. Gemeinden und Regionen werden so auch für Tourist:innen, die auf
das Auto verzichten wollen, attraktiv: Die Gäst:innen kommen, aber der Verkehr bleibt zuhause. Das Postbus Shuttle reduziert so das (über)regionale Verkehrsaufkommen, was weniger Umweltbelastung und mehr Lebensqualität in den Gemeinden bedeutet. Einen Teil zur Mobilitätswende beizutragen ist somit denkbar einfach: In enger Zusammenarbeit mit Gemeinden und Regionen entwickeln ÖBB-Postbus und das Postbus-Shuttle-Team maßgeschneiderte Angebote – einfach anrufen und durchstarten.

Wasser und Hitze vorbauen
Der Klimawandel und damit zusammenhängend immer häufigere Extremwetterereignisse stellen Österreichs Gemeinden vor große Aufgaben. Dazu zählt, für Starkregenereignisse und lange niederschlagsfreie Perioden vorzusorgen, Hitzeinseln zu vermeiden und die Energieeffizienz von Gebäuden zu stärken.

Anton Glasmaier
Geschäftsführer des VÖB (Verband der österreichischen Beton- und Fertigteilwerke)
Betonfertigteile für Be- und Entwässerung Gemeinden, die den Wasserhaushalt zu einem zentralen Baustein in ihren Planungsprozessen machen, sind besser auf Wetterextreme vorbereitet. Das Ziel guter Klimawandelanpassung ist es, Wasser vor Ort zu halten und versickern zu lassen, um zur Grundwasserneubildung beizutragen und dieses als Brauchwasser zur Bewässerung von Gärten oder Gründächern zu verwenden. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel, ging es doch viele Jahre darum, Regenwasser möglichst rasch abzuleiten. Heute ist es notwendig, die großen Wassermengen, die sich in kürzester Zeit ansammeln, gedrosselt in die Kanalisation abzugeben, um die regionalen Kanalnetze nicht zu überlasten. Dafür eignen sich Regenrückhaltebecken aus Betonfertigteilen, die Regenwasser zwischenspeichern. Sickertunnel aus Beton können bei großen Parkflächen mit Betonsteinpflasterung und sickerfähiger Fuge ebenfalls als Puffer und Regenwasserspeicher
dienen. Im besten Fall wird das gesammelte Wasser wieder an die Oberfläche zurückgeleitet, um durch natürliche Verdunstung im Sommer einen kühlenden Effekt für die Umgebung zu schaffen.
Besseres Mikroklima durch innovative Oberflächen Kühlung ist vor allem während langer Trockenperioden und an Hitzetagen gefragt. Platzgestaltungen durch Betonpflastersteine und -platten mit heller Oberfläche helfen, die Temperaturen im Vergleich zu Optionen mit dunklen Oberflächen deutlich angenehmer zu halten. Zusätzlich bietet die Betonsteinverlegung mit wasserdurchlässiger Fuge die Möglichkeit, Plätze nach dem Schwammstadtprinzip zu gestalten. Das Regenwasser wird dabei direkt zu den Schatten spendenden Bäumen auf dem Platz geführt und hilft ihnen beim Anwachsen. Durch den Schatten der Bäume bleiben wiederum die Temperaturen auf den Plätzen angenehm und die Aufenthaltsqualität steigt.
Energieeffiziente Gebäude
Beim Neubau von öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten, Schulen, Gemeindeämtern oder Altersheimen bieten Betonfertigteile durch die thermische Bauteilaktivierung riesige Vorteile gegenüber anderen Baustoffen. Heizen und Kühlen mit Beton ist durch die permanente Einbringung von nur wenig Energie über das ganze Jahr eine kostengünstige und auch fürs Klima sehr verträgliche Art, ein Gebäude zu betreiben. Ein Beispiel dafür ist der Bildungscampus in der Seestadt Aspern in Wien, der mit nur zwei Euro pro Quadratmeter an Heiz- und Kühlkosten pro Jahr punktet. Minimale Heizkosten fallen auch im Kultur- und Veranstaltungszentrum in der Salzburger Gemeinde Hallwang an. Die Sonne liefert die nötige Energie, die in Pufferspeichern und bauteilaktiviertem Beton gespeichert wird. Das preisgekrönte Gebäude zeigt, wie Klimaschutz, Klimawandelanpassung und nachhaltiges Bauen Hand in Hand gehen.
Entgeltliche Einschaltung
Kreislauf-Innovation in der Bauwirtschaft: Der Holcim Zement

Auf dem Weg zu Net Zero haben die Bauwirtschaft und der laufende Gebäudebetrieb den stärksten Einfluss auf die weltweit freigesetzten CO2Emissionen. Mit innovativen Baustoffen wie dem neuen Zement ECOPlanet RC kann der CO2-Fußabdruck beim Bauen aber deutlich gesenkt werden.
Aus Städten neue Städte bauen
Der Schlüssel zu einem kleineren CO2-Fußabdruck liegt in der Kreislaufwirtschaft: Werden aus Städten wieder Städte gebaut, dann werden Ressourcen geschont und weniger CO 2 freigesetzt. Holcim Österreich geht mit seiner jahrzehntelangen Expertise in der Kreislaufwirtschaft auf dem Weg zur nachhaltigen Zement- und Betonproduktion voran.
Der Holcim Zement ECOPlanet RC ist eine wegweisende Kreislauflösung für Baustoffe: Dieser Zement besteht zu über 25 % aus recycelten Baurestmaterialien.
Der Betonbruch wird im unternehmenseigenen Recyclingcenter aufbereitet, in der Rohmühle fein gemahlen und anschließend als Rohstoff in der Zementproduktion
eingesetzt. Zusätzlich bringt Holcim mit einem patentierten „RapidCarb”-Verfahren weiteres CO 2 in den gemahlenen Betonbruch ein. Das reduziert die Emissionen bei der Produktion und reduziert ebenso den Rohstoffverbrauch. Dank intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird heute mit weniger Energie- und Materialeinsatz die gleichbleibende Qualität von Baustoffen erreicht.
Internationaler Vorreiter Damit sind die österreichischen Holcim-Zementwerke mit ihren Produkten weltweit Vorreiter, das heißt, sie weisen einen der niedrigsten Werte beim CO2-Fußabdruck weltweit aus. Holcim bietet schon heute ein breites Portfolio an
Bauprodukten auf dem Niveau „Climate Mitigation Fit” an, das unter dem Label „ECOPlanet” am Markt erhältlich ist. Der ECOPlanet RC CEM II/C-M (S-F) 42,5 N ist bautechnisch zugelassen und kommt für klassische Hochbauanwendungen und Festigkeitsklassen zum Einsatz.
Der Bausektor spielt eine entscheidende Rolle beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Wir stellen uns den Herausforderungen einer nachhaltig gebauten Zukunft. Deshalb investieren wir laufend in die Entwicklung von Materialien und Lösungen, die natürliche Ressourcen schonen und Baukreisläufe schließen.”
Berthold Kren, CEO Holcim Central Europe
Lesen Sie mehr zum Thema Kreislaufwirtschaft www.holcim.at/

EXPERTISE
Nachhaltige Kommunen für eine gute Zukunft
Multiple Krisen, eine verunsicherte Gesellschaft – Unsere Kommunen müssen nun auf transformative Wege hin zur Nachhaltigkeit und deren Benefits setzen.
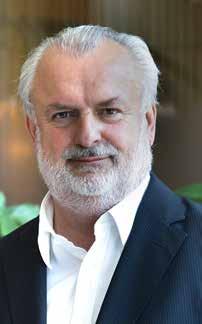
Hier kommt die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) ins Spiel. Ihre Kernkompetenz liegt in der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Quartieren, mit der sie weit in die Zukunft blickt, was für den langen Bestand unabdingbar ist.
Wichtig für eine nachhaltige kommunale Immobilienstrategie ist der Blick aufs große Ganze. Die Betrachtung einzelner Gebäude ist nicht zielführend – eine Quartiersbetrachtung hingegen schon. Außerdem müssen Gebäudeverbünde geschaffen werden, die füreinander Aufgaben übernehmen und die Bedürfnisse aller erfüllen.
Entgeltliche Einschaltung
Die Zukunft
der Kinderbetreuung: digital & vernetzt mit LITTLE BIRD
Nachhaltige Materialien und Kreislaufwirtschaft sind bei allen Bauvorhaben Pflicht. Die Erzeugung von regenerativer Energie ist ebenfalls Standard und quartiersmäßig erfolgsversprechend. Unterschiedlich genutzte Gebäude können die gemeinsam produzierte Energie viel besser verwenden und Kosten sparen.
Durch den Klimawandel ist nachhaltiges Wassermanagement auch bei uns wichtig geworden. Gerade bei Neubauten ist dies leicht umsetzbar. Grauwasser für Toilettenspülungen oder zur Grünflächenbewässerung sollte ebenso Pflicht sein wie Regenwasser-Sammeln für Trockenzeiten. Der soziale Aspekt der
LITTLE BIRD ist ein Unternehmen der österreichischen
Russmedia Gruppe mit Sitz in Schwarzach bei Bregenz
Die Digitalisierung im Rahmen des Verwaltungsreformgesetzes ist in Österreich wichtig bei der Modernisierung kommunaler Dienstleistungen. Wie dies funktionieren kann, zeigt die Kinderbetreuungs-Verwaltungssoftware der LITTLE BIRD GmbH, das schon in 500 deutschen Gemeinden/ Städten erfolgreich eingesetzt wird und auch in Österreich Effizienz zeigt. Verwaltung und Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen in Kindergärten und Co. sind ebenso komplex wie die Akteur:innen vielfältig: Eltern, Gemeinden, Träger:innen, Betreuungseinrichtungen. LITTLE BIRD bildet den gesamten Prozess digital ab: Anmeldung und Vergabe, Verwaltung,
Nachhaltigkeit ist für Kommunen ebenso wesentlich. Die Nutzung kommunaler Objekte unterstützt lokale Gemeinschaften. So kann dem Gasthaussterben entgegengewirkt werden, entstehen bewirtschaftete Treffpunkte und Raum für Initiativen, z. B. für „Reparaturcafés“, die die Kreislaufwirtschaft fördern.
Vor allem am Land ist auch Mobilität für ökologische und soziale Nachhaltigkeit wichtig: Hier gilt es, Allianzen in der Gemeinde und mit diversen Anbieter:innen zu bilden. Die Bemühungen zahlen sich aus, wie viele Best-Practice-Beispiele zeigen.

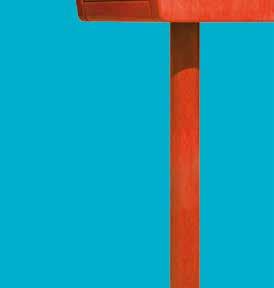
Kommunikation von Kinderbetreuung und Eltern. Dies steigert die Transparenz, Effizienz und Zufriedenheit aller. Entscheidend ist dabei die reibungslose Integration in bestehende, gängige Software, bei der Daten und Verträge übernommen werden, was die Akzeptanz der Lösung erhöht. Zusätzlich bietet LITTLE BIRD Schulungen und ein unterstützendes Team, das sich mit den gemeindlichen Prozessen auskennt.


Applikationsdaten.
Mit der KIKOM-App können Eltern ihr Kind krankmelden, Zustimmungen erteilen und Anwesenheitszeiten erfassen. Die neue E-Payment-Lösung bietet Abrechnung und Bezahlung von Mittagessen und kleineren Geldbeträgen.
Bei Datensicherheit und DSGVOKonformität setzt LITTLE BIRD auf regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen der Sicherheitsmaßnahmen und sicheres Hosting von
Durch die Optimierung der Prozesse profitieren nicht nur Gemeinden und Betreuungseinrichtungen, sondern vor allem Eltern und Kinder. LITTLE BIRD ist eine zukunftssichere Lösung zur Digitalisierung der Verwaltung von Kinderbetreuungsangeboten.
LITTLE BIRD
Vertrieb
Frank Tändler –Leiter Vertrieb vertrieb@little-bird.at www.little-bird.at
+43 (0) 5572949838
Russmedia Gruppe Gutenbergstraße 1 A –6858 Schwarzach
Entgeltliche Einschaltung
CONTAINEX PLUS Line –das PLUS an Innovation
Moderne und ansprechende Raumlösungen zu schaffen ist mit der CONTAINEX PLUS Line ganz leicht. Dank ihrer hochwertigen Ausstattungsvarianten und ihres attraktiven Designs – sowohl draußen als auch im Innenraum – bleiben selbst bei höchsten Ansprüchen keine Wünsche offen.
Innovative Raumlösung
Neben der bewährten CLASSIC Line erhalten Kund:innen nun auch die innovative CONTAINEX PLUS Line, die besonders hohen Anforderungen an Ausstattung und Design gerecht wird. Die hochwertige Produktlinie in perfektionierter Modulbauweise ermöglicht ein individuelles Gestalten der Räume und bietet zahlreiche Highlights. Damit eignet sie sich ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung für Kindergärten und Schulen sowie Büro-, Verkaufs- und Schauräume.
Hochwertige Ausstattung
Einzigartige Wohlfühlräume? Die CONTAINEX PLUS Line macht es möglich! Die hochwertige Dämmung mit serienmäßigem Brandschutz sowie individuelle

Ausstattungsvarianten gewährleisten ein stimmiges Ambiente und ein natürliches Raumklima. So ist die PLUS Line beispielsweise mit elektrischen Außenraffstores oder Aluminiumrollläden, Voll- und Teilverglasungen mit besten U-Werten sowie einer thermisch getrennten Außentüre ausgestattet. In der kalten bzw. warmen Jahreszeit sorgt eine Heizund Klimaanlage mit moderner Wärmepumpentechnologie für angenehme Temperaturen. Darüber hinaus verfügt die neue Produktlinie über modernisierte Verbindungsmaterialien und eine innovative, kontrollierte Dachentwässerung.
Ihr PLUS an Nachhaltigkeit
Auch in Sachen Nachhaltigkeit kann sich die CONTAINEX PLUS Line sehen lassen. Mit Photovoltaik-Modul, Heizung mit digitaler Steuerung, LED-Beleuchtung,
Bewegungsmelder u. v. m. bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, um Energie zu sparen.
Bewährtes „Lego-Prinzip“
Die bewährte und flexible CONTAINEX Paneel-Bauweise – die nach dem altbekannten „Lego-Prinzip“ funktioniert – ermöglicht eine schnelle Errichtung sowohl von Einzelmodulen als auch von komplexen, mehrstöckigen Anlagen. Gleichzeitig sind Adaptionen nach individuellen Bedürfnissen möglich. Außerdem erfüllt die PLUS Line erhöhte Wind-, Schnee- und Bodennutzlasten.
Bei uns steht Ihr Komfort an erster Stelle. Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die Vorzüge von CONTAINEX auf www.containex.com.

Raum zum Wohlfühlen
Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung (z.B. Kitas und Schulen) Angenehmes Raumklima dank optimaler Wärmedämmung
Brandschutz (R)EI30 serienmäßig www.containex.com



„Der unsichtbare Notstand“
Roman Neunteufel über die Herausforderungen hinter dem Wasserhahn
Ein kurzer Dreh am Wasserhahn – und schon fließt das kostbare Nass. Damit das so bleibt, müssen wir uns alle unserer Verantwortung bewusst werden. In unserer heutigen Welt, in der die Ressourcen knapp werden und Umweltfragen immer drängender werden, ist das Bewusstsein für die Bedeutung von Trinkwasser entscheidend. Wir haben das Privileg, in Österreich eine hochqualitative Trinkwasserversorgung zu genießen, doch wie können wir sicherstellen, dass dies auch in Zukunft so bleibt?
Herr Neunteufel, wie schlimm ist es wirklich?
Zum Glück ist die öffentliche Wasserversorgung in Österreich wirklich sehr gut abgesichert. Engpässe treten höchstens lokal und zeitlich begrenzt auf. Die Grundversorgung, also das, was zum Leben und in den Haushalten benötigt wird, ist gut abgesichert. Es gibt kaum akute Probleme. Damit das so bleibt, wird unter den gegebenen und immer schneller eintretenden Umweltveränderungen eine vorausschauende Planung immer wichtiger.


Welche einfachen Maßnahmen können wir selbst ergreifen und wie können Gemeinden das Bewusstsein zum Schutz der Wasserressourcen stärken? Es ist bekannt, dass in heißen, trockenen Sommern der Wasserverbrauch insbesondere durch die Bewässerung privater Gärten stark ansteigt. Wenn dazu noch die Ressourcenverfügbarkeit zurückgeht, z. B. durch lange vorangegangene Trockenperioden, können Engpässe auftreten. Dann ist es wichtig, die Verbrauchsspitzen zu mildern. Das heißt: nicht die Gärten bewässern, Pools nicht nachfüllen, Autos nicht waschen. Für die Gemeinden ist es wichtig, auf mögliche Engpässe hinzuweisen und gleichzeitig klarzustellen, dass durch einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Wasser mögliche Einschränkungen der Grundversorgung vermieden werden können.
Mit steigenden Temperaturen jetzt im Sommer besteht auch ein erhöhter Wasserverbrauch in unseren Gärten. Wie können wir hier effektiv Wasser sparen?
Die Bewässerung der Gärten, insbesondere, wenn es sich um eigenen Gemüseanbau handelt, ist oft eine Notwendigkeit. Am effizientesten wird in den Nachtstunden bewässert. Unter Tags sind die Verluste durch Verdunstung deutlich höher. Außerdem ist seltenes und dafür gründliches Bewässern besser als häufiges und nur oberflächliches; ein- oder zweimal in der Woche genügen. Die Pflanzenwurzeln wachsen dann auch in tiefere Bodenschichten und sind gegen oberflächliche Trockenheit besser gewappnet. Für die Rasenpflege gilt: nicht zu niedrig mähen, Rasenschnitt im Hochsommer als Verdunstungsschutz liegen lassen und akzeptieren, dass der Rasen im August ausgetrocknet sein kann. Der erholt sich wieder.























Noch eine letzte Frage: Ist ein Pool im Garten eine akzeptable Erfrischung oder verantwortungslose Verschwendung?



























Mit Augenmaß und Hausverstand sind Pools okay. Es sollten dementsprechend nicht alle Pools gleichzeitig im Frühjahr befüllt werden. Seitens der Gemeinden gibt es dazu oft Poolfüllkalender. Und sofern es im Sommer zu Sparaufrufen kommt, sollte man diese wirklich berücksichtigen und nicht nachfüllen. Dann ist die Grundversorgung der Bevölkerung aus den öffentlichen Wasserversorgungssystemen weiterhin gut abgesichert.


Entgeltliche Einschaltung
Trinkwassertag 2024

Wolfgang Nöstlinger ÖVGW-Präsident
Am Freitag, den 14. Juni 2024, findet der österreichische TRINK’WASSERTAG statt. Das Thema für 2024 lautet „Bewusster Umgang mit Wasser“. Viele Trinkwasserversorger:innen und Gemeinden bieten an diesem Tag der Bevölkerung die einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen der Wasserversorgung zu blicken. Damit soll vor allem der Wert einer funktionierenden Trinkwasserversorgung hervorgehoben und auf einen bewussten Umgang mit Trinkwasser hingewiesen werden. Im Alltag wird Trinkwasser oft als selbstverständlich wahrgenommen. Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) initiierte deshalb den TRINK’WASSERTAG, um die Anstrengungen und Schritte aufzuzeigen, die notwendig sind, damit das Trinkwasser „einfach so“ aus dem Wasserhahn fließen kann.
Österreichs Trinkwasserversorgung ist sicher Investitionen in die Erweiterung, Modernisierung und Wartung des Leitungsnetzes werden laufend getätigt, um Störungen im Normalbetrieb beherrschen und die Versorgung ohne wahrnehmbare Beeinträchtigung für die Bevölkerung auch im Krisenfall aufrechterhalten zu können. „Um

die Sicherheit der Versorgung mit Trinkwasser bei Störfällen – z. B. bei Rohrbruch, regionalen Wassermangelsituationen, Blackout, Hochwasser oder andere Naturkatastrophen – zu gewährleisten, haben die Trinkwasser-Versorgungsunternehmen entsprechende Strukturen aufgebaut“, sagt ÖVGW-Präsident und Sprecher im Wasserfach Ing. Wolfgang Nöstlinger, MSc MBA.
Bewusster Umgang mit Trinkwasser
Aber auch eine verantwortungsvolle und bewusste Nutzung von Trinkwasser hilft, dass die Wasserressourcen geschont werden. „Gerade während langer Hitzeperioden wird ein bewusster Umgang mit Wasser immer wichtiger“, so Nöstlinger, der ergänzt: „In Hitzeperioden, bei niedrigen
KONGRESS UND FACHMESSE
19. – 20. Juni 2024
Messeplatz 1, 4600 Wels
Die Fachmesse ist eine einzigartige Leistungsschau der Industrie mit Dienstleistungen und Produkten für die Gas- und Wasserversorgung. Allen Interessierten ist die Fachmesse Gas Wasser mittels kostenfreier Tageskarte zugänglich. Weitere Infos dazu gibt es auf www.ovgw.at
Grundwasserständen und bei Wassermangel ist man bei der Trinkwasserversorgung auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.“
Aber wie und wo kann man den persönlichen Wasserverbrauch ohne großen Komfortverlust einschränken? Durch den Umstieg auf neue wassersparende Geräte und die Reparatur von tropfenden Armaturen und undichten Spülkästen kann man schon im Kleinen einen großen Beitrag leisten. Duschen statt ein Bad zu nehmen und das Wasserabdrehen während des Zähneputzens reduzieren den persönlichen Wasserverbrauch. Aber auch die richtige Gartenbewässerung – z. B. am frühen Morgen – und die Sammlung und Verwendung von Regenwasser sind Wege für einen bewussteren Umgang mit Wasser.

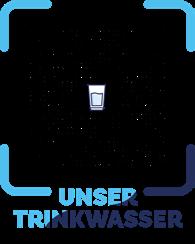
















Einsatzgebiete:
• Straßen, Nebenstraßen und Parkplätze
• Gehwege, Promenaden und Bushaltestellen



• Radwege und Radschnellverbindungen
• Parkanlagen und Naherholungsgebiete
• Camping- und Spielplätze
• Siedlungs- und Wohngebiete


Ihre Vorteile:
• Günstiger als netzgebundene Beleuchtungsanlagen
• Keine Verkabelungsarbeiten & keine Stromkosten
• Beugt Lichtverschmutzung vor
• Innovatives Design & Qualität „Made in Austria“
• 20 Jahre Solarleuchten-Erfahrung


• Über 500 realisierte Projekte in Europa Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne! ecoliGhts – SOLARE BELEUCHTUNG GMBH
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
ecoliGhts – SOLARE BELEUCHTUNG GMBH
A-8741 Weißkirchen • Hopfgarten 18
A-8741 Weißkirchen • Hopfgarten 18



Tel. : + 43 (0)3577 82330-0 • E-Mail : info@ecolights.at
Tel. : + 43 (0)3577 82330-0 • E-Mail : info@ecolights.at von ecoliGhts die Energie


