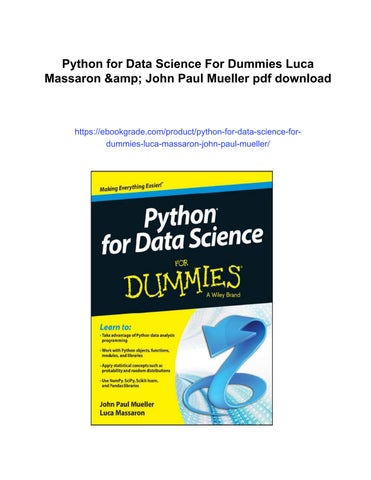Random
documents with unrelated content Scribd suggests to you:
Stepan Trophimowitsch früher so treffend nannte, und was vollkommen richtig wäre, wenn er nicht noch mehr an Hamlet erinnern würde.“
„Et vous avez raison,“[96] bestätigte Stepan Trophimowitsch mit Empfindung und Nachdruck.
„Ich danke Ihnen, Stepan Trophimowitsch. Ich danke Ihnen ganz besonders für Ihren unerschütterlichen Glauben an Nicolas, an den Adel seiner Seele. Diesen Glauben haben Sie auch in mir befestigt, als ich den Mut schon verlieren wollte.“
„Chère,chère...“
Stepan Trophimowitsch wollte schon vortreten, überlegte aber dann doch, daß es immerhin gewagt wäre, sie zu unterbrechen.
„Und wenn Nicolas stets einen stillen, treuen und starken Horatio neben sich gehabt hätte – auch einer Ihrer schönen Vergleiche, Stepan Trophimowitsch –, so wäre er vielleicht längst erlöst“ (Warwara Petrowna geriet schon in einen singenden Ton) „von diesem ‚Dämon der Ironie‘ – auch diesen Ausdruck hat Stepan Trophimowitsch geprägt, – der ihn sein Lebelang martert. Doch Nicolas hat nie weder einen Horatio noch eine Ophelia gehabt. Er hat nur eine Mutter gehabt. Aber was kann eine Mutter in solchen Dingen tun? Wissen Sie, Pjotr Stepanowitsch, es ist mir jetzt vollkommen klar, daß ein Mensch wie Nicolas sogar in diese schmutzigen Winkel hinabsteigen konnte. Ich begreife jetzt alles. Ich begreife diese Lust zum Spott über das Leben, auf die auch Sie vorhin so vorzüglich hinwiesen. Ich begreife diesen unersättlichen Durst nach Gegensätzen, diesen trüben und unheimlichen Hintergrund seines damaligen Lebens, von dem er sich dann wie eine leuchtende Erscheinung abhob. Und in dieser schrecklichen Welt trifft er dann ein Wesen, das alle beleidigen und verspotten, eine Krüppelige, eine Irrsinnige, und zugleich doch einen Menschen, der die edelsten Gefühle hat! ...“
„Hm ... ja, nehmen wir an –“
„Und Sie sagen, Sie können nicht begreifen, weshalb er zunächst nicht wie alle die anderen über sie lacht! Oh, ihr Menschen! Und Sie können nicht verstehen, daß er sie dann vor den Beleidigern beschützt und sie wie eine ‚Marquise‘ behandelt! Dieser Kirilloff muß
ein tiefer Menschenkenner sein, wenn er auch Nicolas nicht verstanden hat! Ja, vielleicht ist es gerade dieser Kontrast, aus dem diese ganze unselige Geschichte entstanden ist. Wäre die Beklagenswerte in anderen Verhältnissen, in einer anderen Umgebung gewesen, dann hätte sie wohl überhaupt nicht diesen törichten Gedanken gefaßt. Das allerdings, Pjotr Stepanowitsch, kann nur eine Frau verstehen, und wie schade ist es doch, daß Sie ... das heißt ... ich will natürlich nicht sagen, wie schade, daß Sie keine Frau sind, aber daß Sie das ganze Verständnis einer Frau nun einmal nicht haben können.“
„Das heißt also: je schlimmer, desto besser – ich verstehe, ich verstehe schon, Warwara Petrowna. Das ist so, wie in der Religion und im Staat: je schlechter es ein Mensch im Leben hat, oder je unterdrückter ein Volk ist, desto eigensinniger wird an die Belohnung, die einen im Jenseits erwartet, gedacht. Und wenn dabei noch hunderttausend Geistliche mitwirken und den Gedanken anfachen, auf den sie selbst spekulieren, so ... oh, ich verstehe Sie, Warwara Petrowna, seien Sie unbesorgt.“
„Ich glaube – doch wohl nicht so ganz. Aber sagen Sie, hätte denn Nicolas, um jenen unseligen Gedanken in diesem unglücklichen Organismus zu ertöten,“ (weshalb sie hier dieses Wort gebrauchte, verstand ich nicht) „hätte er wirklich ebenso über sie lachen und höhnen müssen, wie die anderen rohen Kumpane? Begreifen Sie denn wirklich nicht dieses große Mitleiden, diesen edlen Schauer einer edlen Seele, mit dem Nicolas plötzlich ernst diesem Kirilloff antwortet: ‚Ich lache durchaus nicht über sie.‘ Oh, diese vornehme, diese heilige Antwort.“
„Sublime!,“[97]murmelte Stepan Trophimowitsch.
„Und vergessen Sie nicht, er ist durchaus nicht reich, wie Sie vielleicht denken: ich bin reich, aber nicht er, und damals hat er meine Hilfe niemals in Anspruch genommen.“
„Ich verstehe das, ich verstehe das alles, Warwara Petrowna,“ beteuerte Pjotr Stepanowitsch und bewegte sich bereits etwas ungeduldig auf seinem Stuhl.
„Oh, das ist mein Charakter! In Nicolas erkenne ich mich selbst wieder. Ich kenne diese Jugend, diese Möglichkeiten stürmisch
drängender Ausbrüche ... Und wenn wir uns jemals nähertreten sollten, Pjotr Stepanowitsch, was ich meinerseits aufrichtig wünsche, um so mehr, als ich Ihnen schon so verpflichtet bin, so werden Sie dann vielleicht verstehen –“
„Oh, auch ich wünsche, glauben Sie mir –“
„– Diesen Drang, in dem man in blindem Edelmute plötzlich einen Menschen nimmt, womöglich einen, der unser gar nicht wert ist, einen Menschen, der Sie nicht im geringsten versteht und bereit ist, Sie bei jeder Gelegenheit zu quälen: und diesen Menschen macht man plötzlich wider alle Vernunft zu seinem Idealbild, zu seinem Wahnbild, legt in ihn alle Hoffnungen, beugt sich vor ihm, liebt ihn sein Lebelang, ohne auch nur zu wissen weshalb, – vielleicht gerade deshalb, weil er das gar nicht verdient hat ... Oh, wie ich mein ganzes Leben lang gelitten habe, Pjotr Stepanowitsch!“
Stepan Trophimowitsch suchte erregt meinen Blick, doch ich konnte mich noch rechtzeitig abwenden.
„Und noch vor kurzem, noch vor kurzem – oh, wie viel mir Nicolas verzeihen muß! ... Sie werden es mir nicht glauben, wie alle mich gequält haben! Gequält von allen Seiten, alle, alle, Feinde und Freunde, und die Freunde vielleicht noch mehr als die Feinde. Und als ich den ersten anonymen Brief erhielt, Pjotr Stepanowitsch, Sie werden es mir nicht glauben, aber meine Verachtung reichte einfach nicht aus für diese ganze Gemeinheit ... Nie, nie werde ich mir diesen Kleinmut vergeben!“
„Von diesen anonymen Briefen habe ich schon gehört,“ sagte Pjotr Stepanowitsch, plötzlich wieder belebt, „seien Sie unbesorgt, den Verfasser werde ich schon herausbekommen.“
„Aber Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was für Intriguen hier gesponnen worden sind! Sogar unsere arme Praskowja Iwanowna hat man beunruhigt – und dazu war doch wirklich kein Grund vorhanden! Liebe Praskowja Iwanowna, heute mußt du mir schon verzeihen,“ fügte sie plötzlich in einer großmütigen Regung hinzu, aber doch nicht ohne einen leisen triumphierenden Klang in der Stimme.
„Schon gut, meine Liebe,“ murmelte diese widerwillig. „Ich aber meine, man könnte jetzt endlich aufhören, es ist schon viel zu viel
gesprochen worden.“ Und wieder sah sie scheu ihre Lisa an, die aber blickte auf Pjotr Stepanowitsch.
„Und dieses arme, unglückliche Geschöpf, diese Irrsinnige, die alles verloren, nur das Herz behalten hat, die – werde ich in mein Haus aufnehmen!“ rief Warwara Petrowna plötzlich entschlossen aus. „Das ist eine heilige Pflicht und ich will sie erfüllen! Vom heutigen Tage an stelle ich sie unter meinen Schutz!“
„Und das wird sogar sehr gut sein, in einem gewissen Sinne wenigstens!“ Pjotr Stepanowitsch war wieder ganz Leben. „Entschuldigen Sie, aber vorhin bin ich nicht ganz zu Ende gekommen. Gerade was den Schutz betrifft. Stellen Sie sich vor, Warwara Petrowna, – ich fange dort an, wo ich stehen blieb, –stellen Sie sich also vor, daß damals, als Nicolai Wszewolodowitsch fortgefahren war, dieser Herr da drüben, dieser Herr Lebädkin, nichts Besseres zu tun wußte, als das seiner Schwester ausgesetzte Geld eilends und restlos zu vertrinken. Ich weiß nicht genau, in welcher Weise Nicolai Wszewolodowitsch die Zahlungsart in der ersten Zeit angeordnet hatte. Ich weiß nur, daß er sich schließlich genötigt sah, wenn er Lebädkins Schwester einigermaßen sicherstellen wollte, sie in einem fernen Kloster unterzubringen – was denn auch geschah, selbstredend unter aller nur denkbaren Rücksicht auf ihre Person, aber unter freundschaftlicher Aufsicht, Sie verstehen schon! Doch was glauben Sie wohl, wozu Herr Lebädkin sich entschloß? Erst suchte er mit aller Gewalt zu erfahren, wo man sein Zinspapier, das heißt also seine Schwester, untergebracht hatte, und dann, als ihm dies gelungen war, erwirkte er, indem er irgendwelche Rechte vorschützte, daß man sie ihm herausgab, und darauf schleppte er sie hierher. Hier nun gab er ihr nichts zu essen, sondern schlug sie, und als er auf irgendeine Weise von Nicolai Wszewolodowitsch eine größere Geldsumme herausbekommen hatte, ging das alte, wüste Trinkleben sofort von neuem an. Von Dankbarkeit Nicolai Wszewolodowitsch gegenüber natürlich keine Spur; im Gegenteil, nur sinnlose neue Forderungen stellte er an ihn und drohte gar mit dem Gericht, wenn er nicht Zahlungen erhalten würde – nahm also frech als pflichtmäßig an, was freiwillig war. – Herr Lebädkin, ist alles wahr, was ich hier soeben gesagt habe?“
Der „Hauptmann“, der bis dahin stumm und mit gesenkten Augen dagestanden hatte, trat schnell zwei Schritte vor, – das Blut schoß ihm ins Gesicht.
„Pjotr Stepanowitsch ... Sie haben mich ... grausam behandelt,“ brachte er stockend hervor.
„Wieso grausam? Doch über Grausamkeit oder Zartheit können wir später sprechen, jetzt aber wollen Sie mir gefälligst auf meine Frage antworten: ist alleswahr, was ich hier gesagt habe, oder nicht?“
„Ich ... Sie wissen ja selbst, Pjotr Stepanowitsch ...“ der „Hauptmann“ stockte und schwieg.
Pjotr Stepanowitsch saß im Lehnstuhl mit übergeschlagenen Beinen und Lebädkin stand in der ehrerbietigsten Haltung vor ihm. Lebädkins Unentschlossenheit schien Pjotr Stepanowitsch sehr wenig zu gefallen: in seinem Gesicht zuckte es und sein Ausdruck wurde böse.
„Ja, wollen Sie nicht vielleicht etwas sagen?“ fragte Pjotr Stepanowitsch scharf, wobei er mit zusammengekniffenen Augen durchdringend den „Hauptmann“ anblickte. „In dem Falle – bitte. Haben Sie die Güte, wir hören.“
„Sie wissen doch selbst, Pjotr Stepanowitsch, daß ich nichts sagen kann.“
„Nein, das weiß ich durchaus nicht, höre es sogar zum erstenmal; warum können Sie denn nicht?“
Lebädkin schwieg und blickte zu Boden.
„Erlauben Sie mir, Pjotr Stepanowitsch, fortzugehen,“ sagte er endlich entschlossen.
„Nicht, bevor Sie mir eine Antwort auf meine Frage gegeben haben. Noch einmal: ist alleswahr, was ich gesagt habe?“
„Ja, es ist wahr,“ sagte Lebädkin dumpf und blickte kurz zu seinem Peiniger auf.
An seinen Schläfen trat sogar Schweiß hervor.
„Ist alleswahr?“
„Alles ist wahr.“
„Haben Sie nicht noch etwas hinzuzufügen, oder zu bemerken? Wenn Sie fühlen, daß wir Ihnen irgendwie Unrecht getan haben, so
sagen Sie es. Protestieren Sie, geben Sie laut Ihre Unzufriedenheit kund!“
„Nein, ich habe nichts ...“
„Haben Sie vor kurzem Nicolai Wszewolodowitsch gedroht?“
„Das ... das ... war mehr Alkohol, Pjotr Stepanowitsch!“ (Er hob plötzlich den Kopf.) „Pjotr Stepanowitsch! Wenn die beleidigte Familienehre und die unverdiente Schande im Menschenherzen aufheulen, ist dann – ist dann wirklich der Mensch noch verantwortlich?“ brüllte er plötzlich wieder los, wie vorher sich nicht mehr im Zaum haltend.
„Sind Sie nüchtern, Herr Lebädkin?“ Pjotr Stepanowitsch sah ihn durchdringend an.
„Ich ... bin nüchtern.“
„Was soll das bedeuten: ‚beleidigte Familienehre‘ und ‚unverdiente Schande‘?“
„Das habe ich nur so ... ich wollte niemanden ...“ Der Hauptmann sank wieder zusammen.
„Meine Bemerkungen über Sie und Ihr Benehmen scheinen Sie gekränkt zu haben. Sie sind ja sehr empfindlich, Herr Lebädkin. Aber erlauben Sie mal, ich habe doch noch gar nichts über Ihr Benehmen im eigentlichen Sinne gesagt. Ich werde erst anfangen, über Ihr Benehmen im eigentlichen Sinne zu sprechen. Ja, es ist sogar sehr leicht möglich, daß ich davon anfangen werde ...“
Lebädkin erzitterte plötzlich und starrte wahrhaft entsetzt Pjotr Stepanowitsch an.
„Pjotr Stepanowitsch, ich fange jetzt erst an, aufzuwachen!“
„Hm! Und ich bin es wohl, der Sie jetzt aufgeweckt hat?“
„Ja, Sie haben mich aufgeweckt, Pjotr Stepanowitsch, ich aber habe vier Jahre unter der schwebenden Wolke geschlafen ... kann ich jetzt fortgehen, Pjotr Stepanowitsch?“
„Jetzt können Sie es ... wenigstens, wenn nicht Warwara Petrowna –?“
Die aber winkte nur mit beiden Händen ab.
Der „Hauptmann“ verbeugte sich und ging, doch nach drei Schritten blieb er plötzlich wieder stehen, preßte die Hand aufs Herz, wollte etwas sagen, tat es aber doch nicht – und ging dann endlich
schnell zur Türe. Doch gerade wie er hinaus wollte, wurde sie von außen geöffnet und er stieß mit Nicolai Wszewolodowitsch beinahe zusammen. Der „Hauptmann“ duckte sich gleichsam vor ihm und erstarb auf der Stelle, ohne seine Augen von ihm abwenden zu können, wie ein Kaninchen vor einer Riesenschlange.
Einen Augenblick wartete Stawrogin, dann schob er ihn mit der Hand leicht zur Seite und trat ein.
VII.
Stawrogin war heiter und ruhig. Möglich, daß er etwas sehr Angenehmes erfahren hatte, was wir noch nicht wußten ... jedenfalls war er, wie es schien, mit irgend etwas ganz ausnehmend zufrieden.
„Kannst du mir verzeihen, Nicolas?“ Warwara Petrowna konnte sich nicht bezwingen und erhob sich sogar eilig ihm entgegen.
Da aber lachte Stawrogin auf:
„Das fehlte noch!“ rief er gutmütig und scherzhaft. „Ich sehe schon, es ist euch alles bekannt. Und ich machte mir bereits Vorwürfe während der Fahrt in der Equipage: ‚Wenigstens hätte ich doch den Scherz erzählen müssen, denn sonst, wer geht denn so fort.‘ Als mir aber einfiel, daß Pjotr Stepanowitsch hier geblieben war, sprang die Sorge von mir ab.“
Während er sprach, blickte er sich flüchtig im Zimmer um.
„Pjotr Stepanowitsch hat uns eine alte Petersburger Geschichte aus dem Leben eines eigentümlichen Menschen erzählt,“ sagte Warwara Petrowna, noch ganz entzückt, „eines launischen, eines halb wahnsinnigen Menschen, der aber in seinen Gefühlen immer edel bleibt, immer adlig, immer ritterlich –“
„Also so hoch habt ihr mich schon erhoben,“ scherzte Stawrogin. „Übrigens bin ich Pjotr Stepanowitsch diesmal sehr dankbar für seine Eilfertigkeit“ (hier tauschte er mit ihm einen blitzartig kurzen Blick). „Sie müssen nämlich wissen, maman, daß Pjotr Stepanowitsch stets der allgemeine Friedensstifter ist: das ist nun einmal seine Rolle, seine Krankheit, sein Steckenpferd, und in der Beziehung kann ich ihn besonders empfehlen. Übrigens kann ich mir schon denken,
worüber er hier Bericht erstattet hat. Er erstattet ja immer Bericht, wenn er etwas erzählt. In seinem Kopf hat er eine Kanzlei. Man merke sich nur, daß er in seiner Eigenschaft als Realist nicht lügen kann und daß die Wahrheit ihm teurer ist als der Erfolg ... selbstverständlich außer in jenen besonderen Fällen, wenn ihm der Erfolg teurer ist als die Wahrheit.“ (Stawrogin sah sich, während er sprach, immer noch um.) „Sie sehen also, maman, daß nicht Sie mich um Verzeihung zu bitten haben, und daß, wenn hier irgendwo eine Schuld ist, sie natürlich nur mich treffen kann ... oder sagen wir, wenn hier eine Verrücktheit vorliegt, ich folglich der Verrückte bin –man muß doch seinen Ruf aufrechterhalten!“ und er umarmte seine Mutter und küßte sie zärtlich. „Jedenfalls aber ist die Sache jetzt erzählt, und ich dächte, nun könnte man aufhören, von ihr zu sprechen.“ Seine letzten Worte hatten plötzlich einen trockenen, harten Unterton.
Warwara Petrowna kannte diesen Ton, doch ihre Erregung verging deshalb noch nicht, sogar im Gegenteil.
„Aber wie kommt es nur, daß du heute schon hier bist, Nicolas, du wolltest doch erst in einem Monat –“
„Ich werde Ihnen natürlich alles erzählen, maman, doch augenblicklich –“ Und er trat zu Praskowja Iwanowna.
Doch diese schien ihn diesmal überhaupt nicht bemerken zu wollen: während noch vor einer halben Stunde, als er zum ersten Male erschienen war, ihre ganze Aufmerksamkeit von ihm in Anspruch genommen wurde, war diese jetzt auf etwas ganz anderes gelenkt. In dem Augenblick, als der „Hauptmann“ mit Stawrogin beinahe zusammengestoßen war, hatte Lisa plötzlich zu lachen angefangen – zuerst nur leise und verhalten, dann aber immer lauter und bemerkbarer. Sie wurde rot. Dieser Gegensatz zu ihrem kurz vorher noch so düsteren Aussehen war doch zu auffallend. Als Nicolai Wszewolodowitsch noch mit Warwara Petrowna sprach, winkte sie Mawrikij Nicolajewitsch zu sich heran, als wolle sie ihm etwas sagen: doch kaum beugte er sich zu ihr nieder, da lachte sie schon von neuem. Ja, es schien, als lache sie geradezu über den armen Mawrikij Nicolajewitsch. Dabei strengte sie sich furchtbar an,
ernst zu bleiben, und preßte immer wieder ihr Taschentuch an die Lippen, doch es gelang ihr nicht, sich zu bezwingen.
Nicolai Wszewolodowitsch trat mit der unschuldigsten, aufrichtigsten Miene an sie heran, um sie zu begrüßen.
„Verzeihen Sie, bitte,“ sagte sie schnell, „Sie ... Sie haben gewiß auch Mawrikij Nicolajewitsch gesehen ... Gott, wie verboten lang Sie sind, Mawrikij Nicolajewitsch!“ Und wieder lachte sie.
Mawrikij Nicolajewitsch war allerdings hoch von Wuchs, aber durchaus nicht so auffallend, wie sie es plötzlich zu finden schien.
„Sie ... sind vor nicht langer Zeit angekommen?“ fragte sie, sich gewaltsam zusammennehmend, sogar verlegen, doch mit blitzenden Augen.
„Vor ungefähr zwei Stunden,“ antwortete Stawrogin und sah sie aufmerksam an. Ich muß hier bemerken, daß er ungewöhnlich zurückhaltend war in seiner Höflichkeit, doch ohne diese würde er vollständig gleichgültig, fast gelangweilt ausgesehen haben.
„Und wo werden Sie wohnen?“
„Hier.“
Warwara Petrowna beobachtete sie gleichfalls, plötzlich fiel ihr etwas ein.
„Aber Nicolas, wo warst du denn bis jetzt, diese zwei Stunden?“ fragte sie erstaunt, „der Zug kommt doch um zehn Uhr an.“
„Ich brachte zuerst Pjotr Stepanowitsch zu Kirilloff. Ich hatte ihn in Matwejewo (drei Stationen vor unserer Stadt), getroffen. So fuhren wir die letzte Strecke zusammen.“
„Ich aber wartete schon seit Mitternacht in Matwejewo,“ griff Pjotr Stepanowitsch schnell in das Gespräch ein. „Unsere letzten Wagen waren in der Nacht aus den Schienen gesprungen, wir hätten uns beinahe noch die Beine gebrochen!“
„Mein Gott,“ rief Lisa, „Mama, und wir wollten in der vorigen Woche auch nach Matwejewo fahren!“
„Gott erbarme dich!“ Praskowja Iwanowna bekreuzte sich.
„Ach, Mama, Mama, liebe Mama, erschrecken Sie nicht, wenn ich mir bei einer solchen Gelegenheit auch einmal ein Bein breche, mir könnte das ja nur zu leicht geschehen! Sie sagen doch selbst, daß ich jeden Tag nur ausreite, um mir das Genick zu brechen. Mawrikij
Nicolajewitsch, würden Sie mich führen, wenn ich hinke?“ fragte sie wieder lachend. „Ich würde dann nur Ihnen erlauben, mich zu führen, verlassen Sie sich darauf! Sagen wir, ich breche mir ein Bein? – Aber so seien Sie doch so liebenswürdig, Mawrikij Nicolajewitsch, und sagen Sie sofort, daß Sie sich glücklich schätzen würden!“
„Was kann das für ein Glück sein, wenn man ein Krüppel ist?“ sagte Mawrikij Nicolajewitsch ernstlich ungehalten.
„Dafür würden Sie allein mich führen dürfen, nur Sie, sonst niemand!“
„Auch dann würden Siemich führen, Lisaweta Nicolajewna,“ sagte der Offizier leise und noch ernster.
„Gott, er wollte einen Witz machen,“ rief Lisa fast entsetzt aus. „Mawrikij Nicolajewitsch, unterstehen Sie sich niemals, einen Witz zu machen! Aber Sie sind wirklich bis zu einem unglaublichen Grade Egoist! Doch ich bin überzeugt, zu Ihrer Ehre sei es gesagt, daß Sie sich selbst verleumden. Im Gegenteil, Sie würden mir von früh bis spät versichern, daß ich ohne Fuß weit interessanter sei! Eines ist aber unvereinbar: Sie sind übermäßig lang, ich aber würde, wenn ich hinken müßte, ganz klein sein – wir würden also ein schlechtes Paar abgeben!“
Und sie lachte krampfhaft.
Die Anspielungen waren flach und herbeigezogen, doch ihr war es diesmal offenbar nicht um den Ruhm zu tun, geistreich zu sein.
„Hysterie,“ flüsterte mir Pjotr Stepanowitsch zu, „ein Glas Wasser, schnell!“
Er hatte es erraten: eine Minute später liefen wir hin und her und endlich brachte man denn auch Wasser. Lisa umarmte ihre Mutter, küßte sie leidenschaftlich, weinte verzweifelt – bis sie dann plötzlich wieder auflachte. Darauf fing auch die Alte zu weinen an. Da führte denn Warwara Petrowna sie beide durch dieselbe Tür, durch die Darja Pawlowna eingetreten war, hinaus. Doch sie blieben nicht lange im Nebenzimmer, sondern erschienen schon nach wenigen Minuten wieder im Salon.
Kaum waren sie draußen, da trat Stawrogin an uns heran und begrüßte uns – außer Schatoff, der noch immer in seiner Ecke saß und den Kopf womöglich noch tiefer gesenkt hielt. Stepan
Trophimowitsch versuchte sogleich, irgendein geistreiches Gespräch anzuknüpfen, doch Stawrogin wandte sich ab und wollte zu Darja Pawlowna gehen. Unterwegs jedoch hielt ihn Pjotr Stepanowitsch auf, der ihn fast mit Gewalt zum Fenster zog und ihm dort etwas anscheinend sehr Wichtiges zuzuflüstern begann. Nicolai Wszewolodowitsch freilich hörte, während der andere lebhaft gestikulierte, nur zerstreut, fast gelangweilt zu, mit seinem offiziellen, leicht spöttischen Lächeln auf den Lippen – und schließlich wurde er ungeduldig und machte sich los.
In diesem Augenblick traten die Damen wieder ein.
Warwara Petrowna führte Lisa zu ihrem alten Platz und versicherte lebhaft, daß es den gereizten Nerven unmöglich gut tun könne, wenn sie gleich an die frische Luft ginge: sie solle sich doch erst wenigstens zehn Minuten erholen! Und sie setzte sich neben Lisa und bemühte sich in einer schon recht auffallenden Weise um diese.
Pjotr Stepanowitsch lief auch gleich hinzu und begann ein lebhaftes und lustiges Gespräch.
Währenddessen trat nun Stawrogin endlich mit seinen langsamen Schritten zu Darja Pawlowna. Dascha schrak förmlich zurück, als sie ihn auf sich zukommen sah, und feuerrot, verwirrt, fast taumelnd erhob sie sich schnell.
„Ich glaube, man kann Ihnen gratulieren ... oder noch nicht?“ Er fragte es mit einem sonderbaren Zug um den Mund, den ich noch nie an ihm bemerkt hatte.
Dascha antwortete ihm irgend etwas, aber die Worte konnte ich nicht verstehen.
„Verzeihen Sie, bitte, die Aufdringlichkeit,“ sagte er und sprach lauter, „aber Sie wissen doch, daß man mich absichtlich davon benachrichtigt hat? Wissen Sie das?“
„Ja, ich weiß, daß Sie absichtlich davon benachrichtigt worden sind.“
„Nun, ich hoffe, mein Glückwunsch hat nicht gestört,“ meinte er lachend, – „und wenn Stepan Trophimowitsch ...“
„Wozu, wozu gratulieren?“ Pjotr Stepanowitsch lief schnell herbei, „wozu, wozu gratulieren, Darja Pawlowna? Bah! doch nicht etwa dazu? Wirklich! Ihre Farbe beweist, daß ich recht geraten habe! In
der Tat gibt es doch nur eine einzige Art Glückwunsch, bei dem unsere schönen, sittsamen jungen Damen zu erröten pflegen. Nun, so empfangen Sie ihn denn auch von mir, wenn ich’s richtig erraten habe! Bezahlen Sie aber auch bitte die Wette! Sie werden sich doch noch erinnern, daß wir in der Schweiz gewettet haben? Sie sagten, daß Sie niemals heiraten würden und ich sagte das Gegenteil. Nun, und eigentlich bin ich ja halbwegs deshalb aus der Schweiz hierher gereist ... Apropos – Schweiz! Aber sag mir doch,“ er drehte sich schnell zu Stepan Trophimowitsch herum, „wann fährst du denn jetzt in die Schweiz?“
„Ich? ... in die Schweiz?“ fragte Stepan Trophimowitsch überrascht und verwirrt.
„Ja, wie denn? Fährst du denn nicht? Aber du heiratest doch ... du schriebst es doch!“
„Pierre!“ rief Stepan Trophimowitsch streng.
„Was denn, Pierre! Sieh mal, wenn es dir angenehm zu hören ist, so bin ich hierher geflogen, um dir mitzuteilen, daß ich durchaus nichts dagegen einzuwenden habe! Du wolltest doch meine Meinung möglichst bald wissen! Wenn man dich aber ‚retten‘ muß, wie du in demselben Brief schreibst, so stehe ich dir dito zu Diensten. Ist es wahr, daß er heiratet, Warwara Petrowna?“ und wieder drehte er sich schnell zu dieser. „Ich nehme an, daß ich hier nicht von Geheimnissen rede. Er schreibt ja selbst, daß die ganze Stadt es bereits weiß, daß ihm alle bereits ihre Glückwünsche darbringen wollen, und daß er, um dem zu entgehen, nur noch in der Nacht das Haus verlassen kann. Den Brief habe ich in der Tasche. Ganz klug bin ich freilich nicht aus ihm geworden. Sag selbst, Stepan Trophimowitsch, was soll man nun eigentlich: – soll man dir ‚gratulieren‘? – oder soll man dich ‚retten‘? Sie glauben nicht, Warwara Petrowna, unmittelbar neben den glücklichsten Zeilen stehen solche der größten Verzweiflung. Zunächst bittet er mich um Verzeihung: nun, schön, das sind so seine Sentimentalitäten ... Aber übrigens – nein, es ist unmöglich, nicht davon zu sprechen: stellen Sie sich vor, er hat mich im ganzen Leben nur zweimal gesehen, und auch dann nur zufällig; jetzt plötzlich aber, wie er sich zum dritte Male verheiraten will, bildet er sich ein, damit mir gegenüber
irgendwelche väterlichen Pflichten zu verletzen. Und so fleht er mich tatsächlich über tausend Werst hinweg an, ihm nicht böse zu sein und meine Erlaubnis zu seiner Vermählung zu geben! Du, ärgere dich bitte nicht, Stepan Trophimowitsch, es ist ein Zug unserer Zeit, alles zu verstehen, und ich verurteile dich ja auch nicht, ja, schließlich macht dir das alles sogar, wie man das zu nennen pflegt, nur Ehre, usw., usw. Doch davon wollte ich ja gar nicht sprechen. Die Hauptsache ist vielmehr, daß mir – nun, eben die Hauptsache nicht klar ist. Schreibst da irgend etwas von Schweizer Sünden ... ‚Heirate sozusagen fremde Sünden‘, oder wie du dich da ausdrückst, – mit einem Wort: ‚Sünden‘ sind dabei. ‚Das Mädchen‘, schreibst du, ‚ist ein Juwel‘, und du, nun natürlich, du bist ihrer ‚nicht wert‘. Das ist nun einmal sein Stil,“ sagte er wieder zu Warwara Petrowna gewandt. „Wegen irgendwelcher ‚fremden Sünden‘ ist er ‚gezwungen, zum Altar zu gehen und in die Schweiz zu reisen‘, und darum: ‚fliege her, um mich zu retten!‘ Begreifen Sie etwas? Aber ich sehe ... mir scheint ... ich bemerke am Ausdruck der Gesichter, daß –“ er drehte sich nach allen Seiten um und sah die Anwesenden mit dem unschuldigsten Lächeln an, – „daß ich nach meiner Gewohnheit wieder einmal eine Dummheit gemacht habe ... mit meiner Aufrichtigkeit, oder, wie Nicolai Wszewolodowitsch sagt – Eilfertigkeit ... Ich glaubte doch, daß wir hier unter Freunden sind? Das heißt selbstverständlich unter deinen Freunden, Stepan Trophimowitsch, nur unter deinen, denn ich bin hier ja fremd ... und nun sehe ich ... sehe ich, daß alle irgend etwas wissen, und nur ich dieses ‚Etwas‘ nicht weiß ...“
Er sah sich noch immer im Kreise um.
„So hat Ihnen Stepan Trophimowitsch geschrieben, daß er ‚fremde Sünden‘ heiraten müsse?“ Warwara Petrowna trat mit entstelltem, fast gelbem Gesicht und zuckenden Mundwinkeln auf Pjotr Stepanowitsch zu.
„Ja, sehen Sie, das heißt, wenn ich hier etwas nicht verstanden haben sollte, so ist das natürlich meine Schuld. Aber ich denke doch ... selbstverständlich: er schreibt so! Hier habe ich ja den Brief – den wichtigsten. Wissen Sie, Warwara Petrowna, endlose Briefe und schließlich einfach ein Brief nach dem anderen, so daß ich sie später
gar nicht mehr zu Ende las ... Verzeih mir das Geständnis, Stepan Trophimowitsch, aber, nicht wahr, im Grunde hast du sie, wenn du sie auch an mich adressiert hast, doch mehr für die Nachgeborenen geschrieben. Reg’ dich nicht auf, es macht ja weiter nichts. Aber diesen Brief hier, Warwara Petrowna, den habe ich ganz gelesen. Denn diese ‚Sünden‘, diese ‚fremden Sünden‘: das sind doch bestimmt irgendwelche von seinen eigenen Sünden und ich könnte wetten, die allerunschuldigsten – er aber macht daraus selbstredend eine furchtbare Geschichte, so eine mit einem edlen Zuge, und vielleicht ist die ganze Geschichte nur um dieses Zuges willen herbeigezogen. Es gibt da nämlich noch gewisse Abrechnungen, die nicht ganz stimmen mögen, wozu das verheimlichen! Denn, wissen Sie, man muß es doch endlich gestehen, wir pflegen dem Kartenspiel nun einmal etwas zugetan zu sein ... Aber nein, Verzeihung, das ist schon überflüssig, das ist schon wirklich ganz überflüssig, Verzeihung! Doch was ich sagen wollte, Warwara Petrowna, erschreckt hat er mich tatsächlich, und ich schickte mich schon allen Ernstes an, ihn zu ‚retten‘. Bin ich denn ein Halsabschneider? Er schreibt da etwas von einer Mitgift ... Aber übrigens, heiratest du nun wirklich, Stepan Trophimowitsch? Doch wir reden hier und reden und ich langweile Sie bestimmt nur ... und Sie, Warwara Petrowna, verurteilen mich gewiß ...“
„Im Gegenteil, im Gegenteil, ich sehe nur, daß Sie die Geduld verloren haben und dazu hatten Sie ja auch Grund genug,“ sagte Warwara Petrowna mit einem bösen Lächeln.
Sie hatte die ganze Zeit mit boshafter Genugtuung Pjotr Stepanowitsch zugehört, der augenscheinlich eine bestimmte Rolle spielte. (Was für eine, und wozu? – das wußte ich damals nicht! Aber er spielte eine Rolle, und spielte sie ungeschickt.)
„Ganz im Gegenteil,“ fuhr Warwara Petrowna fort, „ich bin Ihnen nur zu dankbar dafür. Ohne Sie hätte ich nichts erfahren. So öffne ich jetzt zum erstenmal seit zwanzig Jahren die Augen und sehe. Nicolai Wszewolodowitsch, Sie erwähnten vorhin, daß Sie absichtlich benachrichtigt worden seien. Hat Stepan Trophimowitsch auch Ihnen in dieser Art und Weise geschrieben?“
„Ich erhielt von ihm allerdings einen ganz unschuldigen und ... und sehr ... edelmütigen Brief ...“
„Sie stocken, Sie suchen nach Worten – schon gut! Stepan Trophimowitsch, Sie haben mir einen großen Gefallen zu erweisen,“ wandte sie sich plötzlich mit blitzenden Augen an diesen. „Haben Sie die Güte, uns sofort zu verlassen und die Schwelle meines Hauses nie mehr zu überschreiten.“
Was mich an der ganzen Szene am meisten wunderte, das war die erstaunliche Würde, mit der Stepan Trophimowitsch sich hielt. Während der ganzen „Überführung“ durch seinen Sohn und selbst unter dem „Fluch“ Warwara Petrownas machte er nicht ein einziges Mal Miene, sich auch nur zu verteidigen. Woher nahm er so viel Charakterfestigkeit? Ich habe später erfahren, daß ihn seines Sohnes Betragen gleich beim ersten Wiedersehen tief und schmerzlich gekränkt hatte. Das aber war schon ein ehrliches, ein echtes Leid. Und hinzu kam dann noch der andere Schmerz: die quälende Selbsterkenntnis, daß er sich niedrig benommen hatte. Das alles gestand er mir später selbst mit seiner ganzen Offenherzigkeit. Nun, und ein wirkliches Leid und ein echter Schmerz können doch sogar einen außergewöhnlich leichtsinnigen und oberflächlichen Menschen ernst und standhaft machen, wenn auch nur auf kurze Zeit. Ja, wirkliches Leid hat selbst aus Dummköpfen Kluge gemacht, wenn auch freilich gleichfalls nur auf kurze Zeit; das ist schon so eine Eigenschaft des Leides. Wenn dem aber so ist, was konnte dann nicht alles mit einem Menschen wie Stepan Trophimowitsch geschehen? Da konnte ja echter Schmerz eine vollkommene Umwandlung bewirken! – Freilich auch hier nur auf einige Zeit ... Er verbeugte sich würdevoll vor Warwara Petrowna, und ohne ein Wort zu sagen (allerdings blieb ihm ja auch nichts anderes übrig), wollte er schon hinausgehen, als er es doch nicht über sich gewann und zu Darja Pawlowna trat. Diese mochte das schon vorausgefühlt haben, denn sie ging ihm sofort entgegen und begann, in ihrem Schreck, schnell selbst zu sprechen, als hätte sie ihm nur ja zuvorkommen wollen.
„Sagen Sie nichts, Stepan Trophimowitsch, sagen Sie nichts, um Gottes willen,“ sie streckte ihm erregt die Hand entgegen, in ihrem
Gesicht zuckte es schmerzlich. „Seien Sie versichert, daß ich Sie immer hochachten werde, Stepan Trophimowitsch, und denken Sie auch von mir nicht schlecht, Stepan Trophimowitsch, ich ... ich werde das immer sehr, sehr schätzen ...“
Stepan Trophimowitsch verbeugte sich tief vor ihr.
„Es ist dein freier Wille, Darja Pawlowna, du weißt, daß du in dieser ganzen Angelegenheit vollkommen frei handeln kannst,“ sagte plötzlich Warwara Petrowna bedeutsam.
„Ach! Nun – nun begreife ich alles!“ rief da Pjotr Stepanowitsch aus und schlug sich vor die Stirn. „Aber ... aber in was für eine Lage hat man mich denn nun gebracht? Oh, verzeihen Sie mir, Darja Pawlowna, verzeihen Sie, wenn Sie können! ... Du aber,“ wandte er sich an seinen Vater, „du hast mich ja in eine schöne Lage gebracht!“
„Pierre, du könntest dich auch anders ausdrücken, wenn du mit mir sprichst,“ sagte Stepan Trophimowitsch halblaut.
„Schrei nur nicht so! Fang nur nicht an zu schreien, ich bitte dich,“ fiel ihm Pierre, mit den Armen fuchtelnd, ins Wort. „Glaub mir, das sind alles nur alte kranke Nerven und Schreien nutzt da gar nichts. Sag mir lieber, warum du mich dann nicht gleich darauf vorbereitet hast? Konntest dir doch denken, daß ich hier nach meiner Ankunft sogleich auch darauf zu sprechen kommen würde!“
Stepan Trophimowitsch blickte ihm offen in die Augen.
„Pierre, du, der du so viel von dem weißt, was hier vorgeht, solltest du wirklich von dieser Sache nichts, nicht das Geringste gewußt, gehört haben?“
„W–a–as? Na, hör mal ... aber das ist doch! Wir sind also nicht nur ein altes Kind, sondern auch noch ein böses dazu? ... Haben Sie gehört, Warwara Petrowna?“
Es entstand eine Unruhe im Zimmer. Da sollte aber plötzlich etwas geschehen, was niemand auch nur hätte für möglich halten oder gar voraussehen können.
Zunächst muß ich noch erwähnen, daß in den letzten zwei bis drei Minuten Lisaweta Nicolajewna von einer neuen Unruhe ergriffen worden war. Sie hatte schnell ihrer Mutter etwas zugeflüstert, und dann Mawrikij Nicolajewitsch, der sich zu ihr niederbeugte. Ihr Gesicht war erregt, doch zugleich drückte es Entschlossenheit aus. Offenbar hatte sie es jetzt sehr eilig, fortzukommen, denn als Mawrikij Nicolajewitsch die Mama vorsichtig aus dem Lehnstuhle zu heben begann, wollte sie schon helfen – aber sie bezwang sich noch.
Doch das Schicksal schien es nicht zu wollen, daß sie oder sonst jemand das Zimmer verließ, ohne das Ende des Ganzen mit angesehen zu haben.
Schatoff, den alle in seiner Ecke völlig vergessen hatten, und der, wie es schien, selbst nicht recht wußte, warum er da saß und noch nicht fortgegangen war – erhob sich plötzlich von seinem Stuhl und ging mit nicht schnellen, doch festen Schritten durch das ganze Zimmer auf Nicolai Stawrogin zu, ihm gerade ins Gesicht sehend.
Stawrogin war der erste, der sofort bemerkte, daß Schatoff sich erhob, und er lächelte kaum – kaum merklich; doch als Schatoff unmittelbar vor ihm stand, hörte er auf, zu lächeln.
Jetzt erst, als Schatoff schweigend vor ihm stehen blieb und keinen Blick von ihm abwandte, bemerkten auch die anderen die beiden.
Alle verstummten – Pjotr Stepanowitsch ganz zuletzt. Lisa und die Mama blieben mitten im Zimmer stehen.
So vergingen ungefähr fünf Sekunden.
Der Ausdruck dreister Befremdung in Nicolai Stawrogins Gesicht verwandelte sich in Zorn, er runzelte die Brauen und – plötzlich ...
Und plötzlich holte Schatoff mit seinem langen, schweren Arm weit aus und schlug ihn ins Gesicht.
Stawrogin wankte.
Schatoff hatte ganz eigentümlich geschlagen, nicht so, wie man sonst Ohrfeigen zu geben pflegt, nicht mit der flachen Hand, sondern mit der festen, geballten Faust – die aber war bei ihm groß, schwer, knochig, mit rötlichem Flaum und Sommersprossen bedeckt. Wenn der Schlag das Nasenbein getroffen hätte, so würde er es unfehlbar zerschlagen haben, doch er traf mehr die Wange, den
linken Mundwinkel und den Oberkiefer, aus dem denn auch sofort Blut zu tropfen begann.
Ich glaube, wir schrien alle auf. Oder vielleicht war es auch nur Warwara Petrowna, die aufschrie. Ich weiß es nicht mehr, jedenfalls war es gleich darauf totenstill. Übrigens dauerte der ganze Zwischenfall nicht länger als zehn Sekunden.
Trotzdem geschah in diesen zehn Sekunden unendlich viel.
Nicolai Stawrogin gehörte zu den Naturen, die Angst überhaupt nicht kennen. Im Duell stand er, während sein Gegner auf ihn zielte, mit der größten Kaltblütigkeit da. Kam er zum Schuß, so zielte und tötete er mit einer Ruhe, die fast tierisch war. Wenn ihn jemand ins Gesicht geschlagen hätte, so würde er ihn gar nicht erst lange gefordert, sondern ihn einfach auf der Stelle totgeschlagen haben: gerade zu diesen Menschen gehörte er, die mit vollem Bewußtsein töten, und nicht etwa in einem Zustande, in dem der Mensch außer sich und unzurechnungsfähig ist. Ja, ich glaube sogar, solche Wutausbrüche, die einen blenden und benommen machen, kannte er überhaupt nicht. Selbst bei dem unermeßlichen Zorn, der sich seiner bisweilen bemächtigte, behielt er sich immer noch vollkommen in der Gewalt, und war sich dessen bewußt, daß ein Totschlag, den er nicht im Duell beging, ihn zum sibirischen Sträfling machen würde; und dennoch würde er den Beleidiger auf der Stelle erschlagen haben, und zwar ohne auch nur einen Augenblick davor zurückzuschrecken.
Ich habe mich immer bemüht, Nicolai Stawrogin richtig zu verstehen. Dank mancher glücklichen Umstände weiß ich vieles über ihn. Nahe liegt mir vor allem, ihn mit gewissen großen russischen Männern zu vergleichen, von denen sich bei uns noch einige legendäre Erinnerungen erhalten haben.
So erzählt man zum Beispiel von dem Dekabristen[33] L–n, er habe immer mit Absicht die Gefahr gesucht, habe sich an ihr berauscht und sie zu seinem Lebensbedürfnis gemacht: als junger Mensch habe er sich fast grundlos herumduelliert, in Sibirien sei er, nur mit einem Messer bewaffnet, auf die Bärenjagd gegangen und habe in den Wäldern mit entsprungenen Verbrechern, die, nebenbei bemerkt, noch gefährlicher als Bären sind, zusammenzutreffen
gesucht. Zweifellos kannte ein Mann wie dieser L–n ganz genau das Gefühl der Angst: aber gerade dieses Gefühl in sich zu überwinden –das war es, was ihn reizte. Übrigens hatte dieser selbe L–n in der letzten Zeit vor seiner Verschickung nach Sibirien eine furchtbare Hungerzeit durchgemacht und sich durch die schwerste Arbeit sein Brot verdient, nur weil er sich den Wünschen seines reichen Vaters nicht fügen wollte. Also hatte er nicht nur im Kampf mit Bären und im Duell seine Standhaftigkeit und Willensstärke zu erproben und zu beweisen gesucht.
Doch seitdem sind viele Jahre vergangen, und die nervöse, zerquälte und gespaltene Natur der Menschen unserer Zeit läßt das Bedürfnis nach solchen unmittelbaren und ungeteilten Empfindungen, wie sie damals von manchen in ihrem Lebensdrang unruhigen Männern der guten alten Zeit so sehr gesucht wurden, überhaupt nicht mehr aufkommen. Stawrogin hätte auf diesen L–n vielleicht hochmütig herabgesehen, hätte ihn einen Feigling genannt, der sich immer selbst ermutigen müsse, ein Hähnchen, oder so ähnlich – nur würde er sich nie laut darüber geäußert haben. Auch er hätte im Duell den Gegner erschossen wie er es ja tatsächlich getan, auch er hätte mit Bären gekämpft, und auch dem Räuber im Walde wäre er ebenso sicher und furchtlos entgegengetreten: nur hätte er alles das ohne das geringste Empfinden eines Genusses, sondern einfach aus unangenehmer Notwendigkeit getan – schlaff, faul, vielleicht sogar gelangweilt. Das Böse in ihm war selbstredend gewachsen, im Vergleich zu L–n, ja selbst zu Lermontoff. In ihm war es vielleicht noch größer als in diesen beiden zusammen, aber dieses Böse war, wie gesagt, kalt und ruhig, war, wenn ich mich so ausdrücken darf, vernünftig – und somit das Widerlichste, das Furchtbarste, das es überhaupt geben kann.
Also noch einmal: ich hielt ihn damals und halte ihn auch heute noch, nachdem alles schon vorüber ist, für gerade so einen Menschen, der, wenn er einen Schlag ins Gesicht erhält, den Beleidiger sofort und ohne Zögern totschlägt.
Und doch geschah in diesem Falle etwas ganz anderes – etwas Rätselhaftes.
Kaum stand Nicolai Stawrogin wieder fest und aufrecht, nachdem er unter der Wucht des Schlages schmählich gewankt hatte, kaum war der gemeine, gleichsam nasse Schall des Schlages verhallt – da packte er auch schon Schatoff mit beiden Händen fest an den Schultern. Aber sofort, ja schon im selben Augenblick, riß er die Hände wieder zurück und kreuzte sie auf dem Rücken. Er schwieg. Er sah nur Schatoff an. Und sein Gesicht wurde fahl. Doch sonderbar: sein Blick erlosch gleichsam. Aber schon nach zehn Sekunden blickten seine Augen wieder kalt und – ich bin überzeugt, daß ich mich nicht getäuscht habe – vollkommen ruhig: nur bleich war er noch wie ein
Hemd. Freilich weiß ich nicht, was in seinem Innern vorging, ich sah nur das Äußere.
Ich glaube, ein Mensch, der z. B. ein rotglühendes Eisenstück ergreift und es in der Hand preßt, um seine Standhaftigkeit zu erproben, und der dann zehn Sekunden lang einen unerträglichen Schmerz aushält und damit endet, daß er ihn bezwingt – ich glaube, ein solcher Mensch würde ähnliches empfinden wie Nicolai Stawrogin in diesen zehn Sekunden.
Der erste von beiden, der die Augen niederschlug, war Schatoff, und wie man sah, weil er dazu gezwungen war. Darauf wandte er sich langsam um und verließ das Zimmer, doch nicht mehr mit demselben festen Schritt, mit dem er vorhin auf Stawrogin zugeschritten war. Er ging leise und ganz besonders ungelenk hinaus, mit gehobenen Schultern, gleichsam bucklig und mit gesenktem Kopf, als dächte er schweren Gedanken nach. Ich glaube, er murmelte irgend etwas. Bis zur Tür ging er vorsichtig, ohne irgendwo anzustoßen oder etwas umzuwerfen, die Tür selbst aber öffnete er nur ein wenig, so daß er sich dann beinahe seitwärts wie durch einen Spalt durchschob. Gerade dort an der Tür war sein Haarschopf, der steif auf dem Kopfwirbel abstand, ganz besonders bemerkbar.
Kaum war die Türe hinter ihm geschlossen, als noch vor allen Ausrufen ein furchtbarer Schrei durch das Zimmer gellte. Ich sah, wie Lisaweta Nicolajewna ihre Mutter an der Schulter und Mawrikij Nicolajewitsch am Arm packte, sie zwei- oder dreimal mitriß, als wolle sie so schnell wie nur möglich weg von hier, doch plötzlich
stieß sie den Schrei aus und stürzte ohnmächtig längelang hin. Noch jetzt glaube ich zu hören, wie ihr Kopf auf den Teppich schlug.