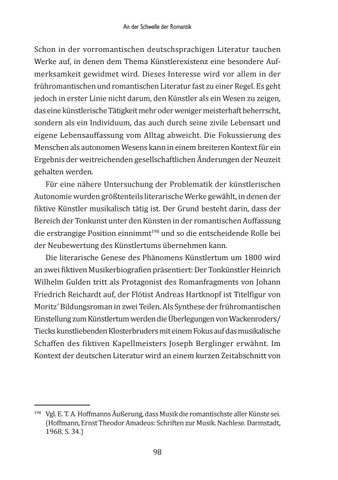An der Schwelle der Romantik
Schon in der vorromantischen deutschsprachigen Literatur tauchen Werke auf, in denen dem Thema Künstlerexistenz eine besondere Auf
merksamkeit gewidmet wird. Dieses Interesse wird vor allem in der frühromantischen und romantischen Literatur fast zu einer Regel. Es geht
jedoch in erster Linie nicht darum, den Künstler als ein Wesen zu zeigen, das eine künstlerische Tätigkeit mehr oder weniger meisterhaft beherrscht, sondern als ein Individuum, das auch durch seine zivile Lebensart und
eigene Lebensauffassung vom Alltag abweicht. Die Fokussierung des
Menschen als autonomen Wesens kann in einem breiteren Kontext für ein Ergebnis der weitreichenden gesellschaftlichen Änderungen der Neuzeit gehalten werden.
Für eine nähere Untersuchung der Problematik der künstlerischen
Autonomie wurden größtenteils literarische Werke gewählt, in denen der fiktive Künstler musikalisch tätig ist. Der Grund besteht darin, dass der
Bereich der Tonkunst unter den Künsten in der romantischen Auffassung die erstrangige Position einnimmt198 und so die entscheidende Rolle bei
der Neubewertung des Künstlertums übernehmen kann.
Die literarische Genese des Phänomens Künstlertum um 1800 wird
an zwei fiktiven Musikerbiografien präsentiert: Der Tonkünstler Heinrich Wilhelm Gulden tritt als Protagonist des Romanfragments von Johann
Friedrich Reichardt auf, der Flötist Andreas Hartknopf ist Titelfigur von Moritz´ Bildungsroman in zwei Teilen. Als Synthese der frühromantischen
Einstellung zum Künstlertum werden die Überlegungen von Wackenroders/ Tiecks kunstliebenden Klosterbruders mit einem Fokus auf das musikalische
Schaffen des fiktiven Kapellmeisters Joseph Berglinger erwähnt. Im Kontext der deutschen Literatur wird an einem kurzen Zeitabschnitt von
198
Vgl. E. T. A. Hoffmanns Äußerung, dass Musik die romantischste aller Künste sei. (Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Schriften zur Musik. Nachlese. Darmstadt, 1968, S. 34.)
98
Ukázka elektronické knihy, UID: KOS225694