Mitteilungen aus dem KKG - herausgegeben mit freundlicher Unterstützung der Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler
Jubiläums-Ausgabe 2024
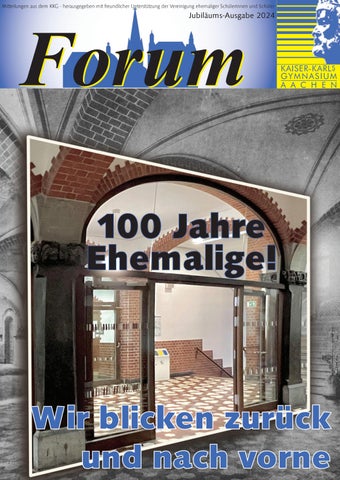
Mitteilungen aus dem KKG - herausgegeben mit freundlicher Unterstützung der Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler
Jubiläums-Ausgabe 2024
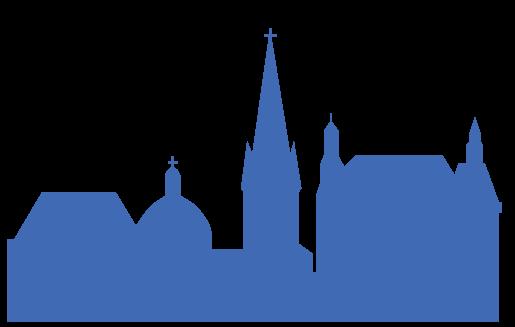


Impressum......................................................................................................................................................................................2
Grußworte: Marco Sievert, Sibylle Keupen....................................................................3
πάνταῥεῖ.........................................................................................................................................................................................5
Journalismus üben – Freiheiten ausleben..............................................................................6
Kunst-AG am KKG.............................................................................................................................................................7
Zwei KKG-Absolventen von brauner Justiz ermordet.........................................8
Spurensuche am KKG.................................................................................................................................................9
Ein Hofjuwelier und ein Textilfabrikant hatten die Idee – 100 Jahre Ehemaligen-Vereinigung............................................................................................................10
Geschichtsträchtiger Ort in der ersten Etage - zum Ehrenmal „Die Kameradschaft“..............................................................................................................................................................16
Arthur Eichengrün – ein großer, aber vergessener Sohn der Stadt..................................................................................................................................................................................................21
30.000 Bücher bilden die Bildung bis ins 17. Jahrhundert ab........22
Dirk Adamschewski ist neuer Schulleiter: 860 Menschen aus 40 Nationen......................................................................................................................................................................24
Mitgliederversammlung 2023: Aus dem Vollen schöpfen.................25
Grabinschriften auf dem KKG-Quadrum.............................................................................26
Kultlehrerin Edda Möller-Kruse verstorben..................................................................27
Gratulation zum Abitur!......................................................................................................................................28
Einladung zur Mitgliederversammlung....................................................................................29
Kassenbericht........................................................................................................................................................................29
400 Jahre Kaiser-Karls-Gymnasium...............................................................................................30
Veronika Poestges: Eindringling in eine heile Männerwelt..............32
Josef Konrads – ein ausdrucksstarker Philologe ................................................33
Dr. Stephan Buchkremer – der Retter des Münsters...............................33
Franz Stettner über seine Zeit am KKG...............................................................................34
Sextaner sind mit ihrem Latein am Ende............................................................................35
Dankeschön, Hermann Gatersleben.......................................................................................35
Gerd Kipp zieht Bilanz........................................................................................................................................36
Frank Bräutigam: „Deutschlehrer am KKG haben mein Interesse für den Beruf geweckt“...................................................................................................................................37
Alfons Breuer: Abitur vor 80 Jahren..........................................................................................38
Lebenstraum, schon in der Quinta: Franz Ewald Clemens, Lateinlehrer am KKG...........................................................................................................................................39
Toni Jansen: Ein Priester ganz ohne die Liturgie des Üblichen...40
Franz Wamich: Ein Jahr nach dem Abitur in Frankreich gefallen.........................................................................................................................................................................................41
Gerd Janczukowicz: „Ich bin theaterbegeistert, vielleicht sogar theaterbesessen“.........................................................................................................................................................43
Axel Deubner: „Heute überkommt mich ein Nostalgiegefühl“...45
Kurz notiert................................................................................................................................................................................46
Heinz Grahn: Natürliche Autorität eines englischen Gentleman............................................................................................................................................................................46
August Hütten: Verschüttet.........................................................................................................................47
Bekannt für seine rheinisch-humorvolle Unterrichtsgestaltung: Bernd Schwemmer .........................................................................................................................................48
Kurt Malangré: „Erster Ehemaliger“ der Stadt Aachen .............................49
Zum Tod von Paul-Wolfgang Jaegers....................................................................................50
Herausgegeben von der Vereinigung ehemaliger Schüler/innen des Kaiser-Karls-Gymnasiums
Augustinerbach 9
52062 Aachen
E-Mail: info@kkg-ehemalige.de
Verantwortlich:
Heiner Hautermans, Aachen
Grafik/Layout:
Axel Costard, Aachen
Druck:
Druck & Verlagshaus Mainz GmbH, Aachen

Einleitende Worte von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen und dem Vorsitzenden der Ehemaligen-Vereinigung, Marco Sievert
Ein Jubiläum mit Blick nach vorne!
100 Jahre! Das ist ein Grund zum Feiern. Und das tun wir auch – allerdings in einer etwas anderen Form, als man vielleicht erwarten würde. Die Sektflaschen bleiben im Keller, die Luftschlangen in der Tüte. Stattdessen nutzen wir die finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, für die Förderung der heutigen Schülerinnen und Schüler. Unser Fokus liegt auf aktuellen Projekten, die in die Zukunft gerichtet sind. Natürlich sollen aber auch unsere Mitglieder etwas von unserem Jubiläum haben: Deshalb erscheint das Forum 2024 als Sonderausgabe in doppelter Stärke, mit ausgewählten Artikeln aus den letzten Jahrzehnten. Viel Spaß bei der Lektüre.
Als 1924 die Gründer der Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums nach langjährigem Engagement beschlossen, den Verein ins Leben zu rufen, war die Welt eine völlig andere. Jürgen Bertram, selbst ehemaliger Schüler und zuletzt Schulleiter des KKG, hat sich intensiv mit der Geschichte unserer Vereinigung auseinandergesetzt. In dieser Ausgabe zeichnet er die Entwicklung von den Anfängen bis heute nach. Dabei beleuchtet er auch den manchmal ambivalenten Umgang der Vereinigung mit der jeweiligen Zeitgeschichte.
Ein einschneidendes Ereignis für unsere Schule steht bevor: Die Lehrerbibliothek, die seit 400 Jahren besteht, wird umziehen müssen. Viele der Bücher sind von unschätzbarem Wert und können in den bisherigen Räumlichkeiten nicht mehr angemessen geschützt und gepflegt werden. Über die Zukunft dieser wertvollen Sammlung berichtet Max Nießen ausführlich in dieser Ausgabe. In unseren Archiven haben wir zudem alte Artikel entdeckt, die bedeutende Ereignisse und bemerkenswerte Persönlichkeiten in Erinnerung rufen. Diese historischen Beiträge haben wir als Faksimiles mit den Original-Jahreszahlen in diese Ausgabe integriert.

Eine Ära geht auch in der Redaktion zu Ende: Unser langjähriger Chefredakteur Heiner Hautermans verabschiedet sich aus seiner aktiven Rolle. Er bleibt uns jedoch in beratender Funktion erhalten. Heiner hat das Amt seinerzeit überraschend übernommen, nachdem sein Vorgänger Hanns Bittmann unerwartet verstorben war. Was als kurzfristige Lösung begann, entwickelte sich zu beinahe zwei Jahrzehnten engagierter Arbeit, für die wir ihm herzlich danken. Wie es nun weitergeht, wird sich zeigen – aber ohne die Unterstützung der Ehemaligen wird es nicht gehen. Daher unser Aufruf: Wer Lust am Schreiben hat und Interesse an spannenden Menschen und Geschichten, meldet sich bitte bei uns unter info@kkg-ehemalige.de. Wir freuen uns auf frischen Wind! Marco Sievert
Ich gratuliere herzlich!
Die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das ist in unserer Stadt sicherlich nicht selbstverständlich und stärkt neben der Schulgemeinde am Ende die Schülerinnen und Schüler.
Die Vereinigung sieht ihre Aufgabe darin, mit ihren Einnahmen durch Mitgliederbeiträge die Arbeit des Fördervereins des KKG zu ergänzen. Sie ist sozusagen das „zweite Standbein“ bei der ideellen und materiellen Unterstützung der Schule, denn ohne die beiden Institutionen könnten viele außerunterrichtliche Veranstaltungen und Aktivitäten nicht stattfinden.
Uralte Tradition ist zum Beispiel die Verleihung des Buchpreises durch die Vereinigung an verdiente und besonders engagierte Schülerinnen und Schüler beim jährlichen Karlsfest im Janu-ar, die Herausgabe des jährlich erscheinenden Mit-teilungsblattes „Forum“ und die Ausrichtung ei-nes Ehemaligentreffens.
Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und bedan-kemich ganz herzlich für so viel ehrenamtlichesEngagement der Ehemaligen.
Sibylle Keupen Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen

Wo kann der Maschinenmensch im Schulalltag helfen? Zusammenbau aus Einzelteilen dauert viele Monate.
Freitags in der 7./8. Stunde sind die meisten KKG’ler schon nach Hause ins Wochenende gestartet. Aber in der Physik ist immer noch richtig viel los. Am 30. August saßen wir – das sind 22 junge TüftlerInnen - in der Physik und warteten gespannt auf den Auftakt des neu eingerichteten MINT-Kurses zum humanoiden Roboter. Marco Sievert als Vorsitzender der Vereinigung der Ehemaligen kam herein und erklärte, dass es in diesem Jahr ein großes Jubiläum gebe. 100 Jahre gibt es die Vereinigung jetzt schon. Zu diesem ganz besonderen Anlass überreichte Marco Sievert uns feierlich einen Bausatz für einen humanoiden Roboter.

Gemeinsam mit unserem Lehrer Herrn Kral werden wir nun diesen Roboter bauen und uns neben der Technik auch mit verschiedenen Fragestellungen auseinandersetzen: Wozu brauchen wir einen Roboter, der dem Menschen ähnlich ist? Wo genau kann er uns im Schulalltag helfen? Was werden wir unserem humanoiden Roboter alles beibringen können?
Fragen, die aktuell viel in unserer Gesellschaft, vor allem von Erwachsenen diskutiert werden. Aber jetzt dürfen wir auch mal ran!
Der MINT-Kurs ist für alle Jahrgangsstufen gedacht. Hier arbeiten wir gemeinsam an unserem großen Projekt. Herr Kral leitet den Kurs und kümmert sich um alles Organisatorische. Er hat im Vorfeld viele Bauteile mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, damit wir mit dem Zusammenbau des Roboters schnell loslegen können. Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler haben uns nun die Hardware geschenkt, mit der wir die 3D-Druckbauteile nach einer Anleitung zusammensetzen können. Dazu gehören hochwertige Lagerungen und ganz viel Elektronik. Servomotoren steuern die Bewegungen des Roboters. Ein kleiner
Computer namens RasperyPi5 soll unseren Roboter lebendig werden lassen. Wir sind gespannt und neugierig.
In den nächsten Monaten werden wir den Roboter aus all seinen Bestandteilen so zusammenbauen, wie es sein Entwickler sich ausgedacht hat. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass sich der Roboter auch weiter entwickeln lässt. Wir sind herzlich eingeladen, einzelne Bauteile gezielt zu verändern. Damit könnten wir unseren Roboter aussehen lassen wie Kaiser Karl. Oder wir entwickeln einzelne Bauteile weiter, so dass sie mehr Stabilität besitzen oder die Bewegungsabläufe besser gelingen. Dazu stehen alle 3D-Druck-Bauteile öffentlich zur Verfügung und können selbst verändert und weiterentwickelt werden. Damit nehmen wir Teil an einem großen Projekt und entwickeln gemeinsam mit vielen anderen auf der Welt diesen Roboter weiter. Damit der humanoide Roboter von uns allen zielführend aufgebaut werden kann, hat jeder von uns Verantwortung für einen Teil des Roboter-Projektes übernommen. Emmi Isik aus der 6b arbeitet gemeinsam mit ihrem Team am Zusammenbau des linken Roboter-Arms. Sie interessiert sich
schon seit langem für das Thema Robotik.
Emmi: „Wir haben zu Hause auch einen Roboter. Ich finde Roboter hochinteressant. Ich vermute, dass wir für den Zusammenbau fast zwei Jahre benötigen werden.“
Charlotte Berg aus der 9c wird das Projekt managen und die Übersicht über die vielen verschiedenen Bauelemente und Arbeitsschritte behalten, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teams zu stärken. Lars (6c), Ava (6d) und Oona (6b) arbeiten im Team, das sich um die Öffentlichkeitsarbeit dieses MINT-Kurses kümmert. Wir schreiben Texte für die Homepage oder andere Beiträge und überlegen uns, wie wir das Projekt humanoider Roboter im KKG präsentieren können. Vielleicht wird es einen Beitrag beim nächsten Karlsfest geben? Wir werden sehen. Lars (6c), Kiran (6c) und Pavel (8d) werden sich um die Organisation weiterer Veranstaltungen kümmern. Vielleicht wird es einen Filmabend geben, der sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Die technische Entwicklungsabteilung kümmert sich um den Zusammenbau der einzelnen Körperteile, Jad, Adam und Lars z.B. um den Oberkörper, Emmi, Oona, Benjamin, Mukul, Favilo, Atilla um den Kopf, Pavel, Jonas, Jonathan, Julio, Lasse und Justus um Hardware und Elektrik, Vladimir, Johannes, Kiran, Paul um den linken Arm, Ava, Kayata, Lorin, Elli um den rechten Arm. Wir danken der Vereinigung der Ehemaligen für diese großartige Gelegenheit, sich mit moderner Technologie auseinanderzusetzen. Danke für die großzügige Spende des Bausatzes. Daneben möchten wir auch unserem Lehrer Herrn Kral danken. Ohne ihn wäre diese Idee nicht zur Wirklichkeit geworden.
Oona Riihijärvi (6b)

Die wahre Bedeutung erschloss sich erst bei der Abifahrt 1973 nach Griechenland.
„Alles fließt.“ Dieses Motto hatten wir bereits des öfteren im Griechisch-Unterricht bei K.P. Tholen vernommen und im Philosophie-Kurs von G. Kipp als zentrale Aussage der Vorsokratiker erfahren. Wie sich dessen Inhalt jedoch für uns Pennäler in der Praxis erschließen würde, wurde uns erst auf der Abi-Fahrt im April 1973 nach Griechenland gewahr. Alles begann auf der Überfahrt von Brindisi nach Patras. Das Budget für die Übernachtung auf der Fähre reichte gerade für die mäßig bequemen Pullmann-Sessel, in denen sich jedoch einige nicht so recht dauerhaft einrichten konnten. Vielmehr fand man sich schnell an der Bordbar ein und Martini Extra Dry wurde als willkommene Medizin gegen den mitternächtlichen Seegang herausgefunden. Auch deutlich nach Mitternacht hielt es eine dauerlastfeste Truppe auch mehr schwankend als stehend am Tresen. Und so kam es, dass der Sonnenaufgang vor der albanischen Küste mit einem kakophonischen πάνταῥεῖ begrüßt wurde. Nur wenige Tage später waren wir in der Jugendherberge derAthener Plaka eingefal-
len. Die Lehrkörper-Begleitung in Form von Klaus Jochum, Franz Heidbüchel und unserem über neun Schuljahre hochverehrten ClemensAlertzstauntenicht schlecht,dass sich auf dem Tisch des Aufenthaltsraums innerhalb kürzester Zeit eine geschlossene Diagonale von Bier- und Ouzoflaschen angesammelt und die Stimmung immer noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hatte. Auf die Frage, wie sich denn diese mit der humanistischen Erziehung auf den ersten Blick nicht kompatible Verhaltensweise vertrage, kam einer unserer Klassenkameraden, der heute nicht mehr namentlich identifizierbar ist, mit dem Hinweis auf das Schild über der Theke herüber, auf dem in für uns natürlich lesbarer Schrift deutlich stand: πάνταῥεῖ.
Dass dieses Motto auch für Lebewesen anderer Art maßgeblich sei, wurde uns allerdings erst kurz vor Ende der Tour nach dem Aufenthalt in einem vergleichsweise noblen Hotel in Kalambaka unweit der Meteora-Klöster bewusst: Hatten wir uns in den Matratzen der Jugendherbergen von Athen und Olympia noch vor dem

Dr. Ralph Schippan – am KKG von 1965 bis 1974.
üblichen Gekräuche retten können, waren die Folgen dieses Hotelaufenthalts auf der Rückfahrt gen Igoumenitsa unübersehbar. Fast bei jedem von uns juckte es an den Armen oder an anderen Körperteilen und der Mehrklang der Einstiche war unüberfühlbar: Flohstiche. Auch dieser Gattung war es wohl ein Lebenselixier geworden: πάνταῥεῖ.
Um diese Erfahrung reicher konnte der Rest des Griechisch- und Philosophieunterrichts bis zum Abitur auch über bisweilen trockene Phasen immer im Fluss bleiben… Dr.-Ing. Ralph Schippan

Im Karlsschüler frischen Wind ins KKG gebracht. Buntes Durcheinander an Ansichten und Unterrichtsstilen.
Umbruch – das war das Schlagwort, das auch wir Ende der 80er Jahre zu spüren bekamen. Als Sextaner hatten wir aber natürlich keine Ahnung von Humanismus oder Bildungsreformen. Was wir spürten, war der Gegensatz zwischen den traditionellen Strukturen vieler älterer Lehrer und dem frischen Wind, den einige junge oder progressive Lehrkräfte mitbrachten. Das beste Beispiel für diese Gegensätze? Herr Tholen, bei dem wir jeden Morgen die Schultische militärisch korrekt entlang der Linoleumfugen ausrichten mussten. Und Herr Schwemmer, der uns ernsthaft fragte, welche mündliche Note wir uns selbst geben würden. Welche pädagogischen Konzepte dahinter steckten, war uns damals nicht bewusst – aber schnell wurde klar: Das KKG war kein monolithischer Block, sondern einbuntesDurcheinander an Ansichten und Unterrichtsstilen.
Verglichen mit der Schulzeit meines Sohnes war unser Unterricht jedoch durchweg lehrerzentriert. Es ging vor allem darum, den Lehrkräften zu gefallen, ihren Auffassungen zu entsprechen und so eine gute Note zu erzielen. Eigene Meinungen äußern, Thesen aufstellen, Themen selbstständig erarbeiten – all das war entweder nicht gewünscht oder nur ein nettes Beiwerk zu den „eigentlichen“ Unterrichtsinhalten.
lungsorgan – und so wurden wir auch von der Schule behandelt. Wir hatten unseren eigenen Redaktionsraum (B007, später B006), in den sich kein Lehrer verirrte. Wir organisierten alles selbst und erhielten weder von der Schule noch von einem der beiden Fördervereine Unterstützung. Der Karlsschüler war „von Schülern für Schüler“ – und wenn nötig auch „gegen die Schule“.
Während meiner gesamten Schulzeit war ich - mit kurzer Unterbrechung in einer pubertären Hochphase - Mitglied der Redaktion. In mehr oder weniger regelmäßigen Redaktionssitzungen saßen Sextaner mit Quartanern und Oberprimanern nachmit-tags zusammen
wussten genau, was sie taten: Uns Kleinen konnte man schwerer etwas abschlagen. So zogen mein Kumpel Björn und ich als 11-Jährige nach der Schule los, besuchten sämtliche Geschäfte – von Frankenne am Templergraben bis Schuh Deutz am Adalbertsteinweg – und versuchten, Werbeanzeigen an Land zu ziehen. Oft mit Erfolg! Und selbst wenn wir keinen Abschluss machten, so hatten wir doch interessante Begegnungen. Rückblickend würde man das heute wohl als das Sammeln von „Soft Skills“ bezeichnen.
Als Redakteure konnten wir vollkommen frei schreiben, was wir wollten, ohne ernsthafteKonsequenzenbefürchtenzumüssen. Natürlich gab es auch keine „Fleißkärtchen“ für unsere Arbeit. Die Kommentarspalte auf dem Zeugnis schwieg sich über diese Tätigkeit aus. Es ging einzig darum, Themen zu finden, die unsere Mitschülerinnen und Mitschüler interessierten und diese zu unterhalten und zu informieren. Wir berichteten über aktuelle Filme und neuerschienene CDs, kommentierten Sportereignisse, veröffentlichten Rätsel und sammelten Zitate von Lehrern, die hin und wieder dummes oder einfach nur lustiges Zeug im Unterricht erzählten.

Doch wie so oft im Leben, gab es auch am KKG kleine Biotope der Freiheit. Für mich war das der „Karlsschüler“. Seit 1962 als freie Schülerzeitung erschienen, verstanden wir uns als unabhängiges Mittei-
Ganzen.
Als Sextaner wurden wir von den „Großen“ zum Anzeigensammeln geschickt, denn es galt, rund 1.000 DM für den Druck des Hefts aufzutreiben. Die älteren Schüler
Auch politische Themen spielten eine Rolle. Einmal steigerten wir uns richtig hinein und griffen in einem Extrablatt die Schulleitung wegen ihrer vermeintlich zögerlichen Haltung gegenüber der Kommunalpolitik in einem bestimmten Sachverhalt an. Das brachte uns einen Besuch beim Schulleiter ein, der mit uns über das Thema diskutierte und uns nahelegte, in Zukunft gründlicher zu recherchieren. Unsere Eltern haben davon nichts mitbekommen.
Der Karlsschüler war ein kleines Biotop, in dem man frei sein, sich exponieren, zusammenhalten, kreativ sein und sogar ein bisschenEinflussausübenkonnte.Fürmich war es eine spannende und prägende Zeit – und ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so ging. Marco Sievert

Die verschiedensten Bühnenbilder für die English Drama Group gestaltet. Schokolade diente als nahrhafter Antrieb.
Dienstagnachmittag, etwa 14.30 Uhr. In der obersten Etage des Hauptgebäudes riecht es nach Frittiertem. Im Flur liegen Holzlatten, Bahnen von hellem Stoff und ein Tackergerät; nur wenig später wird daraus eine riesige Leinwand entstehen. Sie wird sorgfältig grundiert und dann vor einen Overheadprojektor gestellt werden, wo mithilfe eines Rasters das projizierte Bild mit feinen Linien nachgezeichnet werden wird.
Doch bevor es zu all dem kommt, führt der Geruch nach Essen in einen der Kunsträume, in dem sich eine kleine Gruppe von Schülerinnen versammelt hat und Pommes isst. Der Unterricht zuvor war anstrengend gewesen, die neuen Formeln in Mathe wollen noch nicht in den Kopf rein. Aber all das ist vergessen, als die Kunst-AG sich in ihrem Habitat einfindet, sich gegenseitig Skizzen und Zeichnungen zeigt, sich darüber austauscht. Und nachdem die leeren Pommesschalen schließlich in den Mülleimer geworfen wurden, geht es los.
Ein Bühnenbild, das in der Kunst-AG, „einem Ort für Kreative“, entstanden ist.



Es wird gesägt, gehämmert, straff gezogen und getackert. Die Fähigkeiten dazu erlernten sie alle schnell, selbst wenn sich einige zuvor für handwerklich unbegabt hielten. Die frische Leinwand wird Teil eines Bühnenbilds, das für das neuste Stück der English Drama Group benötigt wird. Nachdem man sich auf die Gestaltung geeinigt und den Entwurf auf der weißen Fläche skizziert hat, wird die Farbe angerührt. Den richtigen Farbton zu treffen – und ihn erneut mischen zu können, wenn die Arbeit an einem anderen Tag fortgeführt wird – bleibt die größte Herausforderung für alle. Doch das beinahe wichtigste Utensil an diesen Tagen ist die Schokolade, die stets für die Schülerinnen bereit liegt. Der Leiter der Kunst-AG, Gert Kipp, weiß, wie er seine Schützlinge bei Laune halten kann. Es wird zu einer Tradition, die auch sein Nachfolger Ralf Gablik später übernehmen wird.
Über die Jahre wird die KunstAG die verschiedensten Bühnenbilder gestalten, etwa das Interieur einer Pension mit drehbaren Wänden für ein Agatha-ChristieStück oder das Hotel zu Fawlty Towers,allespassgenau gebaut für die Bühne
im Theatersaal. Aber auch vor Größerem scheut die kleine Gruppe nicht zurück: Ihr letztes Projekt wird das Bühnenbild für A Midsummer Night’s Dream in der Aula Carolina, mehrteilig, detailverliebt und in Dimensionen, die dem Ort angemessen erscheinen.
Es sind jedoch weniger die fertigen Kulissen, die uns als ehemalige Mitglieder der Kunst-AG im Kopf geblieben sind. Es ist vor allem ein warmes Gefühl, das aufkommt, wenn wir an diese Zeit zurückdenken. Die Kunst-AG war ein Ort für Kreative, es war ein geschützter Raum, an dem wir uns austauschen und ausprobieren und ohne Zwang und Notendruck lernen konnten. Ein Ort, an dem für einige von uns die Grundsteine gelegt wurden für eine kreative Laufbahn.
Und so denke ich auch am heutigen Dienstagnachmittag, als ich diese Zeilen schreibe, mit einem Lächeln zurück an die Kunst-AG – ohne die mein Leben sicherlich anders verlaufen wäre.
Leah Hautermans
Die Suche nach den Ursprüngen der Vereinigung führte in die weiten Keller des KKG.
Die Recherche führt in die unendlichen Weiten des KKG-Kellers: Auf der Suche nach den Ursprüngen der Ehemaligenvereinigung begab sich die „Forum“-Redaktion in das Untergeschoss des 1906 fertiggestellten Schulgebäudes nach Entwürfen des Aachener Stadtbaumeisters Joseph Laurent. Dort liegen viele (ungehobene) Schätze und ehrfurchtsvoll nimmt man die staubbedeckten Papierreliquien in die Hand, etwa die Festzeitung der Obersecunda A anno domini 1929, komplett handgeschrieben und -gezeichnet, in der die „Einjährigen“ von den sechs verflossenen Jahren berichten, die „wie im Traum vorübergegangen“ seien.
Die beiden ersten Ausgaben des „Karlsschüler“, damals noch Schulzeitung und Mitteilungsblatt der Ehemaligen zugleich, zeigen als Deckblatt eine Sextanerzeichnung des Schutzpatrons Karl der Große, dem Kinder zuwinken. Die erste Ausgabe erscheint im Dezember 1929, die zweite im April 1930, gedacht war sie als „neues Bindeglied“ zwischen Lehrerschaft, Schülern und Elternschaft, wie der Vorsitzende des Elternrats, Rechtsanwalt Keutmann, „Zum Geleit“ ausführt. Ihre Existenz verdanke sie vor allem dem Fehlen eines „eignen großen Versammlungs- oder Festraums in der Schule“, erläutert Schulleiter Aloys Billen. Zeichnungen und Aquarelle lockern das 20-seitige Heft auf, ebenso eine Bunte Ecke und Klassiker der Aachener Mundartdichtung. Die Aachener Kaufmannschaft inseriert vielfältig (und bereitwilliger als 2024), natürlich bringt der Karlsschüler seine Ersparnisse zur „Sparkasse seiner Vaterstadt“.
Aus historischer Sicht besonders interessant sind die Hefte aus den frühen 1930er Jahren. So war im Heft des Jahres 1933 von einer „Zeitenwende unter dem Zeichen des völkischen Staatsgedankens“ die Rede, auf der S. 10 dieser Ausgabe werden aber Trommler und Fahnenträger, für die Griechisch und Latein nur noch „alter
Plunder“ sind, durch den Kakao gezogen: „Gerade stehen und jawoll sagen/ Ist bequemer und gesunder.“ Das dürfte den Zwiespalt der damaligen Bildungsanstalt ganz gut wiedergeben: Man fühlte sich mehrheitlich weiter der Wissensvermittlung mit humanistischen Bildungszielen statt etwa nazistischer Rassenlehre verpflichtet, einige Lehrer ließen Zurückhaltung oder gar Ablehnung des nationalsozialistischen Gedankenguts erkennen, wie sich Ministerialdirigent Hans Wolfgang Rombach, der Sohn des von den Nazis aus dem Amt gejagten Oberbürgermeister Wilhelm Rombach, erinnerte. Vielfach sei im KKG Widerstand gegen das Eindringen des Nationalsozialismus geleistet worden.
Hans Wolfgang Rombach wurde 1933 eingeschult und legte 1941 sein Abitur ab. Er berichtet in der Sondernummer des „Karlsschüler“ zum 375-jährigen Schuljubiläum 1976 aber auch von einer ab 1933
auftauchten und den Unterricht mit dem Hitler-Gruß begannen. Mindestens drei der von 1939 bis 1945 am KKG tätigen Erzieher seien „gefährliche Nazis mit einem Schuß Kapo-Sadismus“ gewesen, viele andere hätten sich geschickt hinter der Hakenkreuzfahne versteckt, erinnert sich in derselben Ausgabe Günter Frentz, Abiturientia 1948.
Zwei Karlsschüler wurden von der offiziellen oder selbsternannten braunen Justiz ermordet: der Schriftsteller und Widerstandskämpfer Adam Kuckhoff (Abitur 1921), hingerichtet am 5. August 1943 in Berlin Plötzensee und der damalige Oberbürgermeister Franz Oppenhoff (Abitur 1921), auf Befehl Himmlers von einem Werwolfkommando der SS vor seinem Haus am 25. März 1945 erschossen, als Aachen schon befreit war.
Heiner Hautermans
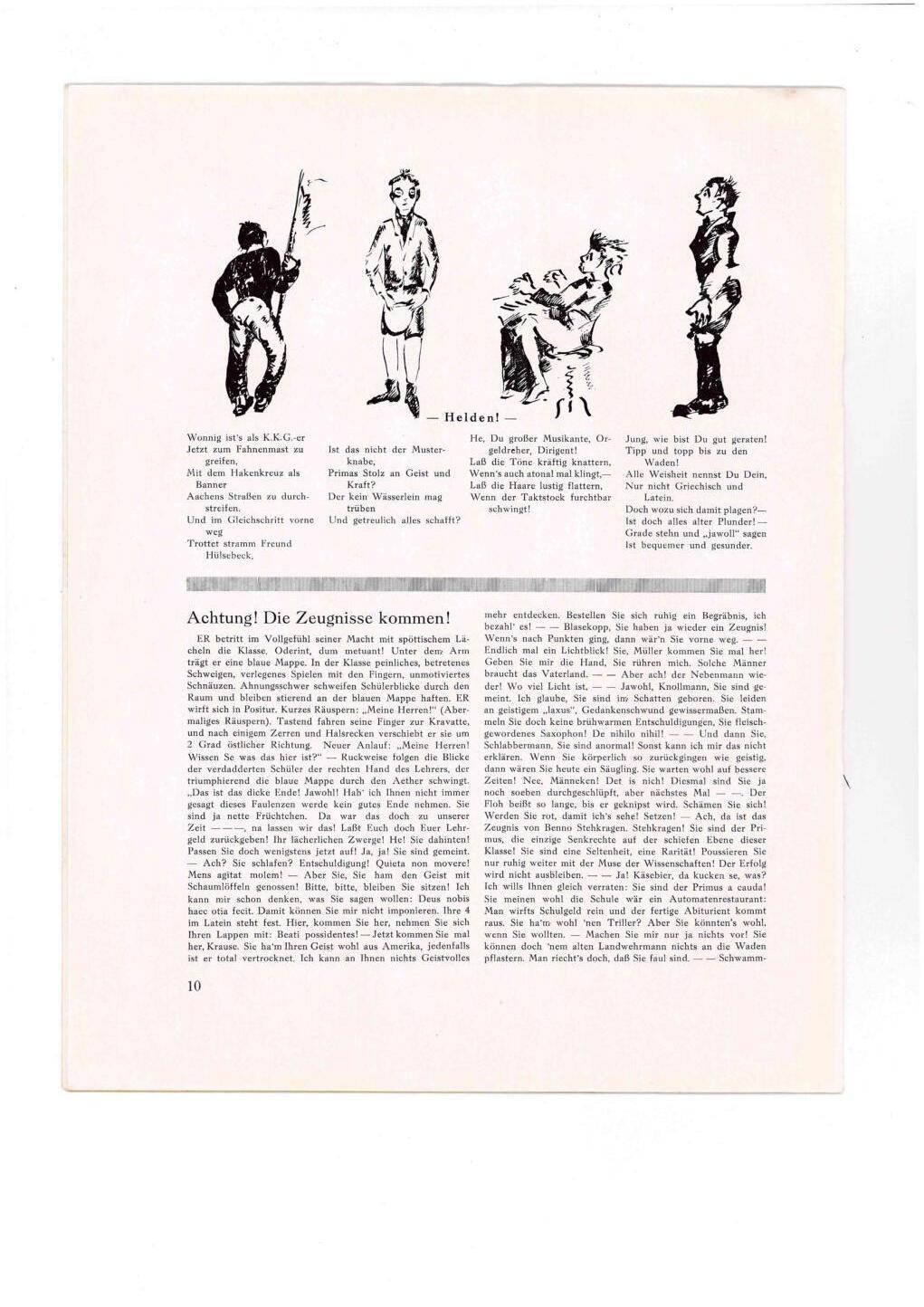
Englischer Arzt erforschte die Wurzeln seiner Familie. Sein Großvater Justizrat Dr. iur. Oskar Francken wurde machte 1887 Abitur am KKG. Der erste jüdische Rechtsanwalt in Aachen.
Das KKG erhielt Anfang des Monats April 2024 Besuch von John Francken, einem pensionierten Zahnarzt aus London, der sich am KKG auf Spurensuche nach seinem Großvater, dem Justizrat Dr. Oskar Francken (2.7.1869 bis 8.9.1932), machen wollte. Auf Einladung der Jüdischen Gemeinde Aachen für Nachkommen von Aachener Juden hatte John Francken in den 1990er Jahren bereits dem EinhardGymnasium, der Schule seines Vaters Dr. Hans Francken, einen Besuch abgestattet. Am Ostermontag, dem 1. April 2024, gab es zum Willkommen ein gemeinsames Abendessen mit John Francken, dem Lehrer Johannes Maximilian Nießen und der Genealogin Iris Gedig, Kuratorin der Internetdatenbank Familienbuch Euregio, die das jüdische Leben in Aachen und am KKG erforschen und den Kontakt hergestellt hatten. John Francken erzählte bei dieser Gelegenheit – auf Deutsch! – seine bewegende Familiengeschichte, der er auch eine Dokumentation gewidmet hat. Eine wichtige Quelle für die Familiengeschichte von John Francken sind die 1370 Briefe seiner Großmutter Dora in SütterlinSchrift, die John Francken transkribiert und ins Englische übersetzt hat – überwiegend Korrespondenz mit Johns Tante Dr. Ruth Francken, wohl einer der ersten in Jura promovierten Frauen.

men auch den Jahresbericht des Schuljahres 1886/1887 beherbergt, in dem sich auf Seite 44 eine Liste der Abiturienten –darunter Johns Großvater Oskar Francken – findet.
Als Oskar Francken 1887 sein Abitur ablegte, existierte der heutige „Altbau“ des KKG, der in den Jahren 1903 bis 1906 errichtet worden ist, noch nicht. Der Unterricht fand im ehemaligen Klostergebäude der Augustiner-Eremiten statt, von dem sich heute nur noch die Aula Carolina erhalten hat.

Am darauffolgenden Dienstag führten Schulleiter Dirk Adamschewski und Johannes Maximilian Nießen John Francken zusammen mit Rolf Gündel von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Aachen durch das KKG und dessen historische Lehrerbibliothek, die zusammen mit weiteren Schulprogram-
Wie aus dem entsprechenden Jahresbericht zu entnehmen ist, besuchten im Schuljahr 1886/1887 insgesamt ca. 500 Schüler das KKG, von denen rund 20 jüdisch waren. Ein Zeitungsartikel des gleichen Jahres weiß zu berichten, dass Oskar Francken als Abiturient des KKG die Ehre zuteil wurde, anlässlich einer Feierstunde zum neunzigsten Geburtstag Kaiser Wilhelms I. einen Vortrag zum Thema „Rückwärts, vorwärts laßt uns blicken“ zu halten. Ein eindrückliches Beispiel für die offenbar reibungslose Akkulturation jüdischer Bürger im Deutschen Kaiserreich. Im gleichen Jahrgang wie Oskar Francken legte auch der spätere Sanitätsrat Dr. Paul Paradies (3.2.1868 bis 26.1.1943) sein Abitur ab. Paradies entzog sich dem Massenmord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden durch Freitod, weshalb er zu den Opfern der Schoah gerechnet werden muss.
Dr. Oskar Francken lehnte es ab, sich taufen zu lassen und war folglich der erste jüdische Rechtsanwalt in Aachen. Sein Büro befand sich in der Wilhelmstraße 107. Im Januar 1899 berichtete der Aachener Anzeiger, dass durch den russi-
schen Studenten Erich von Samson, den Francken wegen Beleidigung angezeigt hatte, ein Attentat auf ihn verübt worden war, das Francken überlebte. Der Attentäter suizidierte sich anschließend. Seit 1906 gehörte Oskar Francken dem Vorstand der Synagogengemeinde Aachen an; seit 1919 war er deren Vorsitzender. Oskar Francken, der zeitlebens an den Folgen der Schussverletzungen zu leiden hatte, starb kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Er ist auf dem jüdischen Friedhof Aachen an der Lütticher Straße bestattet.
John Franckens Vater, Dr. Hans Francken, der am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, dem heutigen Einhard-Gymnasium, sein Abitur ablegte und wie schon sein eigener Vater promovierter Rechtsanwalt war, überlebte die Schoah nur durch einen Zufall, da man ihn mit seinem bereits verstorbenen Vater „Dr. Francken“ verwechselte.
Dr. Hans Francken war zusammen mit Johns Großvater mütterlicherseits, Dr. Georg Heim, auf der Isle of Man interniert, wo sich viele Flüchtlinge, darunter auch Juden, weiteren Repressalien ausgesetzt sahen, nur weil sie aus Nazideutschland stammten. Hans Francken arbeitete als Spion für das britische MI5, um als „Pioneer“ zugelassen zu werden, da es sein größter Wunsch war, den Kampf gegen Hitler aufzunehmen. Da er Deutsch beherrschte, bestand Hans Franckens Aufgabe darin, die Kriegsgefangenen im Latimer House in der Nähe von Amersham abzuhören. Darüber berichtet John ausführlich in seiner Dokumentation.
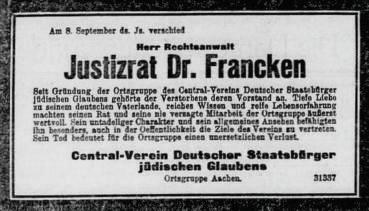
100 Jahre Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums (1924
„Tradition lebendig halten, Wandel im Schulleben aufmerksam begleiten, ideell und finanziell unterstützen und Ehemalige darüber informieren“: so könnte das Motto lauten, das die Rolle der Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums nach einem Jahrhundert ihres Wirkens im KKG auch heute noch im Jahre 2024 umschreibt.
Nach 100 Jahren sieht sich die Vereinigung auch weiterhin einer besonderen Verpflichtung ihrer ehemaligen Schule
benheiten, der Pädagogik und der Lebenswelt Schule. Was hat die KKG-Vereinigung heute nach 100 Jahren mit den Ansprüchen von damals zu tun? Lohnt sich nach 100 Jahren überhaupt in der heutigen Zeit noch ein Engagement der Ehemaligen für die heutigen Schülerinnen und Schüler des KKG?
Schauen wir doch einmal in die wechselvolle Vergangenheit der Vereinigung, denn 100 Jahre sind ein stolzes Jubiläum, zumal sich ein Blick in die Vergangenheit mehr als lohnenswert erweist!
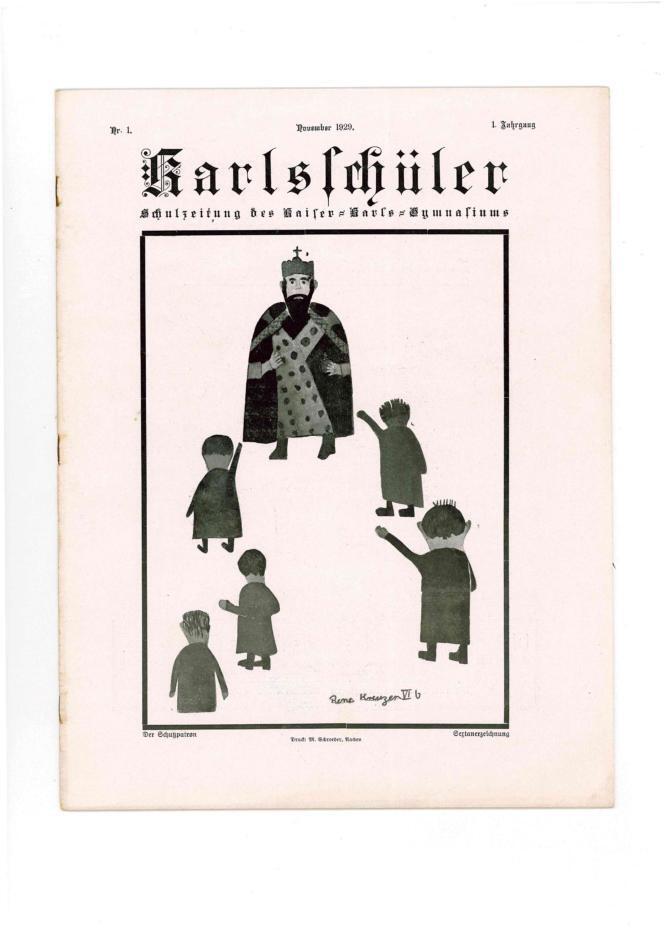
1. Die Gründung der Vereinigung der Ehemaligen (1924) und der „Karlsschüler“ als Mitteilungsblatt
Wie sich das Vorstandsmitglied Josef Hüpgens im Mitteilungsblatt der Vereinigung im Juli 1954 erinnerte, erfolgten die ersten Überlegungen einer Gründung einer „Vereinigung ehemaliger Schüler des KaiserKarls-Gymnasiums“ im Herbst 1923 und Februar 1924.
Hofjuwelier Heinrich Steenaerts und Textilfabrikant Paul Dechamps hatten die Gründungsidee einer „Vereinigung ehemaliger Karlsschüler“ bzw. einer „Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums“. Im Februar 1924 trafen sie sich zur ersten konstituierenden Sitzung im KKG mit Direktor Albert Schulz. Aus dem ersten gedruckten Mitteilungsorgan des KKG, dem „Karlsschüler“ Nr. 1 aus dem Jahr 1929, der ab diesem Zeitpunkt halbjährlich erscheinenden Schulzeitung des KaiserKarls-Gymnasiums, vermerkt der
Vorsitzende der Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums, Landgerichtspräsident Joseph Oppenhoff, Onkel des später von nationalsozialistischen Attentätern ermordeten Aachener Oberbürgermeisters Franz Oppenhoff auf S. 13f.: „Am 04.03.1924 wurde die „Vereinigung ehemaliger Schüler des KaiserKarls-Gymnasium“ endgültig gegründet und trat darauf mit einer großen Versammlung im Alten Kurhaus zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Der Verein bezweckt, die früheren Schüler unserer Anstalt zusammen zu schließen und diese in ideeller und materieller Weise zu unterstützen, in ideeller, indem wir die uns immer noch verbliebene Liebe zu den humanistischen Studien im allgemeinen und zu „unserem“ Gymnasium im besonderen weiteren Kreisen mitzuteilen bestrebt sind; in materieller Weise, indem wir die Summe, die durch den Jahresbeitrag zusammen kommt, dazu verwenden einmal, notleidende Einrichtungen der Schule selbst (z.B. die Schülerbibliothek) zu unterstützen, dann aber auch bedürftigen und würdigen Schülern das Studium zu ermöglichen.“ Nach außen tritt, so Joseph Oppenhoff, die Vereinigung bei kirchlichen und weltlichen Schulfeiern in Erscheinung und richtet für die frisch gebackenen Abiturienten und die Ehemaligen den jährlichen „Osterdienstagskommers“ als geselliges Beisammensein und als Ort der Würdigung der Examensjubiläen (25, 30,40und50Jahre) aus.Versammlungsort am Ende des Schuljahres ist Osterdienstag der große Saal des Alten Kurhauses, nach dem Krönungssaal der größte Raum im damaligen Aachen.
KKG-Schulleiter Aloys Billen erläutert im Karlsschüler 1929 Nr.1 auf S.3: Die bisherigen statistischen Jahresberichte für die Schulbehörde können „kein

924 – 2024). Tradition lebendig halten und Wandel unterstützen.
Bindemittel zwischen Schule und früheren Schülern untereinander werden“. „Gerade in der Vereinigung alter Karlsschüler wurde der Gedanke, eine Schulzeitschrift zu gründen, lebhaft aufgegriffen, und die Schule weiß der Vereinigung wärmsten Dank, daß sie die Gründung ermöglicht hat“. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass gerade die Abitur-Jubeljahrgänge sich „in ihrer früheren Schule einfinden und an Ort und Stelle, wenigstens auf dem von ihrem Schweiß getränkten Boden die Jugendjahre wieder aufleben lassen.“ … „Wir hegen den lebhaftesten Wunsch, daß gerade unsere früheren Schüler Fühlung zu uns behalten, in ihnen sehen wir unsere besten Freunde und Förderer.“ … „Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!“ (Dieses Vorhaben soll gut, glücklich, gesegnet sein und gelingen!)
Der „Karlsschüler“ war ab 1929 also das erste, offizielle Mitteilungsblatt der Schule und diente sowohl der Information der Schüler, Lehrer und Eltern als auch der der Ehemaligen. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts übernahm dann die Schülerzeitung des KKG den Namen „Karlsschüler“.
2. Die Vereinigung in den Jahren 1923 bis 1945
Am 04.03.1924 gründet sich unter dem Vorsitz von dem Landgerichtspräsidenten Joseph Oppenhoff, der der Zentrumpartei angehörte, offiziell die „Vereinigung ehemaliger Karlsschüler bzw. Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums“. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er am 30.05.1933 vom linientreuen Rechtsanwalt Bruno van Kann im Vorsitz der Vereinigung abgelöst, „der es pflichtgemäß unternahm, alte Gepflogenheiten im Sinne einer artgemäßen Nivellierung gleichzuschalten.“ (Josef

Hüpgens, Mitteilungsblatt, Juli 1954). Der Vorstand bestand ab 1933 neben Bruno van Kann aus dem Schulleiter Aloys Billen, seit Mai 1933 Mitglied der NSDAP, dem Fabrikanten Paul Dechamps, dem Dipl.Handelslehrer Heinz Weuthen und dem Chefarzt Dr. Max Krabbel.
1934 sprach KKG-Schulleiter Aloys Billen gemäß der nationalsozialistischen SprachregelunginseinemLeitartikelim„Karlsschüler“ Nr. 1 unter dem Titel „Wandlungen im höheren Schulwesen des völkischen Staates“ von den „unerfreulichen Jahren parlamentarischer Demokratie“. Der „unwiderstehliche Einbruch des nationalsozialistischen Wettersturms in die stickige Atmosphäre“ bedeute „eine epochale Aufrüttelung, Säuberung und Weckung zu neuem hoffnungsfrohen Tun“. „Hitlerjugend und Jungvolk erfaßten eine wöchentlich wachsende Zahl von Jungen, Sekundaner und Primaner strömten in die SA. und SS., der alte Wehrgeist, der alte Sinn für Führertum und Gefolgschaft, der jedem werdenden deutschen Mann im Blut liegt, feierte seine Auferstehung.“ Der „Führer und seine nächsten Helfer“ ließen „nie einen Zweifel darüber aufkommen,
daß es Aufgabe der höheren Schule bleibe, eine körperlich und charakterlich gestählte Jugend zu geistiger Helle, Weite und Wendigkeit heranzubilden.“ Am KKG gab es im Lehrplan nun entsprechende „politische Schulungsstunden“ und „nationalpolitische Lehrgänge“ für Unter- und Oberprimaner, die u. a. auch von der Vereinigung der Ehemaligen großherzig finanziert wurden. Geradezu euphorisch und dem Zeitgeist des „neuen Deutschlands“ entsprechend endet Aloys Billens Artikel mit einem Versprechen: „Das alte Karls-Gymnasium ist innerlich jünger geworden, als es vielleicht jemals war, es wird in heißem Bemühen versuchen, dem Führer und seinem Volke eine Jugend heranzubilden, die Kraft, Eignung und den Willen besitzt, in festem Vertrauen auf ihren Gott, der ein Gott der Mutigen und der Täter ist, am Bau eines freien, stolzen deutschen Staates führend mitzuhelfen.“
Die eindrucksvolle Fassade von 1906 ist durch gotisierende Formen bestimmt

Als Vorsitzender der Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums schreibt Bruno van Kann im Karlsschüler, Nr. 1 (1934), auf S. 2 „ Die Zeiten sind, Gott sei Dank, vorbei, in denen der Abiturient mit hörbarem Aufatmen der Schule den Rücken kehrte, um sich sehr oft nie wieder um sie zu kümmern. Der seit einiger Zeit eingesetzte geistige Umbruch … hat diesen üblen Zeiten für immer ein Ende gemacht.“
Er als Vorsitzender habe „der Vereinigung neuen kräftigen Odem“ eingeblasen. „Daß jeder Schüler, der vom Kaiser-KarlsGymnasium Abschied nimmt, in die Vereinigung einzutreten hat, dürfte wohl eine Selbstverständlichkeit sein.“ Auch die gesamte Lehrerschaft sei beigetreten, so werde „die Vereinigung und die Schule ihre hohen Ziele erreichen…. Es ist ja alles für unser altes Pennal und für die Jugend, die kommende Trägerin Deutschlands, das wir wieder mit Stolz unser Vaterland nennen. Heil, unserem herrlichen Führer.“ Bruno van Kann versteht die Ehemaligenvereinigung als Zwangs- oder mindestens als Pflichtvereinigung und möchte sie nach dem Führerprinzip leiten, etwa wie eine NS-Betriebsgemeinschaft.
In die Zeit des Vorsitzes von J. Oppenhoff (1924 – 33) und B. van Kann (1933 – 39) fällt auch die wechselvolle Geschichte des Ehrenmals „Die Kameradschaft“ von Prof. Hein Minkenberg. 1930 nach einem hoch dotierten und vor allem von der Vereinigung der Ehemaligen (mit dem Vorsitzenden J. Oppenhoff) finanziell immens gesponserten Wettbewerb wurde die Skulptur mit einer festlichen Gedenkfeier
zur Denkmalsweihe in der Schule in der ersten Etage des Altbaus aufgestellt, aber nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1935 schon wieder entfernt und in einem neuerlichen Festakt unter ausdrücklicher, NS-linientreuen Würdigung von Bruno van Kann durch ein „Eisernes Kreuz“ und eine Bronzeplakette mit einem Hitlerzitat ersetzt (s. Forum-Artikel „Geschichtsträchtiger Ort auf der ersten Etage“).
Mit dem Tod des Vorsitzenden Bruno van Kann übernahm von 1939 bis 1945 der Schulleiter OStD Wilhelm Dresen den Vorsitz der Vereinigung.
3. Die Nachkriegsjahre und die Personalie Dr. Hans Globke Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm 1945 Dr. Peter Schmitz die Schulleitung des KKG und auch vertretungsweise den Vorsitz der Vereinigung ehemaliger Karlsschüler. Dem Vorstand gehörte u.a. auch (noch bis 1959) der Arzt Dr. Johannes Wilhelm Freund an.
In den Jahren 1947 bis 1953 folgte Dr. Hans Globke ab 1945 als Stadtkämmerer im Amt, im Vorsitz, den er bis zu seiner ErnennungzumChefdesBundeskanzleramts unter Konrad Adenauer am 27.10.1953 inne hatte. Er gehörte als Ministerialdirigent bzw. Staatssekretär dem engsten Beraterkreis des Bundeskanzlers an, wurde als Adenauers „rechte Hand“ bezeichnet und hatte damit sehr großen Einfluss auf die Politik der jungen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings sollten sich der Chef des Bundeskanzleramts und auch der Kanzler bald massiver
Nachruf in den „Mitteilungen“ der Ehemaligen vom September 1973.
Kritik an Globkes NS-Vergangenheit ausgesetzt sehen.
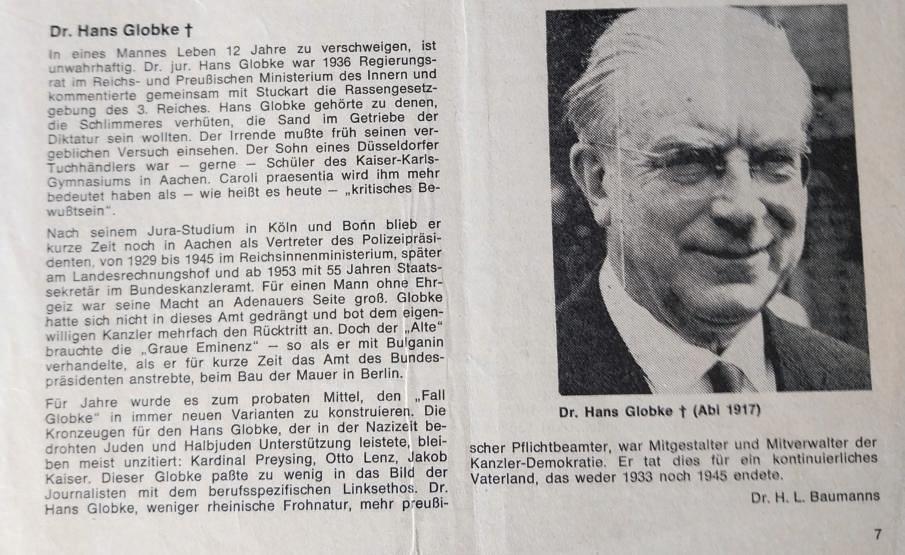
Dr. Hans Globke, KKG-Abiturient von 1916, war studierter Jurist, arbeitete ab 1929 als Regierungsrat im Preußischen Innenministerium und wurde 1932 ins Reichsinnenministerium berufen, in dem er bis 1945 tätig war. Auch wenn Globke kein Mitglied der NSDAP war, wirkte er an der verfassungswidrigen Entmachtung der preußischen Staatsorgane 1932 unter der autoritären Regierung Franz von Papens mit. Vor allem aber seine Abfassung des ersten maßgeblichen Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen von 1935, die den rechtlichen Rahmen der Judenverfolgung im Deutschen Reich bildeten, holte ihn in der Bundesrepublik der Adenauerära ein. Dr. Hans Globke hatte im Jahr 1936 mit einem Vorwort seines Vorgesetzten, dem SS-Obergruppenführer Wilhelm Stuckart, einen Kommentar der antijüdischen Gesetze, dem Kommentar zum Reichsbürgergesetz von 1935, verfasst. Darin werden das Zusammengehörigkeitsgefühl des „rassisch homogenen deutschen Volkes“ propagiert und alle Personen „fremden Blutes“, vor allem Juden, als „rassisch minderwertig“ diskriminiert. Auf Globke geht auch der Vorschlag zurück, „J“-Stempel in Ausweisen anzubringen und ab 1938 Juden zu zwingen, stigmatisierende Vornamen zu tragen. Bei der Entnazifizierung im Nachkriegsdeutschland wird Globke als „unbelastet“ eingestuft. Als der öffentliche Druck in der Bundesrepublik auf ihn immer größer wird, rechtfertigen er und seine Verteidiger ihn mitseinerEigenschaftalsfrommerKatholik. Er stellt sich als Unterstützer verfolgter Juden und Regimegegner dar. Die Führung der DDR schlachtet die Personalie „Globke“ in ihrem eigenen, ideologischen Sinne aus und verurteilt ihn in einem Schauprozess in Abwesenheit zu lebenslanger Haft. In der jungen Demokratie der Bundesrepublik wurde Hans Globke bis heute zum Sinnbild unaufgearbeiteter deutscher Nazi-Vergangenheit. Nicht so im Ehemaligenverein des KKG. Im Mitteilungsblatt vom September 1962 berichtet Josef Hüpgens vom gut besuch-

ten Osterdienstagskommers im großen Saal des Neuen Kurhauses und dem Beifall, den der „Ehrenpräsident“ Staatssekretär Dr. Globke erhielt. Nach den traditionellen Maßstäben des Ehemaligenvereins bewies ein so prominentes, hochdekoriertes Mitglied in einflussreicher Position wie kein zweiter das hohe Prestige der Schule und des Milieus, mit dem sie seit Jahrzehnten verbunden war.
In einem Nachruf in den „Mitteilungen“ der Ehemaligen vom September 1973, als man das halbe Jahrhundert des Bestehens der Vereinigung feierte, stellte Dr. Hans Leo Baumanns – ein junger Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle der CDU und Mitglied im Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung - auf S. 7 den am 13. Februar 1973 Verstorbenen als treuen Staatsdiener dar und ging aus konservativ-katholischer Sicht zum Gegenangriff über: „Hans Globke gehörte zu denen, die Schlimmeres verhüten, die Sand im Getriebe der Diktatur sein wollten. Der Irrende mußte früh seinen vergeblichen Versuch einsehen. (…) Für Jahre wurde es zum probaten Mittel, den „Fall Globke“ in immer neuen Varianten zu konstruieren. Die Kronzeugen für den Hans Globke, der in der Nazizeit bedrohten Juden und Halbjuden Unterstützung leistete, bleiben meist unzensiert (…) Dieser Globke paßte zu wenig in das Bild der Journalisten mit dem berufsspezifischen Linksethos. Dr. Hans Globke, weniger rheinische Frohnatur, mehr preußischer Pflichtbeamter, war Mitgestalter und Mitverwalter der Kanzler-Demokratie. Er tat dies für ein kontinuierliches Vaterland, das weder 1933 noch 1945 endete.“
Das von Baumanns bemühte Stereotyp mit Wut und Verachtung gegenüber dem Mentalitätswandel nach Kriegsende entspricht dem in der deutschen Geschichte der jungen Bundesrepublik oftmals benutzten Muster, in dem sich der Großteil der älteren Deutschen wiederfinden konnte: Aus dem verstrickten bürokratischen Mittäter mit einigen nicht NS-typischen Eigenschaften wird ein ausschließliches Opfer – erst des Regimes, jetzt einer verständnislosen jüngeren Generation. Obwohl faktisch eindeutig Unterstützer des Regimes und aktiv Mitwirkender an massenhaft begangenem Unrecht hat Globke laut Baumanns eigentlich nur versucht, als guter Patriot die Nazi-Diktatur abzumildern, hat selbstlos vom Regime mit dem Tode Bedrohten geholfen und wird ab den 1960ern von einer linksorientierten, DDR-hörigen Klägerschaft diffamiert. Im Haus der Geschichte in Bonn weist heutzutage eine Info-Tafel auf die mehr als zweifelhafte Rolle Globkes in der Ära Adenauers hin. Trotzalledem werden

„Globke-Rettungsversuche“ heute noch gelegentlich am nationalkonservativen rechten Rand der Politik unternommen.
4. Die Vereinigung nach 1953 und der jährliche Kommers
Im Jahr 1953 folgte nach dem Verzicht Globkes, der offenbar zum Ehrenvorsitzenden der Vereinigung erklärt wurde, Dr. Josef Breuer, Stadtkämmerer in Aachen, als Vorsitzender der Ehemaligen. Dem Vorstand gehörten außerdem an: Paul Dechamps, Fabrikant, der seit der Gründung der Vereinigung schon dem Vorstand angehört und in dessen Haus sich auch das Sekretariat der Ehemaligen befand,Dr.Sträter, stellvertretender Regierungspräsident, Dr. Freund, Arzt, Dr. Schmitz als Schulleiter des KKG, und die KKG-Lehrer StR Wimmers und StR Josef Hüpgens. Das Tableau des Vorstands entsprach in seiner Besetzung auch im Wesentlichen weiterhin den Berufsgruppen, die KKGler traditionell und katholisch verwurzelt nach dem Abitur anstreben sollten: Juristen, Beamte, Mediziner, Lehrer.
nigung den fast 50 Jahre bestehenden Termin des Treffens der Ehemaligen erstmals vom „Osterdienstagskommers“ auf das „Oktoberfest“ zu verlegen. Die Entscheidung fiel wohl nicht leicht, titelte der Schriftführer Hanno Ernst auf der Titelseite des Mitteilungsblatts Nr. 1 vom März 1971 empathisch und in großen Lettern: „Der „Osterdienstag“ ist kaputt Jetzt gibt es ein „Oktoberfest“. Der 2. Samstag im Oktober wurde als fester Termin für die Zukunft festgelegt. Gründe waren, wie Hanno Ernst

Das Gebäude ist in allen Teilen massiv hergestellt. Die Korridore sind überwölbt und mit Steinfliesen belegt.
In dieser Zeit informierte die Vereinigung ihre Mitglieder ein- bis zweijährlich schriftlich über ihre Aktivitäten und das jährliche Treffen unter dem Titel „Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-KarlsGymnasiums“. In diesen vier-sechsseitigen Mitteilungsblättern wurden die Jubelabiturientia („Grüne“ die Aktuellen, „Silberne“ nach 25 Jahren, „Goldene“ nach 50 Jahren, außerdem die 30jährigen und 40 jährigen) und die ältesten teilnehmenden KKG-Abiturienten jedes Mal besonders erwähnt. Gerade sie nahmen bei dem jährlichen Kommers der Vereinigung, der feierlich am Osterdienstag mit Studentenliedern und musikalischer Begleitung begangen wurde, eine besondere Rolle ein, denn in langen Reden gedachten sie ihrer vergangenen Schulzeit. Außerdem gab es im Mitteilungsblatt u.a. Informationen zu baulichen Entwicklungen, Themen von Schüleraufsätzen im Fach Deutsch oder Fahrtenzielen der Oberstufe.
1971 beschloss der Vorstand der Verei-
aufführte, dass zunehmend mehr Familien mit schulpflichtigen Kindern die Osterferien für Urlaubsreisen nutzen wollten und es für Berufstätige nach den freien OsterFeiertagen wegen des „höheren Arbeitsanfalls“ schwierig sei, dienstags den Weg nach Aachen auf sich zu nehmen. Hanno Ernst schreibt auch von zunehmend geringer werdender Resonanz bei den frisch „gebackenen“ Abiturienten, die zu Schuljahresende vor den Sommerferien ihre Reifeprüfung abgelegt hatten.
Bis 1981 wurde das Oktoberfest der Ehemaligen-Vereinigung nach dem Abriss des Festsaaltrakts des Alten Kurhauses im Neuen Kurhaus und im „Zwischenstandort“ Quellenhof in Aachen abgehalten, dann erstmalig in den Musiksaal des KKG und schließlich nach ihrer Fertigstellung ab 1985 in die zur Schulaula umgebaute Gymnasialkirche verlegt, die einige Jahre später den Namen „Aula Carolina“ erhielt. 5. Die Vereinigung in den Jahren 1961 - 1983 und der Schulleiter Johannes Helmrath
1959 hatte Dr. Heinz Fries am KKG Dr. Schmitz als Schulleiter abgelöst, ihm folg-
te dann Johannes Helmrath von 1961 –1983, von seinen Schülern ehrfurchtsvoll „Zeus“ genannt.
In seine Zeit fällt auch der Beginn der langen Amtszeit des Arztes Dr. Hermann Gatersleben als Vorsitzender der Vereinigung der Ehemaligen. Von 1969 an stand er an der Spitze der Vereinigung und sollte diesen Posten 30 Jahre lang ausfüllen.
Außerdem gehörten dem Vorstand an: Dr. Hans Bertram, Arzt, Ernst Franzen, OStD i.K. und Hauptabteilungsleiter Schule im Bistum Aachen, Franz Kerres, Architekt, der Landgerichtsdirektor Dr. Hans Keutgen, Wolfgang Trees, Jounalist, Johannes Helmrath, Schulleiter, Klaus Jochum, KKG-Lehrer und Schatzmeister, der oben erwähnte Dr. Hans Leo Baumanns, Johannes Ernst, Journalist und Mitbegründer der Aachener Volkszeitung, der Justitiar Dr. Hans-Josef Giani, Joseph Hüpgens, KKG-Lehrer, August Kerres, Architekt, und der Radioastronom Dr. Eugen Preuß.
Direktor Helmrath nutzte ausgiebig das Publikationsorgan der Vereinigung, um seine Sicht der Schule und seine bildungspolitischen Vorstellungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Er prägt in seinen Artikeln den Ton der Mitteilungen der Ehemaligen entscheidend und schießt seit den späten 1960ern scharf gegen den Zeitgeist und schulische Bildungsreformen.
Das KKG-Mitteilungsblatt der Ehemaligen veröffentlicht z.B. doppelseitig im März 1971 wesentliche Teile der Karlsfestrede von Helmrath. Unter dem Titel „Zum Strukturplan des Deutsche Bildungsrates –zwischen Theorie und Praxis“ kritisiert der KKG-Schulleiter die drei bildungs- und sozialpolitischen Hauptziele: „die Förderung einer größtmöglichen Zahl von Schülern“, „die Herstellung allgemeiner Chancengleichheit“ und die „vollkommene soziale
Für Johannes Helmrath waren die bildungspolitischen Veränderungen der 70er Jahre ein „Desaster“.

Integration“, womit vor allem der Abbau von gesellschaftlichen „Standesschranken“ gemeint ist. Helmraths Bedenken, die er im mit 1300 Zuschauern voll besetzten Auditorium Maximum beim Karlsfest zum Besten gibt, richten sich vor allem gegen die geplanten Wahlmöglichkeiten in der Sek I und II und die damit verbundene „Freiheit“ der Entscheidungen von Schülern und Eltern, denen es laut Helmrath an „Sachkenntnis und Erfahrungen fehle“, gegen die „Förderung großer Schülermassen“, die seiner Meinung nach einhergeht „mit der Retardierung der Hochbegabten“, und: „Das eigentliche Schlimme ist sein Totalitätsanspruch. Wir könnten einem Systemzwang entgegengehen, wie ihn keine freiheitliche Demokratie der Gegenwart kennt.“
Mit der Überschrift „Desaster“ resümiert Johannes Helmrath auch noch 25 Jahre später in seinen Erinnerungen an seine KKG-Jahre eine bittere Bilanz bildungspolitischer Veränderungen: „Daß es nicht in das Ermessen eines Halbwüchsigen gestellt werden kann, je nach seiner augenblicklichen Entwicklungsbefindlichkeit mit 15, 16 oder 17 Jahren das Programm seiner Bildung auszuwählen, habe ich immer für selbstverständlich gehalten. (…) Was die Oberstufenreform wollte und will, ist das À-la-carte-Prinzip. Verantwortungsvolle Pädagogik müßte aber das Menü-Prinzip bevorzugen. Wenn man Bildungsverantwortung ausschließlich von einem sozialpolitischen Gesichtspunkt her organisieren will, muß das zu einem Desaster werden. Und dieses Desaster haben wir heute.“ („Forum“, Herbst 1996, S. 2)
Mit Fug und Recht wird man heute, noch einmal fast 30 Jahre später, feststellen können, dass das beschworene „Desaster“ ausgeblieben ist und die Wahlmöglichkeiten in der Sek I und II sich fest etabliert haben.
1976 beging die Schule in der Ära Helmrath die Feierlichkeiten zum 375-Jahre-Kaiser-Karls-Gymnasium-Jubiläum und gab mit finanzieller Unterstützung der Ehemaligenvereinigung eine offizielle Festschrift und eine Sondernummer des „Karlsschülers“, der Schülerzeitung, heraus.
In Helmraths Amtszeit fällt auch die Gründung des „Vereins der Freunde und Förderer“ (1976). Damit hat das KKG seit dieser Zeit zwei Institutionen, die die Schule finanziell und ideell unterstützt.
Seit 1972 sind am KKG die ersten Mädchen in der Schule aufgenommen worden, in den Jahren 1980 und 1981 legten dann die ersten jungen Frauen am KKG ihre Abiturprüfung ab. Es sollte aber noch ein paar Jahre dauern, bis die Ehemaligen sich den Namen „Vereinigung ehemaliger
Schüler und Schülerinnen des Kaiser-KarlsGymnasiums“ gaben.
6. Die Vereinigung in den Jahren der Schulleiter Elmar Bach, Ulrich Reinartz (kommissarisch) und Dr. Paul-Wolfgang Jaegers (1983 – 2014)
Im Jahr 1995 erhielt das Mitteilungsblatt der Vereinigung den neuen Namen „Forum“. Unter dem Titel „Ein Forum für alle Freunde des KKG“ schreiben der Vorsitzende Dr. Gatersleben und der Schulleiter Dr. Jaegers, dass die neue Bezeichnung nicht nur eine „Anspielung auf die humanistischen Wurzeln“ der Schule, sondern im Sinne der Antike ein Platz für Mitteilungen und des Gedankenaustauschs sein solle (Forum Herbst 1995, S. 1). Damit wurde die seit der Gründung der Ehemaligen die alte Tradition des gemeinsamen Publikationsorgans von Ehemaligen und Schule in neuem Gewand beibehalten. Allerdings mit einer entscheidenden Erweiterung: Während sich bis dahin fast 70 Jahre lang die Mitteilungen in verschiedenem Gewand nur von „oben“, d. h. vom Vorstand und der Schulleitung, an die Öffentlichkeit richteten, sollte die Ausrichtung des „Forum“ auch um Beiträge von Mitgliedern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern erweitert werden und das vielfältige Schulleben spiegeln.
Bis heute ist das seit 1995 jährlich erscheinende „Forum“ das Mitteilungsblatt für ehemalige Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, ist aber von Seiten der Schule, der allgemeinen medialen Entwicklung angepasst, durch weitere Publikationen wie Schulhomepage, KKG-InfoBrief und KKG-Jahrbuch erweitert worden.
Große Verdienste um das „Forum“ erwarb sich elf Jahre lang Hans Bittmann, KKG-Abiturient 1981 und Journalist der Aachener Volkszeitung, der leider unerwartet 2006 verstarb. Im Forum 2006 heißt es in einem Nachruf auf ihn: „Er tat das, wie bei allem, was er machte, mit einem großen Engagement und seiner bekannten journalistischen Akribie. Unter seinen Händen wurde das „Forum“, wie es jetzt hieß, was es heute ist: Aus einem einfachen Mitteilungsblatt wurde eine äußerst professionelle, von allen Lesern hoch geschätzte 24-seitige Schulzeitung.“
Seit seinem plötzlichen Tod kümmert sich nun seit fast 20 Jahren federführend und mit hohem Einsatz vor allem in den Sommerferien Heiner Hautermans, KKG-Abiturient 1971 und langjähriger Journalist der Aachener Nachrichten, um die Herausgabe des „Forum“. Durch seine große Erfahrung in der Zeitungsarbeit, seine Ideen und seine hochwertige redaktionelle Arbeit hat er das Mitteilungsblatt nicht nur den heutigen Ansprüchen an Pu-

blikationen angepasst. Es hat auch durch Heiner Hautermans noch einmal deutlich an Ansehnlichkeit und Variationsbreite von Artikeln gewonnen.
Ein wahre Konstante im Wirken der Vereinigung ist Franz-Ewald Clemens, der 1984 Klaus Jochum im Amt des Schatzmeisters ablöste und bis zum heutigen Tag weiterhin innehat. Unglaubliche 40 Jahre hat nun Franz Ewald Clemens die Finanzen der Ehemaligen mit hohem Einsatz, dem nötigen Sachverstand und einem ständig offenen Ohr für die Belange der Schule - kommt er doch auch weiterhin nach seiner Pensionierung im Jahr 2000 wöchentlich in die Schule und steht im Lehrerzimmer dem Kollegium für ihre Anliegen zur Verfügung! - verwaltet. Eine beachtliche Leistung!
Nach eindrucksvollen 30 Jahren gab 1999 der Vorsitzende der Vereinigung Dr. Hermann Gatersleben seinen Vorstandsvorsitz an die Chemikerin Dr. Heike SchaffrathPlum (Abiturientin 1989) weiter. Mit ihr leitete erstmalig in der Geschichte der Verei-
nigung eine junge Frau die Geschicke der Ehemaligen. Mit ihr im Vorstand waren u.a. Franz Ewald Clemens, Schatzmeister, Georg Gier, KKG-Lehrer und Organisator des Ehemaligentreffens, Günter Berard, KKGLehrer und Verwalter der Mitgliedsdaten – erstmalig wurde auch im Forum auf die Kontaktmöglichkeit per E-Mail verwiesen - , Alexandra vom Berg, Martin Wüller und Hans Bittmann. Unter ihrer Leitung wurde das jährliche Treffen auf den letzten Septembersamstag verlegt.
2006 übernahm Martin Wüller, KKG-Abiturient 1987, den Vorsitz der Vereinigung. Als wichtige Aufgaben der Vereinigung werden im „Forum“ 2007 die finanzielle Unterstützung der Schule neben dem Förderverein genannt: Dazu gehören die seit Jahrzehnten jährlich beim Karlsfest vergebenen Buchpreise an Schülerinnen und Schüler für besondere Verdienste um das Schulleben und herausragende Leistungen, besonders aber kostspielige Einzelprojekte wie die Lautsprecheranlage in der Aula, die Anschaffung des Blüthner Konzertflügels,
die Ausstattung des Theatersaals und die Pekingreise der KKG-BigBand. Seit vielen Jahren unterstützt die Vereinigung schon traditionell, so wird es im „Forum“ ausgewiesen, die Chor- und Orchesterarbeit, die Abiturfeier der „Grünen“ Abiturientia und Klassen- und Studienfahrten. Als neuestes Projekt wurde im Jahr 2007 die finanzielle Hilfe bei der Aufstellung der kürzlich wieder entdeckten Portalsteine des ehemaligen Jesuitenkollegs, der Vorgängerschule des KKG, vorgestellt, die die Vereinigung erworben hatte.
Marco Sievert, KKG-Abiturient 1996 ist seit 2011 Vorsitzender der knapp 300 Mitglieder großen Vereinigung. Ihm steht ein sechsköpfiger Vorstand zur Seite, u. a. Günter Berard, der für die Mitgliederverwaltung zuständig ist, Franz Ewald Clemens (Abiturjahrgang 1957) als Schatzmeister und Heiner Hautermans (Abiturjahrgang 1971), der seit 2007 verantwortlicher Redakteur des jährlich erscheinenden Mitteilungsblattes „Forum“ ist. Die Mitglieder des Vorstands werden berufen.
Die Auseinandersetzung mit Hans Globkes umstrittener Vergangenheit. Ein Kommentar von Marco Sievert.
Die Geschichte lässt sich nicht umschreiben, aber sie zwingt uns, ihr ins Gesicht zu schauen. Hans Globke, ein Mann, dessen Name mit den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte verknüpft ist, führte von 1947 bis 1953 unsere Vereinigung der Ehemaligen an. Heute stehen wir vor der Herausforderung, uns zudem mit einer brisanten Behauptung auseinanderzusetzen: Ist Hans Globke Ehrenpräsident unserer Vereinigung?
Man kann sich seine Vorgänger nicht aussuchen. Mit diesem Kommentar könnte man es bewenden lassen. Als wir aber im Zuge der Recherchen zu unserem Jubiläum erstmals auf den Artikel von Josef Hüpgens stießen (siehe Seite 10), in dem auf die vermeintliche Tatsache hingewiesen wurde, dass Globke beim Jahrestreffen der Ehemaligen 1962 als „Ehrenpräsident“ begrüßt und gefeiert wurde, kam der gemeinschaftliche Gedanke auf, dass man das so nicht stehen lassen könne.

oder ausschließlich preußischen Gehorsam zuzuschreiben, würde seiner offensichtlichen Intelligenz aber nicht gerecht. Die Einschätzung seiner moralischen Schuld mag variieren, und frühere Generationen könnten dazu andere Ansichten gehabt haben als wir heute. Dass er eine Mitschuld am größten Verbrechen der deutschen Geschichte trägt, ist zweifellos unstrittig. Selbst etwaige spätere Reue oder Einsichten ändern nichts an dieser grundlegenden Bewertung. Eine Liste von Ehrenmitgliedern oder gar Ehrenpräsidenten der Vereinigung der Ehemaligen existiert heute nicht. Ob es sie jemals gab, ist nicht bekannt. Es liegt uns also kein eindeutiger Nachweis vor, dass Hans Globke jemals offiziell eine Ehrenbetitelung durch die Vereinigung erhalten hat. Nur dieser eine Artikel erwähnt es nebenbei. Die heutige Satzung der Vereinigung sieht eine Ehrenpräsidentschaft nicht vor.

Laut heutigem wissenschaftlichen Stand war Hans Globke daran beteiligt, die Repression der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus zu systematisieren und zu legitimieren. Er brachte entscheidende Ideen ein, die die Identifizierung von Menschen jüdischen Glaubens vereinfachten und deren Verfolgung vorantrieben. Globke war ein klassischer Schreibtischtäter. Ob er überzeugter Nazi war oder nur willfähriger Helfer, lässt sich heute nicht mehr hinreichend aufklären. Ihm dabei Naivität
Marco Sievert, Vorsitzender der Ehemaligenvereinigung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es derzeit keine hinreichenden Belege über eine solche Ehrenauszeichnung für Hans Globke gibt und sie damit für uns nicht existiert. Sollten neue Belege gefunden werden, werden wir der Mitgliederversammlung dies zur Beratung über den weiteren Umgang damit vorlegen. Angesichts des aktuellen Kenntnisstands über seine Rolle im Nationalsozialismus ist eine Ehrenpräsidentschaft Hans Globkes für uns als Vorstand undenkbar und mit den Werten der Vereinigung und des heutigen Kaiser-Karls-Gymnasiums unvereinbar.
Die wechselvolle Geschichte des Ehrenmals „Die Kameradschaft“ von Prof. Hein Minkenberg (1
Wenn heutzutage KKG-Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte über die Flure der ersten Etage des Altbaus gehen, ist den wenigsten von ihnen bewusst, dass sie im Bereich des großen Steinmosaiks von Anton Wendling an einem geschichtsträchtigen Ort vorbeikommen, der die wechselvolle Historie der letzten 100 Jahre unserer Schule in besonderer Weise abbildet.
1. Das schulische Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs
Nur ein paar Jahre nach ihrer Gründung (1924) unterstützte die „Vereinigung der ehemaligen Karlsschüler“ die kostspielige Anschaffung und Aufstellung eines Ehrenmals in der ersten Etage des Altbaus im Gedenken an die Toten und gefallenen KKG-Schüler und -Lehrer.
Die furchtbaren Eindrücke der verlustreichen Kriegshandlungen des Ersten Weltkriegs, die Grausamkeiten und Entbehrungen und die vielen Toten und Verwundeten waren ein Jahrzehnt später in den Köpfen vieler Menschen noch sehr präsent. An exponierter Stelle der Schule auf der ersten Etage, wo Quer- und Längsflügel des Altbaus zusammentreffen und wo der KKG-Schulleiter seit 1906 seine Ansprachen an Schüler und Lehrerkollegium richtete und feierlich Abiturzeugnisse vergeben wurden, sind nach Kriegsende an der Wand die Namen der achtzig ge-

fallenen KKG-Schüler und -Lehrer zu lesen gewesen. Dazu sollte nun noch eine Skulptur als weitere Ehrung und Mahnung für die nächsten Generationen aufgestellt werden.
Später hat man noch vier große, massive Gedenktafeln aus Granit mit denselben Namen und Todesdaten der Gefallenen anfertigen lassen, die die Wirren des Zweiten Weltkriegs überstanden haben und heute noch im Keller des A-Traktes vorhanden sind.
2. Der KKG-Wettbewerb für ein zusätzliches Ehrenmal 1929/30
Der Verein ehemaliger Karlsschüler, der Elternbeirat und das Lehrerkollegium des KKG hatten, so ist im „Karlsschüler“ Nr. 2 (April 1930) zu lesen, in einem Preisausschreiben, das sich an Aachener Künstler richtete, zu einem Wettbewerb für ein zusätzliches Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in der Schule aufgerufen. Als Preissumme wurde die hohe Summe von insgesamt 4.000 Reichsmark ausgelobt, was heute ungefähr einem Wert von 16.000 Euro entspricht. Das Ehrenmal sollte als Würdigung und als Mahnung für die junge Generation der KKG-Schüler im Schulalltag sichtbar sein.
Das Preisgericht unter Vorsitz von KunstProf. Burger, der u. a. den „Wehrhaften Schmied“ geschaffen hat, weiteren Künstlern sowie von Joseph Oppenhoff (Vorstand Ehemalige), dem Rechtsanwalt Keutmann (Elternbeirat) und dem Schulleiter Aloys Billen entschied sich aus 20 eingegangenen Entwürfen einstimmig für den Entwurf von Prof. Hein Minkenberg, der an der Kunstgewerbeschule in Aachen lehrte.
3. Das neue Ehrenmal „Die Kameradschaft“ von Hein Minkenberg „Herr Minkenberg wird eine Halbplastik aus Eichenholz von 2 1/2 m Höhe schaffen, die auf einem Sockel an beherrschender Stelle des ersten Stocks aufgestellt werden soll. Sie ist „Kameradschaft“ betitelt
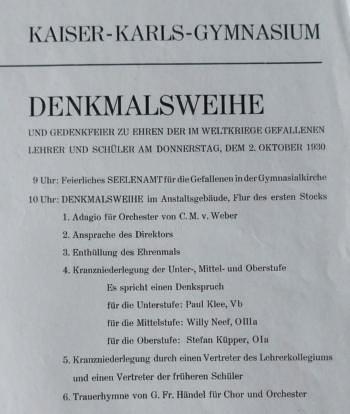
und stellt zwei gemeinsam vorschreitende Männer dar, einen älteren und einen jüngeren; sie ist eine Versinnbildlichung des Gemeinschaftsgeistes in schwerer Notzeit, eine stete Mahnung zu treuem Gedenken und zur Nacheiferung uns Ueberlebenden und der Jugend, die jetzt und in Zukunft in diesem Hause dem Leben entgegenreift.“ (Karlsschüler Nr. 2, April 1930, S.1)
Mit einem großen Festakt, wie dem Karlsschüler 1930, Nr. 3, auf S. 3f. zu entnehmen ist, wurde am 2. Oktober 1930 in der Schule die Denkmalsweihe des Ehrenmals als „Mahnzeichen für die jetzige und künftige Jugend“ und als Gedenken an die vielen Toten und toten Schüler und Lehrer des Ersten Weltkriegs vollzogen. Nach einem Seelenamt für die Gefallenen in der Gymnasialkirche spielte das Schul-Orchester, der Schulchor sang, vor der Enthüllung des Ehrenmals hielt Direktor Aloys Billen eine Ansprache, schließlich folgten Kranzniederlegungen von Schülervertretern mit dem Aufsagen von Denksprüchen sowie von einem Vertreter des Kollegiums und der Ehemaligen.

4. Das Ehrenmal nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurden bald Stimmen laut, das Ehrenmal im KKG wieder zu entfernen, weil es nicht mehr dem nationalsozialistisch geprägten Zeitgeist des „neuen Deutschlands“ entspräche.
Am 24. November 34 forderte die Stadtverwaltung Schulleiter Aloys Billen in einem Schreiben auf, das Ehrenmal für die imWeltkrieggefallenenLehrerundSchüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums umgehend zu entfernen. Sie drohte zudem damit, sollte es über acht Tage noch an seinem Platz
fassung der Rechtslage nach, so argumentiert er gegenüber der Schulbehörde, habe der Herr Oberbürgermeister der Stadt Aachen „nicht die Befugnis, an der Innenausstattung des Kaiser-Karls-Gymnasiums eigenmächtig Aenderungen vorzunehmen.“ (Brief an die Abt. höheres Schulwesen des Oberpräsidenten der Rheinprovinz vom 25.11.34) Weiter schreibt er: „Heldenverehrung und Totenkult gehören sicher in die heutige Schule, sie sind bei uns eng mit dem Ehrenmal für unsere Gefallenen verbunden. Eine Entfernung würde eine wertvolle Tradition, die sich inzwischen herausgebildet hat, zerschlagen und das
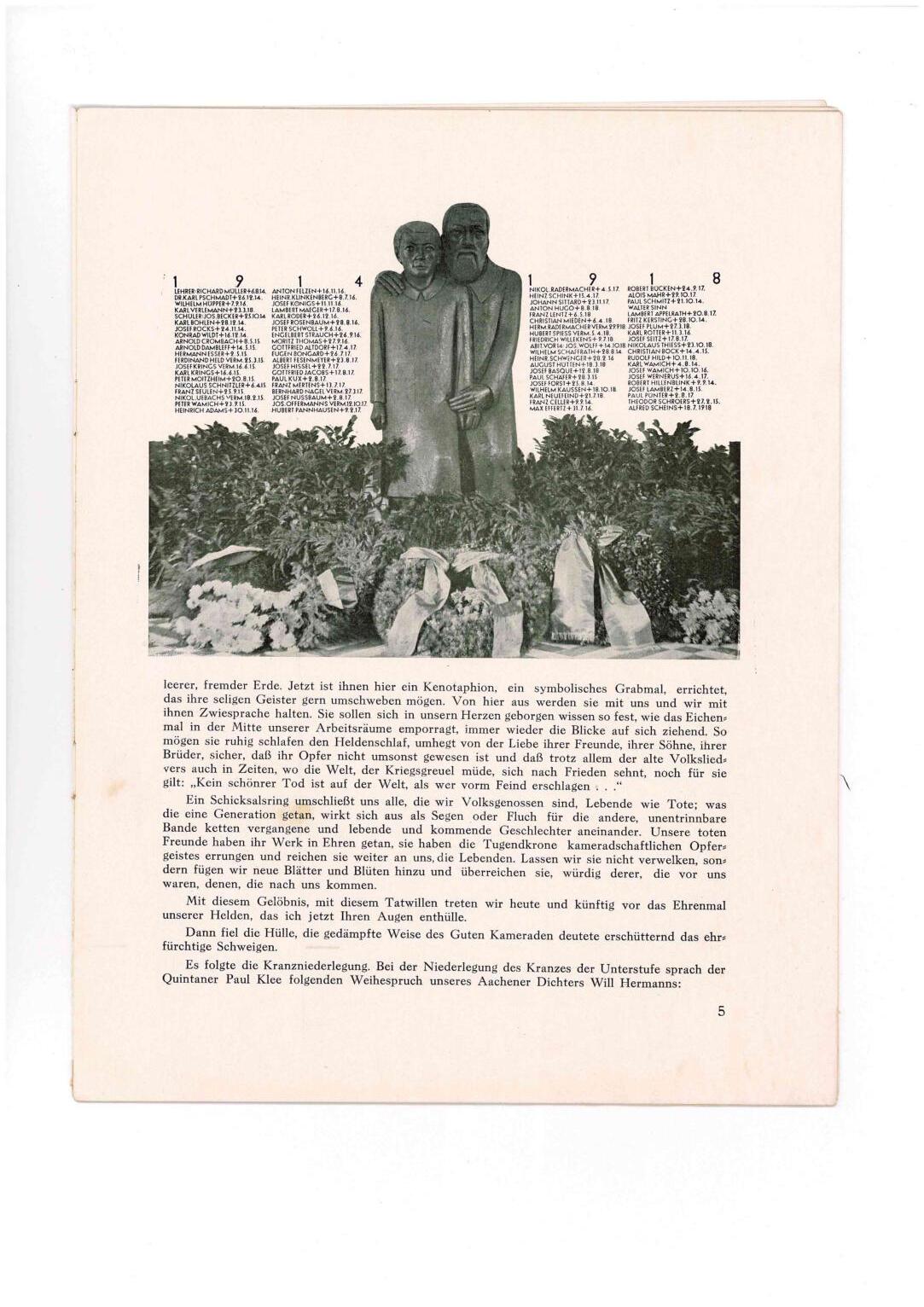
Die „Kameradschaft“ von Prof. Minkenberg zeigte zwei vorschreitende Männer.
gepasst an die NS-Ideologie hört sich derselbe Schulleiter Aloys Billen, der im Mai 1933 in die NSDAP eingetreten war, in seinem Antwortschreiben an den Kunstreferenten des Westdeutschen Beobachters, der nationalsozialistischen Propagandazeitschrift im Gau Köln-Aachen, noch am 20. Juni 34 an (siehe unten). Dieser hatte Billen um eine Stellungnahme und auch um eine Photographie des Ehrenmals gebeten. In seinem Brief betont der KKG-Schulleiter Billen einerseits die Seriosität der Jury bei der Preisvergabe für das Ehrenmal und ihre „sachverständigen Männer“. Andererseits räumt er ein: „Ich glaube, wir verhüllten allesamt am liebsten unser Haupt in Scham, weil wir gewissermaßen die Patenschaft für dieses sogenannte Kunstwerk übernommen haben. Möglicherweise wünscht auch heutzutage der Künstler selbst, der Professor Hein Minkenberg von der Kunstgewerbeschule Aachen, dieses sein Kind in die Abgeschiedenheit eines Krüppelheims. Ich werde gerne die erste Gelegenheit benutzen, ein würdigeres Mal an die Stelle zu setzen, möchte das aber lieber
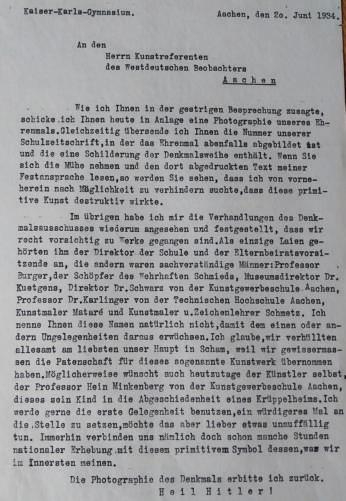
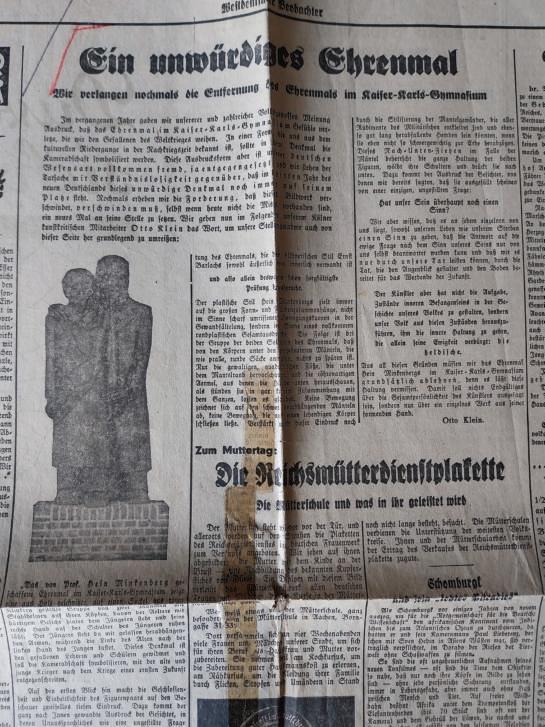
etwas unauffällig tun. Immerhin verbinden uns nämlich doch schon manche Stunden nationaler Erhebung mit diesem primitiven Symbol dessen, was wir im Innersten meinen. (…) Heil Hitler!“ Damit bietet er gezielt den Künstler Hein Minkenberg zu eigentlichen Sündenbock an.
5. Die Entfernung des Ehrenmals 1935 1935 übernahm auf Verfügung des preußischen Oberpräsidenten Wilhelm Dresen, Mitglied der Zentrumspartei, die Schulleitung und löste Aloys Billen ab.
Das Ehrenmal „Die Kameradschaft“, von den KKG-Schülern bald auch wegen seiner dunklen Farbgebung mit dem Spitznamen „De Printemänner“ bedacht, muss wohl auch noch im Mai 1935 an seinem Platz in der ersten Etage gestanden haben. Denn in der Ausgabe vom 10. 5. 35 widmet sich der „Westdeutsche Beobachter“ mit der Expertise seines „kunstkritischen Mitarbeiters“ Otto Klein unter dem Titel „Ein unwürdiges Ehrenmal – Wir verlangen nochmals die Entfernung des Ehrenmals im Kaiser-Karls-Gymnasium“ (siehe oben) in aller Öffentlichkeit ein weiteres Mal in einem längeren Artikel der Sache. Die Forderung wird mit einer photographischen Abbildung des Ehrenmals untermauert. Die Form der „Kameradschaft“ von Hein Minkenberg sei, so der WB, „aus dem kulturellen Niedergange in der Nach-
kriegszeit bekannt“. „Diese Ausdrucksform aber ist unserer deutschen Wesensart vollkommen fremd, ja entgegengesetzt, und wir stehen der Tatsache mit Verständnislosigkeit gegenüber, daß im Dritten Jahr des neuen Deutschlands dieses unwürdige Denkmal noch immer auf seinem Platze steht“. Dieses Bildwerk müsse sofort verschwinden.
Um dieser Forderung weiteren Nachdruck und den Anspruch von Seriosität zu verleihen, druckt der WB eine Stellungnahme des Kunstkritikers Otto Klein ab. Bei der Beschreibung des Figurenpaars interpretiert dieser die Figuren zu Soldaten und deren Haare zu Stahlhelmen. Er geht bald schon auf den für ihn entscheidenden Makel des Ehrenmals ein: den „ganz nach Innen gewandte Ausdruck der Gesichter, in denen Unaussprechliches wie eine ungestillte Frage dunkelt.“ „Je länger man sich aber diesem Eindrucke hingibt, umso mehr spürt man, wie sich etwas Lähmendes, Dumpfes, das den Glauben an die Kraft unseres Willens herabdrückt.“ Er bemängelt entscheidend die „innere Haltung der beiden“, ihre Freud-, Hoffnungs- und Kraftlosigkeit. „Ist dies aber der Geist, der unsere deutschen Frontsoldaten draußen beseelte?“ Heroisierend beruft Otto Klein sich auf die angebliche Stimmungslage der Frontsoldaten, die gemäß nationalistischer Legendenbildung im „tagelangen Trommelfeuer“ und in „Stunden drückender Depressionen“ trotzdem „Raus aus dem Graben! Ran an den Gegner!“ riefen und „verzweifelte Stimmungen“ nicht zuließen. Da „gab es nur noch eins: Deutschland muß leben und wenn wir sterben müssen!“ In der Kameradschaft Minkenbergs sei nichts von den Jungen zu spüren, „die mit dem Deutschlandlied auf den Lip-
pen in den Tod gingen“. Außerdem seien die Mäntel der beiden Figuren unsoldatisch, die Kleidung „wölbt ihre Schultern und drückt sie nach unten.“
Otto Klein rückt Minkenbergs „Kameradschaft“ zu Recht, aber mit böser Absicht nahe an den „bildnerischen Stil Ernst Barlachs“, des Künstlers, dessen Werke im Nationalsozialismus als „entartet“ verfemt wurden. Die Rolle des Künstlers im neuen Deutschland habe seit 1933 nach Ansicht des kunstkritischen Mitarbeiters des WB nicht die Aufgabe, „Zustände inneren Befangenseins in der Geschichte unseres Volkes zu gestalten, sondern unser Volk aus diesen Zuständen herauszuführen, ihm die innere Haltung zu geben, die allein seine Ewigkeit verbürgt: die heldische!“
6. Das „neue“ Ehrenmal: Anbringung eines „Eisernen Kreuzes“ und einer Bronzetafel (1935)
Prof. Dr. Severin Corsten (KKG-Abiturient 1939) hat als Schüler das Ehrenmal „Kameradschaft“ gesehen und die in dunklem HolzgestalteteSkulpturals„sehrausdrucksvoll“ und „jede heldische Pose“ vermeidend beschrieben. In zwei Briefen an die Schule von 2001 datiert er die Entfernung der „Kameradschaft“ auf 1935. Die Schule habe stattdessen umgehend ein von einem Zeichenlehrer aus Pappe gefertigtes „Eisernes Kreuz“ an der Wand angebracht. Es wurde durch eine Bronzetafel mit dem Hitlerzitat: „Wer sein Volk liebt kann nur heroisch denken“ ersetzt. Das der Epigraphik geschuldete fehlende Komma erstaunte, so erinnert sich Prof. Corsten, vor allem die Schüler. 1935 gab es damit, nun für das neue „Ehrenmal“, wieder einen Festakt. „Bei der Einweihung sprach der damalige Vorsitzende der Vereinigung der ehemaligen Schüler des KKG, Rechtsanwalt Dr. Bruno van Kann, und distanzierte sich in geradezu peinlicher Art und Weise von dem Vorgänger-Denkmal.“
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Diktatur verschwanden „Eisernes Kreuz“, die Bronzetafel und die Granittafeln. Letztere wurde im Keller der Schule deponiert.


Bis heute ist der Verbleib des Ehrenmals „Die Kameradschaft“ ungeklärt geblieben. Leider müssen wir wohl am ehesten davon ausgehen, dass die Skulpturengruppe 1935 zerstört bzw. verbrannt worden ist.
7. Das Wendling-Mosaik (1951)
Zum 350jährigen Jubiläum der Schule schenkt im Jahr 1951 die Vereinigung der Ehemaligen dem KKG ein neues Ehrenmal, das an derselben, denkwürdigen Stelle in der ersten Etage des Altbaus angebracht wird. Mit der Aufschrift „Den Gefallenen zweier Weltkriege die Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums“ fertigt Prof. Anton Wendling (1891 – 1965), der sich vor allem durch seine SakralkunstinAacheneinenNamengemacht hatte und dessen neuen Fensterentwürfe zeitgleich in den Abschluss der Chorhalle des Doms eingebaut wurden, ein großflächiges Steinmosaik an der Wand an, das den Erzengel Michael mit einem Schwert abbildet, der das Böse in Gestalt eines Lindwurms siegreich überwindet. Die Vereinigung bzw. Wendling erinnert damit
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg an die Werte der KKG-Bildungstradition: durch die Vermittlung eines Humanismus, der an die Antike anknüpft, wird das Böse durch die Macht des christlichen Glaubens überwunden.
Diese beiden Stützpfeiler des damalig herrschenden Bildungsgedankens werden auch in dem steinernen Chronogramm zum Ausdruck gebracht, das 1950 wohl außen am Längsflügel des Altbaus, nachdem die Kriegszerstörungen in den oberen Etagen behoben worden sind, seinen Platz fand:
„Mit dem gütigen Beistand Gottes und der (am KKG vermittelten) Künste der „Humanitas“ (d.h. der humanistischen Bildung auf der Grundlage der Antike) ist dieser Teil der Karlsschule, der vom Wüten des Krieges zerstört worden ist, aus den Ruinen wieder errichtet worden“.
Das Chronogramm wurde in den 1970er Jahren im Zuge der Erweiterungsarbeiten im Altbau entfernt und in den Keller verbannt. Seit einigen Jahren hängt es wieder
Das heutige Ehrenmal in der ersten Etage zeigt den Erzengel Michael.
im Altbau in der dritten Etage in dem nach dem Zweiten Weltkrieg wieder errichteten Teil der Schule.
8. Heutige Bedeutung
Durch die baulichen Veränderungen im Altbau (Einbau der Brandschutzglaswände in den 70er Jahren) und die Nutzung der Aula Carolina ist die Bedeutung des zentralen Versammlungs- und Gedenkorts in der ersten Etage des Altbaus verlorengegangen. Heutige Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte nehmen in der Regel das Wendling-Mosaik als alten Wandschmuck wahr und laufen meistens achtlos an dieser Stelle mit ihrer wechselvollen Historie vorbei. Umso wichtiger ist es, ihnen vielleicht ab und an von der historischen Bedeutsamkeit dieses Ortes zu erzählen.
Jürgen Bertram


Arthur Eichengrün hat das Aspirin
Der Chemiker und Unternehmer Arthur Eichengrün wurde 1867 in Aachen geboren, ging zur Bayer AG, wo er das Aspirin zumindest miterfand, und überlebte das KZ Theresienstadt. Der Journalist Ulrich Chaussy hat ein Buch über ihn geschrieben.
Es gibt ein Foto von Arthur Eichengrün, aufgenommen irgendwann im Jahr 1949, kurz vor seinem Tod. Es zeigt einen Mann mit müdem, aber stolzem Blick; das hagere Gesicht beherrscht von einem mächtigen Schnauzbart. Im Hintergrund ist verschwommen ein Bergpanorama zu sehen. Das Foto findet sich auf den letzten Seiten des Buchs, das der Münchner Journalist Ulrich Chaussy über Eichengrün geschrieben hat. Er erzählt darin die Geschichte eines Mannes, der als Forscher, Erfinder und Unternehmer die erste Hälfte des 20. JahrhundertsinDeutschlandnicht unerheblich
geprägt hat. Die Spuren seines Schaffens sind bis heute sichtbar, der Mann selbst ist allerdings weitgehend in Vergessenheit geraten. Auch in Aachen, wo er geboren wurde, aufwuchs und studierte.
Chaussy kommt nun nach Aachen, um sein Buch vorzustellen. Er tut das an zwei Orten, die eng mit Eichengrün verbunden waren: am Kaiser-Karls-Gymnasium (damals noch Königliches Gymnasium), das er bis kurz vor dem Abitur besuchte (warum er das Abi in Stuttgart machte, ist eine andere Geschichte, die man in Chaussys Buch nachlesen kann), und an der RWTH, wo er Chemie studierte. Vielleicht tragen diese Veranstaltungen ein bisschen dazu bei, dass die Geschichte von „Aachens großem vergessenen Sohn“ wieder mehr ins Bewusstsein rückt. Verdient hätte er es, und das gleich aus mehreren Gründen.
Arthur Eichengrün wurde am 13. August 1867 als Sohn des jüdischen Textilhändlers- und fabrikanten Julius Eichengrün und dessen Ehefrau Emma geboren. Dass Aachen im 19. Jahrhundert zu einer der führenden Textilstandorte in Deutschland aufstieg, war vor allem diesen jüdischen Unternehmern zu verdanken; auch Emmas Vater Moritz Mayer war einer von ihnen. Nach dem Abitur studierte Arthur Chemie an der RWTH und (sehr kurz) an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin; seinen Doktortitel (später kamen noch zwei Ehrendoktorhüte hinzu) erwarb er 1890 in Erlangen, weil die RWTH noch kein Promotionsrecht hatte.
Eichengrün blieb nicht an der Hochschule, sondern wechselte in die Wirtschaft. Nach einigen Stationen kam er 1896 zur Bayer AG und arbeitete dort im pharmazeutischen Forschungsinstitut. Er war Teil
Auf dem Zenit seines Erfolgs: Der in Aachen geborene Chemiker und Unternehmer Arthur Eichengrün in den 1920er Jahren. Foto: Archiv
Familie Eichengrün, Königswinter


studiert. Nach großer Karriere in der Wirtschaft 1944 ins KZ Theresienstadt deportiert.
eines Laborteams, das 1897 das Aspirin entwickelte. Wie hoch Eichengrüns Anteil daran war, ist bis heute umstritten. Die Synthetisierung der Acetylsalicylsäure wird gemeinhin seinem Kollegen Felix Hoffmann zugeschrieben. Eichengrün hat zumindest die Idee dazu aber bis zu seinem Tod immer für sich reklamiert. Chaussy schreibt ihm in seinem Buch übrigens eine sehr große Rolle bei diesem Meilenstein der Pharmazie und der Medizin zu.
1908 verließ Eichengrün Bayer und gründete in Berlin ein eigenes Unternehmen, die Cellon-Werke. Der von ihm entwickelte Spannlack, ein schwer brennbares Gemisch, wurde für Zeppeline und Flugzeuge eingesetzt. Eichengrün entwickelte auch unbrennbares Material für die Filmindustrie, für Schallplatten und für ein rauchloses Blitzlicht. Seine Karriere in der Kaiserzeit und der Weimarer Republik war rasant. Er lebte auf großem Fuß in Berlin; ein echter Lebemann. Am Ende war er dreimal verheiratet, hatte sechs Kinder, viele Affären. Und knapp 50 Patente.
„Eichengrün zeichneten eine enorme Tatkraft und ein großes Selbstbewusstsein aus“, beschreibt Ulrich Chaussy den Protagonisten seines Buches. Er entwirft dort das Bild eines erfolgsorientierten und -hungrigen Mannes, dem Politik und Religion offensichtlich völlig egal waren. „Er wollte Leistung bringen für die Gesellschaft, in der er lebte. Er erlag jedoch dem Irrtum, dass ihm das auch von dieser Gesellschaft anerkannt würde.“
Dass sich Eichengrün keine großen Gedanken gemacht habe über seine jüdische Herkunft (1894, kurz vor seiner ersten Ehe, trat er aus der jüdischen Gemeinde aus und bezeichnete sich als „freireligiös“), dass er den Zeichen der Zeit und dem latenten Antisemitismus keine Beachtung geschenkt oder sie falsch eingeschätzt habe, gehöre zu der großen Tragik dieses Mannes. Chaussy: „Eichengrün war völlig unpolitisch und hielt sich selbst für unverletzlich. An seiner politischen Intelligenz kann man zumindest große Zweifel haben.“

Tatsächlich wurde Eichengrüns Unternehmen 1938 von den Nationalsozialisten „gesäubert“; er verlor sein Vermögen, seine Familie wurde in alle Winde verstreut. 1944 deportierte ihn die Gestapo in das KZ Theresienstadt. Eichengrün überlebte, kehrte nach der Befreiung durch die Rote Armee zurück nach Berlin, kämpfte – gesundheitlich schwer angeschlagen – um sein Lebenswerk und seinen Ruf. Am Tag
vor Heiligabend 1949 starb er schließlich im Alter von 82 Jahren ziemlich mittellos in Bad Wiessee.
Hermann-Josef Delonge
Obwohl kurzfristig angesetzt, war der Andrang groß: Die Aula Carolina war bei der Lesung des Buchautors Ulrich Chaussy gut gefüllt, als er von einem großen Sohn der Stadt Aachen berichtete.
Die Geschichte von Arthur Eichengrün begann in einer Zeit, in der es noch kein Deutsches Reich gab, in der die deutsche Chemieindustrie in ihren Kinderschuhen steckte und in der der Antisemitismus immer mehr um sich griff. Anfeindungen, Unsicherheiten, aber auch ein lebendiger Erfindergeist begleiteten Eichengrün sein gesamtes Leben. Der Tuchfabrikantensohn studierte nach dem Besuch des KKG ab 1886 an der RWTH Chemie, griff im Corps Montania zum Degen – und wurde Forscher, Erfinder und Unternehmer in Personalunion. Er synthetisierte Kokain und gilt als Miterfinder des Aspirins.
Der Journalist Ulrich Chaussy, der durch ein Buch über das Oktoberfest-Attentat 1980 in München bekanntgeworden ist, schilderte detailliert, wie sich der selbstbewusste Jude, der sich als patriotisch und später nach dem Austritt aus der Religion als freireligiöser Agnostiker bezeichnete, „erfolgreich durch das Kaiserreich durchboxte“. 1938 wurden jedoch wegen seiner jüdischen Herkunft die ihm gehörenden Cellon-Werke zwangsverkauft. Im Mai 1944 wurde er in das KZ Theresienstadt deportiert, weil er sich geweigert hatte, in einem Brief an einen Reichsfunktionär seinem Namen den für Juden vorgeschriebenen Beinamen „Israel“ hinzuzufügen – eine Schikane, die von einem weiteren KKG-Schüler, Dr. Hans Globke, dem Kommentator der Reichsrassegesetze, erlassen worden war. Nach seiner Befreiung kehrte Eichengrün nach Berlin zurück, zog 1948 ins bayerische Bad Wiessee, wo er ein Jahr später im Alter von 82 Jahren starb. (hau)
Die Lesung ergänzte Ulrich Chaussy (links) durch historische Fotos und Dokumente. Rechts: Schulleiter Dirk Adamschewski.

Räume werden für die Rückkehr zu G9 benötigt. Wertvolle Folianten werden im Tresor aufbew schaftliche Aufarbeitung.
Kostbare Schätze umfasst die sogenannte ‚alte Lehrerbibliothek‘ des Aachener KKG: Das älteste Buch stammt aus dem Jahr 1499, die wertvollsten Folianten werden sogar in einem Tresor aufbewahrt. Doch die Sammlung wird schon bald umziehen müssen, weil sie Umbauplänen weichen muss.
Die rund 22.500 Titel in 30.000 Bänden bilden eine von rund zehn historischen Gymnasialbibliotheken ihrer Art in NRW, die sich noch an ihren angestammten Schulorten befinden, und ist eine von insgesamt ca. 100 solcher Bibliotheken in Deutschland. Als Sachgesamtheit bildet sie in ihrem Ensemble einen einzigartigen historischen Überlieferungszusammenhang oder wissenssoziologisch gesprochen: ein „Akteur-Netzwerk“. Dieses hat die Bibliotheks- und Schulgeschichte auf vielfältige
Weise konserviert und es dokumentiert die Aachener Bildungslandschaft seit dem 17. Jahrhundert. Im Herbst 2024 wird die Bibliothek aus guten Gründen ihr bisheriges Zuhause am Augustinerbach verlassen und an anderer Stelle eingelagert, damit die Bauarbeiten für zwei Klassenräume und einen Besprechungsraum im Sommer 2025 rechtzeitig beginnen können.
Schulleiter Dirk Adamschewski begründet dies einmal mit dem Platzbedarf durch eine Rückkehr zum G9-Bildungsgang und zweitens damit, dass die Bibliothek als schriftliches Kulturgut der öffentlichen Hand gehöre und für die wissenschaftliche Erschließung zu öffnen sei, zumal eine Schule „kein Museum“ sei. Gemeinsam mit den städtischen Entscheidungsträgern und hinzugezogenen Fachleuten entschied man sich für die übergangs-
weise Einlagerung und Sichtung des Gesamtbestands zur Sicherstellung seiner wissenschaftlichen Erschließung und folgt damit Vorbildern aus anderen Städten: So sind andere Gymnasialbibliotheken z. B. in Stadtarchiven(Arnsberg,Dortmund,Lemgo in Detmold, Wuppertal) und Universitätsbibliotheken (Köln, Münster, Wuppertal) untergebracht oder ihnen angeschlossen (Düsseldorf, Recklinghausen an Münster). Ehe die Bibliothek ihre Reise antritt, war es noch möglich, ihre Innenräume zu fotografieren und zu digitalisieren, um die Erinnerung an diesen geschichtsträchtigen Ort in Form eines virtuell begehbaren 3DModells wach zu halten.
Während die jesuitischen Vorläuferinstitution des KKG auf das Jahr 1601 zurückgeführt werden kann, lässt sich das Gründungsdatum der historischen Gym-
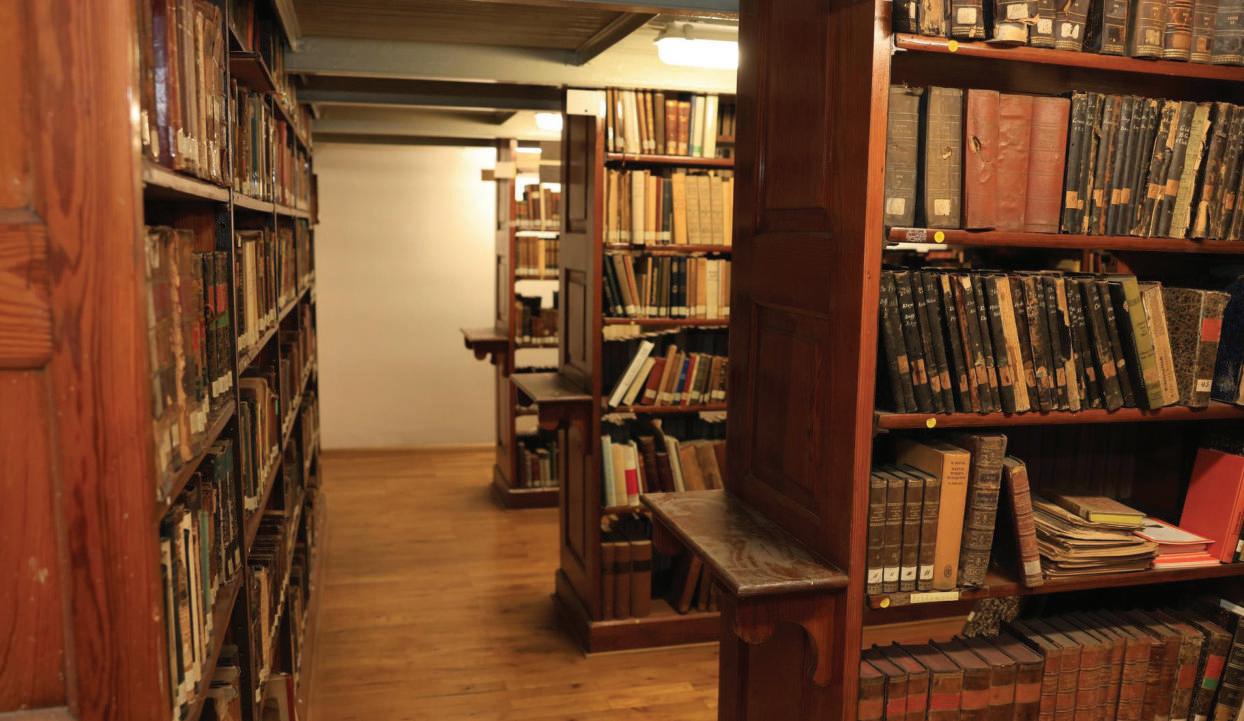
aufbewahrt. Umzug ermöglicht die wissen-

nasialbibliothek nicht genau bestimmen; die Gründung dürfte in die Franzosenzeit zu datieren sein und mit dem Umzug der Schule in das ehemalige Kloster der Aachener Augustiner-Eremiten in Zusammenhang stehen. Im 1906 fertiggestellten „neuen Schulgebäude“, dem heutigen Altbau, war die Bibliothek zunächst in den heutigen Räumen A109 und A110 architektonisch eingeplant; unter welchen Umständen sie an ihren heutigen Standort gelangte, müsste noch ermittelt werden. Auf insgesamt ca. 1.000 Regalmetern versammelt die Lehrerbibliothek heute ca. 22.500 Titel in 30.000 Bänden mit einem historischen Bestand von ca. 12.000 Titeln. Der Sammlungsschwerpunkt liegt der damaligen Programmatik der Schule entsprechend bei der Altphilologie. Das älteste Buch stammt aus dem 15. Jahrhundert: Es handelt sich um einen Wiegendruck (Inkunabel) von 1499 mit Hymnen aus dem Fundus des ehemaligen Jesuiten-Gymnasiums. Jüngst entdeckte Handschriften-Fragmente auf Pergament, die zur Einbandverstärkung oder -reparatur verwendet wurden (sog. Makulatur), sind sogar noch älter und stammen aus dem Mittelalter; Fragmente dieser Art fanden sich etwa in einer aus der renommierten Venezianischen Druckerei von Aldus Manutius und Sohn Paulus stammenden Textausgabe mit Verteidigungsreden Ciceros von 1541, die zur Reparatur des zeitnah angefertigten oder erneuerten Einbands dienten und erst zum Teil identifiziert werden konnten. Ein Teil des Bibliotheksbestands speist sich aus Privatsammlungen, Schenkungen und Nachlässen (z. B. die Schipper’sche Schenkung oder Bücher von KKG-Lehrer und Dichter Dr. Joseph Müller, vom Aachener Oberregierungsrat Ludwig Wilhelm Ritz oder von Alfred von Reumont). Aus der Zeit der französischen Besatzung, dem Département de la Roer, stammen eine Reihe französischsprachiger Klassikerausgaben (z. B. Rousseau) für die École
secondaire.
Eine große Sondersammlung umfasst schließlich Schulprogrammschriften und Jahresberichte aus ganz Deutschland und darüber hinaus aus den Jahren 1811 bis 1915. Diese tauschten die Schulen seinerzeit zu Informations- und Fortbildungszwecken – vergleichbar mit den heutigen Schulhomepages – untereinander aus und wurden vom KKG systematisch gesammelt. Die das KKG selbst betreffenden Jahresberichte wurden sogar – beginnend mit während der Aufhebung des Jesuiten-Ordens von den Franziskanern an St. Nikolaus (heute sog. „City-Kirche“ in der Großkölnstraße) abgenommenen theologischen Dissertationen auf Latein – von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre bewahrt und geben Aufschluss über interessante Ereignisse, Entwicklungen und Persönlichkeiten der Schule, jüngst etwa zu Dr. Arthur Eichengrün oder Dr. Oskar Francken. Nicht zuletzt enthält die Bibliothek einige ihre eigene Geschichte betreffende Archivalien, wie Bibliothekskataloge beginnend um 1840, zwei Zettelkataloge oder eine Kartei vom Beginn des 20. Jahrhunderts, in der die zumeist lateinischsprachigen Herkunfts- und Besitzvermerke in den Büchern (sog. Provenienzen) erfasst wurden, die für die Forschung von Interesse sind. Durch Auswertung der jüngeren Archivalien sowie basierend auf Auskünften des um die Bibliothek sehr verdienten ehemaligen Lehrers Johannes Lennartz (†) ließ sich ermitteln, dass die Lehrerbibliothek bis in die frühen 2000er Jahr finanziell gefördert, einzelne Bände durch die Vaalser Benediktiner restauriert worden waren und
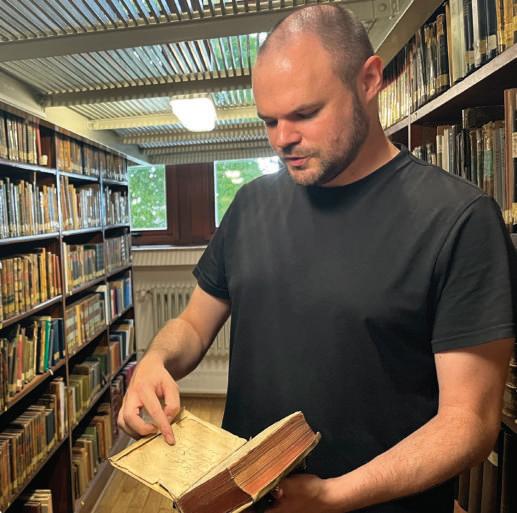
man sich – mangels Vollzeit- bzw. TeilzeitBibliothekar – um Hilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bemüht hatte.
Im Schuljahr 2016/2017 wurde von den Lehrern Johannes Maximilian Nießen und Wolfgang Scheuer eine Bibliotheks-AG ins Leben gerufen, in der erste Digitalisierungsversuche gestartet wurden. Außerdem wurde die Arbeit im Netzwerk Historischer Schulbibliotheken und -archive aufgenommen und seitdem intensiviert, worüber einige Beiträge aus und zu Aachen im Blog bibliotheca.gym (sowie im Blog-internen Adventskalender und andernorts) beredtes und reich bebildertes Zeugnis ablegen (Magofsky/Nießen/Noeske, 2023a; 2023b; Nießen, o. J.; 2024b; Noeske, 2022). Für die Schülerschaft der letzten Jahrgänge oder andere Interessierte konnten immer wieder Unterrichtsgänge zur bzw. Führungen in der Bibliothek ermöglicht werden. Zudem gab es in den letzten Jahren wiederholt interessante Recherche-Anfragen von Wissenschaftlern unterschiedlichster Fachdisziplinen – neben Archiv- und Bibliothekswissenschaft – aus der Chemiegeschichte, germanistischen Literaturwissenschaft, Klassischen Philologie und Kunstgeschichte.
Johannes Maximilian Nießen
Dirk Adamschewski nun auch offiziell zum Leiter der zertifizierten Europaschule bestellt. Mit Dr. Evelyn Gettner zum ersten Mal eine Frau als Stellvertreterin.
Dirk Adamschewski ist nun auch offiziell von der Bezirksregierung in Köln als neuer Leiter des KKG bestimmt worden. Kommissarisch hatte der 53-Jährige die Schule bereits seit dem Sommer, als Nachfolger von Jürgen Bertram, geleitet. Und ein Neuling am KKG ist der gebürtige Münsteraner schon gar nicht. 1998, also vor gut 25 Jahren, kam der Lehrer für Englisch und Mathematik an die Schule am Augustinerbach, die vergangenen acht Jahre war er bereits stellvertretender Schulleiter.
Das Kaiser-Karls-Gymnasium ist Aachens ältestes Gymnasium. Seine Anfänge gehen auf das Jahr 1601 zurück, in zwei Jahren feiert die Schule das 425-jährige Bestehen. Im Schulgebäude am Augustinerbach, errichtet zum großen Teil zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist die Geschichte noch heute fast mit Händen zu greifen, und Traditionen wie das alljährliche Karlsfest werden hochgehalten, wenn auch in zeitgemäßer Form.
Adamschewski hat über die Jahre aber nicht nur Tradition, sondern auch viel Wandel miterlebt und mitgestaltet. Als er ans KKG kam, war die Schule bereits dabei, ihr Profil als altsprachliches Gymnasium mit Latein als Eingangssprache hinter sich zu lassen. „Das Altsprachliche zog nicht mehr“, erinnert sich der Schulleiter.
Den bilingualen Zweig seiner Schule hat Dirk Adamschewski mit aufgebaut. Seit 2017 unterrichtet das Kaiser-Karls-Gymnasium auch zweisprachig. „Das war überfällig“, findet er. Unterricht auf Englisch gibt es in den Fächern Biologie und Geschichte, bilinguale Module in Mathematik sind ebenfalls im Angebot. Adamschewski zum Beispiel unterrichtet gerne Geometrie und Stochastik in englischer Sprache. Als Schulleiter hat er dazu allerdings nicht mehr viel Zeit.
Heute konzentriere sich die Traditionsschule auf drei Säulen, erläutert der Schulleiter. Als MINT-EC-Schule setze das KKG
Schwerpunkte in den naturwissenschaftlichen Fächern, in den Sprachen habe die Schule ein bilinguales Angebot und fördere Kinder außerdem intensiv in den Bereichen Kunst, Musik, Theater und Literatur. „Kinder sollen sich ausprobieren können und ihre Stärken herausfinden“, ist Adamschewski überzeugt. „Dafür machen wir ein breites Angebot.
Rund 860 jungen Menschen besuchen aktuell das Kaiser-Karls-Gymnasium, Tendenz steigend. 40 Nationalitäten und fast alle großen Religionen sind in der zertifizierten Europaschule versammelt. Auf das Miteinander, auf soziales Lernen lege die Schule großen Wert, erläutert Adamschewski. „Ein respektvoller Umgang miteinander, Toleranz und Zuhören, das ist uns wichtig.“ Der neueMannanderSpitzeist deshalbdavon überzeugt, dass das „KKG als Europaschule ein friedliches Miteinander verschiedener Kulturen vorlebt“. Dies werde auch durch Austauschmaßnahmen und Klassenfahrten unterstützt: „Der selbstverständliche, aber auch kritische Umgang mit neuen und alten Medien bereitet unsere Schülerinnen und Schüler auf ihre Zukunft vor und befähigt sie zur aktiven Gestaltung gesellschaftlicher Teilhabe.“ Volleyball, Wandern, Lesen und das Kennenlernen von neuen Ländern sind seine liebsten Beschäftigungen in der Freizeit. Zu seiner Stellvertreterin wurdeDr.EvelynGettner ernannt, die erste Frau in dieser Position an der Traditionsschule. (mg)



Bericht von der Mitgliederversammlung 2023. Vereinigung auch bei jüngeren Absolven-
Die Frage, wie das 100-jährige Bestehen in diesem Jahr begangen werden soll, nahm dann breiten Raum in der analog-digitalen Versammlung ein. Marco Sievert: „Wir wollen das Geld nicht für die Feier, sondern für die Schüler ausgeben.“ Voraussichtlich Anfang November soll eine Talkrunde zu Thema Vergangenheit und Zukunft stattfinden, zum Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und mit anschließendem Umtrunk. Als Investition in die Zukunft will die Vereinigung einen humanoiden Roboter stiften, der von den Schülern programmiert werden kann. Aufgezeigt werden sollen die Chancen und Risiken neuer Technologien. Angedacht ist auch ein interaktives Quiz zu den Themen KKG, Aachen und Karl der Große. Vorsitzender Marco Sievert schilderte die Entstehung der Vereinigung, die von J. Hüpgens in der Halbjahresschrift Vereinigung ehemaliger Schüler des KaiserKarls-Gymnasiums im Juli 1954 so wiedergegeben wurde:
„Die Gründung fällt in den Herbst des Jahres 1923. Die erste Anregung zum Zusammenschluß ehemaliger Karlspennäler ging von dem bekannten Aachener Hofjuwelier Steenaerts aus, dessen Idee bei den anderen alten Schülern sofort begeisterte Zustimmung fand. Herr Steenaerts war auch der erste Vorsitzende der Vereinigung. Im Februar 1924 kamen die Gründer zum 1. Male im Gymnasium mit dem damaligen Leiter der Anstalt, Herrn Dir. Schulz, zu einer konstituierenden Sitzung zusammen. Ziel der Vereinigung sollte es sein, die Verbindung mit der Schule auch im späteren Leben aufrecht zu erhalten, sich bei besonderen Anlässen im vertrauten Kreise zusammenzufinden und schließlich durch Zahlung eines Beitrages in der Lage zu sein, bedürftigen, aber auch würdigen Schülern zu helfen sowie Einrichtungen der Schule, die den Jungen zugutekommen, zu fördern und zu unterstützen.“ (hau)
Sammelband des Rösrather Geschichtsvereins mit einem Beitrag zu Grabinschriften auf dem KKG-Quadrum erschienen. Platten erinnern an Patres der Augustiner-Eremiten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. tres.
Im Jahr 2020 – noch vor der Pandemie –machten vier Schülerinnen aus einem Kurs Praktische Philosophie der Stufe 5 ihren Lehrer auf „geheimnisvolle“ lateinische Inschriften auf dem oberen Schulhof Quadrum des KKG aufmerksam. Die Übersetzung, um die sie ihn spontan baten, konnte er seinerzeit peinlicherweise nicht liefern. Und so ging ich der Sache nach – nicht ahnend, dass meine Nachforschungen auch über die Schulöffentlichkeit des KKG hinaus Interesse wecken würden. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei den in der Nordmauer des Quadrum sowie der Aula Carolina eingemauerten Inschriftplatten um die wenigen nach den Wirren des ZweitenWeltkriegsverbliebenenGrabplatten von sechs zum Teil über Aachen hinaus wirkmächtigen Patres der Augustiner-
bracht hatten. Die Vorgängerinstitution des KKG, das Collegium Marianum, befand sich seinerzeit noch in der Annastraße / Frère-Roger-Straße und in fester Hand des Jesuitenordens.
Durch Recherchen zu drei der Patres, namentlich Lambert(us) und Werner(us) von Rohe zu Elmpt – zwei von drei adligen Brüdern, die alle in das Augustiner-Kloster in Bedburg/Erft eintraten – sowie Arnold(us) Gillessen, kam drei Jahre später ein Kontakt nach Rösrath bei Köln zustande. Denn unter anderem im ehemaligen Rösrather Augustiner-Konvent hatten alle drei Patres gewirkt und gemeinsame Lebenszeit verbracht. Robert Fahr vom Rösrather Geschichtsverein war sofort an Abbildungen ihrer Grabplatten interessiert und lud mich ein, mit einer Miszelle zu einem geplanten Sammelband beizutragen. Als Vorbereitung auf eine längere Darstellung zu allen sechs Patres nahm ich dieses Angebot dankend an und machte mich weiter auf Spurensuche. Mit der Buchpräsentation des Sammelbands „Streifzüge 2. Kleine Forschungen zur Geschichte Rösraths und seiner Umgebung (Schriftenreihe des Geschichtsvereins für die Gemeinde Rösrath und Umgebung e. V. Bd. 52)“ (ISBN: 978-3-92-241375-2; Preis: 19,80 EUR) am 1. Dezember 2023 im historischen Saal des Wöllnerstifts in Rösrath-Hoffnungsthal sind nun auf den Seiten 7–16 die bisherigen Rechercheergebnisse erschienen: eine Transkription und erstmalige Übersetzung der Inschriften sowie kurze Biografien der drei Rösrather bzw. Aachener Pa-


Zu den früheren Standorten der Grabplatten konnten Jürgen Bertram, Paul Blasel, Dr. Jörg Fündling, Hans-Peter Kerff (†) und Michael Von den Driesch, Ehemalige aus Jahrgängen der 1950er bis 1980er Jahre, sowie Dr. Hermann Kramer mit ihrem anekdotischen Wissen dankenswerterweise etwas, aber bisher sprichwörtlich nur Bruchstückhaftes beitragen, sodass ich für weitere Nachforschungen um genauere Auskünfte aus dem Kreis der Ehemaligen mir zu Händen (johannes.niessen@mail.aachen.de) äußerst dankbar wäre!
Aber besonders Erika, Isabella, Julie und Yara bleibt mir an dieser Stelle noch einmal für ihr Interesse zu danken, ohne das ich mich wahrscheinlich nicht weiter mit den Inschriften, deren Entzifferung und Übersetzung sowie den hinter ihnen stehenden Menschen beschäftigt hätte. Im Falle von Yara ist aus dem anfänglichen Interesse sogar mehr geworden: Sie hat Latein gewählt. Dabei wünsche ich weiterhin viel Freude und Erfolg!
Johannes Maximilian Nießen

Unbändige Kreativität und Leidenschaft für die Arbeit vermittelt. Nach der Pensionierung „Choco & Co“ eröffnet.

Über keine Lehrerin wussten die Schülerinnen und Schüler ihrer Zeit mehr als über Edda Möller-Kruse. Als sie 1992 als Kunstlehrerin ans KKG kam, erzählte sie gern von ihrem bewegten Leben, das sie zu dem gemacht hatte, was sie war: eine Querdenkerin im besten Sinne des Wortes, die sich gegen Gleichmacherei und hanseatische Ordnung stellte. Sie schlug einen unkonventionellen Weg ein, der in einer Kaufmannsfamilie so nicht vorgesehen war und merkte schon früh, dass sie eine Macherin war. Ihr Tatendrang und ihr Wille nach Veränderung beherrschten in gesamtes Leben. Welch ein Glück, dass sie ihren eigenen Weg ging – für die vielen Kinder und Jugendlichen und für das KKG! Auch hier in Aachen war sie das „Enfant terrible“, und ihr unbeschwertes und selbstbewusstes Auftreten tat der Schulgemeinde gut. Ihre unbändige Kreativität und Leidenschaft für die Arbeit mit Heranwachsenden prägten ihre Zeit am KKG. Doch ihr Engagement beschränkte sich nicht nur auf den Kunstunterricht. Sie half den Schülern bei der Organisation der ersten LANPartys und initiierte Berufsinformationsveranstaltungen mit Eltern und ehemaligen Schülerinnen und Schülern.

Für Edda Möller-Kruse war Schule nicht nur ein Ort des Lehrens, sondern ein
Ort des Lebens. Daher war es nur folgerichtig, dass sie nach ihrer Pensionierung 2004 einen kleinen Laden (Choco & Co) in der Pontstraße eröffnete, um in einem einzigartigen Projekt jungen Schülerinnen das Abenteuer Selbstständigkeit schmackhaft zu machen.
Bis ins hohe Alter verlor sie nie ihre Neugier und wollte immer „machen, machen, machen“, wie sie es in einem Interview selbst ausdrückte. Sie unterstützte geflüchtete Menschen bei der Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft, entwickelte ständig neue Ideen für ihren Laden und ihre Kreativwerkstatt und war bis zuletzt offen für neue Technologien wie digitale Kunst auf dem iPad.
Edda Möller-Kruse war nicht überall beliebt; sie eckte mit ihrer Tatkraft manches Mal an. Doch auch das war ihr wichtig. Sie hatte ihren eigenen Kopf und wollte unkonventionell sein. Das machte sie zu
einer gradlinigen Person in ihren Werten und zu einer sprunghaften in ihren Ideen. Für die Schülerinnen und Schüler des KKG war sie eine große Bereicherung in Zeiten des Wandels in den 90er Jahren. Für viele war sie nicht nur Kunst-, sondern Kultlehrerin.
Als Ehemalige, die das Glück hatten, ihr zu begegnen, sind wir dankbar für die Begegnung mit einer Frau, die mitten im Leben stand und stets darüber hinausblickte. Sie war ein Vorbild für Lebenslust, Tatendrang und Offenheit.
Am 12. Juli 2024 ist sie im Alter von 84 Jahren unerwartet, aber friedlich von uns gegangen. Wir sind dankbar, dass wir einen Teil ihres Lebenswegs mit ihr gehen durften. Alle, die sie kannten, sind eingeladen, am 19. Oktober 2024 ab 13 Uhr in der Aula Carolina eine Lebensfeier zu ihrem Gedenken zu besuchen. Marco Sievert
Diese Schülerinnen und Schüler haben das Abitur erfolgreich bestanden:
Abdalla, Lina; Axer, Linus Benedikt; Bamberg, Sven-Luca; Bin Adeel, Abdullah; Braun, Philip Sebastian; Bremser, Tom Marius; Celebi, Dila Naz; Comanns, Mark; Dachwitz, Levi Philipp Mac; Daly, Yarah; Dang, Natalia; Minhthu; Dari, Sarah; Darwisch, Finjas; Dichant, Emma; Djie, Tobias; Dung, Marvin; Eleftheriadou, Zoi; El Wadnakssi; Elyas; Fietz, Melanie Marisa; Flecken, Henrik Michel; Frenz, Christian Andreas; Gerdes, Daniel; Hahne; Emily; Henninger, Christoph; Horn, Alexander; Hüllenkremer, Luca Friedrich; Jacobi, Moritz; Jager, Jil; Jarchow; Malaydee; Kacar, Delil; Karaaslan, Bahri Yaman; Kaspar, Lennart Josef; Kazanc, Koray-Can; Kersten, Isabelle; Kharbouch, Iman; Kirdag, Egemen; Knops, Paula Liane; Koch, Ambre; Kölker, Moritz Leonard; Kotthaus, Pascal; Simon; Kyeremeh, Eugene Davies; Lekpek, Ibrahim; Lighoun, Said; Lunatschek, Rico; Luu, Vladimir Nicholas; Tuong-An; Maksuti, Isabella-Jolanta; Matusov, Ilja; Mayer, Lino Alexander; Meier, Markus; Mellaerts, Stanley Jakob; Theo; Mensah-Yiadom, Candy; Mertins, Julian; Müller, Robin Marlon; Nguyen, Phan Minh-Thi; Nowak, Aaron; David; Offergeld, Johannes Lucas; Otten, Jan Luis; Peters, Finn; Plöttner, Levy Ammon; Post, Siri Helena; Pyls, Lilli Sophie; Qashou, Ibrahim; Radu, Diana; Rejmih, Evelyn-Sofie; Remy, Yann Elias; Richter, Philipp Heinrich; Ruf, Anna Lisa; Salaw, Mia; Sandig, Lucio; Schaffrath, Daniel; Stankov, Vassil; Stier, Zanna Helena Ilse; Strang, Jana; Stüve, Ben; Uecker, Katharina Maria; Vashist, Ishaan; Vigna, Sara Lee; Vondenhoff, Aleksandar; Vossen, Tim; Weber, Valerie Lilian; Weidenhaun, Leonard; Yasar, Ilayda; Yousfi, Zoubeir; Zangana, Niyar
An die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums – Sekretariat des Kaiser-Karls-Gymnasiums –Augustinerbach 7 52062 Aachen
Fax: 0241- 94963-22
E-Mail: info@kkg-ehemalige.de
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-KarlsGymnasiums. Ich möchte künftig das „Forum – Mitteilungen aus dem KKG“ an unten stehende Adresse zugeschickt bekommen:
Name, Vorname:
Adresse:
Email:
Abiturjahrgang bzw. Abgangsjahr:
Datum, Unterschrift:
Datenschutzerklärung:
SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift jährlich zum 15.09. einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000732646.
Name Kontoinhaber, Adresse:
IBAN:
BIC:
Ermäßigter Jahresbeitrag für Studierende/Auszubildende bis 30 Jahre 5,00 Euro Jahresbeitrag 15,00 Euro Erhöhter freiwilliger Jahresbeitrag Euro
Ort, Datum, Unterschrift:
Mit dem Inkrafttreten des neuen Europäischen Datenschutzgesetzes (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, transparent mit gespeicherten personenbezogenen Daten umzugehen. Die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums behandelt Ihre Daten auf jeden Fall sorgsam; Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen.
Wir verfügen über folgende personenbezogenen Daten von Ihnen: Ihr vollständiger Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse (sofern mitgeteilt), Ihr Abiturjahrgang sowie (bei Erteilung eines SEPA-Mandats) Ihre Kontoverbindung. Wir haben Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Abiturjahrgangszugehörigkeit dazu gespeichert, um Ihnen im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft Informationen über die die Tätigkeit der Vereinigung und des Kaiser-Karls-Gymnasiums zukommen zu lassen, Sie über relevante Dinge innerhalb des Vereinigung in Kenntnis zu setzen und Ihnen die Möglichkeit zu gewähren, mit den ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern Ihres Jahrgangs in Kontakt zu bleiben. Keinesfalls nutzen wir Ihre Kontakte oder Informationen über Sie zu anderen Zwecken. Eine Weitergabe an Dritte, sofern der- oder diejenige nicht Mitglied der Vereinigung ist und gleichzeitig dem gleichen Abiturjahrgang wie Sie angehört, schließen wir selbstverständlich aus. Bitte teilen Sie uns per E-Mail oder Brief mit, wenn wir Ihre Anschrift nicht mehr verwenden dürfen. Sie würden dann kein „Forum“ und auch keine anderen Informationen oder Einladungen mehr erhalten. Anschreiben, die direkt die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft betreffen, blieben selbstverständlich davon unberührt. Andernfalls gehen wir davon aus, dass wir weiterhin Ihre Daten so nutzen können, wie oben beschrieben.
Ihre Kontoverbindung (sofern durch die Erteilung eines SEPA-Mandats bekannt) nutzen wir ausschließlich zum Zwecke des Einzugs des Jahresbeitrags und geben diese Daten nur zu diesem Zweck an unser Geldinstitut weiter. Keinesfalls geben wir Ihre Kontodaten an sonstige Dritte weiter.
Bei Rückfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@kkg-ehemalige.de oder schreiben uns an Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums, Augustinerbach 7, 52062 Aachen.

am Montag, 18. November 2024, um 19.30 Uhr im Kaiser-Karls-Gymnasium, Augustinerbach 7, 52062 Aachen.
HINWEIS: Wie in der Satzung festgelegt, besteht die Möglichkeit, die Versammlung ausschließlich virtuell abzuhalten. Hiervon machen wir auch in diesem Jahr Gebrauch. Lediglich der Vorstand wird vor Ort anwesend sein. Wenn Sie an der Mitgliederversammlung per Zoom teilnehmen wollen,meldenSiesichbittebiszum15.11.2024unterinfo@ kkg-ehemalige.de an. Sie werden dann einen entsprechenden Onlinezugang erhalten.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
5. Wahl des Vorstands
6. Wahl eines Kassenprüfers
7. Sonstiges
Der Vorstand


Hinweis des Schatzmeisters: Zur Erinnerung: Jahresbeitrag 15,- Euro, für Studierende/Auszubildende (bis 30 Jahre) 5,- Euro. Konto Commerzbank Aachen, IBAN: DE65 3904 0013 0500 1706 00, BIC: COBADEFFXXX. SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren empfohlen! Bitte unbedingt jede Adressen-/Kontoänderung mitteilen! Danke!
Kassenbericht
Vereinigung der Ehemaligen des KaiserKarls-Gymnasiums Aachen. Berichtszeit: 1. Januar - 31. Dezember 2023
I. Bestände:
a) 1. Januar 2023
1. Girokonto
b) 31. Dezember 2022
II. Einnahmen: Mitgliedsbeiträge
III. Ausgaben:
IV. Gewinn- und Verlustrechnung:
1. Bestände 1.1.2023 13893,91
2. Einnahmen 6662,55
3. Ausgaben ./. 7305,75
Bestände 31.12.2023 (s.o.) 13250,71
Aachen, 4. September 2024 Franz Ewald Clemens, Schatzmeister
Dr. Jörg Fündling (Abitur 1989) zum 400. Geburtstag des Kaiser-Karls-Gymnasiums im Jahre 2001. Diesmal geht es um den Zeitabschnitt 2005 bis 2019 – „Bildung, der neue Bodenschatz“.
Je näher Geschichtsschreibung der Gegenwart kommt, desto komplizierter wird – was man eigentlich nicht erwartet – ihre Aufgabe. Sie weiß noch nicht, wie es anschließend ‚weitergeht‘, sie hat sich nicht lange genug nach den Quellen umschauen können (denn die sind weit verstreut), und mit etwas Pech verpasst sie Einzelheiten oder Entwicklungen, die auf längere Sicht zum eigentlich Wichtigen gehören. Ergänzen, neue Fragen stellen und ausbalancieren müssen dann später andere: Geschichte ist Teamarbeit mit langem Atem.
Die Zeit dramatischer Veränderungen für das KKG in Form großer Neu- und Umbauten war auf absehbare Zeit vorbei, weil die Aachener Stadtfinanzen ebenso ungünstig für große Sprünge waren wie die Lage in der dicht bebauten Innenstadt. ‚Einschneidend‘ in diesem Sinn war höchstens die Eröffnung der langerwarteten Mensa im September 2009. Wandel im Kleinen vollzog sich wie immer, indem etwa das Feuchtbiotop der 1980er vom WäldchenHof verschwand und umgekehrt die lang verschollene Inschrift des Jesuitenkollegs als Signal der (nicht ganz) kontinuierlichen Schulgeschichte einen neuen Platz auf dem Quadrum fand.
Zu kostbar, um an Geld zu denken Fehlender Baulärm und die ‚neue Normalität‘ permanent geänderter Vorschriften haben viele kaum spüren lassen, dass in den „Nullerjahren“ die größten Umbrüche seit
Im September 2009 eröffnet: die Mensa im KKG.
den 1960ern und 70ern auf die Gymnasien Nordrhein-Westfalens zukamen. Parteiübergreifend bestand Konsens, an alle Schulformen im Zweifel lieber die Anforderungen als die Geldzuweisungen zu erhöhen. Nach den Jahrzehnten ausgebauter Differenzierungen und Wahlmöglichkeiten wurde stärker auf ein Kernprogramm gesetzt – einmal, weil es weniger Lehrerstellen und Raumbedarf kostete, zum anderen wegen der Anzeichen für einen generellen Leistungsrückgang in Kernkompetenzen wie Rechnen oder Lesevermögen. Was in einer konservativen Sicht als „Kulturverfall“ beklagt worden wäre, alarmierte nun unter den Vorzeichen der Ökonomie: Das Aufstellen und immer dichtere Kontrollieren von Standards sollte, wie ausdrücklich erklärt wurde, den unvermeidlich zitierten „Wirtschaftsstandorts Deutschland“ sichern, für den Bildung ähnlich oft als „wichtigster“ oder gar „einziger Rohstoff“ gerühmt wurde.
Die Gewinnungskosten dieses Rohstoffs wurden jedoch gedeckelt – in einer betriebswirtschaftlich religiösen Ära ein Indiz, was er wert war. Da fest mit einem Rückgang der Schülerzahlen im Zug des demographischen Wandels gerechnet wurde, kürzte man vorab im Stellenplan und setzte wie so oft die erlaubte Klassengröße hoch. Ziemlich genau um 2005 griff nicht nur die Einengung der Fächerwahl für die Oberstufe, sondern auch die Heraufsetzung der Mindestzahlen pro Kurs, um das Angebot aktiv einzuengen; weniger Begründungsdruck hatten die schrittweise gestärkten MINT-Fächer als Garanten zukünftiger technischer Überlegenheit.
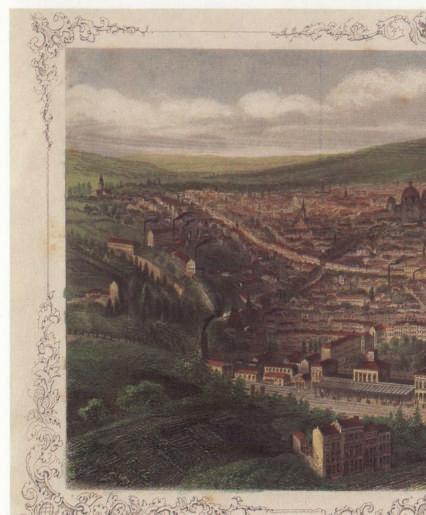
schlechterung der Arbeitsbedingungen sank der Männeranteil im Beruf sichtbar) für größere Lerngruppen laut Vorgabe eine Differenzierung nach individuellen Lernbedürfnissen zu leisten, womit man je nach aktueller Studie mal Finnland, mal Singapur einzuholen wünschte. Abseits von Projektschulen gelangten Stellen für Sozialarbeit, Psychologie und Verwaltung (bei exponentiell steigendem Bürokratieaufwand) nur tröpfchenweise in die Bildungslandschaft von NRW. Auch während der rotgrünen Landesregierung 2010-2017 war der Ausbau der Gesamtschulen praktisch beendet (in Aachen mit dem Start der 4. Gesamtschule 2011); sie waren zum Ersatz für die rasch austrocknenden Haupt- und Realschulen geworden, außerdem teuer in der Gründung. Die Nachfrage nach ihnen stieg nicht mehr so hoch wie erwartet – durcheinander kam die Schulplanung schon deshalb, weil von jedem Geburtsjahrgang schon 2014 in Aachen 57% an Gymnasien wechselten und die Quote später über 60% stieg.

Parallel hatten weniger Lehrerinnen (mit der Ver-
Damit war die Dauerdebatte, welches Aachener Gymnasium bald schließen müsse, beendet. Ein städtisches Entwicklungsgutachten von 2006 hatte dem KKG mittelfristig nur noch eine Gesamtstärke von 600 zugetraut; die realen Zahlen lagen in den Folgejahren bei 820-840, die Neuanmeldungen sprangen wiederholt auf 110 und Ende der 2010er auf nahe 120 – was in neun Jahren eine Schule mit 1000 oder mehr Kindern und Jugendlichen ergeben hätte. Nicht so


sehr das „Fluchtjahr“ 2015 wirkte sich hier aus; reguläre wie krisenbedingte Migration steigerten vor allem die Besuchszahlen jenseits der Gymnasien. Der Anstieg traf aber auf behördlich überfüllte Klassen und ein Lehrerkollegium, das rechnerisch den Unterricht gerade noch abdecken konnte, solange niemand krank oder schwanger wurde oder sich fortbildete (wobei Innovationsfreude auf Industrieniveau, nur nicht zu Industriegehältern, fest erwartet wurde).
Unter Stress arbeitet man am besten Der Schulalltag veränderte sich in dieser Zeit dramatisch. Digitale Lern- und Lehrmethoden durchbrachen die Grenzen des Informatikunterrichts, der Besitz internetfähiger Privatgeräte wurde rasch zur stillschweigenden Erwartung an die Schülerseite, deren Sozialleben sie sowieso veränderten. In Zeiten steigender Berufsmobilität wurden auch Umzüge immer häufiger. Schulministerium und obere Behörden halfen durch Aufrufe, mehr Flexibilität zu zeigen, und die Einführung neuer Dokumentationspflichten. Aus der ganzen Gesellschaft nahmen die –schon traditionellen – Erwartungen an die Schule, soziale und familiäre (Fehl-)Funktionen aufzufangen, rapide zu. Besonders auffällig war der kollektive Geiz der Öffentlichkeit rund um das Projekt der Inklusion. Die Initiative, die in Deutschland allzu lange geübte „Wegsperrmentalität“ an den Sonder-, dann Förderschulen zu durchbrechen, verkam in der Praxis zu einem Sparprogramm an Personalstellen und Gebäudekosten. Kritik daran, wie die Schüler und Schu-

len weithin sich selbst überlassen waren, wurde systematisch verteufelt. Mit der Standardisierung kamen ab 2007 koordinierte ‚Großveranstaltungen‘ dazu: das Zentralabitur für Gymnasien (die Gesamtschulen bekommen bis heute eigene, leichtere Abituraufgaben), die Vergleichsarbeiten in der Klasse 8, die im Jargon als „ZP 10“ bekannten landesweiten Prüfungen an der Schwelle zur Oberstufe. Die Einführung schriftlicher Facharbeiten als Vorübung für die Hochschule und mündlicher Präsentationsprüfungen erhöhte den Aufwand nicht nur auf Lehrerseite zusätzlich. Um es etwas sportlicher zu machen, kam inmitten dieser Umbrüche 2008 der tiefste von allen: der Umstieg zur achtjährigen Gymnasialzeit.
Ähnlich wie im Fall der universitären Bologna-Reform hatten die großen Wirtschaftsverbände darauf gedrängt, jüngere Arbeitskräfte zu bekommen… und auch hier waren sie die ersten, die über das völlig absehbare Ergebnis klagten, dass sich Wissen und Methoden aus neun Schuljahren nicht einfach in acht unterbringen ließen. Statt die (zur Hälfte als Wiederholung gedachte) Jahrgangsstufe 11 zu streichen, verzichtete Nordrhein-Westfalen auf die Inhalte der (anspruchsvollen) Klasse 10. Der Jahre früher einsetzende Nachmittagsunterricht machte aus Halbtagsgymnasien wie dem KKG – der großen Mehrheit – Dreiviertel-Ganztagsschulen; wie sie Angebote schufen, nachmittags bei den Hausaufgaben oder schlicht beim Sattwerden zu helfen, überließ die Ministerialbürokratie weitgehend dem lokalen Erfindungsreichtum. Nicht so interessant schien ihr auch das Aufnahmevermögen (oder der Lebensbedarf) Jugendlicher zu sein. Man zitterte zu Recht vor dem Jahr des Grauens 2013, als die übliche Raumund Personalnot zur Abiturzeit durch den Doppeljahrgang extrem wurde (und die Überfüllung an den ähnlich unterfinanzierten Hochschulen weiterging).
Lebenswichtig blieb daneben, zusätzliches Engagement durch Extraqualifikationen
(samt viel Extraarbeit) nachzuweisen, wie es höheren Orts schlicht erwartet wurde. Die 2010er waren in jeder Schule eine Zeit forcierten Plakettensammelns im Eingangsbereich – dahinter standen persönliche Kraftakte, weil alles zertifiziert, evaluiert, validiert zu sein hatte. Das KKG wurde MINT-EC-Schule, 2017 auch Europaschule und führte im selben Jahr die englischbilinguale Option ein, die in den 1990ern noch am Widerstand mehrerer Seiten gescheitert war. Daneben blieb Zeit und Kraft für erstaunlich viele freiwillige Angebote, von den zahlreichen Arbeitsgemeinschaften bis hin zum Literarischen Quartett. Wie viel Sozialleben auch nach Unterrichtsende am Augustinerbach herrschte, war eine geradezu begeisternde Veränderung gegenüber früheren Jahrzehnten.
Die Themen des Tagesgeschehens wirkten in dieser Zeit eher gedämpft ein. Seit ab 2010 das Thema sexualisierter Gewalt in Institutionen und Organisationen ins öffentliche Bewusstsein drang, wurden Anti-Missbrauchs- und Präventionsbelehrungen Pflicht. Unverschuldet still blieb es rund um den 1200. Todestag Karls des Großen 2014; das Domkapitel war derart entschlossen, das Festgeschehen zu kontrollieren, dass die Kooperationsangebote des KKG und aus der ganzen Stadt schlicht liegenblieben.
Erfreulich unspektakulär ging es dagegen in anderen Fällen zu. Weder die anhaltenden Handicaps des Schulleiters nach einem schweren Unfall noch der Ruhestand von Paul-Wolfgang Jaegers 2014 lösten jene Machtkämpfe und Animositäten aus, die andere Übergangssituationen geprägt hatten. In dieser Hinsicht war man ein beachtliches Stück reifer geworden, als mit Jürgen Bertram der erste „gelernte“ KKGer seit einem halben Jahrhundert die Leitung übernahm.
Letzte Folge: „Harmloser als Grippe“: Schule in interessanten Zeiten leben (20192025)
Veronika Poestges war 15 Jahre lang einzige Lehrerin am Kaiser-Karls-Gymnasium. Die evangelische Pastorin unterrichtete Religionslehre.
Eigentlich solte sie gar keine Chance bekommen, am altehrwürdigen Kaiser-KarlsGymnasium in die heile Männerwelt einzudringen - doch nachdem sie einmal trickreich den Zugang gefunden hatte, machte sie großen Eindruck auf ihre Schüler. Und der ist derart nachhaltig, dass sie noch nach Jahrzehnten von Ehemaligen gegrüßt wird, die sie niemals selbst im Un-
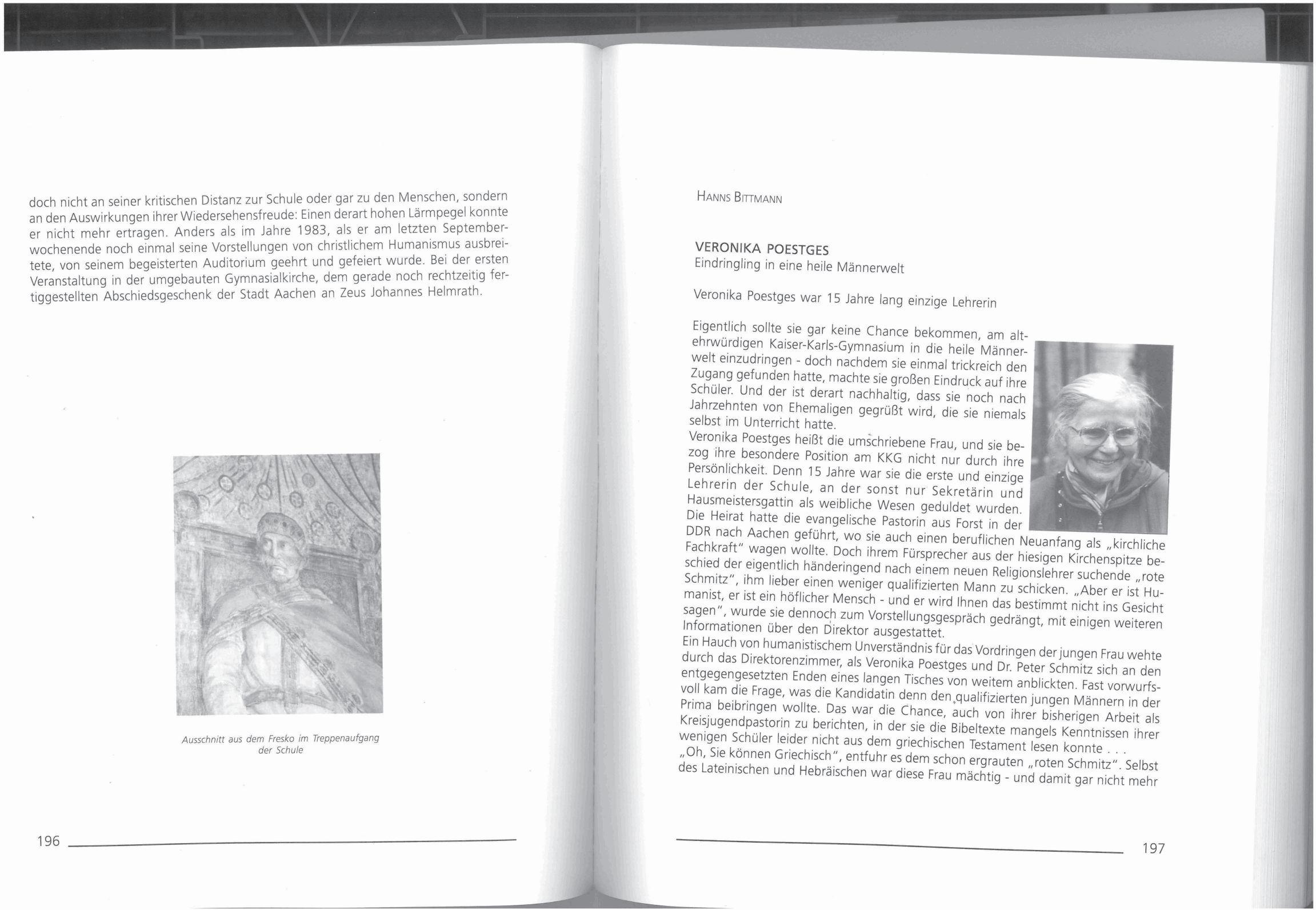
Ein Hauch von humanistischem Unverständnis für das Vordringen der jungen Frau wehte durch das Direktorenzimmer, als Veronika Poestges und Dr. Peter Schmitz sich an den entgegengesetzten Enden eines langen Tisches von weitem anblickten, Fast vorwurfsvoll kam die Frage, was die Kandidatin denn den qualifizierten jungen Männern in der Prima beibringen wollte, Das war die Chance, auch von ihrer bisherigen Arbeit als Kreisjugendpastorin zu berichten, in der sie die Bibeltexte mangels Kenntnissen ihrer wenigen Schüler leider nicht aus dem griechischen Testament le-
„Oh, Sie können Griechisch“, entfuhr es dem schon ergrauten „roten Schmitz“. Selbst des Lateinischen und Hebräischen war diese Frau mächtig. Tatsächlich schaffte sie Anno 1957 den Sprung ins Lehrerzimmer, in dem fortan manches Gespräch der kauzig-kernigen Männergesellschaft verstummen sollte, sobald die Neue über
Nur noch manchmal räusperte sich verlegen der Direktor, wenn er die versammelte Kollegenschaft nur in der männlichen Form angeredet hatte. „Sparen Sie sich das ,meine Damen‘ ruhig“, kam dann zurück. „Ich höre auch auf ,meine Herren‘.“
Mehr Schwierigkeiten bekamen ihre männlichen Mitstreiter dann allerdings, als
Den 90. Geburtstag gefeiert hat Veronika Poestges am heiligen Pfingstsonntag 2015, einem Fest, das ihr nach wie vor viel bedeutet. Bis ins hohe Alter ist die ehemalige Religionslehrerin am KKG noch in allen möglichen Ehrenämtern aktiv gewesen, hat etwa in der Evangelischen Kirche Gottesdienstvertretungen gemacht oder Gesprächskreise für Frauen über soziale oder religiöse Themen abgehalten. „Ich bin in der Annakirche bekannt wie ein bunter Hund.“ Während ihrer Zeit an Aachens ältestem Gymnasium hat sie als einzige Frau im Kollegium mit dazu beigetragen, dass ein ökumenischer Gottesdienst eingeführt wurde. Aus Anlass des runden Geburtstags druckt das „Forum“ noch einmal einen Beitrag des verstorbenen Journalisten und ehemaligen „Forum“-Herausgebers Hanns Bittmann, den dieser für die Festschrift zum 400jährigen Bestehen des Kaiser-Karls-Gymnasiums im Jahr 2001 verfasst hatte. Der damals 44-Jährige ist wie seine Frau Nele im April 2006 auf dem Weg in den Urlaub bei einem Unfall auf der
1972 alle Dämme brachen und noch vor einer zweiten Lehrerin knapp zwei Dutzend kleine Weiblein feste Größen am KKG wurden. Noch immer muss Veronika Poestges beim Gedanken an die Einführung der Koedukation schmunzeln: „Direktor Helmrath ermahnte alle Männer, ihren Ton etwas zu mäßigen und nicht zu grob mit den Schülern umzugehen - schließlich habe man ja bald zarte Mädchen. Ich hab‘ nur entgegnet: „Machen Sie keinen Fehler, zehnjährige Mädchen sind noch keine jungen Frauen. Wenn Sie die zu zart behandeln, dann wickeln sie in einem Monat alle Lehrer um den Finger!.“
15 „Übergangsjahre“ für Veronika Poestges waren abgeschlossen. Nach hinten wanderte die Erinnerung an die unglaubliche Damentoilette im halb zerschossenen Waschhaus, die für die einzige Lehrerin und die Sekretärin genügen musste. Durchaus nicht immer unangenehm war hingegen der Gedanke an die Unterrichtsstunden in der Bibliothek, als die Zahl der evangelischen Schüler noch keinen großen Unterrichtsraum nötig machte.
Aber noch schöner war das Abschiedsjahr mit dem ersten ökumenischen Abiturgottesdienst - ganz im Geiste der Pastorin, doch von ihren Schülern beider Konfessionen initiiert. Alle Kreativität sollte von den Abiturienten ausgehen, sie durften sogar denjenigen aus ihrer Mitte bestimmen, der eine Predigt im Sinne aller Schüler vorbereitet - und sie entschieden sich für Veronika Poestges. Jene durchaus auch streitbare Frau, die weniger qualifizierte Kritik an der Kirche mit einem einzigen Satz zum Verstummen bringen konnte: „Seid still, wenn wir über Kirche schimpfen wollen, das kann ich viel besser - denn ich bin vieI länger dabei.“
Lange blieb sie auch nach ihrer Pensionierung im Jahre 1990 als Seelsorgerin aktiv. Fünf ihrer Schülerinnen und Schüler, die sich den Beruf und die Person von Veronika Poestges zum Vorbild nahmen, luden sie zu ihrer Ordination ein. Da wurde sie wieder ganz besonders spürbar, die Verbundenheit vieler zur ersten, lange einzigen, aber nie einsamen Lehrerin am Kaiser-Karls-Gymnasium. Hanns Bittmann

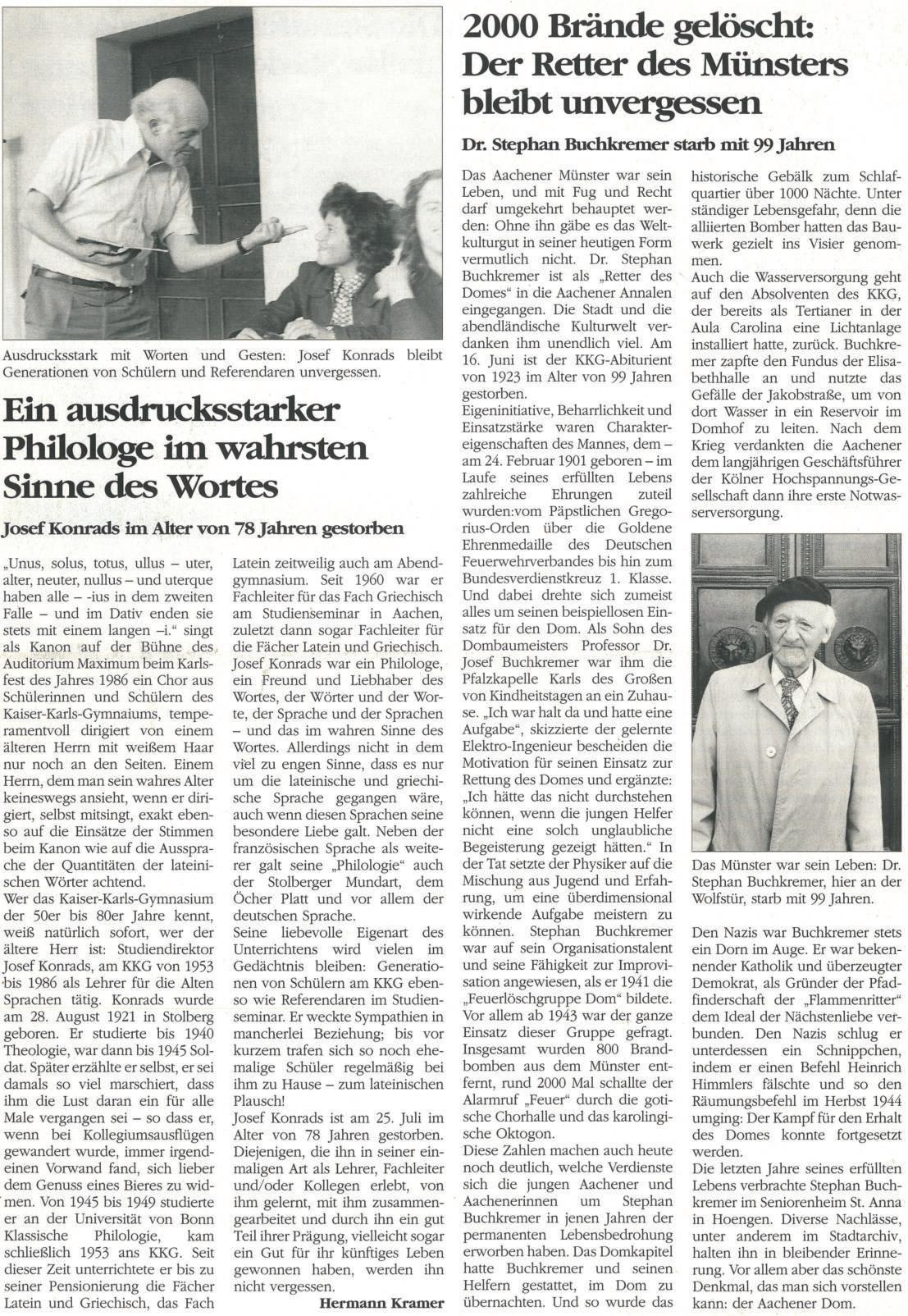




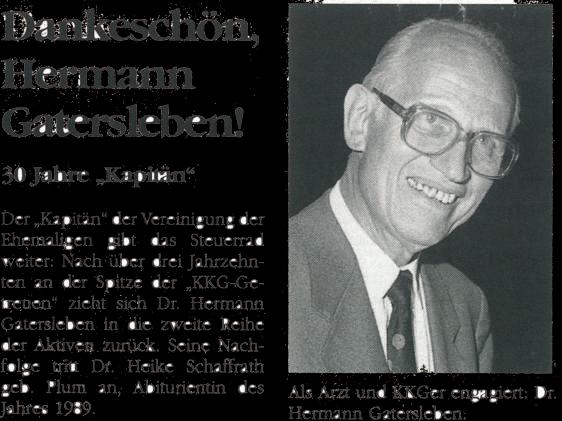
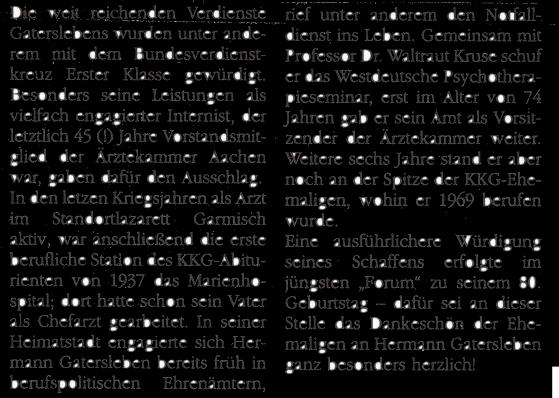



„Die Deutschlehrer am KKG haben
Der ARD-Rechtsexperte und Journalist Frank Bräutigam im Interview. 1995 machte er Abitur am KKG.
Forum: Als Leiter der Rechtsredaktion der ARD sieht man Sie sehr häufig im Fernsehen. Sie haben Jura studiert - fühlen Sie sich eher als Anwalt oder als Journalist?
F. Bräutigam: Ich bin in erster Linie Journalist, der Dinge erklären will und bewertet. Dann kommt in zweiter Hinsicht hinzu, dass ich mich auf ein Fachgebiet spezialisiert habe - das Recht.
Sie sind seit drei Jahren als Leiter der Rechtsredaktion der ARD der Nachfolger von KarlDieter Möller, Wofür treten Sie ein?
Mir ist wichtig, dass das Thema Recht einen ganz vorderen Platz im Programm hat, vor allem in der Tagesschau. Das Recht ist keine langweilige Sache, wie es oft verschrien ist. Hinter jedem Paragrafen stehen Menschen, Schicksale und Konflikte, die ich erklären möchte. Ich erzähle die Geschichten und Emotionen, die dazu gehören.
Man hat ja im Radio und Fernsehen nur wenig Zeit - 1 Minute 30 ist das Maß der Dinge. Hat man da noch genügend Zeit, um komplexe Gerichtsentscheidungen differenziert zu erklären?
Man muss vereinfachen - das ist ganz klar. Darin besteht die Kunst: etwas einfach zu erklären, ohne dass es falsch wird. Es ist unsere tägliche Herausforderung, die Konfliktlinien in kurzen Sätzen herauszuarbeiten und dann auf ein oder zwei zentrale Leitsätze, die für den Bürger wichtig sind, zu beschränken. Man muss den Mut haben, zu verkürzen.
Was halten Sie von Live-Übertragungen von Gerichtsverhandlungen?
Ich bin für eine gewisse Lockerung des Filmverbots, aber nicht bei Strafprozessen an jedem Verhandlungstag. Es geht oft um intime Dinge und Persönlichkeitsrechte. Wenn Zeugen wissen, dass sie live im Fernsehen aussagen, beeinflusst sie das auch.
Sie halten sich bei der Berichterstattung oft sehr zurück mit einer eigenen Meinungsäußerung....
Es gibt die Unschuldsvermutung und deshalb bin ich bei Strafprozessen eher vorsichtig. Stellung beziehe ich dann, wenn ich in den Tagesthemen den Kommentar sprechen darf.

Was sagen Sie Zuschauern, die glauben, dass in Deutschland Täter zu milde bestraft werden?
Diese Zuschriften haben wir nicht so oft. Aber wenn Gerichte beim Thema Sicherungsverwahrung Straftätern Entschädigung zusprechen, weil sie zu lange in Haft waren, dann heißt es schnell: „Ein Sexualverbrecher kriegt auch noch Geld für seine Tat.“ Dann sehe ich es als meine Aufgabe an zu sagen: Ich verstehe, dass Opfer damit Probleme haben, aber es geht nicht darum, die Tat zu rechtfertigen. Das ist anstrengend und hart, aber der Rechtsstaat ist manchmal anstrengend, und es ist gut so, dass wir ihn haben.
Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
Für juristische Dinge habe ich mich während der Schulzeit nicht besonders interessiert. Mein Zuhause war ein „Zeitungshaushalt“. Auf dem Frühstückstisch lag immer eine Lokalzeitung, das gehörte mit zu unserem Familienleben. Hinzu kam, dass ich am KKG gute Deutschlehrer hatte, die das Interesse für Sprache gefördert hatten. Heribert Körlings zum Beispiel, ein ganz hervorragender Deutsch- und Religionslehrer, an den ich heute noch öfters denke. Nach meinem Abi und dem Zivildienst hat mich ein Berufsberater 1996 in das Journalismus-Seminar von Uli Adrian, heutiger ARD-Korrespondent in Polen, nach Rohren in die Eifel geschickt: eine Woche Journalismus für Anfänger. Das Seminar gibt es heute noch, es ist hervorragend. Dann kam ein Praktikum bei der Aachener Zeitung. Ab wann spielte Jura eine größere Rolle?
Ich habe überlegt, welches Studium passen würde, um Journalist zu werden, habe über mögliche Geisteswissenschaften nachgedacht und dann aber auch gemerkt, dass es nicht schlecht sei, ein Fachgebiet zu haben. So bin ich schnell zu Jura gekommen. Ich
habe mit vielen Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, dass es nicht nur langweilig sei, sondern viele spannende Dinge zu erleben gebe. Das hat sich dann auch bestätigt.
Hat der Beruf Ihres Vaters, ehemaliger Vorstand der Sparkasse Aachen, eine Rolle gespielt?
EristBWLer.Ichhabemirauchangeschaut, was man damit machen kann, aber für mich war das nichts. Ich hatte zum Glück von zuhause die Freiheit bekommen, wählen zu können, was mir liegt.
Wie sind Ihre Verbindungen nach Aachen?
Ich besuche regelmäßig meine Eltern, war diesen Sommer beim Reitturnier, und wir haben in Burtscheid, wo ich herkomme, geheiratet. Ich bin immer mal wieder in Aachen. Meine Freunde von damals aus der Schule sind heute in ganz Deutschland verteilt. Aber ich war auch schon beim Ehemaligen-Treffen, wenn es terminlich gepasst hat. Wenn die Schüler mal Lust haben zu erfahren, wie man Journalist wird, komme ich gern mal am KKG vorbei - wenn Bedarf ist.
Haben Sie positive Erinnerungen an Ihre Schulzeit?
Es war natürlich nicht immer alles einfach im Unterricht und auch nicht mit jedem Lehrer, aber im Grunde war es eine positive Zeit. Wenn ich an die altehrwürdigen Hallen und Treppenaufgänge im KKG denke, dann erinnert mich das an alte Schulfilme. Ich hatte einen sehr netten Sportlehrer, Herrn Trentzsch, mit dem wir viel gemacht haben, spielten Basketball in der engen Sporthalle. Das sind schöne Erinnerungen.
Frank Bräutigam leitet auch die Redaktion des „Ratgebers Recht“ der ARD

Ein höchst seltenes Jubiläum: Alfons Breuer ist der vermutlich älteste KKG-Abiturient.
1932 – in Deutschland gibt es mehr als sechs Millionen Arbeitslose, nach der Reichstagswahl im Juli stellt die NSDAP erstmals die stärkste Fraktion. Am KaiserKarls-Gymnasium legen in diesem Jahr 29 junge Männer das Zeugnis der Reife ab. Unter ihnen Alfons Breuer, geboren am 6. 9. 1912. Der ehemalige Leiter der Apotheke der Städtischen Krankenanstalten (später Klinische Anstalten der RWTH Aachen) lebt heute im Alter von 100 Jahren in seinem Haus in Hahn. Vor 80 Jahren das Abitur gemacht, das ist sicher ein höchst seltenes Jubiläum, zu dem das Forum und die Ehemaligenvereinigung herzlich gratulieren. Wer ein solch langes Leben hat, der kann viel erzählen, und das hat Alfons Breuer im Beisein seines Sohnes Albert dann auch getan.
Geboren und eingeschult im April 1918 wurde er zur Kaiserzeit, erinnert sich Alfons Breuer, der damals noch Lieder zum Lobpreis von Wilhelm II. erlernen musste. Zunächst besuchte er die Mittelschule an der Sandkaulstraße, wo zu dieser Zeit die Prügelstrafe noch gang und gäbe war: „Der Stock war da, und er wurde regelmäßig verwendet.“ Seine Mutter starb früh, als er acht Jahre alt war; irgendwann beschloss sein Vater, dass er das KKG besuchen sollte, vielleicht inspiriert durch die Tatsache, dass vier seiner Vettern, darunter der spätere Stadtdirektor Dr. Josef Breuer, ebenfalls das KKG absolvierten. 1923 fiel an einem Tag die Schule aus, weil die rheinischen Separatisten, die für die Abtrennung des Rheinlandes kämpften, das Rathaus besetzt hatten und ihre Gegner alle Hydranten öffneten. Ergebnis: Der Augustinerbach war überschwemmt, das Kaiser-Karls-Gymnasium nicht erreichbar.


Vater Matthias Breuer, Musiklehrer und Organist in Hl. Kreuz, weckte auch in seinem Sohn Alfons die Liebe zur Musik, so dass Musiklehrer Weinberger leichtes Spiel hatte, ihn in den Schulchor zu bekommen. Zusammen mit dem Lehrerinnen- und Lehrergesangverein habe man viele Konzerte im Alten Kurhaus an der Komphausbadstraße gegeben: „Wir durften festliche Abende mitgestalten.“
BevorAlfonsBreuerseinPharmaziestudium aufnahm, musste er ein zweijähriges Praktikum absolvieren, das er mit einem Vorexamen abschloss. Das Studium kostete 200 bis 230 Reichsmark pro Semester; deshalb arbeitete er nach dem Vorexamen zwei Jahre in einer Apotheke, um die Summe aufzubringen: „Das war viel Geld damals.“
Er studierte in Königsberg, Kiel, Münster und Marburg, folgte so den Dozenten, die wichtige pharmazeutische Bücher geschrieben hatten, und machte 1939 sein Examen. Nach Kriegsbeginn machte er bis 1942 Vertretungen in Apotheken, wurde dann eingezogen und arbeitete auch dann an verschiedenen Stellen als Apotheker,
bis er im Kurland (heutiges Lettland) in russische Kriegsgefangenschaft geriet. Auch in dieser Zeit war er als Apotheker tätig. Nach vier Jahren erfolgte 1949 die Entlassung und später die Rückkehr nach Aachen. Schnell schloss er sich auch der KKG-Ehemaligenvereinigung an, besuchte regelmäßig die Treffen, feierte 1957 das 25-jährige Abi-Jubiläum, auf dem man die Zeugnisse einsehen konnte: „Damals war es noch das alte und von mir sehr geschätzte und geliebte humanistische Leben“, erinnert er sich etwas wehmütig. Zwei schon verstorbene Mitschüler aus seinem Jahrgang wurden später Lehrer am KKG, sie sind sicherlich vielen Älteren ebenfalls noch in bester Erinnerung: Religionslehrer Dr. Karl Klinkhammer und Musiklehrer Dr. Karl Vent. Alfons Breuer, sein ganzes Leben lang ein bescheidener und zurückhaltender Mann, ist seit 1982 verwitwet, hat eine Tochter, einen Sohn und fünf Enkel. Er hört gerne klassische Musik, wanderte gerne und interessiert sich für Botanik. Das Forum wünscht ihm noch weiterhin ein erfülltes Leben. Heiner Hautermans

Franz Ewald Clemens ist die gute Seele der KKG-Ehemaligenvereinigung. Dem Schatzmeister liegt immer noch die Big Band sehr am Herzen.
Wer kann schon von sich sagen, dass er mit 76 Jahren noch zwei bis drei Mal pro Woche zur Schule geht? Franz Ewald Clemens ist so einer. Und weil Schule nicht reicht, besucht er auch noch weitere drei Male die Hochschule, hat sich im Seniorenstudium für Geschichte und Katholische Religionslehre eingeschrieben. Das sagt viel aus über einen Mann, der stets vielseitig interessiert und engagiert war und seit drei Jahrzehnten die gute Seele der Ehemaligenvereinigung ist. Einer vom alten Schlag, einer, für den es drei Pole in seinem Leben gab und gibt.
Der wichtigste ist sicher die Familie, seine drei Töchter und die sechs Enkel, die ihm über den großen Verlust seiner Frau hinweghalfen, die vor zwei Jahren völlig überraschend verstorben ist: „Die Familie ist mir heilig und eine große Stütze.“ Die zweite Säule ist die Heimat. Geboren wurde er am5.Oktober1936imMarienhospital,das Elternhaus steht an der Ecke Krugenofen/ Neustraße, das sogenannte Bügeleisen. „Ich wollte immer in Burtscheid bleiben. Man könnte mir ein Ministeramt anbieten, das müsste in Burtscheid sein, sonst würde ich es ausschlagen.“ Noch heute wohnt er an der Siegelallee. Die dritte Konstante in seinem Leben ist das Kaiser-KarlsGymnasium. „Mein Leben dreht sich um die Schule.“ Die hat er auch besucht. Nach den Volksschulen Höfchensweg, einer Evakuierung während des Krieges in Konzen und Thüringen und dem anschließenden Besuch der Volksschule Kleverstraße ging es dann zum KKG. Schon in der Quinta erzählte er seinen Eltern von seinem Lebenstraum: Lateinlehrer am KKG. Als er 1957 sein Abitur ablegte, ging es zügig an die Umsetzung des Lebenstraums: Studium der Klassischen Philologie (Latein und Griechisch) in Köln, nebenbei hörte er aber auch Vorlesungen in Archäologie, Geschichte, Kunstgeschichte, vergleichender Sprachwissenschaft und Philosophie – eine Art Studium generale. Noch heute ist er seinem Vater, einem Handwerker, dankbar, dass er ihm das Studium finanzierte, denn das zog sich fast zehn Jahre hin. Das breite Bildungsspektrum kam

ihm nämlich immer wieder in seinem Leben zugute: „Die Schüler haben das genossen und davon profitiert.“ 1967 hatte er nämlich sein Studium abgeschlossen und trat sein Referendariat an. Eigentlich an der Viktoriaschule, aber mit einer Ausnahmegenehmigung des Studienseminars auch am KKG als zweiter Schule: „Ich war ja immer mit dem KKG in Kontakt geblieben.“ Der damalige Direktor Johannes Helmrath („Zeus“) half mit, dass alle bürokratischen Hürden genommen wurden. Doch noch war es nicht so weit. Erster Einsatzort des jungen Pädagogen war nämlich das Goethe-Gymnasium in Stolberg, wo Franz Ewald Clemens 13 Jahre lang Latein und Griechisch unterrichtete. Sofort musste er auch im Mangelfach Geschichte aushelfen – dank des profunden Studiums kein Problem. Sofort engagierte sich der Universalist auch in den Gremien wie Schulkonferenz oder Lehrerrat, wurde Vertrauenslehrer. 1984 bot sich die Gelegenheit zum Wechsel ans geliebte KKG an, was schon deswegen sinnvoll war, weil Griechisch in Stolberg ausgelaufen war. Er ergriff die Chance und hatte damit seinen Jugendtraum verwirklicht. Franz Ewald Clemens war ein Mann klarer Prinzipien und Worte: „Probleme mit Disziplinlosigkeit gab es bei mir nicht.“ Konsequent sei er gewesen und transparent: „Man sagte mir nach, dass man immer wusste, woran man war.“ Eine Notendiskussion etwa habe er nie führen müssen: „Wenn ich sagte: Du bist 4, dann stimmte das.“ Und auch im Lehrerrat boxte er sich gegen die Alten, die damals das Sagen hatten, durch, war bereits nach einem halben Jahr Mitglied: „Das hatte noch nie jemand geschafft.“ Dass er ebenfalls rasch, 1984, Schatzmeister der Ehemaligenvereinigung wurde, beschlossen seinerzeit der damalige Direktor Elmar Bach und sein Vorgänger ihn diesem Amt und ehemaliger Klassenlehrer Klaus Jochum – frei nach dem Motto: „Du machst das jetzt.“ Ähnlich lange ist er auch schon Kassenwart des Philologenverbandes im Bezirk Aachen, seit 1990 auch Schatzmeister des Fördervereins des Kai-
ser-Karls-Gymnasiums. Eine Kombination, die ihm anfangs merkwürdig vorkam, die sich aber als ideal erwiesen habe. „Wenn der eine Verein etwas nicht kann, macht es der andere. Es geht ja immer um das Wohl der Schule.“ Im Jahr 2000 ging Franz Ewald Clemens in Pension, doch seinen Platz im Lehrerzimmer hat er immer noch. Dabei wolle er niemanden lästig fallen, es seien die Kollegen und die Schulleitung, die auf ihn zukämen und ihn immer wieder um Rat bäten. Mobbing sei etwa heute ein echtes Problem an den Schulen. Zu seiner Zeit gab es Kebbeleien, die noch der Lehrer in den Griff bekommen konnte, heute würden in den fünften Klassen Präventionsmaßnahmen von Fachleuten vorgenommen. Und wichtig für den 76-Jährigen ist: „Ich kann kommen und gehen, wann ich will.“ Besonders am Herzen liegt ihm immer noch die Big Band, die er mitgegründet hat und deren Proben er immer noch besucht: „Das ist mein Lieblingskind.“ Doch immer schwieriger werde es, junge Leute für die ausscheidenden Abiturienten zu finden.
Clemens hat zeitlebens Computer mit Verachtung gestraft: „Das war immer ein Tabuthema. Ich schreibe alles auf der Schreibmaschine, die Olympia ist noch völlig in Ordnung.“ Und wenn doch etwas im Internet nachge-

Ein Besuch bei Toni Jansen, dem Ehrenvorsitzenden des Sozialwerks Aachener Christen, im Hospiz. Schon als Neunjähriger wollte er Geistlicher werden. Der Familienrat entschied, dass er das Kaiser-Karls-Gymnasium besuchen konnte.
Es ist einer jener sonnigen, hellen, freundlichen Vormittage, mit denen uns dieser Oktober beschenkt hat. Ein Besuch im Hospiz Haus Hörn. Ein Besuch bei einem katholischen Priester, der über Jahrzehnte diese Stadt bereichert hat. Bereichert in seiner zurückhaltenden, aufmerksamen und zugewandten Art.
Sein Leben ist geprägt vom Kampf für Gerechtigkeit, aber das Wort „Kampf“ klingt für diesen feinsinnigen Menschen natürlich übertrieben martialisch. Und doch war es so, so nachhaltig, so hartnäckig, so zielstrebig, ja: manchmal so kompromisslos – nicht für sich, für andere.
Dieses Leben ist gekennzeichnet von Anstrengung und Überzeugungskraft, von Respekt vor der Arbeit und von der frühen Erkenntnis, dass man schon sagen soll, was man will. Das tut er als Neunjähriger in Eilendorf, das damals noch lange nicht zur
Toni Jansen, Gründer des Sozialwerks Aachener Christen, hat sich in seinem Leben immer für Gerechtigkeit eingesetzt. Foto: Harald Krömer

Stadt Aachen gehört, eine historische Reminiszenz, die er auch an diesem Vormittag eigens betont. Der Mann ist vom Dorf und doch nie ein Provinzler gewesen.
Der Neunjährige
Als kleiner Steppke hat er seinen Eltern gesagt, dass er unbedingt aufs Gymnasium wolle. Wohl wissend, zumindest irgendwie ahnend, dass dies für seine Eltern nicht einfach werden würde, die Mutter Stöpferin, der Vater Maschinenschlosser. Aufs Gymnasium? Da haben die Eltern gesagt, sie könnten es nicht bezahlen. Und dann blitzten die Entscheidungsfreude, die Entschlusskraft, das Wahrnehmen einer letzten Chance auf: Da gestand der Neunjährige seiner Mutter, dass er Priester werden wolle.
Heute würde man tiefenpsychologisch korrekt von der demokratischen Dynamik des Familienrats sprechen. Kurzum: Der Vater fragte die vier Geschwister des jungen Priesteramtskandidaten, ob sie damit einverstanden seien, dass Anton das Kaiser-Karls-Gymnasium besuchen dürfe. Sie, teilweise noch jünger als der Neunjährige, stimmten nach Diskussion zu. Anton, mit seiner Großmutter in aller Herrgottsfrühe stets zur Messe gegangen, hatte es geschafft.
Er mischt sich ein
Ein schüchterner Priester war er nicht wirklich. Wer ihn predigen hörte, weiß, dass er sich einmischt in diese irdische Welt. Und er bestätigt das heute ausdrücklich. „Ich habe immer gerne gepredigt. Mich hat dabei die Frage beschäftigt, was die Leute bewegt in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Das war mir wichtiger, als noch mal das Evangelium von vorne zu erzählen.“
Das soziale Element hat ihn interessiert und motiviert. Er wusste, dass im Weinberg Gottes hart gearbeitet wird. Er wusste es von seinen Eltern, und er sah es, wenn er genau hinschaute. Das war ihm angeboren, anerzogen, und das hat ihn während seines fünfjährigen Theologie-Studiums bei den Jesuiten in Frankfurt/Main geprägt – für ein langes Leben.
Stationen: Priesterseminar in Aachen, Kaplan in Krefeld, Abteilungsleiter für Gemeindearbeit im Generalvikariat, Pastor an St. Peter in Aachen. Da war er Mitte 30 und hatte schon jenen Elan, der über die Jahrzehnte sein zuverlässiger und guter Wegbegleiter geblieben ist. Er kannte die Probleme der Arbeiter, die Würde der Arbeit und den Respekt davor musste ihm niemand erklären. Er erinnerte sich an die Freitagnachmittage, an denen sein Vater die Lohntüte mit nach Hause brachte (Toni Jansen sagt: „abgab“). „Erst nach 60 Wochenstunden Arbeit, später nach 48, schließlich nach 42.“
Kurzum: Toni Jansen ergriff, mit Hilfe von ganz wenigen anderen, die Initiative und gründete 1982 das Sozialwerk Aachener Christen. Die Jugendarbeitslosigkeit in der Stadt, die Langzeitarbeitslosen, Familienväter und Alleinerziehende ohne Job: Er traute der Liturgie des Üblichen nicht, da war Kirche gefragt nach Art von Toni Jansen: „Keine kirchliche Institution mit dem Deckmäntelchen von Frömmigkeit, sondern ein gut organisierter Betrieb.“
Der wurde immer größer, immer interessanter und immer mehr zog er wichtige Mitstreiter an, die Toni Jansen ansprachen: Unternehmer, Einzelhändler, Anwälte, die dem Sozialwerk einen ebenso intellektuellen wie professionellen und nach wie vor praktisch orientierten Charakter gaben und geben. Die gesamte Palette kam auf das Sozialwerk zu: Mitarbeiterführung, Betriebswirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit. „1000 Dinge waren jeden Tag zu erledigen“, sagt der Priester und Manager in seinem persönlichen Rückblick.
Die seelischen Muskeln
Jetzt ist er Ehrenvorsitzender des Sozialwerks. „Es war mir wichtig, einen offiziellen Schlussstrich zu ziehen.“ Das habe er schon sehr früh geplant. Er empfinde große Dankbarkeit für unendlich vieles, für die Mitarbeiter, den Vorstand, den Beirat, die Spender. Sie alle gemeinsam haben in zahlreichen Biografien ihnen Anvertrauter die Folgen einiger Absturzstellen mit ihrem Engagement ehrenamtlich ausgeglichen. Bernd Mathieu

Eine Ausstellung im Kaiser-Karls-Gymnasium erinnert an Peter Wamich, der 1915 in der Champagne durch eine Granate ums Leben kam. Schautafeln informieren über die Zeiten vor 100 Jahren.
„Ich finde es gut, dass daran erinnert wird, was damals passiert ist“, meint Lina Roß, Schülerin am Kaiser-Karls-Gymnasium, mit Blick auf die Eröffnung der Ausstellung über das Schicksal eines KKGAbiturienten im Ersten Weltkrieg. Peter Wamich machte 1914 am KaiserKarls-Gymnasium Abitur und wurde 1915 zum Kriegsdienst eingezogen.
Einen Monat später ließ er in Frankreich an der Front sein Leben. Er starb am 23. September 1915 in Somme-Py in der Champagne, als er von einer Granate getroffen wurde.

Aus dem Nachlass des 1915 verstorbenen KKG-Abiturienten haben zwei Lehrer eine Ausstellung entwickelt.
Das Kaiser-Karls-Gymnasium hat über sein Leben eine Dokumentation erstellt, die auf die Initiative der Großnichte des gefallenen Soldaten zurückgeht.
Birgit Schumacher stellte der Schule persönliche Briefe und Unterlagen zur Verfügung, die durch schon im Schularchiv vorhandene Materialien ergänzt wurden. In einer Ausstellung sind diese historischen Schätze nun im Kaiser-Karls-Gymnasium zu besichtigen.
„Ich finde es toll, wie sich Jürgen Bertram eingesetzthat“,freutsichBirgitSchumacher über das Interesse seitens der Schule und des stellvertretenden Schulleiters. Sie hat die Dokumentation, die die Lehrer Thomas Gelnar und Jürgen Bertram erstellt haben, schon im Vorfeld gesehen und war begeistert. „Überwältigend schön“, urteilt sie und meint: „Es ist, als ob mein Großonkel nach 100 Jahren zurückkäme.“
Arrestzelle für ungehorsame Schüler Und tatsächlich ist es den Lehrern gelungen, ein lebendiges Bild einer Zeit zu zeichnen, die nunmehr 100 Jahre zurückliegt. Während Thomas Gelnar unter anderem die historischen Zusammenhänge beleuchtete, die zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges geführt haben,

konzentrierte sich Jürgen Bertram auf Peter Wamich und seine Schulzeit. Und die sah zur damaligen Zeit erheblich anders aus als heute.
Für ungehorsame Schüler gab es eine Arrestzelle, und die Noten wurden sehr viel strenger vergeben als heute. „Gut“ und „Sehr gut“ waren kaum zu erreichen. Griechisch und Latein machten 50 Prozent des Unterrichtsstoffs aus, Fächer wie Biologie oder Englisch standen noch nicht auf dem Stundenplan. Peter Wamich hatte keine Einträge im Klassenbuch und galt als fleißig, aber nicht besonders talentiert. Nach dem Abitur nahm er ein Theologiestudium in Bonn auf, wurde dann aber schnell einberufen. Laut Bertram zog er nur ungern in den Krieg. Und das war in seiner Zeit eher unüblich. Wie kriegsfanatisch und unerschrocken die Stimmung damals war, stellte Thomas Gelnar eindringlich dar. Immerhin hatte selbst der damalige Rektor der RWTH seine Studenten mit glühenden Worten ermuntert, in den Krieg zu ziehen. Und viele folgten dem Aufruf derer, die sich wild entschlossen auf den Angriff vorbereiteten.
„Der Erste Weltkrieg begann in Aachen und der Euregio“, führte Gelnar aus. Auch
elf Lehrer des KKG folgten dem Ruf an die Waffen. Insgesamt 80 ehemalige Schüler und Lehrer verloren im Krieg ihr Leben. Das Kaiser-Karls-Gymnasium will ihrer mit der Dokumentation, der Ausstellung und anderen Projekten ehrenvoll gedenken. „Das unsägliche Leid des Krieges und die Sinnlosigkeit ihres ‚heldenhaften’ Sterbens vor einhundert Jahren sollen uns gleichzeitig auch Mahnung für heute und die Zukunft sein und uns nachdrücklich anhalten, uns mit allen Kräften für ein friedliches und geeintes Europa einzusetzen“, meinen die Organisatoren. Und verweisen dabei auch auf die aktuelle politische Lage in der Ukraine.
„Man bekommt einen ganz persönlichen Eindruck von einem Menschen, der zu demselben Zweck auf dieser Schule war wie wir: zum Lernen“, sagt Lina Roß, als sie nach den Einführungsvorträgen an den Schaukästen der Ausstellung stehenbleibt. Da liegt neben dem aufgeschlagenen Klassenbuch auch die Schülermütze, die Peter Wamich getragen hat.
Im Keller des ältesten Aachener Gymnasiums stehen Gedenktafeln mit den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Lehrer und Schüler. Peter Wamichs Name wird als letzter unter der Jahreszahl 1915 geführt.
Martina Stöhr

Die KKG-Abiturienta 1914.
ehemalige
Die Erlebnisse einer bewegten Kindheit sind es, die ihn und seine Weltanschauung geformt haben und die er auch im Laufe eines Lehrerlebens an Hunderte, wenn nicht Tausende von Eleven weitergegeben hat: Gerd Janczukowicz, bis 1997 Deutschund Geschichtslehrer am KKG, hat Generationen von Schülern geprägt. Am27. Mai ist der immer noch dynamische und jünger wirkende ehemalige Studiendirektor 80 Jahre alt geworden.
Sein Vater stammt aus einem Örtchen in der Nähe von Minsk und machte sich während der Oktoberrevolution 1917 als 14-Jähriger in den Westen auf. „Er stammte von einem Bauernhof und ging aufs Gymnasium. Bei der Flucht spielte eine gewisse Abenteuerlust eine Rolle.“ Erst arbeitete der Weißrusse ohne Schulabschluss in einer Holzfabrik in Ostpreußen, später im Bergbau im Ruhrgebiet. Vom dort verschlug es ihn ins Aachener Kohlerevier, wo der kleine Gerd 1935 in Bardenberg geboren wurde.
wo er 1955 das Abitur ablegte. Schon in der Schulzeit zeichnete sich eine Leidenschaft ab: Der Oberschüler spielte Theater in der Evangelischen Jugend. Die Passion fürs Theater setzte sich fort im
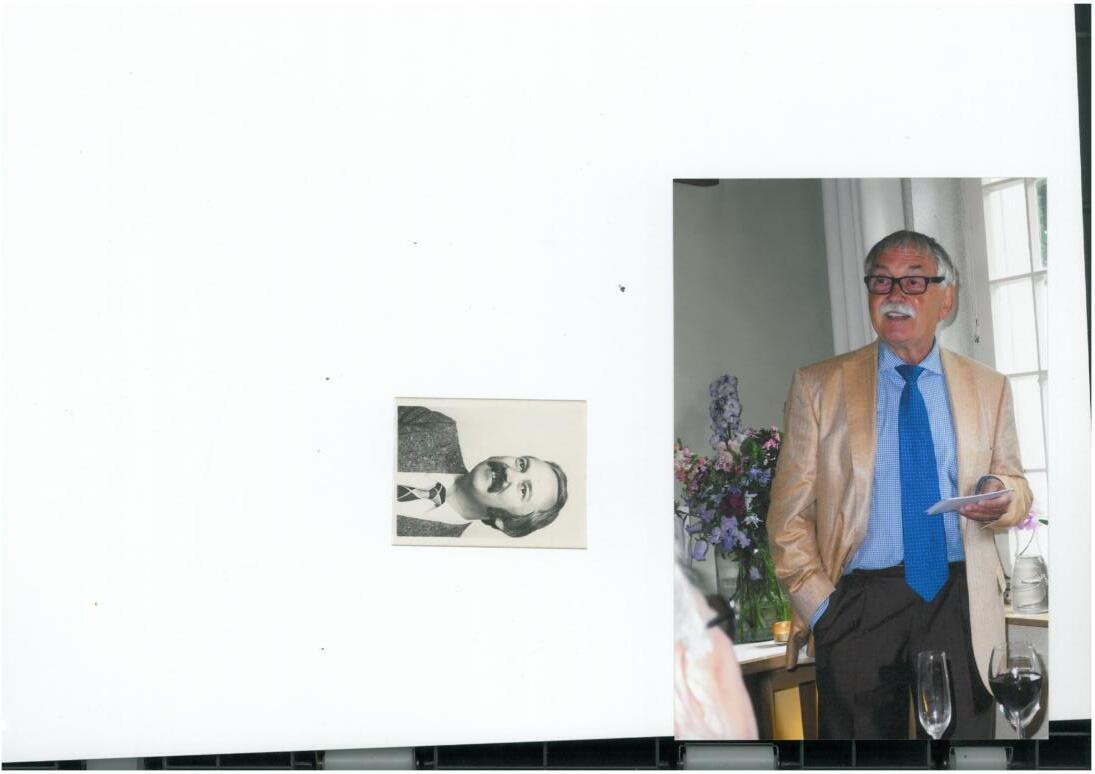
ligion stellte in den konservativen 1960er Jahren ein Ausschlusskriterium dar. Das humanistische Kaiser-Karls-Gymnasium dagegen verzeichnete zu der Zeit eine steigende Anzahl von protestantischen Schülern und der damalige Schulleiter Johannes Helmrath hieß Gerd Janczukowicz willkommen im ebenfalls erzkonservativen Kollegium, in dem sich nur eine einzige (evangelische) Frau befand. Die Entscheidung zwischen Aachen und Alsdorf fiel dem jungen Pädagogen leicht, angesichts der Nähe zur Hochschule, zum Theater und zum städtischen Musikleben.
Schultheater mit Lehrern
Unmenschlichkeit gegen Fremdarbeiter Als Nazi-Deutschland sich in Richtung Osten ausdehnte, erhielt der Vater „auf den letzten Drücker“ 1940 die deutsche Staatsbürgerschaft, im Zuge der „Eingliederung der Ostgebiete in das Großdeutsche Reich“: „Das hat uns das Leben gerettet. Wenn er das nicht geschafft hätte, kann man sich vorstellen, was passiert wäre.“ Sechs Wochen lang musste der Vater als Dolmetscher beim EBV einspringen, bei den Gesprächen mit den dort eingesetzten „Fremdarbeitern“. Dann legte er die Tätigkeit nieder, wegen der Unmenschlichkeit, die manche EBV-Vorgesetzte gegenüber russischen „Fremdarbeitern“ an den Tag legten und obwohl der Rückzug mit persönlichen Risiken für ihn verbunden war: „Das hat mich sehr stark geprägt.“
Gerd Janczukowicz ging in Kohlscheid zur Volksschule, 1944 wurden er und seine Mutter nach Niedersachsen verbracht, während der Vater zum Schanzen (Ausheben von Gräben) in die Eifel eingezogen wurde. Im Mai 1945, Weltkrieg II war zu Ende, erfuhr der Vater über Verwandte in Dortmund, wohin seine Familie evakuiert worden war und holte sie mit dem Fahrrad ab. Der Zehnjährige durfte 1946 als einziger Schüler seiner Volksschulklasse auf das Gymnasium nach Herzogenrath,
Picasso-Stück „Wie man Wünsche beim Schwanz packt“ in Deutschland uraufführten und durch Kontakt zu Ingeborg Bachmann ihr Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“ auf die Bühne bringen konnten.
Entscheidung für das KKG
Gerd Janczukowicz kann stundenlang erzählen. 1961 legte er sein Examen ab und absolvierte sein Referendariat in Alsdorf und im zweiten Jahr am KKG in Aachen, beide Schulen boten ihm eine feste Stelle an. Im Gegensatz zum Pius-Gymnasium, wo er im zweiten Jahr ganze zwei Tage absolvierte: „Ich war evangelisch, und der Schulleiter eröffnete mir, dass ich mich im falschen Umfeld befinde.“ Die falsche Re-
Der Assessor des Lehramts stieg dann schnell zum Studienrat auf, arbeitete später fünf Jahre lang in einer Lehrplankommission in Soest an Richtlinien für die Sekundarstufe I mit, war acht Jahre lang Mitglied des Prüfungsamtes für Lehramtskandidaten der GymnasienanderRWTHimFachDeutsch, führte Generationen von Schülern in das zentrale Lebensbewältigungs-Schlüsselinstrument dialektischer Besinnungsaufsatz ein und - machte Schultheater. Ein erster Höhepunkt war 1983 die Aufführung des Stücks „Die Nacht nach der Abschlussfeier“ von Wladimir Tendrjakow, in dem von der Klassenbesten das Schulsystem scharf kritisiert wird. Zu besetzen waren zwölf Rollen, je sechs mit Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern: „Mich hat gereizt, Schultheater mit Lehrern zu machen“, erläutert der 80-Jährige. Und natürlich, dass er den Ton angeben konnte, Gerd Janczukowicz wählte Texte aus, führte Regie und trat auch auf der Bühne auf – weit über seine Pensionierung hinaus. Ab 2003 geschah das sogar in einem Saal, der ganz oben in den heiligen Hallen der Schule seinen Namen trägt. 2001 stand das 400-jährige Jubiläum des ältesten Gymnasiums Aachens an, das größer gefeiert werden sollte. Gerd Janczukowicz sprach Theo Lieven, den damaligen Chef einer Computerfirma, an, ob er nicht einen jungen Pianisten für ein Konzert im Eurogress zur Verfügung stellen könne. Der erfolgreiche Unternehmer antwortete zu seiner Überraschung, dass er selbst ein Ehemaliger sei und den Solistenpart übernehmen wolle. Allerdings war der junge Theo Lieven an der für ihn unüberwindlichen Hürde Latein gescheitert, in der Quinta musste er die damalige Elite-

schule verlassen. Die Aufführung mit dem Solisten Theo Lieven und dem Aachener Symphonieorchester unter der Leitung des bekannten Dirigenten Lothar Königs, ebenfalls einem ehemaligen KKG-Schüler, wurde ein großer Erfolg - auch finanziell. 25 000 D-Mark blieben als Erlös übrig und wurden in die Herrichtung des Theatersaals gesteckt, an der Stelle, wo es früher mal einen Musiksaal gab, der in Expansionszeiten Klassenräumen weichen musste. Noch bis 2006 spielte Gerd Janczukowicz in dem von ihm ins Leben gerufenen Lehrerkabarett „Die Faulen Säcke“ mit, gestaltete ebenso kurzweilige wie tiefschürfende Brecht- oder Kästner-Abende.
Blick über die Beamtenbrille Als „theaterbegeistert, vielleicht sogar theaterbesessen“ bezeichnet sich der 80-Jährige immer noch, er teilt diese Leidenschaft mit seiner Frau. „Seit zehn Jahren fahren wird jedes Jahr 14 bis 18 Tage zum Berliner Theatertreffen.“ Und auch Sohn Till,


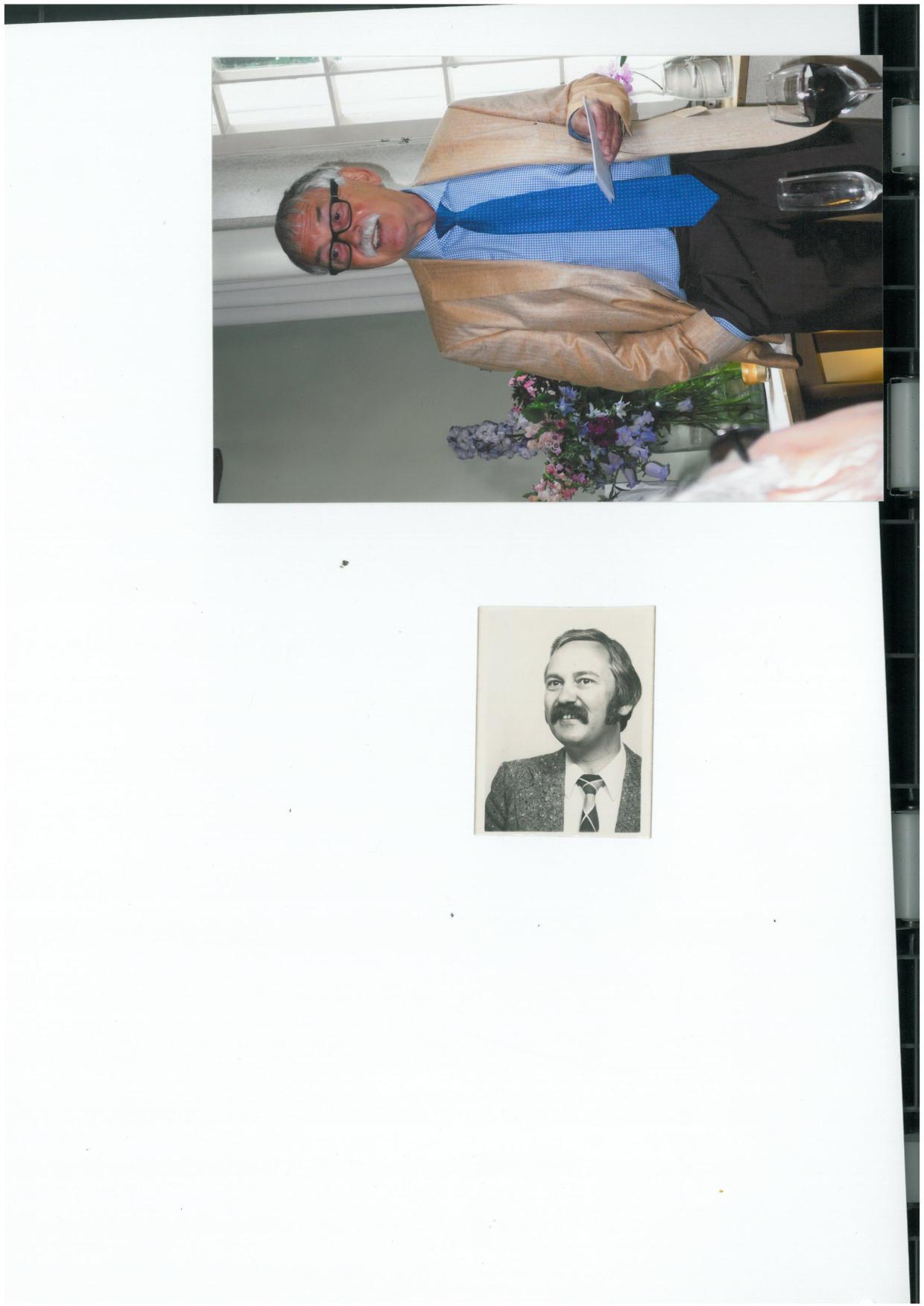


Axel Deubner ist in Aachen ein wichtiger Mann. Vielfach beschrieben, vielseitig interessiert, in vielen Bereichen engagiert, sozial, kulturell, städtebaulich. Beispiel 70. Geburtstag, den er zusammen mit dem 35. seines Sohnes Rolf gefeiert hat: Statt Geschenken hatte er um Spenden für „Akisia“, ein Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern, und „Querbeet“, einem Projekt zur Unterstützung von Drogensüchtigen, gebeten, 14 000 Euro kamen zusammen. Der Seniorchef eines Baumaschinen-Unternehmens, der auch heute noch oft genug im Büro anzutreffen ist, hat im Frühjahr 1966 ein „miserables“ Abitur am KKG abgelegt. Anschließend studierte er Architektur in Aachen, Zürich und Stuttgart und führte aus familiären Gründen die väterliche Firma mit jetzt 50 Mitarbeitern weiter, so konnte er den Arbeitsplatz seines Bruders mit Handicap sichern. Unter anderem war er acht Jahre Vorsitzender der Lousberg-Gesellschaft, macht bei „Aachen sozial“ mit, engagiert sich für die bessere Behandlung von Flüchtlingen oder die Aufwertung des Ostviertels, finanzierte ein Jahr lang die vergessene Stelle eines Lehrers der Schule am Kennedypark. Lange hat er allerdings gezögert, die Bitte, seine Erlebnisse in der Schulzeit zu schildern, zu erfüllen, und begründet das mit „zwiespältigen Erinnerungen“ und der Qualität des damaligen Unterrichts. Der Geschichtsunterricht sei z.B. sehr defizitär gewesen,
„Heute
Der Unternehmer Axel Deubner erinnert sich an seine Schulzeit auf Mitschüler und Lehrer.
dabei sei das Traditionsgymnasium in der Innenstadt geradezu von Tuchfabriken umgeben gewesen. Deren Textilarbeiter waren gebildet und organisierten etwa im Dritten Reich den Widerstand gegen die Nazis. Davon aber sei im KKG der 1950er und 1960er Jahre kaum die Rede gewesen - Ausnahmen wie das Büchlein „Der stumme Protest“ des legendären Deutschlehrers Paul Emunds bestätigten die Regel. Dennoch hat sich Axel Deubner durchgerungen, an den PC gesetzt und seitenlang die Schuljahre an seiner nur mäßig geliebten Penne zu Papier gebracht, erstaunlich detailliert. Einige Auszüge:
„Wenn man sich nach fast 50 Jahren an seine Zeit als Gymnasiast erinnert, so betreffen diese Erinnerungen vorwiegend die Lehrer, dann mit einigen Abstand die Mitschüler und dann natürlich das Gebäude. Wie hat das Gebäude auf mich als Kind gewirkt? Es war groß und mächtig, die Flure waren meist dunkel und außer einem Kachelmuster, das auch sehr nach Anstalt roch, war es völlig schmucklos, nirgendwo eine Kinderzeichnung, überhaupt kein Zeichen, dass hier Kinder zuhause sind. War es Tucholsky, der sagte: „Die Preußen können bauen, was sie wollen, es werden immer nur Kasernen“? Das trifft in gewisser Weise auch auf das KKG zu.
Gegenüber einer modernen Schule hatte sie durchaus auch Vorteile, die Räume waren hoch, die Mauern waren dick und, wenn man nicht grade im Obergeschoß auf der Südseite war, so waren sie auch angenehm kühl. Aber geradezu entsetzlich karg. Offene Kappendecken mit einem Hauptträger, einem Holzdielenboden, alte Bänke, auf denen sich Generation von Schülern verewigt hatten, vermutlich beim Nachsitzen, wenn sie ungestört mit ihren Schnitzmessern ihre Bänke bearbeiten konnten. Viele Bänke hatten auch Tintenfässer. Davor ein zweistufiges Podium, auf dem ein Tisch oder ein Katheder thronte, einegrün/schwarzeWandtafel,Schwamm, Kreide, ein Kartenständer, ein einfacher
Holzspind für ein paar Lehrmittel. Hohe Fensterbrüstungen, aus denen man nicht direkt auf den Schulhof blicken konnte. Ein mächtiges Portal als Eingang. Davor ein kleiner Vorplatz, auf dem die Lehrer parkten mit ihren damals schon vorhandenen Autos. Eine steile Treppe führte auf die Eingangstür, die Punkt acht Uhr verschlossen wurde, damit man die Zuspätkommer dingfest machen konnte.
Zwei kleinere Schulhöfe, der eine mit dem ironischen Namen Wäldchen, weil tatsächlich eine einzige Kastanie dort stand, der der Mittel- und Oberstufe vorbehalten war. Der andere Schulhof hatte auch einen Namen, der ist mir entfallen, aber er hatte etwas ganz Besonderes. Einen Bretterzaun, mit dem die Baustelle der späteren Aula Carolina vom Schulgelände abgetrennt wurde. Durch ein paar lose Bretter gelangten wir ins Freie auf die Pontstraße. Diese streng verbotene Flucht war natürlich ein prickelndes Abenteuer.
Im Laufe der Jahre wurde die Schule immer vertrauter. Man wuchs auch körperlich, der Maßstab war nicht mehr ganz so gewaltig. Und als ich sie verließ, war sie einfach eine handliche, nicht übermäßig große Schule, Wenn ich heute an der Schule vorbeigehe, überkommt mich eigentlich nur ein Nostalgiegefühl, und das Gruseln hat aufgehört.
Die Mitschüler
Die Beziehung zu meinen Mitschülern blieben fast alle, bis auf eine einzige Ausnahme, oberflächlich. In der Unterstufe wurde damals in den ersten zwei bis drei Jahren unglaublich gesiebt und dies nicht nur nach Leistung, sondern auch nach sozialen Kriterien, Kinder aus Arbeiterfamilien hatten nur eine Chance, wenn sie durch intensive Unterstützung zum Beispiel des Gemeindepfarrers die Schulanforderungen erfüllen konnten. So war die Klasse nach drei Jahren ca. um ein Drittel kleiner.
Dass sich in einer solchen Struktur nur sehr schwer eine Klassengemeinschaft bilden kann und auch beginnende Freundschaften immer wieder zerrissen werden, ist selbstverständlich. Darum habe ich auch nur eine einzige Freundschaft aus dieser Zeit.

Schulzeit vor 50 Jahren am Kaiser-Karls-Gymnasium. Ein kritischer Blick auf das Schulgebäude,
Die Lehrer
Die Qualität des Lehrpersonals war weniger als durchschnittlich. Natürlich gab es wunderbare Ausnahmen nach oben, aber auch fürchterliche nach ganz unten. Aus der Generation, die uns hätten unterrichten können, waren sehr viele im Krieg geblieben. Manche kamen schwer verletzt zurück und hatten offenbar nur eine kurze schnelle Ausbildung erhalten, ähnlich wie viele Hausfrauen in den Grundschulen. Ganz besonders rar waren natürlich Lehrer mit entschiedener Anti-Nazihaltung. Bei vielen spürte man ein Mitläufertum oder bei manchen noch Schlimmeres.
Ein besonderer Fall in diesem Zusammenhang war ein Latein- und Griechischlehrer, der schon als junger Lehrer am KaiserKarls-Gymnasium gewesen war. Im Krieg leitete er eine Boxarbeitsgemeinschaft und es wurde berichtet, das er seine Boxschüler mit den furchtbaren Worten: „Blut muss fließen, Blut muss fließen“ anfeuerte. Viele Klassen hatten unter ihm zu leiden, unsere ganz besonders. Er war ein beschränkter Mensch und behauptete ständig, dass sein Zwergpudel Nina viel klüger sei als all seine Schüler und zitierte immer wieder aus Oswald Spenglers Buch „Der Untergang des Abendlandes“.
Ein ganz anderes Format hatte Kunstlehrer Hubert Werden, ein hochtalentierter und etwas eigenbrötlerischer Künstler, der einen unheimlich bereichern konnte, wenn man sich auf ihn einließ. Er war ein Mitglied der Avantgarde-Kunstszene in Aachen nach dem Krieg. Bei ihm konnte man auch die achte Stunde noch wunderbar aushalten, und er hat mich für meinen späteren Lebensweg, mich der Architektur zuzuwenden, sehr bestärkt Es war ein Glück, ihn zu treffen.
Nachdem Direktor Fries als Nachfolger des „roten Schmitz“ relativ schnell Beigeordneter für Kultur geworden war, kam als nächster vom Drei-Königs-Gymnasium in Köln Johannes Helmrath zu uns. Und der war wieder ein richtiger Zeus. Eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit mit großer Leidenschaft für die Schule. Er versuchte uns mit großem Enthusiasmus für die griechische Philosophie zu begeistern. Er war hilfsbereit, hatte natürliche Autorität, man hört ihm gerne zu.

Er war eine Zeitlang unser Klassenlehrer, und eines Tages wurden Sammelbüchsen für die Kriegsgräberfürsorge ausgegeben. Auch ich erhielt so eine Büchse, weigerte mich jedoch, an der Sammlung teilzunehmen, lehnte es mit der Begründung ab, dass die Pflege der Gräber ohne genaue Erklärung, warum es zu diesem furchtbaren Krieg kam und wer ihn verursacht hatte, die Gefahr in sich barg, vielleicht leichtfertig neue Kriege anzuzetteln. Diese Diskussion ging spannungsgeladen durch die ganze Klasse, aber sehr bald beendete er die Diskussion. Auch er hatte wohl tief im Krieg gesteckt, nahm die Büchse wieder an sich, und ich habe das Ganze wie eine halbe Zustimmung zu meiner Haltung empfunden. Es wurde nie wieder ein Wort darüber verloren.
Eine besondere Figur unter den Lehrern war Paul Emunds, Geschichts- und Deutschlehrer. Er war noch relativ jung, ein linker Katholik. Er versuchte uns historisches Bewusstsein zu vermitteln, dabei war er Rheinländer durch und durch. Er war Antipreuße, sah eine Linie von Bismarck über Wilhelm II. zu Adolf Hitler. Was in dieser Zuspitzung sicherlich nicht angemessen war, aber eine sehr lebendige Diskussionen herausgefordert hat. Ein sehr lebendiger Unterricht, der ein tiefes Verständnis für die Geschichte erzeugt hat. Er war ein Pionier des Projektunterrichtes. Mit einer Gruppe von Oberstufenschülern untersuchte er die Umstände der Heiligtumsfahrt von 1937. Monatelang durchforsteten sie alle deutschsprachigen Zeitungen, besonders jene, die noch nicht von den Nazis kontrolliert wurden, wie die Zeitungen im belgischen Grenzgebiet und im Selfkant. Er war ein Lehrer von großer Leidenschaft. Leider gab es nur wenige seines Formats.
Herr Schauerte, Kunst und Biologie, war ein etwas wirrer Mensch, den das Dritte Reich wohl auch irgendwie durch die Mangel gedreht hatte. Vererbungs- und Entwicklungstheorien spukten ständig in seinem Kopf. Er entwickelte diese aus sehr engagiert vorbereiteten Experimenten und mikroskopischen Untersuchungen.
Irgendwann fiel dann der unglaubliche Satz als Konsequenz aus all seinen Untersuchungen: „Kinder, ich sag euch was, auf der Vielzelligkeit steht der Tod“. Und das im besten Aachener Tonfall.
Herr Albert, kriegsbeschädigt, Geschichtsunterricht in der Oberstufe. Wir studierten ausführlich ein kleines dünnes Heftchen, das uns vor der Gefahr des Marxismus wappnen sollte. 68 war wirklich an unserer Schule 1966 noch überhaupt nicht zu spüren.
Veronika Poestges, evangelische Religion. Als ganz kleine Gruppe von Evangelischen hatten wir in der Oberstufe nach der regulären Schulzeit Religionsunterricht in einer Rumpelkammer, die sich Schippersche Bibliothek nannte und in der es fatal nach vermoderten Akten roch. Wir saßen um einen Tisch herum und hatten wunderbare Stunden. Wir lernten die Bibel auch textkritisch zu betrachten, weil die Überlieferung aus verschiedenen Epochen stammt.
Das Verhältnis zwischen den Konfessionen war sehr schwierig in dieser Zeit, vor allem in den 50iger Jahren. Wir wenigen Evangelischen wurden ziemlich bestaunt, wie es denn sein könne, dass man nicht katholisch ist. Am Anfang mussten wir raus aus dem katholischen Religionsunterricht. Schließlich gestattete man mir, in der Klasse sitzen zu bleiben. Ich fand es hochinteressant, was Herr Klinkhammer vortrug, und vor allem machte er unglaublich schöne Zeichnungen. Irgendwann fühlte ich mich dabei so wohl, dass ich versuchte, mich am Unterricht zu beteiligen. Dieses gefiel Herr Klinkhammer aber überhaupt nicht und er verbot mir ziemlich schroff, mich zu melden. Was für eine Absurdität, wenn man heute im Abstand von 60 Jahren auf den Zustand der Kirchen blickt.“ Axel Deubner
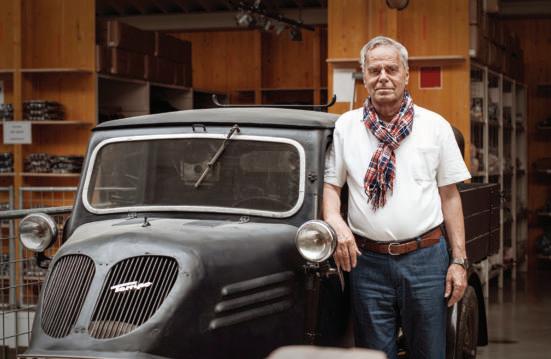
Im Jahr 2023 fand zum 30. Mal der Aachen-Arlington-Schüleraustauschder Q1 statt. Die beiden Städte pflegen seit über fünfzig Jahren eine Städtepartnerschaft und ermöglichen Schülern von Aachener Gymnasien und Gesamtschulen an einem Austausch mit Schülern von Highschools in Arlington teilzunehmen. In Aachen fanden tägliche Ausflüge statt, die die „Arlingtonians“ zum Dreiländereck, nach Maastricht, Köln und Bonn führten. Beim Gegenbesuch konnten die KKG-Schülerinnen und -Schüler einen authentischen Eindruck vom Alltag in einer amerikanischen Familie gewinnen. Während des zweiwöchigen Aufenthalts durften sie ihre amerikanischen Freunde zur Highschool, zu Hobbies, Football-Spielen, Unternehmungen mit Freunden etc. begleiten. Zudem gab es ein sehr vielfältiges und intensives Ausflugs- und Besichtigungsprogramm, u.a. zum Arlington Cemetery, zur National Mall in Washington DC, zum Washington Monument und zur Library of Congress.
Das Finale des Landesschülerwettbewerbs Alte Sprachen NRW, „Certamen Carolinum“, im November 2023 stand thematisch ganz im Zeichen aktueller politischer und ökologischer Themen. Als Siegerinnen im neuen Wettbewerbszweig „Antike trifft Kunst“ zeichnete Staatssekretär Dr. Mauer Shalini Angel Gnanaseelan und Fernanda Egger, beide vom Erzbischöflichen ClaraFey-Gymnasium Bonn, sowie Emily Gruber von der Friedrich-Albert-Lange Schule Solingen aus. Shalini Angel Gnanaseelan begeisterte das Publikum nicht nur als Siegerin dieses Wettbewerbszweiges mit ihrer künstlerischen Interpretation von Daedalus und Ikarus, sondern sorgte auch zum Abschluss der Veranstaltung mit ihrer gesanglichen Darbietung von Adeles „Skyfall“ für langandauernden Beifall.
Donald Kobbelt aus der 8c gewann 2023 zum vierten Mal den ersten Platz beim Regionalwettbewerb Jugend forscht. In diesem Jahr analysierte Donald optimale Netzwerke und untersuchte Python-Programm Transportnetzwerke, um minimale Kosten und maximale Effizienz zu erreichen.
Nachruf auf Heinz Grahn, der im März 2018 verstarb. Gleichermaßen geschätzt von Lehrenden und Schülern.
Oft sind es gerade Alltagszenen, die Erinnerungen ausmachen: Im Klassenraum lautes Stimmengewirr, immer die gleichen wenigen Verdächtigen warten auf dem Flur gespannt auf den Lehrer. Diesmal ist es schon zehn nach acht. Erste Stunde Englisch. Und dann kommt er. Langsam und würdevoll, das stets verschmitzte Lächeln schon auf den Lippen, durch das sich jeder immer persönlich angesprochen fühlte. Immer ein bisschen, als wäre man alleine mit ihm im Raum. Dieses Jahr Deutsch oder Englisch mit Herrn Grahn? Da gab es nicht das obligatorischen Murren, das fast jeder Lehrer von irgendeiner Seite auf sich zog. Heinz Grahn, der scheinbar stets Tiefenentspannte, war über drei Jahrzehnte am KKG eine Institution. Unter Direktor „Zeus“ Johannes Helmrath trat er 1967 trat ins Kollegium ein, für das er sich im Lehrerrat viele Jahre besonders engagierte und auch höchste Anerkennung im Kollegenkreis verdiente. Gleichermaßen schätzten ihn die Schüler. Seine sanfte Ausstrahlung verband er mit der nötigen Konsequenz, mit der Autorität des „alten Hasen“. Störungen im Unterricht folgte schlicht ein lautes Schweigen bei strengem Blick, bis man sich angesprochen fühlte und verstummte. Pulver verschießen durch Anheben der Stimme schien bei Herrn Grahn gänzlich unnötig. Einige Ex-Schüler haben später als Lehrer mit wechselndem Erfolg versucht, eine ähnliche natürliche Autorität zu entwickeln. Im Griff hatte er die Klassen immer. Später merkten viele auch, dass Heinz Grahn uns erfolgreich konditionierte – mit
Gummibärchen, die er öfter als Belohnung aus der Innentasche seines Jacketts zog. Dem ging meist ein bestätigendes, langgezogenes „Hmmmm“ voraus. Am wichtigsten war Heinz Grahn jedoch, dass die Schüler ihre Muttersprache und – bis 1990 natürlich nur als zweite Fremdsprache – auch Englisch vernünftig und effizient lernten. Dabei legte er auch Wert auf eine gepflegte Aussprache. Schüler, die zwischendurch Zeit in England verbracht hatten, empfanden seinen Akzent besonders authentisch. Kein Wunder, denn prägende Jahre hatte er als Assistant Master in London verbracht.
Vielleicht trug auch das dazu bei, dass man glaubte, auch Züge eines britischen Gentleman in ihm zu erkennen – der Habitus hätte zu seiner ruhigen Art gepasst. 1997 wurde er pensioniert und erfreute seine Kollegen, indem er der Schule aktiv verbunden blieb. Im März verstarb der jungen Menschen und Kollegen gleichsam zugewandte Heinz Grahn im Alter von 83 Jahren. Im Gedächtnis bleibt er allen, die er bereicherte. Thorsten Tränkner
Er hatte oft ein verschmitztes Lächeln, durch das sich jeder angesprochen fühlte: Heinz Grahn.
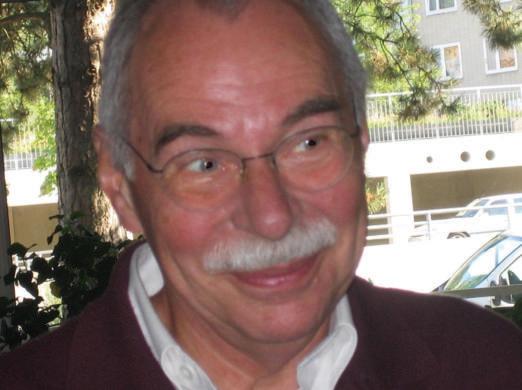

Der Aachener August Hütten ist Soldat im Ersten Weltkrieg. Am 18. März 1918 wird er mit Kameraden im Kilianstollen im Elsass verschüttet. Seine Großnichte Hannelore Börger, ehemalige Lehrerin am KKG, rekonstruiert sein Leben.
Bei Bauarbeiten für eine Umgehungsstraße wird im Oktober 2010 im Elsass eine Tunnelanlage aus dem Ersten Weltkrieg freigelegt. Aus den Trümmern des Kilianstollens bergen Archäologen ein Jahr später die sterblichen Überreste von 21 deutschen Soldaten, die dort am 18. März 1918 bei einem französischen Angriff verschüttet worden waren. Am 18. März 2018, auf den Tag genau 100 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Männer, wird an dem Stollen im Elsass ein Denkmal für die Toten enthüllt. Zu den Feierlichkeiten reisen auch zwei Aachener, Hannelore und KlausReiner Börger, an. Denn der Anführer der toten Soldaten, Feldwebelleutnant August Hütten, war ein Aachener – und Hannelore Börgers Großonkel. Er wurde nur 38 Jahre alt.
Plötzlich ein Brief Hannelore Börger, geborene Hütten, kannte den Großonkel, der im Krieg gestorben war, nur aus Erzählungen der Verwandten. Ein Brief brachte ihr sein Schicksal vor viereinhalb Jahren plötzlich ganz nah. Im Juni 2013 bekam ihre Mutter Post vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. In Frankreich habe man August Hütten, den Onkel ihres Ehemanns, als einen der 1918 verschütteten Soldaten identifizieren können.
„Meine Mutter war damals schon 88, deshalb habe ich mich um die Sache gekümmert“, erzählt Hannelore Börger. Die heute 65-Jährige hat sich seitdem intensiv mit den Kriegsgeschehnissen im Elsass und dem Schicksal ihres Großonkels befasst. Hannelore Börger ist – mittlerweile pensionierte – Lehrerin für Deutsch, Französisch und Geschichte. Das Schicksal ihres Verwandten interessierte sie nicht nur persönlich, sondern auch beruflich. Für die Familie hat sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem ehemaligen Leiter der Hauptschule Eilendorf, eine kleine Chronik über das Leben ihres Großonkels verfasst.
August Hütten, 1880 als zweiter von fünf Brüdern geboren, stammte aus einer alten Aachener Familie. Er besuchte das Kaiser-Karls-Gymnasium – die Schule, an der Hannelore Börger viele Jahr-

zehnte später als Lehrerin unterrichtete. 1898 machte August Hütten sein Abitur, er studierte Jura und wurde Amtsanwalt. Wie seine fünf Brüder musste August Hütten als Soldat in den Krieg ziehen. Ab Dezember 1917 befand er sich, mit Unterbrechungen, mit seiner Kompanie in der Nähe von Altkirch im Elsass, im Kilianstollen von Carspach an der sogenannten Sundgau-Front. Am 7. März 1918 beging er dort seinen letzten Geburtstag. Am 18. März 1918 starb August Hütten. Insgesamt kamen an dem Tag im Kilianstollen 34 deutsche Soldaten ums Leben. Sie alle gehörten zur 6. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiments 94. 13 der Ver-schütteten wurden gleich nach dem Ein-sturz des Stollens tot von ihren Kameraden aus den Trümmern gebor-gen. Die anderen 21 blieben mehr als 90 Jahre lang verschüttet. Ihre Namen allerdings waren all die Zeit bekannt.
2011 wurden 18 von ihnenoffiziell identifiziert anhand von Ausrüstungsgegenständen im Stollen, die den sterblichen Überresten zugeordnet werden konnten. Aber lediglich von drei der

verschütteten Soldaten ließen sich noch Angehörige ermitteln. Und nur Hannelore Börger reagierte auf das offizielle Schreiben.
Im Juni 2013, als der Brief des Volksbunds eintraf, mussten die Angehörigen in Aachen schnell Entscheidungen treffen. Sollten die sterblichen Überreste des Toten nach Aachen überführt werden?, wollte die Kriegsgräberfürsorge wissen. „Wir haben uns dagegen entschieden“, erzählt Hannelore Börger. „Mein Großonkel sollte gemeinsam mit seinen Kameraden beerdigt werden.“
Am 19. Juli 2013 fanden die verschütteten Soldaten des Kilianstollens ihre letzte Ruhestätte, auf dem Soldatenfriedhof von Illfurth im Elsass. Gerne wären die Börgers zu der festlichen Beisetzung nach Frankreich gereist. Aber aus dienstlichen Gründen konnte das Lehrerehepaar ausgerechnet da nicht aus Aachen weg – es war der letzte Tag vor den Ferien.
Die Archäologen haben bei Carspach ein Stück Geschichte ausgegraben. Anhand der Funde im Kilianstollen hatten sie die Gelegenheit, den Alltag der einfachen Soldaten in einem großen Kriegsunterstand zu rekonstruieren. Das findet Hannelore Börger sehr spannend. Als Geschichtslehrerin, sagt sie, habe sie stets versucht, den historischen Stoff von der menschlichen Seite her zu beleuchten.
Abiturarbeit im Keller entdeckt Fast tut es ihr deshalb leid, dass sie nicht mehr im Schuldienst steht. Die Geschichte des Ersten Weltkriegs hätte sie gerne auch einmal am Schicksal ihres Großonkels und seiner Kameraden verdeutlicht. Unten im Keller des Kaiser-Karls-Gymnasiums hat sie bei ihren Recherchen sogar noch die Abiturarbeit ihres Großonkels entdeckt.
Vor allem aber möchte Hannelore Börger das Andenken an ihren Großonkel August Hütten und an alle anderen toten Soldaten als Mahnung verstanden wissen: „Den Frieden, in dem wir leben, nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern ihn als ein kostbares Gut zu schützen und uns immer für ihn einzusetzen.“
Margot Gasper
Bernd Schwemmer, Meister der Bonmots, verabschiedet sich in den Ruhestand.
Sein Abschied vom KKG wäre eigentlich ein Sonderheft wert: ein „Best-of“ seiner legendären Zitate im Unterricht. Bernd Schwemmer wird Generationen von Schülern jenseits der Pädagogik insbesondere als Meister der geistreich-witzigen Kommentare in Erinnerung bleiben, mit denen er selbst den grauesten Schüleralltag auflockern konnte. Dieses Talent ist dem waschechten Kölner, der Geburt, Kindheit und die Schul- und Universitätszeit komplett in Hörweite des „Dicken Pitter“ verbrachte, vermutlich in die rheinische Wiege gelegt worden. Neben Biologie und Geographie studierte er ergänzend noch Geologie und damals obligatorisch Pädagogik und Philosophie. Lange noch pendelte er täglich aus der Heimat nach Aachen, was Schüler immer an der aktuellen Ausgabe des „Kölner Stadtanzeiger“ auf dem Pult erkannten. Dann folgte stets eine Kombination aus effizientem Unterricht und Bonmots. Daher wartete man sehnlichst auf das Erscheinen des „Karlsschülers“ und blätterte direkt zu den „Schwemmer-Zitaten“, die zu Spitzenzeiten eine komplette Seite ausfüllten. Doch strahlte Bernd Schwemmer, der für die Schüler wie kein anderer Lehrer den mittlerweile entschwundenen Modebegriff „cool“ personifizierte, durch seine locker-rheinische Art weniger Autorität aus? Keineswegs. Ohne dass er es nötig gehabt hätte, seinen natürlichen Stil zu ändern, gab es in seinen Bio- und ErdkundeStunden keinerlei Disziplinlosigkeit. Ebensowenig führte ein auflockernder Spaß dazu, dass ein Parallelkurs im Stoff weiter gewesen wäre. Besser verstanden hatten selbst naturwissenschaftliche Problemfälle die Biochemie bei Schwemmer meist auch noch.

Setzte sich auch für die Belange der Schülerinnen und Schüler ein: Bernd Schwemmer, der in den Ruhestand gegangen ist.
ihn sogar nach Düsseldorf. Schlimmer wäre wohl nur, Zeus in den Hades zu schicken. „Gott sei Dank war es näher an Köln gelegen“, betont Bernd Schwemmer heute. Seinen „Einberufungsbescheid“ für das KKG erhielt er im November 1982. Nach zwei Jahren zwischen den Welten zog er dann in die andere Domstadt.
Bernd Schwemmer hat sich ohne viel Aufhebens auch effektiv für die Belange der Schüler eingesetzt.
organisieren, skeptische Direktoren besänftigen, Leistungskurse organisieren, die Schulleitungen eigentlich für nicht realisierbar gehalten hatten. Eine zeitaufwendige Aufgabe, die man gerne nicht allzu lange übernimmt. Bernd Schwemmer hat aber noch Schülern die letzten drei Jahre zum Abitur erleichtert, deren Väter auch schon bei ihm Rat und Ermutigung gesucht hatten.
Dazu übernahm er ab 2010 noch die Aufgabe des ADV-Moderators der Bezirksregierung für Datenverarbeitung und organisierte Veranstaltungen und Fortbildungen im ganzen Aachener Raum.
Das kam nicht von ungefähr: Schon früh interessierte er sich für Computer und erstand für satte zwei Monatsgehälter Mitte der 80er einen „IBM-PC-Klon“ mit 8086-Prozessor – er beherrschte wie bald auch viele Schüler das Programmieren mit Pascal – und kaufte noch einen Nadeldrucker.
Damit konnte er seine legendären Arbeitsblätter, für die er einmal von Abiturienten mit dem „Goldenen Arbeitsblatt“ geadelt wurde, fast wie heute anfertigen – nur Bildchen ließen sich noch nicht einfügen. Kollateralschaden: Bernd Schwemmer fürchtet bis heute, dadurch die Schließung des Kopierladens nebenan verschuldet zu haben.
Zum Beginn der Laufbahn wies die Kölner Biographie jedoch radikale Brüche auf: Erste Praxis im Studium sammelte er als gutbezahlter Aushilfslehrer (16 DM pro Stunde) ausgerechnet jenseits der Zivilisationsgrenze im ostrheinischen Stadtteil Deutz, zum Referendariat verbannte man
Erst war er Schülerlotsenkoordinator, denn von Verkehrsberuhigung konnte damals in der City noch keine Rede sein. Dann half er ab 1993 als Oberstufenkoordinator Generationen von Schülern, viele Klippen zu umschiffen und sich im Dickicht der Kriterien und Vorgaben der reformierten Oberstufe zurechtzufinden. Doch nicht nur das: Die Kooperation mit St. Leonhard und dem Couven-Gymnasium hatte sich damals noch nicht eingespielt. Es galt, an allen Fronten zu arbeiten: Bustransfers
Für die Schüler im Mittelpunkt stand die zugleich effiziente und „rheinisch-humorvolle“ Unterrichtsgestaltung. Kann man Junglehrern empfehlen, den Unterricht pädagogisch so zu gestalten wie Bernd Schwemmer, ihn gar nachzuahmen? Vermutlich nicht, denn die Methode Schwemmer war wohl eine Verbindung aus fachlicher Kompetenz und einer natürlichen Pädagogik, die wohl schlicht mit seiner ganz persönlichen Mentalität verbunden war und ist.
Jetzt nach Ablauf der beruflichen Tätigkeit haben seine Familie und seine Freunde glücklicherweise noch etwas öfter die Gelegenheit, diese ausgiebig zu genießen. Thorsten Tränkner

Der langjährige Aachener Oberbürgermeister Kurt Malangré ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das Bild der Stadt hat er maßgeblich mitgeprägt. 1955 hatte er am KKG die Reifeprüfung abgelegt.
Am Ende war sein Schulweg kurz. Oft ging unserer auf Stadtebene höchstrangige Ehemalige in den letzten Jahren die wenigen Meter zum KKG herüber.
Mal ging es dann weiter mit Einkaufsliste auf den Markt, mal zum geliebten Dom, den der tiefgläubige Katholik täglich besuchte – wenn er nicht in St. Foillan war.
Oft endeten die Spaziergänge an einem Ort, vor dem der CDU-Ehrenvorsitzende, der von 1973 bis 1989 als einer von bislang nur fünf Nachkriegs-OBs an der Spitze der Kaiserstadt stand, seine Kinder noch eindringlich gewarnt hatte: Im alternativ angehauchten Café Kittel. Längst waren die alten politischen Schlachten geschlagen. Der KKG-Abiturient des Jahres 1955 verstand sich gut mit den „Linken“, nachdem ihn 1989 die rot-grüne Mehrheit im Rathaus abgelöst hatte. Zu Nachfolger Jürgen Linden soll er ein herzliches Verhältnis gehabt haben.
Selbst mit Klaus Paiers illegalem Skandalgemälde unweit des KKG - es zeigt ein schwules Liebespaar – hat er später Frieden geschlossen. Auch auf seine ganz persönliche Initiative hin wurde es unter Denkmalschutz gestellt.
Wer Kurt Malangré in seinen letzten Jahren traf, begegnete einen feinen Herrn der alten Schule. Sanftmütig und höflich begegnete er jedem Gesprächspartner mit der gleichen Aufmerksamkeit, die er früher der Spitze der internationalen Politprominenz beim Karlspreis entgegenbracht hatte.
Dabei hat er immer ein besonderes Herz für seine Schule gehabt, der der gebürtige Frankenberger aus konservativ-katholischem, aber auch durchweg Öcher Elternhaus – Weihnachten kam auch das Schängchen – sich stets verbunden fühlte. Die Türe zum OB-Büro stand für „Zeus“ Johannes Helmrath und andere Vertreter „seiner“ Schule immer offen.
Nach dem Abitur 1955 studierte er Jura und Staatswissenschaften in Bonn und Köln – bewusst um Anwalt zu werden, denn für einen Richter hielt er sich für „zu parteiisch“, wie er vor einigen Jahren verschmitzt in einem AN-Interview

erwähnte. Parteiisch sein hieß bald auch politisch werden. Vor 50 Jahren wurde er Ratsherr für die CDU, schon nach nur zehn Monaten als Neuling prompt Fraktionschef und zwei Jahre später ehrenamtlicher Bürgermeister. Ein Jahr als Stellvertretung reichte dann, um 1973 als Nachfolger von Hermann Heusch an die Stadtspitze zu rücken, wo er dann 16 Jahre verblieb. Sogar vier Jahre länger war der glühende Europäer, der als OB 1973-99 dem Karlspreisdirektorium angehörte, ab 1979 erster Aachener Europaabgeordneter – allerdings zunächst widerwillig. Die graue Eminenz seiner Partei, Jost Pfeiffer, hatte ihn auf seinem berüchtigten Sofa zuhause in der Lousbergstraße ins Gebet nehmen müssen, dem Möbel, auf dem dem Mythos nach damals alle politischen Karrieren der Aachener Union begannen oder endeten. Als Stadtoberhaupt bleibt Kurt Malangré besonders in Erinnerung durch die Gründung der Euregio Maas-Rhein, deren Ratsvorsitzender er lange war, sowie den Bau von Eurogress, Uniklinik und Bushof. Im von ihn initiierten Spielcasino im neuen Kurhaus tummelte sich der bundesdeutsche Jetset, inklusive Gunter Sachs. Auch das Rathaus wurde in seiner Zeit restauriert.
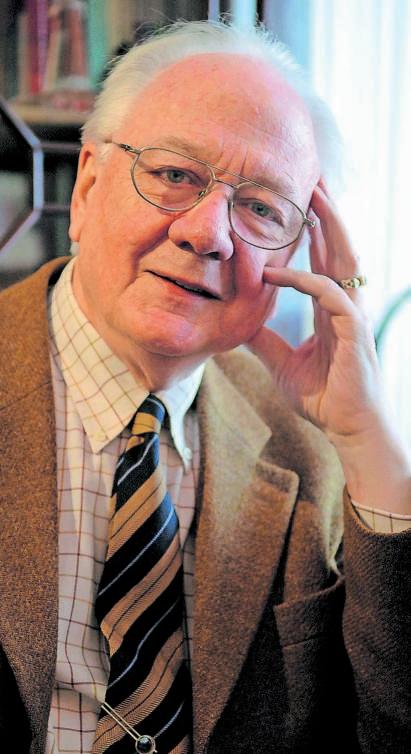
Sein großes Engagement wurde gewürdigt durch das Bundesverdienstkreuz am Bande und den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Ehrenbürger der Stadt Aachen wurde er 2004 und freute sich aber fast genauso über den Rollmopsorden der IG Pontviertel.
Das geliebte Fitnesstudio hatte in den letzten Jahren einen Aktiven weniger, der Hometrainer verwaiste, die Wege durch die Stadt wurden zuletzt beschwerlicher und seltener. Zunehmend widmete Kurt Malangré sich der Lektüre seiner zahllosen Bücher, die die Wände seiner Wohnung bis zur Decke ausfüllten.
Am Ende überraschte er nochmal bei seiner Trauerfeier im vollbesetzten Dom: Waren da versehentlich Biker in Kutten in die Trauergemeinde geraten? Mitnichten: Der Alt-OB war der Bikerszene schon Jahre freundschaftlich und aktiv verbunden. Was ihn am meisten prägte, war der christliche Glaube als Basis seines Handelns. Dass er bundesweit das erste Mitglied des Opus Dei war, ließ ihn zwischenzeitlich öffentlich stark unter Druck geraten. Jetzt wünscht man dem „Ersten Ehemaligen“ des KKG, dass er an das Ziel seiner religiösen Gewissheit gelangen möge.
Am 4. Oktober 2018 ist Kurt Malangré im Alter von 84 Jahren verstorben. Thorsten Tränkner
Im April 2021 verstarb der langjährige Schulleiter des Kaiser-Karls-Gymnasiums Dr. Paul-Wolfgang Jahren. Die Schule prägte Jaegers nachhaltig, indem er zusätzlich zur sprachlichen Akzentuierung „Naturwissenschaften“ etablierte.
Wenn sich Weggefährten an Paul-Wolfgang Jaegers erinnern, denken viele an einen Menschen, der „Fünfe auch einmal gerade sein lassen“ konnte. Die Atmosphäre am KKG in den mehr als 20 Jahren unter Jaegers bezeichnen sie als gelassen und kollegial. Charakteristisch für ihn sei seine humorvolle und diplomatische Art bei klarer eigener Perspektive gewesen, beschreibt ihn einer, der viele Jahr lang mit Jaegers befreundet war.
Paul-Wolfgang Jaegers, Jahrgang 1949, stammte aus einer Lehrerfamilie, sein Vater war Schulleiter einer Volksschule. Seine anfängliche Überlegung, Medizin zu studieren, verwarf er und entschied sich stattdessen ebenfalls für eine Laufbahn als Lehrer. Paul-Wolfgang Jaegers studierte deutsche, englische und niederländische Philologie, vergleichende Literaturwissenschaft, Philosophie und Pädagogik. In Germanistik promovierte er über das Nachkriegshörspiel.
Seine berufliche Laufbahn begann Jaegers am Gymnasium in Monschau, danach unterrichtete er am Rhein-MaasGymnasium Englisch und Niederländisch. Als Fachleiter für Niederländisch war er am Studienseminar in Aachen darüber hinaus in der Referendarausbildung tätig. 1993 kam Jaegers als Schulleiter ans KKG. Zuvor hatte er als Dezernent für Niederländisch in der Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf gearbeitet.
neben der sprachlich-literarischen Säule ein MINT-Profil brauchte.
Wichtig war Jaegers, dass es sich dabei nicht um eine Umorientierung, sondern um eine Erweiterung des Schulprofils handelte. „Wir wollen nicht zu einem mathe-

„Ich habe im Laufe meines Lebens und im Laufe meines Studiums festgestellt, wie wichtig es ist, dass man die Grundlagen kennt“, befand er. Er selbst beherrschte weit mehr als die Grundlagen, verfolgte als vielseitig gebildeter Mann gesellschaftliche Diskussionen, Diskurse und Entwicklungen mit großem Interesse. Nicht nur deshalb war Jaegers für viele ein geschätzter Gesprächspartner, der interessiert zuhörte und die eigene Auffassung deutlich vertrat. Er verstand es, als Direktor im Team zu arbeiten und Aufgaben zu delegieren. Dadurch öffnete er Kollegen Freiräume und die Möglichkeit, eigene Projekte zu verfolgen. Die Zusammenarbeit mit Jaegers war durch einen verbindlichen und gemeinsamen Ton geprägt. Auch dadurch verstand er es, der „Schule einen menschlichen Charakter zu verleihen und für eine konstruktive, wertschätzende und kollegiale Atmosphäre in der Schulgemeinschaft zu sorgen“, wie sich Jürgen Bertram, aktueller Schulleiter des KKG, erinnert.
Dr. Paul-Wolfgang Jaegers im Jahr 2007, als er noch Schulleiter am KKG war. Foto: Leah Hautermans
AlsOberstudiendirektorveränderteJaegers das KKG nachhaltig, indem er zusätzlich zu dem sprachlich-musischen Schwerpunkt Akzente in den Naturwissenschaften und der Informatik setzte. Er erkannte früh, dass das Gymnasium vor den Toren der RWTH
matisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium mutieren, wenngleich wir natürlich da einen Schwerpunkt gelegt haben. Aber die Sprachen gehören einfach zur Tradition des Gymnasiums“, sagte Jaegers wenige Jahre vor seinem Ausscheiden als Schulleiter. Von dem großen Mehrwert des sprachlichen Lernens war er überzeugt.
Die alljährlichen Karlsfeste der Schule bekamen unter Jaegers ein neues Format. Aus der „sehr akademischen Veranstaltung“ (Zitat Jaegers) mit schulpolitischen Grundsatzreden machte er ein buntes Schulfest, bei dem ein unterhaltsames Programm im Vordergrund steht. Den humorvollen und kabarettistischen Akzent setzte er dabei auch selbst, spielte vor über 1.000 Zuschauern im Audimax Theatersketche oder machte Musik in einer Band. Überhaupt gehörten das Theaterspielen und die Musik zu zwei von Jaegers‘ Vorlieben, der neben elektrischer Gitarre auch Kontrabass und Keyboard spielte.

olfgang Jaegers im Alter von 71
Akzentuierung einen Schwerpunkt
Für Glaubens- und Sinnfragen interessierte sich Jaegers als bekennender und kritischer Katholik sehr. Weggefährten kennzeichnen ihn als „rheinisch-katholisch“. Als rational denkender Mensch suchte er im Glauben Sinnperspektiven. Vor allem die Frage nach der mit dem Glauben verbundenen Hoffnung im alltäglichen Leben und über den Tod hinaus bewegte ihn. Die damalige wöchentliche Schulmesse des KKG am Mittwochmorgen besuchte der Schulleiter immer wieder. Ein zunächst angedachtes Theologiestudium in Münster nahm Jaegers nach seiner Zeit am KKG nicht mehr auf. Als pflichtbewusster Schulleiter ließ sich Jaegers auch von einem schweren Fahrradunfall im April 2005inFrankreichnichtausbremsen. Nachdem er einige Monate ausgefallen war, kehrte er mit vollem Einsatz an die Schule zurück.
Auf andere Gedanken brachte ihn in seiner Freizeit neben dem Fahrradfahren auch das Tennis- und Badmintonspielen.
Verabschiedet wurde Jaegers nach mehr als zwei Jahrzehnten als Schulleiter des KKG im Juli 2014. Die Schule verließ er mit der Überzeugung, dass seine Tätigkeit als Lehrer die richtige Lebensentscheidung gewesen war.
Tragisch früh und für viele überraschend verstarb Dr. Paul-Wolfgang Jaegers am 4. April 2021, Ostersonntag, nur wenige Tage vor seinem 72. Geburtstag.
Die Schulgemeinschaft des KaiserKarls-Gymnasiums bewahrt ihm ein ehrendes Andenken.
David Grzeschik

