


• Interview: Deutsche Energiewende nicht finanzierbar
• 300 Jahre Russische Akademie der Wissenschaften
• LaRouche: Kosten und Rentabilität von Infrastrukturprojekten




• Interview: Deutsche Energiewende nicht finanzierbar
• 300 Jahre Russische Akademie der Wissenschaften
• LaRouche: Kosten und Rentabilität von Infrastrukturprojekten

FUSION befasst sich mit den Pioniertechnologien unserer Tage: Fortgeschrittene Kerntechnik, Energie- und Teilchenstrahlung, Nichtmechanische Fertigungsverfahren, Raumfahrt, Supraleiter, Astronomie, Neue Werkstoffe, Medizin, Optische Biophysik.
Ein besonderer Schwerpunkt in FUSION ist Lyndon LaRouches Wissenschaftsmethode.
Seit 1979 herausgegeben vom Fusions-Energie-Forum e.V.
FUSION erscheint zweimal pro Jahr.
Nutzen Sie auch gerne unser Abo-Formular im Netz: www.eir.de/abo/fusionabo
c Innerhalb Deutschlands (4 Ausgaben für 28 €)
c Außerhalb Deutschlands (4 Ausgaben für 35 €)
c Ich möchte zusätzlich gratis einen Online-Zugang für fusionmagazin.de
Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
Datum, Unterschrift
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und an Dritte nicht weitergegeben.
*Mit Erhalt der vierten Ausgabe muss das FUSION-Abonnement gekündigt werden, sonst verlängert es sich automatisch.
c Studentenpreis (4 Ausgaben für 20 €)
Zahlungsweise
c Ich zahle auf Rechnung.
c Ich zahle per SEPA-Lastschrift:
Bitte senden an: E.I.R. GmbH, Bahnstr. 4, 65205 Wiesbaden
Fax: (0049) 61 19 74 09 35
Oder nutzen Sie unsere Abo-Funktion im Internet: https://www.eir.de/abo/fusionabo
ISSN 0173-9387
45. Jahrgang – Heft 1 2024
Herausgeber:
Fusions-Energie-Forum e.V.
81306 München
PF. 70 06 46
Tel. 089-501983
www.fef-ev.de
Bankverbindung: FEF e.V.
IBAN DE94 7007 0024 0509 0998 00
Deutsche Bank München
Chefredakteur:
Dr. Wolfgang Lillge
Verlag:
E.I.R. GmbH
Bahnstraße 4 65205 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 7365 0
Fax: 0611 / 974 0935 www.eir.de
FUSION im Internet: www.fusionmagazin.de
Email: redaktion@fusionmagazin.de
Satz u. Gestaltung: Ilja Bertold Karpowski
Druck: Kössinger AG www.koessinger.de
Einzelheft: 7,50 € Abonnement (deutsches Inland): 28,– € Abonnement (Ausland): 35,– €
2 Editorial 4 Kurznachrichten
7 In Afrika entsteht das nächste globale Wirtschaftswunder
Von Dean Andromidas
14 „Grand Inga“: Afrikas Sprungbrett in die Zukunft
Von Janet G. West
19 Die Wissenschaft der Bewässerung
– vom Industal bis zu den persischen Qanats
Von Karel Vereycken
24 Die richtige Schätzung von Kosten und Rentabilität großer Infrastrukturprojekte
Von Lyndon H. LaRouche jr.
40 300 Jahre Russische Akademie der Wissenschaften
Von Bill C. Jones
44 Energieexperte: „Deutsche Energiewende ist nicht finanzierbar“
48 W ie die FEF 1980 das Fusionsgesetz in den USA durchsetzte
Von Bill C. Jones
Zum Titelbild:
Ein wichtiges Element für die Entwicklung Afrikas ist Wasser. Oben eine animierte Darstellung der Wüstenbegrünung [Urheber: Jason Ross], unten links der Ausbauplan für den riesigen Staudamm Grand Inga in der Nähe der Mündung des Kongo-Flusses, unten rechts der Merowe-Staudamm im Sudan.
„Green
Es wird immer deutlicher, daß sich der Globale Süden nicht länger von den malthusianischen Konditionaliäten des Westens gängeln lassen will. Im Gegenteil, im Zuge der dramatischen Erweiterung des BRICS-Prozesses entsteht eine internationale Interessenkoalition, die sich auf die Entwicklung ihrer Länder konzentriert und dabei nach Wegen sucht, das dollardominierte Währungs- und Finanzsystem zu umgehen.
Nach dem Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe im August 2023 in Südafrika und der dort beschlossenen Erweiterung um weitere fünf Mitglieder scheint es nun aber mit diesem Green Deal vorbei zu sein, denn die BRICS und die zahlreichen weiteren Entwicklungsländer, die sich ihnen anschließen wollen, haben sich den technologischen Sprung zu einer industriellen Entwicklung auf Grundlage von Kernkraft und modernen Infrastruktur fest vorgenommen.
Die Gründung der BRICS-Gruppe in den Jahren 2009–10 war die Reaktion der führenden Entwicklungsländer auf den globalen Finanzkollaps von 2007–09. Das reale Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten und 1 Originaltitel: „The Economic Need for Increasing the Human Population“; in englischer Sprache zu finden auf www.larouchepub.com
In dieser Ausgabe von FUSION wollen wir unseren Lesern schwerpunktmäßig zeigen, wie zielbewußt diese Entwicklung in den BRICS+-Ländern und vor allem in Afrika voranschreitet. Afrika scheint auf dem besten Weg zu sein, das nächste Wirtschaftswunder der Welt zu werden. Der Schlüssel dafür ist Energie, Infrastruktur und die Nutzung und Verarbeitung der eigenen Ressourcen. In ihrer gesamten Geschichte seit den 1960er Jahren hat die politische Bewegung von Lyndon LaRouche darauf gedrängt, daß der enorme Energieund Strombedarf einer wachsenden Weltbevölkerung, insbesondere in den unterentwickelten Ländern, nur mit einer massiven Erhöhung des Energieverbrauchs gedeckt werden kann, und das zunächst mit fossilen Brennstoffen, dann aber zunehmend mit Kernkraftwerken und im nächsten Schritt so schnell wie möglich mit der Fusionsenergie. Wann immer die malthusianische Finanzoligarchie politisch durchsetzen wollte, die Produktion und Nutzung fossiler Brennstoffe zurückzufahren, um „den Planeten zu retten“ und das Bevölkerungswachstum zu stoppen, haben wir dies als menschenfeindlich und ökonomisch unsinnig angeprangert. Spätestens seit LaRouches Bericht an eine Konferenz in Rom 1981 mit dem Titel „Die wirtschaftliche Notwendigkeit der Bevölkerungszunahme“1 ist es für uns ein unumstößlicher Grundsatz, daß Entwicklung nur mit der höchsten verfügbaren Energieflußdichte möglich ist, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren und die Grundlage für den Sprung zu noch höherer Energiedichte zu schaffen, von fossilen Brennstoffen zur Kernenergie und dann zur Plasma- und Fusionstechnologie. LaRouches Bewegung kämpfte also schon gegen den „Grünen New Deal“, lange bevor der britische König Charles diesen Begriff vor 15 Jahren prägte. In letzter Zeit kommt dieses ökonomische Zerstörungsprogramm unter dem etwas harmloser klingenden Begriff „Energiewende“ daher.
Jg. 45, 2024, Nr. 1
Europa wurde in den Trümmern dieser Finanzkatastrophe und der darauf folgenden Gelddruckerei der Zentralbanken begraben. Stattdessen wurden China und Indien zu den Wachstumsmotoren der Welt. Die Erweiterung der BRICS-Gruppe war letztlich auch eine verspätete Reaktion auf das Pariser Klimaabkommen von 2015 und die darauf folgende Politik von Deindustrialisierung und Investitionsabbau, die darauf abzielte, die Produktion und Nutzung fossiler Brennstoffe zu stoppen. Die malthusianische Elite der Welt, die britische Oligarchie um König Charles und seine Milliardäre vom Weltwirtschaftsforum, beabsichtigte, eine riesige neue Spekulationsblase aus „modernen“ Mittelaltertechnologien – Wind- und Solarenergie – zu machen, die fossile Brennstoffe ersetzen und nur eine stark reduzierte menschliche Bevölkerung ernähren würde.
Mit der Erweiterung der BRICS zu „BRICS-11“ sind nun vier der fünf größten Exporteure fossiler Brennstoffe – Rußland, Saudi-Arabien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate – mit zwei der drei größten Gas- und Ölimporteure (China und Indien) vereinigt. Der gegenseitige Handel in diesem Bereich lädt geradezu dazu ein, Geschäfte in den nationalen Währungen der Importeure abzuwickeln. Und der Handel in „ÖlWährung“ fördert natürlicherweise auch den Handel mit nukleartechnischen und anderen modernen Investitionsgütern und den wissenschaftlichen Austausch zwischen den Menschen.
Zu den „BRICS-11“ gehören auch der Weltmarktführer im Export von Nukleartechnologie, Rußland, das inzwischen erfolgreichste Fusionsforschungsprogramm Chinas sowie vier bzw. bald fünf Raumfahrtnationen, die untereinander und mit der NASA Partnerschaften unterhalten. Brasilien ist der weltweit größte Exporteur von Mais und Sojabohnen, Rußland/Weißrußland der weltweit größte Exporteur von Weizen und Düngemitteln, Indien der weltweit größte Exporteur von Reis (40 Prozent des weltweiten Reishandels) und der weltweit größte Exporteur von Arzneimitteln. Die BRICS repräsentieren somit eine wachsende Gruppe politisch zwar sehr unterschiedlicher Länder, die aber das gemeinsame Merkmal haben, ihre nationalen Interessen, ihre Eigenständigkeit und ihre Souveränität zu verfolgen und sich der geopolitischen Beherrschung der Welt durch die „globale NATO“ zu widersetzen. Sie bilden eine lockere, aber erfolgreiche Wirtschaftspartnerschaft, die ein gemeinsames Interesse an einer raschen
wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung hat. Im Gegensatz dazu betreiben die schrumpfenden Volkswirtschaften Europas, vor allem Deutschland, mit voller Kraft ihre sogenannte „Energiewende“. Man freut sich sogar noch, wenn vor der eigenen Haustür die Nord Stream Pipeline für billigen Gasimport aus Rußland gesprengt wird, während gleichzeitig Hunderte von Milliarden Euro in Militärausgaben für den Krieg gegen Rußland gesteckt werden. Wir erlegen uns selbst Sanktionen auf und fahren die eigene Wirtschaft durch Armut und Energiemangel vor die Wand. Sollte es in Europa irgendwann ein Erwachen geben, wäre die einzige Möglichkeit, sich der expandierenden BRICS-Gruppe anzuschließen, um mitzuhelfen, daß die Entwicklungsländer zu Industrieländern werden.
Insbesondere sollten wir die rasche Expansion der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS unterstützen, die zur zentralen Institution für Entwicklungskredite des globalen Südens wird. Die NDB hat in diesem Jahr unter ihrer neuen Direktorin, der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff, ihre Aktivitäten massiv ausgeweitet, nachdem die Dollar-Kapitalmärkte und die Kreditvergabe aufgrund von Sanktionen der USA und der Europäischen Union fast zum Erliegen gekommen waren. Die NDB hatte in den vergangenen acht Jahren insgesamt nur 33 Milliarden Dollar verliehen, doch jetzt strebt sie eine Kreditvergabe in Höhe von 8 bis 10 Milliarden Dollar pro Jahr an, und das überwiegend in den Landeswährungen ihrer Mitglieder – mit der Aussicht auf umfangreiche staatliche Kapitaleinlagen der neuen NDB-Mitglieder VAE und Saudi-Arabien. Die erweiterte Funktionsweise der NDB muß dem Konzept der Internationalen Entwicklungsbank (IDB) von Lyndon LaRouche aus dem Jahr 1975 folgen, das damals von der Bewegung der Blockfreien Nationen auf ihrer Konferenz übernommen wurde. LaRouche hatte vorgesehen, daß die Internationale Entwicklungsbank langfristige Kredite zu einfachen Zinssätzen von 1 bis 2 Prozent für den Export von Investitionsgütern und den Technologietransfer von den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu den Entwicklungsländern ausgeben sollte. Die Neue Entwicklungsbank kann unter Rousseffs Führung schnell eine solche zentrale Rolle bei der Generierung neuer Kredite für große produktive Projekte in den Entwicklungsländern übernehmen, wie wir sie in diesem Heft beschreiben.
Es ist eines der Grundprinzipien der Kosmologie: Auf einer ausreichend großen Skala ist alles „gleichförmig“ – das Universum erscheint einheitlich, egal wohin man schaut. Mit anderen Worten: Das Universum ist isotrop. Vor zwei Jahren entdeckten Forscher jedoch einen kolossalen Galaxienbogen, der sich über 3,3 Milliarden Lichtjahre erstreckt und 9,2 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Anschließend hat dasselbe Team eine weitere Struktur entdeckt, einen Ring von Galaxien mit einem Durchmesser von 1,3 Milliarden Lichtjahren, der ebenfalls 9,2 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Die beiden Strukturen, der „Riesenbogen“ und der „Große Ring“, sind am Himmel um 12 Grad gegeneinander geneigt. Die Entdeckerin der beiden Strukturen, Alexia Lopez, Doktorandin am Jeremiah Horrocks Institute der University of Central Lancashire, stellte ihre Ergebnisse auf der 243. Tagung der American Astronomical Society vor.

Künstlerische Darstellung davon, wie der Große Ring (blau dargestellt) und der Riesenbogen (rot dargestellt) am Himmel aussehen würden.
Wie IFL Science berichtet, erläuterte Lopez, daß diese Entdeckungen alles in Frage stellen, was wir bisher über die Funktionsweise des Universums angenommen haben: „Man hätte vielleicht eine einzige extrem große Struktur im gesamten beobachtbaren Universum erwartet. Aber der Große Ring und der Riesenbogen sind zwei riesige Strukturen, die sogar kosmologische Nachbarn sind, was außerordentlich faszinierend ist… Keine dieser beiden Strukturen läßt sich ohne weiteres mit unserem derzeitigen Verständnis des Universums erklären. Ihre gigantischen Ausmaße, ihre besonderen Formen und ihre kosmologische Nähe müssen uns etwas Wichtiges sagen – aber was genau? Kosmologische Berechnungen sehen die derzeitige theoretische Größenbegrenzung von Strukturen bei 1,2 Milliarden Lichtjahren, aber diese beiden Strukturen sind viel größer – der Riesenbogen ist fast dreimal so groß und der Umfang des Großen Rings ist vergleichbar mit der Länge des Riesenbogens… Nach den derzeitigen kosmologischen Theorien hätten wir Strukturen dieser Größenordnung nicht für möglich gehalten.“ Lopez und ihre Kollegen Dr. Roger Clowes und Gerard Williger von der University of Louisville entdeckten die neuen Strukturen, indem sie die Absorptionslinien in den Spektren von Quasaren aus dem Sloan Digital Sky Survey (SDSS) untersuchten.
Am 16. Juni 2023 erhielt das Shanghaier Institut für Angewandte Physik eine 10jährige Betriebsgenehmigung für Bau und Betrieb eines mit ThorJg. 45, 2024, Nr. 1
ium betriebenen 2-Megawatt-Salzschmelzreaktors am Rande der Gobi-Wüste. Die Salzschmelze dient sowohl als Lösungsmittel für den Brennstoff als auch als primäres Kühlmittel, wodurch die Herstellung fester Brennelemente überflüssig wird. Der Brennstoff ist eine Mischung aus Fluoriden des spaltbaren Urans und des nicht spaltbaren Thoriums, wobei nur das Thorium verbraucht wird. Thorium kommt mehr als 400mal häufiger vor als spaltbares Uran-235. Ein halbes Jahr später, am 13. Dezember 2023, stellte eine chinesische Werft auf der Messe Marintec China 2023 in Shanghai den Entwurf eines atomgetriebenen Großcontainerschiffs vor, das 24.000 Standardcontainer (TEU) transportieren kann. Das Schiff mit dem Namen KUN-24AP wurde von der Jiangnan-Schiffsbaugruppe, einer Tochtergesellschaft des staatlichen chinesischen Schiffsbaukonzerns, entworfen. Das Schiff soll mit einem Thorium-Salzschmelzereaktor der vierten Generation ausgerüstet werden.

Ansicht des atomgetriebenen chinesischen Containerschiffs
Wie bei dem Reaktor in der Wüste Gobi handelt es sich um einen Brutreaktor, der die bei der Uranspaltung entstehenden Neutronen einfängt und damit so viel Thorium in spaltbares Uran-233 umwandelt, daß der Spaltstoffgehalt erhalten bleibt und nur Thorium verbraucht wird. Im Primärkreislauf des Reaktors wird Fluorsalz als Medium verwendet, das nach Abkühlung durch einen Sekundärkreislauf aus Fluorsalz Wärme an einen Tertiärkreislauf mit reinem Wasser oder Kohlendioxid als Medium abgibt. Die Wärme wird dann in eine Turbine geleitet, um Strom zu erzeugen, der zwei Elektromotoren antreibt, die zwei Wellen mit zwei Schiffsschrauben antreiben und so für hohe Leistung, Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit sorgen. Mit diesem System soll das Schiff eine Geschwindigkeit von mehr als 26 Knoten erreichen, verglichen mit der derzeitigen Norm für Diesel-Systeme mit einer Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten. Der Thoriumreaktor macht eine Neubeladung während der erwarteten Lebensdauer des Schiffes von 25 Jahren überflüssig.
William Happer, emeritierter Professor für Physik an der Princeton University, hat am 19. Januar 2024 im wöchentlichen „New York Symposium“ von Diane Sare, der unabhängigen LaRouche-Kandidatin für den US-Senat im Bundesstaat New York, betont, warum der Kreuzzug gegen CO2 eine fatale Fehlentwicklung ist. Hier einige kurze Zitate aus seinem Vortrag:
„Wir erleben heute einen weiteren fehlgeleiteten Kreuzzug. Die menschliche Gesellschaft wird von Kreuzzügen geplagt, so lange es Aufzeichnungen gibt. Zum Beispiel drehten sich die mittelalterlichen Kreuzzüge im Nahen Osten
nicht wirklich um die Rettung des Kreuzes Christi. Es ging um Macht. Es ging um Geld. Es ging um alles andere als wahre Religion. Heute wird ein Kreuzzug gegen das Kohlendioxid (CO2) geführt, das angeblich ein Schadstoff sein soll. Es wird von ,Kohlenstoff-Verschmutzung‘ geredet. Ich kratze mich am Kopf und frage mich, was damit gemeint sein soll, denn alles Leben besteht aus Kohlenstoff. Kohlenstoff ist der grundlegende Bestandteil des Lebens. Und doch haben es die Mainstream-Medien geschafft, viele Menschen davon zu überzeugen, daß sie die Kohlenstoffverschmutzer sind…“.
Das Gegenteil sei der Fall, denn „mehr CO2 macht nicht nur fast keinen Unterschied für das Klima, hat aber einen sehr großen Nutzen für das Leben, für die Land- und Forstwirtschaft… Mehr CO2 erhöht die Produktivität der Pflanzen erheblich… Es gibt zwei Hauptgründe, warum mehr CO2 den Pflanzen hilft: Erstens brauchen Pflanzen weniger Wasser, wenn mehr CO2 vorhanden ist, und zweitens gibt es weniger schädliche Photorespiration [Lichtatmung] mit mehr CO2-Produktion durch die Pflanze.“
Der Iran hat mit dem Bau eines „Superprojekts“ begonnen: Im Süden des Landes sollen vier Kernkraftwerke mit einer installierten Leistung von jeweils 1250 Megawatt und einer erwarteten Gesamtleistung von 5000 Megawatt entstehen, meldete die offizielle Nachrichtenagentur IRNA am 31. Januar. Der Iran will bis 2041 insgesamt 20.000 Megawatt an Kernenergie-Kapazität aufbauen, was eines der ehrgeizigsten Projekte zum Bau von Kernkraftwerken auf der Welt darstellt. Mohammad Eslami, Leiter der Atomenergie-Organisation des Iran (AEOI), der iranischen Atombehörde, sagte, die Fertigstellung der neuen Anlagen werde bis zu neun Jahre dauern.
Dem Bericht zufolge werden die vier neuen Anlagen in der Hafenstadt Sirik an der iranischen Ostküste, etwa 1150 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, gebaut. Nasser Shariflou, der Leiter des Projekts, sagte gegenüber IRNA, das Projekt werde etwa 20 Milliarden US-Dollar kosten und 4000 Arbeitsplätze schaffen. Jede Anlage wird voraussichtlich 35 Tonnen Kernbrennstoff verbrauchen.
Iran betreibt bereits ein aktives Kernkraftwerk, eine von Rußland gebaute 1000-Megawatt-Anlage, die 2011 in Buschehr in Betrieb ging. Ein zweites, von Rußland konstruiertes Kraftwerk mit etwa der gleichen Leistung ist geplant. Außerdem baut der Iran in der ölreichen Provinz Chusistan, nahe der westlichen Grenze zum Irak, eine im eigenen Land entwickelte 300-Megawatt-Anlage.
Der Iran soll „nuklear“ werden, aber ein Iran, der den Westen nicht durch Waffenprogramme beunruhigt, sondern der eine produktive Industrie aufbaut, die durch iranische Kernkraftwerke mit Energie versorgt wird.
Von Dean Andromidas
wird die malthusianische Klima-Agenda der Milliardäre, die von einer „Klimakonferenz“ zur nächsten jetten, nicht akzeptieren. Im Gegenteil, unter den führenden politischen Strömungen des Kontinents wächst der Konsens, daß Afrika durch eine aggressive infrastrukturorientierte Entwicklungspolitik zum nächsten Wirtschaftswunder der Welt werden muß.

Afrika südlich der Sahara ist die größte Region der Erde, in der Elektrizität nicht für alle verfügbar ist.
Das Satellitenbild von 2012 zeigt, daß es in weiten Teilen Afrikas nachts völlig dunkel ist. Nur im Raum Johannesburg und am unteren Nil gibt es so viele Lichter wie auf dem europäischen Kontinent.
Der Schlüssel dafür ist Energie bzw. der von Lyndon LaRouche oft verwendete Begriff „Energiedichte“, d. h. Energie in immer höheren Formen, von menschlicher und tierischer Muskelkraft über Wind und Wasser bis hin zu Kohle, Kohlenwasserstoffen, Kernspaltung und Kernfusion. Afrika will diese höheren Energieformen zusammen mit einer modernen Infrastruktur von Straßen, Eisenbahnen und Stromnetzen für den Aufbau von Entwicklungskorridoren auf dem gesamten Kontinent nutzen, um die 54 souveränen Nationen Afrikas zu einer vollständig integrierten agro-industriellen Wirtschaft zusammenzuschließen. Die afrikanischen Staats- und Regierungschefs sind sich bewußt, daß sie das enorme Energiedefizit des Kontinents rasch überwinden müssen, wenn sie dieses Ziel erreichen wollen. Afrikas reiche Vorkommen an Kohle, Öl, Gas und Uran müssen dabei eine zentrale Rolle spielen.
Anläßlich der Eröffnung der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai wandte sich Nj Ayuk, Vorstandsvorsitzender der Afrikanischen Energiekammer, in einem Meinungsbeitrag am 30. November 2023 auf africa.com ganz offen gegen das malthusianische Diktat der KlimaOligarchen. Bei „allem Respekt für die Phänomene des Klimawandels“ lehne Ayuk den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern ab:
Jg. 45, 2024, Nr. 1
„Die kohlenwasserstoffhaltigen Länder unseres Kontinents verdienen es, die gleichen Vorteile zu genießen, die die Industrienationen genossen haben, als sie die fossilen Brennstoffe unter ihrem Boden und vor ihren Küsten ausbeuteten und zu Geld machten. Die afrikanischen Staaten brauchen ihre fossilen Brennstoffe, insbesondere Erdgas, auch, um die lähmende Energiearmut zu lindern, unter der mehr als 600 Millionen Menschen leiden. Die Menschen in Afrika haben lange genug auf die Vorteile und Chancen der Modernisierung gewartet.“
Ayuks Äußerungen waren noch eher diplomatisch formuliert, verglichen mit der Stimmung auf der jährlichen Afrikanischen Energiewoche, die vom 16. bis 20. Oktober 2023 in Kapstadt stattfand. Diese von Ayuks Afrikanischer Energiekammer ausgerichtete Veranstaltung, auf der für den Ausbau der Öl-, Gas-, Kohle- und Atomenergie zur Industrialisierung Afrikas geworben wurde, war ganz offensichtlich ein Dorn im Auge der afrikanischen Klimaschutzlobby. Die südafrikanische Tageszeitung Daily Maverick sah sich zudem genötigt, die Konferenz in einem langen Artikel mit dem Titel „Afrika-Energiewoche: Wo die Klimawissenschaft den Gas- und Kohlegöttern weicht“ aufs Korn zu nehmen. Das Thema der Konferenz war „Die afrikanische Energie-Renaissance: Vorrang für Energiearmut, die Menschen, den Planeten, Industrialisierung und freie Märkte“. Fast alle afrikanischen Regierungen, Energieunternehmen und staatlichen Energiekonzerne nahmen teil. Die Daily Maverick schrieb dazu: „Die Redner wehrten sich vehement gegen die weltweiten Forderungen nach einer sofortigen Abkehr von fossilen Brennstoffen…“.
Der namibische Präsident Hage Geingob sagte auf der Konferenz:
„Wenn die afrikanische Energierenaissance von Bedeutung sein soll, muß es Afrika erlaubt sein, seine natürlichen Ressourcen zum Wohle des Kontinents zu erforschen und zu nutzen. Dies sollte nicht für den Export in andere Länder geschehen, sondern zum Nutzen der afrikanischen Bevölkerung.“
Ein Panel trug den Titel „König Kohle ist zurück: Afrikas zukünftige saubere Kohleindustrie“. In seinem Schlüsselbeitrag zu diesem Panel sagte Dr. Zwanani Titus Mathe, Vorstandsvorsitzender des südafrikani-
schen Nationalen Energie-Entwicklungsinstituts: „Der Energiemix der Zukunft wird immer Kohle enthalten. Deshalb müssen wir weiter in Kohle investieren und Kohleforschung betreiben… Es ist ganz klar, daß der Grundlaststrom aus Kohle- und Kernkraftwerken kommen wird.“
Enobot Agboraw, Exekutivsekretär der Afrikanischen Kommission für Kernenergie, erklärte auf der Konferenz, daß angesichts der derzeitigen Energiearmut die Kernenergie mit ihrer langen Lebensdauer und Zuverlässigkeit eine wichtige Säule für eine Energiewende ganz anderer Art in Afrika darstelle.
Sayed Salah Eldin Motyaser Aly von der ägyptischen Kernkraftwerksbehörde informierte die Teilnehmer über die Fortschritte von El Dabaa, Ägyptens erstem Kernkraftwerk, das er als „den Beginn unserer zukünftigen Industrialisierung“ bezeichnete:
„Es hat die Möglichkeit für hochqualifizierte Arbeitsplätze und die Entwicklung lokaler Industrien geschaffen. Ägypten hat in viele Initiativen investiert, wie zum Beispiel in die eigens für El Dabaa eingerichtete Berufsschule sowie in ein Ausbildungsprogramm, das zusammen mit unserem strategischen Partner [Rußland] durchgeführt wurde, um sicherzustellen, daß wir über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um dieses Projekt voranzutreiben.“
Alle nordafrikanischen Länder, darunter Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko, sind wichtige Produzenten und Exporteure von Öl und Gas, verfügen über eine 100-prozentige Elektrifizierung und verfolgen dabei eine ehrgeizige Wirtschaftsentwicklungspolitik. Im Gegensatz dazu sind die afrikanischen Länder südlich der Sahara, die den Großteil der Fläche und der Bevölkerung des Kontinents ausmachen, die größte Region der Welt, in der nur ein winziger Teil der Bevölkerung überhaupt Zugang zur Elektrizität hat. In Niger sind es gerade mal 3 Prozent der Bevölkerung, im Tschad sind es 9, in Liberia 11 Prozent, in Burkina Faso 20 Prozent, in Mauretanien 30 Prozent, in Mali 40 Prozent und in allen anderen Ländern südlich der Sahara zwischen 30 bis 60 Prozent, mit Ausnahme von Südafrika. Nur in Südafrika haben zwar 95 Prozent der
Bevölkerung Zugang zur Elektrizität, doch es gibt immer wieder Engpässe.
Nach Angaben der Internationalen Energieagentur

Regierungen Brasiliens, Rußlands, Indiens, Chinas und Südafrikas. Auf dem letztjährigen BRICS-Gipfel in Südafrika und dem parallel stattfindenden Rußland-AfrikaGipfel in St. Petersburg waren zahlreiche afrikanischen Staats- und Regierungschefs vertreten.
Abbildung 1. Diese Karte von Afrika zeigt, wie viel Prozent (in ZehnerSchritten) der Bevölkerung eines jeden Landes Zugang zu Elektrizität hat. (Grau unterlegte Länder haben keine Angaben.)
sind insgesamt 580 Millionen Afrikaner ohne Strom. Die am stärksten betroffenen Länder liegen in Zentralafrika. Dabei ist Afrika reich an Kohle, Öl, Gas und Uran, die aber meistens nur exportiert werden. Nigeria, der größte Erdölproduzent Afrikas, importiert trotz eigener Raffinerien nachgelagerte Erdölprodukte im Wert von 2 Milliarden Dollar.
In vielen afrikanischen Ländern, die Gas exportieren, sind große Landesteile nicht vollständig elektrifiziert. Das liegt vor allem daran, daß die Exporteinnahmen dieser Staaten zur Finanzierung ihrer Regierungen und zur Begleichung internationaler Schulden verwendet werden, anstatt Afrika zu entwickeln und eine fortschrittliche Landwirtschaft und Industrie aufzubauen.
Dies ändert sich nun rasch, da afrikanische Staatsund Regierungschefs angefangen haben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, und sich neuen Wirtschaftspartnern zuzuwenden, darunter Chinas „Belt and Road“-Initiative, Rußland und nun auch den BRICS, dem schnell wachsenden Zusammenschluß der
Die BRICS beschlossen dort, Ägypten und Äthiopien als neue Mitglieder aufzunehmen, zwei der bevölkerungsreichsten Länder Afrikas, die zudem eine sehr ehrgeizige Entwicklungspolitik verfolgen. Es besteht ein wachsender Konsens darüber, daß die sogenannte „Energiewende“ des Westens weg von fossilen Brennstoffen hin zu sogenannten „erneuerbaren Energien“ wie Wind- und Solarenergie die Armut in Subsahara-Afrika noch weiter verschärfen wird, indem sie diese Länder der Vorteile beraubt, die sich aus der Nutzung ihrer reichen Kohlenwasserstoffvorkommen für die Industrialisierung des Kontinents ergeben. Die Karte (s. Abbildung 1) zeigt den Elektrifizierungsgrad auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Es sind viele Küstenländer Afrikas, die einen relativ hohen Elektrifizierungsgrad aufweisen, während die Binnenländer fast immer unter hohem Strommangel leiden. Entsprechend sieht auch die geographische Verteilung der Kohlenwasserstoffressourcen aus, die sich hauptsächlich in den Mittelmeerländern Nordafrikas und entlang der Küste Westafrikas befinden. In Ostafrika sind inzwischen neben den langjährigen Kohlenwasserstoffproduzenten Mosambik und Tansania weitere hinzugekommen. In jüngerer Zeit wurden auch weitere Vorkommen entlang der Ostküste sowie in Binnenländern wie Uganda und in der Sahelzone entdeckt. Kohle ist im südlichen Afrika reichlich vorhanden und trägt dazu bei, daß Südafrika zu 95 Prozent elektrifiziert ist. Führende afrikanische Organisationen versuchen, dieses Ungleichgewicht durch den Bau von Gaspipelines aus den westlichen Küstenländern in die Binnenländer zu beheben, um dort Strom und andere Energie zu erzeugen.
Panafrikanische Verbände wie die Organisation Afrikanischer Erdölproduzenten (APPO), die die 18
erdölfördernden Länder Afrikas vertritt, und die Afrikanische Energiekammer sind mit den Ländern bereits dabei, gemeinsam dieses Projekt voranzubringen.
Die Elektrifizierung Afrikas könnte in zwei Phasen erfolgen: die erste mit fossilen Brennstoffen und Wasserkraft, die zweite mit Kernenergie. Kohle und Gas bieten die schnellsten Möglichkeiten zur Stromerzeugung. Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GUDKW) können mit äußerer Hilfe innerhalb weniger Monate errichtet werden. Alle Hauptkomponenten werden dabei im Werk vorgefertigt und vor Ort nur noch montiert. Ein Beispiel: Im Jahr 2016 beauftragte Ägypten die Firma Siemens mit dem Bau des weltgrößten GUDKW mit der enormen Leistung von 14,4 Gigawatt (GW). Es wurde in nur drei Jahren errichtet und ging 2018 in Betrieb. Damit stieg die ägyptische Stromerzeugung auf mehr als 34 GW.
In den Regionen mit großem Strommangel werden erstmal wesentlich kleinere Anlagen benötigt. Während die Pipelines noch im Bau sind, könnten dort Kraftwerke und somit Stromnetze bereits errichtet werden. Das Verlegen von Pipelines ist keine Raketenwissenschaft, und afrikanische Unternehmen können mit eigenen Arbeitskräften diese Technik leicht beherrschen. Die Phase der Kernenergie wird zeitgleich beginnen müssen, da der Bau eines Reaktors in Ländern, die keine Erfahrung mit Kernenergie haben, 15 bis 20 Jahre dauert. Auch große Wasserkraftwerke benötigen lange Bauzeiten von bis zu einem Jahrzehnt.
schrieben, mit denen Gas innerhalb Afrikas verteilt werden soll.
Bei einem Treffen des Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Energieforums (CABEF) im Januar 2023 wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Region Zentralafrika bis 2030 zu einer „energiearmutsfreien Zone“ zu machen. Zu den Unterzeichnern gehören die Organisation Afrikanischer Erdölproduzenten (APPO), Äquatorialguinea, Kamerun, Gabun, Tschad, die Demokratische Republik Kongo, die Republik Kongo und der zweitgrößte Erdölproduzent Afrikas, Angola. Ihre Idee ist es, ein zentralafrikanisches PipelineSystem namens CAPS zu schaffen, das Erdgas in ganz

Abbildung 2. Die geplante 5660 km lange Gaspipeline Marokko-Nigeria entlang der Küste Westafrikas würde 400 Millionen Menschen in Afrika mit Brennstoff versorgen. Sie soll auch eine Verbindung nach Cádiz, Spanien, herstellen.
Es gibt in Afrika zwar bereits viele Pipelines und Gasanlagen, aber die meisten sind für den Export bestimmt. In keiner von ihnen wird in Afrika produziertes Flüssiggas verarbeitet, um es in Länder wie Südafrika zu transportieren. Im folgenden werden Projekte be-
Zentralafrika verteilen würde, anstatt die geförderten Rohstoffe nur nach Europa und in den Westen zu exportieren und die Einnahmen zur Tilgung von Auslandsschulden zu verwenden. Das Projekt sieht den Bau von Gaskraftwerken, Raffinerien und Gasverflüssigungsanlagen vor. Mit der erzeugten Energie sollen nicht nur Haushalte, sondern vor allem das produzierende Gewerbe versorgt werden, das Ressourcen wie Eisenerz,
Bauxit, Kupfer usw. verarbeitet, Stoffe also, die derzeit nur in Rohform exportiert werden. Der Plan sieht vor, eine 6500 Kilometer lange neue Pipeline durch elf afrikanische Länder zu verlegen.
Allein in Zentralafrika werden die Erdölreserven auf mehr als 31 Milliarden Barrel geschätzt, wobei sich fünf der zehn erdölproduzierenden Länder Afrikas in dieser Region befinden: Gabun, Republik Kongo, Äquatorialguinea, Tschad und Angola. Die China National Petroleum Corporation (CNPC) ist in den Ländern der Region stark engagiert.
Ende 2023 hatte der damalige Minister für Bergbau und Kohlenwasserstoffe Äquatorialguineas, Gabriel Obiang Lima, bei einem Treffen der Afrikanischen En-
„MSGBC Oil, Gas & Power 2022“-Konferenz im Detail vor.
Weiter nördlich an der Westküste Afrikas soll die Erdgaspipeline Marokko-Nigeria gebaut werden, die 400 Millionen Menschen in Afrika mit Strom versorgen könnte (Abbildung 2). Das Projekt wurde von König Mohammed VI. von Marokko auf dem Afrikanischen Investitionsforum (AIF) im November 2023 in Marrakesch, als „transformativ“ bezeichnet. Es werde „die regionale wirtschaftliche Integration fördern [und] allen Ländern entlang der Pipeline-Strecke den Zugang zu verläßlicher Energieversorgung ermöglichen“.

Unterzeichnung der Absichtserklärung für das Erdgasodukt Marokko-Nigeria. Von links nach rechts: Sédiko Douka, ECOWAS-Kommissar für Infrastruktur, Energie und Digitalisierung, Amina Benkhadra (Mitte), Generaldirektorin von ONHYM und Mele Kyari, Vorstandsvorsitzender der NNPC-Gruppe.
ergiekammern einen Zeitplan für das Projekt vorgestellt. Äquatorialguinea und Kamerun arbeiten bereits an der ersten Phase, bei der eine Verbindung über den Tschad entstehen soll. Ziel ist es, Energieknotenpunkte für den Import und Export von Kohlenwasserstoffen (insbesondere Flüssiggas) und Chemikalien zu schaffen. In diesen Knotenpunkten sollen auch Kraftwerke entstehen, die günstigen Strom für die energiearmen Länder im landeingeschlossenen Mittelafrika produzieren können.
Obiang Lima hat mit den Regierungschefs aller 11 Länder gesprochen und sich von der Africa EXIM Bank in Kairo die Finanzierung einer Studie für das Projekt gesichert. Der Minister stellte das Projekt auf der
Das Projekt wurde bereits 2016 vom marokkanischen König und dem damaligen nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari durch ein Abkommen zwischen der Nigerianischen Nationalen Erdölgesellschaft (NNPC) und der marokkanischen Kohlenwasserstoff- und Minenbehörde (ONHYM) angestoßen. Die geplante 5660 Kilometer lange Pipeline würde Nigeria, Benin, Togo, Ghana, die Elfenbeinküste, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Senegal und Mauretanien verbinden und in Nordmarokko und Südspanien enden. Sie beginnt eigentlich in Ghana, wo die bestehende westafrikanische Pipeline zwischen Nigeria, Benin, Togo und Ghana zur Zeit endet.
Alle beteiligten afrikanischen Länder haben bereits Vereinbarungen über ihre Beteiligung unterzeichnet. Machbarkeitsstudien und technische Untersuchungen, die von der Islamischen Entwicklungsbank und dem OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung (OFID) finanziert werden, sind abgeschlossen oder in Arbeit. Obwohl noch kein Datum für den Baubeginn festgelegt wurde, steht das Projekt ganz oben auf der Agenda der marrokkanischen Regierung. Die Pipeline würde auch
den Transport von Gas von der Pipeline an der Küste in die Binnenländer der Sahelzone erleichtern, die den niedrigsten Elektrifizierungsgrad in Afrika aufweisen.
Das Projekt ist Teil der kürzlich vom marokkanischen König angekündigten Initiative, alle afrikanischen Länder an der Atlantikküste durch Hafen- und Transportinfrastrukturen mit den Binnenländern in der Sahelzone und Zentralafrika zu verbinden.

Es kam am 23. Januar 2024 zur symbolischen Grundsteinlegung für das Fundament des ägyptischen Kernkraftwerks El Dabaa in der gleichnamigen Stadt. Daran nahmen der ägyptische Präsident Abdul Fattah al-Sisi, der russische Präsident Wladimir Putin, der ägyptische Premierminister Mostafa Madbouly, Rosatom-Generaldirektor Alexej Lichatschew, der ägyptische Minister für Elektrizität und erneuerbare Energien Mohamed Shaker und der Vorsitzende der ägyptischen Atomkraftwerksbehörde Dr. Amged El-Wakil teil.
In Ostafrika exportiert Mosambik, ein wichtiges Förderland, Erdgas bereits über bestehende Pipelines in die Nachbarländer Simbabwe und Südafrika. Weitere Pipelines sind in Planung. Am 10. November 2023 einigten sich Tansania und Uganda auf eine Machbarkeitsstudie für eine Gaspipeline, um die Projektstruktur, den Gasbedarf und die Dimensionen der Pipeline zu untersuchen.
Beide Regierungen sehen das Projekt als Teil der umfassenderen Energieintegrationsbemühungen in Ostafrika, die darauf abzielen, die regionale Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern. Darüber hinaus haben die Regierungen vereinbart, bei dem ostafrikanischen Rohöl-Pipeline-Projekt EACOP zusammenzuarbeiten, mit dem kürzlich in Uganda entdecktes Erdöl nach Tansania transportiert werden soll, um es auf den Weltmarkt zu bringen. Tansania und Kenia sollen in Kürze mit dem Bau einer 600 Kilometer langen Pipeline von Mombasa nach Daressalam beginnen, um tansanisches Gas nach Kenia zu transportieren.
Um dem Finanzierungsdruck durch westliche Geldgeber zu einem guten Teil zu entgehen, entsteht in Afrika eine neue eigene Bank, die Afrikanische Energie-Bank. Sie soll im Juni 2024 eröffnet werden. Sie wurde 2022 konzipiert und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Afrikanischen Export-Import-Bank (Afreximbank) und der APPO. Letztere hat das oben erwähnte CAPS-Pipelinesystem initiiert, erstere finanziert die Machbarkeitsstudie.
In einer Rede auf der Interafrikanischen Handelsmesse in Kairo am 16. November 2023 sagte Rene Awambeng, einer der Direktoren der Afreximbank:
„Der Vorstand der Afreximbank hat in Zusammenarbeit mit der APPO beschlossen, eine weitere Agentur zu gründen, die sich mit der Finanzierung des afrikanischen Energiebedarfs befassen wird. Wir befinden uns in der Endphase, um alle Genehmigungen zu erhalten, und es wird eine vertragliche Organisation sein. Wir werden drei Arten von Anteilseignern haben: die afrikanischen Ölförderländer, nationale Ölgesellschaften und afrikanische Investoren sowie internationale Investoren aus allen Bereichen.“
In einem Bericht des Business Insider Africa vom Mai 2023 wird der Generalsekretär der APPO, Dr. Omar Farouk Ibrahim mit den Worten zitiert, die Bank werde sich „hauptsächlich auf die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten auf dem afrikanischen Kontinent konzentrieren, da die Mittel [aus dem Westen] versiegen“, wobei er insbesondere auf die Weltbank und andere internationale Finanzinstitutionen anspielte, aber auch auf private Fonds, die den Vorgaben des früheren britischen Zentralbankchefs Mark Carney zur „grünen Klimafinanzierung“ folgen. Ibrahim sagte, daß der Westen Finanzierungskanäle geschlossen hätte und daß „strengere Bedingungen gestellt werden […] als noch vor 20 oder 30 Jahren“.
Die Energieversorgung Afrikas mit Kernkraft hat bereits begonnen. In Südafrika ist ein von der französischen Firma Framatome (heute Areva) in Koeberg bei Kapstadt gebautes 970-Megawatt-Kernkraftwerk in Betrieb. Ein zweiter Reaktor ist in Planung. Da in Südafrika während des Apartheid-Regimes Atomwaffen gebaut wurden, verfügt das Land über fortgeschrittene nukleare Forschungskapazitäten. Bereits in den 1990er Jahren wurde das innovative Modell eines Kugelhaufenreaktors entwickelt, aber wegen mangelnder Finanzierung wieder eingestellt.
Dennoch entwickeln sowohl die dortige Regierung als auch private Interessenten die Technologie weiter. Das vielversprechendste Projekt wird von der Firma STL Nuclear betrieben. Sie hat einen modularen Hochtemperaturreaktor, den HTMR-100 (100 MW thermisch, 35 MW elektrisch), geschaffen – einen gasgekühlten Kugelhaufen-Hochtemperaturreaktor mit einem Brennstoffkreislauf auf Thoriumbasis. Dabei stehen die Bedürfnisse Afrikas im Vordergrund, wo Länder mit einer geringen Bevölkerungsdichte besser mit kleinen, netzunabhängigen Kraftwerken versorgt werden können.
Ägypten wird das zweite afrikanische Land sein, das ein Kernkraftwerk betreibt, wenn sein 4,8-GigawattKraftwerk El Dabaa, das vom russischen Nuklearunternehmen Rosatom gebaut wird, zwischen 2026 und 2027 in Betrieb geht. Als Ägypten beschloß, ein Kernkraftwerk zu bauen, verfügte das Land wie alle afrikanischen Länder mit Ausnahme Südafrikas über keiner-
lei nukleartechnische Kapazitäten. Der Weg dorthin hat fast 20 Jahre gedauert, woran sich andere Länder orientieren können. Viele Schritte mußten gemacht werden, wie die Schaffung einer Regulierungsbehörde und eines rechtlichen Rahmens, die Festlegung des Standorts, die Durchführung von Machbarkeitsstudien und viele mehr. Am wichtigsten ist die Ausbildung des wissenschaftlichen und technischen Personals für den Betrieb des KKW und der Aufbau der physischen Infrastruktur. Ägypten hat nicht nur mehrere hundert Studenten zur Aus- und Weiterbildung nach Rußland geschickt, sondern auch eine eigene Hochschule gegründet, um junge Ägypter in Nukleartechnik und -wissenschaft auszubilden. Erst nach diesen Vorbereitungen von mehr als einem Jahrzehnt erfolgte im Juli 2022 der erste Spatenstich für das Kernkraftwerk von El Dabaa. Inzwischen ist der Bau weiterer Einrichtungen geplant.
Dieser schwierige Prozeß hat andere afrikanische Länder nicht davon abgehalten, ebenfalls in die nukleare Zukunft aufzubrechen. Rußland und Rosatom wollen dabei eine führende Rolle übernehmen. Beim zweiten Rußland-Afrika-Gipfel im Juli 2023 in St. Petersburg standen Nukleartechnologien im Mittelpunkt der Beratungen. Rosatom hat nukleare Kooperationsabkommen mit Burkina Faso, Burundi, Kongo, Äthiopien, Ghana, Mali, Nigeria, Ruanda, Südafrika, Sudan, Tansania, Uganda, Sambia, Simbabwe und Ägypten geschlossen. Viele dieser Projekte werden sicher im Laufe der Zeit zum Bau von Kernkraftwerken in diesen Ländern führen.

Lyndon LaRouches Antwort auf den Versuch
Anzeige
neokonservativer Brandstifter, die Welt in einen Krieg der Zivilisationen zu führen.
Erstveröffentlichung: 2005; jetzt neu überarbeitet.
Softcover, DIN A-5, 170 Seiten, durchgehend farbig
Stückpreis: 19,80 € zzgl. Versandkosten
(Deutschland 3,– €, Ausland 5,– €)
Auch als E-Book im E.I.R. Online-Shop erhältlich
ISBN: 978-3-925725-60-9
Bestellung bei:
E.I.R. GmbH, Bahnstraße 4, 65205 Wiesbaden
Online-Bestellung: https://www.eir.de/shop
Nachjahrhundertelanger kolonialer Ausplünderung, gefolgt von jahrzehntelanger Schuldenknebelung, nutzloser ausländischer Hilfe und „nachhaltigen“ Investitionen durch ihre ehemaligen Kolonialherren stehen die afrikanischen Nationen an der Schwelle zu einer neuen Ära. Der erste Schritt in eine produktive Zukunft liegt in einer umfassenden realwirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere im Zugang zu reichlicher, billiger Energie, ohne die keine Wirtschaft existieren kann.
In jüngster Zeit haben zahlreiche afrikanische Staatsführer ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, den nach wie vor drückenden Kolonialismus zu überwinden, und es gibt kein Projekt, das für diese Bemühungen symbolträchtiger ist als der Grand-Inga-Staudamm in der Demokratischen Republik Kongo. Mit Entschlossenheit wird jetzt darum gekämpft, diesen Traum in naher Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn irgendetwas die Blockade durchbrechen kann, die dieses Projekt seit mehr als einem halben Jahrhundert aufhält, dann ist es der revolutionäre Geist, der sich in letzter Zeit im Globalen Süden ausbreitet, und das realwirtschaftliche Zukunftsdenken, das sich an den Konzepten von Lyndon LaRouche orientiert.
Planungen für das Projekt gehen auf die späten 1950er Jahre zurück und wurden im Laufe der Jahre konzeptio-

Der Staudamm Inga I, mit dem Zuflußkanal für Inga II im Vordergrund. Der Zugang zu reichlicher, günstiger Energie ist immer der erste Schritt zu einer groß angelegten wirtschaftlichen Entwicklung.
Das „Grand Inga“-Wasserkraftprojekt (GIWK) befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo (DRK), etwa 225 Kilometer flußabwärts von ihrer Hauptstadt Kinshasa und etwa 150 Kilometer flußaufwärts von der Mündung des Kongo in den Atlantik (siehe Abbildung 1)
nell erweitert, basierend auf den ursprünglichen Plänen für die Wasserkraftwerke Inga I und Inga II, die in den 1970er Jahren bereits gebaut wurden und immer noch in Betrieb sind. Das riesige „Inga III“-Projekt ist die erste Phase von sechs weiteren Staudämmen, die nacheinander gebaut werden sollen. Der lange Flußlauf des Kongo erstreckt sich über neun Länder in West- und Zentralafrika und bietet rund 75 Millionen Menschen Nahrung, Wasser und Transportmittel. Bereits 1921 kam der United States Geological Survey zu dem Schluß, daß der Kongo potentiell mehr als ein Viertel der weltweit möglichen Wasserkraft erzeugen könnte. Um die Notwendigkeit und Dringlichkeit dieses Projekts zu verstehen, muß zunächst eine entsprechende konzeptionelle Grundlage geschaffen werden. Jg. 45, 2024, Nr. 1

Im Jahr 2017 veröffentlichte das Schiller-Institut einen Sonderbericht mit dem Titel Extending the New Silk Road to West Asia and Africa (Die Neue Seidenstraße nach Westasien und Afrika ausdehnen). In diesem Bericht wurden Vorschläge für die vollständige wirtschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung dieser gesamten Region, einschließlich des Baus des GIWK, detailliert dargestellt. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch der neue Entwicklungsgeist, der von Chinas „Belt and Road“-Initiative ausging – eine Aufbruchsstimmung, die seither nur noch stärker geworden ist. Die erforderliche konzeptionelle Grundlage geht aus der Einleitung des Berichts deutlich hervor:
Die weltweite Medienberichterstattung über Afrika und den Nahen Osten (oder: Südwestasien) konzentriert sich in der Regel auf Krieg, Terrorismus, Hungersnöte, Epidemien und Massenmigration. Sehr selten werden diese beiden Regionen mit wirtschaftlicher Entwicklung, wissenschaftlichen Durchbrüchen oder kulturellem Fortschritt in Verbindung gebracht. Leider hat dieses Bild der Region durchaus eine Grundlage in der Realität. Die Situation hat zwar auch innerstaatliche Ursachen, hängt aber weitgehend mit globalen geopolitischen Faktoren und dem Versuch der großen Weltmächte zusammen, sich Einflußsphären, natürliche Ressourcen, Märkte
Abbildung 1. Das „Grand Inga“Wasserkraftwerkprojekt (GIWK) liegt in der Nähe der Mündung des Kongo-Flußes (s. roter Kreis).
sowie strategische und politische Vorteile gegenüber anderen globalen und regionalen Gegnern zu sichern…
Die gute Nachricht ist, daß sich in der Weltpolitik ein neues Paradigma herausgebildet hat, das die Spielregeln des sogenannten alten Paradigmas konkret verändert – des Paradigmas, das für die oben genannten Probleme in Westasien und Afrika verantwortlich ist. Dieses neue Paradigma ist weder ein Plan für die ferne Zukunft noch eine hypothetische, akademische Spekulation. Es ist eine Realität, die sich jetzt in der Welt durchsetzt…
Die Länder, die das neue Paradigma repräsentieren, insbesondere China, haben bewiesen, daß die Beseitigung von Armut, Hunger und Krankheiten nur durch eine umfassende Industrialisierung und den Einsatz modernster Technologien zur Freisetzung der kreativen, produktiven Kräfte der Gesellschaft erreicht werden kann, wie es die Vereinigten Staaten und Europa in den vergangenen Jahrhunderten getan haben, und nicht durch kleine Schritte, wie sie die Vereinigten Staaten und Europa für Afrika und Asien seit den 1960er Jahren vorgesehen haben…
Die BRICS-Staaten, allen voran China, haben auch den Begriff „nachhaltige Entwicklung“ neu definiert, worunter sie vor allem Industrialisierung, Ernährungssicherheit und die Beseitigung der Armut verstehen, anstatt den Lebens-
standard der Menschen an die unmittelbar verfügbaren Ressourcen und Technologien anzupassen. Technologische Apartheid war viele Jahre lang eine von den Industrienationen praktizierte Politik, die die Entwicklungsländer unter verschiedenen Vorwänden am Erwerb fortschrittlicher Technologien hinderte. Jetzt brechen die BRICS-Staaten unter der Führung Chinas diese „Regel“ und machen fortschrittliche Technologien für Nationen in Asien und Afrika verfügbar. [Hervorhebung hinzugefügt]
Der Kongo ist der tiefste Fluß der Welt (abschnittsweise bis zu 220 Meter) und mit einer Länge von etwa 4700 Kilometern der neuntlängste der Welt. Er berührt Teile von Tansania, Kamerun und Nordangola und fließt durch den Westen Sambias, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo. Gemessen an der durchschnittlichen Strömungsmenge ist er der zweitgrößte Fluß der Welt – 41.000 Kubikmeter pro Sekunde ergießen sich bei ihm in den Atlantik. Zum Vergleich: Die Strömungsmenge des Amazonas beträgt mehr als 175.000 Kubikmeter pro Sekunde, und der des Mississippi nur 17.000 Kubikmeter pro Sekunde. Der Kongo, der sich die meiste Zeit recht langsam in Richtung Atlantik schlängelt, fließt am Ende durch enge Schluchten und Klüfte, was seine Fließgeschwindigkeit dann massiv erhöht. Kurz vor der Mündung hat der Fluß auf einer Länge von 14,5 Kilometer ein Gefälle von 96 Metern. Allein auf diesem Abschnitt, der an seiner breitesten Stelle über 3,2 Kilometer breit ist, könnten Schätzungen zufolge mindestens 39,6 Gigawatt (53.100.000 PS) an mechanischer Energie und fast ebenso viel an elektrischer Energie erzeugt werden – auch wenn einige Schätzungen diese Zahl noch viel höher ansetzen. Aufgrund dieser einzigartigen geologischen Gegebenheiten könnte das „Grand Inga“-Projekt mit Hilfe von Staudämmen wie auch mit Laufwasserturbinen (Turbinen im Fluß, die den Bau eines Staudamms nicht erfordern) eine solch enorme Energiemenge nutzbar machen.

Abbildung 2. Standort der betriebenen Wasserkraftwerke Inga I und II, die mögliche Erweiterung Inga III und deren geplanten Erweiterungen flußaufwärts mit und Kraftwerken Inga IV bis VIII. Sowohl Inga I (350 MW, 1972 in Betrieb genommen) als auch Inga II (1,4 GW, 1982 in Betrieb genommen) arbeiten aufgrund politischer Unruhen und mangelnder Wartung bisher unter ihrer Kapazität.
Abbildung 2 zeigt den Standort der ersten beiden Wasserkraftwerke – Inga I (350 MW, 1972 in Betrieb genommen) und Inga II (1,4 GW, 1982 in Betrieb genommen) –, die beide aufgrund politischer Unruhen und mangelnder Wartung unter ihrer Kapazität arbeiten. Das Grand-Inga-Projekt wird nach seiner Fertigstellung, wie in Abbildung 3 dargestellt, die größte Wasserkraftanlage der Welt sein – doppelt so groß wie der Drei-Schluchten-Damm am Jangtse in China. Es wird mehr als ein Drittel der gesamten derzeit in Afrika erzeugten Elektrizität liefern.
Förderer des GIWK sind die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC), die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas (NEPAD), der Southern African Power Pool (SAPP) und der Weltenergierat mit dem Ziel, die wirtschaftliche und politische Stabilität in der DR Kongo und der Region zu erhöhen. Insbesondere die NEPAD fördert die regionale Wirt-

schaftsintegration und sieht in dem „Inga III“-Staudamm eine potentielle Quelle für die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Ausbau des internationalen Handels und des Wirtschaftswachstums.
Im Mai 2013 unterzeichneten die Regierungen Südafrikas und Kongos den Vertrag über das „Grand Inga“Wasserkraftwerksprojekt, der die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Inga III regelt und Südafrika zum Hauptabnehmer des erzeugten Stroms macht. Die kongolesische Regierung hatte den Vertrag 2014 ratifiziert. Auf dem Pariser Klimagipfel im Juni 2023 forderten die Präsidenten der beiden Länder die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, in den „Grand Inga“ zu investieren. Mit Blick auf die geschätzte Stromerzeugungskapazität von 40 Gigawatt sagte Ramaphosa: „Laßt uns jetzt Geld auf den Tisch legen und gemeinsam sagen, daß wir dieses Megaprojekt angehen werden; ein Megaprojekt, das am Ende Strom für 12 bis 15 afrikanische Länder erzeugen wird.“
Ähnlich äußerte sich Dilma Rousseff, die Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank, in ihrer Rede auf dem BRICS-Gipfel am 24. August 2023:
Hier auf dem afrikanischen Kontinent […] befindet sich das größte ungenutzte Wasserkraftpotential des Planeten, das „Grand Inga“-Projekt, das erneuerbare, kontinuierliche, sichere und erschwingliche Energie garantieren kann. Es hat die dreifache Kapazität des Itaipu-Damms in Brasilien und die doppelte Kapazität des Drei-
Abbildung 3. Skizze des „Grand Inga“-Projekts nach seiner Fertigstellung
Schluchten-Damms in China. Der „Grand Inga“ kann Energie für einen ganzen Kontinent liefern. Zudem muß der Globale Süden versuchen, seinen Reichtum und seine Nachhaltigkeitsquellen aufzuwerten. Es ist an der Zeit, eine Reindustrialisierung mit neuen Merkmalen anzustreben.
Das GIWK mußte im Laufe der Jahre viele Herausforderungen und Rückschläge überwinden, die Ausdruck des strategischen Kampfes sind, der heute in der Welt und speziell in Afrika stattfindet. Eigentlich sollte das Projekt von „AEE Power“, der China Three Gorges Corporation und „Sinohydro“ entwickelt werden, doch die kongolesische Regierung gab im Juni 2021 bekannt, daß sie stattdessen der Fortescue-Unternehmensgruppe die Leitung des gesamten Bauprojekts übertragen hatte. Damals erklärte Alexy Kayembe De Bampende, der leitende Infrastrukturberater von Präsident Félix Tshisekedi, gegenüber Reuters, daß Fortescue hiermit der „alleinige Betreiber“ für das gesamte Projekt sei. Die Chinesen und andere seien willkommen, sich Fortescue „anzuschließen“. Reuters berichtete zudem, daß bereits im September 2020 eine Absichtserklärung in dieser Hinsicht mit Fortescue unterzeichnet worden sei. Die Fortescue Metals Group wurde von Andrew „Twiggy“ Forrest gegründet, dessen Familie in den frühen 1800er Jahren in Austra-
lien mit Rinder- und Schafzucht und Schlachtbetrieben reich wurde. Im April 2003 kaufte Forrest das australische Unternehmen „Allied Mining and Processing“ auf und benannte es in Fortescue um; diese ist heute der viertgrößte Eisenerzproduzent der Welt und verfügt über eine eigene Flotte von sieben Erzfrachtern (ein achtes ist im Bau). Im Jahr 2020 entstand die Tochtergesellschaft Fortescue Future Industries, die sich auf „grüne Energie ohne Kohlenstoff-Fußabdruck“ spezialisiert hatte. Der zunehmende Druck westlicher Finanzinstitute und Denkfabriken auf die Entwicklungsländer, „grün“ zu werden, ist Teil der Agenda der anglo-amerikanischen Oligarchie, um den industriellen Aufstieg der Länder der Dritten Welt zu unterbinden. Forrests Lebenslauf und die Zusammensetzung des Vorstands der Fortescue Metals Group lesen sich wie ein „Who is Who“ der anglo-amerikanischen Oligarchie. Er selbst hat einen Doktortitel in Meeresökologie von der University of Western Australia und war Schirmherr der International Union for Conservation of Nature, ist Partner des Weltwirtschaftsforums für Ozeanaktivitäten und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses des UN-Umweltprogramms zur Bewertung von Meeresmüll und Mikroplastik. Zwei Vorstandsmitglieder geben einen weiteren Eindruck der Unternehmenspolitik von Fortescue:
• Lord Sebastian Coe, britisch geadelt als Companion of Honor, Knight Commander of the British Empire, nicht-geschäftsführender Direktor, ist ein ehemaliger Abgeordneter (1992) und nicht-geschäftsführender Direktor der Vitality-Gruppe von Krankenund Lebensversicherungsunternehmen.
• Yifei Li, nicht-geschäftsführende Direktorin, ist Präsidentin der QiBin-Stiftung und sitzt derzeit im Vorstand von BlackRock China (Hedgefonds) und ist ein Global Trustee der Rockefeller-Stiftung.
Diese Kontrolle über Fortescue sowie die umfangreichen Aktivitäten und Treffen des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair und des Blair-Instituts in mehreren afrikanischen Ländern verdeutlichen die imperialistischen Interessen der anglo-amerikanischen Oligarchie und ihrer finanziellen Tentakel, denen sich afrikanische Führer ausgesetzt sehen, die es wagen, die wirklichen Interessen ihrer Bevölkerung zu verteidigen. Auf einer Bloomberg-Konferenz in Marokko Anfang 2023 sagte Forrest zu „Grand Inga“: „Wir haben die [geplante Strom-]Erzeugung gedrosselt [halbiert – Anm. d. Red.], um sicherzustellen, daß die Umwelt
vollständig geschützt ist.“ Noch schlimmer ist, daß ein erheblicher Teil der Energieproduktion des Projekts zukünftig in die Herstellung von „grünem“ Wasserstoff für den Export fließen solle, so daß nur 12 Gigawatt für die Afrikaner selbst übrig blieben. Möglicherweise als Folge dieser und anderer Komplikationen ist das GIWK in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Anfang Juli 2023 trafen sich jedoch die Präsidenten Südafrikas und Kongos bekannten sich erneut zum GIWK. Es soll eine neue Kommission eingerichtet werden, die sich mit den nächsten erforderlichen Schritten befasst. Auf der Pressekonferenz im Anschluß an das Treffen rückte Félix Tshisekedi, der Präsident der DRK, auch deutlich von Fortescue ab, indem er sagte, daß Forrest nicht die Bedingungen erfüllt habe, die erwartet wurden. Stattdessen bestand er darauf, daß mehr internationale Partner, vor allem afrikanische, einbezogen werden sollten. Nach Darstellung Tshisekedis habe auch die Weltbank erneut Interesse an dem Projekt bekundet, ebenso der chinesische Präsident Xi Jinping in einem Gespräch, das beide vor kurzem führten.
Immer wieder hat es gegen das GIWK die üblichen kurzsichtigen Proteste über „Umweltschäden“, „Vertreibung vieler Menschen“ oder „zu teuer“ gegeben, die seinen Fortschritt behinderten. Derartige Argumente sind jedoch häufig dem Bau großer Staudämme oder Wasserkraftprojekte vorausgegangen, wobei die behaupteten „negativen Auswirkungen“ nur selten in der von den Protestierenden befürchteten Form eingetreten sind. Mit der verstärkten Unterstützung durch den BRICS-Gipfel vom August 2023 in Südafrika besteht die Möglichkeit, daß das GIWK jetzt ohne weitere Verzögerungen vorankommt. Der Bedarf an Energieerzeugung ist groß: Derzeit haben nur 42 Prozent der Bevölkerung des gesamten afrikanischen Kontinents mit etwa 1,5 Milliarden Menschen Zugang zu Elektrizität. Man braucht sich nur eine Karte Afrikas anzusehen und sich vorzustellen, wie in nicht allzu ferner Zukunft das GIWK, der „Grand Ethiopian Renaissance“-Staudamm in Äthiopien, das „Transaqua“-Projekt in Zentralafrika und andere geplante Infrastrukturprojekte zusammenwirken werden, um nicht nur mächtige Flußläufe zu zähmen und Wüsten zu begrünen, sondern auch Hunderte neuer Städte zu beleuchten und das Leben der 650 Millionen jungen Afrikaner zu verbessern.
Der folgende Artikel basiert auf einem Vortrag des Autors, den dieser auf einem Seminar des Schiller-Instituts mit dem Titel „Wasser für den Frieden“ am 9. Januar 2024 in Paris gehalten hat.
Dieersten wasserwirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen werden mit der Jungsteinzeit in Verbindung gebracht, die um 10.000 v. Chr. begann, während der Hund bereits 15.000 v. Chr. domestiziert wurde. Man geht davon aus, daß in dieser Zeit der Übergang von der Subsistenzwirtschaft der Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht stattfand und Dörfer und Städte entstanden, in denen Töpferei, Weberei, Metallurgie und Kunst zu blühen begannen. Der Schlüssel dazu war die Domestizierung von Tieren. Die Ziege wurde um 11.000 v. Chr. domestiziert, die Kuh um 9.000 v. Chr., das Schaf um 8000 v. Chr. und schließlich das Pferd um 2200 v. Chr. in den Steppen der Ukraine. Die ältesten archäologischen Stätten, die landwirtschaftliche Aktivitäten belegen, wurden im Industal und im sogenannten „fruchtbaren Halbmond“1 entdeckt.
Wiki, D. Bagault, C2RMF

Das Amulett von Mehrgarh ist der älteste per Wachsmodell gefertigte Metallguß.
1 Das besonders fruchtbare Gebiet in Südwestasien und im Nilbecken, in dem heute Ägypten, Israel, Jordanien, der Süden der Türkei, Kurdistan, Libanon, Syrien, Zypern, der Irak und der westliche Iran liegen, und das die Form eines Halbmondes bildet.
Die 1974 von den französischen Archäologen François und Cathérine Jarrige entdeckte „Stätte von Mehrgarh“ im Industal, im heutigen pakistanischen Belutschistan, zeugt von bedeutenden landwirtschaftlichen Praktiken ab 7000 v. Chr. Dort wurden zu dieser Zeit bereits Baumwolle, Weizen und Gerste angebaut und Bier gebraut. Rinder, Schafe und Ziegen wurden gezüchtet, aber Mehrgarh war noch viel mehr. Im Gegensatz zu dem üblichen linearen „Entwicklungsschema“ – denn wir befinden uns mitten im Neolithikum – ist Mehrgarh auch der Ort der ältesten Töpferei Südasiens und vor allem des „Amuletts von Mehrgarh“, des ältesten im Wachsausschmelzverfahren gegossenen Bronzeobjekts. Auch die ersten mit geometrischen Motiven verzierten Siegel aus Ton oder Knochen wurden hier gefunden. Was die Technik anbelangt, so wurden dabei winzige Bogenbohrer verwendet, die möglicherweise auch zur Zahnbehandlung verwendet wurden, wie durchbohrte Zähne an einigen Skeletten belegen, die an dort gefunden wurden. Jg. 45, 2024, Nr. 1
Zur gleichen Zeit oder kurz danach, um 6000 v. Chr., erlebte Mesopotamien zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris eine rasante Entwicklung des Städtebaus, was sich in Demographie, Institutionen, Landwirtschaft, Technik und Handel ausdrückte. In der Region entstand ein regelrechter „Fruchtbarer Halbmond“, der sich von Sumer über ganz Mesopotamien und die Levante, d. h. Syrien und das Jordantal, bis nach Ägypten erstreckte.
Ort auf der Welt, an dem die Arbeit am wenigsten beschwerlich war. Über Ägypten schreibt er:
„Das Erdreich… ist schwarz, tiefgründig und schlammig, weil es aus Schlick und Bodensatz besteht, den der Fluß zu Tal geführt hat… Jetzt freilich ernten sie dort die Früchte ihres Landes mit weniger Mühe als alle andere Völker und die übrigen Ägypter. Sie brauchen sich nicht damit zu quälen, das Land zu pflügen und zu behacken, und haben nicht nötig, ihre Felder wie andere Leute mühsam zu bestellen, sondern der Fluß kommt von selbst und bewässert sie. Hinterher, wenn er wieder zurücktritt, besät dann jeder sein Stück Land, treibt die Schweine darauf, und wenn die Schweine die Saat eingetreten haben, wartet er die Ernte ab.“2
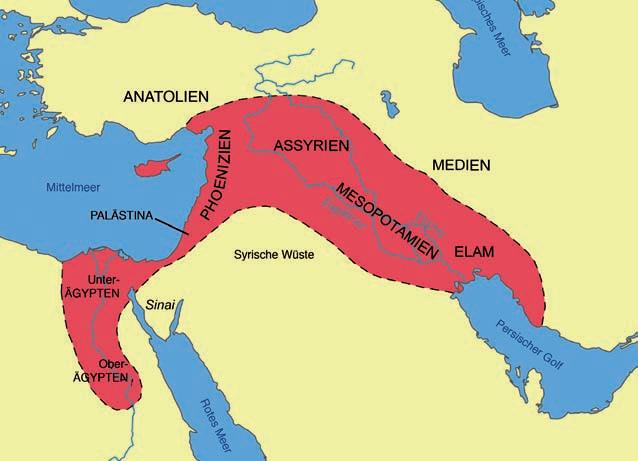
Ob im Industal, in Mesopotamien oder in Ägypten, die frühesten Bewässerungstechniken bestanden darin, Wasser zu sammeln, wenn Mutter Natur es den Menschen schenkte. Regenwasser wurde in Zisternen gesammelt, und wenn Schneeschmelze oder Monsunregen die Flüsse anschwellen ließen, galt es, die saisonalen „Überschwemmungen“ durch Kanäle und Gräben, die das Wasser so weit wie möglich ableiteten, zu verstärken und zu steuern und gleichzeitig die Ernten zu schützen. Hinzu kommt, daß beispielsweise in Ägypten, wo der Nil regelmäßig um etwa 8 Meter anstieg, das Wasser nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch fruchtbaren Schlamm in den Boden in Flußnähe bringt, der die Pflanzen mit den für ihr Wachstum notwendigen Nährstoffen versorgt und so die Fruchtbarkeit des Bodens erhält. Während die Ägypter über die harte Arbeit der Bauern klagten, war das Land für den griechischen Geschichtsschreiber und Weltreisenden Herodot der
In Mehrgarh, wo die Landwirtschaft bereits um 7000 v. Chr. entstand, war die Arbeit komplexer. Das Entwässerungssystem rund um das Dorf und die Überreste von Dämmen zur Verhinderung von Staunässe zeigen, daß die Bewohner die damit verbundenen Prinzipien verstanden. Der Anbau von Baumwolle, Weizen und Gerste sowie die Domestizierung von Tieren zeigen, daß sie auch mit Kanälen und Bewässerungssystemen vertraut waren. Diese ständig weiterentwickelten Kenntnisse ermöglichten es der Zivilisation im Industal, große Städte zu errichten, die durch ihre Modernität beeindrucken, allen voran Harappa und Mohenjo Daro, eine Stadt mit 40.000 Einwohnern, in deren Zentrum kein Palast, sondern ein öffentliches Bad stand. Diese Städte waren Pioniere der modernen Hygiene: Sie waren mit kleinen Behältern ausgestattet, in denen die Einwohner ihre Haushaltsabfälle entsorgen konnten. Viele Städte verfügten über eine öffentliche Wasserversorgung und ein ausgeklügeltes Abwassersystem, das unsere Komplettkanalisation vorwegnahm, wie sie Leonardo da Vinci im 16. Jahrhundert vorschwebte In der Hafenstadt Lothal (heute Indien) zum Beispiel hatten viele Häuser private Bäder und Latrinen aus
2 Aus: „Das Geschichtswerk des Herodotos von Halikarnassos“, Insel-Verlag, 1956, S. 126 f.

1. Darstellung eines Schaduffs: Eine Hebemaschine, hauptsächlich zur Bewässerung in Mesopotamien erfunden; 2. Archimedische Schraube auf einem pädagogischen Kinderspielplatz bei der Landesgartenschau in Bad Gandersheim 2023; 3. Persisches Wasserrad, verwendet für die Bewässerung im Nilgebiet; 4. Die Norias von Hama, historische Wasserhebeanlagen für die Bewässerung, entlang des Flusses Orontes in der Stadt Hama, Syrien.
Ziegelsteinen. Die Abwässer wurden über ein kommunales Abwassersystem entsorgt, das entweder in einen Kanal im Hafen oder in eine Sickergrube außerhalb der Stadtmauern führte, oder in vergrabene Gefäße, die mit einem Abflußloch versehen waren und regelmäßig geleert und gereinigt wurden. Die Ausgrabungen in Mohenjo Daro belegen die Existenz von nicht weniger als 700 gemauerten Brunnen, Häusern mit Bädern sowie einzelnen und gemeinschaftlichen Latrinen. Viele Gebäude der Stadt hatten zwei oder mehr Stockwerke.
Das Wasser, das aus den Zisternen auf den Dächern abfloß, wurde durch geschlossene Tonrohre oder offene Rinnen geleitet, die in überdachte Abwasserkanäle unter der Straße mündeten. Dieses wassertechnische und sanitäre Wissen wurde an die Zivilisation von Kreta weitergegeben, der Mutter Griechenlands, bevor es von den Römern in großem Maßstab umgesetzt wurde. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches geriet das Wissen in Vergessenheit, bis es in der Renaissance wieder aufgegriffen wurde.
Die ersten wasserwirtschaftlichen Anwendungen des Menschen hatten das Ziel, Wasserreservoire einzurichten und deren Fließfähigkeit zu verbessern. Um dies zu erreichen, war es notwendig, Wasser aus der Ebene in höher gelegene Gebiete zu leiten und „Wassertürme“ zu bauen. Zu diesem Zweck war der mesopotamische „Schaduff“ in Ägypten weit verbreitet, später gefolgt von der archimedischen Schraube. Als nächstes kam die „Saqiyah“ oder das „Persische Rad“, ein durch Tierkraft angetriebenes Zahnrad, und schließlich die „Noria“, die bekannteste Wasserschöpfmaschine, die vom Fluß selbst angetrieben wurde. Vor der Ankunft Alexanders des Großen entwickelte bereits das Achämenidenreich in Persien (6. Jahrhundert v. Chr.) die Technik der unterirdischen Qanats oder unterirdischen Aquädukte. Diese in den Fels gehauenen oder von Menschenhand errichteten „Entwässerungsstollen“ sind eine der genialsten Erfindungen zur Bewässerung in trockenen und halbtrokkenen Regionen. Auch wenn sich unsere Umweltschützer daran stören mögen, es ist nicht die Natur, die auf magische Weise „Oasen“ in der Wüste hervorbringt. Es ist ein wissenschaftlich denkender Mensch, der einen Entwässerungsstollen gräbt, um das bodennahe Grundwasser abzuleiten, manchmal auch aus einem Flußbett, das in der Wüste endet. Auf der Webseite von ArchéOrient erläutert der Archäologe und Iran-Spezialist Rémy Boucharlat, emeritierter Forschungsdirektor des CNRS, die Planung eines Qanats:


spiegels, der anzeigt, wie tief der Stollen gegraben werden muß.
„Unabhängig von der Herkunft des Wassers, ob tief oder flach, ist die Technik für den Bau des Stollens die gleiche. Zunächst muß das Vorhandensein von Wasser festgestellt werden, entweder ein Unterlauf in der Nähe eines Flusses oder ein tieferer Grundwasserspiegel in einem Vorgebirge, was die Wissenschaft und Erfahrung von Spezialisten erfordert. Ein Mutterbrunnen erreicht den oberen Teil der Wasserschicht oder des Wasser-
Das Gefälle des Stollens darf nur sehr gering sein, weniger als 2 Promille, um einen ruhigen und gleichmäßigen Wasserfluß zu gewährleisten und um das Wasser allmählich an die Oberfläche zu bringen, mit einem Gefälle, das weit unter dem des Vorgebirges liegt. Der Stollen wird dann gegraben, nicht vom Mutterbrunnen her, da dieser die Grabung sofort fluten würde, sondern vom Tal her, also vom Ankunftspunkt aus. Der Schacht wird zuerst in einem offenen Graben, dann in einem überdachten Graben und schließlich in einem Tunnel in den Boden getrieben. Für den Abtransport des Erdreichs und die Belüftung während des Vortriebs sowie zur Bestimmung der Richtung des Tunnels werden von der Oberfläche
aus in regelmäßigen Abständen Schächte zwischen 5 und 30 Metern je nach Bodenbeschaffenheit gegraben.“
Historisch gesehen war die Mehrheit der Bevölkerung im Iran und in anderen trockenen Regionen Asiens und Nordafrikas auf die Wasserversorgung durch Qanats angewiesen; die Siedlungsgebiete entsprachen daher den Orten, an denen ihr Bau möglich war. Die Technik bietet einen entscheidenden Vorteil: Da das Wasser durch eine unterirdische Leitung fließt, geht kein Tropfen Wasser durch Verdunstung verloren. Diese Technik verbreitete sich auf der ganzen Welt, allerdings unter verschiedenen Namen: Sie heißt „Qanat“ und „Kareez“ in Iran, Syrien und Ägypten, „Kariz“ oder „Kehriz“ in Pakistan und Afghanistan, „Aflaj“ in Oman, „Galeria“ in Spanien, „Kahn“ in Belutschistan, „Kanerjing“ in China, „Foggara“ in Nordafrika, „Khettara“ in Marokko, „Ngruttati“ in Sizilien und „Bottini“ in Siena. Von den Griechen verbessert, von den Etruskern und Römern weiterentwickelt, wurde die Qanat-Technik von den Spaniern über den Atlantik in die Neue Welt gebracht, wo in Peru, Chile und im Westen Mexikos noch heute zahlreiche unterirdische Kanäle dieser Art in Betrieb sind. Nach Alexander dem Großen war Baktrien, das Teile des heutigen Usbekistans, Turkmenistans und Nordafghanistans umfaßte, sogar als „Oasenkultur“ oder „Land der 1000 goldenen Städte“ bekannt. Noch heute beträgt die Gesamtlänge der 30.000 (heute potentiell nutzbaren) Qanat-Systeme im Iran ca. 310.800 km, was bei einer durchschnittlichen Länge von 6 km pro Qanat etwa dem 7,7-fachen Erdumfang entspricht!
Im Jahr 1017 lieferte der Bagdader Hydrologe Mohammed Al-Karadschi eine detaillierte Beschreibung der Bau- und Instandhaltungstechniken der Qanate sowie rechtliche Überlegungen zur gemeinschaftlichen Verwaltung der Brunnen und Leitungen. Jedes Qanat wird zwar von einem „Mirab“ (Wünschelrutengänger, Entdecker) geplant und überwacht, doch der Bau eines Qanats ist eine kollektive Aufgabe, die für Monate oder gar Jahre ein Dorf oder sogar mehrere Dörfer in Anspruch nimmt. Die Unumgänglichkeit gemeinschaftlicher Investitionen in die Infrastruktur und ihre Instandhaltung erforderte eine übergeordnete Vorstellung von Gemeinwohl, das dem Konzept von Privateigentum entgegenstand, an das sich Niederschläge und Flüsse nunmal nicht zu halten pflegen. In Nordafrika wurde die Verteilung des Wassers aus einer Khettara (die dortige Bezeichnung für Qanat) durch traditionelle Richtlinien geregelt, die auch als „Wasserrechte“ bekannt sind. Ursprünglich entsprach die jedem Nutzer zugeteilte Wassermenge seinem Arbeitsanteil beim Bau der Khettara und wurde in die Bewässerungsperiode umgerechnet, in der der Begünstigte die gesamte Wassermenge der Khettara für seine Felder nutzen konnte. Auch heute noch, wenn die Khettara nicht ausgetrocknet ist, gelten diese Regelungen der Wasserrechte. Auch die Größe der zu bewässernden Felder der einzelnen Familien wird dabei berücksichtigt. All dies zeigt, daß die Natur Wunder vollbringen kann, wenn Mensch und Natur gut zusammenarbeiten.
Anmerkung der Redaktion: LaRouches ursprüngliches Papier Über die Grundsätze der Erstellung von Machbarkeitsstudien für große Infrastrukturprogramme, das dem vorliegenden Artikel zugrundeliegt, entstand am 10. August 1986 als Dokument zur privaten Verbreitung und erscheint jetzt zum ersten Mal leicht gekürzt in deutscher Übersetzung.
Dieheute weithin akzeptierten Bilanzierungsmethoden zur Berechnung der Rentabilität von Großprojekten der wirtschaftlichen Basisinfrastruktur sind grundsätzlich irreführend. Auf den ersten Blick sind die verwendeten Methoden aufgrund von zwei fatalen Annahmen fehlerhaft: 1. Die grundfalsche Annahme, daß nationale Infrastrukturprojekte in allen wesentlichen Aspekten durch internationale Finanzkonsortien finanziert werden müssen, und zwar auf der Grundlage der vorherrschenden Handelsbedingungen und Kreditvergabepraktiken. 2. Die grundfalsche Annahme, daß die Rentabilität solcher Projekte auf den erwarteten Einnahmen aus dem Projekt selbst beruhen muß. Jede buchhalterische Projektion, die explizit oder auch nur implizit auf solchen falschen Annahmen beruht, ergibt ein völlig falsches Bild der Investition.
Die offensichtlichsten Fehler, die mit solchen falschen Annahmen einhergehen, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Bei jedem gut durchdachten Infrastrukturprogramm stellen ausländische Lieferanten bestenfalls eine bedeutende Minderheit der insgesamt eingesetzten Materialien, Lieferungen, Ausrüstungen und Ingenieurleistungen dar. Der überwiegende Teil der Baukosten entfällt auf inländische Arbeitskräfte
und Materialien. Es werden inländische Ressourcen mobilisiert, deren Potential sonst ungenutzt bliebe. Der inländische Beitrag sollte niemals durch ausländische Konsortien finanziert werden. Die ausländische Beteiligung an großen Infrastrukturprogrammen sollte in Form eines bewußten „Technologietransfers“ erfolgen. Ein Element dieses „Technologietransfers“ ist, daß das Land zunehmend die Verantwortung für den Bau übernehmen muß. Ausländische Finanzierungen müssen während der Betriebsdauer des fertiggestellten Bauwerks schrittweise abgebaut werden; ausländische Beteiligungen sollten auf Minderheitsbeteiligungen oder Anleihen mit fester Laufzeit reduziert werden. Die Prognose der „Rentabilität“ eines Infrastrukturprojekts ist vergleichbar mit der Rentabilitätsprognose für das Fundament eines noch nicht fertiggestellten Gebäudes. Der Beitrag des Fundaments zur Rentabilität besteht ausschließlich in der Rentabilität des fertiggestellten und genutzten Gebäudes. Ist das genutzte Gebäude insgesamt rentabel, so ist auch der Bau des Fundaments rentabel. Wenn dies nicht der Fall ist, ist der Versuch, die Rentabilität des Fundaments zu schätzen, nicht nur sinnlos, sondern auch falsch. Dieses Memorandum untersucht, wie der berechenbare Beitrag
Jg. 45, 2024, Nr. 1
von Infrastruktur zur Ökonomie wirtschaftswissenschaftlich analysiert wird, und definiert die Buchhaltungsmethoden, die in kompetenten Machbarkeitsstudien angewendet werden sollten.
Um die relevanten Grundfehler der modernen Buchhaltungspraxis in dem Maße zu verstehen, wie es das Thema dieses Memorandums erfordert, ist es unerläßlich, eine strenge Definition der korrekten Bedeutung von „Wirtschaftswissenschaft“ zu geben. Die Fehler in der heutigen professionellen Rechnungslegung und Wirtschaftswissenschaft sind in erster Linie darauf zurückzuführen, daß es während der letzten hundert Jahre an den führenden Universitäten Europas und Nordamerikas keinen regulären Studiengang in Wirtschaftswissenschaften mehr gegeben hat, obgleich die Wirtschaftswissenschaft eigentlich in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde.
Die daraus resultierende Unkenntnis der Fachleute selbst vom „ABC“ der Wirtschaftswissenschaften führt dazu, daß die heute übliche Praxis voller schwerwiegender Fehler ist, die auf der schlichten Unkenntnis elementarer Grundsätze beruhen. Die beiden erwähnten Fehler in den Machbarkeitsstudien für Infrastrukturprogramme sind typisch für diese stümperhafte Inkompetenz, die heute unter Fachleuten weit verbreitet ist.
der Erdoberfläche, um sich zu ernähren. Die Existenzbedingungen waren äußerst prekär, und die Menschheit lebte in einem erbärmlichen Zustand, mit einer Lebenserwartung von deutlich unter zwanzig Jahren.
Heute leben schätzungsweise fünf Milliarden Menschen auf der Erde; bei voller Nutzung der vorhandenen Technologien könnte unser Planet zwei- bis dreimal so viele Menschen ernähren, und zwar auf einem Lebensstandard, der mit dem der entwickelten Länder Westeuropas und Nordamerikas Anfang der 1970er Jahre vergleichbar wäre. Diese Vertausendfachung der potentiellen Bevölkerungsdichte der Menschheit ist ausschließlich das Ergebnis einer Kombination voneinander abhängiger kultureller Fortschritte, deren auffälligstes Merkmal das ist, was wir als „energie- und kapitalintensiven technologischen Fortschritt“ bezeichnen. Die Wirtschaftswissenschaft ist ein Zweig der modernen Naturwissenschaft, mit der sich bestimmen läßt, mit welcher Politik die Nationen die potentielle

Die europäische Wirtschaftswissenschaft entstand aus der Zusammenarbeit zwischen Georgios Gemistos Plethon (links) und Cosimo di Medici (rechts) in der Mitte des 15. Jahrhunderts.
Bevölkerungsdichte der Menschheit erhalten und erhöhen können.
Die Wirtschaftswissenschaft beginnt mit der elementarsten Tatsache der geschichtlichen Existenz des Menschen. Der „primitive Mensch“, der von dem lebte, was die Ethnologen „Jagen und Sammeln“ nennen, benötigte im Durchschnitt etwa zehn Quadratkilometer
Grundlage der Wirtschaftswissenschaft ist ein Zweig der Naturwissenschaften, den die Ökonomen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts als „physische Ökonomie“ oder im Französischen als „polytechnique“ bezeichneten. In der Wirtschaftswissenschaft werden Fragen der Kredit-, Schulden-, Steuer- und Bankenpolitik als Nebenaspekte der „physischen Ökonomie“ behandelt. Die
Verbindung der physischen Ökonomie mit Fragen der Kredit-, Schulden-, Steuer- und Bankenpolitik wird als „politische Ökonomie“ bezeichnet.
Die europäische Wirtschaftswissenschaft entstand aus der Zusammenarbeit zwischen dem großen Cosimo de Medici von Florenz und seinem Berater Georgios Gemistos (Plethon) in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Leonardo da Vinci war es vor allem, der die Grundlagen der Technik entwickelte. Ausgehend von den Arbeiten da Vincis wurde das Studium der politischen Ökonomie bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts unter dem Begriff „Kameralistik“ weitergeführt, womit man die Kunst und Wissenschaft der Staatsführung bezeichnet.
Die Umwandlung der Kameralistik in eine Wirtschaftswissenschaft wurde von Gottfried Wilhelm Leibniz in seinen Arbeiten zwischen 1672 und 1716 vollzogen. Leibniz konzipierte die „industrielle Revolution“ (die Entwicklung von Wärmekraftmaschinen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität) und gab dem Begriff „Technologie“ erstmals eine physikalisch-naturwissenschaftliche Bedeutung.
is Auguste] Ferrier [1777–1861] und [Charles] Dupin [1784–1873] in die Arbeiten der führenden amerikanischen Ökonomen um Mathew Carey ein.
Die entscheidenden Personen bei der Verschmelzung dieser beiden Zweige der Leibnizschen Wirtschaftswissenschaft waren Gilbert Marquis de Lafayette und der von ihm geförderte deutsche Ökonom Friedrich List. Im 19. Jahrhundert war die Wirtschaftswissenschaft international vor allem unter dem Namen „Das Amerikanische System von Hamilton, Carey und List“ bekannt.

Leibniz war nicht nur der führende Wissenschaftler des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts. In den letzten Jahrzehnten seines Lebens war er die zentrale Figur eines internationalen konspirativen Netzwerks mit Zentren in Deutschland, Frankreich und Italien und Ablegern bis zu den Gegnern Marlboroughs (Churchills) in Großbritannien und den englischen Kolonien in Nordamerika. Durch diese politischen Verbindungen zu Verbündeten wie den Amerikanern Cotton Mather und Benjamin Franklin wurde Leibniz‘ Wirtschaftswissenschaft zu einem zentralen Bestandteil dessen, was Finanzminister Alexander Hamilton als erster „das Amerikanische System der politischen Ökonomie“ nannte. Nach dem zweiten Sieg der USA über Großbritannien im Krieg von 1812–1815 flossen die Arbeiten französischer Ökonomen wie [Jean] Chaptal [1756–1832], [François Lou-
Gottfried Wilhelm Leibniz (im Bild eine Statue des Bildhauers Patrick MacDowell in London) war der erste, der dem Begriff „Technologie“ eine physikalisch-naturwissenschaftliche Bedeutung gab.
Eine Gruppierung, die sich in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Venedig gegen die Amerikanische Revolution stellte, entwickelte eine Gegenlehre der politischen Ökonomie, die vor allem aus den Kreisen der adeligen RentierFinanziers von Venedig und den Schweizer Bankinteressen kam, die sich in Genf und Lausanne konzentrierten. Schweizer Bankkreise führten die physiokratische Lehre in Frankreich ein. Dieselben Schweizer Kreise verbreiteten die gegen Leibniz gerichteten Dogmen auch unter den führenden Mitgliedern der britischen Ostindienkompanie wie David Hume und Adam Smith. Daraus entstand die sogenannte „Britische Politische Ökonomie“, die ihren Ursprung in dem Schulungszentrum der Britischen Ostindienkompanie in Haileybury hatte. Adam Smith, Jeremy Bentham, Thomas Malthus, David Ricardo, James Mill, John Stuart Mill, [William Stanley] Jevons und [Alfred] Marshall sind beispielhafte Produkte der Haileybury-Fraktion der Britischen Ostindienkompanie in der politischen Ökonomie.
Mit den Ereignissen der 1870er Jahre, in deren Mittelpunkt der Berliner Vertrag von 1878 stand, erlangte ein Konsortium von Rentier-Finanzinteressen, in dessen Zentrum das venezianische, das schweizerische und das britische Finanzkartell standen, die Weltherrschaft in internationalen Währungsfragen. Der britische Goldstandard vor 1919, die Währungsordnung von

Die Werke von Leibniz gelangten durch Benjamin Franklin (links) und Henry C. Carey (mittig) in die englischen Kolonien Amerikas. Der von General Lafayette geförderte deutsche Ökonom Friedrich List (1789–1846, rechts) veröffentlichte während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten sein Werk „Outlines of American Political Economy“ (Grundzüge der amerikanischen politischen Ökonomie) und brachte Leibniz‘ Wirtschaftswissenschaft nach Deutschland zurück.
Versailles und das Währungssystem von Bretton Woods sind eine Fortsetzung dieser Vorherrschaft von RentierFinanzierkartellen im Umkreis des venezianisch-triestrischen und schweizerischen Rückversicherungskartells.
In den letzten hundert Jahren haben diese RentierFinanziers nicht nur das Weltfinanzwesen und den Welthandel beherrscht, sondern auch die ideologische Kontrolle über die führenden Elemente der politischen Parteien, Universitäten usw. erlangt. Ein Ergebnis dieses anhaltenden Einflusses ist die Verdrängung aller wichtigen Merkmale der Wirtschaftswissenschaft aus den Berufen des Rechnungswesens und der Ökonomie.
Nahezu die gesamte professionelle Wirtschafts- und Buchhaltungspraxis beruht auf bestimmten axiomatischen Annahmen. In der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre sind diese Annahmen explizit. In der Praxis der Rechnungslegung werden dieselben Annahmen weniger offen diskutiert, sind aber implizit und wirksam. Diese Annahmen basieren auf der axiomatischen Annahme, daß die Vorherrschaft des internationalen Finanz- und Handelssystems durch das Kartell des „antiamerikanischen Systems“ von Venedig und der Schweiz, das sich auf die Interessen der Rentiers und Finanziers konzentriert, fortbesteht.
Diese axiomatischen Annahmen spiegeln den Umstand wider, daß die nationalen Bankensysteme der Nationen den Interessen der privaten Rentier-Finanziers untergeordnet sind und durch internationale Währungs- und Bankenabkommen reguliert werden. Die
internen Mechanismen von Kredit, Verschuldung, Geldemission, Steuern und Banken der einzelnen Nationen werden Regeln unterworfen, die mit den besonderen Interessen der internationalen Rentier-Finanziers übereinstimmen.
Daraus folgt auch, daß eine Wiederbelebung sogenannter „merkantilistischer“ Formen nationaler Geldund Bankpolitik nicht geduldet wird. Eine Wirtschaft kann nicht so funktionieren, wie es die Wirtschaftswissenschaft fordert, wenn die Kredit-, Schulden-, Steuerund Bankenpolitik der Nation nicht dem Erfordernis untergeordnet wird, die „merkantilistischen“ Ziele des technischen Fortschritts zu fördern.
Solange renditeorientierte und geldorientierte Institutionen die Austauschprozesse innerhalb und zwischen den Nationen beherrschen, ist eine gesunde Wirtschaftspolitik in der Praxis mehr oder weniger verboten. Für den professionellen Ökonomen oder Buchhalter ist eine solide Wirtschaftspolitik daher ein großes Ärgernis, um das man einen großen Bogen machen sollte.
Dieses Arrangement ist äußerst unpraktisch. Für jeden Patrioten in den sogenannten „Entwicklungsländern“ sind die Regeln, die durch den Berliner Vertrag von 1878 international in Kraft gesetzt wurden, unerträglich. Sie werden oft als „Kolonialismus“ oder „Neokolonialismus“ bezeichnet oder einfach als eine mehr oder weniger mörderische Politik der Ausplünderung der Schwächeren durch die Stärkeren. Auch für die stärkeren Nationen sind sie eine Katastrophe, auch
wenn dies nur periodisch deutlich wird, wenn neue Währungskrisen wie die von 1931–1932 oder die gegenwärtige diese Konsequenz auf die unangenehmste Weise demonstrieren.
Die Untersuchung der internationalen Währungspolitik seit 1946 aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ermöglicht es, sowohl die verheerenden Auswirkungen von Bretton Woods auf die sich entwickelnden Volkswirtschaften als auch den endgültigen Ausbruch eines erneuten Zusammenbruchs der internationalen Währungsordnung selbst vorherzusagen. Aus Sicht des typischen professionellen Ökonomen oder Buchhalters von heute ist die Wahrheit nicht so leicht vorherzusagen. Solche Fachleute „sehen“ das unvermeidliche Scheitern einer solchen Währungsordnung erst dann, wenn der Zusammenbruch bereits eingetreten ist. Da sich der Zusammenbruch einer solchen Geldordnung über eine oder zwei Generationen hinzieht, haben solche Experten etwa zwei Generationen Zeit, um ihr absolutes Vertrauen in die ewigen Wahrheiten ihrer RentierDogmen zu kultivieren; der Moment, in dem sie selbst arbeitslos werden, wäre der Zeitpunkt, wo sie anfangen könnten, einen kleinen Fehler in dem Monetarismus zu vermuten, den sie so lange bewundert haben.
Es gibt also zwei Fragen, die den Fachmann davon abhalten sollten, sofort seinen Bleistift zu zücken, um die Machbarkeit eines vorgeschlagenen Infrastrukturprogramms zu beurteilen. Er sollte zuerst die finanziellen Ergebnisse für die nächsten zehn Jahre prognostizieren: Wird das Finanzsystem, das seinen Berechnungen zugrunde liegt, tatsächlich noch zehn Jahre Bestand haben? Er sollte die Auswirkungen des Projekts auf das betroffene Land prognostizieren: Wird es dieses Land in seiner jetzigen Form noch in zehn Jahre geben? Aber der Experte schiebt solche beunruhigenden Fragen beiseite: „Ich gehe davon aus, daß die bestehende Ordnung auf mehr oder weniger unbestimmte Zeit bestehen bleibt“, sagt er zu sich selbst und setzt den Bleistift an, um ihn über das Papier gleiten zu lassen. Seine Kreise ziehen es vor, die Tatsache zu ignorieren, daß das gegenwärtige internationale Währungssystem wahrscheinlich früher als später in den nächsten zwölf Monaten zusammenbrechen wird, in einer Krise, die der von 1931–1932 ähnelt, aber viel schlimmer ist.
Solche Experten handeln wie ein Architekt, der am Vorabend eines großen Erdbebens ein Gebäude baut und bei der Planung davon ausgeht, daß es kein Erdbeben geben wird. Das finanzielle „Erdbeben“ steht unmittelbar bevor, mit einer Stärke zwischen 8 und 10 auf der Richterskala. Professionelle Machbarkeitsstudien,
die auf den heute allgemein akzeptierten fachlichen Annahmen beruhen, sind die Mühe nicht wert.
Die Tatsache, daß das gegenwärtige internationale Finanzsystem dazu verdammt ist, in naher Zukunft zu verschwinden, sollte der wichtigste Umstand sein, der in jeder Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden muß. Projekte müssen im Hinblick auf die Bedingungen bewertet werden, die ein solcher Zusammenbruch des bestehenden Finanzsystems mit sich bringen würde. Die Durchführbarkeit eines Projekts ist sein Wert unter den Bedingungen, wenn die bestehende Finanzordnung zusammenbricht. Was sind diese Bedingungen? Alle möglichen Ergebnisse sind denkbar. Wir sollten uns jedoch auf die Bedingungen beschränken, die vernünftige Regierungen schaffen werden, um ihre Nationen vor den Auswirkungen eines allgemeinen Währungszusammenbruchs zu schützen. Wir müssen diese vernünftigen Alternativen definieren und das Projekt danach beurteilen, wie es zum Erfolg dieser Alternativen beitragen kann. Wird das Projekt unter diesen Bedingungen einen wesentlichen Nutzen für die Nation bringen? Welchen wichtigen Beitrag wird es unter diesen Bedingungen leisten? Keine andere Art der Machbarkeitsbewertung wäre vernünftig.
In den letzten vierzig Jahren und darüber hinaus hätte die Wirtschaftspolitik der Regierungen immer von den wirtschaftswissenschaftlichen Prinzipien bestimmt werden sollen, die mit den Arbeiten von Leibniz und dem Amerikanischen System verbunden sind. In der Vergangenheit haben die Nationen einen hohen Preis für die Vernachlässigung dieser Prinzipien in Form einer schlechteren Wirtschaftsleistung bezahlt, aber die meisten dieser Nationen haben überlebt, obwohl sie sich nicht an diese Prinzipien gehalten haben. Jetzt, am Rande einer Krise, die schlimmer ist als die von 1931–1932, müssen die Nationen zwischen einem absoluten Desaster und der Orientierung an den Prinzipien des Amerikanischen Systems wählen. Der wesentliche Unterschied zwischen den vergangenen vierzig Jahren und heute besteht darin, daß die Weltwirtschaft von der Realität der politischen Fehler der Vergangenheit eingeholt wurde. Heute sind die einzigen Wirtschaftsprogramme, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden, Programme, deren mittelfristige Funktion in erster Linie darin besteht, die zerrüttete Weltwirtschaft wieder aufzubauen. Jede Machbarkeitsstudie, die nicht von diesem Gesichtspunkt ausgeht, ist völlig nutzlos oder noch schlimmer.
Die internationale Verschuldung beträgt heute mehr als 10 Billionen US-Dollar. Davon entfallen mindestens 3 Billionen US-Dollar auf „außerbilanzielle Kredite“; seit 1982 haben sich etwa 1,2 Billionen US-Dollar dieser außerbilanziellen Kredite im amerikanischen Bankensystem angesammelt. Die nominalen Vermögenswerte des Bankensystems werden durch den Zusammenbruch der Produktion, der Landwirtschaft und der Immobilienwerte aufgezehrt. Die Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer ist schon seit 1982 notleidend, aber die Maßnahmen des IWF haben die Situation so verschärft, daß die fragwürdigen Methoden zur Refinanzierung der ausstehenden Salden nicht mehr fortgesetzt werden können. Aus diesen und ähnlichen Gründen ist das internationale Finanzsystem als Ganzes bankrott, und die privaten Finanzinstitute sind nicht mehr in der Lage, den sich abzeichnenden Währungskollaps zu bewältigen. Die Banken werden keine andere Wahl haben, als ihr Schicksal, ihre Politik, in die Hände der Regierungen zu legen. Die Zeit, in der private Finanzinteressen die Angelegenheiten der Nationen regeln konnten, ist auf mittlere Sicht nach dem Zusammenbruch, vielleicht auch noch länger danach, zu Ende.
Die einzigen erfolgreichen Optionen, die den Regierungen zur Verfügung stehen, sind die des Amerikanischen Systems („Merkantilismus“). Die implizite Befugnis der Regierungen, große Kreditmengen durch die Ausgabe nationaler Schatzanweisungen als Zahlungsmittel zu schaffen, ist der Kern aller denkbaren Optionen. Die einzige vernünftige Wahl der Mechanismen, durch die solche Zahlungsmittel ausgegeben werden können, ist das staatliche („Hamiltonische“) Nationalbankensystem: die Beleihung von Emissionen zu nominalen Kreditgebühren für ausgewählte Kategorien staatlicher und privater Investitionen und für die Zwekke internationaler Exportkredite für „harte Rohstoffe“ an inländische Produzenten. Die Regierungen und ihre Nationalbanken sind verpflichtet, durch Devisenkontrollen, Kapitalausfuhr- und -einfuhrkontrollen sowie Zölle stabile Werte für ihre Währungen durchzusetzen, um die Preise sowohl im Inland als auch im Welthandel auf einem „Paritätsniveau“ zu stabilisieren.
Diese und ähnliche Maßnahmen werden die Geldpolitik und verwandte Politiken den Erfordernissen der physischen Wirtschaft unterwerfen. Unter diesen Umständen werden alle wichtigen Werte der Wirtschafts-
tätigkeit vom Standpunkt der physischen Ökonomie aus bestimmt und nicht von der Art der monetären Gleichungen, die in den letzten Jahrzehnten vorherrschten. Die Wiederaufbaupolitik der Regierungen wird sich zunächst auf die Mobilisierung ungenutzter Arbeitskräfte und Kapazitäten für vorrangige Formen des Beschäftigungswachstums konzentrieren. Unter diesen Umständen müssen die derzeit üblichen Methoden zur Berechnung des Nationaleinkommens (also BSP/BIPMethoden) aufgegeben werden. Statistische Leistungsmessungen beruhen in erster Linie auf der physischen Produktion von Gütern pro Kopf der Bevölkerung und der Arbeitskräfte insgesamt. Diese statistischen Messungen müssen bei allen Durchführbarkeitsstudien von Infrastrukturprogrammen und anderen Investitionskategorien verwendet werden.
Unter diesen Umständen werden alle statistischen Daten nach zwei einfachen Maßstäben erstellt: 1. Pro-Kopf-Warenkörbe für Produktion und Verbrauch, Güter der Haushalte und Produzenten, hauptsächlich Sachgüter, plus eine begrenzte kurze Liste spezieller Dienstleistungskategorien. 2. Demografische Daten über Beschäftigung, Produktion und Konsum. Die statistische Erfassung definiert demografisch den Familienhaushalt und nicht die Einzelperson als primäre Bezugseinheit. Einzelpersonen werden den Haushalten auf Grundlage der internen Demografie verschiedener Haushaltskohorten zugeordnet. Die gesamte Erwerbsbevölkerung wird anhand der Haushaltsmitglieder definiert, die sich als solche qualifizieren, also anhand der Altersgruppe, des körperlichen Zustands, des Bildungsniveaus und wesentlicher Funktionen, die in dem Haushalt ausgeübt werden. Die Beschäftigung der Erwerbsbevölkerung wird unterteilt in „produktive“ bzw. „Gemeinkosten“-Arbeit, wobei Arbeitslosigkeit als Teil der Gemeinkosten behandelt wird. Zu diesem Zweck wird die gesamte Volkswirtschaft als ein einheitliches agroindustrielles Unternehmen betrachtet, und die Unterscheidung zwischen produktiver Beschäftigung und Beschäftigung zu Gemeinkosten wird auf diese Weise vorgenommen.
Die wichtigsten Unterteilungen der Beschäftigung sind in:
1. Ländliche Arbeitskräfte
2. Städtische Arbeitskräfte
a) Güterproduktion für die Erzeuger
b) Wirtschaftliche Basisinfrastruktur
c) Güterproduktion für die privaten Haushalte
Die wichtigsten Untersektoren bei der GemeinkostenBeschäftigung sind
1. Verwaltungs- und Produktionsdienstleistungen
a) Überwachung der Produktion
b) Wissenschaft, Technik und verwandte Bereiche
c) Bildung von Medizin und Gesundheitswesen
2. Institutionelle Aufwendungen
Ausgaben, die als notwendige Funktionen von Unternehmen oder staatlichen Einrichtungen anfallen, einschließlich der Vertriebskosten von Unternehmen
3. Vergeudung
Die Produktion wird anhand von Mengenäquivalenten der Pro-Kopf-Warenkörbe für Güter aus Haushalten oder Produzenten gemessen. Der Verbrauch wird anhand des jeweiligen Pro-Kopf-Verbrauchs der Haushalte bzw. der Produzenten ermittelt. Diese Messungen werden zunächst mit Daten der Landnutzung korreliert. Die wichtigsten Kategorien sind zum Beispiel:
1. Öd- und Reserveflächen
2. Landwirtschaftliche Nutzflächen
3. Allgemeine Verkehrsflächen (mit Ausnahme innerstädtischer Flächen, die auf diese Weise genutzt werden)
4. Städtische Flächennutzung
a) Verarbeitendes Gewerbe
b) Wohnen
c) Gewerbe
d)Stadtverkehr
e) Sonstige
Die Messungen der Warenkorb-, Bevölkerungs-, Arbeitskräfte- und Landnutzungsdaten werden mit den Energiedaten korreliert. Der Energieverbrauch wird in erster Näherung in Form von Kilowatt-Äquivalenten pro Kopf und auch pro Hektar (oder Quadratkilometer) Landnutzung gemessen. Diese beiden Messungen werden dann mit dem Energieverbrauch pro Kopf der Bevölkerungsdichte kombiniert.
Zu den wirtschaftswissenschaftlichen Überlegungen, die bei solchen Statistiken angestellt werden, gehören vor allem die folgenden.
Die allgemeine wirtschaftliche Funktion, die statistisch untersucht werden soll, ist die funktionale Korrelation zwischen der Zunahme der potentiellen Bevölkerungsdichte und dem technischen Fortschritt in einer energie- und kapitalintensiven Wirtschaft, in der der Produktionsgewinn wieder reinvestiert wird, und der sich ändernden Zusammensetzung der Beschäftigung. Dies erfordert, daß die Korrelation zwischen einer bestimmten relativen Höhe der technologischen Entwicklung und des Energiedurchsatzes, gemessen pro Einheit der Bevölkerungsdichte, bestimmt werden muß.
Für eine solche Funktion gibt es sechs wichtige, voneinander abhängige Bedingungen:
1. Die Qualität und Quantität des Inhalts der Warenkörbe pro Kopf, sowohl für die Güter der Haushalte als auch für die Güter der Produzenten, müssen mit einem bestimmten Technologieniveau korrelieren und mit dem technischen Fortschritt zunehmen. (Der unterschiedliche Bildungsbedarf der Gesellschaft auf verschiedenen technologischen Niveaus veranschaulicht diesen Punkt.)
2. Mit dem technischen Fortschritt muß das Verhältnis zwischen den Arbeitskräften auf dem Land und in der Stadt abnehmen, unter der Bedingung, daß die landwirtschaftliche Produktion pro Kopf der Gesamtbevölkerung zunimmt. Dies ist Kapitalintensität in erster Näherung.
3. Das Verhältnis zwischen den Beschäftigten in der Produktion von Industriegütern und den Beschäftigten in der Produktion von Haushaltsgütern muß steigen, unter der Bedingung, daß der Warenkorb der Haushalte pro Kopf zunimmt. Dies ist Kapitalintensität in zweiter Näherung.
4. Der Durchsatz an nutzbarer Energie pro Kopf muß steigen. Dies ist Energieintensität in erster Näherung.
5. Die durchschnittliche Energiedichte im Querschnitt der Energievorräte muß zunehmen. Das ist Energieintensität in zweiter Näherung.
6. Die Technologie muß sich weiterentwickeln, wie es Leibniz im Sinne seines Prinzips der geringsten Wirkung definiert hat.
Die wirtschaftliche Ertragskraft läßt sich auf folgende allgemeine Weise messen: Die Kosten des Warenkorbs, die mit der Beschäftigung von Arbeitskräften für Infrastruktur, Landwirtschaft und Produktion verbunden sind, sind die Produktionskosten. Die Gesamtproduktion abzüglich dieser Kosten ist der Bruttobetriebs-
gewinn der Volkswirtschaft. Die Gemeinkosten, die in ähnlicher Weise gemessen werden, werden addiert, und dieser Betrag wird vom Bruttobetriebsgewinn abgezogen. Der verbleibende Betrag ist der Nettobetriebsgewinn der Wirtschaft.
Der Wert einer Investition besteht also darin, wie sich diese Investition auf die gesamtwirtschaftliche Ertragskraft auswirkt. Man vergleiche dann die Folgen einer nicht getätigten Investition mit den Folgen einer getätigten Investition in diesem Sinne. Die Kosten der Nichtbeschäftigung von Arbeitskräften und ungenutzten Kapazitäten werden in diese Berechnungen einbezogen. In gleicher Weise läßt sich untersuchen, welchen Vorteil es hat, Arbeitsplätze aus den Gemeinkostenkategorien in den Bereich produktiver Beschäftigung zu verlagern. Die Senkung der Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie der arbeitsintensiven un- und angelernten Dienstleistungen ist eine der wichtigsten Ressourcen für produktive Arbeit: Sie reduziert die parasitäre Komponente der Gemeinkosten und vergrößert gleichzeitig den produktiven Sektor.
Diesbezügliche Vergleiche zwischen verschiedenen Volkswirtschaften sind mit den heute verfügbaren Statistiken durchaus möglich. Auch wenn die verfügbaren Statistiken sehr ungenau sind, reichen die Daten aus, um sehr nützliche Verallgemeinerungen zu treffen. Es ist wichtig, unterschiedliche Volkswirtschaften im Hinblick auf die sechs oben angeführten Bedingungen zu vergleichen. Trotz der Unzulänglichkeiten der verfügbaren Daten ergeben sich daraus einige sehr wichtige Hinweise für die politischen Entscheidungsträger. Im Laufe der Zeit wird die Verwendung solcher Daten zu einer deutlichen Verbesserung der Datenerhebung führen.
Zur „wirtschaftlichen Basisinfrastruktur“ gehören zwei unterschiedliche Bereiche: Infrastruktur, deren eigentlicher Beitrag in ihrer Natur als physisches Produkt liegt, sowie Dienstleistungen, die direkt die Fähigkeit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung insgesamt fördern, technologischen Fortschritt zu erzeugen und umzusetzen. Die physische Infrastruktur umfaßt insbesondere:
• Verkehr allgemein
• Wasserwirtschaft
• Allgemeine öffentliche Sanitärfunktionen
• Erzeugung und Verteilung von Primärenergie
• Allgemeine Kommunikation
• Städtische physische Infrastruktur.
Dienstleistungen, die für die Förderung und den Schutz des technologischen Potentials der Arbeitskräfte und der Bevölkerung unerläßlich sind:
• Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung
• Ingenieurdienstleistungen für die physische Infrastruktur und die allgemeine Produktion
• Öffentliche Bildung und klassische Kultur
• Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen.
Bestimmte andere Kategorien von Dienstleistungen sind Teil der nationalen Infrastruktur, haben aber nur indirekten Einfluß auf die Produktivität der Arbeit. Dafür stehen Aufwendungen für das Militär und die Strafverfolgungsbehörden, die für den Schutz einer gesunden Wirtschaft notwendig sind. Jene Bereiche der sozialen Infrastruktur, die sich auf den technologischen Fortschritt und die Arbeitsproduktivität auswirken, werden den „wirtschaftlichen“ Funktionen der gesellschaftlichen Gemeinkosten zugeordnet. Das Militär und die Strafverfolgungsbehörden gehören zu den „institutionellen“ Funktionen der gesellschaftlichen Gemeinkosten.
Die Bedeutung der wirtschaftlichen Basisinfrastruktur wird an zwei Vergleichen deutlich. Zuerst vergleichen wir die wichtigsten Statistiken für Japan, die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten. Zweitens vergleichen wir die gleichen Daten für verschiedene Entwicklungsländer. Der Vergleich erfolgt am besten anhand der sechs von uns oben identifizierten Bedingungen. Die aussagekräftigsten Hinweise erhält man bereits, wenn man nur die Energiedichte mit der Bevölkerungsdichte vergleicht. Sehr verallgemeinernd kann man sagen, daß das technologische Niveau Japans, der Bundesrepublik Deutschland und der USA in etwa vergleichbar ist, wenn man die Durchschnittswerte für den Zeitraum der 1970er Jahre betrachtet. Diese ziemlich genaue, wenn auch grobe Schätzung erlaubt es uns, darzustellen, wie die Funktionen der Energiedichte und der Bevölkerungsdichte

miteinander korrelieren. Zunächst stellen wir fest, daß die Energiedichte pro Kopf als Funktion zunehmender Bevölkerungsdichte abnimmt. Wir sehen auch, daß die
Der Wert der physischen Infrastruktur liegt nicht nur in ihrer Existenz als materielles Produkt, sondern auch in ihrem Beitrag zur Förderung der Fähigkeit der Bevölkerung, technologischen Fortschritt zu erzeugen und weiterzugeben.. Oben: Luftaufnahme von zwei großen Wasserprojekten in Kalifornien: Der Delta-Mendota-Kanal (links) neben dem California Aqueduct (rechts); rechts: Hochspannungsmasten für die Stromdurchleitung; links: ein komplexer Autobahnknotenpunkt.
Energiedichte pro Hektar als Funktion zunehmender Bevölkerungsdichte ansteigt. Wir sehen auch, daß die Energiedichte pro Pro-Kopf-Einheit der Bevölkerungs-
dichte in allen drei Ländern ungefähr gleich ist. In Bezug auf die Produktion stellen wir fest, daß die Erträge pro Kopf und pro Hektar bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung sowohl von der Bevölkerungsdichte als auch von der Energiedichte und der Kapitalintensität abhängen.
Die gleiche Art von Korrelationen finden wir bei der industriellen Landnutzung. Die Produktivität und das Technologieniveau bestimmter Industriebetriebe sind Funktionen der Energiedichte und der Kapitalintensität. Dies bedeutet, daß wettbewerbsfähige Industrien in den drei betrachteten OECD-Volkswirtschaften nahezu identische Funktionen für die Energiedichte aufweisen. Betrachtet man die landwirtschaftliche und industrielle Produktion auf diese Weise, kann man die Hauptursache für die unterschiedliche Energiedichte pro Kopf und pro Hektar in den drei betrachteten Beispielen besser begutachten: die grundlegende wirtschaftliche Infrastruktur. Je höher die Bevölkerungsdichte, desto geringer ist die Energiedichte pro Kopf, die für ein vergleichbares Technologie- und Produktivitätsniveau erforderlich ist. Um jedoch eine höhere Bevölkerungsdichte zu erreichen, müssen pro Flächeneinheit mehr Investitionen in die wirtschaftliche Basisinfrastruktur fließen. Wie die groben Schätzungen des Vergleichs zeigen, scheint es sich dabei um einen „Kompromiß“ zu handeln, bis wir die Frage genauer untersuchen.
Die physischen Komponenten der wirtschaftlichen Basisinfrastruktur können mit dem Fundament eines Gebäudes verglichen werden. Der Entwicklungsstand dieser Infrastruktur bestimmt die Produktionsentwicklung, die auf diesem Fundament aufgebaut werden kann. Der Umfang der Infrastruktur, der pro Kopf der Bevölkerungsdichte erforderlich ist, steigt mit der Kapitalintensität und der Energieintensität. Da die Kapitalintensität von der Energieintensität und der Technologie abhängt, läßt sich dieses Verhältnis näherungsweise als Funktion der Energiedichte ausdrücken. Solche Näherungen sind besser als einfache Faustformel-Schätzungen. Seit Leibniz‘ Beiträgen zur Begründung der Wirtschaftswissenschaften war es praktisch immer möglich, „rein thermodynamische“ Funktionen für wirtschaftliche Prozesse aufzustellen. Indem man die „Inputs“ der Warenkörbe in Form des Energieverbrauchs ausdrückt, der für die Produktion dieser Warenkörbe erforderlich ist, lassen sich in erster Näherung die Arbeit und das Kapital der Produktion in Form der benötigten Energiekosten messen. Wenn man die Thermodynamik entsprechend der Riemannschen
Elektrodynamik neu definiert, lassen sich auch „nichtlineare“ Funktionen der geringsten Wirkung konstruieren, in die die Form eingehen, in der der technologische Fortschritt in den Produktionsprozeß einfließt. Damit kann eine allgemeine physikalisch-ökonomische

Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung ist eine unerläßliche Dienstleistung in einer industriellen Gesellschaft.
Funktion in Form der Riemannschen Elektro(hydro) dynamik umfassend ausgedrückt werden.
Die Messung von Infrastrukturfunktionen in Form von Energiedichtebedingungen kommt daher der Annäherung implizit sehr nahe. Solche Approximationen sind unter heutigen Bedingungen unvermeidlich. Die Fehlergrenzen der erhobenen Daten erlauben keine aussagekräftigen Berechnungen, die über grobe Schätzungen hinausgehen – Schätzungen ohne deduktive Annahmen, die durch die Fehlerquoten der verfügbaren Daten beeinflußt werden. Wenn man, wie bereits angedeutet, die sechs genannten Einschränkungen anwendet, um eine allgemeine Funktion für die Zunahme der potentiellen Bevölkerungsdichte aufzustellen, läßt sich eine verallgemeinerte mathematische Funktion für Wirtschaftsprozesse konstruieren. (Im Rahmen der linearen Systemanalyse ist eine solche Lösung nicht möglich.) Wenn man eine solche verallgemeinerte Funktion konstruiert hat, geht es noch darum, die richtigen Werte für die Koeffizienten und Exponenten der Funktionsterme anzugeben. Sind die verfügbaren Daten genau genug, lassen sich sehr gute Schätzungen für die Werte dieser Koeffizienten und Exponenten ableiten. Mit weniger genauen Daten lassen sich solche Schätzungen ebenfalls vornehmen, aber nur innerhalb der Genauigkeitsgrenzen, die durch die Qualität der verwendeten Daten vorgegeben sind.

Glücklicherweise sind wir nicht auf statistische Zählungsdaten beschränkt. Es ist möglich, Produktionsfunktionen für bestimmte landwirtschaftliche und industrielle Produktionszweige zu erstellen, um die Variabilität einzelner Unternehmen innerhalb der Bedingungen unserer allgemeinen Funktion zu isolieren. Diese enger gefaßten Untersuchungen kombinieren industrietechnische Methoden, um die Rahmenbedingungen für die Produktion des Warenkorbes auf verschiedenen Technologieniveaus zu bestimmen, mit Studien zur Thermodynamik der physikalischen Chemie der beteiligten Produktionsumwandlungen. Mit Hilfe guter Tabellen aus Physik- und Chemielehrbüchern oder mit Hilfe von Primärquellen für die Erstellung solcher Tabellen können wir die Auswirkungen neuer Technologien auf die Produktivitätssteigerung mit einer Genauigkeit von Bruchteilen einer Größenordnung der Produktivitätssteigerung abschätzen. Wir wären also in der Lage, die Produktivitätszuwächse über ganze Generationen oder über große Teile einer Generation hinweg zu prognostizieren, die sich aus den technologischen Fortschritten ergeben, die unter den sechs genannten Bedingungen angewendet werden.
Einnahmen aus Infrastrukturprojekten sind vergleichbar mit den Einnahmen aus der Erschließung eines Bauplatzes. Die Einnahmen aus der Erschließung ei-
LaRouche: „Würde man auf die Erhebung von Fahrgeld verzichten, könnte man der Stadtbevölkerung ein gleichwertiges oder besseres Angebot zur Verfügung stellen – und das zur Hälfte der Kosten für den Steuerzahler!“ Im Bild die New Yorker Subway.
nes Bauplatzes stammen aus Aktivitäten, die ohne die Erschließung des Bauplatzes nicht möglich wären. Sie stammen nicht von dem Bauplatz selbst. Ökonomen, Buchhalter und andere lassen sich oft durch die Tatsache verwirren, daß Elektrizität verkauft wird, daß die Durchfahrt durch Kanäle normalerweise gebührenpflichtig ist, daß Fahrgäste im städtischen Nahverkehr normalerweise Fahrpreise bezahlen müssen und daß in einigen Ländern für die Benutzung von Brücken und öffentlichen Autobahnen Gebühren erhoben werden können. Diese Arten von Einnahmen, die sich direkt aus der Nutzung von Infrastruktur ergeben, bestärken viele in dem Irrglauben, daß die direkten Einnahmen aus dem Betrieb einer Infrastruktur die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts bestimmen.
So wurde beispielsweise vor einigen Jahrzehnten eine Studie über den Betrieb des New Yorker Schnellbahnsystems ohne Erhebung von Fahrpreisen durchgeführt. Eine wichtige Tatsache wurde in der Studie hervorgehoben, nämlich daß die Kosten für die Erhebung und Verwaltung der Fahrgeldeinnahmen alle anderen Betriebskosten des Systems überstiegen. Würde man auf die Erhebung von Fahrgeld verzichten, könnte man der Stadtbevölkerung ein gleichwertiges oder besseres Angebot zur Verfügung stellen – und zur Hälfte der Kosten für den Steuerzahler! Dieses Beispiel verweist auf ein allgemeines Prinzip. In Studien über die Machbarkeit eines Schnellbahnsystems wie in New York City kann keine fundierte Bewertung vorgenommen werden, ohne die Kosten alternativer Verkehrsmittel für die Fahrgäste zu berücksichtigen. Der
Staat muß die höheren Kosten ihrer Gesamtausgaben für Autobahnen, Brücken, Parkeinrichtungen und Verkehrsmanagement berücksichtigen, wenn das Schnellbahnsystem nicht zur Verfügung stünde oder weniger genutzt würde. Der Staat muß auch den Zeitverlust für die Fahrgäste und die Auswirkungen auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung berücksichtigen. Es gibt noch weitere Überlegungen, aber diese beiden Punkte zur Veranschaulichung reichen für unsere Zwecke hier aus.
Im allgemeinen Verkehrswesen sind zwei Hauptfaktoren der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen: 1. Die Kosten pro Tonnen- oder Personenkilometer, und 2. die Kosten langsamerer Verkehrsträger, die den Transport von Personen oder Gütern mit relativ hohem Wert zu ihrem Bestimmungsort verzögern.
Gemessen an den Kosten pro Personenkilometer ist die Schnellbahn der kostengünstigste Verkehrsträger in, zu und aus städtischen Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte. Die kombinierten öffentlichen und privaten Kosten pro Fahrgast für alternative öffentliche oder private Verkehrsmittel sind deutlich höher. Erhöht sich die Reisezeit eines Fahrgastes von einer halben Stunde auf eine Stunde oder anderthalb Stunden oder einen vergleichbaren Wert, sinkt der Lebensstandard dieses Fahrgastes erheblich und die Qualität des Stadtzentrums als Arbeitsmarkt- und Geschäftszentrum verschlechtert sich. Es gibt keinen wichtigen Aspekt des persönlichen Lebens und der wirtschaftlichen Aktivitäten in einem städtischen Gebiet und seiner Umgebung, der nicht erheblich von der Existenz eines gut konzipierten und effizient funktionierenden Schnellbahnsystems in diesem Gebiet profitiert. In einigen Fällen ist der Nutzen direkt, in [anderen] Fällen indirekt, aber in der Regel nicht weniger bedeutsam, als wenn er direkt wäre. Infrastrukturelle Entwicklungen lediglich anhand direkter Fahrgeldeinnahmen zu bewerten, ist unverantwortliche Inkompetenz.

LaRouche: „Für Panama würde ein Kanal auf Meeresspiegelniveau die Wirtschaft auf spektakuläre Weise verbessern. Der größte Nutzen käme den Nationen Mittel- und Südamerikas zugute, deren Handel untereinander und mit weiter entfernten Gebieten erheblich angekurbelt werden würde.“ Hier im Bild: Die Gatun-Schleuse des Panamakanals im Jahre 2000.
Nehmen wir als Beispiele den für die thailändische Landenge vorgeschlagenen Meeresspiegel-Kanal oder den ebenfalls vorgeschlagenen neuen Panamakanal. Beide Kanäle werden Mauteinnahmen generieren. Allerdings werden die Mauteinnahmen den kleinsten Teil der durch den Bau des Kanals erzielten Einnahmen ausmachen. Im Falle des Kra-Kanals ist es so, daß der Hauptabschnitt durch ein mineralienreiches Gebiet
führt, so daß die Erdbewegungsarbeiten nicht einfach nur Kosten für die Erdbewegung sind, sondern tatsächlich Einnahmen aus dem Bergbau generieren. Bei beiden Kanälen schafft die Wasserstraße die Grundlage für industrielle Entwicklungszonen an seinen beiden Enden. Auf diese Weise lenkt der Kanal die verschiedensten Güterströme in diese Gebiete, ein breites Spektrum von Gütern, das auf keine andere Weise zustande kommen könnte. Die Entwicklung des Kanals wird zur infrastrukturellen Grundlage für zahlreiche hochprofitable Industrien in dieser Gegend.
Beide Kanäle ziehen einen großen Teil des Frachtaufkommens an, das von weit her kommt: aus Europa, Amerika, Indien, Japan. Ein großer Teil dieser Ladung ist eine Mischung aus Massengütern, Halbfertig- und Fertigprodukten. Ein großer Teil dieser Ladung muß nach der Passage des Kanals noch eine beträchtliche
Strecke weiter transportiert werden. Hier kommt ein sehr interessanter wirtschaftlicher Faktor ins Spiel. In wirtschaftlichen Studien darf man nicht nur die Transportkosten pro Tonnenkilometer betrachten, sondern man muß die Transportkosten als Prozentsatz der Gesamtkosten für das transportierte Produkt berücksichtigen. Wenn statt einer Tonne minderwertiger Fracht eine Tonne höherwertiger Fracht transportiert werden kann, ergibt sich ein deutlicher wirtschaftlicher Vorteil. Mit anderen Worten: Wenn es etwa in der Mitte einer langen Fahrt eine günstige Möglichkeit für die Verarbeitung des transportierten Materials gibt, ergibt sich ein signifikanter wirtschaftlicher Gewinn durch die Verringerung des prozentualen Anteils der Transportkosten an den Gesamtkosten.
Der Ort in der Mitte des Transportweges, an dem eine solche Aufwertung des Produktes stattfinden könnte, muß bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Nahezu alle Elemente, die für die Verarbeitung eines dieser Produkte erforderlich sind, müssen an diesem Ort leicht verfügbar sein. Die Wartung der Verarbeitungsanlagen an diesem Ort muß wirtschaftlich sein, zum Beispiel durch das Vorhandensein von Werkstätten usw. Ein großer Kanal, der sowohl große Massengutschiffe als auch andere Schiffsklassen aufnehmen kann, wäre dafür der ideale Standort. Ein solcher Kanal muß zum Beispiel über Schiffsreparaturwerkstätten verfügen. Die Arbeitskräfte vor Ort müssen über ein breites Spektrum handwerklicher Fähigkeiten verfügen, die sich leicht diversifizieren lassen, um der lokalen Industrie entsprechende Dienstleistungen anbieten zu können. Ein solcher Kanal muß über große lokale Energiequellen verfügen; diese müssen nur in großem Maßstab erweitert werden, um eine Energieinfrastruktur für die allgemeine industrielle Entwicklung zu schaffen. Die Industrie benötigt relativ niedrige Kosten für eingehende Fracht und einen effizienten, kostengünstigen Umschlag dieser Fracht von und zu den Hafenanlagen. Und so weiter. Sowohl in Thailand als auch in Panama geht es also um einen Kanal, der viel mehr ist als nur ein Kanal. Solche Kanäle sind wichtige Impulsgeber für die gesamte Wirtschaft beider Länder und auch ein wichtiger Impuls für den wirtschaftlichen Fortschritt in den Nachbarländern. Für Panama würde der Kanal die Wirtschaft auf spektakuläre Weise verbessern. Der größte Nutzen käme den Nationen Mittel- und Südamerikas zugute, deren Handel untereinander und mit weiter entfernten Gebieten erheblich angekurbelt würde. Im Falle des thailändischen Kanals würden die Industriegebiete entlang des Kanals den Bau eines Tief-
seehafens in Thailand auf der anderen Seite des Golfs ermöglichen, der zum Ausgangspunkt einer konzentrischen wirtschaftlichen Entwicklung werden würde, die sich vom Hafen bis in die nordöstliche Mekong-Region erstrecken könnte. Er würde auch die Entwicklung des regionalen Seehandels fördern, der vor allem für Indonesien, aber auch für Malaysia und die Philippinen von großem Nutzen wäre. Bei der wirtschaftlichen Machbarkeit eines Infrastrukturprogramms muß die Kettenreaktionswirkung des Programms auf die Wirtschaft des Landes und seiner Nachbarn berücksichtigt werden.
Besonders in den Entwicklungsländern ähnelt das Wachstum der Großstädte meist einem Krebsgeschwür. Dies ist ein Erbe von mehreren Faktoren: vorkoloniale kulturelle Faktoren, die Folgen des Kolonialismus und die monetäre und wirtschaftliche Entwicklung nach 1946. Die meisten dieser Städte sind übergroß, und ihre Strukturen verhindern einen effizienten Personen- und Warenverkehr innerhalb des Stadtgebiets. Es sind drei allgemeine Maßnahmen zu ergreifen:
1. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den städtischen Zentren und dem ländlichen Raum müssen deutlich verbessert werden, so daß die städtischen Industrie- und Bildungszentren zur treibenden Kraft für die Förderung des technologischen Fortschritts und der Produktivität im ländlichen Raum werden;
2. Das Bevölkerungswachstum muß in diesen Zentren unterbrochen und Umsiedlung großer Teile der Bevölkerung aus diesen Zentren in neue Städte ermöglicht werden, und
3. Es bedarf der Entwicklung einer effizienten städtischen Infrastruktur sowohl in den neuen als auch in den alten Städten.
In allen Entwicklungsländern, aber auch in den meisten OECD-Ländern, sind umfangreiche Infrastrukturprogramme dringend erforderlich. Mit diesen Programmen müssen geeignete neue Zentren für urbane Standorte geschaffen werden, sowohl in wirtschaftsgeographischer Hinsicht als auch im Hinblick auf die Tatsache, daß Infrastrukturprojekte Arbeitskräfte an diese Standorte ziehen und damit die Grundlage für eine
organische Entwicklung dieser neuen urbanen Zentren schaffen.
Die wichtigsten Anforderungen an eine neue Stadt sind, daß sie 1. Knotenpunkt für wichtige Güter- und Personenverkehrsströme, 2. wasserwirtschaftliches Zentrum, und 3. Erzeugungs- und Verteilungsstelle von Primärenergie sein muß. Außerdem muß 4. ihre wirtschaftliche Lage günstig sein mit Blick auf die Versorgungsquellen und die positive wirtschaftliche Entwicklung in der Umgebung.
Da die sich entwickelnden Volkswirtschaften nur über ein begrenztes Sozialkapital verfügen, ergeben sich für die Entwicklung dieser neuen städtischen Zentren eine Reihe von Problemen. Nur sehr wenige Ökonomen befassen sich heute ernsthaft mit den realen wirtschaftlichen Effekten von Slumgebieten in städtischen Zentren. Einige politische Kreise in Ägypten haben das Problem recht gut untersucht. Der gleiche Anteil des nationalen Reichtums, der wenig Nutzen bringt, wenn er für die Verbesserung der Lebensbedingungen in großen Gebieten von Kairo und Alexandria ausgegeben wird, hat eine sehr positive Wirkung auf die gleiche Anzahl von Menschen und Haushalten, wenn er für die Entwicklung von bewässerten städtischen und landwirtschaftlichen „neuen Stadtgebieten“ verwendet wird. Es ist billiger, die Bevölkerung in den neuen Stadtgebieten mit qualitativ hochwertigem Wohnraum zu versorgen, als erfolglos zu versuchen, die schlechten Bedingungen in den heruntergekommenen und veralteten Gebieten der bestehenden Städte zu verbessern. Die Vorteile liegen nicht nur in den besseren Lebensbedingungen für die Bürger, die die billigste und beste verfügbare Qualität pro ausgegebener Einheit erhalten. Die Auswirkungen auf die potentielle Produktivität der Arbeitskräfte sind erheblich. Neue Städte sind effizient, während alte Städte in ihrer Gesamtstruktur wirtschaftlich ineffizient sind. Eine vernünftige Verteilung der städtischen Zentren verbessert die funktionalen Beziehungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten und trägt zu einer wesentlich größeren politischen und wirtschaftlichen Stabilität innerhalb der Nation als Ganzes bei.
Die wirtschaftliche Machbarkeit von Infrastrukturprojekten beruht im wesentlichen auf zwei Überlegungen:
1. Die direkten Auswirkungen des Programms auf die Verbesserung einiger der oben genannten sechs Bedingungen, und 2. die durch das Programm ermöglichten produktiven Investitionen, die ohne das Programm entweder überhaupt nicht oder nicht zu den gleichen Kosten verfügbar wären. Häufig sind diese beiden Überlegungen für eine richtige Bewertung der Machbarkeit am wichtigsten. Letztlich laufen beide Überlegungen auf den selben Punkt hinaus. Bei der ersten Überlegung geht es um den allgemeinen Nutzen, bei der zweiten um den spezifischen Nutzen. Bei der ersten Betrachtung stellen wir den Nutzen in Form einer Verbesserung des allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungspotentials der Volkswirtschaft dar. Bei der zweiten Betrachtungsweise betonen wir den Nutzen einiger spezifischer Investitionen, die durch das Programm ermöglicht werden. Buchhalter und Finanzinstitute sind Liebhaber genauer Zahlen. Die Kosten eines Projekts können und sollten nach allgemein anerkannten Genauigkeitsstandards berechnet werden. Bei einer Investition in der Landwirtschaft oder im verarbeitenden Gewerbe lassen sich die erwarteten Betriebseinnahmen in der Regel mit einer angemessenen Fehlermarge hochrechnen. Bei einem großen Infrastrukturprojekt darf nicht versucht werden, die Machbarkeit der Investition anhand der voraussichtlichen Höhe der Betriebseinnahmen zu beurteilen. Die prinzipiellen Gründe für die Unterscheidung zwischen Infrastrukturprogrammen und gewöhnlichen Investitionen in der Landwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe oder in Handelsunternehmen wurden bereits genannt. Dies bedeutet nicht, daß die Einschätzungen der Machbarkeit nebulös sein sollten. Die volkswirtschaftlichen Ausgaben für Infrastrukturprogramme können und sollten mit einer entsprechenden Genauigkeit der Rechnungsführung geschätzt werden. Uns geht es hier darum, daß keine kompetente Schätzung der Machbarkeit mit den heute allgemein akzeptierten Standards der Buchhaltungspraxis möglich sind. Aus diesem Grund müssen wir im folgenden einen pädagogischen Ansatz wählen, um die richtigen Methoden einzuführen.
Ein Konsortium potentieller Investoren übergibt die Pläne für die Entwicklung einer neuen Produktionsoder Gewerbeeinrichtung einem Beratungsunternehmen, das darauf spezialisiert ist, unabhängig die finanzielle Machbarkeit des vorgeschlagenen Projekts zu bewerten. Sowohl erfahrene Investoren als auch solche Berater wissen sehr genau, welches Ergebnis sie erwarten können. Normalerweise würden wir selbst eine solche Vorgehensweise empfehlen und die gleichen Stan-
dards der Beratungspraxis anwenden, wenn wir mit einer solchen Aufgabe betraut würden. Der Punkt ist, daß die Anwendung desselben Ansatzes inkompetent ist, wenn es um die Bewertung der Durchführbarkeit eines Infrastrukturprogramms geht. Das bedeutet nicht,

werden, und diese Beträge bilden einen Teil der Mittelherkunft. Konventionelle Buchhaltungsmethoden sind für die Projektion der Mittelherkunft und -verwendung gut geeignet. Für die Berechnung des Nutzens, der durch das Programm entsteht, dürfen konventionelle Buchhaltungsmethoden nicht verwendet werden. Stattdessen müssen wirtschaftswissenschaftliche Methoden zum Einsatz kommen.
Eine Veranschaulichung hilft, den Punkt zu verdeutlichen. In der Geschichte der amerikanischen Wirtschaft der Nachkriegszeit findet man eine sehr präzise Korrelation zwischen dem Anstieg der Investitionen in die wirtschaftliche Basisinfrastruktur und dem Anstieg der Arbeitsproduktivität. Beide Kurven sind mit einer Verzögerung von zwölf bis achtzehn Monaten eng miteinander verknüpft. Der entscheidende Parameter zur Messung des Nutzens von Infrastrukturprogrammen ist ihr Einfluß auf die durchschnittliche Produktivität der nationalen oder regionalen Wirtschaft. Jeder andere Ansatz zur Bestimmung wirtschaftlicher Machbarkeit ist grundsätzlich falsch.
Künstlerische Darstellung des geplanten Kra-Kanals, der durch den thailändischen Teil der malaiischen Halbinsel verlaufen soll. Kanäle dieser Art auf Meeresniveau bilden die infrastrukturelle Grundlage für die Ansiedlung hochprofitabler Industriebetriebe in ihrer Nähe.
daß solche Beratungspraktiken nicht in begrenztem Umfang im Zusammenhang mit Infrastrukturprogrammen angewendet werden können. Das erklären wir. Bei jedem Infrastrukturprogramm gibt es zwei allgemeine Kategorien, die man berücksichtigen muß, um den wirtschaftlichen Nutzen des Programms zu beurteilen. Zum einen muß man natürlich den wirtschaftlichen Nutzen prognostizieren und einen geschätzten Preis für diesen Nutzen festlegen. Darüber hinaus muß eine Reihe weiterer Berechnungen angestellt werden. Diese beziehen sich auf die Herkunft und die Verwendung der Mittel. Die Verwendungen sind: Baukosten, Betriebskosten und Schuldendienst. Für den Fall, daß das Projekt direkte Einnahmen aus einem Teil seiner Gesamtaktivitäten generiert, können diese Einnahmen mit herkömmlichen Buchhaltungsmethoden projiziert
Der erste Schritt zur Erstellung von Machbarkeitsstudien für Infrastrukturprogramme besteht darin, ein Wirtschaftsmodell für die gesamte Volkswirtschaft zu erstellen (oder, im Falle eines Programms mit multinationalen Auswirkungen, ein Wirtschaftsmodell für die Region). Ein Infrastrukturprogramm wird als eine Veränderung in der Struktur dieses Wirtschaftsmodells behandelt, und die Auswirkungen auf die Wirtschaft als Ganzes bilden die Grundlage für die Bewertung der meßbaren Faktoren der Machbarkeit. Das zu verwendende Wirtschaftsmodell ist dasjenige, das den sechs oben genannten Randbedingungen entspricht. Die ökonomischen Modelle, die auf der „LaRouche-RiemannMethode“ basieren, sind dort aufgeführt. Vom Konzept her ist dieses „Modell“ eine „nichtlineare Funktion“. Die Schwierigkeit besteht darin, daß digitale Computersysteme axiomatisch nicht in der Lage sind, eine nichtlineare Funktion explizit darzustellen. Daher verwendet man in der Praxis den Trick der „Kurvenanpassung“, um Computersysteme so zu programmieren, daß sie eine Reihe linearer Annäherungen an unsere Funk-
tion simulieren. Solange wir uns der Art des Fehlers bewußt sind, der durch solche Näherungsmethoden entsteht, sind die Ergebnisse nützlich und haben den Vorteil, daß sie viel genauer sind als lineare Modelle, die unter anderen Gesichtspunkten erstellt wurden.
Die ersten Schritte bei der Durchführung von Machbarkeitsstudien für Infrastrukturprogramme bestehen also darin, ein Computersystem mit großem Speicher mit allen wichtigen Daten über die Volkswirtschaft zu füttern und die Rechenoperationen entsprechend der Abfolge der linearen Näherungen zu programmieren, die unsere nichtlineare Funktion simulieren. Bei der Frage nach der Machbarkeit eines Infrastrukturprogramms konzentrieren wir uns auf drei Merkmale des Wirtschaftsprozesses: Infrastruktur, Landwirtschaft und Produktion. Unser Ansatz entspricht in etwa dem, was wir in unserer früheren Diskussion über den Vergleich zwischen den USA, der Bundesrepublik Deutschland und Japan angesprochen haben. Wir haben gesagt, daß bestimmte Werte für die ersten fünf unserer sechs Randbedingungen dem Potential entsprechen, das für ein bestimmtes Niveau technologischer Entwicklung erforderlich ist. Wir haben auch erklärt, daß das Niveau der technologischen Entwicklung mit dem Niveau der Arbeitsproduktivität korreliert. Um also ein potentielles Produktivitätsniveau zu erreichen, muß ein technologisches Niveau erreicht werden, und auch die Werte für die ersten fünf Randbedingungen, die mit diesem technologischen Niveau übereinstimmen, müssen erreicht werden. Wir haben gezeigt, wie eine allgemeine Unterfunktion für die Infrastrukturentwicklung in diesen fünf Randbedingungen enthalten sind.
Um das Problem der Bewertung eines bestimmten Infrastrukturprogramms zu erkennen, müssen die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Aspekten der physischen Basisinfrastruktur verstanden werden. Wie steht es um die verschiedenen Bereiche dieser Infrastruktur, die einer ausgewogenen Kombination für das betrachtete Technologieniveau entsprechen? Natürlich sind die meisten Infrastrukturprogramme, insbesondere die großen, eine Mischung aus verschiedenen Arten von physischer Infrastruktur. Zum Beispiel enthält ein großes Wasserwirtschaftsprogramm normalerweise Elemente der Energieerzeugung und -verteilung, Elemente des allgemeinen Verkehrs und so weiter. Was wir brauchen, ist keine Ansammlung von Einzelprojekten,
die losgelöst von der Gesamtwirtschaft betrachtet werden. Was wir brauchen, ist ein Infrastrukturprogramm oder eine koordinierte Reihe solcher Programme, die jeweils eine Reihe von „Projekten“ enthalten. Dieses kombinierte Programm muß die schrittweise Entwicklung der nationalen Infrastruktur als Ganzes ausgleichen.
Die Machbarkeit wird in erster Linie für das Infrastrukturprogramm als Ganzes bestimmt. Die Durchführbarkeit der einzelnen Projekte innerhalb des Programms wird durch die inkrementelle Wirkung des Projekts in Bezug auf die Anforderungen des Programms als Ganzes bestimmt. Aus den bisherigen Überlegungen sollte deutlich geworden sein, daß der Erfolg von Infrastrukturprogrammen davon abhängt, daß ein tragfähiger nationaler Konsens über die Ziele der Privatsektorentwicklung, insbesondere der Landwirtschaft und des verarbeitenden Gewerbes, besteht. Der größte Nutzen einer Infrastrukturentwicklung wird aus den positiven Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Landwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe resultieren. Diese Effekte werden hauptsächlich durch neue Investitionen in der Landwirtschaft und im verarbeitenden Gewerbe vermittelt. Diese neuen Investitionen müssen natürlich mit der Entwicklung und dem Betrieb des Infrastrukturprogramms einhergehen. Daher setzt ein Infrastrukturprogramm voraus, daß zwischen Regierung und Wirtschaft ein Konsens über die Integration des Infrastrukturprogramms in die nationale Wirtschaftsentwicklung erzielt wird. Dies setzt in der Regel voraus, daß Regierung und Wirtschaft gemeinsam Kredite für Investitionen in der Landwirtschaft und im verarbeitenden Gewerbe sowie für die Projekte selbst mobilisieren. Auf diese Weise lassen sich mit Hilfe des ökonomischen Modells die genauen Auswirkungen des Infrastrukturprogramms auf die Volkswirtschaft (bzw. die regionalen Volkswirtschaften) mit relativ hoher Genauigkeit prognostizieren. Wir können zum Beispiel abschätzen, wie viele Haushalte in welchen Regionen durch welche Landnutzungskategorien unterschiedlich stark von den Auswirkungen des Programms betroffen sein werden. Wir können die daraus resultierenden Produktivitätsverschiebungen vorhersagen. Wir können auch die Gesamtwirkung des Programms im Hinblick auf die sechs Randbedingungen und die Steigerung der nationalen Produktivität abschätzen.
Deutsche Erstübersetzung: Dr. Wolfgang Lillge
Am8. Februar 2024 fand im Kremlpalast in Moskau eine große Gala zum 300. Jahrestag der Gründung der Russischen Akademie der Wissenschaften statt. Der russische Präsident Putin hielt eine wichtige Rede, und viele Wissenschaftler wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet, aber es gab auch Theateraufführungen, die die Geschichte der Akademie darstellten, mit Soldaten in Uniformen des 18. Jahrhunderts und einer Verkörperung von Zar Peter dem Großen, dem Gründer der Akademie im Jahr 1724.
Die eigentliche Inspiration zur Gründung der Akademie kam von keinem Geringeren als dem berühmten deutschen Philosophen und Naturforscher Gottfried Wilhelm Leibniz, der alles daran setzte, mit Peter dem Großen in Kontakt zu treten, als er von der Europareise des Zaren und dessen neu entdecktem Wunsch, die Wissenschaft in seinem Land zu fördern, erfuhr. Leibniz war der Ansicht, daß die Entwicklung Rußlands durch Zar Peter I. eine Brücke zwischen Europa und China
bilden würde, einer Region, mit der Leibniz durch seine umfangreiche Korrespondenz mit dort lebenden Jesuitenmissionaren in Verbindung stand. Leibniz war sich bewußt, daß es in China eine große Kultur mit tiefen Wurzeln gab, von der sowohl Europa als auch Rußland profitieren konnten.
Nach einem Treffen mit Peter I. im Jahr 1711 skizzierte Leibniz eine Reihe von Maßnahmen, die der Zar ergreifen sollte, um Rußland in die Moderne zu führen. Dazu gehörten Pläne für ein Druck- und Verlagswesen, ein Gymnasialsystem und eine Universität, die Entwicklung der Landwirtschaft, die Förderung des Manufakturwesens, das Studium der slawischen Sprachen, die Erforschung der Schwankungen des Magnetfeldes und die Durchführung einer Reihe von Expeditionen in den russischen Fernen Osten, um die riesigen, noch unerforschten Gebiete Rußlands zu kartographieren. Im Mittelpunkt von Leibniz‘ Vorschlag stand die Gründung einer wissenschaftlichen


Zar Peter I. („der Große“) war von 1682 bis 1725 Herrscher des russischen Reichs. Er führte persönlich viele Reformen durch, die Rußland auf den Weg zu einer modernen Nation brachten, darunter die Gründung der Russischen Akademie der Wissenschaften im Jahr 1724.
Akademie nach dem Vorbild der französischen Akademie, die Leibniz gut kannte, oder der Berliner Akademie, die er selbst 1700 gegründet hatte. Peter folgte schließlich vielen Vorschlägen von Leibniz mit großer Konsequenz.
Die Planungen für das 300jährige Jubiläum hatten bereits vor Jahren begonnen und werden in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen in ganz Rußland umfassen. Im Mittelpunkt standen jedoch der Jubiläumstag am 8. Februar, der als Tag der russischen Wissenschaft im Land gefeiert wurde, und die große Gala im Kremlpalast.
Bei der Eröffnungsfeier sang ein Chor die russische Nationalhymne, wobei unmittelbar hinter den Sängern ein riesiges Videobild von Raffaels Die Schule von Athen auf die Bühne projiziert wurde – ein deutlicher Hinweis auf die Ursprünge der russischen Wissenschaft
in der Goldenen Renaissance. In seiner Rede lobte Präsident Wladimir Putin die Arbeit der Akademie und wies darauf hin, daß sie in Zukunft eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Landes spielen werde. Interessanterweise verwies er auf die bedeutsame Rolle des berühmten Akademiemitglieds Wladimir Wernadskij, des Begründers der Biogeochemie, in der Geschichte der Akademie. Wernadskij, so Putin, habe verstanden, daß „die unabhängige wissenschaftliche Arbeit in Rußland mit dem Studium unseres Vaterlandes und der Erschließung unserer unendlichen Weiten begann“, also mit den von Leibniz empfohlenen Expeditionen in den Fernen Osten. Die erste Kamtschatka-Expedition, die Peter I. 1724, im Gründungsjahr der Akademie, in Auftrag gegeben hatte, wurde von dem dänischen Marineoffizier in russischen Diensten Vitus Bering, auch „Kolumbus des Zaren“ genannt, geleitet.
Putin verwies auch auf einen anderen Bereich von Wernadskijs Schaffen – seinen Vorschlag von 1915, eine Kommission zur Untersuchung der Produktivkräfte Rußlands einzurichten. Als Rußland durch den Ersten Weltkrieg vom Westen her abgeschnitten war, hatte Wernadskij angeregt, Expeditionen zu entsenden, um die enormen Ressourcen im Hinterland Rußlands zu kartieren, die dann genutzt werden könnten, um der Kriegsblockade entgegenzuwirken. Putin wies darauf hin, daß dies ein Modell für seine gegenwärtige Politik sei, die Ressourcen Sibiriens und des Fernen Ostens zu erschließen, um sich den gegenwärtigen westlichen Sanktionen zu entziehen.
Zahlreiche Wissenschaftler erinnerten an die ruhmreiche Geschichte der Akademie. Viele von ihnen wurden während der Zeremonie ausgezeichnet, darunter einige junge Wissenschaftler, die kreative Beiträge in ihren Fachgebieten geleistet haben. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch des 190. Geburtstags des großen russischen Forschers Dmitri Mendelejew, des Entdeckers des Periodensystems der Elemente, gedacht.

Wladimir Putin (links) im Gespräch mit Gennadi Krasnikow (rechts), Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften, am 30. Januar 2024.
Die Russische Akademie der Wissenschaften hat seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sehr schwierige Zeiten durchlebt. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch 1991 wurde Rußland der „Wild-West“Kapitalismus aufgezwungen, der einen Großteil der in der Sowjetzeit aufgebauten materiellen Wirtschaft zerstörte. Die Akademie verlor viele ihrer Funktionen und wurde weitgehend dezimiert, während viele Wissenschaftler in den Westen emigrierten, weil sie in der zerschlagenen und an ausländische Meistbietende verkauften Industrie keine Arbeit mehr fanden. Dieser Wissensverlust hat der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Rußlands schweren Schaden zugefügt.
Doch Rußland hat sich allmählich aus dieser Talsohle herausgearbeitet, und die jüngsten Maßnahmen der Regierung Putin, die Rolle der Akademie im Rahmen einer neuen Anstrengung zur Entwicklung Sibiriens zu stärken, haben diesen Prozeß weiter beschleunigt. Auch haben sich die Beziehungen Rußlands zu den Ländern des globalen Südens und insbesondere zu seinem wichtigsten Nachbarn China deutlich intensiviert, während der kollektive Westen versucht, Rußland wegen des Ukraine-Krieges zu „isolieren“.
In seiner Rede sagte Putin, daß die Akademie nun mehr Mittel erhalte und er die finanzielle Unterstüt-
zung für Wissenschaftler erhöht habe.1 Es sei auch notwendig, „die Rolle der Akademie bei der Entwicklung und Koordinierung der Grundlagenforschung zu stärken und die wissenschaftliche und methodische Beratung der Forschungszentren und Universitäten unseres Landes durch die Akademie deutlich zu verbessern. Sie müssen den hohen Standards unserer Zeit, den Standards des 21. Jahrhunderts und der Geschwindigkeit des technologischen Wandels in der Welt entsprechen.“
Seit den schwierigen Zeiten der 1990er Jahre, von den Akademikern „Zeit der Unruhen“ genannt, war Rußland ständig gezwungen, seinen Bedarf, insbesondere an Hochtechnologiegütern, auf dem „globalen Supermarkt“ zu decken, wie Gennadi Krasnikow, Präsident der Akademie, es nannte. Nachdem der Westen Rußland von diesem Markt abgeschnitten hat, werde Rußland diese Güter nun selbst produzieren und eine eigene „technologische Souveränität“ erlangen.
Die Akademie wird nach dem Willen Putins noch stärker in die Entwicklung des Landes eingebunden, vor allem bei Entwicklungsprojekten, aber auch in den Bereichen Verkehr, Verteidigung, Medizin, Bildung und darüber hinaus. Als Zeichen dieser Einbindung ernannte Putin Krasnikow zum Mitglied des russischen Sicherheitsrates und rückte damit die Akademie näher an die Entscheidungsprozesse der Regierung heran.
Die Akademie hat schon immer internationale Beziehungen gepflegt. In ihren Anfängen war sie auf die Unterstützung ausländischer Wissenschaftler angewiesen, wobei Persönlichkeiten wie Daniel Bernoulli, Leonhard Euler und Joseph-Nicolas Delisle eine wichtige Rolle spielten, bis russische Forscher wie Michail Lomonossow in hohe Positionen aufstiegen. Interessant ist hierbei auch die Begegnung von Benjamin Franklin und Ekaterina Daschkowa, der ersten weiblichen Präsidentin der Akademie, 1782 in Paris, wonach zuerst
1 Putin wörtlich: „In diesem Jahr sind die Haushaltsmittel zur Finanzierung der Akademie der Wissenschaften im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf fast sechs Milliarden Rubel gestiegen. Auch die monatlichen Zahlungen an Akademiker und korrespondierende Mitglieder wurden um 50 Prozent erhöht. Ich denke, das ist nicht genug. Ich schlage hier eine andere Lösung vor, nämlich die Verdoppelung dieser Zahlungen im Vergleich zu 2023. Ich kann Ihnen hier im Saal die Zahlen nennen. Ein Akademiker wird 200.000 Rubel pro Monat erhalten, ein korrespondierendes Mitglied 100.000 Rubel.“

Franklin Daschkowa zum Mitglied der American Philosophical Society einlud und anschließend Daschkowa Franklin zum Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften ernannte. Heute hat die Akademie 144 nicht-russische Mitglieder aus 55 Ländern. Was Leibniz im Sinn hatte, wird heute auf globaler Ebene mit der Entwicklung der Beziehungen zwischen Rußland und China und dem Aufstieg des globalen Südens immer mehr zur Realität. Leider ist unter den westlichen Nationen der Geist von Leibniz und seiner „Gemeinschaft der Völker“ fast verschwunden, und der brutale Geist des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) ist zum vorherrschenden Element des westlichen Denkens geworden. Wissenschaft ist von Natur aus aber universell. Eine Entdeckung, die irgendwo auf der Welt von einem Einzelnen gemacht wird, kann den Men-
Der russische Präsident Wladimir Putin spricht zu den Gästen der Gala zum 300. Jahrestag der Gründung der Russischen Akademie der Wissenschaften am 8. Februar 2024.
schen überall zugute kommen. Umgekehrt schadet der Versuch, den wissenschaftlichen Austausch einzuschränken, der gesamten Menschheit.
Es ist zu hoffen, daß die Schrecken, die der anhaltende Krieg der NATO in der Ukraine und der völkermörderische Krieg Israels in Gaza verursacht haben, die Menschen im Westen wieder auf die wahren Wurzeln ihrer eigenen Zivilisation zurückführen, die auf der Goldenen Renaissance des 15. Jahrhunderts basiert. Diese Tradition ist sowohl in China als auch in Rußland sehr lebendig, wo das Werk von großen Denkern heute öffentlich gefeiert wird. Nur wenn sich der Westen dieser Tatsache wieder bewußt wird, können wir das erreichen, was Leibniz wollte: eine echte Gemeinschaft von Nationen, die für die gemeinsamen Interessen der Menschheit zusammenarbeiten.

Jürgen Schöttle, geboren 1942, ist Diplom-Ingenieur für Kraftwerkstechnik und war bei der AEG-Telefunken angestellt, dessen Kraftwerksparte später gesondert zur Kraftwerk Union AG ausgelagert wurde und derzeit durch die Siemens Energy AG vertreten wird.
Schöttles Arbeit im Kraftwerkbau fiel in die Blütezeit der zivilen Kernkraftnutzung in Westeuropa. Heute setzt er sich vehement in der Öffentlichkeit für die Kernkraft als Energiequelle ein. FUSION konnte ihn für ein schriftliches Interview gewinnen.
Herr Schöttle, Sie haben als Diplom-Ingenieur für Kraftwerkstechnik die Konstruktion vieler deutscher Kernkraftwerke überwacht beziehungsweise begleitet. Sie sind längst im Ruhestand und sind doch weiterhin ein leidenschaftlicher Fürsprecher für das industrielle Potential Deutschlands. Was treibt Sie an?
Diese Frage stelle ich mir auch, insbesondere wenn mir meine Freunde und Bekannte häufig erklären, daß mein Handeln ohnehin nichts verändert. Doch die Hoffnung, etwas zum Besseren zu verändern, stirbt zuletzt.
Mir ist bewußt, daß Energie in der heutigen Zeit die Grundlage unseres modernen Lebens ist und die Energiegewinnung mit unserem Lebensraum vereinbar sein muß. Das gilt übrigens weltweit.

„Spezialisten“ über die technologische Entwicklung von modernen Energieerzeugungsanlagen. Mit den umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen über die Planung, den Bau und den Betrieb von Kraftwerken bin ich der Ansicht, daß eine zukünftige Energieerzeugung nur in einem Mix aus sogenannten erneuerbaren Energien mit neuen Technologien Bestand haben wird. Der deutsche Weg mit der derzeitigen Energiewende ist volkswirtschaftlich nicht machbar, da nicht finanzierbar, und wir verlieren mit jedem Tag mehr den Anschluß an die dynamische Entwicklung neuer Technologien in anderen Ländern.
Diplom-Ingenieur für Kraftwerkstechnik Jürgen Schöttle.
In meiner Berufszeit konnte ich mir über alle Arten der Energieerzeugung grundlegende Kenntnisse aneignen, was bei der heutigen Spezialisierung und Marktaufteilung in Erzeugung, Transport und Verteilung von Strom in dieser Vielfalt gar nicht mehr möglich ist. Damit bin ich mit meinen 82 Jahren einer der wenigen
Was mich antreibt, ist die Zukunft von Deutschland und die Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen, meinen Kindern und meinen Enkeln.
Stichwort Entwicklung: Die Reaktorkonzepte der Kernkraft sind ja keineswegs stehengeblieben. Was unterscheidet die Kernreaktoren der zweiten Generation von der dritten Generation? Mittlerweile wird ja an der vierten Generation geforscht… Jg. 45, 2024, Nr. 1
Die zweite Generation von Kernreaktoren waren die ersten kommerziellen Kernkraftwerke. Diese Anlagen wurden so gegen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahren gebaut und in Betrieb genommen. Das war die Technik der damaligen Kohlekraftwerke, wobei der Kohlekessel durch ein nukleares Dampferzeugungssystem ersetzt wunde. Fast alle Komponenten entsprachen der damaligen Industriequalität.
Die beim Bau und Betrieb gemachten Erfahrungen wurden dann in der westlichen Welt systematisch erfaßt, ausgewertet und bei der Auslegung, Konstruktion und Fertigung der Generation 3 berücksichtigt. Anlagen der Generation 2 wurden zum großen Teil auch mit diesen neuen Erkenntnissen nachgerüstet. Um dafür ein paar Stichworte zu nennen: Entwicklung neuer Reaktorwerkstoffe, Prüfmethoden, Anforderungen an den Brandschutz, Auswirkungen von Rohrleitungsversagen, Versagen von Einzelkomponenten, wie Rohrleitungen, Behälter, Armaturen, Pumpen, der Steuerung, Störfallbetrachtung bei Erdbeben, Hochwasser, Gaswolke, Flugzeugabsturz und Terrorismus.
Die Anlagen der dritten Generation bekamen massive, robuste Gebäudestrukturen, die ReaktorSicherheitssysteme wurden dreifach redundant und diversitär aufgebaut. Die Generation 3+, wie der EPR der AREVA, wurde zusätzlich mit einem „Core Catcher“ [Auffangsystem] ausgestattet, der beim Kernschmelzen ein Durchbrennen des Reaktorgebäudefundamentes verhindert. Die neuesten Reaktoranlagen der Generation 3+, wie der AP1000, Hualong One und der WWER-1000, haben passive Notkühlsysteme, die den Einsatz von Notstromanlagen bei Anlagenstörungen oder einem Netzausfall unnötig machen.
Reaktoranlagen der Generation 4 arbeiten mit drucklosen Reaktorkühlsystemen mittels Gasen, Salzen oder flüssigen Metallen, haben höhere Kühlmitteltemperaturen, der Kernbrennstoff ist fest oder auch flüssig. Durch die Reaktorgröße und die Bauart ist keine aktive Notkühlung notwendig. Der THTR zum Beispiel, der Kugelhaufenreaktor, eine deutsche Entwicklung, ist ein Generation-4-Reaktor und ist als 100-MW-Block bereits kommerziell im Betrieb; weiterhin gibt es einen 1 Megawatt starken „Dual-Fluid-Reaktor“ als Versuchsreaktor – beide stehen übrigens in China.
Reaktoren der Generation 4 sind wegen ihrer Sicherheit und hohen Prozeßtemperaturen auch im

Der Core Catcher („Kernfänger“) des EPR ist entwickelt worden, um im Falle einer Kernschmelze des Reaktorkerns sowohl den Boden des Reaktorgebäudes zu schützen als auch die resultierende Hitze schnell abzuführen. Der Fänger besteht aus einem großen Auffangbecken unterhalb des Druckbehälters, einem Löschkanal und einem Verschluß am Tiefpunkt des Reaktorbehälters (a). Dazu wird im Notfall die Schmelzmasse durch den Kanal im Auffangbecken ausgelassen, das passiv gekühltund mit hitzebeständigen Kacheln bedeckt ist (b). Ebenso ist es möglich, umgekehrt über den Löschkanal den Druckbehälter selbst mit Kühlwasser extern zu fluten, um die weitere Hitzeentwicklung bei einem extremen Störfall zu unterbinden (c).

urbanen und industriellen Umfeld einsetzbar, und dadurch ist auch die Abwärme bei der Stromerzeugung bzw. für die Beheizung von Gebäuden nutzbar.
Die Nachzerfallsprodukte des verbrauchten Kernbrennstoffes erfordern eine Endlagerzeit von nur noch 300 Jahren. Weltweit befassen sich ungefähr 70 Start-Up-Unternehmen mit Reaktoren der Generation 4.
Sie kennen die Kernkraftwerke von Innen heraus. Wie stark hat sich die Unfallsicherheit der Reaktoren in den letzten 40 Jahren verändert?
Die ersten Reaktoren der Generation 2 hatten eine Sicherheit von 5 · 10-4, das heißt alle 5000 Betriebsjahre mußte statistisch mit einem schweren Störfall gerechnet werden. Durch die schon geschilderten Maßnahmen konnte diese Sicherheit kontinuierlich verbessert werden, so daß die heutigen Reaktoranlagen um den Faktor 1000 verbessert werden konnten.
Der AP 1000 der amerikanischen Firma Westinghouse wird mit einer Sicherheit gegen schwere Störfälle mit 2,41 · 10-7 angegeben, also alle 24 Millionen Betriebsjahre ein schwerer Störfall.
Längst geht es in der deutschen Energiepolitik nicht mehr um Energiewachstum, sondern höchstens um Ersatz vorhandener Energiequellen. Welche Zukunft hat ein Land, das energetisch nicht mehr wachsen will?
Für die Zukunft ist in Deutschland mit keinem Energiewachstum zu rechnen, eher mit dem Gegenteil, wobei
Schematische Darstellung eines Salzschmelzreaktors der vierten Generation.
aber von einem weltweiten, erheblichen Wachstum auszugehen ist.
Existentiell für Deutschland sind die Energieeffizienz und vor allen Dingen die Energiekosten. Mit einer kontinuierlich verbesserten Effizienz können wir auch wachsen, das bedingt aber Innovation in allen Bereichen. Deswegen sage ich bei meinen Vorträgen auch immer, Deutschland muß in Zukunft massiv in Bildung und Forschung investieren. Bei der Bildung liegen wir leider nicht mehr auf den vorderen Plätzen.
Was bedeutet die vollständige Ausschaltung aller deutschen Kernkraftwerke für Deutschland und Europa?
Kernenergie ist die die preiswerteste Art, Energie zu erzeugen. Die Stromerzeugungskosten von Kernkraftwerken liegen bei 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde, also um den Faktor 5 bis 10 niedriger als bei den „erneuerbaren Energien“. Bei den Strompreisen ist es dann der Faktor 2 bis 3. Dieser Umstand ist fatal bezüglich unseres Wohlstands und der weltweiten Konkurrenzfähigkeit.
Wir sind ein Land ohne wesentliche Rohstoffe, deswegen leben wir ganz entscheidend von der Innovation unserer Wissenschaft und Wirtschaft. Energieerzeugung ohne einen Mix mit neuen Technologien hat keine Zukunft. Wir haben in Deutschland schon vor ungefähr 35 Jahren aufgehört im nuklearen Bereich zu forschen, zu entwickeln und zu bauen – ein Riesenfehler. Als wirtschaftlich stärkstes EU-Land und mit unserer bisherigen Vorbildfunktion befürchte ich, daß wir auch den Rest der EU wirtschaftlich mit in die Tiefe ziehen.
Es ist schon verwunderlich, daß wir der übrigen Welt die Kernenergie überlassen und wir durch Ausbau von Solar- und Windanlagen enorme Material-Ressourcen in Anspruch nehmen und die Natur nachhaltig verunstalten.
Ist die sogenannte „Energiewende“ überhaupt technisch umsetzbar?
Die deutsche Energiewende ist nicht bezahlbar und wird an der Finanzierbarkeit scheitern. Der Materialund Metalleinsatz für Solar- und Windanlagen samt Batterien für die Frequenzstützung, Sekunden- und Minutenreserve sowie der Wasserstofferzeugung für die notwendigen Backup-Anlagen ist etwa fünf- bis zehnmal so hoch wie bei den Kernkraftwerken und wird die Rohstoffpreise für diese Materialien und Metall weiter massiv ansteigen lassen.
Der Erntefaktor EROI (Energy Returned on Energy Invested) liegt vergleichbar bei Solaranlagen bei 1,6, bei Windanlagen bei 4,6, bei den neuen Kernrektoren der Generation 3+ bei über 100 und bei den G4-Anlagen über 2000. Der EROI beschreibt das Verhältnis der im Verlaufe der Lebensdauer eines Kraftwerks insgesamt erzeugten Energie zur eingesetzten Energie.
Nach neuesten Informationen des Bundesrechnungshofs wird die Energiewende wohl an der Kostenexplosion scheitern. Wie schätzen Sie die Aussicht ein?
Um die Energiewende mit den Klimazielen entsprechend dem Deutschen Klimaschutzgesetz von 2021 umzusetzen, benötigen wir jährlich einen Investitionsaufwand von 200 bis 300 Milliarden Euro. Bis 2045 wären dies dann weit über 5000 Milliarden Euro. Dies läßt sich übrigens mit dem einfachen Dreisatz gut berechnen.
Da auch nach diesen kurzlebigen Investitionen mit hohen Energiekosten zu rechnen ist, sind das finanztechnisch keine Investitionen, sondern Subventionen, und ich bin mir sehr sicher, daß dies mit einem massiven Bonitätsverlust von Deutschland einhergehen wird, und die Gefahr besteht, daß wir die Euro-Länder mitreißen.
Sagen wir, die Bundesregierung käme morgen zur Besinnung und begreift die Notwendigkeit der Kernkraftnutzung in Deutschland. Wäre es technisch überhaupt möglich, daß das Land wieder in die Kernkraft einsteigt?
Die Parteien werden sich in einer Demokratie immer nach der Meinung der Bevölkerung richten, sie wollen ja gewählt werden. Das heißt, die Bundesregierung wird kein Programm gegen die politische Mehrheit der Bevölkerung beschließen. Nach 40 Jahren Widerstand, Protest und Medienschelte gegen Kernenergie mit Begriffen wie „kein Endlager“, „unverantwortlich“, „unbezahlbar“, „teuflisch“, sehe ich heute keine Basis für einen Wiedereinstieg in die Kernenergie.
Ich rechne mit einem schweren Niedergang der deutschen Industrie verbunden mit massiven Wohlstandsverlusten der Bevölkerung, beschleunigt durch die momentanen Kriegsereignisse. Erst nach einem solchen Niedergang ist ein Umdenken in der Bevölkerung vorstellbar.
Außer einer möglichen Wiederinbetriebnahme der letzten 3 bis 6 stillgelegten Reaktoranlagen sehe ich in den nächsten 4 bis 5 Jahren keinen politischen Beschluß zum Bau neuer Kernkraftwerke. Durch das Fehlen einer kerntechnischen Industrie in Deutschland und auch in Europa insgesamt ist ein Neubau mit einer Inbetriebnahme vor dem Jahr 2035 nicht zu rechnen. Damit bleiben uns in Deutschland vorerst nur „erneuerbare Energien“ und thermische Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen samt CO2-Abscheidung und CO2Verpressung.
Die heutige Planung von Gas-Backup-Kraftwerken mit einer Wasserstoffwirtschaft wird sich aufgrund des schlechten Rückverstromungswirkungsgrades von ungefähr 20 Prozent nicht durchsetzen.
Energiepolitik ist nur langfristig planbar und benötigt eine Planungssicherheit von mindestens 50 Jahren, eine Vorplanungs-, Genehmigungs- und Errichtungszeit von 15 bis 20 Jahren und eine Zeit der Abschreibung der Anlagen von mindestens 30 Jahren. Sehr viele Länder planen weltweit den Neubau moderner Kernkraftwerke. Unter den Industrienationen macht nur Deutschland eine Ausnahme, mit einem bereits absehbaren wirtschaftlichen Niedergang.
Bill Jones hat bei dem Manhattan Project Dialogue am 30. Dezember 2023 den folgenden Vortrag gehalten, den wir hier etwas gekürzt und bearbeitet wiedergeben.
Ich möchte Ihnen einmal schildern, welche Möglichkeiten in einer Organisation wie der unseren stecken, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Die meisten Menschen kennen die Strategische Verteidigungsinitiative oder haben von ihr gehört. Sie wissen wahrscheinlich etwas über die Schlüsselrolle, die Lyndon LaRouche bei der Beratung von Präsident Reagan über dieses Friedensprojekt mit der Sowjetunion im Jahr 1983 gespielt hat. Was sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, welche Rolle die LaRouche-Organisation in den USA bei der Durchsetzung des sogenannten Magnetic Fusion Energy Engineering Act of 1980 gespielt hat.
Viele wissen, was die Kernfusion ist, denn gerade im letzten Jahr gab es einen wichtigen Durchbruch bei dem Laserfusionsprogramm im Lawrence Livermore Laboratory. Plötzlich war es überall in den Nachrichten: „Die Fusionsenergie ist die Energie der Zukunft.“ Selbst jemand wie der US-Umweltbeauftragte John Kerry hat auf dem verrückten COP28-Gipfel in Dubai 2023 zur Entwicklung der Fusionsenergie aufgerufen. Kaum bekannt ist jedoch, daß das eben erwähnte Fusionsenergiegesetz von 1980 größtenteils von einem

Teil der LaRouche-Organisation, der Fusion Energy Foundation (FEF), in den US-Kongreß eingebracht und unterstützt wurde. Es wurde im Senat und im Repräsentantenhaus verabschiedet und dann von Jimmy Carter, der eigentlich ein Kernkraftgegner war, unterzeichnet. Das Gesetz sah die Entwicklung eines Reaktorprototyps bis 1990 vor, also innerhalb von zehn Jahren, und bis zum Jahr 2000 den Bau eines kommerziellen Reaktors, um die Haushalte in den Vereinigten Staaten mit Wärme und Strom zu versorgen. Das hätte vor 23 Jahren sein sollen. Das Gesetz wurde von Carter unterzeichnet, aber von Präsident Reagan nicht weiterverfolgt.
Ich möchte kurz erläutern, wie es dazu kam, daß eine kleine Gruppe von Menschen solche enorme Veränderungen bewirken konnte.
Eine der ersten Ausgaben des Magazins Fusion der „Fusion Energy Foundation“.
Die FEF wurde in den 1970er Jahren von Lyndon LaRouche und Mitgliedern seiner Organisation gegründet, aber das war am Anfang eine sehr unscheinbare Sache. LaRouche, der damals schon seit einigen Jahren Vorlesungen an amerikanischen Universitäten gehalten hatte, interessierte Leute wie mich, Paul Gallagher und andere für seine Ideen, Leute, die durch die Opposition zum Vietnamkrieg,
Jg. 45, 2024, Nr. 1
durch den Kampf der Bürgerrechtsbewegung und den Wunsch nach sozialem Wandel aktiviert waren. Er zeigte uns eine sehr viel breitere Perspektive, die sich auf die globale wirtschaftliche Entwicklung konzentrierte. Das heißt, LaRouche, der im Zweiten Weltkrieg in Indien diente und dort das große Elend und die Unterdrückung durch die Briten gesehen hatte, kam als Veteran in die Vereinigten Staaten zurück und war entschlossen, daß wir amerikanische Methoden und Techniken nutzen müßten, um die Länder der Dritten Welt zu industrialisieren, damit auch sie unseren Wohlstand erlangen können. Das war es, was Leute wie mich an der LaRouche-Bewegung reizte. Die Frage der Entwicklung war also von Anfang an präsent.
Anfang der 1970er Jahre war die Kernfusion nur unter Leuten bekannt, die wissenschaftlich auf diesem
Gebiet tätig waren, aber in den nationalen und internationalen Medien wurde darüber nicht viel diskutiert.
Einige in unserer Organisation entdeckten damals in einer wissenschaftlichen Zeitschrift einen kurzen Hinweis auf die Fusionsenergie, die bis 1958 sogar noch ein Geheimprogramm war, sowohl in den USA als auch in der Sowjetunion, wo ebenfalls daran gearbeitet wurde. Aber in den 1970er Jahren wurde die Diskussion darüber stärker, und wir fanden es sehr interessant, daß die Kernfusion mit LaRouches Entwicklungsperspektive übereinstimmte – unbegrenzte Energieressourcen wären eine wunderbare Sache.
Wir verteilten daraufhin in Greenwich Village ein Flugblatt mit der Aufforderung an die US-Regierung, die Entwicklung der Fusionsenergie zu forcieren. Eines dieser Flugblätter landete im „Courant Institute of Mathematics“, das direkt in Greenwich Village in der Nähe
Astronaut Neil Armstrong (1930–2012), der erste Mensch auf dem Mond, hat im Jahr 1981 folgendes Plädoyer für die Fusionsenergie abgegeben – ein Jahr, nachdem das Fusionsgesetz den Kongreß passiert hatte, aber gestoppt wurde, weil die Reagan-Regierung meinte, nicht die Regierung, sondern die Privatwirtschaft sei dafür zuständig, die Kernfusion zu einer kommerziellen Energiequelle zu entwi kkeln.
„[Die Mondlandung] war ein unvergeßlicher Moment, nicht nur für mich, Neil Armstrong, sondern für uns alle. Es war der Höhepunkt einer langen und großen Anstrengung, die den Einsatz von Hunderttausenden von Menschen erforderte und Milliarden von Dollar kostete. Aber es hat sich mehr als ausgezahlt: mit neuen Erkenntnissen über unser Universum, mit

neuen Technologien, mit nationalem Stolz und Sicherheit. Aber ich bin nicht hier, um über diese Bemühung zu sprechen. Ich möchte Ihnen von einer anderen Bemühung erzählen, die vielleicht noch schwieriger zu erreichen ist, die uns aber noch mehr Nutzen bringen kann, wenn wir erfolgreich sind: Die Suche nach einer unerschöpflichen Quelle billiger, sauberer und sicherer Energie – der Fusionsenergie. Stellen Sie sich vor, was das bedeuten könnte. Unbegrenzte Energie, ohne dafür Schlange stehen zu müssen, ohne den Boden umzugraben, ohne die Luft zu verpesten, ohne die Meere zu verschmutzen, ohne mit anderen Ländern darüber verhandeln zu müssen. Wenn die Suche nach der Fusionsenergie erfolgreich ist, wäre dies ein wahr gewordener Traum.“
des Washington Square Park liegt. Einer der Wissenschaftler am Courant-Institut, der sich seit den 1950er Jahren mit der Fusionsforschung befaßte, war völlig verblüfft, daß ein paar Leute auf der Straße Flugblätter verteilten, in denen die Entwicklung der Fusionsenergie gefordert wurde. Also lud er sie ein, um über unsere Kenntnisse und unsere Arbeit zu sprechen. Natürlich waren wir keine Experten auf dem Gebiet der Fusionsenergie, der Professor hingegen schon, aber er war beeindruckt von der Tatsache, daß dieses Thema zumindest im kleinen Rahmen zu einer öffentlichen Bewegung wurde.
Er erzählte uns also, was die Forschung ergeben hatte, nachdem sie nicht mehr geheim war. Dadurch öffnete sich uns eine Tür zu Leuten, von denen wir damals noch nicht wußten, wie offen sie für die Unterstützung einer weltweiten Entwicklungspolitik durch ein Fusionsenergie-Entwicklungsprogramm waren. Das waren nicht nur Leute am Courant-Institut, sondern auch am Lawrence Livermore Laboratory, in Princeton, in Oak Ridge, praktisch überall dort, wo Experimente zur Kernfusion durchgeführt wurden.

Nach weiteren internen Diskussionen kamen wir zu dem Schluß, daß sich die LaRouche-Organisation mit diesem Thema befassen sollte, und so gründeten wir 1974 zusammen mit einigen aktiven Wissenschaftlern die „Fusion Energy Foundation“. Diese gemeinnützige Organisation sollte die Entwicklung der thermonuklearen Fusionsenergie fördern. Gleichzeitig gab die FEF ein monatlich erscheinendes Magazin mit dem Titel Fusion heraus, in dem wir und andere Fusionsforscher nichttechnische Artikel für die breite Öffentlichkeit verfaßten, um zu erklären, worum es bei der Fusionsenergie geht.
Meine Frau Marsha Freeman, die vor einigen Monaten verstorben ist, war viel an dieser Arbeit beteiligt. Sie sagte immer, daß man den meisten Menschen erst einmal erklären müsse, worum es bei der Kernfusion eigentlich gehe, denn viele kannten nur die Kernspaltung. Das Fusion -Magazin war also ein Aufklärungsprojekt, das wir überall in den USA starteten. Wir stellten uns an viele verschiedene Orte, in Einkaufszentren, Postämter, Arbeitsämter. Damals hatten wir sogar die Möglichkeit, Informa -
US-Abgeordneter
Mike McCormack
tionstische in Flughäfen aufzustellen. Im Laufe der Jahre, bis etwa 1977, entwickelte sich so eine Unterstützerbasis, die in die Zehntausende ging. 1980 hatte Fusion bereits 80.000 Abonnenten. Das war natürlich für eine Wissenschafts-Zeitschrift, die sich nicht an Fachleute richtete, unerhört. Es zeigte, daß es ein enormes Interesse an der Fusionsenergie gab. Aber es war auch wichtig, nach Washington zu gehen. Wenn etwas erreicht werden sollte, mußte ein Gesetz verabschiedet werden, das die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellte, damit die Fusionsenergie so schnell wie möglich entwickelt werden konnte. Wir verbrachten viel Zeit auf dem Capitol Hill. Wir kamen in Kontakt mit einem Abgeordneten des Bundesstaates Washington, Mike McCormack, der ein technisches Verständnis hatte. In diesem Bundesstaat befindet sich die Hanford-Anlage, eine der vier großen Nuklearanlagen, die aus dem Manhattan-Projekt hervorgegangen sind. Die damalige Washingtoner Gouverneurin, Dixy Lee Ray, war eine starke Befürworterin sowohl der Kernenergie als auch der Fusionsenergie. Sie war neugierig auf diese LaRouche-Gruppe, die überall ihre Flugblätter verbreitete. Die einzige Frage, die sie den Leuten stellte, die ihr von unseren Aktivitäten erzählten, war, ob wir ernsthaft an der Kernfusion interessiert seien. Ja, das seien sie. Zu diesem Zeitpunkt waren alle sehr aufgeschlossen und stellten uns das Material zur Verfügung, das sie selbst hatten, um uns bei
unserem Versuch zu helfen, die Öffentlichkeit über die Fusionsenergie zu informieren.
Marsha stand insbesondere mit McCormack in Kontakt, der einen Gesetzesentwurf zur Entwicklung der Fusionsenergie vorlegen wollte – ähnlich dem Manhattan-Projekt zur Entwicklung der Atombombe. Das war keine leichte Aufgabe. 1976 hatte die US-Regierung von Gerald Ford auf Jimmy Carter gewechselt, und die Carter-Administration war in vielerlei Hinsicht eine wirtschaftspolitische Horrorshow. Sie verfolgte eine Nullwachstumspolitik und wollte den Konsum einschränken. Obwohl Carter einmal auf einem Atom-UBoot gedient hatte, war er ein entschiedener Gegner der Atomenergie. Allerdings hatte er ein Faible für die Kernfusion.
Zu Beginn der Carter-Administration gab es noch die Energy Research and Development Administration, die später zum Energie-Ministerium wurde. Dort war man von der Fusionsenergie nicht sonderlich begeistert. Zwar wurden laufende Programme der Vorregierung bis zum Amtsantritt Carters noch ausreichend finanziert, aber unter Carter gab es Leute wie James Rodney Schlesinger, manchmal auch „Dr. Strangelove“ genannt, und seinen Assistenten John Deutch, die gegen ein schnelles Programm zur Entwicklung der Kernfusion waren. Einer, der von der Ford-Administration zur Carter-Administration wechselte, war Edwin Kintner, der in dieser Übergangsphase das Fusionsprogramm leitete. Kintner kam aus dem Nuklearprogramm von Admiral Hyman Rickover, der das erste Atom-U-Boot entwickelt hatte; er stand Rickover sehr nahe und besaß viele der Eigenschaften von Rickover. Admiral Rickover war in vielerlei Hinsicht der Vater der Atomprogramms der Seestreitkräfte, und viele der Leute, die in den frühen 1950er Jahren in dem Atomforschungsprogramm tätig waren, wechselten später in die Fertigung und blieben in der Privatwirtschaft aktiv. Kintner stand uns sehr nahe, weil er wie wir von der Kernfusion begeistert waren. Er war sehr hilfreich, um unsere Sache in Washington voranzubringen.
Unsere Aktivitäten waren entscheidend für die schon genannte Gesetzgebung. Insbesondere der Abgeordnete McCormack war derjenige, der sich stark für die Sache engangierte und viele unserer Ideen für die Entwicklung des Programms aufgriff. Aber er erkannte auch, daß seine Kongreß-Kollegen und seine Wählerschaft im Allgemeinen wenig darüber wußten. Es ging also darum, die anderen Kongreßabgeordneten aufzuklären. Es gab viel Lob -
byarbeit und Diskussionen mit einzelnen Abgeordneten. Aber noch wichtiger war, daß wir Zehntausende Abonnenten für das Fusion hatten. In jedem Bundesstaat gab es Fusion -Abonnenten, darunter Landwirte, Arbeiter und andere, aber auch Leiter von Kraftwerken, und Personen aus den Regierungsinstitutionen. Und wir haben dieses Netzwerk mobilisiert: Tausende Fusion -Leser schickten Post an ihre Abgeordneten im Kongreß, um sie aufzufordern, für den Gesetzesentwurf von Mike McCormack zu stimmen. Das führte dazu, daß all diese Abgeordneten, von denen viele nicht einmal wußten, worum es bei der Kernfusion ging, unter Druck kamen, etwas dafür zu unternehmen. Ähnliches passierte im Senat: Marsha Freeman und andere besuchten Senatoren, um mit ihnen über das Fusionsprogramm zu sprechen, und wiederum wurden die Menschen in ihren Wahlkreisen mobilisiert, ihren Senatoren zu schreiben und sie zu ermutigen, dem Gesetz zuzustimmen. 1979 wurde der Gesetzesentwurf, der den Bau eines Prototypreaktors bis 1990 und eines kommerziellen Reaktors bis 2000 vorsah, sowohl vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat verabschiedet. Das Gesetz wurde dann an das Weiße Haus weitergeleitet. Wahrscheinlich zur Überraschung vieler, vielleicht sogar vieler damaliger Kongreßmitglieder, wurde es von Jimmy Carter ratifiziert und somit rechtskräftig.
1980 gab es wieder Wahlen. Und Carter verlor die Wahl, aber noch wichtiger war, daß er seine Niederlage einräumte, noch bevor die Wahllokale an der Westküste schlossen. Das hatte zur Folge, daß die Demokraten, die sich dort zur Wahl stellten, plötzlich viele Stimmen verloren, weil die meisten Wähler dort bereits wußten, daß ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl nicht mehr zählen würde, weil diese bereits entschieden war.
Auch Mike McCormack wurde abgewählt, so daß in dieser Situation die wirkliche Antriebskraft verloren ging. Ed Kintner, der darüber sehr enttäuscht war, blieb noch eine Weile im Amt und versuchte, Leute aus der Privatwirtschaft davon zu überzeugen, daß Präsident Reagan das Gesetz weiterführen müsse, weil es die einzige Möglichkeit sei, die Fusionsenergie zu entwickeln. Aber die Anhänger von Milton Friedman und der freien Marktwirtschaft wie Dave Stockman, der im Weißen Haus für den Haushalt zuständig war, argumentierten, daß das Ziel des Gesetzes der Bau eines kommerziellen Fusionsreaktors sei und daß dies nicht mit staatlicher Unterstützung geschehen sollte. Die Privaten sollten die Sache in die Hand nehmen.
Aber die Privatwirtschaft hat das damals natürlich nie angefaßt.
24 Jahre nachdem wir einen kommerziellen Reaktor hätten haben sollen, befinden wir uns immer noch in einem Anfangsstadium, obgleich es in letzter Zeit zahlreiche vielversprechende Forschungsansätze für ganz unterschiedliche Kernfusionsprojekte gibt. Das große Glück, das wir damals in den 70er Jahren hatten, war, daß viele Leute, die noch die Depression der 30er Jahre und den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, ein Bollwerk des Fortschritts bildeten. Das waren die Leute, die damals Fusion-Abonnenten waren und uns
unterstützten. Heute ist das völlig anders, weil unsere Kultur dramatisch degeneriert ist; wir erleben die Auswirkungen des Nullwachstums und des mangelnden Verständnisses für das, was in der Weltgeschichte wirklich passiert. Wir sehen das leider auch in der Raumfahrt, die immer ein Bereich der Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Ost und West war. Auch das wird jetzt unterminiert. Dennoch bin ich optimistisch, daß wir uns trotz der enormen Gefahr, die in der globalen Konfrontation mit China und Rußland liegt, in eine Richtung bewegen, in der die Opposition zu dem, was Amerika unter der Herrschaft dieser finanziell-militärischen Oligarchie geworden ist, wächst. Es wird eine Reaktion im amerikanischen Volk geben, und wir können die Dinge 2024 wieder ins Lot bringen: Das ist meine Hoffnung.

Das Fusions-Energie-Forum (FEF) ist eine überparteiliche Vereinigung, in der Wissenschaftler, Ingenieure, Studenten, aber auch Vertreter vieler anderer Berufe zusammentreffen. Sie teilen die gemeinsame Überzeugung, daß alle großen Menschheitsprobleme durch schöpferische Entdeckungen überwunden werden können. Das FEF lehnt die Nullwachstumsideologie und Technikfeindlichkeit als gefährlichen Irrglauben ab.
Mit einen Mitgliedschaft können Sie die Arbeit des FEF nachhaltig finanziell unterstützen, und Sie erhalten FUSION während Ihrer Mitgliedschaft dazu. Ihre Spenden an das FEF sind steuerlich absetzbar.
Weitere Infos finden Sie auf der FEFWebseite:
www.fef-ev.de/mitglied-werden/






Behalten Sie den strategischen Überblick in unserer wilden Zeit. Nur mit der Wochenzeitung Neue Solidarität ist dies möglich!
In der Neuen Solidarität finden Sie mehr als die gängigen Nachrichten-Bits und bekannten Standard-Meinungen. Wir behandeln die politischen, wirtschaftlichen und geistigen Entwicklungen heute, wie sonst nur der Historiker von morgen, der auf sie zurückblickt. Über die Gegenwart als gegenwärtig stattfindende Geschichte kann aber nur der schreiben, der aktiv in sie eingreift. Das tun wir, und deswegen wird die Neue Solidarität von Woche zu Woche interessanter.

Damit sie die Neue Solidarität unverbindlich kennenlernen können, bieten wir auch ein vierwöchiges Gratis-Abonnement unserer Wochenzeitung.
c Printausgabe
Deutschlandweit (90,– € pro Jahr)
Innerhalb des EWR + EFTA (120,– € pro Jahr)
Außerhalb des EWR + EFTA (150,– € pro Jahr)
Name, Vorname Straße
c Printausgabe + Online-Zugang
Deutschlandweit (100,– € pro Jahr)
Innerhalb des EWR + EFTA (130,– € pro Jahr) Außerhalb des EWR + EFTA (160,– € pro Jahr)
c Nur Online-Abonnement (50,– € pro Jahr)
c 4 Wochen gratis 0,– € (Nur für Neukunden)
Zahlungsweise
c Ich zahle auf Rechnung.
c Ich zahle per SEPA-Lastschrift:
Bitte senden an: E.I.R. GmbH, Bahnstr. 4, 65205 Wiesbaden oder nutzen Sie das Bestellsystem im Internet: https://www.eir.de/abo/nsabo/