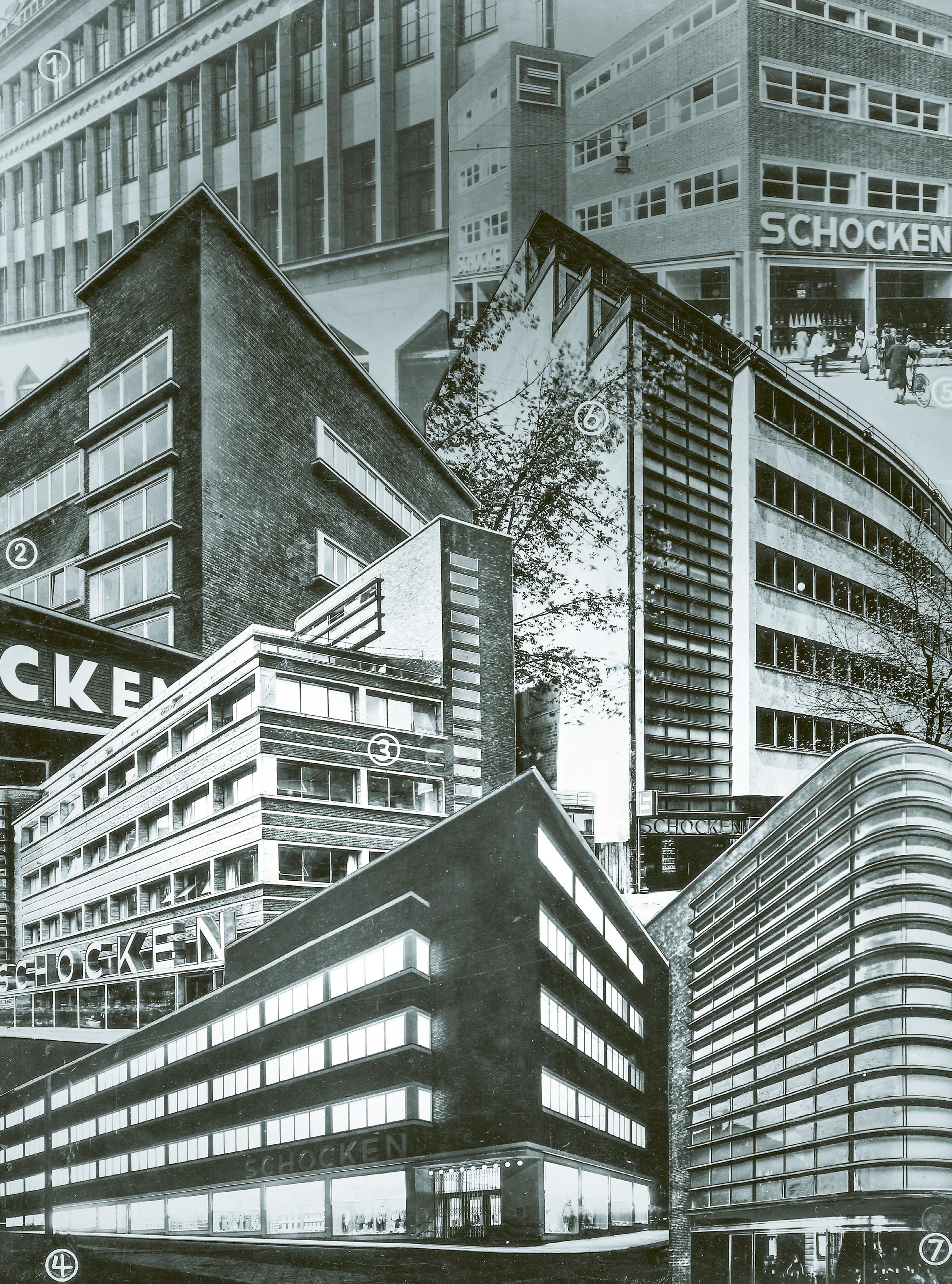

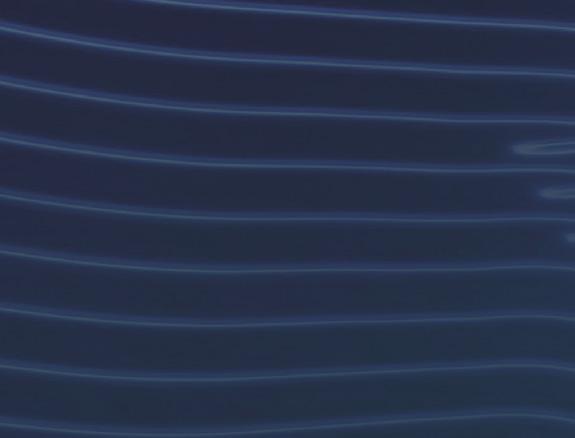



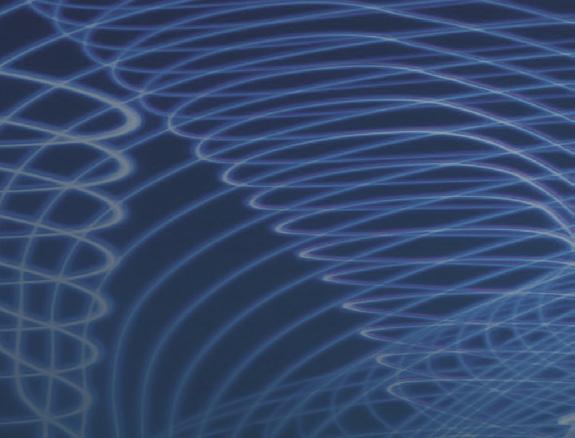

















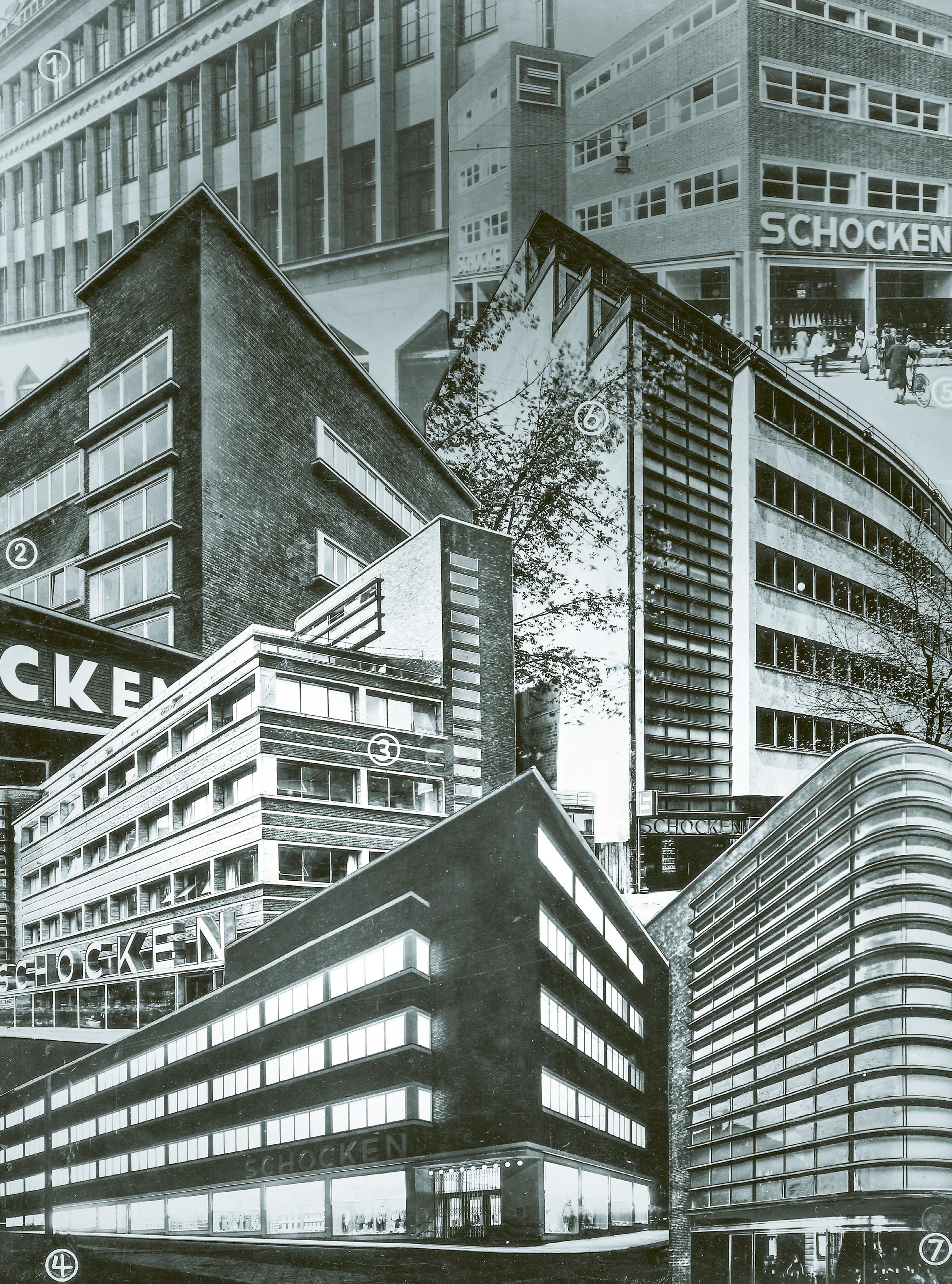

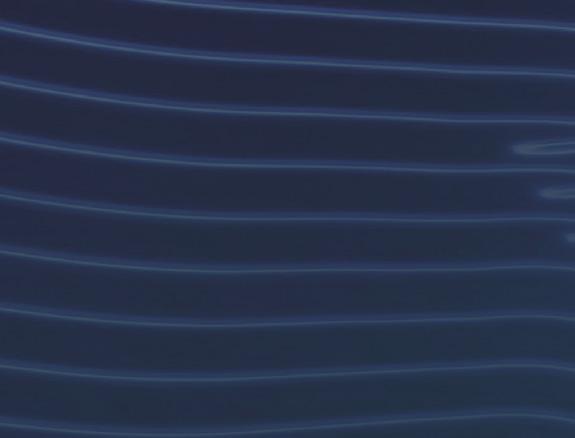



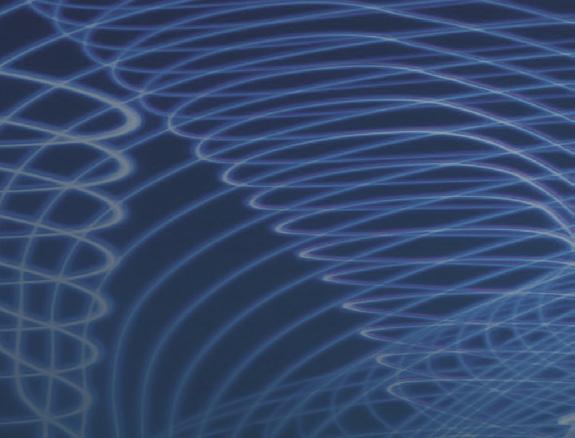
















Direktorin des Jüdischen Museums Berlin Director of the Jewish Museum Berlin
DE Verleger, Mäzen, Zionist, Kunstsammler, Kaufmann. Salman Schockens (1877–1959) unternehmerisches Wirken war von größter Bedeutung: Zum einen für die Entwicklung des modernen und zugänglichen Warenhauses, zum anderen aber für die Verbreitung eines neuen Kanons jüdischer Kultur und jüdischen Denkens, in Deutschland, in Israel und schließlich in den USA. Vor den Nazis geflohen, gründete er in Palästina und Amerika neue Verlagshäuser; in New York fanden aus Europa geflüchtete Intellektuelle bei Schocken Books ihre geistige Heimat.
65 Jahre nach seinem Tod würdigten wir im JMB sein Wirken mit der Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ und nun mit diesem JMB Journal. In dieser Ausgabe publizieren wir exklusiv den literarischen Beitrag des Pulitzer-Preisträgers Joshua Cohen zur Ausstellung. Ihn und Nachkommen von Salman Schocken begrüßten wir zu einem besonderen Abend in der Akademie des JMB, das gemeinsame Gespräch können Sie nachlesen. Markus Krah beschreibt Schockens Biografie als ein Leben „dazwischen“ –zwischen Heimat und Exil, Israel und Diaspora, Tradition und Moderne. Ein besonderes Augenmerk auf Schockens Zeit in Palästina legt Kai Sina. Dass in Jerusalem ein Garten zum Zufluchtsort der Familie wurde, erzählt Caroline Jessen in ihrem Essay. Schockens Engagement für Kunst stand im Einklang mit seiner Beauftragung progressiver Architekten und Designer – Emily D. Bilski erkundet Salman Schocken als Sammler und modernen Ästheten. Stefanie Mahrer unterstreicht sein wichtiges verlegerisches Wirken während der NS-Zeit, und Thomas Sparr widmet sich der Frage, weshalb ein jüdischer Verlag notwendig ist.
Lesen ist immer eine gute Idee! So lade ich Sie ein, zu lesen, zu lernen und ins Museum zu kommen. Hier finden Sie Angebote, die Sie durch die Generationen hindurch erreichen sollen – unsere Direktorin für Vermittlung und Digitales, Barbara Thiele, spricht darüber im Interview. Wir freuen uns auf Sie!

EN Publisher, patron of the arts, Zionist, art collector, businessman. Salman Schocken’s (1877–1959) entrepreneurial activities were of great consequence: For one thing, for the development of the modern, welcoming department store for everyone; and for another, for spreading a new canon of Jewish culture and Jewish thought in Germany, Israel, and ultimately also in the United States. After having fled the Nazis, he founded new publishing houses in Palestine and the United States. Intellectual refugees from Europe found their spiritual home at Schocken Books in New York.
Sixty-five years after his death, we are honoring Schocken’s work in the JMB with the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken and with this issue of the JMB Journal. Herein we are publishing the exclusive literary contribution to the exhibition by Pulitzer Prize winner Joshua Cohen. We welcomed him and descendants of Salman Schocken for a special evening in the JMB Academy; here you can read the conversation that transpired. Also: Markus Krah describes Schocken as having had a life “in between”— between homeland and exile, Israel and Diaspora, tradition and modernity. Kai Sina has paid special attention to Schocken’s time in Palestine. Caroline Jessen’s essay focuses on the garden in Jerusalem that became a place of refuge for the family. Emily D. Bilski explores Salman Schocken as a collector and modern aesthete—Schocken’s patronage for the arts is in line with his having commissioned progressive architects and designers. Stefanie Mahrer underscores his important publishing effort during the Nazi period; and Thomas Sparr examines the question why a Jewish publishing house is necessary.
Reading is always a step in the right direction. I invite you to read, to learn, and to visit the JMB. Our offerings in the museum aim to reach across generations. Barbara Thiele, our Director of Education and Digital Engagement, talks about that in an interview. We’re looking forward to seeing you!
Ihre / Yours,
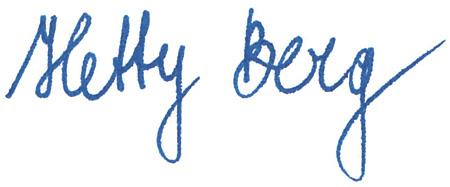
Familie Schocken am 86. Geburtstag von Isaak Schocken (zweite Reihe, Dritter von rechts). Sein Sohn Salman Schocken in der hinteren Reihe, Dritter von rechts. The Schocken family on Isaak Schocken’s 86th birthday (second row, third from the right). His son Salman Schocken is in the back row, third from the right.
Zwickau, 1924

Martina Lüdicke
Monika Sommerer
Sprechende Objekte Speaking Objects
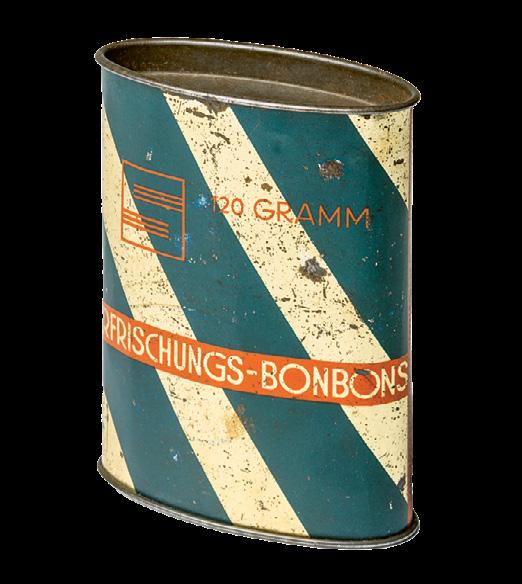
Markus Krah
Salman Schocken. Ein Leben im Dazwischen, ein Zuhause in Büchern Salman Schocken. A Life in Between, a Home in Books
Joshua Cohen, Hillel Schocken, Felix Stephan Gespräch
Kai Sina Zement & Jeremia. Salman Schocken in Palästina Cement & Jeremiah. Salman Schocken in
Preis
Caroline Jessen Gegenorte. Schockens Garten in Jerusalem Counter-sites. Schocken’s Garden in Jerusalem
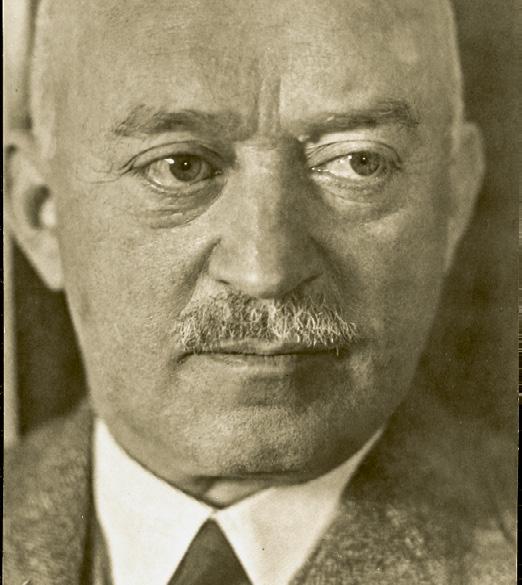

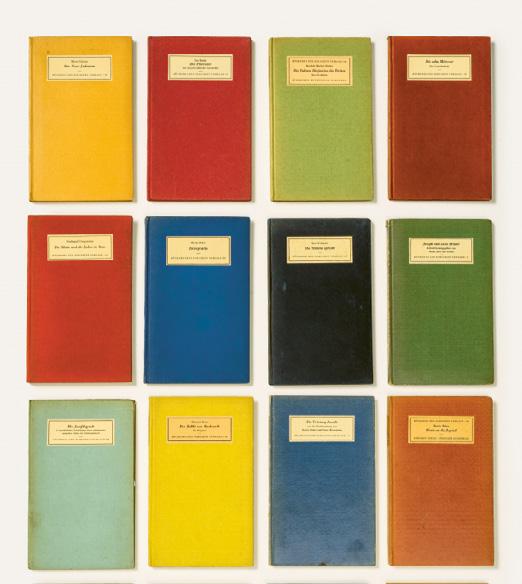
61 FREUNDE DES JMB FRIENDS OF THE JMB Momente der Verbundenheit Moments of Belonging
62
Stefanie Mahrer Prophezeiung von Trost, Verheißung von Erlösung, Kritik am Regime Prophesies of Consolations, Promises of Redemption, Criticism of the Regime 70
Ausstellungsvorschau Upcoming Exhibition
72 Emily D. Bilski Der Sammler The Collector 78
Thomas Sparr Vom Verlegen jüdischer Bücher Publishing Jewish Books
Thiele Teilhabe Participation

Zum Hören: Joshua Cohen liest seine „Inventuren“ Listen to Joshua Cohen reading his Inventories
Für die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ hat das Jüdische Museum Berlin den amerikanischen Autor Joshua Cohen eingeladen, das kulturelle Erbe des Verlegers und Kaufhausunternehmers Salman Schocken zu erkunden.
Von Waren, Büchern und Texten.
For the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken, the Jewish Museum Berlin invited the American author Joshua Cohen to explore the cultural history of the publisher and department store entrepreneur. A close look at goods, books, and texts.
DE 1945 gründet Salman Schocken in New York Schocken Books. Es ist sein dritter Verlag nach den Gründungen in Berlin und Tel Aviv. Fast 80 Jahre später tritt der amerikanische Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen an den Medienkonzern Bertelsmann heran, zu dem Schocken Books inzwischen gehört, um das Imprint Schocken Books zu kaufen und mit einem neuen Verlagsprogramm mit Leben zu füllen. Cohen ist mit den Büchern des Schocken Verlags aufgewachsen, er weiß um seine Bedeutung für die jüdische Geschichte und Literatur. Für die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ im Jüdischen Museum Berlin (20. Mai bis 12. Oktober 2025) haben wir ihn eingeladen, das kulturelle Erbe der Schocken-Verlage einer zeitgenössischen Befragung zu unterziehen und mit seiner literarischen Stimme zu kommentieren.
Das Fundament der Ausstellung bilden 120 Bücher aus den Schocken-Verlagen in Berlin, Tel Aviv und New York. Alle Bände werden in der Bibliothek des Museums aufbewahrt. Der Schocken Verlag hielt ab seiner Gründung 1931 über zahlreiche Veröffentlichungen kontinuierlich jüdische Kultur
EN Salman Schocken founded Schocken Books in New York in 1945. It was his third publishing house after those in Berlin and Tel Aviv. Almost eighty years later, author and Pulitzer Prize winner Joshua Cohen approached the Bertelsmann media group, which now owns Schocken Books, wanting to purchase the imprint and revitalize it with a new publishing program. Cohen grew up with publications by Schocken Books, he is aware of their significance for Jewish history and literature. For the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken in the Jewish Museum Berlin (20 May–12 October 2025), we invited him to examine the cultural legacy of the Schocken publishing companies from a contemporary perspective and provide a literary commentary. The exhibition is based on 120 books from the Schocken publishing companies in Berlin, Tel Aviv, and New York. All of the volumes are preserved in the museum library. The Schocken Verlag in Berlin kept Jewish culture and tradition from all eras and countries alive through numerous publications. It had a significant social impact on a readership in Germany, Israel, and the United States. The books that came
Martina Lüdicke und Monika Sommerer kuratierten gemeinsam die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“. Martina Lüdicke ist Ausstellungskuratorin am Jüdischen Museum Berlin. Sie studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Tübingen und Aix-en-Provence. Monika Sommerer ist Bibliotheksleiterin am Jüdischen Museum Berlin. Von 2011 bis 2022 leitete sie die Bibliothek in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
Martina Lüdicke and Monika Sommerer curated the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken Martina Lüdicke is an exhibition curator at the Jewish Museum Berlin. She studied literature and art history in Tübingen and Aix-en-Provence. Monika Sommerer is the director of the Jewish Museum Berlin’s library. From 2011 to 2022, she was the head of the library at the House of the Wannsee Conference Memorial and Educational Site.

und Tradition aus allen Epochen und Ländern lebendig und hatte großen gesellschaftlichen Einfluss auf eine Leserschaft in Deutschland, in Israel und den USA. Dass das Verlegen von Büchern auch ein mutiger Akt des Widerstands und der Selbstbehauptung sein kann, zeigen die Publikationen, die in Deutschland von der Gründung des Verlags in Berlin 1931 bis zu seiner Zwangsliquidierung Ende 1938 erschienen sind. Das gilt vor allem für die vielen Titel, die Schocken nach den Bücherverbrennungen im Mai 1933 veröffentlichte.
Bücher sind keine einfachen Exponate in kulturhistorischen Ausstellungen, sie verlangen nach Methoden, die ihren historischen Wert und ihre Bedeutung für eine spezifische Leserschaft sichtbar machen. Joshua Cohen hat dafür Texte verfasst, die Salman Schockens verlegerisches Vermächtnis mit seiner Rolle als Geschäftsmann verknüpfen, denn auch als außerordentlich erfolgreicher und innovativer Kaufhausunternehmer ist Salman Schocken bekannt: Von Zwickau aus baut er ab 1901 zunächst mit seinem Bruder Simon, nach dessen Tod 1929 allein, ein Warenhaus-Imperium auf. Die prägnante Formensprache der Schocken-Produkte, die charakteristische Typographie und die schlichte Inneneinrichtung der Häuser setzt neue Maßstäbe. Vor allem aber die Bauhaus-Architektur der von Erich Mendelsohn errichteten Gebäude in Nürnberg, Stuttgart und Chemnitz prägt die legendäre Ästhetik der Schocken-Warenhäuser. Mit über ganz Deutschland verteilten Schocken-Filialen, die bezahlbare, qualitätvolle Waren für eine breite Käuferschicht anbieten, trägt Salman Schocken maßgeblich zur Demokratisierung des Warenhauses bei.
Waren dieser Art – Alltagsgegenstände wie Kleidung, Geschirr, Accessoires, Dekoration, alle aus der Sammlung des JMB – bringt Joshua Cohen zum Sprechen. Einige Objekte
out in Germany from the founding of the publishing house in Berlin in 1931 until its forced liquidation in late 1938 confirm that publishing books can also be a bold act of resistance and self-assertion. This is especially true of the many volumes that Schocken published after the book burnings in May 1933.
Books are not easy to present in cultural history exhibitions. They require methods that make their historical value and their significance for a specific readership visible. Joshua Cohen has written texts for the exhibition that link Salman Schocken’s publishing legacy to his role as a businessman, since Schocken was also an extraordinarily successful and innovative department store entrepreneur. Based in Zwickau, he built up a department store empire starting in 1901, at first with his brother Simon and then alone after Simon’s death in 1929. The precise design of Schocken products, the characteristic typography, and the minimalistic interior design of the buildings set new standards. In particular, however, the Bauhaus architecture of the buildings created by Erich Mendelsohn in Nuremberg, Stuttgart, and Chemnitz influenced the legendary aesthetics of the Schocken department stores. With branches throughout Germany that offered affordable, high-quality goods for a broad customer base, Salman Schocken contributed significantly to making department stores more democratic.
Joshua Cohen has given a voice to these kinds of goods—everyday items such as clothing, dishes, accessories, decorations, all of which came from the JMB collection. Some objects were produced for Schocken; others came from other Jewish-owned department stores such as Wertheim, Tietz, Rosenhain, and Nathan Israel. Cohen’s poetic text montages, poems, short stories, aphorisms, and reflections inspire

stammen aus der Schocken-Produktion, andere Objekte aus Kaufhäusern jüdischer Eigentümer wie Wertheim, Tietz, Rosenhain oder Nathan Israel. Cohens poetische Textmontagen, Gedichte, Kurzgeschichten, Aphorismen und Reflektionen ermöglichen eine assoziative Beschäftigung mit der politischen und gesellschaftlichen Dimension von Schockens publizistischer und unternehmerischer Tätigkeit. Cohen nimmt Kultur und Konsum zum Ausgangspunkt, um über historische Zäsuren ebenso nachzudenken wie über politische Streitfragen der Gegenwart. Mal direkt, mal implizit beziehen sich seine Texte auf Autoren der Schocken Verlage wie Martin Buber oder Franz Kafka. Andere Texte zitieren intellektuelle Wegbegleiterinnen wie Hannah Arendt, die in den Anfangsjahren zwei Jahre Lektorin bei Schocken Books in New York war. Salman Schockens Wunsch nach einer Rückbesinnung auf das jüdische Erbe, seine Vision für Unternehmensführung und Buchherstellung stecken in allen Texten der „Inventuren“. Nicht zuletzt entsteht über die Verbindung von Sammlungsobjekt und künstlerischem Text auch eine Verbindung von Warenhaus und dem Museum als sammelnder Institution. Klassische Konsumgüter hinterfragen mit Cohens Erzählstimme intellektuelle Ideen und verleihen den Objekten der Sammlung neue Deutungsebenen.
Cohens Texte nähern sich den Exponaten auf sehr unterschiedliche Weise. Ein zweisprachiges Gedicht basiert auf dem 1932 im Schocken Verlag erschienenen Text „Ich und Du“ von Martin Buber. In fast konkreter Poesie treten zwei Teelöffel aus dem Warenhaus Tietz in einen Dialog. Zu einem Seidenkleid aus dem Modehaus Kersten & Tuteur entspinnt sich eine Reflektion über die globale Textilwirtschaft. In einer fiktiven Szene, die auf Franz Kafkas „In der
associations regarding the political and social dimensions of Schocken’s publishing and business activities. Cohen uses culture and consumption as the point of departure to reflect on historical upheavals as well as today’s political issues. His texts refer—sometimes directly and sometimes implicitly—to authors published by Schocken such as Martin Buber and Franz Kafka. Other texts cite intellectual companions such as Hannah Arendt, who spent two years as an editor in the early years of Schocken Books in New York. Salman Schocken’s wish for a return to the Jewish legacy and his vision for corporate management and book production permeate all the texts in the Inventories exhibition. By linking objects from the collection and artistic texts, a connection is also created between the department store and the museum as a collecting institution. Cohen’s narrative voice lets classic consumer goods question intellectual ideas and suggests new levels of interpretation for the collection objects.
Cohen’s texts approach the exhibits in many different ways. A two-voice poem, for example, is based on Ich und Du (I and Thou) by Martin Buber, which was published by Schocken Verlag in 1932. In effect concrete poetry, two teaspoons from the Tietz department store enter into a dialogue. A silk dress from the Kersten & Tuteur fashion store inspires a reflection on the global textile industry. In a fictional scene alluding to Franz Kafka’s “In the Penal Colony,” a gramophone needle from the Schocken department store takes aim like a weapon against the protagonist himself. Short aphoristic texts on everyday objects, such as a candy tin from a Schocken department store or a teapot warmer, form condensed stories that open up various perspectives. They encourage further contemplation and reverse the conventional connection be-

Strafkolonie“ anspielt, richten sich Grammophonnadeln aus dem Schocken-Konzern wie Waffen gegen den Protagonisten selbst. Kurze aphoristische Texte zu Alltagsobjekten, wie etwa eine Bonbondose des Schocken-Konzerns oder ein Teestövchen, bilden kondensierte Geschichten, die verschiedene Perspektiven öffnen. Sie fordern zum Weiterdenken auf und kehren die konventionelle Verbindung von Objekt und Text in Museen um: Cohens literarischer Zugang befragt die kulturelle Funktion von historischen Sammlungsbeständen und entwickelt die Geschichte des Verlags- und WarenhausKosmos zu einem Denkraum unserer Gegenwart weiter. Eine Werbeanzeige der „Schocken Bücherei“ wendet sich an die „suchenden Leser unserer Tage“: gerade in kritischen Zeiten sollen sie sich mit jüdischen Schriften aller Länder und Zeiten beschäftigen. Cohens Texte fordern ihrerseits die suchenden Leserinnen und Museumsbesucher von heute auf, sich in einem ungewöhnlichen Format mit Objekten und ihren vielschichtigen Bedeutungsschichten zu beschäftigen.
tween object and text in museums. Cohen’s literary approach questions the cultural function of historical collection inventories and develops the history of the publishing and department store cosmos further into a locus for reflection on the present. A promotion for the Schocken Bücherei addresses “searching readers of our day.” Precisely in critical times, they are encouraged to consider Jewish writings from all countries and eras. Cohen’s texts in turn provide today’s probing readers and museum guests with an unusual way of dealing with objects and their manifold layers of meaning.

Für die Eric F. Ross Galerie im Libeskind-Bau hat das Jüdische Museum Berlin 2023 eine neue Ausstellungsreihe ins Leben gerufen: Unter dem Titel „JMB Sammlung“ geben wir Einblicke in unsere Bestände und eröffnen neue Perspektiven auf bekannte oder noch nie gezeigte Objekte. Gefördert wird dieses Format durch die FREUNDE DES JMB, denen wir an dieser Stelle herzlich danken.
For the Eric F. Ross Gallery in the Libeskind building, the Jewish Museum Berlin created a new exhibition series in 2023: Under the label JMB Collection we offer in-depth insights into our holdings and new perspectives on known objects or objects that have yet to be displayed. This series is supported by the FRIENDS OF THE JMB, whom we would like to take this opportunity to thank.
Text
Joshua Cohen
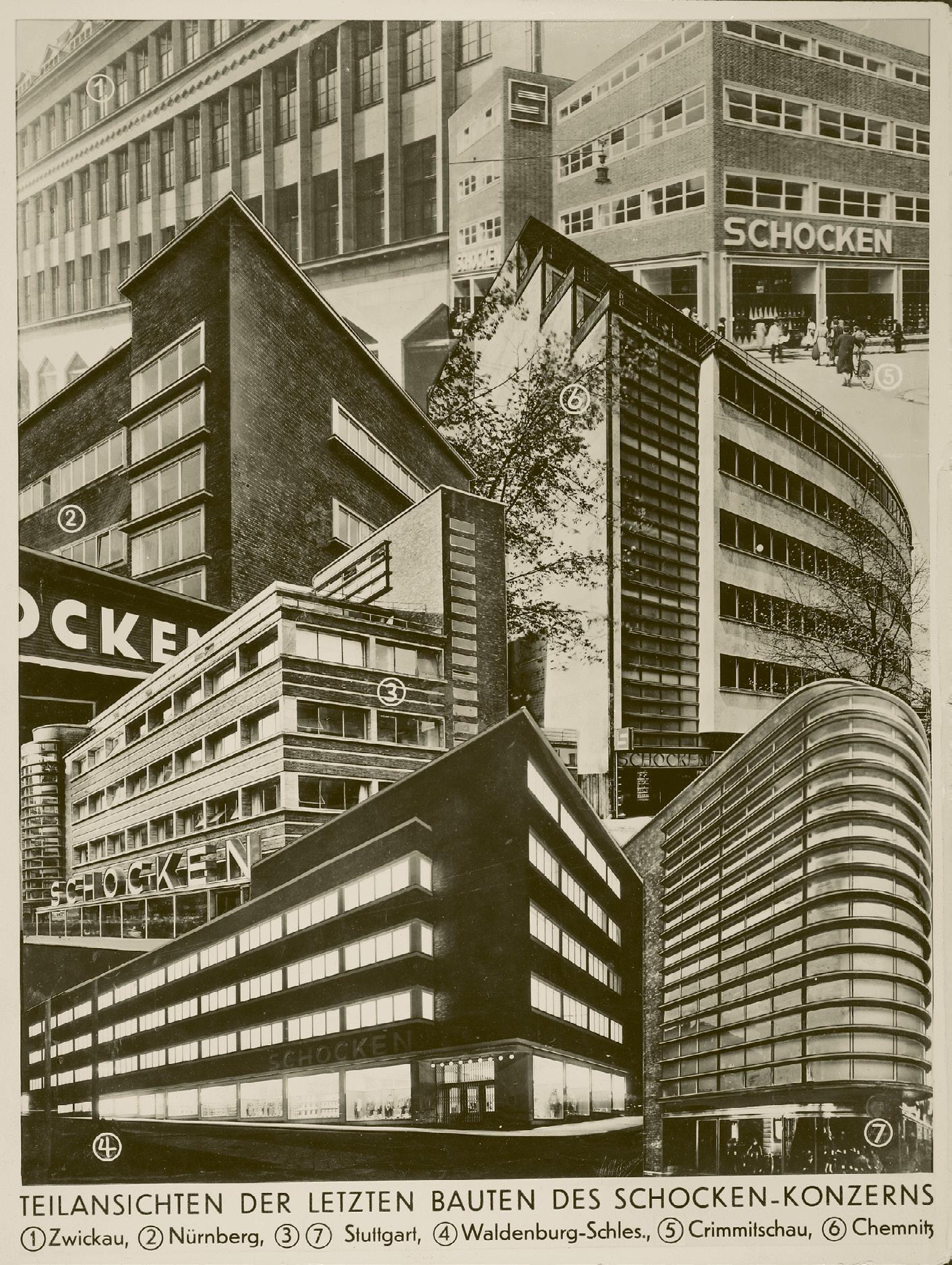
Collage mit Teilansichten verschiedener SchockenKaufhäuser, 1930er-Jahre
Collage with partial views of different Schocken department stores, 1930s
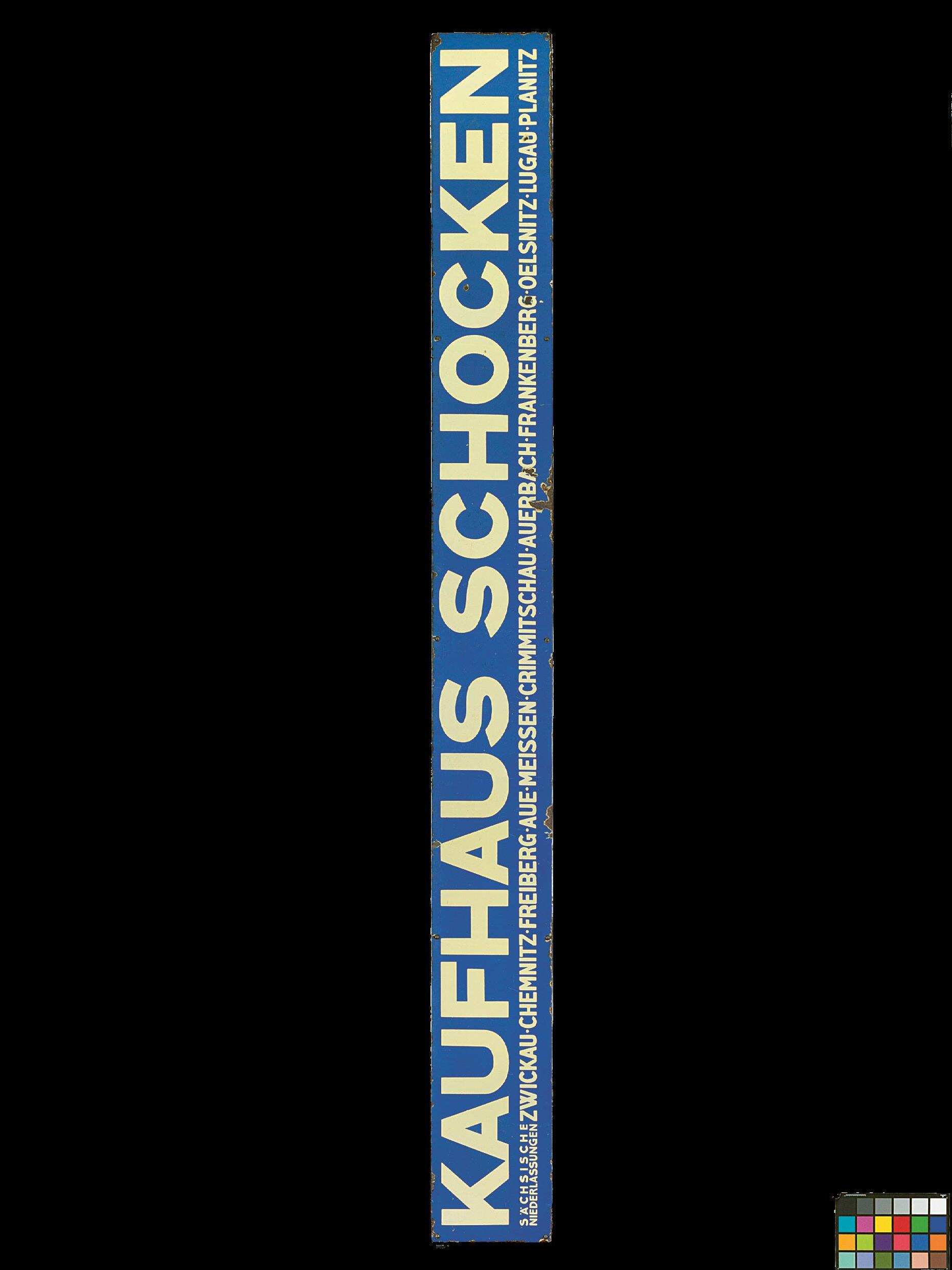
Thesignisnotforjoy.Thesignisnotforfire.Thesignisnotforlove. Thesignisnotforfear.Thesignisnotforrain.Thesignisnotforfaith. Thesignisnotforwar.Thesignisnotforpeace. Thesignisnotforbread. Thesignisnotforwind. Thesignisnotforsleep. Thesignisnotforluck.Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist. MartinBuber, IchundDu
Thesignisnotforsale.Thesignisnotforrent. Thesignisnotforlease. Thesignisnotfortrade. Thesignisnotforbarter. Thesignisnotfor reproduction.Thesignisnotfordisplay. Thesignisnotfor distribution. Thesignisnotforpromotion. Thesignisnotforexhibition. Thesignisnotfortheft. Thesignisnotfor consumption.Thesignisnotforreplica. Thesignisnotforuse.Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist. MartinBuber, IchundDu
DasSchildstehtnichtfürFreude. DasSchildstehtnichtfürFeuer. DasSchildstehtnichtfürLiebe. DasSchildstehtnichtfürAngst. DasSchildstehtnichtfürRegen. DasSchildstehtnichtfürden Glauben. DasSchildstehtnichtfürdenKrieg. DasSchildstehtnichtfürdenFrieden. DasSchildstehtnichtfürBrot. DasSchildistnichtfürdenWind. DasSchildstehtnichtfürdenSchlaf. DasSchildstehtnichtfürdasGlück. Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist. MartinBuber, IchundDu
DasSchildistnichtzu verkaufen. DasSchildistnichtzu vermieten. DasSchildistnichtzu verpachten. DasSchildistnichtfürdenHandel bestimmt. DasSchildistnichtzumTausch bestimmt.
DasSchildistnichtzur Reproduktionbestimmt. DasSchildistnichtzurAusstellungbestimmt. DasSchildistnichtfürdenVertrieb bestimmt.
DasSchildistnichtfürdieWerbungbestimmt. DasSchildistnichtzurAusstellungbestimmt. DasSchildistnichtzum Diebstahl bestimmt. DasSchildistnichtfürden Verbrauch bestimmt.
DasSchildistnichtzur Nachahmungbestimmt.DasSchildistnichtfürden Gebrauch bestimmt.
Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist.
MartinBuber, IchundDu
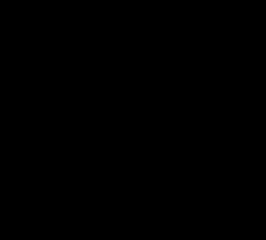
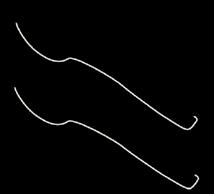
AUS DEM WARENHAUS TIETZ Berlin, 1928–1935 FROM TIETZ
Berlin, 1928–1935
Zu. Gehörigkeit. Zugehörigkeit. Gehörigkeit. Zu.
Ich-Du Ich-Es Zu. Behör. Zubehör. Behör. Zu. Ich-Du Ich-Es Hab. Seligkeiten. Habseligkeiten. Seligkeiten. Hab. Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Wer sich entscheidet, wurde befreit, weil er vor dem Angesicht erschienen ist.
Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Whoever chooses has been released, for he has come before the countenance.


Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Whoever chooses has been spared, for he has presented himself before the countenance.
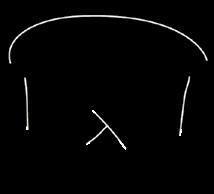
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand
of history were gripping him by the throat and refusing him a voice . of tradition were gripping him by the throat and refusing him a choice . of money were gripping him by the throat and refusing him a plea. of time were gripping him by the throat and refusing him a protest . of the past were gripping him by the throat and refusing him an opinion. of bureaucracy were gripping him by the throat and refusing him a pardon . of a forgotten god were gripping him by the throat and refusing him a prayer. of an unfinished symphony were gripping him by the throat and refusing him a solo. of an unfinished painting were gripping him by the throat and refusing him a brushstroke . of a foreign language were gripping him by the throat and refusing him a translation. of a sentence were gripping him by the throat and refusing him a metaphor. of a metaphor were gripping him by the throat and refusing him a sentence . of the surveillance state were gripping him by the throat and refusing him a moment of privacy. of imperial ambition were gripping him by the throat and refusing him a homeland to defend. of corporate greed were gripping him by the throat and refusing him a fair wage . of partisan gridlock were gripping him by the throat and refusing him a compromise . of state censorship were gripping him by the throat and refusing him a word of dissent . of bureaucratic inertia were gripping him by the throat and refusing him a single reform . of monopolized media were gripping him by the throat and refusing him a truth untold. of electoral disenfranchisement were gripping him by the throat and refusing him a ballot to cast . of capitalist acceleration were gripping him by the throat and refusing him a breath of stillness . of environmental collapse were gripping him by the throat and refusing him a future to inherit der Geschichte ihn an der Kehle packen und ihm eine Stimme verweigern. der Tradition ihn an der Kehle packen und ihm eine Entscheidung verweigern. des Geldes ihn an der Kehle packen und ihm eine Bitte verweigern. der Zeit ihn an der Kehle packen und ihm eine Beschwerde verweigern. der Vergangenheit ihn an der Kehle packen und ihm eine Meinung verweigern. der Bürokratie ihn an der Kehle packen und ihm eine Begnadigung verweigern. eines vergessenen Gottes ihn an der Kehle packen und ihm ein Gebet verweigern. einer unvollendeten Sinfonie ihn an der Kehle packen und ihm ein Solo verweigern. eines unvollendeten Gemäldes ihn an der Kehle packen und ihm einen Pinselstrich verweigern. einer fremden Sprache ihn an der Kehle packen und ihm eine Übersetzung verweigern. eines Satzes ihn an der Kehle packen und ihm eine Metapher verweigern. einer Metapher ihn an der Kehle packen und ihm einen Satz verweigern. des Überwachungsstaates ihn an der Kehle packen und ihm einen Moment der Privatsphäre verweigern. der imperialen Ansprüche ihn an der Kehle packen und ihm eine zu verteidigende Heimat verweigern. der unternehmerischen Gier ihn an der Kehle packen und ihm einen gerechten Lohn verweigern. der parteipolitischen Blockade ihn an der Kehle packen und ihm einen Kompromiss verweigern. der staatlichen Zensur ihn an der Kehle packen und ihm ein Wort des Widerspruchs verweigern. der bürokratischen Trägheit ihn an der Kehle packen und ihm jegliche Reform verweigern. der monopolisierten Medien ihn an der Kehle packen und ihm eine unausgesprochene Wahrheit verweigern. des Wahlrechtsentzugs ihn an der Kehle packen und ihm die Stimmabgabe verweigern. der kapitalistischen Beschleunigung ihn an der Kehle packen und ihm einen Hauch der Stille verwehren. des Umweltkollapses ihn an der Kehle packen und ihm das Erbe einer Zukunft verwehren.
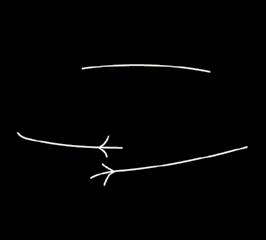
→ Place the tie around your neck with one end slightly longer than the other. → Cross the longer end over the shorter end forming an X near your collar and pull the longer end up through the loop to create a knot. → Place the neck around your tie with one end slightly shorter than the other. → Cross the shorter end over the longer end forming an X near your collar and pull the shorter end up through the loop to create a knot. → Fold the shorter end horizontally to form the first wing of the bow. → Place the end around your tie with one neck slightly longer than the other. → Cross the X forming an end near your collar and pull the loop through the knot. → Fold the longer end vertically to form the first bow of the wing. → Drop the longer end over the center of the folded wing to form the middle part of the bow, then pinch the longer end near its base, fold it back toward your neck, and tuck it through the loop behind the first wing. → Place the end around your neck with one tie slightly shorter than the other. → X the cross ending a form near your pull and collar the knot through the loop. → Short the folder end diagonally to bow the form wing first. → Drop the shorter end over the folded center wing form of the bow part of the middle, then pinch the shorter base near its end, back it folded toward your tuck and neck it through the first loop behind the wing. → Finally, gently pull the wings to tighten and adjust the knot and wings until they are symmetrical.
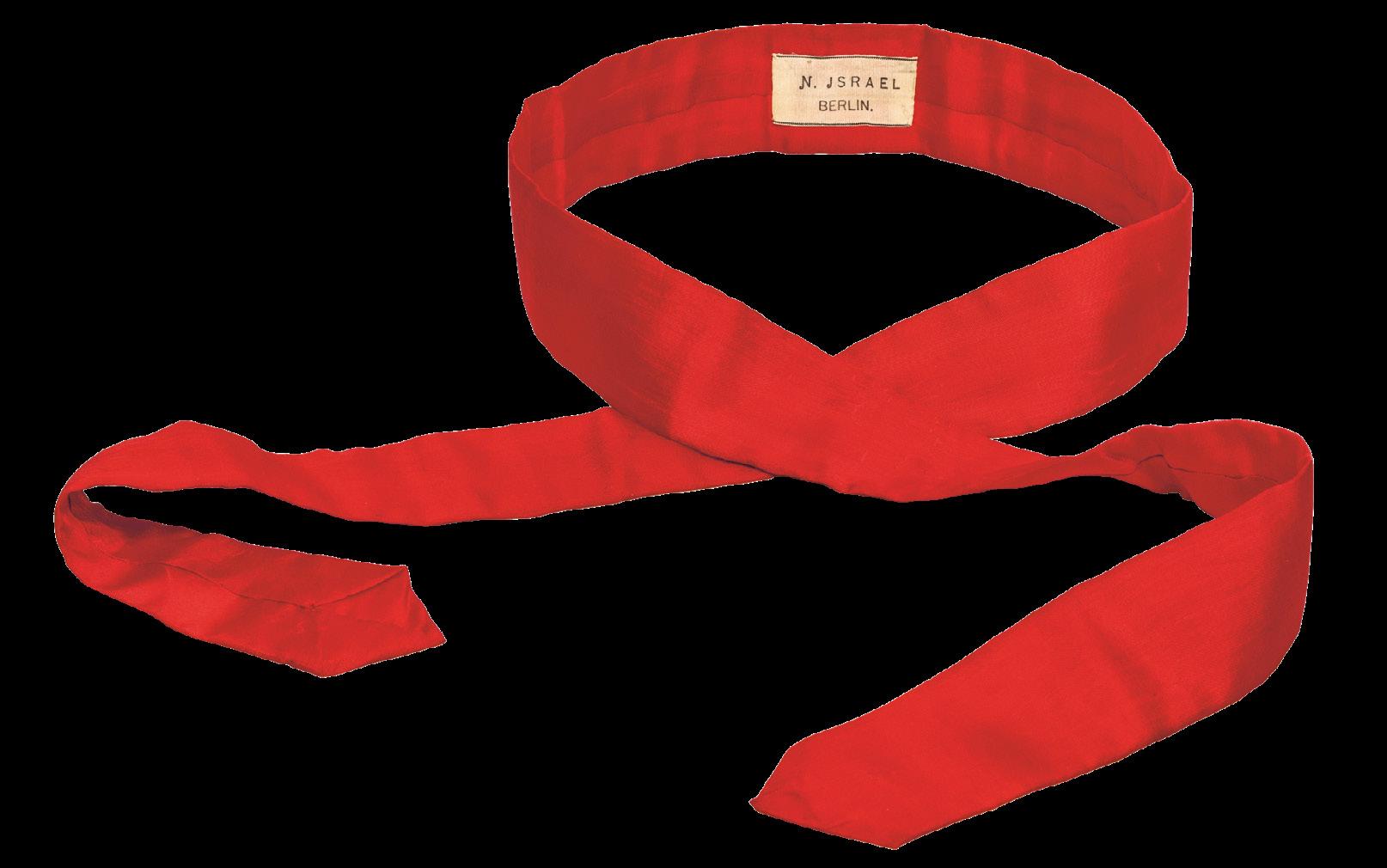
→ Legen Sie die Fliege so um Ihren Hals, dass ein Ende etwas länger ist als das andere. → Legen Sie das längere Ende über das kürzere Ende, so dass ein Kreuz an Ihrem Kragen entsteht, und ziehen Sie das längere Ende durch die Schlaufe nach oben, um einen Knoten zu formen. → Legen Sie den Hals so um Ihre Fliege, dass ein Ende etwas kürzer ist als das andere. → Legen Sie das kürzere Ende über das längere Ende, so dass ein Kreuz an Ihrem Kragen entsteht, und ziehen Sie das kürzere Ende durch die Schlaufe nach oben, um einen Knoten zu formen. → Falten Sie das kürzere Ende waagerecht, um die erste gefaltete Seite der Schleife zu bilden. → Falten Sie die Schleife so, dass eine Seite etwas länger ist als die andere. → Kreuzen Sie das Kreuz, das ein Ende an Ihrem Kragen bildet, und ziehen Sie die Schlaufe durch den Knoten. → Falten Sie das längere Ende senkrecht, um die erste Schlaufe der einen Seite zu bilden. → Legen Sie das längere Ende über die Mitte der gefalteten Seite, um den mittleren Teil der Schleife zu bilden, greifen Sie dann das längere Ende in der Nähe des Ansatzes, falten es zum Hals zurück und führen es durch die Schlaufe hinter die erste Seite. → Legen Sie das Ende um Ihren Hals, wobei eine Seite etwas kürzer als die andere sein sollte. → Kreuzen Sie das Legende in eine Form in der Nähe Ihres Führens und kragen Sie den Knoten durch die erste Schleife der Seite. → Kürzen Sie das faltendere Ende diagonal, um zuerst die Schlaufenseite zu bilden. → Lassen Sie das kürzere Ende über die gefaltete Mitte fliegen und formen Sie den Schleifenseitenteil der Mitte, greifen Sie dann den kürzeren Ansatz in der Nähe des Endes, zurücken es gefaltet in Richtung Ihres Führens und halsen Sie es durch die erste Seite hinter der Schleifenschlaufe. → Ziehen Sie schließlich vorsichtig an den beiden Seiten, um sie zu straffen, und richten Sie den Knoten sowie die beiden Seiten aus, bis sie symmetrisch sind.

Because the face, too, deserves renewal.
Restore what time steals— without illusions.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. He who decides is free, for he has approached the Face.
Smoothness is not vanity; it is resistance to decay. For skin that remembers renewal in the face of history.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. He who decides is free, for he stands before the Face.
Against the dryness of modern life— nourish what endures.
In a world of appearances, let softness speak the truth.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.
She who chooses has become free, for she confronts the Face.
Beauty begins when you embrace your own reflection. Moisturize. The alternative is despair.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.
She who chooses has freed herself, for she confronts the Face.
Denn auch das Gesicht verdient eine Erneuerung.
Die Wiederherstellung dessen, was die Zeit gestohlen hat – ohne Illusionen.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Derjenige, der entscheidet, ist frei, denn er hat sich dem Gesicht genähert.
Glätte ist keine Eitelkeit, sondern Widerstand gegen den Verfall. Für eine Haut, die sich angesichts der Geschichte an die Erneuerung erinnert.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Derjenige, der sich entscheidet, ist frei, denn er steht vor dem Gesicht.
Gegen die Trockenheit des modernen Lebens – nähre das, was Bestand hat.
In einer Welt des Scheins soll die Sanftheit die Wahrheit sprechen.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.
Diejenige, die sich entscheidet, ist frei geworden, denn sie stellt sich dem Gesicht.
Schönheit beginnt, sobald man sein eigenes Spiegelbild umarmt. Cremen Sie sich ein.
Die Alternative ist reine Verzweiflung.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.
Diejenige, die sich entscheidet, hat sich befreit, denn sie stellt sich dem Gesicht.


AUS DEM LUXUS- UND LEDERWARENGESCHÄFT
Deutschland, ca. 1920

The woman came home from the party outlandishly drunk and accidentally put her jewelry away in the box that contained her father’s ashes.
Die Frau kam sturzbetrunken von der Party nach Hause und legte ihren Schmuck versehentlich in die Dose, in der sich die Asche ihres Vaters befand.
FÜR BONBONS DER SCHOCKEN AG vermutlich Zwickau, 1926
Every evening he’d start reading the news and only stop when he’d finished the last candy in the con tainer. But he’d cheat: he wouldn’t suck, he’d chew. Jeden Abend begann er, die Nachrichten zu lesen und hörte erst wieder damit auf, als er das letzte Bonbon aus der Dose gegessen hatte. Doch er schummelte immer: Er lutsche nicht, er kaute.

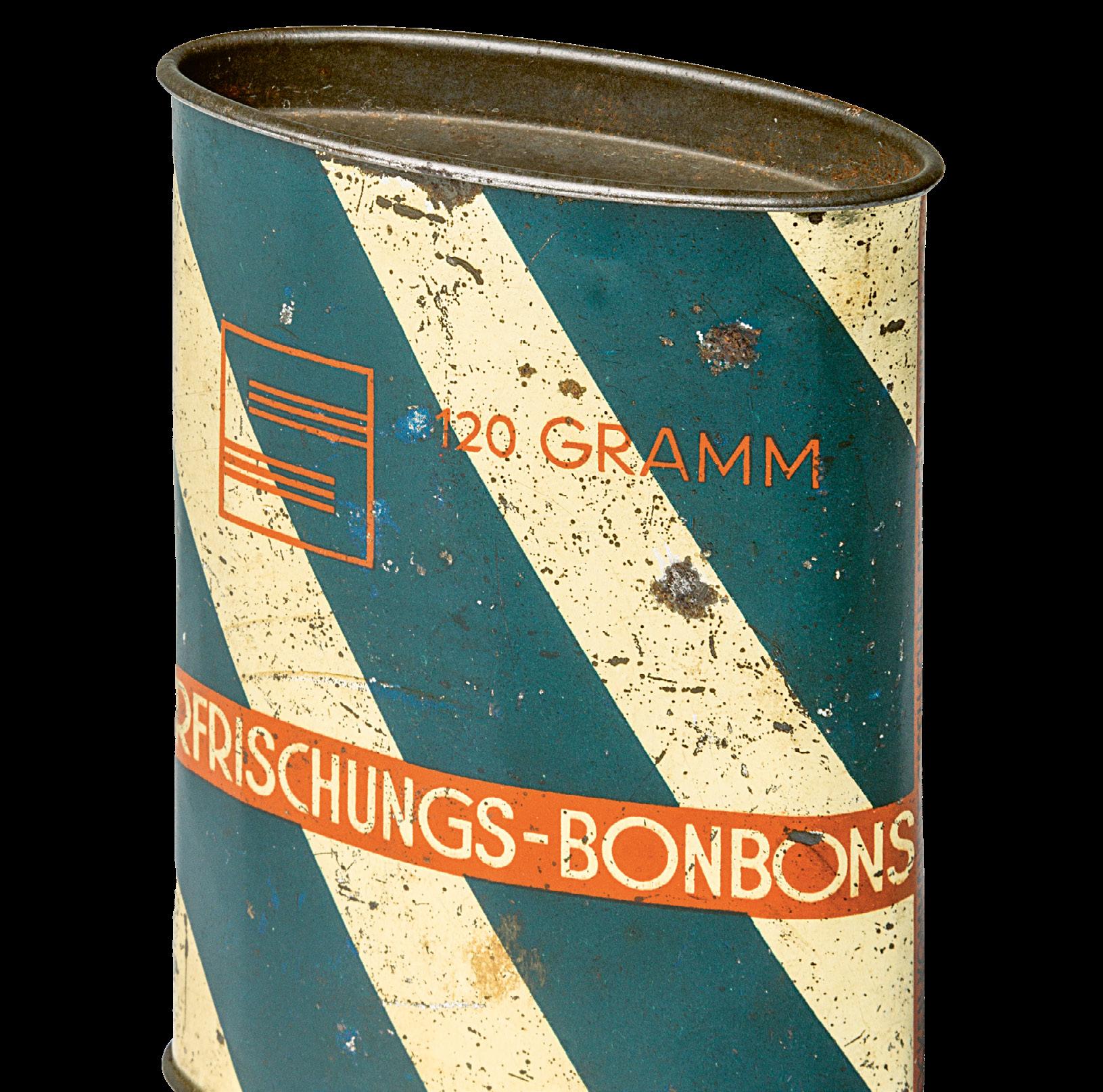

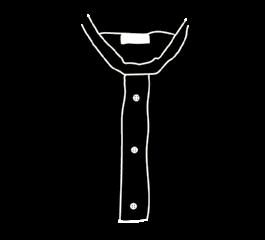
The old man lived many years and died “unstained,” like a bleached shirt.
Der alte Mann lebte viele Jahre und starb „unbefleckt“ wie ein gebleichtes Hemd.



So incorrigible were the man’s friends that before they visited, he would have to run around his house labeling every vessel: “this is not an ashtray.”
Die Freunde des Mannes waren so unverbesserlich, dass er, bevor sie zu Besuch kamen, durch sein Haus gehen und jedes Gefäß beschriften musste: „Dies ist kein Aschenbecher.“
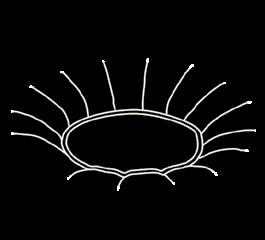
For the family that has every thing: a dish that holds nothing. For the family that has nothing: a dish that holds everything? No, in this world they get no dish at all.
Für die Familie, die alles hat: eine Schale, die nichts enthält.
Für die Familie, die nichts hat: eine Schale, die alles enthält? Nein, denn in dieser Welt bekommen sie noch nicht einmal eine Schale.
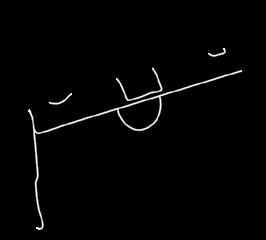

her genitals. After that session, she quit treatment and for weeks and months after would spend her former appointment-hour shopping.
Ihr Psychoanalytiker sagte einmal zu ihr, dass die Wahl der Handtasche einer Frau ein Hinweis darauf sei, wie sie über ihre Genitalien denke. Nach dieser Sitzung brach sie die Therapie ab und verbrachte über die nächsten Wochen und Monate die Zeiten ihrer ehemaligen Sprechstunde damit, einkaufen zu gehen.
Since mankind as a whole is still very far from having reached the limit of abundance, the mode in which society may overcome this natural limitation of its own fertility can be perceived only tentatively and on a national scale. There, the solution seems to be simple enough. It consists in treating all use objects as though they were consumer goods, so that a chair or a table is now consumed as rapidly as a dress and a dress used up almost as quickly as food.
Hannah Arendt , The Human Condition
The woman who wore this dress never met the woman who made this dress and neither of them ever met the female silk moth whose multitudinous offspring had to be boiled alive in their cocoons to obtain barely a single pound of raw silk.
Our whole economy has become a waste economy, in which things must be almost as quickly devoured and discarded as they have appeared in the world, if the process itself is not to come to a sudden catastrophic end.
Hannah Arendt, The Human Condition
The woman who bought this dress once met the woman who sold this dress: their meeting was a transaction. Names were not exchanged.


Da die Menschheit im Ganzen noch sehr weit davon entfernt ist, diese Überflußgrenze erreicht zu haben, können mögliche Wege, auf denen die Gesellschaft vielleicht die natürlich gegebene Begrenzung ihrer eigenen Fruchtbarkeit überwinden wird, nur im nationalen Maßstab beobachtet und nur versuchsweise angegeben werden. Der Fluch des Reichtums ist daher erst andeutungsweise zu spüren und mit ihm die Mittel, die eine im Überfluß lebende Gesellschaft bereitstellt, ihm zu begegnen. Diese bestehen darin, mit Gebrauchsgegenständen so umzugehen, als seien sie Konsumgüter, bzw. das Gebrauchen überhaupt in ein Verbrauchen umzuwandeln, so daß nun ein Stuhl oder ein Tisch so schnell verbraucht wird wie einst ein Kleid oder ein Schuh, während ein Kleid oder ein Schuh möglichst nicht viel länger in der Welt gelassen und ähnlich „konsumiert“ wird wie ausgesprochene Konsumgüter. Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben
Die Frau, die dieses Kleid trug, ist nie der Frau begegnet, die dieses Kleid hergestellt hat, und keine von beiden ist jemals dem Seidenspinnerweibchen begegnet, dessen unzählige Nachkommen in ihren Kokons bei lebendigem Leib gekocht werden mussten, damit auch nur ein einziges Pfund Rohseide gewonnen werden konnte.
Die moderne Wirtschaft entwickelt sich notwendigerweise in Richtung einer „waste economy“, einer auf Vergeudung beruhenden Wirtschaft, die jeden Gegenstand als Ausschußware behandelt und die Dinge fast so schnell, wie sie in der Welt erscheinen, auch wieder aufbraucht und wegwirft, weil sonst der ganze komplizierte Prozeß mit einer plötzlichen Katastrophe enden würde.
Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben
Die Frau, die dieses Kleid kaufte, ist der Frau, die es verkaufte, einmal begegnet: Ihre Begegnung war eine Transaktion. Namen wurden nicht ausgetauscht.





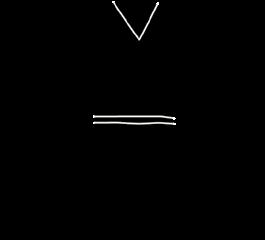
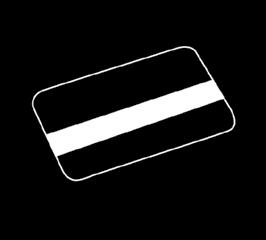

feelThemanhadmusicinhim.Hecould itwellinginsidehim,hecould hisfeelitswelling,therewerestringsin sinews,therewerewoodwinds hisinhislungs,atrumpetblowingin throatandliftinguphistongue; sounds,hecouldfeelthepressureofthese hecouldfeelthetensionthem,andeffortrequiredtoproduce buthecouldn’thearathing, oratleastnotmorethanafainthum buzzthatheoftensuspectedtothisbeanhallucination,andoneday musicfailuretohearhisowninner disassembledsodistressedhimthathe hisgramophoneandpuncturedapplieditsneedletohisskin:he hiswristandfinally,inagreatgushing,thebloodsang.
ErDerMannhatteMusikinsich. spürte,wiesieinihmanstieg, Saitenerspürte,wiesieanschwoll,erhatte inseinenSehnen,erhatteHolzbliesbläserinseinerLunge,eineTrompete Zunge;inseinerKehleundhobseine erspürtedenDruckdieser dieKlänge,erspürtedieSpannungund Anstrengung,dienötigwaren,um hauptsiezuerzeugen,docherkonnteübernichtshören,zumindestnicht odermehralseinganzschwachesSummen HalluzinationBrummen,daseroftfüreine hielt,bisihndiesesUnzuvermögen,seineeigeneinnereMusik higte,hören,einesTagessosehrbeunrudasserseinGrammophonzeransetzte:legteunddieTonnadelanseinerHaut ErdurchstachseinHandgegroßenlenk,undschließlich,ineinemeinzigen Schwall,sangdasBlut.
“The alternative between capitalism and socialism is false, not only because neither exists anywhere in its pure state anyhow, but because we have here twins, each wearing a different hat…” wrote Hannah Arendt, who neglected to mention that each ideology wanted the other ideology’s hat; rather, that each wanted the other not to have a hat at all and to go around bareheaded in the winter and catch a chill.

„Die Alternative Kapitalismus-Sozialismus ist keine wirkliche Alternative. Dies sind gleiche Brüder mit ungleichen Hüten“, schrieb Hannah Arendt, die zu erwähnen versäumte, dass jede Ideologie den Hut der anderen Ideologie haben will; mehr noch, jede Ideologie will, dass die andere Ideologie überhaupt keinen Hut hat und im Winter barhäuptig herumläuft und sich erkältet.
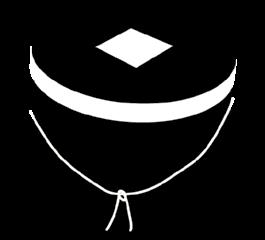
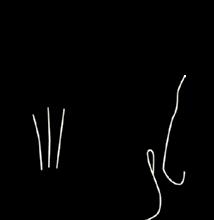
Deutschland, 1920er-Jahre AND WERTHEIM
Germany, 1920s

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
O, deine Hände sind meine Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.
Immer spiel ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleine Reiter, Bis sie umfallen.
Wie ich sie liebe Deine Bubenhände, die zwei.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
Your Hands are my children
All my toys Lie in their furrows.
I play soldiers With your fingers, little horsemen, Until they fall.
How I love them Your small boy’s hands— yes, both.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
O, deine Hände sind meine
Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.
Immer spiele ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleiner Reiter, Bis sie umfallen.
Wie ich
sie liebe
Deine
Bubenhände, die zwei.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
Deine Hände sind meine
Kinder Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Furchen.
Ich spiele
Soldaten Mit euren Fingern, kleine Reiter, Bis sie fallen.
Wie ich sie liebe Deine kleinen
Bubenhände –ja, beide.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei Drei
Vier
This is the thumb, which makes us primates.
This is the forefinger, which accuses. This is the middle finger: you can sit on it. This is the ring finger, which marries. This is the little finger: hold it in the air when you sip your tea.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
Das ist der Daumen, der uns zu Primaten macht. Das ist der Zeigefinger, der anklagt. Das ist der Mittelfinger: den kann ich dir mal zeigen. Das ist der Ringfinger, der heiratet. Das ist der kleine Finger: spreize ihn ab, während du an deinem Tee nippst.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
„Ich legte mein
Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Your Hands are my children All my toys Lie in their furrows. I play soldiers With your fingers, little horsemen, Until they fall.
How I love them Your small boy’s hands— yes, both.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
Deine Hände sind meine
Kinder Alle meine Spielsachen
Liegen in ihren Furchen.
Ich spiele
Soldaten Mit euren Fingern, kleine Reiter, Bis sie fallen.
Wie
ich sie liebe
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
O, deine Hände sind meine Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.
Immer spiel ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleine Reiter, Bis sie umfallen.
Wie ich sie liebe Deine Bubenhände, die zwei.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.
Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four
O, deine Hände sind meine
Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.
Immer spiele ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleine Reiter, Bis sie umfallen.
Wie ich sie liebe
Deine
Bubenhände, die zwei.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Daumen
Zwei
Drei
Vier
Zwei
Drei
Vier
Zwei
Drei
Vier
Zwei
Drei
Vier

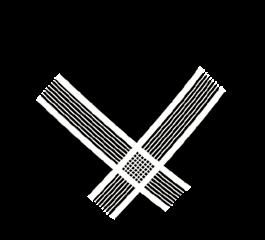

Text Markus Krah
Wie sehr ist eine Biografie an Orte gebunden, zumal eine jüdische Biografie im 20. Jahrhundert? Salman Schockens Leben spielte sich weitgehend zwischen Berlin, Jerusalem und New York ab. Es begann in Margonin in der preußischen Provinz Posen, wo Schocken 1877 geboren wurde, und endete in Pontresina in der Schweiz, wo er 1959 starb. Dazwischen wirkte er als Kaufhausmanager, Kulturmäzen, Zionist und Verleger an weiteren Orten. Dieses Leben „dazwischen“ spiegelt die großen Themen der jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert: Heimat und Exil, Israel und Diaspora, Tradition und Moderne.
To what extent does a life remain bound to places, especially a Jewish life in the twentieth century? Salman Schocken’s unfolded primarily between the cities of Berlin, Jerusalem, and New York. It began in Margonin in the Prussian province of Posen, where he was born in 1877, and ended in Pontresina, Switzerland, where he died in 1959. In the intervening years, he lived in various other places, active as a department store manager, patron of culture, Zionist, and publisher. His life “in between” reflected the central themes of twentieth-century Jewish history: homeland and exile, Israel and the diaspora, tradition and modernity.

DE Geboren wurde Salman Schocken in ein traditionelles Milieu, das sich jedoch rapide veränderte. Schon während der kaufmännischen Lehre, zu der er mit 15 Jahren aufs Dorf geschickt wurde, brach er geistig aus diesem Milieu aus, las sich mit Klassikern wie Goethe ins deutsche Bildungsbürgertum und mit aktuellen Autoren in die Moderne. 1898 kam er in ihr Zentrum nach Berlin. Ab 1901 legten er und sein Bruder Simon in Sachsen mit der Eröffnung ihres ersten Geschäfts die Grundlagen für den Schocken-Konzern – der Beginn einer rasanten Erfolgsgeschichte, getrieben von der Energie eines rastlosen Unternehmers und autodidaktischen Aufsteigers.
1930 leitete Salman Schocken die viertgrößte Warenhaus-Kette in Deutschland. Er gehörte damit zu einer neuen deutsch-jüdischen Wirtschaftselite des späten 19. und frühen
EN Salman Schocken was born into a traditional milieu undergoing rapid change. During his apprenticeship as a merchant, which took him to a rural village at the age of fifteen, he broke away from this environment intellectually. He reached up to join the educated middle class by reading the German classics, such as Goethe, and engaged with modernity through the works of contemporary writers. In 1898, he moved to the very center of the modern movement in Berlin. In 1901, he and his brother Simon laid the foundation for the Schocken department store group by opening their first store in Saxony. This marked the beginning of a rapid success story, driven by the energy of a tireless entrepreneur and autodidact determined to rise through the ranks of German society. By 1930, Salman Schocken was at the helm of the fourth-largest department store chain in Germany, making
Das Kaufhaus Schocken in Stuttgart , nach einem Entwurf von Erich Mendelsohn, hier ca. 1930, wurde 1960 abgerissen. The Schocken store in Stuttgart , designed by Erich Mendelsohn, pictured here around 1930, was demolished in 1960.
20. Jahrhunderts. Die Reaktionen darauf blieben nicht aus, darunter auch massive antisemitische Anfeindungen, etwa 1926 in Nürnberg durch das damals lokale Propagandablatt Der Stürmer von Julius Streicher. Das war ein Vorgeschmack auf das, was bis zur Enteignung des Konzerns 1938 noch kommen sollte.
Die antisemitischen Reaktionen entzündeten sich unter anderem an der selbstbewussten Sichtbarkeit der neuen Elite, die sich bei Schocken in der markanten Architektur der Kaufhäuser und im charakteristischen Logo ausdrückte. Dazu kam ein hoher kultureller Anspruch: Schocken investierte das beträchtliche Einkommen aus den Warenhäusern etwa in die Förderung hebräischer Literatur, vor allem des Schriftstellers Schmuel Yosef Agnon, und in seine Verlage, in denen sich seine unternehmerische Energie und seine kulturellen Ambitionen sichtbar ausdrückten.
him a member of the new German-Jewish economic elite that had emerged in the late nineteenth and early twentieth centuries. His success quickly provoked backlash and he became the target of virulent antisemitism. In 1926, for example, he was singled out by Julius Streicher’s Nuremberg-based and at the time local propaganda newspaper Der Stürmer. This was a grim foretaste of future developments that culminated in the expropriation of his company in 1938.
The antisemitic reactions were partially fueled by the self-assured visibility of this new elite, in Schocken’s case manifested in the striking architecture of the department stores and their distinctive logo. Schocken also pursued cultural ambitions: he invested the considerable profits from his stores in promoting Hebrew literature—especially the works of the writer Shmuel Yosef Agnon—and in expanding his publishing houses, where his entrepreneurial drive and intellectual aspirations found their fullest expression.

Das Kaufhaus Schocken in Chemnitz , nach einem Entwurf von Erich Mendelsohn, hier ca. 1930, ist heute Sitz des smac, des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz. The Schocken store in Chemnitz , designed by Erich Mendelsohn, pictured here around 1930, today houses the smac, the State Museum of Archaeology Chemnitz.
Zwischen Berlin und Jerusalem
Seinen ersten Verlag gründete Salman Schocken 1931 in Berlin, in einer Zeit des Umbruchs für das deutsche Judentum. Er wurde ein wichtiger Akteur in der jüdischen Kulturrenaissance der Zwischenkriegszeit. Schocken reagierte auf die Wahrnehmung, dass viele Jüdinnen und Juden auf der Suche nach einer positiven jüdischen Identität waren. In der Hoffnung auf rechtliche Gleichstellung und soziale Akzeptanz hatten sie wichtige Aspekte jüdischer Identität zugunsten der Assimilation aufgegeben. Das Judentum hatte seinen Platz als liberale Religion gefunden, die wenig Raum ließ für andere Formen jüdischer Identität. Doch hatte dieses assimilierte Judentum Antworten auf existenzielle Fragen, konnte es eine positive jüdische Identität vermitteln? Auf diese Sinnfragen reagierte eine neue Generation von Denkern: Martin Buber und Franz Rosenzweig etwa veröffentlichen ihre Antworten im Schocken Verlag.
Zudem reagierte der Berliner Verlag auf die wachsende Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden und auf die Abwertung des Judentums mit dem Aufstieg der Nazis. Gegen diese Entwicklung setzte Schocken seinem Verlag das Ziel, Judentum und jüdische Identität selbst und positiv zu definieren – vermittelt durch Bücher, von denen er von 1931 bis 1938 über 200 veröffentlichte, darunter Texte von Hermann Cohen, Heinrich Heine, Scholem Aleichem, Franz Kafka, Leo Baeck, Gershom Scholem und vielen anderen: ein „Who is Who“ jüdischer Denker.
Besonders wichtig war ihm die „Schocken Bücherei“, eine Reihe von attraktiv gestalteten, aber preiswerten Taschenbüchern. In ihr bündelte sich das Ziel, einen neuen Kanon aus der Tradition zu schaffen. Insgesamt veröffentlichte der Verlag 92 dieser Bücher: heilige Schriften, historische, ethnographische, kulturelle Werke, Philosophie, jiddische Literatur und Folklore.
Ein Zuhause in Jerusalem, kein Zuhause in Jerusalem?
Die Nazis schlossen den Schocken Verlag 1938. Salman Schocken selbst war mit seiner Frau Lilli und Kindern schon 1934/35 nach Palästina emigriert (wo er seinen zweiten Verlag gründete): Das hatte auch mit seinem Zionismus zu tun. Als Verleger war Schocken wichtig, dass er Kultur-Zionist war und die Stärkung jüdischer Kultur im Land Israel und der Diaspora als entscheidende Kraftquelle für den Fortbestand des jüdischen Volkes verstand – anders als der politische Zionismus, für den die Gründung eines jüdischen Staates im Vordergrund stand.
Schocken ließ sich 1935 in Rechavia nieder, dem Jerusalemer Viertel der Jekkes und der intellektuellen Elite, für die
Between Berlin and Jerusalem
Schocken founded his first publishing house in Berlin in 1931, during a time of profound change for German Jews. He became a leading figure in the Jewish cultural renaissance of the interwar period, recognizing that many Jews were seeking a positive Jewish identity. In their pursuit of legal equality and social acceptance, they had relinquished core elements of Jewish tradition in favor of assimilation. Judaism had established itself primarily as a liberal religion, leaving little room for alternative forms of Jewish identity. But could this assimilated Jewishness provide an answer to life’s existential questions? Could it offer a positive Jewish identity? These existential questions were taken up by a new generation of thinkers. Martin Buber and Franz Rosenzweig, for instance, published their answers with Schocken Verlag.
The Berlin publishing house also responded to the growing marginalization of Jews and the denigration of Judaism that accompanied the rise of National Socialism. To counter these developments, Schocken formulated a clear mission for his company: to define Judaism and Jewish identity in positive terms and to communicate this vision through books. Between 1931 and 1938, he published more than 200 works, including titles by Hermann Cohen, Heinrich Heine, Sholem Aleichem, Franz Kafka, Leo Baeck, Gershom Scholem, and many others—a veritable “Who’s Who” of Jewish thought.
The Schocken Bücherei —a series of attractively designed yet affordable paperback editions—was a particularly important project to him. It embodied his ambition to create a new canon rooted in Jewish tradition. The series ultimately comprised 92 volumes, including sacred texts, historical studies, ethnographic and cultural works, philosophical writings, Yiddish literature, and folklore.
A Home in Jerusalem, no Home in Jerusalem?
The Nazis shut down the Schocken Verlag in 1938. A few years earlier, in 1934–35, Salman Schocken had immigrated to Palestine with his wife Lilli and children, where he founded a second publishing house. The family’s move was partially motivated by his Zionist convictions. As a publisher, Schocken strongly identified with cultural Zionism, viewing the strengthening of Jewish culture—in both the Land of Israel and the diaspora—as essential to the survival of the Jewish people. In this he differed from political Zionists, who prioritized the establishment of a Jewish state.
In 1935, Schocken settled in Rechavia, a Jerusalem neighborhood inhabited by Yekkes and the intellectual elite,
sein Haus und seine Bibliothek ein soziales Zentrum wurden. Er konnte seine riesige Büchersammlung aus Deutschland nach Jerusalem retten, mit einem Aufwand, der ihre Bedeutung für Schocken spiegelte: sie war ihm ein Zuhause. Dagegen galt er vielen Mitmenschen und auch seiner Familie gegenüber als verschlossener, schwieriger, schwer ergründbarer Mensch. Und er wurde auch im Jischuw kaum heimisch, obwohl er durch seine Aktivitäten viele Kontakte knüpfte, darunter auch für die Hebräische Universität.
Für sie reiste er 1940 in die USA. Aus der für ein paar Monate geplanten Reise wurde ein fünfjähriger Aufenthalt, da er nach dem Kriegseintritt der USA kaum mehr zurückkehren konnte – oder vielleicht nicht wollte, da Palästina kein echtes Zuhause war.
Ein neuer Verlag in New York
Fünf Jahre lang sondierte Schocken die geistige Verfassung des amerikanischen Judentums und beschloss, in New York einen weiteren Verlag zu gründen. „Das ist eine Imitation des deutschen Verlages”, sagte er 1945 in Jerusalem.1
Dahinter stand die Vorstellung, dass sich das amerikanische Judentum nach 1945 in einer ähnlichen spirituellen Krise befand wie das deutsche Judentum zuvor. Schocken sah eine Gemeinschaft, die ihren Platz in einer Gesellschaft suchte, die größere Akzeptanz in Aussicht stellte. Antisemitismus war stigmatisiert, das Judentum wurde als liberale Religion als Teil des „jüdisch-christlichen Ethos“ aufgewertet. Und ähnlich wie 25 Jahre zuvor in Deutschland sah Schocken
and his home and library soon became a social hub for this community. He managed to rescue his vast book collection from Germany and bring it to Jerusalem—a testament to how deeply he valued it. The library was, in many ways, his home. Yet to those around him, including his family, Schocken remained a distant, difficult, and inscrutable individual. Despite the many contacts he made through his work, not least for the Hebrew University, he never felt truly at home in the Yishuv, the Jewish community in Palestine.
In 1940, he traveled to the United States on behalf of the Hebrew University. What was intended as a journey of just a few months turned into a five-year stay. Once the United States entered the war, returning was hardly possible, but perhaps he didn't want to go back, having failed to put down roots in Palestine.
For five years, Schocken explored the spiritual and intellectual state of American Jewry and ultimately decided to establish a new publishing house in New York. “It’s an imitation of the German publishing house,” he stated in Jerusalem in 1945.1
He was convinced that, after 1945, American Jewry faced a spiritual crisis similar to the one German Jews had experienced years earlier. Schocken encountered a Jewish community seeking its place in a society that promised greater acceptance. Antisemitism had become stigmatized, and Judaism, as a liberal faith, enjoyed higher status as part
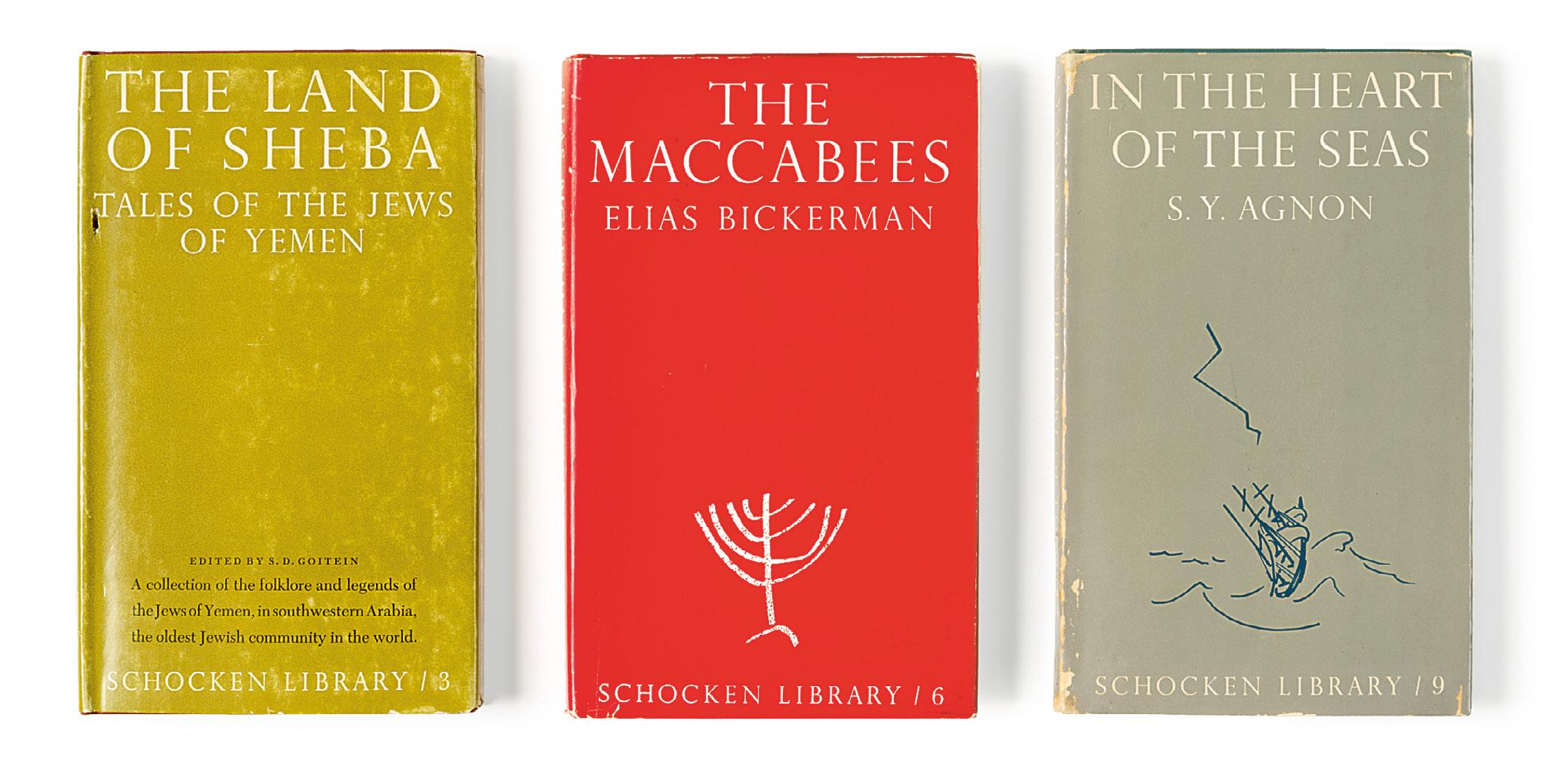
Bücher aus der Reihe „Schocken Library “, 1947/48
Books from the series Schocken Library, 1947/48
in der Elite einer neuen Generation das wachsende Bedürfnis, sich die Tradition für eine moderne, aber tiefe jüdische Identität neu zu erschließen. Schocken erspürte diese beginnende Bewegung als Outsider vielleicht besonders aufmerksam.
Im 1945 gegründeten Verlag Schocken Books war Salman Schocken die treibende Kraft, auch wenn er seine Mitarbeiter (darunter kurze Zeit Hannah Arendt) oft durch Entschlusslosigkeit frustrierte und durch viele Reisen die Entscheidungsprozesse erschwerte. Auch darin spiegelte sich seine Persönlichkeit: kompliziert, zwischen verschiedenen Welten unterwegs, als Kulturvermittler mit sehr eigenwilliger Perspektive und großen Ambitionen.
Denn Schocken wollte mit dem Verlag nicht nur einen neuen Markt erschließen, sondern auch einen kulturellen Auftrag erfüllen. Er bezog ein ungeheures Sendungsbewusstsein aus einer speziellen Melange aus deutscher Kultur und jüdischer Tradition, die er nun dem vermeintlich kulturell unterversorgten US-Judentum anbot, etwa in der Neuauflage der „Schocken Bücherei“ als „Schocken Library“.
Ein Export deutsch-jüdischer Kultur?
Die Kontinuitäten zum deutschen Programm standen in dramatischen Kontrast zu den historischen Diskontinuitäten: Schocken wollte dasselbe Programm in zwei Kulturräumen und Sprachen veröffentlichen, für zwei Gemeinschaften, die sich seit rund 100 Jahren unterschiedlich entwickelt hatten. Und dies über die größten Brüche der jüdischen Geschichte seit fast 2000 Jahren hinweg. Vielleicht suchte er Kontinuität im Zuhause der Texte, die er in Deutschland und den USA publizierte. Denn Schocken glaubte an einen überzeitlich relevanten Kanon jüdischer Schriften. Diese Schriften stünden für eine in der Tradition wurzelnde Essenz des Judentums, die existenziell wichtig sei für moderne Jüdinnen und Juden in ihrer spirituellen Krise. Diese Mission wird deutlich im Vorwort, das Buber 1946 für die „Schocken Library“ schrieb:
„Niemals zuvor in der Geschichte des jüdischen Volkes ist Sammlung so notwendig gewesen wie heute … Sammlung des zerstreuten jüdischen Geistes, der zerstreuten jüdischen Seele. … Die Forderung der Sammlung als die Forderung der Stunde ist es, wovon die Produktion der Schocken Books und innerhalb ihrer besonders die mit diesem Band beginnende Bücherreihe ausgeht.“ 2
Dieses Programm wurde von der intellektuellen Elite begrüßt. „Die Schocken-Bücher sind wieder da“, jubelte die deutschsprachige Emigranten-Zeitschrift Aufbau 1947. 3 Wenn man Erfolg dagegen an Verkaufszahlen misst, kommt man zu nüchternen Ergebnissen. Der Verlag blieb ein Zu-
of the "Judeo-Christian tradition" . As in Germany twenty-five years before, Schocken discerned in the emerging intellectual elite a desire to draw on tradition to shape a modern yet firmly rooted Jewish identity. Perhaps, as an outsider, he was especially sensitive to the stirrings of this nascent movement.
At Schocken Books, founded in 1945, he was a dynamic force, though his indecisiveness often frustrated his staff (including, for a time, Hannah Arendt) and his frequent trips made decision-making difficult. These traits reflected his character: he was a complex figure moving between different worlds, a cultural mediator with an unconventional perspective and ambitious goals.
With his publishing house, Schocken sought not only to enter a new market but also to fulfill a cultural mission. He derived a strong sense of purpose from the distinctive mixture of German culture and Jewish tradition, which he now brought to what he saw as a culturally underserved American Jewish community—for instance, through the Schocken Library, a revival of the Schocken Bücherei
The continuities with the German publishing list stood in stark contrast to the historical discontinuities. Schocken sought to publish the same works across two cultural spheres and languages, for two communities that had developed along different paths over the preceding century. He pursued this project even in the face of the greatest upheaval in Jewish history in nearly two millennia. Perhaps he was seeking to forge continuity through the very texts he published in Germany and the United States, seen as a kind of intellectual home. He was guided by his belief in a canon of Jewish writings with timeless relevance. For him, these works embodied the essence of a Judaism rooted in tradition—an essence of existential importance for modern Jews amid their spiritual crisis. This mission is evident in the preface Martin Buber wrote in 1946 for the Schocken Library:
“Never before in Jewish history has collecting been as important as it is today ... collecting the dispersed Jewish spirit, the scattered Jewish soul. ... The call to collect, as the call of the hour, marks the starting point of Schocken Books and this book series in particular.” 2
The publishing list was warmly received by the intellectual elite. “Schocken Books are Back,” ran the jubilant headline of a 1947 article in the German-language immigrant magazine Aufbau. 3 Yet if success is measured by sales figures, the picture was sobering. The firm remained unprofitable and the Schocken Library was discontinued in 1949 after its twentieth volume. After its productive founding years,
2 Martin Buber, „Verlagsvorwort Schocken Library“, 29. November 1946, SchA, 378/o.
3 „Die Schocken-Bücher sind wieder da“, Aufbau, 24. Oktober 1947.
2 Martin Buber, “Verlagsvorwort Schocken Library,” 29 November 1946, SchA, 378/o.
3 “Die Schocken-Bücher sind wieder da,” Aufbau, 24 October 1947.
schussgeschäft; die „Schocken Library“ endete 1949 mit dem 20. Band. Nach produktiven Gründungsjahren schlingerte Schocken Books mit wenigen eigenen Veröffentlichungen durch die 1950er-Jahre, stets nah am Konkurs.
Damalige Beobachter machten dafür ein mangelndes Verständnis für den US-Markt verantwortlich, oder präziser: ein Unverständnis, dass amerikanische Juden keine deutschen Juden waren, und auch nicht nur Juden, sondern auch Amerikaner. 4 Die „Schocken Library“ enthielt keinen einzigen amerikanischen Autor, kein Thema mit Bezug zu Amerika. Schocken Books blieb in der Anfangsphase ein europäischer Import nach Amerika, ein Fremdkörper wie der Verlagsgründer.
Epilog
Erst nach Schockens Tod 1959 wurde der Weg frei für eine Neuausrichtung des Verlags. In den 1960er-Jahren stellte sich der wirtschaftliche Erfolg ein, als eine neue Generation amerikanischer Jüdinnen und Juden das jüdische Erbe der „Alten Welt“ neu für sich entdeckte. Diese Entwicklungen wirken wie eine verzögerte Bestätigung dessen, was Salman Schocken schon in den 1940er-Jahren erwartete: eine jüdische Kulturrenaissance, die eine moderne Identität in jüdischer Geschichte und Tradition verankern wollte. In den 1970er-Jahren gehörten Veröffentlichungen von Schocken Books zur Grundausstattung gebildeter jüdischer Haushalte wie die „Suhrkamp Bibliothek“ für eine deutsche Bildungselite.
Die späteren Entwicklungen wirken wie ein Epilog zu Salman Schockens Lebensgeschichte. Schocken Books ist seit 1987 ein Imprint für jüdische Themen bei Random House und gehört damit seit 2013 zum Medienkonzern Bertelsmann. Zwei Generationen nach seiner Gründung in Berlin kehrte der Nachfolger des Schocken Verlags damit auf gewisse Weise nach Deutschland zurück: eine ironische Volte der Geschichte. In Salman Schockens Lebensgeschichte schloss sich kein Kreis. Sein Leben im Dazwischen steht einzigartig wie exemplarisch für die großen Fragen, Widersprüche und Brüche jüdischer Geschichte im 20. Jahrhundert.
Schocken Books limped through the 1950s with just a handful of its own publications, always teetering on the edge of bankruptcy.
Contemporary observers attributed the problems to a lack of insight into the U.S. market—or, more precisely, to a failure to recognize that American Jews were not German Jews, but saw themselves not only as Jews but also as Americans. 4 The Schocken Library did not include a single American author or a single work on an American subject. In its early years, Schocken Books remained essentially a European import to America—a foreign body, much like its founder.
Only after Schocken’s death in 1959 was it possible for the publishing house to chart a new course. It achieved commercial success in the 1960s, when a new generation of American Jews rediscovered the Jewish heritage of the “Old World”. These developments seemed to confirm, if belatedly, what Salman Schocken had already anticipated in the 1940s: a Jewish cultural renaissance that sought to anchor modern identity in Jewish history and tradition. By the 1970s, Schocken publications had become as integral to educated American Jewish households as the Suhrkamp Bibliothek was to Germany’s intellectual elite.
From today’s perspective, subsequent developments form a coda to Salman Schocken’s story. Since 1987, Schocken Books has been an imprint for Jewish topics at Random House; since 2013, it has belonged to the Bertelsmann media group. In an ironic twist, two generations after the founding of the Schocken Verlag in Berlin, the successor company has, in a sense, returned to Germany. Yet Salman Schocken’s story never came full circle. His life in between uniquely exemplifies the key questions, contradictions, and ruptures of twentieth-century Jewish history.
Markus Krah ist Direktor des Leo Baeck Instituts New York / Berlin, eines Archivs und Forschungsinstituts zur Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums. Er arbeitet an einem Buch zur Geschichte des US-Verlags Schocken Books.
Markus Krah is the Executive Director of the Leo Baeck Institute New York / Berlin, an archive and research institute dedicated to the history and culture of Germanspeaking Jews. He is currently writing a book on the history of the U.S. publishing house Schocken Books.
4 Nachum Glatzer schrieb rückblickend, „Manche betrachteten Schocken Books als ein hauptsächlich europäisches Verlagsprojekt, das keine Notwendigkeit sah, sich dem American way of life anzupassen.“ Nachum Glatzer, „Herrn Salman Schocken zum achtzigsten Geburtstag“, n. d. [1957], SchA 30.
4 Nachum Glatzer wrote retrospectively, “Some regarded Schocken Books as a European publishing project that saw no reason to adapt to the American way of life.” Nachum Glatzer, “To Mr. Salman Schocken on his eightieth birthday,” undated. [1957], SchA 30.
Ein Gespräch zwischen Joshua Cohen, Hillel Schocken und dem Journalisten Felix Stephan. A conversation between Joshua Cohen, Hillel Schocken and journalist Felix Stephan.
Joshua Cohen (mittig) gilt als eine der bedeutendsten literarischen Stimmen der Gegenwart. Die Werke des USamerikanischen Autors behandeln Themen wie Religion, Vertreibung, Exil und Schoa. Für seinen Roman „Die Netanjahus“ erhielt er den National Jewish Book Award in der Sparte Fiktion und den Pulitzer-Preis des Jahres 2022. Im Jahr 2023 gründete Cohen ein Konsortium, um Schocken Books von dem deutschen Medienkonzern Bertelsmann zu erwerben und damit der großen jüdischen Tradition des Schocken Verlags neues Leben einzuhauchen.
Hillel Schocken (links) hat 1979 das Büro Schocken Architects gegründet, leitet es seither und ist verantwortlich für eine Vielzahl von Projekten für Städte, Museen, Bildungseinrichtungen, die Industrie und die Denkmalpflege. Er ist Professor für Architektur an der zur Universität von Tel Aviv gehörenden Azrieli School of Architecture und war von 2004 bis 2008 deren Leiter. Er ist ein Enkel von Salman Schocken.
Felix Stephan (rechts) ist Kulturjournalist und Schriftsteller. Als freier Autor schrieb er unter anderem für die Süddeutsche Zeitung , für ZEIT online , Monopol und den Tagesspiegel. In seinem viel beachteten Artikel „Ein aberwitziger Plan“ (SZ , 15./16. Juli 2023) beschrieb Stephan Cohens Weg und verlegerische Vision, dem Mediengiganten Bertelsmann Schocken Books abzukaufen. Felix Stephan ist seit 2018 Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung

Joshua Cohen (center) is considered one of the most important literary voices of our time. The American author’s works often feature themes of religion, displacement, life in exile and the Shoah. His novel The Netanyahus earned him the National Jewish Book Award for Fiction and the 2022 Pulitzer Prize. In 2023, Cohen founded a consortium to acquire the Schocken Books imprint from the German media group Bertelsmann to breathe new life into the great Jewish tradition of the Schocken publishing company.
Hillel Schocken (left) has been the founder and director of Schocken Architects since 1979 and is responsible for a wide variety of projects for cities, museums, educational institutions, industry, and historic preservation. He is a professor of architecture at the Azrieli School of Architecture at Tel Aviv University and was the school’s director between 2004 and 2008. He is a grandson of Salman Schocken.
Felix Stephan (right) is a cultural journalist and writer. As a freelance author, he has written for newspapers and magazines including Süddeutsche Zeitung , ZEIT online , Monopol, and Tagesspiegel. In his highly acclaimed article “Ein aberwitziger Plan” (A Ludicrous Plan) (SZ , July 15/16, 2023), Stephan described Cohen’s attempts to strike a deal with media giant Bertelsmann to take over the Schocken Books imprint. Felix Stephan has been working for the arts and culture section of the Süddeutsche Zeitung since 2018.
Der Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen kam zur Eröffnung der Ausstellung „Inventuren“ nach Berlin und gab Einblicke in seine Beschäftigung mit dem Unternehmer und Verleger Salman Schocken. Im Gespräch mit dem Architekten Hillel Schocken und dem Journalisten Felix Stephan diskutierte er über Publizieren und Widerstand, über Kultur und Kapital, über Aneignung und Zugehörigkeit – und über die Relevanz dieser Fragen für unsere Gegenwart.
Pulitzer-prize winner Joshua Cohen came to Berlin for the opening of the exhibition Inventories and shared his insights on the entrepreneur and publisher Salman Schocken. In conversation with the architect Hillel Schocken and journalist Felix Stephan, Cohen discussed publishing and resistance, culture and capital, appropriation and belonging, and the relevance of these questions today.
DE EN
Felix Stephan: Salman Schocken kam 1877 in dem Städtchen Margonin nahe Poznań (Posen) –damals Preußen, heute Polen – zur Welt. Er übersiedelte nach Berlin und begann, alles zu lesen, was ihm in die Finger kam. Dann bat ihn sein Bruder in Zwickau (Sachsen), ihm dort beim Aufbau eines Familienunternehmens, eines Kaufhauses, behilflich zu sein. Der Legende nach traf Salman Schocken im Zug nach Zwickau einen Rabbiner und beklagte sich bei ihm, er habe keine große Lust, dorthin zu fahren, interessiere sich nicht für den Handel, ginge lieber zur Universität. Und der Rabbiner antwortete: „Geh, hilf deinem Bruder. Es studiert sich besser mit vollem Magen.“ Daraus ergibt sich meine erste Frage an Sie, Herr Schocken: Was geschah dann?
Hillel Schocken: Diese Legende beschreibt meinen Großvater sehr gut. Er war eine neugierige Person, neugierig auf vielen Gebieten. Tatsächlich half er seinem Bruder dabei, einen Laden in Zwickau zu eröffnen, aus dem rasch zwei Läden in der Stadt und dann eine ganze Kette von Kaufhäusern – am Ende ungefähr zwanzig –
überall in Sachsen und Deutschland wurde. Sein Erfolg erlaubte ihm genug Muße, um seinen Interessen nachzugehen: Lernen, Studieren, Literatur, Kunst. Im Jahr 1926, Salman war in seinen Zwanzigern, starb der ältere Bruder bei einem Verkehrsunfall. Salman leitete das Geschäft von da an allein und führte es in den 1930er-Jahren zu großem Erfolg – bis zum Aufstieg des Nazi-Regimes. Alles, wofür er über Jahre so hart gearbeitet hatte, musste er zurücklassen. Er begann neu in Palästina und dann in den Vereinigten Staaten.
Felix Stephan: 1931 rief er in Deutschland noch ein zweites Geschäft ins Leben: den Schocken Verlag. Was hat Salman Schocken veröffentlicht?
Joshua Cohen: Salman Schockens Programme waren vielfältig. Es gab Bücher für jüngere Leser, aber es gab auch Bücher über jüdische Geschichte, die für ein westliches, assimiliertes Publikum gedacht waren, Jüdinnen und Juden, die ihre Verbindung zur jüdischen Bildung verloren hatten und eine Gedächtnisstütze brauchten – etwa die praktischen „Schocken Almanache“, in denen man den jeweiligen Tora-Wochenabschnitt fand.
Felix Stephan: Salman Schocken was born in 1877, in the small village of Margonin near Posen in what was then Prussia (today Poland). He came to Berlin and started reading everything he could get his hands on. Then he was called by his brother in Zwickau, Saxony, to help with the family business, a department store. And there’s this legend: On the train to Zwickau, Salman Schocken met a rabbi and complained to him saying he didn’t really want to go, he wasn’t interested in trade, he wanted to go to university. And the rabbi answered: “Go and help your brother. It is much better to study with a full stomach.” So my question to you, Hillel, is: What happened next?
Hillel Schocken: Well, that legend portrays my grandfather very well. He was a curious person, curious in various fields. He did join his brother to start a shop in Zwickau that very soon turned into two shops in Zwickau and later into a fairly large chain of department stores—ultimately about 20—all over Saxony and Germany. His success allowed him enough leisure to follow his interests: learning, studying, literature, art.
In 1926, when he was in his twenties, his elder brother died in a car crash. Salman was left to run the business alone and had brought it to huge success by the 1930s, until the rise of the Nazi regime. He had to leave behind everything he had worked for so hard and for so many years. He started again in Palestine, and then again in the United States.
Felix Stephan: In 1931, he had started a second business in Germany: the publishing house Schocken Verlag. What did Salman Schocken publish, and why?
Joshua Cohen: Salman Schocken’s programs were varied. There were books for younger readers, and there were books about Jewish history. These were intended for a Western, assimilated audience, Jews who’d lost their connection with Jewish education, who required some reminder—like from the practical almanacs Schocken published that let you check the weekly Torah portion. But the center of his publishing program was the Schocken Bücherei : a series of 92 titles, in a uniform pocket-size and pleasing format. I think the purpose of the Bücherei was to bridge Jewish literary history with the highly as-
Aber im Zentrum des Programms stand die „Schocken Bücherei“, eine aus 92 Titeln bestehende Serie, durchweg in einem handlich und ansprechend gestalteten Taschenbuchformat. Ich vermute, Absicht hinter der „Bücherei“ war es, eine Brücke zwischen der jüdischen Literaturgeschichte und der höchst assimilierten Kultur der deutschen Jüdinnen und Juden zu schlagen. Und es gab noch einen weiteren Teil des Verlagsprogramms: Er zielte auf die Vereinigung der westlichen Jüdinnen und Juden mit der östlichen, jiddischen Tradition ab.
Felix Stephan: Arnold Zweig und Martin Buber versuchten, diese beiden Kulturen miteinander zu verschmelzen, richtig?
Joshua Cohen: Richtig. Es ist interessant, dass Salman Schocken – ein Jude aus Osteuropa, der in dieses hochgradig assimilierte Milieu kam, in dem die Jüdinnen und Juden deutscher als die Deutschen sein wollten – sich dazu entschloss, die östliche, jiddische mit der westlichen Tradition zu versöhnen. Er arbeitete mit Martin Buber zusammen, der das Erbe und die Erzählungen der Chassidim sammelte und ins Deutsche brachte. Eine weitere Abteilung im Programm waren Übertragungen von hebräischer Dichtung aus Osteuropa, der Ukraine oder Russland. In Buchform kamen die ersten Übertra-
gungen von Chaim Nachman Bialiks Gedichten bei Schocken heraus. Alle diese unterschiedlichen Stränge liefen in der Idee einer umfassenden jüdischen Bildung zusammen. Es war, meine ich, eine jüdische Bildung aus aschkenasischer Perspektive. Der Gedanke dahinter war, dass das Buchprogramm in den 1930er-Jahren eine literarische, eine religiöse sowie eine folkloristische oder jiddische Komponente haben sollte. Zur selben Zeit wurden diese Bücher von den Nazis verbrannt.
Felix Stephan: Die Bücher waren von hoher Qualität. Schocken persönlich überwachte die Bindung, die Umschläge, die Typografie, die Papierauswahl. Die Bücher wurden in den eigenen Kaufhäusern verkauft. Die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ im JMB zeigt Objekte aus diesen Kaufhäusern und Sie, Herr Cohen, haben Texte verfasst, die auf diesen Objekten basieren oder sie begleiten.
Joshua Cohen: Ja, allerdings ist es mir wichtig, dass mein literarischer Beitrag zu dieser Ausstellung sich weniger auf mich und nicht einmal so sehr auf Salman Schocken, sondern auf das Erbe bezieht, das wir hier vor uns haben. Als mich das Jüdische Museum Berlin darum bat, die Ausstellung
Zur selben Zeit wurden diese Bücher von den Nazis verbrannt.
similated culture of German Jewry. And yet another part of the Schocken Verlag’s program was an attempt to unite Western Jewry with the Eastern Jewish tradition, the Yiddish tradition.
Felix Stephan: Arnold Zweig and Martin Buber, too, were trying to merge those two cultures, weren’t they?
Joshua Cohen: Yes. It’s quite interesting that Salman Schocken—a Jew from Eastern Europe coming into this highly assimilated environment in which the Jews strove to be more German than Germans—chose to unite Eastern Yiddish with the Western tradition: he worked with Martin Buber, who collected the legacy and the tales of the Hasidim and transferred them into German. Another strand was translating Hebrew poetry that was being written in Eastern Europe, in Ukraine, in Russia: Schocken published the first translations of Bialik into German in book form.
All of these strands were united in this idea of a complete Jewish educa-
tion. I mean, a complete Jewish education from an Ashkenazi standpoint. The idea was that there had to be a literary component, a religious component, and a folkloric or Yiddish component coming together in the books he published throughout the 1930s, at the very same time the Nazis were burning them.
And yet another part of the Schocken Verlag’s program was an attempt to unite Western Jewry with the Eastern Jewish tradition, the Yiddish tradition.
Felix Stephan: The books were of very high quality. Schocken attended to the binding, the covers, the typography, the paper himself; they were sold in his own department stores. The exhibition shows objects from those stores, and you have written texts based on the objects or to accompany them.
Joshua Cohen: Yes, but it’s important to me that my literary contribution to this exhibition is less about me, or even about Salman Schocken, than about the legacy we find here. When the Jewish Museum Berlin asked me to help curate this exhibition, for me what mattered was encountering all of these
mitzukuratieren, kam es mir darauf an, all diesen Autoren zu begegnen, die er veröffentlicht hat. Ich versuchte, die Texte von Autoren des Schocken Verlags Berlin mit denen von Schocken Books in den Vereinigten Staaten zu kombinieren. Salman Schockens Beitrag zur Literaturgeschichte reicht so weit, dass er sich vom Hintergrund dreier Kulturen – der deutschen, der israelischen und der amerikanischen – kaum noch trennen lässt. Mit diesem Hintergrund verbinden sich auch meine eigenen Texte. Deshalb habe ich sie fast ausschließlich aus Schriften der Autor*innen von Schocken montiert; Zitate, Paraphrasen und so weiter. Ein Beispiel für meinen Ansatz ist mein Text zu der Hutschachtel. Ich weiß nicht, ob sich in der Schachtel ein Hut befindet, ich durfte sie nicht öffnen. Der Text greift auf einen Gedanken von Hannah Arendt aus dem Jahr 1970 zurück: „Der Kapitalismus ist keine Alternative zum Sozialismus und umgekehrt. Nicht nur, weil keines von beiden in seiner reinen Form existiert, sondern weil beide Zwillinge sind, von denen jeder einen anderen Hut trägt.“
Felix Stephan: Selbst nach der Bücherverbrennung 1933 in Deutschland erlaubte es eine eigenartige Gesetzeslücke jüdischen Verlagen, jüdische Bücher für jüdische Leser*innen zu drucken. Und so setzte der Schocken Verlag Berlin seine Arbeit noch bis zu den Novemberpogromen 1938 fort. Salman Schocken selbst emigrierte Ende 1933 ins Britische
Mandatsgebiet Palästina, er nahm seinen Verlag und seine riesige, 60.000 Bände umfassende, Bibliothek mit. 1937 kaufte er die Zeitung Ha’aretz , die noch immer in Familienbesitz ist – derzeit wird sie von Amos Schocken (ebenfalls ein Enkel von Salman Schocken und Bruder von Hillel Schocken, Anm.d.Red.) herausgegeben. Da die verlegerische Tätigkeit der Familie Schocken ein so klares politisches und soziales Profil aufweist, frage ich mich, wie sich dieses Ethos über Generationen in Israel erhalten hat. Was sind die treibenden Kräfte?
Hillel Schocken: Eine schwierige Frage – und eine schwierige Aufgabe! Als mein Großvater die Tageszeitung kaufte, setzte er sogleich meinen Vater, Gustav Schocken, als Verleger, Eigentümer und Leiter ein. Die Leute fragen mich, wie es möglich ist, dass der Eigentümer und der Verleger ein und dieselbe Person sind. Ich denke, dass unser Vater, der die Zeitung stärker geprägt hat als sein eigener Vater, eine Art geteiltes Gehirn hatte. Da gab es den Geschäftsmann und da gab es den Verleger. Zwischen den beiden gab es keine Verbindung. Fünfzig Jahre lang, bis zu seinem Tod, gelang es ihm, Ha’aretz als Qualitätsblatt am Laufen zu halten. Dann übernahm mein Bruder Amos das Geschäft, der in mancher Beziehung weiter ging, den Herausgeberposten jemand anderem überließ und als Verleger weitermachte. Er hat das Blatt in den letzten 34 Jahren verantwortet.
authors whom he published. What I tried to do was create a combination of texts by authors who were published by both Schocken Verlag in Berlin and Schocken Books in the United States. Salman Schocken’s contribution to literary history is so immense that at this point it almost blends into the background of three cultures, German, Israeli, and American. I wanted to blend my own writing into the background too, making it almost exclusively out of the writing of Schocken’s authors: quotes, paraphrases, etc. An example of my approach could be my text about the hat box. I don’t know if there’s actually a hat inside the box, they didn’t let me open it. The text takes on a thought of Hannah Arendt’s from 1970: “The alternative between capitalism and socialism is false. Not only because neither exists anywhere in its pure state anyhow, but because we have here twins, each wearing a different hat.”
Felix Stephan: After the book burning in 1933, there was a strange loophole in German law that allowed Jewish publishing houses to produce Jewish books for Jewish readers, and Schocken Verlag Berlin continued until after the November 1938 pogroms. Salman Schocken himself emigrated to British Mandate Palestine in late 1933 and took his publishing house and his vast library of 60,000 books with him. In 1937, he bought the newspaper Ha’aretz , which is still run by the family—the publisher today is Amos
Schocken. I'm wondering, since there's such a clear political and social profile in the Schocken family’s publishing activities: How does one preserve this ethos over the generations in Israel? What are the dynamics?
Hillel Schocken: That’s a difficult question. And it’s a difficult task! When he bought the newspaper, our grandfather immediately installed our father, Gustav Schocken, as its publisher, owner, and director. You know, people always ask me how it’s possible that the owner and the publisher are the same person. I think our father, who had more influence on the newspaper than his own father had done, had sort of a divided brain. There was the businessman, and there was the publisher. There was no connection between the two. He managed to run Ha’aretz, keeping it a quality newspaper, for about fifty years until his death. Then my brother Amos took over, who went further in some ways, leaving the editorship to another person and staying on as the publisher. He’s managed the paper for the last thirty-four years. At the moment, he is bravely facing more difficult times than many newspaper publishers today can imagine. Reconnecting this to our grandfather, I’d say it has to do with one of his greatest characteristics: his ability to find quality. Everything our grandfather touched was about quality, whether it was the design of his books, their content, or the quality of the fabrics he sold in his department store. My grandfather was a person
Alles, was unser Großvater anfasste, hatte Klasse, ob es um die Buchgestaltung, den Inhalt oder ob es um die Textilien ging, die er in seinen Warenhäusern verkaufte.
Derzeit sieht er sich tapfer größeren Schwierigkeiten gegenüber, als sie sich viele Zeitungsverleger heute vorstellen können. Wenn ich das auf unseren Großvater zurückbeziehe, würde ich sagen, es hat mit einem von dessen größten Charakterzügen zu tun. Alles, was unser Großvater anfasste, hatte Klasse, ob es um die Buchgestaltung, den Inhalt oder ob es um die Textilien ging, die er in seinen Kaufhäusern verkaufte. Mein Großvater war ein Mensch, der auf Qualität achtete. Und wenn du ein Verlagshaus leiten willst, insbesondere einen Zeitungsverlag, musst du das im Hinterkopf behalten. Niemand hat darüber gesprochen, als wir Kinder waren, doch denke ich, dass sein hoher Anspruch auf Qualität daheim überall spürbar war.
Felix Stephan: In Noemi Schorys Dokumentarfilm Schocken. Ein deutsches Leben (2020/21) kann man Sie sehen, wie Sie die von Erich Mendelsohn entworfene Bibliothek, heute: die Schocken Library, in Jerusalem betrieten. Und da gibt es eine Lampe, die nicht
perfekt ausgerichtet, sondern ein wenig schief ist. Man sieht Sie, wie Sie die Lampe zurechtrücken, erst danach kommen Sie an den Tisch, wo das Interview stattfindet. Und da sagen Sie, als ob Sie mit sich selbst sprächen: „Großvater hätte dazu bestimmt etwas gesagt …“
Hillel Schocken: Als er starb, war ich zwölf. Und doch habe ich eine Erinnerung, die diese Geschichte bestätigt: Eines Tages besuchten wir unseren Großvater in einem Hotel nahe Tel Aviv. Mein Vater war sehr stolz darauf, ihm ein Buch präsentieren zu können, das er gerade bei Schocken in Tel Aviv veröffentlicht hatte. Es handelte sich um eine Sammlung von Bildern eines sehr angesehenen israelischen Landschaftsfotografen. Auf dem Cover sah man das Foto eines Dorfes, aus großer Entfernung aufgenommen. Da waren die umgebenden Ländereien und im Hintergrund das Dorf. Es gab ein gepflügtes Feld, dessen Furchen die Perspektive des Bildes noch verstärkten. Ein wunderschönes Foto. Unser Großvater, der sehr kurz-
of quality. And if you want to run a publishing house, or especially a newspaper, you need to be able to keep that in mind. Nobody talked about this when we were kids, but I think his demand for high quality in everything was passed on through the atmosphere at home.
Felix Stephan: In the documentary Schocken, On the Verge of Consensus by Noemi Schory, you can be seen entering the library built by Erich Mendelsohn, today the Schocken Library in Jerusalem. And there's one lamp that is not perfectly aligned, it's just a little off. And you can be seen straightening the lamp; only then do you walk to the table where the interview will take place. And you're saying, as if to yourself: “Grandfather would have said something about that ...”
scape photographer. On the cover of the book was a photograph of a village, taken from far away, showing the fields and looking on to the village in the background. And you could see a plowed field, with its furrows emphasizing the image’s perspective. It was a very nice photo. Our grandfather, who was very short-sighted, took the book, held it close to his face and said: “These furrows are not straight.”
Felix Stephan: His everlasting presence is still felt! After running into a kind of cul-de-sac in Palestine, Salman Schocken moved to New York, where he opened another publishing house: Schocken Books. Its impact in New York—both the cultural impact and the structural impact, when it comes to how to run a publishing house— was enormous.
Hillel Schocken: I was twelve when he passed away. But I do have a memory that underlines that story: One day, we went to meet our grandfather in a hotel near Tel Aviv. My father was very proud to show him a book he had just published at Schocken in Tel Aviv. The book was a collection of photographs by a very well-established Israeli land-
Joshua Cohen: Schocken Books in the United States became a clearinghouse for refugee intellectuals. Not only was it a place where Hannah Arendt was an editor and where both vanguard Jewish European writers, such as Kafka and Primo Levi, and non-Jewish writers such as Jean-Paul Sartre or Donald Winnicott
sichtig war, hielt sich das Buch direkt vors Gesicht und sagte: „Diese Furchen verlaufen nicht gerade.“
Felix Stephan: Seine Allgegenwart ist noch überall spürbar! Nachdem er in Palästina in eine Sackgasse geraten war, zog Salman Schocken nach New York, wo er einen weiteren Verlag eröffnete: Schocken Books. Die Wirkung dieses Verlags in New York war enorm, und das meint nicht nur die kulturelle, sondern auch die strukturelle Wirkung, wenn es nämlich darum geht, wie ein Verlag geführt werden muss.
Joshua Cohen: In den Vereinigten Staaten wurde Schocken Books zu einer Art Clearingstelle für geflüchtete Intellektuelle. Das war nicht nur der Verlag, in dem Hannah Arendt Lektorin war und sowohl jüdische Avantgarde-Autoren wie Franz Kafka und Primo Levi als auch nichtjüdische Schreiber wie Donald Winnicott und Jean-Paul Sartre auf Englisch herauskamen, es war auch der zentrale Absatzmarkt für die aus Europa vertriebenen Geisteswissenschaften. Schocken wurde zu dem Verlag, in dem Hauptwerke aus Ethnologie, Soziologie, Philosophie und anderen Fächern er-
schienen. Über diesen Weg gelangte Walter Benjamin, der vorher nicht auf Englisch gedruckt worden war, nicht nur in die Universitäten der USA, sondern wurde auch der amerikanischen Mittelklasse ein Begriff. Schocken Books war in vieler Hinsicht der Ort für die Übermittlung europäischer oder kontinentaler Ideen in Amerika. Genau deshalb wurde der Verlag für alle kommenden Generationen amerikanischer Akademiker sehr wichtig, als die „Theorie“Bewegung, etwa die Frankfurter Schule, sich in den gesamten amerikanischen Geisteswissenschaften verbreitete. Er war buchstäblich die europäische Pflanze, die auf die amerikanische aufgepfropft wurde. Ich finde diese beiden Aspekte von Salman Schockens Werk interessant: das liberal-demokratische Ideal von Israel, für das seine Tageszeitung steht, und das Ideal der liberal-demokratischen Tradition in der amerikanischen Universität, das über die Tradition der Flüchtlinge hereinkommt. Beide Ideale sind nun bedroht. Selbstverständlich sind die Bedrohungen unterschiedlicher Art und ist die Gefahr hier und da unterschiedlich groß. Doch in ganz ähnlicher Weise wie diejenigen geisteswissenschaftlichen Fakultäten, die auf dem Modell der
Er war buchstäblich die europäische Pflanze, die auf die amerikanische aufgepfropft wurde.
were brought into English, it was also the primary commercial outlet for the European humanities displaced from Europe. It became a publishing house for major work in anthropology, sociology, philosophy, and more. It became the route by which Walter Benjamin, who hadn’t yet been published in English, came not just into American academia, but into middle-class American awareness. Schocken was very much a home for the translation of European or continental ideas to America. And because of that, it became enormously influential for all the successive generations of American academics as the “theory” movement, say, the Frankfurt School, diffused through the body of the American humanities. It was the actual physical graft of the European plant onto the American plant. I find it interesting to see these two strands coming out of Salman Schocken’s work: the liberal democratic ideal of Israel, as exemplified in his newspaper, and the ideal of the liberal democratic tradition in American academia that comes via the refugee tradition. Both are under threat right now. Of course, I mean different levels of threat, and different levels of danger. But in much the same way that the humanities departments, which are founded on the critical theory model, have a target on their back from the Trump administration, the Schocken family’s newspaper Ha’aretz has a target on its back from the Netanyahu administration. And so what’s interesting to me is how these secular, liberal democratic ideals, not in
any way contradictory of the Jewish tradition or the Jewish ethos, have filtered out into a diaspora of their own through these two strands. For me, the exhibition at the JMB was a chance to bring those strands into dialogue and mutual recognition.
Felix Stephan: Hillel, can you tell us something about how the pressure by the Israeli administration is being felt?
Hillel Schocken: I think it’s quite well known that the current government is acting against the newspaper by trying to cut its readership within the government, among civil servants. And they also cut government advertising in the newspaper. We are surviving so far, in fact the paper is doing quite well. There are enough people, both outside Israel and in Israel, who are with us, and I often hear people say: If not for Ha’aretz, we wouldn't have stayed in Israel. That helps us going through these tough times. And the circulation of Ha’aretz’s English version has doubled in the last two years. That says something about the role of a newspaper.
Felix Stephan: Schocken Books was sold to Random House in the 1980s. At that time Random House was still independent, but a decade later it was acquired by the German publishing group Bertelsmann. During World War II, Bertelsmann was a small publisher, mostly focusing on publishing Bible and law texts, and made its fortune by collaborating with the
Kritischen Theorie basieren, nun zur Zielscheibe der Trump-Regierung werden, ist Ha’aretz, die Tageszeitung der Familie Schocken, zur Zielscheibe der Netanjahu-Regierung geworden. Was mich daran beschäftigt, ist, wie diese säkularen, liberal-demokratischen Ideale, die in keiner Weise der jüdischen Tradition oder dem jüdischen Ethos widersprechen, über diese beiden Stränge in eine je eigene Diaspora geraten sind. Die Ausstellung im JMB bot mir eine Gelegenheit, die beiden Stränge in einem Dialog und in gegenseitiger Anerkennung zusammenzuführen.
Felix Stephan: Herr Schocken, können Sie etwas dazu sagen, wie der Druck der israelischen Regierung sich auswirkt?
Hillel Schocken: Es ist wohl allgemein bekannt, dass die gegenwärtige Regierung gegen die Tageszeitung vorgeht, indem sie die Leserschaft innerhalb der Verwaltung, bei den Beamten, zu reduzieren versucht. Auch schaltet die Regierung weniger Anzeigen in der Zeitung. Wir kommen bislang über die Runden, der Zeitung geht es sogar recht gut. Es gibt genug Leute innerhalb und außerhalb Israels, die auf unserer Seite sind, und oft genug höre ich jemanden sagen: Gäbe es die Ha’aretz nicht, wären wir nicht in Israel geblieben. Das hilft uns dabei, diese harten Zeiten zu überstehen. Und die Auflage der englischen Ausgabe von Ha’aretz hat sich in den letzten beiden Jahren sogar verdoppelt. Das sagt etwas über die Rolle, die eine Tageszeitung haben kann.
Felix Stephan: Schocken Books wurde in den 1980er-Jahren an Random House verkauft. Zu der Zeit war Random House noch unabhängig, doch ein Jahrzehnt später wurde es von dem deutschen Medienkonzern Bertelsmannn aufgekauft. Bertelsmann war während des Zweiten Weltkriegs ein kleiner Verlag, der hauptsächlich Ausgaben der Bibel und Gesetzestexte herausbrachte. Er erwarb sein Vermögen dank einer Zusammenarbeit mit der NSDAP, die ihn beauftragte, kurze, unterhaltsame und erbauliche Geschichten für Wehrmachtssoldaten zu drucken. Wie führt Bertelsmann heute Schocken Books?
Joshua Cohen: Gar nicht. Und lassen Sie uns nicht vergessen: Die Autoren, die Schocken Books in den 1950er- und 1960er-Jahren veröffentlichte, waren die Eckpfeiler der amerikanischen Geisteswissenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Werke, ihr Denken waren so tief im Lehrplan verankert, dass Schocken Books als natürliche Gegebenheit galt. Doch zu der Zeit, als der Verlag an Random House verkauft wurde, war er auf ein jüdisches, fast liturgisches Programm verengt, druckte Talmud-Kompendien ebenso wie ein Chanukka-Kochbuch oder „Yoga für Purim“. So läuft es immer, es ist mehr Tragödie als Farce. Bertelsmann verlor das Interesse daran, den Verlag zu führen, und ließ ihn einschlafen. Das geschah zu einer Zeit, als auch andere jüdische
I wanted to find out what was possible with Schocken
NSDAP, which asked it to produce short, entertaining, and uplifting stories for Wehrmacht soldiers. Could you describe how Bertelsmann are running Schocken Books today?
Joshua Cohen: They’re not. And let’s not forget: The writers that Schocken Books published throughout the 1950s and 1960s really created the backbone of the American post-World War II humanities. Their works and thinking were so deeply anchored in the curriculum that Schocken Books itself was taken for granted. But at the time before it was sold to Random House, it was being turned into a Jewish, almost liturgical publisher, printing compendiums of Talmud as well as books like a Hanukkah cookbook or Yoga for Purim. That’s the way everything goes. It’s more a tragedy than a farce. Bertelsmann lost interest in running Schocken Books and let it lapse. This happened at a time when other Jewish publishers in the United States also folded, whether because of the publishers’ age or lack of money or from Covid-related reasons. At that time, I wanted to find out what was possible with Schocken Books. To make a very long story short—I was interested in buying the imprint, but failed. I was in touch with Bertelsmann and heard from Thomas Rabe, who was then the director:
“Scholten Books” is not for sale. He couldn’t even be bothered to remember the actual name of the publishing house.
Felix Stephan: But surely you tried again. So why do you think they refused to sell Schocken Books?
Joshua Cohen: In business it’s always easiest to do nothing. That way you avoid bad press. But no matter under which brand, the need for publishing is there, both for an increasingly large Israeli diaspora and for American Jewry. Let’s just be very clear about something. You know, American literary publishing was Jewish publishing. From Simon & Schuster to Charles Scribner’s Sons, to Alfred Knopf, even to Bennett Cerf, who founded Random House. These were German Jews. I shouldn’t feel comfortable using this word, but in many ways, the Jewish literary legacy in America has become “hostaged” to people who don’t care at all about its future. And because of that, these books disappear. And as the books disappear, a link to a vital past disappears, and a connection between the past and the conscience necessary to form a political future is also severed.
Felix Stephan: I remember you saying once
Verlage in den Vereinigten Staaten aufgaben, entweder, weil die Verleger in die Jahre gekommen waren, weil es an Geld fehlte oder wegen mit Covid verbundenen Problemen. Um es kurz zu machen: Ich wollte das Imprint Schocken Books kaufen, aber es misslang. Ich hatte Kontakt mit Bertelsmann und hörte vom Vorstandsvorsitzenden
Thomas Rabe, „Scholten Books“ stehe nicht zum Verkauf. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich den Namen des Verlags zu merken.
Felix Stephan: Sicherlich haben Sie noch einmal nachgehakt. Warum, denken Sie, weigert Bertelsmann sich, Schocken Books zu verkaufen?
Joshua Cohen: Im Geschäftsleben ist es immer das Einfachste, gar nichts zu tun. So vermeidet man schlechte Presse. Doch besteht sowohl bei der immer größeren jüdischen Diaspora als auch bei den amerikanischen Jüdinnen und Juden der Bedarf nach einem Verlag, egal, welchen Namen er trägt. Lassen Sie uns über eins klar werden: Amerikanische Literaturverlage waren jüdisch. Von Simon & Schuster über Charles Scribner’s Sons bis Alfred Knopf, ja sogar bis zu Bennett Cerf, der Random House gegründet hat – das waren deutsche Juden. Das Wort sollte mir nicht leicht über die Lippen gehen, und doch: In vieler Hinsicht ist das jüdische literarische Erbe in Amerika in „Geiselhaft“ genommen worden von Leuten, denen seine Zukunft schnuppe ist. Und weil das so ist, verschwinden diese Bücher. Und indem
die Bücher verschwinden, verschwindet eine Verbindung zu einer bedeutenden Vergangenheit. So wird die Brücke zwischen der Vergangenheit und dem Bewusstsein, das notwendig ist, um eine politische Zukunft zu bauen, niedergerissen.
Felix Stephan: Ich erinnere mich, dass Sie einmal sagten, Empörung sei der große Treiber einer großen Schöpferkraft. Spielt Empörung hier eine Rolle?
Joshua Cohen: Ich weiß nicht, ob es Empörung ist. Ich äußere mich in einem ganz bestimmten politischen Zusammenhang. Hillel und die Familie Schocken in Israel kommen aus einem anderen politischen Zusammenhang, der von fast allen Seiten her bedrängt wird – vom Druck, den die derzeitige Regierung auf die israelische Linke ausübt, bis hin zu dem Umstand, dass diese Linke Israel in Scharen verlässt. Im Rahmen unseres Gesprächs spreche ich aus der amerikanischen Perspektive. Unsere höheren Bildungseinrichtungen werden attackiert und das wird den Juden in die Schuhe geschoben, wodurch entweder neuer Antisemitismus massiv an Boden gewinnt oder latenter Antisemitismus eine neue Berechtigung gefunden zu haben glaubt. Über diese Situation habe ich mich genug aufgeregt –glaube ich jedenfalls. Nun will ich etwas unternehmen, um die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, zu retten und zu fördern. Wenn ich wütend bin, dann nicht aus persönlichen Gründen. Es gibt Leute, um derentwillen ich wütend bin.
that outrage is the great driver of a great creative force. Does outrage play a role here?
Joshua Cohen: I don’t know if it’s outrage. I am speaking in a very particular political context. Where Hillel and where the Schocken family in Israel are coming from is another particular political context, one that is fraught on almost every side, from the pressure put on the Israeli Left from the current government to the fact that the Israeli Left is leaving Israel in droves. For the purposes of this discussion, I’m speaking from the American perspective, where our institutions
Dieses Gespräch wurde am 20. Mai 2025 in der W. Michael Blumenthal Akademie geführt. Sie können es in ganzer Länge auf unserer Website anhören.
This conversation took place on 20 May 2025 at the W. Michael Blumenthal Academy. Listen to it in its entirety on our website.

jmberlin.de/gespraech-joshuacohen-inventuren
And as the books disappear, a link to a vital past disappears, and a connection between the past and the conscience necessary to form a political future is also severed.
of higher learning are under attack and it’s being blamed on the Jews, with a massive surge in antisemitism, or with a newfound permission to express constant latent antisemitism. I’m finished being angry about this situation—I think I’m finished. Now I just want to do something to save and further the culture I grew up in. If I’m angry, it’s not for personal reasons. There are people on whose behalf I am angry.

Salman Schocken in Palästina
Salman Schocken in Palestine


Auch wenn er sich, als selbst- und traditionsbewusster Jude, nicht als kultureller oder gar nationaler Repräsentant verstehen konnte und wollte: Salman Schocken nahm die deutsche Kultur nicht nur im ideellen, sondern auch im materiellen Sinne mit sich ins Exil.
As a self-assured, traditional Jew, Schocken could not and did not want to see himself as a cultural, much less a national representative. He nevertheless took German culture —not only in an ideal sense but also in a material one—with him when he went into exile.
DE Wo er sei, sei Deutschland, er trage die deutsche Kultur in sich. Mit diesen Worten soll Thomas Mann im Februar 1938 das Schiff verlassen haben, das ihn über den Atlantik in den sicheren Hafen des US-amerikanischen Exils brachte. Der Satz war nicht nur Ausdruck eines beträchtlichen kulturellen Selbstbewusstseins, sondern auch und mehr noch ein Arbeitsauftrag: die deutsche Kultur vor ihrer „Verhunzung“ –so beschrieb er es an unterschiedlichen Stellen – durch die Nationalsozialisten zu bewahren und zu retten.
Der Kaufmann, Verleger, Mäzen und Philanthrop Salman Schocken hätte diesen Satz mit derselben Berechtigung wie Thomas Mann aussprechen können, als er im Dezember 1933 das nationalsozialistische Deutschland verließ, um ins britische Mandatsgebiet Palästina überzusiedeln.1 Auch wenn er sich, als selbst- und traditionsbewusster Jude, nicht als kultureller oder gar nationaler Repräsentant verstehen konnte und wollte: Schocken nahm die deutsche Kultur nicht nur im ideellen, sondern auch im materiellen Sinne mit sich ins Exil, vor allem in Gestalt seiner rund 60.000 Bände zählenden Privatbibliothek, die eine herausragende Sammlung hebräischer Werke und auch zahlreiche literarische Schätze der deutschen Klassik und Romantik versammelte. Neben einer bedeutenden Kollektion an Goethe-Erstausgaben fanden sich in ihr Raritäten von Jean Paul, Hölderlin, Heine und anderen, ergänzt durch Handschriften und Inkunabeln von kaum schätzbarem Wert. In den Papieren lapidar als „alte und gebrauchte Bücher“ vermerkt, traf ein Großtransport von 164 Kisten am 1. Dezember 1935 in Haifa ein – der entscheidende Schritt, um die Sammlung dem Beutezug des NSChefideologen Alfred Rosenberg zu entziehen. Wie bittere Ironie wirkt es vor diesem Hintergrund, dass ausgerechnet Schockens Sammlung Jahrzehnte nach dem Krieg als Grundlage für bedeutende germanistische Editionsprojekte diente, allen voran für die große Düsseldorfer Ausgabe der Werke Heinrich Heines. 2
EN “Where I am there is Germany! I carry my German culture in me.” With these words, Thomas Mann spoke to journalists after disembarking the ship that brought him across the Atlantic to the safe haven of American exile in February 1938. The sentence was not only an expression of a strong sense of cultural self-confidence, but first and foremost also a mission: to save German culture and prevent it from being distorted (“verhunzt”) by the Nazis; that’s how he described it on several occasions.

Salman Schocken, the businessman, publisher, patron of the arts, and philanthropist, could have spoken the sentence with the same justification as Thomas Mann. Schocken left Nazi Germany in December 1933 to emigrate to the British Mandate of Palestine.1 As a self-assured, traditional Jew, Schocken could not and did not want to see himself as a cultural, much less a national representative. He nevertheless took German culture— not only in an ideal sense but also in a material one—with him when he went into exile, especially in the form of his private library, which consisted of roughly 60,000 volumes, including an outstanding collection of Hebrew works as well as numerous literary treasures of German Classicism and Romanticism. In addition to an important collection of Goethe first editions, it also contained rarities by Jean Paul, Hölderlin, Heine, and others, supplemented by manuscripts and incunabula of inestimable value. Noted succinctly in the shipping documents as “old and used books,” a bulk shipment of 164 crates arrived in Haifa on 1 December 1935—the decisive step to save the collection from the foray of the chief Nazi ideologue Alfred Rosenberg. Against this background it is a bitter irony that, decades after the war, it was precisely Schocken’s collection that served as the foundation for significant German critical edition projects, first and foremost the major Düsseldorf edition of Heinrich Heine’s works. 2
Für eine Bibliothek von Rang brauchte es einen angemessenen Ort. Schocken beauftragte deshalb den Architekten Erich Mendelsohn, der bereits für einige der spektakulärsten Bauten des Kaufhauskonzerns in Deutschland verantwortlich gewesen war, mit dem Entwurf eines repräsentativen Gebäudes. Das Vorhaben verstand er im zionistischen Sinne als „Heimkehr“ – als Beitrag zur Überwindung des Lebens in der Diaspora und zur Schaffung eines neuen
Der Architekt Erich Mendelsohn (1887–1953) The architect Erich Mendelsohn (1887–1953)
1 Die derzeit maßgebliche Forschung zu diesem Themenkomplex, der auch ich in weiten Teilen folge, stammt von Stefanie Mahrer: Salman Schocken. Topographien eines Lebens. Berlin 2021, insb. Teil II, S. 191–367.
2 Caroline Jessen: Von der Unverfügbarkeit der Manuskripte. Die Heine-Sammlung Salman Schockens (1936–1966), in: Geschichte der Philologien 63/64 (2023), S. 5–16.
A library of distinction needed an appropriate home. Schocken therefore commissioned the architect Erich Mendelsohn, who had already created some of the most spectacular buildings of the Schocken department store chain in Germany, to design a prestigious building. He viewed the project in the Zionist sense as a “homecoming,” as a contribution to overcoming life in the diaspora and creating a new cultural center that would bring a renewal of Judaism. Words of the prophet Jeremiah served as the leitmotif: “And they
1 For current significant research on this subject, which I also largely follow, see Stefanie Mahrer, Salman Schocken. Topographien eines Lebens, Berlin: Neofelis, 2021, esp. part II, 191–367.
2 Caroline Jessen, “Von der Unverfügbarkeit der Manuskripte. Die HeineSammlung Salman Schockens (1936–1966),” Geschichte der Philologien 63/64 (2023): 5–16.
kulturellen Zentrums, von dem eine Erneuerung des Judentums ausgehen sollte. Als Leitmotiv dienten Worte des Propheten Jeremia: „Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes.“ Das Baumaterial und die Einrichtung – vom Zement über die Lichtschalter bis zu den Regalen – kamen nahezu vollständig aus Deutschland. Auch die regelmäßigen Lesungen und Vorträge wurden auf Deutsch gehalten, ja selbst der im Anschluss ausgeschenkte Wein stammte von dort. So wurde das geistig-kulturelle Leben des jüdischdeutschen Bürgertums in Jerusalem nicht nur nachgebildet, sondern fortgesetzt und in neuer Form bewahrt – Ausdruck eines Strebens nach Kontinuität in einer Zeit tiefgreifender politischer und biografischer Brüche, verbunden mit außerordentlichem Aufbauwillen.
In unmittelbarer Nachbarschaft zur Bibliothek ließ Salman Schocken – auch er ein „notorischer Villenbesitzer“, wie sich Thomas Mann selbst nannte – ein repräsentatives Wohnhaus für sich und seine Familie errichten. Wie schon beim Bibliotheksbau folgte Mendelsohn dabei seiner im Exil entwickelten Programmatik: Anpassung an Klima, topografische und kulturelle Kontexte – etwa durch den Einsatz von Jerusalem-Stein, aber auch durch den damals in der Region vollkommen unüblichen Einbau einer Klimaanlage – bei gleichzeitiger Beibehaltung moderner, funktionaler Formen. Damit transportierte er den in Deutschland entwickelten Modernismus, an dessen Spitze er zusammen mit Schocken als
shall come back from the land of the enemy.” The building materials and the furnishings and fixtures—from the cement to the light switches to the shelving—came almost entirely from Germany. The periodic readings and lectures were held in German, and even the wine that was served afterwards came from Germany. The intellectual and cultural life of the German-Jewish middle class in Jerusalem was thus not merely copied, but continued and preserved in a new form. This was an expression of an aspiration for continuity at a time of profound political and biographical upheaval, connected with an extraordinary will to rebuild.
In close proximity to the library, Salman Schocken— also a “notorious villa owner,” as Thomas Mann referred to himself—had a prestigious residence built for himself and his family. As he had already done when building the library, Mendelsohn followed the agenda he developed in exile: adaptation to the climate and topographical and cultural contexts— such as using Jerusalem stone, as well as the installation of air conditioning, which at the time was absolutely unusual in the region—while at the same time maintaining modern, functional forms. With that he transported the modernism that had developed in Germany to their place of exile and thus to a new context characterized by local conditions. As the builder of Schocken’s department stores in Germany, he and Schocken were in the vanguard of that modernism. Its integration into the local construction culture was combined
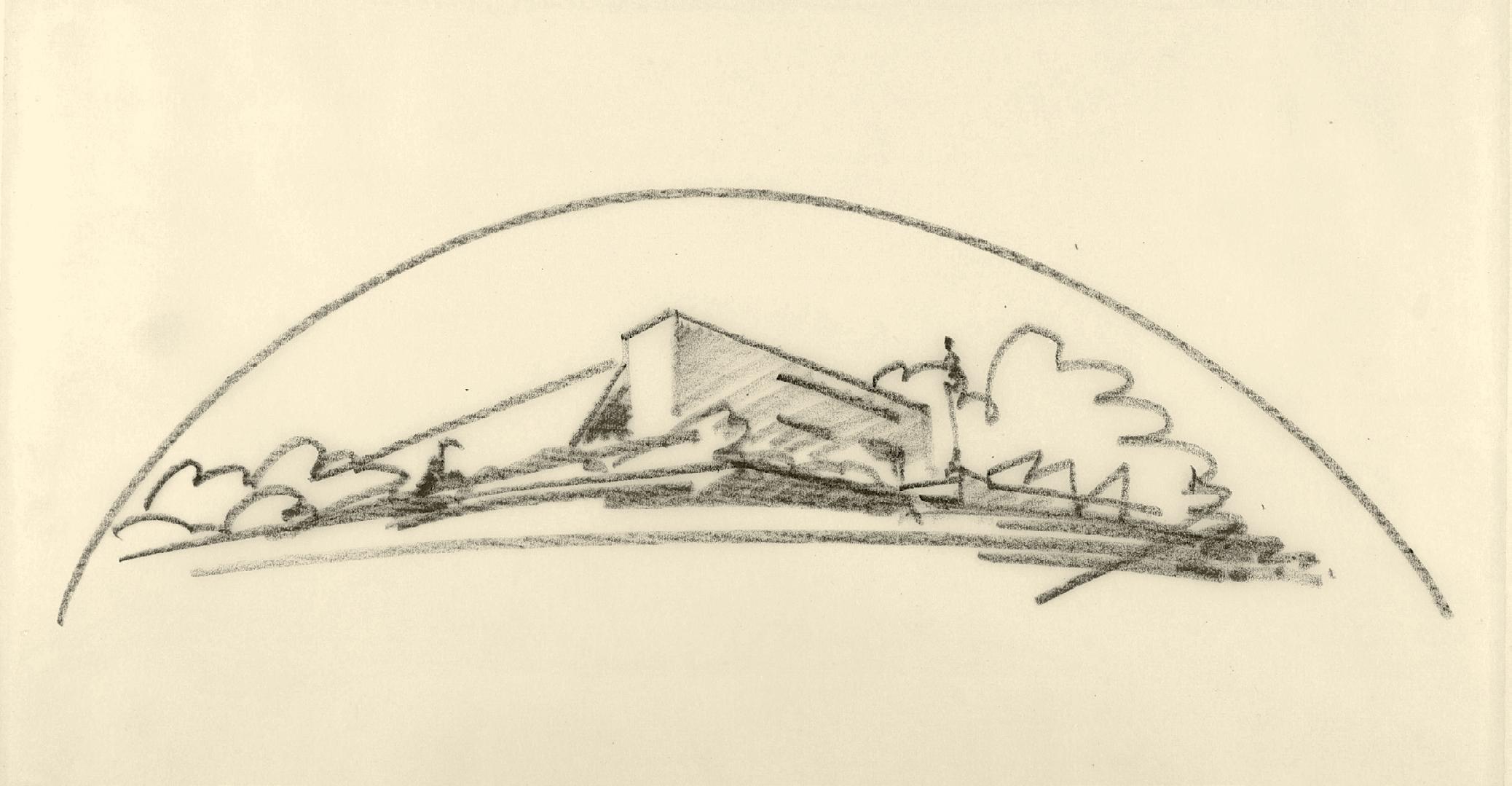
Erich Mendelsohn, Skizze für die Bibliothek Salman Schockens in Jerusalem, 1935/36 Erich Mendelsohn, Sketch of Salman Schocken’s Library in Jerusalem, 1935/36
Bauherr seiner Kaufhäuser in Deutschland gestanden hatte, ins Exil – und transponierte ihn zugleich in einen neuen, von lokalen Bedingungen geprägten Kontext. Die Einfügung in die örtliche Baukultur verband sich mit einer unmissverständlich zeitgenössischen Architektursprache, die Repräsentation und Alltagstauglichkeit gleichermaßen betonte. 3
Auch für die Villa wurde das Baumaterial größtenteils aus Deutschland geliefert, nicht nur aus emotionalen und symbolischen Gründen, sondern auch, weil der Export von Sachgütern für jüdische Ausgewanderte zu den wenigen Möglichkeiten gehörte, ihr Vermögen vor der Ausplünderung durch die Reichsfluchtsteuer zu bewahren; die Grundlage hierfür bot das erpressungsgleiche Transfer Agreement zwischen dem Deutschen Reich und zionistischen Organisationen, das zwar einen Teiltransfer ermöglichte, zugleich jedoch die deutsche Exportwirtschaft stärkte. 4 Zudem wurde der gesamte Haushalt der Zehlendorfer Villa nach Palästina verschifft. Ganz konfliktfrei ging das aber nicht vonstatten: Während Mendelsohn sein Ideal eines eleganten, funktionalen, kühlen Modernismus auch in der Innenausstattung und Möblierung verwirklicht sehen wollte, strebte Lili Schocken, Salmans Gattin, nach einer anheimelnden, bürgerlich geprägten Wohnlichkeit – Blumenschmuck auf den Tischen und feines Porzellan aus Sachsen inklusive –, was zu Diskussionen mit dem Architekten führte. Was hier aufeinanderprallte, waren zwei Formen des Kontinuitätsstrebens und damit verbundene Stilvorstellungen, die gleichermaßen charakteristisch für die Exil-Erfahrung sind. Übrigens, um ein letztes Mal den Vergleich zu bemühen: Eine ähnliche Spannung zwischen moderner Architektur und gewohnter Inneneinrichtung prägte auch das Haus von Thomas Mann in Pacific Palisades – außen ein kalifornisch inspirierter Bau des International Style, erbaut vom Architekten Julius Ralph Davidson; innen ein bewusster Rückgriff auf die vertraute Wohnkultur des deutschen Bildungsbürgertums. Bewahren, Fortsetzen, Aufbauen – dieser Dreiklang kennzeichnet Salman Schockens Wirken in Palästina in umfassendem Sinne. Neben der Bibliothek und dem Wohnhaus im Stadtteil Rechavia, die rasch zu Mittelpunkten des Jerusalemer Kultur- und Gesellschaftslebens wurden, ist sein anhaltendes und tatkräftiges Engagement für den Aufbau der jüdischen Zivilgesellschaft zu nennen: sei es als Mitglied im Exekutivkomitee der Hebräischen Universität, als Gründer des hebräischen Verlags Hotza’at Schocken oder als Käufer
with an unmistakably contemporary architectural language that emphasized both prestige and everyday suitability. 3

For the villa as well, the construction materials were largely delivered from Germany, not only for emotional and symbolic reasons, but also because exporting material goods was among the few options for Jewish emigrants to keep their assets from being plundered through the Reich Flight Tax. The basis for this came from the virtually extortionate Ha’avara (Transfer) Agreement between the German Reich and Zionist organizations, which allowed a partial transfer of assets, but at the same time strengthened Germany’s export industry.4 All the household items of the villa in Berlin’s Zehlendorf district were also shipped to Palestine. The process did not take place without conflict, however. Whereas Mendelsohn strove to implement his ideal of an elegant, functional, cool modernism, also in the interior design and furnishings, Lilli Schocken, Salman’s wife, wanted a homey, middle-class sense of comfort—with floral arrangements on the tables and fine porcelain from Saxony—which led to discussions with the architect. What clashed there were two variants of a desire for continuity and the related style concepts, both of which were characteristic exile experiences. Incidentally, to make the comparison one last time, Thomas Mann’s home in Pacific Palisades depicted a similar tension between modern architecture and familiar interior design. The exterior was a California-inspired building in International Style, built by architect Julius Ralph Davidson; and the interior was a deliberate recourse to the familiar domestic culture of Germany’s urban educated middle class. Preserving, continuing, building—this triad characterized Salman Schocken’s efforts in Palestine in a comprehensive sense. In addition to the library and his residential home in the Rechavia neighborhood, which quickly became a center of Jerusalem’s cultural and social life, his persistent and active support in building Jewish civil society is of note. This included his being a member of Hebrew University’s executive committee, establishing the Hebrew Hotza’at Schocken publishing house, and buying the Ha'aretz daily newspaper in December 1935. Especially regarding the newspaper purchase, he was following the goal of continuing traditional lines of German journalism, while acknowledging a necessary transition. The inspiration for the newspaper was the prewar Frankfurter Zeitung : sober, analytical, with a strong emphasis on high culture. 5 Although Ha’aretz had already treated social
3 Zur Konstellation Schocken/Mendelsohn aus diversen Perspektiven vgl. Antje Bormann, Doreen Mölders, Sabine Wolfram (Hg.): Konsum und Gestalt. Leben und Werk von Salman Schocken und Erich Mendelsohn vor 1933 und im Exil, Berlin 2016.
4 Zur Gestaltung des Gartens, der einen organischen Zusammenhang mit der Villa bilden sollte, siehe den Beitrag von Caroline Jessen in diesem Heft, S. 54.
3 On the Schocken/Mendelsohn configuration from various perspectives, see Antje Bormann, Doreen Mölders, and Sabine Wolfram (eds.), Konsum und Gestalt. Leben und Werk von Salman Schocken und Erich Mendelsohn vor 1933 und im Exil, Berlin: Hentrich & Hentrich, 2016.
4 On the design of the garden, which was intended to have an organic connection to the villa, see the article by Caroline Jessen in this issue of this JMB Journal, 54.
5 David Remnick, “The Dissenters,” The New Yorker (20 February 2011), URL: https://www.newyorker.com/magazine/2011/02/28/the-dissenters
der Tageszeitung Ha'aretz im Dezember 1935. Gerade mit diesem Zeitungskauf verfolgte er das Ziel, deutsche publizistische Traditionslinien fortzuführen, ohne sie bruchlos zu übernehmen. Bei der Konzeption stand unter anderem die Frankfurter Zeitung der Vorkriegszeit Pate: nüchtern, analytisch, mit einem starken Akzent auf Hochkultur. 5 Auch wenn Ha'aretz schon in den Dreißigerjahren gesellschafts- und kulturpolitische Themen behandelte, gewann die Zeitung ihre klare linksliberale, regimekritische Ausrichtung erst ab 1939 unter der Chefredaktion seines Sohnes Gustav (später Gershom) Schocken. Bis heute wird die international wahrgenommene Zeitung von der Familie herausgegeben, mittlerweile in dritter Generation unter Amos Schocken.
Vollends angekommen war Salman Schocken in Palästina allerdings nicht, weder im äußeren noch im inneren Sinne. Zum einen führte er noch jahrelang ein Leben zwischen den Ländern, Sprachen und Kulturen. Bis zur Auflösung des Verlags und der Enteignung des Kaufhauskonzerns 1938 hielt er sich teils monatelang in Europa auf, um sich um geschäftliche Belange zu kümmern, und auch wenn es über die Beweggründe für die Weiter-Emigration in die Vereinigten Staaten 1940 keine gesicherten Erkenntnisse gibt: Es zeigt doch unmissverständlich, dass seine Lebensmitte in mehreren Welten verankert blieb. Schockens Exil war (und blieb) ein transnationales Exil. Wie die Historikerin Stefanie Mahrer in ihrer großen Biografie betont, war es kein bloßes Verpflanzen, sondern ein Leben im Dazwischen – transnational, mehrgleisig, von Kontinuität und Brüchen zugleich geprägt.

Salman Schocken trug die deutsche Kultur mit sich, das zeigt sich in mehrerlei Hinsicht – und es blieb am Ende nicht auf Dinge beschränkt. Im Frühjahr 1935, während eines Besuchs, ließ er die Angestellten seines Konzerns wissen, er gedenke alles zu tun, um ihnen eine „geordnete und planmäßige Auswanderung“ zu ermöglichen. Am 15. September desselben Jahres erließ das NS-Regime die Nürnberger Gesetze, die Juden zu Staatsangehörigen minderen Rechts herabstuften und sie systematisch aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens ausschlossen. Mit bemerkenswerter Weitsicht verschaffte Schocken zahlreichen seiner Angestellten – und teilweise auch deren Angehörigen – die Möglichkeit zur Flucht und bewahrte sie so vor Deportation und Ermordung. Auch dies gehört zu seinem Vermächtnis.
Lilli Schocken (1889–1959) Gershom Schocken (1912–1990)
and cultural policy topics in the 1930s, the newspaper did not acquire its clearly left-wing liberal, regime-critical orientation until 1939, when his son Gustav (later Gershom) Schocken became editor-in-chief. To this day, the internationally renowned newspaper is still published by the Schocken family, meanwhile in the third generation under Amos Schocken. Salman Schocken was not fully at home in Palestine, however, neither physically nor mentally. For one thing, he led a life in between countries, languages, and cultures for many years. Until the publishing house in Germany was dissolved and the department store chain was expropriated in 1938, he spent months at a time in Europe dealing with business matters. And even though it is not certain why he emigrated further to the United States in 1940, his life clearly remained anchored in multiple worlds. Schocken’s exile was (and remained) a transnational exile. As the historian Stefanie Mahrer emphasized in her major Schocken biography, he was not simply transplanted, but instead led a life in-between—transnational, multitracked, and marked by both continuity and breaches. Salman Schocken carried German culture within him, as is apparent in several respects—and in the end that was not limited to things. During a visit in the spring of 1935, he let the employees of his business know that he intended to do everything possible to facilitate their “orderly and well-planned emigration.” On September 15 of that year, the Nazi regime enacted the Nuremberg race laws, which lowered the status of Jews to second-class citizens and systematically excluded them from all areas of public life. With remarkable foresight, Schocken enabled many of his employees—and sometimes also their families—to flee Germany, thus saving them from being deported and murdered. That too is part of his legacy.
Kai Sina ist Lichtenberg-Professor für Neuere deutsche Literatur und Komparatistik an der Universität Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört neben der transatlantischen Literaturgeschichte des 18. bis 21. Jahrhunderts das Verhältnis von Zionismus und Literatur. Zuletzt erschienen ist sein Buch „Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist“ (Berlin 2024).
Kai Sina is Lichtenberg Professor for Modern German and Comparative Literature at the University of Münster. In addition to literary history from the 18th to the 21st century in the transatlantic context, his research focuses on the relationship between Zionism and literature. His most recent book Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist was published in Berlin in 2024.
5 David Remnick: The Dissenters, in: The New Yorker, 20. Februar 2011, URL: https://www.newyorker.com/magazine/2011/02/28/the-dissenters
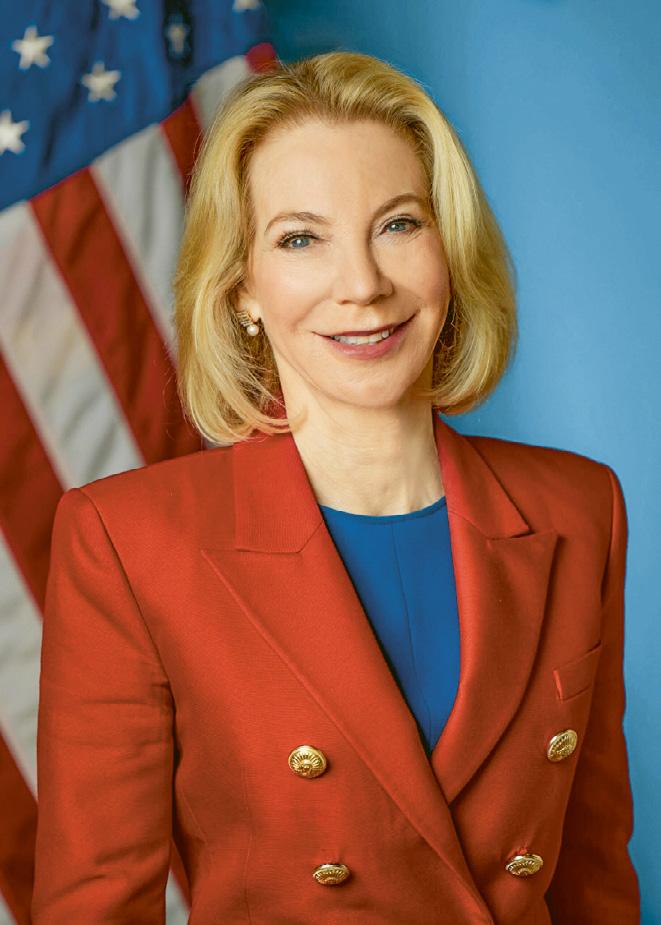

Das Jüdische Museum Berlin und die FREUNDE DES JMB zeichnen mit dem Preis für Verständigung und Toleranz seit 2002 Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus, die sich auf herausragende Weise um die Menschenwürde, die Förderung der Völkerverständigung, der Integration von Minderheiten und des Zusammenlebens unterschiedlicher Religionen und Kulturen verdient gemacht haben. Der diesjährige Preis wird am Samstag, den 15. November 2025, an die USamerikanische Politikwissenschaftlerin und ehemalige Botschafterin Amy Gutmann und an den israelischen Physiker Daniel Zajfman verliehen.
Since 2002, the Jewish Museum Berlin and the FRIENDS OF THE JMB have presented the Prize for Understanding and Tolerance to leading figures in culture, politics, science, and business in recognition of their outstanding contributions to human dignity, international understanding, the integration of minorities, and the peaceful coexistence of different religions and cultures. This year’s prize—to be awarded on Saturday, 15 November 2025—will honor American political scientist and former ambassador Amy Gutmann and Israeli physicist Daniel Zajfman.
Amy Gutmann
In ihrer Dankesrede anlässlich der Verleihung der Leo-Baeck-Medaille im Oktober 2022 sagte Amy Gutmann: „In den Vereinigten Staaten und Deutschland wird die Beständigkeit von Demokratien überschätzt. Wir neigen dazu, sie als selbstverständlich zu betrachten. Um zu bestehen und zu wachsen, benötigen Demokratien unsere Fürsorge, unsere Widerstandskraft und unser Handeln.“
Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin widmete Jahrzehnte ihrer Forschung dem Thema Demokratie. Mit ihren Arbeiten zu deliberativen Demokratiekonzepten, sozialer Gerechtigkeit und dem Umgang mit Identität und Vielfalt hat sie wegweisende Werke vorgelegt. Als Präsidentin der University of Pennsylvania setzte sie ihren Schwerpunkt auf Bildungsgerechtigkeit. Während ihrer Amtszeit von 2004 bis 2022 verdoppelte sie die Zahl von Studierenden aus einkommensschwachen Familien und solchen, die als erste in ihrer Familie eine Universität besuchen. Als Botschafterin der Vereinigten Staaten in Deutschland von 2022 bis 2024 hat sie den Begriff der Kulturdiplomatie mit Leben gefüllt: Über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg Brücken zu bauen und so das transatlantische Band zu stärken, war und ist ihr ein Herzensanliegen. Amy Gutmann wurde am 19. November 1949 in Brooklyn, New York, geboren. Ihr Vater Kurt Gutmann (1910–1964) stammte aus einer jüdisch-orthodoxen Familie im mittelfränkischen Feuchtwangen. Bereits 1934 hatte er die Gefahr erkannt, die durch die Nationalsozialisten drohte. Er schaffte es, für sich selbst und später auch für seine Eltern und Geschwister die Flucht nach Bombay (heute Mumbai) zu organisieren. Nach dem Krieg emigrierte er in die USA und gründete dort eine Familie. Kurt Gutmann starb unerwartet. In Reden und Interviews betont Amy Gutmann immer wieder, wie handlungsleitend das Vermächtnis ihres Vaters für sie ist.
„Ich habe ihn nur 16 Jahre gekannt. Aber in diesen prägenden Jahren lehrte er mich mit seinen Worten und
Taten etwas über den Holocaust. Er hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, sich früh und immer wieder allen Formen von Hass, Fanatismus und Diskriminierung entgegenzustellen. Genau das heißt es, die Maxime des ,Nie wieder!’ weiterzugeben.”
In her acceptance speech for the Leo Baeck Medal in October 2022, Amy Gutmann said:
“In the United States and Germany, we overestimate how enduring democracies are. We tend to take them for granted. Democracies require our care, our resilience, and our action to survive and to thrive.”
As a political scientist, Gutmann has devoted decades of research to democratic theory, producing groundbreaking works on deliberative democracy, social justice, and approaches to identity and diversity. As president of the University of Pennsylvania, she made educational equity a priority. During her tenure from 2004 to 2022, the number of students from low-income and first-generation college families doubled. As U.S. ambassador to Germany from 2022 to 2024, she embraced the concept of cultural diplomacy. Throughout her career, the causes closest to her heart have included building bridges across cultural and religious boundaries and strengthening transatlantic ties.
Amy Gutmann was born in Brooklyn, New York, on 19 November 1949. Her father, Kurt Gutmann (1910–1964), came from an Orthodox Jewish family in Feuchtwangen, Bavaria. In 1934, recognizing the danger posed by the Nazis, he arranged his own escape to Bombay (now Mumbai) and later helped his parents and siblings flee Germany as well. After the war, he immigrated to the United States, where he started a family.
Amy Gutmann has often emphasized the importance of her father’s legacy and how it has guided her own actions. He died when she was just sixteen, but during those formative years he taught her about the Holocaust through both words and deeds, impressing on her the need to take an early and unwavering stand against all forms of hatred, fanaticism, and discrimination. To her, this is what it means to pass on the principle of “Never again” to future generations.
Daniel Zajfman
Daniel Zajfman schätzt Fragen mehr als Überzeugungen, Beweise mehr als Dogmen und Gemeinsamkeiten mehr als Unterschiede. Der israelische Physiker sagte einmal:
„Die bescheidene Frage, die am Anfang jeder Forschung steht, lautet: Ich weiß es nicht, aber ich frage mich: Wie? Wo? Warum? Diese Fragen verbinden alle Forschenden auf dieser Welt.“ Damit wird Wissenschaft zu einer universalen Sprache, die es Menschen aus allen Ländern und Kulturen ermöglicht, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Seit mehr als dreißig Jahren setzt sich Daniel Zajfman für die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschland und Israel ein.
Daniel Zajfman wurde 1959 als Nachkomme von Holocaust-Überlebenden in Brüssel geboren, viele Familienmitglieder waren ermordet worden. 1979 wanderte er nach Israel aus, studierte am Israel Institute of Technology in Haifa Physik und promovierte dort anschließend in Atomphysik. Auf einen mehrjährigen Forschungsaufenthalt in den USA folgten akademische Stationen an renommierten Forschungseinrichtungen, unter anderem als Präsident des multidisziplinären naturwissenschaftlichen Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, und als Direktor des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg. 1991 initiierte er eine wegweisende Zusammenarbeit zwischen den beiden Instituten, die die Basis einer nachhaltigen gemeinsamen Forschungsleistung bildete. Als Vorsitzender des Akademischen Beirats der Israel Science Foundation rief er zudem ein Kooperationsprogramm mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft ins Leben, das Projekte aus vielen verschiedenen Fachbereichen unterstützt. Auch als Chairman des Schwartz/Reisman Science Education Center in Rehovot und Nes Ziona und als Mitglied des Boards der Minerva Stiftung hat Daniel Zajfman den akademischen Austausch und die Vernetzung von Studierenden und Forschenden aus Deutschland und Israel gefördert.
Ihn leitet die Überzeugung, dass wahrer Fortschritt nur durch Dialog, Zusammenarbeit und Partnerschaft möglich ist. Wissenschaft sieht er als versöhnende und transformative Kraft.
Daniel Zajfman values questions more than convictions, evidence more than dogmas, and common ground more than differences. An Israeli physicist, he once said, “The modest question that sparks all research is: I don’t know, but I ask myself: How? Where? Why? These questions connect all researchers the world over.”
This makes science a universal language that allows people from all countries and cultures to work together to find solutions. For more than thirty years, Daniel Zajfman has advocated scientific collaboration and mutual understanding between Germany and Israel.
Daniel Zajfman was born in Brussels in 1959. His parents were Holocaust survivors and many of his relatives had been murdered. He emigrated to Israel in 1979, where he studied physics at the Israel Institute of Technology in Haifa and later obtained his doctorate in atomic physics. After doing research in the United States for several years, Zajfman held various academic positions at prestigious research institutes, including one as president of the Weizmann Institute of Science, a multidisciplinary basic research institution in the natural sciences in Rehovot, Israel, and another as director of the Max Planck Institute for Nuclear Physics in Heidelberg. In 1991, he established a pioneering collaboration between the two institutes, which formed the basis for sustained joint research. As the chair of the Academic Board of the Israel Science Foundation, he also started a collaborative program with the German Research Foundation, which supports projects in many different fields. As chair of the Schwartz/Reisman Science Education Center in Rehovot and Nes Ziona, and as a board member of the Minerva Foundation, Daniel Zajfman has promoted the academic exchange and networking of students and researchers from Germany and Israel. He is convinced that true progress is only possible through dialogue, collaboration, and partnership. He views science as a reconciliatory and transforming force.


Der Architekt Erich Mendelsohn gestaltete nicht nur drei moderne Kaufhausbauten für Salman Schocken, sondern auch eine repräsentative Villa in Jerusalem mit großer Gartenanlage – ein Garten, der in seiner Schönheit und Gestaltbarkeit
zum Zufluchts- und Gegenort in einer zerrütteten Zeit wurde.
As well as designing three modern department store buildings for Salman Schocken, the architect Erich Mendelsohn built a prestigious villa in Jerusalem with a large garden—a garden whose beauty and adaptability made it a refuge and counter-site in turbulent times.
DE Was verbindet Warenhaus und Garten? Die geprüften und empfohlenen Waren seien, so Salman Schocken in einem der vielen programmatischen Texte zu seinem Unternehmen, Teil eines Verbesserungsprojekts: „Der Verkäufer im Kaufhause Schocken steht in einem sinnvoll angeordneten Organismus: aber erst, wenn er seine Arbeit gut zu Ende führt, ist die Funktion des Unternehmens sinnvoll erfüllt. In diesem Bewußtsein wird der gute Verkäufer freudig seinen Dienst tun, der über die Grenze des Geschäftshauses hinaus ein Dienst am Volksganzen ist.“ 1
Gershom Schocken hat mit Blick auf solche Sätze geschrieben, dass „der geographische Ort“ der SchockenKaufhäuser für seinen Vater „nicht das Deutschland des ersten Drittels des zwanzigsten Jahrhunderts“ gewesen sei, „sondern die pädagogische Provinz aus dem Wilhelm Meister, in der Goethe die beste Gesellschaftsordnung zur Heranbildung einer gesitteten Menschheit schildert.“ 2 Dies ist das Bild des Schocken-Kaufhauses als Ort einer idealen Ordnung, als Garant von Fülle und Harmonie.
Schockens Kaufhäuser sollten sich durch gute Produkte und faire Preise, durch Sachlichkeit in Inhalt und Form von den verworrenen Ideen des Kaiserreichs, historistischen Fassaden, Kitsch und Stilgemisch abheben. Diese Bemühungen waren Ausdruck eines modernen Denkens, das Zygmunt Bauman später unter Bezug auf die Metapher des Gärtners als „Gefühl der Verpflichtung gegenüber der Vision einer guten Gesellschaft, einer gesunden Gesellschaft, einer ordentlichen Gesellschaft“3 beschreibt. Das Schocken-Kaufhaus wandte sich auch ganz konkret mit modern gestalteten Faltblättern zu „Krankheiten und Schädlingen der Pflanzen“ und „Winken für den Kleingärtner“ an Kunden, führte ästhetische und gesellschaftliche Ansprüche im Großen wie im Kleinen zusammen.4
In diesem Zusammenhang gewinnt die kurze Geschichte eines von Mendelsohn entworfenen, realen Gartens in Jerusalem Bedeutung, der für wenige Jahre – zwischen 1936 und 1941 – wichtig für Salman Schocken war. Das Gartenprojekt reagierte auf das „zerbrochene Deutschland“.5 Es entwickelte sich parallel zur erzwungenen Aufgabe eines erst wenige Jahre zuvor erworbenen Hauses am Berliner Schlachtensee und vor dem Hintergrund großer Verluste auf allen Ebenen, entstand inmitten der Diskussionen um die politische Zukunft Palästinas und während des Arabischen Aufstands gegen die britische Kolonialherrschaft und die zunehmende jüdische Siedlung in Palästina in den Jahren 1936 bis 1939.
Nach den aufsehenerregenden Kaufhausbauten für Schocken in Nürnberg, Stuttgart und Chemnitz gestaltete
EN What do the department store and the garden have in common? The store’s tested and recommended goods, said Salman Schocken in one of his many programmatic texts on his business, are part of an improvement project: “The salesman in the Schocken department store belongs to a meaningfully ordered organism, but not until he has successfully finished his work is the company’s task meaningfully fulfilled. With this in mind, the good salesman joyfully does his job, which above and beyond the business premises is a service for the people as a whole.” 1
Statements like this one led Gershom Schocken to write that, for his father, “the geographical location” of the Schocken department stores “was not the Germany of the first third of the twentieth century, but the pedagogical province of Wilhelm Meister, in which Goethe describes the best social order for the development of a civilised humanity.” 2 This is the image of the Schocken department store as a site of an ideal order, as a guarantee for abundance and harmony.
With good products and fair prices, and functionality in content and form, Schocken’s department stores were intended to stand out from the convoluted ideas of the German Empire, historical facades, kitsch, and muddled styles. This aspiration was an expression of modern thinking, which Zygmunt Bauman later described using the metaphor of a gardener as “the feeling of duty towards the vision of good society, a healthy society, an orderly society.”3 The Schocken department store also reached out to customers directly with brochures, presented in a modern design, on “Plant Diseases and Pests” and “Tips for Leisure Gardeners.” On both a small and large scale, it brought together aesthetic and social needs. 4
This context makes the brief history of an actual garden in Jerusalem a significant one. Designed by Mendelsohn, the garden was particularly important for Salman Schocken for a short time, from 1936 to 1941. The garden project was a reaction to a “shattered Germany.” 5 It evolved in parallel to the forced sale of a house at Berlin’s Schlachtensee Lake that Schocken had acquired only a few years earlier, and against the background of major losses at all levels, amid discourse on the political future of Palestine and during the Great Arab Revolt against British colonial rule and the growing Jewish settlement in Palestine from 1936 to 1939.
After the spectacular department store buildings for Schocken in Nuremberg, Stuttgart, and Chemnitz, from 1934 to 1937 Erich Mendelsohn designed a prestigious villa in Jerusalem with a huge garden of ca. 5000 m2 (54,000 sq.ft.).
1 [Salman] Schocken, Fünfzehn Leitsätze für das Verkaufspersonal der Kaufhäuser Schocken, in: Die Zentrale. Mitteilungen der Schocken-KommanditGesellschaft auf Aktien Zwickau S.A., Nr. 8, 1928, S. 13.
2 Gershom Schocken, Ich werde seinesgleichen nicht mehr sehen. Erinnerungen an Salman Schocken, in: Der Monat 20 (1968), S. 13-30, hier S. 20.
3 Vgl. Zygmunt Bauman, Der Staat als Gärtner, in: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Aus dem Englischen von Martin Suhr. 2. Aufl. Hamburg 2012, S. 51-57, hier S. 54-55.
4 Diese Idee verbindet die Kaufhaus-Broschüren mit Büchern wie Karl Försters „Vom Blütengarten der Zukunft“ (1917) oder Erich Mendelsohns „Neues Haus – Neue Welt“ (1932).
5 Rede des Herrn Salmann Schocken beim Empfang fuer Erich Mendelsohn am 15. Maerz 1937 in der Schocken Bibliothek, in: SchA 803/82.
1 [Salman] Schocken, “Fünfzehn Leitsätze für das Verkaufspersonal der Kaufhäuser Schocken,” Die Zentrale. Mitteilungen der Schocken-KommanditGesellschaft auf Aktien Zwickau S.A., no. 8 (1928): 13.
2 Gershom Schocken, “I will not see his like again: Remembering Salman Schocken” (1968), translated by Stephanie Obermeier, commentary by Caroline Jessen, The Leo Baeck Institute Year Book 67, no. 1 (October 2022): 155–173.
3 Zygmunt Bauman, “The Practice of the Gardening State,” in Modernity and Ambivalence (Malden, MA: Polity Press, 1991), 26–30, here: 29.
4 This idea links the department store brochures to books such as Karl Foerster’s Vom Blütengarten der Zukunft (On the Flower Garden of the Future, 1917) and Erich Mendelsohn’s Neues Haus—Neue Welt (New House –New World, 1932).
5 Salman Schocken’s speech at the reception for Erich Mendelsohn on 15 March 1937 in the Schocken Library, SchA (Schocken Archive) 803/82.
Erich Mendelsohn in den Jahren 1934 bis 1937 in Jerusalem eine repräsentative Villa mit riesigem Garten (ca. 5000 m2). Sie ersetzte das Berliner Heim nicht einfach, sondern markierte etwas Neues. Die Architektur verband den linearen Stil des Neuen Bauens mit lokalen arabischen Bauweisen.
Ein Mitarbeiter des Schocken-Konzerns koordinierte die Arbeiten; ein englischer Landschaftsgestalter lieferte Vorschläge für die Bepflanzung eines Gartens. Die gestaltende Arbeit des Architekten umfasste alles, auch die Auswahl von Möbeln und Kunstobjekten im Haus und die fotografische Dokumentation des Gartens: „Ich war den ganzen Shabbath – in Sonne und Bergwind – in und um die Schockenhäuser, um von oben – geradeaus – von unten zu photographieren.“6 Erhaltene Fotos inszenieren ein geschlossenes, organisches Ganzes mit weich geschwungenen Wegen. Gestaltungsideen, die sich in verschiedenen Ausprägungen durch das Denken des frühen 20. Jahrhunderts gezogen hatten, setzten sich nach dem Wegbrechen der Wirkungsmöglichkeiten im deutschen Konzern im Jerusalemer Garten auf eigene Weise fort. Zu diesem Garten hat Stefanie Mahrer geschrieben, man könnte ihn „als Versuch verstehen, den biographischen Bruch zu kitten, der ausgelöst wurde durch die erzwungene Migration.“7 Aus dieser Perspektive wird die Anlage als Vermittlung zwischen deutscher Gartenkultur und neuer Umgebung sichtbar. Sie ist zugleich auch eine Ordnungsfigur und Sozialmetapher im Sinne eines umhegten, freien und befriedeten Bereichs.
Der Garten wurde zu einem jener Gegenorte, an „denen die realen Orte, all die anderen Orte, die man in einer Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt werden.“8 Rasenflächen und durch Wege sanft geordnete Bereiche für blühende Stauden, für Sukkulenten, Kräuter und Bänke unter schattenspendenden Bäumen wechselten sich ab. Es gab in Palästina heimische, aber auch ungewöhnliche Pflanzen, Zypressen, Akazien, Peruanische Pfefferbäume und Aleppo-Kiefern, Mandel-, Maulbeer-, Pfirsich- und Feigenbäume und mehr; ein weites Sortiment von Sträuchern und Gräsern. Mit vielen Stauden wie etwa Anemonen, Iris, Lilien, Malven, Pfingstrosen, Prachtkerzen und Rittersporn, aber auch mit Dahlien und Gladiolen sowie unzähligen Rosen in unterschiedlichen Farben und Größen setzte der Garten, von dem heute Schwarzweißbilder, Gärtnerberichte, Rechnungen und Kartierungen zeugen, auf Farbspiele und Fülle. Viele Pflanzenarten waren in mehreren Sorten repräsentiert, auch Obststräucher wie etwa Himbeeren und Stachelbeeren. Es gab ein Gewächshaus, ein
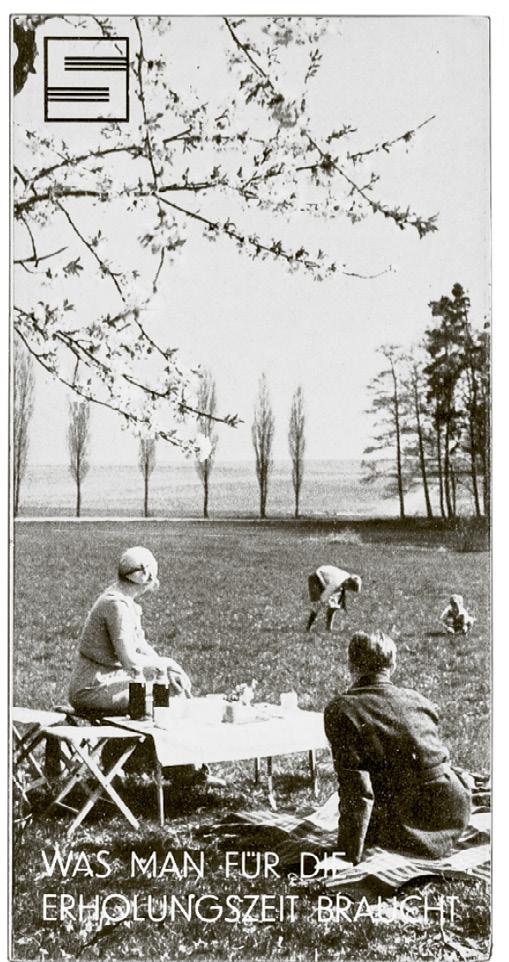
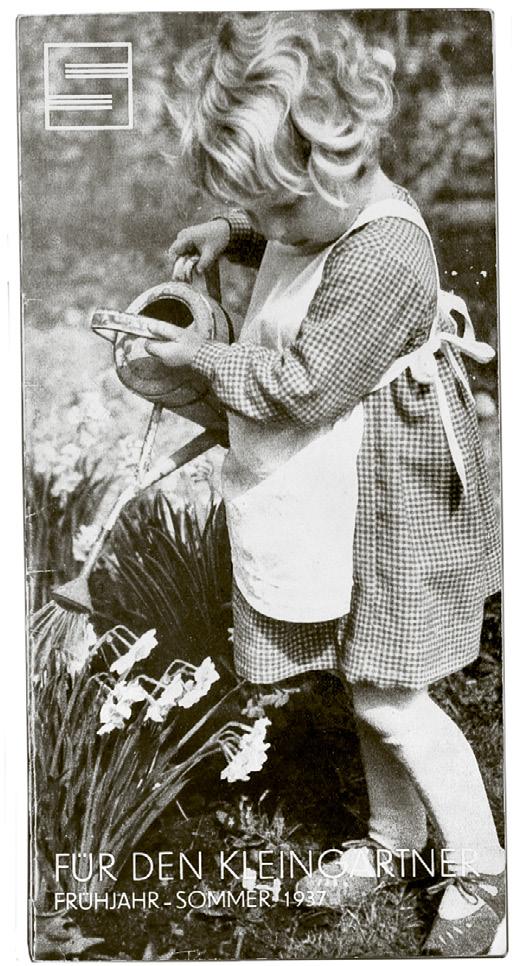
It did not simply replace the Berlin home, but was a sign of something new. The architecture combined the linear style of German modernism (Neues Bauen) with local Arab building styles. A Schocken employee coordinated the project, and an English landscape gardener offered suggestions for the planting. The architect designed everything, down to the selection of furniture and art objects in the house and even the photographic documentation of the garden: “I spent the entire Sabbath—in sun and mountain wind—in and around the Schocken buildings in order to photograph it from above, straight on, and from below.”6
Photos of the garden enact an enclosed but vibrant, organic whole with gently winding paths. Design ideas that had taken various forms throughout early twentieth-century thought continued, in their own distinctive way, in the Jerusalem garden after the collapse of avenues for influence within the German company. Stefanie Mahrer suggested that the garden might be regarded as “an attempt to mend the biographical breach triggered by forced migration.” 7 From this perspective, the garden can be seen as a mediator between German garden culture and the new surroundings. At the same time, it is an ordering figure and a social metaphor as an area that is enclosed, free, and secure.
The garden became what Michel Foucault called “heterotopias,” one of those “counter-sites” in which “the
„Was man für die Erholungszeit braucht“ und „Für den Kleingärtner“ – Gartenbroschüren des Schocken-Kaufhauses, 1930er-Jahre
What You Need for Leisure Time and For the Amateur Gardener : gardening brochures from the Schocken department stores, 1930s
6 Erich Mendelsohn an Louise Mendelsohn, 8.5.1938, Kunstbibliothek Berlin, Nachlass Erich Mendelsohn.
7 Stefanie Mahrer, Salman Schocken. Topographien eines Lebens. Berlin 2021, S. 239.
8 Michel Foucault, Von anderen Räumen (1967), in: Jörg Dünne, Stephan Günzel (Hg.), Raumtheorie. Frankfurt am Main 2006, S. 320.
6 Letter from Erich Mendelsohn to Louise Mendelsohn, 8 May 1938, Kunstbibliothek Berlin, estate of Erich Mendelsohn.
7 Stefanie Mahrer, Salman Schocken. Topographien eines Lebens, Berlin: Neofelis, 2021, 239.
Schattenhaus, Fruchtbeetkästen, ein Vogelbecken und eine hohe Mauer zur Straße hin.
Die der Gestaltung eingeräumte Bedeutung stand quer zu den Ereignissen in Europa und Palästina in dieser Zeit und scheint so, ambivalent, auf sie reagiert zu haben. Der Garten wurde zu einem der wenigen Bereiche, der sich nicht der eigenen Kontrolle und dem eigenen Gestaltungswillen entzog.
In Absprache mit Salman Schocken und seiner Frau Lilli, Erich Mendelsohn und einem Schocken-Mitarbeiter in Zwickau bestellte der Gärtner Gustav Spiro Stauden, Bäume, Knollen und Saatgut aus traditionsreichen Betrieben in Deutschland, Frankreich, Holland, Italien und Großbritannien, nach 1938 auch bei Gartenbaubetrieben des Kibbutz HaMeuhad. Schocken setzte bei allen Anschaffungen auf die Expertise der Kaufhaus-Zentrale – also jenen „sinnvoll geordneten Organismus“, dessen Verlust durch Zwangsverkauf bevorstand. Er bot „die organisatorische Grundlage“9 für alle Arbeitsbereiche des Unternehmers, und seine Grundidee rettete sich in den Garten.
Aus der Zentrale Zwickau kam Rat zu Schläuchen, Düsen, zur Anbringung von Emaille-Schildchen, man schickte Geräte, Fachliteratur und Pflanzkalender. Der Austausch hatte nicht zuletzt finanzielle Gründe: Das Ha’avara-Abkommen zwischen der Jewish Agency, der Zionistischen Vereinigung für Deutschland und dem Reichswirtschaftsministerium ermöglichte Jüdinnen und Juden in Palästina bis 1939, Vermögen durch Warenimporte aus Deutschland mit erheblichen Verlusten zu retten.
In täglich wechselnden Blumenarrangements für Vasen und Schalen hielt der im Garten gerettete Reichtum Einzug in die weiten, minimalistisch möblierten, eleganten Wohnräume des Schocken’schen Hauses. Erich Mendelsohn zielte auf die Einheit von Garten, Haus, Inneneinrichtung und Kunst, riet beispielsweise, „mit Rücksicht auf die zarten Farben des Cezanne“ – im Haus hingen sowohl ein Landschaftsgemälde von Cezanne als auch die „Zypressen“ Van Goghs – „keine zu bunten Blumen ins Arbeitszimmer“ zu stellen.10
Es müsse, so Schocken Ende Oktober 1938, „ein System über die Berichterstattung über den Garten angelegt werden“; zu dokumentieren waren nicht nur Entwicklungsprozesse, sondern auch Anschaffungen, Bewässerungspläne, Wasserverbrauch, Gehälter und anderes: „Die Arbeitsberichte müssen getrennt werden nach verschiedenen Gebieten“, ferner müsse ein Plan „mit schachbrettartigen Feldern“ angefertigt werden, in dem „der Standort
real sites, all the other real sites that can be found within the culture, are simultaneously represented, contested, and inverted.”8 Alternating throughout were lawns and areas for flowering shrubs, succulents, and herbs, all gently ordered by paths, with benches under shade trees. There were plants native to Palestine, but also unusual ones: cypress, acacia, Peruvian pepper and Aleppo pine trees; almond, mulberry, peach, and fig trees, and more; a wide range of grasses and perennials. With its many flowering plants—anemones, iris, lilies, hollyhocks, peonies, gaura, and larkspur as well as dahlias, gladioli, and countless roses in different colors and sizes— the garden played with color and abundance, attested today through black-and-white photographs, gardener’s reports, invoices, and planting plans. Many plants, including berry bushes such as raspberries and gooseberries, were represented in numerous varieties. There was a greenhouse, a shade house, planter boxes, a birdbath, and a high wall toward the street.
The importance attributed to the garden’s design stood in contrast to events at the time in Europe and Palestine, and appears to have been a—rather ambivalent—reaction to them. The garden became one of the few domains where control and creative will were still possible.
The gardener Gustav Spiro—in consultation with Salman Schocken and his wife Lilli, Erich Mendelsohn, and a Schocken employee in Zwickau—ordered shrubs, trees, bulbs, and seeds from long-established companies in Germany, France, Holland, Italy, and Britain, and after 1938 also from horticultural businesses of the Kibbutz HaMeuhad. For all his purchases, Schocken relied on the expertise of the department store headquarters—that is, that “meaningfully ordered organism” that was about to be lost through a forced sale. It formed “the organizational foundation” for all areas of Schocken’s work;9 and its underlying idea was rescued by the garden.
Advice came from the headquarters in Zwickau regarding everything from hoses and nozzles to the mounting of enamel signs. And the Zwickau office sent equipment, relevant literature, and planting calendars. The exchange also had a financial rationale: until 1939, the Ha’avara (Transfer) Agreement between the Jewish Agency, the Zionist Federation of Germany, and the Reich Ministry of Economics made it possible for Jews in Palestine to save their assets by importing goods from Germany, albeit with substantial financial losses.
The wealth rescued in the garden found its way into the spacious, minimalistically furnished elegance of the
9 Mahrer, Salman Schocken, S. 61.
10
8 Michel Foucault, “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias,” translated by Jay Miskowiec, Diacritics 16, no. 1 (1986): 22–27, here: 24.
9 Mahrer, Salman Schocken, 61.

der Pflanzen“ zu verzeichnen sei. Nach Schockens Vorgaben wurden Formulare für „Dekadenberichte“ gestaltet, auf denen der Gärtner in knapper Form über seine Arbeit Rechenschaft gab. Zwischenzeitlich erwog dieser sogar, Blumenbilder aus den Zwickauer Katalog-Sendungen auszuschneiden und eine bebilderte Gartenkartothek anzulegen.11
Die Aufmerksamkeit für den Garten wirkt im zeithistorischen Index unwirklich. Bereits 1933 hatte Schocken aber von der „Papier-Methode“ des Schocken-Konzerns gesprochen und betont, dass nicht zuletzt das systematisch geordnete „Innen-Leben“ des Betriebs dazu beitrage, Schocken „durch alle Fährnisse hindurch stabil“ zu halten und Neuerungen abzusichern.12 Nach 1933 griffen Management und Kontrolle stark über auf den privaten Bereich. Rückblickend entsteht der Eindruck, dass das Planen zum Gegengewicht
Schocken home as fresh flowers arranged every day in vases and bowls. Erich Mendelsohn strove to create a single entity out of the garden, house, interior decorations, and artworks. He urged, for example, “out of consideration for Cézanne’s delicate colors”—both a landscape painting by Cézanne and van Gogh’s Cypresses hung in the house—to avoid placing “brightly colored flowers in the study.” 10
In late October 1938, Schocken decided it was necessary to “set up a system of reporting about the garden.” This was to document both the development of the garden and matters such as purchases, watering schedules, water consumption, and wages: “There must be separate work reports for the different areas,” moreover, a plan was to be prepared “with checkerboard squares” indicating “the location of the plants.” Following Schocken’s stipulations, forms for ten-day
11 Gustav Spiro an Direktor Müller, 21.4.1938, SchA 823.
12 Ansprache des Herrn Schocken an die Abteilungsleiter und Einkäufer am 11. Dezember 1933, in: SchA, Schocken Office Registratur, 7.
10 Minutes of the meeting of Schocken, Mendelsohn, Heinze, and Littmann, 30 May 1937. SchA, Privates, 823. See also Mahrer, Salman Schocken, 215.
einer überfordernden Umgebung wurde. Es ist schwer, dies nicht als Reaktion auf eine Zeit zu verstehen, in der Handlungsspielräume geringer, die Kaufhäuser unter Wert veräußert und der Berliner Verlag liquidiert wurden, die Zukunft von Verwandten und Freunden in Europa gefährdet und Investitionen in Palästina risikoreich waren. Der Schocken’sche Garten stellte den Entwicklungen in Deutschland und Palästina eine individuelle Heterotopie entgegen:
„Das Haus selbst von selbstverständlicher Klarheit –von Hoheit judäisch stolz. Der Garten schon herrlich einwachsend u. die Schockens ganz selig damit. […] Schocken selbst arbeitet jeden Morgen von 6 Uhr ab im Garten, badet im Pool und die ganze Familie fängt an nach brauner Erde zu riechen.“ 13 Haus, Blumen, Bewohner*innen, Erde und Sonne bildeten, folgt man dieser Rhetorik, eine Einheit. Hier scheint deutlich das Bild des geordneten Mikrokosmos auf. Der Garten in Jerusalem wurde jedoch nur für kurze Zeit zu einem Ort der guten Ordnung. Schocken hielt sich aufgrund zahlreicher Verpflichtungen nur sporadisch in Jerusalem auf. 1940 flogen er und seine Frau für die Hebräische Universität Jerusalem nach New York; der Flugraum über Europa war bereits gesperrt. Der Eintritt der USA in den Krieg machte eine Rückkehr dann für Jahre unmöglich. Nach Kriegsende reiste Schocken nur noch für ausgedehnte Familienbesuche nach Jerusalem, er wurde amerikanischer Staatsbürger, seine kulturzionistische Position setzte sich von den Formen des politischen Zionismus immer stärker ab. Die von Mendelsohn entworfene Villa und der Garten wurden an das amerikanische Konsulat vermietet und schließlich verkauft. Die Berichte des Gärtners umfassen nur einen kurzen Zeitraum, in dem sich mit der Gartenplanung noch Zutrauen in eine ungewisse Zukunft verband, das nach 1945 so nicht mehr gegeben war und sich in Resten in Bücherwelten und eine gesellschaftlich ambitionierte, jüdische Verlagsarbeit rettete.
Caroline Jessen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow (DI) in Leipzig. Sie forscht zur Geschichte des Archivs und der Autografensammlung Salman Schockens und ist Co-Kuratorin einer Ausstellung zu „Schockens Gärten“, die das DI im Rahmen des Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen im Herbst 2026 zeigen wird.
Caroline Jessen is a Research Associate at the Leibniz Institute for Jewish History and Culture—Simon Dubnow (DI) in Leipzig. Her research focus lies on the history of Salman Schocken’s archive and autograph collection. She is co-curator of an exhibition on “Schocken’s Gardens,” which the DI will present in the fall of 2026 as part of the Year of Jewish Culture in Saxony.
reports were designed on which the gardener concisely accounted for his work. At one point the gardener even considered cutting out pictures of flowers from the catalogs sent from Zwickau and creating an illustrated garden card index.11
The attention paid to the garden seems surreal in view of the historical index. Yet, as early as 1933, Schocken had explained that the Schocken company’s “paper method,” its systematically ordered “inner life,” contributed importantly to its ability to remain “stable through all perils” and secure its innovations.12 After 1933, Schocken’s management and control increasingly extended into the private sphere. In retrospect, there is a sense that planning became the counterweight to an overwhelming environment. It is hard not to see this as a response to an era when there was less room for maneuvering, when department stores were sold under value, the Berlin publishing company was liquidated, the future of friends and relatives in Europe was threatened, and investments in Palestine were risky. The Schocken garden set an individual heterotopia against these developments in Germany and Palestine:
“The house itself is of a naturtal clarity—a Judean pride in its own sovereignty. The garden is already maturing beautifully and the Schockens are entirely pleased with it. ... Schocken himself works in the garden every day starting at 6 am, swims in the pool, and the whole family is starting to smell of brown earth.” 13
In this description, house, flowers, residents, soil, and sun form a unified whole. The image of an ordered microcosm appears here very clearly. However, the garden in Jerusalem did not remain a site of a good order for long. Due to numerous obligations, Schocken was only sporadically in Jerusalem. In 1940, he and his wife flew to New York on behalf of Hebrew University of Jerusalem; the airspace over Europe had already been closed. Once the United States entered the war, it became impossible to return for several years. After the war ended, Schocken traveled to Jerusalem only for extended family visits. He became an American citizen and his cultural Zionist position diverged more and more from the various currents of political Zionism. The villa and garden designed by Mendelsohn were rented to the American consulate and later sold. The gardener’s reports cover only a brief period, when the planning of the garden was a declaration of faith in an uncertain future. After 1945, faith and optimism were no longer present in the same way, but its remnants found refuge in the world of books and a socially ambitious Jewish publishing project.
13 Erich Mendelsohn an Louise Mendelsohn, Jerusalem, 25.4.1938, in: Kunstbibliothek Berlin, Nachlass Erich Mendelsohn.
11 Letter from Gustav Spiro to Director Müller, 21 April 1938, SchA 823.
12 Address by Salman Schocken to the department heads and buyers on 11 December 1933, in SchA, Schocken Office Registratur, 7.
13 Letter from Erich Mendelsohn to Louise Mendelsohn, Jerusalem, 25 April 1938, in Kunstbibliothek Berlin, estate of Erich Mendelsohn.

MOMENTE DER VERBUNDENHEIT MOMENTS OF BELONGING
Die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ eröffnet einen außergewöhnlichen Einblick in das kulturelle Erbe Salman Schockens. Dass dieses bedeutende Projekt realisiert werden konnte, verdanken wir der großzügigen Unterstützung der FREUNDE DES JMB – dafür möchten wir uns herzlich bedanken!
Ein besonderer Moment der Verbundenheit war die exklusive Preview der Ausstellung für die Mitglieder des Freundeskreises: PulitzerPreisträger Joshua Cohen las Passagen seiner Texte, sprach über die Ideen zur Ausstellung und signierte Bücher. Die beiden Kuratorinnen Monika Sommerer und Martina Lüdicke führten durch die Räume, gaben Einblicke in die Hintergründe und Entstehungsgeschichte der Ausstellung und beantworteten direkt vor den Objekten Fragen. Durch diese lebendigen Gesprächsrunden entstand eine Nähe zu den Exponaten und der Museumsarbeit, die den Abend einzigartig machte. Es sind diese Erlebnisse, exklusive Zugänge, Begegnungen mit Künstler*innen und Kurator*innen und kulturelle Inspiration, die den Mitgliedern des Freundeskreises offenstehen!
The exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken offers an extraordinary insight into the publisher’s and businessman’s cultural heritage. We owe the realization of this important project to the generous support of the FRIENDS OF THE JMB—for which we express our sincere thanks!
A special moment of belonging was made possible during the exclusive preview of the exhibition for members of the Friends: Pulitzer Prize winner Joshua Cohen read passages from his texts, discussed ideas behind the exhibition, and signed books. The two curators, Monika Sommerer and Martina Lüdicke, guided guests through the rooms, provided insights into the background and history of the exhibition’s objects, and answered questions. These lively discussions created a closeness to the exhibits and the museum’s work that made the evening unique. It is these experiences, exclusive access, encounters with artists and curators, and cultural inspiration that make the membership special!
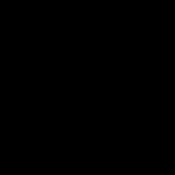
Jetzt scannen und FREUNDE werden! Scan now and become a FRIEND!
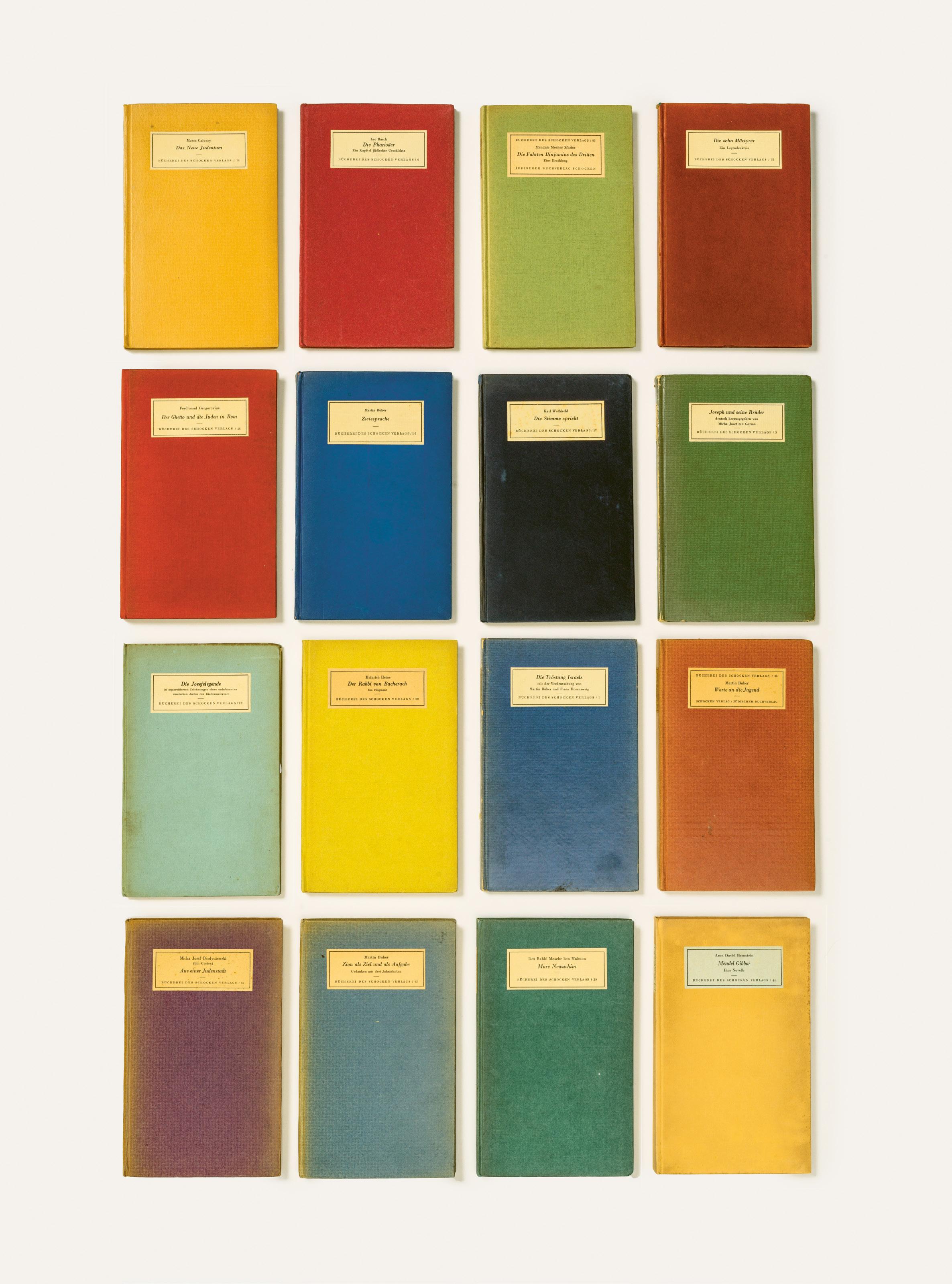
Der Schocken Verlag und sein Programm zur NS-Zeit
Schocken Verlag and Its Program During the Nazi Era
Der Schocken Verlag Berlin ist ein Symbol für die deutsch-jüdische literarische Kultur in der ersten Hälfte der nationalsozialistischen Diktatur. Salman Schocken veröffentlichte zusammen mit seinem Verlagsleiter Lambert Schneider, dem Cheflektor Moritz (später Moshe) Spitzer und dem freien Lektor, Herausgeber und Berater Martin Buber fast 250 Titel: zweisprachige Ausgaben von jüdischen sakralen Texten, Folklore, Faksimiles seltener Drucke, hebräische Dichtung und Bücher von zeitgenössischen Schriftsteller*innen.
Der Schocken Verlag unterwarf sich nicht der antisemitischen Literaturpolitik des nationalsozialistischen Regimes.
The Schocken Verlag Berlin is a symbol of GermanJewish literary culture during the first half of the National Socialist dictatorship. Salman Schocken, together with his managing director Lambert Schneider, chief editor Moritz (later Moshe) Spitzer and freelance editor and consultant Martin Buber, published just under 250 titles, including bilingual editions of traditional Jewish religious texts, folklore, reproductions of rare prints, Hebrew poetry and books by contemporary writers. Schocken publishing house did not surrender to the antisemitic literature politics of the National Socialist regime.
Titel aus der Serie „Bücherei des Schocken Verlags“, Berlin, 1933–1939 Volumes from the series Bücherei des Schocken Verlags (Library of the Schocken Publishing House), Berlin, 1933–1939
DE Trotz der aggressiven anti-jüdischen Politik, die der nationalsozialistische Staat sofort nach Adolf Hitlers Machtübernahme Ende Januar 1933 betrieb, blieb es bis Ende 1938 möglich, Bücher jüdischer Autor*innen und jüdischen Inhalts in Deutschland zu veröffentlichen – wenngleich, gelinde gesagt, unter äußerst schwierigen Bedingungen. Am 10. Mai 1933 wurden in ganz Deutschland in 22 Universitätsstädten Bücher verbrannt, die als dem Nationalsozialismus feindlich angesehen wurden. Diese „Aktion wider den undeutschen Geist“ wurde innerhalb des Schocken Verlags als ernst zu nehmende Bedrohung wahrgenommen. Und doch hegte der Berliner Verlag nicht die Absicht, sich zu beugen. Im Gegenteil: Schocken und Schneider machten Pläne für die kommenden Jahre.1 Im Sommer 1933 beschlossen sie zusammen mit Buber und Spitzer, den Verlag zu erweitern. Sie führten zwei Reihen ein, die sich sofort großer Beliebtheit erfreuten: die „Schocken Bücherei“, eine Sammlung kleinformatiger Bände, und den jährlichen „Schocken Almanach“, der den Leser*innen das Verlagsprogramm und neue Bücher präsentierte. Die „Bücherei“ wurde bald darauf die erfolgreichste Reihe des Verlags. Ihre in 82 Ausgaben herausgegebenen 92 Nummern spiegeln die reiche Tradition der jüdischen literarischen Kultur. In der Reihe erschienen zeitgenössische deutschsprachige Autoren wie Karl Wolfskehl, Franz Kafka und Ludwig Strauss, aber auch der hebräische Schriftsteller S. J. Agnon in deutscher Übersetzung sowie Werke von Martin Buber, Gershom Scholem und Hermann Cohen. Hier kamen auch traditionelle Judaika wie der Midrasch oder Schriften von Maimonides in Übertragungen heraus, biblische Texte in zweisprachigen Editionen, Lieder zum Schabbat und Märchen aus Osteuropa, sowie historische Werke und Biografien bedeutender jüdischer Figuren. Schocken war es möglich, sein Programm zu erweitern und seinen Verlag zu vergrößern, ohne dass er größere Restriktionen des Staates zu erdulden hatte. Ironischerweise war es gerade die selbst auferlegte Beschränkung auf Texte von jüdischen Autor*innen, 2 die den Verlag vor Repressalien der Nationalsozialisten bewahrte. Die Reichsschrifttumskammer schloss den Schocken Verlag im Juli 1937 aus. Solange er aber als „Jüdischer Buchverlag“ firmierte, blieb es ihm erlaubt, weiter zu veröffentlichen. Die Nationalsozialisten glaubten, dass jüdische Bücher nur von Jüdinnen und Juden gelesen würden und deshalb keine unmittelbare Gefahr für die völkische Kultur darstellten. 3
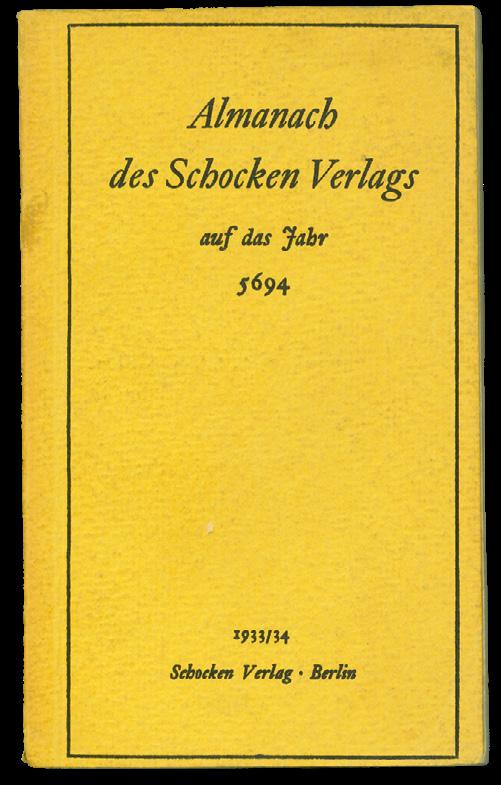
EN Despite the harsh anti-Jewish policies that the National Socialist state implemented immediately after Adolf Hitler rose to power at the end of January 1933, it remained possible to publish Jewish content books in Germany until the end of 1938. However, the conditions for publishing were, to put it mildly, not simple. On 10 May 1933, books viewed as opposing Nazism were burnt in twenty-two university cities across Germany. This “Campaign against Un-German Spirit” was perceived as a serious threat within the Schocken publishing house. The Berlin Schocken publishing house, however, did not plan to surrender. On the contrary,1 Schocken and Schneider were planning into the future. In the summer of 1933 Schocken and Schneider, together with Buber and Spitzer, decided on the expansion of the publishing house. It introduced two new series that instantly became very popular: Schocken Bücherei (Schocken library series), a collection of small volumes; and the yearly Schocken Almanach, which presented the program and new books to its readership. The Bücherei quickly became the most successful series within the publishing house. The 92 issues published in 82 volumes reflect the rich tradition of Jewish literary culture. Among them were contemporary German authors such as Karl Wolfskehl, Franz Kafka and Ludwig Strauss, and the Hebrew writer S. Y. Agnon in German translation, works by Martin Buber, Gershom Scholem and Hermann Cohen, traditional Jewish texts such as Midrashim and works by ben Maimon in translation, biblical texts in bilingual editions, songs for Shabbat and Eastern European tales, as well as historical works and biographies of important Jewish figures.
Schocken was able to develop his program and to expand the publishing house without any major restrictions from the government. Ironically, the self-implemented restriction to only publish texts from Jewish authors 2 protected the publishing house from interference from the National Socialists. In July 1937 the Schocken Verlag was excluded from the Reich Chamber of Letters (Reichsschrifttumskammer) but received a permit to continue publishing under the condition that it would imprint the addition “Jewish Publishing House” (Jüdischer Buchverlag) in all its publications. The Nazis believed that Jewish books would only be read by Jews and therefore did not pose an immediate danger to the desired völkisch culture. 3
„Almanach“ des Schocken Verlags auf das Jahr 5694 , Berlin, 1934 Almanac of the Schocken Verlag for 5694 , Berlin, 1934
1 Nur wenige Tage nach der Bücherverbrennung versandte Briefe an die Autoren Gershom Scholem und Samuel Joseph Agnon dokumentieren, dass Schocken und Schneider in die Zukunft planten: Brief von Lambert Schneider an Gershom Scholem, 23. Mai 1933, in: National Library of Israel Arc. 4 1599 (Heft 1); Brief von Schneider an S.J. Agnon, 13. Mai 1933, in: National Library of Israel Arc. 4 1270.
2 Es gab einige namhafte Ausnahmen, so das später verbotene Büchlein „Die Judenbuche“ der nichtjüdischen Autorin Annette von Droste-Hülshoff.
3 Jan-Pieter Barbian, Literaturpolitik im NS-Staat. Von der „Gleichschaltung“ bis zum Ruin, überarbeitete und aktualisierte Neuauflage, Frankfurt am Main 2010, S. 224, 230f.
1 Letters to the authors Gershom Scholem and Joseph Agnon, written only a few days after the book burnings, show that Schocken and Schneider were planning into the future: Letter Lambert Schneider to Gershom Scholem, 23 May 1933, in: National Library of Israel Arc. 4 1599 (folder 1); Letter Lambert Schneider to S. J. Agnon, 13 May 1933, in: National Library of Israel Arc 4 1270.
2 There are a few famous exceptions, like the later banned book Die Judenbuche by the non-Jewish author Annette von Droste-Hülshoff.
3 Jan Pieter Barbian, Literaturpolitik im NS-Staat. Von der “Gleichschaltung” bis zum Ruin, revised edition, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag 2010, 224, 230f.
Verlage, die sich auf jüdische Literatur spezialisierten, so der Jüdische Verlag, die Jüdische Rundschau, der Hebräische Verlag Menorah und die Verlage J. Kauffmann und M. Lehrberger waren bei der Auswahl ihrer Veröffentlichung tatsächlich weniger eingeschränkt als die nichtjüdischen Verlagshäuser. Schocken brachte nicht nur weiterhin jüdische Bücher heraus, sondern auch Texte, die den NS-Staat und seine faschistische und antisemitische Politik offen kritisierten.4
Der suchende Leser
„Die Bücherei des Schocken Verlages will in allmählichem Aufbau aus dem fast unübersehbaren und häufig unzulänglichen Schrifttum aller Länder und Zeiten in sorgfältiger Auswahl dasjenige darbieten, was den suchenden Leser unserer Tage unmittelbar anzusprechen vermag.“
Dieses Zitat aus einem Werbeprospekt für die 1933 eingeführte Reihe „Schocken Bücherei“ steht, wie Salman Schocken in einer unveröffentlichten Geschichte seiner verlegerischen Bemühungen erklärte, für die Arbeit des Berliner Schocken Verlags ganz allgemein. 5 Schockens Absicht war es, die assimilierten deutschen Jüdinnen und Juden zu ihren Wurzeln zurückzuführen. Er war nicht fromm und sah deshalb nicht die religiösen Traditionen, sondern die Kultur als das Wesen des Judentums an. Er beschrieb sich als einen Mann, der zu seinen jüdischen Wurzeln zurückkehrt, indem er jüdische Bücher liest und dank der literarischen Kultur Zugang zu seiner eigenen Tradition findet. Es war ihm klar, dass er hebräische Schriften in deutscher Übersetzung anbieten musste, wenn er wollte, dass deutsche Jüdinnen und Juden sie lesen, und dieses Angebot wurde dankbar aufgenommen. Zwar sind keine Verkaufszahlen überliefert, doch zeigen ihre weite Verbreitung und der Umstand, dass eine ganze Reihe von Titeln der „Schocken Bücherei“ mehr als eine Auflage erlebten, wie beliebt diese Büchlein waren. Schocken wollte seinen Leser*innen „Schrifttum aller Länder und Zeiten in sorgfältiger Auswahl“ offerieren. Um dieses Versprechen zu erfüllen, verlangte Schocken von seinem Cheflektor, Moritz Spitzer, jeden Monat zwei Nummern der „Bücherei“ herauszubringen, was kaum zu schaffen war. Auch wenn sein Mitarbeiter klagte, bestand Schocken auf der hohen Zahl an Veröffentlichungen, selbst dann noch, als die Maßnahmen der Nationalsozialisten die Arbeit des Verlags mehr und mehr erschwerten. Spitzer und Schneider mögen Schockens anspruchsvolle Standards und seine Beharrlichkeit lästig und beängstigend vorgekommen sein, doch haben zweifellos gerade diese die „Bücherei“ hervorgebracht, wie wir sie heute kennen.
Bücher und Texte vermitteln nicht nur Kultur, sondern tragen auch zum Aufbau von Gemeinschaften bei.6 Eine solche Gemeinschaft wurde von den Veröffentlichungen des
Publishing houses that specialized in Jewish literature, including the Jüdische Verlag, the Jüdische Rundschau, the Hebrew publishing house Menorah, and the publishing houses J. Kauffmann and M. Lehrberger, were in fact much freer in their choice of what to publish than non-jewish publishers. Schocken not only continued producing Jewish books but also published texts that openly criticized the NS-state and its fascist and anti-Semitic politics. 4
“The Schocken Library aims to present, gradually, a careful selection from the immense and often inaccessible literature of all countries and epochs that will appeal directly to the searching reader of our day.”
This quote from an advertisement for the newly introduced 1933 Schocken Bücherei series stands, as Salman Schocken said in an introduction to a never published history of his publishing endeavors, for the work of the Berlin Schocken publishing house in general. 5 Schocken’s objective was to bring “assimilated German Jewry” back to its roots. He was not a religious man, and hence did not view religious traditions as the core aspects of Judaism. For him, rather, culture was the essence of Judaism. He portrayed himself as a man who returned to his Jewish roots by reading Jewish books, gaining access to his own tradition through literary culture. He understood that he had to offer translations of the Hebrew writings if he wanted German Jews to read traditional texts; German Jewry perceived his efforts in a positive manner. Although no sales figures survive, the high distribution rate and the fact that a fair number of the Schocken Bücherei volumes appeared in more than one edition demonstrate the popularity of these small books.
Schocken sought to offer his readers “carefully selected Jewish literature from all countries.” In order to fulfil this promise, Schocken called upon his editor, Moritz Spitzer, to prepare two volumes every month, a request that was almost impossible to meet. Despite his employee’s complaints, Schocken insisted on this high volume of production, even when the strict policies of the National Socialists made work in the publishing house more difficult. As onerous and anxietyinducing as it must have been for Spitzer and Schneider, Schocken’s high standards and persistence were no doubt responsible for producing the Bücherei as we know it today. Books and texts are not only transmitters of culture but also vehicles for community-building.6 Such a community was formed by the publications of the Schocken Verlag. It is clear that Salman Schocken succeeded in making Jewish literary culture available to a broad readership. But the exegesis of texts in their historical context—a method deeply enrooted in the Jewish theological tradition—demonstrates
4 Stefanie Mahrer, Schreiben aus den Katakomben. Bücher als Widerstand. Der Schocken Verlag Berlin in den Jahren 1933 bis 1938, in: Julius H. Schoeps u.a. (Hg.): Jüdischer Widerstand in Europa (1933–1945). Formen und Facetten, Berlin 2016, S. 222–239.
5 Schocken Archives 30 (Vorwort).
6 Laut Benedict Anderson bilden Menschen, die zur selben Zeit dieselben Bücher lesen, eine Gemeinschaft, vgl. Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 2006 [1983].
4 Stefanie Mahrer, “Schreiben aus den Katakomben. Bücher als Widerstand. Der Schocken Verlag Berlin in den Jahren 1933 bis 1938,” in: Jüdischer Widerstand in Europa (1933–1945). Formen und Facetten, eds. Julius H. Schoeps, Dieter Bingen and Gideon Botsch, Berlin: De Gruyter, 2016. 222–239.
5 Schocken Archives 30 (preface), quote translated by Rachel Seelig.
6 According to Benedict Anderson, people who read the same books around the same time constitute a community, see: Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 2006 [1983].
Schocken Verlags gebildet. Es ist unübersehbar, dass es Salman Schocken gelang, jüdische literarische Kultur einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Wer eine Exegese der Schriften in ihrem historischen Kontext unternimmt –eine tief in der jüdischen Theologie verankerte Methode –, stößt aber noch auf einen anderen wichtigen Umstand: Einige Texte üben explizit Kritik am nationalsozialistischen Regime und seiner menschenverachtenden Haltung gegenüber dem jüdischen Volk in Deutschland.7
Als Schocken im Herbst 1933 den „Almanach“ einführte, stellte dessen Herausgeber, Moritz Spitzer, einen Text von Martin Buber voran:
„Der jüdische Mensch von heute ist der innerlich ausgesetzteste Mensch unserer Welt. Die Spannungen des Zeitalters haben sich diesen Punkt ersehen, um an ihm ihre Kraft zu messen. Sie wollen erfahren, ob der Mensch ihnen noch zu widerstehen vermag, und erproben sich am Juden. Wird er standhalten? Wird er in Stücke gehen? Sie wollen durch sein Schicksal erfahren, was um den Menschen ist. Sie machen Versuche mit dem Juden, sie versuchen ihn. Besteht er’s? … Etwas ist geschehen. Statt des einen Wesens, an dem die Spannungen des Zeitalters sich auslassen wollten, sind zwei zu schauen, – ein zerfallendes und ein unbezwingliches. Eins, das Licht ausgibt wie ein phosphoreszierender Sumpf, und eins, das Licht ausgibt wie der Orion. Aber dieses steht für jenes ein. Dieses sagt von jenem: Das bin ich. Es streckt sich über es hin, es deckt es, es duldet, was zu dulden ist. Und wenn eure Probe bestanden sein wird, Spannungen des Zeitalters, werden nicht mehr zwei dasein, sondern einer, der Überwinder.“8
Der erste „Almanach“ erschien aus Anlass von Rosch ha-Schana 1933. Auch wenn Buber die Urheber der „Spannungen des Zeitalters“ nicht beim Namen nennt, könnte sein Text kaum deutlicher werden. Es war kühn von Schocken, Schneider, Spitzer und Buber, ihn im Herbst 1933 herauszubringen, denn nicht nur tröstete er die deutschen Jüdinnen und Juden, er warnte auch Nichtjüdinnen und -juden davor, sich vom „phosphoreszierenden Sumpf“ des Nationalsozialismus verführen zu lassen. Tatsächlich richtete er sich sowohl an jüdische als auch an nichtjüdische Leser*innen. Gerade so wie die Sirenen den Odysseus mit ihrem lieblichen Gesang verführen wollen, um ihn zu vernichten, so verströmt Bubers sprichwörtlicher Sumpf ein verführerisches Licht, das die Massen anziehen will, aber zu ihrem Untergang führen wird. Doch trotz seiner Deutlichkeit wurde Bubers Text von den NS-Behörden weder beanstandet noch verboten.
Den Erinnerungen von Lambert Schneider zufolge, waren die Veröffentlichungen des Schocken Verlags enorm beliebt bei bestimmten Gruppen von nichtjüdischen Leser*innen. Auch wenn es nichtjüdischen Buchläden offiziell untersagt war, jüdische Publikationen zu verkaufen, taten es
another important factor: some texts represented an outright criticism of the National Socialist regime and its inhuman stance against the Jewish people in Germany.7
When launching the series of the Almanach in fall 1933, the editor, Moritz Spitzer, decided to open it with a text by Martin Buber:
“The Jewish person of today is the most exposed person in our world. The tensions of the era have chosen this moment to measure their strength on him. They want to know whether man can still resist them, and test themselves against the Jew. Will he withstand? Will he fall to pieces? Through his fate they to seek to learn the state of humanity. Will he survive?
… Something has happened. Instead of one being, against which the tensions of the era wished to rail, two appear: one decaying and the other invincible. One that emits light like a phosphorescent swamp, and one that emits light like the Orion. But this represents that one. It says about the other: this is me. It stretches over it, covers it, tolerates what is to be tolerated. And once your test has been overcome, tensions of the era, there will no longer be two, but one, the one who overcomes.”8
The first Almanach was published on the occasion of Rosh ha-Shanah in 1933. Even though Buber refrains from naming the ones responsible for the “tensions of the time” (die Spannungen des Zeitalters), the text could hardly be more specific. It was bold of Schocken, Schneider, Spitzer and Buber to publish this text in the fall of 1933, for it not only offered German Jews comfort but also warned non-Jews not to be seduced by the “phosphorescent swamp” ( phosphoreszierender Sumpf ) of National Socialism. Indeed, the text is addressed to Jewish and non-Jewish readers alike. Just as the sirens sought to seduce Odysseus with their beautiful song, only to destroy him, Buber’s proverbial marsh radiates a seductive light that attracts the masses but will ultimately lead them to ruin. While it offers consolation to the Jews, it expresses a stark warning to all others. Despite this apparent perspicuity of the text, it was neither objected nor banned by the National Socialist authorities.
The memoirs of Lambert Schneider indicate that the Schocken publications were extremely popular with certain groups of non-Jewish readers. Although non-jewish bookstores were officially prohibited from selling Jewish publications, many still did so illegally.9 Furthermore, Jewish bookstores were freely accessible, and all the books of the Schocken publishing house could be ordered directly by mail. According to Schneider’s memoirs, the National Socialist regime attempted to banish the publishing house into a metaphorical ghetto and thereby enabled them to publish critical and oppositional texts. Another text by Buber, entitled
7 Es gibt keine schriftlichen Quellen, aus denen hervorginge, wann und weshalb Schocken, Schneider, Spitzer sich jeweils dazu entschlossen, die Politik der Nationalsozialisten zu kritisieren, aber die ersten Belege dafür, dass sie es taten, erscheinen bereits im Herbst 1933.
8 Martin Buber, Der jüdische Mensch von heute, in: Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5694 1933/34, S. 5. Der Schocken Verlag publizierte diesen Text im Jahr 1936 noch ein zweites Mal, s. Martin Buber, Die Stunde und die Erkenntnis. Reden und Aufsätze 1933–1935, Berlin 1936, S. 13.
7 No written records exist that might indicate when and why Schocken, Schneider, Spitzer and Buber decided to criticise National Socialist politics, but the first examples appear as early as fall 1933.
8 In 1936 the same text was published a second time by the Schocken Verlag; cf. Martin Buber, Die Stunde und die Erkenntnis. Reden und Aufsätze 1933–1935. Berlin: Schocken Verlag, 1936. (Quote: My translation.)
9 Lambert Schneider, Rechenschaft über vierzig Jahre Verlagsarbeit 1925–1965. Ein Almanach. Heidelberg: Lambert Schneider, 1965, 42.
doch etliche illegal.9 Außerdem waren jüdische Buchläden frei zugänglich und es konnten alle Bücher aus dem Schocken Verlag auch per Post bestellt werden. Schneider erinnert sich, dass das nationalsozialistische Regime den Verlag in ein symbolisches Ghetto drängen wollte, aber es ihm gerade deshalb ermöglichte, kritische und oppositionelle Texte zu drucken. Ein weiterer Text von Buber, „Erkenntnis tut not“, macht deutlich, dass der Verleger auch auf eine nichtjüdische Leserschaft abzielte. In diesem dreiseitigen Essay geht Buber auf den Raum für den Dialog ein. Er schreibt:
„Es gibt den Raum nicht mehr, in dem wir zu den anderen sprechen und von ihnen vernommen werden können. Es gibt den Dialog nicht mehr. […] Der Raum ist taub geworden. Und doch auch wieder nicht. Denn was wir im ertaubten Raum der Öffentlichkeit zu uns selber, nur noch zu uns selber sagen, kann ja doch von jedem Beliebigen, dem es gar nicht zugedacht war, gehört werden. Wohl, so werde es gehört!“ 10 1935 erreichte der vom Staat organisierte Terror gegen Jüdinnen und Juden einen neuen Höhepunkt. Im März erließ der Präsident der Reichsschrifttumskammer ein Betätigungsverbot für jüdische Schriftsteller*innen. Im September wurden die Nürnberger Gesetze verabschiedet. Die Nationalsozialisten institutionalisierten damit ihre antisemitische Ideologie, zwei Wochen vor dem jüdischen Neujahrsfest. Buber, der den zitierten Essay „Erkenntnis tut not“ für den Schocken „Almanach“ schrieb, erschütterten die Ereignisse des Jahres 1935. Seiner Ansicht nach beendeten die neuen Rassengesetze den deutsch-jüdischen Dialog. Und doch könne, wie Buber bemerkt, ein jeder, eine jede hören, „was wir nur noch zu uns selber sagen“. Das Selbstgespräch, die Gedanken, die einer oder eine nur noch sich selbst gegenüber äußern kann, fielen, als sie aus dem Schocken Verlag in die Öffentlichkeit gelangten, so prononciert und kämpferisch aus, dass sie auch jenseits der innerjüdischen Zirkel Gehör finden mussten. Die Literaturpolitik NS-Deutschlands versuchte, die jüdische literarische Kultur auf eine jüdische Leserschaft einzugrenzen und sie zu einer allein innerjüdischen Angelegenheit oder, wie Buber schreibt, auf ein Selbstgespräch zu reduzieren.
Erkenntnis tut not (Knowledge Is Necessary), reveals that the publishers targeted a non-Jewish audience. In this threepage essay Buber dwells on the space of dialogue. He writes: “The space no longer exists where we can talk to and be heard by others. Dialogue no longer exists. … The space has become deaf. And yet, it has not. For what we say in the deafened space to ourselves, and only to ourselves, can be heard by everyone, by those it was not meant for at all. Surely, so it can be heard.” 10
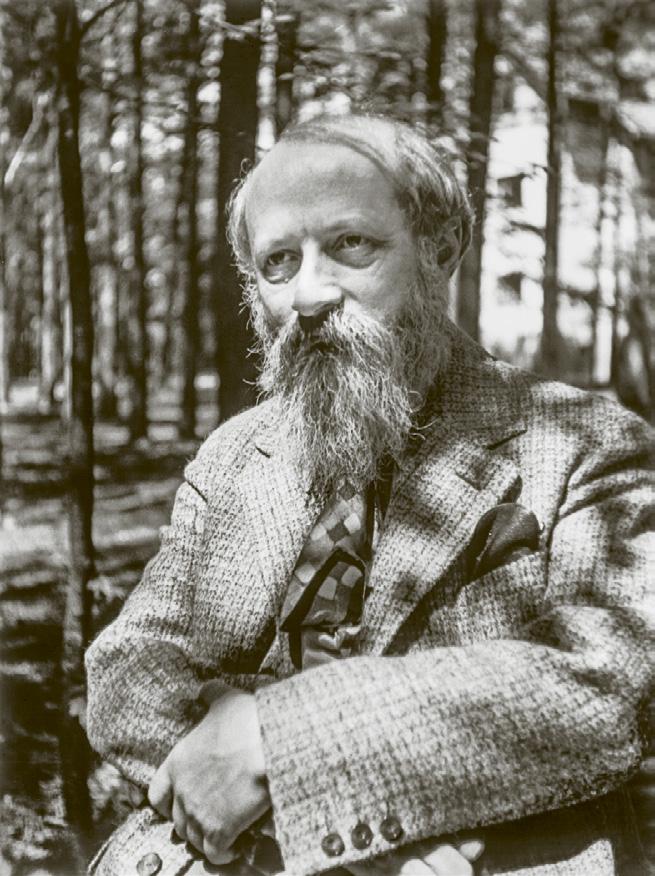
In 1935 state-organized terror against Jews reached a new level. In March of that year the president of the Reich Chamber of Letters issued a ban on Jews working as writers in Germany; by September, the so-called Nuremberg Laws were introduced. With these laws the National Socialists institutionalized their antisemitic ideology just two weeks before the Jewish New Year. For Buber, who wrote the essay Erkenntnis tut not for the Schocken Almanac , the events of 1935 had a deep impact; in his view, the new racial laws put an end to the German-Jewish dialogue. And yet, as Buber noted, everyone can eavesdrop on the inner-Jewish soliloquy. The self-talk, the thoughts that can henceforth only be uttered to oneself, as Buber notes, were in the case of the Schocken publishing house so pronounced and belligerent that they had to be heard beyond the inner-Jewish sphere. The literature politics of National Socialist Germany tried to confine Jewish literary culture to a Jewish readership, making it an inner-Jewish matter only—or as Buber puts it, reducing it to Jewish self-talk.
Despite Buber’s notion that the window for dialogue between Jews and non-Jews had closed, it is clear that the Schocken Verlag publications were bearers of communication between the two groups. In times when direct communication and open criticism put people at risk, the published word took over the task of accusing and explicating. Books and periodicals served as mediators and as the space within which dialogue continued to unfold. They provided German Jewry with a safe space of self-assurance while also opening a channel of communication between two groups which had been separated by racial policies and laws.
Trotz Bubers Ansicht, dass der Raum für einen Dialog zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen taub geworden sei, ist klar, dass die Publikationen des Schocken Verlags die Kommunikation aufrechterhielten. In einer Zeit, in der der unmittelbare Dialog und die offene Kritik Menschen
Thus far, I have highlighted two essays by Martin Buber, which exemplify the manner in which the Schocken Verlag openly criticized the National Socialist regime and its
Martin Buber (1878–1965) während einer Fortbildungswoche der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung in Lehnitz, Foto: Herbert Sonnenfeld
Martin Buber (1878–1965) during a seminar week at the Center for Jewish Adult Education in Lehnitz, Photo by Herbert Sonnenfeld
9 Lambert Schneider, Rechenschaft über vierzig Jahre Verlagsarbeit 1925–1965. Ein Almanach, Heidelberg 1965, S. 42.
10 Martin Buber, Erkenntnis tut not, in: Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5696 1935/1936, S. 11–14, hier S. 13.
Criticism of the Regime
10 Martin Buber, “Erkenntnis tut not”, in: Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5696 1935/1936, p. 11–14, 13. (Quote: My translation)
in Gefahr brachte, übernahm das publizierte Wort die Aufgabe der Anklage und der Erklärung. Bücher und Periodika dienten als Vermittler und als der Raum, in dem der Dialog fortgesetzt werden konnte. Sie verschafften den deutschen Jüdinnen und Juden den sicheren Raum der Selbstgewissheit und öffneten zugleich einen Kommunikationskanal zwischen den beiden Gruppen, die von einer rassistischen Politik und rassistischen Gesetzen getrennt worden waren.
Dem deutschen Judentum eine Stimme geben
Bislang habe ich zwei Essays von Martin Buber hervorgehoben, die beispielhaft dafür stehen, wie der Schocken Verlag das nationalsozialistische Regime und seine Ideologie kritisierte. Wenn wir jedoch die gesamte Produktion des Schocken Verlags in Betracht ziehen, wird deutlich, dass das Regime vor allem in einem anderen Genre angeklagt und angegriffen wurde: Biblische und sakrale Texte dienten als Hauptquelle der politischen Kritik. Ins Deutsche übertragene althebräische Schriften verliehen dem deutschen Judentum eine kraftvolle Stimme.
Der allererste Band der „SchockenBücherei“ – „Die Tröstung Israels. Aus Jeschajahu, Kapitel 40 bis 55“ – setzt ein Zitat aus Jesaja 40:1 an den Anfang: „Tröstet tröstet mein Volk / spricht euer Gott“.11 Im Jahr 1933 verlangte es die Jüdinnen und Juden Deutschlands nach Trost, und der antike biblische Text in der „Verdeutschung“ von Martin Buber und Franz Rosenzweig spendet ihn:
„Du aber, / Jißrael, mein Knecht, / Jaakob, den ich wählte, / du Samen Abrahams, meines Liebenden! / du den ich erfaßte von den Rändern der Erde her, / von ihren Achseln her habe dich ich gerufen / und sprach zu dir: / Mein Knecht bist du! / Gewählt habe ich dich einst / und habe dich nie verworfen, – / fürchte dich nimmer, / denn ich bin bei dir, / starre nimmer umher, / denn ich bin dein Gott, / ich stärke dich, / ich helfe dir auch, / ich halte dich auch / mit der Rechten meiner Wahrhaftigkeit.“ 12 (Jesaja 41:8–10)
ideology. However, if we analyse the whole corpus of the Schocken publishing house, it becomes clear that the regime was accused and criticized primarily in another genre: biblical and religious texts served as the main sources of political critique. Old Hebrew script translated into German provided German Jewry with a powerful voice.
The very first volume of the Schocken Bücherei—Die Tröstung Israels. Aus Jeschajahu, Kapitel 40 bis 55 —opened with a biblical quote taken from Isaiah 40.1: “Tröstest tröstest mein Volk / spricht euer Gott” (Comfort, comfort my people / says your God) (Buber 1933, 4). In 1933 the Jews of Germany were in need of solace, and the ancient biblical text in the translation of Martin Buber and Franz Rosenzweig fulfilled this need.
“But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham, my friend; you whom I took from the ends of the earth, and called from its farthest corners, saying to you, “You are my servant, I have chosen you and not cast you off”; fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. (Isaiah 41:8–10)” 11
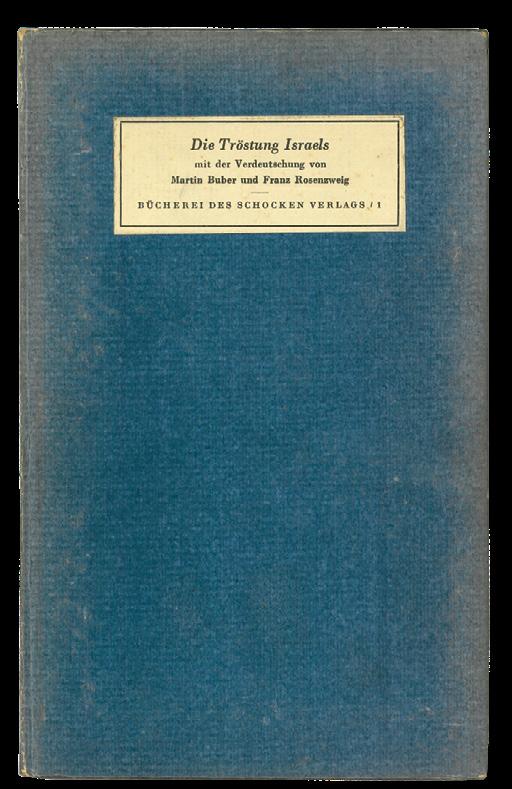
Buber chose for the first volume of the Schocken Bücherei Isaiah verses 40–55, a “collection of prophecies of comfort emphasizing imminent redemption” in verses 40–48, as well as prophecies emphasizing reconciliation with God and physical restoration (verses 49–55).12
Buber wählte aus dem Buch Jesaja die Kapitel 40 bis 55, wobei die Kapitel 40 bis 48 eine „Sammlung von Prophezeiungen von Trost sind, die die nahe Erlösung verheißen“, während die Kapitel 49 bis 55 die Wiederversöhnung mit Gott und die leibliche Wiederherstellung in Aussicht stellen.13 Wesentlich für die jüdische Tradition ist die Notwendigkeit einer ständigen Auslegung der Bibel. Was Buber seinem Publikum anbot, war nicht eine Auslegung des Bibeltextes an sich. Vielmehr stellte er mit der Auswahl gerade dieser Kapitel Texte zur Verfügung, die die Leserschaft direkt anspra-
Jewish tradition is characterized by the emphasis on the need for constant interpretation of the Bible. What Buber offered his readers was not an interpretation of the Biblical text per se, but, by choosing these exact verses he provided them with a text that speaks directly to them. “Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand” (Isaiah 41, 10–11). In the fall of 1933 these words gained an imminent significance for Jewish readers. In verse 41:11 the Biblical text promises revenge: “Behold, all who are incensed against you shall be put to shame and confounded; those who strive against you shall be as nothing and shall perish.” Whereas the previous lines are directed to the despairing Jewish people, this verse was intended to invoke the wrongdoing of the National Socialists. The openness of the text, as Gray stated,13 as well as the tradition of constant interpretation of the biblical text, allows the contemporary reader to make a connection between the ancient religious text and their own world. It also allowed the authors and the publishers of the Schocken Verlag to level criticism at the Nazi regime.
Erster Band der „Bücherei des Schocken Verlags“, Berlin, 1933
First book of the series Bücherei des Schocken Verlags , Berlin, 1933
11 Die Tröstung Israels. Aus Jeschajahu, Kapitel 40 bis 55. Mit der Verdeutschung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, Berlin 1933, S. 4.
12 Ebd., S. 8.
13 Michael A. Fishbane, The JPS Bible Commentary, Haftarot, Philadelphia 2002, S. 410.
11 Die Tröstung Israels. Aus Jeschajahu, Kapitel 40 bis 55. Mit der Verdeutschung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, Berlin : Schocken 1933, 4. English translations of biblical quotations are taken from the English Standard Version.
12 Michael A. Fishbane, The JPS Bible Commentatory: Haftarot, Philadelphia: Jewish Publication Society, 2002, 410.
13 Mark Gray, Rhetoric and Social Justice in Isiah. London, Oxford, New York, New Delhi & Sydney: Bloomsbury Publishing, 2006.
chen. „[Fürchte] dich nimmer, / denn ich bin bei dir, / starre nimmer umher, / denn ich bin dein Gott, / ich stärke dich, / ich helfe dir auch, / ich halte dich auch / mit der Rechten meiner Wahrhaftigkeit.“ (Jesaja 41:10–11) Im Herbst 1933 mussten diese Worte für jüdische Leser*innen eine hohe Dringlichkeit enthalten. Im Vers 41:11 kündigt der biblische Text Rache an: „Wohl, enttäuscht und beschämt werden alle, die wider dich entflammt sind; wie Nichts werden, verschwinden die Männer deiner Bestreitung.“ Während die vorangegangenen Verse sich an das verzweifelte jüdische Volk wandten, sollten diese die Untaten der Nationalsozialisten vor Augen führen. Der schon von Mark Gray 14 festgestellte Freimut dieser Zeilen, aber auch die Tradition der fortgesetzten Auslegung der biblischen Schriften erlaubten es den zeitgenössischen Leser*innen, eine Verbindung zwischen dem alten sakralen Text und ihrer eigenen Welt herzustellen. Sie erlaubten es außerdem den Autor*innen, Herausgebern und Verlegern des Schocken Verlags, Kritik am NS-Regime zu üben.
Werkzeuge eines verdeckten Widerstands
Die Bücher des Berliner Schocken Verlags waren überaus wichtig während der ersten Jahre der nationalsozialistischen Diktatur. Die jüdische Presse der Zeit pries ihre Bedeutung für das deutsche Judentum sowohl in Buchbesprechungen als auch in Artikeln.15 Als gedruckte Bücher und also Gegenstände stellen sie nicht nur sichtbare und berührbare Reminiszenzen an die reiche jüdische Kultur dar, die vom Nationalsozialismus zerstört worden ist, sondern bezeugen auch das Fortbestehen jüdischen Lebens in Deutschland. Die jüdischen Verleger gehörten, indem sie setzen, drucken, binden ließen, in den allgemeinen, weder von religiöser Zugehörigkeit noch von ethnischer Gemeinschaft bestimmten Kreis der Buchproduktion, sie teilten die Leidenschaft für das Buch als eines Gegenstands der materiellen Kultur.16
Die Übersetzungen der biblischen und nachbiblischen Texte eröffnete eine Möglichkeit, das Wort zu ergreifen und gehört zu werden. Indem das Hebräisch der religiösen Tradition in zeitgenössisches Deutsch übertragen wurde, verwandelten sich die Texte in Werkzeuge eines verdeckten Widerstands. Die alten Schriften hatten zuvor keine große Rolle für die assimilierten und säkularen Leser*innen gespielt, aber wurden nun für sie zugänglich und bedeutsam. Auf diese Weise liehen sie den brutal zum Schweigen gebrachten Jüdinnen und Juden Deutschlands ihre Stimme.
Dieser Text basiert auf: Stefanie Mahrer, „Texts and Objects: The Books of the Schocken Publishing House in the Context of their Time“, in: Amir Eshel / Rachel Seelig (Hg.): „The German-Hebrew Dialogue: Studies of Encounter and Exchange“, Berlin / Boston 2018, S. 121–142.
14 Mark Gray, Rhetoric and Social Justice in Isaiah, Oxford u.a. 2006.
15 Saskia Schreuder, „Inmitten aller Not und aller Angriffe“. Der Schocken Verlag im Spiegel der jüdischen Kritik, in: dies. / Claude Weber (Hg.): Der Schocken Verlag / Berlin. Jüdische Selbstbehauptung in Deutschland 1931–1938, Berlin 1994, S. 377–395.
16 Meine Kenntnisse über Satz und Buchgestaltung verdanke ich Ada Wardi. Ich hatte das Vergnügen, mit ihr an einem Ausstellungsprojekt über drei deutsch-jüdische Grafikdesigner*innen zusammenzuarbeiten, die ihr Metier in Deutschland erlernt hatten und wichtig für die moderne hebräische Typenund Buchgestaltung im Staat Israel wurden.
The books of the Schocken Verlag Berlin gained great importance during the early years of the National Socialist dictatorship. In the contemporary Jewish press their significance for German Jewry was praised in book reviews and editorial articles alike.14 As objects, as printed books, they served as visible and touchable reminders of the rich Jewish culture that was being destroyed by Nazism while also bearing witness to the persistence of Jewish life in Germany, to the fact that German Jews were still part of a larger society. The processes of typesetting, printing, and binding included the Jewish publishers in the circle of book production that was not organized by religious affiliations and racial denomination, but by the common interest in the book as an object of material culture.15
The German translation of biblical and post-biblical texts opened up a possibility to speak up and be heard. By translating the Hebrew of religious tradition into contemporary German, the texts were transformed into a means of camouflaged resistance. The old texts had previously not played an important role for many of their assimilated and secular readers but became accessible and relevant again. By this, they lent their voice to the brutally silenced Jews of Germany.
This text is based on: Stefanie Mahrer, “Texts and Objects: The Books of the Schocken Publishing House in the Context of their Time,” in: The German-Hebrew Dialogue: Studies of Encounter and Exchange, edited by Amir Eshel and Rachel Seelig, Berlin, Boston: De Gruyter, 2018, pp. 121–142.
Stefanie Mahrer ist Assistenzprofessorin für Neuere und Neueste Allgemeine Geschichte. Sie forscht und lehrt an den Universitäten Bern und Basel zur Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz, in Deutschland und im britischen Mandatsgebiet Palästina/ Israel des 19. und 20. Jahrhunderts. 2021 erschien ihr Buch „Salman Schocken. Topographien eines Lebens“ im Neofelis Verlag, Berlin.
Stefanie Mahrer is an assistant professor of Modern and Contemporary History. She researches and teaches at the Universities of Bern and Basel on the history and culture of Jews in Switzerland, Germany, and the British Mandate of Palestine/Israel in the 19th and 20th centuries. In 2021, her book Salman Schocken. Topographien eines Lebens was published by Neofelis Verlag, Berlin.
14 Saskia Schreuder, “‘Inmitten aller Not und aller Angriffe’. Der Schocken Verlag im Spiegel der jüdischen Kritik.” Der Schocken Verlag / Berlin. Jüdische Selbstbehauptung in Deutschland 1931–1938. Eds. Saskia Schreuder and Claude Weber. Berlin: Akademie Verlag, 1994. 377–395.
15 I owe my knowledge about typesetting and book design to Ada Wardi, with whom I had the pleasure of working in an exhibition project on three German-Jewish graphic designers who learned their profession in Germany and became important for Modern Hebrew type and book design in the State of Israel.
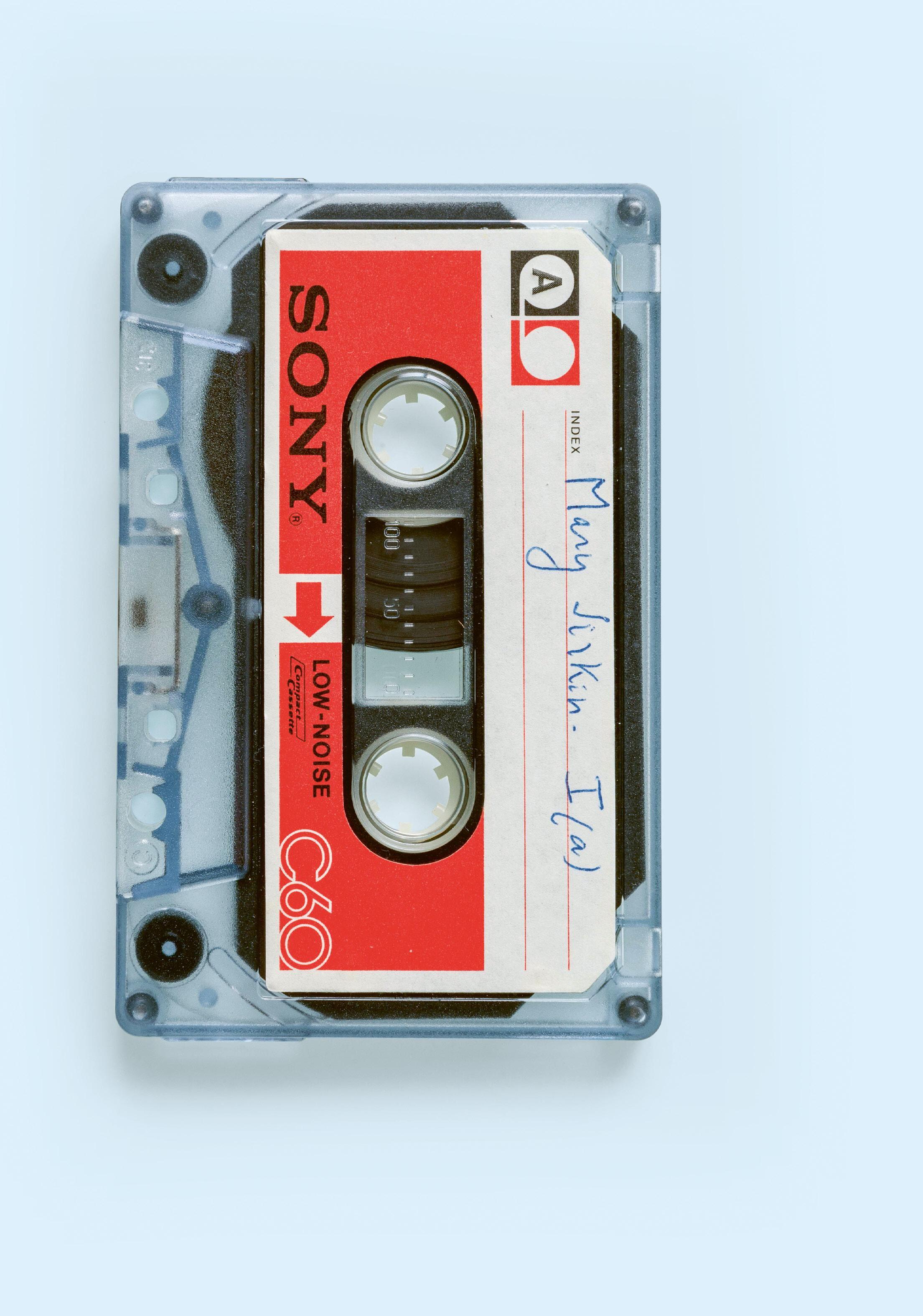
Zum 100. Geburtstag von Claude Lanzmann (1925–2018) – dem herausragenden französischen Journalisten, Filmemacher und Chronisten der Schoa – präsentiert das Jüdische Museum Berlin eine Ausstellung, die Geschichte hörbar macht. Zum ersten Mal wird das Audio-Archiv zu Lanzmanns weltberühmtem Dokumentarfilm Shoah (1985) öffentlich zugänglich. Die Sammlung umfasst 152 bisher unbekannte Audiokassetten. Sie dokumentieren die zahlreichen Gespräche, die Lanzmann und seine Assistentinnen Corinna Coulmas und Irena Steinfeldt-Levy in den 1970er-Jahren während einer mehrjährigen Recherchephase vor Beginn der Dreharbeiten führten – mit Überlebenden, Täter*innen und Dritten. Zusammen mit dem Film, der vor 40 Jahren Geschichte schrieb, zählen die Audioaufnahmen seit 2023 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Shoah ist nicht nur ein Meilenstein der Filmgeschichte, es ist ein eindringliches, unverzichtbares Zeugnis von der Schoa. Die Sammlung Lanzmann gewährt einen tiefen Einblick in Lanzmanns Arbeitsweise und die Entstehung seines epochalen Werks. Die einzigartigen Tondokumente stehen im Zentrum der auditiv erkundbaren Ausstellung und werden ergänzt durch Objekte und Filmaufnahmen.
28. November 2025 bis 12. April 2026
Libeskind-Bau, Eric F. Ross Galerie Eintritt frei
To mark the centenary of the birth of Claude Lanzmann (1925–2018)—the acclaimed French journalist, filmmaker and chronicler of the Shoah—the Jewish Museum Berlin presents an exhibition that makes history audible. For the first time ever, the audio archive of Lanzmann’s world-renowned documentary film Shoah (1985) will be made accessible to the public.
The collection includes 152 previously unknown magnetic tape cassettes. They document the numerous interviews with survivors, perpetrators and others that Lanzmann and his assistants, Corinna Coulmas and Irena Steinfeldt-Levy, conducted in the 1970s during their years of research before filming began. Both the archive and the film, which made history when it appeared 40 years ago, were designated part of the world’s cultural heritage by UNESCO in 2023. Shoah is more than just a milestone in film history; it is a poignant, essential testimony to the Holocaust. The Lanzmann Collection offers profound insight into Lanzmann’s working methods and the development of his epoch-making work. These unique audio recordings are the heart of the exhibition, which can be explored through sound, and are complemented by objects and film footage.
28 November 2025 to 12 April 2026
Libeskind Building, Eric F. Ross Gallery
Free admission
Audiokassette aus der Sammlung Lanzmann: Interview mit Mary Sirkin
Audio cassette from the Lanzmann Collection: Interview with Mary Sirkin


Wer Spuren von Salman Schockens Engagement als Mäzen und Sammler sucht, würde wahrscheinlich nicht im Metropolitan Museum of Art in New York oder im Getty Center in Los Angeles beginnen.
Bekannt ist Schocken als Sammler hebräischer Bücher und Manuskripte, auch von seltenen Erstausgaben und Manuskripten der deutschen Literatur.
Sein Name wird heute eher nicht mit Werken von damals zeitgenössischen Künstler*innen in Verbindung gebracht, oder mit jenen des Impressionismus oder Postimpressionismus. Doch wie er den Architekten Erich Mendelsohn und progressive Designer beauftragt hat, seinem Unternehmen eine starke visuelle Identität zu verleihen, so setzte er sich auch für die moderne Kunst ein.
Text
Emily D. Bilski
If one were to search for traces of Salman Schocken’s activities as a patron and collector, one might not think of visiting the Metropolitan Museum of Art in New York or the Getty Center in Los Angeles. Schocken is renowned as a collector of Hebrew books and manuscripts, as well as of rare first editions and manuscripts of German literature. He is not generally thought of in connection with artists who were his contemporaries, nor with Impressionist and post-Impressionist works. Yet Schocken’s engagement with modern art is in keeping with his commissioning architect Erich Mendelsohn and progressive designers to create a strong visual identity for his business.
DE Für seine Sammlung moderner Kunst sparte
Salman Schocken weder an Zeit noch an Mitteln. Im Lauf der Jahre baute er Verbindungen zu Kunstschaffenden, Galeristen und anderen Sammlern auf. Er war aktives Mitglied der Kestner Gesellschaft in Hannover, die auch heute noch zeitgenössische Kunst fördert. Er lieh Werke für Ausstellungen in Palästina und Deutschland aus, unter anderem für das erste Berliner Jüdische Museum, das von 1933 bis 1938 bestand. Schockens Sammlung moderner Kunst zeichnet sich durch Neugier, ein ausgesprägtes ästhetisches Gespür und einen Instinkt für Qualität aus.
Es gelang ihm, eine eindrucksvolle Sammlung an Grafiken zusammenzutragen. Zu ihr gehörten herausragende Blätter alter Meister wie Albrecht Altdorfer und Albrecht Dürer und mindestens vierzig Werke von Rembrandt. Da Schocken auch Bücher sammelte und von Typografie und allen Drucktechniken fasziniert war, kann seine Vorliebe für grafische Kunst und für Werke, die in vertrauter Umgebung studiert werden können, wenig überraschen. Ursprünglich bestand seine Sammlung moderner und zeitgenössischer Werke hauptsächlich aus Drucken und Zeichnungen aus der Romantik über den Naturalismus und Impressionismus bis hin zum Expressionismus. Zu den zeitgenössischen Künstlern gehörten Mitglieder der Berliner Secession wie Max Liebermann und Lovis Corinth, Expressionisten wie Oskar Kokoschka, Otto Müller, Emil Nolde und Erich Heckel. Schocken besaß auch zwanzig Werke des norwegischen Symbolisten Edvard Munch, dessen Erkundungen extremer emotionaler und psychischer Zustände einen großen Einfluss auf die deutsche Avantgarde der Jahrhundertwende hatte.
Schocken besaß Drucke einer ganzen Reihe französischer Künstler, unter ihnen Eugène Delacroix, Camille Pissarro und Édouard Manet. Einige von ihnen erkunden die Psyche der Gestalten Shakespeares. So gehören die Lithografie „Macbeth befragt die Hexen“ von Delacroix und die vollständige Erstauflage der Hamlet gewidmeten Lithografien des Künstlers zur Sammlung. Das gilt auch für Manets Radierung des französischen Heldendarstellers Philibert Rouvière als Hamlet – ein Auftritt, der in seiner Eindringlichkeit von Delacroix’ Lithografien inspiriert sein könnte.
Die Darsteller*innen und das Publikum des Theaters gehören zu den bevorzugten Motiven von Henri de ToulouseLautrec, dessen Werke Schocken in großer Zahl kaufte. Angesichts von Schockens starkem Interesse an der Macht der Bilder in der Werbung mussten ihn Toulouse-Lautrecs Plakatentwürfe und seine technischen Innovationen in der Lithografie angezogen haben. In der Sammlung finden sich dessen lebendige Darstellungen des Lebens in den Cabarets und auf den Straßen von Paris, außerdem die drei Lithografien umfassende Serie des „Procès Arton“ (Der Prozess Arton; 1896). Sie zeigt das menschliche Drama im Fall des Bankiers Émile Arton, der vor Gericht stand, weil er der Bestechung im Panamaskandal angeklagt war. Da nicht nur Arton selbst, sondern auch andere Personen in dem öffentlichen Gerichtsverfahren jüdischer Herkunft waren, heizte der Skandal den in der Bevölkerung verbreiteten Antisemitismus an. ToulouseLautrec war von Männern und Frauen am Rande der Gesellschaft fasziniert, und er fing sie mit viel Sympathie ein.
EN Salman Schocken invested time and resources in collecting modern works. Along the way he developed relationships with artists, dealers, and fellow collectors. He was active in the Kestner Gesellschaft in Hannover, which to this day promotes contemporary art. Schocken lent works to exhibitions in Palestine and Germany, including the first Berlin Jewish Museum, which existed from 1933 until 1938. His modern art collecting was distinguished by curiosity, a keen aesthetic sensibility and an instinct for quality.
Schocken succeeded in building an impressive graphics collection, including stellar examples of works by Old Masters such as Albrecht Altdorfer and Albrecht Dürer, and at least forty works by Rembrandt. As a book collector fascinated by typography and all aspects of printing, Schocken’s predilection for graphic art and for works that could be studied in an intimate setting, is not surprising. Initially, his collection of modern and contemporary works concentrated on prints and drawings, ranging from Romanticism, to Realism, Impressionism, and Expressionism. Contemporary artists included German Secessionists such as Max Liebermann and Lovis Corinth, and Expressionists Oskar Kokoschka, Otto Müller, Emil Nolde, and Erich Heckel. Schocken also owned over twenty works by Norwegian Symbolist Edvard Munch, whose explorations of raw emotional and psychological states greatly influenced the German avant-garde at the fin-de-siècle.
Schocken collected prints by a range of nineteenth-century French artists, among them Eugène Delacroix, Camille Pissarro, and Édouard Manet. Some of these explore the psychology of Shakespeare’s protagonists. The collection included Delacroix’s lithograph of Macbeth Consulting the Witches and a complete first edition of the artist’s series of lithographs devoted to Hamlet. Manet’s etching of the French tragedian Philibert Rouvière in the role of Hamlet, a performance thought to have been inspired in its intensity by Delacroix’s lithographs, was also in the collection.
Theater performers and patrons were favored subjects of Henri de Toulouse-Lautrec, whose works Schocken collected in depth. Toulouse-Lautrec’s poster designs and his technical innovations in lithography, resonated with Schocken’s interest in the power of images in advertisements. Specific works in Schocken’s collection showcase Toulouse-Lautrec’s vibrant depictions of Parisian cabaret and street life. Schocken also owned the complete set of three lithographs from the series Procès Arton (The Arton Trial, 1896), which depict the human drama on display during the public trail of banker Émile Arton, who was accused of bribery in the Panama Canal scandal. As several of the men implicated were Jewish, the scandal exacerbated popular antisemitism. Toulouse-Lautrec was fascinated by men and women existing at society’s margins, and he depicted them sympathetically.
Käthe Kollwitz, who also directed her gaze towards society’s downtrodden, was the contemporary artist with whom Schocken engaged most intensely. The drawing she dedicated to Schocken on his sixtieth birthday in 1937 testifies to their cordial personal relationship. Kollwitz’s unrelenting attention to the travails of peasants and of the working class, to human suffering due to social and economic injustice, and to the joys and struggles of motherhood, might seem an odd
S./p. 72
Empfangssaal der Villa Schocken in Jerusalem, ca. 1937. An der hinteren Wand sind Van Goghs „Zypressen“ zu sehen.
Reception hall of the Schocken villa in Jerusalem, ca. 1937. Van Gogh’s Cypresses can be seen on the back wall.
Käthe Kollwitz, Frau mit totem Kind, Zeichnung, 1903
Käthe Kollwitz, Frau mit totem Kind (Woman with Dead Child), drawing, 1903
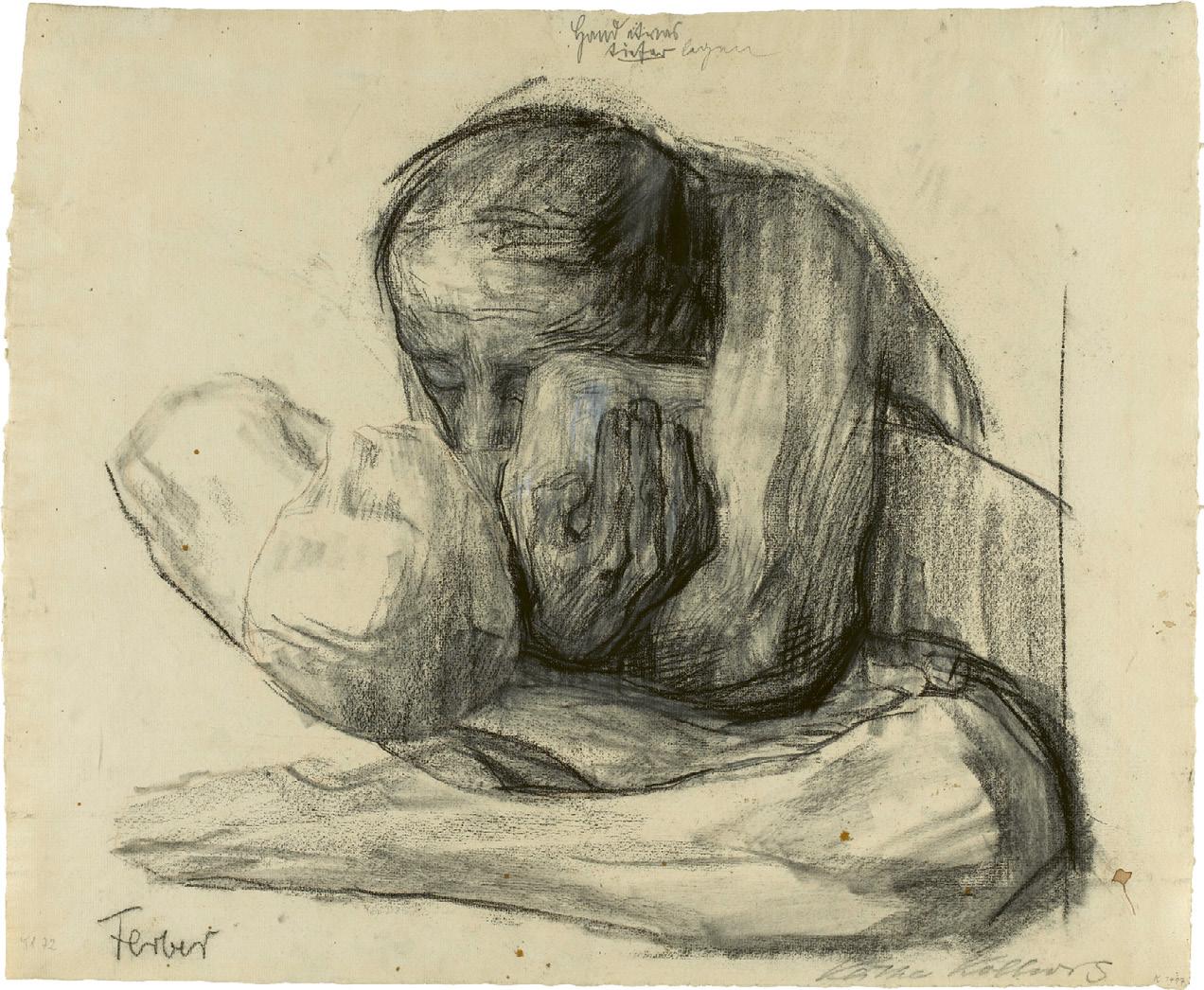
Von den zeitgenössischen Künstler*innen war Käthe Kollwitz, die sich ebenfalls den Unterdrückten zuwandte, diejenige, mit der Schocken die engste Verbindung unterhielt. Die Zeichnung, die sie Schocken an seinem sechzigsten Geburtstag 1937 widmete, bezeugt beider herzliche Verbundenheit. Dass Kollwitz sich unermüdlich mit der Mühsal der Bauern und Bäuerinnen und der Arbeiterklasse, mit dem von sozialer und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit hervorgebrachten menschlichen Elend oder mit den Freuden und Leiden der Mutterschaft beschäftigte, scheint die Künstlerin nicht gerade zur ersten Wahl für einen Geschäftsmann wie Schocken zu machen. Doch ist sein ausgeprägter Sinn für soziale Gerechtigkeit vielfach belegt, etwa mit seiner Unterstützung des Wohlergehens seiner Mitarbeitenden, mit seinem Geschäftsethos oder seinem Einsatz für die im Entstehen begriffene Wirtschafts- und Bildungsinfrastruktur in Palästina. Salman Schocken kaufte direkt bei Käthe Kollwitz in der Absicht, ihr grafisches Werk möglichst vollständig zusammenzutragen. Nach ihrem Tod im Jahr 1945 fand im Kunstmuseum von Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der Schocken Library eine große Gedächtnisausstellung statt. Die ausgestellten Werke stammten größtenteils aus Schockens Sammlung. Als 1967 die Erbengemeinschaft Schockens Kollwitz-Sammlung auflöste, standen 280 Posten zur Auktion: 219 Drucke, 58 Zeichnungen und drei BronzeSkulpturen. Unter anderem fanden sich in dem Konvolut fünf Versionen des „Gedenkblatts für Karl Liebknecht“ (1919); es zeigt den ermordeten kommunistischen Politiker umgeben von Trauernden. Auch die Druck-Zyklen „Ein Weberaufstand“ (1893–1897) und „Bauernkrieg“ (1902–1908) waren vorhanden. Fünf Fassungen von Kollwitz’ erschütternder Darstellung der Trauer einer Mutter, „Frau mit totem Kind“ (1903), standen zum Verkauf: der Druck in verschiedenen Zuständen sowie eine Kreidezeichnung. Es war eines von
choice for a businessman such as Schocken. His support for the welfare of his company’s workers, his business ethics, and his efforts on behalf of the nascent economic and educational infrastructure in Palestine, all reveal a strong sense of social responsibility.
Schocken bought directly from Kollwitz, aiming to amass as complete a collection as possible of her graphic output. After Kollwitz’s death in 1945, a large Memorial Exhibition was held at the Tel Aviv Museum of Art in cooperation with the Schocken Library, with works lent primarily from the Schocken collection. The 1967 sale by Schocken’s heirs of Kollwitz works consisted of 280 auction lots: 219 prints, 58 drawings, and 3 bronze sculptures. Among these works were five versions of the Gedenkblatt für Karl Liebknecht (In Memoriam Karl Liebknecht, 1919), an image of the assassinated Communist politician on his deathbed surrounded by mourners, and Kollwitz’s print cycles Ein Weberaufstand, (A Weavers’ Revolt, 1893–97) and Bauernkrieg (Peasants’ War, 1902–8). Five versions of Kollwitz’s searing depiction of maternal grief, Frau mit totem Kind (Woman with Dead Child, 1903) were included in the sale: several states of the print and a chalk drawing, one of several works purchased at the auction by the Staatsgalerie Stuttgart. Other Kollwitz works originally from the Schocken collection can be found at the Getty Museum, part of a donation from Dr. Richard A. Simms, another passionate Kollwitz collector.
In addition to Kollwitz’s bronzes, Schocken collected works by August Gaul and Ernst Barlach. He was particularly inclined towards the elegantly expressive sculptures of Renée Sintenis. Her small-format animal bronzes covered many surfaces in the Schocken home in Berlin, Zehlendorf. A striking display of three of Sintenis’s iconic works can be seen arranged on a mantlepiece: Kleine Daphne (Small Daphne), Der Läufer Nurmi (The Runner Nurmi),
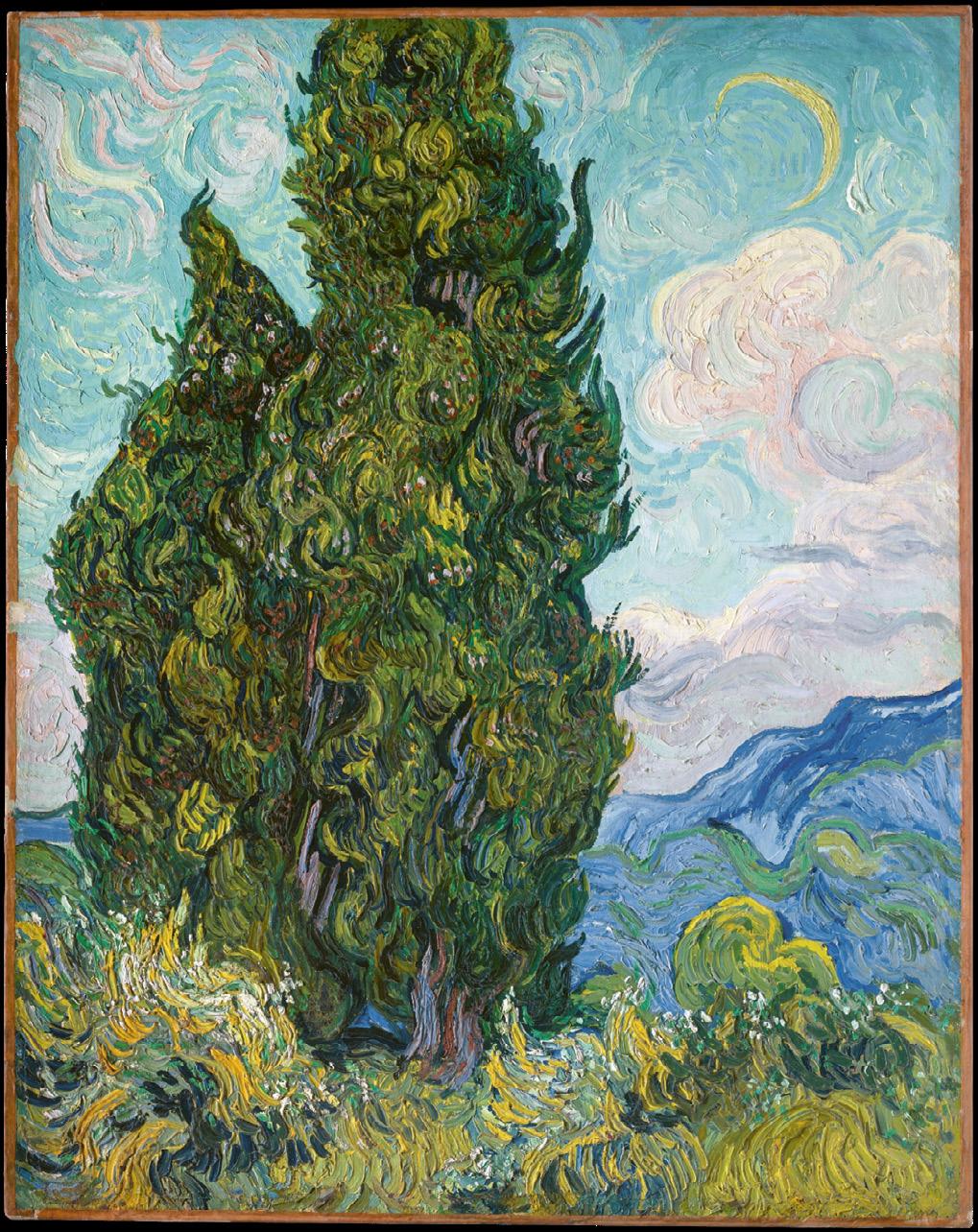
mehreren Werken, die bei der Auktion von der Staatsgalerie Stuttgart angekauft worden sind. Weitere aus der SchockenSammlung stammende Arbeiten von Kollwitz befinden sich heute im Getty Museum als Teil einer Schenkung von Dr. Richard A. Simms, auch er ein passionierter Kollwitz-Sammler.
Die Bronzen von Kollwitz wurden in Schockens Sammlung von Skulpturen August Gauls und Ernst Barlachs ergänzt. Schocken hatte eine Schwäche für die elegantexpressiven Plastiken von Renée Sintenis. Ihre kleinformatigen Tier-Bronzen fanden sich an vielen Orten des Hauses der Familie Schocken in Berlin-Zehlendorf. Ein eindrucksvolles Ensemble bildeten drei ikonische Werke von Sintenis auf dem Kaminsims: „Kleine Daphne“, „Der Läufer Nurmi“ und „Selbstbildnis“. Nach Kollwitz war Sintenis die zweite Frau, die Mitglied der Berliner Akademie der Künste wurde. Ihr Ehemann, Emil Rudolf Weiß, bewegte sich als Buchgestalter und Typograf ebenfalls im Umkreis von Schocken. Weiß gestaltete viele Publikationen Martin Bubers, etwa die von Schocken finanzierte Monatsschrift Der Jude
Die Skulpturen von Sintenis erwarb Schocken, nachdem die Familie von Zwickau in die 1927 gekaufte Zehlendorfer Villa umgezogen war. Da vor dem Umzug nach Berlin die grafischen Werke katalogisiert und verpackt wurden, wissen wir, dass Schocken schon eine ganze Weile gesammelt hat. Dagegen erstreckte sich seine Sammlertätigkeit in diesen Jahren nicht auf moderne Malerei. Das stellte sein Sekretariat in einer Antwort auf das Angebot eines Kunsthändlers 1926 klipp und klar fest. Doch das änderte sich geradezu dramatisch im Jahr 1931, als Schocken damit begann, Malerei der klassischen Moderne im großen Stil zu erwerben.
Vincent van Gogh, Zypressen, Öl auf Leinwand, 1889
Vincent van Gogh, Cypresses, oil on canvas, 1889
and Selbstbildnis (Selfportrait). Sintenis was the second woman—Kollwitz was the first—to become a member of the Berlin Academy of the Arts. Her husband, Emil Rudolf Weiß, also moved within Schocken’s orbit as a book designer and typographer. Weiß designed many of Martin Buber’s publications, including the periodical Der Jude , which had been underwritten by Schocken.
Schocken acquired the Sintenis sculptures after the family moved from Zwickau to the Zehlendorf villa, which had been purchased in 1927. Due to the organization of cataloguing and packing the graphic works in preparation for their transport to Berlin, we know that Schocken had been collecting them already for some time. In contrast, modern paintings did not generally belong to Schocken’s collecting activity during these years, a point explicitly stated in a 1926 communication from his secretary in response to an art dealer’s offers. This stance altered dramatically in 1931, when Schocken embarked on a buying spree of classical modernist paintings.
This shift can be attributed to Schocken’s new appreciation for the value of modern art, coupled with the enhanced opportunities to acquire first-rate pictures at favorable prices in the wake of the stock market crash in 1929 and the German financial crisis in the spring of 1931, which forced the country to abandon the Gold Standard. Looking back in 1958, Schocken recalled that in 1931, when he realized that the German currency no longer held its value, he began to look for unique works to buy.
Over the course of two years, Schocken bought around a dozen works by artists such as Jean-Baptiste Camille Corot, Auguste Renoir, Édouard Manet, Camille Pissarro, Vincent
Diese Veränderung kann einerseits auf Schockens neuerliche Wertschätzung der modernen Kunst, andererseits auf den Preisverfall nach dem Börsenkrach 1929 und die deutsche Finanzkrise im Frühjahr 1931 zurückgeführt werden, die das Land dazu zwang, den Gold-Standard aufzugeben. Schocken erinnerte sich 1958, dass er, als er 1931 den Verfall der deutschen Währung beobachtete, nach einzigartigen Objekten Ausschau hielt, die er kaufen könnte.
Im Verlauf zweier Jahre schaffte sich Schocken rund ein Dutzend Werke von Künstlern wie Jean-Baptiste Camille Corot, Auguste Renoir, Édouard Manet, Camille Pissarro, Vincent van Gogh und Paul Cézanne an. Als andere Sammler aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs ihre Besitztümer verkauften, deckte sich Schocken auf Auktionen, privat und bei Galerien ein. So musste Max Emden, der Besitzer einer Ladenkette, im Jahr 1931 Kunstwerke versteigern und Schocken erwarb von ihm seinen ersten Van Gogh, „Die Vororte von Paris“ (1887). Im März 1932 kaufte er Max Silberberg eine bedeutende Landschaft von Cézanne ab, „Jas de Bouffan“ (1890–1894). Das Gemälde hatte noch 1931 im Mittelpunkt eines Artikels über Silberbergs berühmte Breslauer Sammlung in der Zeitschrift Kunst und Künstler gestanden. Die spektakulärste Anschaffung von Schocken waren Van Goghs „Zypressen“ (1889), die er im Dezember 1931 zusammen mit einem weiteren Cézanne und einem Werk von Marc Chagall beim Kunsthändler Justin Thannhauser erwarb. Schocken und seine Familie übersiedelten Ende 1933 von Deutschland nach Palästina und bezogen 1936 die von Erich Mendelsohn entworfene Villa in Jerusalem. So gelangten die modernen Gemälde in eine ganz neue physische und kulturelle Umgebung. Mendelsohn legte die Hängung der wichtigsten Gemälde innerhalb des Gebäudes fest, ja hatte sie im Kopf, als er die Räume entwarf. Selbst die Oberflächengestaltung, etwa die Farbe der Wände und Böden, nahm er vorweg. Beispielhaft für diese Vorgehensweise ist die effektvolle Hängung von Van Goghs „Zypressen“, die ungerahmt in einer speziell für sie gedachten Nische des Empfangssaals angebracht waren (Bild S. 72). Die anderen Wände blieben kahl und die ebenfalls von Mendelsohn designten Möbel waren so aufgestellt, dass sich im Raum ein Korridor ergab, der einen direkt zum Gemälde geleitete. Die Außenwand war von einer Folge hoher rechteckiger Fenster durchbrochen, die die wie Flammen aufschießende Vertikalität der beiden Zypressen auf Van Goghs Komposition spiegelten. Aus dem Fenster konnte man auf den Garten blicken, in dem ebenfalls Zypressen angepflanzt worden waren.
Trotz des Aufwands, der beim Bau der Villa in Jerusalem getrieben wurde, wohnte die Familie Schocken nicht lange dort. 1940 zog sie nach New York und ließ sich dort nieder. Das war auch das Schicksal der „Zypressen“: Van Goghs Meisterwerk wurde 1949 ans Metropolitan Museum of Art verkauft, wo es bis heute eines der beliebtesten Ausstellungsstücke ist.
Die Autorin dankt Racheli Edelman für die Erlaubnis, im Schocken-Archiv zu recherchieren, außerdem den Mitarbeiter*innen des Archivs für ihre Unterstützung. Besonderer Dank gilt Caroline Jessen.
van Gogh, and Paul Cézanne. As other collectors sold their holdings due to the economic downturn, Schocken bought at auction, privately, and from art dealers. From the June 1931 auction of works owned by Max Emden, the proprietor of a large chain of department stores, Schocken acquired his first Van Gogh painting, On the Outskirts of Paris , 1887. In March 1932, he bought a major Cézanne landscape from Max Silberberg, Jas de Bouffan, 1890–94, which had been prominently featured in an article on this famous Breslau collection that appeared in Kunst und Künstler in 1931. Schocken’s most spectacular acquisition was Van Gogh’s Cypresses (1889), bought together with another Cézanne and a work by Marc Chagall from the dealer Justin Thannhauser in December 1931.
After Schocken and his family departed Germany for Palestine in late 1933, and, in 1936, settled into the Jerusalem villa commissioned from Erich Mendelsohn, the modern paintings entered a new physical and cultural context. Mendelsohn chose locations for the most important paintings and designed the spaces with them in mind, including the interiors’ final finishes, such as the colors of the walls and floors. This approach is epitomized in the dramatic installation of Van Gogh’s Cypresses , which was hung, unframed, embedded within a specially designed niche in the reception room (see page 72). The other walls in the room remained bare, and the placement of the Mendelsohn-designed furniture created a corridor within the room itself that directed one to the painting. The exterior wall was pierced by a sequence of tall rectangular windows that echo the flamelike verticality of the two cypresses in Van Gogh’s composition. From the windows one would have glimpsed the garden, which was also planted with cypress trees.
Despite the care lavished on creating the Jerusalem villa, the family’s residence there was short-lived. The Schockens went to New York in 1940 and ended up settling there, as did the Cypresses . Van Gogh’s masterpiece was sold to the Metropolitan Museum of Art in 1949, where it remains a most beloved work.
My thanks to Racheli Edelman for permission to research in the Schocken Archive, to the Archive’s staff for all their assistance, and to Caroline Jessen.
Emily D. Bilski ist Kunsthistorikerin. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf moderner und zeitgenössischer Kunst sowie auf der Schnittstelle zwischen Kunst, Kulturgeschichte und jüdischer Erfahrung. Sie arbeitet als Kuratorin und Beraterin für Museen in den USA, Europa und Israel.
Emily D. Bilski is an art historian specializing in modern and contemporary art, and in the interface between art, cultural history and the Jewish experience. She works as a curator and advisor for museums in the United States, Europe, and Israel.
Text Thomas Sparr
Die Geschichte des Jüdischen Verlags – heute der Jüdische Verlag im Suhrkamp Verlag – von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart stellt selbst ein Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte dar: 1901 in Basel initiiert und 1902 in Berlin gegründet, gehen seine Anfänge zurück in die stolze Selbstbehauptung deutscher Jüdinnen und Juden im Kaiserreich. Die Verlagsgründer, Martin Buber und Ahron Eliasberg, später zudem Siegmund Kaznelson, wollten Neues, nämlich durch „jüdische Inhalte eine ‚neue jüdische Selbstverständlichkeit‘“ schaffen und westliches und östliches Judentum annähern, das heißt: die oft bettelarmen eingewanderten Jüdinnen und Juden aus Osteuropa mit der jüdischen Tradition der „Eingesessenen“ in Deutschland vertraut machen. So lauteten die programmatischen Sätze über das Verlegen –fünf Jahre nachdem Theodor Herzls „Der Judenstaat“ dem großen zionistischen Projekt Gestalt gegeben hatte.
DE In den 1920er-Jahren erschienen im Jüdischen Verlag Standardwerke wie das fünfbändige „Jüdische Lexikon“, die zwölfbändige Übersetzung des Babylonischen Talmuds von Lazarus Goldschmidt, Werke von Moses Mendelssohn, Scholem Alejchem, Franz Rosenzweig und vielen anderen. Die neue jüdische Selbstverständlichkeit bedeutete, dass ein ganzes Themenspektrum jüdischer Autoren und Autorinnen erschien – und jüdische Leserinnen und Leser fand.

Signet des Jüdischen Verlags von E. M. Lilien, 1909 Signet of the publishing house Jüdischer Verlag, by E. M. Lilien, 1909
Verleihung des Literaturnobelpreises 1966 in Stockholm an Nelly Sachs (auf der Bühne) und Samuel Joseph Agnon (Mitte). Links applaudiert König Gustav Adolf von Schweden. Awarding of the Nobel Prize in Literature 1966 in Stockholm to Nelly Sachs (on stage) and Samuel Joseph Agnon (center). King Gustav Adolf of Sweden applauds on the left.
Extending from the early twentieth century to the present day, the history of the Jüdischer Verlag (Jewish Publishing House, now the Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag) represents a distinct chapter in German-Jewish history. Conceived in Basel in 1901 and formally founded in Berlin in 1902, the publishing house had its roots in a period when Jews were proudly asserting their identity in the German Empire. Its founders—Martin Buber and Ahron Eliasberg, later joined by Siegmund Kaznelson—sought to create something new: to foster, through “Jewish content,” a “new Jewish identity” and bring Western and Eastern Jewry closer together. This involved acquainting the often destitute Jewish immigrants from Eastern Europe with the Jewish traditions of the long-established communities in Germany. These goals formed the guiding principles of the publishing house, formulated five years after Theodor Herzl’s The Jewish State outlined the great Zionist project.
EN In the 1920s, the Jüdischer Verlag published standard works such as the five-volume Jüdische Lexikon (Jewish Encyclopedia), the twelve-volume translation of the Babylonian Talmud by Lazarus Goldschmidt, and works by Moses Mendelssohn, Sholem Aleichem, Franz Rosenzweig, and others. The new Jewish identity was reflected in the wide range of Jewish authors published, whose works now reached a Jewish readership.
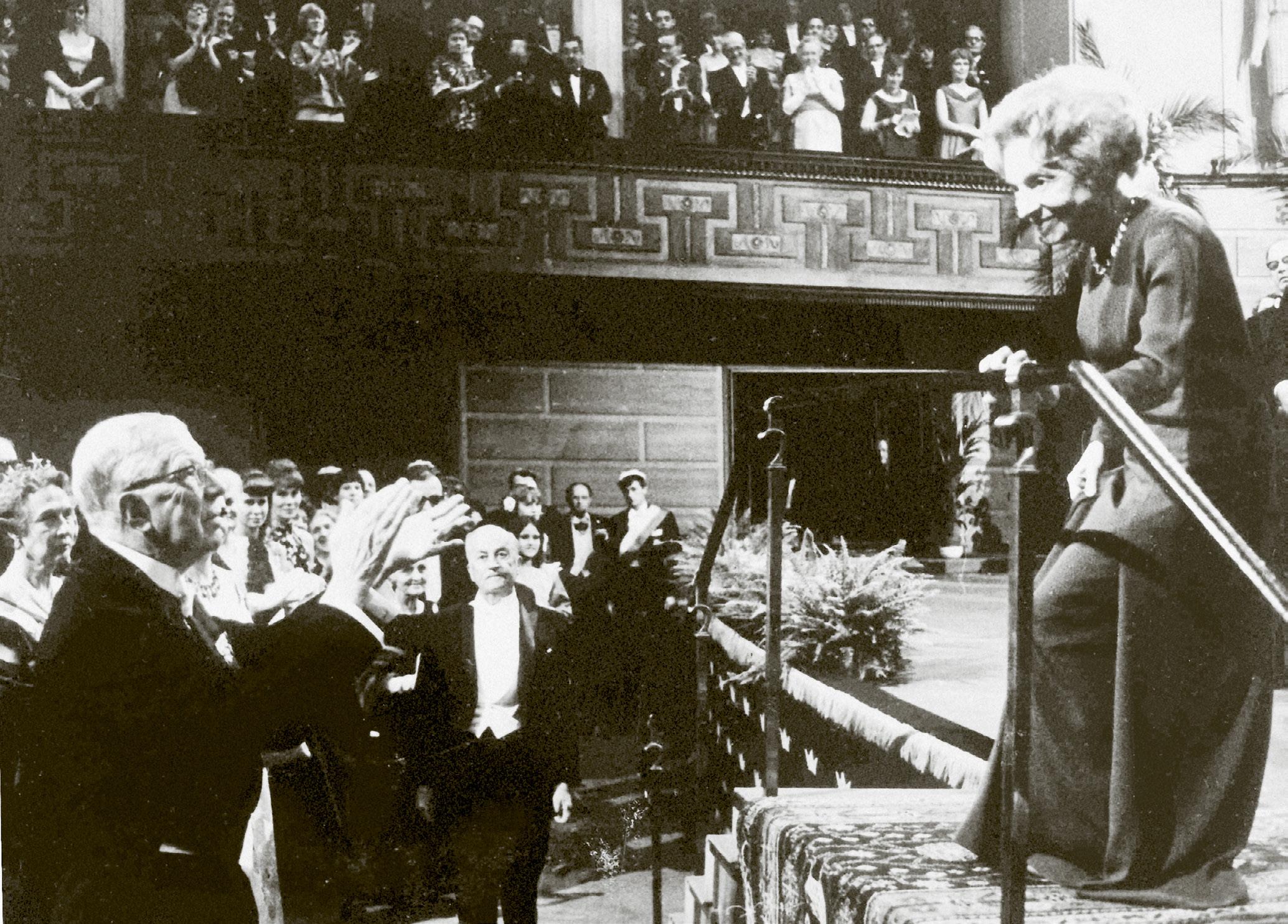
Nach dem Grauen der zwölf Jahre von 1933 bis 1945 verstand sich nichts mehr von selbst. Siegmund Kaznelson gab 1959 eine „abschließende Anthologie“ unter dem Titel „Jüdisches Schicksal in deutschen Gedichten“ heraus. Jüdische Schriftsteller und Schriftstellerinnen, so sagte er voraus, würden fortan nicht mehr auf Deutsch schreiben.
Es ist anders gekommen. Jüdinnen und Juden schrieben und schreiben weiterhin auf Deutsch. Nelly Sachs und Jurek Becker, Barbara Honigmann, Doron Rabinovici oder eine junge Autorin wie Dana Vowinckel. Allerdings wollen die meisten jüdischen Autor*innen der Gegenwart mit ihren Büchern nicht im Jüdischen Verlag erscheinen. Das scheint ihnen zu festgelegt, thematisch eingegrenzt. „Wozu ein Jüdischer Verlag?“ hatte das Berliner Tageblatt schon 1903 angesichts seines ersten Programms gefragt und den Verlag einen „Anachronismus“ genannt.
Die Antwort auf das Wozu geben die Bücher
Siegfried Unseld begründete, zusammen mit Ignatz Bubis und Walter Hesselbach, den Jüdischen Verlag 1990 neu im Suhrkamp Verlag. Sie bewahrten ihn und seine Tradition vor dem drohenden Konkurs im damaligen Athenäum Verlag. Die sieben Bücher des ersten Programms zeigten so etwas wie die Linien des Verlags: Gershom Scholems „Sabbatai Zwi“, eine umfangreiche Biographie des jüdischen Messias, James Youngs „Beschreiben des Holocaust“ (im
After the horrors of the twelve-year period between 1933 and 1945, the world was stripped of all certainty. In 1959, Siegmund Kaznelson published a “final anthology” titled the Jüdisches Schicksal in deutschen Gedichten (Jewish Fate in German Poetry). He predicted that Jewish writers would no longer write in German.
But things turned out differently. Jewish authors—both men and women—wrote, and continue to write, in German. Among them were Nelly Sachs, Jurek Becker, Barbara Honigmann, Doron Rabinovici, and younger voices such as Dana Vowinckel. Yet most contemporary Jewish writers prefer not to have their books published by a Jewish publishing house. They find the label too rigid and thematically limiting. “What’s the justification for a Jewish publishing house?” asked the Berliner Tageblatt as early as 1903, in response to the Jüdischer Verlag’s first publishing list. The newspaper called the venture an “anachronism.”
The Answer to the “Why” Was Provided by Books Together with Ignatz Bubis and Walter Hesselbach, Siegfried Unseld reestablished the Jüdischer Verlag in 1990 as an imprint of Suhrkamp, thereby saving the publishing house and its tradition from impending bankruptcy as part of the former Athenäum Verlag.
The seven titles in its inaugural publishing list give a sense of its editorial focus. They included Gershom Scholem’s
Original: „Writing and Rewriting the Holocaust“), der erste umfassende Versuch, das Erzählen des Holocaust in der Literatur, in Filmen wie der Architektur von Gedenkstätten darzustellen. Gert Mattenklott schrieb über Jüdinnen und Juden in Deutschland anhand ihrer reichen Briefkultur. Abraham Sutzkever veröffentlichte sein erstes Buch auf Jiddisch und Deutsch: „Griner Akawarium – Grünes Aquarium“. Und dieses erste Programm brachte im Februar 1992 „Jüdische Lebenswelten“ heraus, einen Katalog und Essayband über die gleichnamige Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, die Hunderttausende von Besucher*innen anlockte. Die große Neugier galt den nicht nur den Ausstellungsstücken, sondern den Büchern gleichermaßen. Die Menschen hatten Wissensdurst, der schließlich auch gestillt wurde.
Vor rund 35 Jahren gab es so etwas wie Jüdische Studien in Deutschland nur im Ansatz. Es galt Anschluss zu finden an den internationalen Standard in den USA, Israel und in Frankreich. Vieles wurde übersetzt. Es galt, Bücher über jüdische Themen einem überwiegend nichtjüdischen Publikum zu vermitteln. Der Jüdische Verlag brachte eine Reihe von Städtebildern heraus, die mit der jüdischen Geschichte Amsterdams, Berlins, Hamburgs, Prags, Krakaus oder Frankfurts vertraut machten.
In den darauffolgenden Jahren bauten andere Verlage ihre Judaica-Reihen systematisch auf, der Verlag C.H. Beck, S. Fischer, später der Wallstein Verlag. DuMont brachte einen gewichtigen Band über „Jüdische Reisen“ heraus und ergänzte so sein Sortiment. Gerhard Hentrich hatte die Reihe „Jüdische Memoiren“ begründet. Heute veröffentlicht Nora Pester im Verlag Hentrich & Hentrich ausschließlich Bücher zu jüdischen Themen.
Die moderne hebräische Literatur wurde in den 1990er-Jahren entdeckt, und eine Generation vorzüglicher Übersetzer*innen wie Ruth Achlama, Anne Birkenhauer, Markus Lemke, Gundula Schiffer, um nur einige zu nennen, machte das deutsche Publikum mit den Büchern von Amos Oz, Zeruya Shalev, David Grossman, Jehuda Amichai, Jehoshua Kenaz, mit den Gedichten von Dan Pagis, Tuvia Rübner und David Rokeah und anderen vertraut. Weltliteratur und jüdische Literatur in einem. Hinzu kommen die Klassiker wie Chaim Nachman Bialik, Saul Tschernichowski und S. J. Agnon, der als bislang einziger israelischer Autor 1966 mit dem Literaturnobelpreis bedacht wurde. Er teilte ihn mit der Lyrikerin Nelly Sachs.
Im Verlegen jüdischer Dichter steckt ein enzyklopädischer Impuls des Sammelns und Sichtens, des Weitergebens, ein Impuls, den Salman Schocken mit seiner Bücherei vor-
Sabbatai Zwi, an extensive biography of the self-proclaimed Jewish messiah; James Young’s Beschreiben des Holocaust (Writing and Rewriting the Holocaust), the first comprehensive analysis of how Holocaust narratives have been constructed in literature, film, and even memorial architecture; Gert Mattenklott’s study of Jews in Germany through the lens of their rich letter-writing culture; and Abraham Sutzkever’s Griner Akawarium—Grünes Aquarium (Green Aquarium), the author’s first bilingual edition in Yiddish and German. In February 1992, the list was expanded to include Jüdische Lebenswelten (Jewish Worlds), a catalog and essay collection accompanying the exhibition of the same name at the Martin-Gropius-Bau, which drew hundreds of thousands of visitors. Interest focused not only on the exhibition itself but also on these books. People had a thirst for knowledge that was finally being satisfied.
About thirty-five years ago, Jewish studies in Germany was still in its initial phase and needed to catch up with the international standards observed in the United States, Israel, and France. Many works were translated into German to make Jewish topics accessible to a largely non-Jewish audience. The Jüdischer Verlag published a series of city portraits that presented the Jewish history of Amsterdam, Berlin, Hamburg, Prague, Kraków, and Frankfurt.
In the years that followed, other publishers systematically expanded their Judaica series, among them C.H. Beck, S. Fischer, and later Wallstein. DuMont brought out the notable volume Jüdische Reisen (Jewish Travels), Gerhard Hentrich launched the Jüdische Memoiren (Jewish Memoirs) series, and today Nora Pester continues this focus by publishing works devoted exclusively to Jewish topics with Hentrich & Hentrich.
Modern Hebrew literature became popular in the 1990s, when a generation of outstanding translators—including Ruth Achlama, Anne Birkenhauer, Markus Lemke, and Gundula Schiffer—introduced German readers to the works of Amos Oz, Zeruya Shalev, David Grossman, Yehuda Amichai, and Jehoshua Kenaz, as well as to the poetry of Dan Pagis, Tuvia Rübner, and David Rokeah. These authors embodied both world literature and Jewish literature. Attention also turned to classic authors such as Chaim Nachman Bialik, Saul Tschernichowski, and S. Y. Agnon. To this day, Agnon remains the only Israeli writer to have received the Nobel Prize in Literature (1966), which he shared with the poet Nelly Sachs.
The publication of Jewish poets was driven by an encyclopedic impulse to collect, preserve, and transmit— an impulse first exemplified by Salman Schocken and his
gegeben hat. Dem „suchenden Leser unserer Tage“ wollte er eine Tradition nahebringen, die jüdischen Zeitgenossen damals oft vollkommen unbekannt war, die eigene jüdische.
Nach der Jahrtausendwende kommt Entscheidendes hinzu
Es ging in den letzten Jahrzehnten und geht heute um die Rekonstruktion einer zerstörten Tradition, um oft mühsam geborgene Schriften wie das Ringelblum-Archiv, eine Chronik des Alltags im Warschauer Ghetto, Aufzeichnungen aus den Konzentrationslagern, um vergessene Lebenserinnerungen, die Geschichte des Antisemitismus – und dessen Gegenwart. Reihenwerke haben es heute im Buchhandel schwerer. Die suchenden Leser*innen unserer Tage wollen rascher, punktueller Bücher entdecken. Die Lesegeschwindigkeit hat zugenommen, die Geduld nimmt ab. Das Verlegen jüdischer Bücher muss heute einer fordernden, sich rasch verändernden Wirklichkeit gerecht werden, die Themen vorgeben. Die ganze Buchwelt steht vor dieser Herausforderung. Carlo Strengers meisterhaftes Buch „Israel – Einführung in ein schwieriges Land“ hat viele Leser*innen gefunden, der von Gisela Dachs herausgegebene Jüdische Almanach entsteht im Leo Baeck Institute, Jerusalem und machte im letzten Jahr „Stimmen aus Israel“ nach dem 7. Oktober bekannt. Der Rapper Ben Salomo beschreibt in seinem gerade erschienenen Buch „Sechs Millionen, wer bietet mehr?“, wie der Hass auf Jüdinnen und Juden in deutschen Schulen beschaffen ist und was wir gegen ihn stellen können. Lesen wäre eine gute Idee!
Bücherei series. Schocken sought to acquaint the “inquiring readers” of his day with a tradition often almost entirely unknown to many Jews themselves: their Jewish heritage.
A Decisive Development Began After the Turn of the Millennium

In recent decades, publishers have sought to reconstruct a destroyed tradition, focusing on records from concentration camps, long-forgotten memoirs, the history of antisemitism and its persistence into the present, as well as works recovered only with great effort—for example, materials from the Ringelblum Archive, which document everyday life in the Warsaw Ghetto. Today, it has become more difficult to market book series in bookstores. “Inquiring readers” discover books more quickly and selectively, read faster, and have less patience. Publishers of Jewish books must respond to the demands of a rapidly changing world that seeks to dictate the topics–a challenge faced by the entire publishing industry. Carlo Strenger’s masterful work Israel—Einführung in ein schwieriges Land (Israel. Introduction to a Difficult Country) has found a wide readership, and, after the attacks of 7 October, the Jüdische Almanach (Jewish Almanach), edited by Gisela Dachs and published by the Leo Baeck Institute in Jerusalem, presented a wide range of “voices from Israel” to a German audience. In his recently published book Sechs Millionen, wer bietet mehr? (Six Million—Who Bids More?), rapper Ben Salomo describes antisemitism in German schools and explains what can be done to combat it. Reading would be a step in the right direction!
Thomas Sparr leitete den Jüdischen Verlag im Suhrkamp Verlag von 1990 bis 1998, war Cheflektor des Siedler Verlags und arbeitet heute als Editor-at-Large des Suhrkamp Verlags und als Schriftsteller. Von ihm erschienen zuletzt: ;„Ich will fortleben, auch nach meinem Tod.‘ Die Biographie des Tagebuchs der Anne Frank“ (2023) und „Zauberberge. Ein Jahrhundertroman aus Davos“ (2024).
Thomas Sparr directed the Jüdischer Verlag im Suhkamp Verlag from 1990 to 1998, later served as chief editor at Siedler, and is now editor-at-large for Suhrkamp. His most recent publications as author are “Ich will fortleben, auch nach meinem Tod”: Die Biographie des Tagebuchs der Anne Frank (2023) and Zauberberge: Ein Jahrhundertroman aus Davos (2024).
Barbara Thiele ist seit Juni 2024 Direktorin für Vermittlung und Digitales am Jüdischen Museum Berlin. Sie verantwortet das Bildungs- und Veranstaltungsprogramm des JMB und die Kinderwelt ANOHA sowie die digitale Transformation und die Besucherforschung. Als Leiterin des Bereichs Digital & Publishing entwickelte sie seit 2016 mit ihrem Team die Webseiten, zahlreiche Publikationen sowie vielfältige digitale Bildungsangebote. Since June 2024, Barbara Thiele has served as Director of Education and Digital Engagement at the Jewish Museum Berlin. She oversees the museum’s education and events program, the ANOHA Children’s World, digital transformation, and visitor research. In 2016, she was appointed Head of Digital & Publishing, where she and her team were responsible for developing and implementing the museum’s websites, along with numerous publications and digital education initiatives.
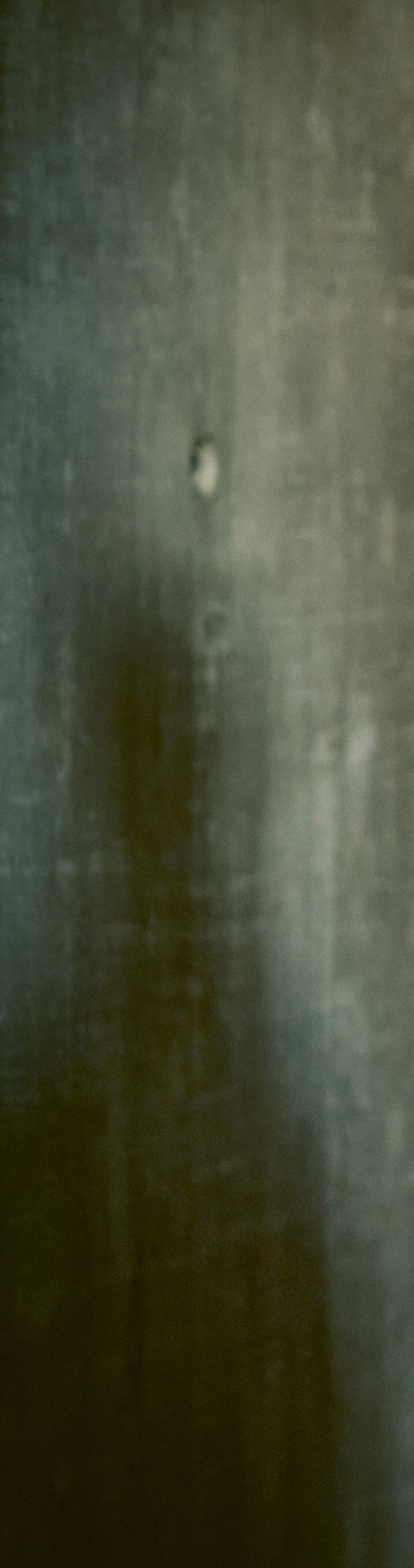

Liebe Barbara, als Direktorin für Vermittlung und Digitales bist Du für so diverse Abteilungen zuständig wie die Bildung, die Kinderwelt ANOHA, die Akademie des JMB, das Veranstaltungsmanagement sowie für die Besucherforschung, auch Digital & Publishing gehört dazu. Welche Vorteile birgt dieser neu geschaffene Verantwortungsbereich?
Zum ersten Mal sind alle Bereiche, die sich neben den Ausstellungen mit der Vermittlung unserer Themen beschäftigen, die also ganz nahe an den Besucher*innen sind, in einem Direktionsstrang vereinigt. Ein Ziel der Neuorganisation ist auch die strukturelle Verbindung der programmgestaltenden mit den beiden organisatorischen Bereichen Veranstaltungsmanagement und Visitor Experience & Research, das bringt wichtige
Umgang mit der Digitalisierung. Die Ansiedlung der digitalen Transformation in der Direktion ist dafür ein entscheidender Schritt: Sie ermöglicht uns, analoge und digitale Vermittlung konsequent zusammenzuführen und die Museumsarbeit nachhaltig und wirksam weiterzuentwickeln. Dadurch können wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen Zugänge zum Museum schaffen und Menschen auch weit über den Standort Berlin hinaus erreichen.
Welchen gesellschaftlichen Beitrag kann die Akademie des JMB mit ihren Programmen in diesen politisch unruhigen Zeiten leisten?
Ziel der Akademie ist es, jüdische Kultur in Geschichte und Gegenwart in Deutschland zu reflektieren. Dabei sind unterschiedliche und auch widersprüchliche Perspektiven erlaubt – und
und widersprüchliche Perspektiven sind notwendig!
Synergien! Gerade arbeiten wir beispielsweise an einer bereichsübergreifenden Bildungs- und Vermittlungsstrategie. Unser Ziel ist es, durch möglichst vielfältige zielgruppenspezifische Programme eine breite gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Zudem geht es um die Weiterentwicklung unseres Outreach-Angebots, die Nachhaltigkeit unserer Angebote und den

As Director of Education and Digital Engagement, you’re responsible for a wide range of departments, including Education, the ANOHA Children’s World, the JMB Academy, Event Management, and Visitor Experience & Research. Digital & Publishing also falls under your remit. What opportunities does this newly created position offer?
For the first time, all of the museum’s departments that present our themes alongside the exhibitions and are in close contact with visitors have been brought together under a single director. The reorganization is intended to create structural links between the program development departments and the two organizational units: Event Management and Visitor Experience & Research. This generates significant new synergies. We are now developing a cross-departmental education and engagement strategy to foster broad social participation through a diverse range of audience-specific programs. Other priorities include outreach development, program sustainability, and approaches to digitization. Assigning responsibility for
the strategic field of digital transformation to the directorate has been a crucial step, as it enables us to systematically integrate analog and digital formats and to continue developing the JMB’s work in a sustainable and effective way. In doing so, we can expand access to the museum on multiple levels—and reach people far beyond Berlin.
In these politically turbulent times, how can the JMB Academy contribute to society through its programs?
für eine pluralistische und demokratische Gesellschaft auch notwendig! Mit den Akademie-Programmen ergänzen wir aktuelle Debatten um ihre historische Dimension, zum Beispiel in der neuen Digital Lecture Series. Stichwort digitale Transformation: Die Digital Lectures können, wie viele Veranstaltungen, auf unserer Website

The academy’s mission is to explore Jewish culture in Germany, past and present. It welcomes diverse—even contradictory—perspectives, which it regards as essential for a pluralistic, democratic society. Its programs, including the new Digital Lecture Series, provide historical context for today’s debates. As part of our broader digital transformation, the digital lectures—like many of our events—can be viewed on our website. Yet the academy’s activities extend beyond panel discussions: it also hosts exhibition-related events, the Cultural Summer, Jazz in the Garden, the
Inclusion and participation are priorities at the JMB and naturally play an important role in our daily work.
angeschaut werden. Zu den Akademie-Programmen zählen allerdings nicht nur ernste Diskussionsrunden: die Veranstaltungen rund um Ausstellungen, der Kultursommer, Jazz in the Garden und das jährliche Familienfest gehören ebenso dazu wie zum Beispiel die regelmäßigen Buchclubs der Bibliothek.
Welche unterschiedlichen Bildungsformate sind nötig, um die diversen Zielgruppen des Museums zu erreichen?
Inklusion und Teilhabe ist im JMB ein Querschnittsthema und gehört für uns zum selbstverständlichen Teil unserer täglichen Arbeit. Auf der einen Seite versuchen wir, Angebote zu entwickeln, die möglichst barrierefrei sind und von vielen Menschen genutzt werden können. Andererseits ist es wichtig, bestimmte Zielgruppen fokussiert zu adressieren, um ihnen Partizipation zu ermöglichen. Dazu gehören konkrete Angebote für Menschen mit Hör- oder Seh-


Schüler*innen bleiben für uns eine der Hauptzielgruppen; wir entwickeln unser Führungs- und WorkshopProgramm stetig weiter, und die interaktive Tour „Junge Perspektiven“ in der JMB App begleitet seit Kurzem gezielt Jugendliche durch unsere Dauerausstellung. Bei der Konzeption aller Angebote steht für mich die Einbindung der entsprechenden Zielgruppe an vorderster Stelle – so haben wir beispielsweise bei der Entwicklung unseres digitalen Klassenraums JMB di.kla mit einem Lehrkräfte-Beirat gearbeitet. Genauso wichtig ist mir eine stetige Evaluation und Anpassung unserer Programme. Nur so bleiben wir als Museum relevant!
Die Kinderwelt ANOHA verzichtet weitgehend auf mediale Anwendungen. Weshalb?
Digitale Transformation ist für uns kein Selbstzweck! Wir setzen digitale Formate
Digitale Transformation ist für uns kein Selbstzweck.
beeinträchtigungen durch Gebärdensprachevideos, Tastmodelle und deskriptive Audios genauso wie Inhalte in Leichter Sprache und digitale Angebote, die von Screenreadern gelesen werden können. Mit „Bilder machen Leute“ haben wir zudem ein Angebot für Menschen mit Demenz etabliert.
bewusst nur dann ein, wenn sie die Inhalte sinnvoll ergänzen und bereichern. Die Kinderwelt ANOHA ist eines der erfolgreichsten Audience Development Projekte in der internationalen Museumslandschaft und wer schon einmal dort war, versteht schnell, warum wir dort mediale Anwendungen sehr
annual Family Festival, and the library’s regular book clubs.
What different educational programs are needed to reach the museum’s diverse target groups?
Inclusion and participation are cross-departmental priorities at the JMB and naturally play an important role in our daily work. We are committed to developing programs that are as accessible as possible and can be used by a broad audience. At the same time, we ad-

is the active involvement of the target groups themselves. For example, when developing the digital classroom JMB di.kla , we worked closely with a teachers’ advisory board. Just as essential, in my view, is the ongoing evaluation and adaptation of our programs—the only way for a museum to remain relevant.
The ANOHA Children’s World makes use of hardly any media applications—why?
Digital transformation is not about technology for its own sake.

dress specific target groups to ensure their participation. For visitors with hearing or visual impairments, we provide resources such as sign language videos, tactile models, audio descriptions, and digital formats compatible with screen readers. We offer content in Simple Language and have created a dedicated program for people with dementia called “Pictures Make People.” School students are one of our key audiences. We continue to expand our program of guided tours and workshops, and our appbased “Young Perspectives” tour now enables young visitors to explore the core exhibition interactively. Across all our programs, a central focus
Digital transformation is not about technology for its own sake. We deliberately use digital formats only when they meaningfully complement and enrich our content. ANOHA is one of the most successful audience development projects in the international museum landscape, and anyone who visits quickly sees why so few media applications are used there. From the moment they enter, children embark on a journey of discovery. They experience the story of Noah’s Ark in a playful, immersive way, engaging in dialogue with our communicators. They can ask a wide range of questions—about nature, environment, religion, diversity, and identity. Children aged seven to ten can explore Listen Up! ,
reduziert nutzen. Im ANOHA beginnen Kinder sofort mit dem Erkunden, sie begegnen der Geschichte der Arche Noah spielerisch und immersiv im Gespräch mit unseren Kommunikator*innen – dazu gehören auch viele Fragen zu Natur und Umwelt, Religion, Vielfalt und Identität. Sieben- bis Zehnjährige können mit „Lauscher auf!“ ein mediales Suchspiel nutzen, das allerdings fast ausschließlich auf Hörstücke reduziert ist. Unsere Erfahrung zeigt: Auch ältere Kinder springen noch gerne in die Pfützen im Regentunnel, entdecken die Geschichte der Sintflut oder basteln kleine Archen, die sie dann schwimmen lassen können. Und auch ich klettere bei jedem Besuch am liebsten auf die Riesenanakonda – mein persönlicher Lieblingsort im ANOHA.
Wie wichtig ist Dir der Austausch mit anderen Museen und Organisationen?
Der Austausch mit Kolleg*innen aus anderen Museen ist für mich schon immer essenziell. Seit 2021 bin ich Co-Sprecherin der Fachgruppe Digitale Transformation des Berliner Museumsverbands. Wir alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen und versuchen uns bestmöglich gegenseitig zu unterstützen; aktuell diskutieren wir viel zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Museen, Archiven und Erinnerungsorganisationen. Vorreiterin und Impulsgeberin für die Branche war und ist das JMB in Sachen Besucherforschung. Der Bereich Visitor Experience & Research des JMB ist

Mitgründer des Netzwerks Besucher*innenforschung, das sich jährlich in Konferenzen austauscht. Das CommunityProjekt Jewish Places entstand überhaupt erst aus einem Kooperationsgedanken heraus. In den kommenden Jahren möchten wir die Kooperationen mit anderen Institutionen noch vertiefen, denn das Teilen von Wissen und Erfahrungen bereichert unsere Arbeit nachhaltig.
Welche Rolle kann Künstliche Intelligenz in der Aufarbeitung und Vermittlung historischer Erinnerung einnehmen?
Das JMB nutzt Künstliche Intelligenz bereits intensiv, um große Datenmengen zu übersetzen, z.B. bei der englischen Version von Jewish Places oder bei der Untertitelung von Videos. Eine große Chance liegt meines Erachtens auch darin, mittels Text- und Spracherkennung große Mengen an historischen Dokumenten, Fotos, Briefen oder Tonaufnahmen zu analysieren, zu verschlagworten und zugänglich zu machen –auch solche, die vorher schwer lesbar oder kaum erschlossen waren. Wir stoßen im Einsatz von KI aber auch an Grenzen. Bei der Übersetzung des AudioArchivs von Claude Lanzmann mussten wir zum Beispiel feststellen, dass die genutzte KI überfordert war: Sie konnte die vielen verschiedenen Sprachen der Aufnahmen auf alten Ton-Kassetten nicht richtig erfassen. Hier benötigen wir in der Zukunft bessere Datensätze zum Training von großen
a media-based search game based almost entirely on audio stories. Yet our experience shows that even older children enjoy splashing through puddles in the Rain Tunnel, discovering the story of the Flood, and building and launching small arks. When I visit, I always climb onto the giant anaconda—it’s my favorite spot in ANOHA.
How important is the exchange of ideas with other organizations and museums?
For me, exchanging ideas with colleagues from other museums has always been crucial. Since 2021, I have served as co-spokesperson for the Digital Transformation Working Group of the Berlin Museum Association. We all face similar challenges and do our best to support one another. Right now, for instance, we’re discuss-
nity project Jewish Places likewise emerged from this spirit of cooperation. In the coming years, we hope to deepen our collaboration with other institutions, since sharing knowledge and experience sustains and enriches our work.
What role can artificial intelligence play in assessing and communicating history?

The JMB already makes extensive use of artificial intelligence to translate large datasets—for example, in creating the English versions of Jewish Places and for video subtitles. In my view, one of the greatest opportunities lies in using text and speech recognition to analyze, index, and present vast collections of historical documents, photographs, letters, and audio
The JMB has long been—and remains— a pioneer and driving force in visitor research.
ing how artificial intelligence can be used in museums, archives, and other memory institutions.
The JMB has long been— and remains—a pioneer and driving force in visitor research. Our Visitor Experience & Research Department helped found the Visitor Research Network, which meets annually to share insights. The commu-
recordings—including materials that were previously difficult to read or rarely catalogued. At the same time, we are also seeing the limits of AI. When working with Claude Lanzmann’s audio archive, for example, we noticed that the AI in use was overwhelmed by the recordings and unable to accurately process the many languages
Sprachmodellen. In dem Zuge müssen wir uns auch mit dem großen Thema der Datensouveränität befassen. Bei allen Möglichkeiten gilt aber auch: Künstliche Intelligenz kann heute täuschend echte historische Bilder, Dokumente oder andere „Zeitzeugnisse“ generieren und arbeitet dabei nicht ausschließlich mit Fakten, sondern mit Mustern in Daten, die wiederum durch einseitiges Training verzerrt sein können. Als Museum verstehen wir es als unsere Aufgabe, marginalisierte, nicht-dominante Geschichten einzubeziehen. Museen und kulturelle Institutionen können hier als Vermittler*innen und Aufklärer*innen eine Schlüsselrolle einnehmen, indem sie KI-generierte Inhalte immer erklärend einordnen und niemals als „objektive Wahrheit“ präsentieren. Museen tragen hier historische Verantwortung.
Das JMB feiert bald sein 25. Jubiläum. Was wünschst Du dir für die Zukunft des JMB?
Seit 25 Jahren arbeitet hier ein unglaublich kreatives und engagiertes Team daran, jüdische Kultur in Geschichte und Gegenwart aus den unterschiedlichsten Perspektiven für unsere Besucher*innen zugänglich zu machen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir mit unseren Themen weiterhin viele Menschen begeistern und sie zum Nachdenken und zum Austausch anregen können. Denn damit können wir unsere Gesellschaft dabei unterstützen, eine offene und pluralistische Demokratie zu bleiben.
Vielen Dank für das Gespräch!
spoken on the old cassettes. Looking ahead, we will need better datasets to train large language models, and we must also address the important issue of data sovereignty. For all its potential, AI also comes with risks. It can generate deceptively authentic-looking “historical” images, documents, and eyewitness accounts. AI does not rely on facts alone, but on data patterns that may be skewed by one-sided training. In this context, museums and cultural institutions have a key role to play as mediators and educators: they must consistently contextualize AI-generated content and never present it as objective truth. Museums, in particular, have a historical responsibility in this regard.
The JMB will soon celebrate its 25th anniversary. What are your hopes for the JMB in the future?
For twenty-five years, an extraordinarily creative and dedicated team has worked at the museum to present
Jewish culture – past and present – to visitors from many different perspectives. My hope for the future is that our themes will continue to inspire people, encouraging reflection and dialogue. In this way, we can help ensure that our democratic society remains open and pluralistic.
Thank you for the interview!
Das Interview führten / The interview was conducted by Marie Naumann & Katharina Wulffius
jmberlin.de/fuehrungen dikla.jmberlin.de jmberlin.de/akademie jmberlin.de/projekte-zur-sammlung-lanzmann jmberlin.de/en/tours dikla.jmberlin.de/en jmberlin.de/en/academy jmberlin.de/en/projects-related-to-the-lanzmann-collection
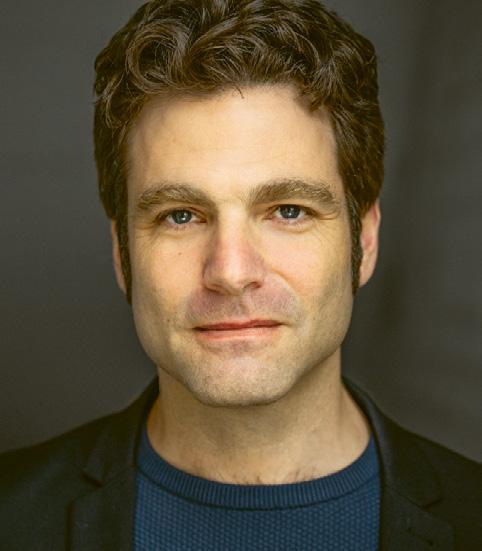

Die Digital Lecture Series des Jüdischen Museums Berlin setzt sich mit dem Denken jüdischer Intellektueller des 19. und 20. Jahrhunderts auseinander: Welche Reflexionen finden sich in ihren Texten, auf die wir angesichts der heutigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zurückgreifen können?
Zeitgenössische Denker*innen aus Wissenschaft und Literatur teilen im Gespräch mit Ofer Waldman, zu welchen historischen Texten sie zurückkehren und wie sie diese für unsere Gegenwart lesen.
Die Lectures finden über Microsoft Teams statt. Das bietet die Möglichkeit der LiveUntertitelung oder -Übersetzung in verschiedene Sprachen, Hinweise dazu folgen in der jeweiligen Veranstaltung. Mitschnitte der Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website. The JMB Digital Lecture Series examines Jewish intellectuals of the nineteenth and twentieth century and asks what answers their work might offer to the current sociopolitical challenges.
In conversation with Ofer Waldman, contemporary thinkers from science and literature share which historical texts they return to and how they read them for our present.
The lectures are held via Microsoft Teams. Microsoft Teams offers the possibility of live subtitling or translation into different languages, information on this will follow in the event. You can find recordings of the events on our website.
16.10.2025 19 Uhr / 7 pm
In englischer Sprache / English Ofer Waldman im Gespräch mit der französisch-israelischen Soziologin Eva Illouz über den Schriftsteller, ehemaligen RésistanceKämpfer und Ausschwitz-Überlebenden Jean Améry (1912–1978). Eva Illouz diskutiert anhand von Amérys Analysen das Spannungsfeld jüdischer Existenz in der Gegenwart, für die weder Zionismus noch die politische Linke oder Rechte als Orientierung, Ausweg oder Trost dienen könne.
Ofer Waldman in conversation with the French-Israeli sociologist Eva Illouz about the writer, Résistance fighter and Auschwitz survivor Jean Améry (1912–1978). Eva Illouz uses Améry’s analyses to discuss the tensions of Jewish existence in the present, for which neither Zionism nor the political left or right can serve as orientation, a way out or consolation.
In deutscher Sprache / German
7pm
In der abschließenden Veranstaltung von „Déjà-vu? Neue Suche nach alten Antworten“ spricht Ofer Waldman mit der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Liliane Weissberg über Moses Mendelssohn und Hannah Arendt, über jüdische Aufklärung, Hoffnungen und Scheitern jüdischer Assimilation. Wie lässt sich mit Arendts kritischen Urteilen auf die Gegenwartsgesellschaft blicken?
In the last event of the series Déjà-vu? A New Search for Old Answers , Ofer Waldman hosts American literary scholar Liliane Weissberg and discusses about Moses Mendelssohn and Hannah Arendt, about Jewish enlightenment, hopes and failures of Jewish assimilation. How can Arendt’s critical judgments be applied to contemporary society?
jmberlin.de/deja-vu
jmberlin.de/en/deja-vu

Im Frühjahr 2026 widmet sich unsere zweite Digitale Lecture Series unter dem Titel „Menschenrechte als letzte Utopie?“ dem Thema Migrationsrecht aus jüdisch-historischer Perspektive.
In spring 2026, our second Digital Lecture Series Human Rights as the last Utopia? will focus on the topic of migration law from a Jewish historical perspective.

JMB di.kla ist ein kostenfreies Online-Lernangebot zu jüdischer Geschichte und Kultur und richtet sich an Schulklassen ab der 7. Jahrgangsstufe. Ohne Anmeldung direkt online verfügbar, bietet JMB di.kla Lehrkräften ein einzigartiges Angebot, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern Schüler*innen zum Mitdenken, Mitmachen und zum Dialog anregt. Das Angebot wächst stetig. Aktuell gibt es fünf Lerneinheiten zu den Themen Purim, Pessach, Hebräisch, Antisemitismus und Jüdische Orte. Diese sind in Deutsch und Englisch verfügbar und lassen sich flexibel in den Unterricht einbinden. Die Themen können sowohl individuell als auch in Kleingruppen bearbeitet werden und bieten neben Material in Schulstundenlänge auch Kurzimpulse zwischen drei und 30 Minuten.
Ab Herbst 2025 erhalten Schulklassen mit der neuen Lerneinheit zu Claude Lanzmanns Audio-Archiv erstmals die Möglichkeit, diesen einzigartigen Bestand historischer Stimmen zur Schoa im Unterricht zu erschließen.
JMB di.kla is a free-of-charge online learning resource on Jewish history and culture, designed for school classes from seventh grade
(age 12) up. It can be accessed online directly, without registration and offers educators a unique resource that brings Jewish themes and present-day experiences to life in an innovative, participatory way, motivating students to think along, join in, and enter into dialogue. Five modules are ready for immediate use, on the topics of Purim, Passover, Hebrew, Antisemitism, and Jewish Places. They are available in German and English, and can be flexibly integrated into teaching—either in individual study or in small groups. They offer material both as 45-minute units and as “mini-lessons” lasting between three and 30 minutes.
Starting this fall, school classes will have the opportunity to explore a unique collection of witness accounts on the Shoah in the classroom for the first time in the new learning module on Claude Lanzmann’s Audio Archive.
Ermöglicht und gefördert durch Made possible and subsidized by

dikla.jmberlin.de dikla.jmberlin.de/en

Eine große Marke setzt nicht nur im Markt Zeichen. W ie wichtig uns der Mensch ist, erkennen Sie nicht nur an unserem Firmenlogo. Der faire und verantwortungsvolle Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern war immer schon ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Diesen Anspruch füllen wir gerne auch außerhalb unserer Werkstore mit Leben. In Stiftungen, zahlreichen Projekten und Partnerschaften machen wir mit Herz und Engagement deutlich, dass wir auch in Zukunft vor allem auf eins setzen: den Menschen.
231221_DOE_Anzeigen_KC_RZ_V3.indd 2
Impressum Credits
© 2025, Stiftung Jüdisches Museum Berlin
Herausgeberin / Publisher: Stiftung Jüdisches Museum Berlin
Direktorin / Director: Hetty Berg
Redaktion / Editors: Marie Naumann, Katharina Wulffius
E-Mail: publikationen@jmberlin.de
Wir danken Joshua Cohen für die Bereitstellung seiner Texte (S. 11–27). Sie entstanden exklusiv für die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ (kuratiert von Martina Lüdicke und Monika Sommerer), die vom 20. Mai bis 12. Oktober 2025 im Jüdischen Museum Berlin zu sehen war, und werden vom Jüdischen Museum Berlin erstmals veröffentlicht.
Many thanks to Joshua Cohen for providing his texts (pp. 11–27). They were written exclusively for the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken (curated by Martina Lüdicke and Monika Sommerer), which was on display at the Jewish Museum Berlin from 20 May to 12 October 2025, and are published by the Jewish Museum Berlin for the first time.
Übersetzungen ins Englische / English Translations: Adam Blauhut (S./pp. 28–35, 78–81), Allison Brown (S./pp. 6–9, 46–60, 82–87)
Übersetzungen ins Deutsche / German Translations: Jan Wilm (S./pp. 11–27), Stefan Ripplinger (S. /pp. 36–44, 62–69, 72–77)
Layout: Eggers + Diaper, Aachen Lithografie / Lithography: Michaela Müller, bildpunkt Druckvorstufen GmbH, Berlin Druck / printed by: Druckhaus Sportflieger, Berlin
Wir danken allen Autor*innen und Mitwirkenden. Besonderer Dank geht an Dani Hacker vom Schocken Institute, Jerusalem, für die Bereitstellung zahlreicher Bilddateien. With many thanks to all authors and staff. Special thanks go to Dani Hacker from The Schocken Institute Jerusalem, for providing numerous image files.
ISSN: 2195-7002
Gefördert durch / Sponsored by
Stiftung Jüdisches Museum Berlin Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin Tel.: +49 (0)30 25993 300 www.jmberlin.de info@jmberlin.de
Falls Rechte (auch) bei anderen liegen sollten, werden die Inhaber*innen gebeten, sich zu melden. / Should rights (also) lie with others, please inform the publisher.
Bildnachweis Copyright
Cover: Collage verschiedener SchockenWarenhäuser / Collage of Schocken department stores (ca. 1930); The Schocken Archive Photo Collection, JTS Schocken Institute
Gestaltung der Ausstellung / Exhibition Design (S./pp. 7–9), Objekt-Icons / Object Icons (S./pp. 11–27): e.o.t. Berlin –Lilla Hinrichs & Anna Sartorius
S./p. 3: JMB, photo: Yves Sucksdorff
S./pp. 5 oben/top & unten/bottom, 7–9, 11, 14, 16, 18 unten/bottom, 19 Mitte/middle, 22, 23, 33, 62: JMB, Photo: Roman März
S./pp. 4, 5 zweites von oben / second from top, 10, 28, 30, 31, 46/47, 50, 54/55, 57, 59, 72/73: The Schocken Archive Photo Collection, JTS Schocken Institute
S./p. 13, 17, 18 oben/top, 19 oben/top, 19 unten/bottom, 24, 64, 68: JMB
S./p. 20: JMB, Schenkung von / Gift of Sidney L. Kroner, Photo: Roman März
S./p. 21: JMB, Schenkung von / Gift of Eleonore Engler, Photo: Roman März
S./p. 27: JMB, Schenkung von / Gift of Roberto Bona, Goslar, Photo: JMB
S./p. 5 zweites von unten/ second from bottom, 37: JMB, Photo: Jule Roehr
S./p. 48: bpk /Kunstbibliothek, SMB
S./p. 49: bpk / Kunstbibliothek, SMB / Dietmar Katz
S./p. 51: CC BY-SA 4.0
S./p. 52: Laurence Chaperon (links/left), Weizmann Institute of Science (rechts/right)
21.12.23 14:56
S./p. 61: JMB, Photo: Johanna Brandt
S./p. 67: JMB, Photo: Herbert Sonnenfeld, Ankauf aus Mitteln der / Purchased with funds from Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
S./p. 70: JMB, Schenkung von / Gift of Association Claude et Felix Lanzmann, Photo: Roman März
S./p. 75: bpk / Staatsgalerie Stuttgart
S./p. 76: The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1949; 49.30
S./p. 78 gemeinfrei / public domain
S./p. 79 picture alliance
S./p. 81 picture alliance / Sammlung Richter
S./p. 82/83: JMB, Photo: André Wagenzik
S./p. 88: Bernd Brundert (links/left), © Corinna Kern/laif/Suhrkamp Verlag (rechts/right)
S. 89: Gestaltung: VISUAL SPACE AGENCY & STUDIO BENS, Illustrationen: navos create, Berlin








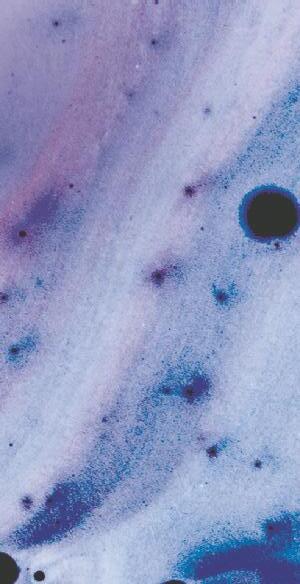



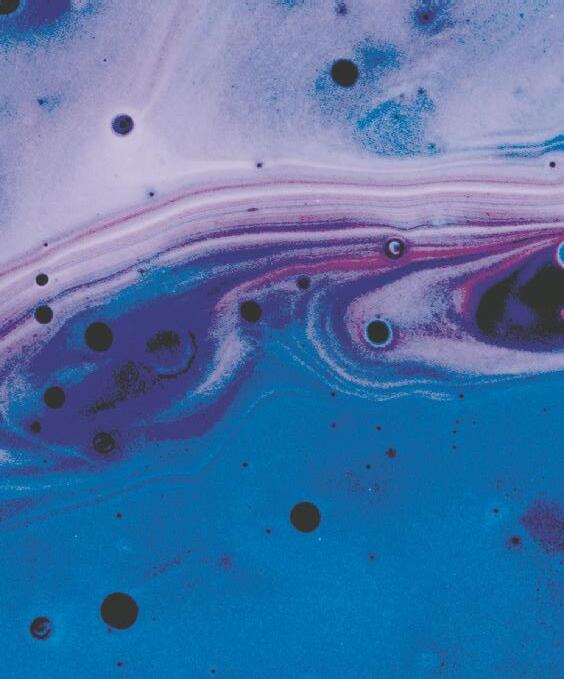
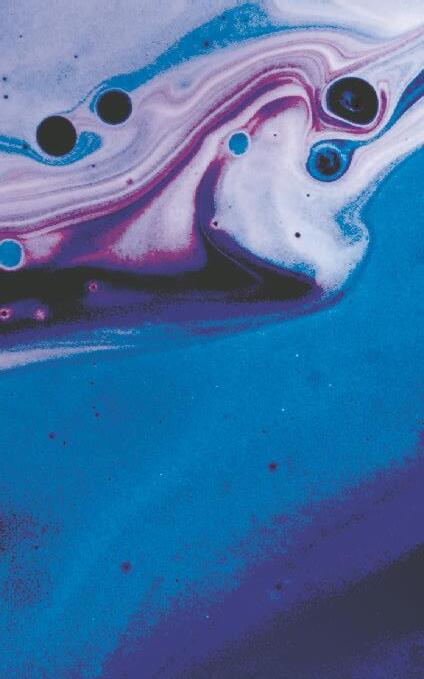

Was die medizinische Forschung heute bewegt, beleuchten wir in unserem Magazin zwei. Jetzt QR-Code scannen und entdecken.
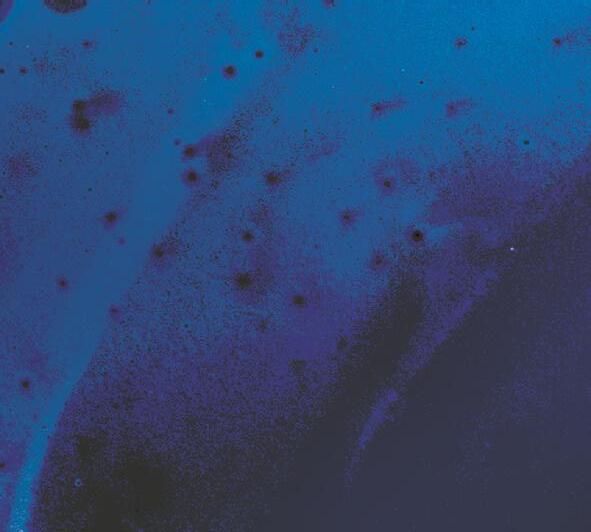


Das Siemens Arts Program kreiert weltweit innovative Plattformen für Kunst und Kultur.
#CreatedToCreate