How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik

How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik
Gathering Yeasts
Maciej Chmara (Chmara.Rosinke)
On sensory mapping, water stories, and listening to landscapes. An interview with Wency Mendes
Ann Mbuti
From Licence to Commitment
Eva Weinmayr
Editorials
Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
Situiert im Globalen.
Kulturwissenschaftliche Naturgeschichten
Karin Harrasser
Gathering Knowledges from the Rubble: Against Scholasticide
Kevin Okoth
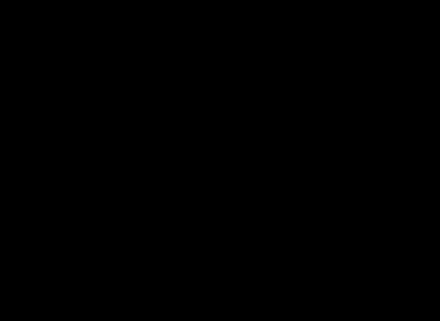
gathering/situating knowledges
Herausgegeben für das HyperWerk am Institut Experimentelles Design und Medienkulturen (IXDM) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW von Matthias Böttger, Ann Mbuti
Mit knowledges von Kenza Benabderrazik, Maciej Chmara (Chmara.Rosinke), Karin Harrasser, Wency Mendes, Kevin Okoth, Eva Weinmayr
Visueller Beitrag
Anna Rosinke (Chmara.Rosinke)
Konzept
Anna Laederach, Ann Mbuti
Lektorat und Korrektorat
Ralf Neubauer, Ann Mbuti
Gestaltung
Anna Laederach, Benedikt Wöppel
Druck merkur, Langenthal (CH)
Papier
Genesis Natural 120g
Schrift
Actual von Fabiola Mejía
Nudles von Anne-Dauphine Borione & Max Lillo
Die Schriftart «Nudles» von Anne-Dauphine Borione & Max Lillo wird mit freundlicher Genehmigung des Kollektivs Bye Bye Binary verwendet. Sie ist freigegeben unter der CUTE Licence (Conditions d’Utilisation Typographiques Engageantes)–einer offenen Schriftlizenz, die den nicht-kommerziellen, gemeinschaftlichen und inklusiven Gebrauch von gendergerechter Typografie fördert.
Mehr Informationen zur Lizenz: https://typotheque.genderfluid.space/ fr/licences
Auflage
300
Wiederverwendung
Anna Rosinke (Chmara.Rosinke) — Ohne Titel (visueller Beitrag) Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe des Beitrags bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Urheber:innen.
Alle anderen Beiträge: Collective Conditions for Reuse (CC4r)
Copyleft with a difference: You are invited to copy, distribute, and modify this work under the terms of the CC4r. https://constantvzw.org/ wefts/cc4r.en.html
Bei Unklarheiten über die Verwendung der einzelnen Beiträge freuen wir uns über eine Nachricht.
Umsetzung des Jahresthemas gathering/situating knowledges in den Themenworkshops: Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
Dank an alle Gäst*innen, die im Studienjahr 2024/25 Themenworkshops zu gathering/situating knowledges gehalten haben (in chronologischer Reihenfolge):
Wency Mendes, Jan Burckhardt und Nils Niederhauser, Ralf Neubauer und Ann Mbuti, Otieno Sumba, Ozan Güngör, Elvira Soliman, Kenza Benabderrazik und Tara Lasrado, Bafta Sarbo und Kevin Okoth, Alexia Thomas, Markus Krajewski, Anina Rana Ritscher, Andreas Heusser, Karin Harrasser, Katarina Petrovi!, Tobéchukwu Onwukeme, Marwa Arsanios, Francisca Khamis Giacoman, tina omayemi reden, Maciej Chmara und Anna Rosinke.
Dank an die Studierenden des BA Prozessgestaltung und des MA Transversal Design, die im Studienjahr 2024/25 an den Themenworkshops teilgenommen und das Thema damit angereichert haben.
Dank und Glückwünsche an alle Prozessgestalter*innen, die 2025 ihre BA-Thesis vorlegen:
Alexia Thomas, Ambre Bork, Basil Huwyler, Ela Blättler, Fynn Martens, Gabi Soliman, Gloria Peña-Triana, Jannis Recher, Jeanne Rosset, Jérémy Ndoum, Johanna Langner, Joshua Buess, Julie Eigenheer, Laura Picker, Lorenz Giertz, Luzia Graf, Malena Schmid, Manuel Schneider, Massimo Pfenninger, Michele Giannini, Nenya Biedermann, Nina Carla Hunziker, Pius Berger, Quentin Yorke, Sarina Böhler, Selva Meyer, Sidonia Gnahoua, Simone Thiel, Timon Essoungou.
Dank an die Mentor:innen und das Team des BA Prozessgestaltung am HyperWerk:
Rasso Auberger, Iyo Bisseck, Matthias Böttger, Sabine Fischer, Ivana Jovi!, Anna Laederach, Florence Le Bègue, Matthias Maurer, Ann Mbuti, Ralf Neubauer, Daniel Nikles, Vanessa Amoah Opoku, Laura Pregger, tina omayemi reden, Martin Schaffner, Paul Schweizer, Martin Sommer, Eva Weinmayr, Gillian Wylde.
HyperWerk ist ein Möglichkeitsraum für neue und unerwartete Formen der Gestaltung. Ein Lernlabor, das mit flexiblen Versuchsanordnungen auf aktuelle Entwicklungen reagiert und experimentell den Wandel seiner eigenen Methoden sucht. Es ist ein Nährboden für transversale Projektarbeit von und mit Student*innen, Mitarbeiter*innen und externen Personen. Als Teil des IXDM versteht es sich als verbindende Grundstruktur für den Bachelorstudiengang Prozessgestaltung und den Masterstudiengang Transversal Design sowie als Seismograph für die oft noch schwachen Signale des gesellschaftlichen Wandels.
HyperWerk, Institut Experimentelles Design und Medienkulturen (IXDM) Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW Freilager-Platz 1, CH-4002 Basel
www.hyperwerk.ch
ISBN 978-3-9525055-6-4
Eva Weinmayr works collaboratively at the interface of art, critical publishing and radical education. Her focus is on decolonial trans* feminist practices, discourses and pedagogies. From 2019 until 2022 she co-led the EU-funded collective research and study programme Teaching to Transgress Toolbox (with erg, Brussels) and co-initiated kritilab, an open-source laboratory for Critical Diversity Literacy at the intersection of art and education. As part of Ecologies of Dissemination (HDK-Valand, PARSE Journal, issue 21), she develops with Femke Snelting decolonial trans*feminist approaches to Open Access.
Dear Reader/Reuser,
Have you noticed the colophon of this publication setting out the specific conditions on how you can reuse the knowledges gathered in this publication?
«Collective Conditions for Reuse» (CC4r)
(Collective Conditions for Reuse 2020) is a document put together by a group of people at and around Constant1 in Brussels to help navigating paradoxes that we encounter when gathering and sharing knowledges.
CC4r states that exclusive ownership over cultural practice cannot be claimed since it has always been collective. Yet we observe frictions when this conviction is brought in conversation with power inequalities and appropriative moves grounded in colonialism, racism,
sexism, classism, among others. (Snelting & Weinmayr 2025)
The student-chosen annual HyperWerk topic gathering/situating knowledges hints at collectivity implicit to communal learning in group work or in seminars where ideas are shared, picked up and built upon. Gathering knowledges makes ideas one’s own, but doesn’t make you own them, as anti-colonial, feminist scholar Katherine McKittrick confirms:
By observing how arranging, rearranging, and collecting ideas outside ourselves are processes that make our ideas our own, I think about how our ideas are bound up in stories, research, inquiries, that we do not (or should not claim we) own.
(McKittrick, 2021: 15)
Yet knowledges are situated, and openness may mean different things in different contexts. Indigenous scholar Leslie Chan, among others, insists that «openness as a concept must […] be rooted in proper and historical and political contexts, otherwise we risk replicating the power inequality and asymmetry that we seek to challenge and replace.» He reminds us that «openness cannot be simply taken for granted or assumed to be universally good, as the notion can just as easily be used as a tool to
dispossess others’ knowledge and to enrich those who are already powerful and wellresourced.» (Chan et al. 2019: 18)
CC4r tries to address this conundrum. When you attach CC4r to a text or piece you produced, you say: dear reuser, you are invited to reuse this piece, but in case your reuse will contribute to oppressive regimes, please refrain. So, CC4r is not a blanket permission but comes with a condition. It supports a shared intellectual practice of not-owning, while requesting to take the implications of reuse into account.
In this light, CC4r is not a legal document, a licence. It rather encourages you to be attentive and to carefully think through the implications of which relations you are creating through your practice of gathering and reusing.
CC4r had itself a collective trajectory: «Collectively Setting Conditions for Reuse» (Mugrefya & Snelting 2022), it has been published on Github in 2020 and then widely used for publications – from self-published zines and flyers to independently published books, PhD theses, academic monographs and edited volumes.
Five years on, it is time to revisit the document. We were not interested in CC4r being
a one-time transactional operation at the end of a collective process, but were looking to support an ongoing decolonial feminist practice of reuse.
In a work session «Revisit Reuse» in Brussels in 2024, a group of participants from different fields and backgrounds made the key shift from condition to commitment. In the new draft version, we read:
The Collective Commitment to Reuse (CC2r) reminds us that cultural practices are made up of relationships rather than (intellectual) property. CC2r is a tool to signal alliance and commitment to decolonial feminist practices of reuse. CC2r is a commitment (i) to share and reuse generously and continuously, (ii) to forgo sharing and reusing if that would mean harmful extraction, and (iii) to build and support a practice of interdependency and solidarity by building a collective ground from where to commit and act.
This shift from licence (the legal bind in conventional intellectual property law) to condition (responsibility), to commitment (solidarity) asks to practice reuse in a way that is always in the making, in need of
experimenting, evaluating, contesting. It is a long-term engagement embedded into every stage of cultural work.
This is urgent. Because Free Licences and Open Access do neither account for the complexity, porosity and multifaceted processes of cultural practice, nor for the power structures at play. The next work session to review and publish CC2r is happening this spring. Probably around the time you hold this publication in your hands, the published «Collective Commitment to Reuse» (CC2r) will be in circulation. Watch out for it.
References
Chan, Leslie; Okune, Angela; Hillyer, Rebecca; Albornoz, Denisse; Posada, Alejandro (eds.). (2019). Contextualizing openness: Situating open science (p. 18). University of Ottawa Press. https:// idrccrdi.ca/en/book/contextualizingopenness-situating-open-science
Collective Conditions for Reuse (CC4r). (2020). https:// constantvzw.org/wefts/cc4r.en.html
McKittrick, Kathrine. (2021). Footnotes (Books and papers scattered about the floor).
In: Dear Science and Other Stories. Duke University Press.
Mugrefya, Elodie, & Snelting, Femke. (2022). Collectively setting conditions for reuse. March Journal for Art and Strategy. https:// march.international/collectivelysetting-conditions-for-reuse/
Snelting, Femke, & Weinmayr, Eva. (2025, forthcoming). Ecologies of dissemination. PARSE Journal, (21). https://parsejournal.com/journal/
1 Constant is a non-profit organisation based in Brussels since 1997 and active in the fields of art, media and technology. Constant works with feminist servers, situated publishing, active archives, extitutional networks, (re) learning situations, hackable devices, performative protocols, solidary infrastructures and other spongy practices to stake out paths towards speculative, libre, intersectional technologies. https:// constantvzw.org/
Knowledges which …
… take shape in the redistribution of resources.
… reverberate through care.
* Der Soliwagen ist ein mobiler Stand, der aus recycelten Materialien gebaut wurde, um durch den Verkauf von Panini Geld für soziale und politische Zwecke zu sammeln. Er kombiniert gemeinschaftliches Kochen mit einem solidarischen Preismodell und fördert Reflexion über soziale Ungleichheiten, Privilegien und gegenseitige Hilfe im Alltag.
* Der Soliwagen ist ein mobiler Stand, der aus recycelten Materialien gebaut wurde, um durch den Verkauf von Panini Geld für soziale und politische Zwecke zu sammeln. Er kombiniert gemeinschaftliches Kochen mit einem solidarischen Preismodell und fördert Reflexion über soziale Ungleichheiten, Privilegien und gegenseitige Hilfe im Alltag.
Fynn Martens Fynn Martens
1. Reflektiere deine Position Solidarität beginnt mit der Frage: Was bedeutet Helfen, wenn ich selbst privilegiert bin? Vermeide Charity – strebe nach Augenhöhe.
2. Gestalte gemeinsam Plane und baue kollektiv. Nutze vorhandene Materialien, teile Wissen offen – DIY als politisches Werkzeug.
3. Mach Privilegien greifbar Verwandle Preise in Fragen: Wer zahlt wie viel – und warum? Lass Menschen ihre Position selbst einschätzen, nicht bewerten.
4. Sprich durch Handlung Kochen, Teilen, Spenden –einfache Gesten, kollektive Wirkung. Nutze den Wagen als Plattform für Begegnung und Vermittlung.
5. Teile den Wagen, nicht nur die Idee Ermögliche gemeinschaftliche Nutzung mit klarer Struktur: Standort, Kalender, Anleitung–Solidarität lebt von Zugänglichkeit.
1. Reflektiere deine Position
Solidarität beginnt mit der Frage: Was bedeutet Helfen, wenn ich selbst privilegiert bin? Vermeide Charity – strebe nach Augenhöhe.
2. Gestalte gemeinsam Plane und baue kollektiv. Nutze vorhandene Materialien, teile Wissen offen – DIY als politisches Werkzeug.
3. Mach Privilegien greifbar Verwandle Preise in Fragen: Wer zahlt wie viel – und warum? Lass Menschen ihre Position selbst einschätzen, nicht bewerten.
4. Sprich durch Handlung Kochen, Teilen, Spenden –einfache Gesten, kollektive Wirkung. Nutze den Wagen als Plattform für Begegnung und Vermittlung.
5. Teile den Wagen, nicht nur die Idee Ermögliche gemeinschaftliche Nutzung mit klarer Struktur: Standort, Kalender, Anleitung–Solidarität lebt von Zugänglichkeit.
Jérémy Ndoum Jérémy Ndoum
1. Begin where it hurts or heals
Sound is memory, emotion, and resistance. Begin by asking what needs to be felt, shared, or remembered—not what gear you need.
2. See the club as classroom, the studio as commons Spaces hold knowledge. Whether dance floor, bedroom, or café: redesign them with care, ritual, and access in mind.
3. Map your sonic self
Before producing, listen inward. What sounds have shaped you? Which ones soothe, haunt, move you? Let those guide your practice.
4. Build with and for others
Sound is not a solo pursuit. Co-create tools that invite dialogue, not dominance—like question cards, shared spaces, or listening rituals.
5. Design for feeling, not perfection
Prioritize emotional clarity over technical polish. A track, a workshop, a room—all can hold tenderness and truth.
6. Keep it open
This isn’t a product. It’s a process. A methodology that adapts, evolves, and travels through communities—like sound itself.
1. Begin where it hurts or heals
Sound is memory, emotion, and resistance. Begin by asking what needs to be felt, shared, or remembered—not what gear you need.
2. See the club as classroom, the studio as commons Spaces hold knowledge. Whether dance floor, bedroom, or café: redesign them with care, ritual, and access in mind.
3. Map your sonic self Before producing, listen inward. What sounds have shaped you? Which ones soothe, haunt, move you? Let those guide your practice.
4. Build with and for others Sound is not a solo pursuit. Co-create tools that invite dialogue, not dominance—like question cards, shared spaces, or listening rituals.
5. Design for feeling, not perfection
Prioritize emotional clarity over technical polish. A track, a workshop, a room—all can hold tenderness and truth.
6. Keep it open
This isn’t a product. It’s a process. A methodology that adapts, evolves, and travels through communities—like sound itself.
… Räume fürs gemeinsame Träumen schaffen … Räume fürs gemeinsame Träumen schaffen
1. Handle solidarisch, suche Begegnungen und interessiere dich für Realitäten. Erkenne Kämpfe an und nimm sie wahr.
2. Entwickle bewegliche Tools, die ein solidarisches Zusammenkommen fördern und helfen können, Isolation zu durchbrechen.
<3 <3 <3
Zum Beispiel: Füllt einen leeren Koffer mit Anregungen zum gemeinsamen Träumen (es können Fragen, Geschichten, Bilder u. v. m. sein). Nutzt ihn in Kontexten, in denen es wenige bis keine Angebote für Kinder gibt, insbesondere dort, wo Kinder systematisch ignoriert werden, wie z. B. in den Asylzentren. Vernetzt und organisiert euch mit Menschen und Organisationen, die bereits in diesen Kontexten aktiv sind. Zusammen mit den Kindern könnt ihr Geschichten erfinden, wünschen, zuhören, singen, träumen, erzählen und kollektive Geschichtsschreibung betreiben. Sucht dann nach Möglichkeiten, diese Erinnerungen und Geschichten von unten sichtbar zu machen.
<3 <3 <3
1. Handle solidarisch, suche Begegnungen und interessiere dich für Realitäten. Erkenne Kämpfe an und nimm sie wahr.
2. Entwickle bewegliche Tools, die ein solidarisches Zusammenkommen fördern und helfen können, Isolation zu durchbrechen.
<3 <3 <3
Zum Beispiel: Füllt einen leeren Koffer mit Anregungen zum gemeinsamen Träumen (es können Fragen, Geschichten, Bilder u. v. m. sein). Nutzt ihn in Kontexten, in denen es wenige bis keine Angebote für Kinder gibt, insbesondere dort, wo Kinder systematisch ignoriert werden, wie z. B. in den Asylzentren. Vernetzt und organisiert euch mit Menschen und Organisationen, die bereits in diesen Kontexten aktiv sind. Zusammen mit den Kindern könnt ihr Geschichten erfinden, wünschen, zuhören, singen, träumen, erzählen und kollektive Geschichtsschreibung betreiben.
Sucht dann nach Möglichkeiten, diese Erinnerungen und Geschichten von unten sichtbar zu machen.
<3 <3 <3
Bauprozessegemeinsam gestalten
Bauprozessegemeinsam gestalten
Michele Giannini
Michele Giannini
1. Misstrauen gehen lassen
Kommunikation, Fehler und Machtspielchen sind kein Muss – sie sind gestalt- oder vermeidbar.
2. Weniger Hierarchie, mehr Zusammenhalt
Lerne von Allianzen, Kunstkollektiven und TeilOrganisationen: Bauprozesse gelingen besser, wenn sich alle als Teil des Ganzen verstehen und Verantwortung übernehmen.
3. Das wichtigste Werkzeug: ein gemeinsames Ziel
Wie gelingt es, über die eigene Disziplin hinauszublicken?
Interdisziplinäre Bauprozesse funktionieren nur gemeinsam –wie machen wir das verständlich?
4. Baustelle Zukunft
Was wäre, wenn wir nicht nur Häuser bauen würden, sondern auch Beziehungen, Verantwortung und Vertrauen – Stein auf Stein?
1. Misstrauen gehen lassen
Kommunikation, Fehler und Machtspielchen sind kein Muss – sie sind gestalt- oder vermeidbar.
2. Weniger Hierarchie, mehr Zusammenhalt
Lerne von Allianzen, Kunstkollektiven und TeilOrganisationen: Bauprozesse gelingen besser, wenn sich alle als Teil des Ganzen verstehen und Verantwortung übernehmen.
3. Das wichtigste Werkzeug: ein gemeinsames Ziel
Wie gelingt es, über die eigene Disziplin hinauszublicken?
Interdisziplinäre Bauprozesse funktionieren nur gemeinsam –wie machen wir das verständlich?
4. Baustelle Zukunft
Was wäre, wenn wir nicht nur Häuser bauen würden, sondern auch Beziehungen, Verantwortung und Vertrauen – Stein auf Stein?
Michele Giannini
Michele Giannini
… echo in the voices of our youngest.
Knowledges which …
… restructure the way we build.
Wie wäre es, wenn ein Buch keinen Anfang und kein Ende hätte? Kein fixes Cover, sondern mehrere Lesearten – viele mögliche Einstiege und viele Arten, Wissen zu begegnen?
Es würde eine Publikation von Texten nach sich ziehen, die nicht behaupten, wie die Welt ist, sondern zeigen, wie wir sie betrachten können. Sie würden nach dem Woher von Wissen fragen, nach dem Wie und dem Wer. Und sie würden dies nicht abstrakt tun, sondern situiert: in Landschaften, Gesprächen, Küchen, Kämpfen, Klassenzimmern.
Entstanden ist ein solcher Reader zum Jahresthema gathering/situating knowledges, das sich am HyperWerk 2024/25 entfaltete – in Workshops, Gesprächen, Praktiken. Das Thema lässt die Vorstellung eines universellen, objektiven Wissens hinter sich und fragt nach vielfältigeren, situiert entstandenen Wissensformen wie verkörpertem Wissen, kollektiver Erinnerung, lokalen Praktiken sowie digitalen und mehr-als-menschlichen Netzwerken.
Entsprechend ist diese Publikation eine Tragetasche, kein Speer. Ein Archiv, das nicht festschreibt, sondern lebendig hält. Sie ist ein Plädoyer für Verbindungen – zwischen Perspektiven, Praktiken, Menschen und Zeiten. Und ein Werkzeug, um gemeinsam zu fragen: How to gather and situate knowledges?
Gathering Yeasts
Maciej Chmara (Chmara.Rosinke)
On sensory mapping, water stories, and listening to landscapes. An interview with Wency Mendes
Ann Mbuti
From Licence to Commitment
Eva Weinmayr
Editorials
Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
Situiert im Globalen.
Kulturwissenschaftliche Naturgeschichten
Karin Harrasser
Gathering Knowledges from the Rubble: Against Scholasticide
Kevin Okoth
How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik
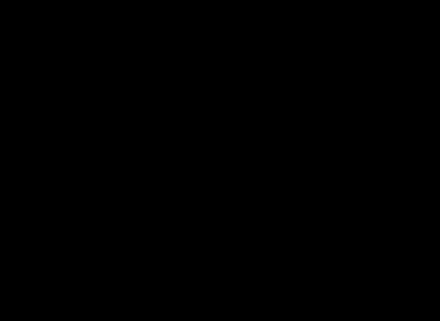
Matthias Böttger ist Institutsleiter des IXDM und Studiengangsleiter des BA Prozessgestaltung. Er beschäftigt sich mit kulturellen, ökonomischen und politischen Gestaltungsbedingungen von Raum und gelebter Umwelt unter der transversalen Frage «Wie können wir zusammen leben?»
Ann Mbuti ist Professorin für Prozessgestaltung am IXDM und unabhängige Autorin mit einem Fokus auf zeitgenössischer Kunst, Popkultur und gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Ihre Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Theorie und Praxis, mit besonderem Interesse an den Wechselwirkungen zwischen Kunst, Diskurs und Öffentlichkeiten.
tina omayemi reden ist Dozentin am IXDM, Künstlerin und Kulturarbeiterin. Sie arbeitet meist im Kollektiv zu Fragen kollektiver Fürsorge, sozialer Gerechtigkeit und Gemeinschaftsbildung. Momente des Hinhörens und Sichtbarmachens von Beziehungsgeflechten, Machtlinien und von Widerstand sind dabei zentral.
1. Wähle deinen Einstieg
Diese Publikation hat kein konventionelles Cover, das den Beginn festlegt. Du kannst mit jedem Text beginnen, der dich anspricht. Jeder Beitrag ist ein eigenständiges Fragment des Wissens, das zum Thema gathering/situating knowledges gehört.
2. Situate your reading
Jedes Kapitel ist ein Moment, in dem Wissen verortet – «situated» – wird. Achte darauf, wie sich Wissen in verschiedenen Kontexten und Perspektiven entfaltet. Wo kommt es her? Von wem wird es geteilt? Welche persönlichen oder sozialen Erfahrungen prägen es? In jedem Kapitel sind Lesende aufgefordert, das Wissen nicht nur aufzunehmen, sondern es aktiv zu verorten und zu hinterfragen.
3. Sammle Wissen
Die Idee des «gathering» durchzieht die gesamte Publikation. Diese Sammlung von
Wissensfragmenten ist nicht als abgeschlossenes Ganzes zu verstehen, sondern als ein kontinuierlicher Prozess. Jeder Beitrag ist Teil eines dynamischen Netzwerks, das die Teile in der Lektüre miteinander in Verbindung setzt.
4. Entdecke verschiedene Textformen
Auf den kommenden/zurückliegenden Seiten finden sich verschiedene Formate – von theoretischen Reflexionen über Interviews bis hin zu visuellen Beiträgen. Etwas Besonderes sind die Beiträge der Studierenden des Venticinque-Jahrgangs, die das Jahresthema festgelegt haben. Sie alle haben ihre Diplomprozesse in «How to»-Anleitungen heruntergebrochen, die du immer wieder eingestreut findest. Diese Anleitungen ermöglichen einen aktiven Wissenstransfer: Probiere sie aus und lass dich auf die verschiedenen Praktiken ein.
5. Sharing is Caring: Nutze die Publikation als dynamischen Raum
Die Publikation ist nicht nur zum Lesen da – sie ist ein Raum für dich, um das Wissen zu reflektieren, zu erweitern und zu teilen. Die «How to»-Anleitungen sind dabei nicht nur eine Einladung, Wissen zu konsumieren, sondern auch aktiv zu praktizieren und weiterzugeben. So entsteht eine lebendige Wissensgemeinschaft, die sich
über diese Seiten hinaus fortsetzt.
6. Sei offen für Mehrdeutigkeiten und Prozess
Im Thema gathering/situating knowledges steckt der Gedanke, dass es nie eine endgültige Antwort gibt – vielmehr ist es ein fortwährender Prozess des Entdeckens, Verknüpfens und Reflektierens. Du bist Teil dieses Prozesses. Sei also neugierig und offen für die Mehrdeutigkeiten, die diese Sammlung mit sich bringt.
An der Tür der hintersten Klokabine der WCs auf unserem Stock hängt ein Brief. Bereits seit über einem Jahr ist er Zeuge eines vergangenen Diplomprozesses und eines Jahresthemas, in dem das Briefeschreiben – die direkte Ansprache –eine zentrale Rolle gespielt hat. Im Rahmen von Dear Earth, ging es zwei Semester lang um die Beziehungsweisen mit und auf der Erde. Und auch im vergangenen Jahr mündete diese thematische Auseinandersetzung in einer Publikation wie dieser. So begann unsere Buchreihe, die sich hier nun weiterführt.
In dem Brief an der Klokabinentür fragt die schreibende Person, was für Wissen in ihrem Körper steckt. Ob Denken vom Fühlen getrennt werden kann. Und wie unsere Schulen aussehen würden, wenn wir emotionale Bildung genauso ernst nähmen wie analytisches Denken. Dieser Brief war kein Beitrag zu unserem aktuellen
Jahresthema gathering/situating knowledges, hat keinen direkten Bezug dazu, kam lange vorher. Doch gerade das macht ihn so zentral.
Denn er bringt genau auf den Punkt, was uns an diesem Jahresthema interessiert: Was gilt eigentlich als Wissen? Was werten wir als legitime Quelle? Und wer entscheidet das?
Am HyperWerk – der Heimat des BA Prozessgestaltung – beschäftigen wir uns seit über 25 Jahren mit solchen Fragen. Hier entstehen keine klassischen Abschlussarbeiten, sondern prozesshafte Auseinandersetzungen mit Welt, Gesellschaft und Gestaltung. Studierende kommen mit unterschiedlichsten Hintergründen, Erfahrungen und Blickwinkeln zusammen, und mit ihnen entstehen Projekte, die nicht vorgaukeln, finale Lösungen zu finden, sondern auf Verbindungen, Vorschläge und neue Perspektiven vertrauen.
Auch für diesen Abschlussjahrgang ging es darum, eine gemeinsame Klammer für diese Vielfalt zu finden. Das Jahresthema gathering/ situating knowledges, entstanden im DreamLab des Venticinque-Jahrgangs, lässt die Vorstellung von Wissen als objektiv, universell und neutral nicht gelten. Stattdessen begreift es Wissen als situiert, kontextuell, plural. Als etwas, das nicht nur in Theorien, sondern auch in Körpern,
Beziehungen und alltäglichen Praktiken lebt. Als etwas, das gesammelt werden kann – aber nur, wenn wir auch fragen, wie, von wem und wozu.
Die theoretischen Ankerpunkte des Themas sind zahlreich – zwei davon stecken bereits im Titel. Das «situating» verweist auf Donna Haraways berühmten Essay «Situated Knowledges» aus dem Jahr 1988, in dem sie Wissen nicht als objektive Wahrheit, sondern als situiert, verkörpert und perspektivisch beschreibt. Haraway fordert darin eine «verantwortliche Objektivität», die ihre eigenen Positionen kennt und offenlegt. Ein Ansatz, der sich gegen koloniale und patriarchale Wissensordnungen richtet und neue, gerechtere Formen des Erkenntnisprozesses ermöglicht.
Im Kontext unserer Publikation bedeutet das: Jeder Beitrag zeigt nicht nur, was gedacht wird, sondern auch warum, von wem und unter welchen Bedingungen.
Wir haben uns mit dem Titel des Jahresthemas bewusst die Aufgabe gestellt, aktiv zu situieren – Wissen nicht nur als abstrahierte Theorien zu begreifen, sondern es in seiner konkreten Verortung zu zeigen: in Körpern, Erfahrungen und Kontexten. Dabei geht es nicht darum, Wissen zu kategorisieren oder zu fixieren, sondern es als
dynamischen, immer wieder neu positionierten Prozess zu begreifen.
«Gathering» wiederum knüpft an Ursula K. Le Guins Idee der «Carrier Bag Theory of Fiction» an: Die Vorstellung, dass Geschichten – und damit auch Wissen – nicht als heroische Lineargeschichten erzählt werden müssen, sondern als das Sammeln von Dingen, Stimmen, Erfahrungen. Die Tragetasche, nicht der Speer, wird bei Le Guin zur zentralen kulturellen Technik.
Ein Behältnis für das Unvereinbare, das Unfertige, das Nebeneinander.
Der Brief an der Tür ist ein Beispiel für dieses Nebeneinander. Er ist keine Fussnote in einem akademischen Text, kein kuratierter Beitrag im offiziellen Diskurs, sondern stammt aus dem letzten Jahr mit einem anderen Themenfokus. Dennoch trifft er mitten ins aktuelle Thema: Er zeigt, wie Wissen hier nicht linear weitergegeben wird, sondern verwoben ist –in Gesprächen, Gesten und Spuren, die zurückbleiben. Er schafft eine staunenswerte Verbindung zwischen den verschiedenen Jahrgängen, die zeigt, dass Wissen wandert, hängen bleibt, aufgenommen und neu verbunden wird. Wissen am HyperWerk entsteht zwischen den Zeiten, zwischen den Menschen, selbst an den Türen zwischen den Räumen. Gerade diese Verwebung,
das ständige Wandern von Wissen und Perspektiven, ist es, was das HyperWerk ausmacht. Das ist nicht immer einfach, denn es macht diesen Ort des Lernens auch zu einem Raum der ständigen Neuorientierung und des gemeinsamen Suchens. Aber es lohnt sich, denn er wird dadurch zu einem Ort, an dem nicht einfach bereits abgepackte Wissensbestände von Fachpersonen an Noch-nicht-Wissende vermittelt werden, sondern wo Wissen aktiv gesammelt, hinterfragt und neu zusammengesetzt wird.
Wo jedes Individuum in der Lage ist, seinen eigenen Wissensbeitrag zu leisten, und gleichzeitig Teil eines Ganzen wird, das sich immer wieder neu formt.
Der Brief an der Tür endet mit der Frage: «Wie würde diese Schule wohl aussehen, wenn wir Körper und Geist als untrennbare Einheit verstünden und alle mehr emotionale Bildung erhielten?» Diese Frage ist nicht nur ein Gedankenspiel, sondern auch ein Plädoyer für eine andere Art des Umgangs mit Wissen. Es fordert uns heraus, über die gängigen Trennungen hinwegzusehen – über die Trennung von Denken und Fühlen, von Ratio und Emotion, von «gutem» oder «schlechtem» Wissen.
Aber die grosse Frage bleibt: Was zählt als Wissen? Und wer entscheidet darüber? Doch viel-
leicht ist es genau die Grösse dieser Frage, die den Raum für Neues öffnet.
In diesem Sinne ist die Publikation, die du nun in deinen Händen hältst, nicht nur ein Rückblick auf den Prozess des letzten Jahres, sondern auch ein offenes Experiment. Sie zeigt, dass Wissen nicht als Endpunkt, sondern als fortlaufender Prozess zu begreifen ist. Ein Prozess, der sich über Grenzen hinweg bewegt, der Dinge zusammenführt, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, und der in seiner Vielfalt und Unvollständigkeit immer auch eine Einladung ist zum Weitermachen.
Ann Mbuti, Matthias Böttger Herausgeber*innen
1. Beginne mit einer gemeinsamen Frage
Ein Jahresthema entsteht nicht aus dem Nichts. Es beginnt mit einem Bedürfnis: nach Verbindung, nach Kontext, nach einer geteilten Richtung. Im dritten Semester des Studiums Prozessgestaltung am HyperWerk nehmen sich Studierende im Studienformat
DreamLab die Zeit, genau dieser Frage nachzugehen: Was bewegt uns kollektiv?
Welche Themen durchziehen unsere Prozesse, Gespräche und Interessen?
2. Recherchiere mit dem ganzen Körper Damit Begriffe einen Sinn haben, braucht es Erfahrung. In einer intensiven Recherchewoche hat sich die Gruppe des Venticinque-Jahrgangs im Herbst 2023 auf die Suche gemacht – nicht nur mit dem Kopf, sondern mit allen Sinnen. Ein Tag im Wald bei strömendem Regen. Ein Besuch im café révolution in Bern. Ein Blick hinter die Kulissen des
Theater Basel. Ein Tag des Austauschs und des Zuhörens: untereinander, mit Gästen, mit Stimmen zu Migration, Solidarität, Organisierung. Die Frage nach Wissen wurde dabei nicht gestellt – sie hat sich gezeigt.
3. Nutze das Kollektiv
Das DreamLab lebt von der Vielfalt seiner Beteiligten. Im Studienjahr 23/24 haben Alexia Thomas, Ambre Bork, Anaïs Beutler, Basil Huwyler, Ela Blättler, Fynn Martens, Gabi Soliman, Gloria Peña-Triana, Isabelle Trutmann, Jana Arndt, Jannis Recher, Jeanne Rosset, Jérémy Ndoum, Joshua Buess, Lea Bongni, Lou Tschumi, Luzia Graf, Malena Schmid, Massimo Pfenninger, Michele Giannini, Nenya Biedermann, Pius Berger, Quentin Yorke, Sarina Böhler, Selva Meyer, Sidonia Gnahoua, Simone Thiel, Timon Essoungou, Timotheus Trinkler zusammen gedacht, diskutiert, gesucht und sich geeinigt. Ihre Stimmen und Perspektiven verdichteten sich zum Thema gathering/ situating knowledges.
4. Formuliere eine Richtung, keinen Rahmen
Das Jahresthema ist kein Motto – es ist ein Impuls. Es soll anregen, nicht einengen: zur kritischen Auseinandersetzung, zur Positionierung, zur situierten Praxis. Es dient als Orientierung, nicht als Vorgabe. Und es bleibt offen dafür, im Lauf
des Jahres verschoben, erweitert oder auch ganz neu gelesen zu werden.
5. Verwurzle Theorie in Praxis
Das Jahresthema wird nach dem DreamLab zurück an das Team gespielt – als kollektiver Vorschlag, als Einladung, als Arbeitsgrundlage. Was im DreamLab entsteht, prägt das ganze darauf folgende Studienjahr: Es beeinflusst, welche Gäste für Workshops und Vorträge eingeladen werden, welche Formate entstehen, worüber gesprochen, diskutiert, weitergedacht wird. Das Thema ist ein Filter, durch den sich Projekte, Workshops und Diskurse neu zusammensetzen.
6. Teile, was du entdeckst
Und schliesslich: diese Publikation. Sie versammelt Gedanken, Entwürfe, Gespräche, Anleitungen, Recherchen. Sie ist ein Archiv des gemeinsamen Denkens – nicht linear, nicht abgeschlossen, sondern als Sammlung und Einladung. Zum Blättern, Stöbern, Verlorengehen – an jeder beliebigen Stelle.
Mit dem Jahresthema gathering/situating knowledges haben die Venticinque im DreamLab die Idee der einen, unumstösslichen Wahrheit in Frage gestellt und sich für einen dezentralen, kollaborativen, verorteten und vielfältigen Ansatz von Wissensproduktion und -vermittlung stark gemacht.
Grundsätzlich ist das Falsifizieren und Umstossen von kanonisierten Erkenntnissen und scheinbar universalen Wahrheiten zentraler Bestandteil des Wissenschaftsbetriebs und der Hochschulen. Mit gathering/situating knowledges stellen sich dabei zusätzlich die Fragen, wer an der Wissensproduktion beteiligt war, wem sie nützt, und welche Perspektiven eingenommen wurden.
Wissen sammeln und situieren ist deshalb zentral – und im Moment vielleicht noch zentraler
als sonst – für unser Zusammenleben. Das kritische Sammeln und Situieren von Wissen kann bisherige Weisheiten in Frage stellen und die Verhältnisse umstossen. Deshalb ist es auch gefährlich – gefährlich vor allem für die, die von den aktuellen Verhältnissen profitieren.
Wissen ist Macht, und die Macht über die Produktion und Verbreitung von Wissen kann unbequeme Stimmen zum Schweigen bringen. Hochschulen sind Institutionen der zentralen Wissensproduktion und Kanonisierung, und sie sind aktuell von autoritärer und reaktionärer Beeinflussung bedroht. «Wahrheit» wird zu einer Ware, die von Milliardären, Autokraten, tech bros und Künstlicher Intelligenz manipuliert werden kann. In einer so polarisierten Welt wird ein kritischer, lebensbejahender Diskurs zunehmend unmöglich gemacht.
Diese Institutionen werden also in die Klemme genommen, und neue sind noch nicht etabliert oder eben sehr situiert in ihren Blasen. So berechtigt die Kritik an Hochschulen und ihrer Idee von neutralem Wissen und hegemonialer Kanonisierung ist, so besorgt bin ich darüber, wie gut autoritäre, reaktionäre Stimmen und Gruppen darin sind, diese Lücken zu besetzen und fake news zu etablieren. Um so wichtiger ist es also, an neuen Strategien der Wissens-
produktion, -vermittlung und -speicherung zu arbeiten, um die gesellschaftliche Transformation zu mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und einer ethischen Digitalität zu ermöglichen. Wissensproduktion, gathering/situating knowledges, braucht dabei Vertrauen, Freiheit, Sicherheit, Solidarität und Generosität. Freiheit und Sicherheit, um neue, auch kontroverse Gedanken zu denken, Erkenntnis auszusprechen und kritisch zu diskutieren, ohne Angst vor Verfolgung und Repressionen haben zu müssen –im Vertrauen darauf, dass diese und weitere Gedanken generös geteilt, sorgsam referenziert und nicht ausgenutzt oder verdreht werden.
Matthias Böttger
Leiter IXDM & BA Prozessgestaltung
As we curated the program around the annual topic gathering/situating knowledges, many questions arose. That students chose this theme, raising the same concerns that had preoccupied us for years, was both somehow unsettling and also deeply resonant. Resonant because it affirmed a shared critical awareness—unsettling because these questions remain as unresolved as ever.
Gathering/situating knowledges challenges the enduring notion that knowledge is singular, objective, or universal. It calls into question the role of institutions which have long positioned themselves as the primary sites of knowledge preservation and dissemination, obscuring the histories, struggles, and exclusions embedded in this process. Knowledge is shaped by power, implicated in histories of domination, and often wielded to maintain existing
Knowledges which … structures rather than dismantle them. To examine knowledge, then, is to examine the conditions of its production: Who defines it? Who preserves it? Who destroys it? Who benefits from its circulation? And which hierarchies determine its legitimacy?
With this in mind, the knowledge gathered throughout this year’s annual topic and shared by students and lecturers made it possible to begin answering some of these questions. These forms of knowledges move in their own ways—within and against the institution— creating moments for thought and action that examine the very conditions under which they were shaped. They reappear throughout the book, surfacing in different contexts and combinations.
tina omayemi reden (as co-organiser of the thematic workshops based on the theme gathering/situating knowledges)
Knowledges which …
… weave resistances together.
… rethink mobility as a commons.
Buch
… ein textiles
für Geschichten,Wünsche und Welten … ein textiles
Julie Eigenheer
Buch
für Geschichten,Wünsche und Welten
Julie Eigenheer
Vielleicht ist es keine Geschichte mit Anfang und Ende, sondern ein Gefühl, ein Wunsch, eine Erinnerung, ein Bild.
1. Denke mit deinen Händen
Weben, Nähen, Knoten, Sticken – deine Bewegungen sind Sprache. Dein Wissen liegt in deinen Fingerspitzen. Du erzählst durch das Tun.
2. Erzähle mit dem Material
Stoffe erinnern – an Körper, an Orte, an Zeiten. Dein Beitrag darf weich, wild, widerspenstig, zart sein. Du kannst Symbole, Muster oder Text einfügen – sichtbar oder versteckt. Codes, Spuren, Träume.
3. Erfinde Welten für dein Jetzt
Jede gestickte Linie ist eine Entscheidung: In welche Welt führt sie? Welche willst du sichtbar machen? Das textile Buch ist ein Ort für Utopien – auch kleine, unvollständige. Ein Entwurf für andere Möglichkeiten.
4. Verliere dich – und finde etwas Das textile Buch darf wandern. Sich verändern. Weitergetragen werden. Du bist Teil eines Austauschs, der Verbindung sucht. Verbindung zu einem Wissen, das nicht in Büchern beginnt, sondern im Handgemachten, im Alltäglichen, im Gemeinsamen.
Vielleicht ist es keine Geschichte mit Anfang und Ende, sondern ein Gefühl, ein Wunsch, eine Erinnerung, ein Bild.
1. Denke mit deinen Händen
Weben, Nähen, Knoten, Sticken – deine Bewegungen sind Sprache. Dein Wissen liegt in deinen Fingerspitzen. Du erzählst durch das Tun.
2. Erzähle mit dem Material Stoffe erinnern – an Körper, an Orte, an Zeiten. Dein Beitrag darf weich, wild, widerspenstig, zart sein. Du kannst Symbole, Muster oder Text einfügen – sichtbar oder versteckt. Codes, Spuren, Träume.
3. Erfinde Welten für dein Jetzt Jede gestickte Linie ist eine Entscheidung: In welche Welt führt sie? Welche willst du sichtbar machen? Das textile Buch ist ein Ort für Utopien – auch kleine, unvollständige. Ein Entwurf für andere Möglichkeiten.
4. Verliere dich – und finde etwas Das textile Buch darf wandern. Sich verändern. Weitergetragen werden. Du bist Teil eines Austauschs, der Verbindung sucht. Verbindung zu einem Wissen, das nicht in Büchern beginnt, sondern im Handgemachten, im Alltäglichen, im Gemeinsamen. Julie Eigenheer Julie Eigenheer
… ein Lastenrad selbst bauen und kollektiv nutzen
Massimo Pfenninger
… ein Lastenrad selbst bauen und kollektiv nutzen
Massimo Pfenninger
1. Besorgt euch einen alten Fahrradrahmen aus Stahl und eine 20-Zoll-Vorderradgabel.
2. Ladet euch die Anleitung zum Bau eines Lastenrads von folgender Webseite herunter: https://projects.ixdm.ch/ gefaehrt-und-gefaehrtinnen/ projekt.html
3. Baut euch euer Lastenrad gemäss der Anleitung.
4. Kauft ein Zahlenschloss, erstellt einen Telegram-Chat, fügt eure Freund*innen hinzu, definiert Nutzungsbedingungen und beginnt die kollektive Nutzung.
5. Lernt, eine Ressource (Lastenrad) in einer Gemeinschaft sinnvoll zu nutzen, und versucht, egozentrische, kapitalistische Eigentumsgedanken abzulegen –es wird sich lohnen.
1. Besorgt euch einen alten Fahrradrahmen aus Stahl und eine 20-Zoll-Vorderradgabel.
2. Ladet euch die Anleitung zum Bau eines Lastenrads von folgender Webseite herunter: https://projects.ixdm.ch/ gefaehrt-und-gefaehrtinnen/ projekt.html
3. Baut euch euer Lastenrad gemäss der Anleitung.
4. Kauft ein Zahlenschloss, erstellt einen Telegram-Chat, fügt eure Freund*innen hinzu, definiert Nutzungsbedingungen und beginnt die kollektive Nutzung.
5. Lernt, eine Ressource (Lastenrad) in einer Gemeinschaft sinnvoll zu nutzen, und versucht, egozentrische, kapitalistische Eigentumsgedanken abzulegen –es wird sich lohnen.
Pius Berger
Pius Berger
1. Setz dich mit Musik auseinander
Was gefällt dir? Sprich mit anderen darüber. Probiere selbst, diese Musik zu machen – um zu verstehen, was es alles braucht, bis ein Song fertig ist.
2. Vernetze dich
Gibt es bestimmte Künstler*innen, deren Musik du sehr magst? Versuche, mit ihnen in Kontakt zu treten. Finde heraus, welche Personen in deinem Umfeld etwas mit der Szene dieser Musikrichtung zu tun haben – und frage sie, ob sie dich bei deinem Projekt unterstützen.
3. Organisiere dich
Was brauchst du, um eine Organisation aufzubauen, die für den Vertrieb dieser Musik zuständig sein soll?
4. Ideenentwicklung
Wofür steht dein Musiklabel?
Welche Werte soll es vertreten? Was machst du anders als andere Labels?
5. Komm ins Machen
Von welchen Künstler*innen würdest du gerne Musik veröffentlichen und wie könntest du sie unterstützen? Bitte sie, dir Demos zu senden –Songs, die sie produziert, aber noch nicht veröffentlicht haben. Mach dir eine Liste solcher Künstler*innen und frage sie alle an.
6. Momentum
Kreiere einen Moment, der die Aufmerksamkeit auf dein Projekt lenkt. Sorge dafür, dass alle, die davon wissen sollten, auch davon erfahren. Teile die Musik dieser Künstler*innen und zeige ihnen gegenüber Dankbarkeit.
7. Reflexion
Was kann in deinem Prozess optimiert werden? Braucht es Veränderung? Wen könntest du um Rat oder Hilfe bitten?
1. Setz dich mit Musik auseinander Was gefällt dir? Sprich mit anderen darüber. Probiere selbst, diese Musik zu machen – um zu verstehen, was es alles braucht, bis ein Song fertig ist.
2. Vernetze dich
Gibt es bestimmte Künstler*innen, deren Musik du sehr magst? Versuche, mit ihnen in Kontakt zu treten. Finde heraus, welche Personen in deinem Umfeld etwas mit der Szene dieser Musikrichtung zu tun haben – und frage sie, ob sie dich bei deinem Projekt unterstützen.
3. Organisiere dich
Was brauchst du, um eine Organisation aufzubauen, die für den Vertrieb dieser Musik zuständig sein soll?
4. Ideenentwicklung
Wofür steht dein Musiklabel? Welche Werte soll es vertreten? Was machst du anders als andere Labels?
5. Komm ins Machen
Von welchen Künstler*innen würdest du gerne Musik veröffentlichen und wie könntest du sie unterstützen? Bitte sie, dir Demos zu senden –Songs, die sie produziert, aber noch nicht veröffentlicht haben. Mach dir eine Liste solcher Künstler*innen und frage sie alle an.
6. Momentum
Kreiere einen Moment, der die Aufmerksamkeit auf dein Projekt lenkt. Sorge dafür, dass alle, die davon wissen sollten, auch davon erfahren. Teile die Musik dieser Künstler*innen und zeige ihnen gegenüber Dankbarkeit.
7. Reflexion
Was kann in deinem Prozess optimiert werden? Braucht es Veränderung? Wen könntest du um Rat oder Hilfe bitten?
To … How To … … co-create visual ideas with AI … co-create visual ideas with AI
Quentin Yorke
Quentin Yorke
1. Start with intuition
Feel, don’t think. Let your idea arrive like a sound, a shape, a blurry impression.
2. Translate your vision into words
Describe it as if you were talking to a friend—not a machine. Use images, moods, metaphors.
3. Co-create with the algorithm
Enter the prompt. Then listen. Observe what appears.
Do not judge too quickly.
4. Reflect with others
Share your generated visuals. What do they see? What do they feel? Listen deeply.
5. Realize what is missing
Ask yourself what is not there. Whose eyes are embedded in the dataset? What is invisible?
6. Reclaim authorship
Make the result yours. Cut, remix, print, speak over it. You are not passive.
7. Pass it on
Let someone else use your prompt. See how it transforms in new hands!
Quentin Yorke
1. Start with intuition
Feel, don’t think. Let your idea arrive like a sound, a shape, a blurry impression.
2. Translate your vision into words
Describe it as if you were talking to a friend—not a machine. Use images, moods, metaphors.
3. Co-create with the algorithm
Enter the prompt. Then listen. Observe what appears.
Do not judge too quickly.
4. Reflect with others
Share your generated visuals. What do they see? What do they feel? Listen deeply.
5. Realize what is missing
Ask yourself what is not there. Whose eyes are embedded in the dataset? What is invisible?
6. Reclaim authorship
Make the result yours. Cut, remix, print, speak over it. You are not passive.
7. Pass it on
Let someone else use your prompt. See how it transforms in new hands!
Quentin Yorke
… rethink sustainable relationships.
Knowledges which …
… build worlds.
Wie wäre es, wenn ein Buch keinen Anfang und kein Ende hätte? Kein fixes Cover, sondern mehrere Lesearten – viele mögliche Einstiege und viele Arten, Wissen zu begegnen?
Es würde bedeuten, dass auch unser Bild von Natur überdacht werden muss. Karin Harrasser erzählt es als eine Geschichte kultureller Überformungen, kolonialer Einschreibungen und wissenschaftlicher Machttechniken. Ihre Erzählweise durchkreuzt disziplinäre Grenzziehungen und macht deutlich: Erkenntnis ist nie neutral, sondern immer situiert.
Diese Publikation ist ein Reader zum Jahresthema gathering/situating knowledges, das sich am HyperWerk 2024/25 entfaltete – in Workshops, Gesprächen, Praktiken. Harrasser sensibilisiert für die Bedingungen, unter denen geforscht, formuliert, vergessen oder erinnert wird, und wirft dabei Fragen auf: Wer spricht? Was gilt als relevant? Und welche Geschichten werden ausgeblendet?
On sensory mapping, water stories, and listening to landscapes. An interview with Wency Mendes
Ann Mbuti
From Licence to Commitment
Eva Weinmayr
Editorials
Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
Situiert im Globalen.
Kulturwissenschaftliche Naturgeschichten
Karin Harrasser
Gathering Knowledges from the Rubble: Against Scholasticide
Kevin Okoth
How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik
Gathering Yeasts
Maciej Chmara (Chmara.Rosinke)
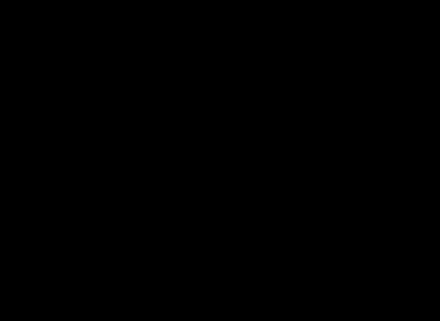
Karin Harrasser is Director of the ifk and Professor of Cultural Theory at the University of Arts Linz. Her research currently focuses on asymmetrical cultural transfers between Europe and South America and on the relation between globalization and contemporary history. Recent books: Surazo Monika und Hans Ertl: Eine deutsche Geschichte in Bolivien (2022), Gegenentkommen (2023).
Karin Harrasser
Es ist nicht mehr zu ignorieren, dass die ungeheure Mobilmachung von Menschen, Dingen und Natur, die mit der Neuzeit einsetzte, eine der größten Herausforderungen, vielleicht aber auch eines der größten Rätsel der Gegenwart bildet. Die Kapitalisierung und Mobilmachung von Ressourcen in globalem Maßstab gibt uns Rätsel auf, weil die daraus folgenden Zerstörungskräfte sich gegen vieles wenden, was die Neuzeit uns beschert hat. Als Klimakrise oder Anthropozän bezeichnet, stehen die E!ekte der neuzeitlichen Mobilmachung auch politisch im Zentrum. Gegenentwürfe, wie degrowth oder Konvivialität, sind zwar bereits in groben Zügen skizziert worden, der Weg dahin ist jedoch alles andere als gebahnt; und er muss wohl als politisch äußerst schmerzhaft imaginiert werden, da das Konzept Wachstum in Form von Investmentstrategien in vielerlei gesellschaftliche Systeme eingebaut ist. Notabene auch in solche des Gemeinwohls (Pensionskassen, Versicherungen) und nicht nur solche der privaten Wertschöpfung. Von sozialökologischer Seite wird jedoch argumentiert, dass Deglobalisierung nur mit Hilfe sehr grundsätzlicher ökonomischer und kultureller Transformationen erreicht werden könnte – was nicht nur libertäre Machos nicht hören wollen, sondern auch das Selbstverständnis der liberal-bürgerlichen Mittelschichten erschüttert. Rechtspopulismus und Nationalismus sind die Symptome dieser Verunsicherung, deren Artikulation als Angri! auf Freiheitsrechte und Autonomie empfunden wird. Historisch betrachtet ist jedoch Globalisierung weder ein räumlich homogenes
Phänomen noch ein zeitlich kontinuierliches. Die E!ekte globaler Wechselwirkungen kommen stets lokal zum Tragen, sind also grundsätzlich immer glokal und niemals symmetrisch. Es ist stets mit Gewinner*innen und Verlierer*innen kalkuliert worden. Aber selbst die mobilsten Elemente, allen voran die Finanzmärkte, verbinden sich mit situierten kulturellen und ökonomischen Praktiken und Anwendungsfeldern. Kosten und Nutzen wurden immer und werden weiterhin hochgradig ungleich verteilt. Seit der ersten neuzeitlichen Kolonisierungswelle ab dem 16. Jahrhundert lassen sich zudem Phasen der Ausbreitung (Feldzüge, Handel, Mission), der Rezentrierung (etwa durch imperiale Machtkonzentrationen) und auch solche der Deglobalisierung (etwa nach Marktzusammenbrüchen) beobachten. Diese E!ekte betre!en ökonomische, geopolitische, aber auch kulturelle Prozesse (Sprachpolitik, politische Diskurse der Nationalisierung, Wirtschafts- und Finanzpolitik etc.).
So gut wie alle aktuellen politischen Problemkonstellationen stehen mit diesen hochdynamischen Wechselwirkungen in Zusammenhang. Ob es um Asyl- oder Sicherheitspolitik geht, um Seuchenbekämpfung, um Klimapolitik: Nichts davon ist denkbar, ohne die lange Geschichte der Globalisierung an konkreten Orten mit ins Auge zu fassen.
Mir scheint dennoch nicht das Lokale als Gegenpol zum Globalen entscheidend, sondern für mich ist das
Situierte sein wesentlicher Kontrapunkt. Mit dem Begri! «situiert» greife ich eine epistemologische Debatte aus den 1990er Jahren auf, die bis heute wichtig und produktiv ist. Mein Bezugspunkt ist Donna Haraways Text über «situiertes Wissen» von 1988: «Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective». (Haraway 1988) Ganz anders als in der aktuellen Verwendung des Begri!s meist praktiziert, geht es in dem Text keineswegs um die Verknüpfung einer identitätslogisch festgelegten Sprecher*innenposition mit dem Gesagten oder dem Gewussten. Wenn aktuell in Vorträgen oder Texten eine situierte Perspektive angekündigt ist, erschöpft diese sich nicht selten in einer ritualhaften Warnung, man spräche – bedauerlicherweise – als eine weiße, akademisch geprägte Mitteleuropäerin und aus dieser Position heraus. Invers wird ein situierter Ansatz als Wahrheitsverstärker reklamiert, wenn man als Betro!ene spricht. Weder das eine noch das andere hat mit dem Konzept des situierten Wissens im engeren Sinn zu tun. Das Sich-gewahrWerden der eigenen Positioniertheit ist hier nur der Anfangspunkt einer darüber hinausgehenden re exiven Herangehensweise. Haraway und anderen Vertreter* innen des Zugangs einer strong objectivity, etwa Sandra Harding, ging es vielmehr darum, Wissensformen, die ihre eigenen Voraussetzungen ausklammerten, daran zu erinnern, dass Wissen immer historisch spezi sch ist und nicht den göttlichen Blick von oben oder ein anderes Wahrheitsprivileg beanspruchen kann. To play the godtrick nannte es Haraway. Umgekehrt betonen
Situiert im Globalen.
aber Haraway und Harding, dass eine ausgeschilderte, partiale Perspektive nicht automatisch wahrer ist; sie ist nur dann robuster, ja «objektiver», wenn sie daran interessiert ist, die Situiertheit als erkenntnisfördernd mitzubedenken. Das Projekt hat insofern einiges gemeinsam mit der unlearning-Perspektive. Es geht darum, all das, was man glaubt zu wissen, jederzeit radikal in Frage stellen zu lernen.
Und damit sind wir mitten in zentralen Aufgaben für das kulturwissenschaftliche Arbeiten unter den Bedingungen globaler Vernetztheit im 21. Jahrhundert; in Debatten um Robustheit von Wissen, um Kulturrelativismus und Moderne, aber auch um das Verhältnis von wissenschaftlichem Wissen zu vernakulärem Wissen; und zu dem zwischen politischem Aktivismus, Kunst und Kulturwissenschaft. Jeder Besuch eines internationalen Kunstevents macht deutlich, dass all diese Fragen in ein zähes Ringen mit erheblichen politischen Konsequenzen eingetreten sind. Nehmen wir die Biennale von Venedig 2024: Noch nie waren so viele sogenannte indigene Künstler*innen ausgestellt. Manchmal gerahmt als alternative Vorschläge zur Formensprache der zeitgenössischen Kunst, manchmal als deren Vollender*innen (full circle mit dem Primitivismus). Politisch verstörend war der russische Pavillon. Er durfte von Russland nicht benutzt werden und wurde, vermutlich im Gegenzug zu Abkommen zur Lithiumförderung, an Bolivien abgegeben. Bespielt wurde er mit einem dezidiert dekolonialen Programm, eigenhändig kuratiert von der MAS
(Movimiento al Socialismo)-Ministerin für «Kulturen, Dekolonisation und Depatriachalisierung». Unter dem Titel «Looking to the futurepast, we are treading forward» fand sich viel Folkloristisches, es trat aber auch das wunderbare Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN), das Experimentalorchester für indigene Instrumente auf. Dass die folkloristische Rahmung für das OEIN adäquat war, kann bezweifelt werden. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass Boliviens Präsentation für Russland ein coup war. Es konnte sich einmal mehr als loyaler Partner des globalen Südens präsentieren –eine politische Strategie, die Putin seit Jahren betreibt: Es geht darum, die Systemkonkurrenz und «Gegen-denWesten»-Rhetorik zu einer dekolonialen «Gegen den globalen Norden» hin zu verschieben. In vielen anderen Pavillons, und zum Teil auch in der Hauptausstellung, wurden als «indigen» gerahmte Arbeiten deutlich als das «Andere» eines globalisierten, kapitalistischen, patriarchalen, der Industriemoderne huldigenden Weltsystems präsentiert.
Was ist passiert? Und was bedeutet das für unsere Arbeit im Bergwerk der Kulturtheorie, der historischen Anthropologie, der Kulturwissenschaft, der zeitgenössischen Kunst? Ich nde viele der nun einer Kunstö!entlichkeit präsentierten Arbeiten sehr interessant, und ich bin froh darüber, dass sie bekannter werden. Was mich aber irritiert, ist ihre Rahmung als das indigene «Andere» einer als einheitlich verstandenen Hegemonie des Westens/des globalen Nordens im Aussagesystem Situiert im Globalen.
Situiert im Globalen.
«Zeitgenössische Kunst». Das Interessante und Herausfordernde vieler dieser Arbeiten ist für mich vielmehr die Art und Weise, wie sie die longue durée von Kolonialität und kultureller Gewalt durcharbeiten; dass sie zeigen, wie viele Dialekte die Formensprache der Moderne hat; oder auch, dass in den präsentierten Arbeiten sichtbar wird, auf welche Arten und Weisen in aktuellen Widerstandspraktiken Indigenität oder vernakuläres, lokales Wissen mobilisiert – und globalisiert – wird. Oft müssen all diese Faktoren im Wortsinn re-konstruiert werden, um politisch wirksam werden zu können, etwa in Landrechtsfragen oder in den berühmten Gerichtsfällen, in denen Flüsse oder Seen als juristische Personen anerkannt wurden.
Hier läge meiner Meinung nach ein wichtiges epistemologisches und methodisches Feld für eine Kulturwissenschaft, die sich kritisch im Globalen situiert. Wir stehen aber in diesen theoretischen Fragen nicht bei Null – im Gegenteil. Seit längerem wird rund um die anthropologischen Arbeiten von Forscher*innen wie etwa Marilyn Strathern, Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, Aperecida Vilaça oder auch von dem leider so früh verstorbenen David Graeber darüber diskutiert, in welche Relation sich die kulturwissenschaftliche Forschung zu nicht-europäischen Wissenssystemen setzen soll. Die Debatte ist im Grunde älter, gleich alt wie die künstlerische Moderne, und hatte sicher mit Émile Durkheims und Marcel Mauss’ Kategorienprojekt eine erste Konjunktur im frühen
20. Jahrhundert. Diese Gruppe von Soziolog*innen und Ethnolog*innen unternahm um die letzte Jahrhundertwende eine kulturvergleichende Erforschung von Kategorien des Wissens. Ausgehend von den aristotelischen Kategorien des Denkens, die den westlichen Kanon strukturieren – z. B. die Substanz (Was ist etwas?), die Quantität (Wie viel ist etwas?), die Qualität (Wie bescha!en ist etwas?), der Ort (Wo ist etwas?) und die Zeit (Wann ist etwas?) – war es der Anspruch, einen größtmöglichen, kulturvergleichenden Katalog von Kategorien anzulegen. Anders als in der primitivistischen Kunst fungierte nicht-eurozentrisches Wissen hier nicht als das absolut «Andere», sondern es war ein Korrelat in einem Netzwerk von möglichen Erkenntnisweisen. Die Debatte der letzten 30 Jahre scheint mir nicht wesentlich darüber hinausgekommen oder sogar beizeiten in einen Neoprimitivismus zurückgefallen zu sein. Die Provokation, die von den oben genannten anthropologischen Forscher*innen in Richtung der Kulturwissenschaft ausgeht, ist, dass sie die Scheidung von Natur und Kultur ausgehend von außereuropäischen Konzeptionen in Frage stellen und damit die Prämisse, dass es eine objektiv beschreibbare Natur und ihre Gesetze auf der einen Seite gäbe («Natur») und eine dieses Gegebene wahrnehmend-aneignende, kommunikativ-interpretierende, hochvariable Kultur auf der anderen Seite. So kommt Philippe Descola zu dem Schluss, dass die naturalistische Scheidung in menschliche und nicht-menschliche Sphären ein Sonderweg der in Europa geborenen Wissenschaften sei, der nur
Situiert im Globalen.
aufgrund der Hegemonie Europas in Wissensfragen dominant geworden ist. Eduardo Viveiros de Castro geht einen Schritt weiter und fordert eine Inversion: Der amerindische Perspektivismus (der im Übrigen in der Fachwelt in seinem allgemeinen Gültigkeitsanspruch für Lateinamerika durchaus kritisch diskutiert wird) solle zum analytischen Standpunkt der Anthropologie werden. Auch Marilyn Strathern, die ich für eine der originellsten Anthropolog*innen überhaupt halte, gewinnt aus den Konzepten und Begri!en der von ihr Untersuchten analytische Konzepte für die Untersuchung europäischer Kulturen. So hat ihr die Erforschung von Subjektkonzeptionen und Eigentumsdenken in Papua-Neuguinea erlaubt, ganz neue Blicke auf Familie und Eigentum in England im 19. und 20. Jahrhundert zu werfen. Dieser Impuls ist beispielsweise in historischen New-Kinship-Studies, die das Verhältnis von Verwandtschaft zu anderen gesellschaftlichen Strukturtypen und daraus entstehenden Machtverhältnissen untersuchen, sehr produktiv.
Radikal kulturvergleichend, aber nicht an die NaturKultur-Grenze rührend, arbeitete David Graeber, als er etwa durch die Beobachtung von Widersprüchen bezüglich der Ausübung und der Wirkung von Zaubern auf Madagaskar herausstellte, dass auch die Glaubenssätze ökonomischen Denkens (des Westens) widersprüchlich sind, etwa wenn wir den Widerspruch ignorieren, dass die Arbeits- und die Lebenswelt nach dem Leistungsprinzip eingerichtet sind, obwohl im Alltag völlig klar
Situiert im Globalen.
ist, dass nicht jede*r alles erreichen kann, wenn er*sie nur wirklich will. Wo frühere Ethnolog*innen Afrikaner* innen sahen, die an Fetische glaubten, sieht Graeber modellhaft die Wirkungsweise von Fetischismus als Mechanismus am Werk, der uns erlaubt, an ökonomischen Prinzipien festzuhalten (sie zu fetischisieren), selbst da und besonders da, wo die Realität ihr Gegenteil beweist. Graeber wandte sich recht explizit gegen die Rede von einer «ontologischen Wende» bzw. gegen Alter-Ontologien als Metatheorie. Er bezeichnete sich als ontologischen Realisten und theoretischen Relativisten; insbesondere in dem letzten, mit dem Archäologen David Wengrow verfassten Buch, «The Dawn of Everything» (Graeber & Wengrow 2021) wird der vergleichende Ansatz sowohl synchron als auch diachron verwendet, um zu zeigen, wie kreativ und machtkritisch Gesellschaften quer durch die Zeiten und überall auf der Welt waren und sind; und als wie wenig selbstverständlich, plausibel und fundiert die dominante Formel von Staat und Kapitalismus genommen werden sollte.
Im Anliegen, den eigenen Erkenntnisvoraussetzungen kritisch zu begegnen, überlappen sich das Konzept des situierten Wissens und der vergleichende beziehungsweise rekursive Ansatz der Sozial- und Kulturanthropologie. Was wären also solche kulturwissenschaftlichen Naturgeschichten? Strong objectivity, situiertes Wissen und die damit verwandten STS (Science and Technology Studies) widmeten sich in erster Linie der Dekonstruktion des Objektivitätsideals der europäischen Natur-
Situiert im Globalen.
wissenschaften. Nicht, wie Latour und Haraway immer wieder betonten, um es auszuhebeln, sondern um es zu stärken und zu verbessern, indem die epistemischen, sozialen, forschungspraktischen und medialen Voraussetzungen mit eingepreist und mit bedacht werden. Man könnte auch sagen, dass es sich hierbei um das Einmahnen der Erweiterung der wissenschaftlichen Tugend der Selbstbegrenzung eingedenk der eigenen kulturellen Prägung handelt. Wie verhält sich aber das gesteigerte Interesse der Kulturwissenschaften an Naturphänomenen dazu? In welchem Verhältnis zum situierten Wissen stehen animal und plant studies, medical humanities, kulturwissenschaftliche Anthropozän- und Klimaforschung, um nur einige Richtungen der letzten Jahre zu nennen? Fast mantrahaft wird die Notwendigkeit betont, eine mehr-als-menschliche Perspektive einzunehmen. Oft wird dafür eine spekulative Perspektive eingemahnt, die aber – genauso oft – nicht zu überzeugen vermag, weil sie in den üblichen Genres und in allzu bekannten Bildern und Erzählungen (romantischen, exotisierenden, anthropomorphisierenden) stecken bleibt. Hinzu kommt, dass eigentlich sämtliche Kunstsparten biophil geworden sind. Vom nature writing über die Filme des Sensory Ehnography Lab («Sweetgrass», «Leviathan») bis hin zu Theaterproduktionen in Landschaften und eco art: Nichts scheint dringlicher oder begehrenswerter, als sich künstlerisch und theoretisierend den anders- oder mehr-als-menschlichen Akteuren zu widmen, die früher Natur hießen.
Situiert im Globalen.
Es muss für meine Begri!e um mehr gehen als um eine Wiederverzauberung der Kulturwissenschaft. Und es muss auch um mehr gehen als darum, von Forschungsförderung, die an gesellschaftlichen Problemfeldern ausgerichtet ist (etwa die EU-Missionen), zu pro tieren. Ein Faktor ist sicher, dass es auch in den Kulturwissenschaften den Wunsch gibt, nicht nur innerhalb der FachCommunity Relevantes zu produzieren. So gerät der*die Kulturwissenschaftler*in aufgrund der globalen Krisen, in denen sich ökologische und politische Fragen mischen, schnell in Fachgebiete, die früher fast ausschließlich in der Expertise der Naturwissenschaften lagen.
Eine zentrale Frage an die Kulturwissenschaften und an die Künste ist aus meiner Sicht, wie es gelingen kann, der Notwendigkeit und dem Wunsch nach Perspektivänderung nachzukommen, ohne in naturalistische oder primitivistische Fallen zu tappen. Wie also Natur und Geschichte in Spannung halten, die Geschichtlichkeit von Natur und das, was sich menschlicher Intentionalität und Wahrnehmung entzieht, synchron im Blick behalten?
Deshalb zum Abschluss ein paar Überlegungen zu einem Gegenstand meiner aktuellen, historisch ausgerichteten Forschung zur kulturellen Gewalt. Mir ist dabei, wie allen, die sich mit Peru und dem Bergbau beschäftigen, El Tío begegnet. Er ist eine Teufels gur, die an den Eingängen zu bolivianischen Minen, etwa in Potosí, wacht; ein christlicher Teufel, der aber auch mit andinen
Situiert im Globalen.
Kosmologien assoziiert ist, gewissermaßen Pachamamas machistisches Gegenüber in den Minen. Die Verehrung von El Tío ist gewiss keine ungebrochene Tradition seit der Zeit vor der Eroberung, sie zeigt vielmehr, wie sich Mission, europäisches Territorialdenken und Extraktivismus mit lokalen Erfahrungen verbinden. Die Minen waren – und sind – Orte gefährlicher, schwerer, körperlicher Arbeit, und vom Cerro Rico de Potosí heißt es deshalb, er sei der Berg, der Männer frisst. Diese Sprechformel hat eine tiefe historische Dimension, denn die Minen waren nach der Eroberung – anders als die Erdober äche – grundsätzlich im Besitz des spanischen Königs. Sie wurden mit dem symbolischen Körper des Souveräns identi ziert, wie auch Andrea Marston in ihrem Buch «Subterranean Matters: Cooperative Mining and Resource Nationalism in Plurinational Bolivia» (2024) betont. Diese Identi kation des Bergs mit dem Körper des Souveräns, aber auch der globale Stellenwert des Bergs, sind festgehalten in der Ikonographie und dem Spruch auf dem ersten Wappen, das Karl V. 1547 der Villa Imperial de Potosí verlieh. Der Berg spricht hier selbst: «Ich bin das reiche Potosí, Schatzkammer der Welt, König der Berge, von Königen beneidet.» Das Wappen zeigt den Berg mit Kreuz am Gipfel, gekrönt mit der Kaiserkrone. Flankiert wird er von den Säulen des Herakles, die mit dem Wahlspruch des Kaisers Karl V., Plus Ultra, verziert sind und die damit den Anspruch des Habsburgers unterstreichen, über Europa hinaus zu herrschen. Der Berg wird damit geradezu zum –selbst das Wort ergreifenden – double Karls. Zu dieser
Situiert im Globalen.
Identi kation mit dem Körper des Souveräns kam ein theopolitisches Argument, das beispielsweise von Peter Paul Rubens in einem Entwurf für die Darstellung des Cerro Rico in einem Triumphbogen für Antwerpen 1635 festgehalten wurde. Es wird hier erklärt, dass Gott die unerschöp ichen Gold- und Silberschätze von Potosí im Gegenzug zur großen Frömmigkeit der Heiligen Könige und ihrer unermesslichen Sorgfalt bei der Verbreitung der Religion entborgen habe. Imperialer Besitz und P icht zur Missionsarbeit werden also beide vom Berg selbst verkörpert. Später gingen sowohl der Besitz der Erze als auch die «Erziehungsp icht» auf den Nationalstaat über. Mission und Extraktion von Edelmetallen waren gleichermaßen Erfahrungen von Gewalt (kultureller, ökonomischer und physischer), und El Tío verkörpert sie bis in die Gegenwart. Heutige bolivianische Bergbaukooperativen, die ungefähr 122’000 Bergbauleute organisieren, sind zwar in der Organisation ihrer Arbeit autonom, aber darauf verp ichtet, nicht gewinnorientiert zu wirtschaften. Sie unterliegen der Aufsicht der staatlichen Minengesellschaft (COMIBOL). Sie sind gewissermaßen die Treuhänder der Identikation von Berg(bau) und Staat. Politisch sind sie sehr stark und gut sichtbar. Sie waren in den Anfängen wichtige Unterstützer von Evo Morales’ MAS (dem Movimiento al Socialismo). Die Bergleute sind häu g nicht nur in Kooperativen, sondern in campesino- oder indígena-Verbänden organisiert. 2014 forderten sie lautstark, also mit Aufmärschen und Straßenblockaden, eine Gesetzesänderung von der sozialistischen Regierung.
Situiert im Globalen.
Sie verlangten ein Gesetz, das ihnen erlauben würde, mit privaten Firmen zu kooperieren – dies war ihnen aufgrund ihres Status’ als gemeinnützige Organisation bis dato nicht erlaubt. Das Gesetz passierte nicht den Senat, sodass sie bis heute nur unter Aufsicht der staatlichen COMIBOL mit privaten Firmen kooperieren dürfen. In ihrer Studie über aktuelle Politik und Episteme der bolivianischen Bergbau-Kooperativen registrierte Andrea Marston nun eine neue Spielart der El Tío-Figur: Nicht alle, aber ein erheblicher Teil der mineros bezeugen heute die Existenz von El Tío als weißem, blonden Vergewaltiger, der die Bergleute überwältigt. Einige Bergleute sagen, er sei bloß eine Halluzination, ausgelöst von giftigen Gasen im Stollen; andere insistieren darauf, dass es ihn wirklich gebe. Die ontologische Frage scheint aber insgesamt nicht besonders wichtig zu sein. Der Teufel hat in beiden Fassungen wieder einmal die Gestalt gewechselt, passend zur «gasförmigen» Verführungskraft des Neoliberalismus, der die Kooperativen in ihrem Wunsch nach Pakten mit dem privaten Sektor erreicht hat. El Tío erzählt uns also die Naturgeschichte des Bergbaus als eine politische Kulturgeschichte; oder eben als eine kulturwissenschaftliche Naturgeschichte voller Widersprüche.
Quellen
Haraway, Donna J. (1988). Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599.
In deutscher Übersetzung: Haraway, Donna J. (1995). Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive. In Dies. (Hrsg.) Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen (S. 73-97). Frankfurt a. M.: Campus.
Graeber, David, Wengrow, David. (2021). The Dawn of Everything. A New History of Humanity New York: Farrar, Straus and Giroux.
In deutscher Übersetzung: Graeber, David, Wengrow, David. (2022). Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit. Stuttgart: Klett-Cotta.
… emerge in whispered conversations.
… challenge the status quo.
… become a chismosa*
… become a chismosa*
* Chismosa [chee-smoh-sah]: a term used in many Latin-American cultures to describe someone who loves to gossip. But it’s more than just spreading rumors—being a chismosa is about storytelling, social bonding, and keeping the community alive.
* Chismosa [chee-smoh-sah]: a term used in many Latin-American cultures to describe someone who loves to gossip. But it’s more than just spreading rumors—being a chismosa is about storytelling, social bonding, and keeping the community alive.
Gabi Soliman Gabi Soliman
1. Check yourself—a true chismosa knows their worth and is not defined by dragging others down. Being a chismosa is a lifestyle, not a weapon. Hot tip: chisme can, however, be used as a weapon against capitalism use it wisely.
2. Gather your people who replenish your soul—a chismosa is never alone.
3. Take up space chismosas never make themselves small for anyone. Walk, talk, and laugh with your head held high.
4. Engage your core—true laughs always come from the belly.
5. Stay hydrated chisme is considered a national sport for many and can get very heated. Keep your water bottle close by.
6. Sharpen your senses—a seasoned chismosa knows how to read the room. They don’t just hear the tea—they sense it.
7. Archive the drama—whether it’s a voice note, a group chat receipt, or a scribble in your diary, a chismosa knows the value of a well-documented timeline. For storytelling and survival.
8. Consent is hot—even in chisme. Know when to speak, when to listen, and when it’s just not your business.
9. Never fix your face—sometimes it’s best to let your face do the talking. Trust me, it already does.
10. Rewrite the narrative—use your power for good. Chismosas are cultural historians. Reclaim, reframe, and redistribute the gossip with care, humour, and subversion.
11. Rest is resistance—even a chimosa needs a break from time to time. Besides: how will you process all that tea? Remember to rest, reflect, and recharge, so you can keep yapping for all your days.
1. Check yourself—a true chismosa knows their worth and is not defined by dragging others down. Being a chismosa is a lifestyle, not a weapon. Hot tip: chisme can, however, be used as a weapon against capitalism use it wisely.
2. Gather your people who replenish your soul—a chismosa is never alone.
3. Take up space chismosas never make themselves small for anyone. Walk, talk, and laugh with your head held high.
4. Engage your core—true laughs always come from the belly.
5. Stay hydrated chisme is considered a national sport for many and can get very heated. Keep your water bottle close by.
6. Sharpen your senses—a seasoned chismosa knows how to read the room. They don’t just hear the tea—they sense it.
7. Archive the drama—whether it’s a voice note, a group chat receipt, or a scribble in your diary, a chismosa knows the value of a well-documented timeline. For storytelling and survival.
8. Consent is hot—even in chisme. Know when to speak, when to listen, and when it’s just not your business.
9. Never fix your face—sometimes it’s best to let your face do the talking. Trust me, it already does.
10. Rewrite the narrative—use your power for good. Chismosas are cultural historians. Reclaim, reframe, and redistribute the gossip with care, humour, and subversion.
11. Rest is resistance—even a chimosa needs a break from time to time. Besides: how will you process all that tea? Remember to rest, reflect, and recharge, so you can keep yapping for all your days.
Gabi Soliman Gabi Soliman
Jannis Recher
Jannis Recher
1. Schau zweimal hin
Nimm dir ein Bild vor, das dir alltäglich erscheint –aus Werbung, Social Media, Nachrichten. Sieh es dir bewusst an. Was zeigt es? Was zeigt es nicht?
2. Frag dich: Was will dieses Bild von dir?
Welche Aktion oder Reaktion möchte es auslösen? Sollst du kaufen, fühlen, zustimmen, scrollen? Mit welcher Absicht und von wem wurde es gestaltet?
3. Was fühlst du, wenn du es anschaust?
Ist es ansprechend, abstossend? Warum? Reizt es durch Dramatik, Vertrautheit oder Emotion?
4. Entschlüssle die Botschaften Welche Werte, Rollenbilder oder Normen transportiert das Bild? Welche Erzählung wird gestärkt? Welche Realität wird dargestellt – und welche bleibt verschwiegen?
5. Stell es in einen anderen Rahmen Wie verändert sich das Bild, wenn du es in einem anderen Kontext betrachtest – als Kunst, als Propaganda, vor 50 Jahren? Wie würdest du es anders lesen, wenn du müsstest?
6. Sieh bewusster Nicht jedes Bild muss hinterfragt werden – aber du kannst es. Indem du hinsiehst statt nur zu schauen, öffnest du einen Raum für Eigenständigkeit, Reflexion und neue Perspektiven. Gewohnheit wird zur Entscheidung.
1. Schau zweimal hin
Nimm dir ein Bild vor, das dir alltäglich erscheint –aus Werbung, Social Media, Nachrichten. Sieh es dir bewusst an. Was zeigt es? Was zeigt es nicht?
2. Frag dich: Was will dieses Bild von dir?
Welche Aktion oder Reaktion möchte es auslösen? Sollst du kaufen, fühlen, zustimmen, scrollen? Mit welcher Absicht und von wem wurde es gestaltet?
3. Was fühlst du, wenn du es anschaust?
Ist es ansprechend, abstossend? Warum? Reizt es durch Dramatik, Vertrautheit oder Emotion?
4. Entschlüssle die Botschaften Welche Werte, Rollenbilder oder Normen transportiert das Bild? Welche Erzählung wird gestärkt? Welche Realität wird dargestellt – und welche bleibt verschwiegen?
5. Stell es in einen anderen Rahmen Wie verändert sich das Bild, wenn du es in einem anderen Kontext betrachtest – als Kunst, als Propaganda, vor 50 Jahren? Wie würdest du es anders lesen, wenn du müsstest?
Recher
6. Sieh bewusster Nicht jedes Bild muss hinterfragt werden – aber du kannst es. Indem du hinsiehst statt nur zu schauen, öffnest du einen Raum für Eigenständigkeit, Reflexion und neue Perspektiven. Gewohnheit wird zur Entscheidung. Jannis Recher
Gemeinsames Schmuckgestalten
Joshua Buess
Joshua Buess
1. Verändere die Rollen
Statt fertige Produkte zu verkaufen, öffne deinen Designprozess. Lade Menschen ein, aktiv mitzuwirken –emotional, gestalterisch und konzeptuell. Orientiere dich dabei an Co-DesignPrinzipien: Gestalter*innen sind dabei nicht nur Produzent*innen,sondern Moderator*innen kreativer Prozesse.
2. Schaffe zugängliche Gestaltungsmöglichkeiten –für alle Niedrigschwellige Tools und Materialien (z. B. Wachs, Heisskleber, einfache Oberflächengestaltung) ermöglichen Menschen ohne Vorkenntnisse, Schmuck zu entwerfen. Je intuitiver und offener das Format, desto grösser die kreative Beteiligung.
3. Nutze Personalisierung
Persönliche Geschichten, kulturelle Hintergründe oder Symbole, die Gestalter*innen einbringen, machen das Endprodukt einzigartig –funktional wie emotional.
4. Bleib flexibel
Der Designer*innenberuf wandelt sich. So wirst du zur Schnittstelle zwischen Idee und Umsetzung, von der Handwerker*in zur Vermittler*in. Du strukturierst den Prozess, schaffst Vertrauen, gibst Feedback und übersetzt Entwürfe in machbare Ergebnisse –in Handwerk und Technik.
1. Verändere die Rollen Statt fertige Produkte zu verkaufen, öffne deinen Designprozess. Lade Menschen ein, aktiv mitzuwirken –emotional, gestalterisch und konzeptuell. Orientiere dich dabei an Co-DesignPrinzipien: Gestalter*innen sind dabei nicht nur Produzent*innen,sondern Moderator*innen kreativer Prozesse.
2. Schaffe zugängliche Gestaltungsmöglichkeiten –für alle Niedrigschwellige Tools und Materialien (z. B. Wachs, Heisskleber, einfache Oberflächengestaltung) ermöglichen Menschen ohne Vorkenntnisse, Schmuck zu entwerfen. Je intuitiver und offener das Format, desto grösser die kreative Beteiligung.
3. Nutze Personalisierung Persönliche Geschichten, kulturelle Hintergründe oder Symbole, die Gestalter*innen einbringen, machen das Endprodukt einzigartig –funktional wie emotional.
4. Bleib flexibel Der Designer*innenberuf wandelt sich. So wirst du zur Schnittstelle zwischen Idee und Umsetzung, von der Handwerker*in zur Vermittler*in. Du strukturierst den Prozess, schaffst Vertrauen, gibst Feedback und übersetzt Entwürfe in machbare Ergebnisse –in Handwerk und Technik.
Joshua Buess
Joshua Buess
Malena Schmid
Malena Schmid
1. Erinnern
Denk an deine Grossmütter: Welche Erinnerungen, Gefühle oder Fragen verbindest du mit ihnen? Was wurde erzählt – was nicht? Wenn du magst und kannst, frage nach.
2. Austauschen
Setz dich ohne Stress mit anderen Menschen zusammen. Tauscht die gefundenen Erinnerungen und Geschichten über eure Grossmütter miteinander aus.
3. Verbinden
Welche Erfahrungen teilen eure Grossmütter? Was verbindet euch mit ihnen? Was haben ihre Leben mit euren zu tun? Gibt es Gemeinsamkeiten aufgrund gesellschaftlicher diskriminierender Strukturen?
4. Einordnen
Setzt die persönlichen Geschichten in ihre historischen und politischen Kontexte. Welche Machtverhältnisse wirk(t)en auf das Leben eurer Grossmütter –und auf eures?
5. Handeln
Kommt in die Handlung: Wie könnt ihr dieses Wissen teilen oder sichtbar machen? Wo könnt ihr ansetzen, um diese diskriminierenden Strukturen zu durchbrechen?
1.
Denk an deine Grossmütter: Welche Erinnerungen, Gefühle oder Fragen verbindest du mit ihnen? Was wurde erzählt – was nicht? Wenn du magst und kannst, frage nach.
2. Austauschen
Setz dich ohne Stress mit anderen Menschen zusammen. Tauscht die gefundenen Erinnerungen und Geschichten über eure Grossmütter miteinander aus.
3. Verbinden
Welche Erfahrungen teilen eure Grossmütter? Was verbindet euch mit ihnen? Was haben ihre Leben mit euren zu tun? Gibt es Gemeinsamkeiten aufgrund gesellschaftlicher diskriminierender Strukturen?
4. Einordnen
Setzt die persönlichen Geschichten in ihre historischen und politischen Kontexte. Welche Machtverhältnisse wirk(t)en auf das Leben eurer Grossmütter –und auf eures?
5. Handeln
Kommt in die Handlung:
Wie könnt ihr dieses Wissen teilen oder sichtbar machen? Wo könnt ihr ansetzen, um diese diskriminierenden Strukturen zu durchbrechen?
Knowledges which … … allow for intimate crafting.
… come from the stories of our ancestors.
Wie wäre es, wenn ein Buch keinen Anfang und kein Ende hätte? Kein fixes Cover, sondern mehrere Lesearten – viele mögliche Einstiege und viele Arten, Wissen zu begegnen?
Es würde bedeuten, dass wir auch hinschauen müssen, wenn Wissensproduktion zur Zielscheibe wird. Kevin Okoth macht deutlich, dass dann nicht nur Bildung zerstört wird, sondern auch die Möglichkeit auf Zukunft.
Diese Publikation ist ein Reader zum Jahresthema gathering/situating knowledges, das sich am HyperWerk 2024/25 entfaltete – in Workshops, Gesprächen, Praktiken. Ein Thema, das dazu verpflichtet, zu fragen, wie Institutionen im globalen Norden mit dem gezielten Angriff auf Bücher, Archive und Lernorte in anderen Teilen der Welt umgehen sollen.
Okoth beginnt seine Ausführungen mit einer unvorstellbaren Zerstörung – und wirft Fragen zu Spuren von Widerstand, Wiederaneignung und radikalem Mitdenken auf. Wie können Samen der Verbundenheit zum Aufkeimen gebracht werden?
From Licence to Commitment
Eva Weinmayr
Editorials
Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
Situiert im Globalen.
Kulturwissenschaftliche Naturgeschichten
Karin Harrasser
Gathering Knowledges from the Rubble: Against Scholasticide
Kevin Okoth
How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik
Gathering Yeasts
Maciej Chmara (Chmara.Rosinke)
On sensory mapping, water stories, and listening to landscapes. An interview with Wency Mendes
Ann Mbuti
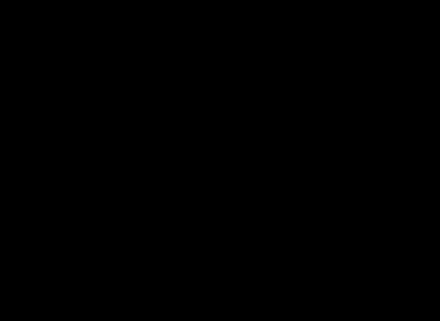
Kevin Okoth is a writer based in London and the author of Red Africa: Reclaiming Revolutionary Black Politics (2023). He is a regular contributor to the London Review of Books and a member of the Salvage Editorial Collective. His work focuses on Marxism, anti-imperialism, twentieth-century anti-colonial struggles, and Pan-Africanism. He is currently working on a book about Kenya and the Cold War.
Kevin Okoth
In February 2025, the Israeli police raided the Educational Bookshop in occupied East Jerusalem and arrested two booksellers, Mahmoud Muna and his nephew, Ahmad, for «disrupting public order». The Israeli authorities seized books, including children’s colouring books, and detained the booksellers for several days. The Educational Bookshop, which stocks books on Palestinian culture and the Israel-Palestine con ict, is an invaluable resource to the residents of Jerusalem. As Mahmoud explained in 2023, even Western journalists ock to the bookshop as soon as they arrive, hoping to use the booksellers’ knowledge to get a better understanding of the situation in Palestine. The dynamic of the bookseller as informant and the Western journalist as «knowledge producer» is, of course, an extractive dynamic. But the Western press’ reliance on this bookshop as one of the only sources of Palestinian opinion is telling in other ways, too: it shows just how much knowledge about Palestine is shaped by the Israeli authorities, who get to decide what we are allowed to know. What does it mean when colonial power not only occupies land, but also controls knowledge?
As part of the «Gathering Knowledges» symposium at IXDM, we were asked to think about how di!erent forms of knowledge produce «tools for transformation», especially in relation to process design, a discipline that focuses on shaping the way we live together. With this brief, I couldn’t help but think about the opposite process: how di!erent forms of knowledge have been
Gathering Knowledges from the Rubble:
used to prevent transformation, and how imperialist violence prevents the reproduction of liberatory knowledges. In Gaza, Israel has systematically destroyed the Palestinian education system. The pattern of attacks on schools, universities, teachers, students, and journalists in Gaza shows that Palestinian culture, knowledge, and history has itself become the target of Israel’s genocidal war. By April 2024, over 80 percent of schools in Gaza had been damaged or destroyed. 60 percent of all other educational institutions, including several public libraries and archives—including those which cover over 150 years of history—had been damaged or destroyed. This destruction was, and continues to be, enabled by arms and technology supplied to Israel by Europe and the United States.
Writing about West Africa, the philosopher Olúfémi
Táíwò argued that colonialism disrupted indigenous modes of knowledge production and shattered indigenous conceptions of reality and identity. As in the process of nation-building, colonialism failed to replace these disrupted modes of knowledge production with new ones; subsequently, communities were left without «unifying myths, collective metaphors [and] common meanings» (Táíwò 1993: 898). The languages that were used in the new universities in Africa, for example, were English, French or Portuguese: languages that most working people could not understand. The people were thus robbed of their own knowledges and locked out of accessing the knowledge that was being produced in
Gathering Knowledges from the Rubble:
these new, «decolonised» institutions—a point which the Kenyan novelist Ngũg% wa Thiong’o never tired of repeating. (Ngũgĩ wa Thiong’o 1986)
In «Perfect Victims», Mohammed el-Kurd recounts his attempt to eulogise the Palestinian writer and poet Dr. Refaat Alareer who was killed in an Israeli air strike in Gaza in December 2023. El-Kurd complains that Palestinians must always use «the colonizers’ language» to eulogise their own. But «to attempt to eulogize a Palestinian man in the colonizer’s lexicon is to selfagellate» (El-Kurd 2025: 44). It is, in short, to allow control of the narrative to be wrested away from the colonised and handed to the coloniser. The problem for el-Kurd is also that there is an absence of Palestinian voices in public discourse. But this absence cannot be blamed on the lack of Palestinian knowledge producers. Rather, it shows how systematic and calculated the erasure of Palestinian voices in institutions across the global north has been since 1948. But it also points to the erasure of Palestinian institutions which would give these knowledge producers the space from which to produce such knowledge. The very resources Palestinians have at their disposal to produce and disseminate revolutionary culture are being destroyed in front of our eyes.
The academic Karma Nabulsi coined the term «scholasticide» to describe the targeted destruction of Palestinian systems of knowledge production (Scholars against the War on Palestine 2024). At the time, Nabulsi was trying to nd
Gathering Knowledges from the Rubble:
words to describe the systematic bombing of the ministry of education, schools, universities, and other sites of teaching and learning during Israel’s 2008/09 war on Gaza. But the process Nabulsi describes began much earlier, as the Nakba of 1948 was followed by the Arab-Israeli war of 1967 and the invasion of Lebanon in 1982—with each event leading to the mass destruction of Palestinian knowledge systems. More than 15 years later, the scholasticide has only intensi ed. Today, Israel’s aim is no longer simply to cause damage to infrastructures of knowledge production, but to erase them entirely.
The underdevelopment of the modes of knowledge production is closely related to the underdevelopment— and in the Palestinian case, the complete destruction— of a country’s economy and critical infrastructure Colonialism, and especially settler colonialism, wants to destroy indigenous institutions in order to replace them with institutions built in its own image, institutions which are removed geographically and/or ideologically from the site of struggle.
In response to the ongoing scholasticide in Gaza, the historian Sherene Seikaly called on the American Historical Association to pass a resolution opposing scholasticide in Gaza. «This genocide targets the Palestinian people, our peoplehood, our capacity to narrate the past, and to imagine the future», Seikaly said. «The task of the historian is to ask the hard questions, and to take the di!icult positions—not when the dust
settles, but as the re reigns.» (Çubukçu 2025) The resolution received «overwhelming support» from the association’s members but was ultimately rejected by the AHA’s executive council. Yet simply by showing that scholasticide is at the very heart of Israel’s genocidal project, radical scholars are pointing to what Soledad Santana calls «the ugly, imperialist fabric of international law». (Santana 2024) The Genocide convention of 1948 did not include «cultural genocide», and by extension scholasticide, in its o!icial de nition of genocide.
The term «scholasticide» is rarely applied outside of the Palestinian context, but the current civil war in Sudan, for example, ts many of the de nitions listed by «Scholars against War»—including the killing of students and teachers, or the systematic destruction of educational institutions. The country’s educational system has been devastated: around 18 million out of Sudan’s 22 million children have mostly been out of school since the war started, and the country is on the verge of one of the most severe education crises in the world. Though this isn’t the same settler colonial context as in Palestine, the civil war in Sudan reminds us that the production and re-production of knowledge, and especially of emancipatory knowledges, is becoming a casualty of imperialism in all its forms and guises. Just as in Iraq, where the US invasion and subsequent wars destroyed a once-thriving education system, it will take a long time to repair the damage. The struggle
for education, and against scholasticide, is universal, whether in Iraq, Sudan or Palestine.
As Francesca Albanese, the UN’s Special Rapporteur on the Occupied Palestinian Territories, has pointed out, genocide is a form of «colonial erasure». (Albanese 2024: para. 95) It is therefore essential to think scholasticide within the framework of «decolonisation» more generally. Today’s movements for the decolonisation of universities or art institutions—often led by radical students and sta!, or by art workers—have tried to reimagine the place of education in society. Calls for decolonisation in institutions across the global north have drawn media and public attention to the racist and colonial foundations of these institutions, while trying to undo the erasure of histories and cultures of peoples who have been racialised, colonised, or who su!er under contemporary imperialism. But the powerful term «decolonisation», which de ned an era of revolutionary dreams and aspirations, has at times been reduced to a buzzword. If we want to take seriously our task of «decolonisation», then we must restore the term to its true, revolutionary meaning.
The demand to «decolonise», «gather», or «recover» knowledges cannot be separated from the struggle against neo-colonialism and imperialism. As Walter Rodney once put it: «Decolonisation is inseparable from a total strategy for liberation» which must include «control of the material resources» and «a restructuring Gathering Knowledges from the Rubble:
Gathering Knowledges from the Rubble:
of the society so that those who produce have the principal say in how their wealth is going to be distributed». (Rodney 2022: 300) Rodney’s critical pedagogy asks urgent questions about the nature of education and the aims of knowledge production. «What is the position of all of us because we fall in the category of the […] intellectual, a privilege in our society?» he asks in the nal chapter of «The Groundings with my Brothers». «What do we do with that privilege?» (Rodney 2019: 66) Is it enough to simply challenge Eurocentric ideas by incorporating voices from the global south, or Indigenous and Black voices from the global north? Can we claim to be decolonising without paying attention to how existing colonial projects are destroying the culture and knowledge of an entire people as we speak?
In her essay «Against History: Art, Culture, Business-as-Usual under the Gazan Genocide», the writer and academic Ghalya Saadawi pushes back against the culture industry’s attempt to dissuade artists and art workers from showing solidarity with the Palestinian struggle by engaging in boycotts, divestment or sanctions. The demand to ignore their institutions’ complicity in the genocide is a gesture which individualises art, making it a site of individual achievement and not of collective struggle. As art and educational institutions have cracked down on pro-Palestinian voices by cancelling talks, withdrawing fellowships, revoking visas, and enabling the deportation of activists, Saadawi argues once again, as Walter Benjamin did, for the
«politicisation of art». (Saadawi 2025) This leads us towards what the late writer and critic Marina Vishmidt called «infrastructural critique»: focusing on the connections between the ideological and material conditions that shape our institutions, so that we can challenge these in our critique and political practice. (Vishmidt 2017)
Across the world, students have taken up this call to action; they have built encampments and occupied buildings to draw attention to the systematic destruction of Palestinian knowledge systems. At the same time, they have highlighted how their own institutions facilitate scholasticide, and how these very institutions continue to pro t from neo-colonialism and imperialism. The students are ghting for the future of the university and of education more generally; the hope is that the entire infrastructure of educational institutions can be re-arranged through solidarity and struggle.
Today, this is still a timely and urgent call to action. We should heed these words and let them guide us in our struggle to gather knowledges in a time of catastrophe. Against scholasticide, we must champion solidarity. This may take the form of engaging in boycotts; pushing other educational institutions to adopt motions recognising that what is happening in Palestine is scholasticide; organising reading groups, study sessions and events to educate ourselves and others about imperialism and settler colonialism; pushing institutions to divest from the military-industrial
complex or other companies which are complicit in genocide and in the mass destruction of educational institutions; or using institutional resources to create spaces where scholars and students whose infrastructures of knowledge production have been destroyed can continue to teach and learn. For academics and teachers, standing up for students who have faced disciplinary action due to their political activism is especially important.
These «tools for transformation» are all just examples; which forms of solidarity are possible will depend on our individual institutional contexts and the position they occupy within global hierarchies of power. But it doesn’t stop there. We will all be needed to help gather, recover, rebuild and preserve education and knowledge systems from the rubbles of Gaza, Sudan and beyond. As the Gaza University academics and administrators put it in an open letter in May 2024: «The Israeli occupation forces have demolished our buildings, but our universities live on.»
References
Albanese, Francesca. (2024).
A/79/384: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese—Genocide as colonial erasure. United Nations General Assembly, 79th session. https://www.ohchr.org/ en/documents/country-reports/ a79384-report-special-rapporteursituation-human-rights-palestinian
Çubukçu, Ayça. (2025, January 30).
Hannah Arendt, Gaza, and personal responsibility under genocide. The New Arab. https:// www.newarab.com/opinion/ hannah-arendt-gaza-and-personalresponsibility-under-genocide
El-Kurd, Mohammed. (2025).
Perfect Victims: And the Politics of Appeal. Chicago IL: Haymarket Books.
Gaza Academics and University Administrators. (2024, May 29).
Open letter by Gaza academics and university administrators to the world. Al Jazeera. https:// www.aljazeera.com/opinions/ 2024/5/29/open-letter-by-gazaacademics-and-universityadministrators-to-the-world
Ng ũgĩ wa Thiong’o. (1986).
Decolonising the mind: The politics of language in African literature London: Heinemann.
Rodney, Walter. (2019). The Groundings with My Brothers. [New edition]. Brooklyn, NY: Verso.
Rodney, Walter. (2022).
Decolonial Marxism: Essays from the Pan-African revolution Brooklyn NY: Verso.
Saadawi, Ghalya. (2025). Against History: Art, Culture, Business-asUsual under the Gazan Genocide. Salvage Autumn/Winter 2024 & Spring/Summer 2025, pp. 89-108.
Santana, Soledad. (2024, November 21). Scholasticide as Cultural Genocide: The Pro-Palestine Student Movement and International Law’s Colonial Underbelly. Spectre. https://spectrejournal.com/ scholasticide-as-cultural-genocide
Scholars against the War on Palestine. (2024, February 14).
Tool Kit: International Actions Against Scholasticide. https:// scholarsagainstwar.org/wp-content/ uploads/2024/02/SAWP-Actions-AgainstScholasticide-Toolkit.pdf.
Táíwò, Olúfémi. (1993). Colonialism and Its Aftermath: The Crisis of Knowledge Production. Callaloo, 16(4): 891–908.
Vishmidt, Marina. (2017). Between not everything and not nothing: Cuts toward infrastructural critique. In Hlavajova, Maria & Sheikh, Simon (eds.), Former West: Art and the Contemporary After 1989. MIT Press. pp. 265–269.
which … …travel through militant waves.
… aim to overturn systems while building life-affirming alternatives.
1. Untersucht the politics of sounds.
2. Analysiert, inwiefern Sound ein subversives Mittel sein kann.
3. Sucht Mauern, die zu durchbrechen sind. Wo Grenzen, Isolation oder Kontrolle herrschen, kann Sound ein verbindendes Element sein.
1. Untersucht the politics of sounds.
2. Analysiert, inwiefern Sound ein subversives Mittel sein kann.
3. Sucht Mauern, die zu durchbrechen sind. Wo Grenzen, Isolation oder Kontrolle herrschen, kann Sound ein verbindendes Element sein.
Johanna Langner
Johanna Langner
1. Mit Fragen beginnen, nicht mit Antworten
Stelle Fragen mit einem Blick auf strukturelle Ungleichheiten: Wo befinden sich Gefängnisse, Lager oder ähnliche Institutionen? Wer ist dort inhaftiert –und warum?
2. Abolitionistisch denken, lokal handeln
Verknüpfe die Kritik am Gefängnissystem mit konkreten Orten, Beispielen und Menschen. Recherchiere, wie Straf- und Migrationspolitik ineinandergreifen – und welche Alternativen denkbar sind.
3. Zahlen lebendig machen Statistiken sind wichtig, aber sie erzählen keine vollständige Geschichte. Mach strukturelle Gewalt sichtbar, ohne die individuellen Perspektiven der Betroffenen zu übergehen.
4. Wissen zugänglich machen
Vermittle deine Recherche durch verschiedene Formate –etwa Texte, Audiobeiträge oder Karten.
5. Verbindungen schaffen statt nur zu berichten Leiste einen Beitrag zu einem solidarischen Netzwerk. Unterstütze Wege der Resonanz –etwa durch Briefaktionen oder die Sichtbarmachung von Widerstand innerhalb und ausserhalb von Mauern.
1. Mit Fragen beginnen, nicht mit Antworten Stelle Fragen mit einem Blick auf strukturelle Ungleichheiten: Wo befinden sich Gefängnisse, Lager oder ähnliche Institutionen? Wer ist dort inhaftiert –und warum?
2. Abolitionistisch denken, lokal handeln
Verknüpfe die Kritik am Gefängnissystem mit konkreten Orten, Beispielen und Menschen. Recherchiere, wie Straf- und Migrationspolitik ineinandergreifen – und welche Alternativen denkbar sind.
3. Zahlen lebendig machen Statistiken sind wichtig, aber sie erzählen keine vollständige Geschichte. Mach strukturelle Gewalt sichtbar, ohne die individuellen Perspektiven der Betroffenen zu übergehen.
4. Wissen zugänglich machen
Vermittle deine Recherche durch verschiedene Formate –etwa Texte, Audiobeiträge oder Karten.
5. Verbindungen schaffen statt nur zu berichten
Leiste einen Beitrag zu einem solidarischen Netzwerk. Unterstütze Wege der Resonanz –etwa durch Briefaktionen oder die Sichtbarmachung von Widerstand innerhalb und ausserhalb von Mauern.
… amplify a music magazine as a tool for change
… amplify a music magazine as a tool for change
1. Start with the need, not with the medium
Ask yourself: which voices are missing? A print magazine is not the goal but a tool to reveal gaps.
2. Let the structure reflect your values
Who writes, who decides, which content, which stories?
Collective authorship means sharing perspectives and shifting power.
3. Act the way you want the industry to be Visibility without fair pay is an empty promise. Factor in care and time as integral parts of the publication.
4. Research as a practice of listening Conversations with those affected are not just sources— they are part of the process. Relationships over «content».
5. Ask what a magazine can actually change
If others are allowed to speak—and others are required to listen—what begins to shift?
1. Start with the need, not with the medium
Ask yourself: which voices are missing? A print magazine is not the goal but a tool to reveal gaps.
2. Let the structure reflect your values
Who writes, who decides, which content, which stories?
Collective authorship means sharing perspectives and shifting power.
3. Act the way you want the industry to be Visibility without fair pay is an empty promise. Factor in care and time as integral parts of the publication.
4. Research as a practice of listening Conversations with those affected are not just sources— they are part of the process. Relationships over «content».
5. Ask what a magazine can actually change If others are allowed to speak—and others are required to listen—what begins to shift?
Sarina Böhler
Sarina Böhler
… use playful and reflective methods to talk about gender and identity in education?
… use playful and reflective methods to talk about gender and identity in education?
Basil Huwyler Basil Huwyler
1. Starte mit einer Frage
Wie können wir über Geschlecht und Identität sprechen – ohne Berührungsängste, Ausgrenzung oder starre Normvorstellungen?
2. Gestalte Lernräume statt nur
Inhalte
Lernen ist mehr als Wissen. Es ist Atmosphäre, Haltung, Beziehung. Entwickle Materialien, die das Gespräch öffnen – nicht schliessen.
3. Mach’s modular und beweglich Schaffe Bausteine, die angepasst, kombiniert und mobil eingesetzt werden können – in Schulen, Weiterbildungen oder Workshops.
4. Vermittle mit Spiel und Reflexion Fördere Fragen statt Antworten. Setze auf Formate, die an die persönliche Erfahrung anknüpfen und auf spielerische Weise Tiefgang ermöglichen – wie Rollenspiele, Lernkoffer, visuelle Medien.
5. Teste im echten Leben
Lass Jugendliche, Lehrpersonen und Fachkräfte mitgestalten. Sammle Feedback. Lerne gemeinsam, wie Lernräume diskriminierungssensibel gestaltet werden können.
6. Baue Allianzen
Vernetze dich mit Pädagog*innen, Aktivist*innen und Gestaltenden und sei am Puls dessen, was die Jugendlichen heute bewegt. Lernkultur ist kein Einzelprojekt, sondern ein gemeinsames Anliegen.
1. Starte mit einer Frage Wie können wir über Geschlecht und Identität sprechen – ohne Berührungsängste, Ausgrenzung oder starre Normvorstellungen?
2. Gestalte Lernräume statt nur
Inhalte
Lernen ist mehr als Wissen. Es ist Atmosphäre, Haltung, Beziehung. Entwickle Materialien, die das Gespräch öffnen – nicht schliessen.
3. Mach’s modular und beweglich Schaffe Bausteine, die angepasst, kombiniert und mobil eingesetzt werden können – in Schulen, Weiterbildungen oder Workshops.
4. Vermittle mit Spiel und Reflexion Fördere Fragen statt Antworten. Setze auf Formate, die an die persönliche Erfahrung anknüpfen und auf spielerische Weise Tiefgang ermöglichen – wie Rollenspiele, Lernkoffer, visuelle Medien.
5. Teste im echten Leben Lass Jugendliche, Lehrpersonen und Fachkräfte mitgestalten. Sammle Feedback. Lerne gemeinsam, wie Lernräume diskriminierungssensibel gestaltet werden können.
6. Baue Allianzen
Vernetze dich mit Pädagog*innen, Aktivist*innen und Gestaltenden und sei am Puls dessen, was die Jugendlichen heute bewegt. Lernkultur ist kein Einzelprojekt, sondern ein gemeinsames Anliegen.
which … … challenge who speaks.
… reconstruct identities.
Wie wäre es, wenn ein Buch keinen Anfang und kein Ende hätte? Kein fixes Cover, sondern mehrere Lesearten – viele mögliche Einstiege und viele Arten, Wissen zu begegnen?
Es würde bedeuten, dass auch alles mit einem Samen beginnen könnte. In Kenza Benabderraziks Text ist dies kein romantisches Bild, sondern ein radikaler politischer Akt: Tomaten wachsen zu lassen bedeutet, sich dem Zugriff globaler Agrarkonzerne zu entziehen. Es bedeutet, Biodiversität zu verteidigen, Ernährungssouveränität zurückzufordern und das Wissen der Erde in all seiner materiellen, sozialen und symbolischen Kraft ernst zu nehmen.
Diese Publikation ist ein Reader zum Jahresthema gathering/situating knowledges, das sich am HyperWerk 2024/25 entfaltete – in Workshops, Gesprächen, Praktiken. Sie nimmt das Pflanzen als Haltung ein: Sammeln, Beobachten, Verweben, Pflegen. Situiertes Wissen, das wurzelt, das wächst, das sich nicht vereinnahmen lässt. Und eines, das die Frage aufwirft, was es selbst vereinnahmt und in sich trägt.
Editorials
Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
Situiert im Globalen.
Kulturwissenschaftliche Naturgeschichten
Karin Harrasser
Gathering Knowledges from the Rubble: Against Scholasticide
Kevin Okoth
How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik
Gathering Yeasts
Maciej Chmara (Chmara.Rosinke)
On sensory mapping, water stories, and listening to landscapes. An interview with Wency Mendes
Ann Mbuti
From Licence to Commitment
Eva Weinmayr
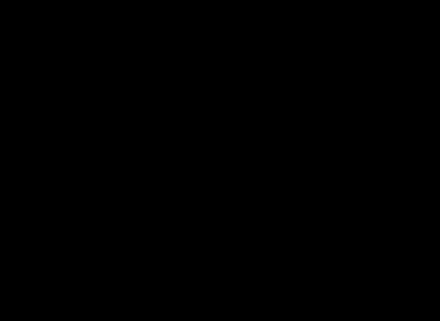
Kenza Benabderrazik is a lecturer and researcher in the Sustainable Agroecosystems Group at ETH Zurich Her work explores socio-ecological dynamics in agrifood systems, drawing on political ecology, feminist and decolonial approaches. Kenza also coordinates transdisciplinary outreach projects and art-science collaborations which foster dialogues among researchers, artists, and food system actors. She runs the SAE Greenhouse Art-Lab, a space at the intersection of science, art, and agroecological transformation.
As we often enter spring with a willingness to embrace the growth of plants, and perhaps contribute, in our own way, to growing our own food, hobby gardening can o!er multiple opportunities to rethink our food systems. In this short guide, I present a small step-by-step guide through the process of growing tomatoes, along with re ections on what each step entails, not only practically, but more broadly, or even more intimately, as an invitation to engage more deeply in this journey—and how it may cultivate a sense of kinship, sovereignty, and attention in our everyday lives.
Today, a handful of transnational corporations exert immense control over our global food systems. (Folke et al. 2019) These corporations, operating in agriculture, forestry, seafood, and fossil energy, are responsible for signi cant environmental impacts and have the power to in uence critical biosphere functions:
• 10 companies control 56% of the global fertilizer production.
• 4 companies dominate 84% of the pesticide market.
•3 companies control 60% of the seed production.
A striking concentration of power, with one of its hubs right here in Basel, home to the headquarters of Syngenta and key o ices of Bayer. These companies hold a near-monopoly over global seed and agrochemical markets.
Pick the right seeds, as in the ones that contribute to the diversi cation of our food systems, the ones that make you explore di erent tastes, colors, varieties. The ones that have been cultivated by dedicated peasants, families for generations, or seed breeders advocating for a diverse and socially just food system.
Interestingly, the company Sativa1 has been committed to independent and GMO-free seed supply for organic agriculture and gardeners and is located close to Basel (just 10-minute walking distance from the Basel Academy of Art and Design FHNW campus). They are involved in biodynamic and organic breeding, vegetable preservation, seed propagation, and the trade of cereal and vegetable seeds from organic and biodynamic cultivation. Prioritizing seeds that have been cared for and replicated by engaged minds gives farmers more agency and supports sovereignty. This rst step is also intertwined with the last one—as in, pick the seeds you’d like to eat and think about them not only linearly but in a closed loop, and you’ll engage in a cyclical seasonal
relationship of reciprocity, growing, eating on and on and on. For each variety you choose, a wide range of recipes unfolds. You won’t need the same consistency, color, avor for a salad or a stew or a sauce. Just in the same way you won’t be able to grow just any Tomatoes in any space—start connecting the dots between spaces, practices, diets, stories.
Five years ago, a kilo of Tomato seeds cost almost the same as a kilo of gold. Tomato seeds, and any seeds, are incredibly precious. The question that arises is: How has the commodi cation of earthly materials been driven by extractivist practices? And how can seed sovereignty be a powerful tool to disrupt and reclaim what is meant to feed the cycle of reciprocity?
Over the past century, we have lost between 75 and 90% of agricultural biodiversity. For example, where we once cultivated over 400 varieties of Tomatoes, fewer than 80 are commonly grown today. Patented seeds undermine traditional practices of selecting, producing, and exchanging locally adapted seeds. This standardization of the food supply erodes species diversity on a global scale.
There is a concept in vegetable gardening that some people call «companion planting».2 For each vegetable grown, there is a combination of other vegetables, owers, and herbs that work well together. Typically, Tomatoes grow well near marigolds. The bright colors and the strong scent of marigolds make them excellent deterrents against insects like Tomato hornworms and aphids. Garlic, onions, lavender, basil, and chives also contribute to this bene cial system.
The goal is to ensure diversity in leaf textures, smells, and colors around your plot—as a way to contain any pests or diseases and ensure a lively and healthy dynamic. At the same time, the growth of Tomatoes shouldn’t be compromised by other vertically growing plants—light, water, and soil dynamics are key to ensuring that each plant has enough space, nutrients, and connections. The idea is to build upon mutual aid (Kropotkin 1902) for prosperity, solidarity, and survival.
So, choose the right seeds of Tomatoes, along with other companions for them to take care of one another. «Mutual aid is a form of organizing where people get to create new systems of care and generosity so we can survive.» (Spade 2020: Back cover blurb) Mutual aid operates at multiple levels—for example, the symbiotic relationship between plants and fungi in the soil, particularly around the roots—called mycorrhiza—is essential to their growth. It enhances disease resistance and supports natural plant protection processes.
For Tomato cultivation, mycorrhizal fungi can be fantastic allies, boosting healthy growth by supplying additional water and nutrients. It all connects through diversity and care.
care, for t carry the promise of resilience
Set up a small nursery—a space of possibility, resistance, and care—to start growing your seedlings. When they need to take root, place a few seeds in small pots, cradled in rich, u!y, aerated soil, full of nutrients. You want to provide the strongest foundation for those seeds to grow, much like how seeds planted in our brains need nurturing. Just as ideas need nourishment to grow into movements, these seeds demand attention, water, and the right conditions to establish deep, reciprocal connections with the living world beneath/around/within them. They will reach out, weaving networks with roots, microorganisms, minerals, and decaying organic matter—an underground commons of exchange and resilience. Once they gain strength, you can thoughtfully arrange them within the small ecosystem you envision and transplant them into the space where they will grow, resist, and eventually nourish.
You’ll have to nd a spot that receives six to eight hours of sunlight each day.
And actually, I would argue that we’re all a bit like Tomatoes …
Finding the right location is also one of the many important elements to re ect on before even starting with this project. I would invite you to think about your intentions and how this project can contribute to nourish you in multiple ways. Ideally with Tomatoes, but also on another ecosomatic level. How can taking care of a plant’s growth, water supply, soil health, pests, and diseases also be a way to meet some of your physiological needs?
In this regard, I would encourage you to identify which fundamental needs this wish, this vision of you (and your companions) growing Tomatoes, is ful lling. Is it about nding space for expression (creation), taking care of a living being (a!ection), embarking on a risky adventure to push your comfort zone (freedom), sharing a moment with other human beings around something (participation), or is it rather about simply feeding yourself (subsistence)?
In doing so, you can also re ect on where exactly you would envision these Tomatoes and others growing. Remember: if you have to water them several times a week, it would be better if they were not too far from the spaces where you work or live. Where are the spaces for growing? How can you cultivate room for nourishment?
Where are the spaces allocated for human and plant companionship?
In navigating institutional con nes, we draw inspiration from Fred Moten and Stefano Harney who describe a strategy of «sneaking into the university to steal what one can; to abuse its hospitality, to spite its mission, to join its refugee colony, its gypsy encampment, to be in but not of». (Moten & Harney 2013) This sentiment encapsulates our approach to the spaces we inhabit— spaces that are at once given, taken, and reclaimed.
Drawing on bell hooks’ concept of the margin as a site of possibility (hooks 2000) we ask: How can we reimagine and create spaces within a white supremacist, capitalist, patriarchal establishment where decolonization might take root? These margins—or «undercommons»—serve as spaces for critical engagement, but they also underscore inherent tensions and risks.
Questions of sustainability arise: How long can such spaces persist? Who shoulders the labor of maintaining them, especially within universities where positions for diasporic scholars are often short-lived or constrained by migration policies, particularly in Switzerland?
As Carol Azumah Dennis aptly describes, this is an ongoing epistemic project unfolding
«in the maroons, the hidden crevices, and alcoves of the university, in its constantly moving, shape-shifting spaces».
(Dennis 2018: 190-207)
The potentially ephemeral nature of this project also raises questions: How do we cultivate fertile ground and plant seeds in ways that allow them to germinate and ourish—within and beyond the institution—for multiple cycles to come? What can we share, pass on or leave behind? How would we like to organize and mobilize to reclaim the space for growing? For nourishing one another?
Plant your seedling—what you bury today will rise tomorrow. Once the rst leaves appear and your seedling has reached around 10 to 20 cm, you can transplant it con dently into the space you have chosen/claimed/ taken/stolen, together with the seedlings of the chosen companions. Think about the spacing for each of these plants. You already envision a bright future for them, so you need to give them their own space. Despite the interconnectivity, you have to optimize the arrangement and design it in a way that the life within your planting bed is harmonious and not su!ocating.
Maybe think about the political aspirations you would like to infuse into your Tomato-and-other-plant-setting,
in an interspecies community where everyone will grow with each other.
In a small AI exercise with my cyborg companion, I asked what those systems of plant interactions could look like under di erent socio-economic regimes— here is the funny answer:
Collectivism in the Tomato Garden:
The garden thrives as a shared commons, where every plant contributes and receives according to its needs.
Mycorrhizal fungi weave an underground network of care, redistributing water and nutrients so that no root is left dry, no plant is left struggling. Tomatoes, beans, basil, and marigolds form alliances—beans x nitrogen, Tomatoes provide shade, basil enhances avor, and marigolds o er protection. The soil itself is alive with mutual aid, a cooperative ecosystem where excess is pruned only to nourish what is weaker. The gardener acts as a steward, ensuring balance but never imposing dominance. The harvest is shared, not hoarded, and the wealth of the land circulates back into the soil, sustaining future generations of growth. Here, care is
not a commodity—it is the very fabric of survival. The underground networks of fungi act as the invisible hand of the collective, ensuring that no plant hoards resources at the expense of others. Private property dissolves; the garden belongs to all, and harvests are shared as the natural outcome of communal stewardship.
Neoliberal Capitalism in the Tomato Garden: The garden is divided into private plots, each plant left to compete for resources. Hybrid Tomato varieties, bred for high yields, demand constant input— chemical fertilizers, pesticides, and arti cial supports—to maximize short-term pro t. Monoculture dominates, eliminating diversity in the name of e iciency. Mycorrhizal fungi, once a thriving underground network of solidarity, are disrupted by overworked soil. Weak plants are discarded rather than nurtured, and the harvest is commodi ed—packaged, priced, and sold to the highest bidder. The logic is clear: grow fast, produce more, extract relentlessly. But beneath the glossy fruits, the soil is depleted, the ecosystem fragile, and the future uncertain.
Investigate the act of nourishment and center our practice on the concept of anthropophagy to challenge extractivist, patriarchal, capitalist, and colonial models. Anthropophagy—understood both biologically and metaphorically—serves as a lens to examine humanity’s relationship with food and the earth. The earth, as soil and ground, is the ultimate source of nourishment for most living beings. Yet, for centuries, Western thought has treated it
as a resource to be exploited rather than an entity with which to practice reciprocity. (Willett et al. 2019) The project ALIMENTO, curated by Adriana Dominguez, o ers a perspective into this circularity and ways in which diverse artists across the world have digested it.
At some point during the journey, your plants might need more nutrients to grow better and produce edible fruits, leaves, etc. The question of fertility depends on the soil they are growing in. Its parent material is one of the key drivers, of course—a sandy soil or a loamy soil will not o!er the same potential. And you can also attend this ground by enriching it with organic material. Some of the main nutrients your plants might need are nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K). They will also need many more micronutrients throughout the process. Some of these nutrients are available freely, openly, and continuously—within and through us. These nutrients are us and can continue to become us—I’m talking about our urine and our faeces.
This practice has eroded over time, particularly under the in uence of techno x-driven, designed linear systems. Yet, when we consider the sheer amount of food we consume daily—some transformed into energy (for us to be and exist), the rest simply expelled—we begin to see the rupture. For centuries, in the urban planning of wealthy European cities (that extended
beyond with the years), every trip to the pristine white ceramic toilet has meant ushing away between 10 and 15 liters of water, along with the nutrients our bodies release. These nutrients, instead of being returned to the land, are lost in wastewater treatment plants, deepening our alienation from our own biological cycles, from what we produce, and from our potential to reclaim sovereignty over reciprocity and circularity.
This rupture was already evident in the 19th century when Justus von Liebig warned: «Every system of farming based on the spoliation of the land leads to poverty. Rational agriculture, in contrast, is based on the principle of restitution; by giving back to the elds the conditions of their fertility, the farmer ensures the permanence of the latter.»
(Liebig 1859: 175-178)
Marx and Liebig, in their exchange, pointed to the industrial absurdity of this metabolic disconnection. More recently, John Bellamy Foster has built on this critique, stating that: «Marx employed the concept of metabolic rift to capture the material estrangement of human beings in capitalist society from the natural conditions of their existence. To argue that large-scale capitalist agriculture created such a metabolic rift between human beings and the soil was to argue that basic conditions of sustainability had been violated.» (Foster 1999: 380)
Addressing the metabolic rift requires a shift towards regenerative solutions
which reconnect humanity with nature. We emphasize interdependence and stewardship as cornerstones of sustainable and just futures.
In this ongoing cycle of extraction and waste, what is lost is not just fertility but an entire way of being in relation with one another—one where care, reciprocity, and interconnectedness are central rather than discarded as excess.
Wonderfully, initiatives have emerged to question this practice and nd ways to prevent this waste. In fact, the composting toilets you often see around are great examples of turning waste into something useful. There are many ways to hack these systems and close the loops once again. As you might have noticed, this journey is multilayered and circular, full of loops, cycles, and disruptions.
The collective Las Polinizadora (Gabriela León y María García Ibañez) and the scientist Sandra Elizabeth Smith Aguilar in Oaxaca, Mexico, have developed a Cacoteca. 3
In the Cacoteca you will nd information related to the di!erent types of ecological toilets, composting, the history of faeces, and to some of its curiosities.
More concretely, bringing nutrients to your plants can take many forms. You might rely on other plants, such as legumes, which x nitrogen and return it to the roots
of your Tomatoes. You could also source manure from nearby farms, maintain a simple compost system, or explore more radical approaches like urine fertilizer. Even co-composting—a mixture of organic waste and other nutrient-rich materials—o!ers another way to close the nutrient cycle e!ectively.
The act of growing food carries these care practices— it is about more than just cultivating Tomatoes to cook for someone—it is about nourishing loved ones. It is an ongoing engagement in nurturing relationships, feeding cycles of circularity and reciprocity, not only with the people around you but also with the earth and the plants themselves. Throughout this process, care extends beyond the harvest.
If we would like to embark on a transformative journey which would carry hope for the future, grief for what was, and acceptance of what is and what could be—then care is a central practice to leave space and time for.
Care4
The principle of care replaces the techno-scienti c ideal of control in agrifood system sustainability and the neoliberal tinge of «food security».5 and establishes the ethical foundation of food sovereignty.6
Care recognizes the role of women, children, migrants and many others, whose indispensable contributions to food production are often neglected.7 It emphasizes mutual producer-consumer interests in agrifood systems as well as interconnectedness and interdependencies within local and even global food networks. Care brings attention to the need to establish multispecies-sustainability policies based on the recognition of the multitude of animal, vegetal, fungal, and microbial agents shaping shared landscapes8 even as these are co-constructed and co-stewarded across large geographical and relational distances.9 The principles of care and commons are often grounded in diverse syncretic forms of traditional agricultural knowledge and spirituality, including an awakened sense of belonging to the «spirited» web of living beings.10
7. Recognize, repair, and regenerate — no struggle is isolated
Know your product. The stories of Tomatoes around the world have been the stories of migration, movement, and of sharing moments and recipes. They have also been the stories of slavery, exploitation, and degradation of the land.
The expansion of intensive fresh- fruit- and- vegetables (FFVs) production in Southern Europe has rested on the recruitment of a large international migrant workforce during the last four decades. Abundant evidence points
to a considerable level of maltreatment and exploitation of this workforce, partly resulting from neoliberal interventions leading to disempowerment of labor unions, reduced salaries, and increased labor exibility.
Annually, thousands of Moroccan seasonal migrants travel to Spain for the harvest season. In 2001, Morocco and Spain signed an agreement, allowing seasonal laborers to pick fruit in Spain on temporary visas. (Anouar 2022)
And if today more human beings on the planet are eating Tomatoes, this goes hand in hand with industrial food systems which are driving forces of the climate crisis. In the same way, they are vulnerable to the climate shocks they themselves are accelerating.
And in the past, with pizza or any dish containing Tomatoes you have eaten, there is probably somewhere around the world a story of oppression, land eviction, or destruction. So, yes! Growing your own Tomatoes is disruptive, and it’s also interesting in terms of growing awareness and kinship.
Commons11
The principle of food as a commons rather than a commodity already informs many approaches to land management and access to food.
It exists alongside diverse similar notions found across cultures and re ects food’s many dimensions, from necessity for human life to expression of cultural identity. «The end-goal of a food commons system should not be pro t maximization but rather increasing food access in ways that are fair to producers and consumers, build community and shorten the distance from eld to table […] all the while stewarding natural resources for future generations».
(Vivero-Pol 2018: 32) Communal stewardship of food systems allows people to experience natural abundance, which helps to unlearn damaging patterns of behavior driven by the experience of arti cial scarcity under private ownership.12 Re-commoning—reversing the process of «accumulation by dispossession»—
(Harvey 2003: 137) literally and conceptually opens access to space required for post-growth food systems. Land, soil, water, seeds, equipment, techniques, knowledge and skills— each of these resources can be managed through commoning as a way of being13 practised by humans and non-humans alike. This principle is applied in the various contemporary attempts to advance the governance of agrifood systems through practices of «food democracy».
(Bornemann & Weiland 2019)
«In the last half-century, a reductionist and mechanistic paradigm has privatized seeds, destroyed diversity, and discredited farmers’ knowledge, enabling corporate control of agriculture.» (Shiva 2016)
This concentration of power not only accelerates environmental destruction but also perpetuates deep inequalities. The wealthiest 10% of the global population are responsible for over half of global emissions, yet it is the most vulnerable— those least responsible—who bear the brunt of climate change.
Amidst this imbalance, a crucial question arises: Who is truly feeding the world? Despite the dominance of industrial agriculture, small-scale farmers and family farms are responsible for producing 70 to 80% of the world’s food. These farms, often smaller than two hectares, serve as the backbone of global food security and, more importantly, as the cornerstones of food sovereignty.
Women, who make up approximately 43% of the agricultural labor force in the global majority, play a pivotal role at every stage of food production. It is evident that the sustainability of
agroecosystems and food systems is inseparable from social justice. One concept central to this discussion is food sovereignty—de ned as «the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to de ne their own food and agriculture systems».
(La Vía Campesina, n.d.)
This de nition, crafted by those who produce food— small farmers, shers, pastoralists, and others— challenges existing power structures and demands a seat at the table for those who grow and consume food. It calls for the democratization of food systems and decision-making processes.
The Nyéléni Declaration, established in Mali in 2007, further ampli es these voices, emphasizing the need to address food sovereignty in African contexts.
(Nyéléni Declaration 2007)
Post-independence: many African nations inherited plantation systems rooted in colonial legacies of monoculture and cash crops—such as cocoa, co ee, tea, bananas, and nowadays also Tomatoes—designed to serve export markets rather than local food needs. These systems, focused on economic gain, perpetuated food insecurity and dependency on volatile global markets. In response, African peasant organizations have emerged
as resilient forces advocating for systemic change. Shaped by diverse histories of colonial oppression, national liberation struggles, and failed development policies, these movements re ect the rich and varied dynamics of social mobilization across the continent. However, the challenges faced by agrarian communities and rural populations remain as varied as their histories.
Food security can theoretically be achieved through fast food and supplements. But what truly matters is rooting food production and nutrition in the land, the territories, and the cultures that sustain them. Only by empowering communities to reclaim sovereignty over their food systems can we ensure sustainable and just solutions for the future.
So, when we engage in this act of growing—with limited space, time, and competency—we must acknowledge that we are far from truly growing our own food. Instead, we are engaging in a process of relationality, questioning the bigger picture, paving ways to reinvent ourselves, and regenerating kinship. This is a practice of resistance and existence.
With our gestures, we challenge the larger dynamics. With our movements, we reclaim the space that was taken from us. With our harvest, we re ect on our next supermarket trip and
acknowledge the lives of the many who are oppressed by the system—the lives of the many who are silenced, invisibilized, and dehumanized.
We bring humanity back into the process of eating, feeding, and caring.
In this process, we’ve learned and committed ourselves to creating space for re ection, questioning, and archiving—engaging with food in an ambivalent relationship. We will continue to visit the supermarket when the craving for Tomatoes hits, and it’s okay to leave room for inconsistency at times. These moments, too, are part of the journey. From these liminal sites of knowledge production, we aim to re-center marginalized practices and voices, while critically re ecting on our own complicity within the very structures we critique.
9. A meal is never just a meal— it carries histories, hands, and hopes
Here they are—the nourishing foods you have tended to with care, cultivated together across time and space. And now, a new layer of knowledge unfolds: how to prepare them, how to connect with the produce in a way that honors its journey—from soil to plate, from seed to sustenance. We cherish and honor the fruits of our process, seeking to enhance their avor, texture, and color—a pinch of salt, a drizzle of olive oil. We add the herbs we have grown alongside them, savoring each bite.
And when we want to perfect the dish or connect it with familiar avors, we can always call our kin to learn the best way to cook them.
Remember to save some seeds from your Tomatoes, holding hopes and promises for new beginnings, so you can grow new plants and share fresh meals with your loved ones, continuing to feed the timeless dances of circularity and reciprocity with one another.
Undercommons: a term used by Fred Moten and Stefano
Harney to describe spaces of resistance within dominant institutions
Extractivism: the practice of exploiting natural resources for pro t, often associated with colonial and capitalist systems
Food Sovereignty: the right of people to de ne their own food systems, including production, distribution, and consumption, free from external domination
Circularity/Reciprocity in Food Systems: the concept of sustainable, reciprocal relationships between humans, the earth, and non-human entities in food production
Decolonization: the process of challenging and undoing colonial legacies within knowledge systems, institutions, and social practices
Anthropophagy: explored both biologically and metaphorically in the context of nourishment and human relationships to the earth
Metabolic Rift: a concept critiquing the disconnection between humans and ecosystems, often attributed to industrialization and capitalism
Regenerative Solutions: solutions that focus on reconnecting humanity with nature through agroecology, emphasizing interdependence and stewardship
Seed Sovereignty: the right of farmers to save, use, exchange, and sell their own seeds—First Nations Development Institute
References/Further Readings
Altieri, Miguel A.; Nicholls, Clara Ines. (2020). Agroecology and the emergence of a post COVID-19 agriculture. Agriculture and Human Values 37(3), 525-526.
Anouar, Souad. (2022, September 16). Spain to hire 11,000 Moroccan seasonal workers for strawberry harvest. Morocco World News https://www.moroccoworldnews. com/2022/09/41497/spain-to-hire-11000-moroccan-seasonal-workers-forstrawberry-harvest/
Bornemann, Boris; Weiland, Sabine. (2019). New perspectives on food democracy. Politics and Governance, 7(1), 1–7.
Brock, Samara, et al. (2024). Knowledge democratization approaches for food systems transformation. Nat Food 5, 2024 5(5), 342–345.
Chaudhary, Abhishek, et al. (2015). Quantifying Land Use Impacts on Biodiversity: Combining Species–Area Models and Vulnerability Indicators. Environmental Science & Technology 49(16), 9387-10254.
Clapp, Jennifer. (2019). The rise of financial investment and common ownership in agrifood firms. Review of International Political Economy 26(4), 604-629.
Dennis, Carol Azumah. (2018). Decolonising Education: A Pedagogic Intervention. In Bhambra, Gurminder K.; Nişancio%lu, Kerem; Gebrial, Dalia (eds.) Decolonising the University, 190-207. London: Pluto Press.
FAO. (2015). A groecology for Food Security and Nutrition: Proceedings of the FAO International Symposium. 18-19 September 2014, Rome, Italy.
Folke, Carl; et al. (2019). Transnational corporations and the challenge of biosphere stewardship. Nature Ecology & Evolution 3(10), 1396-1403.
Foster, John Bellamy. (1999). Marx’s theory of metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology. American Journal of Sociology, 105(2), 366–405.
Godfray, H. Charles J.; et al. (2010). Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science 327(5967).
Harvey, David. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.
HLPE. (2019). Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. http://www.fao.org/3/ ca5602en/ca5602en.pdf
hooks, bell. (2000). Feminist Theory: From Margin to Center. Boston: South End Press.
Kropotkin, Pëtr. (1902). Mutual Aid: A Factor of Evolution The Anarchist Library. https://theanarchistlibrary.org/ library/petr-kropotkin-mutual-aida-factor-of-evolution
La Vía Campesina. (n.d.). What is food sovereignty?
Available at https://viacampesina. org/en/what-is-food-sovereignty/
Liebig, Justus von. (1859). Letters on modern agriculture New York: J. Wiley.
McGreevy, S. R., Rupprecht, C. D. D., Niles, D., et al. (2022). Sustainable agrifood systems for a post-growth world. Nature Sustainability, 5(12), 1011–1017. https://www.nature.com/ articles/s41893-022-00933-5
Moten, Fred; Harney, Stefano. (2013). The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study London: Minor Compositions.
Nyéléni Declaration. (2007). Declaration of the Forum for Food Sovereignty. https://nyeleni.org/IMG/ pdf/DeclNyeleni-en.pdf
Poore, Joseph; Nemecek, Tomas. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 360(6392), 987-992.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity; UNEP World Conservation Monitoring Centre. (2010). Global biodiversity outlook 3. Montréal.
Shado Magazine. (n.d.). What is seed sovereignty? Retrieved from https:// shado-mag.com/know/seed-sovereignty/
Shiva, Vandana. (2016). Who really feeds the world? The failures of agribusiness and the promise of agroecology Berkeley CA: North Atlantic Books.
Shukaitis, Stevphen (2009) Space is the (non)place: Martians,
Marxists, and the outer space of the radical imagination. The Sociological Review 57(1).
Spade, Dean. (2020). Mutual Aid: Building Solidarity During This Crisis (and the Next). London/Brooklyn NY: Verso.
Springmann, Marco; et al. (2018). Options for keeping the food system within environmental limits. Nature 562(7728), 519-525.
United Nations. (2018). UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP). Full text available at: https://www. geneva-academy.ch/joomlatools-files/ docman-files/UN%20Declaration%20 on%20the%20rights%20of%20peasants. pdf
Vermeulen, Sonja J., et al. (2012). Climate change and food systems. Annual Review of Environment and Resources 37, 195-222).
Vivero-Pol, José Luis. (2018). The idea of food as a commons. In Vivero-Pol, José Luis; Ferrando, Tomaso; De Schutter, Olivier; Mattei, Ugo (eds.), Routledge Handbook of Food as a Commons (pp. 25–41). London: Routledge.
Willett, Walter, et al. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet 393(10170), 447-492.
Zhang, X., et al. (2019). Managing nitrogen for sustainable development. Nature 528(7580), 51-59.
… and for more about actually growing Tomatoes: https:// www.wikihow.com/Grow-a-Tomato-Plant
Endnotes
1 Website: https:// www.sativa.bio/en/
2 Companion planting charts: https://growincrazyacres.com/ companion-planting-chart/
3 La Cacoteca: http:// lapolinizadora.com/cacoteca-4/
4 See Puig de la Bellacasa, María. (2017). Matters of care: Speculative ethics in a more than human world. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.
5 See McGreevy, S. R., Rupprecht, C. D. D., Niles, D., et al. (2022). Sustainable agrifood systems for a post-growth world. Nature Sustainability, 5(12), 1011–1017. https://www.nature.com/articles/ s41893-022-00933-5
6 See Vía Campesina. (1996). The right to produce and access to land: Position of the Vía Campesina on food sovereignty, presented at the World Food Summit, 13–17 November, Rome. Vía Campesina.
7 See Barca, Stefania. (2020). Forces of reproduction: Notes for a counter-hegemonic Anthropocene. Cambridge University Press.
8 See Rupprecht, Christopher D. D., et al. (2020). Multispecies sustainability. Global
Sustainability, 3, E3. https:// doi.org/10.1017/sus.2020.1
9 See Weber, H., Wiek, A., Lang, D. J. (2020). Sustainability entrepreneurship to address large distances in inter-national food supply. Business Strategy and Development, 3(3), 318–331. https://doi.org/10.1002/bsd2.108
10 See Orr, David W. (2002). Four challenges of sustainability.Conservation Biology, 16(6), 1457–1460.; and also: Chabay, Ilan; Koch, Larissa; Martinez, Grit; Scholz, Geeske. (2019). Influence of narratives of vision and identity on collective behavior change. Sustainability, 11(20), 5680. https://doi.org/ 10.3390/su11205680
11 See McGreevy, Steven R.; Rupprecht, Christoph D.D.; Niles, Daniel; et al. (2022). Sustainable agrifood systems for a post-growth world. Nat Sustain 5, 1011–1017.
12 See Kallis, Giorgos. (2019). Limits: Why Malthus was wrong and why environmentalists should care. Stanford University Press.
13 See also Bollier, David, Helfrich, Silke. (2015). Patterns of commoning. Commons Strategy Group and Off the Common Books.
… shape community practices.
… invite to tune in, listen, and resonate.
… sow connection through creative exchange … sow connection through creative exchange
1. Begin with a question
Was bewegt dich? Was möchtest du teilen, hören, verstehen?
Lass eine erste Idee wachsen.
2. Gestalte einen Ort, der Austausch erlaubt
Schaffe Raum – auf Papier, am Tisch, im Gespräch, in dem Gedanken fliessen können. Offen, verspielt, sicher.
3. Lade andere ein Verbindung entsteht durch Beteiligung. Ob still oder laut, analog oder digital: Jeder Beitrag zählt.
4. Finde gemeinsame Sprachen Bilder, Worte, Gesten, Farben – kreative Kommunikation kennt viele Wege. Ermutige Vielfalt.
5. Dokumentiere die Vielfalt Sammle, was entsteht. Nicht um zu bewerten, sondern um sichtbar zu machen, was möglich ist, wenn Menschen ihre Perspektiven teilen.
6. Lass es weiterziehen
Wie Samen im Wind: Lass die entstandenen Gedanken neue Orte finden – durch Reproduktion, Ausstellung oder Weitergabe.
1. Begin with a question
Was bewegt dich? Was möchtest du teilen, hören, verstehen?
Lass eine erste Idee wachsen.
2. Gestalte einen Ort, der Austausch erlaubt
Schaffe Raum – auf Papier, am Tisch, im Gespräch, in dem Gedanken fliessen können. Offen, verspielt, sicher.
3. Lade andere ein Verbindung entsteht durch Beteiligung. Ob still oder laut, analog oder digital: Jeder Beitrag zählt.
4. Finde gemeinsame Sprachen
Bilder, Worte, Gesten, Farben – kreative Kommunikation kennt viele Wege. Ermutige Vielfalt.
5. Dokumentiere die Vielfalt Sammle, was entsteht. Nicht um zu bewerten, sondern um sichtbar zu machen, was möglich ist, wenn Menschen ihre Perspektiven teilen.
6. Lass es weiterziehen
Wie Samen im Wind: Lass die entstandenen Gedanken neue Orte finden – durch Reproduktion, Ausstellung oder Weitergabe.
… moving withMitwelt … moving withMitwelt
1. Take a moment to perceive your current location
Tune into sensory information such as sounds, smells, sights, air, temperature, textures of the ground. What can you notice?
2. Locate a place you feel invited to What’s a place in this space you’re curious about? Imagine the most obvious pathway you could take to that place.
3. Find an alternative route to that place
How can you go along this alternative route with a sense of wonder? Move in a tempo that feels suitable for the route you choose. In which ways can you be present for the encounters along the way? Adjust your tempo to get in touch with whom you’re crossing ways.
4. Let yourself arrive in the place What position supports you in arriving in the place? If you have the impulse to do so, take a moment for a small gesture to acknowledge the togetherness with the place you’re in.
5. Share or remember some experiences along the way Whom do you want to share your experiences with? Write about an encounter or draw what shows up. Share it with a human or otherthan-human companion.
1. Take a moment to perceive your current location
Tune into sensory information such as sounds, smells, sights, air, temperature, textures of the ground. What can you notice?
2. Locate a place you feel invited to What’s a place in this space you’re curious about? Imagine the most obvious pathway you could take to that place.
3. Find an alternative route to that place
How can you go along this alternative route with a sense of wonder? Move in a tempo that feels suitable for the route you choose. In which ways can you be present for the encounters along the way? Adjust your tempo to get in touch with whom you’re crossing ways.
4. Let yourself arrive in the place What position supports you in arriving in the place? If you have the impulse to do so, take a moment for a small gesture to acknowledge the togetherness with the place you’re in.
5. Share or remember some experiences along the way Whom do you want to share your experiences with? Write about an encounter or draw what shows up. Share it with a human or otherthan-human companion.
1. Gestalte offene Räume, in denen Menschen auf Augenhöhe reflektieren und gestalten können.
2. Setze einfache, aktivierende Impulse, z. B. Fragen, Materialien oder symbolische Handlungen – als Einladung zum Tun.
3. Vertraue darauf, dass kleine Gesten wie Samen wirken: Sie müssen nicht vollständig geplant sein, um Wirkung zu entfalten.
4. Ermögliche Verbindung durch geteilte Kreativität –zeitversetzt, persönlich oder kollektiv.
5. Dokumentiere, was entsteht, als Zeichen eines wachsenden Netzwerks, nicht als Abschluss.
1. Gestalte offene Räume, in denen Menschen auf Augenhöhe reflektieren und gestalten können.
2. Setze einfache, aktivierende Impulse, z. B. Fragen, Materialien oder symbolische Handlungen – als Einladung zum Tun.
3. Vertraue darauf, dass kleine Gesten wie Samen wirken: Sie müssen nicht vollständig geplant sein, um Wirkung zu entfalten.
4. Ermögliche Verbindung durch geteilte Kreativität –zeitversetzt, persönlich oder kollektiv.
5. Dokumentiere, was entsteht, als Zeichen eines wachsenden Netzwerks, nicht als Abschluss.
Because the most sustainable clothes are the ones we already have.
1. Wähle ein Kleidungsstück, das du schon (zu) lange besitzt.
2. Mach dich frei vom «richtigen» Gebrauch: Es ist nur Stoff – deiner Interpretation überlassen.
3. Trag es als etwas anderes als es ist –auf links, verkehrt herum, umfunktioniert.
4. Experimentiere
5. Achte auf das Gefühl: Was verändert sich?
6. Wiederhole den Prozess Es geht nicht ums Resultat, sondern ums Spiel.
7. Mach dir bewusst:
Styling ist mehr als ein Look. Es ist eine Haltung, ein Spiel mit Bedeutungen, ein Akt der Aneignung. Und manchmal auch: ein stiller Widerstand.
Because the most sustainable clothes are the ones we already have.
1. Wähle ein Kleidungsstück, das du schon (zu) lange besitzt.
2. Mach dich frei vom «richtigen» Gebrauch: Es ist nur Stoff – deiner Interpretation überlassen.
3. Trag es als etwas anderes als es ist –auf links, verkehrt herum, umfunktioniert.
4. Experimentiere
5. Achte auf das Gefühl: Was verändert sich?
6. Wiederhole den Prozess Es geht nicht ums Resultat, sondern ums Spiel.
7. Mach dir bewusst: Styling ist mehr als ein Look. Es ist eine Haltung, ein Spiel mit Bedeutungen, ein Akt der Aneignung. Und manchmal auch: ein stiller Widerstand.
… are passed on through conversations and stories.
… question the relationship with matter.
Wie wäre es, wenn ein Buch keinen Anfang und kein Ende hätte? Kein fixes Cover, sondern mehrere Lesearten – viele mögliche Einstiege und viele Arten, Wissen zu begegnen?
Es würde bedeuten, dass uns auch das Wissen des Sauerteigs beschäftigt. Was sagt ein fermentierender Starter über seine Umgebung aus – über das Mehl, die Luft, die Menschen, die ihn berühren? Und was entsteht, wenn man diesen Prozessen wirklich zuhört?
Maciej Chmara macht das Fermentieren zum Ausgangspunkt für eine präzise und eigenwillige Forschung an den Schnittstellen von Architektur, Alltagskultur und Mikrobiologie. Zwischen Einmachgläsern, wilden Hefen und eigenen Achselbakterien entfaltet sich ein dichtes Geflecht.
Diese Publikation ist ein Reader zum Jahresthema gathering/situating knowledges, das sich am HyperWerk 2024/25 entfaltete – in Workshops, Gesprächen, Praktiken. Maciej Chmaras Experimente mit Sauerteig sind ein Beispiel für situiertes Wissen: Ein Stück Brot verwandelt sich in ein Archiv. Was können wir lernen, wenn wir unserer mehr-als-menschlichen Umgebung wirklich zuhören?
Situiert im Globalen.
Kulturwissenschaftliche Naturgeschichten
Karin Harrasser
Gathering Knowledges from the Rubble: Against Scholasticide
Kevin Okoth
How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik
Gathering Yeasts
Maciej Chmara (Chmara.Rosinke)
On sensory mapping, water stories, and listening to landscapes. An interview with Wency Mendes
Ann Mbuti
From Licence to Commitment
Eva Weinmayr
Editorials
Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
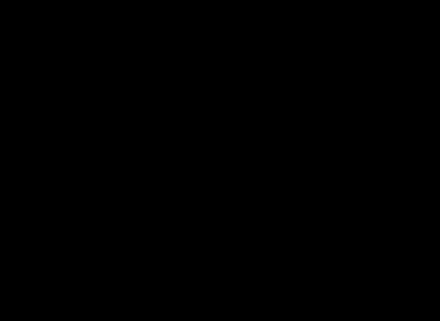
Maciej Chmara is part of Chmara.Rosinke. He and Anna Rosinke head the interdisciplinary design studio, which is based in Vienna and Berlin. Their background includes a wide range of fields from drawing, art history, architectural theory to interior and object design, which allows them to develop a good understanding of creative work and its realization. Since the beginning of their cooperation, they use the kitchen as a medium to research social constellations, urban space, and cooking as an aesthetic practice. In their current research projects, microbiology and mental health in the context of food preparation play a big role.
Während ich dies schreibe, stehen in meiner Küche fünf kleine nummerierte Einmachgläser mit einer Agar-Zuckerlösung, auf der sich verschiedenfarbige Schimmelpilze und auch Hefekolonien bilden. Über den drei größeren Gläsern schwebt immer mal wieder eine Frucht iege. Der Inhalt der Gläser riecht sehr interessant, leicht joghurtig-käsig, mit einer aromatischen Tiefe, aber absolut angenehm. Zumindest sehe ich das so. Meine Partnerin beförderte die Fermente auf den Balkon und meint, den Gestank nicht aushalten zu können.
So einen Sauerteigansatz hatte ich noch nie –normalerweise fermentiert Hefe oder Sauerteig bei Zimmertemperatur ideal, aber diese Probe hat immer noch keine hohe Triebkraft und fermentiert nur bei Kühlschranktemperaturen. Ich bin gespannt, wie sich diese Sauerteige entwickeln, welche Mikroorganismen dominieren werden, und ob sie eine Verbindung zum Ort ihrer Entnahme haben – dem Gelände der alten Malzfabrik in Berlin. Inzwischen wurde das erste Brot damit gebacken, und tatsächlich riecht es ein wenig wie ein knusprig mit Käse überbackenes Brötchen.
Letztes Jahr habe ich begonnen, immer mal wieder kleine «Hefefallen» im Wald, im Garten, am See aufzustellen oder Hefen von Äpfeln oder Erdbeeren zu entnehmen, um die Mikroorganismen dann in sterilisiertem Mehl zu vermehren, bis ich mir sicher sein konnte, dass die im Mehl von Natur aus enthaltenen
Mikroben den Starter nicht dominieren würden. Das Ergebnis war erstaunlich. Die unterschiedlichen Mikroorganismen hatten nicht nur, wie erwartet, einen Ein uss auf Triebkraft und Aroma, sondern viele der Brote entwickelten auch unterschiedlich starke Bräune während des Backvorgangs, auch wenn sie unter exakt denselben Bedingungen nebeneinander in einem Bäckerofen gebacken wurden.
Unter Hefe wird meist industrialisierte Back- oder Bierhefe verstanden, Saccharomyces cerevisiae, die wir in Form von Hefewürfeln oder Trockenhefe in jedem Supermarkt kaufen können. In der Industrie werden die Eigenschaften unterschiedlicher Hefearten, teilweise in Kombination mit verschiedenen Bakterienarten, genutzt, um zum Beispiel Brot, Wein, Kakao, Biokraftsto!e oder auch neuartige Biomaterialien herzustellen.
Seitdem während der COVID-Lockdowns wegen Hamsterkäufen Hefe in den Läden rar war und in weiten Teilen der Gesellschaft Sauerteigbrot ein Comeback feierte, ist Hefe in Verruf geraten. Behauptungen haben sich verbreitet, wonach in Sauerteig keine Hefe enthalten sei, sondern die Fermentation alleine über Milchsäurebakterien ablaufe, oder wonach Sauerteigbrot kein Gluten beinhalte. Das stimmt alles nicht. Auch im Sauerteig sind Hefen enthalten, nur eben nicht immer; aber oft auch Saccharomyces cerevisiae,
die ebenfalls in der Natur vorkommen kann. Der große Unterschied ist, dass Sauerteig eine Gesellschaft unterschiedlicher mikrobieller Arten ist, die aus Hefepilzen, Milchsäurebakterien und unter Umständen auch Essigsäurebakterienarten besteht. Durch diese Vielzahl an Arten entsteht ein komplexerer Fermentationsprozess, der das Endprodukt – das Brot – geschmacklich attraktiver und auch bekömmlicher machen kann, als wenn der Fermentationsprozess über eine einzige Hefeart abläuft.
Wenn sich die im Starter enthalten Mikroorganismen auf das Mehl-Wasser-Gemisch stürzen, produzieren sie Alkohol, Kohlensäure, Milchsäure und Essigsäure. In geringem Maße können auch andere Säuren produziert werden, welche dem Brot einen charakteristischen Geschmack verleihen. Diese Vielfalt an Mikroorganismen ist in der Lage, auch komplexere Kohlenhydrate zu fermentieren, wie sie zum Beispiel in Roggenmehl enthalten sind. Einfache Bierhefe kommt damit nicht zurecht.
Mein Sauerteig beinhaltet zwei dominante Hefepilzarten (Saccharomyces paradoxus, die eigentlich in Nordeuropa heimisch ist, und Kazachstania unispora), zwei dominante Milchsäurebakterienarten (Pediococcus parvulus und Lactobacillus parabrevis) und einen dominanten Essigsäurebakterienstamm (Endobakter medicaginis).
Die genetische Sequenzierung meines Starters hat gezeigt, dass außer diesen noch zig andere Arten in geringer Anzahl vorhanden sind. Ich kann nicht sagen, welchen Ein uss diese nicht dominanten Mikroorganismen auf den Sauerteig und mein Brot haben.
Auf Basis einer vergleichenden genetischen Untersuchung ist aber klar, dass diese Mikroorganismen einen festen Platz in der Gesellschaft haben: dass ihre Konzentrationen sich an anderen Orten, mit anderer Fütterung und anderen Bäcker*innen zwar ändern, die Stämme aber stabil bleiben. Die einzelnen Mikroorganismen produzieren allesamt Gifte wie Alkohol, Kohlen-, Milch- und Essigsäure. Im Prinzip bekriegen sie sich von Anfang an, bis sie es scha!en, eine stabile Gesellschaft aufzubauen, in der jede das Gift der anderen mikrobiellen Art akzeptiert oder lernt, sich anzupassen. Erst wenn die Mikroorganismen zu wenig Nahrung bekommen oder zu hohen Temperaturen ausgesetzt sind, kann das System zusammenbrechen. So geben dem Zellbiologen Tetsuhiro Hatakeyama zufolge in der kritischen Situation des Nahrungsmangels die Hefen Gifte in ihre Umgebung ab, die andere Mikroorganismen abtöten. (Hatakeyama 2022) Dabei bleiben auch Zellen, die aus derselben elterlichen Zelle hervorgegangen sind, nicht verschont. Die Hefen selbst haben eine Resistenz gegen das Gift entwickelt. Das Phänomen wurde NachzüglerTötung genannt. Bei 4 bis 8°C gekühlte Sauerteige können aber aufgrund ihrer sehr geringen Aktivität lange und stabil gelagert werden.
Es ist denkbar einfach, einen Starter anzusetzen. Manchmal braucht es ein paar Versuche, bis sich ein stabiler, aromatisch interessanter und robuster Starter bildet. Wichtig ist hierbei, der Nase und der Intuition zu vertrauen. Solange ein Starter nach Joghurt, alter Apfelhaut oder Alkohol riecht, ist alles gut. Sobald er nach altem Laufschuh oder aromatischem Schweizer Käse riecht, sollte er besser entsorgt werden. Hier ist eine Anleitung für ein einfaches Starterrezept:
Tag 1: Ein Einmachglas gut reinigen , idealerweise auskochen, dann 50g Mehl (am besten Roggenvollkornmehl) und 50ml Wasser hineingeben und mit der Hand verrühren. Das Glas o!en stehen lassen und mit einem Küchentuch abdecken.
Tag 2: 50g Mehl und 50ml Wasser hinzugeben und vermischen – immer das gleiche Mehl verwenden. Wenn Frucht iegen oder sogar Wespen um den Teig schwirren, ist das ein gutes Zeichen und muss nicht verhindert werden.
Tag 3: Die Menge verdoppeln: 100g Mehl und 100ml Wasser hinzufügen und verrühren. Das Glas mit dem Deckel verschließen. Es entstehen wahrscheinlich die ersten Bläschen.
Tag 4: Die Hälfte des Teigs aus dem Glas
herausnehmen (man kann ihn z. B. für Pfannkuchen oder Pasta verwenden). Danach wieder 100g Mehl und 100ml Wasser dazugeben. Wenn du nichts vom Teig entfernst und immer wieder gleich viel Mehl und Wasser hinzufügst – ihn also im Mehl-Wasser-Verhältnis von 1:1 anfütterst –, wächst der Sauerteig stark an – nach ein paar Tagen hast du Unmengen davon.
Tag 5: Wie Tag 4.
Ab Tag 6 oder 7: Die Bläschen werden nun immer größer, da der Sauerteig nun mikrobiell aktiv ist. Man erkennt ein Teigwachstum um 50 bis 100% innerhalb von 12 Stunden – das Zeichen, dass nun gebacken werden kann.
Der Sauerteig sollte dann etwa zwei Wochen lang täglich 1:1 gefüttert werden, bis ein stabiler Starter entsteht. Nach etwa zwei Wochen muss er nicht mehr täglich gefüttert werden, sondern kann direkt nach der Fütterung für ein paar Tage (und später auch Wochen) ohne Zufütterung in der Tür des Kühlschranks (da es dort nicht zu kalt ist) ausharren. Wenn er mehrere Wochen im Kühlschrank ohne Zufütterung liegt, kann es sein, dass er ein bis drei Tage lang angefüttert werden muss, bevor wieder damit gebacken werden kann. Hierzu sollten Blasenbildung, Wachstum und Geruch beurteilt werden. Apfelhautgeruch deutet auf die Präsenz vieler Hefen hin und ist ein Zeichen für einen aktiven Starter.
In ihrem Artikel «The ecology of insect—yeast relationships and its relevance to human industry» beschreiben Anne Madden und Rob Dunn, wie Hefen Frucht iegen und andere Insekten als Transportmittel nutzen, um zu neuen Nahrungsquellen zu gelangen. (Reese et al. 2020)
Die Insekten werden aber nicht so sehr vom Zucker oder von den Nektararomen angelockt, als vielmehr von den von Hefen produzierten Fermentaromen. Durch diese nden sie einfacher neue Futterorte. Es gibt ungefähr 1500 Hefearten. Die Beziehung zwischen Mikroorganismen und Insekten ist eine symbiotische. Bestimmte Wespen- und Bienenarten helfen Hefen sogar dabei, in ihren Mägen zu überwintern.
Es gibt nur wenig Forschung dazu, wie sich ein Sauerteig bildet und woher genau alle darin enthaltenen Mikroorganismen stammen. Der Großteil der Hefen und Bakterien stammt aus dem für den Starter verwendeten Mehl selbst, aber Kontaminationen durch Hefen und Bakterien auf unseren Händen, durch Bakterien auf Staub, durch Hefen auf Frucht iegen und anderen Insekten oder auch durch Mikroorganismen auf unseren Schüsseln und Arbeitsober ächen sind möglich. Der Sauerteig jeder Person, die mit ihren Händen damit arbeitet, ist anders und bildet einen individuellen mikrobiellen Fingerabdruck. Andersherum ist es genauso: Regelmäßig backende Personen begeben sich in einen Austausch mit ihrem Sauerteig und werden von den
Mikroorganismen des Starters bevölkert. Wir werden zu Sourdough Cyborgs.
Das Mikrobiom unserer Haut bildet eine Schutzbarriere, die Keime fernhält und unser Immunsystem unterstützt. Im Bauchnabel und unter den Achselhöhlen gibt es große Ansammlungen von Milchsäurebakterien, die (je nach Einschätzung des eigenen Körpergeruchs) auch dazu genutzt werden können, den Starter stärker zu individualisieren. In einer von mir durchgeführten Versuchsreihe habe ich genau das gemacht und den Teig wie auch das Brot einer Reihe von Personen zu riechen gegeben. Bei den Teigen (es gab Placebo-Teig, Teig mit und Teig ohne Achsel- und Bauchnabelbakterien), konnten alle Versuchspersonen, auch ich selbst, Unterschiede erriechen. Bei den dann daraus gebackenen Broten konnten nur diejenigen Versuchspersonen, die nicht meiner Familie angehören, Unterschiede herausriechen. Laut Chris Callewaert, auch Dr. Armpit genannt, kann das daran liegen, dass meine Familie an meinen Geruch, mein Mikrobiom, gewöhnt ist, dieses vielleicht auch zu einem hohen Prozentsatz teilt. (Callewaert in einem E-Mail-Austausch) Daraus lässt sich schließen, dass wir individuelle mikrobielle Vorlieben haben oder entwickeln können.
Unsere Mikrobiome
Unsere Haut beherbergt aber nur einen kleinen Teil unseres gesamten Mikrobioms. Der Großteil der zu
unserem Körper gehörigen Pilze und Bakterien be ndet sich im Darm. Diese Mikroben fermentieren und verdauen nicht nur unser Essen, sondern kommunizieren über den Vagus-Nerv mit unserem Gehirn, indem sie Botensto!e senden. Der Neurowissenschaftler Phil Burnet untersucht den Ein uss dieser Mikroorganismen auf psychische Krankheiten und das therapeutische Potenzial von Prä- und Probiotika. (Szeligowski et al. 2020)
In den letzten Jahren konnten verschiedene Forschungsgruppen die Verbesserung depressiver Zustände durch mikrobielle Therapieformen wie auch eine verbesserte Wirksamkeit von Antidepressiva nachweisen. (Minichino et al. 2020)
Gutes Brot, vor allem Vollkornbrot, enthält resistente Stärke, Inulin und Ballaststo!e und hat dadurch einen positiven Ein uss auf unser Mikrobiom. Erstaunlich ist, dass, obwohl die Mikroorganismen während des Backprozesses aufgrund der hohen Hitze sterben, sie nach Phil Burnet dennoch einen Ein uss haben. Auch tote Bakterien können teils noch gelesen werden und dazu führen, dass Botensto!e produziert werden. Auch der Mensch geht mit dem Sauerteig eine symbiotische Beziehung ein. (Carabotti et al. 2015) Mikroorganismen erhalten von uns Schutz und Nahrung in unseren Küchen, Bäckereien, Fabriken und Unterstützung bei ihrer Verbreitung, indem wir Sauerteig weitergeben, neu ansetzen oder Hefewürfel kaufen. Menschen bekommen dafür Brot, Bier, Wein, Ka!ee, Schokolade, Kimchi, Käse, Biomaterialien und vieles mehr.
Mit Hilfe von Sauerteigen, «Hefefallen» und anderen Fermentationsexperimenten können Potenziale der vielen verschiedenen Hefe- und Bakterienarten entdeckt werden, die es bisher nicht zu industriellem Maßstab gebracht haben.
Nach Dunn und Madden ist es reiner Zufall, dass gerade Saccharomyces cerevisiae so verbreitet ist. (Reese et al. 2020) Vielleicht hat sie es aber auch durch ihre E!izienz, ihr Temperaturspektrum, ihre Aromen- und Alkoholentwicklung, wie auch durch ihre Anpassung an unser menschliches Umfeld und ihre leichte Handhabung so weit gebracht, dass sie als Hefeart unsere Gesellschaft dominiert und keine Wespe mehr braucht, um in deren Magen zu überwintern. Sie überlebt auch getrocknet und in Tüten verpackt in jedem Supermarkt.
Zutaten:
150g Roggenvollkornmehl
350g Weizenmehl (Type 405er – 800er)
350ml Wasser
zwei leicht gehäufte Teelö!el Salz (10g)
zwei Esslö!el Sauerteigstarter
Alle Zutaten in einer Schüssel gut vermengen, bis ein uniformer Teig entsteht, und ca. 16 Stunden abgedeckt in der Schüssel lassen. Die Fermentationsdauer hängt stark von den Mikroorganismen, der Aktivität des Starters und von der Temperatur der Küche ab und kann zwischen 10 und 24 Stunden variieren. Hier hilft nur Beobachten. Eine perfekte universelle Regel gibt es nicht.
Wenn die Teigmenge sich durch die Fermentation ungefähr verdoppelt hat, den Teig aus der Schüssel nehmen und auf einer leicht bemehlten Fläche ausbreiten.
Wenn der Teig jetzt auf der Arbeitsober äche liegt, hebe ihn mit eher ach gehaltenen Händen an der linken Seite an und ziehe leicht, damit er sich um mindestens die Hälfte verlängert, ohne zu reißen. Dann falte ihn ungefähr bis in die Teigmitte. Wichtig ist, von oben keinen Druck auszuüben. Behandle ihn ganz sorgsam.
Jetzt hast Du eine längliche Form. Drehe sie um 90 Grad, sodass die kurzen Enden des Teigs links und recht liegen. Hebe die linke Seite wieder von unten an, ziehe sie etwas und falte den Teig. Hebe nun die rechte Seite an, ziehe sie etwas und falte den Teig, sodass eine rundliche Brotform entsteht.
In der Mitte dieser Form ist jetzt eine Naht entstanden. Versuche, diese mit der Hand etwas festzuhalten, damit der Teig nicht an Form verliert, und drehe ihn mit der Naht nach unten auf die bemehlte Fläche.
Lege ein Küchentuch in eine Schüssel – sie sollte kleiner als ein Brot sein, also eine Müslischüssel oder etwas Ähnliches – oder in einen Gärkorb und bemehle es großzügig. Den Teigling ebenfalls bemehlen und auf das Tuch legen.
Den Ofen mit einem Gusseisen-, Emaille-, Tontopf oder einem Bräter (aus Glas) darin auf 240°C gut vorheizen.
Den Teigling – er muss gut bemehlt sein, sonst klebt er am Boden fest – in den vorgeheizten Gusseisentopf legen. Deckel drauf und eine Stunde lang backen.
Quellen
Carabotti, Marilia; Scirocco, Annunziata; Maselli, Maria Antonietta; Severi, Carola. (2015, June 1). The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Annals of Gastroenterology 28(2), 203-209. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/ articles/PMC4367209/
Callewaert, Chris. (2022, 17. April). Biotech tries manipulating the skin microbiome. The Scientist. https:// www.the-scientist.com/biotech-triesmanipulating-the-skinmicrobiome-69867
Hatakeyama, Tetsuhiro. (2022, November). Starved yeast poisons clones. Universität Tokio. https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/ press/z0508_00259.html
Minichino, Amedeo; Brondino, Natascia; Solmi, Marco; Del Giovane, Cinzia; Fusar-Poli, Paolo; Burnet, Philip; Cipriani, Andrea & Lennox, Belinda R. (2020). The gut-microbiome as a target for the treatment of schizophrenia: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials of add-on strategies. Schizophrenia Research, 234, 58–70. https://doi. org/10.1016/j.schres.2020.02.012
Reese, Aspen; T. Madden; Anne A.; Joossens, Marie; Lacaze, Guylaine & Dunn, Robert R. (2020). Influences of Ingredients and Bakers on the Bacteria and Fungi in Sourdough Starters and Bread. MSphere 5:10. https://doi.org/10.1128/ msphere.00950-19
Szeligowski, Tomasz; Yun, Alexandra Lim; Lennox, Belinda R. & Burnet, Philip W. J. (2020). The Gut Microbiome and Schizophrenia: The Current State of the Field and Clinical Applications. Frontiers in Psychiatry, 11. https:// doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00156
… are found in the beauty of that which has been overlooked.
… seek to understand the dynamics at play on our plates.
… form loving relations to Found Goods … form loving relations to Found Goods
1. Gathering
Richte deine Aufmerksamkeit auf die Materialien um dich herum. Was liegt auf der Strasse, im Abfall, im Recycling? Pflege und ordne sie, gib ihnen ein Zuhause.
2. Language/Storytelling Nenne sie bei einem neuen Namen. Was als Abfall galt, wird zu Found Goods. Dieser Perspektivenwechsel ist der erste Schritt zu einer liebevollen Beziehung.
3. De-structing Fragmentiere, zerteile, queere deine Found Goods, sodass sie transformiert und ihre ursprünglichen Funktionen hinterfragt werden.
4. Trans-forming Forme, kombiniere, komponiere –liebevoll und sanft. Lass die Fragmente mitreden. Was möchten sie werden?
5. Playful Interaction
Spiele, erzähle, erkunde –Begegne den Found Goods nicht als Objekten, sondern als erzählenden Subjekten. Lächeln sie dich an? Fliegen sie davon? Lass dich von deiner Freude und Kreativität leiten.
6. Multisensory Experience
Verbinde deine Sinne, tauche ein, spüre das Dazwischen. Wie können dich diese Found Goods begleiten? Nimm die Fragmente ganzheitlich und achtsam wahr und werde dir bewusst, wie du diese Beziehung umgeformt hast.
1. Gathering
Richte deine Aufmerksamkeit auf die Materialien um dich herum. Was liegt auf der Strasse, im Abfall, im Recycling? Pflege und ordne sie, gib ihnen ein Zuhause.
2. Language/Storytelling Nenne sie bei einem neuen Namen. Was als Abfall galt, wird zu Found Goods. Dieser Perspektivenwechsel ist der erste Schritt zu einer liebevollen Beziehung.
3. De-structing Fragmentiere, zerteile, queere deine Found Goods, sodass sie transformiert und ihre ursprünglichen Funktionen hinterfragt werden.
4. Trans-forming Forme, kombiniere, komponiere –liebevoll und sanft. Lass die Fragmente mitreden. Was möchten sie werden?
5. Playful Interaction
Spiele, erzähle, erkunde –Begegne den Found Goods nicht als Objekten, sondern als erzählenden Subjekten. Lächeln sie dich an? Fliegen sie davon?
Lass dich von deiner Freude und Kreativität leiten.
6. Multisensory Experience
Verbinde deine Sinne, tauche ein, spüre das Dazwischen. Wie können dich diese Found Goods begleiten?
Nimm die Fragmente ganzheitlich und achtsam wahr und werde dir bewusst, wie du diese Beziehung umgeformt hast.
Ambre Bork
Ambre Bork
… pflanzenbasiert Wurst gestalten durch Fermentation … pflanzenbasiert Wurst gestalten durch Fermentation
Lorenz Giertz
Lorenz Giertz
1. Gemüse vorbereiten
Wurzelgemüse (z. B. Karotte, Rote Bete, Pastinake) sous-vide bei ca. 85°C für 3h garen, anschliessend 1 Stunde räuchern für ein smoky flavor. Das gegarte Gemüse 3 Tage in einem Vakuumbeutel mit Salz (2% des Gesamtgewichts) und Gewürzen nach Wahl einlegen (Pfeffer, Wacholder, usw.).
2. Beimpfen
Herausnehmen, trockentupfen und mit Koji-Sporen beimpfen: Mit einer Mischung aus Reismehl und Sporen (30g/4g) von allen Seiten bestäuben. Dies startet die zweite Fermentationsphase mit dem Schimmelpilz.
3. Koji-Fermentation
Für 36 bis max. 60h in einem Fermentationskasten mit 75% Luftfeuchtigkeit und bei 30°C fermentieren lassen, bis das Myzel das ganze Gemüse ummantelt. Für den Fermentationskasten braucht’s eine Thermobox, einen passenden Gitterrost, ein Befeuchtungsgerät, eine Wärmematte und jeweils einen Controller für Feuchtigkeit und Temperatur. So bildet sich Umami und eine feinere Textur.
4. Trocknen
Bei 55°C trocknen – für ca. 12h oder bis das Gewicht sich halbiert. Die Textur wird schnittfest und entwickelt wurstähnliche Eigenschaften. Entweder gleich geniessen oder vakuumieren für eine Haltbarkeit von bis zu 6 Monaten.
5. Reflexion im Nachgang
Als Digestif: das Nachdenken. Was bedeutet Genuss ohne Tier? Welche Rolle spielt Fermentation als Tool für die Transformation von Lebensmitteln? Was braucht mein Körper, und welche nachhaltigen Ressourcen kann ich in meine Ernährung integrieren?
Lorenz Giertz
1. Gemüse vorbereiten
Wurzelgemüse (z. B. Karotte, Rote Bete, Pastinake) sous-vide bei ca. 85°C für 3h garen, anschliessend 1 Stunde räuchern für ein smoky flavor. Das gegarte Gemüse 3 Tage in einem Vakuumbeutel mit Salz (2% des Gesamtgewichts) und Gewürzen nach Wahl einlegen (Pfeffer, Wacholder, usw.).
2. Beimpfen
Herausnehmen, trockentupfen und mit Koji-Sporen beimpfen: Mit einer Mischung aus Reismehl und Sporen (30g/4g) von allen Seiten bestäuben. Dies startet die zweite Fermentationsphase mit dem Schimmelpilz.
3. Koji-Fermentation
Für 36 bis max. 60h in einem Fermentationskasten mit 75% Luftfeuchtigkeit und bei 30°C fermentieren lassen, bis das Myzel das ganze Gemüse ummantelt. Für den Fermentationskasten braucht’s eine Thermobox, einen passenden Gitterrost, ein Befeuchtungsgerät, eine Wärmematte und jeweils einen Controller für Feuchtigkeit und Temperatur. So bildet sich Umami und eine feinere Textur.
4. Trocknen
Bei 55°C trocknen – für ca. 12h oder bis das Gewicht sich halbiert. Die Textur wird schnittfest und entwickelt wurstähnliche Eigenschaften. Entweder gleich geniessen oder vakuumieren für eine Haltbarkeit von bis zu 6 Monaten.
5. Reflexion im Nachgang
Als Digestif: das Nachdenken. Was bedeutet Genuss ohne Tier? Welche Rolle spielt Fermentation als Tool für die Transformation von Lebensmitteln? Was braucht mein Körper, und welche nachhaltigen Ressourcen kann ich in meine Ernährung integrieren?
Lorenz Giertz
… comfort common –eine kulinarische Suche nach Ruhe und Sicherheit
Nina Carla Hunziker
… comfort common –eine kulinarische Suche nach Ruhe und Sicherheit
Nina Carla Hunziker
1. Wähle Vertrautes
2. Nutze Reduktion
3. Schaffe Struktur
4. Finde Orientierung
5. Kreiere Rituale
Nina Carla Hunziker
1. Wähle Vertrautes
2. Nutze Reduktion
3. Schaffe Struktur
4. Finde Orientierung
5. Kreiere Rituale
Nina Carla Hunziker
1. Kapazitäten ernst nehmen
Mach dir bewusst, dass Ruhe individuell verschieden aussieht und das Bedürfnis nach «rest» unterschiedlich ist. Was sind deine restful practices?
2. «Rest» als politische Praxis verstehen
Hinterfrage kapitalistische Vorstellungen von Produktivität. Rest ist ein Akt der Fürsorge, Selbstermächtigung und Disability
Justice. Wie denkst du über dein Bedürfnis nach Erholung nach?
Ist «wertvoll» ein Teil davon?
3. «Rest» sichtbar, fassbar machen
Nutze textile Handarbeit (z. B. Fäden, Plüschfiguren) als Einladung, über Ruhe neu nachzudenken – als aktive, kreative Praxis. Textile Techniken sind anpassbar: Sie lassen sich dem eigenen Energielevel, Tempo und Bedürfnis anpassen. Welche Formen gibst du deiner restful practice?
4. Material als Sprache nutzen Fäden, Stoffe, Plüschfiguren: Materialien können helfen, komplexe Gedanken zu greifen, zu übersetzen und in Beziehung zu bringen – auch jenseits von Worten. Welche Nachrichten an dein zukünftiges Ich enthält ein Objekt?
5. Gemeinsam verweilen Ruhen bedeutet nicht immer Alleinsein. Durch gemeinsames Machen entsteht Verbindung –eine Form von Intimität, die weder körperliche Nähe noch Leistung verlangt. Welche Form von zusammen Sein entspricht deinen aktuellen Bedürfnissen?
1. Kapazitäten ernst nehmen
Mach dir bewusst, dass Ruhe individuell verschieden aussieht und das Bedürfnis nach «rest» unterschiedlich ist. Was sind deine restful practices?
2. «Rest» als politische Praxis verstehen Hinterfrage kapitalistische Vorstellungen von Produktivität. Rest ist ein Akt der Fürsorge, Selbstermächtigung und Disability Justice. Wie denkst du über dein Bedürfnis nach Erholung nach? Ist «wertvoll» ein Teil davon?
3. «Rest» sichtbar, fassbar machen Nutze textile Handarbeit (z. B. Fäden, Plüschfiguren) als Einladung, über Ruhe neu nachzudenken – als aktive, kreative Praxis. Textile Techniken sind anpassbar: Sie lassen sich dem eigenen Energielevel, Tempo und Bedürfnis anpassen. Welche Formen gibst du deiner restful practice?
4. Material als Sprache nutzen Fäden, Stoffe, Plüschfiguren: Materialien können helfen, komplexe Gedanken zu greifen, zu übersetzen und in Beziehung zu bringen – auch jenseits von Worten. Welche Nachrichten an dein zukünftiges Ich enthält ein Objekt?
5. Gemeinsam verweilen Ruhen bedeutet nicht immer Alleinsein. Durch gemeinsames Machen entsteht Verbindung –eine Form von Intimität, die weder körperliche Nähe noch Leistung verlangt. Welche Form von zusammen Sein entspricht deinen aktuellen Bedürfnissen?
… make me smile
Knowledges which …
… invite closeness, exchange, and the holding of hands.
Wie wäre es, wenn ein Buch keinen Anfang und kein Ende hätte? Kein fixes Cover, sondern mehrere Lesearten – viele mögliche Einstiege und viele Arten, Wissen zu begegnen?
Es würde auch Verlernen bedeuten. Wenn Wency Mendes von «sensory mapping» spricht, meint er weit mehr als eine neue Kartografie: Er meint eine Praxis des Verlernens, der situierten Aufmerksamkeit und der verkörperten Kritik. In einem Gespräch über Flüsse, die erzählen, über Körper, die kartieren, und über Landschaften, die gehört werden wollen, wird deutlich, was es bedeutet, die Ufer des Rheins mit dem ganzen Körper zu befragen.
Diese Publikation ist ein Reader zum Jahresthema gathering/situating knowledges, das sich am HyperWerk 2024/25 entfaltete – in Workshops, Gesprächen, Praktiken. Dabei wird nicht nur das Dreiländereck neu lesbar, sondern auch das Buch selbst. Es entsteht ein vielstimmiges, resonantes Territorium: ein Raum, in dem Wissen fliesst, sich widersetzt und neu geordnet wird. Eines, das weder Anfang noch Ende kennt.
Gathering Knowledges from the Rubble: Against Scholasticide
Kevin Okoth
How to Grow Tomatoes
Kenza Benabderrazik
Gathering Yeasts
Maciej Chmara (Chmara.Rosinke)
On sensory mapping, water stories, and listening to landscapes. An interview with Wency Mendes
Ann Mbuti
From Licence to Commitment
Eva Weinmayr
Editorials
Matthias Böttger, Ann Mbuti, tina omayemi reden
Situiert im Globalen. Kulturwissenschaftliche Naturgeschichten
Karin Harrasser
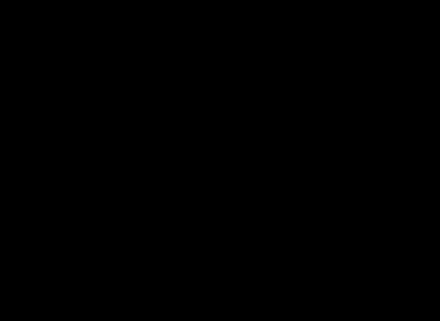
Wenceslaus Mendes is an independent researcher, (documentary) filmmaker, who engages with video and technology in theatre and performance as well as in conceptual and installation art projects. His practice is situated within indigenous and tribal communities through shared concerns with land and water, environment, sustainability and climate change; documenting practices, oral culture and processes of ethno-technologies.
Ann Mbuti
On sensory mapping, water stories, and …
In autumn 2024, artist, lmmaker, and researcher Wency Mendes gave a workshop at IXDM which explored how we might feel our way through transitional spaces rather than simply map them. Drawing on his deep engagement with indigenous knowledge systems, environmental justice, and embodied storytelling, Mendes invited our students to explore the Rhine’s riparian zones not through data but through their senses.
What happens when we move through a space with our noses, ears, and feet—not just our eyes? What kinds of knowledge emerge when we treat place as process, not as object? In this conversation, Mendes shares his approach to sensory mapping, explains how local and non-canonical ways of knowing shape his work, and re ects on the politics of space, collaboration, and the possibilities of resilience. He also speaks about founding Goa Water Stories, a platform dedicated to the deep interconnections between Goa’s water systems and local communities—and what inspired its creation.
Ann Mbuti Could you start by telling us a bit about yourself and your background? How did you come to work at the intersection of ecology, culture, and community knowledge?
Wency Mendes I am a lmmaker—cinematographer and editor by profession—, artist, and independent researcher who engages with video and technology in
On sensory mapping, water stories, and …
theatre and performance and conceptual, immersive experiences and installation art projects that have travelled globally. I work in advertising, broadcast television and digital web, independently practicing, producing content and working with multimedia.
My practice lies within indigenous and tribal communities through shared concerns of land and water, environment, sustainability and climate change; documenting practices, oral culture, and processes of ethno-technologies. Here, I engage with the politics of food, consumption, and the processes of «knowledge» in its making and dissemination through building sensoriums. For me, local—geospatial and temporal— and Indigenous knowledge are both essential and critical towards building an inclusive and sustainable future. My research lies at the intersection between race and caste across the subcontinent of India. Here, the projects closely examine incidents of discrimination and prejudice, purity and segregation, the making of labour and the Indian Prison System. A process of «co-labour-abling» is the methodology of making work; here, questions are raised, and its process and outcomes are de ned together and conjoined with the community, environment and ecosystem from which the language of the work originates.
AM Your workshop at IXDM focused on the sensory mapping of liminal spaces at the Rhine’s border triangle. Could you explain
On sensory mapping, water stories, and …
what «sensory mapping» is and why it is important for understanding these spaces?
WM I was interested in what it means to map a space that doesn’t want to be mapped. A liminal space is already in between; it’s in transition, it’s always changing. So then what happens if you try to feel that space instead of representing it—with your body, through movement, through smell, through listening? Mapping becomes more about resonance than about measurement.
Liminal spaces are in constant ux, which facilitates new stimuli and imaginings constantly. We are material beings and gather rst-hand, lived experiences through a multimodal approach to understanding. This framework focuses and makes relevant the information from stimuli as sensual beings and proliferates non-canonical and non-hierarchical systems of knowledge, outside the status quo, that are geospatial to initiate an «other» discourse. Here, «sensory mapping» facilitates a «contactivity» with our world through its materiality. These emerging narratives are intricately linked to local ora, fauna, water, ecology and the impact of changing climatic conditions and livelihood practices, to construct a discourse centred around the possibility of resilience.
AM The workshop engaged participants in exploring riparian zones—areas where land and water meet—through their
On sensory mapping, water stories, and …
senses. Which unique insights can this embodied approach o!er that traditional mapping methods might overlook?
WM One of the things we noticed is how the river is so heavily managed—it’s channelled and shaped—but even then, it pushes back. Like, you can see where the water is eating into the bank despite all the embankments. And then there’s also the sense that people don’t really know how to be in these spaces— there’s discomfort, there’s not really a script for how to move. That uncertainty ... it tells you something.
AM What does that mean for an area like the Rhine which you visited?
WM The riparian zones are spaces in constant ux. Invariably, we attempt to x these boundaries, and these acts further complicate our ecological, socio-cultural, economic and political worlds with disastrous implications. Mapping is invariably linked to a human-centric revelation of the possibilities and thereby to utility-exploitation and constructing a «standing reserve» of the land with all this « xing» and land-«scaping». Sensorial mapping allows for «other» possibilities of imagination of these spaces, through a process of inclusivity not bound by the rational mind. During the exercises, new perspectives emerge on the impact of sound on the environ, gender and safety, accessibility of spaces to di!erent species, etc.
On sensory mapping, water stories, and …
AM You describe borders as spaces «in ux». Can you share some key observations from the workshop which highlight this uidity?
WM Borders are not binary propositions; there is always a gradation and granularity in transition, they are analogous. During the workshop, we notice this and are made aware of the numerous engagements, such as the accessibility of the human and non-human characters within land and water, between national boundaries, the movement of goods and services and the changing habitats and livelihoods within the «Dreiländereck»—the border triangle of Basel.
AM How do you see sensory mapping as a tool for broader environmental or social advocacy? Can it help us rethink policies or conservation e!orts in borderland ecosystems?
WM Sensory mapping engages and intersects with the «local» and the indigenous through interactive and immersive processes developed through community practice. By bringing together through play a community’s diverse skill sets from their geographies and knowledge schemas and their sensual understanding of the lived experience, we may enable alternative narratives and perspectives to emerge and be heard, «other stories to tell about culture, technology, and things
On sensory mapping, water stories, and …
to come.» (Nelson 2002: 3) This engagement draws on the ethno-technologies, knowledge systems, values, and wisdom, which are rooted in the cultural heritage, customs and practices that are geospatial. (Esteva 2013) Consequently, the opportunities through the extended spaces we create foster creativity, innovation and imaginative thinking.
AM Shifting to your work with Goa Water Stories: this initiative focuses on the deep relationship between Goa’s water systems and local communities. What inspired you to co-found this platform?
WM Here in Goa, the repositories of oral traditions and community knowledge have always been the «elders» of the community. This knowledge, aggregated through lived experience, is codi ed and passed through the generations via numerous rites of passage, modes of communication, rituals and folklore. Modernity and its globalised modalities of technological development are systemically erasing these forms of knowledge through deskilling, dislocation and displacement. Furthermore, the passing of this generation without documentation nor a trace of their learnings compounds this loss.
Goa Water Stories engages and intersects with the resident local and indigenous communities in Goa, towards a remembering of community memory and of these ethno-technologies—intangible cultural heritage,
On sensory mapping, water stories, and …
community processes, ways of doing, narratives, rituals and practices, etc.—that have been key in the preservation of our ecologies. Geographically, these learnings are associated with the on-hand geospatiality of the present material and resources, as embedded in genetics to the ora and fauna of their daily livelihood engagements and sustenance. These practices have immense relevance today, in a conversation and discourse within climate change, water conservation, environmental studies and regeneration, a validation—towards a community and to society at large—as alternative models of development.
AM You emphasize the role of oral traditions and indigenous knowledge in understanding water heritage. Can you share an example of a particularly powerful story or practice you’ve encountered through Goa Water Stories?
WM The Gavli-Dhangar community of Goa are a pastoral community where their way of life evolved through an interplay of their traditional occupation and the ecology of their habitat. When an elder passes away, on the thirteenth day during a ritual, a member of the family invites the spirit-being of the person who has passed away to inhabit their body for the ritual. During this ritual, the possessed body narrates the family’s history to all those present.
On sensory mapping, water stories, and …
AM What are the biggest challenges Goa’s water systems are facing today, and how does community knowledge contribute to addressing them?
WM The biggest challenge to Goa’s water system is the modern paradigm of knowledge and technology and its model of globalised development. Community knowledge can only positively contribute and address this challenge if the modern nation-state and its instruments of power and governance choose to acknowledge the community-citizens and their learnings as knowledge.
AM Goa Water Stories engages a wide range of participants—academics, artists, researchers, and local communities. How do you ensure that these diverse voices are meaningfully integrated into discussions on water conservation and policy?
WM This is a process. We do this through multiple engagements throughout the project. This takes the forms of presentations with multiple ecosystem stakeholders present, knowledge and skill-sharing workshops, on-site and with the community, peer reviews as immersive engagements, and strategic interventions within the mass media and news reports and writings.
On sensory mapping, water stories, and …
AM Both your workshop and Goa Water Stories explore the relationship between people, land, and water. How do you see these two projects informing each other?
WM The practice and process change, evolve and develop through working with community. The bisses (irrigation channels) of Valais have a similar counterpart here in the regions of Valpoi and Satteri in Goa. The tools, learnings and programme travel across geographies, along with their learnings and insights through consequent workshops. The impact of changing climatic conditions impacts us all. The melting of glaciers, migratory patterns of birds and sh, changing salinity, temperature and oxygen content of the oceanic water, loss of biodiversity and species richness are felt universally. We need further interactions between various geographies of our climatic impacts, the learnings and failures.
There is no bubble space nor walls of safety from climatic repercussions—we need to critically engage, share and organise in constant dialogue with each other.
AM In the workshop, you explore the changing relationships between land, water, and architecture. Do you see parallels between the borderlands of the Rhine and the evolving water landscapes of Goa?
On sensory mapping, water stories, and …
WM The parallels are across time, and it is the learning that we need to share across our waters and geographies. The concretisation of the riverbeds, the erasure of riparian zones, the lack of biodiversity and the development of modern infrastructure, the pollution of water, the impacts on society, health and culture. The intersections are numerous.
AM Your work involves a mix of scienti c inquiry and artistic/creative expression. How do you balance these approaches, and why is it important to include both in environmental discourse?
WM The root of the word art is téchnē, ars, poiesis—this is a making of knowledge. The environmental discourse has to critically engage with the materiality of analogous worlds and its complex web of intersections. Interdisciplinarity facilitates «other» knowing, imaginations and interpretations, proliferates and accelerates inclusivity and expands the «border areas» of discourse.
AM Based on your experiences with both projects: how can communities—whether in Europe or Goa—use sensory and cultural knowledge to build more sustainable futures?
On sensory mapping, water stories, and …
WM We need to accept and validate sensory and cultural knowledge accrued by our bodies over time as cohabitants and an integral part of a larger—giganormous—analogous universe and world. There needs to be an understanding and acceptance that we are connected in more ways than what our rational mind may make sense of and comprehend—beyond the socio-cultural, ecological, political, etc.
AM What are the next steps for Goa Water Stories?
WM With Goa Water Stories, we are currently collating and understanding the feedback and taking stock of the failures and successes that this work has brought about. We do so to understand the possibilities of a reimagining of how this project may grow, evolve and engage with the environ and communities here in Goa, and how the learnings are made accessible. We are also trying to understand the need and possibility of a material and physical exhibition that could perhaps travel.
AM How can people get involved?
WM You could write to us at goawaterstories@ gmail.com and ask us what you would like to know or do. We engage with people across geographies on research, art, education, dissemination and knowledge-making.
References
sensory mapping, water stories, and …
Esteva, Gustavo; Babones, Salvatore J., Babcicky, Philipp. (2013). Alternatives to the cult of growth. In The future of development: A radical manifesto (Chap. 3).
Bristol: Policy Press.
Nelson, Alondra. (2002).
Introduction: Future texts.
Social Text, 20(2), 1–15. https:// doi.org/10.1215/01642472-20-2_71-1
… open up new contexts for familiar things.
… are loving acts.
Intermediales Reproduzieren und Kontextualisieren durch Found-Footage-Storytelling …
Intermediales Reproduzieren und Kontextualisieren durch Found-Footage-Storytelling
Manuel Schneider
Manuel Schneider
1. Suche und finde ein Sujet in deiner unmittelbaren Umgebung, am besten ein unbewegliches oder eines ohne Bewegungsdrang.
2. Baue ein Studio mit viel, viel, viel Licht in allen Ecken des Raums und auf dem Sujet selbst.
3. Stillhalten … und deine Kamera 36mal aus allen Winkeln auslösen, bis der Film voll ist. Renne oder krieche so schnell wie möglich zum besten Filmlabor in deiner Nähe, um die Filme zu entwickeln.
4. Nach 2 Wochen Warteschlange bei der Entwicklung: Nutze die digitalisierten Bilder und kluge Algorithmen mit Software deiner Wahl, um daraus (hoffentlich) eine Figur zu rechnen, die du nun in jede digitale Umgebung einfügen kannst, die du dir ausdenken magst.
5. Überlege dir, wo sich dein Sujet befinden oder aufhalten würde. Suche in deinem Handyarchiv nach 4 Bildern, die es mit Kontext bereichern, eine Geschichte erzählen oder eine Fantasie beschreiben, und füge dein Sujet und die 4 Bilder in einer Form deiner Wahl zusammen.
1. Suche und finde ein Sujet in deiner unmittelbaren Umgebung, am besten ein unbewegliches oder eines ohne Bewegungsdrang.
2. Baue ein Studio mit viel, viel, viel Licht in allen Ecken des Raums und auf dem Sujet selbst.
3. Stillhalten … und deine Kamera 36mal aus allen Winkeln auslösen, bis der Film voll ist. Renne oder krieche so schnell wie möglich zum besten Filmlabor in deiner Nähe, um die Filme zu entwickeln.
4. Nach 2 Wochen Warteschlange bei der Entwicklung: Nutze die digitalisierten Bilder und kluge Algorithmen mit Software deiner Wahl, um daraus (hoffentlich) eine Figur zu rechnen, die du nun in jede digitale Umgebung einfügen kannst, die du dir ausdenken magst.
5. Überlege dir, wo sich dein Sujet befinden oder aufhalten würde. Suche in deinem Handyarchiv nach 4 Bildern, die es mit Kontext bereichern, eine Geschichte erzählen oder eine Fantasie beschreiben, und füge dein Sujet und die 4 Bilder in einer Form deiner Wahl zusammen.
… Wissen mit der Mitwelt teilen
… Wissen mit der Mitwelt teilen
Nenya Biedermann Nenya Biedermann
1. Verbinden
Nähere dich mehr-als-menschlichen Wesen wie Wäldern, Pflanzen, Erde oder Orten als Gesprächspartner:innen. Hör ihnen aufmerksam zu: Welche Form von Wissen oder Inspiration geben sie dir?
2. Hingeben
Zeige Fürsorge – durch ein Lied, eine Geste oder ein Innehalten. Entwickle einfache, sinnliche Rituale, um diesen Austausch erfahrbar zu machen; lausche zum Beispiel dem Flüstern der Bäume oder grabe deine Finger in die Erde.
3. Sinnieren
Stell dir die Frage: Was machst du aus Liebe zu deiner Mitwelt?
Sammle die Antworten, was diese Microacts of Love für dich sein könnten.
4. Weitergeben
Ermögliche anderen, sich auf ihre eigene Weise mit der Mitwelt zu verbinden. Gib das erhaltene Wissen symbolisch oder materiell zurück: Teile deine Antworten, ermögliche Resonanz – mit dem Boden, dem Wald, den Pflanzen, mit anderen.
1. Verbinden
Nähere dich mehr-als-menschlichen Wesen wie Wäldern, Pflanzen, Erde oder Orten als Gesprächspartner:innen. Hör ihnen aufmerksam zu: Welche Form von Wissen oder Inspiration geben sie dir?
2. Hingeben
Zeige Fürsorge – durch ein Lied, eine Geste oder ein Innehalten. Entwickle einfache, sinnliche Rituale, um diesen Austausch erfahrbar zu machen; lausche zum Beispiel dem Flüstern der Bäume oder grabe deine Finger in die Erde.
3. Sinnieren
Stell dir die Frage: Was machst du aus Liebe zu deiner Mitwelt?
Sammle die Antworten, was diese Microacts of Love für dich sein könnten.
4. Weitergeben
Ermögliche anderen, sich auf ihre eigene Weise mit der Mitwelt zu verbinden. Gib das erhaltene Wissen symbolisch oder materiell zurück: Teile deine Antworten, ermögliche Resonanz – mit dem Boden, dem Wald, den Pflanzen, mit anderen.
Raum achtsam (um)gestalten zum Verweilen
Laura Picker
Raum achtsam (um)gestalten zum Verweilen
Laura Picker
1. Wahrnehmen (Aussen)
Positioniere dich im Raum und nimm wahr, was dich umgibt. Versuche, deinen Blickwinkel zu erweitern: Leg dich beispielsweise hin und spüre den Boden unter dir.
2. Wahrnehmen (Innen)
Spüre, was die Umgebung mit dir macht. Wo führen dich deine Bedürfnisse oder Wünsche hin, wenn du dir einen Lieblingsraum vorstellst? Welche Materialien lösen ein Wohlgefühl aus? Gibt es Gegenstände, zu denen du einen persönlichen Bezug hast? Würdest du gerade gerne lieber sitzen, stehen oder liegen?
3. Material, das schon da ist/ Material organisieren
Was ist schon im Raum? Verwende, was da ist. Was möchtest du zusätzlich? Achte darauf, Dinge auszuwählen, die dir Freude bereiten und dich neugierig machen.
4. Zeit fürs Gestalten
Nimm dir genügend Zeit und Raum, um die Materialien zu platzieren, auszuprobieren, zu verwerfen, umzudenken, Neues zu holen und zu berühren. Gestalte den Raum nach deinem Gusto und deinen Bedürfnissen. Have fun, go wild, take all the time you need.
5. Wahrnehmen (Sein und Spüren) –Anpassen
Fühle, was sich verändert hat, im Aussen und Innen. Nutze den Raum, gestalte um, was umgestaltet werden will. Wiederhole diesen Schritt so oft du willst.
6. Dasein, Teilen und Danken
Teilen kann etwas sehr Schönes sein. Wenn du dich danach fühlst, kannst du in deinen Raum einladen, dich austauschen und geniessen. Zeige dem Raum, den verwendeten Materialien, dir selbst und deinem Einsatz und allen, die diesen Raum mit dir teilen, Wertschätzung.
1. Wahrnehmen (Aussen)
Positioniere dich im Raum und nimm wahr, was dich umgibt. Versuche, deinen Blickwinkel zu erweitern: Leg dich beispielsweise hin und spüre den Boden unter dir.
2. Wahrnehmen (Innen)
Spüre, was die Umgebung mit dir macht. Wo führen dich deine Bedürfnisse oder Wünsche hin, wenn du dir einen Lieblingsraum vorstellst? Welche Materialien lösen ein Wohlgefühl aus? Gibt es Gegenstände, zu denen du einen persönlichen Bezug hast? Würdest du gerade gerne lieber sitzen, stehen oder liegen?
3. Material, das schon da ist/ Material organisieren
Was ist schon im Raum? Verwende, was da ist. Was möchtest du zusätzlich? Achte darauf, Dinge auszuwählen, die dir Freude bereiten und dich neugierig machen.
4. Zeit fürs Gestalten Nimm dir genügend Zeit und Raum, um die Materialien zu platzieren, auszuprobieren, zu verwerfen, umzudenken, Neues zu holen und zu berühren. Gestalte den Raum nach deinem Gusto und deinen Bedürfnissen. Have fun, go wild, take all the time you need.
5. Wahrnehmen (Sein und Spüren) –Anpassen Fühle, was sich verändert hat, im Aussen und Innen. Nutze den Raum, gestalte um, was umgestaltet werden will. Wiederhole diesen Schritt so oft du willst.
6. Dasein, Teilen und Danken Teilen kann etwas sehr Schönes sein. Wenn du dich danach fühlst, kannst du in deinen Raum einladen, dich austauschen und geniessen. Zeige dem Raum, den verwendeten Materialien, dir selbst und deinem Einsatz und allen, die diesen Raum mit dir teilen, Wertschätzung.
To … How To … … practicesoil-based … practicesoil-based
Timon Essoungou
Timon Essoungou
1. fight the system
2. get to know the people and beings that work and live with the soil you stand on
3. maybe plant a flower or a tree (indigenous to the land)
4. help freeing all the oppressed people
5. abolish the police
1. fight the system
2. get to know the people and beings that work and live with the soil you stand on
3. maybe plant a flower or a tree (indigenous to the land)
4. help freeing all the oppressed people
5. abolish the police
Knowledges which …
… unfold through mindful materials.
… rethink the land commons to build just relations to soil.
Wie wäre es, wenn ein Buch keinen Anfang und kein Ende hätte? Kein fixes Cover, sondern mehrere Lesearten – viele mögliche Einstiege und viele Arten, Wissen zu begegnen?
Es würde bedeuten, dass Wissen nicht exklusiv ist, sondern relational – und gleichzeitig die Frage aufwerfen, wie wir damit in dieser Publikation umgehen, denn eine klassische CopyrightLogik reicht dann nicht aus. Wer darf was mit diesem Wissen tun? Wer darf es weitergeben, verändern, nutzen – und unter welchen Bedingungen?
Entstanden ist diese Publikation als ein Reader zum Jahresthema gathering/situating knowledges, das sich am HyperWerk 2024/25 entfaltete – in Workshops, Gesprächen, Praktiken. Eva Weinmayr fragt in ihrem Beitrag nicht nur, wie dieses und anderes Wissen geteilt wird, sondern auch, mit welcher Verantwortung. Anstatt auf pauschale Offenheit zu setzen, schlägt sie vor, kulturelle Praktiken als Beziehungsgeflechte zu begreifen, nicht als Besitz.
Was bedeutet es, den «Reuse» von Wissen nicht als Akt der Aneignung, sondern als solidarische Praxis zu verstehen? Immer situiert, immer in Bewegung?