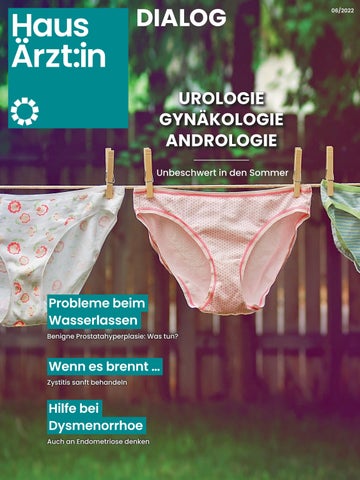5 minute read
Dysmenorrhoe: auch an Endometriose denken
Pharmakologische Therapieoptionen einer vielschichtigen Erkrankung
Regelschmerzen sind vor allem unter jungen Frauen weit verbreitet. Schätzungen zufolge leiden 50–75 % der Mädchen und jungen Frauen unter Dysmenorrhoe. Bei etwa zehn von 100 Frauen sind die Beschwerden so stark, dass sie an bis zu drei Tagen pro Monat arbeitsunfähig sind bzw. ihren Alltag nur stark eingeschränkt bewältigen können.
Primäre Dysmenorrhoe am häufigsten

Beim Großteil der betroffenen Frauen liegt eine primäre Dysmenorrhoe ohne organische Ursache vor. Aus pathophysiologischer Sicht handelt es sich um einen ischämischen Schmerz. Am Ende der zweiten Zyklushälfte sinkt der Progesteronspiegel ab, was die Synthese von Prostaglandinen in der Gebärmutterschleimhaut stimuliert. Dies erhöht die Kontraktilität der Uterusmuskulatur und führt zu einer Ischämie sowie Hypoxie des Endometriums. Daraus resultieren die typischen krampfartigen Schmerzen im Unterleib.
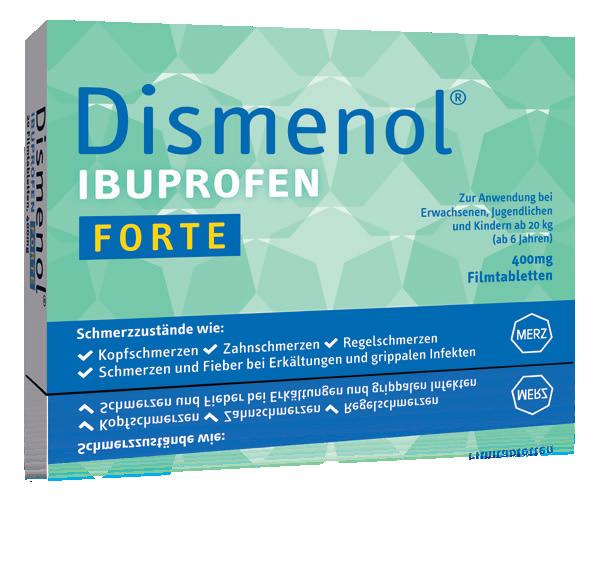
Analgetika als Goldstandard
DISM2021-10-011
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen. Produziert wird das rezeptfreie Arzneimittel in Deutschland. NSAR stellen die wichtigste Wirkstoffklasse für die symptomatische Therapie einer primären Dysmenorrhoe dar: Für Ibuprofen, Naproxen und DiclofeKopfschmerzen nac ist die Wirksamkeit gut belegt.1 Sie hemZahnschmerzen men die Prostaglandin-Synthese in der Regelschmerzen Gebärmutterschleimhaut und reduzieren dadurch einerseits die Kontraktilität des Uterus, andererseits die neuronale Hypersensitivität gegenüber Schmerzen. Empfohlen wird, mit der Analgetika-Einnahme möglichst unverzüglich nach Schmerzbeginn oder sogar ein bis zwei Tage vor der

erwarteten Blutung zu beginnen. Zudem muss die Initialdosis hoch genug sein. Direkte Vergleiche der verschiedenen NSAR fehlen bislang. Ibuprofen und Naproxen gelten als Mittel der ersten Wahl und sind in der Indikation Dysmenorrhoe auch zugelassen. Paracetamol erwies sich als schwächer wirksam. Auch für ASS ist die Evidenz etwas geringer, zudem könnte ASS die Blutung möglicherweise verstärken. Wenn Krämpfe dominieren, kann Butylscopolaminiumbromid gegeben werden.
Alternativ: Ovulationshemmer
Wenn sich mit NSAR keine adäquate Schmerzlinderung erzielen lässt oder ohnehin eine hormonelle Kontrazeption gewünscht ist, so kann auf Ovulationshemmer zurückgegriffen werden. Orale Kontrazeptiva verhindern nicht nur den Eisprung: Wegen der Hormongabe wird auch deutlich weniger Endometrium aufgebaut. Dadurch werden geringere Mengen von Prostaglandinen synthetisiert und der Menstruationsfluss reduziert. Auch bestimmte Gestagene können die Prostaglandin-Synthese direkt inhibieren. Sollte keine Empfängnisverhütung gewünscht sein, so kann alternativ auch die zyklische Einnahme eines reinen Gestagen-Präparates (z. B. von Dydrogesteron, Chlormadinonacetat, Dienogest) in der zweiten Zyklushälfte erwogen werden. >
Endometriose: oft spät diagnostiziert
Wenn weder durch NSAR noch durch Ovulationshemmer eine Besserung der Symptomatik erreicht werden kann, sollten mögliche organische Ursachen (= sekundäre Dysmenorrhoe) abgeklärt werden. Nicht selten stellt sich erst nach vielen Jahren heraus, dass sich hinter starken Menstruationsbeschwerden eine Endometriose verbirgt: Bis zur korrekten Diagnose einer Endometriose vergehen in Österreich durchschnittlich acht bis zehn Jahre. Die Ursachen hierfür sind einerseits eine mangelnde Kenntnis dieses chronischen Krankheitsbildes, andererseits sehen viele Betroffene in der Dysmenorrhoe keinen Krankheitswert und nehmen die Schmerzen als „normal“ hin. Eine zunehmende Sensibilisierung – sowohl der betroffenen Frauen als auch der
Ärzteschaft – könnte dabei helfen, diese Situation zu verbessern. Denn es gilt: Je früher eine Endometriose behandelt wird, desto besser ist die Prognose.
Heterogene Symptomatik
Die Symptomatik der Endometriose präsentiert sich sehr unterschiedlich, was die Diagnose zusätzlich erschwert. Zu den Leitsymptomen zählen neben Dysmenorrhoe verschiedenste Schmerzzustände sowie Sterilität. Häufig berichten die Betroffenen über zyklusabhängige Schmerzen insbesondere beim Wasserlassen, Stuhlgang und Geschlechtsverkehr. Im späteren Krankheitsverlauf können die Beschwerden auch zyklusunabhängig auftreten. Erklären lässt sich die heterogene Symptomatik zumindest teilweise durch die Pathogenese der Erkrankung. Charakteristisch sind endometriumartige Zellverbände, die auch außerhalb der Gebärmutterhöhle auftreten. Diese Endometrioseherde können sich in verschiedenen Bereichen des Körpers ansiedeln – und je nach Lokalisation variiert die Symptomatik. Sie wachsen zyklusabhängig und bluten, was Verklebungen, Verwachsungen und Entzündungen nach sich zieht.
Therapieoptionen
Die Behandlung der Endometriose verfolgt im Allgemeinen zwei Ziele: Schmerzfreiheit und die Erfüllung eines eventuell vorhandenen Kinderwunsches. Der Behandlungsplan wird vom Ausmaß der Beschwerden und von der Lokalisation der Endometrioseherde bestimmt.2, 3
Operative Entfernung der Herde
Als Goldstandard bei einer schweren Endometriose gilt die komplette operative Entfernung der Gewebeherde. Der Eingriff erfolgt meist laparoskopisch, nur selten ist ein Bauchschnitt notwendig. Die Erfolgsaussichten sind gut, allerdings ist das Rezidivrisiko relativ hoch: In den Stadien 1 und 2 beträgt es 25 % innerhalb von vier Jahren, in den Stadien 3 und 4 liegt es bei 80 %.
Endokrine Therapie
Um den Effekt der Operation zu erhalten, erfolgt im Anschluss meist für drei bis sechs Monate eine endokrine Therapie. Bei leichteren Formen der Endometriose ist mitunter auch die alleinige medikamentöse Behandlung suffizient. Das wesentliche Prinzip der Hormongabe ist das Auslösen einer therapeutischen Amenorrhoe. Östrogen gilt als entscheidender Wachstumsreiz für Endometrioseherde. Dementsprechend zielen hormonelle Therapien darauf ab, den Östrogenspiegel zu senken: Die Herde schrumpfen und die Beschwerden nehmen ab.
Reine Gestagene: Als Mittel der Wahl hat sich inzwischen Dienogest (2 mg) etabliert. Daneben werden vereinzelt Dydrogesteron und Medroxyprogesteronacetat eingesetzt. Als Alternative zur systemischen Gabe kann der Einsatz eines levonorgestrelhaltigen Intrauterinpessars erwogen werden, welches insbesondere bei Adenomyomen gute Effekte zeigt.3
GnRH-Analoga: Als weitere Option stehen Analoga des „Gonadotropinreleasing“ Hormons (GnRH) wie Buserelin zur Verfügung. Sie werden seit vielen Jahren zur Therapie einer laparoskopisch gesicherten Endometriose eingesetzt. Häufig treten jedoch unerwünschte Begleiteffekte wie klimakterische Beschwerden und eine verringerte Knochendichte auf. Daher kommt diese Wirkstoffklasse heute überwiegend als Zweitlinientherapie bei schwerer Endometriose bzw. bei Kinderwunsch zur Anwendung.
Kombinierte orale Kontrazeptiva: Auch mit kombinierten oralen Verhütungsmitteln lässt sich eine therapeutische Amenorrhoe erzielen. Die Anwendung erfolgt off Label, eine Einnahme im Langzyklus (ohne Pause) ist zu favorisieren. Nach einer operativen Sanierung können in den Stadien 1 und 2 orale Kontrazeptiva als Langzeittherapie zur Rezidivprophylaxe eingenommen werden.
Kombipräparat in klinischen Studien
Eine Fixkombination von 40 mg Relugolix, 1,0 mg Estradiol und 0,5 mg Norethisteronacetat wurde 2021 von der EMA zur Therapie von Uterusmyomen mit mäßigen bis starken Schmerzen zugelassen. Der mögliche Einsatz des Kombipräparats bei Endometriose wird derzeit in klinischen Studien geprüft.
Mag.a Dr.in Irene Senn
Quellen: 1 Marjoribanks J et al.,
Cochrane Database Syst
Rev 2015(7):Art. No.
CD001751. 2 AWMF, S2k-Leitlinie:
Diagnostik und Therapie der Endometriose: Reg-
Nr 015/045 2020. 3 Mettler L et al., Gynäkologie und Geburtshilfe 2021;26(1):40-49. © shutterstock.com/galunga.art