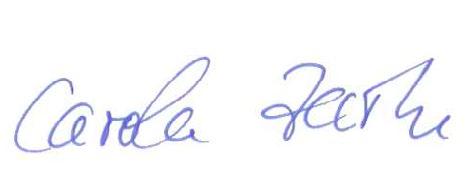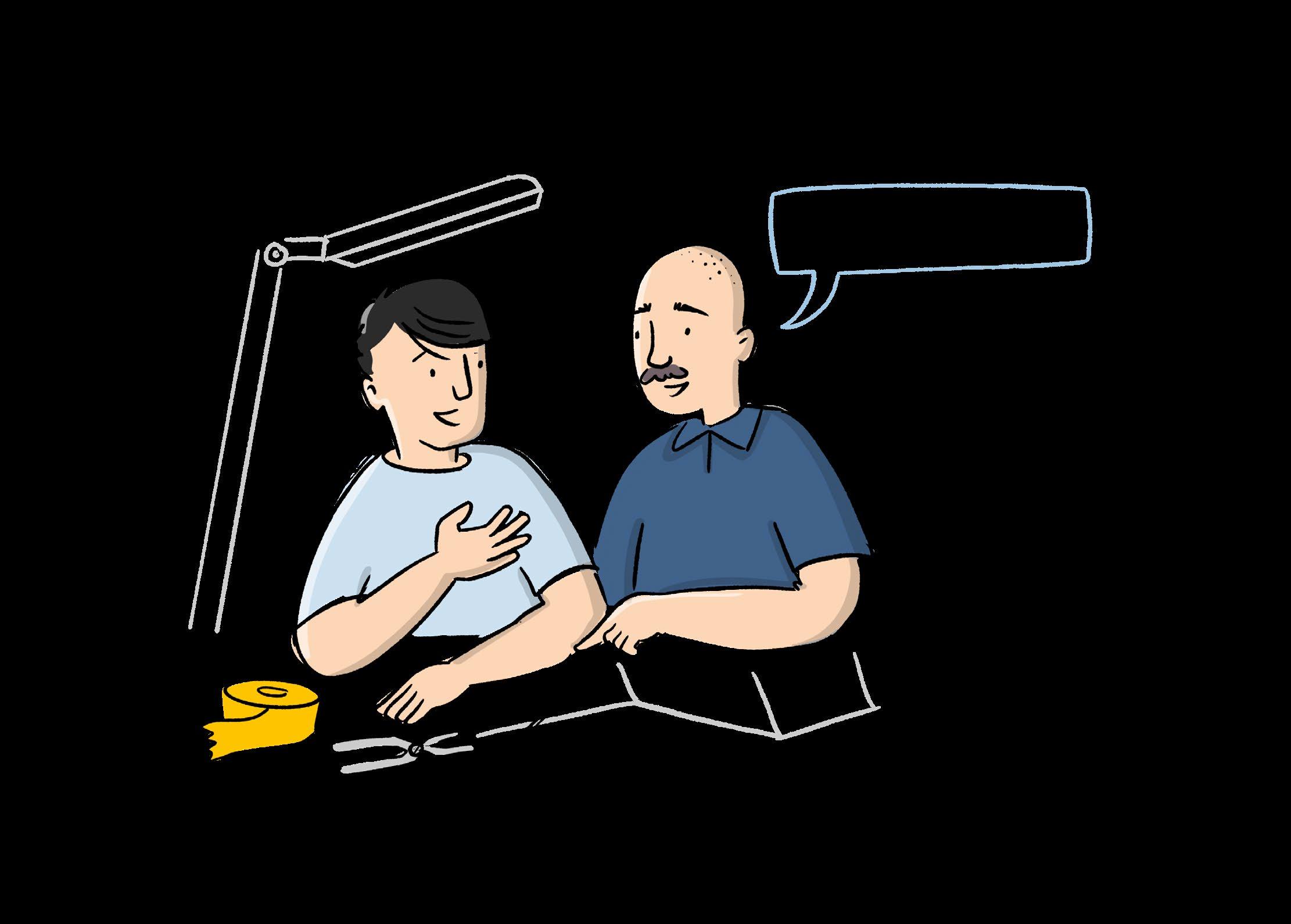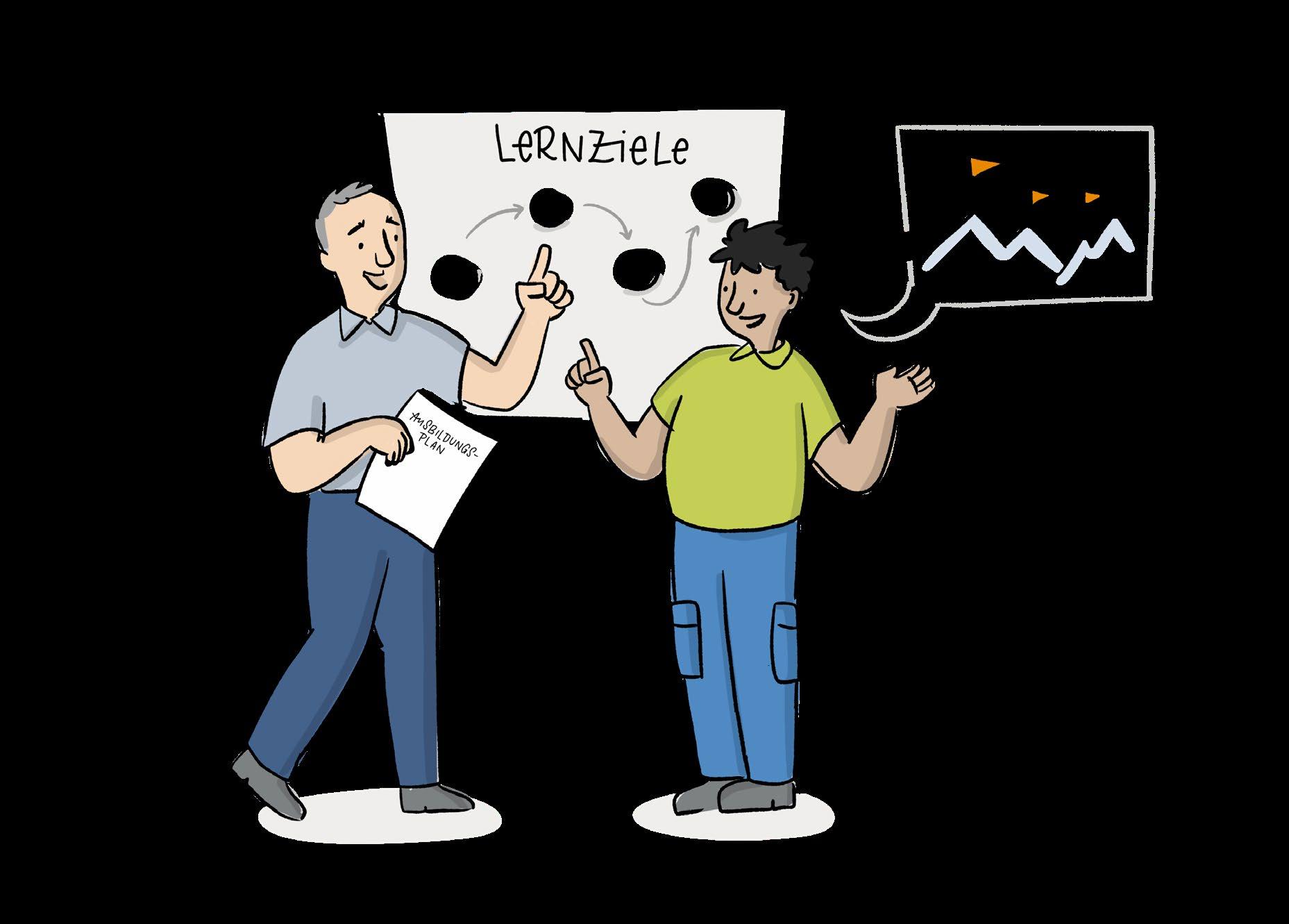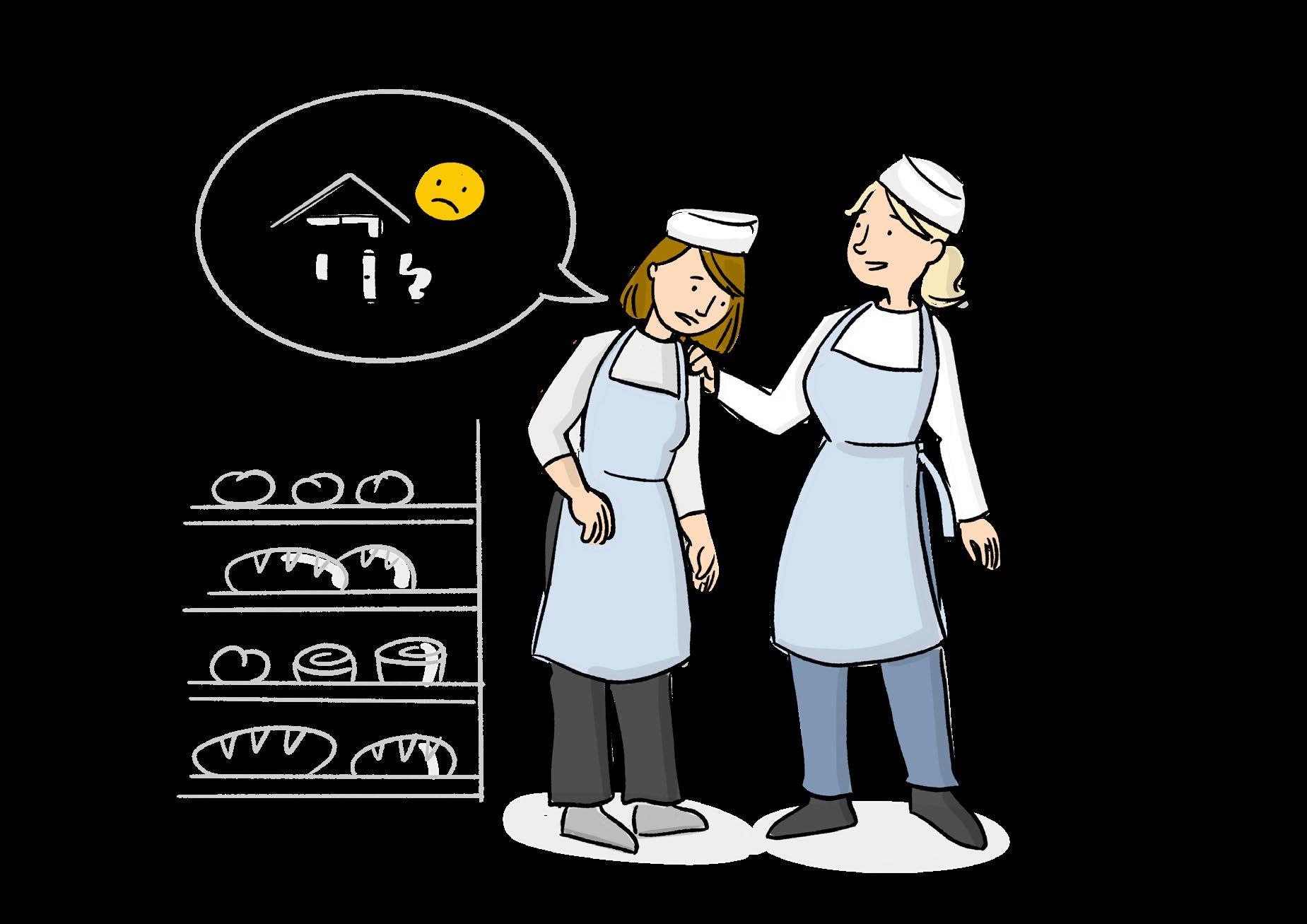Gute Ausbildung im Handwerk
Kompakter Begleiter für ausbildende Betriebe
Die Visionskarten wurden von der Handwerkskammer Berlin im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung beauftragt. Das Projekt wird von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe über das Aktionsprogramm Handwerk
2021 – 2023 gefördert.
Erstellt wurden die Visionskarten
von der k.o.s GmbH
www.kos-qualitaet.de
Autorinnen und Autor:
Noreen Brünies
Sophie Keindorf
Tilman Jendrasik
Sketchnotes (Illustrationen):
Nadine Roßa
Layout & Satz:
Svenja Schall
Studio SK - Büro für Grafikdesign
Ihre Ansprechpersonen
bei der Handwerkskammer
Berlin rund um
Ausbildung:

Claudia Lange, Ausbildungsberatung
Unternehmenskultur:
Adriane Nebel, Wirtschaftspolitik
1. Auflage Berlin 2022

Grußwort
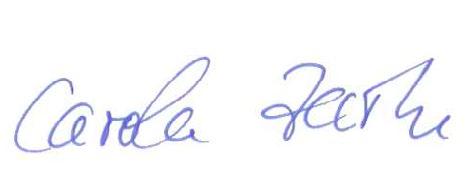
Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, der Schlüsselfaktor für eine gute Ausbildung sind Sie. Denn gemeinsam mit Ihren Auszubildenden gestalten Sie deren Alltag.
Dabei geht es nicht nur darum, dass Sie fachliche Inhalte vermitteln. Es geht auch um das gesamte Miteinander im Betrieb: Wie reden Sie mit den Auszubildenden? Wie motivieren Sie sie? Wie fördern Sie ihre persönliche Entwicklung? Wie gestalten Sie (Lern-)Prozesse? Geben Sie ausreichend Rückmeldung und wie gehen Sie mit Fehlern von Auszubildenden um?
Welche Faktoren für eine nachhaltige Ausbildungsqualität wichtig sind, haben Ausbilderinnen und Ausbilder gemeinsam mit Azubis in der vorliegenden Handreichung zusammengetragen. Diese soll Ihnen als kompakte Begleiterin für den Ausbildungsalltag im Betrieb dienen.
Ihr Engagement für gute Ausbildung können Sie außerdem über das Qualitätssiegel „gute Ausbildung“ sichtbar machen, welches die Handwerkskammer Berlin an starke Ausbildungsbetriebe vergibt.
Die Ausbilderinnen und Ausbilder sind seit jeher mit einer Vielzahl von Aufgaben konfrontiert, die teilweise auch im Konflikt miteinander stehen können. Hinzu kommen neue Anforderungen an Betriebe und betriebliche Lernprozesse, die sich aus einer zunehmend digitalisierten Arbeits- und Lebenswelt ergeben. Bei all diesen Herausforderungen verliert man leicht den Blick für das Wesentliche: Das Miteinander im Betrieb.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Ausbildung unseres Nachwuchses! Ihre
Carola Zarth
Präsidentin der Handwerkskammer Berlin
Carola Zarth
Die Idee
Die betriebliche Ausbildung bildet einen wichtigen Übergang von der Schule in das Berufsleben. Es gilt die fachlichen Anforderungen der Berufsschule zu meistern und den Aufgaben und Pflichten im Betrieb gerecht zu werden. Dabei treffen in der Ausbildung verschiedene Vorstellungen, Rollen und Generationen aufeinander, was zu Konflikten oder sogar zur Auflösung von Ausbildungsverträgen führen kann.
Die Handwerkskammer Berlin hat deshalb ausbildendes Personal und Auszubildende dazu eingeladen, in einem Workshop zu diskutieren, wie eine gute Ausbildung gestaltet sein muss. Alle Ideen, die sie während des Workshops zusammengetragen haben, fanden Eingang in diese Visionskarten, die als Handreichung für eine nachhaltige Ausbildungsqualität genutzt werden können. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für ihren ehrlichen Input und die produktive Auseinandersetzung mit dem Thema „gute Ausbildung“!
Die Visionskarten wurden im Rahmen des Aktionsprogramms Handwerk 2021-2023, in Kooperation mit der Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung erstellt und von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gefördert.
Die „Handreichung für Ausbilder*innen – aus der Sicht von Auszubildenden“ vom Handwerkerinnenhaus Köln e. V. diente als Inspiration für den dahinterliegenden Entwicklungsprozess und die Broschüre.
Der Prozess wurde von der k.o.s GmbH begleitet und umgesetzt.
Betriebliche Rahmenbedingungen
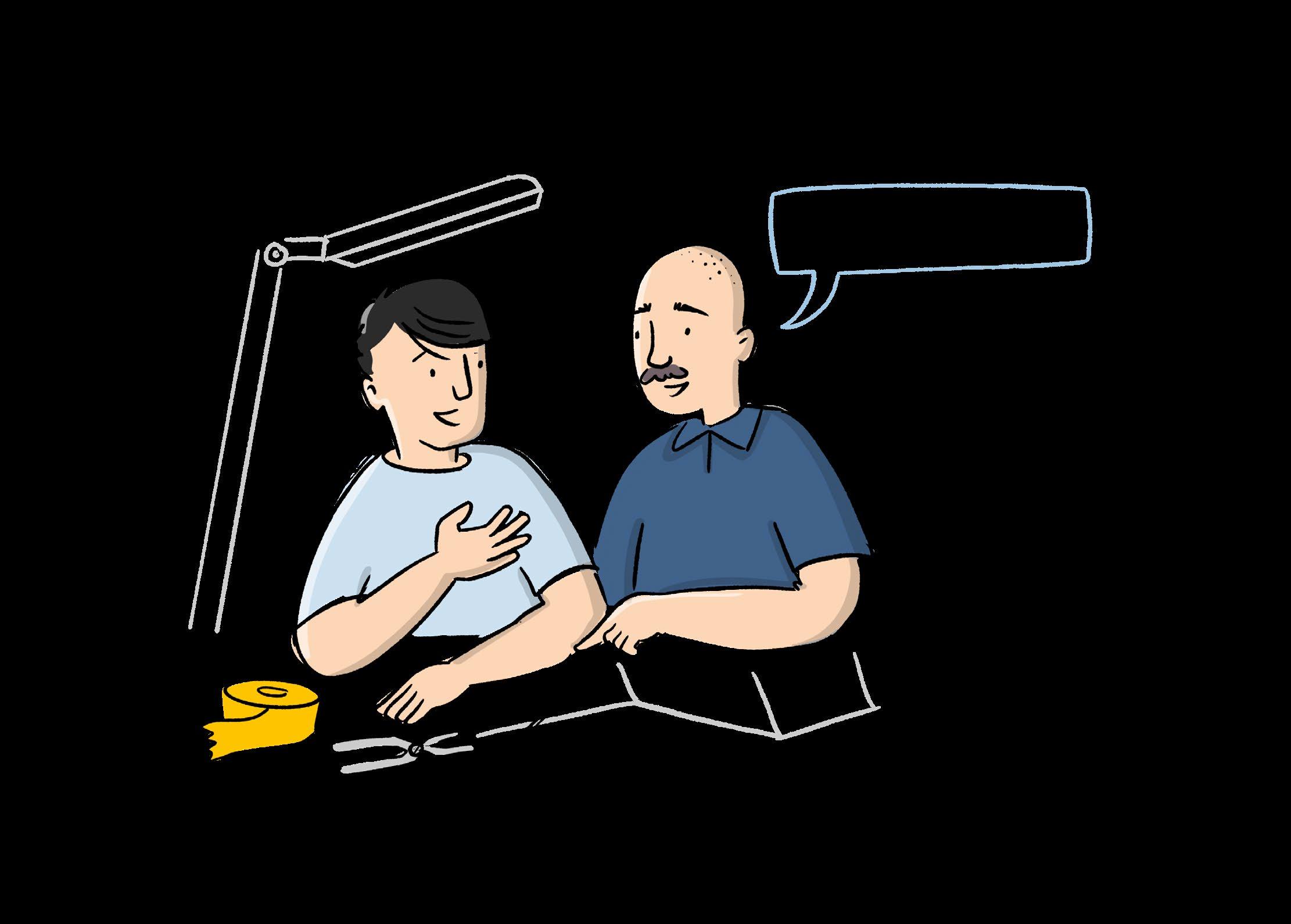
Hintergrund
Lernförderliche Rahmenbedingungen sind für die Qualität der Ausbildung entscheidend. Dafür ist es wichtig, dass der Betrieb ausreichend Ressourcen einplant und zur Verfügung stellt. Neben den notwendigen Arbeitsmitteln gehören dazu: personelle, zeitliche und organisatorische Rahmenbedingungen.
Checkliste Ausbildungsmanagement, In: Betriebliche Ausbildung erfolgreich managen. (Download 1 , S. 26 ff.)
Einführungsmappe
Instrument für Betriebe für den Ausbildungseinstieg. (Download 2 )
Personalressourcen
In immer mehr Unternehmen stärkt ein Ausbildungsmanagement die Steuerung und Koordination der Ausbildung. Nicht alle Belange der Ausbildung müssen von einer Person allein übernommen werden, es ist daher sinnvoll, die Zuständigkeiten
im Vorfeld zu klären, zu verteilen und sich abzustimmen, wie die Austausche untereinander organisiert werden, damit alle immer informiert sind.
Organisatorische Rahmenbedingungen
Dazu gehören bspw. Bereiche, die in der Ausbildung durchlaufen werden, Arbeitsmittel und die Gestaltung betrieblicher Lernorte (vgl. ↘Lernräume). Auch diese werden im Ausbildungsplan festgelegt.
Zeitliche Ressourcen
Um die Zeit, die das ausbildende Personal für die Ausbildung benötigt, gut abschätzen zu können, eignet sich der ↘ betriebliche Ausbildungsplan. Je genauer Tätigkeiten und Ausbildungsziele geplant werden, desto besser kann der Ressourceneinsatz gesteuert werden.
Zuschüsse vom Land Berlin
Über das Förderprogramm FBB der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales können Betriebe für die finanzielle Unterstützung erhalten.
Weitere Infos auf der Website der Handwerkskammer Berlin. (Download 3 )
»
Ich wünsche mir, dass wir mehr Zeit im Betrieb haben, für die Ausbildung und mein Ausbilder mir auch mal in Ruhe Dinge erklären kann.
«
Betriebliche Rahmenbedingungen
Ausbildungsplanung
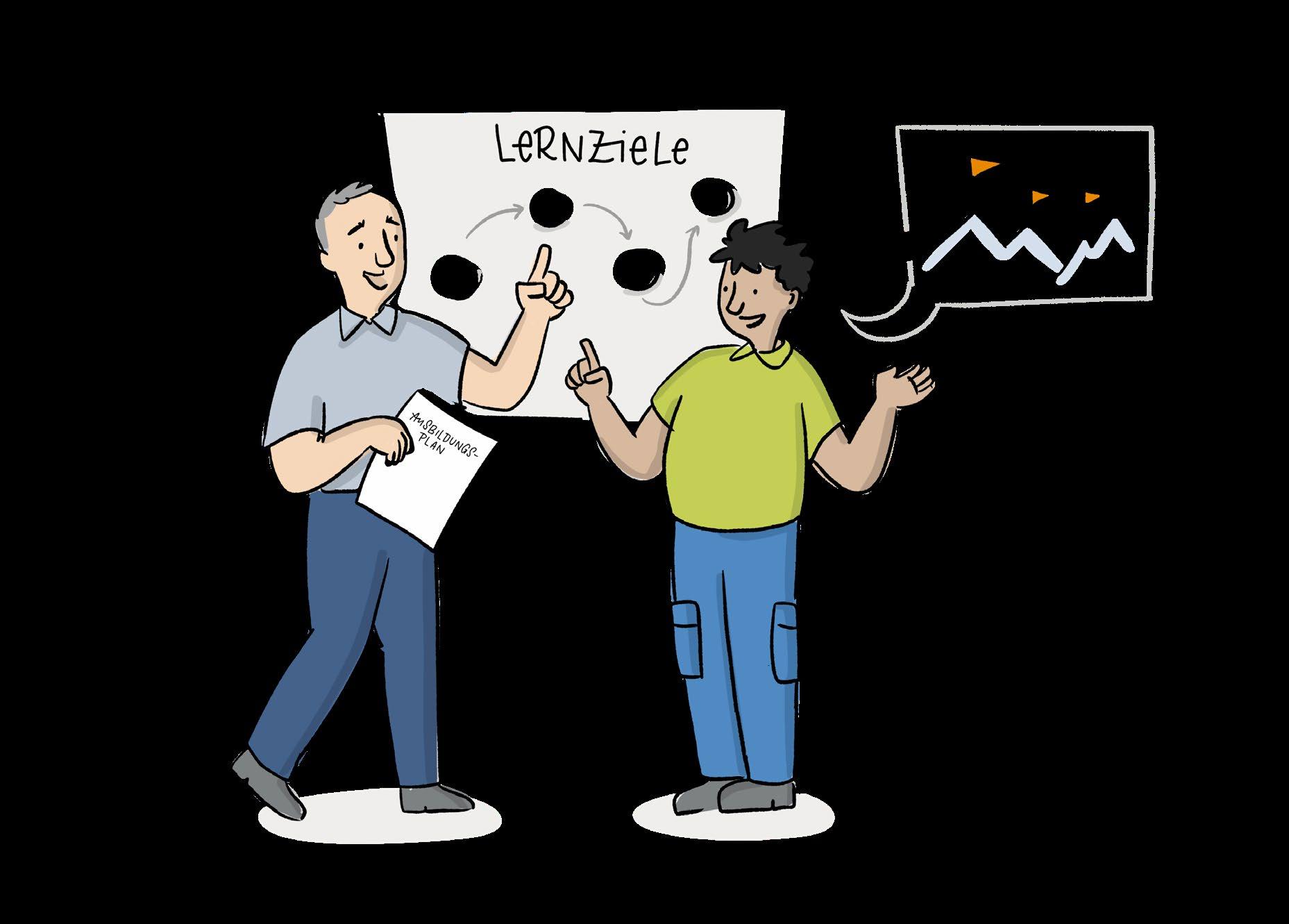
Hintergrund
Ein betrieblicher Ausbildungsplan bietet Struktur und Orientierung für Auszubildende über den Inhalt und den Verlauf der Ausbildung. Zudem gibt er einen wichtigen Überblick darüber, was die Lernziele und Anforderungen des jeweiligen Ausbildungsberufs sind und fördert das Verständnis darüber, wie einzelne Ausbildungsabschnitte zusammenhängen. Über die Inhalte sollten alle Beteiligten informiert werden und wissen, was die Auszubildenden an den einzelnen Ausbildungsstationen und Betriebsbereichen lernen sollen. Hilfreich dafür ist z. B. der Einsatz eines Laufzettels.
Tipps: Wie erstelle ich einen Ausbildungsplan?
1. Was für Aufgaben gibt es bei uns im Betrieb?
◼ Unternehmensbereiche und Arbeitsprozesse identifizieren
◼ Ausbildungsrelevante Tätigkeiten bestimmen
◼ Ausbildungsinhalte benennen und beschreiben
2. Was steht im Ausbildungsrahmenplan?
◼ Abgleich mit dem Ausbildungsrahmenplan*
◼ Berücksichtigung der besonderen Fähigkeiten der Auszubildenden
3. Wie passen Betrieb und Ausbildungsrahmenplan zusammen?
◼ Ordnen des zeitlichen Durchlaufs und Umsetzung nach Lehrjahr und Inhalt
4. In welchem Format kann ich das umsetzen?
◼ Übertrag in einen analogen Plan oder Excel für kleine Unternehmen
◼ Digitale Lösung
*Ausbildungsrahmenpläne finden Sie beim BiBB in der Verordnung (VO) zum jeweiligen Ausbildungsberuf (Download 4 )
Arbeitshilfen: Schritt für Schritt zum eigenen Ausbildungsplan (Download 5 )
Video zur Erstellung eines Ausbildungsplans (Download 6 )
«
Oft wird uns nicht erklärt, warum wir wann und was machen müssen. Ich würde mir da viel mehr Ordnung und einen Überblick wünschen.
Ausbildungsplanung »
Lernräume

Hintergrund
Azubi-Projekte bieten viele Vorteile: das selbstorganisierte Lernen von Auszubildenden wird gefördert und Kompetenzen wie Team- & Kommunikationsfähigkeit oder Konfliktmanagement lassen sich ausbauen. Die Wahrnehmung der eigenen Handlungsfähigkeit führt zu mehr Motivation im Ausbildungsalltag. Auszubildende wünschen sich mehr Übernahme von Verantwortung, Mitgestaltungsmöglichkeiten und das Gefühl des Zutrauens – all das lässt sich mit Projektarbeit und der Schaffung von Experimentierräumen, in denen auch mal Fehler gemacht werden können, fördern. Betriebsinterne Azubi-Projekte können insbesondere für die Querschnittsthemen der modernisierten Standardberufsbildpositionen genutzt werden.
Tipps
◼ Einbeziehung von Auszubildenden in den Prozess der Ideenfindung: Das hilft, sich mit dem Vorhaben zu identifizieren und sorgt für mehr Motivation.
◼ Gemeinsames Brainstorming: Kann helfen Potenziale aus dem Betrieb aufzudecken, Ideen für Projekte zu entwickeln, sichert Mehrwert für den Betrieb.
◼ Zusammenarbeit: Über verschiedene Hierarchiestufen, Ausbildungsjahre und Bereiche. Das stärkt den Erfahrungs- und Wissensaustausch untereinander.
◼ Von klein zu groß: Azubi-Projekte können stark in Ziel, Ressourcen, Umfang, Dauer und Beteiligung variieren. Damit das Projekt nicht aufgrund eines zu hohen Umfangs scheitert, denken Sie zunächst in kleinen Projekten und sammeln Erfahrungen.
Ideen & Beispiele
◼ Organisation der Weihnachtsfeier, des Sommerfests, des Ausbildungsbeginns oder weiterer Team-Aktivitäten
◼ Optimierung von betriebsinternen Prozessen wie z. B. Digitalisierung der Materialausleihe/Bestand/ Datenmanagement
◼ Ausbildungs-Imagevideos für den Betrieb und Beschreibung des Ausbildungsalltags zur Fachkräftegewinnung
◼ Check der Unternehmenswebseite (z. B. Auffindbarkeit von Informationen für Bewerbungsprozess)
◼ Ideenwettbewerb für neues Produkt
◼ Azubi-Baustelle: Übertragung der Verantwortung für die Planung und Durchführung bestimmter Aufgaben für einen gewissen Zeitraum
Basiswissen Projektmanagement –für Azubis (Download 7 )
Ich finde es super, wenn mir Aufgaben zugetraut werden und ich Projekte von A-Z umsetzen kann.
«
Lernräume »
Lernbegleitung

Hintergrund
Die Kompetenzanforderungen, die Auszubildende, Ausbildungspersonal und auch Betriebe betreffen, werden zunehmend komplexer und verändern sich stetig. Die reine Vermittlung von Wissen ist nicht mehr ausreichend, der Fokus liegt auf der Förderung von Handlungslernen und Lernen in Echtsituationen (siehe auch ↘ Azubi-Projekte). Es geht darum, Auszubildende zu unterstützen, Dinge auszuprobieren, Lösungen zu finden und sie im Lernprozess zu begleiten.
Warum Lernbegleitung?
◼ Kompetenzen für die (digitalisierte)
Arbeitswelt können nur selbst entwickelt werden und lassen sich nicht, z. B. über reinen Frontalunterricht, vermitteln.
◼ Auszubildende stecken sich ihre eigenen Lernziele, geben Lerntempo und Lernweise vor: Unter- oder Überforderung wird vermieden.
◼ Lernerfolg kann besser gesichert werden.
◼ Die Wahrnehmung der eigenen Handlungsfähigkeit führt zu mehr Motivation.
Perspektivwechsel
Die Rolle als Lernbegleitung einzunehmen ist nicht ganz leicht und erfordert einen Perspektivwechsel: Weg von der Belehrung – hin zur Ermöglichung. Überlegen Sie für sich selbst:
◼ In welchen Situationen haben Sie in Ihrer Ausbildung am meisten/ besten gelernt?
◼ Was hätten Sie sich von Ihrem Ausbilder oder Ihrer Ausbilderin gewünscht?
Lesetipp: „Der Ausbilder als Lernbegleiter“
In der Broschüre wird erläutert, wie sich die Rolle und das Selbstverständnis von betrieblichem Ausbildungspersonal verändern (müssen). Insbesondere vor dem Hintergrund der Modernisierung vieler Ausbildungsverordnungen und geforderten Lernmethoden, ist es wichtig, sich mit dem Perspektivwechsel auseinander zu setzen. (Download 8 )
Ausbildungsbegleitung
Die Handwerkskammer Berlin unterstützt Sie personell bei der Lernbegleitung. Infos und Beratungsangebote finden Sie in der Rubrik „Ausbildung“ auf unserer Website. (Download 9 )
Mein Ausbilder hat bereits bei seiner ersten Vorstellung
«
gesagt, dass er nicht gern erkläre… Ich wusste da schon, dass es nicht leicht wird.
Lernbegleitung »
Lebenslanges Lernen

Hintergrund
Auszubildende bringen Kompetenzen mit und haben gute Ideen. Auch erleben sie es als hochmotivierend, wenn sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen lernen können. Denn: immer weiter zu lernen gehört heute ganz selbstverständlich zum Arbeitsalltag und wird unter dem Stichwort „lebenslanges Lernen“ zusammengefasst. (vgl. ↘Innovation)
Lernen sollte nicht zufällig passieren, sondern geplant und strukturiert. Auch ist die Beteiligung aller Mitarbeitenden wichtig. Für das Lernen voneinander kann jeder Betrieb die Form finden, die am besten passt. Voraussetzung ist, die entsprechenden ↘betrieblichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das fördert die Fachkräftebindung und sichert ihre Entwicklung.
Tipps
1. Klären, wo neues Wissen gebraucht wird.
2. Auswählen, welche Lernform am besten passt (z. B. interne Wissensweitergabe, externe Weiterbildung etc.).
3. Unterschiedliche Interessen berücksichtigen: Erfahrene Mitarbeitende haben andere Lerninteressen als Unerfahrene. Gemeinsam überlegen, wie Interessen zusammengebracht werden können.
4. Für Motivation sorgen: Die Leistungen anerkennen, loben und Feedback geben.
5. Regelmäßige Zeitfenster schaffen, Beteiligten Zeit und Raum geben.
Beispiele
1. In Lerntandems oder Lerngruppen kann sich zu bestimmten Themen ausgetauscht werden. Dies fördert den Wissenstransfer am Arbeitsplatz.
2. Lernnachmittage für Azubis können für die Arbeit am Berichtsheft, zur Vor- und Nachbereitung der Inhalte aus der Berufsschule oder zum Lernen von Fachbegriffen genutzt werden.
3. Arbeitszeitkonten auch für Lernzeiten nutzen.
4. eLearning Angebote nutzen. Erst jeder für sich, später Austausch zu dem Gelernten.
Lerntandems
Praxisbroschüre zur Gestaltung zum Lernen zwischen Älteren und Jüngeren. (Download 10 ,S. 20 ff.)
«
Ich wünsche mir, dass sich alle mehr Zeit für das Lernen nehmen und wir alle mehr voneinander lernen können.
Lebenslanges Lernen »
Anerkennung und Wertschätzung

Hintergrund
Zu einer guten Ausbildung gehört mehr als eine angemessene Entlohnung oder das Einhalten vereinbarter Arbeits- und Urlaubszeiten. Studien zeigen: Wertschätzung und Anerkennung fördern die Motivation, das gegenseitige Vertrauen, die Bindung an den Betrieb und damit auch den unternehmerischen Erfolg. Oft reichen schon kleine Gesten im Ausbildungsalltag, die die Zufriedenheit und Motivation erhöhen können. Ein kleines Lob wirkt Wunder, wenn es ehrlich gemeint ist. Zur Wertschätzung gehört aber auch die Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden.
Beispiele
Wertschätzung heißt, Mitarbeitenden zu zeigen, dass ihre Arbeit einen Wert für den Betrieb hat.
Kleine „Goodies“ –große Wirkung
◼ Lob, Dank für eine erbrachte Leistung. (vgl. ↘Austausch)
◼ Übertragung von mehr Verantwortung; eigenständige Arbeiten (vgl. ↘Zutrauen und Vertrauen)
◼ Vorschläge aufgreifen
◼ Bei Entscheidungen private (z. B. familiäre) Situation berücksichtigen.
◼ Wertschätzende Kommunikation (vgl. ↘Zuhören und ↘Kommunikation)
Auch kleine Ausbildungsbetriebe haben die Möglichkeit, mit Zusatzleistungen, Wertschätzung auszudrücken. Dazu gehören z. B.:
◼ Zuschuss zu Lehr- und Lernmaterialien wie Bücher
◼ Bereitstellung digitaler Lerngeräte wie Tablets
◼ Erlaubnis Werkzeuge / Werkstatt nach der Arbeit auch mal für private Zwecke zu nutzen
◼ Angebote zur Gesundheitsförderung
◼ Übernahme von Fahrtkosten
Konkrete Instrumente und Beratungsangebote zum Thema: Arbeitgeberattraktivität „Geld ist nicht alles“ finden Sie auf der Seite der Handwerkskammer Berlin. (Download 11 )
Leider gibt es sehr selten ein Lob für uns und wir fühlen uns oft wie Mitarbeitende zweiter Klasse. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit genauso anerkannt wird, wie die der Anderen.“
«
Anerkennung und Wertschätzung »
Kommunikation

Hintergrund
Kritik gehört zur Ausbildung. Wenn diese jedoch verbale Grenzen überschreitet, kann dies zu Demotivation oder einem Ausbildungsabbruch führen. Mit Gewaltfreier Kommunikation (kurz GFK) kann es gelingen, konstruktiv Kritik zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen. GFK ist eine Haltung, die menschliche Kommunikation ohne Vorwürfe und abwertendes nonverbales Verhalten anstrebt.
Vier Schritte der GFK
Beobachten
Welches konkrete Verhalten beobachte ich?
Bitte
Welchen Wunsch habe ich an dich?
Bedürfnis
Welches Bedürfnis habe ich?
Gefühle
Wie fühle ich mich damit?
Video: Das Eisbergmodell
Was hat Kommunikation mit einem Eisberg zu tun? Das kurze Video erklärt die Zusammenhänge. (Download 12 )
Beispiel 1:
„Du bist immer so still! Du musst Dich hier aber mal durchsetzen und auch mal was sagen!“
Besser: „Ich nehme Dich als ziemlich ruhig war, woran liegt das eigentlich?“
Beispiel 2:
„Du machst das immer falsch, das kann doch echt nicht wahr sein!“
Besser: „Ich habe beobachtet, dass Du Dich damit schwer tust. Wie kann ich Dir helfen?“
Daran, dass ich sehr oft angemeckert werde, habe ich mich fast schon gewöhnt. Wenn ich nicht schnell alles verstehe, bekomme ich nur zu hören, wie unfähig ich bin. «
Kommunikation
»
Bedürfnisse erkennen: aktiv Zuhören
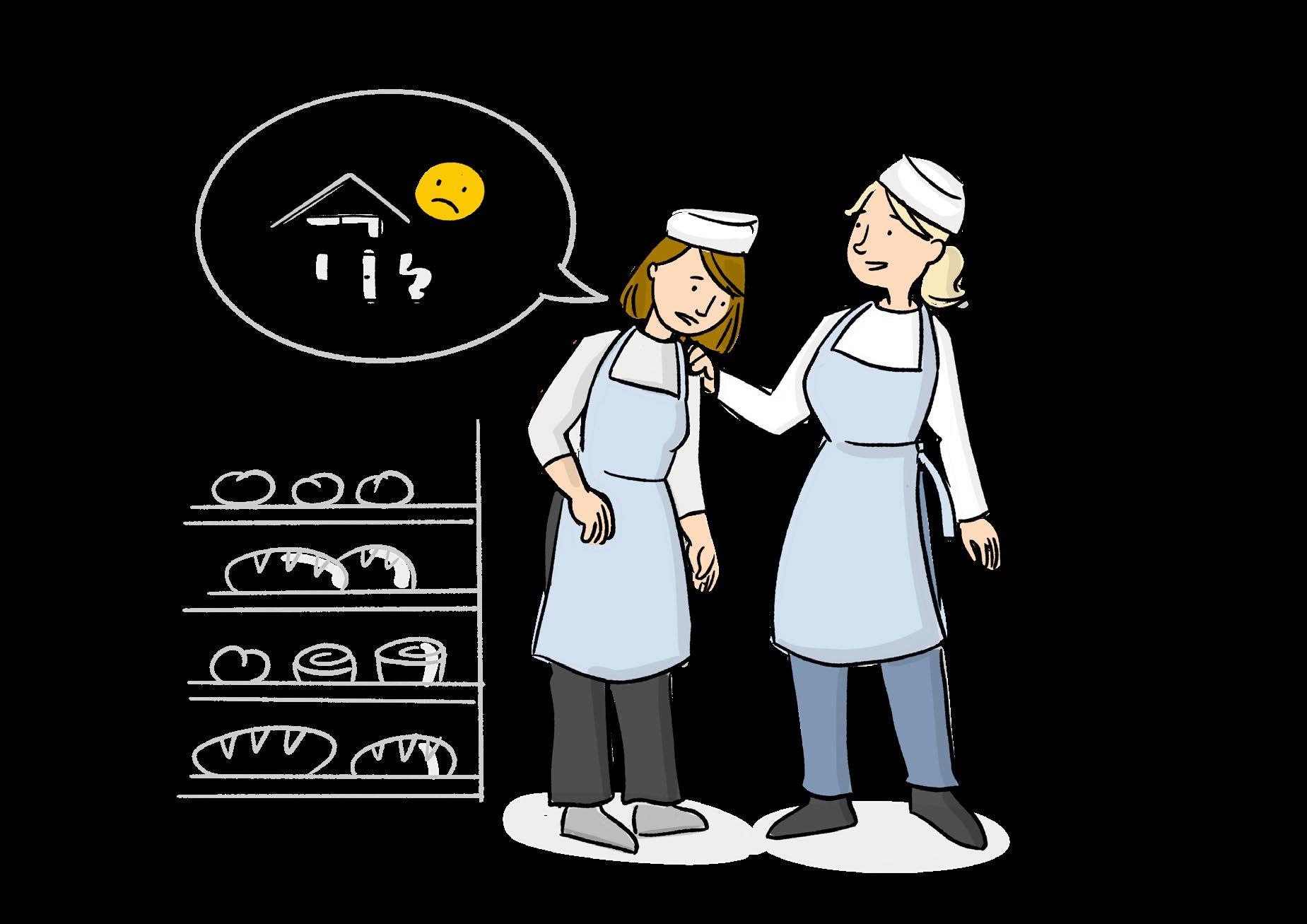
Hintergrund
Der formulierte Wunsch der Auszubildende nach mehr und aktivem Zuhören, deckt sich mit der Einschätzung des ausbildenden Personals, dass die pädagogischen Anforderungen an sie in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Ausbildungspersonal ist nicht nur formal für die Ausbildung verantwortlich, sondern fungiert oft als „Begleitung in allen Lebenslagen“. Das gilt insbesondere dann, wenn in dem Betrieb sehr junge Auszubildende lernen, die auch mal ihre privaten Sorgen mit in den Betrieb bringen und sich daher wünschen, neben beruflichen, auch mal private Dinge besprechen zu können. (vgl. ↘Kommunikation, ↘Lernbegleitung, ↘Feedback).
Was ist aktives Zuhören?
Aktives Zuhören beachtet sowohl den Inhalt als auch die Gefühle. Dafür gibt es Techniken, die trainiert werden können. So können Missverständnisse, Konflikte und Probleme besser gelöst werden. Voraussetzung ist ein wirkliches Interesse an der anderen Person.
Tipps
◼ Einen ruhigen Ort für das Gespräch suchen. Keine Ablenkung.
◼ Handy stumm schalten.
◼ Kopfnicken, Blickkontakt.
◼ Gespräch auf Augenhöhe, z. B. beide sitzen.
Techniken des aktiven Zuhörens (nach Carl Rogers):
1. Nachfragen.
2. Verstandenen Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben (Paraphrasieren).
3. Wahrgenommene Gefühle verständnisvoll wiedergeben.
4. Missverständnisse durch Nachfragen vermeiden.
5. Das Gesagte zusammenfassen und weiteres Gespräch anregen.
Lernvideo: In diesem Video erklärt Michael Sokoll (FOM Hochschule), was aktives Zuhören ist und wie es umgesetzt werden kann. (Download 13 )
Ich möchte mit meinen Bedürfnissen gehört und gesehen werden. «
Bedürfnisse erkennen: aktiv Zuhören »
Regelmäßiger Austausch

Hintergrund
Auszubildende wollen ernst genommen werden und nehmen es als wertschätzend wahr, wenn Betriebe sich Zeit für geplante und strukturierte Feedbackgespräche nehmen. Dort können sie gemeinsam mit dem Ausbildungspersonal in Ruhe auf die Ausbildung schauen und prüfen, in welchem Bereich noch Verbesserungsbedarf besteht. Unzufriedenheiten oder Missverständnisse können rechtzeitig erkannt und besprochen werden. Das schafft Vertrauen und steigert die Motivation.
So geht‘s
◼ Das Gespräch vorbereiten:
Was genau möchten Sie dem/der Auszubildenden mitteilen? Geht es um eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Verhalten? Wo soll das Gespräch hinführen?
◼ Die Gesprächssituation arrangieren:
Planen Sie ausreichend Zeit für das Gespräch ein und kündigen Sie es rechtzeitig an. Ist der Zeitpunkt für Sie beide geeignet? Finden Sie einen angemessenen Raum, in dem das Gespräch ungestört bleibt.
◼ Konkrete Situationen ansprechen:
Vermeiden Sie Verallgemeinerungen, wie z. B. „immer“ oder „nie“. Redewendungen dieser Art bauen Anspannung auf und lenken vom Wesentlichen ab.
◼ Konkrete Verhaltensweisen benennen:
Leitfaden Reflexionsgespräche
Instrument für Ausbildungsverantwortliche inkl. Hintergrundinfos und Erläuterungen zum Vorgehen. (Download 14 )
Broschüre
Praxisbroschüre zu Feedback im Ausbildungsalltag. (Download 15 )
Nehmen Sie Bezug auf eine konkrete (Arbeits-)Situation, die Sie beobachtet haben. (vgl. ↘Kommunikation) Formulieren Sie ihre Erwartungen und begründen Sie die Anforderungen.
◼ Feedback einholen:
Fragen Sie nach, ob Ihre Beobachtungen auf Verständnis bei Ihrem Gegenüber stoßen oder welche Schilderungen Ihr Auszubildender bzw. Ihre Auszubildende entgegnen oder ergänzen möchte.
◼ Vereinbarungen treffen:
Halten Sie fest, wie das Besprochene umgesetzt werden wird.
«
Wir Azubis haben oft gar keine Ahnung, wie wir in der Ausbildung stehen und würden uns wünschen, mal eine Rückmeldung zu bekommen.
Regelmäßiger Austausch »
Zusammenarbeit

Hintergrund
Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit ist eine gute Kommunikation. Auszubildende sind Teil des Teams und es liegt in der Verantwortung des Betriebes, sie gut einzubinden. Darüber hinaus gehört Teamfähigkeit als Sozialkompetenz zu einer der Schlüsselkompetenzen, die Teil jeder beruflichen Ausbildung sind. Der digitale Wandel erfordert zusätzlich, die Zusammenarbeit auch digital zu gestalten.
Netzwerk Q 4.0
Das bundesweite Netzwerk bietet Trainings für Berufsbildungspersonal zum Thema (digitale) Zusammenarbeit an. (Download 16 )
Merkmale guter Zusammenarbeit im Team
◼ Alle arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin.
◼ Klare Regeln, Aufgaben, Verbindlichkeiten sorgen für Transparenz.
◼ Teammitglieder vertrauen einander.
◼ Teammitglieder geben sich regelmäßig Rückmeldungen.
◼ Konflikte werden konstruktiv gelöst.
Digital Zusammenarbeiten
Eine zunehmend digitale Arbeitswelt, geht auch mit einer digitalen Zusammenarbeit in der Ausbildung einher.
Dazu gehört z. B.:
◼ Zeit- und Arbeitsplanungen untereinander abstimmen
◼ Orts- und zeitunabhängiger Abruf des Sachstands von Arbeitsaufträgen
◼ Gruppenarbeiten koordinieren, direktes Feedback
◼ Wissensspeicher gemeinsam anlegen
◼ Arbeitsergebnisse teilen, untereinander kommentieren und dokumentieren
Digitale Zusammenarbeit kann die Effizienz und Transparenz steigern und damit die Motivation erhöhen.
Mich motiviert die Zusammenarbeit in unserem Team.
Wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen. «
Zusammenarbeit »
Zutrauen und Vertrauen

Hintergrund
Die Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ist ein Kennzeichen hoher Ausbildungsqualität. Die Fähigkeit, Aufträge selbstständig umzusetzen, ist elementares Ziel der Ausbildung. Dazu gehört: Arbeitsaufträge zu planen, durchzuführen und die Ergebnisse eigenständig zu bewerten. Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich als ↘ Lernbegleitung verstehen, fördern die Entwicklung der Auszubildenden ohne sie gleichzeitig zu überfordern. Durch die abgestimmte Verantwortungsübernahme kann die Motivation der Auszubildenden erhöht werden.
Selbstständigkeit fördern
Durch Beteiligung kann die Selbstständigkeit erhöht werden. Dafür können z. B. gemeinsam die nächsten Ausbildungsschritte und Arbeitsaufträge geplant werden. In Beurteilungsgesprächen (vgl. ↘ regelmäßiger Austausch) können die Arbeitsergebnisse gemeinsam ausgewertet werden. Auf diese Weise haben Auszubildende die Möglichkeit, die Umsetzung mitzugestalten, sie fühlen sich ernst genommen und übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Tun.
Reflexionsfragen
◼ Wissen Sie, wie Sie Arbeitsaufgaben lernförderlich gestalten?
◼ Können Sie Fähigkeiten Ihrer Auszubildenden einschätzen und darauf eingehen?
◼ Fällt Ihnen die Planung von Arbeitsaufträgen und die Rückmeldung zu den Ergebnissen leicht?
◼ Wie vermitteln Sie Ihren Auszubildenden eine dienstleistungsorientierte Arbeitsweise?
Ampeltafel
Instrument, mit dem Fremd- und Selbsteinschätzungen zu Lernergebnissen in der Ausbildung vorgenommen werden. (Download 17 )
Erkundungsauftrag
Instrument zur Förderung der Selbstständigkeit. (Download 18 )
Ich wünsche mir, dass mein Ausbilder mehr Vertrauen in meine Fertigkeiten hat und ich auch mal eigenständig Aufgaben übernehmen kann.
«
Zutrauen und Vertrauen »
Innovationen fördern

Hintergrund
Die Zukunftsfähigkeit vieler Betriebe hängt davon ab, ob und wie sie es schaffen, sich auf neue Anforderungen und Entwicklungen einzustellen. Dazu gehören z. B. technische Neuentwicklungen, aber auch Veränderungen bei den Wünschen von Kundinnen und Kunden, auf die ein Betrieb reagieren muss. Dafür ist es wichtig, dass ein kontinuierliches Lernen als Teil der Arbeit verstanden wird und eine entsprechende Lernkultur gepflegt wird. Das gilt auch und insbesondere für die Ausbildung.
Mein Betrieb hat eine neue CNC-Maschine angeschafft.
Die anderen Kollegen hatten keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Also haben wir das als Auszubildende gemacht. Jetzt können wir als Betrieb ganz neue Produkte anfertigen. Das war eine tolle Erfahrung.
Tipps
Für Kleinstbetriebe bietet es sich an, nicht nur Möglichkeiten für eine interne Umsetzung zu prüfen, sondern auch externe Unterstützungsstrukturen zu nutzen.
◼ Intern: Über ↘Azubi-Projekte können Innovationen im und für den Betrieb entwickelt und erprobt werden.
◼ Extern: Überbetriebliche Berufsbildungsstätten, z. B. Lehrbauhof Berlin.
◼ Extern: Lernerfahrungen und -ergebnisse aus Lehrlingsunterweisung (ÜLU) nutzen
ÜLU in Berlin
Auf der Seite der HWK erhalten Sie Informationen zur Organisation, Kosten und Fördermöglichkeiten der ÜLU. (Download 19 )
Reflexionsfragen
◼ Woher bekommt Ihr Betrieb neue Ideen & Anregungen?
◼ Gibt es einen Ort / Raum, in dem Sie sich zu neuen Ideen (Produkte, Fertigungstechniken etc.) austauschen?
◼ Wenn in Ihrem Betrieb neue Maschinen, Werkzeuge angeschafft werden: Wie werden Auszubildende bei der Einarbeitung einbezogen?
Digitalisierung und Innovation
Beratungen, Veranstaltungen, Förderhinweise der HWK Berlin finden Sie bei den Beauftragten für Innovation und Technologie (BIT). (Download 20 )
«
Innovationen »
Vereinbarkeit

Hintergrund
Das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben“ hat für viele Auszubildende einen hohen Stellenwert, sei es, weil sie bereits eine eigene Familie haben oder sie einem regelmäßigen Hobby nachgehen. Befragungen zeigen, dass immer mehr Beschäftigte flexibel und zeitlich reduziert arbeiten möchten, um einen guten Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben herstellen zu können. Betriebe, die eine gute Vereinbarkeit ermöglichen, haben deutliche Wettbewerbsvorteile bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung.
Wie kann ich Vereinbarkeit in meinem Betrieb fördern?
Vereinbarkeit ist kein Frauenthema. Immer mehr Väter wollen ebenfalls ihre Rolle und Betreuungsaufgaben wahrnehmen. Wichtig ist, dass betriebliche Angebote allen bekannt sind und die Inanspruchnahme, z. B. von Elternzeit/Teilzeit, keine Nachteile mit sich bringt. In dem jährlichen Mitarbeitendengespräch können Umsetzungsmöglichkeiten festgehalten werden.
◼ Flexible Arbeitszeiten im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten anbieten.
◼ Individuelle, ggf. zeitlich begrenzte Maßnahmen und Angebote ermöglichen.
◼ Möglichkeiten der Teilzeit-Ausbildung prüfen.
◼ Führungs- und Leitungskräfte sind Vorbilder: z. B. Führen in Teilzeit.
◼ Kurzfristige Lösungen, z. B. bei Personalausfällen, im Team besprechen und abstimmen.
Praxisbeispiele aus dem Handwerk
„Chancengleichheit im Handwerk: Praxisbeispiele und Instrumente“: In dieser Broschüre finden Sie Beispiele, wie Berliner Handwerksbetriebe das Thema Vereinbarkeit für sich umgesetzt haben. (Download 21 )
Auf der Website der Handwerkskammer Berlin finden Sie weitere Infos zum Thema Vereinbarkeit und Chancengleichheit. (Download 22 )
«
Ich möchte gern als Vater meine Ausbildung besser mit der Betreuung meiner Kinder vereinbaren können. Dafür ist es toll, dass mein Betrieb mir flexible Arbeitszeit ermöglicht.
Vereinbarkeit »
Sexismus und sexuelle Belästigung

Hintergrund
Viele Handwerkerinnen berichten, dass Sexismus fast schon zum Arbeitsalltag gehört und sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz „Normalität“ ist. Nicht selten kommt es vor, dass diejenigen, die sie diskriminieren, qua Position geschützt sind und sich niemand traut für die Frauen Partei zu ergreifen. Hier wünschen sich die Auszubildenden Veränderung. Sexismus kann in unterschiedlichen Formen auftreten, von scheinbar harmlosen Bemerkungen bis hin zu Demütigungen und sexueller Belästigung.
Anlaufstellen für Frauen
HWK Ausbildungsbegleitung (Link A ),
Mädchennotdienst (Link B ),
LARA Berlin (Link C )
Welche Pflichten habe ich als Arbeitgeber?
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet jede Form der sexuellen Belästigung (§3 AGG). Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind verpflichtet ihre Beschäftigten gegen sexuelle Belästigung zu schützen (§12 AGG).
Wie können Sie Beschäftigte konkret vor Belästigung schützen?
◼ Information an Beschäftigte, was Sexismus und sexuelle Belästigung ist
◼ Aufklärung über Rechte und Pflichten, über Beschwerdewege und Unterstützungsangebote
◼ Information zu möglichen Sanktionen
Testen Sie Ihr Wissen: Was zählt zu sexueller Belästigung?
□ Verbale Belästigung
□ Physische Belästigung
□ Anzügliche Blicke
□ Zeigen pornografischer Bilder
unter das AGG und sind gesetzlich verboten.
Auflösung: Alle vier Formen fallen
Leitfaden: „Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?“ (Download 23 )
«
Wir wünschen uns eine Null-Toleranz-Politik gegenüber sexuellen Belästigungen und Diskriminierungen.
Sexismus und sexuelle Belästigung »
Links zu Arbeitshilfen und Literatur
1 Checkliste Ausbildungsmanagement
https://ausbildungsqualitaet-berlin.de/wp-content/ uploads/2020/11/Heft_Ausbilden_Nr5_ Ausbildungsmanagement.pdf
7 Basiswissen Projektmanagement
https://ausbildungsqualitaet-berlin.de/wp-content/ uploads/2021/11/Lernkarten_Projektmanagement_ besmart.pdf
2 Einführungsmappe
https://www.foraus.de/dokumente/pdf/Instr_05__ Einfuehrungsmappe__Q3.pdf
8 Der Ausbilder als Lernbegleiter
https://www.foraus.de/de/themen/foraus_112385.php
3 Fördermöglichkeiten
https://www.hwk-berlin.de/artikel/zuschuessefuer-berliner-ausbildungsbetriebe-91,110,169.html
9 Ausbildungsbegleitung
https://hwk-berlin.de/artikel/waehrend-derausbildung-91,199,286.html#Section3
4 Ausbildungsrahmenpläne
https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_ berufesuche.php
10 Lerntandems
https://www.inqa.de/SharedDocs/downloads/webshop/lernfaehig-im-tandem.pdf;jsessionid=82005380FDB24F64FC18788B12FDAB93.delivery2-replication?__ blob=publicationFile&v=1
5 Arbeitshilfen
https://ausbildungsqualitaet-berlin.de/wp-content/ uploads/2021/08/BAQ-Heft01-neu2021_online.pdf
11 Arbeitgeberattraktivität
https://www.hwk-berlin.de/artikel/personal-91,129,300. html#AGattraktivitaet
6 Video Ausbidungsplan
https://ausbildungsqualitaet-berlin.de/videoausbildungsplanung/
Lernräume Lernbegleitung Lebenslanges Lernen Anerkennung und Wertschätzung
Ausbildungsplanung Betriebliche Rahmenbedingungen
12 Video: Das Eisbergmodell
https://www.youtube.com/watch?v=iw-48myCRbo
19 ÜLU in Berlin
https://www.hwk-berlin.de/artikel/organisation-derausbildung-91,0,287.html
13 Lernvideo
https://www.youtube.com/watch?v=2nx04QV16y0
20 Digitalisierung und Innovation
https://www.hwk-berlin.de/artikel/digitalisierungund-innovation-91,0,364.html
14 Leitfaden Reflexionsgespräche
https://www.foraus.de/dokumente/pdf/
Instrument_26_Lernprozessbegleitung(1).pdf
21 Praxisbeispiele
https://www.kos-qualitaet.de/wp-content/ uploads/2021/09/fsh_Chancengleichheit-imHandwerk_2018.pdf
15 Broschüre
https://ausbildungsqualitaet-berlin.de/wp-content/
uploads/2020/01/Heft_Ausbilden_Nr4_feedback.pdf
22 Infos bei der HWK
https://www.hwk-berlin.de/artikel/vereinbarkeitfamilie-und-beruf-91,183,351.html
16 Netzwerk Q4
https://netzwerkq40.de/de/
17 Ampeltafel
https://www.foraus.de/dokumente/pdf/
Instrument_08_-_Ampeltafel_-_ML-QuES.pdf
23 Leitfaden
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/ SharedDocs/downloads/gb-check/leitfaden_ was_tun_bei_sexueller_belaestigung.html
18 Erkundungsauftrag
https://www.foraus.de/dokumente/pdf/ Instrument_24.pdf
Aktives Zuhören
Zusammen- arbeit Zutrauen und Vertrauen
Kommuni- kation
Regelmäßiger Austausch
Innovationen
Vereinbarkeit
Sexismus
Anlaufstellen
Anlaufstellen bei der Handwerkskammer Berlin
Ausbildungsberatung
Erste Anlaufstelle und vertrauliche Beratung für alles rund um das Thema Ausbildung:
→ Ausbildungsberatung@hwk-berlin.de
→ 030 25903-506
A Ihre Anlaufstellen in der Handwerkskammer
https://www.hwk-berlin.de/artikel/waehrendder-ausbildung-91,199,286.html
Ausbildungsbegleitung
Vertrauliche Beratung und nachhaltige Begleitung während der Ausbildung → Ausbildungsbegleitung@hwk-berlin.de
Azubivermittlung
Unterstützung bei der Azubisuche
→ vermittlung@hwk-berlin.de
Inklusionsberatung
Vertrauliche Beratung bei Unterstützungsbedarfen und Behinderung
→ inklusion@hwk-berlin.de
Förderung der Berufsausbildung
Finanzielle Förderung für Ausbildungsbetriebe:
https://www.hwk-berlin.de/artikel/zuschuesse-vom-land-berlin-fuer-unternehmen-91,110,471.html
Weitere Anlaufstellen
Beihilfe für Auszubildende
Finanzielle Hilfe für Auszubildende:
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
Azubiakademie
Die Azubiakademie bietet tolle Workshops, Nachhilfe, Ausflüge für Auszubildende und alles kostenlos! www.azubiakademie.de
Mentoring durch Vera, Senior Expertenservice
Kostenlose und individuelle Unterstützung
und Begleitung in der Ausbildung: www.vera.ses-bonn.de
soulspace
Unterstützung für junge Menschen in seelischen Krisen: www.soulspace-berlin.de
Legasthenie-Zentrum Schöneberg
Beratung und Diagnostik: www.legasthenie-zentrum-berlin.de
B Anlaufstellen für Frauen – Mädchennotdienst
https://www.berlin.de/notdienst-kinderschutz/ maedchennotdienst/
C Anlaufstellen für Frauen – LARA Berlin
https://lara-berlin.de/home
Impressum Herausgeber Handwerkskammer Berlin Blücherstraße 68 10961 Berlin Telefon: 030 25903-01 Telefax: 030 25903-235 info@hwk-berlin.de www.hwk-berlin.de Redaktionsschluss: Dezember 2022