Geborgenheit und Liebe schenken
Sibylle Wagner
Familie & Beziehungen
UMGANG MIT TRAUER

Körper & Seele
RESILIENZ: ICH KRIEG DAS HIN
Glaube & Lebenshilfe
GELASSENHEIT LERNEN








Familie & Beziehungen
UMGANG MIT TRAUER

Körper & Seele
RESILIENZ: ICH KRIEG DAS HIN
Glaube & Lebenshilfe
GELASSENHEIT LERNEN







Vor neun Jahren hat Sibylle Wagner sich entschieden, SOS-Kinderdorfmutter zu werden. Seitdem versorgt sie jeden Tag sechs Kinder (plus drei eigene), organisiert den Alltag der Familie und die Zusammenarbeit im Team. „Der Tag läuft nie so, wie ich ihn geplant habe“, verrät sie. „Ich kann gar nicht gut organisieren, aber ich weiß, dass Jesus mich hier hingestellt hat. Und er gibt mir die Mitarbeiter, die mich ergänzen.“
Frau Wagner, wie viele Kinder leben bei Ihnen im Kinderdorf-Haus?
Im Moment betreue ich sechs Kinder. Hinzu kommen unsere eigenen drei Kinder und ein Erziehungsstellenkind, das an meine Familie angebunden ist. Vier Kinder sind bereits ausgezogen.

Die Jüngsten, ein Zwillingspaar, sind acht Jahre alt. Die Älteste ist 18 und zur gleichen Zeit hier eingezogen wie ich; das ist jetzt neun Jahre her. Sie hätte durchaus wieder nach Hause ziehen können, aber im Gegensatz zu zweien ihrer Geschwister wollte sie nicht. Sie hat hier Wurzeln geschlagen. Ich habe eine gute Beziehung zu ihrer Mutter. Ich versuche, zu allen Eltern im Kontakt zu bleiben, weil das für die Kinder viel ausmacht. Deshalb sage ich jeder Mutter: „Sie bleiben die Mama. Ich heiße vielleicht Kinderdorfmutter, aber ich bin Sibylle, auch für die Kinder.“ Ich unterstütze es daher, dass die Kinder Kontakt zu ihren Eltern haben.
Und wie viele Kinder wohnen insgesamt im Kinderdorf?
Bei uns im SOS-Kinderdorf Württemberg in SchorndorfOberberken sind es etwa 70. Zusätzlich haben wir drei Außen-Wohngruppen mit etwa 20 Kindern und Jugendlichen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Pflegefamilie und einer SOS-Kinderdorf-Familie?
Mein Mann und ich hatten zehn Jahre lang ein Erziehungsstellenkind. Da fühlten wir uns oft allein. Hier ist immer Fachpersonal in Reichweite, das man rund um die Uhr um Unterstützung bitten kann.
Die Kinderdorfmütter bei uns im Dorf haben ein gutes Verhältnis untereinander. Wir treffen uns regelmäßig zur Mütterrunde und tauschen uns aus. Da sagt jede, wie es ihr geht. Wenn ich etwas brauche oder es mir nicht gut geht, schreibe ich das in die Mütter-WhatsApp-Gruppe und kann auf Unterstützung und Ratschläge zählen.
Und die Kinder haben wiederum andere Kinder um sich, die das gleiche Schicksal teilen. Daher fühlt es sich auch für die
Kinder anders an, wenn sie in einem SOS-Kinderdorf leben. Das Tolle ist: Nicht nur die Kinder finden hier ein neues Zuhause, auch wir als Familie haben hier ein Zuhause gefunden.
Mit welchen Erfahrungen kommen die Kinder zu Ihnen?
Ein hohes Risiko in unserer Gesellschaft bringen Stiefelternkonstellationen bzw. Patchworkfamilien mit sich: Hier ist eins von zwölf Kindern auf stationäre Jugendhilfe angewiesen. Viele Kinder kommen auch schlicht deshalb zu uns, weil ihre Eltern es nicht schaffen, sie ausreichend zu versorgen. Viele leiden unter psychischen Erkrankungen, Abhängigkeiten oder es gibt Gewalt in der Familie.
Oft haben die Kinder zu Hause nur unzureichend zu essen bekommen. Wenn ein Nachbar oder ein Lehrer so etwas mitbekommt, wird das Jugendamt informiert und schaut nach – und dann kommen oft noch andere Dinge zum Vorschein. Die Eltern kümmern sich unzureichend um die Kinder, teils sind diese sich selbst überlassen und gehen zeitweise nicht in die Schule. Viele waren nie in einem Kindergarten. Und es leben auch nicht wenige Kinder in unserem Kinderdorf, die schon in ihrem jungen Alter sexuelle Gewalt erleiden mussten.
Wie werden die Kinder mit diesen schlimmen Erfahrungen fertig?
Die Kinder besitzen eine besondere Resilienz. Gegenüber von uns wurde ein ION-Haus eröffnet [ION: in Obhutnahme].
Dorthin kommen Kinder von 0–11 Jahren, die von jetzt auf gleich aus ihrer Familie herausgenommen werden, oft durch die Polizei. Hier gibt es keine Vorbereitungszeit.
Und dann sehe ich, wie das Kind am nächsten Tag vor dem Haus auf dem Dreirad oder Fahrrad herumfährt und Kontakte zu anderen Kindern bekommt.
Natürlich kommen später die schlimmen Erfahrungen ans Licht, und sie brauchen Unterstützung und Therapie. Dennoch bedeutet das nicht, dass sie keine Chance mehr im Leben haben.



Es gibt viele Begriffe, mit denen man Jesus beschreiben könnte: Liebe, Heilig, Ermutiger, Retter, Heiler. Eines ist meistens nicht dabei: gelassen.
Von Deborah Füßer





Jesus verspricht in der Bibel: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen“ (Matthäus 11,28-29). Dieser Vers hat mich schon immer tief angesprochen. Ich fand es leicht, ihm zu glauben und die versprochene Ruhe zu spüren, wenn alles gut läuft und ich das Gefühl hatte, mein Leben im Griff zu haben.
Doch die letzten Jahre haben mich genau in dieser Ruhe sehr herausgefordert: ein unerwarteter Jobverlust, eine chronische Krankheit, die mich auf die Hilfe anderer angewiesen machte und mich dazu zwang, viele Wochen überwiegend liegend zu verbringen. Auch als es mir körperlich langsam besser ging, standen neue Herausforderungen an – abgesagte Projekte in meiner Selbstständigkeit oder wiederkehrende gesundheitliche Rückschläge. Diese Zeiten kratzten an meiner Existenz – sowohl finanziell als auch körperlich und emotional.
EINE LEISE EINLADUNG
Wenn ich begann, meine Zukunft allein an meiner nicht mehr vorhandenen Kraft und den begrenzten Möglichkeiten zu messen, fühlte ich mich manchmal mühselig und beladen. Selbst als ich gezwungen war, körperlich stillzuhalten, spürte ich, dass die innere Ruhe alles andere als selbstverständlich ist. Ich erkannte, wie sehr ich mich zuvor auf meine eigene Stärke und auf menschliche Sicherheiten verlassen hatte. Ich war erschöpft und müde. Doch gerade inmitten dieses Sturms spürte ich Jesu Einladung, mit all meiner Last zu ihm zu kommen, mein Herz bei ihm auszuschütten und bei ihm Ruhe zu finden. Aber durfte ich wirklich ruhig sein, wenn das Leben so stürmisch war? Würde Gott mich mit allem versorgen, was ich brauchte, selbst dann, wenn ich nichts leisten konnte und die Herausforderungen mich zu überwältigen schienen?
Die Aufforderung von Jesus „Lernt von mir“ (Matthäus 11,29) hat mich besonders angesprochen und meine Neugier geweckt. Ich begann, tiefer einzusteigen und Jesus zu beobachten, wie er mit den Stürmen des Lebens umging. Zudem las ich über ein Gespräch zwischen dem Psychologen Bill Gaultiere und Dallas Willard, einem bekannten Theologie- und Philosophieprofessor. Bill stellte seinem Freund die Frage: „Wenn du Jesus beobachten könntest und ihn mit einem Wort beschreiben solltest, welches würdest du wählen?“ und bekam zur Antwort: „Gelassen“. Diese Antwort faszinierte und irritierte mich zunächst. Hat Jesus nicht auch Blut geschwitzt vor Angst, war zornig über die Pharisäer oder die Händler im Tempel, vergoss Tränen und war erschüttert? Jesus war ein Mensch wie du
und ich und empfand die ganze Bandbreite an Emotionen. Jesus war keineswegs gleichgültig, dennoch scheint ihn nichts aus der Ruhe zu bringen.
DIE RUHE IM STURM
Es lohnt sich, einmal tiefer einzusteigen und zu beobachten, mit welcher Gelassenheit Jesus auftrat.
Als er gefangen genommen wurde, ging er den Soldaten sogar entgegen. Als Petrus dabei aus dem Affekt heraus reagierte und einem Soldaten das Ohr abschlug, nahm sich Jesus die Zeit, heilte den Soldaten und wies seine Jünger zur Ruhe an: „Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen würde?“ (Matthäus 26,53).
Selbst in seinem tiefsten Schmerz spürt man sein tiefes Vertrauen in Abba, seinen Vater: „Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, geschehe“ (Markus 14,36).
Als er angeklagt wurde, blieb Jesus ganz ruhig und schwieg vor seinen Anklägern (Matthäus 27,11-14).
Er schrieb in den Sand, als die Pharisäer ihn dazu drängen wollten, die Steinigung einer Frau zu befürworten, die Ehebruch begangen hat (Johannes 8,6-8).
Als Jesus immer bekannter wurde und die Menschen in Scharen herbeiströmten, um von ihm zu hören und geheilt zu werden, zog er sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten (Lukas 5,15-16).
Als er erfuhr, dass sein Freund Lazarus krank war, eilte er entgegen den Erwartungen und Vorstellungen seiner Umgebung nicht los, sondern blieb noch zwei Tage an dem Ort, an dem er war, um dann in seinem göttlichen Timing loszugehen und Lazarus von den Toten aufzuerwecken (Johannes 11,6).
Er begann seinen Dienst mit 40 Tagen in der Wüste, völlig im Verborgenen. Als er in dieser Zeit in Versuchung geriet, verfiel er nicht in Panik, sondern hielt den Lügen Gottes Wort entgegen (Matthäus 4,1-11).
Mitten in einem heftigen Sturm, in dem die Jünger in Panik gerieten, schlief Jesus im Boot (Markus 4,38).
VON SCHNELL ZU GEHETZT
Jesu Gelassenheit fasziniert mich. Unabhängig von den Umständen, Herausforderungen oder Erwartungen lebte er stets in einer Grundhaltung der Ruhe und des Vertrauens. Er war niemals in Eile.
Wie sieht das in meinem Leben mit der Eile und der Gelassenheit aus? Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir so unendlich beschäftigt sind, so viele Optionen haben und eigentlich immer mehr tun könnten. Ruhelosigkeit, Geschäftigkeit und ständige Erreichbarkeit sind unsere Begleiter. Beim Warten greifen wir zum Handy, in



Von Ira Schneider





Kürzlich waren wir bei einem befreundeten Paar zum Pasta-Essen eingeladen. Es war ein richtig gemütlicher Abend. Während wir es warm und kuschelig hatten, war es draußen frisch. So langsam neigte sich der Herbst dem Ende zu. Die bevorstehenden Feiertage schienen nicht mehr fern. So kamen wir aufs Thema Weihnachten zu sprechen. Irgendwann fragte unser Freund, wie wir denn Weihnachten feiern würden.
Wir erzählten unseren Freunden von unseren Weihnachtsfestlichkeiten. Was mich störte, war das Gefühl zu haben, für unseren sehr bewussten Umgang mit dem Fest belächelt zu werden. Irgendwie schienen die beiden uns nicht so richtig ernst zu nehmen. Das traf einen wunden Punkt in mir.
WEIHNACHTEN IN DER HERKUNFTSFAMILIE
Natürlich war da eine Leerstelle im Gespräch, es fehlte der Kontext. Unser guter Freund konnte nicht wissen, wie viel Stress die Feiertage in der Vergangenheit für uns mit sich gebracht haben. Es gab zwei Ebenen, die uns bei dem Thema Weihnachten forderten – eine geistliche und eine zwischenmenschliche. In unseren beiden Herkunftsfamilien fehlte uns ein Fest, das wirklich Tiefe hatte und das tatsächlich Jesu Geburt und Liebe feierte. Ich fühlte mich als Teenager am Weihnachtsabend immer ein wenig allein, da nur ich für mich allein Jesus still im Herzen feierte. Und bei meinem Mann wurde Weihnachten seit der Trennung seiner Eltern immer von einem seltsamen Früher-waren-alle-zusammen-Gefühl überschattet.

Dann gab es da noch die zwischenmenschliche Ebene als weiteren Schmerzpunkt. Wenn die Feiertage vor der Tür stehen, werden meinem Mann und mir sowohl die Komplexität unseres Familiensystems, als auch unser alter Schmerz wieder neu bewusst: Unsere Eltern sind jeweils getrennt. Alle leben in neuen Ehen oder Partnerschaften und wohnen an verschiedenen Orten in ganz Deutschland. Das bedeutet, dass wir in unserer Feiertagsgestaltung gedanklich vier Parteien berücksichtigen müssen, da nicht alle miteinander in einem Raum feiern würden. An unterschiedlichen Orten innerhalb von nur wenigen Urlaubstagen zu sein, ist ebenfalls ziemlich stressig. Wir navigieren uns durch vier Familienwelten, was eine besondere gedankliche, zeitliche und emotionale Leistung erfordert. Was mir bei diesem Pasta-Essen schmerzlich bewusst wurde, war das Gefühl der Wehmut. Unser Freund hat Geschwister, die an Gott glauben und Ehepartner haben, die mit Gott unterwegs sind. Über Generationen hinweg lebt seine Familie bereits in der Nachfolge von Jesus. Der Glaube ist Tradition und Identität zugleich. Das ist ein Erbe, das unser Freund mit seiner Familie fortführen darf, indem er zum Beispiel wertvolle Traditionen an sein Kind weitergibt. Als wir uns als Paar gefunden hatten, entstand in uns der Wunsch, Weihnachten anders zu feiern, als wir es erlebt hatten. Wir wollten uns bemühen, ein neues Familienfest mit eigenen und bewussten Traditionen aufzubauen. Denn auch in der Familie unseres Freundes hat irgendwann in irgendeiner Generation eine Familie gestartet, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Sicher, zum einen ist es ein großes Privileg, gemeinsam Familientraditionen zu gestalten und ihnen eine – vielleicht neue – Bedeutung zu schenken. Zum anderen haben wir aber auch eine Verantwortung gegenüber der kommenden Generation. Es ist wichtig, dass wir Traditionen, die tiefe und identitätsstiftende Werte vermitteln, bereits jetzt vorbereiten, damit wir in der Zukunft etwas Gutes aussäen können.
Die Erwartungshaltungen an uns, wo wir wann und wie lange über die Feiertage sein sollten, hat uns in der Vergangenheit jedes Jahr überfordert und wir mussten einen Umgang damit finden. Vor ungefähr sechs Jahren noch gab es Weihnachtsfeste, an denen ich mich regelrecht zerrissen gefühlt habe, vermischt mit Schuldgefühlen. Unsere Seelen waren erschöpft, wenn wir die vielen langen Reisen antraten. Gefühlt fand Weihnachten auf der Autobahn statt. Nicht selten flossen bei mir auf den Rückfahrten Tränen, weil mir neu bewusst wurde, wie zerstückelt unsere Familien sind. Daher suchten mein Mann und ich nach einer anderen Lösung, bei der wir nicht jedes Jahr von den verschiedenen Eindrücken völlig überflutet und erschöpft werden.
Ich würde gern schreiben, dass wir mittlerweile alles geordnet und im Griff haben, aber das wäre nur die halbe Wahrheit. Es ist nach wie vor eine Herausforderung. Doch mit jedem Jahr lernen wir dazu. Es geht um den Spagat, unseren Familien gegenüber Verbindung auszudrücken und gleichzeitig Grenzen zu setzen. Welche Erwartung wollen und können wir erfüllen? Wie können wir uns gut abgrenzen? In welchen Bereichen möchten wir an uns denken und gut für uns sorgen? Das alles zu berücksichtigen bedeutet, sich jedes Mal wieder Gefühlen zu stellen, neu zu planen, gemeinsam zu überlegen, zu kommunizieren, auszuhandeln und dann zu entscheiden. Doch mit jedem Jahr kommen uns neue kreative Ideen, wie wir die Weihnachtszeit gut gestalten könnten, zum Beispiel, indem wir alle zu uns einladen und somit etwas mehr Gestaltungsspielraum haben.
DEN GESTALTUNGSRAUM NUTZEN
Für den Heiligabend – oder je nach Schichtdienst meines Mannes einen anderen Abend in den Weihnachtsfeiertagen – haben wir inzwischen eine feste Lösung gefunden. Dieser Abend ist zu einer sehr bedeutsamen Zeit für uns beide geworden. Uns ist eines klar: Wir zwei sind auch ohne Kinder eine kleine Familie. Am Altar haben wir diese Familienneugründung besiegelt. Deshalb wussten wir irgendwann: Den Heiligabend feiern wir fortan zu zweit. Ich muss ehrlich sagen: Das zu entscheiden und dann zu kommunizieren, war alles andere als leicht. Wir wussten: Wenn wir diese Grenze setzen, wird das bei anderen Schmerz auslösen. Diesen Schmerz nicht abzuwerten und dem Gegenüber zuzugestehen, aber gleichzeitig sanft und klar bei dem eigenen Wunsch zu bleiben, war ein Drahtseilakt. Grenzen zu setzen und Verbindung zu halten, ist wirklich eine Kür. Doch mittlerweile, wo allen klar ist, dass es dabei keineswegs um eine persönliche Ablehnung geht, sondern um die eigene Autonomie als Paar, erleben wir nicht nur ganz viel Verständnis und Wohlwollen, sondern auch Flexibilität und Zuvorkommen.
Diesen Schmerz nicht abzuwerten und dem Gegenüber zuzugestehen, aber gleichzeitig sanft und klar bei dem eigenen Wunsch zu bleiben, war ein Drahtseilakt.


Auf dieser Seite schreibt Saskia Barthelmeß über Schönes und Schweres und alles dazwischen.



„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, heißt es in einem Lied, das oft in der Weihnachtszeit gesungen wird. Meine Kinder machen jeden Tag die Türchen ihrer Adventskalender auf. Und ich mache die Tür zu. Meine innere Tür. Um mich zu schützen – vor Krieg und Leid, vor Stress und Hektik, vor Erwartungen und Enttäuschungen. Soll das alles doch lieber draußen bleiben und ich richte mich hier drinnen gemütlich ein. Zünde mir eine Kerze an und bleibe ganz bei mir. Doch die Tür, die mich schützen soll, hält gleichzeitig auch alles ab, was mir begegnen will – die liebevolle Einladung, die helfende Hand, ein offenes Ohr. Ich merke, wie sich meine Seele wie ein bockiges Kind aufführt: „Ich will einfach meine Ruhe haben. Lasst mich doch alle! Und überhaupt: Es interessiert ja sowieso niemanden, wie es mir wirklich geht!“ Meine Tür bleibt zu. Ich bin allein.
ER KLOPFT AN UND WARTET
Und dann, völlig unerwartet, trifft mich die uralte Botschaft von Weihnachten mitten ins Herz. Das kleine hilflose Baby. Der Gott, der zu uns kommt. Immanuel. Ist das nicht genau das, wonach ich mich so sehr sehne? Dass jemand hineinwill zu mir. Dass er sich nicht abschrecken lässt von der verschlossenen Tür, sondern freundlich sagt: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ Er hämmert nicht dagegen. Er weiß, dass es Zeiten geben kann, in denen ich niemanden hereinlassen möchte. Und doch bleibt er stehen. Klopft. Wartet. Und weiß: Ich brauche keinen Trost, der durch die Tür gerufen wird, keine Ratschläge oder Tipps. Was ich brauche, ist jemand, der weiß, wie es sich hier drinnen anfühlt. Der sich selbst so sehr eins mit mir macht, dass er mich verstehen kann.


Ist das nicht das tiefe Geheimnis von Weihnachten? Gott bleibt nicht draußen, er wird wie ich. Ihm muss ich kein freundliches Gesicht zeigen, wenn es in mir nicht freundlich aussieht. Ihm muss ich nichts erklären. Er kommt so nahe, dass er in mir lebt. Eins wird mit mir. Näher geht es nicht.
Immer wieder sperre ich Gott aus meinem Leben aus. Will alles alleine schaffen; habe keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen, warum er die Welt so lenkt, wie er es tut. Bin nicht offen für die Begegnung mit ihm. Doch er geht nicht weg. Er bleibt. Er liebt. Er tröstet. Und er versteht. Denn all das Leid und das Schwere dieser Welt –das nicht mit Anfang Dezember plötzlich auf wundersame Weise verschwindet – ist genau der Grund, warum er vor langer Zeit in Jesus auf die Erde gekommen ist.
EINE OFFENE TÜR
Er hat nicht einfach die Tür zum Himmel zugemacht und mich mir selbst überlassen. Er hat sie weit aufgerissen, ist hindurchgestürmt und hat seinen Rettungsplan in die Tat umgesetzt. Von A bis Z. Von der Krippe bis zum Kreuz. Was für ein Gott! Ich glaube, ihm will ich heute die Tür öffnen. Damit es auch in mir Weihnachten werden kann. Und mit frohem Herzen stimme ich ein in die wunderschöne Melodie: „Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heilger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.“ T
findet es spannend, Neues zu entdecken –an Menschen und an Gott. Sie liebt Lesen und Schreiben und lebt mit ihrer Familie in Innsbruck.






Deborah Pulverich
Meinen Frieden gebe ich dir
Ein Buch zum Luftholen und inneren Frieden finden. Neben wahren Geschichten von verschiedenen Autorinnen zu den Themen „Frieden finden“ und „Frieden stiften“ finden sich auf den Seiten viele kreative Texte und Gedichte, die dazu einladen, in Zeiten der Unruhe und Unsicherheit in Gottes Frieden zur Ruhe zu kommen. Die wunderschönen Fotos der Herausgeberin machen die Lektüre auch optisch zu einem Erlebnis. Passend dazu gibt es ein Postkartenset.


Aufstellbuch
Mein kleines Glück
Dieses inspirierende Aufstellbuch im Landhausstil macht überall etwas her – auf der Fensterbank, im Regal, auf einer Kommode oder dem Schreibtisch. Neben 60 wunderschönen Bildmotiven, die man beliebig zusammenstellen kann, enthält es auch 30 ermutigende Bibelverse. So ist Abwechslung garantiert!
Ellen Nieswiodek-Martin
Alltagswundergeschichten
Die Bibel ist voller Wunder, die Gott getan hat. Aber wie ist es heute? Die Autorinnen haben selbst Wunder in ihrem Alltag erlebt und ermutigen mit ihren Geschichten dazu, im eigenen Leben Augen und Herz offen zu halten für Gottes Wirken. Ein gutes Geschenk für alle, die gerne kürzere Geschichten lesen.

Ellen Nieswiodek-Martin
Weihnachten – Zeit des Lichts
Diese Sammlung wahrer Geschichten ist genau das Richtige für die Vorweihnachtszeit. Die Autorinnen erzählen, was Licht in ihre Adventszeit gebracht hat. Nebenbei gibt es kleine Anregungen und Tipps für die Adventszeit und die Gestaltung des Weihnachtsfestes.
Schreibbuch Zwischendurchgedanken Für kreative Ideen, Gebetsanliegen und alle Gedanken, die einem zwischendurch so kommen – dieses schön gestaltete Schreibbuch im praktischen Format eignet sich dafür, all das festzuhalten, was man nicht vergessen möchte. Auf allen Seiten finden sich gepunktete Linien zum Schreiben oder Zeichnen und Zitate zum Nachsinnen. Ein kleiner Begleiter im Alltag, den man gerne in die Hand nimmt! Alle Produkte kann man bestellen unter www.lydia.net/lydia-edition








Seit zwölf Jahren bin ich mit Leidenschaft Hospiz- und Trauerbegleiterin und sehe es als meine Berufung an, trauernden Menschen eine Stimme zu geben. Mir ist es wichtig, dass Menschen mit all ihren Gefühlen und Gedanken kommen können und ihnen in ihrer Trauer ohne Bewertung einfach zugehört und auf sie eingegangen wird. Oft werde ich gefragt, was mich dazu bewegt hat, diese Arbeit zu machen. Ein Grund dafür ist meine eigene Geschichte … Von Viviana Boy
Ich bin als jüngstes von drei Kindern in einer italienischen Familie aufgewachsen. Meine Kindheit und Jugend waren geprägt von einigen Todesfällen von nahestehenden Angehörigen und dennoch wurde der Tod bei uns eher totgeschwiegen. Niemand sprach mit mir über Tod und Trauer, als ich klein war. Dadurch hatte ich jahrelang große Angst vor dem Tod und habe ihn als Feind gesehen. Schon früh musste ich von meiner Lieblingscousine Abschied nehmen, die mit neun Jahren an Leukämie verstorben ist. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich den Anruf aus Italien bekam mit der Nachricht. Ich war furchtbar erschrocken und traurig und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich blieb mit meinen Gefühlen allein. Die Erwachsenen haben darüber gesprochen, ich habe nur Fetzen mitbekommen und meine Fantasie und meine Angst davor, mich könnte das gleiche Schicksal ereilen, wurden damals immer größer.
UNAUSGESPROCHENE WORTE
Als mein Opa einige Jahre später an einem Herzinfarkt starb und wir als Familie zur Beerdigung nach Italien fuhren, hat keiner im Vorfeld mit uns Kindern gesprochen und uns erklärt, was dort geschehen würde. In Italien war es Brauch, dass der Verstorbene nach seinem Tod in seinem Haus aufgebahrt wurde und das ganze Dorf sich von ihm verabschieden konnte. Ich weiß noch, dass ich meinen Opa sehr gerne gesehen hätte, von einem Erwachsenen aber davon abgehalten wurde. Ich sollte „ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn kannte“.
Wir durften nicht zur Beerdigung auf den Friedhof mitfahren, da die Erwachsenen meinten, es sei nicht gut für uns. Also blieben wir im Haus meiner Oma und machten uns viele Gedanken. Die Angst wurde weiter geschürt.
Mit meiner Mutter habe ich im Nachgang nicht mehr über diese Erfahrungen sprechen können, da sie das Thema Tod und Sterben praktisch aus ihrem Leben verbannt hatte.
ALLEIN MIT VIELEN ÄNGSTEN Als ich Teenagerin war, erkrankte mein Onkel, zu dem ich nach der Scheidung meiner Eltern eine enge Bindung hatte, an Darmkrebs. Schnell war klar, dass er zu spät zur Untersuchung gegangen war und ihm nun nicht mehr geholfen werden konnte. Der körperliche Verfall setzte schnell ein, mein Onkel veränderte sich, wurde blasser, dünner, musste regelmäßig ins Krankenhaus, hatte schlechte Tage und wurde zunehmend schwächer. Wieder hat niemand mit uns Kindern gesprochen. In seinen letzten Lebenstagen habe ich meinen Onkel besucht. Die Krankheit hatte ihn gezeichnet, es war klar ersichtlich, dass es nicht mehr lange dauert, bis er sterben würde. Bis heute habe ich dieses Bild von ihm im Kopf! Auch hier hatte mich keiner im Vorfeld darauf vorbereitet, was ich sehen würde, wenn wir durch die Krankenhauszimmertür hineingehen würden. Auch nach dem Tod meines geliebten Onkels und mit meiner Trauer war ich alleine.
Ich wurde älter, aber die Angst vor dem Tod blieb bestehen.
WENN DIE WELT EINSTÜRZT
In der Kirchengemeinde meines späteren Mannes lernte ich dann einen liebenden Gott kennen und ließ mich als Erwachsene taufen. Ab dem Zeitpunkt hat sich meine Beziehung zu Gott sehr verändert, man könnte sagen, ich habe erneut zu Gott gefunden.
Dennoch blieben die alten Ängste präsent. Als ich mit meinem dritten Kind schwanger war, starb meine Mutter
im Alter von 62 Jahren für uns alle vollkommen unerwartet. Ich erinnere mich noch genau, wie der Anruf kam, wie mein Mann mich rief und in seine Arme nahm und mir behutsam sagte, dass meine Mutter tot sei. Für mich brach in dieser Sekunde meine Welt zusammen. Ich konnte es nicht glauben, war zutiefst geschockt und fiel in ein großes Trauerloch. Die nächsten Tage erlebte ich wie in Trance. Beerdigung planen, Sarg aussuchen, Kleidung für meine Mutter, Sargbeigaben, Blumen, Musik und so weiter. Ich funktionierte und fragte mich in den wenigen klaren Momenten, was ich hier machte. Meine Mutter war für mich unzerstörbar, ein Fels, eine so starke Frau, die uns drei Kinder nach der Trennung meiner Eltern durchs Leben gebracht hatte. Sie war nun einfach weg? Das konnte nicht sein! Was war passiert, wo war sie jetzt?
Um diese Fragen für mich zu beantworten, war mir schnell klar, dass ich diesen furchtbaren und mir mächtige Angst machenden Tod besser kennenlernen musste. Ich musste mich ihm stellen, musste herausfinden, was es mit ihm auf sich hatte, musste mich mit meiner Trauer auseinandersetzen.
Unmittelbar nach dem Tod meiner Mutter war ich sehr wütend auf Gott, bis ein Freund zu mir sagte, dass Gott uns nicht immer vor „Katastrophen“ bewahrt, sondern mit uns durch diese Zeiten geht.
ICH STELLE MICH DEM THEMA
TRAUER IST KEINE KRANKHEIT
Ich erkannte mehr und mehr, dass der Tod zum Leben gehört, dass er vom Beginn unseres ersten Atemzuges hier auf der Erde mit uns geht. Leise und nicht merkbar, aber er geht mit – nicht als Bedrohung, sondern als Gefährte, der einfach zum Leben dazugehört. Wir werden geboren und wir sterben. Im Übrigen haben die Geburt und der Tod eines gemeinsam: Wir wissen nicht, wie es auf der anderen Seite ist, und wir wissen auch nicht genau, wie es sein wird, wenn es so weit ist.
Wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass
Trauern keine Krankheit ist und jeder Trauerweg individuell ist und gegangen werden will.
Einige Wochen später entdeckte ich auf dem Weg zur Kita einen Aushang im Schaukasten. Der ambulante Hospizverein führte einen Befähigungskurs zur Hospizbegleitung durch. Das wollte ich machen und hoffte, mich da mit dem Tod auseinandersetzen zu können! Kurze Zeit später fand ich mich in den Räumlichkeiten des ambulanten Hospizdienstes bei einer Vorstellungsrunde wieder, bei der es um unsere Motivation ging, diesen Kurs durchführen zu wollen. Mit voller Überzeugung sagte ich, dass ich nur aus „eigenen therapeutischen Gründen“ da wäre und eigentlich gar nicht in die Begleitung wolle. Es endete so, dass dieser Kurs der Startschuss für meine Laufbahn als Trauerbegleiterin war. Ich durfte einen Mann bei seinem Sterbeprozess begleiten und ließ mich kurze Zeit später auch zur Hospizbegleiterin für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst ausbilden.
Nachdem ich einige Zeit in der Hospizarbeit gearbeitet hatte, verspürte ich den Wunsch, mich noch weiter in die Thematik hineinzugeben und entschied, mich als Trauerbegleiterin vom „Bundesverband für Trauerbegleitung“ ausbilden zu lassen. Ich schloss mich einem Trauerverein für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Angehörigen an und konnte viel lernen.
Diese Zeit hat mich in meinem Tun als Trauerbegleiterin sehr geprägt! Den Tod als allgegenwärtigen und unumgänglichen Teil meines Lebens zu sehen und ihn nicht als Feind zu betrachten, war eine wichtige Erkenntnis dabei. Täglich das Schöne zu sehen, das man hat, und nichts aufzuschieben, das man gerne noch erleben würde, da man nicht weiß, wie viel Zeit man noch auf dieser wunderbaren Erde mit den lieben Menschen um einen hat.
Dankbar zu sein für das Kleine und das Große.
Ich habe viele Familien ein Stück ihres Trauerweges begleiten dürfen. Ich habe gelernt, dass Trauern keine Krankheit ist und jeder Trauerweg individuell ist und gegangen werden will. Es gibt nicht den einen, richtigen Weg –es gibt den eigenen persönlichen Trauerweg, den jeder gehen muss, um nicht in seiner Trauer stecken zu bleiben.
GEFÜHLE ZULASSEN

Trauer muss durchlebt werden, auch wenn es sehr schmerzhaft ist und man in der Situation das Gefühl hat, dass man dabei zugrunde geht. Damit ist gemeint, dass Trauer und alle damit verbundenen Gefühle, Bedürfnisse wahrgenommen, ernst genommen und ausgelebt werden sollten. Man muss quasi da durch, auch wenn es weh tut,






Bei der Stadtführung mit Anne Benner schauen wir nicht nur historische Gebäude an, sondern tauchen tief ein in die Lebenswelten der Menschen, die früher an diesen Orten gelebt haben. Wir weinen und staunen über das, was wir hören. Die kaufmännische Angestellte, Familienfrau und sechsfache Oma erzählt so lebendig von vergangenen Zeiten, dass zwei Stunden wie im Flug vergehen. Für die 55-Jährige ist dabei wichtig: der Glaube und der Mut, gegen den Strom zu schwimmen.
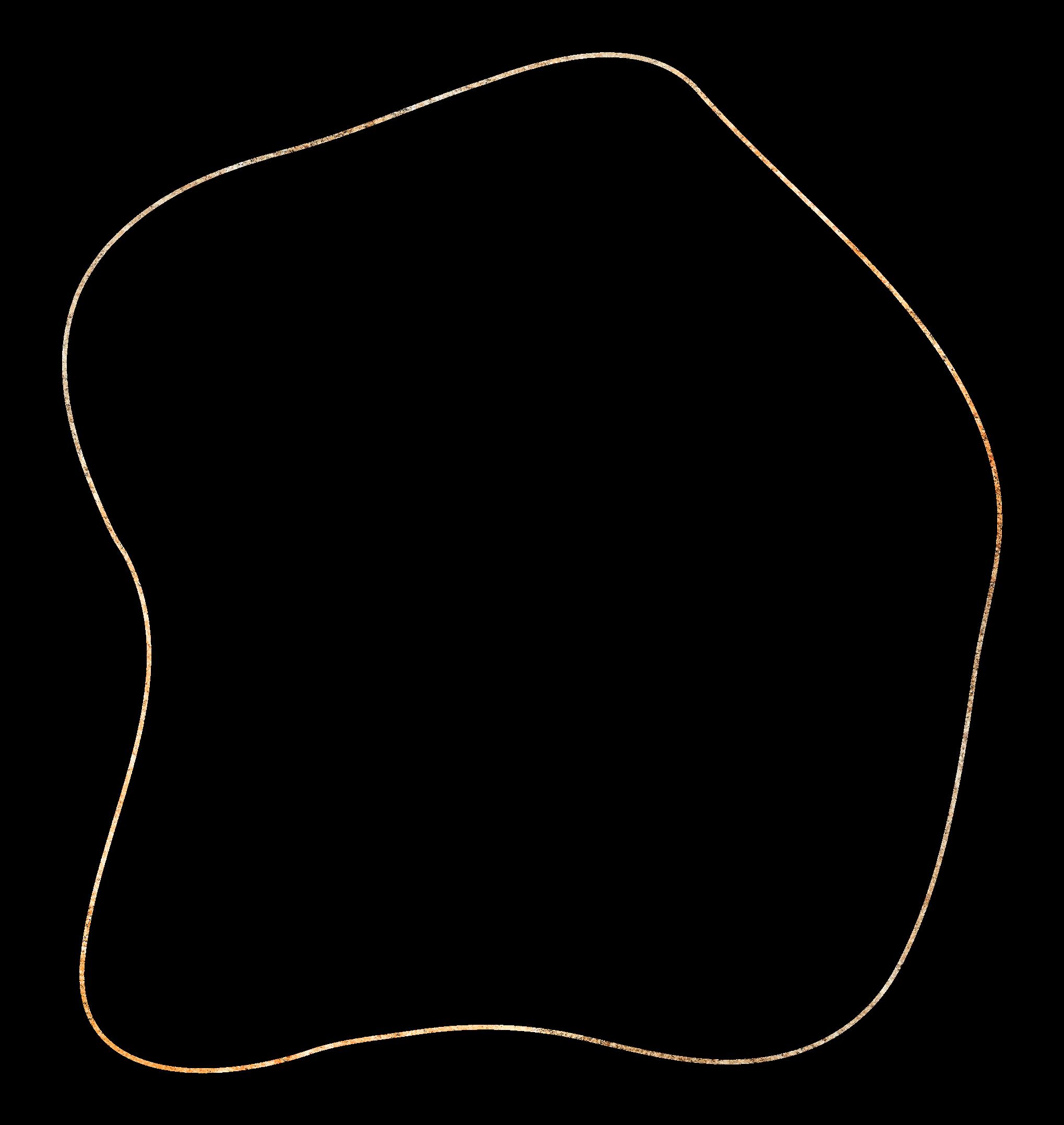



Anne Benner liebt es, Menschen durch ihre Stadtführungen zum Nachdenken zu bringen.
FOTOS: Deborah Pulverich

Anne, du arbeitest als kaufmännische Angestellte. Und du bist Stadtführerin in der hessischen Kleinstadt Herborn. Wie kam das?
Geschichte ist mein Hobby. In der Schule habe ich den Geschichtsunterricht geliebt. Ich habe immer Bilder im Kopf, wie es damals gewesen sein könnte, ich tauche in die historischen Gegebenheiten hinein.
Als meine Tochter noch ein Baby war, bin ich oft mit dem Kinderwagen durch die Stadt geschlendert und habe so Ecken kennengelernt, die ich noch nicht kannte.


Bei den Feierlichkeiten eines Stadtjubiläums haben wir uns als christliche Gemeinde beteiligt. Wir haben Papierschöpfen angeboten und hatten den Nachbau einer alten Gutenberg-Druckerpresse vor Ort. Das passte zu Herborns Geschichte als Bibelstadt. Da habe ich ein bisschen recherchiert, weil wir ein Heft über die Herborner Geschichte im Zusammenhang mit der Bibelherstellung herausgegeben haben. Ich habe damals viele Bücher entdeckt, die ich nicht kannte. Dann kam mein Interesse für die Stadtgeschichte erst richtig auf.
Ich habe mir gesagt: Wenn ich mehr Zeit habe, würde ich gern ehrenamtlich Stadtführungen machen. Als dann mein damaliger Arbeitgeber Insolvenz anmelden musste, hatte ich plötzlich Zeit.
Wie kam es zu den Stadtführungen? Du hättest dein Interesse für die Geschichte ja auch nur privat pflegen können.
In meinem Bekanntenkreis wurde ich immer wieder angefragt, ob ich ihre Besucher durch die Stadt führen könnte. Das habe ich dann gern gemacht. Etwas später bin ich offiziell in das Herborner Stadtführerteam aufgenommen worden. Wir arbeiten ehrenamtlich mit dem Stadtmarketing zusammen. Nun hatte ich noch mehr Möglichkeiten, mich weiterzubilden und mehr zu erfahren.
In Herborn gab es Anfang des 17. Jahrhunderts einen Theologieprofessor, der nach Martin Luther eine weitere deutsche Bibelübersetzung herausgebracht hat. Das war eine Studienbibel mit vielen Kommentaren, die sogenannte Piscator-Bibel. Diese wurde auch hier gedruckt. Caspar Olevian und Johannes Piscator waren die ersten Professoren an der Herborner Hohen Schule, einer Hochschule mit Schwerpunkt Theologie. Piscator hat die Bibel übersetzt und Olevian am Heidelberger Katechismus mitgewirkt. Dieser besteht aus Fragen und Antworten, wie ein Interview. Bei den Stadtführungen kann ich zum Beispiel in der Kirche aus dem Heidelberger Katechismus vorlesen. Die erste Frage dort lautet: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Das ist für mich eine Möglichkeit, etwas vom Glauben weiterzugeben, etwas, das im Leben Halt geben kann. Was ist denn dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Da muss man erst mal überlegen.
Welche Reaktionen kommen da?
Manche kennen die Antwort auswendig. Ältere Leute mussten das meist im Konfirmandenunterricht auswendig lernen. Andere können überhaupt nichts damit anfangen, die haben das in ihrem ganzen Leben noch nie gehört. Aber die Frage findet meistens Anklang.
Die Herborner Geschichte lässt sich wunderbar mit dem christlichen Glauben verknüpfen. Da kann man auch mal etwas Persönliches bei einer Stadtführung weitergeben. Aber ich erzähle auch ganz normale, lustige Geschichten, ich mache keine evangelistische Stadtführung daraus.
Wie kam es denn zu den Stadtführungen zur jüdischen Geschichte?
Mich hat das Judentum immer interessiert. Hier bin ich auch geprägt durch meine Familie. Mein Vater und auch meine Mutter hatten schon immer eine Liebe zum Volk Israel und ein tiefes biblisches Wissen. Sie sprachen mit Ehrfurcht vom „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“.
2015 war ich dann zum ersten Mal in Israel. Da ist in mir noch mal etwas passiert. Ich kam mit meinem Kopfwissen an und dachte, das bestätigt sich jetzt alles. Diese zehn Tage waren lebensverändernd. Ich habe ein neues Bild des Landes und der jüdischen Wurzeln unseres Glaubens bekommen. Die Liebe zu dem Land hat seitdem einen festen Platz in meinem Herz. Diese erste Israel-Reise fand statt, bevor ich mit den Stadtführungen anfing. Ich war dann noch ein paar Mal dort, bevor ich 2019 die jüdische Stadtführung begonnen habe.
Es gab in der Stadt mehrere Personen, die sich mit der jüdischen Geschichte gut auskannten. Ein katholischer Kaplan hatte sogar zusammen mit Jugendlichen eine Forschungsarbeit zum Thema „Jüdische Geschichte“ gemacht. Diese Erkenntnisse fand ich spannend. Als ich einmal mit dem damaligen Stadtarchivar durch die Stadt gelaufen bin, hat mich sein großes Wissen beeindruckt. Damals spürte ich eine Art innere Berufung: Hier muss ich was draus machen!
Du hast das Konzept für die Führungen selbst erstellt. Wie bist du vorgegangen?
Ich hatte durch die Reisen nach Israel eine große Wissens- und Erfahrungserweiterung über das Judentum. Dieses Wissen und die Liebe dazu habe ich in die Stadtführung gepackt. Ich habe im Laufe der Zeit immer weiter recherchiert. Ich habe das Stadtarchiv besucht, war in Wiesbaden im Hessischen Landesarchiv und in Berlin im Deutschen Historischen Museum. Außerdem habe ich ganz viel Internetrecherche betrieben. Es gibt tolle Möglichkeiten, um Familiengeschichten herauszufinden.




„Christel, weißt du wirklich, was du da tust?“ Ich erwache mit dieser Frage am Sonntagmorgen. Zwei Stunden später sitze ich im Gottesdienst und spüre Adrenalin pur in mir. Unsere Pastorin reicht mir das Mikro und ich schaue in erwartungsvolle Gesichter. Jetzt werde ich ihnen die Wahrheit über unsere Familie sagen. Die Tatsache, dass unsere Tochter seit 20 Jahren drogenabhängig ist.
Von Christel-Irene Kehl


Drogensucht ist am Anfang schwer erkennbar. Wir dachten, unsere Tochter hätte mit typischen Pubertätsproblemen zu kämpfen. Wir wären niemals auf den Gedanken gekommen, dass Christin kiffen würde! Sie war ein liebes, sympathisches Mädel mit leuchtenden Augen, immer munter, fit und fröhlich. Christin war beliebt in ihrem großen Freundeskreis, spielte begeistert Fußball und lernte Klavier. Sie hatte alles, was für einen Teenie wichtig ist. Als sie siebzehn war, feierten wir in der Gemeinde ihre Taufe mit einem großen Fest. Es war eine große Freude, so eine Tochter zu haben. Sie war mein ganzer Stolz.
Niemals werde ich diesen schockierenden Abend vergessen, als wir aus unserem Italienurlaub zurückkamen. Christin war zu Hause geblieben und begrüßte uns irritiert: „Wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe noch gar nicht mit euch gerechnet.“ Sie sah furchtbar aus. Abgemagert bis auf die Knochen, ganz sicher wog sie keine 50 Kilogramm mehr. Ihr blasses Gesicht wirkte eingefallen. Ihre tiefliegenden Augen, schwarz umrandet, sahen gespenstisch aus. So sehen Junkies aus, dachte ich damals. Wie war das nur möglich? Wir erkannten fassungslos: Unsere Tochter war definitiv drogenabhängig!
ZWISCHEN HOFFNUNG UND VERZWEIFLUNG
Christin hatte es meisterhaft geschafft, ihr Doppelleben vor uns zu verheimlichen. Wir ahnten nicht, dass sie einen festen Freund hatte, der seit Jahren drogenabhängig war. In diesen drei Wochen unserer Abwesenheit hatten sich Christin und Tom offenbar mit härteren Drogen tief in die Sucht getrieben. Wir redeten ihr ernsthaft ins Gewissen und Christin hörte auch zu. Dann packte sie ihre Sachen und zog zu Tom. Die beiden versicherten uns, dass sie so nicht weitermachen und sich bemühen wollten, von den Drogen loszukommen. Sie versuchten vieles, aber nichts gelang. Glücklicherweise entschied sich Christin daraufhin für eine Therapie bei „Teen Challenge“ und wurde drogenfrei. Nach monatelangen Höhen und Tiefen erlebten wir als Familie wieder eine herrliche Zeit der Ruhe. Wir konnten ohne Ängste und Sorgen leben, in der Hoffnung auf ein auch für uns drogenfreies Leben.
Selbstbewusst begann Christin eine Ausbildung in einem Hotel in Portugal. Dann erreichte sie die Nachricht, dass Tom an einer Überdosis gestorben war. Christin und Tom wollten getrennt lernen, drogenfrei zu leben, um dann zu heiraten. Christin war zutiefst traurig und tröstete sich mit Drogen. Wir lasen ihre E-Mails mit Entsetzen. Sie waren ein heilloses Durcheinander. Wenig später erfuhren wir, dass sie ihre Ausbildung abgebrochen hatte. Wir baten sie, nach Hause zu kommen, doch sie wollte ihre neue Arbeit in der Strandbar nicht aufgeben. So flog ich nach Portugal,
um zu retten, was zu retten war. Nur mit der großen Unterstützung durch die Missionarsfamilie vor Ort konnten wir zwei Wochen später zusammen zurückfliegen.
DIE SPIRALE DREHT SICH NACH UNTEN
Christin durfte eine Zeit lang bei ihrer gläubigen Freundin wohnen. Diese half ihr klug und rührend durch die Zeit des Drogenentzuges. Christin sah wieder gesund aus und war voller Lebensfreude. Nach diesen heilsamen Wochen lebte sie wieder bei uns und begann mit vollem Elan ihr Studium. Drei Jahre später kiffte sie wieder. Daher musste sie sich eine eigene Wohnung suchen. Wir wollten die ständigen Konflikte, Krisen und Katastrophen mit ihr nicht mehr länger aushalten. „Warum, Christin?“, fragte ich, wenn ich sie besuchte und immer wieder versuchte, ihr zu helfen. „Jeder Tag mit Drogen ist ein Tag zu viel.“
„Ich langweile mich nur“, erwiderte sie mit leiser Stimme. Christin geriet in eine Polizeikontrolle und verlor ihren Führerschein für ein Jahr. Ohne den Führerschein konnte sie ihre Bewerbungen vergessen. Das enttäuschte sie sehr. Alle ihre Bemühungen hatten keinen Erfolg. Christin musste einsehen, dass sie noch einmal eine Therapie machen musste. Nach wochenlangem Warten wurde ihr eine zweite Therapie im „Neuen Land“, einem christlichen Therapiehaus, genehmigt. Nach zweiundzwanzig Wochen hatte sie ihre Therapie erfolgreich beendet. Wir feierten voller Stolz ihren Erfolg. Kurze Zeit später bekam sie eine Arbeitsstelle. Wir freuten uns mit ihr. Die Freude war leider nicht von langer Dauer. Es gab fast täglich Probleme auf ihrer Arbeitsstelle, die sie nicht allein lösen konnte. Der Joint wurde wieder zu ihrem besten Freund und ihr wurde gekündigt. Diesmal kam sie nicht sofort nach Hause. Sie fuhr mit ihrem Auto quer durch Deutschland. Irgendwo wurde sie von der Polizei aufgegriffen, weil sie ein merkwürdiges Fahrverhalten zeigte. Christin hatte eine Psychose und wurde in einer Fachklinik behandelt. Wir waren wieder guter Hoffnung, dass ihr Leidensweg dort endlich ein Ende finden würde, auch für uns. Doch Christin ließ sich nicht zu einer Therapie überreden. Erzwingen ließ sich gar nichts. Ihre Lebensweise änderte sich nicht. Wir leben seitdem mit ihren Höhen und Tiefen. Die Drogensucht ist zu unserem Schicksal geworden.
UNGEWISSE ZUKUNFT
Drogen sind in der Lage, das Leben von Menschen, die eigentlich aufrichtig und ehrlich leben wollen, zu ruinieren. Das Wort Gottes sagt: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1. Korinther 16,14). Doch Drogen sind nicht mit Liebe zu besiegen. Drogen zerstören unsere nächste Generation. Sie schwächen viele in einem Alter, in dem sie klug und



