En Vogue



29. Mai 2025
Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin
Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: art@bassenge.com . www.bassenge.com
IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DIESEN KATALOG / EXPERTS FOR THIS CATALOGUE:
Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.
Jennifer Augustyniak +49 (0)30 - 893 80 29 30 jennifer@bassenge.com Fotografie
Dr. Ruth Baljöhr +49 (0)30 - 893 80 29 22 r.baljoehr@bassenge.com
David Bassenge +49 (0)30 - 893 80 29 17 david@bassenge.com
Barbara Bögner +49 (0)30 - 893 80 29 38 b.boegner@bassenge.com Moderne Kunst
Eva Dalvai +49 (0)30 - 893 80 29 80 e.dalvai@bassenge.com
Lea Kellhuber +49 (0)30 - 893 80 29 20 l.kellhuber@bassenge.com
Nadine Keul +49 (0)30 - 893 80 29 21 n.keul@bassenge.com
Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei

Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2.500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.
in der Galerie F37 Fasanenstraße 37 10719 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai 11 bis 18 Uhr
MITTWOCH, 28. Mai 2025
Vormittag 10.00 Uhr
Nachmittag 15.00 Uhr
Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5236
Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5237-5331
Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5332-5467
Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5468-5720
DONNERSTAG, 29. Mai 2025
Vormittag 10.00 Uhr
Nachmittag 14.00 Uhr
Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6217 Rahmen Nr. 6218-6239
Portraitminiaturen Nr. 6301-6450
Abend 18.00 Uhr En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen Nr. 6500-6681
FREITAG, 30. Mai 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6700-6925
Nachmittag 15.00 Uhr Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7359
SONNABEND, 31. Mai 2025
Vormittag 11.00 Uhr
MITTWOCH, 4. Juni 2025
Nachmittag 15.00 Uhr
Moderne Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8210 Post War & Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8220-8437
Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4074 Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4075-4300
VORBESICHTIGUNGEN
Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts und Portraitminiaturen Erdener Straße 5A, 14193 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Montag, 26. Mai, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 27. Mai 10.00–17.00 Uhr
Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 10.00–18.00 Uhr, En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen in der Galerie F37, Fasanenstraße 37, 10719 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 11.00–18.00 Uhr
Schutzgebühr Katalog: 20 €


Wann haben Sie zuletzt an Ihre Garderobe gedacht?
Heute Morgen, gestern Abend? Vielleicht auch am Mittag, so wie der Literaturkritiker Fritz J. Raddatz, der selbstverständlich zum Lunch das Outfit wechselte, auch wenn er nur zuhause tafelte? Unser Katalog En Vogue, der nun mit fast 200 Objekten sich vor Ihnen auftut, könnte der Anlass sein, mit den Gedanken an das unserem Körper Nächstliegende verschwenderisch zu sein. Denn die Kleidung und ihr zeittypischer Ausdruck, die Mode, ermöglicht nahezu alles. In Momenten der striktesten Beherrschung ist sie bestenfalls glänzendes Nichts (man denke an die Uniform), im Zuge ihrer größten Befreiung ist sie alles: spielerische Inszenierung, fiebernde Ostentation, genialische Travestie, Groteske und Skandal.
Wer auf die Geschichte zurückgreift, stößt rasch auf die Französische Revolution als Schlüsselereignis. Alte Strukturen lösen sich auf, der Stand als maßgebliche Kategorie, der die schickliche Kleidung bestimmt, wird aufgelöst und die binäre Geschlechtsdifferenz wird zum prägenden Merkmal der Form. Die von jetzt an geltende bürgerliche Kleiderordnung konterkariert das Zurschaustellen der Aristokratie: der einst aufgegockelte Mann ist zur Wesentlichkeit im Unauffälligen verurteilt, während die Frau nun kunstvoll ihre Reize zur Geltung bringen darf. Es folgt das Auf und Ab der Mode und des Modischen, das in Zyklen und Wellen Ordnungen und Rollen, zuweilen auch das Fundament der Gesellschaft, umspült und zersetzt. Eine Praxis, die listig und oft mit Witz Identität und Stereotypen in Frage stellt, vermischt, ver zerrt oder einfach nur durcheinanderbringt. Geheimnis und Proklamation, Verschwinden und Distinktion – die Kleider, die wir am Leibe (und zu Markte) tragen, sagen uns, wer wir sind.
Zu den schönsten Begleiterscheinungen dieses Kataloges gehört es, dass man zu dem Schluss kommen darf: Männer sind in der Geschichte der jüngeren Mode nur eine schöne Nebensache. Die Herren der Schöpfung ne utralisieren ihren Körper mittels Anzug, dieser revolutionär gleichmachenden Erfindung des späten 19. Jahrhunderts, die Roland Barthes gar nicht mit Mode in Verbindung brachte, so elementar ist für ihn ihr alleiniger Charakter der Funktion. Männer verschwenden keinen Gedanken an Kleider, brachte es Barack Obama überspitzt auf den Punkt. Und so sind sie auf den folgenden Seiten wohl zu Recht unterrepräsentiert: Sie scheinen auf als Begleiter, in ikonographisch pikanter Rolle als Landsknecht, übernehmen den männlichen Part eines eleganten Paares, sie sind Karikatur oder Repräsentant jener pittoresken Spe
zies der Dandys, die die Prinzipien der Frauenkleidung auf die Männerkleidung übertragen. Als Ausbund der Eleganz im schwarzen Frack und grüner Weste fungieren sie als Konsumenten von Krawatten, Gehstöcken und Revers Nadeln. Männer halten ihre abgelegten Hosen und Jacken in faszinierenden Zeichnungen fest oder sie dienen als Behältnis für Nähzeug. Wenig spektakulär. Dagegen die Frauen! Immer wieder können wir uns in diesem Katalog mit der von Dostojewski im „Idiot“ geäußerten Verheißung trösten, dass Schönheit die Welt retten wird. Und wer diesem Wunschdenken nicht folge n mag, betrachte die perfekten Kompositionen der Modefotografie, die eleganten, extravaganten, frappie renden Originalentwürfe und Modezeichnungen, die phänomenalen Leistungen des Kunsthandwerks bei Accessoires, vom Federfächer bis zur Clutch bis zum Flanierschirm, beim Schmuck aus Gold, Bernstein und – man staune –Pergament oder die portugiesischen Knöpfstiefel von 1906. Ein französisches Flapperkleid aus den zwanziger Jahren, Artefakte der Wiener Werkstätte, selbst Strohhüte zeugen von der Energie allem Äußerlichen die Wahrheit des Geheimnisses beizumessen, deren Dialektik der in Modedingen und Geschmacksfragen zum Dauerzitierten avancierte Oscar Wilde so beschrieb: „Nur oberflächliche Menschen urteilen nicht nach Äußerlichkeiten. Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren.“
Vieles von dem, was die Mode verspricht und in sogenannten Stilikonen wie Marlene Dietrich zum Ausdruck bringt, wird in den Objekten unseres Kataloges offenbar: das Zusammenspiel von Tradition und Avantgarde, die Inszenierung des weiblichen Körpers und seine Erotisierung, die Metamorphosen der Silhouette und der Körper, feine Unterschiede und Codes. Ein an der richtigen Stelle placiertes Schönheitspflästerchen sagt mehr als viele Worte. Die kleinen und großen emanzipativen Bewegungen der Geschichte – auch sie werden in der Mode sichtbar: Die Tennis spielende, Fahrrad fahrende Frau, die sich die Bein und Fußfreiheit erkämpft, wird der nun in Erscheinung tretenden Fußbekleidung besondere Aufmerksamkeit schenken. Die Mode als sich selbst erneuernde, vielleicht doch ewig junge Kunstform – sie wird im Folgenden lebendig und verströmt eine Dynamik, die ihresgleichen sucht.
Doch jetzt öffnet sich der Vorhang. Schauen Sie und folgen Sie unserer Einladung: Entrez, s’il vous plaît!
Stephan Schurr

6500
6500
Atelier Maison Belloir et Vazelle
Entwurf für den Theatervorhang des Théâtre de la Renaissance in Paris.
Aquarell und Gouache auf Velin. 33,1 x 40 cm. Unterhalb der Darstellung in schwarzer Feder bez. und mit Maßangaben „Rideau d‘AvantScène. 5. m50 x 4. m70. longueur du Rouleau 5. m80 Echelle 5%“. Um 1870.
2.800 €
Provenienz: Aus dem Firmenarchiv von Belloir & Vazelle, Paris. Das Unternehmen für Tapisserie, Dekoration und Möbel wurde 1820 von Pierre Jean Marie Belloir unter dem Namen Maison Belloir père gegründet und firmierte nach 1870 mit Eintritt von Georges Vazelle als Maison Belloir & Vazelle. Das Unternehmen zählte zu den bedeutendsten Dekorateuren in Paris. Neben Ausstattungen für feierliche Anlässe und Festivitäten im großen Stil, schuf die Firma auch opulente Dekorationen für Theater, Bühnen, öffentliche Gebäude und feine Palais der Stadt.
6501*
Wassili Nikolajewitsch Masjutin (1884 Riga – 1955 Berlin)
Kostümentwurf für eine Dame mit Fächer. Aquarell über Bleistift auf Velin. 19,3 x 12,4 cm. Wohl um 1931–32.
600 €
Gemeinsam mit Wladimir Majakowski studierte Wassili Masjutin in Moskau von 1910 bis 1912 an der Schule für Malerei, Bildhauerkunst und Baukunst. Danach wirkte er als Maler, Graphiker und Illustrator. Während der russischen Revolution emigrierte er 1922 nach Berlin. Von 1931 bis 1932 lebte er in Paris, wo er mit Max Reinhardt und Sergei Rachmaninow Mitglied des Freundeskreises „Théâtre Tchekhoff“ ist. Aus dieser Schaffensphase dürfte dieser wie auch der nachfolgende Kostümentwurf stammen.

6502

6502*
Wassili Nikolajewitsch Masjutin
Kostümentwurf für eine Dame mit Bolerojäckchen und schwingendem Rock. Aquarell über Bleistift auf Velin. 19,3 x 12,4 cm. Wohl um 1931–32.
600 €

6503
Pieter Schenck (Verleger, 1660 Elberfeld – 1713 Amsterdam)
Bildnis der Christiane Theresia von SachsenWeißenfels, geb. Löwenstein (1665–1730), mit Blume. Farbradierung à la poupée. 25,2 x 18,2 cm. „Pieter Schenck exc.“. Nicht bei Hollstein (Johannes Teyler and Dutch Color Prints).
800 €
Ausgezeichneter Druck mit Rändchen. Schwache Knitterspuren am oberen Rand, sonst schönes Exemplar.
6504
Johann Teyler (1648 Nijmegen – nach 1698/99)
Umkreis. Edeldame mit Dreizack auf einem Delphin reitend.
Farbradierung à la poupée und mit zeitgenöss. Kolorit. 29,5 x 21,3 cm. Nicht bei Hollstein (Johannes Teyler and Dutch Color Prints).
600 €
Ausgezeichneter Druck mit Rand um die Einfassungslinie. Etwas vergilbt und leicht stockfleckig, Wasserrand rechts, marginale Knitterspuren, sonst gut erhalten. Beigegeben eine weitere Farbradierung à la poupée „Bauernpaar“.

6505
Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin)
Rokoko und Betonform.
Kugelschreiber in Schwarz über Farboffset auf Postkartenkarton. 15 x 10,5 cm. Unten links mit Kugelschreiber in Schwarz signiert „Vostell“ und datiert sowie bezeichnet „Paris“, verso mit handschriftlichem Text, dort nochmals signiert „Wolf“. 1984.
300 €
Die Verfremdung, Umformung oder Übermalung von Objekten und Materialien bildet das Zentrum von Vostells Arbeitsweise. Marie Antoinette Victoire de Bourbon von Nicolas de Largilliere hier von Vostell verfremdet und verwandelt, indem er seine charakteristischen Betonformen vom Kopf ausgehend über die Figur im opulenten Rokokokleid zeichnet.


Dona Gudrun in Nueva York.
Kugelschreiber in Schwarz über Farboffset auf Postkartenkarton. 15 x 10,5 cm. Oben links mit Kugelschreiber in Schwarz signiert „Vostell“ und datiert, verso mit handschriftlichem Text, dort nochmals signiert „Wolf“. 1984.
300 €
Ausgehend von der Grundform des Kunstwerks, abstrahiert Vostell hier die weibliche Darstellung und überarbeitet sie mit eckigen, die Form des Reifrocks überspitzenden Kugelschreiberkonturen.

6507
Albrecht Dürer (1471–1528, Nürnberg)
Das Fräulein zu Pferd und der Landsknecht. Kupferstich. 10,6 x 7,6 cm. Um 1497. B. 82, Meder 84 wohl b (von d).
4.500 €
Vermutlich begründete Vasaris Aussage „eine Frau in flandrischer Art zu Pferd mit einem Knappen zu Fuß“ den Irrglauben, bei der Darstellung der eleganten Reiterin handle es sich um ein mittelalterliches Edelfräulein mit ihrem Knappen. Doch Rainer Schoch verweist zu Recht darauf, dass die Kostüme eher darauf schließen lassen, die Szene sei weniger dem ritterlichen Kontext, als dem Soldatenleben entnommen. Der junge Landsknecht mit engem Beinkleid und geschlitztem Wams hat sich breitbeinig in Pose gestellt. Das Fräulein im Damensitz auf dem kräftigen Streitross mit Schabracke trägt ein einfacheres, an den Schultern geschlitztes Kleid. Die zarte Berührung der beiden Figuren findet Widerhall in
der üppigen Feder, die zart die Hellebarde berührt. Vermutlich hat sich die verliebte Dame den Federhut ihres Begleiters geschnappt, denn interessanterweise findet sich die imposante Straußenfeder am Barett in der zeitgenössischen Mode nur als Teil der Landsknechtstracht, wie Dürer diese etwa in seinem Kupferstich „Der Spaziergang“ darstellt (siehe unser Los 6511). Dieser „Kleidertausch“ eröffnet damit die Möglichkeit, in der Darstellung eine Interpretation von weiblicher Überlegenheit und männlicher Abhängigkeit zu sehen (vgl. Schoch/Mende/Scherbaum, Band I, S. 60).
Ganz ausgezeichneter, in den Details schön und klar zeichnender Druck, an die Facette geschnitten, links partiell minimal knapp. Leicht fleckig, entlang der Ränder vereinzelt unauffällig ausgebesserte Läsuren, oben geschlossener Randeinriss, dünne Stellen, rechts des Monogramms beriebene, ausgebesserte Stelle, weitere Altersspuren, sonst sehr gut.
6508
Robert (Bob) Klebig (1914–1994)
Emilio Pucci und Models vor dem Brandenburger Tor.
Hochglanz SilbergelatineAbzug auf Karton montiert in Holzrahmen. 23,7 x 17,7 cm (45,2 x 38,4 cm). 1950er Jahre.
400 €
Robert (später auch bekannt als Bob) Klebig war Schüler der renommierten Berliner Modefotografin Yva, die durch ihre stilprägenden Modeaufnahmen in den 1920er und 1930er Jahren Berühmtheit erlangte. Ihre elegante Bildsprache beeinflusste eine ganze Generation von Fotografen, darunter auch Helmut Newton, der in ihrem Studio seine ersten Erfahrungen sammelte. In dieser Aufnahme porträtiert Klebig den italienischen Modedesigner Emilio Pucci (vgl. Los 6591) vor dem Brandenburger Tor – eine ikonische Kulisse für eine seiner ersten internationalen Modekampagnen zu dieser Zeit. Das Bild entstand kurz vor dem Bau der Berliner Mauer und fängt die Atmosphäre einer Stadt im Wandel ein. Puccis Entscheidung, seine Mode in Berlin zu präsentieren, zeigt, dass die Stadt trotz politischer und wirtschaftlicher Umbrüche weiterhin eine Anziehungskraft für die internationale Modewelt besaß.

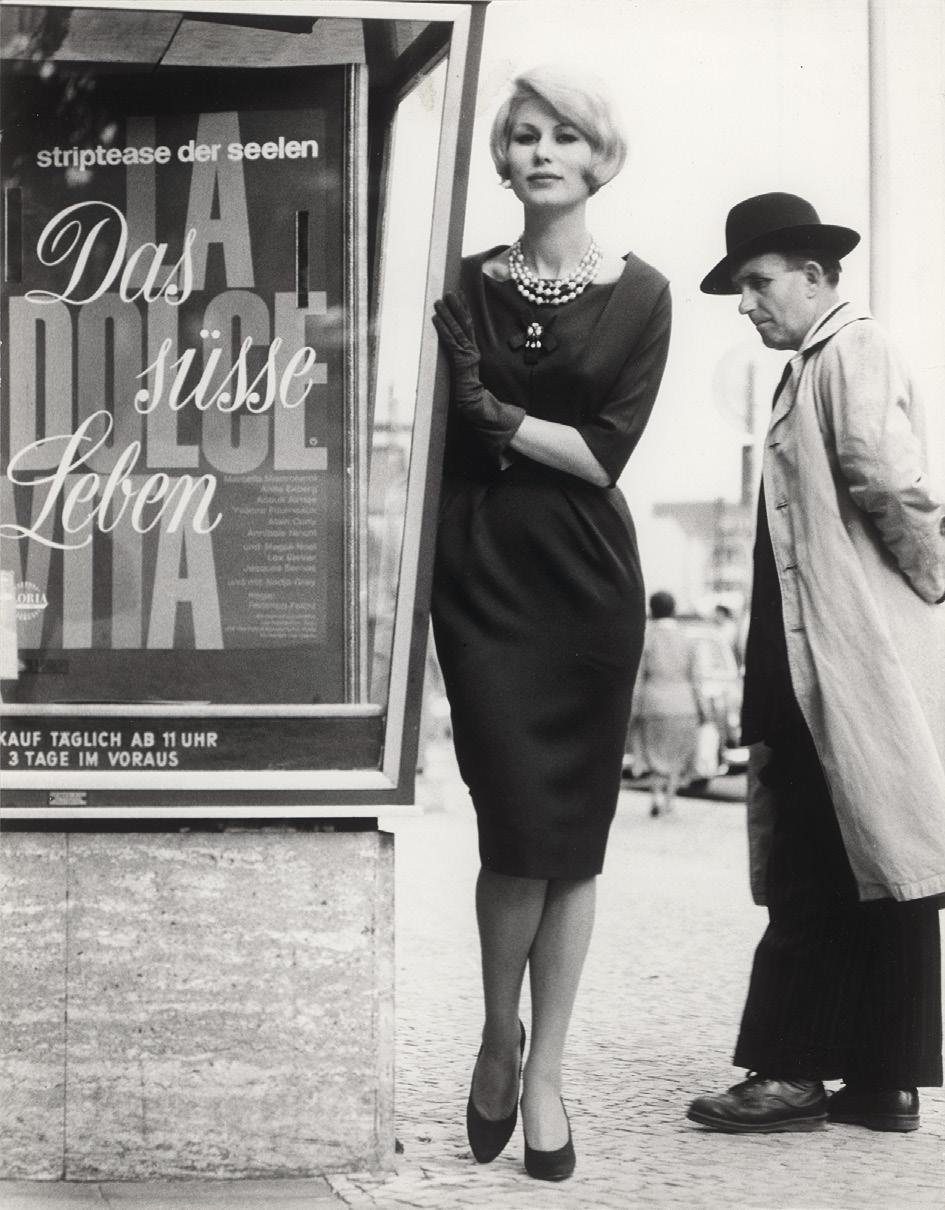
6509
Robert (Bob) Klebig
Model, Kurfürstendamm, Berlin. Hochglanz SilbergelatineAbzug auf Karton montiert in Holzrahmen (leicht bestoßen). 30,2 x 23,8 cm (51,5 x 44,4 cm). 1960.
400 €
Diese Aufnahme von Robert Klebig aus dem Jahr 1960 vereint Modefotografie mit subtiler sozialer Beobachtung. Im Mittelpunkt steht eine elegant gekleidete Frau, die in selbstbewusster Pose an einer Litfaßsäule lehnt, auf der das Plakat für den Film La Dolce Vita von Federico Fellini zu sehen ist. Ihr modernes Auftreten, betont durch ein schlichtes, aber stilvolles Kleid und auffälligen Schmuck, verkörpert die aufkommende Eleganz der 1960er Jahre. Im Kontrast dazu steht ein älterer Mann, der mit misstrauischem oder neugierigem Blick an ihr vorbeigeht – ein subtiler Kommentar zum gesellschaftlichen Wandel dieser Zeit. Berlin, noch von den Nachwirkungen des Krieges und der beginnenden Teilung geprägt, befindet sich in einer Phase des Umbruchs, in der alte und neue Werte aufeinandertreffen.

6510
6510
Federfächer
Weißer Straußenfederfächer.
Straußenfedern, auf Harzstäben montiert. Länge der Stäbe: ca. 24 cm, Länge komplett (wenn geschlossen) ca. 50 cm, Breite ca. 75 cm (wenn geöffnet). Um 1900.
450 €
6511
Albrecht Dürer (1471–1528, Nürnberg)
Der Spaziergang. Kupferstich. 19,3 x 12,1 cm. Um 1498. Meder 83 I k (von II).
3.500 €
Provenienz: Aus der Sammlung Pierre Sentuc (Lugt 3608). Noch schwach ein Kratzer durch die Sanduhr, aber vor den letzten Überarbeitungen. Ausgezeichneter, etwas flacher und gleichmäßiger Druck mit feinem Rändchen um die Plattenkante, partiell auf diese geschnitten. Gebräunt, oben geglättete horizontale Faltspur, kleine dünne Papierstellen bzw. Risschen, wie auf dem linken Unterarm der Frau oder links neben dem Baumstamm unterhalb des flatternden Gewandes des Todes, hinterfasert, weitere kleine ausgebesserte Stellen entlang des rechten Randes oben sowie an der linken unteren Ecke, hier mit unauffälligen Federretuschen, die rechten Ecken wiederangefügt, sonst im Gesamteindruck noch schön.

6512

Wenzel Hollar (1607 Prag – 1677 London)
Die hässliche Herzogin („Rex et Regina de Tunis“).
Radierung nach Leonardo da Vinci. 6,7 x 12,4 cm.
Parthey 1603, New Hollstein 742 II.
750 €
Die Radierung ist Teil der Folge Varie Figuræ et Probæ von Wenzel Hollar, die 1645 in Antwerpen erschien. Obwohl Leonardo da Vinci als Erfinder der Portraits auf dem Blatt genannt ist, geht das weibliche Bildnis auf das berühmte Gemälde aus dem Jahr 1513 von Quentin Matsys zurück, das unter dem Namen „Die hässliche Herzogin“ bekannt ist (London, National Gallery). Das Werk zeigt eine alte Frau mit faltiger Haut und erschlafften Brüsten. Sie trägt die aristokratische gehörnte Kopfbedeckung (escoffion) ihrer Jugend, die zur Zeit des Gemäldes bereits längst aus der Mode gekommen war, und ein Gewand mit tiefem Decolleté, das ihrer verblüten Schönheit leider keinen Dienst erweist. Ein möglicher literarischer Einfluss für dieses Werk ist Erasmus von Rotterdams Essay Lob der Torheit (1511), in dem er sich über Frauen lustig macht, die „immer noch kokett spielen“, „sich nicht von ihren Spiegeln losreißen können“ und „nicht zögern, ihre abstoßenden, verdorrten Brüste zur Schau zu stellen“.
Ausgezeichneter Druck mit gleichmäßigem Rändchen. Vereinzelte Stockfleckchen, minimal vergilbt, kleine Montierungsrückstände verso, sonst ganz vorzüglich erhalten.
6513
Halsschmuck
Bückeburger Hochzeitskette.
21 Bernsteinscheiben (ca. 2,5–4,5 cm Durchmesser), Messingschließe, verziert mit roten und grünen Glassteinen. L. 47 cm. Deutsch, um 1890.
2.800 €
Dieses imposante, massiv gearbeitete Schmuckstück, das als Kette um den Hals getragen wurde, war ein essenzieller Bestandteil der Hochzeitstracht im niedersächsischen Bürgertum sowie in wohlhabenden bäuerlichen Gesellschaftsschichten. Besonders im Schaumburger und Mindener Land erfreuten diese Ketten sich großer Verbreitung, waren jedoch auch im Ravensbergischen und Osnabrücker Raum bekannt. Westlich von Hannover sind sie als sogenannte „Bückeburger Hochzeitsketten“ überliefert, deren Tradition tief in der regionalen Kultur verwurzelt ist. Diese kostbaren Schmuckstücke wurden innerhalb der Familien über Generationen weitergegeben.
Die bäuerliche Tracht des 19. Jahrhunderts diente nicht nur als Ausdruck regionaler Identität, sondern markierte zudem den gesellschaftlichen Status der Trägerin – ihr Lebensalter, ihren Familienstand und ihre soziale Stellung fanden in der Kleidung und insbesondere im Schmuck eine sichtbare Manifestation.
Die Hochzeitskette, ein wertvolles Geschenk des Bräutigams an die Braut, bestand aus kunstvoll gefertigten Bernsteinperlen und wurde durch eine aufwendig verzierte Schließe ergänzt, auf der häufig die Initialen des Brautpaares eingraviert waren.
Der Gebrauch von Bernstein für Schmuckstücke reicht bis in die Antike zurück, wobei dem fossilen Harz eine schützende und heilende Wirkung zugeschrieben wurde. Neben seiner translucenten Schönheit und der charakteristischen Wärme, wurde Bernstein aufgrund seiner elektromagnetischen Eigenschaften geschätzt –zudem besitzt er die Fähigkeit zu brennen, was ihm im Niederdeutschen die Bezeichnung „Börnstein“ (Brennstein) einbrachte. In plattdeutscher Tradition ist der Begriff „Flüötekrallen“ überliefert, der als „Flutkorallen“ gedeutet werden kann, da Bernstein

häufig an den Küsten angespült wurde. In einigen Trachtenregionen setzte sich die Bezeichnung „Krallen“ für Bernsteinketten durch.
Der für diese prächtigen Ketten verwendete Bernstein gelangte über weitläufige Handelswege in die Region, insbesondere aus den an die Ostsee grenzenden Gebieten des heutigen Polen. So spiegeln diese Hochzeitsketten nicht nur lokale Traditionen wider, sondern auch eine lange, kulturhistorisch bedeutende Verbindung zum Bernsteinhandel und dessen kunsthandwerklicher Verarbeitung.



6514
Wenzel Hollar (1607 Prag – 1677 London)
Schweizer Frauentrachten. 8 Radierungen. Je ca. 9,3 x 6 cm. 1644. Pennington 18581865, Turner (New Hollstein) 588589 IIIII (von III), 590 I (von II), 597, 598 II, 599, 600, 620 I (von II).
Aus der 1644 in London publizierten, 33teiligen Folge mit europäischen Frauentrachten, die einen wertvollen Einblick in die verschiedenen gesellschaftlichen Hierarchien und Rollen jener Zeit gibt. Die Kleidung der dargestellten Frauen diente dabei weit mehr als nur praktischen Zwecken sie war auch zentraler Indikator für Herkunft, Status und Lebensphase der Trägerin. So unterscheiden sich zum Beispiel die Trachten der Züricher Jungfrau, der Hochzeiterin und der Bürgersfrau erkennbar in Details wie Stoffwahl, Schnitt und Verzierungen. Hollars präziser Blick für textile Strukturen und die kunstvolle Wiedergabe von Details und Accessoires vermitteln nicht nur die modischen Vorlieben der Epoche, sondern auch die Bedeutung von Kleidung als Medium sozialer Kommunikation.
Ausgezeichnete Drucke mit der vollen Darstellung, meist mit feinem Rändchen um die Darstellung. NH 590 mit einer Quetschfalte und einem kleinen geschlossenen Randeinriss, vereinzelt leicht fleckig, sonst sehr gut erhalten.

6515
Trachtenhut
Priener Trachtenhut.
Filz (Hasenhaar?), vier Goldquasten, goldene Kordeln aus Metallfäden, verziert mit Pailletten und Glassteinen, mit bestickten, rocklangen Hutbändern aus Seide (?) und Samtverzierung. 27,5 cm (Durchmesser), 7 cm (Höhe), 155 cm (Länge Hutbänder). Die Innenseite des Hutes mit dem HutmacherLabel Carl Brunhuber, Prien, am Chiemsee, um 1896. Mit einer nicht dazugehörigen Hutschachtel der Firma Marie Pandler, Prien, am Chiemsee.
450 €
„Tracht ist Mode – und regionale Trachten wurden stets durch modische Neuerungen abgewandelt und weiterentwickelt“ (100 Heimatschätze. Verborgene Einblicke in bayerische Museen, 2019, S. 54ff.)
Der Priener Hut ist hier ein bekanntestes Beispiel der oberbayerischen Tracht. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1879 zurück, als die Priener Modistin Anna Brunhuber (18611935) das erste Exem
plar entwarf. Ihr Design erfuhr erstmals 1879 auf der Gewerbeausstellung in Berlin Aufmerksamkeit. Zunächst handelte es sich um einen schwarzen Strohhut mit Straußenfeder und Seidenblumen, bis er sich schließlich zu einem edlen Modell aus schwarzem Filz (meist Hasenhaar) mit kostbarer, handgestickter goldener Borte und Quasten wandelte, meist mit eingearbeiteten Glassteinen und Paillettenverzierungen. Die Unterseite des Hutes, der leicht schräg getragen wird, schmücken zudem aufwendige Stickereien. Für den perfekten Sitz sorgt das „HintobiBandl“ aus schwarzem Samt. Das neue Modell aus Filzplüsch der Firma Brunhuber – wie auch hier vorliegend – wurde schließlich 1896 auf der Bayerischen Landes, Industrie, Gewerbe und Kunstausstellung in Nürnberg präsentiert. In einem Werbezettel von 1906 wurden die Hutmodelle als „Schöner Priener Sonntagshut“ und „Fescher Priener Festtagshut“ ausgewiesen. Die Modelle unterschieden sich dabei nicht nach der sozialen Stellung der Trägerin. Im Zuge der Trachtenbewegung hatte Anna Brunhuber die Absicht, einen Hut insbesondere für die bäuerliche Bevölkerung zu schaffen. Heute steht der „Priener Hut“ als überregionales Markenzeichen für die Chiemgauer Tracht (op.cit. S. 55). Es existieren zahlreiche Varianten des Priener Huts. 6515



6516
Heinrich Aldegrever (1502 Paderborn – 1555/62 Soest)
Drei Entwürfe für Broschen mit Blattranken, Maske und Grotesken.
Kupferstich. 4,1 x 15,1 cm. 1536. B. 258, Hollstein 258, Mielke (New Hollstein) 258.
450 €
Provenienz: Aus der Sammlung Adalbert Freiherr von Lanna (Lugt 2773).
Ganz ausgezeichneter Abzug bis an die Darstellung geschnitten, partiell mit der Plattenkante, hier mit leichtem Plattenschmutz. Schwach fleckig, die linke obere Eckspitze ergänzt, verso Reste alter Montierung, sonst schön erhalten.

6517
Baltazar Moncornet
(um 1600 Rouen – 1668 Paris)
Livre Nouveau de toutes sortes d‘Ouvrages d‘Orfèvrerie.
10 (von 12) Kupferstiche nach François Lefebvre Je ca. 17,4 x 13,4 cm. (1661). Le Blanc 37, Berliner Ornamentstichkatalog 819.
1.500 €
Nach Entwürfen von François Lefebvre geschaffene Folge, die in sehr origineller Weise Vorlagen von Schmuckornamenten für Ketten, Medaillons, Uhren und aufwendige Schmuckgehänge mit kleinen, schmalen Veduten von Paris, Rouen, Ruel und Rom kombiniert. Die beinahe vollständige Folge ohne die Nummern – es fehlen lediglich der Titel sowie Blatt 6 – in ganz ausgezeichneten, meist klaren Drucken mit sehr feinem Rändchen um die Einfassungslinie, die Plattenkante teilweise sichtbar. Etwas angestaubt und nur vereinzelt leicht fleckig, sonst in sehr schöner Erhaltung.
6518
Deutsch
um 1610. Bildnis der Johanna von SachsenWeimar als Kind.
Öl auf Pergament mit Goldhöhung. 8,3 x 5,7 cm. Am oberen Rand in goldfarbener Feder bez. „F. Johanna, H. Z. S“.
7.500 €
Johanna von SachsenWeimar wurde am 14. April 1606 in Weimar als jüngstes und elftes Kind des Herzogs Johann Wettin von SachsenWeimar (15701605) und der Prinzessin Dorothea Marie von Anhalt (15741617) geboren. Johannas Vater verstarb fünf Monate vor ihrer Geburt und auch ihr eigenes Leben war sehr kurz: Sie starb am 3. Juli 1609 in Weimar. Das Portrait zeigt die kleine Herzogin in einem kostbaren Kleid mit feiner floraler Stickerei in Gold, Rosa und Grün. Der weiße, gestärkte Batistkragen ist mit Spitze besetzt, der zu dem Haarschmuck aus Spitze passt.



6519
Ohrschmuck
Paar barocke SmaragdOhrgehänge. 18 kt Gelbgold. Zweiteilige Bügelgehänge mit Ranken, gefasst mit 40 natürlichen, wohl südamerikanischen Smaragden im Treppenschliff (max. 3,6 x 3,6 mm, zus. ca. 5,21 ct). Stempel „Schreitender Vierfüßler“ (Löwe?). Länge 4,9 cm. Gesamtgewicht 8,2 g. Spanisch, um 1760.
2.500 €
6520
Ohrschmuck
Paar filigraner KorallenOhrgehänge mit Kameen. 14 kt Gelbgold. Brisuren und mehrteilige Gehänge mit Rahmen aus Goldfiligran, gefasst mit vier Kameen (ca. 12,4 x 9,4 mm bzw. 22,5 x 14,6 mm) und sechs angehängten facettierten Pampeln (max. ca. 15,5 x 8,8 mm), je aus roter Mittelmeerkoralle (corallium rubrum). Nicht gestempelt. Länge 8,9 cm. Gesamtgewicht 22,6 g. Um 1830.
3.500 €
6521
John Faber II (1684 Den Haag – 1756 Bloomsbury)
The Jeweller (Der Juwelier). Schabkunstblatt nach Philippe Mercier. 24,8 x 32,6 cm. (1744). Nagler IV, S. 413, ChalonerSmith 411c.
400 €
In einem Interieur präsentiert der Juwellier einen raffinierten Perlenschmuck der vor ihm sitzenden eleganten Dame. Sofort erweckt das reizvolle Stück Begehrlichkeiten. Mit großen erwartungsvollen Augen blickt die Dame auf ihren Begleiter, der der Situation nicht entkommend, bereits in seiner Tasche nach seiner Barschaft sucht. Ausgezeichneter, gleichmäßiger Druck meist an die Facette geschnitten, der untere Schriftrand fehlt. Leicht angestaubt und vereinzelt schwach berieben, vertikale Mittelfalte, rechts der Rand etwas bestoßen und lädiert, verso stockfleckig, unmerkliche, punktuelle Ausbesserungen, weitere Alters und Gebrauchsspuren, verso kleine Montierungsreste, alt aufgezogen, sonst gut.

6522
Robert (Bob) Klebig (1914–1994)
Model vor dem Brandenburger Tor. Hochglanz SilbergelatineAbzug auf Karton montiert in Holzrahmen (leicht bestoßen). 23,2 x 17,5 cm (45,2 x 38,4 cm). 1950er Jahre.
400 €
6523
Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726 Danzig – 1801 Berlin)
Die Dame mit dem Muff. Schabkunstblatt auf Makulaturpapier. 6,4 x 5,2 cm. (1759). Engelmann 20.
1.800 €
Ab Mitte des 16. Jahrhunderts etablierte sich der Muff als Teil der Garderobe der gehobeneren Kreise. Während er zu Beginn lediglich als ein Wärme spendendes Kleidungsstück angesehen wurde, avancierte er vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert zu einem der populärsten modischen Accessoires. In seinen frühen Radierungen „Die beiden sitzenden Damen am Baume“ (1758, E. 15) und „Die vier Damen am Fenster“ (1763, E. 23) hat Chodowiecki wiederholt Frauen aus seinem Umkreis gezeigt, die den Muff als Accessoire tragen, womit er ihre gehobene gesellschaftliche Stellung unterstreicht. Prachtvoller Druck mit schönen Valeurs, mit Rand um die unregelmäßige und mit Grat druckende Plattenkante Das eminent seltene Blatt – Chodowieckis „einziger Versuch in schwartzer Kunst“ – unterscheidet sich von den „vorkommenden sogenannten Originalen“ (d.h. Kopien) durch die unregelmäßige Körnung der Platte, deren Kanten nicht begradigt sind. Etwas stockfleckig, Montierungsreste verso, sonst in sehr guter und originaler Erhaltung. Von allergrößter Seltenheit
6524*

Wenzel Hollar (1607 Prag – 1677 London)
Gestreifter Muff und Pelzboa. Radierung. 7,2 x 11,2 cm. 1645. Pennington 1947, Turner (New Hollstein) 794 II.
8.000 €
Provenienz: Sammlung Benjamin Petzold, Wien (Lugt 2025). Kunsthandlung J. F. Linck, Berlin (Lugt 1685).
Wenzel Hollars Folge von kunstvoll arrangierten Muffen entstand während seines ersten Aufenthalts in England und ist ein eigenwilliges und faszinierendes Unikum der Radierkunst im 17. Jahrhunderts: „They [...] are still extraordinary for the almost fetishistic delight expressed in them“ (A. Griffith und G. Kesnerová). Durch die delikaten, dicht arrangierten Linien gewinnen die Textur und Stofflichkeit der zu modischen Händewärmer verarbeiteten Pelze fast haptische Präsenz. In dem hier vorliegenden zweiten Zustand verkleinerte der Künstler die Platte geringfügig, um die virtuose MuffDarstellung noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Prachtvoller, feinzeichnender, das Pelzwerk herrlich zu Geltung bringender Druck mit zartem Plattenton sowie regelmäßigem 6–7 mm breiten Rändchen. Minimale Stockflecken überwiegend oben, Montierungsreste verso, sonst vollkommenes Exemplar.


6525
6525
Bert Stern (1929–2013, New York, N.Y.)
Vogue, Feburary 1st 1961. Späterer SilbergelatineAbzug. 61 × 50,4 cm. Rückseitig signiert, betitelt, datiert und mit CopyrightStempel des Fotografen versehen. 1961.
1.000 €
Bert Stern war eine Schlüsselfigur der Modefotografie der 1960er Jahre, bekannt für seine raffinierte Lichtführung, dynamischen Kompositionen und seinen cineastischen Blick. Seine Arbeiten für Vogue zeichneten sich durch eine Mischung aus Bewegung, Dra
matik und müheloser Raffinesse aus, die das klassische StudioSetting mit einem modernen, fast filmischen Ansatz verband. In dieser Aufnahme von 1961 fängt Stern das Zusammenspiel von Mode und Bewegung meisterhaft ein. Die fließenden Stoffe, die anmutigen Gesten der Models und das subtile Spiel mit Licht und Schatten erzeugen eine Atmosphäre von Leichtigkeit und Sinnlichkeit. Mode wird hier nicht einfach dargestellt, sondern zum Ausdruck von Emotion und Bewegung. Sterns Gespür für Timing und Inszenierung machte ihn zu einem der einflussreichsten Modefotografen seiner Generation, dessen Bildsprache bis heute nachwirkt.

6526
6526
Daniel Chodowiecki (1726 Danzig – 1801 Berlin)
Drei junge Damen, stehend von vorn, sich umschlungend haltend.
Bleistift auf Bütten, verso: Bleistiftstudie Mann mit Hut. 15,4 x 10,9 cm. Unten links eigenh. datiert „le 19 8bre [17]58“.
1.200 €
Provenienz: Sammlung Mme Stechow (Lugt 2371). Deren Versteigerung bei C. G. Boerner, Leipzig, M. Stechow, Berlin: das radierte Werk des Daniel Chodowiecki [...], Auktion 128 am 10.–13. Dezember 1919, Los 22 mit Abb.
In den Jahren 1758 und 1759 zeichnet Chodowiecki eine Vielzahl solcher kleineren Gesellschaftstücke, die er in seinem unmittelbaren familiären Umfeld beobachten konnte (s. Willi Geismeier: Daniel Chodowiecki, Leipzig 1993, S. 66 ff.). Besonders schön kommt dabei auch die Mode des friderizanischen Rokoko zur Geltung mit den eng taillierten Kleidern und den feinen Hauben. Beigegeben eine Chodowiecki zugeschriebene Federzeichnung „Mutter mit drei Kindern in der Landschaft“ (vgl. Kupferstich im „Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer“, 1792, gestochen von Daniel Berger).

6527
6528
Fingerschmuck
Viktorianischer BoatRing mit australischen Opalen. 18 kt Gelbgold. Spitzovales Pavée aus 12 australischen Opalen mit reichem Farbspiel im Cabochonschliff (D. max. 3,8 mm), vier Diamanten im Rosenschliff (D. je ca. 1,2 mm, zus. ca. 0,01 ct). Stark beriebener englischer Punzen sowie Reste alter „18CT“Marke, diese nachpunziert. Ringkopf ca. 0,9 x 2,1 cm; Ringgröße 56. Gesamtgewicht 3,8 g. Großbritannien, um 1900.
1.500 €
Ohne die sensationelle Entdeckung eines großen Opalvorkommens im australischen Queensland in der Mitte des 19. Jahrhunderts wäre die rasante Verbreitung dieses Steins nicht denkbar. Insbesondere in Großbritannien war der funkelnde Opal ab den 1890erJahren sehr in Mode.

6527
Ohrschmuck
Paar antikisierender GemmenOhrgehänge mit Bachantinnen.
Gold Doublé mind. 8 kt auf Tombak. Ornamentale Fassung, darin Glasgemmen (13,6 x 18,3 mm) aus pâte de verre auf roter Glasscheibe, abgehängter Pendel, erneuerter Bügel in Gold mind. 8 kt. Nicht gestempelt. Länge ca. 6,4 cm. Gesamtgewicht 11,7 g. Um 1800.
450 €
6529
Pierre François Courtois (1736 Paris – 1763 Rochefort)
und Mlle Raimbau. Schmuckentwürfe mit Edelsteinen. 52 Radierungen. Je 4to. (1762). Berliner Ornamentstichkatalog 869.
350 €
Die Kupfer zeigen phantasievolle Schmuckentwürfe von kostbaren Broschen, Anhängern, Schleifen und Orden aus Jean Henry Prosper Pougets „Traité des Pierres précieuses et de la manière de les employer en Parure“, 1762 in Paris erschienen. Ausgezeichnete Drucke mit Rand. Überwiegend etwas gebräunt bzw. stockfleckig, kleinere Randschäden.





6530
Objet de vertu
Boîte à mouches et à rouge.
Dose für Schönheitspflästerchen und Rouge mit Fassung aus fein ziseliertem Silber (auf dem Flansch punziert), Gold und Silbermontur. Rechteckig, auf der Oberseite des Deckels mit eingelassenem Aquarell „Bildnis einer Dame mit Hochsteckfrisur, Spitzenhaube und gelbem Halstuch“. Innen im Deckel mit originalem Spiegelglas, sowie zweiteiliges Fach mit scharnierten Deckeln und mit originalem Tupfer. 3 cm (Höhe) x 6,5 cm (Breite) x 4,8 cm (Tiefe). Frankreich, um 1780.
1.200 €
Mouche, das französische Wort für Fliege, ist eine zur Zeit des Rokoko übliche Bezeichnung für das Schönheitspflaster bzw. für den angedeuteten Leberfleck. Die „Boîte à mouches“ bezeichnet die Dose, in der die „Mouches“ bis zu ihrem nächsten Einsatz aufbewahrt wurden. Während heute auf rauschenden Festen ein solcher Fleck mit Schminke aufgetragen wird, wurde früher ein Stück

Stoff aus schwarzem Taft oder Leder verwendet. Mit den Lippen angefeuchtet und auf das blass gepuderte Gesicht aufgetragen, ließ sich so ein Blickfang mit unterschiedlicher Bedeutung und Aussage erzeugen. Damen und Herren gleichermaßen nutzten diesen Geheimcode der Mouches zur möglichen Kontaktaufnahme oder auch zum Vertreiben „lästiger“ Verehrer und Verehrerinnen.

6531
Marco Alvise Pitteri (1702–1786, Venedig)
Bildnis einer Frau mit Strohhut, wohl Madame de Pompadour.
Radierung nach Giovanni Battista Piazzetta. 45,8 x 35,5 cm. Nicht in Le Blanc, Ravà 187. Wz. Wappenkartusche (?) mit Initialen FV.
600 €
Provenienz: Aus den Sammlungen Axel Widstrand (Lugt 2630a) und Frank Bensow (Lugt 982c).
Man nimmt an, dass es sich bei der im Schäferkostüm Dargestellten um ein Bildnis der Madame de Pompadour (eigentlich JeanneAntoinette Poisson), maîtresse en titre von Louis XV. handelt. Madame de Pompadour war die ModeIkone des 18. Jahrhunderts, deren Kleidungsstil nachhaltig die Coutouriers ihrer Zeit beeinflusste. In ganz Europa eiferten die adeligen Damen ihrem Stil nach. Interessant ist der kleine, auf ihrer rechten Wange angebrachte Schönheitsfleck („Mouche“), der im Zeitalter des Rokoko bei keiner Toilette fehlen durfte. Prachtvoller Druck mit feinem Rand. Minimal angestaubt, links im Hintergrund sowie rechts im Rand geglättete Quetschspuren, dort Spuren von brauner bzw. grauer Feder, rechts dort hinterfasert, kleine Knickspur in der unteren rechten Ecke, sonst schönes Exemplar.


6532
Joseph François Foulquier (1744 Toulouse – 1789 Martinique)
Skizzenblatt mit diversen Köpfen und Haartrachten. Radierung. 10,6 x 22,1 cm. „Ritratti di alcune capellini piacevole fatti dapresso natura da J. F. Foulquier ... in Tolosa 1768“. Le Blanc, aus 5 (?).
300 €
Amüsantes und zugleich seltenes Blatt des AmateurRadierers Foulquier. Guter Druck, meist mit Rändchen, rechts teils mit der vollen Darstellung. Unauffällige vertikale Knickfalte, weitere schwache Horizontalfalte, sonst tadellos.
William Hogarth (1697–1764, London)
6533 The five Orders of Periwigs – Die fünf Perückenordnungen. Radierung auf Velin. 30,2 x 22,1 cm. 1761. Paulson 209 III.
400 €
Hogarth überträgt in dieser Radierung die Terminologie der klassischen Architektur auf Männerperücken, um die Spaltung der britischen Gesellschaft zu karikieren. Die Herrenperücken waren nämlich weit mehr als nur Mode. Sie drückten gesellschaftlichen Status aus. Deshalb gab es eigens erlassene Perückenordnungen, die den Berufsständen die Art der zu tragenden Perücke vor

6534
schrieb. Mit verspottender Ernsthaftigkeit arrangiert Hogarth die Perückentypen in Reihen wie in einer architektonischen Abhandlung. In Anlehnung an die Namen der Säulenkapitelle bezeichnete er seine Exemplare als „Episcopal“, „Old Peerian“, „Aldermanic“, „Lexonic“ und „Queerinthian“.
Ganz ausgezeichneter Druck mit breitem Rand, aus der Ausgabe von Baldwin and Cradock 1822. Vereinzelte Fleckchen im weißen Rand und leicht angestaubt, sonst in sehr guter Erhaltung.
6534
François Adolphe Grison (1845 Bordeaux – 1914 ChêneBougeries)
Dame beim Frisieren im Boudoir. Öl auf Holz. 32 x 23,5 cm. Unten links signiert „Grison“. 3.500 €



6535

Deutsch
um 1780/90. Album mit Entwürfen für edelsteinbesetzten Schmuck.
36 Zeichnungen, überwiegend in grauer Feder oder Bleistift, teils koloriert. 2,6 x 2,7 cm bis 9 x 16,1 cm. Montiert in einem marmorierten HLederAlbum mit goldgeprägten Titelinitialen „F. F.“ und Goldschnitt (kleine Fehlstelle am Rücken oben, Ecken minimal bestoßen) mit Orig.Pappschuber. Vereinzelte technische Bezeichnungen.
900 €
Die Zusammenstellung von Entwürfen für Schmuckstücke umfasst Entwürfe für kostbare Broschen, Anhänger, Ohrringe, Schließen und Haarnadeln.
6536
Abraham Constantin (1785–1855, Genf)
zugeschrieben. Bildnis der Letizia Buonaparte im roten Kleid mit Spitzenkragen, Perlenkette und Diadem.
Email auf Kupfer, in ursprünglicher Goldfassung mit einem Broschenaufsatz und einer später hinzugefügten Sicherheitskette. 5 x 3,6 cm (oval). Um 1810.
2.400 €
Die Miniatur zeigt die Mutter von Napoleon I., Letizia Buonaparte, geborene Ramolino (17501836). Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein Werk des berühmten Schweizer Emailleurs Abraham Constantin, der in der besprochenen Zeit in Paris tätig war und Aufträge von der kaiserlichen Familie erhielt.

6537
Halsschmuck
LavaKamee mit Bildnis von Salvator Rosa. Kamee aus geschnittenem Lava (4,3 x 5,4 cm), modern in Silber gefasst, mit Silberkette. Verso auf der Gemme bezeichnet „Sal.v Rosa“ (geritzt), Fassung und Kette mit Feingehalt „925“ gestempelt. Größe Anhänger 6,5 x 4,5 cm (inkl. Öse); Länge Kette 91 cm. Gesamtgewicht 43,4 g. Neapel, um 1860.
750 €
Neben Muscheln und Korallen nutzten die versierten neapolitanischen Gemmen und Kameenschneider auch das verschiedenfarbige Lavagestein vom Vesuv. Vor allem im 18. Jahrhundert war Lava ein beliebtes Material für Schmuckstücke, die an die Grand TourReisenden verkauft wurden. Hier dargestellt ist das berühmte Kind der Stadt Salvator Rosa nach dem Selbstbildnis, das sich heute in den Uffizien, Florenz, befindet.

6538
Ohrschmuck
Antike römische Ohrringe mit Granaten. 21,6 kt Gelbgold. Plastische Ohrringe mit schiffchenförmigem Körper, vorne je tropfenförmiger roter Achat (ca. 10,2 x 13,7 mm) in granulierter Fassung, unten Arrangement aus Kugeln und Granulat gefasst mit je drei roten Granaten (ca. 2,5 mm bis 5,6 x 3,2 mm). Nicht gestempelt. Gesamtgröße ca. 1,3 x 2,6 x 4,4 cm. Gesamtgewicht 14,9 g. Römisch, 2. Jh. n. Chr.
6.000 €
Provenienz: 1978 Kunsthandlung Baronesse Irene von Ohlendorf, München (lt. Auskunft der Vorbesitzer). Privatsammlung Ostwestfalen.
Die frühsten Entwürfe für bootsförmigen Ohrschmuck entstanden um 1300 v. Chr. auf Zypern, von wo aus sie sich im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten. Das reiche Dekor des vorliegenden Paares lässt sich auf das 2. Jh. n. Chr. datieren und verweist auf die östlichen Provinzen des römischen Reiches bzw. die angrenzenden Gebiete wie dem persischen Partherreich. Beim Tragen wurden ursprünglich die oberen Drähte auseinander gebogen. Ein vergleichbares Paar befindet sich im Walters Museum in Baltimore (Inv.Nr. VO.92).
Hinweis: Dieses Schmuckstück kann aufgrund zollrechtlicher Bestimmungen die Europäischen Union nicht verlassen.
6539
Jacques-Louis David (1748 Paris – 1825 Brüssel)
Bildnis einer jungen Frau gekleidet im Stil der Antike mit Schleier und Tunika. Schwarze Kreide auf Velin. 16 x 11,4 cm. Um 1818.
Literatur: Pierre Rosenberg und LouisAntoine Prat: Jacques Louis David 1748–1825, Catalogue raisonné des dessins, Mailand 2002, Bd. II, S. 1279, Nr. 340 ter.
Provenienz: Wohl Nachlassauktion des Künstlers, Catalogue de Tableaux ..., Dessins, Études, Livres de Croquis de M. Louis David, Paris, 17. April 1826 (und folgende Tage). Paris, Hôtel Drouot, Étude Massol, 6. März 2002 (ohne Katalog). Privatsammlung Paris.
Insbesondere in seiner späten Schaffensphase nehmen Portraits und Kopfstudien eine große Rolle im Werk von JacquesLouis David ein. Etwa vierzig Portraits und dazu um die fünfzig sogenannte Têtes d‘expression, also Charakterköpfe, sind derzeit von David bekannt. Unsere Studie einer jungen Frau mit ebenmäßigem Gesicht in antiker Kleidung gehört zu einer Gruppe von halbfigurigen Bildnissen, die David mit eigenen Worten als „Figures coupées“ beschrieben hat (Brief an Naves vom 22. März 1818). Diese Figuren tragen sämtlich Kostüme im Stil der Antike oder der Renaissance. Die auf unserem Blatt dargestellte Frau verkörpert das antike Schönheitsideal der Ebenmäßigkeit. Das fein gebildete Gesicht mit der schlanken, geraden Nase und der hohen glatten Stirn wird von dunklen Locken gesäumt, über die ein leichter Schleier fällt. Zwei Fibeln halten eine Tunika, die den Körper der Frau sanft umspielt, ohne ihn jedoch einzuengen.



6541
Erwin Blumenfeld (1897 Berlin – 1969 Rom)
Bette Davis für Vogue Späterer SilbergelatineAbzug, scharniermontiert auf Passepartout. 35,5 x 27,8 cm (50,8 x 40,8 cm). Mit Stempel “From the Estate of Erwin Blumenfeld” sowie Titel und Datierung in Bleistift auf der Rückseite. 1951.
1.200 €
Erwin Blumenfeld war einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts, bekannt für seine innovative, experimentelle Modefotografie. In den 1940er und 1950er Jahren arbeitete er für Magazine wie Vogue und Harper’s Bazaar und schuf avantgardistische, oft surreal anmutende Bilder durch meisterhaften Einsatz von Licht, Schatten und Farben. Im Mai 1951 fotografierte Blumenfeld die legendäre Schauspielerin Bette Davis für die amerikanische Vogue. Davis sitzt auf einem schlichten Stuhl, gekleidet in
6540
Salomon Savery (1594–1678, Amsterdam)
Vier stehende Frauen in barocker Kleidung. 4 (von 6) Radierungen nach Dirck Hals. Je ca. 15,6 x 10,4 cm. Hollstein 48 ff. Wz. Krüglein mit Halbmond.
Der niederländische Kupferstecher Salomon Savery zeigte in seinen Stichen häufig zeitgenössische Kleidung und Alltagsszenen. Die hier dargestellte Frau trägt ein auffälliges, voluminöses Kleid, das typische Merkmale der Mode des frühen 17. Jahrhunderts aufweist. In der linken Hand hält sie einen geschlossenen Fächer. Möglicherweise ist die Darstellung auch karikaturhaft zu interpretieren das Gesicht und die Haare wirken leicht skurril, die Haltung und Proportionen übersteigert. Solche Darstellungen waren im 17. Jahrhundert nicht unüblich, vor allem in satirischen oder moralisierenden Kupferstichen. Es könnte sich also auch um eine Kritik an modischer Eitelkeit oder gesellschaftlichen Rollenbildern handeln.
Aus der Folge „Weibliche Kostümstudien“. Prachtvolle, kräftige Drucke, leicht tonig und mit schöner Facettenschwärze entlang der Plattenkante, mit Rändchen um dieselbe. Ganz schwach angestaubt sowie sehr vereinzelt unbedeutende Fleckchen, weitere kleine Handhabungsspuren, sonst einheitlich sehr schön erhalten.



ein voluminöses, schulterfreies Abendkleid, ergänzt durch eine transparente Stola. Lange weiße Handschuhe und ein prächtiges Diamantcollier mit passenden Ohrringen unterstreichen ihre glamouröse Erscheinung. Mit leicht geneigtem Kopf und einem sanften Lächeln verkörpert sie zeitlose Eleganz. Der schlichte Hintergrund hebt ihre eindrucksvolle Präsenz hervor und unterstreicht die künstlerische Finesse der Komposition. Dieses Porträt ist ein herausragendes Beispiel für Blumenfelds Fähigkeit, die Essenz seiner Motive mit außergewöhnlicher Präzision einzufangen und zugleich den ästhetischen Geist der damaligen Modefotografie zu verkörpern.
6542
Französisch
um 1890. Entwürfe für zwei Faltfächer mit weißer Brüsseler Spitze.
2 Zeichnungen, je Gouache, Deckweiß, grauer Stift auf graubraunem Papier, teils mit Goldpapierstreifen entlang der Kanten. 31,2 x 46 cm; 29 x 47 cm. Unten rechts auf einem Klebeetikett „Melle Chamberl 18 ans“. 450 €
6543
Anna Lena Straube (geb. 1978 in Bremen)
„Lost“ (1) . Öl auf Leinwand. Ca. 230 x 200 cm. Auf der Rückseite zweimal signiert „Al Straube“, sowie betitelt und datiert. 2012.
9.000 €
Sichtbares und Verborgenes. Vergangenheit und Gegenwart. Hell und Dunkel. Schön und Schrecklich. Traum und Alptraum: Straubes Œuvre vereint Gegensätze, spielt mit Widersprüchen, stellt ambivalente Emotionen und Eindrücke einander in einem Wechselspiel gegenüber. Eine erzählerische Malweise, realistische Bildgegenstände und abstrakte Ideen vereinen sich in ihren Kompositionen, die sich, wie auch das vorliegende Gemälde, vor allem mit der malerischen Erkundung einer vieldeutigen Schönheit beschäftigen.
Auf unserem Werk schimmert der weiße, mit Perlen verzierte Seidenstoff eines viktorianischen Abendkleides geheimnisvoll vor dunklem Grund. Das überaus elegante Gewand mit kurzen Ärmeln, rundem Halsausschnitt und einer Fransenborte mit Perlschnüren über dem Decolleté wird in der Taille von einem schmalen Seiden
band fest zusammen gehalten. Darunter weitet sich der in einer Schleppe auslaufende, bodenlange Rock, der mit Volants im Saumbereich verziert ist. Das Gewand scheint geradezu im Raum zu schweben. Die Trägerin des Kleides ist, obgleich nicht sichtbar, so doch vorhanden. Das Schwarz im Halsausschnitt, das sich von dem diffusen dunklen Ton des Fonds abhebt, signalisiert, dass die Künstlerin hier etwas bewusst ausgespart hat. Der Körper der Frau erscheint als Negativform, als Leerstelle im Bild. „Lost“ ist der Titel, den die Künstlerin dem Werk verliehen hat. Er beschreibt den Verlust der Persönlichkeit hinter den gesellschaftlichen Konventionen, wobei die Mode dieselben lediglich sichtbar macht. Der enge Gürtel um die Taille hindert die freie Entfaltung, ebenso wie der lange, üppige Rock die Bewegung der Trägerin einschränkt. Der Hüftgürtel, der unter dem Gewand verborgen getragen wird, modelliert geschickt die Silhouette. Die natürliche Körperform hat sich dem Schönheitsideal der Zeit unterzuordnen und das Wesen der Frau bleibt unerkannt.
Anna Lena Straube, die an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel in der Klasse von Peter Nagel studiert hat, ist seit 2005 freischaffend tätig in Berlin; sie wird vertreten von der Galerie Bengelsträter, Düsseldorf, und der Caldwell Snyder Gallery, San Francisco.


1. Hälfte 19. Jh. Musterbuch mit Entwürfen für Stickereien.
62 Zeichnungen, Feder in Braun, über Bleistift, teils grau laviert auf feinem J. WhatmanVelin (1826). Gebunden in einem neueren HLederBand mit Orig.Einbanddeckel (berieben, Hitzespuren, angeschmutzt). 4to. Wenige Seiten mit Annotationen in engl. Sprache, die letzten beiden Seiten mit dem handschriftl. Vermerk „Pattern for Embroidered Bag“, im hinteren Innendeckel die Besitzangabe „Mrs. Williams, 5 Frederick Place Clifton“ und weiter in Bleistift „Now at 16 Arlington Villa, Victoria Park, Clifton / Bristol / now at Westbourne Villa / now at [...]“.
900 €
Die fein ausgeführten Musterzeichnungen zeigen zahlreiche, sehr dekorative, sowohl ornamentale als auch florale Bordüren, sowie komplizierte Flächen und Eckmuster. In Stafford Cliffs English Archive of Design and Decoration (London 1998) findet sich auf S. 80 die Abbildung eines Musterbuchs mit ähnlichen, aber wesentlich einfacheren Entwürfen und der Bezeichnung „Designs for lace ... taken from a sketch book now in the possession of the Victoria & Albert Museum, London. [...]. The caracteristics of the paper suggest that the book dates from between 1809 and 1820.“ (S. 63).
6545
Französisch
um 1920. Entwurf für einen Kragen aus weißer Spitze. Deckweiß und Bleistift auf dunkelgrünem Papier.
47 x 32 cm. Unten rechts signiert „L. Chambat [?]“.
300 €


6546
Dänisch
um 1800. Elegantes Paar bei der Promenade. Bleistift und Pinsel in Braun auf Velin. 19,7 x 13,5 cm.
400 €
Ein Herr im figurbetonten Gehrock, schmalen Beinkleidern, Gehstock und Zylinder führt eine zierliche Dame im Ausgehkleid, einem unter dem Kinn gebundenen Strohhut und Flanierschirm am Arm. Das Paar hat sich zu einem Spaziergang getroffen, bei dem es nicht in erster Linie um die Bewegung an der frischen Luft geht, sondern um das Flanieren unter anderen Flaneuren, um das Sehen und GesehenWerden. Deshalb wurde sehr viel Sorgfalt auf das modische Erscheinungsbild gelegt, wie man hier unschwer erkennen kann.

6547
Karl von Saar (1797–1853, Wien)
Porträt eines eleganten Herren im schwarzen Frack mit dunkelgrüner Weste und Zylinderhut.
Aquarell und Gouache über Bleistift. 18,3 x 13,2 cm. Am linken Rand signiert und datiert „v. Saar 35“.
1.500 €
Der Wiener Maler Karl von Saar studiert bereits mit vierzehn Jahren ab 1811 an der Wiener Akademie der bildenden Künste, u.a. bei Lampi d. Ä. und Caucig, wendet sich anschließend aber hauptsächlich der Porträtmalerei zu. In den AkademieAusstellungen 1822, 1835 sowie 1846 und folgende war er mit Miniaturen und Aquarellbildnissen vertreten, anfangs unter dem Einfluss Moritz Daffingers, ab etwa 1830 aber mehr unter dem Josef Kriehubers. Im Lauf der Jahre porträtierte von Saar mit seinen realistisch empfundenen und scharf herausmodellierten Arbeiten zahlreiche Schriftsteller und bildende Künstler.

6548
Weste
Biedermeier Herrenweste.
Seide mit eingewebtem floralen Muster, auf der Rückseite Leinen mit verstellbarer Schließe. Mit 8 goldfarbenen Metallknöpfen, seitliche Taschen, Jabot aus weißer Spitze. Deutsch, um 1840.
350 €
Die Weste ist ein schönes Beispiel für die Schneiderkunst und den Stil der Biedermeierzeit. Die Detailtreue und die Wahl der herbstlichen Farben spiegeln die Mode und ästhetischen Vorlieben dieser Epoche wider. Besonders bemerkenswert ist das eingearbeitete Spitzenjabot, das eine raffinierte Eleganz verleiht. Die Schnalle an der Rückseite aus Leinenstoff ermöglicht eine individuelle Anpassung der Passform, was auf den praktischen Ansatz der damaligen Mode hinweist.
6549 Herrenschmuck
Reversnadel mit Jockey. Pferd aus Silber gefasst mit 10 Diamanten im Altund 8/8 Schliff (zus. ca. 1,12 ct) und einem Rubin im Cabachonschliff (D. ca. 0,9 mm), darauf montiert der Jockey aus schwarzem und weißem Email. Nadel aus Gelbgold 9 kt. Nicht gestempelt. Länge insg. 6,2 cm; Schaustück ca. 1 x 2,4 cm. Gesamtgewicht 1,8 g. Originales Formetui des Londoner Juweliers Harley Mandel „Jeweller & Silversmith to the Queen and Princess of Wales“. England, um 1895.
1.200 €


6550 Österreichisch
um 1880. Spazierstock mit Kugelgriff „Venus, Amor und Satyr in der Landschaft“. Holz, ebonisiert, Silberzwinge 925, mit emailliertem Knauf. L. 93 cm. Monogrammiert „VS“.
2.200 €
Der Spazierstock hat eine lange Geschichte und war weit mehr als nur eine Gehhilfe. Bereits im Mittelalter diente er als Zeichen von Würde, Macht oder sozialem Status. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde er zum modischen Accessoire der Oberschicht, oft kunstvoll verziert und individuell gestaltet. Heute erlebt er als Stilobjekt und Sammlerstück eine neue Wertschätzung.

6551
Carl Jacob Lindström (1800 Linköping –1847/49 Neapel)
Zwei Dandys. Bleistift auf Velin. 17,7 x 23 cm. Unten rechts signiert „Lindström“. Um 1830.
2.400 €
Zwei Dandys sind in ihrem Bemühen, sich modisch zu kleiden, ein wenig über das Ziel hinaus geschossen. Die taillierten Gehröcke mit den überbreiten Krägen, der überdimensionierten Halsschleife sowie die großen Klunker, die die gestreifte Weste des Schönlings zieren, lösen Verwunderung aus. Vor allem aber beeindrucken die Beinkleider mit weitem Schlag des nach links gehenden jungen Herren, die aus einem extravaganten Stoff mit SkorpionMuster gefertigt sind. Der Skorpion mit seinem Stachel auf der Hose dürfte als anzügliche Anspielung auf die männliche Potenz des Trägers zu verstehen sein.

6552

Susanne Waltermann (geb. 1959 in Hannover)
Schöne große Unterhose; Kleines Hemd mit langen Ärmeln, unordentlich.
2 Blatt, je Mischtechnik auf Papier, übernäht. 29 x 20,5 cm; 29,5 x 20,9 cm. 2001.
600 €
Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk der Künstlerin).
„Hemd und Hose […] werden bei Susanne Waltermann zu Repräsentanten des Abwesenden, eines unsichtbaren Körpers, dessen Befindlichkeit dennoch leicht dechiffrierbar ist. Und gerade die verlassene, ausgebeulte Hohlform, der der Körper seine Form aufgedrückt hat, entbehrt nicht der unfreiwilligen Komik.“ (Bettina Baumgärtel, in: Ausst.Kat. Susanne Waltermann. Bilder genäht hrsg. vom Stadtmuseum Siegburg 2004, S. 1). Susanne Waltermanns genähte Bilder strahlen durch die Verwendung dicken Zwirns und deren bewusst unsauber vernähten Enden eine reizvolle Haptik aus.
6553
Henri Charles Guérard (1846–1897, Paris)
Ein Paar Stiefel. Radierung und Kaltnadel auf Bütten. 31,3 x 39,8 cm. In der Platte bewidmet „à l‘ami F Buhot“. Um 1877. 350 €
Provenienz: Aus der Sammlung Ed. Marthelot (Lugt 884). Charles Henri Guérard war Schüler von Nicolas Berthon und feierte schon zu Beginn der 1870er Jahre erste Erfolge als Maler. Sein malerisches Werk tritt jedoch hinter seinem sehr umfangreichen druckgraphischen Schaffen zurück, deren Techniken er wie kaum ein anderer meisterte. Seinem Künstlerfreund Félix Buhot widmet Guérard diese experimentell wirkende Radierung mit der Darstellung von abgetragenen Damenstiefeln. An diesen Schuhen, deren Leder die Spannkraft verloren hat, deren Laschen ausgerissen und die Spitzen nach oben gebogen sind, kann man sich unschwer vorstellen, wie die Trägerin täglich über die Boulevards von Paris schritt. Es sind nicht die Schuhe einer feinen Dame, die in einer Kutsche ihr Ziel erreicht, sondern die einer einfachen Frau, die in diesem Schuhwerk fest im Leben steht.
Prachtvoller, herrlich gratiger Druck rechts und links mit Rand, unten teils mit Rändchen, sonst wohl mit der vollen Darstellung bzw. minimal knapp. Etwas vergilbt und fleckig, kleinere Einrisse im rechten und linken Rand, sonst schönes Exemplar. Selten.
6554
Rosemarie Trockel
(1952 Schwerte, lebt in Düsseldorf)
Ohne Titel.
2 Krawatten, Ausstellungsheft „La Salle Blanche“ und Zeitung. Lose in Karton. 36,5 x 16 x 3 cm (Kartongröße). Unten rechts im Zeitungsrand mit Farbstift in Rot signiert „Rosemarie T.“ sowie gewidmet. Um 1995
350 €

Das Ausstellungsheft „Ich kann, darf und will nicht“, erschienen anlässlich der Ausstellung Trockels im Musée des BeauxArts de Nantes, 1995. Der Zeitungsausschnitt entstand aus einer Kooperation des museum in progress und der Tageszeitung „Der Standard“ und bezieht sich auf die Medienausstellung „Vital Use II“, 1994/95. Rosemarie Trockels Kunst bezieht alle Medien von Zeichnung über Malerei, Fotografie, Skulptur, Installation bis zum Film – mit ein. Ihr kritischer Blick richtet sich auf gesellschaftliche, politische Strukturen sowie auf die Natur. Mit humorvollen Anspielungen und Gegensätzen wie den Krawatten als Männlichkeitssymbol versucht sie, den starren Rollenverhältnissen entgegenzuwirken. Herausgegeben von der Edition Thomas Müller.


6555
Ernst Griebel (1877–1955 (?), deutscher Künstler)
„Der Kunde, wie er beim Schneider steht, und wie er auf der Straße geht“.
2 Zeichnungen, je Tusche und Aquarell über Bleistift auf festem Papier, auf einem Blatt verso: Vorstudie in Bleistift. Je ca. 46,8, x 35,3 cm. Je signiert und datiert „Ernst Griebel. / 1910“.
350 €

6556
Thomas Tegg (Verleger, 1776–1845, Wimbledon/London)
„A Flint“ Figur eines Schneiders kompiliert aus Gegenständen seines Handwerks. Umrissradierung mit zeitgenössischem Kolorit. 34,4 x 23,7 cm. 1811.
900 €
Provenienz: Aus der Sammlung William Augustus Fraser, London (Lugt 2380).
Die äußerst amüsante, in der Art Arcimboldos konzipierte Figur zeigt einen Schneider, dessen Körper aus Gegenständen des Schneiderhandwerks zusammengesetzt ist: Die Arme bestehen aus Karten von Stoffmustern, die Hände aus Nadelkissen, während der Leib mit Knopfmustern besetzt ist. Der Kopf ist als großer Kohlkopf geformt, wobei „Cabbage“ ein Begriff ist, der die beim Schneider verbleibenden Stoffreste und Verschnitt bezeichnet. Prachtvoller Druck mit Rändchen. Kleiner Einriss im unteren Rand und Ausbesserung im rechten weißen Rand, geringfügig fleckig und angestaubt. Selten
6557
Ferdinand Andri (1871 Waidhofen an der Ybbs – 1956 Wien)
Nähzeug Behältnis in Gestalt eines Mannes mit rotem Hut, Halsschleife und dunkelgrünem Gewand. Gedrechselte, hohle Holzfigur (Kegelfigur) mit abschraubbaren Kopf, innen mit zwei Spulen Nähgarn in Weiß und Schwarz und einem Fingerhut aus Metall, farbig staffiert. Höhe ca. 9 cm. Entwurf um 1910. Ausführung Waidhofener Spielzeugindustrie.
600 €

6557

6558
Fritz Köthe (1916–2005, Berlin)
Tanz der Sicherheitsnadeln mit den Reissverschlüssen (Surreale Komposition).
Feder in Schwarz auf bräunlichem Velin. 25,2 x 30,5 cm. Unten links in schwarzer Feder monogrammiert „K“ und datiert. 1948.
400 €
Provenienz: Privatsammlung Berlin. Vom Surrealismus beeinflusst zeigt sich die differenzierte, frühe Federzeichnung Köthes, die mit feinsten Schraffuren und skurrilem Humor ein Ballett aus Nähutensilien in einer weiten Ebene entstehen lässt. Verso Fragment einer weiteren Komposition, Sternenhimmel mit Kirchturm.

6559
6560
Nikola Mašić (1852 Otočac – 1902 Zagreb)
Die Hose.
Feder in Schwarz und Bleistift, auf chamoisfarbenem Velin, verso: architektonische Skizzen zu einer gotischen Kirche. 19,8 x 10,6 cm. Rechts signiert und datiert „Masic 24/4 [18]76“, sowie in Bleistift bez. „Ein Jahr hat er‘s getragen, Trägt‘s nicht länger / mehr“ (aus Friedrich Schillers Ballade: Ritter Toggenburg).
1.200 €
Gebrauch erweckt die Dinge zum Leben. Auch dieses Kleidungsstück spricht dafür. Nur ein Stück Stoff an der Tür? Keineswegs. Mit schwarzer Feder hat der Zeichner virtuos eine offensichtlich grob gewebte Hose in authentischem Schatten und Faltenwurf auf einem schmalen Stück Papier festgehalten. Untailliert, gerade geschnitten ist dieses Beinkleid, alles andere als elegant zu nennen, mit rundgesäumten „paspelierten“ Vordertaschen, von denen nur eine zu sehen ist. Ebenfalls sichtbar: zwei Hosenträgerknöpfe. So hängt die Hose auch an einem kurzen Stück des Hosenträgers schlaff am Nagel einer Tür, die für das hier Gezeigte so unwichtig
6559
Osmar Schindler (1867 Burkhardtsdorf – 1927 DresdenWachwitz)
Studienblatt mit abgelegter Jacke. Bleistift auf Velin. 20,5 x 17,5 cm.
500 €
Osmar Schindler, der seine Ausbildung an der Dresdener Akademie bei Ferdinand Pauwels und Leon Pohle erhalten hat, zeigt auf diesem Skizzenblatt eine Jacke aus zwei verschiedenen Perspektiven. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Schindlers Jacke, die der Künstler hier als Artefakt zu einer künstlerischen Fingerübung verwendet.
ist, dass sie nur als Bleistiftskizze aufscheint. Klinke und Kastenschloss legen es nahe, dass wir uns in einem Bauernhaus befinden. Die Wahrheit dieser Hose: Sie hat wohl ausgedient als ausgebeulte, oft getragene Arbeitshose zu dieser Stunde, aber sie bleibt stets greifbar dort, wo es ins Freie, nach draußen ans Tagwerk geht. Ein Zitat, das die Zeichnung begleitet, lässt vermuten, dass es mit der Hose eine weitere Bewandtnis haben könnte: „Ein Jahr hat er’s getragen, Trägt’s nicht länger mehr“ ist da zu lesen, zwei Zeilen aus Schillers Ballade Ritter Toggenburg. Dort allerdings ist vom Herzensgram die Rede, der dem Ritter unerträglich geworden ist. Kann man erahnen, was für ein Kleidungsstück Nicola Mašić hier porträtiert hat? Eine Hose, die ihn lange treu begleitet hat, die ihm durch den Gebrauch buchstäblich ans Herz gewachsen ist, die Teil seines Alltags, die ihm gar zur zweiten Haut geworden ist und die nun an einer Tür, an der Schwelle zur Nutzlosigkeit ihr Ende findet? Vielleicht, denn stets sind die Dinge mehr als ihr Schein.
Mašić erhielt seine Ausbildung bei Lindenschmidt in München und Bougereau in Paris, war Direktor der Kunstakademie in Zagreb und ab 1894 Direktor der Strossmayer Galerie, der europäischen Sammlung Alter Meister in der heutigen Hauptstadt Kroatiens.

6561

Spitzenfächer
Abendfächer aus weißer Spitze. Faltfächer mit Stäben aus Perlmutt mit einem Blatt aus Brüsseler Spitze, die Stäbe „à la semisultane“ angeordnet. Länge Deckstab ca. 28 cm, Breite ca. 52 cm (geöffnet). In der originalen Schachtel des Herstellers „The Crown Perfumery Company* 17 New Bond St W“. Englisch, um 1877. 450 €
Die Crown Perfumery Company war auf Luxusartikel spezialisiert. Die exklusive Kundschaft, die wohl zumeist in königlichen Palästen, in Landhäusern und außergewöhnlichen Cottages lebte, bezog von dort die Parfums, Salze, Seifen, Taschen und diverse Accessoires. Das Unternehmen hatte weltweit einen phänomenalen Erfolg. Ende des 19. Jahrhunderts war die Crown Perfumery Company eine wichtige Kraft in der Parfümindustrie. Ihre exzellenten Produkte wurden auf Weltausstellungen von der Fachwelt gelobt. Auf der originalen Schachtel sind bereits zwei Medaillen abgedruckt: Wien 1873 und Philadelphia 1876, so dass der Fächer nach 1876 datieren muss.
6562
Adolph von Menzel (1815 Breslau – 1905 Berlin)
Studienblatt mit einer Hand, die einen Fächer hält, sowie weiteren Detailstudien zu Figuren und Pinselproben.
Bleistift und Aquarell auf leichtem Karton, verso: weitere zahlreiche Pinselproben in Aquarell. 17 x 13 cm.
20.000 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (mit dem rotbraunen Monogrammstempel Lugt 4600 am oberen Rand).
Aus dem Nachlass Emilie Menzel Krigar (18231923, Berlin), der Schwester des Künstlers.
Vier Einzelstudien vereint Menzel auf diesem grandiosen Skizzenblatt, dessen Reiz sich nicht nur durch die geschickte Anordnung der Studien, deren sogenannte mise en page, sondern vor allem durch die farbigen Pinselproben am Unterrand ergibt. Ganz offensichtlich hat Menzel gleichzeitig an einem Aquarell gearbeitet und zur Kontrolle, ob der richtige Farbton getroffen wurde, den Pinsel auf unserem, nun fast zur Makulatur degradierten Blatt abgestrichen. Dieses Verfahren scheint oft geübte Praxis bei Menzel gewesen zu sein, denn auch auf einem Studienblatt mit der „Germania“ (Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt) oder dem mit dem „tanzenden Maler“ (Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu

Berlin) gibt es exzessive Pinselproben, wobei auch dort die Farbproben um die Studien herum angeordnet sind und so einen ästhetischen Reiz entwickeln.
Als besonders markantes Detail fällt bei der Betrachtung des Studienblattes sofort der geöffnete Fächer auf, der locker in einer Hand liegt. Menzel, der unnachahmliche Beobachter des gesellschaftlichen Lebens Berlins, integrierte dieses so typische Accessoire der Damenmode wiederholt in seinen Ball oder Gesellschaftsbildern. Oft war der Künstler zu Hofe geladen und besuchte auch
bis in seine letzten Jahre die großen Hofbälle, auf denen man sein Beobachten und Skizzieren duldete, auch wenn er dazu mitunter auf einen Tisch kletterte. Über viele Jahre hin entstanden „Ballstudien“, die Menzel im Atelier gesondert in einer roten Tasche im schwarzen Spind aufbewahrte. Die Synthese aus all seinen Beobachtungen kulminierte im großartigen „Ballsouper“ (Alte Nationalgalerie, Berlin) von 1878, in dessen inhaltlichem Zentrum zwei einander begrüßende Damen mit Fächern stehen. Möglicherweise ist auch unsere Zeichnung im Kontext der Ballstudien entstanden.
6563
Flanierschirm
Eleganter Flanierschirm.
Griff aus geschnitztem Holz, die Stange aus Bambus, die Griffstange verziert mit einer schwarzen Schleife aus Moiréeseide, die äußere Bespannung aus schwarzer, in Falten gelegter Seide und Spitze, an den Rändern eine breite Spitzenbordüre, die Innenbespannung ebenfalls aus Seide (kleiner Riss an einer Strebe).
Durchmesser (aufgespannt) 80 cm; Länge Stab 98 cm. In der originalen Schachtel (mit Gebrauchsspuren). Deutsch, um 1905/10.
250 €


6564
Frederik Hendrik Kaemmerer (1839 Den Haag – 1902 Paris)
Spaziergang im Park: Junge Pariserin im weißen Seidenkleid mit ihrem Hündchen. Öl auf Leinwand. 40 x 25,5 cm. Unten rechts signiert „FH Kaemmerer“, verso auf dem Keilrahmen ein altes Etikett handschriftl. bez. „[...] Paris / Tableau [...] / J. H. Kaemmerer / [...] vente [...] 1927 [?] [...]“.
2.400 €

6565
Deutsch
um 1910. Lederne Schnürstiefeletten.
Bleistift auf Velin, verso Bleistiftstudie eines Rebhuhns (?). 27,8 x 36,7 cm. Unten rechts undeutlich signiert „C Beltz“ (?). 1.800 €
Sanft umschmeichelt das Stiefelleder die Füße seiner Trägerin. Die geschnürten Stiefeletten waren um die Jahrhundertwende das Gebot der Stunde, betonten sie doch die zierliche Form des weiblichen Fußes. Nachdem die bodenlangen Kleider zum Ende des Jahrhunderts ausgedient hatten und die Rocklängen kürzer wurden und so einen Blick auf das Schuhwerk gewährten, gerieten die Schuhe der Damen zunehmend ins Visier der Modeindustrie. In dieser Zeit begann man auch erst, zwischen rechtem und linkem Schuh zu unterscheiden und die Schuhe für die verschieden geformten Füße anzupassen. Ab 1905 entstand sogar eine Bewegung, die für Füße mehr Freiheit forderte. Schuhe sollten den Fuß nicht einengen, sondern bequem sein und ein angenehmes Laufen ermöglichen. Allerdings leisteten sich modische Schuhe nur die vermögenden Damen, die ärmeren Frauen waren froh, überhaupt zwei Paar Schuhe zu besitzen. Unsere Stiefeletten mit flachem Absatz
und bereits nach oben gebogenen Sohlen sind ganz offensichtlich viel getragen worden. Sie sind das Statement einer Epoche, in der sich der Bewegungsradius und mithin die Unabhängigkeit der Frauen nicht zuletzt durch geeignetes Schuhwerk maßgeblich verändert hat.
6566
Ferdinand Roybet (1840 Uzès – 1920 Paris)
Portrait der Malerin Juana Romani im schwarzen Cape und Federhut.
Feder und Pinsel in Schwarz auf festem Velin. 26,3 x 14 cm. Oben links signiert „F. Roybet“. Um 1891.
1.200 €
Provenienz: Sammlung Christian Humann, Paris/New York. Galerie ArnoldiLivie, München (1982).
Süddeutsche Privatsammlung.

Die aus Velletri bei Rom gebürtige Juana Romani (18691923) kam bereits in jungen Jahren nach Paris. Schon bald verkehrte sie in Künstlerkreisen der SeineMetropole, da sie einzelnen Malern und Bildhauern Modell stand. Der Bildhauer Alexandre Falguière etwa wählte ihren Kopf als Vorbild für eine Büste der Diana (heute im Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Stanford), Victor Prouvé porträtierte sie als Judith (Privatsammlung). Juana Romani entschloss sich, selber Malerin zu werden und wurde Schülerin von Émile Auguste CarolusDuran, JeanJacques Henner und Ferdinand Roybet, deren Einfluss sich deutlich in ihrem Werk wider
spiegelt. Von 1888 bis 1904 stellt sie erfolgreich im Salon der Société des Artistes Français aus, später litt sie an einer psychischen Erkrankung und verbrachte die letzten Lebensjahre in einer Nervenheilanstalt. Ihr Lehrer Ferdinand Roybet fertigte einige Portraits seiner charismatischen Schülerin. Unsere ausdrucksvolle Zeichnung der mondän gekleideten Malerin steht in enger Verbindung zu einem Gemälde Roybets aus dem Jahr 1891, das Juana Romani selbstbewusst stehend mit schwarzem Cape und Federhut zeigt und das Roybet seiner Schülerin gewidmet hat (s. zuletzt Bonhams, Los Angeles, Auktion am 16. November 2021, Los 318).

6567
6567
Hans Leiter
(tätig in den 1920er Jahren)
Die neuen Schuhe – Zwei Damen im Boudoir. Pinsel in Grau, Schwarz und Weiß, Graphit und Spritztechnik auf dünnem chamoisfarbenem Malkarton. 38,8 x 30,8 cm. Am Unterrand signiert und datiert „H Leiter [19]22“, verso gestempelt „4057“ und „5. Sept. 1922“ sowie in Bleistift bez. „Boshaft“.
350 €
Entwurf für eine Illustration in den Fliegenden Blättern, Heft Nr. 4057 vom 4. Mai 1923, S. 143, dort betitelt: „Boshaft“ und mit der Bildunterschrift: „Da will ich meine Schuhe putzen und kann nicht mit der Hand hinein! Was ich doch für kleine Füße habe“ – „Nein, Eva, so große Hände“.

6568 Spitzencape
Schwarzes Spitzencape. Schwarze Seide mit ChantillySpitze, mit Perlen bestickt. 41 cm (Kragenweite), ca. 40 cm (Länge). Frankreich, 19. Jh.
180 €
6569

Heinrich Zille (1858 Radeburg bei Dresden – 1929 Berlin)
„Willi kiek mal die, mit die Pioto Handschuhe“. Kohle und Bleistift auf feinem, faserigem Japan. 34,5 x 30 cm. Unten mittig rechts mit Bleistift signiert „H. Zille“ und datiert „1924“, links mit Kohle betitelt.
2.400 €
Provenienz: Privatsammlung, Wiesbaden.
Die Realitäten des Berliner Straßenlebens in den Zwanziger Jahren prallen aufeinander: Pelzkragen hier, Schiebermütze dort, Luxus auf der einen, Armut auf der anderen Seite. Das typische Personal einer Zille‘schen Straßenszene ist versammelt: Der Eckensteher und sein Mädchen, die elegante Dame mit Hündchen, der Schuhputzer und die füllige Mutter mit Kind. Im Zentrum steht das Motiv der Luxusaccessoires, der Name Pioto nicht nur in Zilles Text, sondern auch ganz zart gezeichnet über der Komposition. Realistisch und liebevoll schildert Zille das Berliner Alltagsleben, erfasst Details lediglich summarisch und zeichnet die Gestalten lebendig und pointiert in kräftigen, energischen Kohlestrichen.

6570
6570
My Ullmann (eigent. Maria Anna Amalie, gen. Marianne, 1905 Wien – 1995 Konstanz)
„Frau K. mit ihren Töchtern“. Feder in Braun auf strukturiertem Velin. 27 x 21,5 cm. Rechts unten monogrammiert und datiert „3.5.[19]25“, sowie links unten mit Bleistift betitelt. 1.200 €
Literatur: Barbara Stark und Lilli Hollein (Hrsg.): My Ullmann –Bilder, Bühne, Kunst am Bau, Ausst.Kat. MAK Wien und Städtische WesenbergGalerie Konstanz, Petersberg 2023, S. 10 (mit ganzseitiger Abb.).
My Ullmann ging bereits im Alter von nur 16 Jahren zum Studium an die Wiener Kunstgewerbeschule, um unter Carl Witzmann und Franz Cizek zu lernen. Besonders die kinetistischen Schöpfungen Cizeks hatten großen Einfluss auf ihre eigene künstlerische Entwicklung. Im Jahre 1924 beteiligte sich Ullmann an der letzen Ausstellung der CizekKlasse mit einem konstruktivistischem Fries für einen Theaterbau. Ihr Interesse am Theater wurde vermutlich weiter durch die von Friedrich Kiesler organisierte Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik bestärkt, die in diesem Jahr in Wien stattfand. Kurz darauf beteiligt sie sich mit der CizekKlasse an der Exposition internationale des arts décoratifs et Industriels modernes in Paris, wird aber wegen ihrer „aufmüpfigen Art“ vom weiteren Studium an der Kunstgewerbeschule ausgeschlossen und macht sich als freischaffende Künstlerin selbständig (vgl. Stark/ Hollein S. 14).
6571
Wiener Werkstätte
Acht Modefotographien: Helena Dragojevic in Gewändern nach Entwürfen von Eduard Josef WimmerWisgrill.
Sieben Vintage SilbergelatineAbzüge. Je ca. 21 x 12,5 21,7 x 15 cm. Je montiert auf schwarzem Karton, sieben davon unten mit dem goldgeprägten Logo der Wiener Werkstätte, teils auf dem Karton, ein Foto unten rechts von der Dargestellten signiert und datiert „Hela Dragojevic 12/XII 1913.“, teils auf der Rückseite des Fotos wohl in der Hand von Hans AnkwiczKleehoven bez. „Entwurf E. J. Wimmer“ und mit der Jahreszahl „1913“. Unbekannter Fotograf, um 1913.
750 €


Provenienz: Aus der Sammlung Hans AnkwiczKleehoven (1886–1962).
Die Fotografien zeigen Kleider und einen Mantel nach Entwürfen von Eduard Josef WimmerWisgrill, der 1907 die Modeabteilung der Wiener Werkstätte gegründet hatte und die er von 1910 bis 1922 leitete. Das Modell, welches die Gewänder präsentiert, ist Helene Dragojevic, die ebenfalls an der Wiener Werkstätte mitwirkte. Beigegeben ein Pressespiegel zur „Kleiderschau der Wiener Werkstaette, Berlin, 12.14. März 1913“.

6572
Seidenschuhe
Elegante Abendschuhe.
Schwarze Seide und Wildleder mit Stickerei aus Edelstahlperlen auf dem Rist, jeder Schuh verziert mit einem ovalen Medaillon mit dem Dekor „Blätter“ entworfen von Josef Hoffmann, Messing und weißes Email. Maße Medaillons je ca. 2,9 x 3,2 cm. Ausführung: Johann Souval für die Wiener Werkstätte, verso gestempelt: WW. Wien, um 1911. (werden verkauft ohne Schuhspanner).
1.800 €
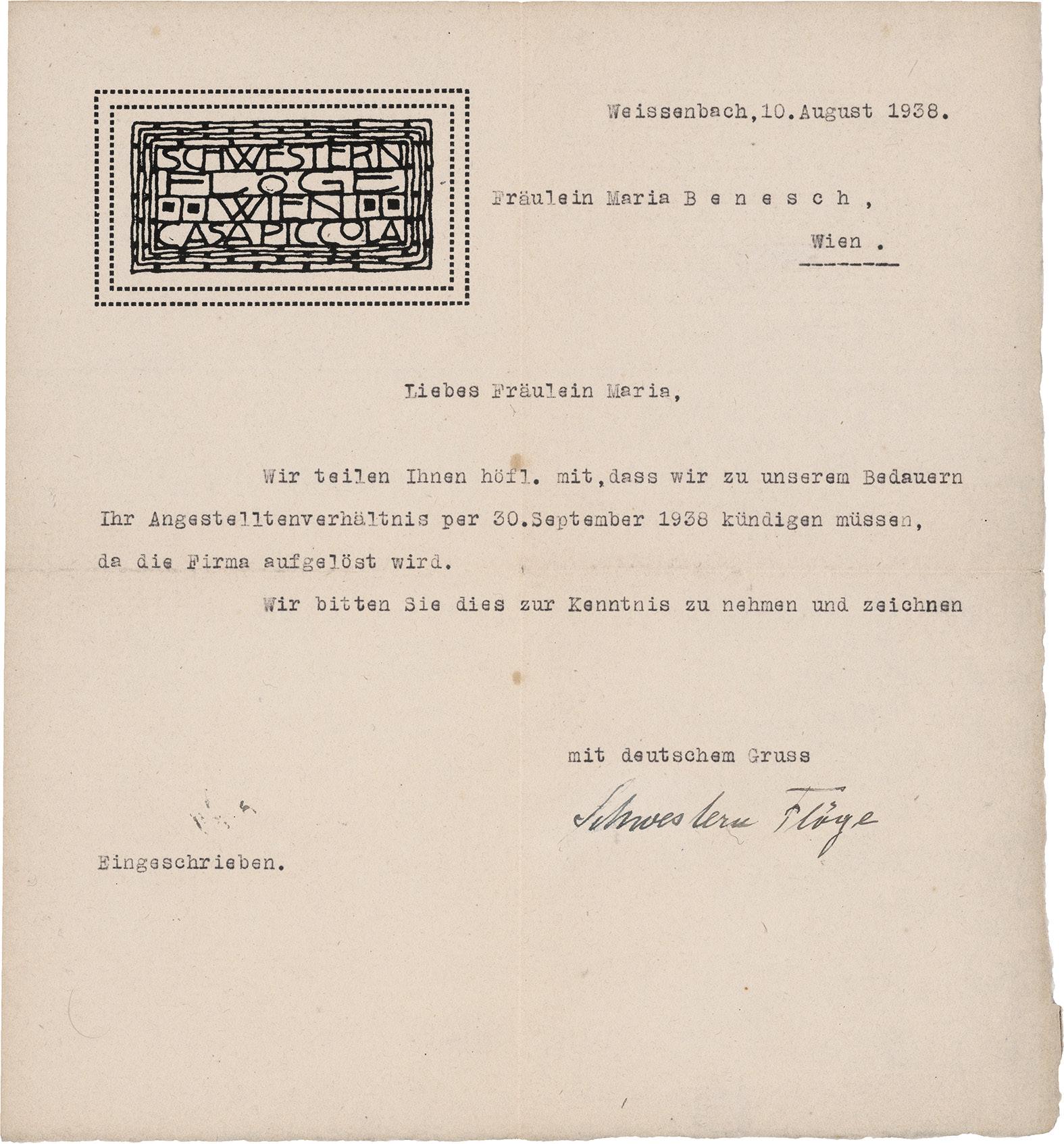

6573
Modesalon Schwestern Flöge
Maschinenschriftliches Kündigungsschreiben an eine Angestellte mit Unterschrift „Schwestern Flöge“. 1/2 Seite. Mit dem von Gustav Klimt entwickelten Briefkopf „Schwestern Flöge Wien Casapiccola“. 22,5 x 20,8 cm. Weissenbach, 10. August 1938.
600 €
Der Modesalon der Schwestern Emilie, Pauline und Helene Flöge eröffnete am 1. Juli 1904 in der Mariahilfer Straße in Wien. Die Schließung des legendären Modesalons gute drei Jahrzehnte später im Jahr 1938 hatte indirekt mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten zu tun, da Flöge ihre bisherige Kundschaft, die überwiegend jüdischer Herkunft war, verlor. Aus diesem konkreten Anlaß erfolgte auch die Kündigung der Anstellung des Fräulein Maria Benesch in Wien: „...Wir teilen Ihnen höfl. mit, das wir zu unserem Bedauern Ihr Angestelltenverhältnis per 30. September 1938 kündigen müssen, da die Firma aufgelöst wird.“.
6574
Modesalon Schwestern Flöge
Werbeschild für den Modesalon „Schwestern Flöge Wien Casapiccola“.
Golddruck auf fester, brauner Platte in Lederoptik. 23 x 32,5 cm. 20. Jh.
800 €
6575
Alice Wanke (1873–1939, Wien)
Schmuckentwürfe für Anhänger und Broschen im Stil der Wiener Werkstätte. 6 Zeichnungen in schwarzer Feder, Bleistift, Aquarell, ein Blatt mit Deckweißhöhungen auf Transparentpapier. 6 x 5 cm 31 x 21 cm. 2 Blatt signiert in brauner Feder bzw. Bleistift. Um 1910.
350 €
Alice Wanke, die ihre Ausbildung in der Kunstgewerbeschule Wien u.a. bei Josef Hoffmann erhielt, betätigte sich vor allem als Graphikerin, entwickelte Plakate, Inserate, Signets, Vignetten und Buchillustrationen. Schmuckentwürfe sind von ihr sehr selten. Ein Entwurf für eine Halskette, die sich stilistisch an Joseph Hoffmann orientiert, befindet sich in der Grafischen Sammlung Stern.


6576
6576
Eugen Pflaumer (geb. 1876)
Anhänger.
Rechteckig, durchbrochen. 2 x 4 cm. Silber, mit stilisiertem Floraldekor, gefasst mit vier Schmucksteinen. Gest. Meistermarke EP. Feingehaltspunze „900“. Um 1910.
1.800 €
Ausstellung: Sparkasse Bozen, Lux magica. Gold und Silber in der Kunst, November 2024 Januar 2025, Abb. S. 64.
Eugen Pflaumer gehörte zu den ersten Gold und Silberschmieden, die von der Wiener Werkstätte angestellt wurden. Von 1903 bis 1906 war er erster Leiter der Goldschmiedewerkstatt der damals neu gegründeten Institution, deren Mitglied er für einige Jahre war. Er führte Schmuckentwürfe für Josef Hoffmann und Objektentwürfe für Koloman Moser aus (z. B. Prunkkassette, MAK, Wien).
6577
Eugen Pflaumer
Zwei Entwürfe für filigrane Anhänger aus Silber, teils aus Gold mit Halbedelsteinen. Schwarze Feder, farbige Stifte, Aquarell über Bleistift auf kariertem Papier. Je ca. 15,9 x 10,9 cm. Je monogrammiert und datiert „1909“ bzw. „1910“, 350 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Privatbesitz Wien.


Eugen Pflaumer
Entwurf für eine Silberbrosche mit Schmucksteinen im Stil der Wiener Werkstätte. Weiße und graue Feder über Graphit, Aquarell oder Deckfarbe auf rotbraunem Karton. 15 x 11,3 cm. Um 1905/1910.
350 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Privatbesitz Wien.


Bestickte Etuitasche im Bauhausstil. Rupfen mit mehrfarbigem, geometrischem Muster in Seidenstickerei in Grün, Blau, Beige und Rosa, innen mit blauem Seidenfutter, mit Reißverschluss. 13 x 22,5 cm. Deutsch, um 192830.
240 €
Provenienz: Ehemals aus dem Besitz der am Bauhaus tätigen Künstlerin Marianne Brandt. Privatsammlung Hessen.

6580
Franziska Ofenschiessl (tätig um 1922/23 in Wien)
Entwürfe für Stoffe und Taschen. 12 Zeichnungen, Gouache, Aquarell, schwarzer Stift, Bleistift, von der Künstlerin auf 5 Papierbögen zur Präsentation montiert. 4,5 x 6 cm – 20 x 20 cm. Teils mit eigenh. Bezeichnungen. 1922–23.
800 €
Die Gruppe der teils streng geometrischen, teils abstrakt floralen Entwürfe im Stil der Wiener Werkstätte stammen von der bisher nicht dokumentierten Designerin Franziska Ofenschiessl.


6581 Handtasche
Avantgardistische Handtasche mit geometrischer Gestaltung.
Holzplatten und stäbe, schwarz und cremefarben lackiert, mit schwarzem Textilfutter und cremefarbenem Innentäschchen aus Leder, Kunststoffverschluss, mit silberner Metallkette. 12,5 x 18 x 4 cm (geschlossen). Deutsch, 1920er Jahre.
200 €

6582
Modezeitschrift
Wiener Mode. Nr. 2/1930, Sondernummer: Wiener Werkstätte.
14 Bl. Mit zahlreichen, teils farbigen, teils ganzseitigen Abbildungen. 31 x 23,5 cm. Farbig illustr. Originalbroschur (Entwurf: M. Flögl) mit Klammerheftung (Ränder etwas gebräunt und mit geringfügigen Knickspuren; Vorderumschlag mit kleiner Läsur).
Wien, RobVerlag, 1930.
300 €
Einzelheft der vierteljährlich erschienenen Wiener ModeZeitschrift, hier die Ausgabe des zweiten Quartals 1930, eine Sondernummer zum Kunsthandwerk der Wiener Werkstätte. Mit einem programmatischen Beitrag von Grethe Müller („Mode und Werkstätte“), Aufsätzen zum österreichischen Kunstgewerbe, zur Produktion der Wiener Werkstätte, über Stoffe und Kissen, Spitzen und Schals, einem Abdruck der Rede von Edwin Redslob, anlässlich der Eröffnung des Berliner Hauses der Wiener Werkstätte und mehreren kurzen Artikeln über „Die Dame und ihre vier Wände“, die „Welt
geltung der Wiener Werkstätte“ u. a. Die Abbildungen zeigen in ihrer Eleganz einzigartige Modeentwürfe von Max Snischek (Mantelkleid, Pyjama, gestricktes Wollkleid, Hüte aus Filz, Mantel aus englischem Stoff, Blusenkleid, Teagown, großes Abendkleid u. a., vgl. unsere Losnr. 6636), jeweils mit genauer Bezeichnung der Farbwahl, des zu verwendenden Materials, des Charakters und der beabsichtigten Wirkung („mondän und festlich“, „Sie sind sich wohl auch des Reizes bewußt, den diese Abwechslung bringt“). Außerdem stellt die Ausgabe Tapeten vor, etwa die „SalubraWandbekleidung“ (in Farbe), sowie Keramiken, Accessoires (einen „eleganten Perlbeutel für den Abend“), Vasen, zwei Service, Tischgeschirr und Gläser von Josef Hoffmann. Die grafische Gestaltung enthält progressive Elemente, so sind beispielsweise die Abbildungen umlaufend betitelt und kommentiert. Der Umschlagentwurf der in vielen Bereichen der Wiener Werkstätte tätigen Mathilde Flögl (18931958) ist der beste Beweis für die zeitlose Präsenz der großen gestalterischen Wiener Reformbewegung. – Dabei: Einzelblatt aus einem Modemagazin (32 x 24,5 cm) von 1924 mit großer farbiger Abbildung („Neue Gesellschaftskleider aus dem Modehaus der Wiener Werkstätte“), verso mehrere KinofilmAnzeigen und Inserate.

6583
My Ullmann (1905 Wien – 1995 Konstanz)
Kostümentwurf „Kragen“ für die Faschingsredoute Die bunte Laterne Bleistift und Aquarell auf Transparentpapier. 29,4 x 20,8 cm. Mit Bleistift signiert, bezeichnet und datiert „Hoffmeister / Kragen / [19]33“.
1.500 €
Literatur: Barbara Stark und Lilli Hollein (Hrsg.): My Ullmann –Bilder, Bühne, Kunst am Bau, Ausst.Kat. MAK Wien und Städtische WesenbergGalerie Konstanz, Petersberg 2023, S. 80 (mit Abb.).
My Ullmann gilt als eine der Begründerinnen des Wiener Kinetismus, der avantgardistischen Sonderform des Konstruktivismus, angesiedelt zwischen Kubismus und Futurismus. Nach Stationen in Wien und in der Werkstatt von Otto HaasHeye in Zürich ging sie 1932 nach Berlin. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten in rezessionsgeschüttelten Stadt Fuß zu fassen, erhielt sie Ende des Jahres den prestigeträchtigen Auftrag, für das große Faschingsfest des Verbandes deutschen Kunstgewerbes im Marmorsaal am Zoo, die Kostüme zu entwerfen. Das Motto der Veranstaltung am 10. Februar 1933 lautete „Modeparadies“, was Ullmann motivierte ihrer Fantasie bei der Gestaltung der Stücke künstlerisch völlig freien Lauf zu lassen. Nur etwa zwanzig dieser Entwürfe haben sich bis heute erhalten, bei denen Ullmann auch die modischen Entwicklungen ihrer Zeit miteinbezieht, wie die ikonische Marlenehose.
6584 My Ullmann
Kostümentwurf „Mode“ für die Faschingsredoute
Die bunte Laterne
Bleistift und Aquarell auf Transparentpapier. 29,6 x 20,8 cm. Mit Bleistift signiert, in der Darstellung bezeichnet „Berlino / Mode / 3087“ und datiert „[19]33“.
1.500 €
Literatur: Barbara Stark und Lilli Hollein (Hrsg.): My Ullmann –Bilder, Bühne, Kunst am Bau, Ausst.Kat. MAK Wien und Städtische WesenbergGalerie Konstanz, Petersberg 2023, S. 81 (mit Abb.).

6585

6585 My Ullmann
Kostümentwurf „Modistin“ für die Faschingsredoute
Die bunte Laterne.
Aquarell über Bleistift auf Transparentpapier. 29,6 x 20,8 cm. Unten rechts signiert „MY [19]33“.
1.500 €
6586
Schmuckschatulle
Große Schmuckschatulle im ägyptischen Stil. Rechteckige, nach oben hin konisch zulaufende Form, auf gedrungenen Kugelfüßen, Klappdeckel mit Messinggriff, auf der Vorderseite Schlüsselschild (Schlüssel fehlend). Die Außenseiten üppig mit Perlen, Strasssteinen, Gemmenabformungen, Reliefs mit Sphinxen, Horusfalken, Skarabäen u.a. in Glas, Metall und Kunststoff besetzt, das Innenfach mit rotem Stoff ausgeschlagen. 30 x 27 x 18 cm. Französisch oder Deutsch, um 1880.
600 €

6587
William Alexander (tätig wohl in Großbritannien, 1. Hälfte 19. Jh.)
Picturesque representations of the dress and manners of the Chinese. 2 Bl. und 50 kolorierte Kupfertafeln, jeweils mit dazugehörigem Erläuterungsblatt. 34 x 27,5 cm. Etwas späterer Halblederband (berieben, mit Schabspuren, VDeckel lose) mit RVergoldung und goldgeprägtem RSchild. London, John Murray, 1814.
600 €
Zweite Auflage des zuerst 1805 ebenda mit noch 48 Kupfern erschienenen Kostümwerks, das auch Berufsdarstellungen zeigt.




6588*
Karl Gröning (1897–1980, Hamburg)
Kostümentwurf: Indische Königin auf ihrem Thron mit Elefanten.
Aquarell auf Velin. 31,2 x 31 cm. Auf dem Untersatzkarton signiert und datiert „Groening [19]26“.
450 €
Karl Gröning studierte an der Hamburger Kunstgewerbeschule bei Carl Otto Czeschka, dessen Meisterschüler er war. Ab 1917 war er in Berlin und Belgrad tätig, bis er 1924 nach Hamburg zurückkehrte und als Bühnenbildner, Regisseur und Plakatmaler reüssierte. Dieses frühe Aquarell spiegelt in seiner kristallinen Formensprache deutlich den Einfluss Czeschkas, nimmt aber auch bereits die Formensprache des Art déco vorweg. Möglicherweise ein Entwurf zu einem Stück von Rabindranath Tagore.
6589
Schnupftabakgläser
Sammlung von vielfarbigen Schnupftabakgläsern. Ca. 30 Glasflakons. Verschiedene Größen. Wohl Bayern, zumeist 20. Jahrhundert.
300 €
Schnupftabakgläser sind besonders im bayerischen Wald und Böhmerwald verbreitet. Erste Hinweise auf ihre Herstellung reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. In diesen Regionen waren Begriffe wie „Tobackhpixl“ oder „Tabakbüchsel“ üblich, die gläserne Behälter für Tabak bezeichneten. Der Ausdruck „Büchsel“ hat sich bis heute erhalten (Heiner Schaefer: Neues vom Tabakglas, Regen 2012, S. 7). Im 18. Jahrhundert ging die Produktion kriegsbedingt zurück, doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahmen die Gläser wieder an Bedeutung zu. Besonders in Bayern war es damals alltäglich, ein eigenes Schnupftabakglas mitzunehmen, da Schnupftabak sehr populär war.
Um 1900 gab es in Zwiesel sieben Schnupftabakfabriken. Die Gläser, in denen der Tabak aufbewahrt wurde, waren vielfach verziert und unterschiedlich aufwendig gefertigt. Ab den 1960er Jahren erlebten die Schnupftabakgläser als Sammelobjekte eine neue Blüte. Die Vielfalt an Formen und Designs weckt das Interesse vieler Sammler.
Hier vorliegend eine beeindruckende Sammlung diverser Schnupftabakgläser in unterschiedlichen Herstellungsverfahren und Farben, darunter vermutlich auch einige ältere aus dem späten 19. Jahrhundert, teils mit Verschlüssen und Gravur.
Beigegeben zahlreiche gedruckte bzw. hs. Beigaben zum Thema wie Kleinschriften, Prospekte, Reklame, Rechnungen, Kopien von Aufsätzen und Illustrationen, private Korrespondenz, handschriftliche Notizen und kleinere Texte, Werbeartikel etc., darunter auch einige Bücher wie Schranka, Tabakanekdoten; Tabago, Ein Bilderbuch vom Tabak; Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft; Schaefer, Brasilflaschl und Tabakbüchsl.






6590
Georges Lepape (1887 Paris – 1971 Bonneval)
Les choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape. 4 Bl., und 12 Orig.Farblithographien (davon 2 gefalt.), diese gouachiert, teils goldgehöht. 33,5 x 30 cm. Illustr. OKart. (fleckig, Rücken teils zerschlissen). Auflage 700 Ex. Paris 1911. Wz. Van Gelder Zonen mit Fortuna; Dactyle Super Japan.
3.000 €
Das Album ist in einer Auflage von 700 Exemplaren „sur papier de luxe“ erschienen, darüber hinaus wurden 300 weitere nummerierte Exemplare publiziert. Das Werk stammt aus der frühen Schaffenszeit des Pariser Modeschöpfers Paul Poiret, einer Schlüsselfigur des Art déco. 1910 beauftragte Poiret den Pariser Künstler Georges Lepape mit der Illustration seines zweiten Modealbums Les Choses de Paul Poiret, der Fortsetzung des erfolgreichen Les Robes de Paul Poiret. Lepapes expressive, farbintensive Kompositionen etablierten ihn sofort als gefragten Modeillustrator. Seine Arbeiten prägten die visuelle Sprache des Art déco und erschienen in den führenden Pariser Modezeitschriften. Stéphane Jacques Addade beschreibt die Veröffentlichung dieses Albums als „la naissance d’une esthétique nouvelle – celle de l’Art déco – constitua un événement considérable tant elle eut d’influence dans les années qui suivirent“ (StephaneJacques Addade: „Paul Poiret. En publiant l‘époque“ in: Portfolios modernes Art déco, hrsg. Lamond/Addade, 2014, S. 2731).


Seidencarré (Halstuch).
Seide mit einem mehrfarbigen, geometrischen Muster in verschiedenen Rosatönen, Rot, Grün, Gelbgrün, Gelb und Orange. Ca. 90 x 90 cm. Mit dem originalen Herstellerlabel „Emilio Pucci Florence – Italy“. Italien, wohl um 195565 (vgl. Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, New York, Object no. 1985.375.30).
150 €
6592
Italienisch
17. Jh. Kostümstudie: Osmanischer Mufti. Aquarell und Gouache über Kohle auf Bütten, auf einem alten Sammlerkarton montiert. 24 x 18,6 cm. Unten links bezeichnet „Mufti“. Wz. FleurdeLis im Doppelkreis mit angehängtem Buchstaben V (Fragment, vgl. Heawood Nr. 1591).
4.000 €
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich europaweit ein bemerkenswertes Interesse an Trachten, das sowohl historische als auch zeitgenössische sowie traditionelle Modelle umfasste. Diese Neugier manifestierte sich in einer zunehmend systematischen Publikationstätigkeit von Verlegern, die Bildbände mit detaillierten Kostümillustrationen aus aller Welt herausbrachten. Die Darstellung von Trachten diente hierbei nicht der Porträtierung individueller Figuren, sondern vor allem der geographischen und kulturellen Verortung. So entstand eine visuelle Topographie, die das europäische Wissen über „andere“ Kulturen über das Medium der Kleidung vermittelbar machte. Unser anonymer Zeichner führt diese Tradition mit bemerkenswerter technischer Sicherheit und frischen, leuchtenden Farben fort.


6593
6593
Italienisch
17. Jh. Kostümstudie: Osmanischer Krieger. Aquarell und Gouache über Kohle auf Bütten, auf einem alten Sammlerkarton montiert. 24 x 18,8 cm.
3.500 €


6594 6594

6594
Reynaldo Luza y Argaluza (1893–1973, Lima)
und Léon Bénigni (1892 Paris – 1948). Entwürfe für elegante Mode für die Manufaktur KBC (Koechlin, Baumgartner & Cie.).
2 Pochoirs mit Gouache über Lithographie auf Velin. Je ca. 36,2 x 27 cm. Links oben monogrammiert und rechts unten mit Bleistift datiert bzw. links oben bezeichnet oder signiert und datiert. 1928.
750 €
Wohl entstanden im Rahmen der Veröffentlichung eines Werbealbums zur Firmengeschichte des einflussreichen deutschfranzösischen Textilherstellers der HauteCouture KBC im Jahre 1928. Der aus Lima in Peru stammende Reynaldo Luza y Argaluza studierte zunächst in Löwen bevor er als Illustrator zuerst in Peru und anschließend für Harper‘s Bazar in New York arbeitete, wo er 1921 zum ChefModeillustrator ernannt wurde. Ab 1922 arbeitete er für Harper‘s Bazar in Paris mit den führenden Modedesignern und Künstlern seiner Zeit, darunter Paul Poiret, Coco Chanel, Salvador Dalí, Max Ernst und Man Ray. Léon Bénigni war einer der gefragtesten Werbegraphiker seiner Zeit und war unter anderem ebenfalls für Harper‘s Bazar tätig. Mit seinen Entwürfen für Damenmode gilt er als einer der Schöpfer des modernen Modestils.
6595
Martha Romme
(tätig im späten 19. und frühen 20. Jh.)
Au dîner dansant à Shérazad.
Pochoir. 32,8 x 26 cm. Unten links in Bleistift nummeriert „1147“. (1919).
450 €
Aus der Zeitschrift Feuillets d‘Art von 1919.

6596
Ulrike Hamm (geb. 1962 in Bad Segeberg)
Brosche aus Pergament. Weißes Kalbspergament, eingefärbt in Türkis, Rostrot und Gelb. Edelstahl. Ca. 9,5 x 9,5 cm. Werkstatt
Anmut Kühnheit (Ulrike Hamm), Berlin. 2011.
600 €
Mit ihren Kreationen aus echtem Pergament hat sich Ulrike Hamm eine Nische in der zeitgenössischen Schmuckkunst geschaffen. Seit über zwanzig Jahren widmet sich die Goldschmiedin diesem eigensinnigen, lebhaften Werkstoff, der ebenso zart wie robust, störrisch wie geheimnisvoll ist und voller Überraschungen steckt. Aus Kalbshäuten, die sie nach strengen Kriterien und intensiver Sichtung beim Hersteller auswählt, entwickelt Hamm federleichte, farbintensive Schmuckstücke von feiner Poesie. In ihrer Werkstatt erforscht sie kontinuierlich die Möglichkeiten des Materials: Sie färbt, spannt, druckt, testet Grenzbereiche mit Hitze, Kälte oder Säure und erschafft so aus zweidimensionalen Flächen plastische Formen. Die Arbeit mit echtem Pergament ist ein Dialog zwischen künstlerischer Einflussnahme und der natürlichen Dynamik eines Materials, das sich nicht zwingen lässt. Die fertigen Schmuckstücke wirken fragil und sind doch unempfindlich und beständig. Sie erinnern an florale Strukturen, archaische Ornamente oder filigrane Netzwerke. Bei aller Leichtigkeit und Eleganz ist es ein Schmuck, der bewusst getragen werden will.
Ulrike Hamms Pergamentarbeiten wurden vielfach ausgestellt und ausgezeichnet, u. a. mit dem Hessischen Staatspreis und dem Preis der Zeughausmesse Berlin. Sie versteht ihr Schaffen als eine fortwährende Spurensuche – nach Strukturen, Prinzipien, Ordnungen, nach dem Wechselspiel von Festhalten und Loslassen. Genau darin liegt die stille Kraft ihrer Werke: in der Verbindung von Anmut und Kühnheit, von handwerklicher Meisterschaft und einer tief empfundenen Nähe zur Natur des Materials.
6597
Ulrike Hamm
Armschmuck aus Pergament.
Weißes Kalbspergament, eingefärbt in Türkis, Burgunderrot, Pistaziengrün und Goldocker. H. ca. 6,5 cm, Innendurchmesser ca. 6,5 cm. Werkstatt Anmut –Kühnheit (Ulrike Hamm), Berlin. 2024.
500 €

6598
Kimono-Musterbuch
Blockbuch mit 30 Entwürfen. Farbholzschnitte, teils mit Silberhöhung und Reliefprägung. 31 Doppelblätter. 25 x 17,5 cm. Japan (Tokio) 1901.
300 €
KimonoBeispiele in der qualitativen Wiedergabe und Tradition der Ukiyoe Farbholzschnitte mit floralen und geometrischen Mustern, Tier und Pflanzendarstellungen, gedruckt in leuchtenden Farben, teils mit schimmernder Silberhöhung und feinstem Reliefdruck. Beigegeben ein weiteres Musterbuch mit 25 teils farbigen Beispielen. Kyoto 1897.


6599
6599
Emil Orlik (1870 Prag – 1932 Berlin)
Ein Schneider (Japanischer Schneider).
Farbradierung mit Roulette auf Velin. 20,3 x 19,7 cm (Plattenkante); 24 x 24 cm (Blattgröße). Signiert „Emil Orlik“, datiert und bezeichnet „Probedruck“. 1902. VossAndreae R 106.
900 €
Erschienen als Blatt 15 der Mappe „Aus Japan“. Brillanter, differenzierter und wunderbar gratiger Probedruck mit dem vollen Rand. Selten
6600
Japanisches Stoffmusterbuch
Musterbuch mit Proben japanischer Stoffe. 45 Blatt mit über 100 applizierten Stoffmustern auf Japanbütten und zahlreichen handschriftlichen Eintragungen in Kanjis. 28,5 x 21 cm. Pappband d. Z. (dieser mit Oberflächenabrieb und bestoßen, der Rückdeckel mit Kanjischriftzug); als Blockbuch gebunden. Wohl Japan frühes 20. Jahrhundert.
900 €
Ein umfangreiches und privat zusammengestelltes Musterbuch mit einer vielfältigen Auswahl textiler Proben mit traditionellen japanischen Dekoren und Ornamenten. Es umfasst Leinen und viele Seidenstoffe und bietet einen Überblick über die Web und Textiltechniken der späten Edo und frühen MeijiZeit.
6601
Japanische Stoffe
Drei Entwürfe für Stoffe. 3 Farbholzschnitte, zwei davon mit Silberdruck. Je ca. 24 x 16,5 cm. Japanisch, Meiji Periode (18681912).
240 €

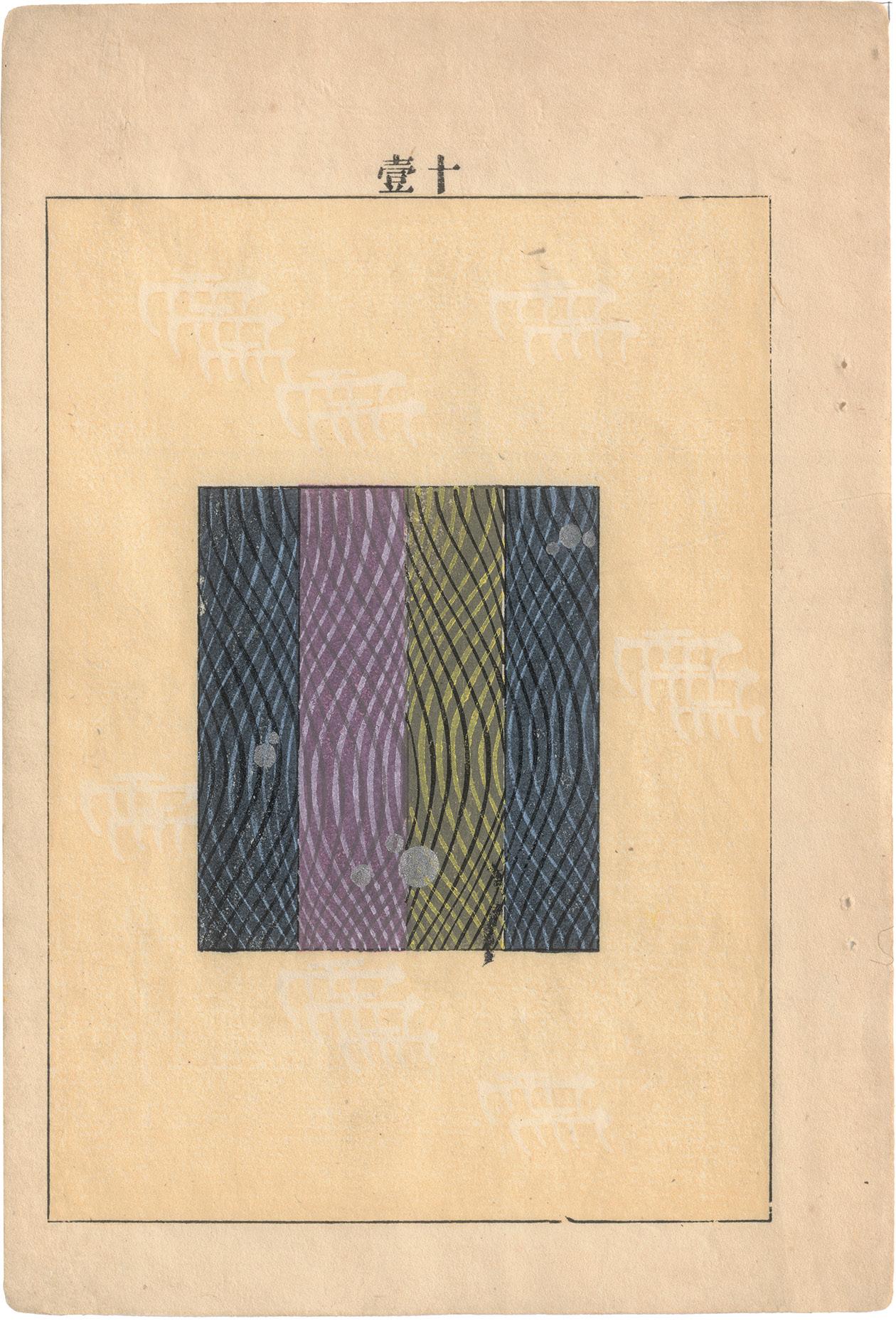


6602
Utagawa Kunisada (Toyokuni III, 1786 Honjo, Edo – 1865 Edo)
Narumi: Frau beim Arimatsu Shibori Färben. Farbholzschnitt aus der Serie:Tôkaidô gojûsan tsui (Dreiundfünfzig Paarungen für den TôkaidôWeg). Format Ôban tatee (36 x 24,5 cm). Unterschrift: Ôju Kôchôrô Toyokuni ga. Herausgeber: Iseya Ichibei. Siegel des Zensors und Datumssiegel: Mura, um 1845–46.
500 €
6603
Utagawa Kunisada
Kaki no Asago: Frau, die ein äußeres Gewand anlegt Farbholzschnitt aus der Serie: Ukiyo jinsei tengankyô (Typen der schwebenden Welt, gesehen durch das Glas eines Physiognomikers). Format Ôban tatee (37,2 x 25,4 cm). Unterschrift: Gototei Kunisada ga. Herausgeber: Moriya Jihei. Zensorensiegel und Datumssiegel: kiwame, um 1830 (Tenpô 2).
1.200 €

6604

Nguyen van Trung (vietnamesischer Künstler, frühes 20. Jh.)
Sandalen und Pantoletten. Aquarell über Bleistift auf Velin. 32,2 x 24,8 cm. Unten rechts in roter Feder signiert „Frung / 4“, verso in Bleistift bez. „Chaussure amamite sabots = (cai guoc)“.
1.200 €
Provenienz: Sammlung des JulesGustave Besson, Paris. Während der französischen Kolonialzeit schufen die Studenten an der Hochschule für angewandte Kunst Gia Dinh unweit von Saigon unter der Leitung des Direktors JulesGustave Besson zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle mit vietnamesischen Gegenständen, die als Illustrationen zu einer Monographie zur Alltagskunst Vietnams dienen sollten. Die einfachen, aber formschönen Sandalen und Pantoffeln geben ein beredtes Zeugnis von der Stilsicherheit der südostasiatischen Schuhmacher. In dem feuchtheißen Tropenklima im südlichen Vietnam ist luftiges Schuhwerk, das schnell trocknete, essentiell.


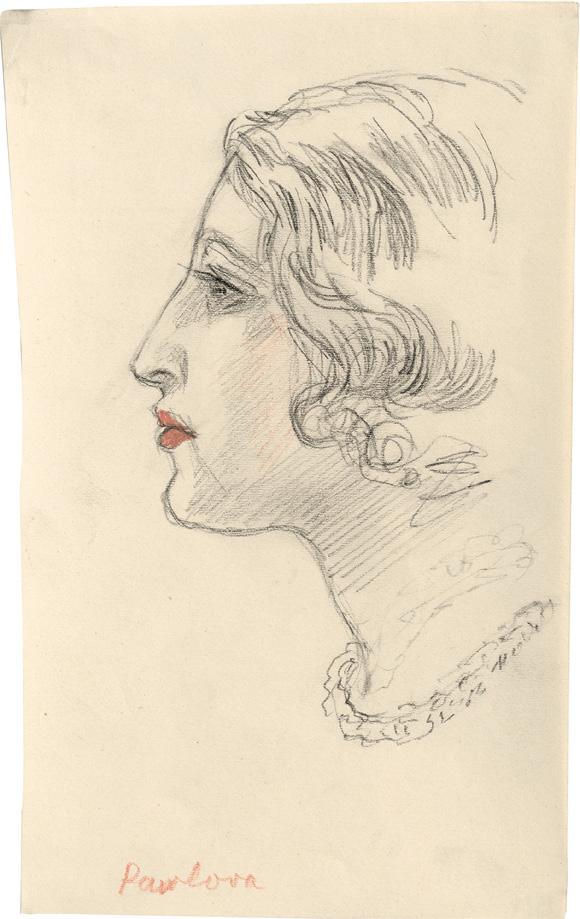
6605
Emil Orlik (1870 Prag – 1932 Berlin)
Bildnis der Tänzerin Anna Pawlowa im Profil nach links; Bildnis einer Frau mit Bubikopf. 2 Zeichnungen, je schwarzer und roter Stift auf Velin. Je ca. 20,5 x 12,3 cm. Am Unterrand in Rot bez. „Pawlowa“.
500 €
6606
Emil Orlik
Dame en face, mit Hut und schwarzem Schleier. Schwarze und rote Kreide auf Velin. 20 x 12,9 cm. Unten rechts mit Nummer „12“ in Bleistift. Um 1920.
450 €

6607
Kopfschmuck
Stirnband mit StrassSteinen.
Karamellfarbene Seide mit Besatz aus gefassten Steinen, das Innere des Bandes mit Tüll gefüttert. Amerikanisch, um 1920.
350 €
Es ist möglich, hinter das Band eine weiße oder andersfarbige Feder zu stecken, die das Outfit dann komplettierte.


6608*
Haarmode
„Hausarbeiten des Friseurlehrlings Erika Hübner zur Gehilfenprüfung am 13. Dezember 1932“.
1 Bl. mit handschriftl. Titel und Datierung, 132 S., davon 117 handschriftl. bezeichnet, mit zahlreichen, teils farbigen Zeichnungen, einmontierten Fotografien, Haar und Stoffmustern sowie Farbpapieren. 20,7 x 16,3 cm. Flexibler oranger Orig.Leineneinband. (Berlin?) 1932.
240 €
Das charmante und liebevoll gestaltete Büchlein einer angehenden Friseurin gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Handwerks der „HaarKunst“ kurz vor Ende der Weimarer Republik. Ganz in diese Zeit versetzt uns gleich zu Beginn der kurze historische Exkurs zu der Entwicklung der Haarmoden über die Jahrhunderte, der mit der Erfindung der Dauer und Wasserwelle endet. Weiterhin in Wort und Bild beschrieben sind berufseigene Arbeitsweisen, die Fabrikation von Perücken, Werbung und Schaufenstergestaltung, aber auch wichtige Aspekte der Hand und Fußpflege, Massage und Schminke.

6609
Emil Betzler (1892 Kamen – 1974 Frankfurt a. M.)
Straßenszene (Vor dem Friseurgeschäft). Kaltnadel auf Velin. 23,8 x 31,6 cm (Plattenkante); 30 x 41 cm (Blattgröße). Signiert „EBetzler“ (ligiert). 1920.
350 €
Auf einem Motorrad der Mark Fafnir fährt ein mondänes Paar an der breiten Schaufensterfront eines Friseurs vorbei. Ausgestellt sind Mannequins die die neuen, im Trend liegenden Kurzhaarfrisuren bewerben. Vor allem der Bubikopf erlebte in dieser Zeit seinen kometenhaften Aufstieg als Haarschnitt für die moderne, emanzipierte Frau. Prachtvoller, gratiger und in den Schwärzen samtiger Druck mit Rand, unten mit dem Schöpfrand. Im alten Passepartoutausschnitt leicht gedunkelt, insgesamt etwas angestaubt und unfrisch, vereinzelt leicht fleckig, dezente Knickfalten, verso in den oberen Ecken Montierungsrestchen, sonst schönes Exemplar.
6610
Glockenhut

Goldlamé & StrassSteine Flapper Cloche. Entlang des vorderen Randes mit Strasssteinbesatz ebenso an den zwei kleinen geformte Blumen (Schnecken) an den Ohren. Um 1924
900 €
In den 1920er Jahren etablierte sich die Mode, „Haarersatz“ in Form von Glockenhüten zu tragen. Diese Cloche imitiert solche Haare.
Elegantes Flapperkleid. Überkleid aus Netztüll, bestickt mit goldenen und silber schimmernden Pailleten, dazu Goldfäden und kleine Glasstifte, Unterkleid aus weißer Seide. Länge ca. 106 cm, Brustumfang ca. 88 cm. Französisch, 1920er Jahre.
1.600 €


6612 Stiefel
Zierliche Knöpfstiefel.
Cognacfarbenes Leder, innen Verschluss mittels Schnürung (originale Schnüre vorhanden), außen Verschluss mittels 12 Knöpfen. Innen das Label „Victor Gomes & P. Pedroso: 106 R. Augusta 108 / 47 R. S. Nicolau 49 * Lisboa“. Mit der originalen Schuhschachtel (lädiert, geklebt). Portugal, um 1906. 450 €

6613
Rudolf Schlichter (1890 Calw – 1955 München)
Modell mit Knickerbocker und Knöpfstiefeln. Bleistift auf Skizzenblockpapier, verso weitere Bleistiftskizzen des Künstlers. 27 x 19,8 cm. 1920er Jahre. 4.000 €
Provenienz: Kunsthandel Florian Sundheimer, München 2020. Auf feinen, schmalen Knöpfstiefeln an den verhältnismäßig kleinen Füßen steht das Modell – es ist wohl Speedy, die Frau des Künstlers. Während Knickerbocker und Jacke angedeutet bleiben,
sind die Schuhe, Schlichters bevorzugtes Fetischobjekt, in ihrem Glanz und mit Reihen kleiner Knöpfchen höchst detailliert und liebevoll ausgearbeitet. Rudolf Schlichter, Vertreter der Neuen Sachlichkeit, „neigte zum Masochismus und war ein Fetischist, den u.a. Knöpfstiefel inspirierten, wie eine Reihe von kleinen Skizzen in der Stuttgarter Sammlung zeigt (Inv. Nr. C 2020/58125817). Seit 1927, und mit der Heirat 1929, war Elfriede Elisabeth Koehler, genannt Speedy, eine ‚Lebedame aus Genf‘, seine unentbehrliche Muse und Domina“ (Staatsgalerie Stuttgart, staatsgalerie.de, Zugriff 28.01.2025). In seinem Roman „Zwischenwelt“ beschreibt der Künstler 1931, wie er voll Verlegenheit mit eigenen Skizzen in den Schuhsalon ging, um dort für Speedy Stiefel nach seinen Entwürfen anfertigen zu lassen (Rudolf Schlichter: Zwischenwelt. Ein Intermezzo, Berlin 1994, S. 64f.).

6614
Glockenhut
Filigrane Cloche. Silberfarbenes Metallnetz, besetzt mit Strasssteinen, im Stirnbereich ein Dreieck aus StrassSteinen, zwei kleine geformte Blumen (Schnecken) an den Ohren. Amerikanisch, um 1920 (Charleston Ära).
600 €
6615
Pierre Imans (tätig ca. 1896–1940)
Schaufensterfiguren. Fotografiert von Draeger Frères Imprimeurs (tätig 1886–1980). 2 SilbergelatineAbzüge, jeweils 21,7 x 15,7 cm und 22,7 x 16,8 cm. Mit Prägestempel „Draeger Frères“ sowie „Pierre Imans, Cires et Mannequins Artistiques, 10 rue de Crussol, Paris“ in der unteren linken Ecke, zudem Nummerierung im Negativ am oberen Bildrand. 1920er Jahre.
1.200 €
Pierre Imans war ein angesehener Pariser Hersteller von Wachsmannequins, der für seine außergewöhnlich realistischen Figuren bekannt war. Seine Kreationen, gefertigt mit echtem Haar, Glasaugen und fein ausgearbeiteten Gesichtszügen, setzten neue Maßstäbe in der Präsentation von Mode und Luxusartikeln. Seine Mannequins fanden nicht nur in den Schaufenstern der führenden Modehäuser Verwendung, sondern wurden auch für Modefotografie und künstlerische Inszenierungen geschätzt. Seine Werke, oft als lebensechte Meisterwerke gefeiert, wurden weltweit exportiert und beeinflussten maßgeblich die Ästhetik der frühen Schaufensterdekoration.
6616
Accessoire
Minaudière.
Kleine scharnierte Klappbox aus ziseliertem Silber in zylindrischer Form, innen goldfarben bzw. partiell vergoldet. Die zwei Innenfächer getrennt durch Klappspiegel. Mit schwarzer Zierquaste und schwarzer Trageschnur an „925“Silberösen. 8 x 3,4 cm (Gehäuse), Gesamtlänge 45 cm. Gewicht 92 gr. Stärker beriebene Punzen: Modellnr., Werkstattmarke „LK“, Feingehalt 900 (?). Mit graviertem BesitzerMonogramm „AB“. Louis Kuppenheim, Pforzheim, um 1920.
200 €
Die Minaudière als geniale Mischung zwischen Kosmetikköfferchen und Abendtäschchen enthält für die Dame unerlässliche Dinge wie Spiegel, Lippenstift, Puder oder andere Schätze in Miniaturformat. Bei unserer sehr kleinen Minaudière mutiert das Objekt zum Schmuckstück, das um den Hals getragen oder am Handgelenk mit sich geführt werden kann.




6617
Jean Aumond (tätig 1919–1965)
Mistinguett als Päonie mit grünem Blätterhut. Gouache mit Gold und Silberfarbe über Bleistift auf Papier. 31 x 24,5 cm. Unten rechts signiert und datiert „Jean Aumond 1920“.
1.200 €
Provenienz: Sammlung Jacques Crépineau (19322017).
Mistinguett ist der Künstlername der französischen Sängerin und Schauspielerin Jeanne Florentine Bourgeois (18751956). Ihre Karriere begann sie als Blumenverkäuferin in einem Restaurant in ihrer Heimatstadt EnghienlesBains. Das fulminante Debut hatte sie 1895 im Casino de Paris. Danach trat sie in Revuen der Folies Bergère, des Moulin Rouge und des Eldorado auf. Ihre gewagten Nummern und ihre extravaganten Kostüme bezauberten die Pariser. Sie war die populärste und weltweit höchstbezahlte Unterhaltungskünstlerin ihrer Zeit. 6617
6618
Hennequin-Rêveur
Studio d‘Arts Décoratifs (4e série: Motifs Inédits Pour Toutes Industries d‘Art).
1 IndexBlatt und 12 Blätter. 39,5 x 28,5 cm. Lose Blätter in OHalbleinenmappe (diese berieben und bestoßen) mit montiertem Deckelschild. Paris, Armand Guerinet, 1928.
400 €
Die Mappe versammelt zwölf Tafeln mit ArtdécoMotiven, die für Stoffe, Textilien, Tapeten und andere dekorative Gestaltungen entworfen wurden. Die Entwürfe zeigen eine stiltypische Mischung aus geometrischen Formen, ornamentalen Elementen, floralen und abstrakten Mustern, meist in überaus kräftigen Farben.


6619
Patrick Demarchelier
(1943 Le Havre – 2022 New York)
Shalom, Paris.
SilbergelatineAbzug. 34 x 46 cm (40,4 x 50 cm). Auf Karton aufgezogen, vom Fotografen mit Tinte signiert sowie mit Fotografenstempel, darin betitelt und datiert und mit Editionsstempel (12 von 20 nummeriert) verso auf Unterlagekarton. 1995.
3.500 €
Provenienz: Camera Work Gallery, Berlin.
Geboren in Le Havre, Frankreich, interessierte sich Patrick Demarchelier bereits im Alter von 17 Jahren für Fotografie. Mit 20 Jahren zog er nach Paris, wo seine Arbeit ihn in Fotolabors mit Modemagazinen in Kontakt brachte. Anschließend avancierte er zu einem der bekanntesten Modefotografen der Welt. 1975 zog er nach New York, was auch seinen internationalen Durchbruch brachte. Seit den späten 1970er Jahren haben angesehene Modemagazine wie Elle, Glamour, GQ, Mademoiselle, Vogue und Rolling Stone seine Arbeiten veröffentlicht. Er war auch der erste nichtbritische Fotograf, der ein Mitglied der britischen Königsfamilie porträtierte, als er 1998 begann, von Prinzessin Diana eine Fotoserie zu machen.

6620
Irving Penn (1917 Plainfield, N.J. – 2009 New York)
Twelve of the Most Photographed Models of the Period.
SilbergelatineAbzug. 50,5 x 61,3 cm. Rückseitig in Bleistift signiert und nummeriert „14/20“. 1947.
3.000 €
Dieses berühmte Porträt von Irving Penn, aufgenommen 1947 für Vogue, zählt zu den Ikonen der Modefotografie des 20. Jahrhunderts. Die Komposition vereint zwölf der meistfotografierten Models ihrer Zeit, darunter Penns spätere Ehefrau Lisa Fonssagrives, Dorian Leigh und Muriel Maxwell. Penns minimalistischer, doch akribisch konstruierter Ansatz zeigt sich in der präzisen Anordnung der Models, deren Haltungen und Gesten sorgfältig inszeniert sind. Jede von ihnen strahlt eine eigene Persönlichkeit aus – einige
würdevoll und erhaben, andere nachdenklich – doch als Gruppe bilden sie eine harmonische Einheit. Diese Balance zwischen individueller Präsenz und kollektiver Komposition zeugt von Penns meisterhaftem Gespür für Bildgestaltung. Die gezeigten Outfits reichen von Abendroben bis hin zu maßgeschneiderten Ensembles und unterstreichen die zeitlose Eleganz der Mode der 1940er Jahre Der reduzierte Studiohintergrund, frei von Ablenkungen, ist typisch für Penn seine Fähigkeit, Form, Textur und Bewegung auf das Wesentliche zu reduzieren, hebt ihn von seinen Zeitgenossen ab. Durch sanft gerichtetes Licht modelliert er die Figuren und verleiht ihnen eine beinahe skulpturale Anmut, die an klassische Porträts erinnert. Obwohl das Bild ursprünglich für eine Modestrecke entstand, geht es weit über die kommerzielle Modefotografie hinaus. Penn stilisiert seine Models zu Ikonen – mehr als bloße Trägerinnen von Mode. Das Porträt fängt einen entscheidenden Moment in der Modegeschichte ein, als Models zu Musen wurden und Penns präzise, durchdachte Bildsprache die Modefotografie als ernstzunehmende Kunstform etablierte.

6621
Strohhut
Eleganter Damenstrohhut (Canottier).
Stroh, mit breiter Krempe und schwarzem Seidenband. Höhe Hutkrone ca 7,5 cm, Kopfumfang ca. 51 cm, Durchmesser ca. 4045 cm. Innen goldfarbiger Aufdruck: „By Royal Warrants to Her Majesty THE QUEEN and The Royal Family * Robert Heath * 37 & 39 Knightsbridge, S.W.“. Englisch, um 1899. 500 €
Der Hut entstammt dem renommierten Hutsalon von Robert Heath in Knightsbridge, dessen Kopfbedeckungen auch von Queen Victoria getragen wurden. Bei dem sehr gut erhaltenen Strohhut handelt es sich um eine klassische Kopfbedeckung für ein Ausgeh oder Straßenkleid.


6622
Raoul Dufy
(1877 Le Havre – 1953 Forcalquier)
Panorama Robes pour l‘Été 1920.
Gazette du Bon Ton. Artmodes & frivolités. Herausgegeben von Lucien Vogel. Jahrgang III, Heft IV. Mit 8 pochoirkolorierten Tafeln und Raoul Dufys doppelblattgroßem „Panorama Robes pour l‘été“. 25 x 19 cm. OBroschur (im oberen Rand mit kleinen Fehlstellen). Paris, Lucien Vogel, (1920).
1.200 €
6623
Raoul Dufy
Composition noire et blanche. Tusche und Gouache auf schwarz beschichtetem Glanzpapier. 62,5 x 50 cm. Unten links sowie verso mit dem Stempel „RD / BIANCHINI FERIER“. Wohl um 1912.
500 €
Provenienz: MirabaudMercier, Paris, Auktion am 14. Dezember 2021, Los 102.
Sammlung Henning Lohner, Berlin.
Dufy schuf nicht nur Gemälde, sondern illustrierte auch über 50 literarische Werke, fertigte Keramikstücke an, Entwürfe für Theaterdesign, Innenarchitektur, Wandteppiche, Wandgemälde und gestaltete rund 5000 Textildesigns.

Modeentwurf: Kleid mit großen Volants. Feder in Braun, Aquarell, Deckweiß und Bleistift auf Catel & FarcyVelin. 32,3 x 25 cm. Im rechten Rand mit Bleistiftannotationen. Um 1919.
3.500 €
Große Volants, das kleine Schultercape und der elegante Schwung des ausladenden Hutes evozieren Anklänge an spanische Kostüme. Der Entwurf entstand für ein Kleid von Paul Poiret, mit dem Dufy lange zusammenarbeitete und der zahlreiche Künstler an sich band.
6625
Joachim Rágóczy (1895 Bonn – 1975 Berlin)
„Sommerkleider“.
Aquarell und Feder in Schwarz auf Bütten. 26,4 x 22,1 cm. Unten mittig in schwarzer Feder signiert „RÁGÓCZY“. Um 1925.
400 €
Elegant, in sommerlichen Pastelltönen posieren drei Damen in Sommermode mit weiten Kleidern und Accessoires wie Sonnenschirm und hut. Joachim Rágóczy studierte seit 1915 bei Emil Orlik und war bis 1932 sein Assistent und Privatsekretär. In den 1920er und 1930er Jahren verbrachte er jährlich die Sommermonate an der Nord und Ostseeküste von Dänemark bis Ostpreußen, wo vermutlich unsere charmante kleine Zeichnung entstand.


6626
6626
Raoul Dufy (1877 Le Havre – 1953 Forcalquier)
Parterre de Roses. Tusche, Gouache und Bleistift auf Velinkarton. 64,5 x 58,5 cm. Unten links mit dem Stempel „RD / BIANCHINI FERIER“, unten rechts mit Bleistift mit Farbanweisungen. Wohl um 1912.
500 €
Provenienz: MarcArthur Cohn, Cannes, Auktion am 9. August 2009, Los 970.
Artcurial, Paris, Auktion am 15. Oktober 2019, Los 130. Sammlung Henning Lohner, Berlin.
Im Jahr 1912 begann Dufy, Stoffmuster für die renommierte Lyoner Seiden und Textilmanufaktur BianchiniFérier zu entwerfen und arbeitete bis 1928 mit dem Hersteller zusammen. Elegant stilisierte Rosenblüten in Schwarz stehen mit großen Abständen auf dem hellen Grund, ergänzt um eine farbig gestaltete Blume auf Schwarz. Mit Bleistift angebrachte Markierungen verdeutlichen die Rhythmik des Rapports.

6627
Erté
(eigentlich Romain de Tirtoff, 1892 St. Petersburg – 1990 Paris)
„BAGATELLE“: Kostümstudie für ein mit Rosenblüten besetztes Kleid.
Gouache über schwarzem Stift auf chamoisfarbenem Papier. 30 x 21,5 cm. In schwarzem Stift signiert „Erté“, am linken Rand mit eigenh. (?) Maßangaben, verso bezeichnet und nummeriert „Bagatelle, N 10 815“ sowie „Dolcy et Ursula Bru. “.
900 €
Provenienz: Hôtel Drouot, Paris, Cabarets et Music-halls, Maquettes de costumes par Erté, Auktion im April 1995, Los 132.
6628
Gret Kalous-Scheffer (1892–1975, Wien)
Vier Modeentwürfe für die Dame: Abendrobe mit langen grünen Handschuhen, Rosaweiß gestreiftes Kostüm, Dirndl, Tageshut mit kleiner Schleife. 4 Zeichnungen, je schwarzer Stift und Aquarell auf Velin. Je ca. 29,8 x 21 cm. Sämtlich monogrammiert. Um 1920–30.
450 €
Gret KalousScheffer war eine bedeutende Modeschöpferin und zeichnerin, die auch eine Modeschule in Wien gründete. Ihr Markenzeichen war die durchdachte Gestaltung des gesamten äußeren Erscheinungsbildes, das Bekleidung, Frisur, Schmuck und Stil auf harmonische Weise miteinander verband. Ihr Ziel war es, ein Gesamtkunstwerk der äußeren Erscheinung nach einer einheitlichen Linie für den durchkomponierten Alltag zu schaffen. Aus diesem Grund richtete sie als eine der ersten Modeschöpferinnen Wiens ihren Fokus vor allem auf Freizeit und Sportbekleidung. In ihrer Methodik brach sie traditionelle Lehrmethoden auf, als sie begann ausschließlich in Gruppen zu unterrichten, die sie nach den Spezialbegabungen ihrer Schüler bildete, wie beispielsweise Haargestaltung, Konfektionszeichnen, Entwurf von Schuhmodellen, Komposition von Ausflugskostümen, Dirndln, Theater und Revueroben.

6629

6628
6629
Mid-Century Modedesign
Originalentwürfe für elegante Damenmode. 50 Zeichnungen, Gouache und Bleistift auf Makulaturpapier, wenige Blätter auf einen blauen Untersatz montiert, lose Blatt. Je ca. 30 x 21 cm. 1940er/50er Jahre.
1.200 €
Die Entwürfe zeigen Blusen, Röcke, Jacken, Mäntel, Tageskleider, Abendkleider und Kostüme. Die Entwürfe wurden größenteils auf Makulaturpapier angefertigt, rückseitig das GeschäftsBriefpapiers der Spandauer Firma ‚AutobusReisen‘, teilweise mit Werbeanschreiben aus der Zeit vor 1945.
Abbildungen auch Seite 158 und 164

6630
6630
René Gruau (1909 Rimini – 2004 Rom)
Femme au Parapluie: Voilà la Pluie. Lithographie auf ArchesVelin. 68 x 48 cm (75 x 53 cm). Auflage 45 röm. nummerierte Künstlerex. (AP XLI/XLV). Signiert. Um 1989.
1.800 €
Dieses ikonische Poster wurde ursprünglich 1945 von René Gruau als Teil einer Werbung für die französische HauteCoutureMarke Dior entworfen. Unten links mit dem Prägestempel des Herausgebers, erschienen in einer Gesamtauflage von 345 Exemplaren. Ausgezeichneter Druck mit Rand.

6631
Raoul Dufy (1877 Le Havre – 1953 Forcalquier)
Mailles blanches, fond noir. Tusche und Gouache auf gewalztem Bütten. 48 x 60 cm. Unten rechts mit Fragment des Stempels „RD / BIANCHINI FERIER“ in Rot, im Unterrand in roter Kreide bezeichnet „DEVANT“ und mit Richtungspfeil sowie oben rechts in der Darstellung „Cache (pour le fond)“ und Markierungslinien. Wohl um 1912.
500 €
Provenienz: MirabaudMercier, Paris, Auktion 14.12.2021, Lot 106. Sammlung Henning Lohner, Berlin.
Nachdem Dufy 1911 vom Modedesigner Paul Poiret den Auftrag erhalten hatte, Geschäftspapiere zu entwerfen, entwickelte sich zwischen ihnen eine Freundschaft und kreative Partnerschaft, die viele Jahre andauern sollte. Er begann, Textilien für Poirets Kleidungsstücke zu entwerfen. Dufys Designs waren bemerkenswert kühn und standen in starkem Kontrast zur damaligen verspielteren Mode. Die Markierungen in der Darstellung weisen auf eine konkrete Verwendung der Entwurfszeichnung hin.
6632
Julius Klinger (1876 Dornbach – 1942 Vernichtungslager Maly Trostinez)
Künstlerplakate Hollerbaum & Schmidt. Plakat in zwei Teilen. Farblithographie auf Affichenpapier. 149 x 99 cm (158,5 x 107,3 cm, zusammengesetzt). Um 1900.
5.000 €
Literatur: Heinz Spielmann: Plakat- und Buchkunst um 1900, Hamburg 1963, Nr. 749, Abb. 52. Esprit und Eleganz strahlt die radikal abstrahierte Darstellung aus. Dem geometrischen Muster im flächigen Rapport steht der Schwung der konkaven Konturlinien gegenüber. Diese pointierte Ausdruckskraft und die zeitlose Modernität sind kennzeichnend für Klingers Begabung und machten ihn schnell zu einem der populärsten Berliner Plakatkünstler. Julius Klinger, einer der prägendsten Gestalter der JugendstilPlakatkunst, entwickelte ab 1900 zusammen mit der Druckerei Hollerbaum & Schmidt eine neue Art der funktionellen Plakatgestaltung und wurde damit bald international bekannt. Klinger lernte während seiner ersten Tätigkeit beim Wiener Magazin „Wiener Mode“ seinen späteren Lehrer Koloman Moser kennen und wurde von diesem an die Meggendorfer Blätter empfohlen. Von 1897 bis 1902 war er Mitarbeiter bei der Wochenschrift „Jugend“; während dieser Zeit entstand wohl das vorliegende, großformatige Plakat.


Atelier Lizzie Derriey
Originalentwürfe für Stoffmuster.
30 Zeichnungen, Gouache über Feder und Bleistift auf chamoisfarbenem Velin. Ca. 8 x 8 cm 22,5 x 17,5 cm (Darstellung); 50 x 32,6 cm (Blattgröße). Wz. Renage (Isère). Paris, 1950er und 60er Jahre.
800 €

Versteckt im Herzen von Paris, in der legendären Rue du Faubourg SaintHonoré, existierte einst ein Atelier, das Farbe, Kreativität und unverwechselbares Design zelebrierte: das Lizzie Derriey Design Studio. Zwischen 1928 und 1994 entwarf dieses visionäre Studio atemberaubende Textil und Tapetenmuster für den InteriorBereich und für einige der größten Modehäuser der Welt, wie Jean Patou, Givenchy, Oscar de la Renta und Yves Saint Laurent. Bis zu 25 Künstler arbeiteten gleichzeitig in dieser kreativen Kooperative –jeder Pinselstrich ein Unikat, jedes Design ein Kunstwerk. Doch mit der Zeit geriet das Studio in Vergessenheit. Fast sieben Jahrzehnte exquisiten Designs schienen verloren. Erst 2010 wurde ein Teil der verschollenen Werke überraschend in Südfrankreich entdeckt. Die Faszination über diesen Fund war so groß, dass die heutigen Besitzer entschieden, einige der wertvollen Originale einer neuen Generation zugänglich zu machen. Liberty London, ein Synonym für Textildruck, Design und Kreativität, war der einzige Ort, an dem die Kollektion exklusiv präsentiert wurde. Im Rahmen einer Ausstellung bei Liberty, erklärte eine ehemalige Mitarbeiterin des Ateliers wie die Entwürfe entstanden: „The creation of the design was all done by hand using basic materials –paper, gouache, sable brushes. … Before designers began exhibiting at large design fairs like Indigo and Surtex, and the designer halls at Heimtex, most designs were sold from the showrooms of the design studios. Therefore the buyers and clients would generally visit all these studios by appointment. They would have special design buying trips planned in their schedule at various times of the year, pounding the streets of Paris, Como, etc. Studios would also send out their Sales people to also pound the streets with their weighty portfolios and sometimes hope to sell a design or collection. … In the old days the studio had very strict rules regarding the exposure of designers to clients. … the European studios, especially the French ones, were quite obsessed about this. If they had a good designer who’s designs were selling well, they did everything in their power to keep them under wraps.“ (zitiert nach: Pattern People, 3. Juni 2011).
Die vorliegende Sammlung von 30 Originalentwürfen zeigt die für das Atelier typischen floralen Muster, die teils durch mutige Farbkombinationen, teils durch ins Ornamentale weisende Abstraktionen oder Zitate aus der FlowerPowerÄsthetik ganz modern und lebendig wirken.


6634
6634
Elli Herber (tätig 1920er Jahre)
Originalentwürfe für elegante Damen und Herrenmode.
48 Zeichnungen, Aquarell/Gouache über Bleistift und Feder, auf chamoisfarbenem Velin oder Karton, vereinzelt auf Transparentpapier. Ca. 14 x 12,5 cm62 x 37 cm. Teils signiert „Elli Herber“. 1926/27.
1.600 €
Diese Modeentwürfe präsentieren Tages und Cocktailkleider aus fließenden Stoffen, mit betonter Hüfte und kniebedeckter Länge –getragen von selbstbewussten, beinahe androgyn wirkenden jungen Frauen mit kurzen Haaren, ganz im typischen GarçonneStil der 1920er Jahre. Einige Designs lösen sich jedoch bereits von diesem Ideal: Sie zeigen kürzere, schulter oder rückenfreie Kleider mit weniger schmalen Silhouetten, ausgestellten Röcken und lebhaften, farbintensiven Mustern. Ergänzend finden sich kleinere Skizzen mit Entwürfen für Damenhüte. Die Herrenmode besticht durch elegante Anzüge, teilweise kombiniert mit Trenchcoats oder Melonenhüten.
Die Mappe enthält zudem zwei farbige Verpackungsentwürfe, ein Aquarell „Stillleben mit Flakon“ sowie einen dekorativen Werbeoder Geschenkaufsteller.


6636
6635
Horst P. Horst (eigentl. Paul Horst Bohrmann, 1906 Weißenfels – 1999 Palm Beach Gardens, FL)
Marlene Dietrich für Vogue. Vintage SilbergelatineKontaktabzug auf Hochglanzpapier. 25,5 x 20,7 cm. Im Negativ nummeriert; Fotografenstempel „Horst Vogue Studio“ sowie Prüfungsstempel „Vogue Studios“ mit Datum „10. März 1948“ auf der Rückseite. 1948.
1.200 €
Horst P. Horst war ein deutschamerikanischer Fotograf, der mit seiner stilprägenden Mode und Porträtfotografie internationale Anerkennung fand. In seinen Arbeiten verband er klassische Eleganz mit moderner Ästhetik. Seine 1947 für die Vogue entstandenen Porträts von Marlene Dietrich veranschaulichen sein meisterhaftes Spiel mit dramatischer Beleuchtung und skulpturaler Komposition und zeigen sie als Ikone von Raffinesse und kühler, sinnlicher Eleganz.
6636
Max Snischek (1891 Dürnkrut – 1968 Hinterbrühl bei Mödling)
SommerAbendkleid und StrandPyjama. Schwarzer Stift auf dünnem Velin. 23 x 28,8 cm. Signiert, sowie unten links in Bleistift betitelt. Um 1925.
400 €
Provenienz: Aus der Sammlung Hans AnkwiczKleehoven (1886–1962).
Nach seinem Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule von 1912–1914 bei Rosalia Rothansl, stellte Max Snischek bereits 1915 in der Modeausstellung im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie aus. 1922 übernahm er die Leitung der Modeabteilung der Wiener Werkstätte von Eduard Josef WimmerWisgrill. Anfang 1932 ging der Künstler nach München, wo er an der Meisterschule für Mode das Fach Figurenzeichnen unterrichtete. Beigegeben von demselben eine weitere, in farbigen Kreiden ausgeführte Modezeichnung: „Junge Frau im rosa Kleid mit schwarzer Schleife und Flanierschirm“.

6637
Strohhut
Schwarzer DamenStrohhut.
Stroh, schwarz, breite Krempe, schwarze Banderole mit der gestickten Aufschrift „Hindenburg“ zwischen zwei Fahnen, mit originaler Bindeschnur. Höhe Hutkrone ca. 7 cm, Kopfumfang 53 cm. Deutsch, um 1915.
240 €
Geschenkhut für den Stapellauf des großen Kreuzers „Hindenburg“ in Wilhelmshaven am 1. August 1915.

6638
6638
Gottfried Helnwein (1948 Wien, lebt in Tipperary und Los Angeles)
Marlene Dietrich. Farboffset auf festem Velin. 48 x 44 cm (71 x 61 cm). Signiert „Helnwein“. Auflage 499 num. Ex. 1989/90.
1.800 €
Marlene: Stilikone, androgyne Schönheit, Mythos der Filmgeschichte. Ihr berühmter Ausspruch zu Mode und Stil wirft ein Schlaglicht auf die Person: “I dress for the image. Not for myself, not for the public, not for fashion, not for men.” (zit. nach Smithsonian Institution,
Marlene Dietrich: Dressed for the Image, si.edu, Zugriff 17.03.2025). Helnweins Motiv entstand als Filmplakat für den Dokumentarfilm „Marlene“. Marlene Dietrich zeigte sich sehr zufrieden mit dem Portrait, und es folgte daraus eine persönliche Verbindung zwischen beiden. „In den letzten Jahren pflegten die Diva und der Maler regelmässigen Kontakt, Marlene Dietrich und Gottfried Helnwein. Gesehen haben sich die beiden jedoch nie. [...] Es gibt kein Rollenklischee, in das sie passen würde. Sie hatte immer etwas Maskulines, Bestimmtes und Direktes. Und sie hat ihr Leben einzelkämpferisch geführt. Wie auch James Dean stand Marlene irgendwo zwischen den Geschlechtern. Sie war nicht eine Frau, sie war das Bild der Frau.“ (gottfriedhelnwein.at, Zugriff 18.03.2025).

6639
Horst P. Horst
(eigentl. Paul Horst Bohrmann, 1906 Weißenfels – 1999 Palm Beach Gardens, FL)
Alix (Black Satin) Dress, NY.
Platinum palladium Abzug. 47,2 x 38 cm (61 x 51 cm).
Prägestempel vom Fotografen im unteren rechten Rand; verso vom Fotografen signiert sowie Copyrightstempel und von fremder Hand in Bleistift beschriftet, Edition 7. 1938.
5.000 €
6640

Halsschmuck
Choker Collier.
Hochwertige MilanaiseFlechtkette aus goldfarbenem Metall mit weichen Rändern, in der vorderen Mitte ein offen gefasster facettierter grüner Glasstein („Smaragd“), achteckige Fassung mit geschliffenen Glassteinen, auf der Schließe verso gemarkt „Grosse © Germany“. Deutschland, Henkel & Grossé, Pforzheim, 1980er Jahre. In Originalkarton des Händlers Fior, London.
150 €
6640a
Jil Sander
Elegante Clutch.
Schwarzes Kalbsleder. H. 15,5 x Br. 31 x T. 3,5 cm.
800 €

6641
Anna Lena Straube (geb. 1978 in Bremen)
„Fire“.
Acryl auf Leinwand. 210 x 150 cm. Verso signiert „Al Straube“ sowie betitelt, bezeichnet und datiert „‚fire‘ aus Werkphase ‚lost in fiction‘ 2025“.
12.000 €
Straubes Werk „Fire“ aus dem aktuellen Schaffenzyklus „Lost in Fiction“ zeigt die amerikanische Leinwandlegende Lauren Bacall stilsicher im GlencheckKostüm rauchend. Die Vorlage für Straubes Gemälde entstammt wohl der HemingwayVerfilmung „To Have and Have Not“ von Howard Hawks. Mit dieser ersten Rolle wurde die selbstbewusste junge Schauspielerin im Jahr 1944 zum Star. Bereits während der Dreharbeiten verliebten sich Bacall und ihr 25 Jahre älterer Filmpartner Humphrey Bogart, dessen Coolness hier in der locker im Mundwinkel hängenden Zigarette anklingt. Straubes Bildtitel „Fire“ spielt wohl auf Bacalls berühmten Filmsatz „Anybody got a match?“ an. Irritierend und verfremdet aber erscheint hier die Szene, wie überbelichtet verschwimmen manche Konturen, während durch die gesteigerten Kontraste andere Details extrascharf herausstechen und um Bacalls Figur herum irrlichternde Feuerzeugflammen und undeutliche Schatten zwischen traumartig verzerrten Gesichtern tanzen. Darüber regnet, wie häufig in Straubes Gemälden, eine feine Schicht farbiger Tropfen und transformiert die 80 Jahre alte Filmszene in eine komplexe Impression flirrender Modernität.


6642 Fascinator
Kleiner Federhut (Fascinator).
Oberfläche vollständig bedeckt mit farbigen Federn exotischer Vögel und mit möglicherweise eingefärbten Perlhuhnfedern, Leinenfutter. Wohl US Size 6. Mit amerikanischem Herstellerlabel „United Hatters Cap & Millinery Workers Union“ und „Union Made in U.S.A. AL 326185“. USA, 1950/60er Jahre.
150 €

6643
Cathleen Naundorf (geb. 1968 in Weißenfels)
Noah‘s Ark XIII (8), haute couture Dior Summer 2012 Collection.
CPrint von Original Polaroid Abzug. 43 x 60 cm (53 x 70 cm). Verso von der Fotografin signiert, betitelt und 4/10 nummeriert sowie mit Fotografenstempel.
5.000 €
Die auf Mode und Porträtfotografie spezialisierte Fotografin Cathleen Naundorf arbeitet aktiv mit Haute Couture Häusern wie Chanel, Dior, Elie Saab und Valentino zusammen. Inspiriert durch die Begegnung und langjährige Freundschaft mit Horst P. Horst, begann Cathleen Naundorf sich zunehmend für die Modefotografie zu interessieren. Seit Anfang der 1990er Jahre reiste sie für renommierte Verlage durch die ganze Welt. Naundorfs Arbeiten wurden in Harper‘s Bazaar, National Geographic und Condé Nast veröffentlicht und ihre Fotografien werden weltweit in Galerien und Museen gesammelt und ausgestellt. Die 2018 erschienene Publikation „Women of Singular beauty – CHANEL Haute Couture by Cathleen Naundorf“ feierte über 15 Jahre Naundorfs Zusammenarbeit mit dem legendären Modehaus CHANEL.

Cathleen Naundorf
Just Like a Dream (12), couture Stéphane Rolland été 2014.
CPrint von Original Polaroid Abzug. 59,8 x 44,5 cm (70 x 54,5 cm). Verso von der Fotografin signiert, betitelt und 1/10 nummeriert sowie mit Fotografenstempel.
5.000 €
6645
Horst P. Horst

(eigentl. Paul Horst Bohrmann, 1906 Weißenfels – 1999 Palm Beach Gardens, FL)
Evening Gown by Alix Paris. Platinum palladium Abzug. 46,2 x 34,6 cm (61 x 51 cm). Prägestempel vom Fotografen im unteren rechten Rand; verso vom Fotografen signiert sowie Copyrightstempel und von fremder Hand in Bleistift beschriftet und 2/6 nummeriert. 1938.
5.000 €
Literatur: Richard J. Horst/Lothar Schirmer (Hrsg.): Horst. Sixty Years of Photography, München 1991, Abb. Tafel 21.
Horst P. Horsts Arbeit zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, das Wesen seiner Porträtierten einzufangen, ganz gleich, ob es sich um berühmte HollywoodStars, Modemodelle oder kulturelle Persönlichkeiten handelt. Seine Porträts strahlen einen Sinn für Raffinesse aus und beinhalten eine besondere Aufmerksamkeit für Beleuchtung, Komposition und Details.

Fashion for Harper’s Bazaar Silbergelatineabzug. 35,7 x 29,7 cm. Verso mit Bleistift beschriftet. 1930er Jahre/Abzug 1970er Jahre von Pierre Gassmann.
800 €
New York World‘s Fair, Harper’s Bazaar Silbergelatineabzug. 30,5 x 23,5 cm. Verso mit Nachlassstempel und „Tirage original de Martin Munkacsi réalisé par Pierre Gassmann Paris“ Stempel sowie verso mit Bleistift beschriftet. 1938/Abzug 1970er Jahre von Pierre Gassmann.
900 €


Willy Maywald (1907 Kleve – 1985 Paris)
Hutmode.
2 Vintage hochglanz Silbergelatineabzüge. 22,6 x 23 cm und 28 x 21,8 cm. Auf Karton montiert (Karton lichtbedingt verfärbt, angeschmutzt und Gebrauchsspuren, besonders an den Rändern); vom Fotografen mit Bleistift signiert und beschriftet „Paris“ auf der Unterlage. 1930er Jahre.

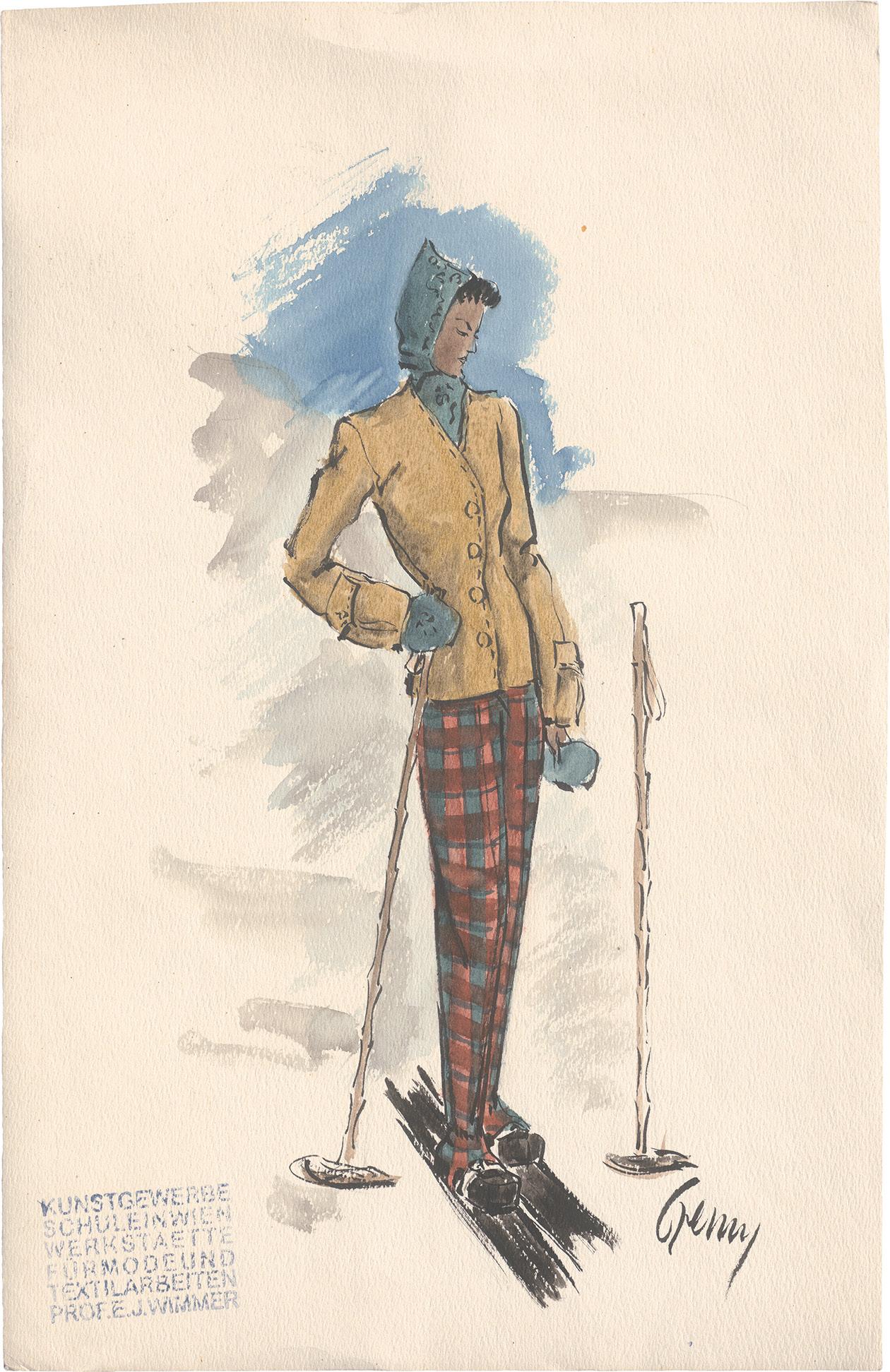
6649
Elfriede Czerny (studierte 1936–40 in Wien)
Vier Modeentwürfe für Damenbekleidung: Ausgehkostüm; zwei Abendkleider; SkiEnsemble. 4 Zeichnungen, je Aquarell und schwarzer Stift auf Velin. Je ca. 36,2 x 24 cm (Blattmaße). Sämtlich signiert und mit dem Stempel der Kunstgewerbeschule in Wien „Werkstaette für Mode und Textilarbeiten Prof. E. J. Wimmer“. Um 1939/40.
450 €

6650
Louis Vuitton
LV Monogram Pallas, M40929, Braun und Safran. Beschichtetes Monogram Canvas, gefärbtes Kalbsleder sowie naturbelassenes Rindsleder. H. 26 x Br. 34 x T. 13 cm. 2013.
800 €

6651
Vivienne Westwood
Medium Yasmin Bag, gelb mit glitzerndem Logo. Kunstleder, geprägt in Krokodiloptik. H. 22 x Br. 31 x T. 14 cm.
500 €
Vivienne Westwood ist eine der einflussreichsten Modedesignerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Sie revolutionierte die Modewelt mit ihrer unkonventionellen Mischung aus PunkÄsthetik, viktorianischen Elementen und britischem Traditionsstil. Westwood trug maßgeblich zur Entstehung der Punkmode bei und setzte dabei auf provokante Designs, die gesellschaftliche Normen infrage stellten. Ihre Kreationen waren oft rebellisch und politisch, was sie zu einer Ikone der Modeavantgarde machte.
Louis Vuitton
Seidencarré (Halstuch).
Seide mit einem geometrischen Muster aus vier Quadraten in Maron und Weiß, Zierleisten und das VuittonLogo in Gelb. Ca. 66 x 66 cm. Mit dem originalen Label „Louis Vuitton Paris“. Italien, 21. Jh.
200 €

6653

Archimede Seguso (1909–1999, Murano)
Vintage Glasgliederkette für Chanel. MuranoGlas in Weiß mit bronzefarben schimmernden Einschlüssen, goldfarbene Kappen, StrassSteinRondellen und ASSignaturSchließe. Länge 95 cm. Chanel, 1960er Jahre.
750 €
In den 1960er Jahren beauftragte Coco Chanel den venezianischen Glaskünstler Archimede Seguso mit der Anfertigung handgefertigter GlasSchmuckstücke für ihre CoutureKollektion. Das Ergebnis war eine exklusive Linie tragbarer Glaskunstwerke – darunter Ohrringe und Halsketten in leuchtenden Farben, verziert mit funkelnden Kristallen und charakteristischen ovalen Glasgliedern.
Diese Halskette besteht aus handgefertigtem, weißen Glas mit bronzefarben schimmernden Einschlüssen, diese kunstvoll gefasst in vergoldete Kappen und vereinzelt mit glitzernden StrassSteinRondellen. Besonders bemerkenswert ist die außergewöhnliche Länge von 95 cm. Seguso, der als „Couturier des Glases“ galt, arbeitete bis ins hohe Alter und hinterließ ein bleibendes Erbe in der Kunst des Glasdesigns. Seine Werke wurden über Jahrzehnte von Königshäusern, Staatsoberhäuptern und Luxusmarken wie Tiffany’s geschätzt. Auch heute noch produziert das Unternehmen Seguso kunstvolle Glaskreationen für eine exklusive Kundschaft, darunter Michelle Obama. Ein faszinierendes Stück Modegeschichte und ein wahres Meisterwerk tragbarer Kunst.


6654
Karl Lagerfeld (1933 Hamburg – 2019 NeuillysurSeine)
Modezeichnung (Langes Kleid).
Faserschreiber in Schwarz, Bleistift und farbige Kreiden auf glattem festen Velin. 50 x 21,7 cm. Unten rechts mit Bleistift bezeichnet „Nenika“, oben links mit Kugelschreiber (von fremder Hand) „993“. Um 1965.
1.200 €
Provenienz: Archiv Tiziani, Rom. Nachlass Raf Ravaioli.
Privatsammlung Palm Beach, Florida. Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion am 18. April 2019, Los 80.
Sammlung Henning Lohner, Berlin.
Zart koloriert Lagerfeld das Inkarnat des Models und verleiht der Entwurfszeichnung sommerliche Frische. Die messerscharfen Striche des feinen Zeichenstiftes entsprechen technisch der Akkuratesse, mit der der Modeschöpfer die klare Silhouette des Midikleides erfasst. Winzige Kringellinien deuten zugleich die rokokohafte Verspieltheit an, die neben den genialen klaren Konturen in seinem Schaffen aufblitzt. Die kleinen Entwurfszeichnungen im rechten Rand zeugen vom Gestaltungsprozess des Designers.
6655
Karl Lagerfeld
Modezeichnung (Kurzes Paillettenkleid).
Feder in Schwarz, Kugelschreiber in Blau, farbige Faserschreiber und Farbkreide auf leichtem Velinkarton. 50 x 21,5 cm. Oben rechts mit Kugelschreiber in Blau bezeichnet „robe entièrement couverte de paillettes transparente“. Um 1965.
1.200 €
Provenienz: Archiv Tiziani, Rom. Nachlass Raf Ravaioli. Privatsammlung Palm Beach, Florida. Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion am 18. April 2019, Los 78. Sammlung Henning Lohner, Berlin. Schwungvoll und in eleganter Lineatur gezeichneter Designentwurf mit attraktiven farbigen Akzenten.
6656
Arno Fischer (1927 Berlin – 2011 Neustrelitz)
Modefoto.
Vintage Silbergelatineabzug. 39,5 x 29,7 cm. In den Ecken auf Karton montiert. 1960er Jahre.
500 €
1962 wurde Arno Fischer Teil des Redaktionsteams bei Sibylle der bekanntesten LifestyleZeitschrift der DDR. Die vorwiegend der Mode gewidmete Zeitschrift war in der DDR einzigartig, da die Fotografen ihre eigene künstlerische Ideen umsetzen konnten.


6657
Chanel Boutique – TweedWolljacke.
Einreihige TweedJacke in Fuchsia (100% Wolle, Innenfutter 100% Seide mit CCLogo), vier Taschen, insgesamt 16 goldene Metallknöpfe mit „CHANEL PARIS“, diskret eingenähter Druckknopf vorne, goldene Gliederkette im unteren Saum. Größe 34. 1990er Jahre.
Provenienz: In den frühen 1990erJahren in dem Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in New York erworben, mit deren Label. Ikonische TweedWolljacke aus der Chanel Boutique. Einreihige, taillierte Jacke in strahlend frischem Fuchsia mit RundhalsAusschnitt, mit sechs goldenen Metallknöpfen. Vier Taschen, je zwei in Brust und Hüfthöhe, mit jeweils einem goldenen Metallknopf. An den Ärmeln jeweils drei, etwas kleinere, goldene Metallknöpfe. Die Jacke ist vollständig mit farblich passendem CCLogoStoff aus Seide gefüttert. Entlang des unteren Saums mit der obligatorischen Goldkette versehen.
Mit teils handschriftlichem FabrikEtikett der Chanel Boutique: Kollektion 26. Modell 21683. Größe 34. Fabriqué en France. Brustweite: ca. 39 cm, Schulter zu Schulter: ca. 40 cm, Länge: ca. 67 cm, Ärmellänge: 58 cm.
Mit originalem, samtenem ChanelKleiderbügel mit goldenem CCLogo, sowie im originalem Kleidersack von Bergdorf Goodman.
6658
Myra von Busekist (geb. 1969 in Heidelberg)
Pompon Poodle Pink. Pompons, farbige Merinowolle, auf farbigem Lederkorpus. Ca. 140 x 65 x 62 cm. 2023.
12.000 €
Der Pudel: nicht nur Hund, sondern immer wieder auch Modeaccessoire. Vor allem in der exzentrischen Löwenschur zeigt er sich als ein Fashion Statement, das in den Sixties für Eleganz und Stil stand. Die Modedesignerin Myra von Busekist fertigt die flauschigen Pompons in leuchtend pinker Merinowolle an und verwandelt die Figur des überlebensgroßen, liegenden Hundes in ein provokantes Objekt. Busekist absolvierte ihr Studium in Trier und

Madrid (1992–1997) und arbeitete zunächst 15 Jahre in der Mode, bis sie 2011 begann, eine ganz eigene Welt von Tierskulpturen und Wollobjekten zu entwickeln. Der PomponPudel in Pink gehört zu den bekanntesten Objekten der Berliner Künstlerin. In ihrem Kreuzberger Atelier wird er, wie jedes ihrer Einzelstücke, aufwendig von Hand gefertigt. Er wird mit über 350 Pompons modelliert, die aus ca. 20 kg MerinoWolle gewickelt werden. Rumpf und Gliedmaßen werden aus Nappaleder genäht. Sowohl der Bommel als vorrangiges Element des Herstellungsprozesses, als auch das Motiv des Pudels selbst – als lebendes modisches Accessoire in einer bizarren Art geschoren – stehen symptomatisch für die Arbeitsweise der Künstlerin an der Grenze von Mode, Design und Kunst. Ihre Softskulpturen werden von Sammlern nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, HongKong, Abu Dhabi oder SaudiArabien gekauft; sie wurden im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe ausgestellt und sind aktuell (bis Juni 2025) im Kunstgewerbemuseum Berlin zu sehen.

6660
Bert Stern (1929–2013, New York)
David Bailey Taking a Photograph of Veruschka, Vogue New York.
Späterer Silbergelatineabzug. 58 x 44,5 cm. Rückseitig signiert und mit CopyrightStempel des Fotografen versehen. 1965.
1.200 €
Dieses ikonische Porträt von Bert Stern, aufgenommen 1964 für die Vogue, dokumentiert die kreative Zusammenarbeit zwischen dem Fotografen David Bailey und dem deutschen Supermodel Veruschka von Lehndorff. Veruschka, geboren als Vera Gräfin von LehndorffSteinort, zählte in den 1960er Jahren zu den gefragtesten Models und war bekannt für ihre außergewöhnliche Erscheinung und Wandlungsfähigkeit. David Bailey, eine zentrale Figur der „Swinging Sixties“, revolutionierte die Modefotografie mit seinem innovativen Stil und arbeitete mit zahlreichen prominenten Persönlichkeiten zusammen. Sterns Fotografie gewährt einen seltenen Einblick in die kreative Dynamik der Modefotografie dieser Ära und zeigt das faszinierende Zusammenspiel zwischen Fotograf und Muse.
6659 XOOOOX
(geboren 1979, lebt in Berlin)
SkimmerStreet Art Edition; Walking Lady. 2 Serigraphien in SchwarzWeiß auf Velinkarton. 69,5 x 37 cm (69,5 x 49,5 cm) bzw. 53 x 16 cm (70 x 50 cm). Auflage 70 bzw. 100 num. Ex. Jeweils signiert „XOOOOX“. 2018.
300 €
Vom UndergroundSprayer zum GraffitiKünstler, sind Werke von XOOOOX inzwischen auch im Urban Nation Museum in Berlin zu sehen. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand. Verso in den Ecken und Rändern stellenweise mit Montierungsresten, ansonsten in sehr schönem Zustand.


6661
Louis Vuitton
LV Speedy Bandoulière 25, Creme, Wild at Heart, limited edition.
Beschichtetes Monogram Canvas und Leder. H. 21 x Br. 26 x T. 15 cm. 2021.
1.500 €
Die Speedy 25 Bandoulière hat hier zwar ihre ikonische Form beibehalten, wurde aber mit neuen Details versehen, insbesondere mit einem auffälligen, exklusiven MonogrammPrint in handgemalter Optik, inspiriert von einem archivierten Motiv des Hauses aus dem Jahr 1924. Ursprünglich wurde das Modell für Reisende in den Dreißigerjahren entworfen – der Name verweist auf die schnellen Transportmittel der damaligen Zeit. Ohne Staubbeutel und Schloss.

Arno Fischer (1927 Berlin – 2011 Neustrelitz)
Modefotos.
2 Vintage Silbergelatineabzüge. 39,7 x 29,8 cm und 39,5 x 30 cm. In den Ecken auf Karton montiert. 1960er Jahre.
600 €

6663
6663
Karl Lagerfeld (1933 Hamburg – 2019 NeuillysurSeine)
Modezeichnung (Rotes Kostüm). Faserschreiber in Schwarz und Rot auf Skizzenblockpapier. 48,5 x 36 cm. Oben rechts mit Faserscheiber in Schwarz bezeichnet „fait 8“ sowie „this ensemble can be made in solid color too“ und mittig „metal belt“. Um 1965.
1.500 €
Provenienz: Archiv Tiziani, Rom. Nachlass Raf Ravaioli. Privatsammlung Palm Beach, Florida. Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion am 18. April 2019, wohl Los 105. Sammlung Henning Lohner, Berlin. In eine dynamische, trapezförmige Grundkomposition bettet Lagerfeld die beiden Entwürfe ein. Oben bilden die angedeuteten Hüte eine begrenzende Gerade, seitlich sind es jeweils die ausgestellten Beine und leicht abgespreizten Arme.


6664
Archimede Seguso (1909–1999, Murano)
Vintage Glasgliederkette für Chanel. MuranoGlas in Kobaltblau und Smaragdgrün, goldfarbene Kappen sowie goldfarbene Schließe. Länge 56 cm. Chanel, 1960er Jahre.
600 €
6665
Murano-Glasvase
Vase in Form einer Clutch in Reptiloptik. Farbiges Glas mit Aufschmelzungen. H. 19 x Br. 6 x L. 17,5 cm. Murano, wohl 1960/70er Jahre.
150 €
6666
Karl Lagerfeld (1933 Hamburg – 2019 NeuillysurSeine)
Modezeichnung (Kleid schwarzgelb). Faserschreiber in Schwarz und Gelb sowie Fineliner und mit Stecknadel beimontiertes Stoffmuster auf leichtem Velinkarton. 50 x 21,5 cm. Oben rechts mit Bleistift bezeichnet „917“ sowie „IDA“, unten rechts nochmals „Ida“, oben links „Alfonso“ (?). Um 1965.
1.200 €
Provenienz: Archiv Tiziani, Rom. Nachlass Raf Ravaioli. Privatsammlung Palm Beach, Florida. Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion am 18. April 2019, wohl Los 105.
Sammlung Henning Lohner, Berlin.
Bei Tiziani entstand in den Swinging Sixties nach Entwürfen Karl Lagerfelds Kleidung für Elizabeth Taylor und andere Prominente. Er skizziert seine Modeidee exakt, die Konturen des Modells jedoch nur gerade so weit, dass der Betrachter sie zu Ende denken kann. Dieses Unvollständige, in der Andeutung Belassene erhöht den Reiz seiner Entwurfszeichnungen.



6669
6667
Oleg Cassini (1913 Paris – 2006 Long Island, NY) Paillettenkleid. Etuikleid mit kurzen Ärmeln, vollständig bestickt mit gold und perlmuttfarbenen Pailleten und Stiften auf Seidenchiffon, Futter: weißes Rayon, Reißverschluss und Haken auf der Rückseite. Länge 98 cm, Größe 34 (Deutschland). Oleg Cassini Black Tie, USA, wohl 1980er Jahre.
400 €
Oleg Cassini, 1913 als Sohn russischer Adliger in Paris geboren, entwarf seine ersten eigenen Entwürfe 1936 im Modesalon seiner Mutter Gräfin Marguerite Cassini, bevor er 1936 in die USA übersiedelte. Größere Bekanntheit erlangte er durch eigenen Kreationen in den 1950er und 1960er Jahren, die dazu führten, dass Jacqueline Kennedy Cassini zu ihrem offiziellen Modedesigner kürte. 300 Kleider entwarf der Modeschöpfer allein für Jacqueline Kennedy, daneben kleidete er Schauspielgrößen wie Marilyn Monroe oder Natalie Wood ein. Seine Beziehung zu Grace Kelly, mit der Cassini auch verlobt war, füllte die Spalten der Regenbogenpresse.

6668
6668
Christian Dior
Brosche „Biene“. Durchbrochenes, goldfarbenes Metall, besetzt mit Kunstperlen und Strasssteinen. 4,1 x 4,2 cm. Auf der Unterseite gemarkt „Chr. Dior“. Henkel & Grossé, Pforzheim, 1980er Jahre.
150 €
6669
Yves Saint-Laurent
„Skalar“Brosche. Goldfarbenes Metall. 5 x 6,5 cm. Stempelmarke „YSL“. Vintage, 1980er.
150 €

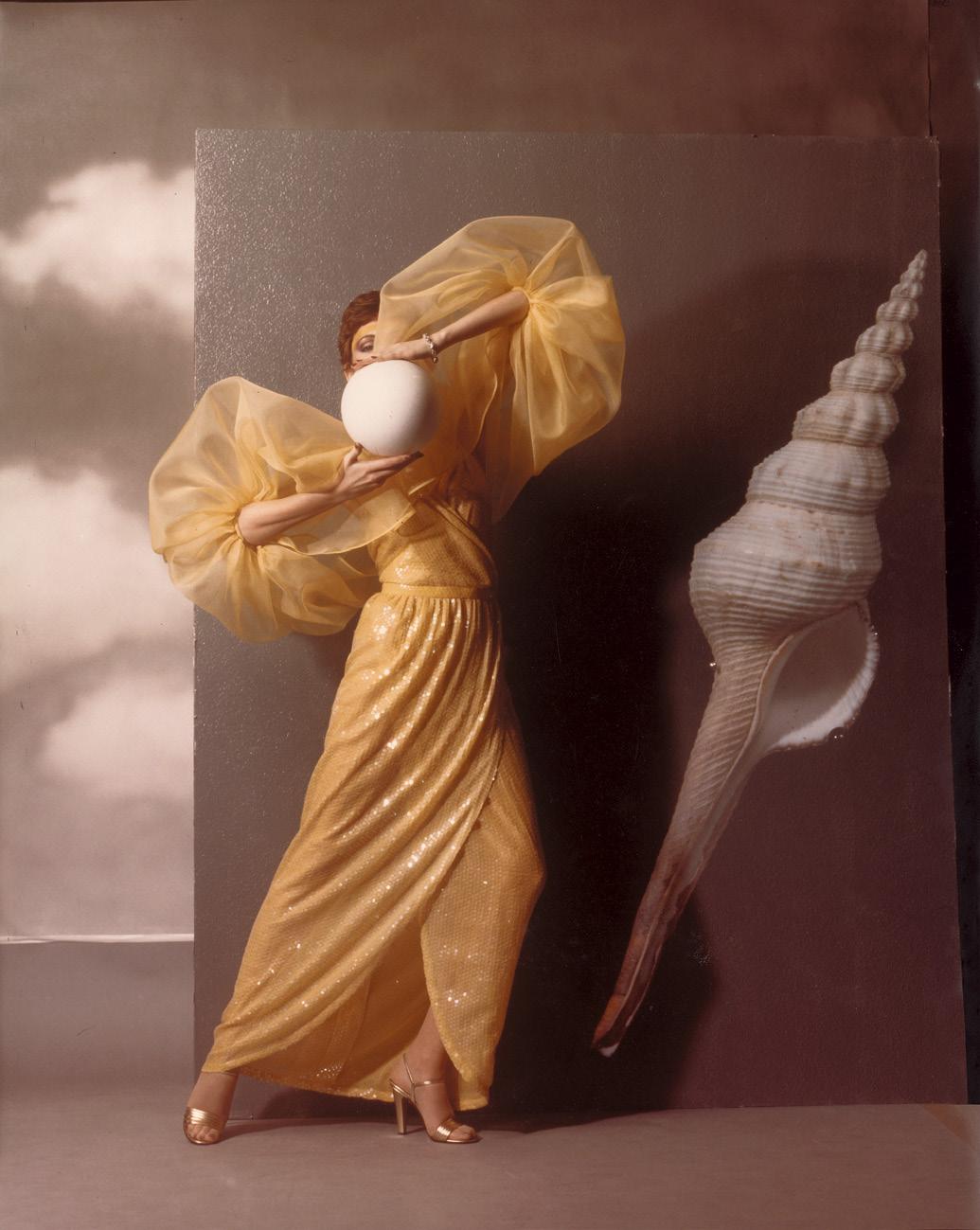


6670
Regina Relang
(eigentl. Regina Lang, 1906 Stuttgart – 1989 München)
„Jeux des bals“ (Doppelbelichtung); „Muschel Serie“. 2 Vintage CPrints auf Kodak Papier. Ca. 41 x 30,5 cm. Beide mit Faserstift (ausgeblichen) von der Fotografin verso betitelt. 1979–80.
750 €
6671
Regina Relang
„Schmetterling Serie“; „Plissee Serie“.
2 CPrints auf Kodak Papier. 23,8 x 23,7 cm und 36,5 x 29,8 cm. Beide mit Faserstift (ausgeblichen) von der Fotografin verso betitelt. 1974–75.

6672*
Yves Saint Laurent
Außergewöhnlicher SommerStrohhut. Strohhut in Schwarz mit rotem Hutband ebenfalls aus Stroh, auf der breiten Krempe zwölf runde, messingfarbene Knöpfe. Höhe Hutkrone ca. 9,5 cm, Kopfumfang 59 cm. Innen mit dem originalen Herstellerlabel „Saint Laurent rive gauche Paris“. Um 1980.
350 €
6673
Karl Lagerfeld (1933 Hamburg – 2019 NeuillysurSeine)
Modezeichnung. Faserstifte und Pinsel in Schwarz auf Skizzenpapier. 29,5 x 21 cm. Unten rechts mit Faserstift in Schwarz signiert „Karl Lagerfeld“. Anfang 1980er Jahre.
1.500 €
Handschriftliche Annotationen überdeckt Lagerfeld mit breit aufgesetzten schwarzen Pinselstrichen und verleiht damit der schwungvollen Modezeichnung einen ungewöhnlichen, markanten Kontrastreichtum und eine Modernität, die weit über den üblichen Modellentwurf hinausgeht: Fast scheint die tiefe Dunkelheit sich über die zarte Frauengestalt legen zu wollen. Zu Beginn der 1980er Jahre, zur Zeit des New Wave, entwarf Lagefeld unter anderem diese TShirts für Peek&Cloppenburg.
6674
Olaf Gründel (geb. 1965 )
Originalentwürfe für Damen und Herrenmode. 11 Zeichnungen, teils Aquarell oder Buntstift über Bleistift und schwarzem Stift, teils nur Bleistift oder schwarzer Stift, auf chamoisfarbenem Velin. Je 29,9 x 21 cm. Signiert „Olaf Gründel“ und teilweise datiert „1982“ und „1985.“
300 €
Die Entwürfe sind mit sicherem Strich skizziert, oft bis ins Detail ausgearbeitet und zeigen die typische 80erJahre Mode mit den extrem breiten, gepolsterten Schultern und hohen Taillen. Der Designer Olaf Gründel arbeitete bei Wolfgang Joop, Ralph Lauren und Jil Sander und entwarf danach in Berlin Kleider, Handtaschen und Accessoires für Donna Karan, Goldpfeil, Escada und Louis Vuitton. 2008 gründete er die Anton Groger Luxury Goods GmbH in Potsdam.
Ebenso in der Mappe enthalten zehn weitere kleinfomatige Modeentwürfe, teils mit Stoffproben und Maßangaben, neun großformatigere Zeichnungen, teils signiert und datiert, zum Thema Mode, ein Entwurf eines Colliers, eine Studie auf Transparentpapier, vier mit Stift überarbeitete Prints mit Mannequins und acht weitere Blatt im Zusammenhang mit Modenentwürfen (Fotos, Plakat, Pausvorlagen) sowie eine Preisliste von „Anton Groger, Hamburg“. Insgesamt 46 Blatt



6675
Hermès

Chemin de Corail (Seidenhalstuch).
SeidenTwill (100% Seide), handgerollt, in Fuchsia, Grau und Burgund. Ca. 90 x 90 cm. Annie Faivre für Hermès, 2016.
200 €
Die namenhafte Designer Annie Faivre ist vor allem mit ihren HalstuchEntwürfen für die Luxusmarke Hermès bekannt geworden. Sie studierte sowohl an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts als auch an der École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs. Seit 1980 bereits ist sie für Hermès tätig; ihre berühmtesten Kreationen waren Le Roy Soleil, das die Pracht von König Ludwig XIV. einfängt, und Grands Fonds, ein Design, das von den Tiefen des Ozeans und dem Meeresleben inspiriert ist. Mit dem vorliegenden Tuch aus der Kollektion Chemin de Corail geht sie diesen Weg weiter und kreiert einen fantastischen Reigen um die Darstellung der Koralle, dieses zerbrechlichen Meeresorganismus, dessen rätselhafte Natur durch eigentümliche Bezeichnungen wie Engelshaut, Blutblume, Blutschaum unterstrichen wird. Typischerweise signiert Annie Faivre mit einem kleinen Affen; dieser befindet sich auch auf unserem Halstuch, leicht versteckt direkt neben ihrem Namen.
6676
Hermès
HSS Birkin 30, TriColor, Fuchsia, Orange, Taupegrau, Palladium Hardware.
Leder Togo/Clemence. H. 22 cm x Br. 30 cm x T. 16 cm. 2012.
16.000 €
Die Geschichte der Hermès Birkin Bag beginnt im Jahr 1984 – auf einem Flug von Paris nach London. Die Schauspielerin Jane Birkin saß zufällig neben JeanLouis Dumas, dem damaligen Chef des

Luxuslabels Hermès. Als ihre Handtasche herunterfiel und sich der Inhalt über den Boden verstreute, beklagte die Schauspielerin, dass sie keine elegante und zugleich praktische Tasche für den Alltag finde. Dumas hörte zu – und entwarf kurz darauf ein Modell ganz nach ihren Wünschen: geräumig, luxuriös, aus feinstem Leder gefertigt. So entstand die Birkin Bag – und wurde zum ultimativen Statussymbol. Bis heute steht sie für zeitlose Eleganz, Handwerkskunst und begehrte Exklusivität.
Diese wunderschöne HSS Birkin 30 in drei Farben ist innen komplett in Orange gehalten und hat eine kleine Einstecktasche sowie eine Reisverschlusstasche im Innenraum. Sie kommt mit der Clochette inkl. zwei Schlüsseln mit Staubbeutelchen, dem großen Staubbeutel sowie der OriginalBox. Sie ist zudem eine Special Order, zu erkennen an der sogenannten HorseshoeStampPrägung.

6677
Karl Lagerfeld (1933 Hamburg – 2019 NeuillysurSeine)
Modezeichnung („Dominique, robe de dentelle blanche“).
Schwarze und farbige Faserschreiber und Farbkreide sowie mit Stecknadel beimontiertes Stoffmuster auf leichtem Velinkarton. 50 x 21,5 cm. Oben rechts mit Bleistift bezeichnet „457“ sowie unten links „Dominique“, rechts mit Fineliner in Schwarz mit Materialangaben. Um 1965.
1.200 €
Provenienz: Archiv Tiziani, Rom. Nachlass Raf Ravaioli.
Privatsammlung Palm Beach, Florida. Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion am 18. April 2019, Los 68.
Sammlung Henning Lohner, Berlin.
6678
Hermès
Gürtel mit LogoSchnalle. Straußenleder in Tangerine, emaillierte Palladium HSchnalle. Länge 113,5, Breite 3 cm. Mit originalem Staubbeutel und Box.
1.500 €


6679
Anna Lena Straube (geb. 1978 in Bremen)
„Gemini“.
Acryl auf Leinwand. 200 x 150 cm. Verso betitelt, datiert und signiert: „‚Gemini‘ 2025 aus Werkphase ‚lost in fiction‘ Al Straube“, sowie mit weiterer eigenhändiger Bezeichnung, Datierung und Signatur, die anschließend von der Künstlerin durchgestrichen wurden: „‚captis‘ aus ‚cut work‘ 2018 Al Straube“.
12.000 €


6679a
Halsschmuck
Festliches KragenCollier. 4reihige Halskette in VForm, beweglich gearbeitet, aus schwarzen, facettierten Glassteinen mit Hakenverschluss. Böhmen, vermutlich Gablonz, um 1870/80.
180 €
Beweglich gearbeitetes Collier aus vier Reihen schwarzer Glassteine, in Imitation von Jet, möglicherweise als Trauerschmuck gedacht.
6680
Raoul Dufy (1877 Le Havre – 1953 Forcalquier)
Triangles blanches, fond noir. Tusche und Gouache auf schwarz beschichtetem Glanzpapier. 50,5 x 60,6 cm. Unten rechts mit dem Stempel „RD / BIANCHINI FERIER“ in Rot, im Unterrand mit Bleistiftnumerierungen „52793“ sowie Markierungslinien in Rot, verso dreifach bezeichnet „52793“. Wohl um 1912.
500 €
Provenienz: MirabaudMercier, Paris, Auktion am 14. Dezember 2021, Los 100.
Sammlung Henning Lohner, Berlin.
Der subtil gestaltete Textilentwurf erinnert in seiner Wirkung an die Zartheit von Klöppelspitze. Die Markierungen in der Darstellung weisen auf eine konkrete Verwendung der Entwurfszeichnung hin.

6681
Richard Avedon (1923 New York, N.Y. – 2004 San Antonio, TX)
Barbra Streisand gekleidet in Madame Grès für Vogue.
Silbergelatineabzug auf Agfa Papier. 50,8 x 40,6 cm. Rückseitig in Bleistift beschriftet „Avedon Vogue March 15 1966“.
2.000 €
Richard Avedon revolutionierte die Mode und Porträtfotografie mit seiner dynamischen Bildsprache und seiner Fähigkeit, die Persönlichkeit seiner Modelle mit außergewöhnlicher Intensität einzufangen. Seine Arbeiten für Vogue und Harper’s Bazaar prägten über Jahrzehnte das visuelle Verständnis von Eleganz und modernem Glamour. Im März 1966 reiste die damals 23jährige
Barbra Streisand mit Avedon nach Paris, um für die Vogue die neuesten HauteCoutureKreationen zu präsentieren. Diese Zusammenarbeit führte zu einer ikonischen Bildstrecke, die Streisand in Entwürfen von Yves Saint Laurent und Lanvin zeigte. Ein besonders bemerkenswertes Porträt aus dieser Serie zeigt Streisand in einer Kreation von Madame Grès. Avedon inszenierte sie vor einem minimalistischen Hintergrund, wobei die streng symmetrische Komposition und der intensive Ausdruck der Sängerin ihre fast überlebensgroße Präsenz betonen. Die skulpturalen Linien des voluminösen Kleides, kombiniert mit experimentellen Accessoires, verleihen dem Bild eine Qualität, die zwischen Klassik und Futurismus oszilliert. Diese Aufnahme ist ein Paradebeispiel für Avedons Fähigkeit, Modefotografie mit narrativer Tiefe zu verbinden. Er inszeniert Streisand nicht nur als Stilikone, sondern als Persönlichkeit von außergewöhnlicher Kraft und Individualität – ein Bild, das weit über die Ästhetik der 1960er Jahre hinausstrahlt.
A
Aldegrever, Heinrich 6516
Alexander, William 6587
Andri, Ferdinand 6557
Atelier Lizzie Derriey 6633
Aumond, Jean 6617
Avedon, Richard 6681
B
Betzler, Emil 6609
Blumenfeld, Erwin 6541
Busekist, Myra von 6658
C
Cassini, Oleg 6667
Chanel 6657
Chodowiecki, Daniel Nikolaus 6523, 6526
Constantin, Abraham 6536
Courtois, Pierre François 6529
Czerny, Elfriede 6649
D
David, JacquesLouis 6539
Demarchelier, Patrick 6619
Dior, Christian 6668
Dufy, Raoul 66226624, 6626, 6631, 6680
Dürer, Albrecht 6507, 6511
E Erté 6627
F
Faber II, John 6521
Fischer, Arno 6656, 6662
Foulquier, Joseph François 6532
G
Griebel, Ernst 6555
Grison, François Adolphe 6534
Gröning, Karl 6588
Gruau, René 6630
Gründel, Olaf 6674
Guérard, Henri Charles 6553
H
Hamm, Ulrike 65966597
Helnwein, Gottfried 6638
HennequinRêveur 6618
Herber, Elli 6634
Hermès 66756677
Hogarth, William 6533
Hollar, Wenzel 6512, 6514, 6524
Horst, Horst P. 6635, 6639, 6645
I
Imans, Pierre 6615
K
Kaemmerer, Frederik H. 6564
KalousScheffer, Gret 6628
Klebig, Robert (Bob) 65086509, 6522
Klinger, Julius 6632
Köthe, Fritz 6558
Kunisada, Utagawa 66026603
L
Lagerfeld, Karl 66546655, 6663, 6666, 6673, 6678
Leiter, Hans 6567
Lepape, Georges 6590
Lindström, Carl Jacob 6551
Luza y Argaluza, Reynaldo 6595


M
Maison Belloir et Vazelle 6500
Mašić, Nikola 6560
Masjutin, Wassili
Nikolajewitsch 65016502
Maywald, Willy 6648
Menzel, Adolph von 6562
Modesalon Schwestern Flöge 65736574
Moncornet, Baltazar 6517
Munkacsi, Martin 66466647
N
Naundorf, Cathleen 66436644
O
Ofenschiessl, Franziska 6580
Orlik, Emil 6599, 66056606
P
Penn, Irving 6620
Pflaumer, Eugen 65766578
Pitteri, Marco Alvise 6531
R
Rágóczy, Joachim 6625
Relang, Regina 66706671
Romme, Martha 6594
Roybet, Ferdinand 6566
S
Saar, Karl von 6547
Sander, Jil 6641
Savery, Salomon 6540
Schenck, Pieter 6503
Schindler, Osmar 6559
Schlichter, Rudolf 6613
Seguso, Archimede 6653, 6664
Snischek, Max 6636
Stern, Bert 6525, 6660
Straube, Anna Lena 6543, 6641, 6679
T
Tegg, Thomas 6556
Teyler, Johann 6504
Trockel, Rosemarie 6554
Trung, Nguyen van 6604
U
Ullmann, My 6570, 65836585
V
Vostell, Wolf 65056506
Vuitton, Louis 6650, 6652, 6661
W
Waltermann, Susanne 6552
Wanke, Alice 6575
Westwood, Vivienne 6651
Wiener Werkstätte 6571
X
XOOOOX 6659
Y
Yves Saint Laurent 6669, 6672
Z
Zille, Heinrich 6569



Kunst- und Fotoauktionen
29. Mai bis 4. Juni 2025
Telefon: (030) 893 80 29-0 Fax: (030) 891 80 25 E-Mail: art@bassenge.com Kataloge online: www.bassenge.com
1. Die Galerie Gerda Bassenge KG, nachfolgend Versteigerer genannt, versteigert als Kommissionärin im eigenen Namen und für Rechnung ihrer Auftraggeber (Kommittenten), die unbenannt bleiben. Die Versteigerung ist freiwillig und öffentlich im Sinne des § 383 III BGB.
2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
3. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Ver steigerung besichtigt und geprüft werden. Die Sachen sind gebraucht. Erhaltungszustände der einzelnen angebotenen Arbeiten bleiben im Katalog in der Regel unerwähnt. Die Katalogbeschreibungen sind keine Garantien im Rechtssinne und keine vertraglich vereinbarten Beschaffenheitsangaben. Gleiches gilt für individuell angeforderte Zustandsberichte. Sie bringen nur die subjektive Einschätzung des Versteigerers zum Ausdruck und dienen lediglich der unverbindlichen Orientierung. Alle Gegenstände werden in dem Erhaltungszustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des Zuschlages befinden. Soweit nicht in der Katalogbeschreibung explizit erwähnt, sind Rahmungen nicht bindender Bestandteil des Angebots. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitig vorgetragener, begründeter Mängelrügen innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Zuschlags seine Ansprüche gegenüber dem Einlieferer (Auftraggeber) geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Erwerber den Kaufpreis samt Aufgeld. Die Haftung des Versteigerers auf Schadensersatz für Vermögensschäden – gleich aus welchem Grund – ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Versteigerer fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt.
4. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Wenn mehrere Personen dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sachen erneut ausbieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
5. Im Falle eines schriftlichen Gebotes beauftragt der Interessent den Versteigerer für ihn während der Versteigerung Gebote abzugeben. In schriftlichen Aufträgen ist bei Differenzen zwischen Nummer und Kennwort das Kennwort maßgebend.
6. Telefonische Gebote und Online-Direkt-Gebote über das Internet bedürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Für die Bearbeitung übernimmt der
Versteigerer jedoch keine Gewähr. Telefonische und OnlineGebote werden nur akzeptiert, wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch bei Nichtzustandekommen einer Verbindung gilt, dass für den Auktionator dieses Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Für das Zustandekommen einer entsprechenden Telefon- oder Onlineverbindung übernimmt der Versteigerer keine Gewähr. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB).
7. Mit der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr für nicht zu vertretende Verluste und Beschädigung auf den Ersteigerer über. Das Eigentum an den ersteigerten Sachen geht erst mit vollständigem Zahlungseingang an den Erwerber über.
8. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 30% zu entrichten, in dem die Umsatzsteuer ohne separaten Ausweis enthalten ist (Differenzbesteuerung) oder ein Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer (Regelbesteuerung) von z.Zt. 7% (Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Graphiken, Bücher etc.) bzw. 19% (Handschriften, Autographen, Kunstgewerbliche Gegenstände, Siebdrucke, Offsets, Fotografien, etc.). Die im Katalog mit einem * gekennzeichneten Objekte unterliegen in jedem Fall der Regelbesteuerung (Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer von z.Zt. 7% bzw. 19%). Bei den im Katalog mit einem ^ gekennzeichneten Objekten ist Einfuhrumsatz steuer angefallen. In diesen Fällen wird zusätzlich zu einem Aufgeld von 27% (Differenzbesteuerung) die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 7% auf den Zuschlag erhoben.
Für bundesdeutsche Kunsthändler und Antiquare, die zum Vor steuer abzug berechtigt sind, kann die Gesamt rech nung auf Wunsch, wie bisher nach der Regelbesteuerung ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (außerhalb der EU) und – bei Angabe ihrer USt.-Identifikations-Nr. bei Auftragserteilung als Nachweis der Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen –auch an Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, unter der Voraussetzung, dass sie für gewerblichen Gebrauch einkaufen. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung ist nicht möglich. Alle anderen Käufe aus EU-Ländern unterliegen der Umsatzsteuer. Ausländischen Käufern außerhalb der Europäischen Union wird die Umsatzsteuer erstattet, wenn binnen 4 Wochen nach der Auktion der deutsche zollamtliche Ausfuhrnachweis und der zollamtliche Einfuhrnachweis des entsprechenden Importlandes erbracht werden. Bei Versand durch uns gilt der Ausfuhrnachweis als gegeben. Bei Online-Live-Geboten über Internetplattformen erhöht sich das Aufgeld um die dort anfallende Transaktionsgebühr (i. d. R. 3-5%). Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedür fen einer besonderen Nachprüfung und eventueller Berichtigung; Irrtum vorbehalten. Katalog- und Zusatzabbildungen dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Reproduktionsrechte und digitale Dateien der Abbildungen können gegen Gebühr erworben werden. Gegebenen-
falls noch bestehende Urheberrechte Dritter bleiben davon unberührt und müssen u.U. gesondert eingeholt werden.
9. Die Auslieferung der ersteigerten Stücke erfolgt in unseren Geschäftsräumen gegen Bezahlung. Kreditkarten (Mastercard, VISA, American Express), Schecks sowie andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Bankspesen/ Transaktionsgebühren bzw. Kursverluste können zu Lasten des Käufers gehen. Die Auf bewahrung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Versand wird gegen Vorabrechnung des Rechnungsbetrages ausgeführt. Die Versandspesen sowie die Kosten für Versicherung gegen Verlust und Beschädigung gehen zu Lasten des Käufers. Übersteigen die tatsäch lichen Versandkosten die vorab berechnete Pauschale, so wird die Differenz dem Käufer nachträglich in Rechnung gestellt.
10. Bei der Ausfuhr von Kulturgütern ist gem. der EG-Verordnung Nr. 116/2009 bzw. § 24 KGSG abhängig von Kategorie und Wert des Objekts ggf. eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Aus Gründen des Artenschutzes können Objekte aus bestimmten, geschützten Materialien (u.a. Elfenbein, Schildpatt, Perlmutt und einige Korallenarten) besonderen Im- und Exportbeschränkungen unterliegen. Zum Zwecke des Exports (insbesondere außerhalb der Europäischen Union) kann hierfür eine spezielle Ausfuhrgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erforderlich sein. Entsprechende Ausfuhrgenehmigungen können nur unter strengen Bedingungen erteilt und ggf. auch gar nicht erlangt werden, auch kann der Import dieser Gegenstände in manche Staaten eingeschränkt oder untersagt sein. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich, sich über etwaige Im- und Exportbeschränkungen zu informieren. Export und Import entsprechender Objekte erfolgen allein auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
11. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Der Versteigerer ist berechtigt, falls nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Versteigerung Zahlung geleistet ist, den durch den Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrag ohne weitere Fristsetzung zu annullieren, Verzugszinsen in
banküblicher Höhe – mindestens jedoch 1 % auf den Bruttopreis je angebrochenen Monat – zu berechnen und von dem Ersteigerer wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals versteigert wird und der säumige Käufer für einen Mindererlös gegenüber der vorangegangenen Versteigerung einschließlich der Gebühren des Auktionshauses aufzukommen hat. Zu einem Gebot wird er nicht zugelassen, auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen Anspruch.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand im vollkaufmännischen Verkehr ist Berlin. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UNAbkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
13. Die im Katalog aufgeführten Preise sind Schätzpreise, keine Limite.
14. Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung, bei der der Interessent entweder telefonisch oder schriftlich (im Sinne der Ziffern 5 und 6) den Auftrag zur Gebotsabgabe mit einem bestimmten Betrag erteilt. Entsprechende Gebote behalten ihre Gültigkeit für 4 Wochen nach Abgabe.
15. Die Abgabe eines Gebotes in jeglicher Form bedeutet die Anerkennung dieser Versteigerungsbedingungen. Der Versteigerer nimmt Gebote nur aufgrund der vorstehenden Versteigerungsbedingungen entgegen und erteilt dementsprechend Zuschläge. Kommissionäre haften für die Käufe ihrer Auftraggeber.
16. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt.
David Bassenge, Geschäftsführer und Auktionator
Dr. Markus Brandis, öffentlich bestellter u. vereidigter Auktionator

Stand: Mai 2025
1. The Galerie Gerda Bassenge KG, subsequently called “the auctioneer” carries on business as commission-agent in its own name on behalf of its voluntary consignors. This auction sale is a public one in the sense of § 383 III BGB.
2. The auctioneer reserves the right to combine, to split, to change or to withdraw lots before the actual final sale.
3. All objects put up for auction can be viewed and examined prior to the sale at the times made known in the catalogue. The items are used and sold as is. As long as not explicitly mentioned in the catalogue description, framing is not an inherent part of the offer. As a rule, the condition of the individual work is not given in the catalogue. Catalogue descriptions are made with as much care as possible, but the descriptions do not fall under the statutory paragraph for guaranteed legal characteristics. The same applies for individually requested condition reports. These also offer no legal guarantee and only represent the subjective assessment of the auctioneer while serv ing as a non-binding orientation. The liability for damage to life, body or health shall remain unaffected. In case of a justified claim, however, he will accept the responsibility to make a claim for restitution on behalf of the buyer against the consignor within a period of 12 months, running from the fall of the hammer. In the event of a successful claim the auctioneer will refund the hammerprice plus premium.
4. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be deemed the buyer. In case of identical bids the buyer will be determined by drawing lots. In the event of a dispute the auctioneer has the absolute discretion to reoffer and resell the lot in dispute. He may also knock down lots conditionally.
5. In the case of a written bid the bidder commissions the auctioneer to place bids on his behalf during the auction. In cases where there is a discrepancy between number and title in a written bid the title shall prevail.
6. Telephone and direct online bidding via the internet must be approved in advance by the auctioneer. The auctioneer cannot be held liable for faulty connections or transmission failure. In such a case the bidder agrees to bid the reserve price of the corresponding lot. For such bidding the regulations of long distance contracts do not apply (Fernabsatzverträge) [cf § 312g II,10 BGB].
7. On the fall of the auctioneer’s hammer title to the offered lot will pass to the acknowledged bidder. The successful buyer is obliged to accept and pay for the lot. Ownership only passes to the buyer when full payment has been received. The buyer, however, immediately assumes all risks when the goods are knocked down to him.
8. A premium of 30% of the hammer price will be levied in which the VAT is included (marginal tax scheme) or a premium of 25% of the hammer price plus the VAT of 7% (paintings, drawings, sculptures, prints, books, etc.) or 19% (manuscripts, autographs letters, applied arts, screen prints, offset prints, photographs, etc.) of the invoice sum will be levied (regular tax scheme). Buyers from countries of the European Union are subject to German VAT. Items marked with an * are subject to the regular tax scheme (premium of 25% of the hammer price plus the current VAT of 19%). Items marked with an ^ are subject to import duty. In these cases in addition to a premium of 27% (marginal tax scheme), the charged import tax of currently 7% will be added to the hammer price.
Exempted from these rules are only dealers from EU-countries, who are entitled, under their notification of their VAT ID-Number, to buy on the basis of VAT-free delivery within the European Union. Notification of VAT ID-Numbers must be given to the auctioneer before the sale.
For buyers from non EU-countries a premium of 25% will be levied. VAT will be exempted or refunded on production of evidence of exportation within 4 weeks of the auction, or, if appropriate, importation to another country. This is taken as given when the dispatch is effected by us.
Live bidding through online platforms entails a transaction fee stipulated by the platform and will be added to the premium (usually 3-5% of the hammer price).
Due to the work overload of the accounting department during auctions, invoices generated during or directly after an auction require careful revision and possible correction; errors excepted. Catalogue images may not be used without permission. Reproduction rights and digital files can be acquired for a fee. Any copyrights of third parties that may still exist remain unaffected by this and may have to be obtained separately.
9. Auction lots will, without exception, only be handed over after pay ment has been made. Credit cards (VISA, Mastercard, American Express), checks and any other form of non-cash payment are accepted only on account of performance. Exchange rate risk and bank charges may be applicable. Storage and dispatch are at the expense and risk of the buyer. If the shipping costs exceed the lump sum on the invoice the outstanding amount will be billed separately.
10. According to regulation (EC) No. 116/2009 resp. § 24 KGSG, export license may be necessary when exporting cultural goods depending on the type or value of the object in question. For the purposes of wildlife conservation, it is necessary to obtain an export license according to regulation (EC) No. 338/97 when exporting objects made from certain protected materials (incl. ivory, tortoiseshell, mother-of-pearl and certain corals) out of the territory of the European Community. Export licenses for objects made of
protected materials are only granted under strict conditions or may not be granted at all. The import of such objects may be restricted or prohibited by certain countries. It is the buyer’s responsibility to inform himself, whether an object is subject to such restrictions. Export and import of such objects are at the expense and risk of the buyer.
11. The buyer is liable for acceptance of the goods and for payment. The purchase price shall be due for payment upon the lot being knocked down to the buyer. In case of a delayed payment (two weeks after the sale) the purchaser will be held responsible for all resultant damages, in particular interest and exchange losses. In case of payment default the auctioneer will charge interest on the outstanding amount at a rate of 1% to the gross price per month or part of month. In such an event the auctioneer reserves the right to annul the purchase contract without further notice, and to claim damages from the buyer for non-fulfilment, accordingly he can reauction the goods at the buyer’s expense. In this case the buyer is liable for any loss incurred, the buyer shall have no claim if a higher price has been achieved. He will not be permitted to bid.
12. The place of fulfillment and jurisdiction is Berlin. German law applies exclusively; the UN-Treaty (CISG) is explicitly excluded.
13. The prices quoted after each lot are estimates, not reserves.
14. The after-sales is part of the auction in which the bidder places either by telephone or in written form (as stated in number 5 and 6) the order to bid a set amount. Corresponding bids are binding for 4 weeks after submission.
15. By making a bid, either verbally in the auction, by telephone, written by letter, by fax, or through the internet the bidder confirms that he has taken notice of these terms of sale by auction and accepts them. Agents who act on behalf of a third party are jointly and separately liable for the fulfillment of contract on behalf of their principals.
16. Should one or the other of the above terms of sale become wholly or partly ineffective, the validity of the remainder is not affected. In the event of a dispute the German version of the above conditions of sale is valid.
David Bassenge, auctioneer Dr. Markus Brandis, attested public auctioneer

As of May 2025


Idee und Konzept
Dr. Ruth Baljöhr
Texte
Jennifer Augustyniak
Dr. Ruth Baljöhr
Eva Dalvai
Selma El Sayed
Katharina Fünfgeld
Simone Herrmann
Lea Kellhuber
Nadine Keul
Miriam Klug
Stephan Schurr
Giovanni Teeuwisse
Harald Weinhold
Gestaltung und Satz
Stefanie Löhr
Reproduktionen
Ana Briceño
Philipp Dörrie
Torben Höke
Stefanie Löhr
Clara Schmiedek
Fotografie
Philipp Dörrie
Torben Höke
Philipp Lohöfener
