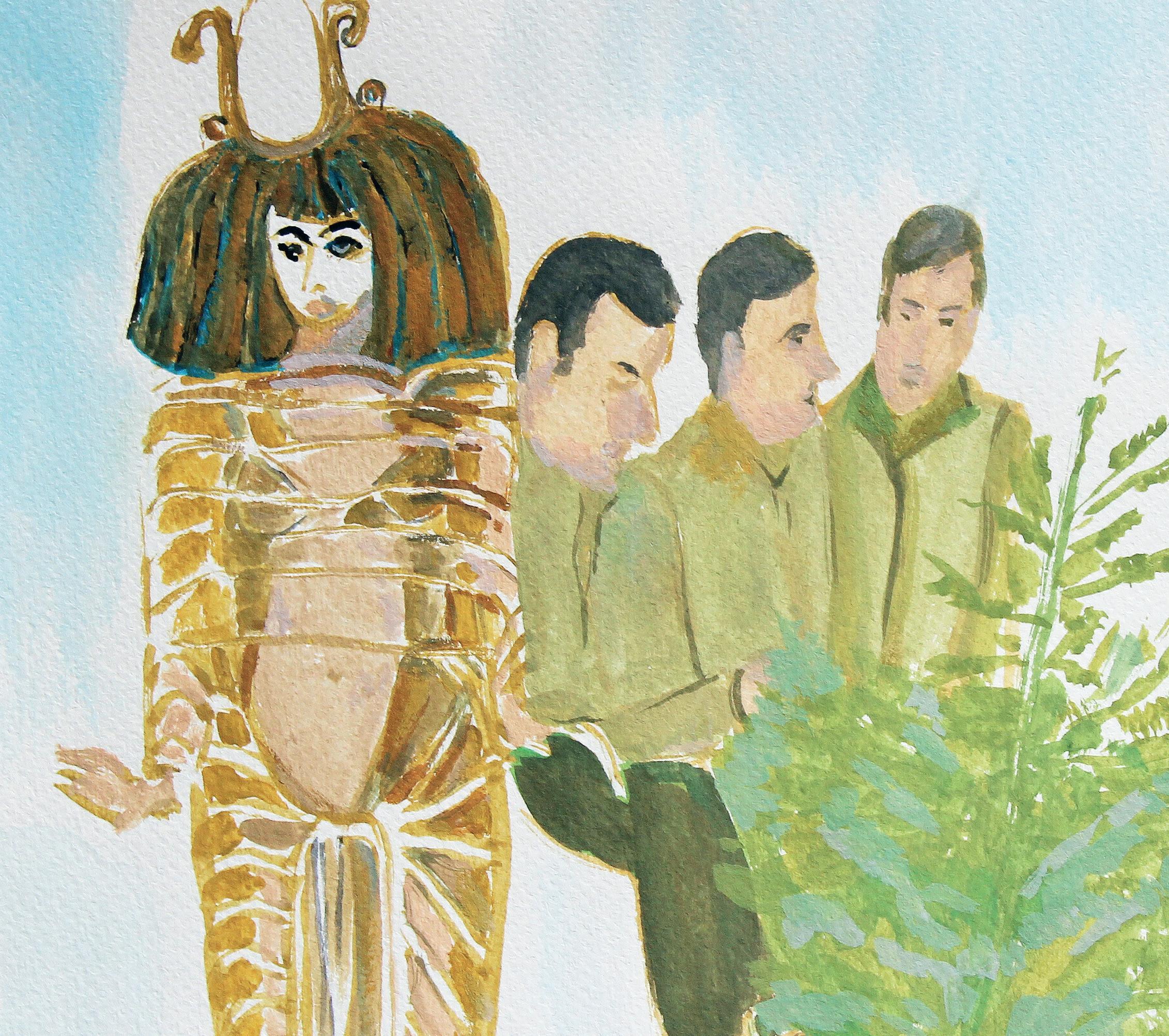
8 minute read
Der Avantgardist im Jenseits Seite
Der Avantgardist im Jenseits
Dem Dichter Friedrich Hölderlin ist ein neues, vielfältiges Buch gewidmet
Mythen ranken sich um einen Dichter, der unter dem Pseudonym „Scardanelli“ seine letzten Werke schrieb. Friedrich Hölderlin, 1770 in Lauffen am Neckar geboren und 1843 in Tübingen gestorben, darf immer noch als einer der bedeutendsten Lyriker auch unserer Zeit gelten. 2020 war ein Gedenkjahr, doch ließen die Wellen der Pandemie die meisten Feiern und Veranstaltungen untergehen oder zu entsinnlichten Treffen in der digitalen Sphäre verkommen. Projekte, in denen geprüft werden sollte, ob Hölderlins Werk uns noch begeistern und kraft der Begeisterung einen Weg zur Besonnenheit weisen kann, blieben ebenso unverwirklicht wie einst Hölderlins Traum von einer Deutschen Republik.
Dennoch gab und gibt es weiterhin Versuche, den Dichter aufleben zu lassen. So auch der Band „Hölderlins fragwürde Aktualität“, der im Juli dieses Jahres bei Königshausen und Neumann erschienen ist. Darin stellen die unterschiedlichsten Beiträge Hölderlin auf den „Prüfstand“. Ziel ist, Enthusiasmus und Nüchternheit im Lichte jener „höheren Aufklärung“ zu vereinigen, die der Dichter betreiben wollte. Dazu werden verschiedene Medien, Genres und Formate genutzt: Gedichte, persönliche Statements, Bilder, literarische Essays, gelehrte Abhandlungen und auch das LyricConcert HölderlinGroove.
Worin die Modernität Hölderlins besteht, hat die Forschung bereits in den 1990erJahren mit Nachdruck zu bestimmen versucht und – so wird vielfach behauptet – auch erschöpfend dargelegt. Etwa Gerhard Kurz, Valérie Lawitschka und Jürgen Wertheimer als Herausgeber von „Hölderlin und die Moderne. Eine Bestandsaufnahme“, Tübingen 1995.
Demnach haben Hölderlins Schriften für die Moderne eine paradigmatische Funktion. Seine ist eine Sprache, die stets an ihren eigenen Rändern balanciert und zwischen Erzählen, Singen, Zirpen, Klingen und dem Vorantreiben einer Handlung changiert – etwa in seinem Roman „Hyperion“. Bei dessen Analyse gelangt die Germanistik an ihre Grenzen. Der Text ist einer, der aus dem Rahmen fallen möchte, wie auch sein Dichter selbst aus dem Rahmen fällt. Als er den Text verfasste, kippte Hölderlin in eine Art „geistige Umnachtung“, aus der er Zeit seines Lebens nicht mehr herausfinden sollte. So entstand dieser Brief
TEXT: SOPHIE REYER
„Zu einem modernen Dichter wird Hölderlin, indem er sich jenseits des Postulats der Nachahmung der Antike mit den alten Mustern kritisch auseinandersetzt, um daraus eine poetische Logik zu entwickeln , die neue Formen des Dichtens in Szene zu setzen vermag“
ACHIM GEISENHANSLÜKE, LITERATURWISSENSCHAFTLER, GOETHE-UNIVERSITÄT, FRANKFURT AM MAIN
Hölderlins frag-würdige Aktualität, Lisa Wolfson, Sophie Reyer (Hg.), Königshausen & Neumann, 2022, ISBN-13: 9783826069758
roman vor einem drastischen autobiografischen Hintergrund.
Hyperion, ein Mann mittleren Alters, erzählt seinem deutschen Freund Bellarmin in Form von Briefen über sein Leben. Er wächst in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Südgriechenland auf. Die Liebe zur Natur sowie ein wohliges SichWiegen im Einklang mit allen Dingen bestimmen seine Existenz. Gleich zu Beginn des Texts begegnet dem fiktiven IchErzähler, einem literarischen Hybrid, das an manchen Stellen mit dem Ich des Autors zu verschwimmen scheint, die Einheit mit der Allheit in Form von sprudelnden Quellen, Wolken und Wiesen. Doch „wer bloss an einer Pflanze riecht, der kennt sie nicht!“
Der Lehrer Adamas führt ihn in die Heroenwelt des Plutarch und weiter in das Zauberland der griechischen Götter ein. Es gelingt ihm, Hyperion für die griechische Vergangenheit zu begeistern, der junge Mann wird, von großen Sehnsucht gepackt, zum Suchenden. Sein Freund Alabanda weiht ihn in Pläne zur Befreiung Griechenlands vom osmanischen Joch ein. Dann verliebt sich Hyperion in Diotima, die ihm die Kraft zum Handeln eingibt – er nimmt 1770 am Befreiungskrieg der Griechen gegen die Osmanen teil.
Wie es schon in den ersten Zeilen des Briefromans angedeutet wird, ist alles in der Welt von der Sehnsucht geprägt, zum Urquell zurückzukehren. Während er den Schmerz sinnloser Schlachten erlebt, kehrt in Hyperion die Sehnsucht nach Natur und der Seligkeit des SichinihrWiegens zurück. Abgestoßen von der Rohheit des Krieges und schließlich schwer verwundet muss er zusehen, wie Alabanda flieht und seine Geliebte Diotima stirbt. Er geht nach Deutschland, aber auch dort wird ihm das Leben unerträglich. Nach Griechenland zurückgekehrt, fristet er sein Dasein als Eremit, findet Schönheit in der Einsamkeit und der Natur und überwindet alle Tragik, die im Alleinsein des Menschen liegt. Mit der Schöpfung verbunden, erlebt Hyperion den Rest seiner Tage – mit Versen, die von ihr singen. Ist er „heimgekehrt“?
Der Text selbst hält diese Frage offen: „Hyperion“ weist wohl eine Fülle an Eigenheiten des Briefromans, des Entwicklungsromans und des Bildungsromans auf, evoziert aber auch die Form des Dramas. Etwa durch ein monologische Sprechen, das auf ein „Du“, auf ein Publikum, ausgerichtet ist. Es gilt dem Freund, an den die Briefe adressiert sind, ließe sich aber auch in Bühnengeschehen umsetzen. „Hyperion“, ein Hybrid, changiert zwischen archaischen Strukturen und modernen Sprachansätzen. Dieser Text des laut Zeugenaussagen meist „umnachteten“ Dichters ist lyrische Epik, stets oszillierend zwischen Sprachspiel und dem Weitertreiben einer Handlung. Damit erinnert er auch noch an Rezitative und Arien einer Oper. Ist „Hyperion“ eines der ersten modernen Musiktheater?
Was Hölderlin zum literarischen Avantgardisten macht, sucht die Anthologie „Hölderlins fragwürde Aktualität“ zu entdecken. Der Literaturwissenschaftler Achim Geisenhanslüke fasst die wichtigsten Erkenntnisse und Thesen pointiert zusammen. „Hölderlin folgt der ,Querelle des Anciens et des Modernes‘, um sie dialektisch zu überwinden: Hatte die griechische Poesie, wie Hegel und Hölderlin überzeugt sind, in der Form der Tragödie ihre Erfüllung gefunden, so fordert die moderne Poesie nach einer eigenen, davon unterschiedenen Form. Hölderlin sucht sie zunächst im Kontext der Tragödie selbst, indem er sich darum bemüht, mit dem ,Tod des Empedokles‘ eine eigene dramatische Form zu finden. Aus dem Scheitern seiner Bemühungen zieht er ebenso radikale wie produktive Konsequenzen: Die lyrischen Bestandteile der antiken Tragödie, die Chorlieder, wie die Anknüpfung an Pindar führen ihn zu den neuen hymnischen Formen, die sein Spätwerk bestimmen. Anstelle des gattungspoetisch und geschichtsphilosophisch begründeten Vorrangs der antiken Tragödie, wie ihn noch Hegel in seiner ,Ästhetik‘ zu begründen versucht, gewinnt bei Hölderlin die Lyrik eine paradigmatische Funktion für die Moderne – eine Lyrik, die geschichtsphilosophisch auf der Differenz zwischen Antike und Moderne beharrt und zugleich in ihrer eigenen Formbestimmtheit gattungspoetische Grenzen außer Kraft zu setzen sucht. Zu einem modernen Dichter wird Hölderlin, indem er sich jenseits des Postulats der Nachahmung der Antike mit den alten Mustern kritisch auseinandersetzt, um daraus eine poetische Logik zu entwickeln, die eigenen Gesetzen gehorcht und so neue Formen des Dichtens in Szene zu setzen vermag.“
: GEDICHT MICHAEL DONHAUSER: WIE GRAS
Michael Donhauser
Seit „Der Holunder“, einer Sammlung von Prosagedichten aus 1986, veröffentlichte der in Wien lebende Autor Michael Donhauser (geb. 1956 in Vaduz) ein gutes Dutzend Bücher – Prosa, Lyrik und Übersetzungen. Zuletzt erschienen im Berliner Verlag Matthes & Seitz die Stifter-Paraphrase „Waldwand“ (2016) und „Wie Gras. Legenden“ (2022).
Nah den Bäumen, ihren Nüssen, nah dem Lispeln wie von Blättern war bewegt, was sich als Äste steif dem Taumel widersetzte, während Halmen gleich bald wankte, bald sich neigte dieses Leben, das uns rührte durch die Anmut seiner Schönheit im Vergehen.
AUS: MICHAEL DONHAUSER: WIE GRAS. LEGENDEN. MATTHES & SEITZ, BERLIN 2022
: BIG PICTURE AUS BUDAPEST
LÁSZLÓ LÁSZLÓ RÉVÉSZ (AUSSCHNITT)
: IMPRESSUM
Medieninhaber: Falter Verlagsgesellschaft m. b. H., Marc-Aurel-Straße 9, 1010 Wien, T: 0043 1 536 60-0, E: service@falter.at, www.falter.at; Redaktion: Christian Zillner; Fotoredaktion: Karin Wasner; Gestaltung und Produktion: Andreas Rosenthal, Nadine Weiner, Raphael Moser; Korrektur: Ewald Schreiber; Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau; DVR: 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter www.falter.at/offenlegung/falterverlag ständig abrufbar. HEUREKA ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit
ERICH KLEIN
: WAS AM ENDE BLEIBT
Tottaubheit
Der ukrainisch-amerikanische Dichter Ilya Kaminsky eröffnet sein großes Poem „Republik der Taubheit“ provokant und spricht vom „Glück während des Krieges“. Damit gemeint ist der distanzierte Zuschauer. Am Schauplatz des Geschehens selbst, in der von fremden Truppen besetzen, fiktiven Stadt Vasenka herrscht Versammlungsverbot. Ein Junge wird erschossen. Dessen Cousine, ganz Antigone, hebt zu einem Klagelied an: Ihr Schrei reißt ein Loch in den Himmel. Es folgen rasch aufeinander Szenen wie in einem Stummfilm. Die Stadt, beginnt sich zu erheben. Verhaftungen setzen ein. Immer wieder wird der tote Junge umkreist. Der Dichter zögert bei dessen Beschreibung: „Der Körper des Jungen liegt auf dem Asphalt wie eine Büroklammer.“ In der nächsten Zeile korrigiert er sich und verwirft die metaphorische Rede: „Der Körper des Jungen liegt auf dem Asphalt wie der Körper eines Jungen.“
Wer sich dichtend am Rande von Tod und Verderben bewegt, läuft Gefahr, in Kitsch zu verfallen. Kaminsky vermeidet das durch eine Strategie der Indirektheit: Über den Todesschuss heißt es nur: „Das Geräusch, das wir nicht hören, schreckt die Möwen vom Wasser“. Auch Taubheit als Symbol des Widerstandes mutet reichlich paradox an. Vor allem aber wendet sich der Dichter mit der örtlichen NichtIdentifikation des ganzen Geschehens gegen die unbeteiligte Leserin und den distanzierten Leser! Ob er mit „Republik der Taubheit“ die Besetzung der Krim, den russischen Krieg in der Ost-Ukraine oder einen anderen Krieg im Sinn hatte, bleibt offen und spielt letztlich keine Rolle. In einem Interview betonte Kaminsky, er habe sein Poem beim Einmarsch der Amerikaner in den Irak konzipiert und dann fünfzehn Jahre daran gearbeitet. Einige Szenen polizeilicher Gewalt könnten in den USA spielen oder an die leeren Straßen während der Pandemie der letzten Jahre erinnern. Wäre also alles eins?
Ganz im Gegenteil! Der erste Akt des Poems endet mit einer Art Hymnus, einer rhetorischen Frage und einer minimalistischen Antwort: „Was ist Stille? Etwas vom Himmel in uns.“ Im zweiten Akt nehmen surreal Bilder voller Gewalt überhand – am Ende steht abruptes Aufwachen wie aus einem Alptraum. „Wir sitzen im Publikum, reglos. Stille saust, wie die Kugel, die uns verfehlt hat.“ Die Dichtung bringt die Pastorale unseres Alltags gehörig ins Wanken: Der Schrecken dieser Welt ist nicht abzuschalten. Sind es nicht wir, die in einer „Republik der Taubheit“ leben? Dementsprechend lautet der Schluss: „Was ist ein Mann? Eine Stille zwischen zwei Bombardements.“







