
Leipziger Ausgabe der Werke von
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Leipziger Ausgabe der Werke von
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Herausgegeben von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Serie VI · Geistliche Vokalwerke Band 12


Leipziger Ausgabe der Werke von
Herausgegeben von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Serie VI · Geistliche Vokalwerke Band 12
herausgegeben von Clemens Harasim
Edited by the Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Series VI · Sacred Vocal Works
Volume 12
Oratorio for Soloists, Mixed Chorus and Orchestra
edited by Clemens Harasim
Editionsleitung
Christiane Wiesenfeldt ∙ Thomas Schmidt (Vorsitz)
Ralf Wehner ∙ Regina Schwedes
Editionsbeirat
Martin Holmes ∙ Sebastian Klotz ∙ Nick Pfefferkorn ∙ Martina Rebmann ∙ Benedict Taylor Ehrenmitglied: Friedhelm Krummacher
Forschungsstelle
bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Wissenschaftliche Mitarbeiter
Ralf Wehner, Birgit Müller, Clemens Harasim und Tobias Bauer
Die Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy ist ein Forschungsvorhaben der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und wird im Rahmen des Akademienprogramms von der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen gefördert.
Das Akademienprogramm wird koordiniert von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Diese Publikation wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
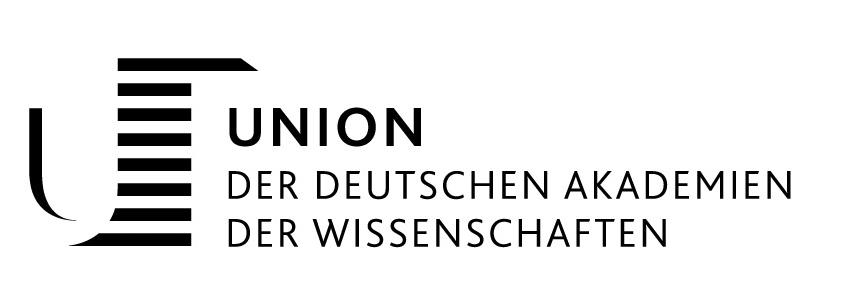

Bestellnummer SON 461 ISMN 979-0-004-80388-2
Notengraphik: Notecraft Europe Ltd. Druck: BELTZ Bad Langensalza GmbH © 2025 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden Breitkopf & Härtel KG Walkmühlstraße 52 65195 Wiesbaden Germany info@breitkopf.com www.breitkopf.com
Printed in Germany
Die Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy verfolgt die Absicht, sämtliche erreichbaren Kompositionen, Briefe und Schriften sowie alle anderen Dokumente seines künstlerischen Schaffens in wissenschaftlich angemessener Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als historischkritische Ausgabe will sie der Forschung und der musikalischen Praxis gleichermaßen dienen.
Im Vordergrund stehen die musikalischen Werke; von ihnen sind nicht nur die vollendeten Kompositionen in all ihren Fassungen, sondern auch die Quellen des Entstehungsprozesses (Skizzen und Entwürfe) ebenso wie die unfertigen Kompositionen (Fragmente) vorzulegen. Daneben ist die von Mendelssohn geführte Korrespondenz außerordentlich wichtig. Die Erkenntnis, dass die zuverlässige Edition der Briefe für die wissenschaftliche Erschließung eines kompositorischen Œuvres unabdingbar ist, gilt allgemein; bei Mendelssohn indes gewinnt die Korrespondenz, die den Komponisten als Zeitzeugen ersten Ranges ausweist, durch den hohen literarischen Wert vieler seiner Briefe besondere Bedeutung. Schließlich dürfen – will man ein umfassendes Bild des Künstlers Mendelssohn bieten – die bildnerischen Werke, vornehmlich Zeichnungen und Aquarelle, nicht fehlen. Ein thematischsystematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (MWV), das 2009 in einer Studien-Ausgabe erschienen ist, soll dazu beitragen, den raschen Zugriff auf das Gesamtwerk zu fördern. Angesichts der Bedeutung Mendelssohns einerseits und dessen wesentlich von außerkünstlerischen Motiven verursachter Vernachlässigung durch die wissenschaftliche wie praktische Rezeption andererseits bedarf selbst ein so umfassend angelegtes Konzept kaum der ausführlichen Rechtfertigung. Die von Julius Rietz zwischen 1874 und 1877 vorgelegte Werkausgabe, oft irrig Alte Gesamtausgabe genannt, war alles andere als vollständig und – anders etwa als die alte Bach-Ausgabe – keineswegs von der Intention getragen, das Gesamtwerk von Mendelssohn vorzulegen; sie hieß dementsprechend bescheiden Felix Mendelssohn Bartholdy’s Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe. Die von Rietz getroffene Auswahl hatte zur Konsequenz, dass ein beträchtlicher Teil der Kompositionen Mendelssohns bis heute noch immer der Veröffentlichung harrt und ein weiterer bislang nur unzulänglich publiziert ist. Daran haben die wenigen Bände der seit 1960 im Deutschen Verlag für Musik, Leipzig, erschienenen Neuausgabe kaum etwas ändern können. Die vorliegende Ausgabe schließt hinsichtlich der zeitlichen Disposition der zu edierenden Kompositionen an diese Leipziger Ausgabe der Werke Felix Mendelssohn Bartholdys an, trägt aber grundsätzlich dem neuesten Standard der Editionsprinzipien wissenschaftlicher Gesamtausgaben Rechnung. Dies bezieht sich namentlich auf die Maxime, dass alle Herausgeberentscheidungen – sei es im Notentext selbst, sei es im Kritischen Bericht – kenntlich und dem kritischen Nachvollzug des Benutzers zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus entspricht die Ausgabe der heute allgemein akzeptierten Überzeugung, dass alle Stationen des Entstehungsprozesses bzw. der vom Komponisten verantworteten Verbreitung (Skizzen, Fassungen, selbstverfasste Versionen wie Klavierauszüge) zum Werk selbst gehören. Diese Auffassung trifft ganz besonders in der spezifischen musikhistorischen Situation zu, in der Mendelssohn sich befand und die ihn dazu führte, den ästhetischen Anspruch des autonomen, ein für allemal abgeschlossenen Kunstwerks in ganz unterschiedlichen Graden der Vollendung zu realisieren. Davon legen die unterschiedlichen Fassungen zahlreicher Werke Zeugnis ab, aber
auch die Tatsache, dass der Komponist selbst viele abgeschlossene Kompositionen nicht der Veröffentlichung für wert hielt. Dies stellt die differenzierende Hermeneutik der Quellen, die den editorischen Entscheidungen vorangehen muss, ebenso wie die editorische Pragmatik vor besonders schwierige Aufgaben, eröffnet aber auch die Chance, hinsichtlich von unfertigen oder unvollendeten Kompositionen beispielgebende Verfahrensweisen der Edition zu entwickeln.
Eine besondere Problematik ergibt sich daraus, dass Mendelssohn nur den von ihm veröffentlichten oder zur Veröffentlichung vorbereiteten Werken Opuszahlen beigegeben hat, viele seiner Werke also ohne autorisierte Opuszahl überliefert sind. Dennoch haben sich – zumal durch die oben genannte von Julius Rietz verantwortete Ausgabe – die Opuszahlen von 73 an fest eingebürgert. Dieser Tatsache trug die vorliegende Ausgabe bis zum Jahre 2009 Rechnung, indem diese Opuszahlen weiter benutzt, aber durch eckige Klammern gekennzeichnet wurden. Seit Erscheinen des Werkverzeichnisses (MWV) wird für die postum veröffentlichten Werke nur noch die dort eingeführte MWV-Bezeichnung verwendet.
Die Ausgabe erscheint in 13 Serien:
Serie I Orchesterwerke
Serie II Konzerte und Konzertstücke
Serie III Kammermusikwerke
Serie IV Klavier- und Orgelwerke
Serie V Bühnenwerke
Serie VI Geistliche Vokalwerke
Serie VII Weltliche Vokalwerke
Serie VIII Skizzen und Fragmente, die den in den Serien I bis VII veröffentlichten Werken nicht zugeordnet werden können; zusammenhängende Skizzenkonvolute
Serie IX Bearbeitungen und Instrumentationen
Serie X Zeichnungen und Aquarelle
Serie XI Briefe, Schriften und Tagebücher
Serie XII Dokumente zur Lebensgeschichte
Serie XIII Werkverzeichnis
Die Werke bzw. diejenigen Fassungen der Kompositionen, denen Werkcharakter zukommt, erscheinen in den Hauptbänden, die auch den Kritischen Bericht enthalten. Sekundäre Fassungen, Klavierauszüge und Skizzen zu den Werken der Serien I bis VII werden in Supplementbänden vorgelegt; bei geringem Skizzenbestand kann dieser dem Kritischen Bericht angefügt werden. Dem jeweiligen Status der Werkgenese entsprechend wird zwischen drei Typen der editorischen Präsentation unterschieden:
– Die Werkedition, deren Grundsätze der ausführlicheren Erläuterung bedürfen, gilt für die Hauptbände der Serien I bis VII und IX, gegebenenfalls auch für Supplementbände.
– Die Inhaltsedition kommt in den Supplementbänden der Serien I bis VII und IX (z. B. fertige, aber nicht zum Druck bestimmte Fassungen) und in Bänden der Serie VIII (z. B. Fragmente in Reinschrift) zur Anwendung. Die Inhaltsedition hält sich streng an den Text der Quelle. Korrigiert werden lediglich offenkundige Versehen, über die im Kritischen Bericht referiert wird
– Die Quellenedition gilt in erster Linie für Skizzen und Entwürfe. Der Abdruck ist diplomatisch, nicht jedoch stets zeilengetreu; Zeilenwechsel im Original werden durch geeignete Zusatzzeichen angezeigt.
Zur Werkedition
Die Edition der Werke in den Hauptbänden stellt das Ergebnis der umfassenden philologischen Sichtung und Interpretation durch den Herausgeber dar. Abweichungen von der Hauptquelle werden entweder durch die Kennzeichnung im Notentext (eckige Klammern oder Strichelung, Fußnoten), durch die Erläuterung im Kritischen Bericht oder – bei besonders gravierenden Eingriffen – durch beides angezeigt.
Darüber hinaus gelten für die Werkedition folgende Prinzipien:
– Die Partituranordnung und die Notation entsprechen den heute gültigen Regeln. –
Die Schlüsselung der Vokalstimmen wird der heute üblichen Praxis angeglichen.
– Die Instrumente werden durchweg mit italienischen Namen bezeichnet. Dagegen werden bei den Vokalstimmen entweder deutsche (deutscher oder lateinischer Text) oder englische Bezeichnungen (englischer Text) verwendet; nur für den Fall, dass der Text der Vokalstimmen zweisprachig, d. h. beispielsweise deutsch und englisch wiedergegeben werden muss, bietet die italienische Bezeichnung der Singstimmen einen gangbaren Kompromiss.
– Orthographie und Silbentrennung verbaler Texte werden den heutigen Regeln angepasst, doch bleiben originale Lautfolge und charakteristische Wortformen gewahrt.
Abbreviaturen (auch solche für nicht ausgeschriebene Stimmen in Partitur-Manuskripten, wie z. B. „c[ol] Ob 1 8va alta“) werden im Allgemeinen stillschweigend aufgelöst.
Über Abweichungen oder Besonderheiten hinsichtlich dieser Prinzipien wird im Kritischen Bericht Rechenschaft abgelegt.
Der Kritische Bericht, der in den Hauptbänden – soweit es der Umfang erlaubt – immer, in den Supplementbänden jedoch nur gelegentlich dem Notentext folgt, bietet die philologische Argumentation für den vorgelegten Text und weist die Quellen aus, aufgrund derer die editorischen Entscheidungen getroffen wurden. Er enthält die folgenden konstitutiven Abschnitte:
– Verzeichnis der im Kritischen Bericht verwendeten Abkürzungen;
– Quellenbeschreibung;
– Auflistung der textkritisch nicht relevanten Lesarten einzelner Quellen, insbesondere Korrekturverzeichnisse bei autographen Quellen;
– Quellenbewertung;
– Erläuterung der speziellen editorischen Verfahren des jeweiligen Bandes;
– Textkritische Anmerkungen, die über Einzelentscheidungen des Herausgebers Rechenschaft ablegen.
Christian Martin Schmidt
The Leipzig Edition of the Works of Felix Mendelssohn Bartholdy is intended to afford public access to all the available compositions, letters, writings and other documents relating to the artistic work of Felix Mendelssohn Bartholdy in an appropriately scholarly form. As a historico-critical edition, it aims to be of equal value to researchers and practicing musicians alike.
The musical works take pride of place. Next to completed compositions in all their versions, the Leipzig Edition also presents the sources underlying the creative process (sketches and drafts) as well as unfinished compositions (fragments). In addition, Mendelssohn’s letters are extremely important. It is generally acknowledged that reliably edited correspondence is indispensable for the scholarly study of any composer’s work. In Mendelssohn’s case, however, the correspondence is of particular significance, not only because it reveals the composer to be an outstanding witness of his time, but also because of the exceptional literary merit of many of his letters. Finally, if one wishes to provide a comprehensive picture of Mendelssohn as an artist, his pictorial works of art, principally drawings and watercolors, cannot be overlooked. A thematic-systematic catalogue of his musical works (MWV) was published in a study edition in 2009 and helps provide quick access to the composer’s entire life’s work.
A comprehensive study like this hardly calls for lengthy justification, given both Mendelssohn’s importance as a composer and his neglect by the scholarly and musical world alike, essentially attributable to non-artistic motives. The edition of Mendelssohn’s works published by Julius Rietz between 1874 and 1877 and often erroneously referred to as Alte Gesamtausgabe, was anything but complete, and unlike the Old Bach Edition, for example, was not compiled with any intention of presenting Mendelssohn’s complete works, hence its modest title, Felix Mendelssohn Bartholdy’s Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe. As a consequence of Rietz’s selection, a considerable amount of Mendelssohn’s compositions still awaits publication to this day, while others have been published only in an inadequate form. The few volumes of the new edition which have been published since 1960 by Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, have failed to make any major change to this state of affairs.
As regards the chronological arrangement of the compositions to be edited, the present publication conforms to this Leipziger Ausgabe der Werke Felix Mendelssohn Bartholdys , but generally takes account of the latest principles governing the publication of complete scholarly editions. This refers in particular to the tenet that all the editor’s decisions – whether relating to the score itself or to the Kritischer Bericht (Critical Report) – must be clearly stated and made accessible to the critical understanding of the user. In addition, the edition conforms to the view generally accepted today that every stage of the composing process or of the publication attributable to the composer himself (sketches, different versions, his own transcriptions such as piano scores) forms part of the work itself.
This view is particularly pertinent in the light of the specific musico-historical situation in Mendelssohn’s day, which led him to fulfill the aesthetic demands attendant on a definitive, self-contained work of art in highly differing degrees of perfection. This is evidenced not only by the differing versions of
numerous works, but also by the fact that the composer himself considered many completed works not worth publishing. This hampers a differentiating hermeneutic approach to the sources, which must precede any editorial decision, and a pragmatic approach on the part of the editor. At the same time, however, it provides an opportunity for the development of exemplary methods for the editing of unfinished or otherwise incomplete compositions.
A particularly problematic situation results from the fact that Mendelssohn only gave opus numbers to the works which he published or prepared for publication. Many of his works have thus come down to us without authorized opus numbers. Nevertheless, the opus numbers from 73 onward have long since come into general use, in part through the aforementioned edition supervised by Julius Rietz. The present edition took this into account until the year 2009 by continuing to use these opus numbers, albeit placing them between square brackets. Since the publication of the Thematic Catalogue (MWV), only the MWV designation introduced there will be used to identify the posthumously published works.
The publication will appear in thirteen series, i.e.
Series I Orchestral Works
Series II Concertos and Concert Pieces
Series III Chamber Music
Series IV Piano and Organ Works
Series V Stage Works
Series VI Sacred Vocal Works
Series VII Secular Vocal Works
Series VIII Sketches and fragments which cannot be assigned to the works published in series I to VII; associated groups of sketches
Series IX Arrangements and Orchestrations
Series X Drawings and Watercolors
Series XI Letters, Writings and Diaries
Series XII Documents relating to Mendelssohn’s life
Series XIII Thematic Catalogue of Works
The works or those versions of the compositions which can be attributed the status of a work will appear in the main volumes, which will also contain the Kritischer Bericht. Secondary versions, piano scores and sketches relating to the works in series I–VII will be presented in supplementary volumes. In cases where only a small number of sketches are available, these may be included in the Kritischer Bericht.
Three forms of editorial presentation are distinguished, corresponding to the respective genesis of the work, as follows.
– The Edition of Works, the principles of which call for a detailed explanation, will apply to the main volumes of series I–VII and IX, and, if indicated, to the supplementary volumes.
– The Edition of Content, which usually will apply to the supplementary volumes to series I–VII and IX (e.g. finished but unprinted versions) and volumes of series VIII (e.g. fair copies of fragments). The edition of content will strictly adhere to the source texts. Only obvious mistakes will be corrected, and these will be referred to in the Kritischer Bericht.
– The Edition of Sources relates primarily to sketches and drafts. Reproductions will be faithful, but lines may in some cases be arranged in a different way; line changes in the original will be indicated by suitable supplementary symbols.
The editing of works in the main volumes represents the results of an exhaustive philological study and its interpretation by the editor. Divergences from the principal source will be indicated either by markings in the score (square brackets or broken lines, footnotes), with an explanation in the Kritischer Bericht, or – in particularly serious cases – by both.
In addition, the following principles apply to the edition of works:
– The arrangement of the score and the notation comply with present-day standards.
– The keys for the vocal parts are adjusted in accordance with conventional present-day practice.
– The instruments are designated by their Italian names throughout. By contrast, German terms are used for the vocal parts (where the words are in German or Latin), or English terms (where the words are in English); only in such cases where the text of the vocal parts is rendered bilingually (for example in German and in English), voice designations in Italian are used as a viable compromise.
– The spelling and syllabification of verbal texts are adapted in accordance with present-day rules, but the original phonetic sequence and characteristic word forms are retained.
– Abbreviations (including those for parts which are not completely written out in score manuscripts, such as “c[ol] Ob 1 8va alta”), are in general tacitly written out in full.
An explanation of any divergence from these principles or peculiarities in their use is given in the Kritischer Bericht.
The Kritischer Bericht which, space permitting, always follows the score in the main volumes and, if appropriate, also in the supplementary volumes, presents the philological legitimation of the text as printed and indicates the sources on which the editorial decisions are based. It contains the following essential paragraphs:
– List of abbreviations used in the Kritischer Bericht.
– Description of sources.
– A list of the text-critically non-relevant readings of individual sources, particularly indexes of corrections in the case of manuscript sources.
– Evaluation of sources.
– An explanation of the particular editing methods for the respective volume.
– Text-critical remarks which account for individual decisions by the editor.
Christian Martin Schmidt (Translation: Uwe Wiesemann)
In diesem Band sind alle erhaltenen musikalisch ausgearbeiteten Teile zu Felix Mendelssohn Bartholdys geplantem dritten Oratorium „Erde, Hölle und Himmel“ („Christus“) MWV A 26 mitsamt der Skizzen ediert. Es existieren ein fragmentarisches und zweiteiliges Kompositionsautograph,1 das die Grundlage bereits für den postumen Erstdruck2 bildete, und mehrere Blätter mit Skizzen.
Die Vielzahl von Fragen, die sich bis heute an dieses Fragment stellen, ergibt sich vor allem aus dem Fehlen schriftlicher Äußerungen des Komponisten; weder in den erhaltenen Briefen noch in sonstigen Notizen ist das im Entstehen begriffene Werk erwähnt.3 Rückschlüsse auf Werkgenese und beabsichtigte Werkgestalt sowie Zeitraum und Art der Niederschrift lassen sich demnach lediglich aufgrund der – weithin schemenhaften – Vorgeschichte, der Aussagen Dritter und der überlieferten Quellen selbst ziehen.
Ausgangspunkt vieler Diskussionen war und ist die Frage nach dem Titel4 bzw. der Titelgebung des Oratorienfragments. Die einzige autographe Niederschrift trägt keinen Titel.5 Daraus zu schließen, dass sich Mendelssohn zu diesem Zeitpunkt noch nicht für einen endgültigen Titel entschieden hatte, ist durchaus naheliegend. Hauptzeugin für einen „Erde, Hölle und Himmel“ lautenden Arbeitstitel, bezugnehmend auf ein so betiteltes Libretto von Freiherr Baron Christian Carl Josias von Bunsen (1791–1860), ist die englische Königin Victoria (1819–1901), die am 4. Dezember 1847 in ihr Tagebuch notierte: „Bunsen much regrets Mendelssohn, whom he had known very well. He had settled & arranged with him the text for the new Oratorio of ‚Earth, Hell & Heaven‘ & said it had been wonderful to see how beautifully Mendelssohn chose the text from Scripture.“6 Bereits am 1. Mai 1847, nach einem Besuch Mendelssohns im Buckingham Palace, hatte sie schriftlich festgehalten: „For some time he has been engaged in composing an Opera & an Oratorio, but has lost courage about them. The subject […] for the Oratorio [is] a very beautiful one depicting Earth, Hell &
Heaven, & he played one of the Choruses out of this to us, which was very fine.“7 Somit lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Bunsen als Librettist ein Hauptakteur bei der Entstehung eines Oratoriums mit dem Titel „Erde, Hölle und Himmel“ gewesen ist und dass die überlieferte Musik zu genau diesem Oratorium gehören sollte. Andererseits berichtete Ignaz Moscheles (1794–1870) drei Tage nach dem Tod Mendelssohns: „Endlich veranlaßte ich ihn, mir seine neuesten Sachen hören zu laßen. Er sprach von einem 1. Akte einer Oper Loreley, einem Violin Quartette und mehreren Liedern. Sein Bruder [Paul Mendelssohn-Bartholdy] erzählte mir, daß unter den Papieren Mendelssohns sich ein Plan zu einem Oratorium: Christus vorfindet. 2 Stücke seyen schon fertig. Felix soll zu ihm gesagt haben, daß er seine besten Kräfte für dieses Werk aufsparen wollte!! Es war am 5ten October als er sich ganz musikalisch gestimmt fühlte.“8 Allein auf dieser durch Moscheles überlieferten Aussage des Bruders Paul beruht offensichtlich der bis in die heutige Zeit tradierte Titel des Erstdruckes 1852. Mit dem „unter den Papieren Mendelssohns [befindlichen] Plan“ waren wohl nicht die zwei „fertigen Stücke“ in Partiturform gemeint, sondern entweder die spärlichen Notizen zum geplanten Ablauf,9 die jedoch wiederum eindeutig mit „Erde, Hölle und Himmel“ betitelt sind, oder jene, mit Sicherheit vom Komponisten erweiterte, veränderte und spezifizierte Textzusammenstellung Bunsens.10 Vermutete man hingegen, dass es sich bei jenem „Plan“ um einen heute gänzlich unbekannten handelt, der darüber hinaus mutmaßlich entsprechend betitelt gewesen wäre, ließe sich der Oratorientitel „Christus“ für das Werk rechtfertigen. Eine weitere Erwähnung dieses Titels findet sich in einem Brief von Clotilde Charlotte Gräfin Reuss (1821–1860), Gemahlin des mit Mendelssohn befreundeten Heinrich II. Graf von Reuss-Köstritz (1803–1852), an ihre Schwester vom gleichen Tag wie der Brief von Moscheles: „Mendelssohn hatte noch viel aus einer Oper, viel eines neuen Oratoriums ‚Christus‘ componirt und noch mehrere Lieder
1 Quelle C
2 RECITATIVE und CHÖRE aus dem unvollendeten Oratorium CHRISTUS von FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY. Op. 97, Verlag: Breitkopf & Härtel (Platten-Nr. 8430), Leipzig 1852. Parallel erschien ein Druck in London mit der englischen Textunterlegung von William Bartholomew.
3 Dieser Umstand verwundert durchaus, schrieb doch Mendelssohn regelmäßig an Freunde und Verwandte von seinen jeweiligen kompositorischen Arbeiten und Kompositionsvorhaben, wenn auch oft nur in Nebensätzen. Dass er dies in diesem Falle nicht tat (lässt man einmal außer Acht, dass derartige Schriftzeugnisse möglicherweise auch verloren gegangen sind), heißt wohl, dass er zum einen das Oratorium betreffende Aspekte mit den Protagonisten persönlich besprach und zum anderen den Zustand des Stückes womöglich als noch nicht spruchreif erachtete.
4 Damit sind in nicht unwesentlicher Weise auch Fragen nach der inhaltlichen Struktur und Konzeption verbunden.
5 Siehe Quellenbeschreibung, Quelle C
6 Zitiert nach George R. Marek, Gentle Genius. The Story of Felix Mendelssohn Bartholdy, London 1972, S. 318.
7 Zitiert nach ebd., S. 306. Mit ziemlicher Sicherheit erklang einer der beiden im Manuskript enthaltenen Chöre, entweder „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen“ oder „Ihr Töchter Zions“.
8 Brief vom 7. November 1847 von Ignaz Moscheles an Josef Fischhof, zitiert nach Ernst Rychnovsky, Aus Felix Mendelssohn Bartholdys letzten Lebenstagen, in: Die Musik VIII/9 (1908/09), S. 141–146 (im Folgenden: Rychnovsky, Letzte Lebenstage), das Zitat S. 142. Zur Entstehung des erwähnten Opernfragments Die Lorelei MWV L 7 und des „Violin Quartette[s]“ (Streichquartett f-Moll MWV R 37) hauptsächlich während des Schweiz-Aufenthaltes im Sommer 1847 lassen sich zumindest grobe Eckdaten ermitteln, während zum nicht von ihm selbst, sondern nur – und offenbar erst im Nachgang –von Paul Mendelssohn-Bartholdy berichteten Oratorienfragment nichts weiter bekannt ist.
9 Unter anderem Quelle B.
10 Quelle [A].
und andere Kleinigkeiten; alles diesen Sommer.“11 Höchstwahrscheinlich erhielt der Ehemann der Gräfin diese Information von Moscheles; denn er gehörte selbst nicht zum Kreis derer, die zu jener Zeit Kontakt zur Familie Mendelssohn hatten. Mit der Titulierung „Christus“ verband sich gemeinhin auch die Vorstellung, es handele sich ihrer Konzeption nach lediglich um eine aus Bibeltexten zusammengestellte und durch Choräle angereicherte Behandlung der Lebensgeschichte Jesu. Beispielsweise schrieb 1886 Wilhelm Lackowitz (1837–1916) über das Stück: „Der Gedanke, die Lebens- und Leidensgeschichte Christi in einem Oratorium zu bearbeiten, war Mendelssohn schon früher gekommen, trat aber vor der Wahl des ‚Elias‘ zurück. Er war indessen nicht aufgegeben, wurde vielmehr durch den Schluß des ‚Elias‘, welcher ganz direkt auf die Erscheinung des Gottessohnes hinweist, nicht nur neu angefacht, sondern er wirkte hierauf jedenfalls bestimmend ein. Es ist fast mehr als wahrscheinlich, daß nun erst dieser Gedanke, dem starren unbeugsamen Vertreter des alten Bundes den liebenden, welterlösenden Mittler des neuen gegenüber zu stellen, plastische Gestalt gewann. Auf diese Weise wäre eine Trilogie, welche in Elias, Christus und Paulus die Hauptstützen des Reiches Gottes auf Erden darstellte, zur Wahrheit geworden.“12 So sei deutlich „der Plan zu erkennen, daß das Oratorium ‚Christus‘ zusammenfassend das werden sollte, was Sebastian Bach in seinem Weihnachts-Oratorium und seinen Passionsmusiken dargestellt hatte. […] Das Werk sollte, soweit erkennbar, zwei Teile umfassen, der erste die ‚Geburt‘, der zweite das ‚Leiden Christi.‘ […] Weder dem Händelschen Messias, noch den Bachschen Passionsmusiken und Weihnachts-Oratorium nachgehend, würde der ‚Christus‘ ausgefallen sein […].“13 Hingegen ging Rudolf Werner von einer dreiteiligen Konzeption aus, die aber dennoch nur die biblisch bezeugte Lebensgeschichte Jesu umfasst hätte: „Der Stoff sollte offenbar in drei Teilen dargestellt werden, von denen der erste die Geburt Christi, der zweite die Passion, der dritte vermutlich die Auferstehung behandelte.“14 Dies ließe sich mit einer Konzeption Erde – Hölle – Himmel dahingehend
übereinbringen, dass die Menschwerdung der „Erde“, die Passion der „Hölle“ und die Auferstehung dem „Himmel“ entspräche. Abweichend davon findet sich jedoch auch schon früh die Zuordnung des Lebens Jesu zur „Erde“; die sogenannte Höllenfahrt Jesu, also der Abstieg in die Unterwelt nach der Kreuzigung zur „Hölle“; schließlich die eigentliche Auferstehung und Himmelfahrt zu „Himmel“. Demnach wäre sämtliche bekannte Musik zum ersten Teil („Erde“) zugehörig. In dieser Weise wäre jedenfalls die Beschreibung des bis dahin noch nicht publizierten Fragments durch Julius (Isaac) Benedict (1804–1885) zu verstehen, der gleichwohl den Titel „Christus“ verwendete: „Two violin quartetts were composed and written out; the first act of an opera, entitled ‚Loreley,‘ completed; several portions of his new grand oratorio of ‚Christ‘ (our Saviour’s earthly career, descent to hell, and ascension to heaven) were sketched out, and some partly finished […].“15 Demgegenüber heißt es im ergänzten Schlussteil der ansonsten unverändert nachgedruckten zweiten Auflage von 1853: „The work to which he attached the most importance was his oratorio ‚Christus,‘ which he intended should comprise the three great periods in our Saviour’s life—1st, his Birth; 2nd, his Sorrows and Death; and 3rdly, his Resurrection. All that has come before us consists of fragments of the first and second parts […].“16 Die Passionsszene wird hier – sicherlich beeinflusst durch den mittlerweile erschienenen Druck – dem zweiten Teil des Oratoriums zugeordnet. Der zweite Teil wird nun nicht mehr mit „descent to hell“, sondern mit „his Sorrows and Death“, der dritte Teil nicht mehr mit „ascension to heaven“, sondern mit „resurrection“ bezeichnet. Diese Umdeutung – und wenn man so will: Fehldeutung –Benedicts in Kenntnis des Druckes von 1852 ist insofern bemerkenswert, da sich somit die Frage stellt, wie er zuvor zur korrekten Deutung gelangt war. Benedict, der Mendelssohn noch im Oktober 1847 besuchte, hatte recht genauen Einblick in die kompositorische Arbeit der letzten Zeit.17 Dafür sprechen auch seine Ausführungen zu den Skizzen in Bezug auf die postume Erstausgabe: „It would have been both interesting and
11 Brief vom 7. November 1847 von Clotilde Charlotte Gräfin Reuss an Elise Gräfin zu Castell-Castell, zitiert nach Raphael Graf von Hoensbroech, Felix Mendelssohn Bartholdys unvollendetes Oratorium Christus, Kassel 2006 (= Kölner Beiträge zur Musikwissenschaft; Band 6) (im Folgenden: Hoensbroech, Christus), S. 96.
12 Recitative und Chöre aus dem unvollendeten Oratorium ‚Christus‘ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. […] Text mit Einleitung und Anmerkungen von W. Lackowitz (= Gustav Modes Text-Bibliothek, Nr. 216), Berlin [1886], S. III.
13 Ebd., S. III–IV. Die vor allem durch die Zweiteilung im Druck von 1852 suggerierte Idee, das Oratorium sollte generell lediglich aus zwei Teilen (die Geburt und die Passion Jesu behandelnd) bestehen, findet sich noch 1908 bei Ernst Rychnovsky: „‚Christus‘ (op. 97) ist Fragment geblieben. Es sollte aus zwei Teilen bestehen. Vom ersten Teil, der die Geburt Christi behandeln sollte, sind beendet worden ein Rezitativ für Sopran, ein […] Terzett […] und der Chor ‚Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen‘ […]. Der zweite Teil sollte das Leiden Christi darstellen. Es liegen vor die Pilatusszenen und der Chor ‚Ihr Töchter Zions‘.“, Rychnowsky, Letzte Lebenstage [Anm. 8], S. 142f., Anm. 3.
14 Rudolf Werner, Felix Mendelssohn Bartholdy als Kirchenmusiker (Veröffentlichungen der Deutschen Musikgesellschaft. Ortsgruppe Frankfurt a. M., Band II), Frankfurt/Main 1930 (im Folgenden: Werner, Kirchenmusiker), S. 106.
15 Sketch of the Life and Works of the late Felix Mendelssohn Bartholdy. Being the Substance of a Lecture, delivered at the Camberwell Literary Institution, in December, 1849. By Jules Benedict, London 1850, S. 57.
16 Sketch of the Life and Works of the late Felix Mendelssohn Bartholdy. By Jules Benedict. Second Edition, with Additions, London 1853, S. 62–63.
17 Der Kapellmeister des Drury Lane Theater in London war mit Mendelssohn seit frühester Jugend befreundet, traf mit ihm während der letzten Englandreise im April und Mai 1847 zusammen, besuchte ihn Mitte Oktober 1847 mehrfach und sprach mit ihm dabei über zukünftige Pläne: „[…] on the morning of the 9th October […] he suddenly turned deadly pale, and, quickly after becoming insensible, he was borne home to his family. Three days later, arriving myself at Leipsic, I was permitted to approach him, but only stayed a moment in his presence. On the following day, the 12th, he felt better, and desired earnestly to see me. He got up, and spent almost two hours with me. […] The next day I saw him again, and for the last time. He seemed more cheerful, and observed […]. We discoursed of future plans; and I left him with the sanguine hope of hearing soon of his perfect recovery.“, ebd., S. 58–59.
instructive had the sketches which exist of the greater part of this Oratorio (and which would doubtless afford an insight into the whole plan) been published.“18 Benedict hatte demnach augenscheinlich nicht nur die ausgearbeiteten Sätze, sondern auch Skizzen zum Oratorium gesehen; die Formulierung lässt gar vermuten, dass es noch weitere als die heute verfügbaren Skizzen19 gegeben haben könnte.
Jedenfalls sind Benedicts frühere, noch nicht durch den Druck beeinflusste Äußerungen, wonach die Passionsszene noch dem ersten statt dem zweiten Teil zugeordnet ist, im Grunde so zu interpretieren, dass Komponist und Librettist tatsächlich die Dreiteilung der Handlung (Jesu Leben und Leiden – Höllenfahrt – Auferstehung) für ihre Gesamtkonzeption vorsahen. Über Inhalt und Text des zweiten Teils, in dem die „Höllenfahrt Christi“ thematisiert werden sollte, kann heute nur gemutmaßt werden. Auf der Grundlage biblischer Texte allein hätte die Handlung nicht beruhen können. Denn während die Evangelien und die Apostelgeschichte keinen Hinweis zu einem Hinabfahren Jesu zwischen Tod und Auferstehung geben, findet sich diesbezüglich zumindest eine kurze Erwähnung im Epheserbrief (Kap. 4.9: „Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde?“). Gleichwohl zählt das Hinabfahren in die Unterwelt, in die „Tiefen der Erde“ („inferiores partes terrae“), zu den christlichen Glaubensgrundsätzen, was sich auch im Apostolicum in der Formel widerspiegelt: „descendit ad inferos“ („hinabgestiegen in das Reich des Todes“). Ausführlich, anschaulich und höchst dramatisch berichtet nun hingegen das apokryphe Evangelium Nicodemi20 vom Hinabsteigen Jesu in die Unterwelt.21 Demnach kommt es dort zur Begegnung mit dem Urvater Adam, mit den Märtyrern und mit den Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer, der kurz zuvor eintrifft und den Propheten die Ankunft des Herrn verkündet. Nach einer Debatte zwischen Satan und Hades durchbricht Jesus in Begleitung von Engeln die „ehernen Tore und eisernen Querbalken“, legt Satan in Ketten und führt die Propheten aus der Unterwelt in das
Paradies. Die konsistente und mehrschichtige Dramatik der Erzählung beeindruckte Mendelssohn offenbar sehr; Julius Schubring (1806–1889), einer der Textdichter des Paulus MWV A 14, erinnerte sich im Jahr 1866: „Über das Oratorium ‚Christus‘ hat er kein Wort mit mir gewechselt: dagegen haben wir früher über Petrus und über Johannes den Täufer unterhandelt. Was ich über denjenigen Bericht, welchen das Evangelium Nicodemi von der Höllenfahrt Christi gibt, mitgetheilt hatte, hat ihn außerordentlich interessiert, und nach seinen Äußerungen kann ich vermuthen, daß er davon wohl einmal musikalischen Gebrauch gemacht haben würde.“22 Tatsächlich hatte wohl eine Bemerkung Schubrings vom Beginn des Jahres 1840 den wirksamsten Anstoß für das Sujet eines neuen Oratoriums von Mendelssohn gegeben; die Korrespondenz drehte sich zunächst um die Figur Johannes des Täufers: „Weißt Du übrigens, mir geht seit einiger Zeit im Kopf herum, daß es doch für das Hauptfest – Ostern, – noch nichts rechts giebt. Ramler u. Zelter soll ja nicht viel werth sein. Mir ist vor Kurzem die Idee wieder recht lebhaft geworden, als ich im apokryphischen Evangelium des Nicodemus die wirklich poëtische Schilderung der Höllenfahrt Christi las – (die doch auch im allg. Glaubensbekenntniß zwischen Tod & Auferstehung des Herrn gesetzt wird.)“23 In der Antwort heißt es: „Ein sehr wichtiges Wort hast Du mir mit Deinem apokryphischem Nicodemus geschrieben, ud. mit seiner Höllenfahrt – ich glaube das führt mich geraden Wegs zur Vollendung meiner Idee über Hölle ud Himmel ein großes Werk zu komponieren, ud. das wird der Pfeiler sein, nach dem ich mich so lange schon umgesehn habe.“24 Tatsächlich suchte der Komponist nun wohl mehr oder weniger gezielt nach einem passenden Libretto; das Sujet mitsamt grobem Handlungsablauf und inhaltlichen Eckpunkten war nun gefunden. Bereits kurz nach der durch die erfolgreiche Uraufführung des Paulus MWV A 14 am 22. Mai 1836 in Düsseldorf gekrönten Zusammenarbeit Mendelssohns mit Schubring, dem Hauptlibrettisten dieses Oratoriums, hatte der Austausch der beiden über Ideen für ein Folgewerk dieser Gattung begonnen.25 Dem
18 Ebd., S. 63.
19 Siehe Quellen C und D.
20 Die reiche Wirkungsgeschichte dieser apokryphen, ursprünglich auf Griechisch verfassten und in über 500 Manuskripten überlieferten Schrift hat ihren wesentlichen Grund in der „farbigen Ausgestaltung von Passion und Auferstehung einschließlich der Höllenfahrt Christi. […] Es [wird] deutlich, dass das Leiden und Sterben Jesu […] für die christliche Frömmigkeit von Beginn an eine große Bedeutung besaßen.“ Jens Schröter, Die apokryphen Evangelien. Jesusüberlieferungen außerhalb der Bibel, München 2020, S. 82.
21 Diese ausführliche Schilderung bildet den dritten Teil des „Nikodemusevangeliums“; den ersten, auch unter dem Titel „Acta Pilati“ („Pilatusakten“) bezeichneten Teil nimmt die unmittelbare Passionsgeschichte (Prozess und Verurteilung) ein; im zweiten Teil wird von der Grablegung sowie der Gefangennahme und wundersamen Befreiung des Joseph von Arimathäa berichtet. Der Text beruht – laut Prolog der griechischen Fassung – auf den vom römischen Offizier Ananias übersetzten hebräischen Aufzeichnungen von zeitgenössischen Juden bzw. – laut Prolog der lateinischen Fassung – auf Schriften aus den Archiven des Pontius Pilatus. Beide Fassungen sprechen auch von hebräischen Aufzeichnungen des Nikodemus, der laut Johannesevangelium Zeuge des Prozesses und der Grablegung war. Siehe dazu und zum Folgenden ebd., S. 82–86.
22 Julius Schubring, Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy, an dessen 57. Geburtstage (3. Februar 1866) […], in: Daheim. Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen, Leipzig 1866, S. 376.
23 Brief vom 19. und 21. Februar 1840 von Julius Schubring an Felix Mendelssohn Bartholdy, Bodleian Library, University of Oxford (im Folgenden: GB-Ob), MS. M. Deneke Mendelssohn d. 37, Green Books XI-59, gedruckt in: Briefwechsel zwischen Felix Mendelssohn Bartholdy und Julius Schubring, zugleich ein Beitrag zur Geschichte und Theorie des Oratoriums, hrsg. von Julius Schubring, Leipzig 1892 (im Folgenden: Briefwechsel mit Schubring), S. 155–160, das Zitat S. 156–157.
24 Brief vom 25. Februar 1840 an Julius Schubring, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv (im Folgenden: D-B), 55 Ep 1340, gedruckt in: Briefwechsel mit Schubring [Anm. 23], S. 160–162, das Zitat S. 161.
25 Mit Brief vom 14. Juli 1837 hatte sich Mendelssohn erstmals diesbezüglich an Schubring gewandt, „da mir in meinem Paulus die besten Fingerzeige u. Angaben für den Text von Dir gekommen sind.“, Washington, D.C., The Library of Congress, Music Division (im Folgenden: US-Wc), Gertrude Clarke Whittall Foundation Collection, Mendelssohn Papers, ML 30.8j, box 2, folder 14, gedruckt in: Briefwechsel mit Schubring [Anm. 23], S. 109–111, das Zitat S. 109.
„Paulus“ sollte demnach zunächst der „Petrus“ folgen: „Mehrere äußerlichen Gründe sprechen dafür zum Stoff den Petrus zu wählen. […] Daß es an innerlichen Gründen nicht fehlt, die mir den Stoff werth machten, brauche ich Dir nicht zu sagen.“26 Und bald darauf wandte sich Mendelssohn auch an Carl Klingemann (1798–1862); im Brief vom 12. August 1836, in dem es hauptsächlich um die geplante Aufführung des Paulus in Liverpool und die Drucklegung bei Novello ging, wünschte er sich, dass er „statt für das alte Oratorium so viel zu thun, mir ein neues machtest! und mich auf diese Weise zu einer neuen Thätigkeit anregtest, statt daß ich mich selbst fortwährend dazu anregen muß.“27 Er solle seine Gedanken „lieber auf einen Elias, oder Petrus oder meinethalben Og zu Basan verwenden […].“28 Und obwohl sich in der Korrespondenz – zunächst mit Klingemann, dann mit Schubring – die alttestamentliche Geschichte des Propheten Elias als Sujet für sein zweites Oratorium mehr und mehr herausbildete,29 suchte Mendelssohn dennoch in den Jahren vor der Fertigstellung seines Elias MWV A 25 – und teilweise parallel zu und unabhängig von diesem – nach einem weiteren Stoff für ein Oratorium und verständigte sich mit mehreren Personen darüber.30
Dieser Findungsprozess während der Vorarbeiten am Elias spricht, ebenso wie die im April 1844 – also etwa ein Jahr vor den zuerst niedergeschriebenen Teilen zum zweiten Oratorium – zumindest konzeptionell weitgehend fertige und das Leben Jesu thematisierende, mutmaßliche Textvorlage,31 zwar deutlich gegen eine absichtsvolle Chronologie, doch vermutete bereits Otto Jahn einen gedanklichen Zyklus: „Mendelssohn hatte neben dem Elias ein zweites Oratorium Christus begonnen, das nun unvollendet geblieben ist. Es ist möglich, dass beide in einem gewissen Zusammenhange standen, dass in einer bestimmten Absicht der Prophet des alten Bundes Christus vorangehen sollte […].“32 Und noch Rudolf Werner führte aus, ebenfalls auf den Elias bezogen: „Und wenn der Schluß dieses Werkes auf das Kommen Christi hinweist, so geschah das wohl nicht nur, um dem Oratorium einen erhabenen Ausklang zu geben, sondern schon in dem bestimmten Gedanken, auf den Elias ein Christus-Oratorium folgen zu lassen, das dann – zwi-
schen Elias, dem stärksten Propheten des alten Testaments, und Paulus, dem gewaltigsten Verkünder des neuen Evangeliums, stehend – mit diesen beiden eine Trilogie bildete.“33
Die konkreten Sujets „Erde“, „Hölle“ und „Himmel“ für ein Oratorium begegnen erstmals bereits im Jahr 1839. Zunächst spielten dabei die Librettisten Carl Gollmick (1796–1866) und Henry Fothergill Chorley (1808–1872) eine Rolle. Gollmick, Theaterrepetitor in Frankfurt am Main, sandte Mendelssohn nach persönlicher Absprache einen Librettoentwurf zu, der –nach eigener Aussage – „die drei höchsten Principien des moralischen Daseins ‚Erde, Himmel und Hölle‘ verlangt. Nachdem ich diesen Stoff der Extreme vorerst prosaisch behandelt und in Scenen eingetheilt, übergab ich, um möglichst sicher zu gehen, das Manuscript meinem Freunde Gambs, der dann alle diese Theile nach biblischen Texten so poetisch regelte, daß ich die Sache als complet betrachten durfte.“34 Da der besagte „prosaische“ Entwurf nicht überliefert ist, muss fraglich bleiben, ob außer dem mutmaßlichen Titel Weiteres in die Planung zum Oratorium einfloss, zumal sich die Korrespondenz zwischen Gollmick und Mendelssohn nicht fortsetzte.35
Seit dem Besuch des Musikschriftstellers Henry Fothergill Chorley beim Niederrheinischen Musikfest in Düsseldorf im Mai 1839 standen auch er und Mendelssohn in regem Austausch zum Oratoriensujet „Erde, Himmel und Hölle“. Im November führte Chorley mit spürbarer Begeisterung aus: „But your floating vision of Earth, Hell & Paradise lost something of a more tangible form. What think you of making the story of Dives & Lazarus the frame-work of such an opus? – Say, in the first part of Earth – a chorus or choruses descriptive of natural beauty – Spring for instance – on presenting the cheerful images of busy, domestic life. […] Then, to proceed, – a harvest feast for the sick-man’s banquet – (with the poor beggars at the gate) & here (to link as it were, the present with the future) might be introduced that parable of the same import with the story of Lazarus. […] Then, the second part would comprise the sick man, placed amid the flames & torments of hell – agonized for one drop of water – & afterwards with the remembrances of his unconverted heathen – while the poor despised beggar, reposes
26 Ebd.
27 Brief vom 12. August 1836 an Carl Klingemann, Jerusalem, The National Library of Israel, Archives Department, ARC. 4° 1651/11.2 Otto Lobbenberg Collection. no. 16, gedruckt in: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, hrsg. und eingeleitet von Karl Klingemann (jun.), Essen 1909, S. 204–205, das Zitat S. 204.
28 Ebd.
29 Siehe dazu Christian Martin Schmidt, Zwischen Eschatologie und geschlossenem Kunstwerk. Gattungskonzept und Bibelinterpretation in Mendelssohns Oratorium Elias op. 70 MWV A 25, in: Denkströme Heft 7. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, hrsg. im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig von Pirmin Stekeler-Weithofer, Leipzig 2011, S. 122–150.
30 Zu Mendelssohns weiteren Oratorienplänen nach dem Paulus allgemein siehe vor allem Christian Martin Schmidt, Einleitung, Serie VI, Band 11A (2012) dieser Ausgabe, S. XIX.
31 Quelle [A]; siehe dazu unten.
32 Otto Jahn, Ueber F. Mendelssohn Bartholdy ’ s Oratorium Elias, in: Allgemeine musikalische Zeitung 50 (1848) Nr. 8 (23. Februar), Sp. 113–122, das Zitat Sp. 115; Neufassung des Textes als Ueber Felix Mendelssohn Bartholdy ’ s Oratorium Elias, in: Gesammelte Aufsätze über Musik von Otto Jahn, Leipzig 1866, S. [40]–63, das Zitat S. 43.
33 Werner, Kirchenmusiker [Anm. 14], S. 105.
34 Carl Gollmick, Auto-Biographie nebst einigen Momenten aus der Geschichte des Frankfurter Theaters, Frankfurt/Main 1866, Bd. 2, S. 106.
35 R. Larry Todd geht hingegen davon aus, dass es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit […] bei den […] Oratorienfragmenten um die Überreste einer Kooperation zwischen Mendelssohn und Gollmick [handelt].“, Felix Mendelssohn Bartholdy. Sein Leben. Seine Musik, Stuttgart 2008, S. 606. Demnach sei nicht Bunsens, sondern Gollmicks heute unbekanntes Libretto Grundlage der Vertonung gewesen.
in Abraham’s bosom, & answers the petitions of Dives, with the gentle, but passionless reply of a beatified spirit […].“36 Doch Mendelssohn warf Fragen auf und bremste Chorleys Enthusiasmus; für ihn schienen die handelnden Personen Dives und Lazarus sowie ihre Rollen in der Hölle und im Himmel – wie auch auf der Erde – nicht recht stringent zu sein, und er begründete dies ausführlich: „After what you say, I see that I have not been able to form an exact idea of what you intend the whole to be; the fact is, that I did not quite understand what part both figures should act in hell or in heaven – because I do not quite understand the part they act on earth – – and indeed the true sense of the story itself, as I find it in the Evangile. – Or is there another source, which you took your notions from? I asked some of my theological friends here, but they knew none. – I only find Dives very rich and Lazarus very poor, and as it cannot be only for his riches that one is burning in hell, while the other must have greater claims to be carried to Abraham’s bosom than his poverty alone, it seemed to me as if some very important part of the story was left in blank. Or should Lazarus be taken as an example of a virtuous poor man, the other of the contrary? But then we ought to know or to learn (by the poem) what he does or has done to deserve the greatest of all rewards: the mere reason (as given in St Luke) that he suffered want, and that the other has had his share of happiness on earth already, does not seem sufficient to me to give interest to the principal figure of such a poem, as that which you intend. – Perhaps you have another view of the whole; pray let me know it, and tell me what part you would give to both of them in earth, hell and heaven – if once delivered of this scruple, I should quite agree with your opinion, and the great beauties, you point out, I certainly should feel and admire with all my heart. Do not lose patience with me; I am of a rather slow understanding, and can never move forwards untill [sic] I have quite understood a thing. The best is, that in all such discussions one always draws nearer, not only to the subject, but also to each other.“37 Im Antwortschreiben erläuterte Chorley erneut und diesmal ausführlicher seine Idee und sein Konzept, beantwortete Mendelssohns Fragen und versuchte, dessen Bedenken zu zerstreuen, denn: „It seems to me that we are misunderstanding each other […].“38 Doch auch jetzt überzeugte der Chorley’sche Plan den Komponisten nicht. Immerhin hat er sicher dazu
beigetragen, dass Mendelssohns Vorstellungen sich in der Folge konkretisierten.
Gleichwohl muss Mendelssohn gelegentlich ein allgemeines Interesse für einen „Christus“-Stoff geäußert haben, denn mit Schreiben vom 5. April 184239 sandte ihm Otto Jahn (1813–1869) ein Libretto von dessen Orgellehrer Johann Georg Christian Apel (1775–1841) zu, mit dem Titel „Christus. Ein Oratorium, aus Bibelsprüchen und Liedstrophen des Schleswig-Holsteinischen Gesangbuchs zusammengetragen, für Solo- und Chorgesang mit obligater Orgelbegleitung in Musick gesetzt und mit freien Orgelfantasien verbunden“40. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses – allerdings vierteilige –Werk einen gewissen Einfluss auf Mendelssohns Konzeption eines eigenen Oratoriums hatte; doch sind kaum Gemeinsamkeiten erkennbar, und so blieb die Kenntnis dieses Librettos auch weitgehend folgenlos für sein eigenes Schaffen. Zeugnis für die Konzeption eines oratorischen Werks, nun wiederum konkret mit den thematischen Begriffen Erde – Hölle –Himmel versehen, ist ein undatierter, beidseitig beschriebener Zettel, der gemäß seinem Titel in der Mendelssohnforschung unter der Bezeichnung „Fürsts Plan“ firmiert.41 Mendelssohn notierte hier in Stichpunkten den Inhalt nach den Vorstellungen von Joseph Fürst (1794–1859), dem befreundeten Kaufmann aus Berlin, der ihm bereits beim Libretto des Paulus wesentlich geholfen hatte.42 Dem setzte Mendelssohn seine eigenen Ideen hinzu, deren Niederschrift allerdings nur wenige Zeilen zum ersten Teil umfasst und somit fragmentarisch blieb. Ohne biblischen – geschweige denn christologischen – Bezug sind die ausgesprochen bildlichen Stichworte inhaltlich und konzeptionell näher an seinerzeit populären Werken wie Louis Spohrs Das jüngste Gericht und vor allem Friedrich Schneiders Das Weltgericht (nach dem Libretto von August Apel) als am klassischen biblischen Oratorium orientiert. Es zeigt sich darin eine vielmehr außerkirchliche, gewissermaßen weltliche Religiosität. Zudem scheint hier dem lyrischen Element gegenüber dem dramatischen der Vorzug eingeräumt zu werden; was durchaus der zeitgenössischen Ästhetik der Gattung Oratorium entspricht, wonach laut Gottfried Wilhelm Fink (1783–1846) „ihre Grundwesenheit lyrisch seyn müsse“ 43 und lediglich der „zweyte Hauptbestandteil derselben […] der dramatische Wechsel verschiedener Personen (wohin wir schon den Wechsel
36 Brief vom 3. November 1839 von Henry Fothergill Chorley an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 36, Green Books X-120.
37 Brief vom 28. Februar 1840 an Henry Fothergill Chorley, Standort unbekannt, zitiert nach Fotokopie eines Vorbesitzers, zuerst gedruckt in: Henry F. Chorley, Autobiography, Memoirs and Letters, London 1873, Bd. 1, S. 309f.
38 Brief vom 10. März 1840 von Henry Fothergill Chorley an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 37, Green Books XI-96.
39 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 41, Green Books XV-168.
40 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 27, fol. 92–101. Das Libretto wurde 1825 in Kiel auch gedruckt, offenbar als Textbuch im Zusammenhang mit der Uraufführung des nur mit Orgel begleiteten Oratoriums. Die Vertonung Apels ist nicht erhalten, da er die Partitur kurz vor seinem Tod vernichtete.
41 Quelle B
42 In der Forschung wurde bis vor wenigen Jahren Joseph Fürst, der seine Briefe und Dokumente immer mit „J. Fürst“ unterschrieb, mit dem Leipziger Orientalisten Julius Fürst (1805–1873) verwechselt. Joseph Fürst stellte sich Robert Schumann in einem Brief vom 27. März 1848 vor „als einer der näheren hiesigen Freunde unseres unvergeßlichen Felix Mendelssohn-Bartholdy […] und als einen, der unter diesen nicht eine der letzten Stellen einnahm.“ (Schumann Briefwechsel, Serie II, Band 17, hrsg. von Klaus Martin Kopitz, Eva Katharina Klein und Thomas Synofzik, Köln 2015, S. 180–182, das Zitat S. 180f.), im Folgebrief vom 19. April des Jahres heißt es dann gar: „Ich darf sagen, ich habe in Felix meinen besten Freund verloren. So theilnehmend für meine größten wie für meine kleinsten Interessen war Niemand für mich. Sein Tod zermalmte mich fast.“ (ebd., S. 183–185, das Zitat S. 184).
43 Gottfried Wilhelm Fink, Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen, in: Allgemeine musikalische Zeitung 29 (1827), Nr. 37 (12. September), Sp. 625–632 und Nr. 38 (19. September), Sp. 641–649, das Zitat Sp. 626.
der mancherley Sologesänge, Chöre und Doppel-Chöre rechnen)“ sei, und dies auch nur, weil sie sonst „zur poetischen Erzählung, die der Natur der Sache nach nur sehr selten musikalisch seyn kann, herabsinken würde.“44 Auf narrative Elemente und sich entwickelnde Handlungen sei deshalb in einem guten Libretto idealerweise zu verzichten, hingegen sollten reflektierende und den Hörer emotional bewegende Bestandteile abwechselnd aufeinanderfolgen. Laut Fink könne das Oratorium kein Drama im herkömmlichen Sinne sein, denn: „Bekanntlich fordert das Drama, dass sich verschiedene Charactere durch Handlungen vor unseren Augen entwickeln und dadurch sowohl sich selbst, als das Ganze zu einem nothwendigen Ziele führen. Auf diese Art wird die Empfindung des Hörers aus den Handlungen der Personen lebendig in ihm erregt und immer weiter geführt bis zum Ende. Das kann nun aber in der Cantate oder dem Oratorium nicht Statt finden. […] Solche Verhältnisse, die dem Drama das Höchste bieten, sind der mehr das Gewordene als das Werdende umfassenden Musik gar nicht darstellbar. […] Dieser Reiz eines klaren Zusammenhangs […] muss in der Cantate und dem Oratorium beynahe ganz allein durch die Phantasie des Hörers, ja sogar durch lebhafte Vorstellungen des verknüpfenden Verstandes ersetzt werden.“45 Die Entscheidung Mendelssohns, dieses in „Fürsts Plan“ skizzierte Konzept nicht weiter zu verfolgen, muss also auch als Suche nach einem Oratorienstoff mit einerseits stärkerem biblischen Bezug und andererseits dramatischerer Erzählung verstanden werden. Ganz offensichtlich erschien ihm der mit dem Paulus beschrittene und schließlich mit dem Elias fortgesetzte Weg attraktiver. Letztendlich sind sämtliche Entwürfe, Ideen, Konzeptionen und Pläne vor allem als mehr oder weniger fruchtbare Anregungen für Überlegungen zu einem weiteren Oratorium zu verstehen. Klar ist, dass Freiherr von Bunsen mit seinem Plan und Textentwurf46 überzeugte und somit den Vorzug erhielt. Einen Teil davon ließ Bunsen dem Komponisten während seines Berlin-Aufenthaltes am „OsterMontag Morgens 44“, dem 8. April 1844, zukommen: „Hier haben Sie den Entwurf ausgeschrieben bis zur Auferstehung: das Folgende steht in den Entwürfen die ich vor 10 und 15 Jahren gemacht, und die ich deßhalb erst in London wieder ansehen möchte, wo wir uns ja treffen werden. Ich habe die Choräle im zweiten Gesange hinzuschreiben noch keine Zeit gehabt: ich meine zwischen Jesus Worte am Kreuz gehören sie namentlich. Der Schluß des ersten Gesanges scheint mir glücklich. Das Ganze ist durchführbar:
nur muß auf fortgesetzte Ueberleitung durch Erzählung hier und da wohl verzichtet werden. Ich habe in den Ca[n]zones ein neues Mittel vorgeschlagen, dieß zu ersetzen. Ich sende Ihnen den Entwurf zur Stille[n] Woche und Gesangbuch, damit Sie mir morgen früh – 8 Uhr: um 10 Uhr habe ich Abfahrtz[eit] –Ihre Ansicht mitteilen können.“47 Aus den musikalischen Quellen geht hervor, dass Mendelssohn dem erzählenden Evangelisten tatsächlich möglichst wenig Raum geben wollte, im Interesse eines dramatischeren Handlungsverlaufs; dass die angesprochenen „Canzones“ (so es sich nicht um die gesondert erwähnten Choräle handelte) später als Ersatz hätten hinzukomponiert werden sollen, kann bezweifelt werden. Offensichtlich waren mit dem „ersten Gesang“ die Geburtsszene, mit dem „zweiten Gesang“ die Passionsszene im ersten Teil („Erde“) gemeint. Zum Text des zweiten Teils („Hölle“) lässt sich auf Grundlage von Bunsens Mitteilungen nichts Weiteres sagen. Unklar ist auch, wie es sich mit den „Chorälen im zweiten Gesange […] zwischen Jesus Worte am Kreuz“ verhält, ebenso die damit verbundene Frage, ob die zwei überlieferten Choralstrophen direkt hintereinander nach dem Chor „Ihr Töchter Zions“ oder innerhalb der vorgesehenen eigentlichen Kreuzigungsszene jeweils nach bestimmten Jesusworten hätten gesungen werden sollen.48
Mit Sicherheit flossen hier auch in erheblichem Maße Bunsens eigene theologische Ansichten ein, hatte er doch kurz zuvor eine theologisch-liturgische Studie zur „Stillen Woche“ publiziert.49 Beim mitgesendeten Gesangbuch handelte es sich vermutlich um ein Exemplar des von ihm 1833 herausgebrachten;50 eine völlig neu konzipierte Fassung erschien erst 184651 und befand sich noch in der Vorbereitung, wie Bunsen seiner Frau am 22. Juli 1844 mitteilte: „[So] lege ich jetzt die Hand an das ‚Allgemeine Gesang= und Gebetbuch‘ – dessen Druck am 15. August im Rauhen Hause in Hamburg beginnt. […] Es ist mein eigentliches Leib= und Lebensbuch.“52 Wahrscheinlich enthielt das heute unbekannte Libretto nicht nur jene Texte des mit diesem Schreiben mitgesandten „ersten“ und „zweiten Gesanges“ des ersten Teils und den zweiten Teil „bis zur Auferstehung“, sondern auch „das Folgende“, das Bunsen beim erwähnten anstehenden Treffen in London im Juli 1844 dem Komponisten hätte übergeben wollen. Ein Treffen kam allerdings nicht zustande, da Mendelssohn am 11. Juli London verlassen musste, während sich die Ankunft Bunsens schließlich auf den 15. Juli verschob.53 So lässt sich nicht mit
44 Ebd., Sp. 627.
45 Ebd., Sp. 628.
46 Quelle [A].
47 Brief [undatiert] von Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green Books XIX-227.
48 Siehe dazu die Überlegungen bei Hoensbroech, Christus [Anm. 11], S. 151–154, insbesondere die Tabelle S. 154.
49 Die heilige Leidensgeschichte und die stille Woche. Von Christian Carl Josias Bunsen. Erste Abtheilung. Die Liturgie der stillen Woche mit Vorwort, Hamburg 1841.
50 Versuch eines allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebetbuchs zum Kirchen= und Hausgebrauche, Hamburg 1833.
51 Allgemeines evangelisches Gesang- und Gebetbuch zum Kirchen= und Hausgebrauch, Hamburg 1846. Im gleichen Jahr erschien dazu: Vierstimmiges Choralbuch zum allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebetbuche zum Kirchen- und Hausgebrauch von Dr. Josias Bunsen. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. Friedrich Filitz, Berlin 1846.
52 Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen. Aus seinen Briefen und nach eigener Erinnerung geschildert von seiner Witwe. […], Bd. 2, Leipzig 1869, S. 270.
53 Siehe die Briefe vom 27. Juni, 3. Juli und 8. Juli 1844 von Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green Books XIX-60, d. 46, Green Books XX-10 und d. 46, Green Books XX-79b sowie den Brief vom 10. Juli 1844 an Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen, Standort unbekannt, Inhaltsangabe in: J. A. Stargardt, Katalog 252, Autographen [1925], Nr. 60, S. 6.
Sicherheit sagen, ob letztlich der vollständige Oratorientext zum Komponisten gelangte oder dieser nur Torso blieb, wonach Mendelssohn dennoch zu komponieren begann. Hingegen kann kaum bezweifelt werden, dass dieser wie auch immer geartete Entwurf Bunsens schließlich die Textgrundlage zum dritten Oratorium Mendelssohns bildete. Umso bedauerlicher ist, dass der Text heute nicht greifbar ist, denn eine Vielzahl von Fragen hätte damit beantwortet werden können. Nach Aussage von Rudolf Werner war das Schriftstück bis 1929 „erhalten und befand sich unter der großen Sammlung der an M. gerichteten Briefe im Besitz von Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Albrecht Mendelssohn Bartholdy in Hamburg, einem Enkel des Komponisten. Infolge eines kürzlichen großen Brandunglücks ist das betr. Material aber z. Zt. unzugänglich, und es ist noch nicht festzustellen, wieviel von den Manuskripten erhalten geblieben ist.“54
Jener Brand fand am 4. April 1929 statt. Zuerst berichtete das Hamburger Fremdenblatt unter der Überschrift „Großfeuer in Wohldorf=Ohlstedt“: „Am Donnerstag nachmittag entstand in dem von Professor Dr. Mendelssohn-Bartholdy bewohnten Landhause in der de Chapeaurougestraße 8 ein Feuer, daß den größten Teil des Gebäudes in wenigen Stunden bis auf das untere Mauerwerk vernichtete. Kurz nach 2 1/2 Uhr brach in einem Raum, in dem Klempner mit dem Dichten einer Rohrleitung beschäftigt waren, das Feuer aus und griff mit großer Schnelligkeit um sich. Die Wehr von Wohldorf-Ohlstedt suchte vor allem das untere Gebäude zu schützen, damit die wertvollen wissenschaftlichen Dokumente und Bücher, die sich dort befinden, gerettet werden konnten. Glücklicherweise war in dem keine 50 Meter von der Brandstätte entfernten Feuerlöschteich reichlich Wasser vorhanden, und konnte die Ausbreitung des Feuers doch so gehindert werden, daß fast sämtliche wissenschaftliche Sammlungen, Bücher, Handschriften usw., geborgen wurden.“55 Der Hamburgische Correspondent berichtete am gleichen Tag: „Brand im Hause Mendelssohn=Bartholdys. Die wertvolle Bibliothek gerettet. In dem Landhaus an der Chapeaurougestraße in Wohldorf-Ohlstedt, das Professor Dr. Mendelssohn-Bartholdy bewohnt, hat gestern nachmittag ein Feuer gewütet, das den größten Teil des Gebäudes bis auf das untere Mauerwerk vernichtete. […] Die Feuerwehrleute von Wohldorf-Ohlstedt waren besonders bemüht, die wertvollen wissenschaftlichen Sammlungen zu retten, und mit Hilfe der Hamburger Feuerwehr […] gelang es auch, fast sämtliche Bücher, Dokumente und Handschriften zu bergen.“56 Auch aus einem Fachartikel von Hugo Carl Cornelius Wach (1872–1939), dem Schwager und Cousin von Albrecht Mendelssohn Bartholdy, zum Wiederaufbau des architekturhistorisch bedeut-
samen Hauses erfährt man zum Verbleib der Dokumente keine Details, vom Brand wird dagegen zu Beginn berichtet: „Am 4. April 1929 wurde das ländliche Wohnhaus des bekannten Universitätslehrers für internationales Recht Albrecht Mendelssohn-Bartholdy in Ohlstedt bei Wohldorf, Staat Hamburg, durch Feuer zerstört. Die Familie fand ein vorläufiges Unterkommen in zwei Reisewagen, wie solche vom fahrenden Volk benutzt werden.“57 Auch aus der Sammlung der an Albrecht Mendelssohn Bartholdy gerichteten Briefe58 geht nichts hervor, wenngleich in den meisten, am 6. April verfassten Schreiben der Brand erwähnt wird. So schrieb ein Kollege: „It is warmly hoped that […] your undoubtedly most valuable collection of rare books and manuscripts was saved from the flames.“59 Wie aus dem Brief von Hugo Wach hervorgeht, seien „die schönen Möbel aus dem Erdgeschoss erhalten“.60 Auch der überwiegende Teil der historischen Dokumente, insbesondere aus dem Nachlass Felix Mendelssohn Bartholdys, hat die Katastrophe unbeschadet überstanden.
Der umfangreiche und nahezu vollständig bei diesem Brand verschont gebliebene Brief- und Dokumentenbestand (mit den „Green Books“) aus Albrecht Mendelssohn Bartholdys (1874–1936) Besitz ging nach dessen Tod über eine Auktion vollständig an Paul Victor Mendelssohn Benecke (1868–1944); zuvor hatte Albrecht die Sammlung bei seiner Zwangsemigration aus Deutschland Ende 1933 mit nach Oxford genommen. Benecke wiederum vermachte die Sammlung Margret Deneke (1882–1969), und nach dem Tod ihrer Schwester Helena Deneke (1878–1973) wurde sie schließlich in den Bestand der Bodleian Library überführt. Dort lässt sich kein derartiges Libretto auffinden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass es bei besagtem Brandunglück vernichtet worden ist. Was die vertonten Teile angeht, hatte Bunsens Libretto wohl eher den Charakter einer Auswahl und Zusammenstellung von Bibelworten und Choraltexten als den eines klassischen Librettos. Dem eröffnenden Rezitativ und dem folgenden Terzett liegt Matthäus 2.1–2 zugrunde. Der Text des Chors „Es wird ein Stern“ stammt aus dem Buch Numeri 24.17 und aus Psalm 2.9. Die Passionsszene mit dem Chor „Ihr Töchter Zions“ geht weitgehend auf die Berichte der Evangelien nach Lukas und Johannes zurück.61
Unstrittig ist, dass die Reihenfolge der Teile im Autograph auch weitgehend der beabsichtigten Reihenfolge im Oratorium entspricht. Nach Rudolf Werner sei die Szene von der Geburt Christi „in sich abgeschlossen“62; dagegen spricht aber vor allem die erhaltene, 25 Takte umfassende Skizze zu einem deutschen „Nunc dimittis“.63 Das hätte zweifellos den Abschluss der Szene bilden sollen; mit Sicherheit also sollte mindestens noch die
54 Werner, Kirchenmusiker [Anm. 14], S. 105, Anm. 128.
55 Hamburger Fremdenblatt, Freitag, 5. April 1929, Morgen-Ausgabe, S. 3.
56 Hamburgischer Correspondent, Freitag, 5. April 1929, Abend-Ausgabe, S. 3.
57 H. C. C. Wach, „Vom Bauernhaus zum Landhaus“, in: Deutsche Bauzeitung, hrsg. von Erich Blunck, Jg. 64, Nr. 87–88 (29. Oktober 1930), S. 602–606.
58 D-B, MA Nachl. 2
59 Ebd., 1929, Nr. 32.
60 Brief vom 15. April 1929, ebd., Nr. 41.
61 Zur genauen Herkunft der Textteile siehe Textvergleich.
62 Werner, Kirchenmusiker [Anm. 14], S. 106.
63 Quelle C, S. 139/59, Verlaufsskizze C4
Darstellung Jesu im Tempel mit dem Gesang des Simeon als Abschluss der Weihnachtsgeschichte vertont werden. Die Passionsszene verweist insbesondere in der Anlage der Folge von Rezitativen und Turba-Chören und zudem durch den Choral „Er nimmt auf seinen Rücken“ deutlich auf die Bach’schen Passionen.64 Gleichwohl findet eine in Passionsmusiken seit jeher übliche und dramatisierende Rollenaufteilung nicht statt; sowohl der Evangelientext als auch die Worte von Pilatus werden vom Tenorsolisten übernommen, Christusworte kommen nicht vor. Dass Vers 3 aus Lukas 23, in dem Christus in direkter Rede spricht, im ansonsten durchkomponierten Teil nicht vertont ist, verdeutlicht umso mehr, dass Mendelssohn auf dieses Stilmittel generell bewusst verzichtete.
Zu keinem Zeitpunkt bestand darüber Zweifel, dass es sich bei diesem Fragment um ein unvollendetes Stück handelte und dass, auch wenn sich andernorts noch musikalisches Material hätte finden lassen, dies doch nur Fragment geblieben wäre. Dennoch entschied sich das für die postumen Publikationen verantwortliche Gremium65, die Partitur in dieser Form drucken zu lassen, und so erfolgte die Veröffentlichung durch Julius Rietz bereits 1852 als Opus 97. Die Drucklegung eines unvollendeten Werkes ist um die Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus erstaunlich. Zu erklären ist dies einerseits und vor allem damit, dass der Bedarf des Publikums an oratorischen Werken des Komponisten nach dem Paulus und dem Elias so enorm groß war, dass der Zustand als Torso nicht mehr per se als Kriterium für eine Unaufführbarkeit galt. Andererseits war es auch das Bestreben, die Musik Mendelssohns möglichst umfassend der Öffentlichkeit zu präsentieren; die Idee einer Gesamtausgabe spielte ohnehin bereits lange vor der dann schließlich in den 1870er-Jahren realisierten eine Rolle. Aus dieser Ausgabe scheint das Stück erstmals beim Birmingham Music Festival im September 1852 öffentlich gespielt worden zu sein. Ein Jahr darauf ist es in Wien erklungen, und am 2. November 1854 fand eine Gedächtnisfeier im Leipziger Gewandhaus unter der Leitung von Julius Rietz statt, bei der „[d]ie Sätze zu dem unvollendeten Oratorium ‚Christus‘“66 zur
Aufführung kamen. Wie Ignaz Moscheles berichtet, befasste man sich am Leipziger Konservatorium bereits Anfang 1849 mit den Handschriften zum Werk: „Das Fragment ‚Christus‘ aus Mendelssohn’s Nachlass wird jetzt von unseren Schülern einstudirt; es besteht aus fünf oder sechs Chören, Recitativen und einem Terzett im erhabensten Styl, würdig des Gegenstandes. Ein Trauerchor der Töchter Zion’s, einer des Volkes ‚Kreuzige ihn‘ sind Meisterwerke, die sich selbst als Bruchstücke einen Ehrenplatz erwerben müssen. Die Zeit der Herausgabe ist noch nicht bestimmt.“67 Eine Aufführung im Konservatorium noch im selben Jahr, etwa zum feierlich begangenen Sterbetag Mendelssohns, lässt sich nicht nachweisen; jedoch hat sich für das Gedenkkonzert am 4. November 1851 ein Programmzettel erhalten, wonach das Fragment gesungen wurde; da der Druck noch in Vorbereitung war, geschah dies aus dem Manuskript.68 Im Festkonzert anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Konservatoriums, am 2. April 1853, erklangen die „Stücke aus dem unvollendeten Oratorium“,69 dann sicherlich aus dem Druck musiziert.
Herzlich gedankt sei der Biblioteka Jagiellońska, Kraków, für die Möglichkeit der Einsichtnahme in die autographe Partitur sowie die Reproduktionserlaubnis einzelner Seiten. Weiterhin dankt der Herausgeber der Bodleian Library, University of Oxford; der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv; The National Library of Israel, Jerusalem; sowie The Library of Congress, Washington, D.C., die Einsichtnahme in bei ihnen aufbewahrte Originaldokumente gewährten.
Wertvolle Hilfe und fruchtbare Anregungen wurden dem Herausgeber zuteil vom Arbeitsstellenleiter der „Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy“, Ralf Wehner, sowie den Kollegen Birgit Müller und Tobias Bauer.
Leipzig, im November 2024 Clemens Harasim
64 Dazu insbesondere Felix Loy, Bach-Rezeption in den Oratorien von Mendelssohn Bartholdy, Tutzing 2003 (= Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft, Band 25), S. 104 und S. 136.
65 Diesem gehörten – zunächst unter der Ägide der Witwe Cécile Mendelssohn Bartholdy – der Jurist Heinrich Conrad Schleinitz, der Bruder Paul Mendelssohn-Bartholdy sowie die Musikerfreunde Ferdinand David, Moritz Hauptmann, Ignaz Moscheles und Julius Rietz an. Siehe dazu Ralf Wehner, Einleitung, Serie I, Band 9 (2016) dieser Ausgabe, S. XXIV–XXV; insbesondere zur diesbezüglichen Rolle und Bedeutung der Witwe siehe auch Christiane Wiesenfeldt, Zwischen Vormundschaft und Bevormundung. Die Komponistenwitwe Cécile Mendelssohn Bartholdy, in: Mendelssohn-Studien 19 (2015), S. 209–229.
66 Alfred Dörffel, Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig vom 25. November 1781 bis 25. November 1881 (= Festschrift zur hundertjährigen Jubelfeier der Einweihung des Concertsaales im Gewandhause zu Leipzig), Leipzig 1884, S. 140.
67 Aus Moscheles’ Leben. Nach Briefen und Tagebüchern, hrsg. von Charlotte Moscheles, Band 2, Leipzig 1873, S. 203.
68 Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Archiv, Konzertprogramme 1843–1948: 1851/1852. Mit Abdruck des Gesangstextes. Die beiden Teile sind überschrieben mit: „(Stücke aus dem ersten Theile ‚die Geburt.‘)“ und „(Stücke aus dem dritten Theile ‚die Kreuzigung.‘)“. Siehe dazu oben die Diskussion über mutmaßliche Werkgestalt und -titel. Dieses Konzert ist als „Erstaufführung“ deklariert in: Theodor Müller-Reuter, Lexikon der deutschen Konzertliteratur. Ein Ratgeber für Dirigenten, Konzertveranstalter, Musikschriftsteller und Musikfreunde, Leipzig 1909, S. 118. Im Übrigen sei es von Schleinitz geleitet worden, ebd.
69 Emil Kneschke, Das Königliche Conservatorium der Musik zu Leipzig 1843–1893 (= Universal-Bibliothek für Musikliteratur, Nr. 4–5), Leipzig [1893], S. 33.
This volume contains all surviving musically developed components of Felix Mendelssohn Bartholdy’s planned third oratorio “Erde, Hölle und Himmel” [“Earth, Hell, and Heaven”] (“Christus”) MWV A 26, including the sketches. The preserved sources include a fragmentary, two-part composition autograph,1 which also formed the basis for the posthumous first edition,2 as well as a number of sheets containing sketches. A number of questions about this fragment remain to this day, above all because of the lack of written comments made with respect to it by the composer. The work in progress is not mentioned in any surviving letters or other notes.3 Conclusions about the genesis and intended form of the work, as well as about the timeframe and manner in which it was recorded, can thus only be inferred from the – largely obscure – prehistory, the statements of third parties, and the surviving sources themselves.
The starting point in this regard is and remains the origin of the oratorio fragment’s title.4 As the only existing autograph manuscript does not bear a title,5 it is reasonable to conclude that Mendelssohn had not yet decided on a definitive title when he produced it. The strongest evidence supporting “Erde, Hölle und Himmel” as the working title can be found in the diary of Queen Victoria of England (1819–1901), who, on December 4, 1847, referred to a libretto with this title by Baron Christian Carl Josias von Bunsen (1791–1860): “Bunsen much regrets Mendelssohn, whom he had known very well. He had settled & arranged with him the text for the new Oratorio of ‘Earth, Hell & Heaven’ & said it had been wonderful to see how beautiful Mendelssohn chose the text from Scripture.”6 The Queen had already made a reference to the project on May 1, 1847, after a visit from Mendelssohn to Buckingham Palace: “For some time he has been engaged in composing an Opera & an Oratorio, but has lost courage about them. The subject […] for the Oratorio [is] a very beautiful one depicting Earth, Hell & Heaven, & he played one of the Choruses out of this to us, which was
very fine.”7 It can therefore be said with a fair degree of certainty that the librettist Bunsen played a key role in the creation of an oratorio entitled “Erde, Hölle und Himmel,” and that the surviving music was intended precisely for this oratorio. On the other hand, it is also necessary to consider the following remarks of Ignaz Moscheles (1794–1870), made three days after Mendelssohn’s death: “I was finally able to convince him to allow me to hear his latest works. He spoke of a first act of an opera Loreley, a violin quartet, and several songs. His brother [Paul Mendelssohn-Bartholdy] told me that there is a plan among Mendelssohn’s papers for an oratorio: Christus. He said that 2 pieces were already finished. Felix apparently told him that he wanted to save the best of his energy for this work!! It was on October 5th when he truly felt in good spirits musically.”8 The title of the first edition of 1852, which is still used today, can evidently be traced back to this single statement by Mendelssohn’s brother Paul as relayed by Moscheles. The “plan among Mendelssohn’s papers” was probably not the two “finished pieces” in score form; rather, Moscheles was likely referring either to the sparse notes on the organization of the work9 – where Mendelssohn was indeed unambiguous in his use of the title “Erde, Hölle und Himmel” – or to Bunsen’s arrangement of the text, to which Mendelssohn had definitely contributed with additions, alterations, and specifications.10 However, if one assumes that the letter is referring to an altogether different “plan,” one which is to this day still completely unknown and was titled according to the information in Moscheles’s letter, the oratorio title “Christus” may very well be justified. The title was also mentioned in a letter written on the same day as Moscheles’s, from Clotilde Charlotte Gräfin Reuss (1821–1860) – wife of Mendelssohn’s friend Heinrich II Graf von Reuss-Köstritz (1803–1852) – to her sister: “Mendelssohn also composed much of an opera, much of a new oratorio ‘Christus,’ and several songs and other little pieces; all this summer.”11 The countess’s husband most likely received this information from
1 Source C
2 RECITATIVE und CHÖRE aus dem unvollendeten Oratorium CHRISTUS von FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY. Op. 97, publisher: Breitkopf & Härtel (plate no. 8430), Leipzig, 1852. The work was published in parallel in London with an English text by William Bartholomew.
3 This is rather surprising considering how regularly Mendelssohn wrote to friends and relatives about his compositional work and plans, if often only in passing. The fact that he did not do so in this case suggests (putting aside the possibility that such remarks may have been lost) either that the necessary discussions with respect to the oratorio took place in person or that he felt the piece was not yet ready to deserve mention.
4 This question is also not without significance for matters of content, structure, and conception of the work.
5 See Source Description, Source C
6 Quoted from George R. Marek, Gentle Genius. The Story of Felix Mendelssohn Bartholdy, London, 1972, p. 318.
7 Quoted from ibid., p. 306. It is almost certain that one of the two choruses from the manuscript was played, either “Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen” [“A star will rise from Jacob”] or “Ihr Töchter Zions” [“Daughters of Zion”].
8 Letter of November 7, 1847, from Ignaz Moscheles to Josef Fischhof, quoted from Ernst Rychnovsky, Aus Felix Mendelssohn Bartholdys letzten Lebenstagen, in: Die Musik VIII/9 (1908/09), pp. 141–146 (hereafter: Rychnovsky, Letzte Lebenstage), quotation on p. 142. It is at least possible to establish a rough timeline for the composition of the opera fragment Die Lorelei MWV L 7 and the “violin quartet” (String Quartet in F minor MWV R 37), which were composed mainly during Mendelssohn’s stay in Switzerland in the summer of 1847. However, nothing further is known about the oratorio fragment, which was mentioned not by Mendelssohn himself but only – and apparently after the fact – by Paul Mendelssohn-Bartholdy.
9 See, among others, Source B
10 Source [A].
11 Letter of November 7, 1847, from Clotilde Charlotte Gräfin Reuss to Elise Gräfin zu Castell-Castell, quoted from Raphael Graf von Hoensbroech, Felix Mendelssohn Bartholdys unvollendetes Oratorium Christus, Cassel, 2006 (= Kölner Beiträge zur Musikwissenschaft; vol. 6) (hereafter: Hoensbroech, Christus), p. 96.
Moscheles himself, as the former was not among those in contact with the Mendelssohn family at the time.
The title “Christus” also led to the widespread notion that the oratorio was conceived wholly as a treatment of the life story of Jesus, compiled from biblical texts and enriched with chorales. In 1886, for example, Wilhelm Lackowitz (1837–1916) wrote about the piece: “Mendelssohn had the idea of treating the story of Christ’s life and suffering in an oratorio earlier, but he then chose a different path with ‘Elias.’ The idea was not, however, abandoned. Indeed, in the conclusion of ‘Elias,’ which refers directly to the appearance of the Son of God, he not only rekindles the idea but also uses it to lend a decisive impulse to the work. It can be said almost with certainty that only then was this idea – of contrasting the rigid, unbending representative of the old covenant with the loving, world-redeeming mediator of the new covenant – able to take shape. With this came the possibility of realizing a trilogy, in which Elias, Christus, and Paulus represent the main pillars of the kingdom of God on earth.”12 Thus, according to Lackowitz, one could clearly “make out a plan where, in short, the oratorio ‘Christus’ was supposed to bring together that which Sebastian Bach had depicted in his Christmas oratorio and his Passion music. […] As far as one can tell, the work was to comprise two parts, the first depicting the ‘Nativity,’ the second the ‘Passion of Christ.’ […] ‘Christus’ would not have failed in succeeding either Handel’s Messiah or Bach’s Passion music and Christmas Oratorio.”13 In contrast, Rudolf Werner, assumed a three-part conception, which would nevertheless only have included the life story of Jesus according to the Bible: “Evidently, the material was to be presented in three parts, the first of which dealt with the birth of Christ, the second with the Passion, and the third presumably with the Resurrection.”14 This could be reconciled with a conception of Erde – Hölle – Himmel insofar as the Incarnation corresponds to “Earth,” the Passion to “Hell,” and the Resurrection to “Heaven.” Diverging interpretations can, however, be found early on, whereby the life of Jesus is assigned to “Earth”; the socalled Harrowing of Hell – i.e., Jesus’s descent into the underworld after the crucifixion – to “Hell”; and, finally, the actual
Resurrection and Ascension to “Heaven.” Accordingly, all known music would belong to the first part (“Earth”). Julius (Isaac) Benedict’s (1804–1885) description of the unpublished fragment could be interpreted along these lines although he retains the title “Christus”: “Two violin quartetts were composed and written out; the first act of an opera, entitled ‘Loreley,’ completed; several portions of his new grand oratorio of ‘Christ’ (our Saviour’s earthly career, descent to hell, and ascension to heaven) were sketched out, and some partly finished […].”15 In a second edition of 1853, Benedict amended the final section of the otherwise unaltered lecture with a different description of the oratorio: “The work to which he attached the most importance was his oratorio ‘Christus,’ which he intended should comprise the three great periods in our Saviour’s life—1st, his Birth; 2nd, his Sorrows and Death; and 3rdly, his Resurrection. All that has come before us consists of fragments of the first and second parts […].”16 The Passion scene is assigned to the second part of the oratorio here, a decision that was undoubtedly influenced by the edition that had been released in the meantime. The second part is now no longer referred to as “descent to hell,” but as “his Sorrows and Death,” and the third part no longer as “ascension to heaven,” but as “resurrection.” This reinterpretation – and, if you like, misinterpretation – by Benedict, made with knowledge of the 1852 edition, is remarkable to the extent that it raises the question of how he had previously arrived at the correct interpretation. Benedict, who visited Mendelssohn as late as October 1847, had a rather detailed insight into the latter’s recent compositional work.17 His comments on the sketches in the context of the posthumous first edition also speak to this fact: “It would have been both interesting and instructive had the sketches which exist of the greater part of this Oratorio (and which would doubtless afford an insight into the whole plan) been published.”18 Thus, Benedict had evidently not only seen the fully developed movements, but also sketches for the oratorio; his wording even suggests that there may have been more sketches19 beyond those available today. In any case, Benedict’s earlier statements – which, uninfluenced by the print, still assigned the Passion scene to the first rather
12 Recitative und Chöre aus dem unvollendeten Oratorium ‘Christus’ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. […] Text introduced and with commentary by W. Lackowitz (= Gustav Modes Text-Bibliothek, no. 216), Berlin, [1886], p. III.
13 Ibid., pp. III–IV. The idea that the oratorio should generally consist of only two parts (dealing with the Nativity and the Passion of Jesus), which is suggested above all by the two-part division in the 1852 print, can still be found in Ernst Rychnovsky’s 1908 edition: “‘Christus’ (op. 97) has remained a fragment. It was to consist of two parts. From the first part, which was to deal with the birth of Christ, a recitative for soprano, a [...] trio [...] and the chorus ‘Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen’ have been completed […]. The second part was meant to depict the Passion of Christ. Extant are the Pilate scenes and the chorus ‘Ihr Töchter Zions’.”, Rychnowsky, Letzte Lebenstage [note 8], pp. 142f., note 3.
14 Rudolf Werner, Felix Mendelssohn Bartholdy als Kirchenmusiker (Veröffentlichungen der Deutschen Musikgesellschaft. Ortsgruppe Frankfurt a. M., vol. II), Frankfurt/Main, 1930 (hereafter: Werner, Kirchenmusiker), p. 106.
15 Sketch of the Life and Works of the late Felix Mendelssohn Bartholdy. Being the Substance of a Lecture, delivered at the Camberwell Literary Institution, in December, 1849. By Jules Benedict, London, 1850, p. 57.
16 Sketch of the Life and Works of the late Felix Mendelssohn Bartholdy. By Jules Benedict. Second Edition, with Additions, London, 1853, pp. 62–63.
17 Benedict, who was musical director at the Drury Lane Theater in London, had been friends with Mendelssohn from their youth. He met with him repeatedly during the latter’s last trip to England in April and May 1847 and visited him several times in mid-October 1847, when they talked about future plans: “[…] on the morning of the 9th October […] he suddenly turned deadly pale, and, quickly after becoming insensible, he was borne home to his family. Three days later, arriving myself at Leipsic, I was permitted to approach him, but only stayed a moment in his presence. On the following day, the 12th, he felt better, and desired earnestly to see me. He got up, and spent almost two hours with me. […] The next day I saw him again, and for the last time. He seemed more cheerful, and observed […]. We discoursed of future plans; and I left him with the sanguine hope of hearing soon of his perfect recovery.”, ibid., pp. 58–59.
18 Ibid., p. 63.
19 See Sources C and D
than the second part – should essentially be interpreted as an indication that the general vision of the composer and librettist was a three-part oratorio (Jesus’s Life and Suffering – Harrowing of Hell – Resurrection).
Today, we can only speculate about the specific content and text of the second part, which handled “Christ’s Harrowing of Hell.” The plot could not have been based on biblical texts alone. The Gospels and the Acts of the Apostles make no reference to such a descent between the death and resurrection of Jesus, and it receives only a brief mention in Ephesians (chapter 4.9: “Now that he ascended, what does this mean but that he also descended into the depths of the earth?”). At the same time, the descent into the underworld, into the “depths of the earth” (“inferiores partes terrae”), is one of the basic tenets of Christian faith, which is also reflected in the Apostolic Creed in the expression: “descendit ad inferos” (“descended into hell”). In contrast, the apocryphal Gospel of Nicodemus20 provides a detailed, vivid, and highly dramatic account of Jesus’s descent into the underworld.21 According to this gospel, Jesus encounters here the forefather Adam as well as the martyrs and the prophets, including John the Baptist, who had arrived just before to announce the Lord’s arrival to the prophets. After a debate between Satan and Hades, Jesus, accompanied by angels, breaks through the “gates of brass and bars of iron,” puts Satan in chains, and leads the prophets from the underworld to paradise. Evidently, the consistent and multi-layered drama of the narrative had left a strong impression on Mendelssohn; Julius Schubring (1806–1889), one of the librettists of Paulus MWV A 14, recalled in 1866: “We did not exchange any words about the oratorio ‘Christus’: on the other hand, we did discuss Peter and John the Baptist on an earlier occasion. He was extremely interested in what I had told him about the account of Christ’s Descent into Hell in the Gospel of Nicodemus, and from what he said, I can assume that he would have found a musical use for it.”22 Indeed, a remark by Schubring at the be-
ginning of 1840 probably provided the strongest impetus for the theme of a new oratorio by Mendelssohn; the focus of the correspondence was initially John the Baptist: “By the way, I’ve been thinking for some time that there’s still nothing suitable for the main feast – Easter. Ramler and Zelter are said not to amount to much. The idea recently came back to me quite vividly when I read in the apocryphal Gospel of Nicodemus the truly poetic description of Christ’s Descent into Hell – (which is also placed between the Death & Resurrection of the Lord in the Apostolic Creed).”23 Mendelssohn replied: “You have sent me a very important message with your mention of the apocryphal Nicodemus, and with his Descent into Hell – I believe this will allow me to complete of my idea of composing a large work about Hell and Heaven, and that will be the pillar I have been searching for for so long.”24 Thus, it is likely that the composer was from this point onwards looking for a suitable libretto more or less consistently; the theme, including the broad structure of the narrative and key aspects of its content, had already been found.
Mendelssohn’s collaboration with Schubring, the main librettist of St. Paul MWV A 14, culminated in the successful premiere of that oratorio in Düsseldorf on May 22, 1836. Shortly after, the two had already begun exchanging ideas for a further work in the genre.25 Their initial plan was to have “Paulus” followed by “Petrus”: “There are several external reasons for choosing Petrus as the subject. […] I need not tell you that there is no lack of internal reasons as to why the material is dear to me.”26 Soon after, Mendelssohn also turned to Carl Klingemann (1798–1862); in a letter dated August 12, 1836, concerning, above all, the planned performance of St. Paul in Liverpool and its publication by Novello, he wished that “instead of doing so much for the old oratorio, you would make me a new one! and, with it, inspire me to take on something new, instead of me having to continually inspire myself to do so.”27 His ideas would be “much more productively directed toward an Elias, or Petrus
20 The rich reception history of this apocryphal text, which was originally written in Greek and has survived in over 500 manuscripts, stems in large part from the “colorful depiction of the Passion and Resurrection, including Christ’s descent into Hell. […] It [becomes] clear that the suffering and death of Jesus […] were of great importance for Christian piety from the very beginning.” Jens Schröter, Die apokryphen Evangelien. Jesusüberlieferungen außerhalb der Bibel, Munich, 2020, p. 82.
21 This detailed account forms the third part of the “Gospel of Nicodemus”; the first part, also known as the “Acta Pilati” (“Acts of Pilate”), deals with the actual Passion narrative (trial and condemnation); the second part reports on the burial, capture, and miraculous liberation of Joseph of Arimathea. The text is based – according to the prologue of the Greek version – on the Hebrew records of contemporary Jews translated by the Roman officer Ananias or – according to the prologue of the Latin version – on writings from the archives of Pontius Pilate. Both versions also refer to Hebrew chronicles of Nicodemus, who, according to the Gospel of John, witnessed the trial and the burial. See, also with respect to the following, ibid. pp. 82–86.
22 Julius Schubring, Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy, an dessen 57. Geburtstage (3. Februar 1866) […], in: Daheim. Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen, Leipzig, 1866, p. 376.
23 Letter of February 19 and 21, 1840, from Julius Schubring to Felix Mendelssohn Bartholdy, Bodleian Library, University of Oxford (hereafter: GB-Ob), MS. M. Deneke Mendelssohn d. 37, Green Books XI-59, printed in: Briefwechsel zwischen Felix Mendelssohn Bartholdy und Julius Schubring, zugleich ein Beitrag zur Geschichte und Theorie des Oratoriums, ed. by Julius Schubring, Leipzig, 1892 (hereafter: Briefwechsel mit Schubring), pp. 155–160, quotation on pp. 156–157.
24 Letter of February 25, 1840, to Julius Schubring, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv (hereafter: D-B), 55 Ep 1340, printed in: Briefwechsel mit Schubring [note 23], pp. 160–162, quotation on p. 161.
25 In a letter dated July 14, 1837, Mendelssohn wrote to Schubring for the first time in this regard, “because it was you who gave me the best suggestions and information for the text in my St. Paul.”, Washington, D.C., The Library of Congress, Music Division (hereafter: US-Wc), Gertrude Clarke Whittall Foundation Collection, Mendelssohn Papers, ML 30.8j, box 2, folder 14, printed in: Briefwechsel mit Schubring [note 23], pp. 109–111, quotation on p. 109.
26 Ibid.
27 Letter of August 12, 1836, to Carl Klingemann, Jerusalem, The National Library of Israel, Archives Department, ARC. 4° 1651/11.2 Otto Lobbenberg Collection. no. 16, printed in: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, ed. and introduced by Karl Klingemann (jun.), Essen, 1909, pp. 204–205, quotation on p. 204.
or, if need be, Og of Bashan […].”28 The Old Testament story of the prophet Elijah increasingly took shape in his correspondences – first with Klingemann, then with Schubring – as the subject for his second oratorio.29 And yet Mendelssohn’s efforts with respect to another oratorio – i.e., his search for further material and discussions on the matter with others – would continue independently of and, to certain extent, in parallel with his work on Elijah MWV A 25.30
This process of exploration in the years leading up to the completion of Elijah clearly suggests that a chronology was not intended, just as does an apparent draft version of the text treating the life of Jesus which was largely complete, at least at a conceptual level, by April 1844,31 that is, around one year before the first sections of the second oratorio were committed to paper. That said, Otto Jahn already speculated on Mendelssohn pursuing a cyclical concept: “In addition to Elias, Mendelssohn had begun a second oratorio Christus, which was left unfinished. It is possible that the two were connected in a certain way, that the prophet of the old covenant was intended to precede Christ […].”32 Rudolf Werner wrote in the same vein, also in reference to Elijah: “And if the conclusion of this work points to the coming of Christ, this was likely not only done to provide the oratorio with a sublime conclusion, but also with the specific idea of having an oratorio on Christ follow Elijah; positioned between Elijah, the strongest prophet of the Old Testament, and St. Paul, the most powerful proclaimer of the new Gospel, it would have formed a trilogy together with these two.”33 The idea of using the specific themes of “Earth,” “Hell,” and “Heaven” for an oratorio first emerged in 1839, in interactions with the librettists Carl Gollmick (1796–1866) and Henry Fothergill Chorley (1808–1872). Gollmick, a répétiteur at the opera house in Frankfurt am Main, sent Mendelssohn a draft libretto after personal consultation, which – according to Gollmick – “demands the three highest principles of moral existence, ‘Earth, Heaven, and Hell.’ After an initial treatment of this material of extremes in prose and dividing it into scenes, I handed the manuscript over to my friend Gambs in order to be as certain as possible, who then arranged all these parts so poetically according to biblical texts that I allowed myself to consider the matter complete.”34 As the “prose” draft in question has not survived, it is not possible to determine whether Gollmick con-
tributed anything to the plans for the oratorio other than the presumed title, especially since the correspondence between Gollmick and Mendelssohn did not continue thereafter.35 Mendelssohn had also maintained an active correspondence with the music writer Henry Fothergill Chorley about the oratorio subject “Earth, Heaven, and Hell” since the latter’s visit to the Niederrheinisches Musikfest in Düsseldorf in May 1839. In November, Chorley wrote with noticeable enthusiasm: “But your floating vision of Earth, Hell & Paradise lost something of a more tangible form. What think you of making the story of Dives & Lazarus the frame-work of such an opus? – Say, in the first part of Earth – a chorus or choruses descriptive of natural beauty – Spring for instance – on presenting the cheerful images of busy, domestic life. […] Then, to proceed, – a harvest feast for the sick-man’s banquet – (with the poor beggars at the gate) & here (to link as it were, the present with the future) might be introduced that parable of the same import with the story of Lazarus. […] Then, the second part would comprise the sick man, placed amid the flames & torments of hell – agonized for one drop of water – & afterwards with the remembrances of his unconverted heathen – while the poor despised beggar, reposes in Abraham’s bosom, & answers the petitions of Dives, with the gentle, but passionless reply of a beatified spirit […].“36 But Mendelssohn raised questions and curbed Chorley’s enthusiasm, providing a detailed argument as to why he did not find the characters Dives and Lazarus or their roles in Hell and Heaven – just as on Earth – quite so compelling: “After what you say, I see that I have not been able to form an exact idea of what you intend the whole to be; the fact is, that I did not quite understand what part both figures should act in hell or in heaven – because I do not quite understand the part they act on earth – – and indeed the true sense of the story itself, as I find it in the Evangile. – Or is there another source, which you took your notions from? I asked some of my theological friends here, but they knew none. – I only find Dives very rich and Lazarus very poor, and as it cannot be only for his riches that one is burning in hell, while the other must have greater claims to be carried to Abraham’s bosom than his poverty alone, it seemed to me as if some very important part of the story was left in blank. Or should Lazarus be taken as an example of a virtuous poor man, the other of the contrary? But then we ought to know or
28 Ibid.
29 See Christian Martin Schmidt, Zwischen Eschatologie und geschlossenem Kunstwerk. Gattungskonzept und Bibelinterpretation in Mendelssohns Oratorium Elias op. 70 MWV A 25, in: Denkströme Heft 7. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, ed. by Pirmin Stekeler-Weithofer on behalf of the Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, 2011, pp. 122–150.
30 For a general overview of Mendelssohn’s further oratorio plans after St. Paul, see above all Christian Martin Schmidt, Introduction, Series VI, Volume 11A (2012) of this edition, p. XLIV.
31 Source [A]; see below.
32 Otto Jahn, Ueber F. Mendelssohn Bartholdy’ s Oratorium Elias, in: Allgemeine musikalische Zeitung 50 (1848) no. 8 (February 23), cols. 113–122, quotation in col. 115; reissued as Ueber Felix Mendelssohn Bartholdy’ s Oratorium Elias, in: Gesammelte Aufsätze über Musik von Otto Jahn, Leipzig, 1866, pp. [40]–63, quotation on p. 43.
33 Werner, Kirchenmusiker [note 14], p. 105.
34 Carl Gollmick, Auto-Biographie nebst einigen Momenten aus der Geschichte des Frankfurter Theaters, Frankfurt/Main, 1866, vol. 2, p. 106.
35 R. Larry Todd, on the other hand, states that “the […] oratorio fragments are almost certainly the remains of a collaboration between Mendelssohn and Gollmick”, Felix Mendelssohn Bartholdy. Sein Leben. Seine Musik, Stuttgart, 2008, p. 606. According to this account, it was not Bunsen’s but Gollmick’s now unknown libretto that formed the basis of the setting.
36 English letter of November 3, 1839, from Henry Fothergill Chorley to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 36, Green Books X-120.
to learn (by the poem) what he does or has done to deserve the greatest of all rewards: the mere reason (as given in St Luke) that he suffered want, and that the other has had his share of happiness on earth already, does not seem sufficient to me to give interest to the principal figure of such a poem, as that which you intend. – Perhaps you have another view of the whole; pray let me know it, and tell me what part you would give to both of them in earth, hell and heaven – if once delivered of this scruple, I should quite agree with your opinion, and the great beauties, you point out, I certainly should feel and admire with all my heart. Do not lose patience with me; I am of a rather slow understanding, and can never move forwards untill [sic] I have quite understood a thing. The best is, that in all such discussions one always draws nearer, not only to the subject, but also to each other.”37 In his reply, Chorley again explained his idea and concept, this time in more detail, answered Mendelssohn’s questions, and tried to dispel his concerns, because: “It seems to me that we are misunderstanding each other […].”38 While Chorley’s plan still failed to convince the composer, it certainly contributed to the latter’s subsequent concretization of his ideas. At the same time, Mendelssohn must have occasionally expressed a general interest in a “Christus” theme. In a letter dated April 5, 1842,39 Otto Jahn (1813–1869) sent him a libretto by his organ teacher Johann Georg Christian Apel (1775–1841) entitled “Christus. An oratorio, compiled from Bible verses and hymn strophes from the Schleswig-Holstein Hymnal, set to music for solo and choral voices with obbligato organ accompaniment and combined with free organ fantasies.”40 It can be assumed that this work – which, however, was in four parts – had some sort of influence on Mendelssohn’s conception of his own oratorio; however, the lack of recognizable similarities also means that his knowledge of this libretto remained largely inconsequential for his own work.
Evidence of the conception of an oratorio work, now furnished in turn with the specific thematic terms Earth – Hell – Heaven, is provided by an undated slip of paper with writing on both sides, which, consistent with its title, is known in Mendelssohn research as “Fürst’s Plan.”41 Here, Mendelssohn took down the key points of the content according to the ideas of Joseph Fürst (1794–1859), a merchant friend from Berlin who had already
helped him considerably with the libretto of St. Paul 42 Mendelssohn added his own ideas, but since these only consisted of a few lines for the first part, they remained fragmentary. Without biblical – let alone christological – connections, the markedly figurative key references are closer in content and concept to popular works of the time, such as Louis Spohr’s Das jüngste Gericht and, above all, Friedrich Schneider’s Das Weltgericht (based on the libretto by August Apel), than to the classical biblical oratorio. They suggest more of a non-ecclesiastical, to a certain extent secular religiosity. In addition, the lyrical element seems to be given preference over the dramatic. This is entirely in keeping with the contemporary aesthetics of the oratorio genre, whose “basic essence must be lyrical,” according to Gottfried Wilhelm Fink (1783–1846),43 while only “the second main component [is] the dramatic alternation of different characters (to which we already count the alternation of various solo songs, choruses, and double choruses),” and this only because it would otherwise “degenerate into a poetic narrative, which, by its very nature, can only very rarely be musical.”44 For this reason, a good libretto should ideally dispense with narrative elements and unfolding plots, and instead should alternate between the reflective components and those which are emotionally moving for the listener. According to Fink, an oratorio could not be a drama in the conventional sense, because: “As is well known, drama demands that various characters develop through actions before our eyes and thereby drive both themselves and the work in its entirety toward a necessary goal. In this way, the actions of the characters bring the sensations in the listener to life and carry them through to the end. This certainly cannot happen in the cantata or the oratorio. […] Such relationships, which lend the drama its eminence, cannot be depicted in music, which is more about what has become than what is becoming. […] This appeal of clarity of context […] must be replaced in the cantata and the oratorio almost entirely by the listener’s imagination, indeed even by vivid images conjured through associative understanding.”45 Mendelssohn’s decision not to pursue the concept outlined in “Fürst’s Plan” any further must therefore also be understood as part of a search for oratorio material with both a stronger relationship to the Bible and a more dramatic narrative. It is apparent that the path taken with
37 English letter of February 28, 1840, to Henry Fothergill Chorley, location unknown, quoted from a photocopy of a previous owner, first printed in: Henry F. Chorley, Autobiography, Memoirs and Letters, London, 1873, vol. 1, pp. 309f.
38 English letter of March 10, 1840, from Henry Fothergill Chorley to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 37, Green Books XI-96.
39 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 41, Green Books XV-168.
40 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 27, fol. 92–101. The libretto was also printed in Kiel in 1825, apparently as a booklet for the premiere of the oratorio, which was only accompanied by organ. Apel’s setting has not survived, as he destroyed the score shortly before his death.
41 Source B
42 Until a few years ago, Joseph Fürst, who always signed his letters and documents “J. Fürst,” has been confused by scholars with the Leipzig orientalist Julius Fürst (1805–1873). In a letter dated March 27, 1848, Joseph Fürst introduced himself to Robert Schumann “as one of the closer local friends of our unforgettable Felix Mendelssohn-Bartholdy […] and as someone who did not occupy one of the more marginal positions among these close friends.” (Schumann Briefwechsel, Series II, Volume 17, ed. by Klaus Martin Kopitz, Eva Katharina Klein, and Thomas Synofzik, Cologne, 2015, pp. 180–182, quotation on p. 180f.), In the follow-up letter of April 19 that year, he even states: “I may say that I have lost in Felix my best friend. No one was as sympathetic to both my greatest and smallest interests. His death almost crushed me.” (ibid., pp. 183–185, quotation on p. 184).
43 Gottfried Wilhelm Fink, Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen, in: Allgemeine musikalische Zeitung 29 (1827), no. 37 (September 12), cols. 625–632 and no. 38 (September 19), cols. 641–649, quotation in col. 626.
44 Ibid., col. 627.
45 Ibid., col. 628.
St. Paul and ultimately continued with Elijah seemed more attractive to him. In the end, all the drafts, ideas, concepts, and plans can essentially be seen as more or less productive suggestions in the context of deliberations for a further oratorio. It is clear that Mendelssohn was most convinced by the plan and draft text of Baron von Bunsen, who was given preference accordingly.46 Bunsen sent part of it to the composer during his stay in Berlin on “Easter Monday morning 44,” April 8, 1844: “Here you have the draft written out up until the Resurrection: What follows is found in the drafts which I made 10 and 15 years ago, and which I therefore only want to look at again in London, where we will meet. I have not yet had time to add the chorales in the second piece: I believe they should be placed between Jesus’s words on the cross. The end of the first piece seems fitting to me. All of it is achievable: It will just be necessary to refrain here and there from extending the transitions through narration. I have suggested ca[n]zones as a new means of replacing such passages. I am sending you the draft for the Holy Week and the hymnal so that you can share your opinion with me tomorrow morning – 8 o’clock: I must depart at 10 o’clock.”47 It is evident from the musical sources that Mendelssohn did in fact want give as little room as possible to the narrating Evangelist, in the interest of a more dramatic action; it is doubtful that the “canzones” mentioned here (if this does not refer to the separately mentioned chorales) were to be composed later as a replacement. “First piece” evidently refers to the Nativity scene, the “second piece” to the Passion scene in the first part (“Earth”). No further conclusions can be drawn from Bunsen’s letter about the text of the second part (“Hell”). Other matters also remain unclear, such as the “chorales in the second piece […] between Jesus’s words on the cross,” as well as the related question as to whether the two surviving chorale verses were to be kept together and sung after the chorus “Ihr Töchter Zions” or were meant to be sung separately, each following certain words of Jesus within the envisaged crucifixion scene itself.48 Bunsen’s own theological views certainly played a significant role here; after all, he had just recently published a theological-liturgical study on the “Holy Week.”49 The hymnal he sent along with the letter was probably a copy of the one he published in 1833;50 a completely new version was not published until 184651 and was still in preparation at the time, as Bunsen informed his wife on July 22, 1844: “[So] I will now get to work on the ‘Allgemeines Gesang= und Gebetbuch’ – the
printing of which will begin on August 15 at the Rauhen Haus in Hamburg. […] This, in fact, is my book for body and soul.”52 The libretto, unknown today, probably contained not only the texts to the enclosed “first” and “second piece” of the first part as well to the second part “up until the Resurrection,” but also “what follows,” which Bunsen, as mentioned, intended to give the composer at an upcoming meeting in London in July 1844. However, no such meeting took place, as Mendelssohn had to leave London on July 11, while Bunsen’s arrival was ultimately delayed until July 15.53 It is therefore impossible to say with certainty whether the complete oratorio text reached the composer in the end or whether he was left only with a torso, on the basis of which work on the composition nevertheless commenced. On the other hand, there is little doubt that this draft by Bunsen, regardless of the condition it was in, ultimately served as the textual basis for Mendelssohn’s third oratorio. It is all the more regrettable that the text did not survive, as it could have provided answers to several important questions. According to Rudolf Werner, the document was “preserved until 1929 and was among the large collection of letters addressed to M. in the possession of Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Albrecht Mendelssohn Bartholdy in Hamburg, a grandson of the composer. As a result of a recent major fire, however, the material in question is currently inaccessible, and it is not yet possible to determine to what extent the manuscripts have survived.”54 Werner is referring to a fire that took place on April 4, 1929, which the Hamburger Fremdenblatt first reported on under the headline “Major fire in Wohldorf=Ohlstedt”: “On Thursday afternoon a fire broke out in the country residence of Professor Dr. Mendelssohn-Bartholdy at de Chapeaurougestraße 8, destroying most of the building down to the brick foundations in just a few hours. Shortly after 2 1/2 o’clock, the fire broke out in a room where plumbers were sealing a pipe and spread rapidly. The Wohldorf-Ohlstedt fire brigade tried to protect the lower building, in particular, so that the valuable scientific documents and books located there could be saved. Fortunately, there was plenty of water in the fire pond less than 50 meters from the site of the fire, so that the spread of the fire could be prevented in a way that saved almost all of the scientific collections, books, manuscripts, etc.”55 The Hamburgischer Correspondent reported on the same day: “Fire in Mendelssohn=Bartholdy’s house. The valuable library saved. In the country house on Chapeaurougestraße in Wohldorf-Ohlstedt, where Profes-
46 Source [A].
47 Letter [undated] from Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green Books XIX-227.
48 See the comments in Hoensbroech, Christus [note 11], pp. 151–154, especially the table on p. 154.
49 Die heilige Leidensgeschichte und die stille Woche. Von Christian Carl Josias Bunsen. Erste Abtheilung. Die Liturgie der stillen Woche mit Vorwort, Hamburg, 1841.
50 Versuch eines allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebetbuchs zum Kirchen= und Hausgebrauche, Hamburg, 1833.
51 Allgemeines evangelisches Gesang- und Gebetbuch zum Kirchen= und Hausgebrauch, Hamburg, 1846. The same year saw the publishing of: Vierstimmiges Choralbuch zum allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebetbuche zum Kirchen- und Hausgebrauch von Dr. Josias Bunsen. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. Friedrich Filitz, Berlin, 1846.
52 Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen. Aus seinen Briefen und nach eigener Erinnerung geschildert von seiner Witwe. […], vol. 2, Leipzig, 1869, p. 270.
53 See the letters of June 27, July 3, and July 8, 1844, from Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green Books XIX-60, d. 46, Green Books XX-10 and d. 46, Green Books XX-79b as well as the letter of July 10, 1844, to Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen, location unknown, contents summarized in: J. A. Stargardt, Katalog 252, Autographen [1925], no. 60, p. 6.
54 Werner, Kirchenmusiker [note 14], p. 105, note 128.
55 Hamburger Fremdenblatt, Friday, April 5, 1929, Morning Edition, p. 3.
sor Dr. Mendelssohn-Bartholdy lives, a fire raged yesterday afternoon, destroying most of the building down to the brick foundations. […] The firefighters from Wohldorf-Ohlstedt made a special effort to save the valuable scientific collections, and with the help of the Hamburg fire department […], they also managed to salvage almost all the books, documents, and manuscripts.”56 A technical article on the reconstruction of the architecturally and historically significant house, written by Albrecht Mendelssohn Bartholdy’s brother-in-law and cousin Hugo Carl Cornelius Wach (1872–1939), does not provide any details on where the documents ended up. A report of the fire, however, is provided at the beginning of the article: “On April 4, 1929, the country residence of the well-known university lecturer in international law Albrecht Mendelssohn-Bartholdy in Ohlstedt near Wohldorf, Hamburg, was destroyed by fire. The family found temporary accommodation in two travel carriages of the kind used by travelling communities.”57 The collection of letters addressed to Albrecht Mendelssohn Bartholdy58 also does not offer any clues, although the fire is mentioned in most of the letters written on April 6. One colleague wrote: “It is warmly hoped that […] your undoubtedly most valuable collection of rare books and manuscripts was saved from the flames.”59 According to Hugo Wach’s letter, “the beautiful furniture from the first floor has been preserved.”60 The majority of the historical documents, especially those from Felix Mendelssohn Bartholdy’s estate, also made it through the catastrophe unscathed.
Albrecht Mendelssohn Bartholdy’s (1874–1936) extensive collection of letters and documents (including the “Green Books”), which was almost completely spared in the fire, was sold after his death in its entirety at auction to Paul Victor Mendelssohn Benecke (1868–1944); Albrecht had taken the collection with him to Oxford when he was forced to emigrate from Germany at the end of 1933. Benecke, in turn, bequeathed the collection to Margret Deneke (1882–1969), and, after the death of her sister Helena Deneke (1878–1973), it was finally transferred to the holdings of the Bodleian Library. No such libretto can be found there, so it can be assumed that it was destroyed in the aforementioned fire.
As far as the sections set to music are concerned, Bunsen’s libretto probably resembled more a selection and compilation of biblical words and chorale texts than a classic libretto. The
opening recitative and the following trio are based on Matthew 2.1–2. The text of the chorus “Es wird ein Stern” is taken from Numbers 24.17 and Psalm 2.9. The Passion scene with the chorus “Ihr Töchter Zions” is largely based on the accounts in the Gospels according to Luke and John.61
It is undisputed that the order of the parts in the autograph also largely corresponds to the intended order in the oratorio. According to Rudolf Werner, the scene of the birth of Christ is “self-contained”;62 however, the surviving 25-bar sketch for a German “Nunc dimittis,”63 which undoubtedly was meant to form the conclusion of the scene, contradicts this. Thus, it is certain that at least the depiction of Jesus in the temple, with the Canticle of Simeon as the conclusion of the Christmas story, was intended to be set to music.
The Passion scene clearly references Bach’s Passions, particularly in the sequence of recitatives and turba choruses as well as with the chorale “Er nimmt auf seinen Rücken” [“He takes upon his back”].64 Nevertheless, there is no dramatizing division of roles, which has always been customary in Passion music; both the Gospel text and Pilate’s words are given to the tenor soloist, Christ’s words are nowhere to be found. Verse 3 from Luke 23, in which Christ speaks directly, is not set to music in the otherwise through-composed part, supporting the conclusion that Mendelssohn’s general decision not to use this stylistic device was deliberate.
At no point was there any doubt that this fragment constituted an unfinished work and that, even if musical material were to be found elsewhere, it would have remained a fragment. Nevertheless, the committee responsible for the posthumous publication65 of Mendelssohn’s works decided to have the score printed in this form, and it was subsequently released by Julius Rietz as Opus 97 in 1852. The publication of an unfinished work in the middle of the 19th century is quite astonishing. This decision can be traced back, above all, to the public’s demand for oratorio works by the composer following the success of St. Paul and Elijah, making it an exception to the general notion that torsos of works were as such not performable. However, it also reflected a desire to present Mendelssohn’s work to the public in as comprehensive a form as possible; the idea of a complete edition had played a role in publication decisions well before such a project would finally become a reality in the 1870s.
56 Hamburgischer Correspondent, Friday, April 5, 1929, Evening Edition, p. 3.
57 H. C. C. Wach, “Vom Bauernhaus zum Landhaus”, in: Deutsche Bauzeitung, ed. by Erich Blunck, vol. 64, no. 87–88 (October 29, 1930), pp. 602–606.
58 D-B, MA Nachl. 2
59 Ibid., 1929, no. 32.
60 Letter of April 15, 1929, ibid., no. 41.
61 For details on the origins of the text parts, see “Textvergleich”.
62 Werner, Kirchenmusiker [note 14], p. 106.
63 Source C, p. 139/59, Outline sketch C4
64 See especially Felix Loy, Bach-Rezeption in den Oratorien von Mendelssohn Bartholdy, Tutzing, 2003 (= Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft, vol. 25), p. 104 and p. 136.
65 Members of the committee – initially under the aegis of the widow Cécile Mendelssohn Bartholdy – included the lawyer Heinrich Conrad Schleinitz, the brother Paul Mendelssohn-Bartholdy, and the musician friends Ferdinand David, Moritz Hauptmann, Ignaz Moscheles, and Julius Rietz. See Ralf Wehner, Introduction, Series I, Volume 9 (2016) of this edition, pp. XXXVII–XXXIX; on the role and significance of the widow in this respect, see also Christiane Wiesenfeldt, Zwischen Vormundschaft und Bevormundung. Die Komponistenwitwe Cécile Mendelssohn Bartholdy, in: Mendelssohn-Studien 19 (2015), pp. 209–229.
It appears that the first public performance of the piece from Rietz’s edition took place at the Birmingham Music Festival in September 1852. One year later, it was performed in Vienna, and on November 2, 1854, a memorial service was held at the Leipzig Gewandhaus under the direction of Julius Rietz, at which “the movements to the unfinished oratorio ‘Christus’”66 were performed. As Ignaz Moscheles reported, the manuscripts of the work had been studied at the Leipzig Conservatory as early as the beginning of 1849: “The fragment ‘Christus’ from Mendelssohn’s estate is now being rehearsed by our students; it consists of five or six choruses, recitatives, and a trio in the most sublime style, worthy of the subject matter. A mourning chorus sung by the Daughters of Zion, and another sung by the masses, ‘Kreuzige ihn’ [Crucify him], are masterpieces which are bound to earn a prominent status even as fragments. The time of publication has yet to be determined.”67 There is no evidence of a performance at the conservatory that year, for example, for the solemn celebration of the anniversary of Mendelssohn’s death. However, the fragment is mentioned on a program note preserved from the memorial concert on November 4, 1851; as the printed edition was still in preparation at the time, it must have been sung from the manuscript.68 At the festive concert mark-
ing the tenth anniversary of the conservatory on April 2, 1853, the “pieces from the unfinished oratorio”69 were then surely performed from the printed edition.
Much gratitude is due to the Biblioteka Jagiellońska, Kraków, for the opportunity to inspect the autograph score and for permission to reproduce individual pages. The editor would also like to thank the Bodleian Library, University of Oxford; the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv; The National Library of Israel, Jerusalem; and The Library of Congress, Washington, D.C., for allowing access to original documents from their holdings. The editor received valuable assistance and productive suggestions from the director of the research center of the “Leipzig Edition of the Works of Felix Mendelssohn Bartholdy,” Ralf Wehner, as well as from his colleagues Birgit Müller and Tobias Bauer.
Leipzig, November 2024
Clemens Harasim (Translation: Sean Reilly)
66 Alfred Dörffel, Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig vom 25. November 1781 bis 25. November 1881 (= Festschrift zur hundertjährigen Jubelfeier der Einweihung des Concertsaales im Gewandhause zu Leipzig), Leipzig, 1884, p. 140.
67 Aus Moscheles‘ Leben. Nach Briefen und Tagebüchern, ed. by Charlotte Moscheles, vol. 2, Leipzig, 1873, p. 203.
68 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Archive, Konzertprogramme 1843–1948: 1851/1852. Includes a copy of the song text. The two parts are labeled: “(Pieces from the first part ‘the Nativity’)” and “(Pieces from the third part ‘the Crucifixion’)”. See the discussion above about the presumed form and title of the work. This concert is heralded as a “premiere” in: Theodor Müller-Reuter, Lexikon der deutschen Konzertliteratur. Ein Ratgeber für Dirigenten, Konzertveranstalter, Musikschriftsteller und Musikfreunde, Leipzig, 1909, p. 118, which also states that Schleinitz directed the concert, ibid.
69 Emil Kneschke, Das Königliche Conservatorium der Musik zu Leipzig 1843–1893 (= Universal-Bibliothek für Musikliteratur, no. 4–5), Leipzig, [1893], p. 33.
[Rezitativ]
Tenor solo Bass I solo Bass II solo
Wo ist der neu ge - bor - ne - Kö nig - der Ju den? - Wir
Wo ist der neu ge - bor - ne - Kö nig - der Ju den? - Wir ha ben - sei nen -
Wo ist der neu ge - bor - ne - Kö nig - der Ju den? - Wir ha ben -
Violoncello I
Violoncello II
Contrabbasso
solo
I solo
II solo
I
ha ben- sei nen - Stern ge sehn - und sind ge kom - men, - ihn an zu - be - ten, - und sind ge -
Stern, sei nen - Stern ge sehn - und sind ge kom - men, - ihn an zu - be - ten, - und sind ge -
sei nen - Stern ge sehn - und sind ge kom - men, - ihn an zu - be - ten, - und sind ge -
Clarinetto in B
Fagotto
Corno in Es [anche in D e B]
Tromba in Es [anche in D e B]
Trombone alto e tenore
Trombone basso
Timpani in G, f
Da ü ber - ant - wor - te - te - er ihn, dass er ge kreu - zigt - wür de. -
Sie nah men - Je sum - und führ ten - ihn hin zur Schä del - stät - te, - es folg te - ihm a ber -
gro ßer - Hau fe - Volks, und Wei ber, - die klag ten, - die klag ten- und be wei - ne - ten - ihn.
Ü Er Wo nimmt bist auf du, sei Son nen ne,Rü blie cken ben?die Die Las Nacht ten, hat - die dich mich ver drü triecken ben,bis die Nacht, zum Er des lie Ta - gen ges-
Ü Er Wo nimmt bist auf du, sei Son nen ne,Rü blie cken ben?die Die Las Nacht ten, hat - die dich mich ver drü triecken ben,bis die Nacht, zum Er des lie Ta - gen ges-
Wo Er nimmt bist du, auf Son sei ne, nenblie Rü ben?
ckenDie die Nacht Las ten, hatdich die ver mich trie drü - ben, ckendie bis Nacht, zum Er des lie Ta - gen ges-
Er Wo nimmt bist auf du, sei Son nen ne,- blie Rü ben?
ckenDie die Las Nacht ten, hat - die dich mich ver drü triecken ben,bis die Nacht, zum Er des lie Ta - gen ges-
Ü schwer, Feind. er Fahr wird hin, ein du Fluch, Er da denge son- ne, gener wenn wirbt Je - er sus,mir mei den neSe Won gen, ne,und noch o, hell wie in gna mei den nemreich Her - ist zender! scheint.
Ü Feind. schwer, Fahr er wird hin, ein du Fluch, Er da denge son- ne, gener wenn wirbt Je - er sus,mir mei den neSe Won gen, ne,und noch o, hell wie in gna mei den nemreich Her - ist zender! scheint.
Feind. schwer, Fahr er hin, wird du ein Er Fluch, den da - son gene, gen- er wenn Je wirbtsus, er - mei mir ne den - Won Se ne, gen,noch und o, hell wie in gna mei den nemreich Her - ist zender! scheint.
Feind. schwer, Fahr er wird hin, ein du Fluch, Er da denge son- ne, gener wenn wirbt Je - er sus,mir mei den neSe Won gen, ne,und noch o, hell wie in gna mei den nemreich Her - ist zender! scheint.
Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.
This is an excerpt. Not all pages are displayed.
Have we sparked your interest?
We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com.
