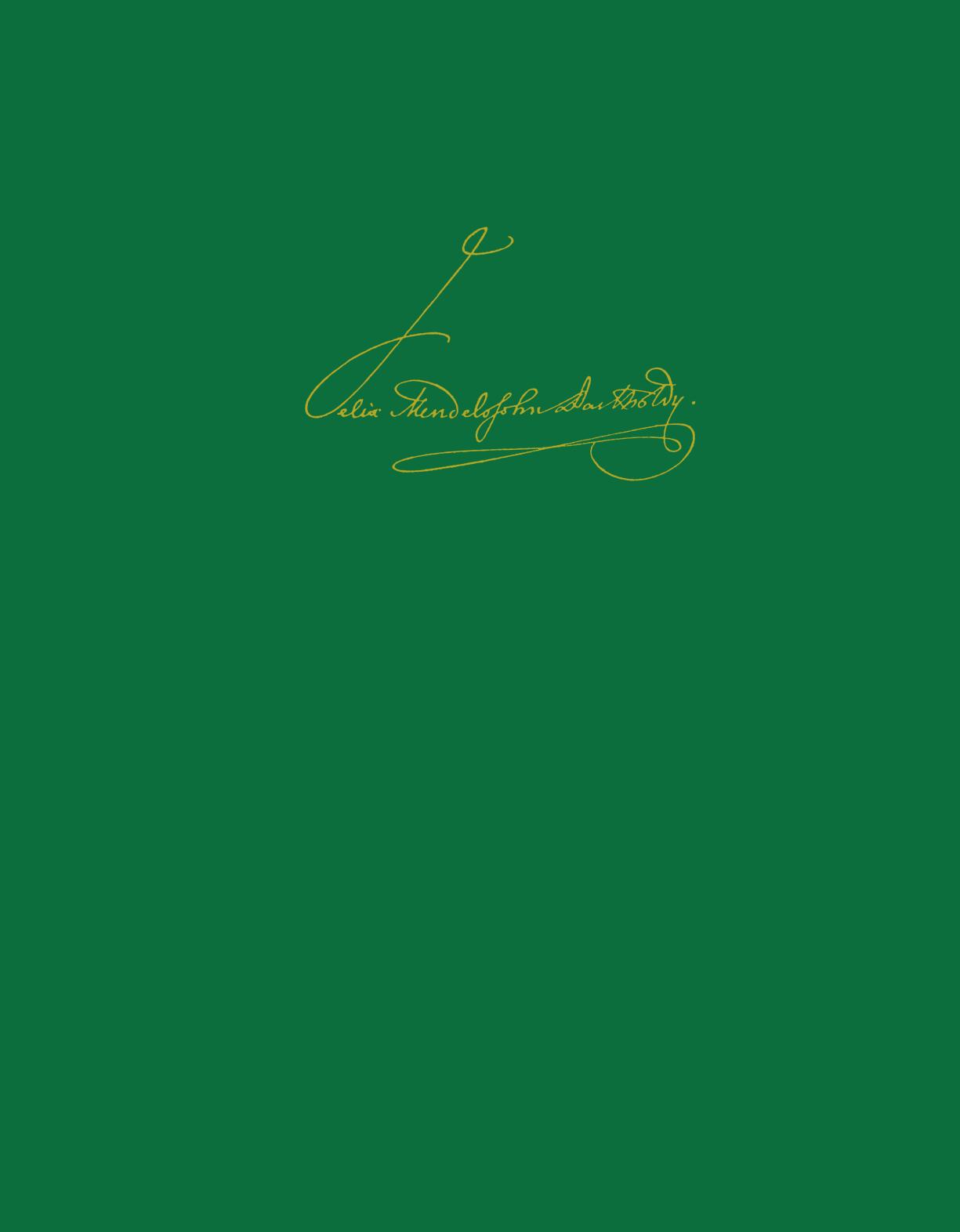
Leipziger Ausgabe der Werke von
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Leipziger Ausgabe der Werke von
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Herausgegeben von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Serie VI · Geistliche Vokalwerke Band 7

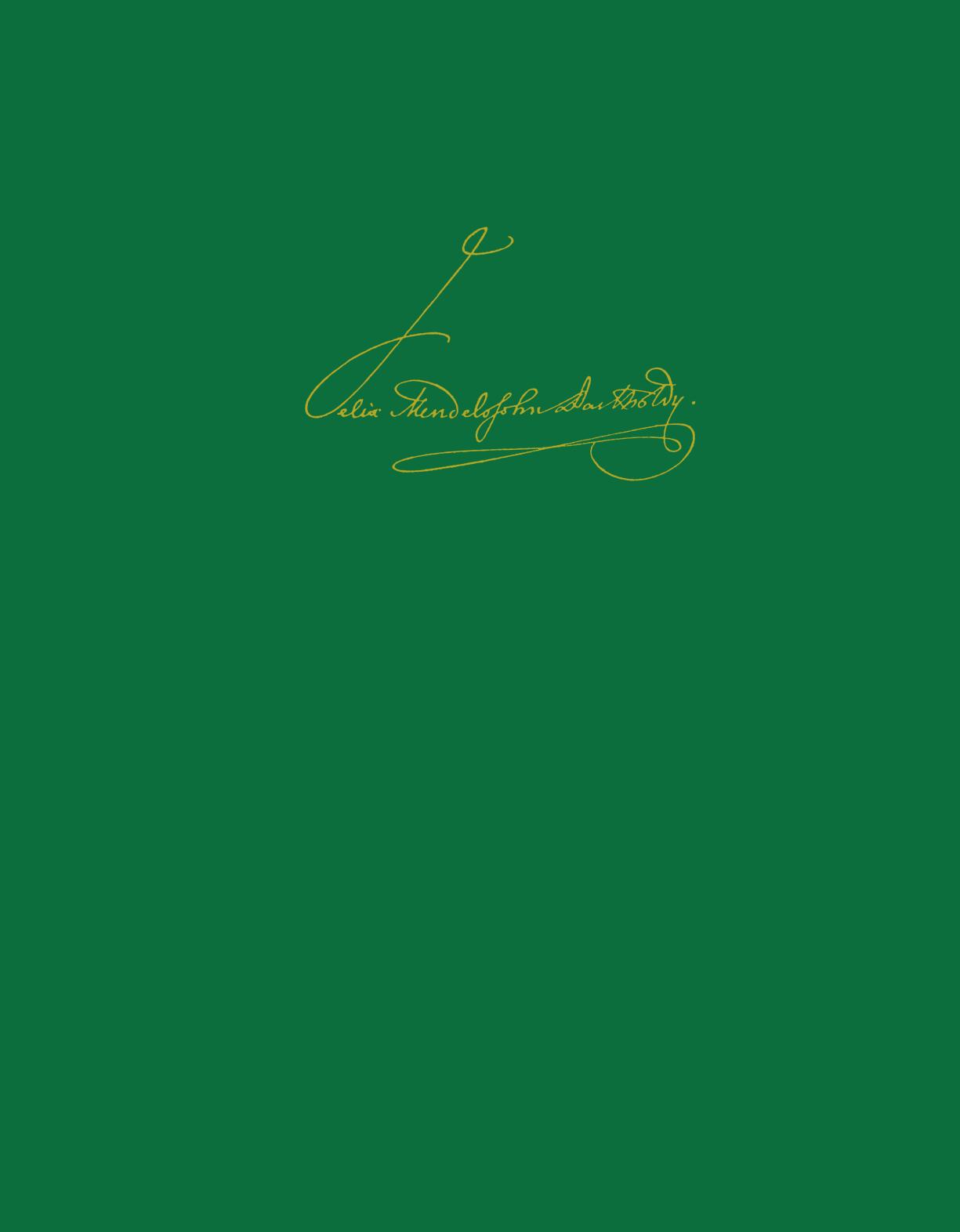
Leipziger Ausgabe der Werke von
Herausgegeben von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Serie VI · Geistliche Vokalwerke Band 7
herausgegeben von Ralf Wehner
Edited by the Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Series VI · Sacred Vocal Works
Volume 7
edited by Ralf Wehner
Editionsleitung
Christiane Wiesenfeldt ∙ Thomas Schmidt (Vorsitz)
Ralf Wehner ∙ Regina Schwedes
Editionsbeirat
Martin Holmes ∙ Sebastian Klotz ∙ Nick Pfefferkorn ∙ Martina Rebmann ∙ Benedict Taylor Ehrenmitglied: Friedhelm Krummacher
Forschungsstelle
bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Wissenschaftliche Mitarbeiter
Ralf Wehner, Clemens Harasim, Birgit Müller und Tobias Bauer
Die Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy ist ein Forschungsvorhaben der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und wird im Rahmen des Akademienprogramms von der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen gefördert.
Das Akademienprogramm wird koordiniert von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Diese Publikation wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
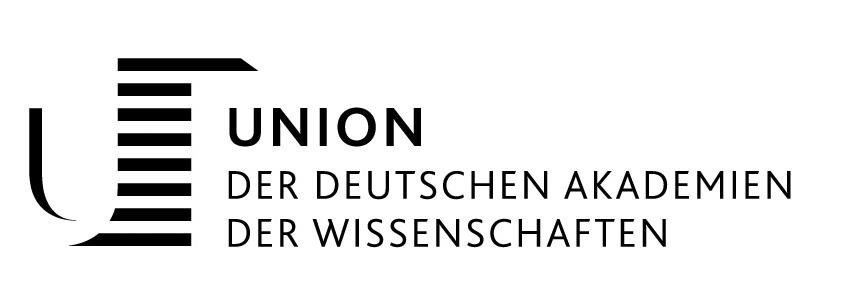

Bestellnummer SON 460 ISMN 979-0-004-80311-0
Notengraphik: Notecraft Europe Ltd. Druck: BELTZ Bad Langensalza GmbH © 2024 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden Breitkopf & Härtel KG Walkmühlstraße 52 65195 Wiesbaden Germany info@breitkopf.com www.breitkopf.com
Printed in Germany
Choral „Christe, du Lamm Gottes“ für gemischten Chor und Orchester MWV A 5
Choral „Jesu, meine Freude“ für gemischten Chor und Orchester MWV A 6
Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ für Sopran solo, gemischten Chor und Orchester MWV A 7
1 Choral „Mein Gott, du weißt am allerbesten“ (Chor)
2 Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (Chor)
3 Arie „Er kennt die rechten Freudenstunden“ (Sopran solo) ............................................
4 Choral „Sing, bet und geh auf Gottes Wegen“ (Chor)
Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ für Bariton solo, gemischten Chor und Orchester MWV A 8 [1] Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ (Chor) .................................................
[2] Arie „Du, dessen Todeswunden die sünd’ge Welt versöhnt“ (Bariton solo) ...............................
3 Choral „Ich will hier bei dir stehen“ (Chor)
Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester MWV A 10 [Chor] „Vom Himmel hoch“ (Chor) ..............................................................
„Er ist der Herr Christ, unser Gott“ (Bariton solo)
Choral „Er bringt euch alle Seligkeit“ (Chor)
Arie „Sei willekomm, du edler Gast“ (Sopran solo)
Arioso „Das also hat gefallen dir“ (Bariton solo) ......................................................
Schluss-Chor „Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron“ (Chor)
Gebet „Verleih uns Frieden“ / „Da nobis pacem, Domine“ für gemischten Chor, kleines Orchester und Orgel MWV A 11 ...........................................................
Choral „Wir glauben all an einen Gott“ für gemischten Chor und Orchester MWV A 12 185
Choral „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ für Bariton solo, gemischten Chor und Orchester MWV A 13 [1 Chor] „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ (Chor) ................................................
2 Rezitativ „Barmherzig und gnädig ist der Herr“ (Bariton solo)
3 Arie „Das Silber durchs Feu’r siebenmal bewährt“ (Bariton solo)
4 Choral „Das wollst du, Gott, bewahren rein“ (Chor)
Anhang – Fassungen von „Verleih uns Frieden“ MWV A 11
„Verleih uns Frieden“ MWV A 11 – Erste Fassung (1831)
„Verleih uns Frieden“ MWV A 11 – Zweite Fassung (1834)
„Verleih uns Frieden“ MWV A 11 – Klavierauszug für Rosa Mendelssohn (1833) 297 Gebet „Verleih uns Frieden“ / „Da nobis pacem, Domine“ MWV A 11 – Klavierauszug, Fassung des deutschen Erstdruckes (1839)
I. Zur Editionspraxis in diesem Band
II. Sammelquellen
III. Kritischer Bericht zu den einzelnen Kompositionen
MWV A 5 Choral „Christe, du Lamm Gottes“ ......................................................
MWV A 6 Choral „Jesu, meine Freude“
MWV A 7 Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“
MWV A 8 Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“
MWV A 10 Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ .....................................
MWV A 11 Gebet „Verleih und Frieden“ / „Da nobis pacem, Domine“
MWV A 12 Choral „Wir glauben all an einen Gott“
MWV A 13 Choral „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“
IV. Textvergleich ..................................................................................
und verworfene Passagen
Die Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy verfolgt die Absicht, sämtliche erreichbaren Kompositionen, Briefe und Schriften sowie alle anderen Dokumente seines künstlerischen Schaffens in wissenschaftlich angemessener Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als historischkritische Ausgabe will sie der Forschung und der musikalischen Praxis gleichermaßen dienen.
Im Vordergrund stehen die musikalischen Werke; von ihnen sind nicht nur die vollendeten Kompositionen in all ihren Fassungen, sondern auch die Quellen des Entstehungsprozesses (Skizzen und Entwürfe) ebenso wie die unfertigen Kompositionen (Fragmente) vorzulegen. Daneben ist die von Mendelssohn geführte Korrespondenz außerordentlich wichtig. Die Erkenntnis, dass die zuverlässige Edition der Briefe für die wissenschaftliche Erschließung eines kompositorischen Œuvres unabdingbar ist, gilt allgemein; bei Mendelssohn indes gewinnt die Korrespondenz, die den Komponisten als Zeitzeugen ersten Ranges ausweist, durch den hohen literarischen Wert vieler seiner Briefe besondere Bedeutung. Schließlich dürfen – will man ein umfassendes Bild des Künstlers Mendelssohn bieten – die bildnerischen Werke, vornehmlich Zeichnungen und Aquarelle, nicht fehlen. Ein thematischsystematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (MWV), das 2009 in einer Studien-Ausgabe erschienen ist, soll dazu beitragen, den raschen Zugriff auf das Gesamtwerk zu fördern. Angesichts der Bedeutung Mendelssohns einerseits und dessen wesentlich von außerkünstlerischen Motiven verursachter Vernachlässigung durch die wissenschaftliche wie praktische Rezeption andererseits bedarf selbst ein so umfassend angelegtes Konzept kaum der ausführlichen Rechtfertigung. Die von Julius Rietz zwischen 1874 und 1877 vorgelegte Werkausgabe, oft irrig Alte Gesamtausgabe genannt, war alles andere als vollständig und – anders etwa als die alte Bach-Ausgabe – keineswegs von der Intention getragen, das Gesamtwerk von Mendelssohn vorzulegen; sie hieß dementsprechend bescheiden Felix Mendelssohn Bartholdy’s Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe. Die von Rietz getroffene Auswahl hatte zur Konsequenz, dass ein beträchtlicher Teil der Kompositionen Mendelssohns bis heute noch immer der Veröffentlichung harrt und ein weiterer bislang nur unzulänglich publiziert ist. Daran haben die wenigen Bände der seit 1960 im Deutschen Verlag für Musik, Leipzig, erschienenen Neuausgabe kaum etwas ändern können. Die vorliegende Ausgabe schließt hinsichtlich der zeitlichen Disposition der zu edierenden Kompositionen an diese Leipziger Ausgabe der Werke Felix Mendelssohn Bartholdys an, trägt aber grundsätzlich dem neuesten Standard der Editionsprinzipien wissenschaftlicher Gesamtausgaben Rechnung. Dies bezieht sich namentlich auf die Maxime, dass alle Herausgeberentscheidungen – sei es im Notentext selbst, sei es im Kritischen Bericht – kenntlich und dem kritischen Nachvollzug des Benutzers zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus entspricht die Ausgabe der heute allgemein akzeptierten Überzeugung, dass alle Stationen des Entstehungsprozesses bzw. der vom Komponisten verantworteten Verbreitung (Skizzen, Fassungen, selbstverfasste Versionen wie Klavierauszüge) zum Werk selbst gehören. Diese Auffassung trifft ganz besonders in der spezifischen musikhistorischen Situation zu, in der Mendelssohn sich befand und die ihn dazu führte, den ästhetischen Anspruch des autonomen, ein für allemal abgeschlossenen Kunstwerks in ganz unterschiedlichen Graden der Vollendung zu realisieren. Davon legen die unterschiedlichen Fassungen zahlreicher Werke Zeugnis ab, aber
auch die Tatsache, dass der Komponist selbst viele abgeschlossene Kompositionen nicht der Veröffentlichung für wert hielt. Dies stellt die differenzierende Hermeneutik der Quellen, die den editorischen Entscheidungen vorangehen muss, ebenso wie die editorische Pragmatik vor besonders schwierige Aufgaben, eröffnet aber auch die Chance, hinsichtlich von unfertigen oder unvollendeten Kompositionen beispielgebende Verfahrensweisen der Edition zu entwickeln.
Eine besondere Problematik ergibt sich daraus, dass Mendelssohn nur den von ihm veröffentlichten oder zur Veröffentlichung vorbereiteten Werken Opuszahlen beigegeben hat, viele seiner Werke also ohne autorisierte Opuszahl überliefert sind. Dennoch haben sich – zumal durch die oben genannte von Julius Rietz verantwortete Ausgabe – die Opuszahlen von 73 an fest eingebürgert. Dieser Tatsache trug die vorliegende Ausgabe bis zum Jahre 2009 Rechnung, indem diese Opuszahlen weiter benutzt, aber durch eckige Klammern gekennzeichnet wurden. Seit Erscheinen des Werkverzeichnisses (MWV) wird für die postum veröffentlichten Werke nur noch die dort eingeführte MWV-Bezeichnung verwendet.
Die Ausgabe erscheint in 13 Serien:
Serie I Orchesterwerke
Serie II Konzerte und Konzertstücke
Serie III Kammermusikwerke
Serie IV Klavier- und Orgelwerke
Serie V Bühnenwerke
Serie VI Geistliche Vokalwerke
Serie VII Weltliche Vokalwerke
Serie VIII Skizzen und Fragmente, die den in den Serien I bis VII veröffentlichten Werken nicht zugeordnet werden können; zusammenhängende Skizzenkonvolute
Serie IX Bearbeitungen und Instrumentationen
Serie X Zeichnungen und Aquarelle
Serie XI Briefe, Schriften und Tagebücher
Serie XII Dokumente zur Lebensgeschichte
Serie XIII Werkverzeichnis
Die Werke bzw. diejenigen Fassungen der Kompositionen, denen Werkcharakter zukommt, erscheinen in den Hauptbänden, die auch den Kritischen Bericht enthalten. Sekundäre Fassungen, Klavierauszüge und Skizzen zu den Werken der Serien I bis VII werden in Supplementbänden vorgelegt; bei geringem Skizzenbestand kann dieser dem Kritischen Bericht angefügt werden. Dem jeweiligen Status der Werkgenese entsprechend wird zwischen drei Typen der editorischen Präsentation unterschieden:
– Die Werkedition, deren Grundsätze der ausführlicheren Erläuterung bedürfen, gilt für die Hauptbände der Serien I bis VII und IX, gegebenenfalls auch für Supplementbände.
– Die Inhaltsedition kommt in den Supplementbänden der Serien I bis VII und IX (z. B. fertige, aber nicht zum Druck bestimmte Fassungen) und in Bänden der Serie VIII (z. B. Fragmente in Reinschrift) zur Anwendung. Die Inhaltsedition hält sich streng an den Text der Quelle. Korrigiert werden lediglich offenkundige Versehen, über die im Kritischen Bericht referiert wird
– Die Quellenedition gilt in erster Linie für Skizzen und Entwürfe. Der Abdruck ist diplomatisch, nicht jedoch stets zeilengetreu; Zeilenwechsel im Original werden durch geeignete Zusatzzeichen angezeigt.
Werkedition
Die Edition der Werke in den Hauptbänden stellt das Ergebnis der umfassenden philologischen Sichtung und Interpretation durch den Herausgeber dar. Abweichungen von der Hauptquelle werden entweder durch die Kennzeichnung im Notentext (eckige Klammern oder Strichelung, Fußnoten), durch die Erläuterung im Kritischen Bericht oder – bei besonders gravierenden Eingriffen – durch beides angezeigt.
Darüber hinaus gelten für die Werkedition folgende Prinzipien:
– Die Partituranordnung und die Notation entsprechen den heute gültigen Regeln. –
Die Schlüsselung der Vokalstimmen wird der heute üblichen Praxis angeglichen.
– Die Instrumente werden durchweg mit italienischen Namen bezeichnet. Dagegen werden bei den Vokalstimmen entweder deutsche (deutscher oder lateinischer Text) oder englische Bezeichnungen (englischer Text) verwendet; nur für den Fall, dass der Text der Vokalstimmen zweisprachig, d. h. beispielsweise deutsch und englisch wiedergegeben werden muss, bietet die italienische Bezeichnung der Singstimmen einen gangbaren Kompromiss.
– Orthographie und Silbentrennung verbaler Texte werden den heutigen Regeln angepasst, doch bleiben originale Lautfolge und charakteristische Wortformen gewahrt.
Abbreviaturen (auch solche für nicht ausgeschriebene Stimmen in Partitur-Manuskripten, wie z. B. „c[ol] Ob 1 8va alta“) werden im Allgemeinen stillschweigend aufgelöst.
Über Abweichungen oder Besonderheiten hinsichtlich dieser Prinzipien wird im Kritischen Bericht Rechenschaft abgelegt.
Der Kritische Bericht, der in den Hauptbänden – soweit es der Umfang erlaubt – immer, in den Supplementbänden jedoch nur gelegentlich dem Notentext folgt, bietet die philologische Argumentation für den vorgelegten Text und weist die Quellen aus, aufgrund derer die editorischen Entscheidungen getroffen wurden. Er enthält die folgenden konstitutiven Abschnitte:
– Verzeichnis der im Kritischen Bericht verwendeten Abkürzungen;
– Quellenbeschreibung;
– Auflistung der textkritisch nicht relevanten Lesarten einzelner Quellen, insbesondere Korrekturverzeichnisse bei autographen Quellen;
– Quellenbewertung;
– Erläuterung der speziellen editorischen Verfahren des jeweiligen Bandes;
– Textkritische Anmerkungen, die über Einzelentscheidungen des Herausgebers Rechenschaft ablegen.
Christian Martin Schmidt
The Leipzig Edition of the Works of Felix Mendelssohn Bartholdy is intended to afford public access to all the available compositions, letters, writings and other documents relating to the artistic work of Felix Mendelssohn Bartholdy in an appropriately scholarly form. As a historico-critical edition, it aims to be of equal value to researchers and practicing musicians alike.
The musical works take pride of place. Next to completed compositions in all their versions, the Leipzig Edition also presents the sources underlying the creative process (sketches and drafts) as well as unfinished compositions (fragments). In addition, Mendelssohn’s letters are extremely important. It is generally acknowledged that reliably edited correspondence is indispensable for the scholarly study of any composer’s work. In Mendelssohn’s case, however, the correspondence is of particular significance, not only because it reveals the composer to be an outstanding witness of his time, but also because of the exceptional literary merit of many of his letters. Finally, if one wishes to provide a comprehensive picture of Mendelssohn as an artist, his pictorial works of art, principally drawings and watercolors, cannot be overlooked. A thematic-systematic catalogue of his musical works (MWV) was published in a study edition in 2009 and helps provide quick access to the composer’s entire life’s work.
A comprehensive study like this hardly calls for lengthy justification, given both Mendelssohn’s importance as a composer and his neglect by the scholarly and musical world alike, essentially attributable to non-artistic motives. The edition of Mendelssohn’s works published by Julius Rietz between 1874 and 1877 and often erroneously referred to as Alte Gesamtausgabe, was anything but complete, and unlike the Old Bach Edition, for example, was not compiled with any intention of presenting Mendelssohn’s complete works, hence its modest title, Felix Mendelssohn Bartholdy’s Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe. As a consequence of Rietz’s selection, a considerable amount of Mendelssohn’s compositions still awaits publication to this day, while others have been published only in an inadequate form. The few volumes of the new edition which have been published since 1960 by Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, have failed to make any major change to this state of affairs.
As regards the chronological arrangement of the compositions to be edited, the present publication conforms to this Leipziger Ausgabe der Werke Felix Mendelssohn Bartholdys , but generally takes account of the latest principles governing the publication of complete scholarly editions. This refers in particular to the tenet that all the editor’s decisions – whether relating to the score itself or to the Kritischer Bericht (Critical Report) – must be clearly stated and made accessible to the critical understanding of the user. In addition, the edition conforms to the view generally accepted today that every stage of the composing process or of the publication attributable to the composer himself (sketches, different versions, his own transcriptions such as piano scores) forms part of the work itself.
This view is particularly pertinent in the light of the specific musico-historical situation in Mendelssohn’s day, which led him to fulfill the aesthetic demands attendant on a definitive, self-contained work of art in highly differing degrees of perfection. This is evidenced not only by the differing versions of
numerous works, but also by the fact that the composer himself considered many completed works not worth publishing. This hampers a differentiating hermeneutic approach to the sources, which must precede any editorial decision, and a pragmatic approach on the part of the editor. At the same time, however, it provides an opportunity for the development of exemplary methods for the editing of unfinished or otherwise incomplete compositions.
A particularly problematic situation results from the fact that Mendelssohn only gave opus numbers to the works which he published or prepared for publication. Many of his works have thus come down to us without authorized opus numbers. Nevertheless, the opus numbers from 73 onward have long since come into general use, in part through the aforementioned edition supervised by Julius Rietz. The present edition took this into account until the year 2009 by continuing to use these opus numbers, albeit placing them between square brackets. Since the publication of the Thematic Catalogue (MWV), only the MWV designation introduced there will be used to identify the posthumously published works.
The publication will appear in thirteen series, i.e.
Series I Orchestral Works
Series II Concertos and Concert Pieces
Series III Chamber Music
Series IV Piano and Organ Works
Series V Stage Works
Series VI Sacred Vocal Works
Series VII Secular Vocal Works
Series VIII Sketches and fragments which cannot be assigned to the works published in series I to VII; associated groups of sketches
Series IX Arrangements and Orchestrations
Series X Drawings and Watercolors
Series XI Letters, Writings and Diaries
Series XII Documents relating to Mendelssohn’s life
Series XIII Thematic Catalogue of Works
The works or those versions of the compositions which can be attributed the status of a work will appear in the main volumes, which will also contain the Kritischer Bericht. Secondary versions, piano scores and sketches relating to the works in series I–VII will be presented in supplementary volumes. In cases where only a small number of sketches are available, these may be included in the Kritischer Bericht.
Three forms of editorial presentation are distinguished, corresponding to the respective genesis of the work, as follows.
– The Edition of Works, the principles of which call for a detailed explanation, will apply to the main volumes of series I–VII and IX, and, if indicated, to the supplementary volumes.
– The Edition of Content, which usually will apply to the supplementary volumes to series I–VII and IX (e.g. finished but unprinted versions) and volumes of series VIII (e.g. fair copies of fragments). The edition of content will strictly adhere to the source texts. Only obvious mistakes will be corrected, and these will be referred to in the Kritischer Bericht.
– The Edition of Sources relates primarily to sketches and drafts. Reproductions will be faithful, but lines may in some cases be arranged in a different way; line changes in the original will be indicated by suitable supplementary symbols.
The editing of works in the main volumes represents the results of an exhaustive philological study and its interpretation by the editor. Divergences from the principal source will be indicated either by markings in the score (square brackets or broken lines, footnotes), with an explanation in the Kritischer Bericht, or – in particularly serious cases – by both.
In addition, the following principles apply to the edition of works:
– The arrangement of the score and the notation comply with present-day standards.
– The keys for the vocal parts are adjusted in accordance with conventional present-day practice.
– The instruments are designated by their Italian names throughout. By contrast, German terms are used for the vocal parts (where the words are in German or Latin), or English terms (where the words are in English); only in such cases where the text of the vocal parts is rendered bilingually (for example in German and in English), voice designations in Italian are used as a viable compromise.
– The spelling and syllabification of verbal texts are adapted in accordance with present-day rules, but the original phonetic sequence and characteristic word forms are retained.
– Abbreviations (including those for parts which are not completely written out in score manuscripts, such as “c[ol] Ob 1 8va alta”), are in general tacitly written out in full.
An explanation of any divergence from these principles or peculiarities in their use is given in the Kritischer Bericht.
The Kritischer Bericht which, space permitting, always follows the score in the main volumes and, if appropriate, also in the supplementary volumes, presents the philological legitimation of the text as printed and indicates the sources on which the editorial decisions are based. It contains the following essential paragraphs:
– List of abbreviations used in the Kritischer Bericht.
– Description of sources.
– A list of the text-critically non-relevant readings of individual sources, particularly indexes of corrections in the case of manuscript sources.
– Evaluation of sources.
– An explanation of the particular editing methods for the respective volume.
– Text-critical remarks which account for individual decisions by the editor.
Christian Martin Schmidt (Translation: Uwe Wiesemann)
Choräle haben eine lebenslange Faszination auf Felix Mendelssohn Bartholdy ausgeübt. Das Aussetzen von Choralmelodien gehörte zu den integralen Bestandteilen seiner soliden Ausbildung bei Carl Friedrich Zelter (1758–1832).1 Von dieser Zeit an (1819/1820) bis hin zum Oratorienfragment Erde, Hölle und Himmel 2 (1847) lassen sich bei ihm in vielen Gattungen und zu fast allen Zeiten Bezüge zum protestantischen Kirchenlied finden. Über allem schwebte ein in der Familie geprägtes hohes Ethos, das Abraham Mendelssohn Bartholdy (1776–1835) seinem Sohn mit der Mahnung an die Hand gab: „Überhaupt ist mit dem Choral nicht zu spaßen […].“3 Dieser Rat des Vaters kam allerdings 1835 insofern spät, als Felix Mendelssohn Bartholdy zu jenem Zeitpunkt den Topos bereits in einer Vielfalt bedacht hatte, die ihresgleichen sucht. Dabei näherte sich Mendelssohn dem Choral stets respektvoll, keinesfalls aber dogmatisch und verhalf ihm in unzähligen Facetten zu neuem Leben. Eine besondere Rolle spielten dabei die auf Martin Luther zurückgehenden Choräle. Die Bandbreite reicht von angedeuteten Zitaten und einfachen Harmonisierungen im Kantionalsatz über achtstimmige Motetten bis zu prächtigen Chorsätzen im Oratorium Paulus MWV A 14 oder in der Sinfonie-Kantate Lobgesang MWV A 18, von instrumentalen Choralbearbeitungen und Fantasien für Klavier oder Orgel bis zum Finalsatz der Sinfonie d-Moll MWV N 15, der sogenannten „Reformations-Sinfonie“. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Mendelssohn auch für die anglikanische, die französisch-reformierte Kirche4 und die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Aargau choralartige Gesänge für den Gemeindegesang komponiert hat.5 Als repräsentatives Beispiel für den künstlerischen Umgang mit einer katholischen Sequenz gilt das Lauda Sion MWV A 24.6 Rein besetzungstechnisch zählen zu den vokal-instrumentalen Bearbeitungen auch das deutsche Te Deum und die Choralaussetzungen für den Berliner Domchor (1843), die bereits in einem anderen Zusammenhang dargestellt wurden.7
Der vorliegende Band befasst sich mit einem speziellen Segment dieser künstlerischen Aneignung. Im Mittelpunkt stehen Choralbearbeitungen für Solostimmen, Chor und Orchester beziehungsweise Chor und Orchester, die Mendelssohn im Zeitraum zwischen 1827 und 1832 beschäftigt haben. Diese Werkgruppe gehörte lange Zeit zu den am wenigsten bekannten Bereichen im Gesamtschaffen, was einerseits mit der Quellenüberlieferung, andererseits mit dem Umstand zusammenhängt, dass Mendelssohn nur eine einzige dieser Kompositionen veröffentlichen ließ. So blieb bis in das 20. Jahrhundert weitgehend unbekannt, dass er gleich mehrere Choralbearbeitungen für eine größere Besetzung vorgenommen hatte. Die in der Sekundärliteratur ebenso griffig wie problematisch als „Choralkantaten“ bezeichneten Werke schrieb Mendelssohn in einem begrenzten, doch biographisch wichtigen Zeitraum. Bei der ersten Komposition war er 18, bei der letzten 23 Jahre alt. Fünf Werke entstanden auf der großen Bildungsreise, die ihn zwischen 1830 und 1832 durch Österreich und Italien bis nach Frankreich und England führte. Im Gegensatz zu seinen im Wesentlichen später entstandenen fünf Psalmkantaten, von denen immerhin vier gedruckt wurden,8 ließ der selbstkritische Komponist von den Choralbearbeitungen lediglich „Verleih uns Frieden“ MWV A 11 veröffentlichen. Dabei handelte es sich um ein Werk, das eine singuläre Stellung innerhalb der Gruppe einnahm, da es zwar textlich, jedoch nicht musikalisch auf einem Choral beruhte. Bevor näher auf die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte einzelner Stücke eingegangen wird (einen ersten Überblick vermittelt die Tafel I), lohnt sich ein Blick auf die Reflexion der Kompositionen in der Sekundärliteratur, da diese – weit mehr als in anderen Schaffensbereichen – dazu beigetragen hat, auf den Bestand aufmerksam zu machen. Editionen, Aufführungen und wissenschaftlich begleitende Publikationen gaben sich gegenseitig Impulse, was dazu führte, dass die Werkgruppe trotz mancher ungeklärter Fragen mittlerweile zu den bekannteren Teilgebieten im Œuvre Felix Mendelssohn Bartholdys gehört.
1 Erste Choralaussetzungen im Übungsbuch für Zelter, Bodleian Library, University of Oxford (im Folgenden: GB-Ob), MS. M. Deneke Mendelssohn c. 43, Edition und Kommentar siehe R. Larry Todd, Mendelssohn’s Musical Education. A Study and Edition of his Exercises in Composition. Oxford, Bodleian MS Margaret Deneke Mendelssohn C. 43, Cambridge 1983 (Cambridge Studies in Music); einen Überblick über die dortigen Choräle vermittelt die Aufstellung im Mendelssohn-Werkverzeichnis unter MWV Z 1.
2 MWV A 26, das Fragment wurde 1852 unter der Bezeichnung „Christus“ mit der postumen Opuszahl 97 gedruckt. Werkbezeichnungen nach Mendelssohn-Werkverzeichnis (MWV), siehe Serie XIII, Band 1A (2009) dieser Ausgabe.
3 Der Brief, aus dem das Zitat stammt, wird seit seiner Veröffentlichung 1863 mit Datum 10. März 1835 angegeben, siehe Briefe aus den Jahren 1833 bis 1847 von Felix Mendelssohn Bartholdy, hrsg. von Paul und Carl Mendelssohn Bartholdy, Leipzig 1863, S. 84. Allerdings trägt der Brief im Original (GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 34, fols. 35–38b) keine Monats- oder Jahresangabe, er ist lediglich mit 28. und 30. datiert.
4 Psalm 5 „Lord, hear the voice of my complaint“ MWV B 31, Psalm 31 „Defend me, Lord, from shame“ MWV B 32, Cantique pour l’Église Wallone de Francfort „Venez et chantez“ MWV B 56.
5 „Tag des Zorns, Gericht der Sünden“ MWV B 43, siehe Ralf Wehner, „… ich sehe sie nun zugleich alle durch und lerne sie kennen …“ Felix Mendelssohn Bartholdy und die wirklich alte Musik, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis XXI (1997), S. 101–127, speziell S. 116–120.
6 Siehe Serie VI, Band 6 (2014) dieser Ausgabe.
7 Ebd. Es betrifft die Choräle „Herr Gott, dich loben wir“ MWV A 20, „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ MWV A 21 und „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ MWV A 22.
8 Der 42., 95., 114. und 115. Psalm, siehe MWV A 15, A 16, A 17 und A 9. Einzig der 98. Psalm MWV A 23 blieb bis 1851 unveröffentlicht. Entstanden waren diese Werke 1830 und 1837 bis 1843, also mit Ausnahme des 115. Psalms chronologisch nach den Choralbearbeitungen.
Tafel I
Übersicht über den Werkbestand
MWV Choral
Originale Bezeichnung
A 5 Christe, du Lamm Gottes Choral
A 6 Jesu, meine Freude Choral
A 7 Wer nur den lieben Gott lässt walten Choral
A 8 O Haupt voll Blut und Wunden Choral
A 10 Vom Himmel hoch, da komm ich her Weihnachtslied
A 11 Verleih uns Frieden gnädiglich Choral/Gebet
A 12 Wir glauben all an einen Gott Choral
A 13 Ach Gott, vom Himmel sieh darein Choral
Zur Literatursituation
Obwohl Rudolf Werner 1930 in seiner bahnbrechenden Dissertation zum kirchenmusikalischen Schaffen von Felix Mendelssohn Bartholdy nachdrücklich auf die, wie er schrieb, „ChoralKantaten“ aufmerksam gemacht hatte9 – Werner waren fünf bzw. sechs Werke zugänglich10 – begann erst rund fünfzig Jahre später eine nennenswerte Rezeption. Denn mit der Wiederentdeckung und sukzessiven Veröffentlichung der Werke zwischen 1972 und 1985 ging auch eine wissenschaftliche Beschäftigung einher, die zu etlichen Aufsätzen und zu zwei großen monographischen Arbeiten führte, der quellenorientierten Studie von Pietro Zappalà11 und der strukturanalytisch und wirkungsästhetisch angelegten Dissertation von Ulrich Wüster12. Beide Autoren konnten auf acht Werke zurückgreifen, was lange keine Selbstverständlichkeit war, denn einzelne Stücke blieben über viele Jahrzehnte verschollen. Bis heute sind die Standorte der
Textautor
Datierung, Ort Erstdruck
Martin Luther zum 24.12.1827, Berlin 1978
Johann Franck 22.01.1828, Berlin 1972
Georg Neumark / Israel Clauder [1828/1829], Berlin 1976
Paul Gerhardt 12.09.1830, Wien 1973
Martin Luther 28.01.1831, Rom 1985
Martin Luther 10.02.1831, Rom 1839
Martin Luther 01.03.1831, Rom 1980
Martin Luther 05.04.1832, Paris 1972
Originalhandschriften von drei Kompositionen und das Klavierarrangement von „O Haupt voll Blut und Wunden“ unbekannt. Erst in den 1960er und 1970er Jahren kam Bewegung in die Beschäftigung mit dieser Werkgruppe. 1958 hatte zunächst Georg Feder in einem weit verbreiteten Referenzwerk auf die vergessenen Stücke aufmerksam gemacht.13 Dann gelangte der Choral „Jesu, meine Freude“ 1962, und damit 80 Jahre nach dem letzten Nachweis,14 wieder an die Öffentlichkeit. Die zum Kauf angebotene Partitur konnte von der Newberry Library, Chicago, erworben werden, die sie als Faksimile herausgab.15 1972 erfolgte der Erstdruck.16 Ein Jahr später machte Oswald Bill darauf aufmerksam, dass sich das Notenarchiv des mit Mendelssohn eng befreundeten Sängers Franz Hauser17 (1794–1870), zumindest in Teilen, seit 1957 in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt befand.18 Zum dortigen Bestand gehörten auch drei große Choralbearbeitungen, von denen wiederum „Wer nur den lieben
9 Rudolf Werner, Felix Mendelssohn Bartholdy als Kirchenmusiker, Frankfurt am Main 1930 (= Veröffentlichungen der Deutschen Musikgesellschaft Ortsgruppe Frankfurt a. M.; 2).
10 Im Abschnitt „Werke der Reife“ behandelte Rudolf Werner, ebd., im Kapitel „c) Choral-Kantaten“ (S. 65–76) die auf einen cantus firmus zurückgehenden Werke. Getrennt davon wurde S. 52–53 auf das sechste Stück, das „Verleih uns Frieden“ eingegangen. Damals unerreichbar waren die Kompositionen „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und „Jesu, meine Freude“.
11 Pietro Zappalà, Le «Choralkantaten» di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Venezia 1991 (= Collezione di tesi Universitarie; Serie IV, 2) (zugl. Tesi di Laurea, Pavia 1985), im Folgenden: Zappalà, Choralkantaten.
12 Ulrich Wüster, Felix Mendelssohn Bartholdys Choralkantaten. Gestalt und Idee. Versuch einer historisch-kritischen Interpretation, Frankfurt a. M., Bern etc. 1996 (= Bonner Schriften zur Musikwissenschaft; 1), (zugl. Diss. Bonn 1993), im Folgenden: Wüster, Choralkantaten.
13 Georg Feder, Die protestantische Kirchenkantate, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Friedrich Blume, Band 7, Kassel 1958, Sp. 581–608 (im Folgenden: Feder, Kirchenkantate). Als Illustration wählte Feder die erste Seite der autographen Partitur von „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ aus, ebd., Sp. 605–606.
14 List & Francke, Leipzig, Catalogue d’une très précieuse collection de manuscrits et lettres autographes (12. Juni 1882, Nachlass Schleinitz), in Nr. 21.
15 Jesu, meine Freude By Felix Mendelssohn-Bartholdy. A facsimile of the composer’s autograph now in The Newberry Library, with an introduction by Oswald Jonas. Published for members of The Newberry Library Associates, Chicago 1966.
16 Im Mendelssohn-Jahr 1972 erschienen in Hilversum „Jesu, meine Freude“ und „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“, beide hrsg. von Brian W. Pritchard.
17 Grundlegend weiterhin: Yoshitake Kobayashi, Franz Hauser und seine Bach-Handschriftensammlung, Diss. Göttingen 1973; zu Mendelssohns Verhältnis zu Hauser speziell siehe Susanna Großmann-Vendrey, Felix Mendelssohn Bartholdy und die Musik der Vergangenheit (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts; Band 17), (im Folgenden: Großmann, Vergangenheit), besonders S. 206–214.
18 Oswald Bill, Unbekannte Mendelssohn-Handschriften in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, in: Die Musikforschung 26 (1973), Heft 3, S. 345–349.
Gott lässt walten“ bis dato völlig unbekannt geblieben war. In den folgenden Jahren bis 1985 wurden all diese Werke zum ersten Mal publiziert (siehe Tafel I) und erreichten dank mehrfacher Schallplatten- bzw. CD-Einspielungen und Aufführungen einen zunehmenden Bekanntheitsgrad. Die gängige Bezeichnung war und blieb dabei „Choralkantate“, wie auch aus den Titeln der im Folgenden genannten Veröffentlichungen deutlich wird. Im Zuge der publizistischen und wissenschaftlichen Begleitung waren die ersten Aufsätze darauf fokussiert, auf den Werkkomplex als Ganzes aufmerksam zu machen.19 Außerdem wurden neben weiteren überblicksartigen Veröffentlichungen20 zunehmend auch spezielle Aspekte und Werke beleuchtet21. Dabei spielte die Rezeption der Musik Johann Sebastian Bachs eine besondere Rolle.22 Zuletzt wurde in die Diskussion gebracht, ob nicht auch die in Mendelssohns Berliner Umfeld gepflegte Kultur der Oden- und Liedkantaten im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Einfluss auf den Komponisten gehabt haben könnte.23 Den Blick weitend, hat Armin Koch bereits 2001 eine Dissertation vorgelegt, die zwar nicht explizit die in Rede stehende Werkgruppe behandelte, sondern sich primär dem Choralhaften im Gesamtwerk widmete. Untersucht wurden vor allem jene „Sätze und Abschnitte, die wie Choralzitate klingen, deren Melodien sich jedoch in dieser Form hymnologisch nicht nachweisen lassen.“24 Doch bot die Arbeit eine aufschlussreiche Gesamtschau auf Mendelssohns formale wie inhaltlich vielfältige Auseinandersetzung mit dem protestantischen Choral allgemein und ist deshalb für jegliche Beschäftigung mit der Thematik von Bedeutung.
Terminologie und Bach-Rezeption
Wie der Tafel I zu entnehmen ist, wurden die meisten Werke mit Choral überschrieben. Ausnahmen bildeten das Weihnachts-
lied „Vom Himmel hoch“ und „Verleih uns Frieden“, das bei der Drucklegung mit dem Titel Gebet versehen wurde. In der Korrespondenz bezeichnete Mendelssohn das letzte Werk gelegentlich auch als „kleine[s] Lied“25. Die Aufnahme in die Werkgruppe ist vor allem der Verwendung des Lutherschen Choraltextes geschuldet, der für Mendelssohn Grundlage für eine cantus-firmus-freie Komposition wurde. Auf dem Deckeletikett des Bandes 21 seiner Notenbibliothek fasste Mendelssohn schließlich die drei dort eingebundenen Werke (MWV A 5, A 10, A 13) mit dem Begriff Cantaten zusammen. Bei den sogenannten „Choralkantaten“ handelt es sich – generell gesprochen – um mehrteilige vokal-instrumentale Werke, bei denen ein protestantischer Choral als thematische und inhaltliche Grundlage dient. Obwohl diese Sonderform der protestantischen Kirchenkantate seit dem 17. Jahrhundert bedient wurde, kam der eigentliche Begriff erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Zusammenhang mit den relevanten Werken der alten Bach-Gesamtausgabe auf.26 Im idealen und strengen Sinne werden alle Strophen eines Chorals vertont (per omnes versus). Dies trifft bei Mendelssohn am ehesten auf das letztkomponierte Werk „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ zu, doch finden sich dort auch weiterführende Verse.27 Die gebräuchliche Form in der Musikgeschichte ist jene, die durch zusätzliche Texte für die Gestaltung der Binnensätze charakterisiert wird. In diesem Sinne können bei Mendelssohn die mehrsätzigen Werke „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, „O Haupt voll Blut und Wunden“ sowie „Vom Himmel hoch“, die zudem einzelne Solosätze enthalten, als „Choralkantaten“ bezeichnet werden. Schwierig erweist sich der Begriff vor allem bei den einsätzigen Werken „Christe, du Lamm Gottes“ und „Jesu, meine Freude“, die treffender als Choralchorsätze zu benennen wären. Im erweiterten Sinne trifft dies auch auf das mehrteilige „Wir glauben all an einen Gott“ zu. Von sieben oder acht „Choralkantaten“ Mendelssohns in der Gesamtheit zu sprechen, kann daher
19 Brian W. Pritchard, Mendelssohn’s Chorale Cantatas: An appraisal, in: Musical Quarterly LXII/1 (1976), S. 1–24; Willi Schulze, Mendelssohns Choralkantaten, in: Logos Musicae. Festschrift für Albert Palm, hrsg. von Rüdiger Görner, Wiesbaden 1982, S. 188–193. Die Aufsätze entstanden in Hinblick auf die Editionen einzelner Werke durch die beiden Autoren.
20 David Griggs-Janower, Mendelssohn’s Chorale Cantatas: a well kept secret, in: Choral Journal 33/4 (1992), S. 31–33; Verena Friedrich, „… an dem weiter zu arbeiten, was mir die grossen Meister hinterlassen haben“. Einführung in die Choralkantaten von Felix Mendelssohn Bartholdy, in: Musik und Gottesdienst 63 (2009), S. 213–223.
21 Oswald Jonas, An Unknown Mendelssohn Work, in: American Choral Review IX (1967), S. 16–22 (über „Jesu, meine Freude“); R. Larry Todd, A Passion Cantata by Mendelssohn, in: American Choral Review 25/1 (1983), S. 2–17 (im Folgenden: Todd, Passion Cantata); Ralf Wehner, Studien zum geistlichen Chorschaffen des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinzig 1996 (= Musik und Musikanschauung im 19. Jahrhundert; Bd. 4), zu den Choralbearbeitungen der 1820er Jahre besonders S. 67–95 (erweiterte Fassung der Diss. Leipzig 1991).
22 Friedhelm Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn. Über Mendelssohns kompositorische Bach-Rezeption, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 17 (1993), S. 44–78 (im Folgenden: Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn); Esther S. You, Old Wine in New Bottles: Felix Mendelssohn-Bartholdy’s Chorale Cantatas – J. S. Bach’s Models Become „Romanticized“, D. M. A. University of Cincinnati 2006; R. Larry Todd, Die Matthäus-Passion – Widerhall und Wirkung in Mendelssohns Musik, in: „Zu groß, zu unerreichbar“. Bach-Rezeption im Zeitalter Mendelssohns und Schumanns, hrsg. von Anselm Hartinger, Peter Wollny und Christoph Wolff, Wiesbaden/Leipzig/Paris 2007, S. 79–97 (im Folgenden: Todd, Matthäus-Passion – Widerhall); Lee David Nelson, The Chorale Cantatas of Felix Mendelssohn-Bartholdy: An examination of Mendelssohn’s translation of J. S. Bach’s musical syntax and form, D. M. A. University of Arizona 2009.
23 Peter Wollny, Gattungs- und Stilprobleme in Mendelssohns Choralkantaten, in: Von Bach zu Mendelssohn und Schumann. Aufführungspraxis und Musiklandschaft zwischen Kontinuität und Wandel, Wiesbaden 2012 (= Beiträge zur Geschichte der Bach-Rezeption; Bd. 4), S. 289–295 (im Folgenden: Wollny, Gattungs- und Stilprobleme).
24 Armin Koch, Choräle und Choralhaftes im Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, Göttingen 2003 (= Abhandlungen zur Musikgeschichte; Bd. 12), (zugl. Diss. Würzburg 2001/2002), S. 1.
25 Erstmals im Brief vom 30. Januar 1831 an Franz Hauser, Nachweis s. u. Anm. 100.
26 Wollny, Gattungs- und Stilprobleme [Anm. 23], S. 292, sowie: Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn [Anm. 22], S. 61; zur Terminologie siehe auch Zappalà, Choralkantaten [Anm. 11], S. 1–3, sowie Feder, Kirchenkantate [Anm. 13].
27 Das Rezitativ geht auf Verse des 12. Psalms zurück und verwendet mithin keinen Choraltext.
strenggenommen als problematisch empfunden werden. Der Begriff hält sich dennoch beharrlich, insbesondere da die korrekteren Bezeichnungen wie vokal-instrumentale Choralbearbeitung eher sperrig oder ungenau wirken und sich auch auf reine Choralaussetzungen beziehen lassen, wie sie beispielsweise im Oratorium Paulus op. 36 MWV A 14 oder im Festgesang MWV D 4, der sogenannten „Gutenberg-Kantate“28, vorkommen. Eine ebensolche Beharrlichkeit und Langlebigkeit zeigte sich in der Forschung bezüglich der Frage, welcher Einfluss den Werken von Johann Sebastian Bach auf die Mendelssohn-Stücke beizumessen sei. Die verbindende Klammer kennzeichnete Friedhelm Krummacher mit folgenden Worten: „Was die Werke zu einer Serie vereinigt, ist jedoch die Auseinandersetzung mit Bachs Choralchorsätzen, genauer: der Kombination von motettischem Chor- und selbständigem Instrumentalsatz. Darin unterscheiden sich die Werke auch von den beiden Choralmotetten ‚Mitten wir im Leben sind‘ und ‚Aus tiefer Not‘, die in der Kirchenmusik op. 23 veröffentlicht wurden.“29 Es hat daher in der Literatur nicht an Versuchen gefehlt, kompositorische Vorbilder, insbesondere im Kantatenschaffen von Johann Sebastian Bach, aufzuzeigen. Allerdings darf Mendelssohns Kenntnis speziell dieses Bereiches Ende der 1820er Jahre nicht überbewertet werden. Sie war primär durch die Bachpflege der Berliner Sing-Akademie geprägt, während Mendelssohns eigene Sammlung entsprechender Musikalien zunächst eher schmal war und tatsächlich erst in den 1830er Jahren durch die Bekanntschaft mit Franz Hauser nennenswerte Zuwächse erfuhr.30 Die Nähe in der Klangsprache und bestimmte formale Muster fielen allerdings bereits zu Lebzeiten auf. Der Komponist selbst hatte dazu eine eindeutige Meinung. Ausgelöst wurde die folgende Äußerung 1834 durch die Übersendung einer Bach-Kantate durch Franz Hauser nach Düsseldorf. Mendelssohn bedankte sich und erklärte: „[…] dann mußte ich das ‚wer nur den lieben Gott‘ gleich ganz durchsehen, weil ich es noch gar nicht kannte, und deshalb selbst componirt hatte, und denk Dir daß mir verschiedene Stellen im meinigen immer noch ganz gut, ja fast besser geschienen haben (andre dann freilich wieder nicht) und daß ich bei einigen gar mit dem alten Sebastian Ähnlichkeiten habe. Ist das nicht eine Freude? Aber zeig Du das keinem in Leipzig, sie würden mich spießen.“31 Bereits 1831 während der Italienreise, auf der etliche Choralbearbeitungen entstanden, hatte Mendelssohn geschrieben: „Hat
es Aehnlichkeit mit Seb. Bach so kann ich wieder nichts dafür, denn ich habe es geschrieben, wie es mir zu Muthe war, und wenn mir einmal bey den Worten so zu Muthe geworden ist, wie dem alten Bach, so soll es mir um so lieber sein. Denn Du wirst nicht meinen, daß ich seine Formen copire, ohne Inhalt, da könnte ich vor Widerwillen u. Leerheit kein Stück zu Ende schreiben.“32
Die Werke der späten 1820er Jahre (MWV A 5 bis A 7)
Wenig ist über die Genese der ersten drei Choralbearbeitungen bekannt, die zwischen 1827 und 1829 nach Texten von Martin Luther, Johann Franck (1618–1677) und Georg Neumark (1621–1681) entstanden. „Christe, du Lamm Gottes“ fungierte 1827 als Weihnachtsgeschenk für Fanny Mendelssohn Bartholdy. Sie berichtete an Carl Klingemann (1798–1862) am ersten Weihnachtsfeiertag: „[…] für mich hatte er ein Stück andrer Natur geschrieben,33 einen vierstimmigen Chor mit kleinem Orchester über den Choral ‚Christo [sic], du Lamm Gottes.‘ Ich habe es heut ein paar Mal gespielt, es ist ganz wunderschön.“34 Im bewegten Mittelteil griff der Komponist ein Fugenthema aus seiner Sinfonia f-Moll MWV N 11 von 1823 auf und kombinierte es mit einem expressiven, nicht minder anspruchsvollen polyphonen Vokalsatz. Im Kontrast dazu stehen die Rahmenteile des Werkes. Während der Anfang mit Diminutionen und motivischen Abspaltungen des Chorals operiert, bevor dieser in großen Notenwerten vorgetragen wird, steht im dritten Teil das klangliche Element im Vordergrund. Nur selten hat Mendelssohn eine derart meditative Musik geschrieben wie in dem versöhnlichen Abschluss seiner ersten vokal-instrumentalen Luther-Vertonung. Bereits einen Monat später vollendete Mendelssohn einen weiteren Choralchorsatz: „Jesu, meine Freude“. Beide Stücke wurden wenig später indirekt erwähnt. In einer Jahreszusammenfassung schrieb Mendelssohn rückblickend auf die vergangene Zeit: „Auch kam ich der ich den ganzen Sommer hindurch (und zu meiner Beschämung gesteh ich’s) nichts hatte schreiben können, fesch und neu nach dem alten und staubigen Berlin, und ein Quartett für Saiteninstrum., mehrere Lieder und Clavierstücke, ein großes Tu es Petrus (das wohl mein gelungenstes Stück ist) und 2 geistliche Musiken zeigen wenigstens, daß
28 Siehe Serie VII, Band 3 (2020) dieser Ausgabe.
29 Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn [Anm. 22], S. 61.
30 Ralf Wehner, Mendelssohns Sammlung von „Kirchen=Cantaten“ Johann Sebastian Bachs, in: „Zu groß, zu unerreichbar“ Bach-Rezeption im Zeitalter Mendelssohns und Schumanns, hrsg. von Anselm Hartinger, Peter Wollny und Christoph Wolff, Wiesbaden/Leipzig/Paris 2007, S. 415–461.
31 Brief vom 16. März 1834 an Franz Hauser, Standort unbekannt (s.u. Anm. 226 zum Brand des Archivs), zitiert nach Abschrift in: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv (im Folgenden: D-B), MA Nachl. 7; 30, 1 [Nr. 16], S. 58–62, gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, Bd. 3, hrsg. und kommentiert von Uta Wald unter Mitarbeit von Juliane Baumgart-Streibert, Kassel etc. 2010 (im Folgenden: Sämtliche Briefe, Bd. 3), S. 367–369, das Zitat S. 368. Die Formulierung wäre anders ausgefallen, wenn Hauser das Werk schon von Mendelssohn erhalten hätte.
32 Brief vom 13. Juli 1831 an Eduard Devrient, The Morgan Library & Museum, New York (im Folgenden: US-NYpm), Morgan Collection – Musicians Letters, Call Number MLT M5377.D514 (4), gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, Bd. 2, hrsg. und kommentiert von Anja Morgenstern und Uta Wald, Kassel etc. 2009 (im Folgenden: Sämtliche Briefe, Bd. 2), S. 323–327, das Zitat S. 324.
33 Im Vergleich zur Kindersinfonie MWV P 4 für die jüngere Schwester Rebecka Mendelssohn Bartholdy.
34 Brief vom 25. Dezember 1827 von Fanny Mendelssohn Bartholdy an Carl Klingemann, Standort unbekannt, zitiert nach: Sebastian Hensel, Die Familie Mendelssohn 1729–1847. Nach Briefen und Tagebüchern, Berlin 1879, Bd. I, S. 181.
mein Herz nicht staubig geworden.“35 Neben dieser pauschalen Erwähnung findet sich gegenüber dem schwedischen Freund Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878) eine eigene Einschätzung der neuen Stücke. Mendelssohn habe „eine kleine geistliche Musik, in der manches Gute ist [gemacht], und eine andre geistliche, die gar nichts taugt.“36 Zweifellos sind damit „Christe, du Lamm Gottes“ und „Jesu, meine Freude“ gemeint und es wird wohl jene Bewertung gewesen sein, die dazu beigetragen hat, das letztgenannte Stück unter Verschluss zu lassen. Im Gegensatz dazu ließ Mendelssohn das „Christe, du Lamm Gottes“ abschreiben, verschenkte es später und zog sogar 1835 eine Drucklegung in Betracht. Noch 1839 findet sich eine Erwähnung des Werkes. In der Korrespondenz mit Franz Hauser war dieser auf eine Bach-Kantate zu sprechen gekommen, die Mendelssohn unbekannt war: „Die Cantate: ‚Christe Du Lam[‘] hab ich eben so wenig, eben so wenig je nennen hören oder besessen. Findest Du sie später, so möchte ich sie wohl einmal kennen lernen, weil ich als Knabe mich an demselben Choral einmal versucht habe.“37
Im April 1829, wenige Tage nach der Wiederaufführung der Bachschen Matthäus-Passion, machte sich Mendelssohn auf den Weg nach England. Es war seine erste große Reise ohne Begleitung eines Elternteils. Neben dem Wunsch, Land und Leute kennenzulernen, ging es Mendelssohn auch um die Vermittlung seiner Musik. Im Reisegepäck befanden sich an Instrumentalwerken u. a. die 1. Sinfonie op. 11 MWV N 13, die Sommernachtstraum-Ouvertüre op. 21 MWV P 3, das Streichquartett a-Moll op. 13 MWV R 13 sowie das Oktett op. 20 MWV R 20. Vereinzelt ließ sich Mendelssohn noch Stimmenmaterial nach England nachschicken. Die Orchesterstücke wurden erfolgreich in den Konzerten der Philharmonic Society zur Aufführung gebracht.38 Demgegenüber war das bis dahin komponierte Repertoire an Vokalmusik, speziell geistlicher Chormusik, verhältnismäßig schmal. Immerhin sind vier Werke nachweisbar, die Mendelssohn verschiedenen Persönlichkeiten in England vorstellte. Alle Stücke waren innerhalb der vergan-
genen anderthalb Jahre entstanden: das vierchörige Antiphona et Responsorium „Hora est“ MWV B 18, das „Tu es Petrus“ MWV A 4 für fünfstimmigen gemischten Chor und Orchester, der Choralchorsatz „Christe, du Lamm Gottes“ sowie ein weiteres, diesmal viersätziges Werk über den Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, über das lange nichts bekannt war. Erst 1872 erfolgte ein erster Fingerzeig auf das letztgenannte Werk, als Charlotte Moscheles (1805–1889) das Leben ihres Mannes Ignaz Moscheles (1794–1870) anhand von Dokumenten nachzeichnete und bezogen auf Mendelssohn und das Jahr 1829 ausführte: „Er zeigte bei seinen ländlichen Besuchen die Manuscripte seiner geistlichen Cantate über einen Choral in A-moll, einen sechzehnstimmigen Chor ‚Hora est‘, der nicht publicirt war, und ein Violin-Quartett in A-moll.“39 Wann diese A-Moll-Kantate entstand und ob sie in Hinblick auf die anstehende Reise komponiert wurde, ist unbekannt. Sie muss jedenfalls im April 1829 bei Abreise vorgelegen haben. Bald nach der Ankunft stellte Mendelssohn die Stücke in London zunächst Klingemann vor. Dieser schrieb nach Berlin: „[…] ich kenne schon Meeresstille u glückliche Fahrt – tu es Petrus u den weichen Choral u in ihm den jüngeren aber stärkeren Felix, in jedem anders u doch derselbe.“40 Mit dem „weichen Choral“ dürfte „Christe, du Lamm Gottes“ gemeint gewesen sein. Einen Monat später hatte sich Mendelssohn bereits mit vielen Personen bekannt gemacht, woraus sich eine Aufführungsmöglichkeit abzeichnete: „[…] wahrscheinlich erhalte ich in diesen Tagen die Aufforderung im großen Musikfeste in Birmingham eine meiner geistlichen Musiken aufzuführen.“41 Drei Tage später wurde auch die Familie in die Erwägungen einbezogen: „[…] dagegen werde ich die Aufforderung zum Musikfest in Birmingham auf jeden Fall annehmen, sobald ich sie bekomme, und freue mich schon darauf, meinen Choral ‚Wer nur den lieben Gott‘ mit Englischem Text zu hören; denn den würde ich da singen lassen, Miss Paton42 paßt sehr gut zu der Arie in der Mitte, und der Chor soll gut sein. Habe ich Zeit und Lust bis dahin, so mache ich vielleicht eine neue Musik, auf
35 Brief vom 5. Februar 1828 an Carl Klingemann, Standort unbekannt, zitiert nach alter Photographie, gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, Bd. 1, hrsg. und kommentiert von Juliette Appold und Regina Back, Kassel etc. 2008 (im Folgenden: Sämtliche Briefe, Bd. 1), S. 233–238, das Zitat S. 237. Das erwähnte Quartett war das Streichquartett a-Moll op. 13 MWV R 13. Zum „Tu es Petrus“ siehe Serie VI, Band 6 (2014) dieser Ausgabe.
36 Brief vom ca. 19. Februar und 22. April 1828 an Adolf Fredrik Lindblad, Paul Sacher Stiftung, Basel, Sammlung Rudolf Grumbacher, Ref. Nr. 203, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 1 [Anm. 35], S. 240–244 [dort datiert „19.(?) Februar“], das Zitat S. 242. Anmerkung zur Datierung: Der aus zwei Teilen bestehende Brief, nur am Ende datiert, gibt an, dass seit dem ersten Teil (dem das Zitat entstammt) „eine Zeit von 9 Wochen etwa vergangen“ sei. Vom 22. April exakt neun Wochen zurückgerechnet, ergäbe den 19. Februar.
37 Brief vom 24. November 1839 an Franz Hauser, Standort unbekannt (s. u. Anm. 226 zum Brand des Archivs), zitiert nach Abschrift in: D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [Nr. 30], S. 100–105, gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, Bd. 7, hrsg. und kommentiert von Ingrid Jach und Lucian Schiwietz unter Mitarbeit von Benedikt Leßmann und Wolfgang Seifert, Kassel etc. 2013, S. 80–82, das Zitat S. 82. Antwort auf einen Brief vom 8. bis 10. November 1839 von Franz Hauser, in dem er Mendelssohn fragte, ob er ihm nicht eine Kantate mit diesem Titel ausgeliehen habe, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 36, Green Books X-130. Bei der Bach-Komposition handelte es sich um den Schluss-Choral „Christe, du Lamm Gottes“ aus der Kantate „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ BWV 23.
38 Zur 1. Sinfonie siehe Serie I, Band 4 (2000) dieser Ausgabe, S. XIII–XIV.
39 Charlotte Moscheles, Aus Moscheles’ Leben. Nach Briefen und Tagebüchern, hrsg. von seiner Frau, Leipzig 1872, Band 1, S. 207.
40 Brief vom 24. und 28. April 1829 von Carl Klingemann an Fanny Mendelssohn Bartholdy (Briefteil vom 24. April), D-B, Autogr. I/264/2, gedruckt in: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, hrsg. und eingeleitet von Karl Klingemann (jun.), Essen 1909, S. 52.
41 Brief vom 26. Mai 1829 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and Tilden Foundations (im Folgenden: US-NYp), *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 63, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 1 [Anm. 35], S. 295–299, das Zitat S. 298.
42 Mary Ann Paton (1802–1864) war eine schottische Sopranistin, die 1829 zeitgleich zu Mendelssohns Aufenthalt in Londoner Konzerten auftrat. Sie war im selben Jahr auch Gast beim Musikfest in Birmingham.
Luthers celebrated Hymn: Ein veste Burg ist unser Gott, wo nicht, so müssen einige Fetzen Dürer herhalten.“43 Im weiteren Verlauf des Briefes wird vor allem auf die Chancen einer solchen Aufführung aufmerksam gemacht, auch wenn sich daraus Konsequenzen für die Planung der kommenden Reisen ergeben würden: „Das Musikfest ist gegen Ende September, und man wird mich wahrscheinlich auffordern, meine Sachen selbst da zu dirigiren. Moscheles, mit dem ich ein kleines Gespräch über meinen Plan für den Rest des Jahres hatte, meinte, ich möchte diese Gelegenheit nicht vorüber gehen lassen, und die projectirte Reise nach Wien für eine andre Zeit verschieben, da ich ohne hin im Herbst die meisten Wiener außer der Stadt finden würde, und keinen Ersatz im besten Falle für das hier Versäumte dort bekommen könne […].“44
Das formal Besondere und Singuläre an dem Werk ist vor allem die ungewöhnliche Eingangssituation der Komposition. Denn dem sonst üblichen eröffnenden Choralchorsatz auf den titelgebenden Text (hier Nr. 2) schaltete Mendelssohn einen einfachen Choral im Kantionalsatz vor, der zwar Georg Neumarks bekannte Melodie von „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ aufgriff, sich aber textlich auf die erste Strophe des Liedes „Mein Gott, du weißt am allerbesten“ von Israel Clauder (1670–1721) bezog.
Ende Juli 1829 sollte die große Sommerreise mit Carl Klingemann nach Schottland starten, was Grund genug war, vorher noch einige Dinge zu ordnen, sich in London von Freunden und Kollegen zu verabschieden und nach Hause zu berichten: „Mein SommerNsTr. bleibt hier für das Philharm. das ihn verlangt hat. Ebenso mein Choral ‚Wer nur den lieben Gott‘ u. wahrscheinlich der Petrus für die festivals; auf die Art bleibe ich in Verbindung und hoffe, daß ich es besser einrichten werde, als es so gewesen wäre […].“45 In den hektischen Vorbereitungen der Abreise konnte Mendelssohn den Pianisten Charles Neate (1784–1877) nicht mehr aufsuchen. Dieser gehörte 1813 zu den Gründern der Philharmonic Society46 und war einer ihrer Direktoren. Bei seinem Aufenthalt war Mendelssohn mit ihm zu verschiedenen Musiziergelegenheiten zusammengekommen. Neate hatte Mendelssohn sogar eigene
Kompositionen geschenkt.47 Nun revanchierte sich Mendelssohn mit einer Gegengabe und wollte mit ihr sicher auch anregen, dass sich Neate für eine Aufführung derselben einsetzen würde: „As I leave town tomorrow morning I regret very much that I will not be able to express myself to you my best and sincerest thanks for the kindness you have had for me. Your beautyful compositions gave me the greatest delight every time I play’d them, and I am indebted to you for one of the most agreeable evenings I passed in this country. For both those things accept my sincere thanks. [im Original Absatz] Allow me to offer you the manuscript score of the piece of mine, I play’d once to you & to Sir George; though I know that its musical value is but very little I take the liberty of offering it to you […].“48 Zwar wurde das Manuskript in dem Brief nicht näher bezeichnet, doch ist eine Abschrift von „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ überliefert, auf die Neate notierte, dass er sie von Mendelssohn erhalten habe.49 Dem Brief ist zu entnehmen, dass Mendelssohn die Komposition nicht nur C. Neate, sondern auch George Smart (1787–1867), ebenfalls ein Gründungsmitglied der Philharmonic Society, vorgespielt hatte.
Zwar zerschlug sich aus unbekannten Gründen eine Aufführung im Herbst 1829, doch hielt Mendelssohn weiter an seinen Plänen fest. Gegen Ende des England-Aufenthaltes informierte er seine Familie: „Von Geschäften nur für heute, daß meine Sinfonie ud. mein SommerNsTr. nächste saison beim Philharm. gegeben werden, leider kann ich nur nicht dirigiren; daß ferner [mein] [Cho]ral aus a ‚Wer nur den lieben Gott‘ hier bleibt, ud. ebenfalls nächstes Jahr auf den n[ationa]l festivals aufgeführt werden soll […].“50 Kurze Zeit später fuhr der Komponist zu einem Abschiedsbesuch zu Thomas Attwood (1765–1838) auf dessen Landgut in Norwood Surrey. Ihm übereignete er am 18. November 1829 eine Abschrift des „Christe, du Lamm Gottes“ sowie seines „Tu es Petrus“51 Wichtig ist noch festzuhalten, dass es bereits Mitte September in Berlin im Hause Mendelssohn zu einer kleinen Aufführung kam, über die der Komponist brieflich informiert wurde. Einige Gäste, darunter Julius Schubring (1806–1889) sowie Mendels-
43 Brief vom 29. Mai 1829 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 64, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 1 [Anm. 35], S. 299–302, das Zitat S. 300. Die „Fetzen Dürer“ bezogen sich auf Mendelssohns 1828 zur Dürer-Feier in Berlin komponierte Festmusik MWV D 1, siehe Serie VII, Band 1 (2012) dieser Ausgabe.
44 Brief vom 29. Mai 1829 an die Familie, ebd. Das Musikfest in Birmingham fand schließlich vom 6. bis 9. Oktober 1829 statt, allerdings ohne Musik von Mendelssohn.
45 Brief vom 17. Juli 1829 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 72, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 1 [Anm. 35], S. 339–341, das Zitat S. 340.
46 Gründungsurkunde mit Unterschrift von C. Neate abgebildet in: Cyril Ehrlich, First Philharmonic. A History of the Royal Philharmonic Society, Oxford 1995, S. 5.
47 Welche Werke das waren, ist unbekannt. Man wird davon ausgehen können, dass Mendelssohn das Geschenk nicht auf die Schottlandwanderung mitnahm und dass es später möglicherweise in England verblieb. In den zugänglichen Beständen der Mendelssohnschen Notenbibliothek ist kein solches Werk erhalten.
48 Brief vom 21. Juli 1829 an Charles Neate, The British Library, London, MS Mus. 1220, fol. 4, dieser Ausschnitt auch gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 1 [Anm. 35], S. 345.
49 Siehe Kritischen Bericht zu MWV A 7, Quelle B
50 Brief vom 10. November 1829 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 96, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 1 [Anm. 35], S. 448. In eckigen Klammern ergänzte Buchstaben durch Papierverlust im Original notwendig.
51 Siehe Serie VI, Band 6 (2014) dieser Ausgabe, S. 235, dort Quelle C, mittlerweile in Wien aufbewahrt.
sohns Schwestern „sangen Deinen Choral: Wer nur den lieben und erbauten sich.“52 Neben dem Aufführungsbeleg ist diese Nachricht aus einem weiteren Grund von Wichtigkeit, da sie bestätigt, dass zu jenem Zeitpunkt in Berlin noch eine Handschrift, vermutlich das Autograph, vorhanden gewesen sein muss.
Mendelssohns Aufführungspläne bezüglich geistlicher Vokalmusik erfüllten sich nicht. Als der Komponist ein halbes Jahr später seine große Italienreise antrat, gehörten die Stücke nicht mehr zum Reisegepäck.
Reisejahre 1830 bis 1832
Am 13. Mai 1830 trat Felix Mendelssohn Bartholdy seine Grand Tour an, eine insgesamt sehr erfolgreiche Reise, die ihn erst zwei Jahre später, nach jeweils mehrmonatigen Aufenthalten in Rom, Paris und London, Ende Juni 1832 nach Berlin zurückbringen sollte.53 Die ersten Etappen waren Leipzig, wo Mendelssohn erste Kontakte zu Musikverlegern schloss, Weimar, wo eine erneute Begegnung mit Johann Wolfgang von Goethe stattfand, sowie München, wo Mendelssohn fast acht Wochen (6. Juni bis 6. August) Station machte, bevor er über Salzburg und Linz nach Wien reiste, wo er bis Ende September 1830 blieb. Die Weiterreise führte mit mehrtägigen Zwischenstationen in Venedig und Florenz schließlich nach Rom, das er am 1. November 1830 erreichte. Hier verbrachte der Komponist die Wintermonate bis April 1831. Mendelssohns unzählige Begegnungen mit Personen und Landschaften, Mentalitäten und Sprachen, Werken der Architektur und der bildenden Kunst, die vielen musikalischen Erlebnisse und Eindrücke, aber auch Erfahrungen mit Krankheiten,54 Tod55 oder Naturgewalten finden ihren Niederschlag in einem umfangreichen Briefkorpus. Außerdem lassen sich chronologische Zusammenhänge sowie Details der Reiseroute aus Aufzeichnungen in drei Notizbüchern56 rekonstruieren. Hinzu
kommen einige Aquarelle und nicht weniger als fünf Alben mit Bleistiftzeichnungen,57 von denen ein Album erst 2017 bekannt wurde.58 Die ausführlichen Berichte nach Hause begründeten Mendelssohns Ruhm als fantasie- und geistvoller Briefschreiber und ebenso kritischer wie genauer Beobachter seiner Umwelt.59 Seine oft detailreichen Ausführungen lassen selbst den heutigen Leser noch teilhaben an Mendelssohns Gedankenwelt. Im Gegensatz zu den in Berlin komponierten Werken der 1820er Jahre, zu denen kaum schriftliche Äußerungen vorliegen, da das Wichtigste mündlich erörtert werden konnte, bilden die regelmäßigen Berichte von der Reise nach Hause wertvolle Quellen, die auch für die Choralbearbeitungen des vorliegenden Bandes relevant sind.
Als eigentliche Früchte der Reise sind vor allem Kompositionen zu bezeichnen, die im Laufe der zwei Jahre vollendet, erneut notiert oder konzeptionell angelegt wurden.
Insgesamt hat sich Mendelssohn auf seiner Reise mit weit über sechzig eigenen Werken beschäftigt. Eine chronologische Übersicht zeigt dies eindrücklich und ist auch in anderen Zusammenhängen aufschlussreich (siehe Tafel II). Klar erkennbar ist der hohe Anteil an geistlicher Chormusik (speziell in Rom), doch entstanden auf der Reise mit zwei klavierkonzertanten Werken60 und der Ballade Die erste Walpurgisnacht op. 60 MWV D 3 auch gewichtige Werke aus anderen Genres. Im Bereich der Orchestermusik ist die Frühfassung der Hebriden-Ouvertüre MWV P 7 als einziges vollendetes Werk zu nennen.61 All dies verdient besondere Beachtung vor dem Hintergrund, dass der Plan, an zwei Sinfonien zu arbeiten, zwar immer wieder Erwähnung, letztlich aber keine nennenswerte Umsetzung fand und erst Jahre später realisiert wurde.62 Die Begegnungen während der Reise führten darüber hinaus zu Neunotaten und Revisionen bereits existierender Stücke, die als Stichvorlagen an Verlage beziehungsweise aus Dankbarkeit oder zu Erinnerungszwecken an mehr oder weniger bekannte Personen gegeben wurden. So ist das mehrfache Aufschreiben des Kanons MWV Y 5 oder die Vielzahl von Klavierstücken und Sololiedern auch aus arbeits-
52 Brief vom 15. September 1829 von Fanny und Rebecka Mendelssohn Bartholdy an ihren Bruder, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn b. 4, Green Books I-88. Die Aufführung fand am Sonntag, 13. September 1829, statt.
53 Zum Verlauf der Reise siehe auch Hans-Günter Klein, Die Mendelssohns in Italien. Ausstellung des Mendelssohn-Archivs der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 6. Dezember 2002 bis 18. Januar 2003, Wiesbaden 2002 (= Ausstellungskataloge, Neue Folge; 46), (im Folgenden: Die Mendelssohns in Italien), S. 43–44.
54 Mendelssohn erkrankte in Paris lebensgefährlich an Cholera.
55 Während der Reise (1832) starben drei Mendelssohn sehr nahestehende Personen: J. W. v. Goethe, C. F. Zelter und Eduard Ritz.
56 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2 bis g. 4. Das erstgenannte Tagebuch der Reise von Mai 1830 bis Februar 1831, für unseren Zusammenhang eine wichtige Quelle, wurde bereits in einer eindrucksvollen Edition vorgelegt, siehe Pietro Zappalà, Dalla Spree al Tevere: il diario del viaggio di Felix Mendelssohn Bartholdy verso l’Italia (1830–1831). Edizione e commento, in: Album Amicorum Albert Dunning in Occasione del suo LXV Compleanno, a cura di Giacomo Fornari, Turnhout 2002, S. 713–788.
57 Ralf Wehner, Vorläufiges Verzeichnis des bildkünstlerischen Werkes von Felix Mendelssohn Bartholdy, in: Mendelssohn-Studien 20 (2017), S. 227–365 (im Folgenden: Wehner, Bildwerkeverzeichnis), besonders S. 323–330, vier der fünf Alben sind erhalten.
58 Roland Dieter Schmidt-Hensel, Ein bislang unbekanntes Zeichenbuch Felix Mendelssohn Bartholdys von seiner italienischen Reise (März bis Juli 1831), in: Mendelssohn-Studien 20 (2017), S. 81–109.
59 Ein großer Teil der Reisebriefe wurde – mit den zeitspezifischen Besonderheiten der Edition – im Jahre 1861 erstmals veröffentlicht: Reisebriefe von Felix Mendelssohn Bartholdy aus den Jahren 1830 bis 1832, hrsg. von Paul Mendelssohn Bartholdy, Leipzig 1861. Innerhalb weniger Jahre erlebte das Buch mehrere Auflagen sowie Übersetzungen ins Englische (1862), Russische (1863), Französische (1864) und Schwedische (1869).
60 1. Klavierkonzert g-Moll op. 25 MWV O 7 und Capriccio brillant op. 22 MWV O 8.
61 Siehe Serie I, Band 8A (2023) dieser Ausgabe.
62 Zu den beiden Werken Sinfonie A-Dur („Italienische“) MWV N 16 (1833/1834) und Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 („Schottische“) MWV N 18 (1842) siehe Serie I, Bände 5 (2005), 5A (2013), 6 (2010) und 6A (2011) dieser Ausgabe.
ökonomischen Gründen zu erklären. Zudem waren Postsendungen teuer, sodass kleiner dimensionierte Stücke innerhalb der Briefe notiert oder die Umfänge der Beilagen reduziert wurden. Eine solche Sparsamkeit führte auch im Falle des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden“ zu einem speziellen Notat. Die Dominanz an geistlicher Musik gerade im ersten Jahr der Reise interpretierte Mendelssohn selbst mit den Worten: „Und daß ich gerade jetzt mehrere geistliche Musiken geschrieben habe, das ist mir ebenso Bedürfniß gewesen, wie es einen manchmal treibt gerade ein bestimmtes Buch, die Bibel oder sonst was zu lesen, und wie es einem nur dabey recht wohl wird.“63
„O Haupt voll Blut und Wunden“ MWV A 8
Mendelssohns Choralbearbeitung „O Haupt voll Blut und Wunden“ entstand innerhalb von drei Wochen in Wien. Die Inspiration zu dem dreisätzigen Werk ging aber nicht – wie zu vermuten wäre – auf die Erinnerung an die anderthalb Jahre zurückliegende Aufführung der Bachschen Matthäus-Passion zurück, in der der zugrundeliegende Choral eine tragende Rolle spielte, sondern wurde ausgelöst von dem bleibenden Eindruck, den ein Gemälde bei Mendelssohn hinterließ, das er zwar schon lange kannte, aber wenige Wochen zuvor in der Hofgartengalerie München im Original gesehen hatte. Über diesen unmittelbaren Anstoß zu der Komposition unterrichtet ein Brief, der auch das Anfangsdatum 22. August 1830 dokumentiert: „Hier ist Wien und dort ist Berlin; da das nicht zusammen ist, so muß ich also wieder einmal einen Privatbrief schreiben. Sonntag früh ist es, ich habe eben den Anfang einer sehr ernsthaften kleinen Kirchenmusik auf den Choral ‚O Haupt voll Blut und Wunden‘ componirt; so was interessirt Dich schon, wie ich weiß, drum werde ich Dir das dunkle Ding zuschicken, und Du kannst es singen lassen, wo und wie Du magst. Aber es ist sehr finster; laß Dir einmal bei einem Kunsthändler unter den Linden den Kupferstich von einem spanischen Bilde von Franz Zurbaran zeigen; es hat mehrere Zeit dort ausgehangen und stellt den Johannes vor, der die Maria von der Kreuzigung her nach Hause begleitet; davon habe ich nun das Original in München gesehen, und ich denke es ist eins der tiefsinnigsten
Bilder, die mir je vorgekommen sind.“64 Das lebensgroße Bild Maria und Johannes vom Kalvarienberg heimkehrend, 65 als dessen Urheber mittlerweile Antonio del Castillo y Saavedra (1616 bis 1668) identifiziert werden konnte, wurde zwischen 1815 (dem Jahr der Erwerbung in Paris) und 1881 dem spanischen Barockmaler Francesco de Zurbaran (1598–1664) zugeschrieben.66 Am Ende des Briefes kam Mendelssohn noch auf Details der neuen Kirchenmusik zu sprechen: „Aber nun ist der Brief auch mauseaus; nur muß ich an Fanny erst vertrauen, daß die Choralmelodie im Sopran liegt und von den Hoboen in Octaven, den Flöten und allen Geigen gespielt wird. Wenn sie nun fragt, wer außerdem die Stimmen fortführt, so erinnre ich sie, daß es 2 Bratschen 2 Cellos 2 Fagotte und Contrabässe in der Welt giebt. Ich freue mich auf das Stück von welchem niemand wissen wird, ob es in cmoll oder in es dur geht; Du kennst mich auf die Art: Fanny.“67
Wie bei „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ komponierte Mendelssohn eine Arie für eine Solostimme, diesmal jedoch nicht für Sopran, sondern für Bariton. Dieses Solostück wurde am 5. September 1830 beendet. Mendelssohn hatte bei der Komposition aber nicht an den Bariton Franz Hauser gedacht, mit dem er in Wien viel Zeit verbrachte, sondern an Eduard Devrient (1801–1877), der bei der Matthäus-Passion 1829 die Partie des Jesus übernommen hatte. Mendelssohn ließ den Sänger an seiner Situation in Wien teilhaben: „Freilich aber bin ich fern, ud viele Zeit ist schon wieder vergangen, seit wir uns nicht gesehn haben […]. Lustig gelebt habe ich seitdem, ud bin heiter gewesen, habe aber wenig Musik innerlich gemacht, wäre nicht Wien solch ein verdammt liederliches Nest so daß ich mich ganz in mich verkriechen muß ud geistliche Musiken schreibe, so hätte ich gar Nichts Neues aufzuweisen. Indeß habe ich heut die zweite Nummer eines Chorals mit Instrumenten beendigt, ud werde wohl übermorgen mit der dritten ud so mit dem ganzen Stück fertig werden, ud dann fange ich ein kleines Ave Maria für Singstimmen allein an, das ich schon ganz im Kopfe trage. In dem Choral, den ich Euch schicke, sobald er fertig ist, findest Du eine Arie für Deine Stimme; sey so gut ud singe sie zerknirscht. Hauser flucht, daß meine Solobässe ud Lieder so hoch liegen; ich behaupte dann, sie paßten Dir […].“68
63 Brief vom 13. Juli 1831 an Eduard Devrient, Nachweis und Druckort s. o. Anm. 32.
64 Brief vom 22. und 23. August 1830 an Rebecka Mendelssohn Bartholdy (Briefteil vom 22. August), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 114, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 70–74, das Zitat S. 70. Mit dem von Mendelssohn aus dem Gedächtnis als Kupferstich bezeichnetem Opus kann nur eine Lithographie von Ferdinand Wolfgang Flachenecker (1792–1847) gemeint sein, erschienen in dem Galeriewerk Königlich Baierischer Gemaelde=Saal zu München und Schleißheim. In Steindruck von Piloty, Selb & C., Zweiter Band, München 1821 (unpaginiert), siehe auch Faksimile VIII.
65 Öl auf Leinwand, heutiger Standort: Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Staatsgalerie im Neuen Schloss Schleißheim, Inventarnummer 257 Ausführlich zum Bild und seiner Geschichte siehe Spanische Meister, bearbeitet von Halldor Soehner, München 1963 (= Gemäldekataloge; Bd. 1), Vollständiger Katalog, Textband, S. 36–39, mit Abbildungen im Tafelband, Abb. 58–60. Das Format wird dort wie folgt angegeben: „192,5 x 126,3 cm (gegenwärtiges Bildmaß)“. Schwarzweiß-Reproduktionen des Gemäldes in der Mendelssohn-Literatur: Todd, Passion Cantata [Anm. 21], S. 2; Wüster, Choralkantaten [Anm. 12], S. 475; Todd, Matthäus-Passion – Widerhall [Anm. 22], S. 97.
66 Spanische Meister, Textband, ebd., S. 38. Von 1822 bis 1836 wurde das Gemälde in der Hofgartengalerie, von 1836 bis 1945 in der Alten Pinakothek ausgestellt, siehe auch Peter Böttger, Die Alte Pinakothek in München, München 1972.
67 Brief vom 22. und 23. August 1830 an Rebecka Mendelssohn Bartholdy, Nachweis s. o. Anm. 64. Die überwiegend gedeckten Farben des Bildes scheinen eine Entsprechung in dem – durch geteilte Violen und Violoncelli zusätzlich verstärkten – dunklen Klangcharakter des Musikstückes zu finden.
68 Brief vom 5. September 1830 an Eduard Devrient, US-NYpm, Morgan Collection – Musicians Letters, Call Number MLT M5377.D514 (3), gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 93–96, das Zitat S. 94. Der Brief wurde in Wien nicht abgeschickt und erhielt am 2. Oktober in Kloster Lilienfeld einen Nachtrag: „Der Choral ist nun freilich längst fertig, und das ave auch; mit der ersten guten Gelegenheit schicke ich die Stücke zu Euch […]“, ebd. Das „ave“ erschien später als op. 23 Nr. 2.
Tafel II
Chronologisches Verzeichnis der zwischen Mai 1830 und Juni 1832 komponierten oder erneut notierten Werke
Mit * bezeichnet sind Daten, an denen ein Zweitnotat oder eine Revision erfolgte.
Datierung Werkbezeichnung
19.05.1830* Kanon h-Moll
MWV
Ort, Bemerkungen
Y 5 Leipzig, für Heinrich Dorn
Mai 1830 Lieblingsplätzchen „Wisst ihr, wo ich gerne weil’“ K 61 Weimar
Ende Mai 1830* Fantasie über das irländische Lied The Last Rose of Summer E-Dur op. 15 für Klavier
02.06.1830* Sinfonie d-Moll („Reformations-Sinfonie“)
03.06.1830 Andante con moto A-Dur für Klavier
U 74 Weimar, hier als Fantasia, für Ulrike von Pogwisch
N 15 Weimar, für Heinrich Dorn
U 75 Weimar, für Ottilie von Goethe
13.06.1830* Rondo capriccioso E-Dur op. 14 für Klavier U 67 München, für Delphine von Schauroth
13.06.1830 Andante A-Dur für Klavier U 76 München, Reinschrift für Fanny Hensel mit Brief vom 14.06.1830
26.06.1830 Lied ohne Worte b-Moll op. 30 Nr. 2 für Klavier U 77 München, zur Geburt von Sebastian Hensel
18.07.1830* The Evening Bell B-Dur für Harfe und Klavier Q 20 München, für Gräfin Fanny O’Hegerty
06.08.1830* Im Herbst „Ach, wie schnell die Tage fliehen“ op. 9 Nr. 5 K 38 München
08.08.1830* Rondo capriccioso E-Dur op. 14 für Klavier
U 67 Salzburg, Stichvorlage an Hofmeister
08.08.1830* Fantasie über das irländische Lied The Last Rose of Summer E-Dur op. 15 für Klavier U 74 Salzburg, Stichvorlage an Hofmeister
08.08.1830* Trois Fantaisies ou Caprices op. 16 für Klavier
U 70–72 Salzburg, Stichvorlage an Hofmeister
08.08.1830* Variations concertantes D-Dur op. 17 für Violoncello und Klavier Q 19 Salzburg, Stichvorlage an Hofmeister
08.08.1830 Streichquartett a-Moll op. 13, Arrangement für Klavier zu vier Händen
August 1830 Lied für Bariton und Klavier
August 1830* Scheidend „Wie so gelinde die Flut bewegt“ op. 9 Nr. 6
12.09.1830 Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ für Bariton solo, gemischten Chor und Orchester
13.09.1830 Variationen A-Dur für Violoncello und Klavier
13.09.1830* Kanon h-Moll
17.09.1830 Albumblatt
18.09.1830* Frühlingslied „In dem Walde süße Töne“ op. 19[a] Nr. 1
27.09.1830 Das erste Veilchen „Als ich das erste Veilchen erblickt“ op. 19[a] Nr. 2
30.09.1830* Lied ohne Worte b-Moll op. 30 Nr. 2 für Klavier
30.09.1830 „Ave Maria“ op. 23 Nr. 2 für Tenor solo und achtstimmigen gemischten Chor
Mitte Oktober 1830 „Von schlechtem Lebenswandel“
16.10.1830 Venetianisches Gondellied g-Moll für Klavier op. 19[b] Nr. 6
16.10.1830 Reiselied „Bringet des treuesten Herzens Grüße“ op. 19[a] Nr. 6
18./19.10.1830 Choral „Aus tiefer Not“ op. 23 Nr. 1 für Solostimmen, gemischten Chor und Orgel
R 22 Salzburg, Stichvorlage an Breitkopf & Härtel
K 62 Wien, für Eduard Devrient, Standort unbekannt
K 50 Wien, hier Auf der Fahrt, für Aloys Fuchs
A 8 Wien
Q 21 Wien, Gemeinschaftskomposition mit Joseph Merk
Y 5 Wien
Z 8 (b) Wien, für Joseph Merk
K 56 Wien, hier Minnelied vom Jahre 1246, in Album Wimpffen, Bd. II
K 63
U 77
B 19
K 64
U 78
K 65
B 20
Pressburg, für Catharine Pereira, Standort unbekannt
Wien, für Franz Hauser
Wien, revidiert in Venedig 16.10.1830
Venedig, mit Brief vom 17.10.1830 an Eduard Devrient, auf Post verloren
Venedig, hier Auf einer Gondel, Reinschrift für Delphine von Schauroth, 17.10.1830, auf Post verloren
Venedig, hier In die Ferne
Venedig
Datierung Werkbezeichnung
Oktober 1830 oder später
Fuge e-Moll für Klavier, Fragment
15.11.1830 Der 115. Psalm „Non nobis Domine“ op. 31 für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester
20.11.1830
Choral „Mitten wir im Leben sind“ op. 23 Nr. 3 für gemischten Chor a cappella
11.12.1830 Lied ohne Worte a-Moll op. 19[b] Nr. 2 für Klavier
11.12.1830 Andante maestoso F-Dur für Klavier, Teil I
12.12.1830*
Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ für Bariton solo, gemischten Chor und Orchester
16.12.1830 Konzert-Ouvertüre Nr. 2 Die Hebriden h-Moll op. 26
18.12.1830*
Choral „Aus tiefer Not“ op. 23 Nr. 1 für Solostimmen, gemischten Chor und Orgel
29.12.1830 „Tantum ergo“
MWV Ort, Bemerkungen
U 79 [Italien, Ort unbekannt]
A 9 Rom
B 21 Rom
U 80 Rom, für Rebecka Mendelssohn Bartholdy
U 81 Rom, zum 54. Geburtstag des Vaters, Teil II sollte von Fanny Hensel komponiert werden
A 8 Rom, Klavierauszug für Familie, abgeschickt am 14.12.1830
P 7 Rom
B 20
Rom, eigenhändige Abschrift für C. F. Zelter
Z 8 (c) Rom, Hinweis aus Notizbuch
30.12.1830 „O beata et benedicta“ für Frauenchor und Orgel B 22 Rom
30.12.1830 „Surrexit pastor“ op. 39 Nr. 3 für Solostimmen, Frauenchor und Orgel
23
31.12.1830 „Veni Domine“ op. 39 Nr. 1 für Frauenchor und Orgel B 24 Rom
Januar 1831* Reiselied „Bringet des treuesten Herzens Grüße“ op. 19[a] Nr. 6 K 65 Rom, für Jules Benedict
28.01.1831 Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“ für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester A 10 Rom
10.02.1831 Choral „Verleih uns Frieden“ für gemischten Chor und kleines Orchester A 11 Rom
01.03.1831 Choral „Wir glauben all an einen Gott“ für gemischten Chor und Orchester A 12 Rom
08.03.1831 Nachspiel D-Dur für Orgel
01.06.1831* Venetianisches Gondellied g-Moll für Klavier op. 19[b] Nr. 6
01.06.1831* Reiselied „Bringet des treuesten Herzens Grüße“ op. 19[a] Nr. 6
W 12 Rom
U 78 Sorrent, hier Auf einer Gondel, für Theodor Hildebrandt
K 65 Sorrent
26.06.1831 Kanon Es-Dur für zwei Violen Y 7 Florenz, für George Smart
15.07.1831 Die erste Walpurgisnacht op. 60, Ballade für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester
August 1831 Drei Walzer für Klavier
D 3 Mailand, Abschluss des Vokalteils
U 83–85 Unterseen, für eine Tochter des Oberförsters Karl Albrecht Kasthofer
10.08.1831 Die Liebende schreibt „Ein Blick von deinen Augen“ K 66 Unterseen
11.08.1831 Reiselied „Ich reit ins finstre Land hinein“, Fragment
August/ September 1831
K 67 Unterseen
Lied ohne Worte E-Dur op. 19[b] Nr. 1 für Klavier U 86 [Schweiz, Ort unbekannt]
18.09.1831 Andante H-Dur – Allegro di molto h-Moll für Klavier U 87 München, später umgearbeitet zu Capriccio brillant op. 22 MWV O 8
Oktober 1831 Klavierkonzert Nr. 1 g-Moll op. 25 O 7 München
02.11.1831 Lied ohne Worte E-Dur op. 19[b] Nr. 1 für Klavier U 86 München, für Josephine Lang
03.11.1831 Con moto A-Dur für Klavier U 88 München, für Julie zu Oettingen-Wallerstein
03.11.1831* Kanon h-Moll Y 5 München
17.11.1831* „Ave Maria“ op. 23 Nr. 2 für Tenor solo und achtstimmigen gemischten Chor B 19
Frankfurt am Main, eigenhändige Abschrift für Johann Nepomuk Schelble
Datierung Werkbezeichnung
21.11.1831* Fuge e-Moll op. 35 Nr. 1[b] für Klavier
MWV Ort, Bemerkungen
U 66 Frankfurt am Main November/ Dezember 1831
Todeslied der Bojaren „Leg in den Sarg mir mein grünes Gewand“
03.12.1831* Geständnis „Kennst du nicht das Glutverlangen“ op. 9 Nr. 2
04.12.1831* Erntelied „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod“ op. 8 Nr. 4
K 68
K 41
K 37
05.12.1831 Verschwunden „Da lieg ich unter den Bäumen“ K 69
Januar 1832 Choral „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ für Bariton solo, gemischten Chor und Orchester
13.02.1832* Die erste Walpurgisnacht op. 60, Ballade für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester
23.02.1832 Andante zum Streichquintett A-Dur op. 18
09.03.1832 Neue Liebe „In dem Mondenschein im Walde“ op. 19[a] Nr. 4
09.03.1832 Gruß „Leise zieht durch mein Gemüt“ op. 19[a] Nr. 5
A 13
D 3
R 21
Düsseldorf, für Carl Leberecht Immermann
Duisburg, hier Frage, für Eduard Bendemann
Düsseldorf
Düsseldorf
Paris, am 5. April 1832 datiert und an J. N. Schelble gesandt
Paris, Abschluss der Ouverture
Paris
K 70 Paris
K 71 Paris
20.03.1832 Vokalkanon „Ich will Dienstag kommen“ X 2
22.03.1832* Kanon h-Moll Y 5
März /April 1832* Sommernachtstraum-Ouvertüre op. 21, Arrangement für Klavier zu vier Händen
02.04.1832* Das erste Veilchen „Als ich das erste Veilchen erblickt“ op. 19[a] Nr. 2
04.04.1832* Lied ohne Worte E-Dur op. 19[b] Nr. 1
P 3
K 63
Paris, Stichvorlage für Cramer, Addison & Beale
Paris, für Almanach von Alexander Johnston
U 86 Paris, für Frl. Wendelstadt
04.04.1832* Andante H-Dur – Allegro di molto h-Moll für Klavier U 87 Paris, als Rondo brillant für Mad. Blanche Goupil
13.04.1832 Winterlied „Mein Sohn, wo willst du hin so spät“ op. 19[a] Nr. 3
16.04.1832* Kanon h-Moll
K 72 Paris
Y 5 Paris, für Frédéric Chopin
19.04.1832* Sechs Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 19[a] SD 6
19.04.1832* Oktett op. 20
19.04.1832* Sommernachtstraum-Ouvertüre op. 21
R 20
P 3
Paris, Stichvorlage an Breitkopf & Härtel
Paris, Stichvorlage an Breitkopf & Härtel (Stimmen)
Paris, Stichvorlage an Breitkopf & Härtel (Stimmen)
Frühjahr 1832 Klaviertrio, Fragment Q 22 Paris, mehrfach erwähntes Projekt, wenige Skizzen
Mai 1832 Der Blumenstrauß „Sie wandelt im Blumengarten“ op. 47 Nr. 5
K 73 London
18.05.1832 Capriccio brillant h-Moll op. 22 für Klavier und Orchester O 8 London
29.05.1832 Vokalkanon „Wohl ihm“
X 3
London, für Ignaz Moscheles
Juni 1832 oder früher Lied ohne Worte A-Dur op. 19[b] Nr. 3 für Klavier U 89 London
Juni 1832 oder früher Lied ohne Worte fis-Moll op. 19[b] Nr. 5 für Klavier U 90
01.06.1832 Kadenzen zu W. A. Mozarts Konzert für zwei Klaviere Es-Dur KV 365/316a
12.06.1832* Melodies for the Pianoforte op. 19[b]
Anh. B
SD 5
19.06.1832* Konzert-Ouvertüre Nr. 2 Die Hebriden h-Moll op. 26 P 7
20.06.1832* Konzert-Ouvertüre Nr. 2 Die Hebriden h-Moll op. 26 P 7
20.06.1832* Das erste Veilchen „Als ich das erste Veilchen erblickt“ op. 19[a] Nr. 2
K 63
London
London, für Konzert mit Ignaz Moscheles
London, Stichvorlage für Novello
London, Arrangement für Klavier zu vier Händen für die Geschwister Marie und Sophie Horsley
London, eigenhändige Abschrift der Partitur
London, für Elizabeth Hutchins Horsley, hier als Der ersten Liebe Verlust
So sicher der Anfang der Kompositionsarbeit zu fixieren ist, so unsicher bleibt die Datierung des Abschlusses. Die chronologischen Eckpunkte werden zunächst durch eine eigenhändige Notiz abgerundet, die den Abschluss am 12. September 1830 fixierte: „Sonntag Ab Arbeiten d. Choral fertig“69. Dieses Datum notierte Mendelssohn auch auf einer Abschrift, die er in Wien anfertigen ließ und auf die weitere Reise mitnahm. Sie bildete schließlich die Grundlage für weitere Abschriften in Frankfurt am Main und London.70 Die bei Franz Hauser in Wien verbliebene Originalpartitur weist jedoch für das Ende des Schlusschorals den 4. September aus und datiert die Arie mit 13. September.71 Wenn aber bereits am 5. September, wie gegenüber Devrient erwähnt, die Arie „beendigt“ gewesen ist, kann es sich bei dem jetzt bekannten Solostück nur um eine andere Niederschrift gehandelt haben, sollte nicht ein Datierungsfehler unterstellt werden.
Textlich geht die Komposition auf zwei der zehn Strophen des weitverbreiteten Passionsliedes von Paul Gerhardt (1607–1676) zurück und verwendet für die Arie „Du, dessen Todeswunden“ einen unbekannten Text, der sich stilistisch demjenigen Gerhardts anpasst. Nicht auszuschließen ist, dass Mendelssohn selbst den Text für diese Strophe entwarf.72
Seinem Lehrer Zelter schickte Mendelssohn – unterdessen in Venedig – einen kleinen Bericht, in dem er auch auf die Atmosphäre in der österreichischen Stadt zu sprechen kam: „In Wien habe ich 2 kleine Kirchenmusiken fertig gemacht: einen Choral in 3 Stücken für Chor und Orchester (O Haupt voll Blut und Wunden) und ein Ave Maria für 8 Stimmigen Chor a capella; die Leute um mich herum waren so schrecklich liederlich und nichtsnutzig, daß mir geistlich zu Muthe wurde, und ich mich, wie ein Theolog unter ihnen ausnahm.“73
In jedem Falle wollte Mendelssohn seine Familie an dem Werk teilhaben lassen. Mittlerweile nach Rom weitergereist, entschied sich der Komponist deshalb, einen particellartigen Klavierauszug anzufertigen und diesen auf die Post zu geben. Das Notizbuch hielt für den 3. Adventssonntag fest: „Ab. Clavier[au]szug für Fanny“74. In einem gesonderten Brief ging Mendelssohn ausführlich auf das Weihnachtsgeschenk für seine Schwestern ein: „Ich schicke Euch beiden den Clavierauszug mei[ne]s Chorals aus Wien, möge er Euch gefallen. Ich habe den Clavierauszug gemacht weil die Partitur zuviel Platz genommen hätte,
denn es ist stark instrumentirt; da er nur für Dich [gemeint Fanny Hensel] gemacht ist, so wirst Du Dich nicht wundern, wenn er an manchen Stellen unspielbar ist, ich habe es mehr [wie] eine kleine Partitur behandelt, Du wirst Dir es schon nach Deiner Hand einrichten, ud ich möcht Dich sehen, wie Du es das erstemal am Clavier dirigirst, Dich schändlich ärg[erst, da]ß es gar nicht klingen will, ud denkst: hat mein Hr. Bruder wirklich solchen Unsinn erdacht? Fürchte Dich aber nicht, das Ding ist wohl etwas schwarz [geworden,] aber es muß doch klingen. Über die Instrumente nur so viel, daß 2 Cellos und 2 Bratschen im ersten Stück die Mittelstimen und d. Begleitung führen, Contrabässe ud Fagotte machen den Baß; mit dem Choral setzen immer Hoboen ud Clarinetten in hohen Octaven, Flöten unisono ud alle Geigen unisono ein, ausgenommen in der Stelle: O Haupt sonst schön gekrönet, wo die Flöten ud Geigen allein mitgehen, ud im dritten ud vierten Takt vor dem Ende weichen die Geigen ab; in der Arie ist nichts zu bemerken, als daß die Flöte den Choral spielt, ud sehr viel b Clarinetten im ganzen umherwühlen ud schreien; im letzten Stück machen die Hörner ud Bässe ud Fagotte immer den Ruf zusammen, ud da denke ich man wird ihn schon hören. Das Übrige ersiehst Du von selbst. Ich hätte gern auch Andres geschickt, aber der Raum ließ es [nic]ht zu […].“75
Die Formulierung, dass der Auszug „wie eine kleine Partitur“ gestaltet wäre, deutet wohl auf eine eher particellartige Ausführung dieses Arrangements von „O Haupt voll Blut und Wunden“ hin. Über eine Antwort der Familie ist ebenso wenig bekannt wie über den Verbleib der Notenhandschrift. Nicht auszuschließen ist, dass Mendelssohns Weihnachtsgeschenk die Stadt Berlin nie erreicht hat.76
Luthers Texte als Inspirationsquelle (MWV A 10 bis A 13)
In dem bereits zitierten Brief an Devrient erwähnte Mendelssohn ein Abschiedsgeschenk von Hauser, das auf die weitere kompositorische Arbeit einen erheblichen Einfluss nehmen sollte: „[…] er hat mir unter andern ein kleines Büchelein mit Luthers Liedern auf die Reise mitgegeben, und da will ich viel componiren […].“77 Bei dem erwähnten „Büchelein“ handelte es sich um die zum Reformationsfest 1817 in Berlin erschienene
69 Notizbuch, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 17v.
70 Siehe Kritischen Bericht, Quellen D und F
71 Zappalà, Choralkantaten [Anm. 11], S. 25, ging deshalb davon aus, dass es sich um einen Schreibfehler handeln und das Schlussdatum stattdessen 14. September heißen muss; so auch R. L. Todd im Vorwort seiner Edition des Werkes für A-R Editions. Das Datum sei „probably a simple error for 14 September“, siehe: Felix Mendelssohn Bartholdy, O Haupt voll Blut und Wunden, ed. by R. Larry Todd, Madison 1981 (= Collegium Musicum: Yale University Second Series; Vol. IX), Preface, S. IX.
72 Zur Literaturdiskussion darüber siehe Wüster, Choralkantaten [Anm. 12], S. 219–221.
73 Brief vom 16. Oktober 1830 an Carl Friedrich Zelter, D-B, N. Mus. ep. 460, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 108–111, das Zitat S. 110–111.
74 Notizbuch, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 30v. Eintrag für den 12. Dezember 1830.
75 Brief vom 14. Dezember 1830 an die Familie. Der Brief ist in drei Teilen überliefert: Teil I: an die Mutter, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 125, Teil II (dem das Zitat entstammt): für Fanny Hensel, ebd., Familienbriefe, Nr. 100, Teil III: für Rebecka Mendelssohn Bartholdy, D-B, MA Depos. Berlin 3, 37, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 168–170, das Zitat S. 169–170. In eckige Klammern vorgenommene Ergänzungen durch starken Papierverlust im Originalbrief notwendig.
76 Das Problem auf der Post verlorengegangener Musikalien betrifft auch andere Werke der Italienreise, insbesondere die aus Venedig verschickten Stücke. Andere Partituren, wie „Aus tiefer Not“ für C. F. Zelter erreichten hingegen ihre Empfänger, siehe Tafel II.
77 Briefteil vom 2. Oktober 1830 an Eduard Devrient, Nachweis s. o. Brief vom 5. September 1830, Anm. 68.
Ausgabe von Karl Grell.78 Es entfaltete alsbald seine Wirkung und wurde in der Korrespondenz mehrmals erwähnt, so gegenüber Lehrer Zelter: „Vor meiner Abreise aus Wien schenkte mir ein Bekannter Luthers geistliche Lieder, ud wie ich sie mir durchlas sind sie mir mit neuer Kraft entgegengetreten, und ich denke viele davon diesen Winter zu componiren; so bin ich denn hier mit dem Choral ‚aus tiefer Noth‘ für 4 Singstimmen a capella beinahe ins Reine gekommen, ud. habe auch das Weihnachtslied ‚vom Himmel hoch‘ schon im Kopfe; auch an die Lieder ‚Ach Gott vom Himmel sieh darein‘ ferner ‚Wir glauben all’ an einen Gott‘, ‚Verleih uns Frieden‘, ‚Mitten wir im Leben sind‘ ud. endlich ‚ein feste Burg‘ will ich mich machen, doch denke ich all die letzten für Chor ud Orchester zu componiren.“79 Fast alle in diesem Brief genannten Pläne wurden verwirklicht. Da Hausers Geschenk zwar die Texte, jedoch keine Noten enthielt, notierte Mendelssohn insgesamt neun Melodien, gewissermaßen als Gedankenstütze.80 Unberücksichtigt blieb lediglich der Choral „Ein feste Burg“, der ja unmittelbar vor Antritt der Reise eine tragende Rolle im Finale der Sinfonie d-Moll MWV N 15, der sogenannten „Reformations-Sinfonie“, gespielt hatte.81 Anfang Dezember 1830 bedankte sich Mendelssohn noch einmal bei Hauser und bestätigte: „Ihr Luthersches Liederbüchlein hat mir schon die besten Dienste geleistet (es liegt eben neben mir und ich freue mich täglich damit) […].“82
Welchen besonderen Reiz die Luthertexte auf den Komponisten ausübten, kommt in einer Briefpassage gegenüber Carl Klingemann zum Ausdruck. Von dem Wunsch getragen, wieder einmal Texte von Klingemann vertonen zu können, schlug Mendelssohn den Bogen zu seinen aktuellen Projekten: „Ich habe bei Deinen Worten das eigne Gefühl, daß ich keine Musik zu machen brauch, es ist als läse ich sie heraus, und als stände sie schon vor mir, und wenn bey andern Gedichten, namentlich Goethe, die Worte sich von der Musik abwenden und sich allein behaupten wollen, so rufen Deine Gedichte nach dem Klang und da kann der wahre nicht fehlen. Dies habe ich seitdem nur noch einmal in eben so hohem Grade gefunden, und zwar sonderbarer Weise, da ich für die Akademie etwas zu componiren hatte, in den Liedern von Luther, die mir ein Bekannter in Wien schenkte und mit auf die Reise gab; ich bitte Dich lies sie, oder wenn Du sie nicht gesammelt bekommen kannst, so schlag im Gesangbuch etwa folgende auf: ‚Mitten wir im Leben sind‘ oder ‚Aus tiefer Noth‘ oder ‚vom Himmel hoch da komm ich
her‘, ‚Ach Gott vom Himmel sieh‘ ‚Mit Fried und Freud‘ kurz alle.“83 Und er fügte hinzu: „Wie da jedes Wort nach Musik ruft, wie jede Strophe ein andres Stück ist, wie überall ein Fortschritt, eine Bewegung, ein Wachsen sich findet, das ist gar zu herrlich, und ich componire hier mitten in Rom sehr fleißig daran, und betrachte mir das Kloster, wo er gewohnt hat und sich damals von dem tollen Treiben der Herren überzeugte.“84 Von der Inspiration zur Komposition vergingen bei Mendelssohn bisweilen viele Wochen. Gerade bei den vielen auf seinen großen Reisen thematisierten Plänen, die zu Hause das Bild des in der Fremde fleißig arbeitenden Sohnes vermitteln sollten, bestanden zwischen Vorhaben und tatsächlicher Umsetzung oft erhebliche Diskrepanzen. Das betrifft auch die im Folgenden umrissene Entstehungsgeschichte der Choräle „Vom Himmel hoch“, „Verleih uns Frieden“ und „Wir glauben all an einen Gott“.
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“ MWV A 10
Das erste Werk der Reihe widmete sich einem der bekanntesten Weihnachts-Choräle schlechthin. Sicher wird die nahende Advents- und Weihnachtszeit zur Entscheidung beigetragen haben, gerade diesen Choral als erstes zu vertonen. Mitte Oktober, also noch in Venedig, hatte Mendelssohn das Weihnachtslied „schon im Kopfe“85. Dennoch fragte er sicherheitshalber bei Zelter an: „Bitte, schreiben Sie mir doch über diesen meinen Plan, und ob sie es billigen, daß ich überall die alte Melodie behalte, mich aber nicht daran binde, und z. B. den ersten Vers von ‚Vom Himmel hoch‘ ganz frey als einen großen Chor nehme?“86 In humorvoller Übertreibung erwähnte Mendelssohn das Projekt auch gegenüber seiner Familie: „[…] aber damit Du nicht glaubst, ich sey in lauter Elend und Pein versunken, so kommt ein lustiger Mordscandal: ‚vom Himmel hoch‘ mit 20 Trompeten und an die dreidausend Posaunen aus cdur; 2 Flöten fangen ganz allein fortissimo an […].“87 Interessanterweise hat sich diese Idee mit dem prägnanten Flötenanfang bis in die Komposition gehalten. Vorerst standen jedoch andere Arbeiten im Mittelpunkt, etwa die Vollendung des lateinischen 115. Psalms. Zu berücksichtigen ist ferner der Umstand, dass Mendelssohn seit dem 1. November in Rom weilte und – wie in einer Vielzahl von Briefen dokumentiert ist – von der Faszination dieser Stadt umfangen war. Ende November wurden wie-
78 D. M. Luthers geistliche Lieder nebst dessen Gedanken über die Musica […]. Die exakte bibliographische Identifizierung des Buches (Nachweis im Kapitel „Textvergleich“ am Ende des Kritischen Berichts) gelang erst Anfang der 1990er Jahre, siehe Wüster, Choralkantaten [Anm. 12], S. 477–480, mit Faksimile des Titelblattes auf S. 477.
79 Brief vom 16. Oktober 1830 an Carl Friedrich Zelter, Nachweis s. o. Anm. 73, das Zitat S. 110.
80 Quellenbelege und Transkriptionen im Kapitel „Choralnotate und verworfene Passagen“ am Ende des vorliegenden Bandes.
81 Siehe Serie I, Band 7 (2017) dieser Ausgabe.
82 Brief vom 6. Dezember 1830 an Franz Hauser, Standort unbekannt (s. u. Anm. 226 zum Brand des Archivs), zitiert nach Abschrift, D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [Nr. 2], S. 10–19, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 155–159, das Zitat S. 157.
83 Brief vom 26. Dezember 1830 / 2. Januar 1831 an Carl Klingemann, Privatbesitz, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 182–186, das Zitat S. 184.
84 Ebd.
85 Brief vom 16. Oktober 1830 an Carl Friedrich Zelter, Nachweis s. o. Anm. 73.
86 Ebd.
87 Brief vom 23. und 24. Oktober 1830 an die beiden Schwestern, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 13–14, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 113–117, das Zitat S. 116.
der Kompositionspläne nach Berlin übermittelt: „Wenn die Hebriden fertig sind, so denke ich mich an Salomon von Händel […] zu machen,88 und ihn für eine künftige Aufführung fertig einzurichten mit Abkürzungen und Allem. […] Nach dieser Arbeit denke ich die Weihnachtsmusik ‚vom Himmel hoch‘ und die amoll Sinfonie89 zu schreiben, dann vielleicht einige Sachen fürs Clavier und ein Concert u. s. w. wie es kommen will.“90 Schließlich sollte es noch zwei Monate bis zur Vollendung dauern. Das erste Ziel war, bis zum Heiligen Abend fertig zu werden: „[…] zu Weihnachten denke ich mir den Lutherschen Choral zu componiren, denn diesmal werde ich ihn mir allein machen müssen: das ist dann freilich ernsthafter […].“91 Doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. Mitte Januar konnte Mendelssohn dann vermelden, dass er mit seinem „Weihnachtsliede, das aus 5 Nummern besteht schon fast fertig“92 sei. Diese Formulierung zieht die schwer zu beantwortende Frage nach sich, welcher Satz als letztes hinzugekommen ist, denn als das Werk letztlich am 28. Januar 1831 vollendet wurde, bestand es aus sechs Sätzen: dem prächtigen Eingangschor, der mehr als die Hälfte des Werkes ausmacht, zwei Arien, einem Arioso, einem Choral und dem Schluss-Chor. In Frage käme etwa der Choral, der im Manuskript etwas unvermittelt an die erste Arie anschließt. Mendelssohn war mit dem Resultat augenscheinlich unzufrieden und ergriff daher die günstige Gelegenheit, die Partitur außerpostalisch nach Berlin befördern zu lassen. Am 26. Februar 1831 verließ Emil Bendemann (1808–1882), Bruder des Malers Eduard Bendemann (1811–1889), die Ewige Stadt gen Norden. Im Gepäck hatte er mehrere Mitbringsel für die Geschwister Mendelssohn: ein Zeichenbuch (für Bruder Paul),93 eine Abschrift der Hebriden-Ouvertüre (für Fanny)94 und das originale Weihnachtslied (für Rebecka). Beide Musikalien enthielten jeweils eine mit 25. Februar 1831 datierte Nachricht
an den Buchbinder 95 Diejenige zu „Vom Himmel hoch“ war an die jüngere Schwester gerichtet: „Liebes Beckchen Du sollst die g dur Arie singen, ich weiß selbst nicht recht, ob sie sehr langweilig oder sehr hübsch ist, ich trage sie zu schlecht vor. Laß das Stück bei den Sonntagsmusiken ausführen, ich höre Du kennst den Dirigenten dieses Concerts, dessen Ruf bereits bis Rom erscholl, also empfiehl mich ihm. Ich schicke gerade diese Musik obwohl sie von den neuen am wenigsten gelungen ist, und obwohl sie noch an allen Ecken der Glättung bedarf, aber ich schicke sie, weil sie lustig ist, und dann möchte ich die andern gerne noch ein Weilchen behalten um was Zeigbares Neues zu haben. Devrient muß die Arien singen und Du darfst Dich mit ihm darüber sehr zanken. Das Ende der Arie wird smorzando gesungen.“96 Ob das Stück tatsächlich bei einer Sonntagsmusik erklungen ist, bleibt ungewiss.97 Auf jeden Fall wurden aber Vorbereitungen dazu getroffen, denn es hat sich, wenn auch fragmentarisch, eine Chorstimme zu dem Werk erhalten, die im Familienbesitz überliefert wurde.98
„Verleih uns Frieden“ MWV A 11
Zu den bereits am 16. Oktober 1830 gegenüber Zelter benannten Lutherschen Liedern gehörte auch „Verleih uns Frieden“. Doch erst Ende Januar 1831 begannen die Arbeiten an einem Werk nach dieser Textvorlage. Am 24. Januar 1831 schrieb Mendelssohn: „Meine Weihnachtsmusik ist in den nächsten Tagen fertig, dann kommen noch zwei andre Luthersche Lieder ‚Wir glauben all‘ und ‚Verleih uns Frieden‘ mit denen ich so Gott will in etwa 8 Tagen zu Ende zu kommen denke, dann habe ich noch die beiden Sinfonien und etwas fürs Clavier zu machen, und wenn ich das Alles in 2 Monaten fertig bringen will, so muß ich mich dran halten […].“99 Gegenüber Hauser
88 Georg Friedrich Händel, Oratorium Salomo (Solomon) HWV 67. Von der 1830 erfolgten Einrichtung haben sich keine Quellen überliefert, jedoch zwei Orgelstimmen, die mit der Aufführung zum Musikfest in Köln 1835 zusammenhängen. Die 2009 im Mendelssohn-Werkverzeichnis [Anm. 2] noch mit unbekanntem Standort erwähnte Orgelstimme aus dem Besitz von E. H. W. Verkenius (MWV, S. 506, Quelle d) konnte mittlerweile ausfindig gemacht werden, siehe Alain Gehring, Händels ‚Solomon‘ in der Bearbeitung von Felix Mendelssohn Bartholdy (1835), in: Die Musikforschung 65 (2012), Heft 4, S. 313–337.
89 Die Erwähnungen der Arbeit an dieser „Schottischen“ Sinfonie und an der „Italienischen“ Sinfonie wird sich wie ein roter Faden durch die Korrespondenz ziehen.
90 Brief vom 22. bis 25. November 1830 an die beiden Schwestern (Briefteil vom 23. November), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 23–24, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 138–141, das Zitat S. 139.
91 Brief vom 20. und 21. Dezember 1830 an die Familie (Briefteil vom 20. Dezember), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 31–32, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 175–179, das Zitat S. 177.
92 Brief vom 17. Januar 1831 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 35–36, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 188–193, das Zitat S. 189.
93 Wehner, Bildwerkeverzeichnis [Anm. 57], S. 324–325 (ZB 8).
94 Partitur eines italienischen Kopisten, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 58, siehe Quellenübersicht in Serie I, Band 8 (2006) dieser Ausgabe, S. 269, Quelle D bzw. Serie I, Band 8A (2023).
95 Stehende Redewendung in der Familie Mendelssohn bei Übersendung von Handschriften. Für das Zeichenbuch entstand analog eine Nachricht an den Custode [Paul], GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fol. 1, vgl. auch später Recept an die Schwestern, s. u. Anm. 184.
96 Brief vom 25. Februar 1831 an Rebecka Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 128, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 217–218, das Zitat ebd.
97 In den bisher nur lückenhaft rekonstruierbaren Programmen ist es nicht zu finden, siehe Hans-Günter Klein, „… mit obligater Nachtigallen- und Fliederblütenbegleitung“. Fanny Hensels Sonntagsmusiken, Wiesbaden 2005.
98 Siehe Kritischen Bericht, Quelle C.
99 Brief vom 24. Januar 1831 an Rebecka Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 126, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 193–197, das Zitat S. 194. Die erwähnten zwei Monate hingen mit dem voraussichtlichen Ende des Aufenthaltes in Rom zusammen.
hieß es wenige Tage später inhaltlich etwas konkreter: „[…] und dann soll noch das kleine Lied ‚Verleih uns Frieden‘ kommen, als ein Canon mit Cellos und Bässen (die Singbässe fangen an.).“100 Im Verhältnis zu dem sechssätzigen Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“ war „Verleih uns Frieden“ tatsächlich ein kleines Stück, dies sowohl hinsichtlich der Besetzung als auch des Umfangs. Die Partitur umfasste sechs Seiten mit insgesamt 102 Takten. Auf einem gesonderten Titelblatt notierte Mendelssohn: Verleih uns Frieden. Choral von Dr. Luther für Chor und Orchester. Abgeschlossen wurde das Autograph am 10. Februar 1831: „Donnerstag […] Morg[ens]. Arb[eit]. (Verleih uns Frieden fertig.)“.101 Die Besonderheit des Stückes resultiert vor allem aus der Tatsache, dass Mendelssohn zwar Luthers Text aufgriff, nicht aber dessen Melodie. Somit ist „Verleih uns Frieden“ das einzige Werk, das nicht auf einer Kirchenliedmelodie beruht, sondern einzig auf einer von Mendelssohn selbst erfundenen melodischen Linie und deren Ausarbeitung. Der Komponist schien wieder in eine gute Schaffensphase gekommen zu sein: „Überhaupt geht es mit dem Componiren jetzt wieder frisch, die Italiänische Sinfonie macht große Fortschritte, es wird das lustigste Stück das ich gemacht habe, namentlich das letzte […]. ‚Verleih uns Frieden‘ ist fertig, und ‚wir glauben all‘ wird es dieser Tage, nur die Schottische Sinfonie kann ich noch nicht recht fassen; habe ich in dieser Zeit einen guten Einfall so will ich gleich drüber her, und sie schnell aufschreiben und beendigen.“102 Nichts deutete zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass ausgerechnet dieses „kleine Lied“ das einzige Werk bleiben sollte, das aus der Gruppe der Lutherschen Choralbearbeitungen zu Lebzeiten Mendelssohns veröffentlicht wurde.103
„Wir glauben all an einen Gott“ MWV A 12
Das verbindende Kriterium der Werke, einen Choral als textliche oder melodische Grundlage zu besitzen, hielt Mendelssohn nicht davon ab, für jede Komposition nach individuellen Gestaltungsprinzipien zu suchen. Dabei schöpfte er ein breites Formenreservoir aus. Für das in Italien chronologisch als letztes beendete „Wir glauben all an einen Gott“ scheint von Anfang an das polyphone Element eine Rolle gespielt zu haben. Drei Tage vor Weihnachten setzte sich Mendelssohn nieder, um nach
Hause zu berichten: „d. 21sten. Der kürzeste Tag ist trübe, wie es vorauszusehen war; heute muß also wieder an Fugen, Choräle, Bälle ud. dgl. gedacht werden.“104 In diesem Zusammenhang kam es zur ersten konkreten Erwähnung eines neuen Werkes, verbunden mit einer anekdotisch anmutenden, doch durchaus realistisch scheinenden Begebenheit in seinem Quartier: „Aber eine große Fuge mache ich: ‚Wir glauben all’‘ und singe selbst dazu, daß mein Hauptmann erschreckt die Treppe herunterkommt, hereinsieht und frägt, ob mir was fehle. Ich antworte dann: ein Contrathema. Was fehlt mir aber nicht alles!“105 Der Dezember war kompositorisch bis dahin vor allem mit dem Abschluss der Hebriden-Ouvertüre und dem Fertigstellen von Weihnachtsgeschenken ausgefüllt gewesen (siehe Tafel II). Doch weder die Fuge „Wir glauben all“ noch das eigentliche Weihnachtslied, das sich Mendelssohn selbst schreiben wollte, konnten bis Jahresende abgeschlossen werden. Stattdessen nutzte der Komponist die letzten Tage des Jahres 1830 für drei lateinische Stücke für Frauenstimmen und Orgel, die er den Nonnen auf Trinità de’ Monti in Rom zuzueignen gedachte.106 Mendelssohns Notizbuch verzeichnet ferner ein „Tantum ergo fertig“107, wobei die Formulierung offen lässt, ob ein solches Werk komponiert, abgeschrieben oder nur durchgesehen worden ist. Einen Monat später hatte sich bezüglich „Wir glauben all“ die Situation kaum geändert. Immerhin war zwischendurch „Vom Himmel hoch“ abgeschlossen worden: „Die Weihnachtsmusik ist fertig, und die andre angefangen […].“108 In der Zwischenzeit war die Idee, das Werk in Form einer großen Fuge zu gestalten, zugunsten einer dreiteiligen Form modifiziert worden. Gegenüber Franz Hauser entwarf Mendelssohn seine Pläne „[…] nun sitze ich mitten in seinem ‚Wir glauben all’ an einen Gott‘ was ich in 3 großen Fugen componire […]. Dann will ich mit geistlicher Musik für Rom aufhören, und mich an meine Sinfonie aus amoll machen, wenn das Alles fertig wird, so giebt’s einen guten Stoß neue Musik.“109 Das „kleine Lied“ MWV A 11 war letztlich eher fertig. Erst für den 1. März hielt Mendelssohn im Notizbuch fest: „Wir glauben all’ fertig […]“.110 Endlich konnte das Sinfonie-Projekt aufgegriffen werden, ohne dass sich allerdings musikalische Notate aus dieser Zeit erhalten haben.111 In einem zusammenfassenden Brief vom 21. März 1831 erklärte Mendelssohn jedenfalls: „Jetzt arbeite ich aber vorläufig noch an einer Sinfonie, die ich leider hier nicht mehr werde beendigen können, und aus der Sie auch Brocken kennen. Von Luther ist fertig, außer den Stü-
100 Brief vom 30. Januar 1831 an Franz Hauser, Standort unbekannt (s. u. Anm. 226 zum Brand des Archivs), zitiert nach Abschrift, D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [Nr. 3], S. 20–23, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 197–199, das Zitat S. 198.
101 Notizbuch, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 35r. Das Datum entspricht auch der Schlussdatierung der Partitur.
102 Brief vom 22. Februar 1831 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 40–41, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 212–216, das Zitat S. 214.
103 Siehe hierzu das Kapitel „Realisierte Veröffentlichung – Das Gebet ‚Verleih uns Frieden‘ MWV A 11“.
104 Brief vom 20. und 21. Dezember 1830 an die Familie (Briefteil vom 21. Dezember), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 31–32, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 175–179, das Zitat S. 178.
105 Brief vom 20. und 21. Dezember 1830 an die Familie, ebd., das Zitat S. 178–179.
106 Siehe Serie VI, Band 2 (2022) dieser Ausgabe.
107 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 31v.
108 Brief vom 1. Februar 1831 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fol. 37, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 199–202, das Zitat S. 200.
109 Brief vom 30. Januar 1831 an Franz Hauser, s. o. Anm. 100.
110 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 3, fol. 1r.
111 Zu dieser Besonderheit siehe Serie I, Band 5 (2005) dieser Ausgabe, S. XIII–XIV.
cken von denen Sie schon wissen: ‚Das Weihnachtslied[‘], Verleih uns Frieden, und ‚Wir glauben all’ an einen Gott[‘], alle 3 für Chor und Orchester.“112 Damit waren die Vertonungen von Luthertexten vorläufig abgeschlossen.113 Mit dem abklingenden Winter nahte das Ende des Rom-Aufenthaltes. Ihm folgte ein längerer Aufenthalt in Neapel (12. April bis 3. Juni) mit Ausflügen nach Amalfi, Capri etc.114 Dem schloss sich eine mehrmonatige Rückreise inklusive einer Querung der Schweizer Alpen zu Fuß an. Erst Anfang September 1831 kam Mendelssohn in München an, und bezog dort für knapp zwei Monate Quartier. Die Weiterreise nach Paris führte den Komponisten über Stuttgart und Heidelberg zunächst nach Frankfurt am Main, wo er die Beziehungen zum Cäcilien-Verein aufzufrischen gedachte. Diese bestanden seit 1822 und sollten auch über den Tod des Chorgründers und Leiters Johann Nepomuk Schelble (1789–1837) aufrechterhalten werden.115 Neben der Berliner Sing-Akademie war der Frankfurter Cäcilien-Verein prägend für Mendelssohns Erfahrungen im Umgang mit gemischten Chören. Die Kultur des gepflegten Gesanges und die Affinität zur Musik der Vergangenheit, insbesondere zu Bach und Händel, trugen wesentlich dazu bei, dass sich Mendelssohn im Frankfurter Sängerumfeld stets wohlfühlte. Sein Aufenthalt (ca. 11. bis 18. November 1831) wurde nach Kräften zum gemeinsamen Musizieren genutzt. Außerdem gestattete Mendelssohn eine Reihe von Abschriften seiner geistlichen Werke, bevor er sie partiell nach Berlin schicken ließ.116
„Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ MWV A 13
Noch bevor Mendelssohn Frankfurt erreicht hatte, „wo ich dem Caecilienverein mehrere meiner Römischen Musiken lassen will“,117 entstanden Pläne für eine weitere Choralbearbeitung. Aus München meldete sich der Komponist mitten aus der Arbeit an seinem neuen Klavierkonzert: „Eine tolle geistliche Mu-
sik hab’ ich aber wieder im Kopfe, die soll, so Gott will, in Paris mein erstes Stück sein […].“118 Diese Briefpassage ist insofern aufschlussreich, als sie belegt, dass „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ von vornherein als Projekt für den Aufenthalt in Paris vorgesehen war, wo der zweite Reise-Winter verbracht werden sollte. Die Aufführungen unter Schelble und der erneute Kontakt zum Frankfurter Cäcilien-Verein mögen Mendelssohn zusätzlich beflügelt haben. Gleichwohl waren die Ablenkungen in Paris – ähnlich wie die ein Jahr zuvor in Rom – groß, sodass es Überwindungen kostete, sich zum Komponieren zu zwingen. Dies wird aus einem Schreiben deutlich, mit dem Mendelssohn seine ältere Schwester in ein imaginäres Gespräch verwickelte: „[…] gut, sagst Du, so zieh Dich in Dich selbst zurück rue lepelletier no. 5, und schreibe Deine Musik auf ‚Ach Gott vom Himmel‘ oder eine Sinfonie, oder Dein neues Violinquartett […].“119 Erst Anfang April 1832 wurde „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ definitiv abgeschlossen. Zu bedenken ist aber, dass Mendelssohn parallel an der fulminanten Ballade Die erste Walpurgisnacht und an anderen Stücken arbeitete und darüber hinaus mehrere Kompositionen für den Druck vorbereitete (siehe Tafel II). Am Morgen des 5. April beendete er das Werk.120 Allerdings geschah dies, wie einer späteren Äußerung zu entnehmen ist, „in größter Eile“,121 da die Partitur noch am selben Tag von Ferdinand Hiller mit nach Frankfurt genommen werden sollte. Die genauen Zusammenhänge erläuterte Mendelssohn wenige Tage später: „Auch eine neue Kirchenmusik für den Cäcilienverein ist beendigt und durch Hiller bereits abgeschickt an Schelble. Er hat Paris am Donnerstag [5. April] verlassen und ist einer der wenigen die nicht aus Furcht, sondern wirklich aus Plan weggegangen sind. So seht Ihr also, daß mir es noch musikalisch zu Muthe ist, wenn auch den Leuten um mich herum gar nicht. Besagte Kirchenmusik soll übrigens Schelble abschreiben lassen, und zu Euch schicken; wundert Euch also nicht, wenn Sie ohne ein Wort ankommt, nehmt sie gut auf und ladet sie zum Essen ein.“122
112 Brief vom 21. März 1831 an Franz Hauser, Standort unbekannt (s. u. Anm. 226 zum Brand des Archivs), zitiert nach Abschrift D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [Nr. 4], S. 24–27, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 235–237, das Zitat S. 237.
113 Mendelssohn kam auf Luthers „Wir glauben all an einen Gott“ einige Jahre später bei der Arbeit an seinem Oratorium Paulus zurück, wo der Choral innerhalb des Chores „Aber unser Gott ist im Himmel“ (Teil von Nr. 36) eine tragende Rolle spielt.
114 Siehe Klein, Die Mendelssohns in Italien [Anm. 53], S. 51.
115 Ralf Wehner, „in Schelbles Geist, Sinn und Richtung“. Felix Mendelssohn Bartholdy und der „Cäcilien-Verein“, in: „Die Leute singen mit so viel Feuer “ Der Cäcilienchor Frankfurt am Main 1818 bis 2018, hrsg. von Daniela Philippi und Ralf-Olivier Schwarz in Verbindung mit dem Cäcilien-Verein, Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 2018, S. 39–51. Neben der im Folgenden verwendeten historischen Schreibweise „Cäcilien-Verein“ kommt bei Mendelssohn und seinen Zeitgenossen auch die Form „Cäcilienverein“ oder „Caecilienverein“ vor.
116 Zu den zuletzt genannten Aspekten siehe Kapitel „Wirken und Nachwirken – Frühe Rezeption“.
117 Brief vom 31. Oktober 1831 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 138, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 410–411, das Zitat S. 411.
118 Brief vom 27. September 1831 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 137, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 400–402, das Zitat S. 401.
119 Brief vom 28. Dezember 1831 an Fanny Hensel, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 99–100, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 442–445, das Zitat S. 442.
120 Pariser Tagebuch-Notizen, D-B, MA Ms. 143, S. 5: „Donnerst. […] Vis. Cherubini, Devrient, Eichthal, Hiller. Morg. Arb. Ach Gott vom Himmel fertig.“
121 Undatierter Brief vom Februar 1835 an Fanny Hensel, D-B, MA Ep. 196, s. u. Anm. 136 und dazugehöriges Zitat.
122 Brief vom 9. April 1832 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 151, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 512–513, das Zitat S. 512. Die erbetene Abschrift wurde in Frankfurt vorgenommen und nach Berlin geschickt, siehe Kritischen Bericht, Quelle C. In der weiteren Geschichte des Werkes spielte sie eine Vermittlerrolle für eine weitere Abschrift, siehe Kapitel „Veröffentlichungspläne“.
Mit der Weggabe seiner Partitur ruhte das Thema der Luther-Choräle erneut für einige Zeit. Erst drei Jahre später kam Mendelssohn in Zusammenhang mit der geplanten Drucklegung von Sakralwerken u. a. auf dieses Werk zurück.
Veröffentlichungspläne
Die in den 1820er Jahren erfolgte Publikation der Werke mit den Opuszahlen 1 bis 10 war im Wesentlichen von den Eltern initiiert und organisiert worden. Auf der Englandreise 1829 hatte Mendelssohn dann persönlich erste Kontakte zu Verlegern aufgenommen, was u. a. die Publikation der Sinfonie Nr. 1 c-Moll zu Folge hatte, die später die Opuszahl 11 tragen sollte.123 Auf seiner großen Reise von 1830 bis 1832 führten die Gespräche mit Verlegern in Leipzig, Wien, Bonn und London zu weiteren Veröffentlichungen. In den Reisebriefen wird gelegentlich Mendelssohns Freude deutlich, mit seinen Kompositionen auch eigenes Geld verdienen zu können, da „mir das Herausgeben der Stücke nichts kostet, sondern im Gegentheil was einbringt“,124 wie er bezüglich des Oktetts und Quintetts aus Paris formulierte. Dass dies auch mit Kirchenmusik möglich war, zählte zu den neuen Erfahrungen. Am Ende seiner Reise, 1832 in London, erhielt Mendelssohn sogar schon diesbezügliche Angebote: „Ich muß verschiedne Sachen herausgeben ehe ich reise und etwas Geld einnehmen; bekomme aber von so vielen Seiten Aufträge, und zum Theil so angenehme, daß es mir wirklich schwer fällt, sie nicht noch anzufangen. Unter andern bekam ich heut früh von einem Verleger ein Billet, der 2 große Kirchenstücke in Partitur, eins für den Morgen, das andre für den Abend herausgeben will“.125 In den folgenden Jahren unternahm Mendelssohn mehrfach Versuche, auch seine Choralbearbeitungen zu veröffentlichen. Bemerkenswert ist, dass bei der Auswahl die drei Stücke „Jesu, meine Freude“, „Wir glauben all an einen Gott“ und „O Haupt voll Blut und Wunden“ keine Rolle spielten und dafür zwei äl-
tere aus den 1820er Jahren in Erwägung gezogen wurden. Bereits im November 1831 war Mendelssohn auf der Durchreise von Frankfurt nach Düsseldorf durch Bonn gekommen und hatte dort Kontakte zu N. Simrock aufgenommen. Als erste Publikation erschienen unter dem Titel Kirchenmusik op. 23 die drei in Wien und Venedig entstandenen Motetten „Aus tiefer Not“, „Mitten wir im Leben sind“ und „Ave Maria“ (siehe Tafel II). Da die Werke nicht noch einmal abgeschrieben werden konnten, hatte Mendelssohn sogar die Originalmanuskripte als Stichvorlagen weitergegeben. Es lag nach den Erfahrungen mit N. Simrock nahe, ihm auch die nächsten Kirchenmusiken anzuvertrauen. Am 1. Oktober 1833 hatte Mendelssohn die Position des Städtischen Musikdirektors in Düsseldorf angetreten, zu dessen Aufgaben auch die Ausgestaltung der katholischen Kirchenmusik an den beiden Stadtkirchen St. Lambertus und St. Maximilian gehörte.126 Hier war im Sommer 1834 unter anderem das „Verleih uns Frieden“ erklungen.127 Und so lag es ein knappes halbes Jahr später nahe, dieses Werk in die Planungen einzubeziehen: „[…] auch 6 Fugen will ich herausgeben, und dem alten Attwood zueignen,128 und drei kleine Kirchenmusiken. Da bitte ich Dich nun, Fanny, um einigen Rath, welche drei ich nehmen soll; Verleih uns Frieden muß eine davon sein, nun möchte ich sie aber gern alle drei deutsch und weiß nicht welche zwei andern ich wählen soll, schlage mir doch zwei vor die Du vorziehn würdest […].“129 Mitte Februar äußerte sich Mendelssohn gegenüber seinem Freund Klingemann: „[…] ich gebe jetzt wieder drei geistliche Musiken heraus, auch das ‚Verleih uns Frieden‘ das Du ja wohl kennst,130 da können sie dazu singen the Lord is a man of war.“131 Über die zwei anderen in Frage kommenden Werke entspann sich etwa gleichzeitig ein kurzer, aber intensiver Briefwechsel zwischen den Geschwistern Mendelssohn. Am Ende eines Briefes aus Düsseldorf bat der Komponist seine ältere Schwester: „Ach noch eine Bitte und zwar geschäftsmäßig laß mir doch die Partituren meiner Musiken ‚ach Gott vom Himmel‘ (a mol) die ich Dir mal schickte132 und ‚Christe Du Lamm‘ (f dur) wenn Du
123 MWV N 13. Das Werk erschien 1830 bei J. B. Cramer, Addison & Beale zunächst ohne Opuszahl als Grand Symphony in einer speziellen Kammermusikfassung für Klavier zu vier Händen mit Violine und Violoncello ad. lib. Siehe Serie I, Band 4A (2002) dieser Ausgabe.
124 Brief vom 21. Januar 1832 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), Abschnitt für Fanny Hensel, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 99–100, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 466–469, das Zitat S. 466.
125 Brief vom 1. Juni 1832 an die Familie (p. Adr. Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 119–120, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 548–550, das Zitat S. 550. In Folge dieses Auftrags entstand im August 1832 das englische Te Deum „We praise thee, O God“ MWV B 25 für den Morning Service.
126 Zu seinen Dienstverpflichtungen und den damit verbundenen Kompositionen siehe Serie I, Band 10 (2019) dieser Ausgabe, S. XV–XVIII.
127 Nachweise siehe Kapitel „Wirken und Nachwirken – Frühe Rezeption“.
128 Aus den „6 Fugen“ wurden letztlich – allerdings zwei Jahre später – 6 Stücke, nämlich drei Praeludien und Fugen op. 37. Zunächst schloss Mendelssohn am 11. Januar 1835 für Attwood die Two Fugues for the Organ MWV V 1 für zwei Spieler ab.
129 Brief vom 11. Dezember 1834 an Abraham Mendelssohn Bartholdy, Abschnitt für Fanny Hensel, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 215, gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, Bd. 4, hrsg. und kommentiert von Lucian Schiwietz und Sebastian Schmideler, Kassel etc. 2011 (im Folgenden: Sämtliche Briefe, Bd. 4), S. 107–109, das Zitat S. 108. Die Formulierung „alle drei deutsch“ könnte auf die lateinischen Frauenchöre Bezug nehmen, die zunächst aufgrund ihrer Sprache ausschieden.
130 Wann genau Klingemann das Stück gehört oder gesehen hat, ist noch zu entschlüsseln.
131 Brief vom 16. Februar 1835 an Carl Klingemann, Privatbesitz, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 4 [Anm. 129], S. 171–173, das Zitat S. 172. Das Zitat „the Lord is a man of war“ war eine Anspielung auf das gleichnamige Bass-Duett aus Händels Oratorium Israel in Egypt, das laut einem vorangegangenen Brief Klingemanns in London in einem Konzert mit einer englischen Adaption von Mendelssohns „Ave Maria“ erklungen war, Brief vom 3. Februar 1835 von Carl Klingemann an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 30, Green Books IV-9.
132 Hier muss eine Erinnerungslücke von Mendelssohn vorliegen, da die Familie nur jene Quelle für eine Abschrift zur Verfügung hatte (im vorliegenden Band bezeichnet Quelle C), die in Frankfurt von der autographen Partitur (Quelle B) genommen und von dort auf Anweisung Mendelssohns nach Berlin geschickt wurde.
dies letztere hast, abschreiben und schicke sie mir schleunig her. Eins davon soll herauskommen. Du hast mir auch nicht geantwortet, welches und welche?“133 Am 17. Februar 1835 reagierte nun Fanny Hensel detailliert, schlug mit „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ ein drittes Werk vor und brachte ihre Bedenken hinsichtlich des Schluss-Chores von „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ zu Papier: „Die beiden Stücke, die Du verlangst hast, sind im Begriff abzugehn, das Eine hab ich nur noch nicht vom Notenschreiber zurück.134 Was nun das Herausgeben betrifft, so wollte ich Dich fragen, ob Du auch nicht vergessen hast: wer nur den lieben Gott läßt walten, es gefällt mir sehr, u. wenn ich unter den 2 genannten zu wählen hätte, so wäre es Christe du Lamm Gottes. Von [‚]ach Gott vom‘ gefällt mir ganz besonders das erste Stück, u. vorzüglich vom unisono an, wo es sehr ernsthaft u. schön bis nach a dur hinein geht. Die Arie ist wunderlich und schön wie die Worte. Aber das Letzte Stück möchte ich Dir stark anfechten. Du mußt nur nicht glauben, daß ich Dir eine retour Kutsche schicke, das ists gewiß und wahrhaft nicht. Aber das fängt in fis moll an, u. schließt in a moll oder vielmehr in E dur, durch wenige Modulationen hindurch, u. doch glaube ich hätten die Worte da die allergrößte Standhaftigkeit u. ein Beharren im Choral erfordert. Wären wir beisamen so würden wir uns leicht darüber verständigen, so bitte ich Dich aber, antworte mir darauf, u. sage mir in wiefern Du vielleicht seit den Paar Jahren, die über die Composition vergangen sind, andrer Meinung geworden bist. Die Arie aus: wer nur den lieben Gott, bringt mich darauf, Dir zu sagen, daß ich in mehreren Solosachen Deiner kleinen geistlichen Musiken eine Art von Gewohnheit finde, die ich nicht gern Manier nennen möchte, u. nicht recht zu benennen weiß, nämlich etwas übereinfaches, welches mir Dir nicht ganz natürlich zu seyn scheint, eine Art von kurzen Rhythmen z. B. die etwas kindliches aber auch etwas kindisches haben, u. mir der ganzen Gattung sowohl, als auch Deiner ernsten Art die Chöre zu behandeln, nicht ganz angemessen scheint. Ich habe hier vorzüglich die Arie aus der Weihnachtsmusik im Sinn, wo ich mir wohl denken kann, wie Du dazu gekommen bist, aber auch in mehreren andern scheint mir das Prinzip das Nämliche zu seyn. Wenn es Zeit hätte, bis wir uns sehn, so wäre es wohl hübsch,
wenn wir die Auswahl zusammen machen könnten, denn ich habe nicht alle die Musiken, die ich nicht besitze, genug im Kopf, um Dir meinen weisen Rath zu ertheilen.“135 Mendelssohns Antwort kam umgehend: „Leider hat die Herausgabe der Kirchenmusiken nicht Zeit bis wir uns sprechen. Aber Du bist auch ein prächtiger Cantor daß Du so behutsam und zimperlich gestehst, Dir gefiele der letzte Choral von ‚Ach Gott vom Himel‘ nicht. Das ist eine anerkannte Wahrheit, daß der nichts taugt. Aber bedenke, ich machte ihn in größter Eile um das Stück versprochnermaßen zur Zeit nach Frankfurt zu schicken, ud. das ist die einzige Rechtfertigung für mein Unthier mit dem fismol Kopf und dem edur Schweif. Als ich Dir darum schrieb sagte ich mir im Stillen ‚wenns kommt, machst Du einen andren Schluß ran‘ und so ists nicht mehr als billig, daß Du dasselbe in Berlin gesagt hast; wir halten das ja gewöhnlich so.“136 Mittlerweile musste Mendelssohn den Verleger mit seiner Entscheidung etwas vertrösten: „Mit den 3 Kirchenmusiken für Chor und Orchester würde es vielleicht eine oder 2 Wochen länger dauern, indessen wäre es mir doch lieb, wenn auch diese in Ihrem jetzigen Catalog kämen, und bis Ende März werde ich Ihnen gewiß das fertige Manuscript zuschicken können.“137 Schließlich legte der Komponist die Entscheidung, welche Werke besser für eine Veröffentlichung geeignet wären, in die Hände des Bonner Verlegers: „Zugleich bitte ich Sie mir zu sagen, ob es Ihnen einerlei wäre, wenn statt der 3 kleineren Kirchenmusiken, ein größerer Psalm (von 4 Nummern, 2 Chöre und 2 Solostücke) erschiene? Ich bin noch unschlüssig deshalb, und wünsche Ihre Meinung zu wissen, um in jedem Falle die Manuscripte bald in Ordnung zu bringen.“138 Simrock präferierte eindeutig ein größeres Werk statt der drei kleineren, sodass Mendelssohn seine Entscheidung fällen und am 10. April 1835 mitteilen konnte: „Ihrer gütigen Antwort zufolge habe ich mich nun für den Psalm entschieden und werde Ihnen die Partitur davon in der nächsten Woche zuschicken.“139 Bei dem erwähnten Psalm handelte es sich um den in Rom komponierten 115. Psalm „Non nobis Domine“ op. 31 MWV A 9, den Mendelssohn für die Ausgabe noch selbst aus der Vulgata ins Deutsche übersetzte: „Nicht unserm Namen, Herr, nur deinem geheiligten Namen sei Ehr“. Zwischenzeitlich war sogar noch die
133 Brief vom 30. Januar und 1. Februar 1835 an Fanny Hensel (Briefteil vom 1. Februar), D-B, MA Depos. MG 28, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 4 [Anm. 129], S. 155–156, das Zitat S. 156. Die Antwort auf Mendelssohns Anfrage vom 11. Dezember 1834 (s. o. Anm. 129) lag demzufolge noch nicht vor.
134 Diese Formulierung deutet darauf, dass es sich um die beiden Abschriften von MWV A 5 und A 13 aus dem Autographenband 21 handeln könnte, die von einem Kopisten stammen.
135 Brief vom 17. Februar 1835 von Fanny Hensel an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 30, Green Books IV-13, zuerst gedruckt in: The Letters of Fanny Hensel to Felix Mendelssohn. Collected, Edited and Translated with Introductory Essays and Notes by Marcia J. Citron, [Stuyvesant, New York] 1987, S. 489–491, das Zitat S. 489.
136 Undatierter Brief an Fanny Hensel, der von fremder Hand irrtümlich auf April/Mai 1835 datiert wurde, aus inhaltlichen Gründen und wegen der Ankündigung des Briefes durch den Vater am 26. Februar 1835 wohl auf den 27. Februar anzusetzen wäre, D-B, MA Ep. 196, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 4 [Anm. 129], S. 181–182, dort datiert „27.(?) Februar 1835“, das Zitat S. 182, statt „Cantor“ dort „Censo[r,]“.
137 Brief vom 25. Februar 1835 an N. Simrock, D-B, MA Ep. 25, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 4 [Anm. 129], S. 174–175, das Zitat S. 174.
138 Brief vom 28. März 1835 an N. Simrock, D-B, MA Ep. 26, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 4 [Anm. 129], S. 206–207, das Zitat S. 206. Das laut entsprechendem Vermerk auf dem Brief am 30. März 1835 beantwortete Schreiben von Simrock ist nicht in den Green Books enthalten, kann aber inhaltlich durch Mendelssohns folgenden Brief erschlossen werden.
139 Brief vom 10. April 1835 an N. Simrock, Standort unbekannt, zitiert nach dem Faksimile aus einem Verkaufsangebot der Firma Antikvariat Arnold Busck, Kopenhagen, auf der 8. Antiquariatsmesse Amsterdam (European Antiquarian Bookfair. Nederlandsche Vereenigung van Antiquaren), die vom 26. Februar bis 1. März 1987 stattfand, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 4 [Anm. 129], S. 220–221, das Zitat S. 221. Die versprochene Satzvorlage des 115. Psalms op. 31 erhielt der Verleger schließlich mit Brief vom 19. Mai 1835, D-B, MA Ep. 27
Idee aufgekommen, die ebenfalls ungedruckten römischen Motetten für Frauenchor veröffentlichen zu lassen. Wiederum wurde zuerst die Familie befragt: „Und dann müssen einige Kirchenmusiken kommen, ich kann nur noch durchaus nicht drei herauskriegen, die mir recht passend scheinen. Die Nonnenstücke wären ganz gut […] aber das dritte (aus adur)140 ist eben nicht ganz gut. Ein neues dazu zu componiren fehlt mir die Zeit, die Lust, der Text und die Nonnen.“141 So hatte Simrocks Entscheidung für ein größeres Werk Mendelssohns Unsicherheit über die anderen geistlichen Stücke vorerst verdrängt. Die „Nonnenstücke“ kamen erst 1838 nach umfassender Revision als Drei Motetten für weibliche Stimmen mit Begleitung der Orgel op. 39 bei N. Simrock heraus (MWV SD 17). Weiter blieben also die Choralbearbeitungen unveröffentlicht. Einen erneuten Anlauf unternahm Mendelssohn anderthalb Jahre später, mittlerweile in Leipzig wohnend. Im Februar 1837 ließ er über Klingemann den alten Bekannten Thomas Attwood anfragen, „ob er mir erlauben will ihm 3 Kirchenmusiken für Chor und Orchester die ich jetzt herausgeben will zuzueignen? Oder ist in England solche Anfrage nicht nothwendig?“142 Die Anfrage bei Attwood war insofern folgerichtig, als dieser bereits 1829 von Mendelssohn das „Christe, du Lamm Gottes“ und 1832 das „O Haupt voll Blut und Wunden“, jeweils in Abschriften, geschenkt bekommen hatte, ihm also Mendelssohns Art der Choralbearbeitung wie kaum einem Zweiten außerhalb der Familie vertraut war. „Attwood nimmt die dedication mit Jubel auf […]“, konnte Klingemann beim nächsten Brief berichten.143
Als Verleger wurde dieses Mal die Firma Breitkopf & Härtel ausgewählt, mit der Mendelssohn insbesondere seit seiner Übersiedlung nach Leipzig 1835 in engem Kontakt stand.144 Am 11. März 1837 griff Mendelssohn seinen alten, 1835 nicht realisierten Plan auf und unterbreitete nun den Geschäftsführern von Breitkopf folgendes Angebot: „Ew. Wohlgeboren bitte
ich mich wissen zu lassen, ob Sie wohl auch einige meiner Arbeiten im kirchlichen Styl herauszugeben Willens wären. Ich wünsche jetzt mit den Clavierfugen zugleich oder doch bald nach ihnen drei größere Fugen für die Orgel drucken zu lassen,145 und später im Laufe des Frühjahres drei Kirchen-Cantaten für Orchester und Chor, mit Deutsch und Engl. Text. und es wäre mir lieb wenn auch etwas der Art von mir bei Ihnen erschiene. […] das Manuscript der 3 Kirchenmusiken könnte ich hingegen erst später schicken, und würde dann noch deshalb an Sie schreiben.“146 Aufschlussreich ist hier einerseits die Bezeichnung der Werke als „Kirchen-Cantaten“, andererseits die Idee, die Werke nun außer in deutscher auch in englischer Sprache anzubieten, wozu auch die geplante Widmung an Attwood passte. Parallel dazu verhandelte Mendelssohn mit Simrock über die „Nonnenstücke“: „Auch ein Heft von drei kleinen Kirchenmusiken (für weibliche Stimmen allein) möchte ich wohl im Laufe der nächsten Monate herausgeben, und es wäre mir lieb, wenn sie ebenfalls bei Ihnen erscheinen könnten.“147 Zwischen Mitte März und Ende September 1837 hielt sich Mendelssohn außerhalb Leipzigs auf. Am 28. März 1837 fand in Frankfurt am Main die Vermählung mit Cécile Jeanrenaud (1817–1853) statt. Ihr folgte eine ausgiebige Hochzeitsreise.148 Ende August fuhr Mendelssohn nach London und von dort weiter zum Musikfest nach Birmingham, wo er seinen Paulus dirigieren und das 2. Klavierkonzert op. 40 MWV O 11 zur Uraufführung bringen sollte.149 Erst am 1. Oktober 1837 war Mendelssohn wieder in Leipzig.150 Noch auf der Reise muss der Entschluss gefallen sein, das Projekt „Kirchen-Cantaten“ nicht weiterzuverfolgen. Als erstes wurde Heinrich Conrad Schleinitz (1802–1881) von Frankfurt am Main aus über die Entscheidung informiert, die auch erkennen lässt, welche zwei Werke ursprünglich geplant waren: „Ich bin jetzt übrigens entschlossen, weder ‚Verleih uns‘ noch die Weihnachtsmusik151 hier zu geben, jedoch das Erstere einmal
140 Das „O beata et benedicta“ MWV B 22 wurde dann auch Jahre später bei der Drucklegung durch ein neu komponiertes „Laudate pueri Dominum“ MWV B 30 ersetzt.
141 Brief vom 31. März und 2. April 1835 an Rebecka Dirichlet, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 227, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 4 [Anm. 129], S. 207–210, das Zitat S. 208.
142 Brief vom 18. bis 20. Februar 1837 an Carl Klingemann, Privatbesitz, gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, Bd. 5, hrsg. und kommentiert von Uta Wald unter Mitarbeit von Thomas Kauba, Kassel etc. 2012 (im Folgenden: Sämtliche Briefe, Bd. 5), S. 206–207, das Zitat S. 207.
143 Brief vom 10. März 1837 von Carl Klingemann an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 32, Green Books VI-24. Letztlich wurden dem Organisten Attwood die Praeludien und Fugen für die Orgel op. 37 „mit Verehrung und Dankbarkeit gewidmet“.
144 Zum allgemeinen Verhältnis siehe Ralf Wehner, 17 Jahre mit dem Komponisten, mehr als 170 Jahre für den Komponisten. Felix Mendelssohn Bartholdy und das Verlagshaus Breitkopf & Härtel, in: Breitkopf & Härtel. 300 Jahre europäische Musik- und Kulturgeschichte, hrsg. von Thomas Frenzel, Wiesbaden 2019, S. 169–178.
145 Die Sammlungen Sechs Praeludien und Fugen op. 35 für Klavier und die Präludien und Fugen op. 37 für Orgel erschienen 1837/1838 bei Breitkopf & Härtel und parallel in einem englischen und französischen Verlag, siehe MWV SD 14 und SD 15.
146 Brief vom 11. März 1837 an Breitkopf & Härtel, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (im Folgenden: D-DS), wie alle Breitkopf-Briefe dieses Bestandes ohne Einzelsignatur, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 5 [Anm. 142], S. 222.
147 Brief vom 6. April 1837 an N. Simrock, Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf, 54.81, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 5 [Anm. 142], S. 240. Dieses Projekt war erfolgreich, die Werke erschienen als op. 39.
148 Peter Ward Jones, The Mendelssohns on Honeymoon. The 1837 Diary of Felix and Cécile Mendelssohn Bartholdy. Together with Letters to their Families, Oxford 1997, deutsche Ausgabe: Felix und Cécile Mendelssohn Bartholdy, Das Tagebuch der Hochzeitsreise nebst Briefen an die Familien, hrsg. von Peter Ward Jones, Zürich und Mainz 1997.
149 Siehe Serie II, Band 3 (2004) dieser Ausgabe.
150 Mendelssohn kam an diesem Tag 14 Uhr in Leipzig an und dirigierte bereits 18 Uhr das Konzert im Gewandhaus, laut Brief vom 4. Oktober 1837 an Lea Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 338, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 5 [Anm. 142], S. 343–348.
151 „Vom Himmel hoch“ war bis dahin noch nicht benannt worden. Welches das dritte Werk war, entzieht sich heutiger Kenntnis.
später. An deren Statt will ich aber meinen neuen Psalm bald drucken lassen, weil er mir jetzt gar zu gut gefällt.“152 Bei dem neuen Psalm handelt es sich um den größtenteils auf der Hochzeitsreise entstandenen 42. Psalm „Wie der Hirsch schreit“ op. 42 MWV A 15. Wenig später schrieb Mendelssohn, mittlerweile in Koblenz, an den Leipziger Verleger und teilte ihm seine Entscheidung mit: „Statt der 3 kleineren Kirchenmusiken, die theils zu meinen früheren Arbeiten gehörten, ud. von denen ich jetzt noch nicht einmal gewiß weiß, ob ich sie überhaupt herausgeben darf, bringe ich Ihnen nach Lpzig das Mspt. eines größeren Werkes, des 42sten Psalms mit, der mir das beste scheint was ich in dieser Art componirt habe und den ich gern bei Ihnen erscheinen sehn würde.“153 So wurde letztlich zweimal –1835 und 1837 – die Publikation von Choralbearbeitungen zugunsten der Veröffentlichung einer Psalmkantate zurückgestellt. Die wiederholten Versuche, die Stücke, auch wenn sie zu den „früheren Arbeiten“ gehörten, zur Veröffentlichung zu bringen, zeigen immerhin, dass Mendelssohn sie mehr schätzte, als es durch den letztlichen Verzicht auf eine Publikation den Anschein hat.
Realisierte Veröffentlichung: Das Gebet „Verleih uns Frieden“ MWV A 11
Am 5. Juni 1839 druckte Breitkopf & Härtel in der Allgemeinen musikalischen Zeitung (AmZ ) eine bemerkenswerte Mitteilung ab: „An die Geehrten Leser der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Autographen der berühmtesten lebenden Tonsetzer im treuesten Fac-simile als Beilagen zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Bereits zu Anfang dieses Jahres versprachen wir den geehrten Abnehmern der Allgemeinen Musikalischen Zeitung für die Folgezeit eine Reihe interessanter Beilagen. Wir hoffen dieses Versprechen im weitesten Sinne zu erfüllen, wenn wir von heute an eine Folge von Autographen der berühmtesten lebenden Tonsetzer in vollkommen treuem Facsimile der Zeitung beigeben. Dieselben sind sämmtlich eigens für diesen Zweck erbeten und gewährt, und im Formate der Zeitung geschrieben. Den Anfang machte das diesem Stück beiliegende ‚Verleih’ uns Frieden‘ von Dr. Felix Mendelssohn-Bartholdy, und wir brauchen nur die Namen Adam, Auber, Halevy, Meyerbeer, Onslow, Reissiger, Spohr und Thalberg zu nennen, um auf den Werth dessen, was zunächst folgen wird, aufmerksam zu machen. Leipzig, im Juni 1839. Breitkopf und Härtel.“154 Beigelegt war eine mit sieben Seiten recht umfängliche Reproduktion der Mendelssohnschen Handschrift, die sogar neben der SchlussSchleife die Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift enthielt, dadurch den graphischen Reiz steigerte und den ideel-
len Wert für den Musikliebhaber vergrößerte. Dem Druck vorausgegangen war eine längere Vorbereitungsphase, die im Februar 1839 begann.
Die Liste der bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Mendelssohn-Werke mit Opuszahlen war mittlerweile auf 43 angewachsen. Dazu kamen wenige Werke ohne Opuszahlen. An Kirchenmusik fanden sich darunter die Sammlungen op. 23 und op. 39, das Oratorium Paulus op. 36 sowie der 115. Psalm op. 31 und 42. Psalm op. 42. Nachdem mehrere Versuche gescheitert waren, das „Verleih uns Frieden“ zusammen mit zwei anderen Werken zu publizieren, ergab sich nun die Möglichkeit, das mittlerweile acht Jahre alte, jedoch in der Zwischenzeit mehrfach aufgeführte und revidierte Werk155 in ungewöhnlicher Weise an die Öffentlichkeit zu bringen. Der Dimension und Bedeutung des Werkes gemäß verzichtete der Komponist auf eine Opuszahl. Mendelssohn war zu jener Zeit mit den Korrekturen seiner Streichquartette op. 44 und des 42. Psalms beschäftigt. Parallel dazu liefen die Vorbereitungen auf die Uraufführung von Franz Schuberts „großer“ Sinfonie in C-Dur D 944, die Mendelssohn am 21. März 1839 leitete. Die Geschäftsführer Raymund Härtel (1810–1888) und Dr. Hermann Härtel (1803–1875) waren deshalb in jenen Wochen mit Mendelssohn in engem Kontakt. Bei einem der persönlichen Treffen muss auch zur Sprache gekommen sein, dass Breitkopf & Härtel für ihre AmZ eine Serie von Faksimile-Reproduktionen plante, die repräsentativ mit einem Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy eröffnet werden sollte.
Die ersten Absprachen wurden mündlich getroffen, denn mit Brief vom 9. März 1839 erhielt Mendelssohn ein spezielles Notenpapier im Format der AmZ, „dessen Sie sich gefällig zu dem gütigst für unsre musikalische Zeitung versprochnen ‚Verleih uns Frieden‘ bedienen wollen.“156 Einen Tag nach Aufführung der Schubert-Sinfonie konnte Mendelssohn antworten: „Ew. Wohlgeboren erhalten hiebei das ‚Verleih uns Frieden‘ welches ich Ihrem Wunsch gemäß auf das Papier geschrieben, welches Sie mir neulich dazu schickten. Wenn Sie es der musikalischen Zeitung beilegen, so bitte ich Sie es nicht als eine Beilage die ich dazu gebe, sondern die Sie dazu geben darin aufzuführen. Als Titel wünsche ich: Gebet, nach Worten von Luther componirt von F. M. B.“157 Der Verlag regte an, noch eine Unterschrift an das Ende der Komposition zu setzen, worauf Mendelssohn antwortete: „Natürlich will ich unter die Partitur wenn Sie es wünschen meinen Namen und das Datum recht gern setzen. Doch dachte ich da es ein facsimile meiner Handschrift sein soll, und ich niemals meinen Namen unter meine Noten schreibe, ja eine Art Vorurtheil dagegen habe, daß es auch bei diesem Stücke nicht stehn dürfe, da es bei keinem andern geschehn ist. Doch kann ich mir freilich denken daß es bei einem Autograph gerade
152 Brief vom 3. Juli 1837 an Heinrich Conrad Schleinitz, Standort unbekannt, zitiert nach Erstdruck: Ein ungedruckter Brief von F. Mendelssohn-Bartholdy an Herrn Concertdirector Conrad Schleinitz in Leipzig, in: Die Tonhalle. Organ für Musikfreunde 1 (1868), Nr. 33 (9. November), S. 525.
153 Brief vom 5. August 1837 an Breitkopf & Härtel, D-DS, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 5 [Anm. 142], S. 318–319, das Zitat S. 319.
154 Allgemeine musikalische Zeitung 41 (1839), Nr. 23 (5. Juni), Sp. 451–452. Kursive Hervorhebungen im Original.
155 Siehe hierzu das Kapitel „Wirken und Nachwirken – Frühe Rezeption“.
156 Brief vom 9. März 1839 von Breitkopf & Härtel an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-87.
157 Brief vom 22. März 1839 an Breitkopf & Härtel, D-DS, gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, Bd. 6, hrsg. und kommentiert von Kadja Grönke und Alexander Staub, Kassel etc. 2012 (im Folgenden: Sämtliche Briefe, Bd. 6), S. 349–350, das Zitat ebd.
auf den Namen besonders ankommt, und wenn das der Fall ist, so bitte ich mir es zu sagen und werde dann das Manuscript mit Unterschrift zurücksenden.“158
Die „Geehrten Leser“ der AmZ konnten sich also an einer weitgehend fehlerfreien Partitur in der Handschrift von Mendelssohn Bartholdy erfreuen. Es war dies überhaupt die erste Veröffentlichung eines Autographs des Komponisten. Die originale Vorlage verblieb zunächst bis Anfang der 1950er Jahre im Besitz der Härtel-Familie und wurde dann von einem Schweizer Privatsammler erworben. Erst in Zusammenhang mit der vorliegenden Ausgabe war es möglich, Mendelssohns Originalvorlage mit dem „treuesten Fac-simile“ (AmZ) zu vergleichen. Die abgebildete Partitur ist zunächst ganz eindeutig als Handschrift Mendelssohns zu erkennen und zeugt von der hohen Qualität der damaligen Lithographie-Technik, die eine detailgetreue Wiedergabe möglich machte. Eine genaue Analyse zeigt zunächst, dass der Verlag viele typographische Details mustergültig getroffen hat. Allerdings wird auch deutlich, dass an etlichen Stellen dynamische und artikulatorische Zeichen nicht übernommen wurden und bei der Darstellung von korrigierten Noten nur eine Auswahl getroffen wurde. Mit diesen Retuschen erhielt die faksimilierte Partitur den Charakter einer Reinschrift, den die Vorlage nicht hatte.159
Parallel zu der Zeitschriften-Beilage bereitete Mendelssohn die reguläre Druckausgabe des Werkes vor, die außer der deutschen Textunterlegung auch deren lateinische Übersetzung und eine spezielle Widmung enthalten sollte. Mit der Sendung der Faksimile-Vorlage überreichte Mendelssohn einen neuen Klavierauszug: „In der separaten Herausgabe wünsche ich noch eine Dedication auf dem Titel eingeschoben, nämlich componirt und Herrn Präsidenten Verkenius mit aufrichtiger Hochachtung gewidmet von F. M. B. Dort müssen auch die lateinischen Worte untergesetzt werden. Eben so im Clavierauszug den ich gemacht habe160 und Ihnen beikommend übersende. Die Singstimmen bitte ich aus der Partitur darüber zu setzen. Als Honorar würde ich mir 12 Louis erbitten. Sie schicken mir wohl von allen dreien, Partituren und Clavierauszug, sowie vom Titel eine Revision.“161 Dem erwähnten Präsidenten Erich
Heinrich Wilhelm Verkenius (1776–1841) war Mendelssohn seit seiner Düsseldorfer Zeit verbunden.162 Verkenius wohnte in Köln und war ab 1821 einflussreiches Mitglied im Comité für die Niederrheinischen Musikfeste. Primär in dieser Funktion war er in Beziehung zu Mendelssohn getreten und die beiden etwa eine Generation auseinanderstehenden Persönlichkeiten waren bald freundschaftlich verbunden.163 Die Ergänzung des lateinischen Textes kann als Zugeständnis an das katholische Umfeld im Rheinland gewertet werden. Doch gerade mit der Vorlage zu dieser zweiten Textunterlegung ergaben sich ungeahnt Schwierigkeiten. Noch bevor das Manuskript von ihm eingereicht wurde, bat Mendelssohn Dr. Hermann Härtel: „[…] da meine Bemühungen bei der Thomasschule vergeblich waren, so bitte ich Sie mir eine lateinische Übersetzung der Lutherschen Worte quaest.164 von Ihrem Freunde zu verschaffen. Die Verse heissen: [folgt Text]“.165 Weiter heißt es in dem Brief: „Der Anfang ‚Da nobis pacem Domine‘ passt vortrefflich, auch zur Musik“,166 außerdem: „Die Hauptsache wäre dass Rhythmus u. Accent genau beibehalten würden […].“167 Da eine Übersetzung so schnell nicht zu beschaffen war, übertrug Mendelssohn selbst – wie bereits bei seinem 115. Psalm – den kurzen Text ins Lateinische und legte ihn dem Brief vom 24. März 1839 bei: „Der lateinische Text erfolgt hiebei.“168 Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass mehr als ein halbes Jahr später – längst war die Ausgabe erschienen – ein Herr Herold169 anlässlich der Leipziger Erstaufführung am 30. Oktober 1839 an Mendelssohn schrieb und daran erinnerte, dass er für Mendelssohn eine Übersetzung anfertigen wollte, die er in dem Schreiben nun mitteilte.170 Ob Mendelssohn auf diese verspätete Hilfestellung reagiert hat, ist unbekannt.
Auf dem Weg zum 21. Niederrheinischen Musikfest, das vom 19. bis 21. Mai 1839 in Düsseldorf stattfand, verbrachte Mendelssohn ab Ende April einige Tage in Frankfurt am Main. Diesem Umstand ist zu verdanken, dass die Nachwelt gut über die weiteren Geschicke der Erstausgabe von „Verleih uns Frieden“ informiert ist, denn alle Absprachen mussten nun auf dem Postweg erfolgen. Anfang Mai ging Mendelssohn zunächst davon aus, dass die Ausgabe bald erscheinen würde. Von Frankfurt aus
158 Brief vom 24. März 1839 an Dr. Hermann Härtel, D-DS, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 6 [Anm. 157], S. 353.
159 Zu den genauen Details siehe den Kritischen Bericht, Inhaltliche Abweichungen der Quelle I
160 Der Klavierauszug war für die Publikation neu aufgeschrieben worden. Zwar hatte Mendelssohn bereits ein solches Arrangement für Rosamunde Mendelssohn zu Weihnachten 1833 angefertigt (siehe den Kritischen Bericht, Quelle D), doch lag dieser Auszug nicht in Leipzig vor und war aufgrund seiner inhaltlichen Abweichungen (siehe Abdruck dieser Fassung im vorliegenden Band) als Stichvorlage nicht geeignet.
161 Brief vom 22. März 1839 an Breitkopf & Härtel, Nachweis s. o. Anm. 157.
162 Zum Verhältnis beider siehe Großmann, Vergangenheit [Anm. 17], S. 218–219.
163 Das in der Korrespondenz mit Breitkopf & Härtel mehrfache Anmahnen, dass Verkenius einen Beleg erhalten sollte, zeigt, wie wichtig Mendelssohn diese persönliche Angelegenheit war.
164 quaest., Abkürzung für quaestionierten = in Rede stehenden, geht zurück auf das lateinische Wort quaestio = Frage.
165 Brief vom 16. März 1839 an Dr. Hermann Härtel, Standort unbekannt. Die Zitate werden im Folgenden nach drei Katalogen wiedergegeben. Dieses Textstück zitiert nach J. Halle, München, Katalog 39 [1907], Nr. 116.
166 Ebd., hier zitiert nach letztem Nachweis des Briefes: J. A. Stargardt, Berlin, Katalog 292, Autographen aus den Gebieten der Musik […] (Mai 1929), Nr. 82.
167 Ebd., hier zitiert nach: Karl Ernst Henrici, Berlin, Auktionskatalog CXXXV, Autographen (25. Juni 1928), Nr. 386. Unterstreichung durch den Herausgeber, im Katalog gesperrt gedruckt.
168 Brief vom 24. März 1839 an Dr. Hermann Härtel, D-DS, s. o. Anm. 158.
169 In Leipzig wirkten zu dieser Zeit laut Leipziger Adreßbuch auf das Jahr 1839 zwei Lehrer dieses Namens: ein Emeritus J. Chr. Herold (S. 65) und ein ohne Vornamen genannter Lehrer, der als „M[agister] Herold“ von der mit der Bürgerschule verbundenen Elementarschule bezeichnet wurde (S. 64). Möglicherweise war es auch der Stadtrat Georg Eduard Herold.
170 Brief vom 30. Oktober 1839 von Herold an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 36, Green Books X-113.
meldete er sich: „Sobald mein ‚Verleih uns Frieden‘ in der SeparatAusgabe mit der Dedication an den Präsidenten Verkenius fertig ist bitte ich Sie demselben ein Exemplar in meinem Namen nach Cöln zuzuschicken.“171 Doch das Antwortschreiben zeigte, dass sich eine Verzögerung ergeben hatte und noch nicht einmal der Werktitel eindeutig festlag: „Wollen Sie wohl die Güte haben, Titel und Dedication des ‚Verleih’ uns Frieden‘ nochmals anzugeben, oder vielmehr – verzeihen Sie die Eile und Unordnung meines Schreibens – nur den Titel (die Dedication finde ich in Ihrem Geehrten vom 22. März), nämlich den eigentlichen Namen des Stücks, – ich glaube ‚Gebet‘ – und soll dieser noch näher bezeichnet werden?“172 Gleichzeitig wurde Mendelssohns Wunsch bestätigt: „Sobald das ‚Verleih’ uns Frieden‘ fertig ist, werden wir nicht verfehlen, Ihrem Auftrag gemäß ein Exemplar an Herrn Verkenius zu senden.“173 Die Rückfrage führte zu einem längeren Brief. Die Schwierigkeiten bei der Beantwortung waren vor allem darin begründet, dass Mendelssohn – immer noch in Frankfurt am Main – die Manuskripte nicht zur Verfügung hatte: „Der Titel nach dem Sie fragen, ist wenn ich nicht irre: Gebet nach Lutherschen Worten für Chor und Orchester componirt und &c &c …… gewidmet von FMB. Die Dedication bitte ich genau wie ich angegeben, auf den Titel zu setzen. Findet sich meine frühere Angabe des Titels noch, und weicht sie von dieser ab, so bitte ich der früheren zu folgen. Ist es noch Zeit so schicken Sie mir vielleicht eine Revision der Separatausgabe so wie des Titels – wo nicht so verlasse ich mich auf die Leipziger Genauigkeit und Correctoren. Novello bei dem das Stück in London erscheint, sagt mir, von dem facsimile der Partitur glaube er mehrere Exempl. in England abzusetzen, wenn Sie ihm welche schicken wollten; ich theile dies pflichtschuldigst mit, obwohl ich nicht weiß ob es Ihnen conveniren kann.“174
Der Londoner Verleger Joseph Alfred Novello (1810–1896) war Anfang März 1839 in einem nicht erhaltenen Schreiben von Mendelssohns Plänen unterrichtet worden. Der Brief war nicht postalisch, sondern durch Ferdinand David (1810–1873) persönlich übermittelt worden.175 Zwei Monate später meldete sich Novello: „I have great pleasure in becoming the purchaser of the english copyright of your prayer for chorus and orch: at the price you name five guinees […].“176 Als Veröffentlichungstermin wurde in dem Brief der 25. Mai 1839 vorgeschlagen. Zwei Tage vorher, am 23. Mai, füllte Mendelssohn – noch in Düsseldorf – die geschäftliche Vereinbarung aus: „Received of Mr. J. A. Novello the sum of five Guinea’s for the English Copy-
right of my ‚Prayer‘ for Chorus in [sic] Orchestra in E flat 3/4“.177 Nichts spricht dafür, dass Mendelssohn Einfluss auf Inhalt oder Gestaltung der englischen Ausgabe genommen hat. Der Herstellungsprozess in Leipzig war mittlerweile in die entscheidende Phase getreten: „Das ‚Verleih’ uns Frieden‘, Partitur und Klavierauszug, erhalten Sie beifolgend zur Revision, und wir werden bedacht seyn, Herrn Novello Exemplare des Autographs zugehen zu lassen. Die von Ihnen eröffnete Reihe ist schon recht ansehnlich angewachsen.“178 Als Postscriptum setzte Breitkopf hinzu: „Um baldgeneigte Remission der Correctur darf ich wohl bitten […].“179 Diesem Wunsch kam Mendelssohn wortwörtlich in Windeseile nach. Denn nicht einmal eine Woche, nachdem Breitkopf die Korrekturen in Leipzig abgeschickt hatte, konnte er sie schon aus Frankfurt zurückschicken: „Die übersandte Correktur erfolgt hiebei zurück. Es waren noch bedeutende Fehler darin, die ich recht sorgfältig verbessern zu lassen bitte.“180 Im September 1839 erkundigte sich Mendelssohn bei Verkenius und machte gleichzeitig einen Vorschlag, das Werk auch für den katholischen Ritus zu nutzen: „Mein ‚Verleih uns Frieden‘ muß hoffentlich schon in Ihren Händen sein; wenigstens höre ich bei Breitkopf & Härtels daß es vor 2 Monaten abgegangen ist. Ich hoffe sie haben auch Stimmen mitgeschickt, sonst will ich sie Ihnen nachliefern; Sie können es vielleicht mal als Graduale oder Offertorium in der Kirche gebrauchen, wenn Ueberfluß an Cellos da ist.“181
Wirken und Nachwirken – Frühe Rezeption
Felix Mendelssohn Bartholdy hat sehr genau ausgewählt, welche seiner Werke er veröffentlichen ließ. Auf die Bedeutung, die der Komponist seinen Stücken zumaß, erlaubt dieses Vorgehen jedoch keinen Rückschluss. Im Gegenteil ist aus vielen Werkgruppen bekannt, dass einzelne ungedruckte Kompositionen durch Abschriften ausgewählten Personen exklusiv zugänglich gemacht wurden und keinesfalls im Verborgenen blieben. Prägnante Beispiele sind das „Tu es Petrus“ MWV A 4, das Sololied „Mein Liebchen, wir saßen zusammmen“ MWV K 91 oder der Männerchor „Abschiedstafel“ MWV G 33. Zu diesem Komplex gehören auch mehrere Choralbearbeitungen. Mendelssohn verschenkte Abschriften und unterstützte gelegentliche Aufführungen. Zudem kam er mit einzelnen Werken noch Jahre später – teils von ungeahnter Seite – in Berührung.
171 Postscriptum zu Brief vom 8. Mai 1839 an Breitkopf & Härtel, D-DS, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 6 [Anm. 157], S. 391.
172 Zweites Postscriptum zu Brief vom 15. Mai 1839 von Breitkopf & Härtel an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-158.
173 Ebd.
174 Brief mit Poststempel vom 30. Mai 1839 an Breitkopf & Härtel, D-DS, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 6 [Anm. 157], S. 393–394, das Zitat S. 394.
175 David erwähnt einen solchen Brief, den er gleich bei seiner Ankunft in London bei J. A. Novello abgegeben habe, in einem Gemeinschaftsbrief mit Ignaz Moscheles vom 13. April 1839 an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-124.
176 Brief vom 9. Mai 1839 von J. Alfred Novello an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-114.
177 Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, MT/2011/149
178 Brief vom 13. Juni 1839 von Breitkopf & Härtel an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-187.
179 Brief vom 13. Juni 1839 von Breitkopf & Härtel, ebd.
180 Brief vom 19. Juni 1839 an Dr. Hermann Härtel, D-DS, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 6 [Anm. 157], S. 415–416, das Zitat S. 416. Im selben Brief bat er zum wiederholten Male um Übersendung von Partitur und Klavierauszug an Verkenius.
181 Brief vom 13. September 1839 an Präsident [E. H. W. Verkenius], Paul Sacher Stiftung, Basel, Sammlung Rudolf Grumbacher, Ref. Nr. 753, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 6 [Anm. 157], S. 466–467, das Zitat S. 466.
Insgesamt acht Werke, die auf der Italienreise entstanden waren, stellte Mendelssohn im November 1831 dem Frankfurter Cäcilien-Verein für Abschriften zur Verfügung. Das Resultat ist ein umfängliches Konvolut, das noch heute in Frankfurt am Main erhalten ist.182 Als besondere Wertschätzung schrieb Mendelssohn sein „Ave Maria“ MWV B 19 höchstpersönlich für J. N. Schelble ab und überreichte es ihm am 17. November 1831. Am selben Tag hatte Mendelssohn noch Zeit für einen Brief: „Wir sind meist zusammen, Abends wird in corpore Musik gemacht, neulich im Cäcilienverein gab Schelble einigen Händel, ein Chor von Mozart, dann ‚es ist der alte Bund‘ von Bach, das himmlisch klang[,] das Credo aus der großen hmoll Messe, und einen Chor von mir. Heut Abend läßt er ‚Ihr werdet weinen und heulen‘ [BWV 103] eine Kirchenmusik von meinen Römischen u.s.w. in einem Extravereine singen […].“183 An diesem Abend, den 17. November 1831, fand auch die Uraufführung von „Verleih uns Frieden“ statt. Tags darauf berichtete Mendelssohn: „Die Feder ist dick vom Stimmenschreiben, gestern hat Schelble ein Paar meiner Römischen Musiken (Verleih uns Frieden ud. Aus tiefer Noth) singen lassen ud. die Stimmen meist selbst copirt, außerdem kam noch vor ‚Du Hirte Israel‘ [BWV 104] eine andre kleine Cantate ‚lieber Gott wenn werd ich sterben‘ [BWV 8], ‚es ist der alte Bund‘ [aus BWV 106], einige Orgelsachen […] und eine freie Phantasie auf Seb. Bachsche Themas. Es war ein erquicklicher Abend.“184 Überschrieben wurde das Schriftstück mit Recept an die Schwestern. Diese ungewöhnliche Bezeichnung ist in einer Reihe zu sehen mit den Nachrichten an den Buchbinder, 185 die Sendungen beigegeben wurden, die nicht mit der Post transportiert wurden. Hier begleitete der Zettel ein Päckchen, das von Friedrich von Savigny (1814–1875) nach Berlin transportiert werden sollte.186 In der Sendung befanden sich u. a. zwei Zeichenbücher,187 die „Nonnenstücke“ und vermutlich auch einige Choralbearbeitungen mit Ausnahme der Partitur von „O Haupt voll Blut und Wunden“, die vom Komponisten selber bis nach London mitgenommen wurde.
Von allen acht Choralbearbeitungen beschäftigte sich Mendelssohn in der Folgezeit am meisten mit „Verleih uns Frieden“.
Das erste Weihnachtsfest nach Antritt seiner Position in Düsseldorf verbrachte Mendelssohn in Bonn, wo er seinen Cousin Georg Benjamin („Benni“) Mendelssohn (1794–1874) und dessen Frau Rosamunde („Rosa“) Ernestine Pauline Mendelssohn, geb. Richter (1804–1883), besuchte. Als Geschenk überreichte Mendelssohn während des Aufenthaltes Ende 1833 einen zu diesem Zweck hergestellten Klavierauszug von „Verleih uns Frieden“. Als sich ein halbes Jahr später in Düsseldorf die Möglichkeit der Aufführung abzeichnete, wandte sich Mendelssohn an seine Familie in Berlin: „O Fanny, wieder ein Auftrag: Rosa hat einen Clavierauszug von meinem: ‚Verleih uns Frieden‘ den ich für sie in Bonn gemacht; wahrscheinlich hat sie ihn auch in Berlin; schreib mir doch daraus die Singstimmen (blos unter einander in Partitur, ohne ClavierAusz.) und schick sie her, etwa in einem Briefe, das Ding ist ja kurz. Ich habe einige Aendrungen in der Stimmführung gemacht, um die mirs zu thun ist.“188
In diesem Zusammenhang übertrug Mendelssohn auch Korrekturen in die Originalpartitur, bevor er das Werk zur Ausschrift von Partitur und Stimmen gab. In Mendelssohns Düsseldorfer Probentagebuch189 sind sieben Proben und Aufführungen von „Verleih uns Frieden“ innerhalb eines Jahres zwischen 15. Juli 1834 und 23. Juni 1835 erwähnt. Gekoppelt wurde das Stück bei den öffentlichen Darbietungen mit der Messe C-Dur von Luigi Cherubini (20. Juli 1834) und Beethovens Messe C-Dur op. 86 sowie mit zwei Bach-Kantaten190 (16. Juni 1835). Aus dieser intensiven Beschäftigung mit seinem Werk wird verständlich, dass sich Mendelssohn ab Herbst 1835 um eine Drucklegung bemühte (siehe Kapitel „Veröffentlichungspläne“).
Die Leipziger Erstaufführung fand im Gewandhaus am 30. Oktober 1839 statt. Die erhaltenen handschriftlichen Stimmen dürften in diesem Kontext entstanden sein.191 Auf dem Programmzettel hieß es schlicht: Gebet von Luther. Gewandhaus-Chronist Alfred Dörffel (1821–1905) kommentierte dies später mit den Worten: „So – ohne Namen des Componisten – ist die Composition bei ihrer erstmaligen Aufführung bezeichnet worden. Man sagte damals, Mendelssohn habe, unab-
182 Siehe Kritischen Bericht, Beschreibung der Sammelhandschrift III.
183 Brief vom 14. und 17. November 1831 an Fanny Hensel (Briefteil vom 17. November), D-B, MA Depos. Berlin 3,5, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 421–422, das Zitat S. 421.
184 Brief vom 18. November 1831 an Fanny Hensel und Rebecka Dirichlet, überschrieben Recept an die Schwestern, The Courtauld Institute of Art, London, Accession no. Ms. 1952.RW.4100.1. Peter Ward Jones (Oxford) verdanke ich den Hinweis auf diese noch ungedruckte Quelle.
185 Siehe oben Formulierungen vom 25. Februar 1831 anlässlich der Sendung von „Vom Himmel hoch“, Anm. 95.
186 Nachgewiesen durch Brief vom 28. Dezember 1831 an Fanny Hensel, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 99–100, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [Anm. 32], S. 442–445. Zu diesem Zeitpunkt wartete Mendelssohn in Paris noch auf eine Nachricht, ob die Sendung Berlin erreicht hätte.
187 Wehner, Bildwerkeverzeichnis [Anm. 57], S. 324–328 (ZB 9 und ZB 10).
188 Brief vom 12. bis 14. Juni 1834 zusammen mit Hermann Franck an Lea Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Familienbriefe, Nr. 202, gedruckt in: Sämtliche Briefe, Bd. 3 [Anm. 31], S. 454–455 (dort datiert 14. Juni 1834), das Zitat ebd. Das Datum wurde mehrfach überschrieben, offensichtlich wurde der Brief am 12. Juni 1834 begonnen, aber nicht an diesem Tag beendet, der Poststempel stammt vom 14. Juni 1834, woraus sich eine Entstehungszeit zwischen 12. und 14. Juni ergibt.
189 Fragmentarisch erhalten, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 49, fols. 15–17, siehe Matthias Wendt, Felix Mendelssohn Bartholdys Düsseldorfer Probenplan Mai 1834 – Juli 1835, in: „Übrigens gefall ich mir prächtig hier“. Felix Mendelssohn Bartholdy in Düsseldorf, hrsg. von Bernd Kortländer (Katalog zur Ausstellung des Heinrich-Heine-Instituts, Düsseldorf, 1. Oktober 2009 bis 10. Januar 2010), Düsseldorf 2009, S. 60–69, mit Übertragungen und ausführlichen Kommentierungen.
190 „Du Hirte Israel, höre“ BWV 104 und „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ BWV 106. Für beide Kantaten hatte Mendelssohn in Hinblick auf eine Aufführung am 29. Juni 1834 eine aufführungspraktische Einrichtung unter Hinzufügung von Klarinetten und Fagotten vorgenommen, siehe Mendelssohn-Werkverzeichnis, S. 500.
191 Siehe den Kritischen Bericht, Quelle O
hängig von seinem Namen, den Eindruck des Stückes auf die Zuhörerversammlung wahrnehmen und letztere auf diese Weise zugleich in Bezug auf die Unbefangenheit ihres Urtheils gewissermaßen auf die Probe stellen wollen.“192 Wie sehr die Komposition den Nerv der Zeit traf, belegt die Rezension von Robert Schumann (1810–1856) in seinem Rückblick auf die Saison: „Eine andere Neuigkeit war ein Gebet ‚Verleih uns Frieden gnädiglich‘ nach Worten von Luther von Mendelssohn, das am Vorabende des Reformationsfestes hier zum erstenmal gehört wurde; eine einzig schöne Composition, von deren Wirkung man sich nach dem bloßen Anblick der Partitur wohl kaum Vorstellung machen kann. Der Componist schrieb sie während seines Aufenthaltes in Rom, dem wir auch einige andere seiner Kirchencompositionen verdanken. […] Das kleine Stück verdient eine Weltberühmtheit und wird sie in der Zukunft erlangen; Madonnen von Raphael und Murillo können nicht lange verborgen bleiben.“193
Zu den 1831 in Frankfurt vom Komponisten gewährten Abschriften gehörte auch „O Haupt voll Blut und Wunden“. Von dieser Frankfurter Partitur wurde ohne Wissen Mendelssohns eine weitere Abschrift angefertigt, wie aus der Korrespondenz zwischen Dr. Eduard Krüger (1808–1885) und Robert Schumann zu erschließen ist.194 Krüger hatte sich aus Frankfurt am Main mehrere Abschriften von Bach-Werken mitbringen lassen und dazu Klavierauszüge angefertigt, die er 1841 mithilfe Schumanns zur Drucklegung in Leipzig anbieten wollte. Darunter befand sich auch eine damals völlig unbekannte Kantate „O Haupt voll Blut und Wunden“. Schumann bekam wenig später Besuch von Mendelssohn und zeigte ihm dabei den neuen Klavierauszug, was zu einer unerwarteten Reaktion führte, wie einem Brief an Krüger zu entnehmen ist: „Ueber das 4te Stück ‚O Haupt voll Blut‘ muß ich Ihnen eine Entdeckung machen. Mendelssohn war gerade bei mir, als ich es von Ihnen erhielt und ihm als einem Bachianer vorlegte. Es gab einen drolligen Auftritt. Mit einem Worte, die Composition ist v o n i h m s e l b s t aus seiner Jugendzeit. Er begriff nicht, wie Sie dazu gekommen sein konnten.“195 Auf die Herkunft seiner Quelle an-
gesprochen, führte Krüger gegenüber Schumann aus: „Ein gewisser Carl Köhl, Sohn eines Schauspielers aus Frankfurt (wenn ich nicht irre), der hier längere Zeit als Clavier- u Zeichenlehrer ansässig gewesen, machte vor 2–3 Jahren eine Reise dorthin u. brachte von da ein Manuscript zurück: […] 2) O Haupt voll Blut u. W., mit der Unterschrift J. S. Bach. Wir bewundern Felix nun doppelt, der den unvergänglichen Meister in der Jugend hat so weit nachahmen können – […].“196 Das Erlebnis muss bei Robert Schumann einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, denn er notierte noch Jahre später in seinen auf Mendelssohn bezogenen Erinnerungen den Satz: „Das Krüger’sche Bachianum und Mendelssohn’s | Gesicht dazu.“197 Vorlage für die Frankfurter Abschrift von „O Haupt voll Blut und Wunden“ war eine noch im September 1830 in Wien angefertigte Partitur, die Mendelssohn zu unbekanntem Zeitpunkt mit einem eigenhändigen Titelblatt versehen und auf seiner Reise bis nach England mitgenommen hatte. Dort schenkte er sie 1832 an Thomas Attwood. Von diesem übernahm Ignaz Moscheles die Handschrift und brachte sie bei seinem Umzug 1846 nach Leipzig an Mendelssohns Wohnort. Diese Partitur – heute in Berlin aufbewahrt – bildete schließlich die Grundlage für eine von Moscheles angeregte Aufführung zu einer 1853 veranstalteten Gedächtnisfeier zum 6. Todestag von Mendelssohn.198 Die verschlungenen Wege dieser Partitur, die mit Fug und Recht zu den weitgereisten Handschriften aus dem Besitz von Mendelssohn gezählt werden kann, führten im 20. Jahrhundert zunächst zurück nach London, von dort nach New York und schließlich Anfang der 1970er Jahre zurück nach Deutschland.199 Ihre Geschichte ist nur ein einzelnes Beispiel für die Schicksale von Handschriften, die gerade im Falle Mendelssohns und speziell auch in dieser Werkgruppe zu einer weltweiten Verstreuung geführt haben.200 Sein Weihnachtslied hatte Mendelssohn 1831 zwar als „lustig“201 eingestuft, aber letztlich nicht ganz überzeugend gefunden, weswegen er es auf seiner weiteren Reise nicht mitnahm, sondern von Rom aus an die Familie schickte. Nach seiner Rückkunft ließ Mendelssohn nach 1835 das Autograph mit zwei weiteren
192 Statistik der Concerte im Saale des Gewandhauses zu Leipzig, Leipzig 1881, S. 40.
193 Musikleben in Leipzig während des Winters 1839–1840, hier zitiert nach: Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Dritter Band, Leipzig 1854, Reprint Leipzig 1985, S. 283–284, ursprünglich in: Neue Zeitschrift für Musik XII/36 (1. Mai 1840), S. 144.
194 Ausführlich wird der im Folgenden verkürzt zusammengefasste Vorgang beleuchtet durch Armin Koch in einem Kommentar in: Robert Schumann. Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy, hrsg. von Gerd Nauhaus und Ingrid Bodsch, Textbearbeitung und Kommentar von Kristin R M. Krahe und Armin Koch, Bonn 2011 (2012), (im Folgenden: Schumann, Erinnerungen an Mendelssohn), S. 87–88 (Anmerkung 57).
195 Brief vom 26. September 1841 von Robert Schumann an Eduard Krüger, Privatbesitz, hier zitiert nach Erstdruck: Robert Schumann’s Briefe. Neue Folge, hrsg. von F. Gustav Jansen, Leipzig 1886, S. 177–178, das Zitat S. 178.
196 Brief vom 17. Oktober 1841 von Eduard Krüger an Robert Schumann, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Korespondencja Roberta Schumanna, Bd. 12, Nr. 2068.
197 Erinnerungen an F. Mendelssohn vom Jahre 1835 bis zu s. Tode. (Materialien), Robert-Schumann-Haus Zwickau, Archivnummer 4871/ V, 3, 1–6, das Zitat im 1. Faszikel, fol. 5r. Diese Originalaufzeichnungen erschienen erstmals 1947 als Faksimile: Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy. Nachgelassene Aufzeichnungen von Robert Schumann, hrsg. vom Städtischen Museum Zwickau (Sachsen), bearbeitet von Georg Eismann, Zwickau 1947, 2., durchgesehene und erweiterte Ausgabe 1948. Mittlerweile liegt ein qualitativ hochwertiges Farbfaksimile vor, siehe: Schumann, Erinnerungen an Mendelssohn [Anm. 194].
198 Entsprechende Notiz von Moscheles auf der Handschrift, vgl. Kritischen Bericht, Beschreibung der Quelle C. Siehe auch Kurzbesprechungen in: Neue Berliner Musikzeitung 7 (1853), Nr. 40 (28. November), S. 318, und Signale für die Musikalische Welt 11 (1853), Nr. 45 (November), S. 357. Das Solo (original für Bariton) wurde von der Konservatoriumsschülerin Auguste Koch aus Bernburg übernommen.
199 Genaue Belege siehe unter Provenienz im Kritischen Bericht, Quelle C
200 Siehe auch Kapitel „Zur Quellenüberlieferung“.
201 Siehe oben Begleitbrief vom 25. Februar 1831 an Rebecka Mendelssohn Bartholdy, Anm. 96.
Abschriften zu einem querformatigen Band für seine Handschriftensammlung zusammenbinden.202 Wenig bekannt ist, dass er dieses Konvolut an den Thomaskantor Moritz Hauptmann (1792–1868) zum Zwecke einer Aufführung auslieh. In einem an versteckter Stelle gedruckten Brief schrieb er Anfang Dezember 1842: „In beifolgendem Buch finden Sie die besprochne Weihnachtsmusik, es ist die dritte. Wenn Sie sie zu Ihrem Zwecke wirklich brauchen können, so sollte mir es eine sehr große Freude sein, und ein curioses Gefühl nach so langer Zeit zum erstenmal das Stück zu hören und zwar bei einer Gelegenheit und an einer Stelle wie ich sie mir damals wohl dachte, aber niemals für erreichbar hielt. Mit Nachsicht waffnen Sie sich aber bis an die Zähne und in keinem Fall lachen Sie mich zu sehr aus.“203 Hauptmann, erst seit kurzem im Amte als Thomaskantor,204 setzte das Werk tatsächlich zu Weihnachten 1842 auf das Programm der Thomaner. Noch am 23. Dezember lud er Mendelssohn zu einer am Folgetag stattfindenden Probe ein: „Wir machen morgen Vormittag eine Orchesterprobe vom Weihnachtslied und möchten Sie natürlich sehr gern dabei haben. Es geht um 10 Uhr an, wenn es Ihnen aber zu früh ist, können wir erst einiges Andres probiren dabei Sie nicht zu sein brauchten. Ich möchte Sie etwas vorbereitet wissen auf den Thomas-Schülerhaften Vortrag des Basssolos. Ich wollte ich könnte es singen, was doch für einen Kantor eigentlich keine unerhörte Forderung sein dürfte, aber ich weiß es nur wie es gesungen werden müßte.“205 Am 25. Dezember 1842 erklang das bis dahin unbekannte Werk schließlich in der Nikolaikirche Leipzig und tags darauf in der Thomaskirche.206 Ob Mendelssohn der Probe oder einer der beiden Aufführungen des Weihnachtsliedes beiwohnte, ist nicht dokumentiert. Zwei Jahre später sind – wiederum am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag – weitere Aufführungen an denselben Orten nachweisbar.207 Das Material dazu wurde noch 1921 in der Notenbibliothek der Thomasschule Leipzig aufbewahrt, ist aber seit der Auslagerung 1944 verschollen.208
Der Band, den Mendelssohn verliehen hatte, kam zurück und wurde 1848 im Zusammenhang mit der Ordnung des Mendelssohnschen Nachlasses im sogenannten „Schleinitz-Katalog“209 als Nachlass-Band 21 gezählt. Ein weiteres Konvolut –Nachlass-Band 23 – wurde nach 1837 eingebunden und enthielt ebenfalls querformatige Handschriften, vornehmlich der Reisejahre 1830 bis 1832. Enthalten war laut autographem Deckeletikett210 neben „Verleih uns Frieden“ auch „Wir glauben all an einen Gott“. Doch als die Mendelssohnschen Erben 1878 die Bände des musikalischen Nachlasses der preußischen Königlichen Bibliothek übereigneten,211 fehlte im Band 23 das Autograph von „Wir glauben all an einen Gott“ – und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Die näheren Umstände hierzu sind durch einige englischsprachige Schriftstücke überliefert, die sich bei Abschriften des Werkes in Oxford erhalten haben212 und wurden 2010, durch weitere Dokumente bereichert, von William A. Little erneut zusammengetragen.213 Demnach hatte Paul MendelssohnBartholdy, jüngerer Bruder und Nachlassverwalter des Komponisten, auf eine entsprechende Anfrage des Bürgermeisters von Bradford, Samuel Smith (1805–1873), ein unbekanntes Mendelssohn-Werk für die Eröffnungsfeierlichkeiten einer noch heute existierenden repräsentativen Konzerthalle, der St. George’s Hall in Bradford, Yorkshire, herausgesucht und das Autograph von „Wir glauben all an einen Gott“ zusammen mit einer Abschrift nach England geschickt. Mit Brief vom 24. Mai 1853 sandte Smith diese Handschriften an William Bartholomew (1793–1867) weiter zwecks Einrichtung einer englischen Textunterlegung.214 Bei dieser Gelegenheit erhielt auch Elizabeth Mounsey (1819–1905) Zugang zu Mendelssohns Autograph und schrieb sich das im Manuskript unmittelbar anschließende Nachspiel D-Dur MWV W 12 ab, da sie als Organistin an diesem Werk interessiert war.
Offiziell wurde die neue Konzerthalle in Bradford, die über 3500 Personen Platz bot, durch Queen Victoria am 31. August
202 Heute Nachlass-Band 21, siehe Kritischen Bericht, Sammelquelle IV.
203 Brief vom 4. Dezember 1842 an Moritz Hauptmann, Standort unbekannt, höchstwahrscheinlich wurde der Brief beim Bombenangriff auf Kassel am 22. Oktober 1943 vernichtet, zitiert nach: La Mara [i.e. Marie Lipsius], Ungedruckte Briefe Mendelssohn’s. Nach den Handschriften mitgetheilt, in: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, Nr. 33 (18. März 1890), S. 130, Brief Nr. 5.
204 Moritz Hauptmann wurde am 12. September 1842 feierlich in das Amt eingeführt, siehe Stefan Altner, Das Thomaskantorat im 19. Jahrhundert. Bewerber und Kandidaten für das Leipziger Thomaskantorat in den Jahren 1842 bis 1918, Leipzig 2007, S. 36.
205 Brief vom 23. Dezember 1842 von Moritz Hauptmann an Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 42, Green Books XVI-189.
206 Leipziger Tageblatt und Anzeiger, Nr. 358 (24. Dezember 1842). Erstmals hat Anselm Hartinger auf die Uraufführung und die folgenden Wiederholungen aufmerksam gemacht, siehe Anselm Hartinger, „Es gilt dem edelsten und erhabensten Theil der Musik“. Felix Mendelssohn Bartholdy, die Thomaner, die Thomaskirche und die Leipziger Stadtkirchenmusik. Neue Dokumente und Überlegungen zu einer unterschätzten Arbeitsbeziehung, in: Mendelssohn-Studien 16 (2009), S. 139–186.
207 Leipziger Tageblatt und Anzeiger, Nr. 359 (24. Dezember 1844).
208 Siehe Kritischen Bericht, Nachweise zu Quelle [D].
209 Zu den verschiedenen Exemplaren dieses Kataloges siehe Ralf Wehner, Das Schicksal des Bandes 43 und weiterer Manuskripte aus dem Nachlass von Felix Mendelssohn Bartholdy, in: Die Tonkunst 3 (2009), Heft 2 (April), S. 189–200 (im Folgenden: Wehner, Schicksal), besonders S. 189–192.
210 Wiedergabe im Kritischen Bericht zu MWV A 12, Quelle [B].
211 Zu diesem Komplex siehe Ralf Wehner, Die Nachlass-Bände und andere Formen der handschriftlichen Überlieferung, Serie XIII, Bd. 1A (2009) dieser Ausgabe, S. XIII–XV.
212 Siehe Kritischen Bericht, Quellen D und E
213 Wm. A. Little, A Minor Mendelssohnian Mystery: The Curious Case of the ‚Credo‘ and the ‚Nachspiel‘, in: Journal of Musicological Research 29 (2010), Nr. 2–3, S. 148–158 (im Folgenden: Little, Mendelssohnian Mystery).
214 Eine Abschrift des Briefes durch Elizabeth Mounsey hat sich erhalten, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 51, fols. 65–66. Teilzitat siehe unten.
1853 eingeweiht.215 Unter der musikalischen Gesamtleitung von Michael Costa (1808–1884) folgte ein dreitägiges Musikfest, auf welchem Werke von Mendelssohn einen Schwerpunkt bildeten. Ein speziell zur Eröffnung des Hauses zusammengestellter Chor von 200 Sängerinnen und Sängern – aus ihm bildete sich später die noch heute agierende Bradford Festival Choral Society –übernahm die chorischen Gesangspartien in den vokal-instrumentalen Werken des Festivals. Neben dem Paulus zur Eröffnung erklangen auch die Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 MWV N 18, die sogenannte „Schottische“, das Finale des erst ein Jahr zuvor publizierten Opernfragments Die Lorelei MWV L 7, die Schauspielmusik zu Ein Sommernachtstraum op. 61 MWV M 13 und schließlich das neue Werk „Wir glauben all an einen Gott“, in der zeitgenössischen Presse durchweg als „Credo“ betitelt.216 Es eröffnete das Morgenkonzert des letzten Festivaltages (2. September 1853), gefolgt von größeren Ausschnitten aus Haydns Oratorium Die Schöpfung und Händels Israel in Ägypten. „The Bradford Musical Festival has terminated as it began – triumphantly.“, lobte enthusiastisch der extra nach Bradford gereiste Rezensent der Musical World, der sich mit einer ausgiebigen Besprechung des Festes zu Wort meldete217 und auch näher auf das neue Stück einging: „The ‚Credo‘ being an unknown work, its composer, from whose pen every fragment that now can be traced is eagerly looked for, excited the greatest curiosity and interest. Luckily it opened the performance, which leaves time to say a few words about it. According to the books, ‚it was presented to the Festival Committee by the representatives of the late composer.‘ For ‚presented‘ it may be presumed ‚lent‘ should be substituted, since it cannot be supposed for an instant that so fine a work should remain in manuscript, lost to the numberless admirers of Mendelssohn’s genius. We believe it was in the Sistine Chapel at Rome that Mendelssohn was inspired with the idea of writing this ‚Credo;‘ and if such be the case, it must be an earlier work than was supposed.“218 Die Reaktion, die das Werk beim Publikum hervorrief, zeugte vor allem von der hohen Wertschätzung, die Mendelssohn in England, zumal sechs Jahre nach seinem Tod, noch immer genoss: „The impression produced upon the audience (among whom were observed some relatives219 of the composer) was deep and serious; and a conviction that another noble contribution to the treasures of the art, from the pen of one who had already given so much, was unanimous among those most capable of appreciating it.“220
Ob die Handschrift wirklich, wie bereits in der Rezension angemerkt, geschenkt oder nur geliehen war, muss offenbleiben. Samuel Smith schrieb jedenfalls unmittelbar nach Empfang der
Berliner Sendung an den Übersetzer: „I have this moment the honour to recieve [sic] from Mr Paul Mendelssohn of Berlin a Copy Mss. of an unpublished composition by the late Felix Mendelssohn & which has been presented to the Committee of the opening Festival of St George’s Hall Bradford by the family & representatives of the composer.“221 Letztlich ist nur ein Faktum sicher verbürgt: William Bartholomew hat die ihm zur Übersetzung überlassenen Mendelssohn-Handschriften zurück nach Bradford geschickt, wo sie Grundlage für die Uraufführung des Stückes am 2. September 1853 bildeten. Seither verliert sich jede Spur, und William A. Little konnte 2010 vermuten: „Possibly, it is hidden away in some dusty attic in Bradford …“222 .
Die Choralbearbeitungen weisen einige Merkmale auf, die für die Überlieferung Mendelssohnscher Werke allgemein gelten. Charakteristisch sind ein hoher Grad an Verstreuung an viele Orte, eine partielle Auslagerung von Bibliotheksbeständen im Zweiten Weltkrieg sowie die Aufbewahrung in Privatbesitz, mit denen eine oft jahrzehntelange Ungewissheit über den Standort einzelner Handschriften einhergeht. Im Speziellen kann ein hoher Anteil an Abschriften von der Hand unbekannter Kopisten festgehalten werden. Zudem spielen besonders im Falle von „Verleih uns Frieden“ Fassungen und Klavierarrangements eine Rolle. Durch die geringe Zahl an Werken ist die Lage dennoch übersichtlich. Drei Bibliotheken in Berlin, Darmstadt und Frankfurt am Main stehen im Zentrum der Überlieferung mit jeweils drei oder mehr relevanten Quellen. Einzelne Handschriften werden in Basel, Chicago, Leeds, Leipzig, New Haven, Oxford, Paris und Washington, D.C. aufbewahrt. Als wichtiger Komplex ist zunächst Mendelssohns musikalischer Nachlass zu nennen, der 1878 dem preußischen Staat von den vier Mendelssohn-Kindern zur Aufbewahrung übergeben wurde. Hier haben sich die 1831 in Rom aufgeschriebenen Partituren des Weihnachtsliedes MWV A 10 und von „Verleih uns Frieden“ MWV A 11 erhalten. Das Autograph von „Wir glauben all an einen Gott“ MWV A 12 befand sich ebenfalls in dem Bestand, ging aber bereits 1853 verloren. Zwei weitere Stücke bewahrte Mendelssohn nur in Abschriften auf: „Christe, du Lamm Gottes“ MWV A 5 und „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ MWV A 13. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese Bände von der Bibliothek ausgelagert und gelangten im Sommer 1943
215 Siehe Opening of St. George’s Hall, in: The Bradford Observer 20 (1853), Nr. 1018 (1. September), S. 5–6. Eine zeitgenössische Abbildung des neuen Gebäudes mit einem Bericht über das Festival in: The Illustrated London News 23 (1853), Nr. 642 (3. September), S. 193.
216 Eine Voranzeige des Festivalprogramms erschien auch überregional in verschiedenen Zeitungen, zum Beispiel: The Athenaeum, Nr. 1346 vom 13. August 1853, S. 954, oder: The Literary Gazette, Nr. 1909 vom 20. August 1853, S. 824. Berichte über das Festival erreichten sogar das Ausland, siehe die in New York erscheinende Zeitung The Musical Review and Choral Advocate 4 (1853), Nr. 11 (November), S. 165–166.
217 Anon., The Bradford Musical Festival, in: The Musical World XXXI (1853), Nr. 37 (10. September), S. 577–582, das Zitat S. 580.
218 Ebd., S. 580, dem zitierten Ausschnitt folgte eine kurze analytische Beschreibung des Werkes.
219 Nach Forschungen von Rosemary Cole war Alexander Mendelssohn (1798–1871) anwesend, gemäß Little, Mendelssohnian Mystery [Anm. 213], S. 153.
220 The Musical World XXXI (1853), Nr. 37 (10. September), S. 580.
221 Brief vom 24. Mai 1853 von Samuel Smith an William Bartholomew, Standort unbekannt, zitiert nach Abschrift in: GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 51, fols. 65–66, das Zitat fol. 65r.
222 Little, Mendelssohnian Mystery [Anm. 213], S. 155.
mit 36 weiteren Mendelssohn-Bänden bzw. Bestandseinheiten223 zunächst nach Pommern auf das Schloss Altmarrin (Kreis Kolberg). Im Februar 1945 verbrannte dieses Depot. Die Mendelssohn-Handschriften befanden sich jedoch glücklicherweise in jenen Kisten, die unmittelbar vorher – buchstäblich in letzter Minute – nach Berlin zurückgebracht werden konnten. Dort wurden die Bestände eiligst auf einen Lastkahn verladen, der nach zwölftägiger Reise auf den Wasserstraßen Brandenburgs den Zielort Schönebeck an der Elbe erreichte. Dort erfolgte die Einlagerung in einen 440 Meter unter der Erdoberfläche liegenden Bergwerksstollen, den sogenannten „GrafMoltke-Schacht“. Im Sommer 1946 kam es dann zur Rückführung an den alten Standort Berlin (Unter den Linden), nachdem die Idee verworfen wurde, die in diesem Depot gelagerten Bestände der Staatsbibliothek als Reparationsleistung in die Sowjetunion zu transportieren.224 Von Kriegseinwirkungen war auch die Stadt Frankfurt am Main schwer getroffen. Ein Komplex von Mendelssohn-Chorwerken blieb allerdings in einem – ebenfalls verlagerten225 und deshalb geretteten – Teil des historischen Archivs des Frankfurter Cäcilien-Vereins erhalten, also einer Institution, der Mendelssohn das Abschreiben noch vor der Drucklegung erlaubt hatte. Auf diese Weise sind bestimmte Fassungen überliefert, die den Zustand der in Wien und Rom geschriebenen Werke eindeutig fixieren. Bisweilen sind dies Fassungen, die von der späteren Drucklegung der Werke abweichen. Zudem hatte J. N. Schelble, der Leiter des Chores, die autographe Partitur von „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ geschenkt bekommen, was den Frankfurter Bestand zusätzlich aufwertete. Ein weiterer bedeutender Teil steht in Zusammenhang mit dem Sänger Franz Hauser, dessen Bibliothek zwar insgesamt zerstreut und Ende des Zweiten Weltkrieges ebenfalls erheblich dezimiert wurde,226 in dessen überlieferten Mendelssohn-Quellen aber immerhin drei für unseren Zusammenhang maßgebliche Werke erhalten blieben, über deren genaue Vorprovenienz allerdings keine gesicherten Kenntnisse vorliegen. Von besonderem Wert wäre dabei die Beantwortung der Frage, bei welcher Gelegenheit Hauser – ob noch zu Lebzeiten des Komponisten oder nicht – in den Besitz der Sammelhandschrift von zwei Werken kam, die auf einem Titelblatt in italienischer Sprache als Cantata bzw. Cantate bezeichnet sind.227 Diese Frage könnte unter anderem mit der Identifizierung des Notenschreibers beantwortet werden, die bisher nicht gelungen ist.
Generell ist in dieser Werkgruppe die relativ hohe Zahl an namentlich unbekannten Kopisten auffällig, was weniger mit der Werkgruppe an sich als mit den Verwendungszwecken und Entstehungsorten der Abschriften zusammenhängt. Von den acht Werken sind zusammen 20 Abschriften in Partitur und Stimmen bekannt oder nachweisbar. Nicht mitgezählt sind dabei Abschriften aus dem 19. Jahrhundert, die keinen direkten Bezug zum Leben des Komponisten aufweisen und deshalb im vorliegenden Band keine nähere Berücksichtigung finden können.228 Der Anteil ist zwar gering im Verhältnis zu anderen Komponisten etwa des 18. Jahrhunderts, deren Werke primär in Abschriften überliefert sind. Für das Gesamtschaffen von Mendelssohn aber ist die Situation ungewohnt. Denn die Überlieferung wird hier im Allgemeinen wesentlich von autographen Quellentypen verschiedenster Art und autorisierten oder nichtautorisierten Abschriften geprägt, deren philologischer Wert sehr unterschiedlich sein kann.229 Für die Abschriften arbeitete Mendelssohn an bestimmten biographischen Stationen seines Lebens mit professionellen Kopisten, d. h. als Kopisten tätigen Berufsmusikern, zusammen, die mit Mendelssohns Handschrift vertraut waren. In Leipzig waren diese Eduard Henschke (1805–1854) und Friedrich Louis Weissenborn (1813–1862), die den Hauptteil der Abschriften herstellten; in Düsseldorf nahm diese Position Johann Gottlieb Schauseil (1804–1877) ein. Für die Choralbearbeitungen stellt sich die Situation wie folgt dar: Mehrere Kopisten wirkten jeweils in Berlin und Frankfurt, mit einzelnen Abschriften vertreten sind Kopisten aus Düsseldorf, Leipzig und Wien. Namentlich bekannte Berufskopisten sind lediglich der bereits erwähnte J. G. Schauseil, einer von Mendelssohns Hauptkopisten in Düsseldorf, sowie Carl Wilhelm von Inten (1799–1877) in Leipzig. Beide sind in Zusammenhang mit Aufführungsmaterialien von „Verleih uns Frieden“ zu nennen. Dazu kommen – allerdings nicht überlieferte – Stimmen von der Frankfurter Uraufführung, die vorwiegend von J. N. Schelble, zum Teil auch von Mendelssohn selbst aus der Partitur gezogen wurden. Ob die mit A. Schirmer bezeichnete Partitur von „Wir glauben all an einen Gott“, die 1853 nach England geschickt wurde, ebenso zu diesem Zeitpunkt und zum Anlass der geplanten Aufführung entstand oder schon vorlag, ist ebenso ungewiss. Theoretisch kann sie in den 1840er Jahren entstanden sein, da Schirmer zu dieser Zeit bereits als Chorist und Notenschreiber in Berlin wirkte.230 Die besonderen editorischen Herausforderungen er-
223 Genaue Aufschlüsselung im Mendelssohn-Werkverzeichnis, S. XVI.
224 Nähere Informationen zu dieser Thematik und Literaturhinweise ebd.
225 Franz Fischer, Die Freiherrlich Carl von Rothschildsche Bibliothek (Bibliothek für neuere Sprachen und Musik) 1928–1945, in: Die Rothschild’sche Bibliothek in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1988 (= Frankfurter Bibliotheksschriften; Bd. 2), S. 68–100, zur Auslagerung nach Oberfranken insbesondere S. 92–93.
226 Das Franz-Hauser-Archiv verbrannte zu großen Teilen im Februar 1945 in Weinheim an der Bergstraße, siehe Karl Anton, Neue Erkenntnisse zur Geschichte der Bachbewegung, in: Bach-Jahrbuch 42 (1955), S. 9. Höchstwahrscheinlich wurden dabei auch die Originalbriefe von Mendelssohn an Hauser vernichtet. Ein Teil der Kompositionen dagegen überstand den Feuersturm.
227 Zu den genauen Formulierungen siehe Beschreibung von Sammelhandschrift I.
228 Das Répertoire Internationale des Sources Musicales (RISM) weist etliche Partituren und Stimmenmaterialien aus diesem Bereich nach.
229 Zur Funktionalität dieser und weiterer Quellengruppen siehe Thomas Schmidt, Von der Skizze zum Druck, in: Mendelssohn Handbuch, hrsg. von Christiane Wiesenfeldt, Kassel und Berlin 2020, S. 104–123.
230 Der Notenschreiber A. Schirmer aus der Taubenstraße 17 ist bereits 1844 im Berliner Adressbuch nachweisbar, Berufsbezeichnung dort: „Chorsänger beim Königl. Theater u. Notenschreiber“, siehe Allgemeiner Wohnungsanzeiger für Berlin, Charlottenburg und Umgebungen auf das Jahr 1844, 23. Jg., Berlin 1844, S. 406.
wuchsen in diesem Band vor allem aus den vielen Differenzen, die die Abschriften zu einem Werk untereinander oder in Hinblick auf autographe Quellen aufwiesen.231
Zu den mit der Überlieferung von Choralbearbeitungen verbundenen Grundfragen gehört auch das Phänomen des jahrzehntelangen Privatbesitzes. Das betraf zum Beispiel die autographe Partitur von „Jesu, meine Freude“. Diese hatte Mendelssohn 1836 zusammen mit einem Konvolut, das 1848 als Nachlass-Band 43 gelistet und später eine vollständige Verstreuung erfahren musste, an Heinrich Conrad Schleinitz gegeben,232 aus dessen Nachlass sie 1882 versteigert wurde, weitere acht Jahrzehnte in unbekanntem Privatbesitz verblieb und erst 1962 nach einer weiteren Auktion – wie oben erwähnt –von einer amerikanischen Bibliothek erworben wurde. Eine von Mendelssohn 1829 in England verschenkte Abschrift von „Christe, du Lamm Gottes“ konnte 1872 der Sammler William Thomas Freemantle (1849–1931) erwerben.233 Nach mehr als fünf Jahrzehnten in seinem Besitz gelangte sie über einen Zwischenbesitzer in die Leeds University Library. Noch länger war eine Abschrift von „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ unzugänglich, die noch im Mendelssohn-Werkverzeichnis 2009 mit unbekanntem Standort benannt werden musste. Von dieser Abschrift – 1942 das letzte Mal nachgewiesen234 – war noch nicht einmal bekannt, ob sie den Zweiten Weltkrieg überdauert hatte. Im Zuge erneuter Recherchen bei der Vorbereitung dieses Bandes konnte diese Quelle für die Mendelssohn-Forschung erstmals nutzbar gemacht werden. Weiterhin fehlen die autographen Vorlagen zu drei Werken: „Christe, du Lamm Gottes“, „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und „Wir glauben all an einen Gott“. Rein theoretisch könnten sich alle drei Handschriften im Besitz der weitverzweigten Familie Mendelssohn befinden, sind doch die letzten Nachweise – die allerdings durchweg aus dem 19. Jahrhundert stammen – mit der Familie des Komponisten verbunden. Das erstgenannte Werk wurde 1835 in Berlin von einer Partitur abgeschrieben, die Mendelssohn 1827 seiner älteren Schwester geschenkt hatte. Nach dem Tod Fanny Hensels verblieb deren Sammlung bei ihrem Witwer Wilhelm Hensel (1794–1861) und dem Sohn Sebastian Hensel (1830–1898). Ob „Christe, du Lamm Gottes“ oder „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ dabei war, entzieht sich unserer Kenntnis, denn als viersätziges Werk war letzteres für eine konzertante Aufführung eher geeignet als einsätzige Choralchorsätze wie „Christe, du Lamm Gottes“ oder „Jesu, meine Freude“. Folgerichtig befand sich eine Partitur im Gepäck Mendelssohns, als dieser 1829 nach England reiste. Dass es sich dabei um eine Abschrift handelte, wird durch den Quellenbefund bestätigt, denn jene Partitur, die Mendelssohn an Charles Neate verschenkte, wird mittlerweile in Leeds aufbewahrt. In Berlin muss also das Autograph verblie-
ben sein, das auch die Vorlage für eine weitere Abschrift bildete, die zu unbekanntem Zeitpunkt vorgenommen wurde und heute als Teil des Hauser-Nachlasses in Darmstadt liegt. Mendelssohns 1835 gegenüber Franz Hauser geäußerte Begeisterung für die gleichnamige Bach-Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, verbunden mit der Mitteilung, dass er den Text früher auch selbst vertont habe, lässt zumindest den Schluss zu, dass Hauser zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von Mendelssohns Werk haben konnte, da die Formulierung in dem Brief sonst anders ausgefallen wäre. Die Abschrift aus Hausers Nachlass muss also später entstanden sein. Ob sie auf Veranlassung von Mendelssohn noch zu dessen Lebzeiten oder erst als Erinnerung an ihn nach dessen Tod angefertigt wurde, konnte nicht ermittelt werden.
Von den zuletzt erwähnten Kompositionen, die nur noch abschriftlich erhalten sind, wurde lediglich das letzte Werk „Wir glauben all an einen Gott“ 1848 im Nachlass-Verzeichnis, dem „Schleinitz-Katalog“235, benannt. Es befand sich damals im Band 23. 1853 wurde diese autographe Partitur für eine Aufführung nach England verliehen (siehe vorangegangenes Kapitel), augenscheinlich aber dem Band nicht wieder zurückgeführt und demzufolge auch 1878 nicht der Königlichen Bibliothek überlassen.
Mit dem letztgenannten Werk ist ein weiteres Rätsel verbunden, das mit einem bereits erwähnten Orgelstück zusammenhängt. Im unmittelbaren Anschluss an „Wir glauben all an einen Gott“ notierte Mendelssohn – offensichtlich auf der folgenden Seite beginnend – ein Nachspiel D-Dur MWV W 12. Diese Nähe im Manuskript sorgte zunächst dafür, dass der Frankfurter Kopist 1831 das Orgelstück zusammen mit der Choralbearbeitung notierte. Offenbar hing das Nachspiel auch physisch mit dem Autograph des Chorals zusammen, da es sonst nicht 1853 nach Bradford geschickt worden wäre. Gelegentlich wird deshalb diskutiert, ob das Nachspiel ein Postludium zum Choral oder ein eigenständiges Werk gewesen sein könnte bzw. ein Zusammenhang mit einem anderen Werk besteht.236 Da diese Frage nicht endgültig zu klären ist und das Orgelstück in dieser Ausgabe bereits vorliegt,237 wurde auf einen erneuten Abdruck verzichtet.
Dem Herausgeber wurde bei der Vorbereitung dieses Bandes von mehreren Seiten Unterstützung zuteil. Der erste Dank geht an diejenigen Bibliotheken, die die Einsicht und Auswertung ihrer Bestände erlaubten und Reproduktionen ausgewählter Seiten gestatteten: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Universitäts-
231 Näheres jeweils unter den Textkritischen Anmerkungen im Kritischen Bericht zu den einzelnen Kompositionen.
232 Siehe Wehner, Schicksal [Anm. 209], mit Datierungsbelegen auf S. 195.
233 Ralf Wehner, „There is probably no better living authority on Mendelssohn’s Autograph.“ W. T. Freemantle und seine Mendelssohn-Sammlung, in: Mendelssohn-Studien 16 (2009), S. 333–369.
234 Nachweis siehe Kritischer Bericht zu MWV A 7, Quelle B
235 Siehe Wehner, Schicksal [Anm. 209].
236 Zuletzt 2010 in: Little, Mendelssohnian Mystery [Anm. 213].
237 Siehe Serie IV, Band 7 (2004), dieser Ausgabe. Dort auf S. 139–140 auch Abdruck der Dokumente zur Aufführung in Bradford 1853.
bibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main und Georgetown University, Washington, D.C. Zusammen mit den in der Einleitung zitierten Dokumenten stammen die Handschriften aus sechs Ländern mit folgenden Bibliotheken: Basel (Paul Sacher Stiftung); Chicago (The Newberry Library); Düsseldorf (Heinrich-Heine-Institut); Kraków (Biblioteka Jagiellońska); Leeds (University Library, Brotherton Collection); Leipzig (Stadtgeschichtliches Museum); London (The British Library, The Courtauld Institute of Art); New Haven (Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University); New York (Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and Tilden Foundations sowie The
Morgan Library & Museum); Oxford (Bodleian Library, University of Oxford); Paris (Bibliothèque nationale de France) und Zwickau (Robert-Schumann-Haus). Darüber hinaus trugen Birgit Müller, Christiane Wiesenfeldt, Thomas Schmidt und Tobias Bauer in konstruktiver Weise zum Gelingen des Bandes bei. Ein besonderer Dank für wertvolle Hilfe in Zusammenhang mit der Auffindung der Abschrift zu „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ gilt Kevin Delinger vom Booth Family Center for Special Collections der Georgetown University Library.
Leipzig, den 15. Januar 2022
Ralf Wehner
Throughout his life, Felix Mendelssohn Bartholdy was fascinated with Protestant chorales. The setting of chorale melodies was an integral part of the rigorous training he received under the tutelage of Carl Friedrich Zelter (1758–1832).1 From his time with Zelter (1819/1820) to the composition of the oratorio fragment Erde, Hölle und Himmel 2 (1847), references to Protestant hymns can be found at almost every step of the way and in a number different genres. The prevalence of chorales in Mendelssohn’s work was founded upon a lofty ethos cultivated in the family, one instilled in him by his father, Abraham Mendelssohn Bartholdy (1776–1835), with the following cautionary advice in 1835: “The chorale should never be taken lightly […]”.3 This admonition came relatively late, however, as Felix Mendelssohn Bartholdy’s had by then already implemented the topos in an unparalleled variety of ways. Mendelssohn always approached the chorale with respect but without any trace of dogma, breathing new life into the form with respect to several of its facets. Here, the chorales attributed to Martin Luther played a special role. Mendelssohn’s use of chorales ranged from allusive quotations and simple chordal harmonizations to eight-part motets and the magnificent choruses in the oratorio St. Paul MWV A 14 or in the symphony-cantata Lobgesang MWV A 18; from instrumental chorale settings and fantasies for piano or organ to the final movement of the Symphony in D minor MWV N 15, the so-called “Reformation Symphony”. It should not go unmentioned that Mendelssohn also composed chorale-like hymns for congregational singing for the Anglican Church, the French Reformed Church,4 and the Protestant Reformed Church of the Swiss Canton of Aargau.5 A fine example of his artistic approach to the Catholic sequence is the Lauda Sion MWV A 24.6 Looking purely at the scoring, the vocal-instrumental arrangements also include the German Te Deum and the chorale settings for the Berliner Domchor [Berlin Cathedral Choir] (1843), which
have already been presented in this edition in a different context.7
This volume deals with one specific segment of this artistic appropriation. The focus is on chorale arrangements for chorus and orchestra, with or without solo voices, which Mendelssohn worked on between 1827 and 1832. This group of works long represented one of the least known segments of Mendelssohn’s œuvre, a circumstance that had to do both with the transmission of sources and the fact that Mendelssohn only had one of these compositions published. Thus, it remained largely unknown into the 20th century that he had composed several large-scale chorale arrangements. Mendelssohn composed these works –whose designation as “choral cantatas” in the secondary literature is as pragmatic as it is problematic – within a short but biographically significant timespan. He was 18 when he composed the first of these works and 23 when he composed the last. Five were written during the extensive educational journey that took him through Austria and Italy to France and England between 1830 and 1832. Mendelssohn was more self-critical with these works than with his later psalm cantatas, having four out of five of the latter8 but only one of the chorale arrangements published, “Verleih uns Frieden” MWV A 11. This work occupies a unique position within the group, as the chorale serves only as a textual and not as a musical basis. Before going into more detail about the origins and source history of the individual pieces (an initial inventory is provided in Table I), it is worth taking a look at the various treatments of the compositions in the secondary literature, which, in comparison to other compositional areas, has played a significant role in drawing attention to the set of works. Editions, performances, and accompanying scholarly publications have provided each other with mutual impulses, the result being that this work group is now one of the better-known subdomains of Felix Mendelssohn Bartholdy’s œuvre, despite some unresolved questions.
1 The first chorale settings are found in a workbook Mendelssohn used while studying with Zelter, Bodleian Library, University of Oxford (hereafter: GB-Ob), MS. M. Deneke Mendelssohn c. 43. An edition of the workbook with commentary is found in: R. Larry Todd, Mendelssohn’s Musical Education. A Study and Edition of his Exercises in Composition. Oxford, Bodleian MS Margaret Deneke Mendelssohn C. 43, Cambridge, 1983 (Cambridge Studies in Music); an overview of the chorales contained in the workbook can be found in the Thematic-Systematic Catalogue of the Musical Works (MWV) under MWV Z 1.
2 MWV A 26, the fragment was printed in 1852 under the title “Christus” with the posthumous opus number 97. For work titles according to the Mendelssohn Thematic Catalogue (MWV), see Series XIII, Volume 1A (2009) of this edition.
3 Since its publication in 1863, the letter from which this quotation was taken has been dated March 10, 1835, see Briefe aus den Jahren 1833 bis 1847 von Felix Mendelssohn Bartholdy, ed. by Paul and Carl Mendelssohn Bartholdy, Leipzig, 1863, p. 84. However, the original letter (GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 34, fols. 35–38b) does not provide a month or year, and is simply dated 28 and 30.
4 Psalm 5 “Lord, hear the voice of my complaint” MWV B 31, Psalm 31 “Defend me, Lord, from shame” MWV B 32, Cantique pour l’Église Wallone de Francfort “Venez et chantez” MWV B 56.
5 “Tag des Zorns, Gericht der Sünden” MWV B 43, see Ralf Wehner, “… ich sehe sie nun zugleich alle durch und lerne sie kennen …” Felix Mendelssohn Bartholdy und die wirklich alte Musik, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis XXI (1997), pp. 101–127, especially pp. 116–120.
6 See Series VI, Volume 6 (2014) of this edition.
7 Ibid. This applies to the chorales “Herr Gott, dich loben wir” MWV A 20, “Allein Gott in der Höh sei Ehr” MWV A 21, and “Vom Himmel hoch, da komm ich her” MWV A 22.
8 Psalm 42, 95, 114, and 115, see MWV A 15, A 16, A 17, and A 9. Only Psalm 98 MWV A 23 remained unpublished until 1851. These works were composed in 1830 and between 1837 and 1843, which means that, with the exception of Psalm 115, all were composed after the chorale arrangements.
MWV Chorale
Original Designation Text Author Date, Location First published
A 5 Christe, du Lamm Gottes Choral
A 6 Jesu, meine Freude Choral
A 7 Wer nur den lieben Gott lässt walten Choral
A 8 O Haupt voll Blut und Wunden Choral
A 10 Vom Himmel hoch, da komm ich her Weihnachtslied
A 11 Verleih uns Frieden gnädiglich Choral/Gebet
A 12 Wir glauben all an einen Gott Choral
A 13 Ach Gott, vom Himmel sieh darein Choral
Martin Luther for Christmas Eve 1827, Berlin 1978
Johann Franck 01/22/1828, Berlin 1972
Georg Neumark / Israel Clauder [1828–1829], Berlin 1976
Paul Gerhardt 09/12/1830, Vienna 1973
Martin Luther 01/28/1831, Rome 1985
Martin Luther 02/10/1831, Rome 1839
Martin Luther 03/01/1831, Rome 1980
Martin Luther 04/05/1832, Paris 1972
the original manuscripts of three compositions and the piano arrangement of “O Haupt voll Blut und Wunden” are still unknown. Research on this group of works did not gain impetus until the 1960s and 1970s. In 1958, Georg Feder first drew attention to the forgotten pieces in a widely circulated reference work.13 The chorale “Jesu, meine Freude” then became available to the public in 1962, 80 years after the last piece of evidence regarding its location.14 The score was offered for sale and acquired by the Newberry Library, Chicago, which also published it as a facsimile.15 The first printed edition followed in 1972.16 One year later, Oswald Bill drew attention to the fact that the music archive of the singer Franz Hauser17 (1794–1870), a close friend of Mendelssohn’s, had been preserved in the Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, at least in part, since 1957.18 The inventory there included three large-scale chorale arrangements, one of which, “Wer nur den lieben Gott Table I Overview of
Although Rudolf Werner emphatically drew attention in 1930 to what he called the “chorale cantatas” in his groundbreaking dissertation on Felix Mendelssohn Bartholdy’s church music9 –Werner had access to six of the works discussed here10 – it would take another fifty years for any real reception of these pieces to begin. Between 1972 and 1985, the compositions were rediscovered and successively published, inspiring a number of scholarly works. The latter included a number of essays and two major monographs, a source-oriented study by Pietro Zappalà11 and a dissertation by Ulrich Wüster,12 which focused on structural analyses and reception aesthetics. Both authors were able to draw upon eight works, which was hardly a matter of course at the time considering the fact that individual pieces had been considered lost for many decades. To this day, the locations of
9 Rudolf Werner, Felix Mendelssohn Bartholdy als Kirchenmusiker, Frankfurt am Main, 1930 (= Veröffentlichungen der Deutschen Musikgesellschaft Ortsgruppe Frankfurt a. M.; 2).
10 In the section of his dissertation entitled “Works of maturity”, Rudolf Werner dealt with the five works based on a cantus firmus, see ibid. chapter “c) Choral cantatas” (pp. 65–76). The sixth piece, “Verleih uns Frieden”, was dealt with separately on pp. 52–53. The compositions “Wer nur den lieben Gott lässt walten” and “Jesu, meine Freude” were not available at the time.
11 Pietro Zappalà, Le «Choralkantaten» di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Venezia, 1991 (= Collezione di tesi Universitarie; Series IV, 2) (also Tesi di Laurea, Pavia, 1985), hereafter: Zappalà, Choralkantaten.
12 Ulrich Wüster, Felix Mendelssohn Bartholdys Choralkantaten. Gestalt und Idee. Versuch einer historisch-kritischen Interpretation, Frankfurt a. M., Bern etc., 1996 (= Bonner Schriften zur Musikwissenschaft; 1), (also Diss. Bonn 1993), hereafter: Wüster, Choralkantaten.
13 Georg Feder, Die protestantische Kirchenkantate, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, ed. by Friedrich Blume, vol. 7, Kassel, 1958, cols. 581–608 (hereafter: Feder, Kirchenkantate). Feder used the first page of the autograph score of “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” as an illustration, ibid., cols. 605–606.
14 List & Francke, Leipzig, Catalogue d’une très précieuse collection de manuscrits et lettres autographes (June 12, 1882, Schleinitz Estate), in no. 21.
15 Jesu, meine Freude By Felix Mendelssohn-Bartholdy. A facsimile of the composer’s autograph now in The Newberry Library, with an introduction by Oswald Jonas. Published for members of The Newberry Library Associates, Chicago, 1966.
16 In the Mendelssohn Year 1972, “Jesu, meine Freude” and “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” were published in Hilversum, both ed. by Brian W. Pritchard.
17 A fundamental study on this topic is still: Yoshitake Kobayashi, Franz Hauser und seine Bach-Handschriftensammlung, Diss. Göttingen, 1973; for a consideration specifically of Mendelssohn’s relationship with Hauser, see Susanna Großmann-Vendrey, Felix Mendelssohn Bartholdy und die Musik der Vergangenheit (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts; Band 17), (hereafter: Großmann, Vergangenheit), especially pp. 206–214.
18 Oswald Bill, Unbekannte Mendelssohn-Handschriften in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, in: Die Musikforschung 26 (1973), issue 3, pp. 345–349.
lässt walten”, was previously completely unknown. In the following years up until 1985, all of these works were published for the first time (see Table I), and achieved increasing recognition thanks to multiple vinyl and CD recordings and performances. Their common designation was – and remained –“choral cantata”, as is also clear from the titles of the publications mentioned here. With regard to the journalistic and scholarly work that accompanied these developments, the first essays focused on drawing attention to the work complex as a whole.19 In addition to further publications that provided more of an overview,20 specific aspects and works were also increasingly brought to light.21 Here, the reception of Johann Sebastian Bach’s music played an important role.22 Most recently, it has been discussed whether the culture of ode and lied cantatas, which had played significant role in Berlin’s musical life since the last third of the 18th century, could have had an influence on the composer.23 Armin Koch already took a broader view in his 2001 dissertation, which did not explicitly deal with the work-group in question but was dedicated to the role of the chorale in Mendelssohn’s entire œuvre. The study focused primarily on those “movements and sections that sound like chorale quotations but whose melodies have no proven hymnological basis in their respective forms.”24 Nonetheless, Koch’s insightful views on Mendelssohn’s general engagement with the Protestant chorale in its formal and thematic diversity makes the study important for any consideration of the topic.
Terminology and Bach reception
As can be observed in Table I, most of the works were entitled Chorale. Exceptions were the Weihnachtslied “Vom Himmel hoch” and “Verleih uns Frieden”, the latter entitled Gebet
(= Prayer) when it was released in print. In correspondences, Mendelssohn occasionally referred to this work as a “little song”25. Its inclusion in this work-group is primarily due to the use of Luther’s chorale text, which was the basis for Mendelssohn’s cantus-firmus-free composition. On the cover of volume 21 of his music library, Mendelssohn ultimately brought together the three works included there (MWV A 5, A 10, A 13) with the term Cantaten.
A so-called “choral cantata” is – generally speaking – a multipart vocal-instrumental work in which a Protestant chorale serves as the musical and textual thematic basis. Although this special form of the Protestant church cantata had been in use since the 17th century, the actual term did not emerge until the mid-19th century, when it was used for the corresponding works in the first edition of Bachs collected works.26 In an ideal and strict sense, all verses of a chorale should be set to music (per omnes versus). In Mendelssohn’s case, this criterion is best fulfilled by the last-composed of these works, “Ach Gott, vom Himmel sieh darein”, although additional verses are also used here.27 Throughout music history, additional texts were commonly used for the composition of the inner movements. In this sense, Mendelssohn’s multi-movement works “Wer nur den lieben Gott lässt walten”, “O Haupt voll Blut und Wunden”, and “Vom Himmel hoch”, all of which also contain individual solo movements, can be described as “chorale cantatas”. The term proves particularly difficult with respect to the single-movement works “Christe, du Lamm Gottes” and “Jesu, meine Freude”, which would be more accurately described as chorale movements. In a broader sense, this also applies to the multi-part “Wir glauben all an einen Gott”. Thus, to speak of a total of seven or eight “chorale cantatas” by Mendelssohn can, strictly speaking, be considered problematic. Nevertheless, the term persists, especially since more accurate terms, such as
19 Brian W. Pritchard, Mendelssohn’s Chorale Cantatas: An appraisal, in: Musical Quarterly LXII/1 (1976), pp. 1–24; Willi Schulze, Mendelssohns Choralkantaten, in: Logos Musicae. Festschrift für Albert Palm, ed. by Rüdiger Görner, Wiesbaden, 1982, pp. 188–193. The articles were written in connection with editions of individual works by the two authors.
20 David Griggs-Janower, Mendelssohn’s Chorale Cantatas: a well kept secret, in: Choral Journal 33/4 (1992), pp. 31–33; Verena Friedrich, “… an dem weiter zu arbeiten, was mir die grossen Meister hinterlassen haben”. Einführung in die Choralkantaten von Felix Mendelssohn Bartholdy, in: Musik und Gottesdienst 63 (2009), pp. 213–223.
21 Oswald Jonas, An Unknown Mendelssohn Work, in: American Choral Review IX (1967), pp. 16–22 (handles “Jesu, meine Freude”); R. Larry Todd, A Passion Cantata by Mendelssohn, in: American Choral Review 25/1 (1983), pp. 2–17 (hereafter: Todd, Passion Cantata); Ralf Wehner, Studien zum geistlichen Chorschaffen des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinzig, 1996 (= Musik und Musikanschauung im 19. Jahrhundert; vol. 4), on the chorale arrangements of the1820s in particular, see pp. 67–95 (extended version of the diss. Leipzig, 1991).
22 Friedhelm Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn. Über Mendelssohns kompositorische Bach-Rezeption, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 17 (1993), pp. 44–78 (hereafter: Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn); Esther S. You, Old Wine in New Bottles: Felix Mendelssohn-Bartholdy’s Chorale Cantatas – J. S. Bach’s Models Become „Romanticized“, D. M. A. University of Cincinnati, 2006; R. Larry Todd, Die Matthäus-Passion – Widerhall und Wirkung in Mendelssohns Musik, in: “Zu groß, zu unerreichbar”. Bach-Rezeption im Zeitalter Mendelssohns und Schumanns, ed. by Anselm Hartinger, Peter Wollny, and Christoph Wolff, Wiesbaden/Leipzig/Paris, 2007, pp. 79–97 (hereafter: Todd, Matthäus-Passion – Widerhall ); Lee David Nelson, The Chorale Cantatas of Felix Mendelssohn-Bartholdy: An examination of Mendelssohn’s translation of J. S. Bach’s musical syntax and form, D. M. A. University of Arizona, 2009.
23 Peter Wollny, Gattungs- und Stilprobleme in Mendelssohns Choralkantaten, in: Von Bach zu Mendelssohn und Schumann. Aufführungspraxis und Musiklandschaft zwischen Kontinuität und Wandel, Wiesbaden, 2012 (= Beiträge zur Geschichte der Bach-Rezeption; vol. 4), pp. 289–295 (hereafter: Wollny, Gattungs- und Stilprobleme).
24 Armin Koch, Choräle und Choralhaftes im Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, Göttingen, 2003 (= Abhandlungen zur Musikgeschichte; vol. 12), (also Diss. Würzburg 2001/2002), p. 1.
25 The first such reference came in a letter of January 30, 1831, to Franz Hauser, for evidence see below note 100.
26 Wollny, Gattungs- und Stilprobleme [note 23], p. 292, as well as: Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn [note 22], p. 61; on the terminology, see also Zappalà, Choralkantaten [note 11], pp. 1–3, as well as Feder, Kirchenkantate [note 13].
27 The recitative is based on verses from the 12th Psalm and therefore does not use a chorale text.
vocal-instrumental chorale arrangement, can seem rather cumbersome or ambiguous. For example, this term can also refer to pure chorale settings, such as those found in the oratorio St. Paul op. 36 MWV A 14 or in the Festgesang MWV D 4, the so-called “Gutenberg cantata”28
The extent of Johann Sebastian Bachs influence on these works has also been a constant and persistent focus of research. Friedhelm Krummacher described the connection as follows: “What unites the works into a series, however, is their occupation with Bach’s chorale setting of chorales [Choralchorsätze], or more precisely: the combination of chorale motet form and an independent instrumental form. In this respect, the works also differ from the two chorale motets ‘Mitten wir im Leben sind’ and ‘Aus tiefer Not’, which were published in Kirchenmusik op. 23.”29 There has therefore been no lack of attempts in the literature to identify compositional models, particularly in the cantatas of Johann Sebastian Bach. However, Mendelssohn’s knowledge of these specific works at the end of the 1820s should not be overestimated, as it was shaped primarily by the Berlin Sing-Akademie’s cultivation of Bach. Mendelssohn’s own collection of such works was indeed rather small at the time, and in fact only grew significantly in the 1830s thanks to his acquaintance with Franz Hauser.30 However, connections with regard to idiom and certain formal patterns were already drawn during his lifetime. The composer himself had a clear opinion on this. The following remark goes back to a Bach cantata Franz Hauser sent to Düsseldorf in 1834 for which Mendelssohn thanked him and explained: “[…] then I had to look through the whole of ‘Wer nur den lieben Gott’, because I did not know it at all, which is why I had composed it myself. Can you imagine, various passages in mine still seemed quite good to me, almost better (others, of course, did not), and I even found similarities with the old Sebastian in some of them. Isn’t that a joy? But don’t tell anyone in Leipzig of this, they would skewer me.”31 Mendelssohn had already written the following remark in 1831 during his journey to Italy, on which he composed a number of chorale arrangements: “If it resembles Seb. Bach, then again I can’t help it, for I composed it as I felt it, and if the words make me feel like the old Bach, then I should like it all the better. For
you will not think that I would copy his forms without content, for reluctance and emptiness would not let me finish a single piece.”32
The works of the late 1820s (MWV A 5 to A 7)
Little is known about the origins of the first three chorale settings, which were composed between 1827 and 1829 to texts by Martin Luther, Johann Franck (1618–1677), and Georg Neumark (1621–1681). “Christe, du Lamm Gottes” was a Christmas present for Fanny Mendelssohn Bartholdy in 1827. She wrote to Carl Klingemann (1798–1862) on Christmas Day: “[…] he wrote a piece of a different nature for me,33 the chorale ‘Christo [sic], du Lamm Gottes’ set to a four-part chorus with a small orchestra. I played it a few times today, it is really quite beautiful.”34 In the lively middle section, the composer drew upon a fugue theme from his Sinfonia in F minor MWV N 11 from 1823 and combined it with an expressive, no less demanding polyphonic vocal part. This is framed by two contrasting sections. While the beginning of the work operates with diminutions and motivic divisions of the chorale before it is presented in larger note values, the third part brings the element of sonority to the fore. Only rarely has Mendelssohn written such meditative music as in the conciliatory conclusion of his first vocal-instrumental setting of Luther.
Just one month later, Mendelssohn completed another chorale setting: “Jesu, meine Freude”. Both pieces were mentioned indirectly shortly after. Looking back over the past year, Mendelssohn wrote: “After not being able to write anything all summer (and to my shame I confess it), I came back to old and dusty Berlin, fresh and new. And to prove that at least my heart has not gotten dusty, I have a quartet for strings, several songs and piano pieces, a large Tu es Petrus (which is probably my best piece) and 2 pieces of sacred music.”35 In addition to this general reference, Mendelssohn gave his own assessment of the new pieces to his Swedish friend Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878). Mendelssohn had “made a little piece of sacred music, in which there is much that is good, and another piece of sacred
28 See Series VII, Volume 3 (2020) of this edition.
29 Krummacher, Bach, Berlin und Mendelssohn [note 22], p. 61.
30 Ralf Wehner, Mendelssohns Sammlung von “Kirchen=Cantaten” Johann Sebastian Bachs, in: “Zu groß, zu unerreichbar” Bach-Rezeption im Zeitalter Mendelssohns und Schumanns, ed. by Anselm Hartinger, Peter Wollny, and Christoph Wolff, Wiesbaden/Leipzig/Paris, 2007, pp. 415–461.
31 Letter of March 16, 1834, to Franz Hauser, location unknown (see below note 226 on the fire at the archives), quoted from the copy in: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv (hereafter: D-B), MA Nachl. 7; 30, 1 [no. 16], pp. 58–62, printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, vol. 3, ed. and with commentary by Uta Wald in association with Juliane Baumgart-Streibert, Kassel etc., 2010 (hereafter: Sämtliche Briefe, vol. 3), pp. 367–369, quotation on p. 368. The wording would have been different if Hauser had already received the work from Mendelssohn.
32 Letter of July 13, 1831, to Eduard Devrient, The Morgan Library & Museum, New York (hereafter: US-NYpm), Morgan Collection – Musicians Letters, Call Number MLT M5377.D514 (4), printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, vol. 2, ed. and with commentary by Anja Morgenstern and Uta Wald, Kassel etc., 2009 (hereafter: Sämtliche Briefe, Bd. 2), pp. 323–327, quotation on p. 324.
33 In comparison to the Kindersinfonie MWV P 4 for his younger sister Rebecka Mendelssohn Bartholdy.
34 Letter of December 25, 1827, from Fanny Mendelssohn Bartholdy to Carl Klingemann, location unknown, quoted from: Sebastian Hensel, Die Familie Mendelssohn 1729–1847. Nach Briefen und Tagebüchern, Berlin, 1879, vol. I, p. 181.
35 Letter of February 5, 1828, to Carl Klingemann, location unknown, quoted from an old photograph; printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, vol. 1, ed. and with commentary by Juliette Appold and Regina Back, Kassel etc., 2008 (hereafter: Sämtliche Briefe, vol. 1), pp. 233–238, quotation on p. 237. The quartet mentioned here was the String Quartet in A minor op. 13 MWV R 13. On “Tu es Petrus” see Serie VI, Volume 6 (2014) of this edition.
music, which is no good at all.”36 This undoubtedly refers to “Christe, du Lamm Gottes” and “Jesu, meine Freude”, and it must have been this assessment that contributed to the latter piece being kept under lock and key. In contrast, Mendelssohn had the “Christe, du Lamm Gottes” copied, later gave it away, and even considered publishing it in 1835. The work was referenced yet again in 1839. In Mendelssohn’s correspondences with Franz Hauser, the latter had mentioned a Bach cantata that was unknown to Mendelssohn: “I have never heard any mention of the Cantate: ‘Christe Du Lam[’] let alone have I ever owned it. If you find it later, I would like to get to know it, because I tried my hand at the same chorale once as a boy.”37 Mendelssohn set off for England in April 1829, just a few days after the revival of Bach’s St. Matthew Passion. It was his first major journey unaccompanied by a parent. In addition to the desire to get to know the country and its people, Mendelssohn was also interested in disseminating his music. Among the instrumental works he brought with him were the 1st Symphony op. 11 MWV N 13, the Midsummer Night’s Dream Overture op. 21 MWV P 3, the String Quartet in A minor op. 13 MWV R 13, and the Octet op. 20 MWV R 20. Mendelssohn had some of the parts sent to England after he arrived. The orchestral pieces were successfully performed in the concerts of the Philharmonic Society.38 In contrast, the number of vocal music works he had composed up to this point was relatively small, especially with respect to sacred choral music. But there is at least evidence of four such works that Mendelssohn presented to various individuals in England, all of which had been composed within the previous year and a half: the four-chorus Antiphona et Responsorium “Hora est” MWV B 18, the “Tu es Petrus” MWV A 4 for five-part mixed chorus and orchestra, the chorale movement “Christe, du Lamm Gottes”, and a further work, with four movements and after the chorale “Wer nur den lieben Gott lässt walten”. For a long time, little was known about the last-mentioned work. An important hint did not surface until 1872, when Charlotte Moscheles (1805–1889) drew upon a number of documents to provide an account of the life
of her husband Ignaz Moscheles (1794–1870). With regard Mendelssohn and the year 1829, she wrote: “During his visits to the countryside, he revealed the manuscripts of his sacred cantata on a chorale in A minor, a sixteen-part chorus ‘Hora est’, which had not been published, and a violin quartet in A minor.”39 It is not known when this A minor cantata was composed and whether it was composed with the upcoming journey in mind. In any case, it must have existed by his departure in April 1829. Soon after his arrival, Mendelssohn first presented the pieces to Klingemann in London. The latter wrote to Berlin: “[…] I already know Meeresstille und glückliche Fahrt – tu es Petrus and the gentle chorale, and see in it the younger but stronger Felix, in each piece different and yet always the same.”40 The “gentle chorale” was probably a reference to “Christe, du Lamm Gottes”. A month later, Mendelssohn had already made a number of acquaintances, which soon led to a performance opportunity: “[…] In the next few days, I will probably receive an invitation to perform one of my sacred works at the big music festival in Birmingham.”41 Three days later, he shared with his family his considerations regarding the festival: “[…] on the other hand, I will definitely accept the invitation to the music festival in Birmingham as soon as I receive it, and I am already looking forward to hearing my chorale ‘Wer nur den lieben Gott’ with English text; for it is this piece I would like to have sung there, the middle-aria suits Miss Paton42 very well, and the choir is supposed to be good. I may write new music to Luther’s celebrated hymn: Ein veste Burg ist unser Gott, if I have time and fancy doing so, if not, then some scraps from Dürer will have to do.”43 Further on in the letter, attention is drawn above all to the possibilities that such a performance could offer, even if this would mean having to change plans for his journeys to come: “The music festival is toward the end of September, and I will probably be asked to conduct my pieces there myself. Moscheles, with whom I had a short conversation about my plans for the rest of the year, said that I would not want to let this opportunity pass by and should postpone the planned trip to Vienna for another time, as most of the Viennese would be
36 Letter of ca. February 19 and April 22, 1828, to Adolf Fredrik Lindblad, Paul Sacher Stiftung, Basel, Sammlung Rudolf Grumbacher, Ref. Nr. 203, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 1 [note 35], pp. 240–244 [there dated “February 19(?)”], quotation on p. 242. Note on the dating: The letter, which consists of two parts and is only dated at the end, states that “a period of about 9 weeks has passed” since the first part (from which the quotation is taken). Exactly nine weeks before April 22 is February 19.
37 Letter of November 24, 1839, to Franz Hauser, location unknown (see below note 226 on the fire at the archives), quoted from the copy in: D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [no. 30], pp. 100–105, printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, vol. 7, ed. and with commentary by Ingrid Jach and Lucian Schiwietz in association with Benedikt Leßmann and Wolfgang Seifert, Kassel etc., 2013, pp. 80–82, quotation on p. 82. This is a response to a letter of November 8 to 10, 1839, from Franz Hauser, in which Hauser asks whether he lent Mendelssohn a cantata with this title, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 36, Green Books X-130. The composition by Bach mentioned here is the final chorale “Christe, du Lamm Gottes” from the cantata “Du wahrer Gott und Davids Sohn” BWV 23.
38 On Symphony No. 1 see Series I, Volume 4 (2000) of this edition, pp. XXII–XXIII.
39 Charlotte Moscheles, Aus Moscheles’ Leben. Nach Briefen und Tagebüchern, ed. by idem., Leipzig, 1872, vol. 1, p. 207.
40 Letter of April 24 and 28, 1829, from Carl Klingemann to Fanny Mendelssohn Bartholdy (section of letter from April 24), D-B, Autogr. I/264/2, printed in: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, ed. and with an introduction by Karl Klingemann (jun.), Essen, 1909, p. 52.
41 Letter of May 26, 1829, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and Tilden Foundations (hereafter: US-NYp), *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 63, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 1 [note 35], pp. 295–299, quotation on p. 298.
42 Mary Ann Paton (1802–1864) was a Scottish soprano who was performing in London in 1829 while Mendelssohn was staying there. She was also a guest at the music festival in Birmingham that same year.
43 Letter of May 29, 1829, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 64, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 1 [note 35], pp. 299–302, quotation on p. 300. “Scraps from Dürer” refers to Mendelssohn’s Festmusik MWV D 1, composed in 1828 for the Dürer Festival in Berlin, see Series VII, Volume 1 (2012) of this edition.
out of town in the fall anyway and there would be no possibility of finding compensation there for what I will have missed here […].”44
Above all, it is the unusual opening of the composition that makes it singular and quite special with respect to form, as it does not begin with the typical chorale chorus movement on the text that gives the work its title (this is No. 2). Instead, Mendelssohn chose to start with a simple cantional setting of a chorale which, although it uses Georg Neumark’s well-known melody to “Wer nur den lieben Gott lässt walten”, refers with its text to the first verse of the hymn “Mein Gott, du weißt am allerbesten” by Israel Clauder (1670–1721).
Mendelssohn had much to attend to before his extended summer journey with Carl Klingemann to Scotland at the end of July 1829, including farewells to friends and colleagues in London and letters reporting home: “My SommerNsTr. [Sommernachtstraum = Midsummer Night’s Dream] remains here for the Philharm., which has requested it. Likewise my chorale ‘Wer nur den lieben Gott’ and probably the Petrus for the festivals; in this way I will stay in touch and hope that things will go better than they would have otherwise […].”45 With the hectic preparations for his departure, Mendelssohn was no longer able to see the pianist Charles Neate (1784–1877). Neate was one of the founders of the Philharmonic Society in 181346 and one of its directors. During his stay, Mendelssohn had met with him on various occasions to play music. Neate had even given Mendelssohn a few of his own compositions as gifts.47 Mendelssohn now returned the favor with his own compositions, a gift which was no doubt also meant to encourage Neate to arrange for a performance of the works: “As I leave town tomorrow morning I regret very much that I will not be able to express myself to you my best and sincerest thanks for the kindness you have had for me. Your beautyful compositions gave me the greatest delight every time I play’d them, and I am indebted to you for one of the most agreeable evenings I passed in this country. For both those things accept my sincere thanks. [paragraph break] Allow me to offer you the manuscript score of the piece of mine, I play’d once to you & to Sir George; though I know that its musical value is but very little I take the liberty of offering it to you
[…].”48 Although the manuscript was not specified in the letter, a copy of “Wer nur den lieben Gott lässt walten” has survived with a note by Neate that he had received it from Mendelssohn.49 The letter reveals that Mendelssohn had played the piece not only for C. Neate but also for George Smart (1787–1867), another founding member of the Philharmonic Society. Although a performance in the fall of 1829 fell through for unknown reasons, Mendelssohn stuck to his plans. Toward the end of his stay in England, he informed his family: “The only business news for today is that my symphony and my SommerNsTr. will be given next season at the Philharmonic, just that unfortunately I cannot conduct; and that my Choral in A minor ‘Wer nur den lieben Gott’ remains here, and will also be performed next year at the national festivals […].”50
A short time later, the composer went to bid farewell to Thomas Attwood (1765–1838) at his estate in Norwood Surrey. He gave him a copy of “Christe, du Lamm Gottes” and his “Tu es Petrus”51 on November 18, 1829.
It is also important to note that a small performance at the Mendelssohn house in Berlin already took place in mid-September, which the composer was informed about by letter. Several guests, including Julius Schubring (1806–1889) and Mendelssohn’s sisters “sang your chorale: Wer nur den lieben, and were uplifted by it.”52 This message is not only important as evidence of a performance, it also confirms that another manuscript, presumably the autograph, must have been located in Berlin at that time.
Mendelssohn’s performance plans for his sacred vocal music were not realized. When the composer set off on his journey to Italy six months later, the works were all left behind.
On May 13, 1830, Felix Mendelssohn Bartholdy embarked on his Grand Tour, and did not return to Berlin until two years later, at the end of June 1832. Altogether, it was a highly successful journey, with months-long visits to Rome, Paris, and London.53 The first stops were Leipzig, where Mendelssohn
44 Letter of May 29, 1829, to the family, ibid. The music festival in Birmingham ultimately took place from October 6 to 9, 1829, but without music by Mendelssohn.
45 Letter of July 17, 1829, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 72, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 1 [note 35], pp. 339–341, quotation on p. 340.
46 The founding charter of the society with C. Neate’s signature is reproduced in: Cyril Ehrlich, First Philharmonic. A History of the Royal Philharmonic Society, Oxford, 1995, p. 5.
47 It is not known which works these were. It can be assumed that Mendelssohn did not take the gift with him on the Scottish journey and that it may have remained in England thereafter as well. No such work has been preserved in those holdings of Mendelssohn’s music library that are currently accessible.
48 English letter of July 21, 1829, to Charles Neate, The British Library, London, MS Mus. 1220, fol. 4, this passage was also printed in: Sämtliche Briefe, vol. 1 [note 35], p. 345.
49 See Critical Report on MWV A 7, Source B.
50 Letter of November 10, 1829, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 96, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 1 [note 35], p. 448.
51 See Series VI, Volume 6 (2014) of this edition, p. 235, designated there as Source C, the copy has since been moved and is preserved in Vienna.
52 Letter of September 15, 1829, from Fanny and Rebecka Mendelssohn Bartholdy to their brother, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn b. 4, Green Books I-88. The performance took place on Sunday, September 13, 1829.
53 For details on the course of the journey, see Hans-Günter Klein, Die Mendelssohns in Italien. Ausstellung des Mendelssohn-Archivs der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 6. Dezember 2002 bis 18. Januar 2003, Wiesbaden, 2002 (= Ausstellungskataloge, Neue Folge; 46), (hereafter: Die Mendelssohns in Italien), pp. 43–44.
made his first contacts with music publishers; Weimar, where he once again met Johann Wolfgang von Goethe; and Munich, where he spent almost eight weeks (June 6 to August 6). From there, Mendelssohn traveled via Salzburg and Linz to Vienna, where he stayed until the end of September 1830. On his onward journey he stayed in Venice and Florence for several days before arriving in Rome on November 1, 1830. The composer spent the winter months there until April 1831.
In a large collection of surviving letters from the journey, Mendelssohn reflects on his countless encounters with people and the countryside, mentalities and languages, works of architecture and fine art, as well as on the many musical experiences and impressions, but also on experiences with illness,54 death,55 and the forces of nature. In addition, chronological context and details of the travel route can be reconstructed from entries in three notebooks.56 The story is also told by several watercolors and no fewer than five albums of pencil sketches,57 one of which did not surface until 2017.58 The detailed reports he sent home established Mendelssohn’s renown as an imaginative and witty letter writer and as a critical and precise observer of his environment.59 Often rich in detail, his accounts even make it possible for today’s readers to take part in Mendelssohn’s world of thoughts and ideas. In contrast to the scarcity of written remarks with respect to the works composed in Berlin in the 1820s, when the most important matters were able be discussed orally, the regular reports home from the journey provide an abundance of valuable evidence that is also relevant for the chorale arrangements in this volume.
The actual fruits of the journey are above all the compositions that were completed, re-notated, or laid out conceptually over the course of the two years. In total, Mendelssohn worked on well over sixty of his own works during his journey. The chronological overview demonstrates this impressive feat and is also revealing in other ways (see Table II). While the proportion of sacred choral music is clearly high (especially in Rome), the two piano concertante works60 and the ballad Die erste Walpurgisnacht op. 60 MWV D 3 are a reminder that important works from other genres were also composed on the journey. With respect to orchestral music, the early version of the Hebrides Overture MWV P 7 is the only completed work.61 This is all
significant, especially because Mendelssohn repeatedly mentioned that he intended to work on two symphonies, although these plans would ultimately not come to fruition on the journey and were in fact not realized until years later.62 The encounters during the journey also led to new drafts and revisions of existing pieces which were given away, either to publishers as engraver’s copies or to a wide range of acquaintances as expressions of gratitude or as souvenirs. Thus, the multiple copies of the Canon MWV Y 5 or the large number of piano pieces and solo songs can also be traced back to practical reasons and efficiency. Furthermore, as sending packages by post was expensive, smaller pieces were notated within the letters or the number of supplements was kept to a minimum. Such frugality also led to a special notation in the case of the chorale “O Haupt voll Blut und Wunden”. Mendelssohn himself interpreted the predominance of sacred music, especially in the first year of the journey, as following: “And the fact that I have written several pieces of sacred music right now, this was something I needed to do, just as some are driven to read a certain book, the Bible or something else, and only when they do this do they feel well and right.”63
“O Haupt voll Blut und Wunden” [O Sacred Head, Now Wounded] MWV A 8
Mendelssohn’s chorale arrangement “O Haupt voll Blut und Wunden” was composed over the span of three weeks in Vienna. However, the three-movement work was not – as one might assume – inspired by Mendelssohn’s performance of Bach’s St. Matthew Passion a year and a half earlier, in which the chorale played a prominent role. Rather, the catalyst for the work was the lasting impression left on Mendelssohn by a painting which he had long been familiar with but had seen in the original at the Hofgarten gallery in Munich just a few weeks earlier. A letter provides details about the initial impetus for the composition, and also provides evidence of when exactly his work on it began, that is August 22, 1830: “Here is Vienna and there is Berlin; since they are so far apart, I must once again write a private letter. It is Sunday morning, I have just com-
54 Mendelssohn fell dangerously ill with cholera in Paris.
55 Three people very close to Mendelssohn died while he was on the journey (1832): J. W. v. Goethe, C. F. Zelter, and Eduard Ritz.
56 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2 to g. 4. The first-mentioned travel diary from May 1830 to February 1831, an important source in this context, has already been presented in an impressive edition, see Pietro Zappalà, Dalla Spree al Tevere: il diario del viaggio di Felix Mendelssohn Bartholdy verso l’Italia (1830–1831). Edizione e commento, in: Album Amicorum Albert Dunning in Occasione del suo LXV Compleanno, a cura di Giacomo Fornari, Turnhout, 2002, pp. 713–788.
57 Ralf Wehner, Vorläufiges Verzeichnis des bildkünstlerischen Werkes von Felix Mendelssohn Bartholdy, in: Mendelssohn-Studien 20 (2017), pp. 227–365 (hereafter: Wehner, Bildwerkeverzeichnis), especially pp. 323–330, four of the five albums have been preserved.
58 Roland Dieter Schmidt-Hensel, Ein bislang unbekanntes Zeichenbuch Felix Mendelssohn Bartholdys von seiner italienischen Reise (März bis Juli 1831), in: Mendelssohn-Studien 20 (2017), pp. 81–109.
59 A large portion of the travel letters was first published in 1861 – with the particularities of editions of that time: Reisebriefe von Felix Mendelssohn Bartholdy aus den Jahren 1830 bis 1832, ed. by Paul Mendelssohn Bartholdy, Leipzig, 1861. Within just a few years, the book saw several editions as well as translations into English (1862), Russian (1863), French (1864), and Swedish (1869).
60 Piano Concerto no. 1 in G minor op. 25 MWV O 7 and Capriccio brillant op. 22 MWV O 8.
61 See Series I, Volume 8A (2023) of this edition.
62 On the both works, Symphony in A major (“Italian”) MWV N 16 (1833/1834) and Symphony no. 3 in A minor op. 56 (“Scottish”) MWV N 18 (1842), see Series I, Volumes 5 (2005), 5A (2013), 6 (2010), and 6A (2011) of this edition.
63 Letter of July 13, 1831, to Eduard Devrient, for evidence and publication location see note 32.
Chronological list of works composed or re-notated between May 1830 and June 1832
Dates on which a second notation or a revision was made are marked with *.
Date
Designation
05/19/1830* Canon in B minor
May 1830 Lieblingsplätzchen “Wisst ihr, wo ich gerne weil’”
End of May 1830* Fantasy on the Irish Song The Last Rose of Summer in E major op. 15 for Piano
06/02/1830* Symphony in D minor (“Reformation Symphony”)
06/03/1830 Andante con moto in A major for piano
06/13/1830* Rondo capriccioso in E major op. 14 for piano
06/13/1830 Andante in A major for piano
06/26/1830 Song Without Words in B-flat minor op. 30 no. 2 for piano
07/18/1830* The Evening Bell in B-flat major for harp and piano
MWV Location, commentary
Y 5 Leipzig, for Heinrich Dorn
K 61 Weimar
U 74 Weimar, here as Fantasia, for Ulrike von Pogwisch
N 15 Weimar, for Heinrich Dorn
U 75 Weimar, for Ottilie von Goethe
U 67 Munich, for Delphine von Schauroth
U 76 Munich, fair copy for Fanny Hensel with letter of 14/06/1830
U 77 Munich, for the birth of Sebastian Hensel
Q 20 Munich, for Countess Fanny O’Hegerty
08/06/1830* Im Herbst “Ach, wie schnell die Tage fliehen” op. 9 no. 5 K 38 Munich
08/08/1830* Rondo capriccioso in E major op. 14 for piano
08/08/1830* Fantasy on the Irish song The Last Rose of Summer in E major op. 15 for piano
08/08/1830* Trois Fantaisies ou Caprices op. 16 for piano
08/08/1830* Variations concertantes in D major op. 17 for violoncello and piano
08/08/1830 String quartet in A minor op. 13, arrangement for piano four hands
August 1830 Lied for baritone and piano
August 1830* Scheidend “Wie so gelinde die Flut bewegt” op. 9 no. 6
09/12/1830 Choral “O Haupt voll Blut und Wunden” for baritone solo, mixed chorus and orchestra
09/13/1830 Variations in A major for violoncello and piano
09/13/1830* Canon in B minor
09/17/1830 Album leaf
09/18/1830* Frühlingslied “In dem Walde süße Töne” op. 19[a] no. 1
09/27/1830 Das erste Veilchen “Als ich das erste Veilchen erblickt” op. 19[a] no. 2
09/30/1830* Song Without Words in B-flat minor op. 30 no. 2 for piano
09/30/1830 “Ave Maria” op. 23 no. 2 for solo tenor and 8-part mixed chorus
Mid-October 1830 “Von schlechtem Lebenswandel”
10/16/1830 Venetianisches Gondellied in G minor for piano op. 19[b] no. 6
10/16/1830 Reiselied “Bringet des treuesten Herzens Grüße” op. 19[a] no. 6
10/18–19/1830 Choral “Aus tiefer Not” op. 23 no. 1 for solo voice, mixed chorus and organ
October 1830 or later Fugue in E minor for piano, fragment
U 67 Salzburg, engraver’s copy sent to Hofmeister
U 74 Salzburg, engraver’s copy sent to Hofmeister
U 70–72 Salzburg, engraver’s copy sent to Hofmeister
Q 19 Salzburg, engraver’s copy sent to Hofmeister
R 22 Salzburg, engraver’s copy sent to Breitkopf & Härtel
K 62 Vienna, for Eduard Devrient, location unknown
K 50 Vienna, here as Auf der Fahrt, for Aloys Fuchs
A 8 Vienna
Q 21 Vienna, collaborative work with Joseph Merk
Y 5 Vienna
Z 8 (b) Vienna, for Joseph Merk
K 56
Vienna, here as Minnelied vom Jahre 1246, in Album Wimpffen, vol. II
K 63 Pressburg, for Catharine Pereira, location unknown
U 77 Vienna, for Franz Hauser
B 19 Vienna, revised in Venedig 10/16/1830
K 64 Venice, with letter of 10/17/1830 to Eduard Devrient, lost in transit
U 78 Venice, here as Auf einer Gondel, fair copy for Delphine von Schauroth, 10/17/1830, lost in transit
K 65 Venice, here as In die Ferne
B 20 Venice
U 79 [Italy, exact location unknown]
Date Designation
11/15/1830
11/20/1830
12/11/1830
12/11/1830
12/12/1830*
12/16/1830
12/18/1830*
Der 115. Psalm “Non nobis Domine” op. 31 for solo voice, mixed chorus, and orchestra
Choral “Mitten wir im Leben sind” op. 23 no. 3 for mixed chorus a cappella
Song Without Words A minor op. 19[b] no. 2 for piano
Andante maestoso in F major for piano, part I
Choral “O Haupt voll Blut und Wunden” for solo baritone, mixed chorus and orchestra
MWV Location, commentary
A 9
B 21
U 80
Rome, for Rebecka Mendelssohn Bartholdy
U 81 Rome, for the 54th birthday of the father, part II was probably composed by Fanny Hensel
A 8
Rome, piano reduction for the family, sent on 12/14/1830
Concert Overture no. 2 Die Hebriden in B minor op. 26 P 7 Rome
Choral “Aus tiefer Not” op. 23 no. 1 for solo voices, mixed chorus and organ
12/29/1830 “Tantum ergo”
B 20 Rome, autograph copy for C. F. Zelter
Z 8 (c) Rome, referenced in a notebook 12/30/1830 “O beata et benedicta” for female chorus and organ B 22 Rome
12/30/1830 “Surrexit pastor” op. 39 no. 3 for solo voices, female chorus and organ B 23
12/31/1830 “Veni Domine” op. 39 no. 1 for female chorus and organ B 24
January 1831* Reiselied “Bringet des treuesten Herzens Grüße” op. 19[a] no. 6
K 65 Rome, for Jules Benedict
01/28/1831 Weihnachtslied “Vom Himmel hoch” for solo voices, mixed chorus and orchestra A 10 Rome
02/10/1831 Choral “Verleih uns Frieden” for mixed chorus and small orchestra A 11
03/01/1831 Choral “Wir glauben all an einen Gott” for mixed chorus and orchestra
03/08/1831 Nachspiel in D major for organ W 12 Rome
06/01/1831* Venetianisches Gondellied in G minor for piano op. 19[b] no. 6
06/01/1831* Reiselied “Bringet des treuesten Herzens Grüße” op. 19[a] no. 6
06/26/1831 Canon in E-flat major for two violas
07/15/1831 Die erste Walpurgisnacht op. 60, ballad for solo voices, mixed chorus and orchestra
August 1831 Three waltzes for piano
U 78 Sorrent, here as Auf einer Gondel, for Theodor Hildebrandt
K 65 Sorrento
Y 7 Florence, for George Smart
D 3 Milan, conclusion of the vocal section
U 83–85 Unterseen, for a daughter of the head forester Karl Albrecht Kasthofer
08/10/1831 Die Liebende schreibt “Ein Blick von deinen Augen” K 66 Unterseen
08/11/1831 Reiselied “Ich reit ins finstre Land hinein”, Fragment
August / September 1831
Song Without Words in E major op. 19[b] no. 1 for piano
09/18/1831 Andante in B major – Allegro di molto in B minor for piano
October 1831 Piano Concerto no. 1 in G minor op. 25
11/02/1831
Song Without Words in E major op. 19[b] no. 1 for piano
11/03/1831 Con moto in A major for piano
11/03/1831* Canon in B minor
11/17/1831* “Ave Maria” op. 23 no. 2 for solo tenor and eight-part mixed chorus
11/21/1831* Fugue in E minor op. 35 no. 1[b] for piano
K 67 Unterseen
U 86 [Switzerland, exact location unknown]
U 87 Munich, later reworked into Capriccio brillant op. 22 MWV O 8
O 7 Munich
U 86 Munich, for Josephine Lang
U 88 Munich, for Julie zu Oettingen-Wallerstein
Y 5 Munich
B 19 Frankfurt am Main, autograph copy for Johann Nepomuk Schelble
U 66 Frankfurt am Main
Date Designation
November/ December 1831
12/03/1831*
Todeslied der Bojaren “Leg in den Sarg mir mein grünes Gewand”
Geständnis “Kennst du nicht das Glutverlangen” op. 9 no. 2
12/04/1831* Erntelied “Es ist ein Schnitter, der heißt Tod” op. 8 no. 4
12/05/1831
MWV Location, commentary
K 68
K 41
K 37
Verschwunden “Da lieg ich unter den Bäumen” K 69
January 1832 Choral “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” for solo baritone, mixed chorus and orchestra
02/13/1832* Die erste Walpurgisnacht op. 60, ballad for solo voices, mixed chorus and orchestra
02/23/1832 Andante of String Quartet in A major op. 18
03/09/1832 Neue Liebe “In dem Mondenschein im Walde” op. 19[a] no. 4
03/09/1832 Gruß “Leise zieht durch mein Gemüt” op. 19[a] no. 5
03/20/1832 Vocal canon “Ich will Dienstag kommen”
03/22/1832* Canon in B minor
March/April 1832*
Sommernachtstraum Overture op. 21, Arrangement for piano four hands
04/02/1832* Das erste Veilchen “Als ich das erste Veilchen erblickt” op. 19[a] no. 2
04/04/1832* Song Without Words in E major op. 19[b] no. 1
04/04/1832* Andante in B major – Allegro di molto in B minor for piano
04/13/1832 Winterlied “Mein Sohn, wo willst du hin so spät” op. 19[a] no. 3
04/16/1832* Canon in B minor
04/19/1832* Sechs Gesänge for one voice and piano op. 19[a]
04/19/1832* Octet op. 20
04/19/1832* Sommernachtstraum Overture op. 21
Spring 1832 Piano trio, fragment
May 1832 Der Blumenstrauß “Sie wandelt im Blumengarten” op. 47 no. 5
Düsseldorf, for Carl Leberecht Immermann
Duisburg, here as Frage, for Eduard Bendemann
Düsseldorf
Düsseldorf
A 13 Paris, dated April 5, 1832 and sent to J. N. Schelble
D 3
Paris, conclusion of the overture
R 21 Paris
K 70 Paris
K 71 Paris
X 2 Paris
Y 5 Paris
P 3 Paris, engraver’s copy for Cramer, Addison & Beale
K 63 Paris, for Alexander Johnston’s almanac
U 86 Paris, for Ms. Wendelstadt
U 87 Paris, as Rondo brillant for Mme. Blanche Goupil
K 72 Paris
Y 5 Paris, for Frédéric Chopin
SD 6 Paris, engraver’s copy sent to Breitkopf & Härtel
R 20 Paris, engraver’s copy sent to Breitkopf & Härtel (parts)
P 3
Paris, engraver’s copy sent to Breitkopf & Härtel (parts)
Q 22 Paris, frequently mentioned project, a few sketches
K 73 London
05/18/1832 Capriccio brillant in B minor op. 22 for piano and orchestra O 8 London
05/29/1832 Vocal canon “Wohl ihm”
June 1832 or earlier Song Without Words in A major op. 19[b] no. 3 for piano
X 3 London, for Ignaz Moscheles
U 89 London
June 1832 or earlier Song Without Words in F-sharp minor op. 19[b] no. 5 for piano U 90 London
06/01/1832 Cadenzas to W. A. Mozart’s Concerto for Two Pianos in E-flat major KV 365/316a
06/12/1832* Melodies for the Pianoforte op. 19[b]
Anh. B London, for a concert with Ignaz Moscheles
SD 5 London, Stichvorlage for Novello
06/19/1832* Concert Overture no. 2 Die Hebriden in B minor op. 26 P 7
06/20/1832* Concert Overture no. 2 Die Hebriden in B minor op. 26 P 7
06/20/1832* Das erste Veilchen “Als ich das erste Veilchen erblickt” op. 19[a] no. 2
K 63
London, Arrangement for piano four hands for the sisters Marie and Sophie Horsley
London, autograph copy of the score
London, for Elizabeth Hutchins Horsley, here as Der ersten Liebe Verlust
posed the beginning of a short and very serious piece of church music after the chorale ‘O Haupt voll Blut und Wunden’; since I know you will be interested in this, I will send you the sombre piece, and you can have it sung wherever and however you like. But it is very gloomy; let the art dealer on Unter den Linden show you the copperplate print of a Spanish picture by Franz Zurbaran; it has been hanging there for some time and depicts St. John accompanying Mary home from the crucifixion; I have now seen the original in Munich, and I think it is one of the most profound images I have ever come upon.”64 The life-size painting Maria und Johannes vom Kalvarienberg heimkehrend, 65 [Mary and John Returning from Calvary], whose author has since been identified as Antonio del Castillo y Saavedra (1616–1668), had been attributed to the Spanish Baroque painter Francesco de Zurbaran (1598–1664) from 1815 (the year it was acquired in Paris) to 1881.66 At the end of the letter, Mendelssohn goes on to discuss details of the new piece of church music: “But now the letter is also done and dusted; but I must still confide to Fanny that the chorale melody is in the soprano and is played by the oboes in octaves, the flutes, and all the violins. When she then asks who else will fill out the parts, I will remind her it is possible to find 2 violas, 2 cellos, 2 bassoons, and double basses in this world. I am looking forward to the piece, and to the fact that no one will be able to tell whether it is in C minor or E-flat major; you should expect as much of me: Fanny.”67
As was the case with “Wer nur den lieben Gott lässt walten”, the cantata also included an aria for solo voice, this time for baritone rather than soprano. This solo movement was completed on September 5, 1830. Though Mendelssohn had spent a lot of time with baritone Franz Hauser in Vienna, it was Eduard Devrient (1801–1877) – who had sung the part of Jesus in the St. Matthew Passion revival in 1829 – that Mendelssohn had in mind for the part. Mendelssohn shared the circumstances surrounding his work on the piece in Vienna with the singer: “Of course I am far away, and much time has passed since we have
last seen each other […]. I have lived well during this time, and have been in good spirits, but little of the music I have made has come from deep inside me; if Vienna were not such a damned miserable backwater that has made me crawl into my own soul and write sacred music, I would have nothing new to show. However, today I have finished the second number of a chorale with instruments, and will probably finish the third the day after tomorrow and thus the whole piece, and then I will begin a little Ave Maria for voices alone, which I already have in my head. In the chorale, which I will send you as soon as it is finished, you will find an aria for your voice; be so good as to sing it contritely. Hauser curses that my bass solos and songs are so high; I would counter by saying they suit you […].”68
While we can be certain about the date Mendelssohn began work on the composition, the date of completion remains unclear. A note in Mendelssohn’s own handwriting seems at first to provide the last chronological cornerstone of the compositional process, recording September 12, 1830, as the date of completion: “Sunday evening, work on the chorale finished”69. Mendelssohn also noted this date on a copy that he had made in Vienna and took with him on his journey, which ultimately formed the basis for further copies made in Frankfurt am Main and London.70 However, the original score, which remained with Franz Hauser in Vienna, indicates that the final chorale was completed on September 4 and the aria on September 13.71 Thus, if the aria was already “finished” on September 5, as Mendelssohn mentions to Devrient, the solo piece that has survived can only be a different record, assuming no error was made in the dates.
With regard to the text, the composition is based on two of the ten verses of the widely disseminated Passion hymn by Paul Gerhardt (1607–1676) and uses an unknown text for the aria “Du, dessen Todeswunden”, one which is similar in style to Gerhardt’s text. It cannot be ruled out that Mendelssohn himself wrote the text for this verse.72
64 Letter of August 22 and 23, 1830, to Rebecka Mendelssohn Bartholdy (section of letter from August 22), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 114, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 70–74, quotation on 70. The work that Mendelssohn described as a copperplate print from memory can only refer to a lithograph by Ferdinand Wolfgang Flachenecker (1792–1847), published in the gallery work Königlich Baierischer Gemaelde=Saal zu München und Schleißheim. In Steindruck von Piloty, Selb & C., Second Volume, Munich, 1821, (unpaginated), see also facsimile VIII.
65 Oil on canvas, current location: Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Staatsgalerie im Neuen Schloss Schleißheim, inventory number 257. For details about the painting and its history, see Spanische Meister, ed. by Halldor Soehner, Munich, 1963 (= Gemäldekataloge; vol. 1), Vollständiger Katalog, text volume, pp. 36–39, with reproductions in the volume of plates, images 58–60. The format is given there as following: “192,5 x 126,3 cm (current size of image)”. Black-and-white reproductions of the painting in the Mendelssohn literature are found in: Todd, Passion Cantata [note 21], p. 2; Wüster, Choralkantaten [note 12], p. 475; and Todd, Matthäus-Passion – Widerhall [note 22], p. 97.
66 Spanische Meister, text volume, ibid., p. 38. The painting was on exhibition in the Hofgartengalerie from 1822 to 1836 and in the Alte Pinakothek from 1836 to 1945, see also Peter Böttger, Die Alte Pinakothek in München, Munich, 1972.
67 Letter of August 22 and 23, 1830, to Rebecka Mendelssohn Bartholdy, for evidence see above note 64. The largely subdued colors of the picture seem to find a correspondence in the dark character of the music, which is deepened even further by the divided violas and cellos.
68 Letter of September 5, 1830, to Eduard Devrient, US-NYpm, Morgan Collection – Musicians Letters, Call Number MLT M5377.D514 (3), printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 93–96, quotation on p. 94. The letter was not sent in Vienna and received a postscript in Kloster Lilienfeld on October 2: “The chorale is now of course long finished, and the Ave as well; when the first good opportunity comes I will send the pieces to you […]”, ibid. The “Ave” was later released as op. 23 no. 2.
69 Notebook, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 17v.
70 See Critical Report, Sources D and F
71 Zappalà, Choralkantaten [note 11], p. 25, therefore assumed that this was a copyist’s error and that the final date should instead be September 14; R. L. Todd made a similar claim in the preface to his edition of the work for A-R Editions. The date was “probably a simple error for 14 September”, see: Felix Mendelssohn Bartholdy, O Haupt voll Blut und Wunden, ed. by R. Larry Todd, Madison, 1981 (= Collegium Musicum: Yale University Second Series; Vol. IX), Preface, p. IX.
72 For a discussion of literature on this topic, see Wüster, Choralkantaten [note 12], pp. 219–221.
After moving on to Venice, Mendelssohn sent his teacher Zelter a short report, in which he also described the atmosphere in the Austrian city: “In Vienna I completed 2 small pieces of church music: a chorale of three movements for chorus and orchestra (O Haupt voll Blut und Wunden) and an Ave Maria for 8-part chorus a capella; I was surrounded by people who were feckless and dissolute, I lost all my spirits and felt like a theologian among them.”73
In any case, Mendelssohn wanted to share the work with his family. Having traveled on to Rome, the composer therefore decided to make a score-like piano reduction, which he then sent by post. He made the following entry in his notebook on the 3rd Sunday in Advent: “Evening. Piano score for Fanny”74 . In a separate letter, Mendelssohn went into detail about the Christmas present for his sisters: “I am sending both of you the piano reduction of my chorale from Vienna, I hope it pleases you. I made the piano reduction because the score would have taken up too much space, for it is heavily orchestrated; since I made it just for you [Fanny Hensel], you will not be surprised if some passages are unplayable, I have treated it more like a small score, you will arrange it to suit your hands, and I would like to see how you conduct it for the first time on the piano, how you will be shamefully annoyed that it does not want to sound at all, and think: Did my Mr. Brother really come up with such nonsense? But don’t be afraid, even if the pages ended up rather black, I know it will sound good. Just a few notes about the instruments: 2 cellos and 2 violas carry the middle voices and the accompaniment in the first piece. Contrabasses and bassoons make up the bass; the chorale is always played by the oboes and clarinets in high octaves, flutes in unison, and all violins in unison, except in the passage: O Haupt sonst schön gekrönet, where the flutes and violins play it alone and, in the third and fourth measure before the end, the violins drop out; in the aria, there is nothing to note except that the flute plays the chorale, and a great deal of B-flat clarinets are heard shouting and screaming throughout; in the last number, the horns, basses, and bassoons always make the exclamation together, and thus I think it will come through. You can see the rest for yourself. I would have liked to send other things as well, but the space did not allow it […].”75
The formulation that the excerpt would be arranged “like a small score” indicates that this arrangement of “O Haupt voll Blut und Wunden” very likely resembled a short score. Little is known about the family’s response or the whereabouts of the autograph. It cannot be ruled out that Mendelssohn’s Christmas present never reached the city of Berlin.76
Luther’s texts as a source of inspiration (MWV A 10 to A 13)
In the letter to Devrient quoted above, Mendelssohn mentioned a farewell gift from Hauser, one which would have a considerable impact on his future compositional work: “[…] he gave me, among other things, a little booklet with Luther’s songs to take with me on my journey, and there is much in it I would like to compose […].”77 The “booklet” mentioned here was an edition by Karl Grell published in Berlin for the Reformation Festival in 1817.78 The book’s immediate influence on Mendelssohn is evident from several references to it in correspondences, for example with the composer’s teacher Zelter: “Before my departure from Vienna, an acquaintance gave me Luther’s sacred songs, and as I read through them they gave me new strength, and I am thinking of composing many of them this winter; the chorale ‘aus tiefer Noth’ for 4 voices a capella is almost all sorted out, and the Christmas song ‘vom Himmel hoch’ is also already in my head; I also want to work on the songs ‘Ach Gott vom Himmel sieh darein’ as well as ‘Wir glauben all’ an einen Gott’, ‘Verleih uns Frieden’, ‘Mitten wir im Leben sind’, and finally, ‘ein feste Burg’, though I am thinking of composing all of these last songs for chorus and orchestra.”79 Almost all of the plans mentioned in this letter were realized. As Hauser’s gift contained only texts without music, Mendelssohn jotted down a total of nine melodies as a sort of reminder to himself.80 The only chorale left unconsidered here was “Ein feste Burg”, which had played a prominent role immediately before the start of the journey in the finale of the Symphony in D minor MWV N 15, the so-called “Reformation Symphony”.81 At the beginning of December 1830, Mendelssohn thanked Hauser once again and confirmed: “Your Luther songbook has already served me quite well (it is lying next to me now and gives me joy daily) […].”82
73 Letter of October 16, 1830, to Carl Friedrich Zelter, D-B, N. Mus. ep. 460, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 108–111, quotation on pp. 110–111.
74 Notebook, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 30v. Entry for December 12, 1830.
75 Letter of December 14, 1830, to the family. The letter survived in three parts: Part I: to the mother, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 125, Part II (which contains the quotation): for Fanny Hensel, ibid., family letters, no. 100, Part III: for Rebecka Mendelssohn Bartholdy, D-B, MA Depos. Berlin 3, 37, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 168–170, quotation on pp. 169–170.
76 Other works from the Italian journey were also lost in the post, especially those sent from Venice. Other scores, however, such as “Aus tiefer Not” for C. F. Zelter, reached their recipients, see Table II.
77 Section of letter of October 2, 1830, to Eduard Devrient, for evidence see above letter of September 5, 1830, note 68.
78 D. M. Luthers geistliche Lieder nebst dessen Gedanken über die Musica […]. The exact bibliographical identification of the book (evidence in the chapter “Textvergleich” [text comparison] at the end of the Critical Report) was not possible until the beginning of the 1990s, see Wüster, Choralkantaten [note 12], pp. 477–480, which contains a facsimile of the title page on p. 477.
79 Letter of October 16, 1830, to Carl Friedrich Zelter, see above note 73, quotation on page p. 110.
80 Source references and transcriptions in the chapter “Choral notations and discarded passages” at the end of this volume.
81 See Series I, Volume 7 (2017) of this edition.
82 Letter of December 6, 1830, to Franz Hauser, location unknown (see below note 226 on the fire at the archives), quoted from the copy, D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [no. 2], pp. 10–19, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 155–159, quotation on p. 157.
The particular appeal of Luther’s texts for Mendelssohn is expressed in a passage in a letter to Carl Klingemann, which brings his desire to once again set texts by Klingemann together with his current projects: “With your words I have the feeling that I don’t need to make music, it is as if I can read the music already in them, as if it is already right in front of me. If other poems, namely those of Goethe, contain words that diverge from the music and seek to assert themselves alone, then your poems evoke musical sounds and are thus always true. Since then, I have felt this way in a similar respect only once, it was when I had to compose something for the Academy and, strangely enough, came with the songs of Luther, which an acquaintance in Vienna gave me as a present to bring on my journey; I beg you to read them, or if you cannot get them as a collection, then look up the following in the hymnal: ‘Mitten wir im Leben sind’ or ‘Aus tiefer Noth’ or ‘vom Himmel hoch da komm ich her’, ‘Ach Gott vom Himmel sieh’, ‘Mit Fried und Freud’, in short, all of them.”83 And he added: “How every word there calls for music, how every verse is a different piece, how there is progress, movement, and growth everywhere, it is all too wonderful, and I am composing it very diligently here in the middle of Rome, looking at the monastery where he lived and was inspired by the burning ambition of the men of the time.”84
Sometimes many weeks passed from the time Mendelssohn was first inspired and when he actually began composing. There were often considerable discrepancies between his plans and their actual implementation, especially those made on his long journeys, even though the image of a son working diligently abroad was important to convey to those at home. This also applies to the origins of the chorales “Vom Himmel hoch”, “Verleih uns Frieden”, and “Wir glauben all an einen Gott”, which are outlined below.
“Vom Himmel hoch, da komm ich her” [From Heaven Above to Earth I Come] MWV A 10
The first work in the series is dedicated to one of the best-known Christmas chorales. The approaching Advent and Christmas season was certainly a factor in Mendelssohn’s decision to set
this particular chorale to music first. In mid-October, while still in Venice, Mendelssohn already described the Christmas song as “in my head”85. He nevertheless sought assurances from Zelter with respect to his use of the chorale: “Please, write to me about my plan, and whether you approve of my keeping the old melody everywhere, but not binding myself to it, and, for example, using the first verse of ‘Vom Himmel hoch’ quite freely as a large chorus?”86 To his family, Mendelssohn showed his sense of humor by exaggerating about the project: “[…] but lest you think I am sunk in misery and torment, just think about this murderously amusing scandal: ‘Vom Himmel hoch’ with 20 trumpets and about three thousand trombones in C major; 2 flutes begin fortissimo all by themselves […].”87 Interestingly, the idea of a striking beginning in the flutes was retained in the composition. Mendelssohn’s immediate focus, however, would turn to other works first, such as the completion of the Latin Psalm 115. It should also be noted that Mendelssohn had been in Rome since November 1 and – as is documented in a number of letters – was fascinated by the city. Plans about compositions were again sent to Berlin at the end of November: “When the Hebrides are finished, I am thinking of doing Handel’s Solomon88 […] and of preparing it for a future performance, cuts and all. […] After this work is done, I plan to compose the Christmas music ‘Vom Himmel hoch’ and the A minor Symphony,89 and then perhaps some things for the piano and a concerto, etc., as it comes to pass.”90 In the end, it would take another two months to complete the work. The first goal was to finish by Christmas Eve: “[…] I am thinking of composing Luther’s chorale for Christmas, because this time I will have to do it on my own: this makes it a more serious matter […].”91 But there were repeated delays. In mid-January, Mendelssohn was able to announce that he was had “almost finished the Christmas song, which consists of 5 numbers”92. This remark raises the difficult question of which movement was added last, as the work consisted of six movements when it was finally completed on January 28, 1831: the stately opening chorus, which makes up more than half of the work, two arias, an arioso, a chorale, and the final chorus. The chorale, which in the manuscript follows the first aria somewhat abruptly, could, for example, have been added later.
83 Letter of December 26, 1830 / January 2, 1831, to Carl Klingemann, privately owned, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 182–186, quotation on p. 184.
84 Ibid.
85 Letter of October 16, 1830, to Carl Friedrich Zelter, for evidence see above note 73.
86 Ibid.
87 Letter of October 23 and 24, 1830, to the two sisters, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 13–14, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 113–117, quotation on p. 116.
88 George Frederic Handel, Oratorio Salomo (Solomon) HWV 67. While no sources of the 1830 arrangement remain, two organ parts connected with the performance at the music festival in Cologne in 1835 have survived. The organ part that had been owned by E. H. W. Verkenius (MWV, p. 506, source d), the location of which was still described as unknown in the 2009 Mendelssohn Thematic Catalogue [note 2] has since been located, see Alain Gehring, Händels ‘Solomon’ in der Bearbeitung von Felix Mendelssohn Bartholdy (1835), in: Die Musikforschung 65 (2012), issue 4, pp. 313–337.
89 A central theme of the correspondence is Mendelssohn’s work on the “Scottish” and “Italian” Symphonies.
90 Letter of November 22 to 25, 1830, to the two sisters (section of letter from November 23), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 23–24, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 138–141, quotation on p. 139.
91 Letter of December 20 and 21, 1830, to the family (section of letter from December 20), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 31–32, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 175–179, quotation on p. 177.
92 Letter of January 17, 1831, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 35–36, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 188–193, quotation on p. 189.
Mendelssohn was apparently dissatisfied with the result and therefore seized the opportunity to have the score carried by familiar hands to Berlin. On February 26, 1831, Emil Bendemann (1808–1882), brother of the painter Eduard Bendemann (1811–1889), left the Eternal City to return north. He had several gifts for the Mendelssohn siblings in his luggage: a drawing book (for brother Paul),93 a copy of the Hebrides Overture (for Fanny),94 and the original Weihnachtslied (for Rebecka). Both pieces of music contained a Message for the Bookbinder dated February 25, 1831.95 The message for “Vom Himmel hoch” was directed toward the younger sister: “Dear Beckchen, you should sing the G major aria, I don’t really know myself whether it is very boring or very pretty, since I sing it so poorly. Have the piece performed at the Sonntagsmusik, I hear you know the conductor of this concert, whose reputation has already reached Rome, so put in a good word for me. I am sending this music even though I had the least success with it among the new works and it still needs smoothing out around all its corners, but I am sending it because it is amusing. Then I would like to keep the others for a while in order to have something new to show. Devrient has to sing the arias and you can quarrel with him about them. The end of the aria is to be sung smorzando.”96 Whether the piece was actually performed at a Sonntagsmusik remains uncertain.97 In any case, we know that preparations were made for such a concert thanks to a surviving chorus part, albeit in fragmentary form, which was preserved in the family estate.98
“Verleih uns Frieden” [Grant us peace] MWV A 11
“Verleih uns Frieden” was one of the Lutheran hymns Mendelssohn already mentioned to Zelter on October 16, 1830. However, it was not until the end of January 1831 that work began on a composition based on this text. On January 24, 1831, Mendelssohn wrote: “My Christmas music will be finished in the next few days, then come two other Luther songs ‘Wir glauben all’ and ‘Verleih uns Frieden’, which I aim to finish in about 8 days, God willing. Then I still have to work on the two sym-
phonies and something for piano, and if I want to finish it all in 2 months, I have to keep at it […].”99 A few days later, Mendelssohn was somewhat more specific when writing to Hauser: “[…] and then comes the little song ‘Verleih uns Frieden’, as a canon with cellos and basses (the vocal basses begin).”100 In comparison to the six-movement Weihnachtslied “Vom Himmel hoch”, “Verleih uns Frieden” was indeed a small piece, both in terms of instrumentation and length. The score comprised six pages with a total of 102 bars. On a separate title page, Mendelssohn noted: Verleih uns Frieden. Choral by Dr. Luther for chorus and orchestra. The autograph was completed on February 10, 1831: “Thursday […] Morning. Work. (Verleih uns Frieden finished.)”.101 The piece is unique, above all because Mendelssohn used Luther’s text but not his melody. Thus, “Verleih uns Frieden” is the only work that is not based on a chorale melody, relying completely on a melodic line invented and developed by Mendelssohn himself.
The work seems to have brought the composer back to a good place creatively: “In general, I feel reinvigorated when composing, am making great progress on the Italian Symphony, the last movement of which will be the most cheerful piece I have yet written […]. ‘Verleih uns Frieden’ is finished, and ‘Wir glauben all’ will be finished in the next few days, it is only the Scottish Symphony that I can’t quite grasp yet; whenever I have a good idea these days, I want to write it down and finish it quickly.”102 At this point, there was nothing to suggest that, of all things, this “little song” would remain the only work from the collection of chorale arrangements based on Luther that would be published during Mendelssohn’s lifetime.103
“Wir glauben all an einen Gott” [We all believe in one God] MWV A 12
The fact that all of these works had a chorale as a textual or melodic basis did not prevent Mendelssohn from finding individual creative principles for each composition. To accomplish this, he drew from a broad reservoir of forms. The polyphonic element seems to have played a role from the outset in the last of
93 Wehner, Bildwerkeverzeichnis [note 57], pp. 324–325 (ZB 8).
94 Score in the hand of an Italian copyist, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 58, see Source Overview in Series I, Volume 8 (2006) of this edition p. 269, Source D as well as Series I, Volume 8A (2023).
95 This was a standard heading for messages sent with manuscripts within the Mendelssohn family. An analogous Message to the Custodian [Paul] was provided with the drawing book, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fol. 1, cf. the later formulation Recipe for the sisters, see below note 184.
96 Letter of February 25, 1831, to Rebecka Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 128, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note.32], pp. 217–218, quotation on ibid.
97 The piece is not found in the programs, which have so far only been reconstructed with significant gaps, see Hans-Günter Klein, “… mit obligater Nachtigallen- und Fliederblütenbegleitung”. Fanny Hensels Sonntagsmusiken, Wiesbaden, 2005.
98 See Critical Report, Source C
99 Letter of January 24, 1831, to Rebecka Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 126, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 193–197, quotation on p. 194. With “two months”, Mendelssohn is referring to the remaining duration of his stay in Rome.
100 Letter of January 30, 1831, to Franz Hauser, location unknown (see below note 226 on the fire at the archives), quoted from the copy, D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [Nr. 3], S. 20–23, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 197–199, quotation on p. 198.
101 Notebook, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 35r. This date also corresponds to the date of completion on the score.
102 Letter of February 22, 1831, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 40–41, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 212–216, quotation on p. 214.
103 For details on this topic, see the chapter “A realized publication: The prayer ‘Verleih uns Frieden’ MWV A 11”.
the works completed in Italy, “Wir glauben all an einen Gott”. Three days before Christmas, Mendelssohn sat down to report home: “The 21st. The shortest day is cloudy, as was to be expected, so today it is necessary to think of fugues, chorales, balls, and the like.”104 It was in this letter that the new work was mentioned explicitly for the first time, in the context of a seemingly anecdotal, yet quite realistic incident in his quarters: “But I am writing a grand fugue: ‘Wir glauben all’ and am singing it myself as well, so that my captain comes down the stairs startled, looks in and asks if I need anything. I then answer: a countersubject. But is there anything I am not missing!”105 For the entire month of December before this, Mendelssohn had been preoccupied with compositional work, above all with the completion of the Hebrides Overture and the Christmas presents (see Table II). However, neither the fugue “Wir glauben all” nor the actual Weihnachtslied, which Mendelssohn wanted to write himself, could be completed by the end of the year. Instead, the composer used the last days of 1830 to write three Latin pieces for female voices and organ, with the intention of dedicating them to the nuns at Trinità de’ Monti in Rome.106 A “Tantum ergo fertig”107 is also recorded in Mendelssohn’s notebook, although his wording leaves open the question of whether such a work was composed, copied, or merely read through. A month later, the situation regarding “Wir glauben all” had hardly changed. At least “Vom Himmel hoch” had been completed in the meantime: “The Christmas music is finished, and work on the other has begun […].”108 In the time that had passed, the idea of composing the work as one grand fugue had been modified in favor of a three-part form. Mendelssohn outlined his plans in a letter to Franz Hauser: “[…] now I am sitting in the middle of his ‘Wir glauben all’ an einen Gott’ which I am composing as three grand fugues […]. Then I want to stop with sacred music for Rome and start on my symphony in A minor; when it is all finished, there will be a sizeable pile of new music.”109 In the end, the work would not be completed until after the “little song” MWV A 11. It was not until March 1 that Mendelssohn wrote in his notebook: “Wir glauben all’ finished […]”110. The symphony project could finally be taken up, although no musical notations from this period have survived.111 In a letter summa-
rizing the situation of March 21, 1831, Mendelssohn explained: “For now, however, I am still working on a symphony, which unfortunately I will no longer be able to finish while here. You are familiar with fragments of it. Of the works after Luther, I have finished, apart from the pieces you already know about: ‘Das Weihnachtslied[’], Verleih uns Frieden, and ‘Wir glauben all’ an einen Gott[’], all three for chorus and orchestra.”112 Thus, the project with Luther’s texts had, for the time being, come to a conclusion.113 Mendelssohn’s departure from Rome was approaching with the end of winter. His time there was followed by a long stay in Naples (April 12 to June 3) with excursions to Amalfi, Capri, etc.114 This was followed by a return journey that lasted several months and included a trek across the Swiss Alps on foot. It was not until the beginning of September 1831 that Mendelssohn would arrive in Munich, where he then stayed for almost two months. The onward journey to Paris, which took the composer through Stuttgart and Heidelberg, began with a stop in Frankfurt am Main, where he hoped to reinforce his relationship with the Cäcilien-Verein. The choral society had been in existence since 1822, and Mendelssohn’s links would continue going strong even after the death of its founder and director Johann Nepomuk Schelble (1789–1837).115 Alongside the Berlin Sing-Akademie, the Frankfurt Cäcilien-Verein provided Mendelssohn with formative experiences with mixed choruses. Its tradition of well-rehearsed ensemble singing and its affinity with music of the past, especially Bach and Handel, were the reasons Mendelssohn always felt at home when taking part in Frankfurt’s choral culture. He made the most of his stay (from around November 11 to 18, 1831) by spending as much time as possible making music with others. Mendelssohn also allowed a number of copies of his sacred works to be made before having some of them sent to Berlin.116
“Ach Gott, vom Himmel sieh darein” [Oh God, look down from heaven] MWV A 13
Even before Mendelssohn had reached Frankfurt, “where I want to leave several of my Roman compositions for the Caecilien-
104 Letter of December 20 and 21, 1830, to the family (section of letter from December 21), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 31–32, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 175–179, quotation on p. 178.
105 Letter of December 20 and 21, 1830, to the family, ibid., quotation on pp. 178–179.
106 See Series VI, Volume 2 (2022) of this edition.
107 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 2, fol. 31v.
108 Letter of February 1, 1831, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fol. 37, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 199–202, quotation on p. 200.
109 Letter of January 30, 1831, to Franz Hauser, see above note 100.
110 GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 3, fol. 1r.
111 On this idiosyncrasy see Series I, Volume 5 (2005) of this edition, pp. XXIII–XXIIV.
112 Letter of March 21, 1831, to Franz Hauser, location unknown (see below note 226 on the fire at the archives), quoted from the copy D-B, MA Nachl. 7; 30, 1 [no. 4], pp. 24–27, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 235–237, quotation on p. 237.
113 Mendelssohn returned to Luther’s “Wir glauben all an einen Gott” a few years later while working on the oratorio Paulus, where the chorale plays a leading role within the chorus “Aber unser Gott ist im Himmel” (part of no. 36).
114 See Klein, Die Mendelssohns in Italien [note 53], p. 51.
115 Ralf Wehner, “in Schelbles Geist, Sinn und Richtung”. Felix Mendelssohn Bartholdy und der “Cäcilien-Verein”, in: “Die Leute singen mit so viel Feuer ” Der Cäcilienchor Frankfurt am Main 1818 bis 2018, ed. by Daniela Philippi and Ralf-Olivier Schwarz in association with the Cäcilien-Verein, Frankfurt am Main, Frankfurt a. M., 2018, pp. 39–51. In addition to the historical spelling “Cäcilien-Verein” used here, Mendelssohn and his contemporaries also referred the society as the “Cäcilienverein” or “Caecilienverein”.
116 On this last-mentioned aspect, see the chapter “Influence and lasting impact – Early reception”.
verein”,117 plans for a further chorale arrangement had been made. The composer reported from Munich while in the middle of work on his new piano concerto: “But I have some powerful sacred music in my head again, which, God willing, will be my first piece in Paris […].”118 This passage in the letter is revealing, as it proves that “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” was intended from the outset as a project for Paris, where the second winter of the journey was to be spent. The performances under Schelble and the renewed contact with the Frankfurt Cäcilien-Verein may have provided additional inspiration for Mendelssohn. Nevertheless, Paris – similar to Rome the year before – was so full of distractions that he had to go to great lengths to force himself to compose. This becomes clear in a letter in which Mendelssohn involved his older sister in an imaginary conversation: “[…] that’s that, you say, withdraw and isolate yourself in Rue Lepelletier no. 5, and write your music to ‘Ach Gott vom Himmel’ or a symphony, or your new violin quartet […].”119 “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” was not completely finished until the beginning of April 1832. It must be noted, however, that Mendelssohn was also working on the impressive ‘Ballade’ Die erste Walpurgisnacht and other pieces at the same time, and was also preparing several compositions for publication (see Table II). He finished the work on the morning of April 5.120 However, a later remark describes how this was done “in great haste”,121 as the score was to be taken to Frankfurt by Ferdinand Hiller that same day. Mendelssohn explained the exact circumstances a few days later: “New church music for the Cäcilienverein has also been completed and has already been sent to Schelble with Hiller. He left Paris on Thursday [April 5] and is one of the few who did not leave out of fear, but really planned to go. So you can see that I am still in good spirits musically, even if the people around me are not at all. By the way, Schelble is to have this church music copied and sent to you; so don’t be surprised if it arrives without a word, treat it well and invite it to dinner.”122
After his score was sent away, thoughts of the Luther chorales were once again put on hold for some time. It was not until three years later that Mendelssohn returned to this project in connection with publication plans that included sacred works.
The publication of the works with the opus numbers 1 to 10 in the 1820s was essentially initiated and organized by Mendelssohn’s parents. During his trip to England in 1829, Mendelssohn made his first personal contact with publishers. This resulted in the publication of Symphony No. 1 in C minor, which later received the opus number 11.123 On his extended journey from 1830 to 1832, discussions with publishers in Leipzig, Vienna, Bonn, and London led to further publications. The travel letters occasionally reveal Mendelssohn’s joy in connection with being able to earn his own money with his compositions, describing with regard to the Octet and Quintet in Paris that “publishing the pieces costs nothing, on the contrary, it earns me something”124. The possibility of earning money also with church music was a new experience for him. At the end of his journey, in London in 1832, Mendelssohn even received offers in this regard: “I have to publish various things before I travel and earn some money; but I receive commissions from so many places, and some of them so pleasant, that it is really difficult for me not to start them. Among other things, I received a letter this morning from a publisher who wants to publish two large church pieces in score, one for the morning, the other for the evening”.125
In the following years, Mendelssohn also made several attempts to publish his chorale arrangements; it is conspicuous that the three pieces “Jesu, meine Freude”, “Wir glauben all an einen Gott”, and “O Haupt voll Blut und Wunden” did not play a role in his selection, and that two older pieces from the 1820s were considered instead. On his way from Frankfurt to Düsseldorf, Mendelssohn already passed through Bonn in November 1831, where he contacted N. Simrock. The three motets composed in Vienna and Venice, “Aus tiefer Not”, “Mitten wir im Leben sind”, and “Ave Maria” (see Table II), appeared as the first publication, under the title Kirchenmusik op. 23. As it was not possible to have copies made of the works, Mendelssohn even used the original manuscripts as engraver’s copies. After Mendelssohn’s experiences with N. Simrock, it seemed appropriate that the latter should be entrusted with the next church compo-
117 Letter of October 31, 1831, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 138, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 410–411, quotation on p. 411.
118 Letter of September 27, 1831, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 137, printed in: Sämtliche Briefe, Bd. 2 [note 32], pp. 400–402, quotation on p. 401.
119 Letter of December 28, 1831, to Fanny Hensel, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 99–100, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 442–445, quotation on p. 442.
120 Paris Diary-Notes, D-B, MA Ms. 143, p. 5: “Thursday. […] Vis. Cherubini, Devrient, Eichthal, Hiller. Morning. Work on Ach Gott vom Himmel finished.”
121 Undated letter of February 1835 to Fanny Hensel, D-B, MA Ep. 196, see below note 136 and the corresponding quotation.
122 Letter of April 9, 1832, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 151, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 512–513, quotation on p. 512. The requested copy was made in Frankfurt and sent to Berlin, see Critical Report, Source C. In the further history of the work it played a mediating role for a further copy, see the chapter “Publication plans”.
123 MWV N 13. The work was first published in 1830 by J. B. Cramer, Addison & Beale without an opus number as a Grand Symphony in a special chamber music version for piano four hands with violin and violoncello ad lib. See Series I, Volume 4A (2002) of this edition.
124 Letter of January 21, 1832, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), section of letter for Fanny Hensel, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 99–100, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], p. 466–469, quotation on p. 466.
125 Letter of June 1, 1832, to the family (posted to Abraham Mendelssohn Bartholdy), GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 119–120, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 548–550, quotation on p. 550. As a result of this commission, the English Te Deum “We praise thee, O God” MWV B 25 was composed in August 1832 for the Morning Service.
sitions as well. On October 1, 1833, Mendelssohn took up the position of municipal music director in Düsseldorf, whose duties also included the organization of Catholic church music at the two city churches, St. Lambertus and St. Maximilian.126 This led to a performance in the summer of 1834 of “Verleih uns Frieden”, among other pieces.127 And so, just under six months later, it was clear that this work would be included in his plans: “[…] I also want to publish six fugues and dedicate them to old Attwood,128 as well as three small pieces of church music. I am now asking you, Fanny, for some advice as to which three I should take; Verleih uns Frieden must be one of them, but then I would like to have all three in German and do not know which two others I should choose, please tell me which two you would pick […].”129 In mid-February, Mendelssohn wrote to his friend Klingemann: “[…] I am now publishing three pieces of sacred music again, including ‘Verleih uns Frieden’, which you probably know,130 to this they can sing the Lord is a man of war.”131 A brief but intense exchange of letters between the Mendelssohn siblings about the two other works in question took place at around the same time. At the end of a letter from Düsseldorf, the composer asked his older sister: “Oh, one more request, a business request: please have copied for me the scores of my pieces ‘ach Gott vom Himmel’ (A minor), which I once sent you,132 and ‘Christe Du Lamm’ (F major), if you have the latter, and send them to me without delay. One of them needs to be published. Also, you haven’t answered me as to which one?”133 On February 17, 1835, Fanny Hensel responded in detail, suggesting a third work, “Wer nur den lieben Gott lässt walten”, and putting her concerns regarding the final chorus of “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” to paper: “The two pieces you requested are about to be sent, I am just waiting to receive one of them back from the copyist.134 As far as the publication is concerned, I was wondering whether you may have forgotten: Wer nur den lieben Gott läßt walten, I like it very much, and if I had to choose from the 2 mentioned, it would be Christe du Lamm Gottes. From [‘]ach Gott vom’, I particularly like the first number, especially beginning with the
unison, where it is very serious and beautiful all the way into A major. The aria is unique, and the music as beautiful as the words, but I can’t help but take issue with the last number. Please don’t think that I am just trying to get back at you with my criticism, by no means, this is truly not the case. But it begins in F-sharp minor and ends in A minor, or rather in E major, with a few modulations in between, and yet I believe the words call for utmost resolution and persistence in the chorale. If we were together, we would easily come to an understanding about this. Thus, I ask you to answer me and tell me to what extent you may have changed your mind in the couple of years that have passed since the composition. The aria from: Wer nur den lieben Gott makes me feel it necessary to tell you that I find a kind of habit in several solo parts in your short sacred pieces, which I would not like to call manner, and do not quite know how to describe, namely, something overly simplistic that does not seem quite natural to you, a type of short rhythms, for example, that have something childlike but also something childish, and do not seem quite appropriate, neither to the whole genre nor to your serious approach to choruses. Here I am thinking mainly of the aria from the Christmas music, where I can understand well what you were thinking, but the principle seems to me to be the same in several others as well. If there is time before we meet, it would be nice if we could make the selection together, because, to give you an informed opinion, I do not remember well enough all of the music which I do not own.”135
Mendelssohn’s reply came immediately: “Unfortunately, the publication of the church music does not have time until we speak. But you are also a superb cantor, as you are so gentle and unassuming in confessing that you do not like the last chorale of ‘Ach Gott vom Himmel’. It is an acknowledged truth that it is no good. But remember, I made it in great haste in order to send the piece to Frankfurt in time as promised, and that is my only justification for the monster with the F-sharp minor head and the E major tail. When I wrote to you about this, I said to myself ‘when the time comes, you’ll write another ending’, and
126 On his service obligations and the associated compositions, see Series I, Volume 10 (2019) of this edition, pp. XXXIV–XXXVII.
127 For evidence see chapter “Influence and lasting impact – Early reception”.
128 The “6 fugues” ultimately became 6 pieces – albeit two years later – namely, three Preludes and Fugues op. 37. Mendelssohn first completed the duets Two Fugues for the Organ MWV V 1 for Attwood on January 11, 1835.
129 Letter of December 11, 1834, to Abraham Mendelssohn Bartholdy, section of letter for Fanny Hensel, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 215, printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, vol. 4, ed. and with commentary by Lucian Schiwietz and Sebastian Schmideler, Kassel etc., 2011 (hereafter: Sämtliche Briefe, vol. 4), pp. 107–109, quotation on p. 108. The phrase “all three in German” could have been made with the Latin women’s choruses in mind, which were initially excluded due to their language.
130 When exactly Klingemann heard or saw the piece is still to be determined.
131 Letter of February 16, 1835, to Carl Klingemann, privately owned, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 4 [note 129], pp. 171–173, quotation on p. 172. The quote “the Lord is a man of war” was an allusion to the bass duet of the same name from Handel’s oratorio Israel in Egypt, which, according to a previous letter from Klingemann, had been performed in London in a concert with an English adaptation of Mendelssohn’s “Ave Maria”, letter of February 3, 1835, from Carl Klingemann to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 30, Green Books IV-9.
132 There must be a gap in Mendelssohn’s memory here, as the family only had the source for a copy (designated as Source C in this volume), which was taken from the autograph score (Source B) in Frankfurt and sent from there to Berlin according to Mendelssohn’s instructions.
133 Letter of January 30 and February 1, 1835, to Fanny Hensel (section of letter from February 1), D-B, MA Depos. MG 28, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 4 [note 129], pp. 155–156, quotation on p. 156. An answer to Mendelssohn’s request of December 11, 1834, (see note 129 above) had therefore not yet been provided.
134 This formulation suggests that these could be the two copies of MWV A 5 and A 13 from Autograph Volume 21, which were made by a copyist.
135 Letter of February 17, 1835, from Fanny Hensel to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 30, Green Books IV-13, first printed in: The Letters of Fanny Hensel to Felix Mendelssohn. Collected, Edited and Translated with Introductory Essays and Notes by Marcia J. Citron, [Stuyvesant, New York] 1987, pp. 489–491, quotation on p. 489.
so it is at the very least appropriate that you would say the same thing in Berlin; that is usually what happens with us.”136 In the meantime, Mendelssohn had to convince the publisher to wait a while for his decision: “It will perhaps take a week or 2 longer with the 3 church music pieces for chorus and orchestra, but I would still be happy if they also appear in your current catalog, and I will certainly be able to send you the finished manuscript by the end of March.”137 In the end, the composer placed the decision as to which works would be better suited for publication in the hands of the Bonn publisher: “At the same time, I would ask you to tell me if it would suit you if a larger psalm (of 4 numbers, 2 choruses and 2 solo pieces) were published instead of the 3 smaller pieces of church music? I am still undecided about this and would like to know your opinion so that I can get the manuscripts in order soon in either case.”138 Simrock clearly preferred a larger work to the three smaller ones, so that Mendelssohn was able to make his decision and write on April 10, 1835: “Following your kind reply, I have now decided on the psalm and will send you the score of it next week.”139 The psalm in question was Psalm 115 “Non nobis Domine” op. 31 MWV A 9, composed in Rome, which Mendelssohn himself translated from the Vulgate into German for the edition: “Nicht unserm Namen, Herr, nur deinem geheiligten Namen sei Ehr” [Not unto us, O Lord, but unto thy name give glory]. Meanwhile, Mendelssohn even entertained the idea of publishing the Roman motets for women’s chorus, which were also unpublished. Again, the family was consulted first: “And then there must be some church music, I just can’t yet find three that seem quite suitable to me. The nuns’ pieces would be quite good […] but the third (in A major)140 is simply not that good. I lack the time, the desire, the text, and the nuns to compose a new one.”141 Thus, Simrock’s decision in favor of a larger work had initially displaced Mendelssohn’s uncertainty about the other sacred pieces. The “nuns’ pieces” were not published
by N. Simrock until 1838, after extensive revision, as Drei Motetten für weibliche Stimmen mit Begleitung der Orgel [Three motets for female voices with organ accompaniment] op. 39 (MWV SD 17).
The chorale arrangements therefore remained unpublished. Mendelssohn made another attempt a year and a half later, when he was living in Leipzig. In February 1837, he asked his old acquaintance Thomas Attwood via Klingemann “whether he would allow me to dedicate to him 3 pieces of church music for chorus and orchestra that I now want to publish? Or is such a request not necessary in England?”142 The request to Attwood was logical insofar as he had already received as gifts from Mendelssohn “Christe, du Lamm Gottes” in 1829 and the “O Haupt voll Blut und Wunden” in 1832, both in copies, and was therefore more familiar with Mendelssohn’s style of chorale arrangement than almost anyone else outside the family. “Attwood accepts the dedication with joy […]”, Klingemann was able to report in his next letter.143
This time, Mendelssohn chose the publisher Breitkopf & Härtel, with whom he had been in close contact, especially since his move to Leipzig in 1835.144 On March 11, 1837, Mendelssohn returned to his old plans, which had not been realized in 1835, and now made the following offer to Breitkopf’s managing directors: “I ask you, most honorable sir, to let me know whether you would be willing to publish some of my compositions for the church. I would now like to have three larger fugues for the organ printed at the same time as the piano fugues, or at least soon after them,145 and later in the spring three church cantatas for orchestra and chorus, with German and English texts, and I would be delighted if something of this kind were to be published by you. […] However, I would only be able to send you the manuscript of the 3 church music pieces later, and thus would then write to you again.”146 The description of the works as “church cantatas” is revealing here, as is the idea of now offer-
136 Undated letter to Fanny Hensel, which was erroneously dated April/May 1835 by a third party. The probable date of February 27, 1835, can be inferred from the content of the letter and the fact that the letter was announced by the father on February 26, 1835, D-B, MA Ep. 196, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 4 [note 129], pp. 181–182, dated there “Februar 27(?), 1835”, quotation on p. 182, “Cantor” transcribed there as “Censo[r,]”.
137 Letter of February 25, 1835, to N. Simrock, D-B, MA Ep. 25, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 4 [note 129], pp. 174–175, quotation on p. 174.
138 Letter of March 28, 1835, to N. Simrock, D-B, MA Ep. 26, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 4 [note 129], pp. 206–207, quotation on p. 206. The letter from Simrock, which, according to the corresponding note on the letter, was answered on March 30, 1835, is not included in the Green Books, but its content can be inferred from Mendelssohn’s following letter.
139 Letter of April 10, 1835, to N. Simrock, location unknown, quoted from the facsimile from a sales offer by the company Antikvariat Arnold Busck, Kopenhagen, at the 8th European Antiquarian Bookfair in Amsterdam (organized by the Nederlandsche Vereenigung van Antiquaren), which took place from February 26 to March 1, 1987, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 4 [note 129], pp. 220–221, quotation on p. 221. The publisher ultimately received the score of Psalm 115 op. 31 promised by Mendelssohn with his letter of May 19, 1835, D-B, MA Ep. 27
140 The “O beata et benedicta” MWV B 22 was then replaced years later by a newly composed “Laudate pueri Dominum” MWV B 30.
141 Letter of March 31 and April 2, 1835, to Rebecka Dirichlet, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 227, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 4 [note 129], pp. 207–210, quotation on p. 208.
142 Letter of February 18 to 20, 1837, to Carl Klingemann, privately owned, printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, vol. 5, ed. and with commentary by Uta Wald in association with Thomas Kauba, Kassel etc., 2012 (hereafter: Sämtliche Briefe, vol. 5), pp. 206–207, quotation on p. 207.
143 Letter of March 10, 1837, from Carl Klingemann to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 32, Green Books VI-24. In the end, the Preludes and Fugues for the Organ op. 37 were “dedicated with reverence and gratitude” to the organist Attwood.
144 On Mendelssohn’s general relationship with the publisher, see Ralf Wehner, 17 Jahre mit dem Komponisten, mehr als 170 Jahre für den Komponisten. Felix Mendelssohn Bartholdy und das Verlagshaus Breitkopf & Härtel, in: Breitkopf & Härtel. 300 Jahre europäische Musik- und Kulturgeschichte, ed. by Thomas Frenzel, Wiesbaden, 2019, pp. 169–178.
145 The collections Six Preludes and Fugues op. 35 for piano and Preludes and Fugues op. 37 for organ were published in 1837/1838 by Breitkopf & Härtel and in parallel by English and French publishers, see MWV SD 14 and SD 15.
146 Letter of March 11, 1837, to Breitkopf & Härtel, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (hereafter: D-DS), no individual signature (like all Breitkopf letter in this archive), printed in: Sämtliche Briefe, vol. 5 [note 142], p. 222.
ing the works in English as well as in German, which also fit well with the planned dedication to Attwood. At the same time, Mendelssohn was negotiating with Simrock about the “nuns’ pieces”: “I would also like to publish a booklet of three small pieces of church music (for female voices alone) in the course of the next few months, and I would be delighted if they could also be published by you.”147 Mendelssohn was away from Leipzig between mid-March and the end of September 1837. On March 28, 1837, he was wed to Cécile Jeanrenaud (1817–1853) in Frankfurt am Main. This was followed by an extensive honeymoon.148 At the end of August, Mendelssohn traveled to London and from there to the music festival in Birmingham, where he was to conduct his Paulus and premiere the Second Piano Concerto op. 40 MWV O 11.149 Mendelssohn did not return to Leipzig until October 1, 1837.150
The decision to abandon the “church cantatas” project must have been made during the journey. Heinrich Conrad Schleinitz (1802–1881) was the first to be informed of the decision in a notification from Frankfurt am Main, which also reveals which two works were originally planned: “By the way, I have now decided not to publish either ‘Verleih uns’ or the Christmas music151 here, but to publish the former at a later date. Instead, however, I want to have my new psalm printed soon, because I like it so very much now.”152 The new psalm was Psalm 42 “Wie der Hirsch schreit” op. 42 MWV A 15, which was largely composed on the honeymoon. A little later, Mendelssohn, now in Koblenz, wrote to the Leipzig publisher and informed him of his decision: “Instead of the 3 smaller pieces of church music, which are partly earlier works and which I do not even know for certain whether I will publish at all, I am bringing to you in Leipzig the manuscript of a larger work, the 42nd psalm, which seems to me to be the best that I have composed in this style and which I would like to see published by you.”153 Thus, in the end, the publication of chorale arrangements was postponed twice – in 1835 and 1837 – in favor of the publication of a psalm cantata. The repeated attempts to publish the pieces, even if they belonged to the “earlier works”, are, at the very least, evidence that Mendelssohn valued them more than may appear when considering only the final decision not to publish them.
A realized publication: The prayer “Verleih uns Frieden” MWV A 11
On June 5, 1839, a rather remarkable notice by Breitkopf & Härtel appeared in the Allgemeine musikalische Zeitung (AmZ ): “To the honored readers of the Allgemeine Musikalische Zeitung. Autographs of the most famous living composers in the most faithful fac-simile as supplements to the Allgemeine Musikalische Zeitung. Already at the beginning of this year, we promised the honored subscribers of the Allgemeine Musikalische Zeitung that a series of interesting supplements would follow. We hope to stay true to this promise in every sense possible by including a series of autographs of the most famous living composers in completely faithful facsimiles with the journal from today on. We have specially requested and been promised autographs for this purpose, and all have been prepared in the format of the newspaper. The series will begin with ‘Verleih’ uns Frieden’ by Dr. Felix Mendelssohn-Bartholdy, which accompanies this issue, and we need only mention the names Adam, Auber, Halevy, Meyerbeer, Onslow, Reissiger, Spohr, and Thalberg to draw attention to the value of what will follow at first. Leipzig, June 1839, Breitkopf and Härtel.”154 Seven pages in length, the enclosed reproduction of Mendelssohn’s manuscript was quite extensive. A reproduction of his handwritten signature at the end also enhanced its graphic appeal and its sentimental value for music lovers. The printing was preceded by a lengthy preparatory phase which began in February 1839. By this time, 43 of Mendelssohn’s works had been published with opus numbers, and a few without. Among them were the church music collections op. 23 and op. 39, the oratorio Paulus op. 36 as well as the Psalm 115 op. 31 and Psalm 42 op. 42. After several unsuccessful attempts to publish “Verleih uns Frieden” together with two other works, the new series in the AmZ provided an opportunity for the now eight-year-old work, which had been performed and revised several times since,155 to reach the public in a unique way. In accordance with the dimensions and significance of the work, the composer decided not to give it an opus number. At the time, Mendelssohn was busy with corrections of his String Quartets op. 44 and his Psalm 42. At the same time, preparations were underway for the premiere of Franz Schubert’s “Great” Symphony in C major D 944, which
147 Letter of 6. April 6, 1837, to N. Simrock, Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf, 54.81, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 5 [note 142], p. 240. This project was successful, the works were released as op. 39.
148 Peter Ward Jones, The Mendelssohns on Honeymoon. The 1837 Diary of Felix and Cécile Mendelssohn Bartholdy. Together with Letters to their Families, Oxford, 1997, German edition: Felix und Cécile Mendelssohn Bartholdy, Das Tagebuch der Hochzeitsreise nebst Briefen an die Familien, ed. by Peter Ward Jones, Zürich and Mainz, 1997.
149 See Series II, Volume 3 (2004) of this edition.
150 Mendelssohn arrived in Leipzig at 2 pm that day and conducted the concert in the Gewandhaus at 6 pm, according to the letter of October 4, 1837, to Lea Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 338, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 5 [note 142], pp. 343–348.
151 “Vom Himmel hoch” had as of yet not been named. It is not known today what the third work was.
152 Letter of July 3, 1837, to Heinrich Conrad Schleinitz, location unknown, quoted from the first printing: Ein ungedruckter Brief von F. Mendelssohn-Bartholdy an Herrn Concertdirector Conrad Schleinitz in Leipzig, in: Die Tonhalle. Organ für Musikfreunde 1 (1868), no. 33 (November 9), p. 525.
153 Letter of August 5, 1837, to Breitkopf & Härtel, D-DS, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 5 [note 142], pp. 318–319, quotation on p. 319.
154 Allgemeine musikalische Zeitung 41 (1839), no. 23 (June 5), cols. 451–452. Italics in original.
155 For details on this topic see the chapter “Influence and lasting impact – Early reception”.
Mendelssohn conducted on March 21, 1839. The directors of the publishing house, Raymund Härtel (1810–1888) and Dr. Hermann Härtel (1803–1875), were therefore already in close contact with Mendelssohn at the time. Breitkopf & Härtel’s plans for a series of facsimile reproductions in its AmZ – and the fact that a work by Felix Mendelssohn Bartholdy would provide the series with an illustrious beginning – may have come up in one of their personal meetings with Mendelssohn. The first agreements were made verbally, as the first letter regarding the series, sent to Mendelssohn on March 9, 1839, already contained special manuscript paper in the format of the AmZ, “which we kindly ask you to use for ‘Verleih uns Frieden’, as promised for our music journal.”156 One day after the performance of Schubert’s symphony, Mendelssohn was able to reply: “Your honourable sir shall receive enclosed the piece ‘Verleih uns Frieden’, which I wrote on the paper you recently sent me in accordance with your request. If you enclose it with the music journal, I would ask you to include it as a supplement that you have provided and not I. I would like the title to be: Gebet, nach Worten von Luther componirt von F.M.B. [Prayer, after words of Luther composed by F.M.B.]”157 The publisher suggested adding a signature at the end of the composition, to which Mendelssohn replied: “Of course I will be quite happy to put my name and the date under the score if you wish. However, since it is to be a facsimile of my handwriting, and I never write my name under my notes, indeed am predjudiced against it in a way, I thought that it should not appear on this piece either, as it has not been done on any other. But I can certainly imagine that the name is particularly important in an autograph, and if this is the case, please let me know and I will then return the manuscript with my signature.”158
The “honored readers” of the AmZ were thus able to enjoy a largely error-free score in Mendelssohn Bartholdy’s handwriting. This was the very first publication of an autograph score by the composer. The original manuscript first remained in the possession of the Härtel family until the early 1950s and was then acquired by a Swiss private collector. Only in connection with the present edition was it possible to compare Mendelssohn’s original with the “completely faithful fac-simile” (AmZ). The reproduced score is at first glance clearly recognizable as
Mendelssohn’s handwriting and testifies to the high quality of the lithographic technique of the time, without which such a detailed reproduction would not be possible. A close analysis shows, first of all, that the publisher observed a number of typographical details in an exemplary manner. However, it is also clear that dynamic and articulation markings were not transferred in several places and that corrections were presented only selectively. This retouching gave the facsimile score the character of a fair copy, which the original did not have.159
Parallel to the journal supplement, Mendelssohn prepared the regular printed edition of the work, which, apart from the German text, was to contain a Latin translation and a special dedication. Mendelssohn sent a new piano reduction with the template for the facsimile: “In the separate edition, I would also like a dedication inserted on the title page, namely, composed and dedicated to Mr. President Verkenius with sincere respect by F. M. B. There, the Latin words must also be added beneath. The same applies to the piano reduction which I have prepared160 and am now sending you enclosed. Please place the vocal parts from the score above it. I would ask for 12 Louis as a fee. You will probably send me a revision of all three, scores and piano reduction, as well as of the title.”161 The aforementioned president Erich Heinrich Wilhelm Verkenius (1776–1841) had been an acquaintance of Mendelssohn since his time in Düsseldorf.162 Verkenius lived in Cologne and, from 1821, was an influential member of the organizing committee of the Lower Rhine Music Festival. It was primarily in this capacity that he came into contact with Mendelssohn, with whom he soon became friends despite a full generation separating the two.163 The addition of the Latin text can be seen as a concession to the Catholic environment of the Rhineland. However, the template for this second text underlay created unexpected difficulties. Even before submitting the manuscript, Mendelssohn asked Dr. Hermann Härtel: “[…] since my efforts at the Thomasschule were in vain, I ask you to obtain a Latin translation of Luther’s words quaest.164 from your friend. The titles of the verses are: [text follows]”.165 The letter continues: “The beginning ‘Da nobis pacem Domine’ fits excellently, also to the music”,166 and further: “Most important is that the rhythm and accent be retained exactly […].”167 As a translation could not be obtained so quickly, Mendelssohn
156 Letter of March 9, 1839, from Breitkopf & Härtel to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-87.
157 Letter of March 22, 1839, to Breitkopf & Härtel, D-DS, printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sämtliche Briefe, vol. 6, ed. and with commentary by Kadja Grönke and Alexander Staub, Kassel etc., 2012 (hereafter: Sämtliche Briefe, vol. 6), pp. 349–350, quotation on ibid.
158 Letter of March 24, 1839, to Dr. Hermann Härtel, D-DS, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 6 [note 157], p. 353.
159 For exact details, see Critical Report, Deviations in the Content of Source I
160 The piano reduction was notated anew for publication. Although Mendelssohn had already made such an arrangement for Rosamunde Mendelssohn for Christmas 1833 (see Critical Report, Source D), this excerpt was not available in Leipzig and was not suitable as an engraver’s copy due to deviations in content (see the reprint of this version in this volume).
161 Letter of March 22, 1839, to Breitkopf & Härtel, for evidence see above note 157.
162 On the relationship between the two, see Großmann, Vergangenheit [note 17], pp. 218–219.
163 The repeated reminders in correspondences with Breitkopf & Härtel that Verkenius should receive a copy demonstrate how important this personal matter was to Mendelssohn.
164 quaest., abbreviation for quaestionierten = in question, comes from the Latin word quaestio = question.
165 Letter of March 16, 1839, to Dr. Hermann Härtel, location unknown. The quotations are reproduced here according to three catalogues. This text is quoted from J. Halle, Munich, Catalogue 39 [1907], no. 116.
166 Ibid., quoted here from the last trace of the letter: J. A. Stargardt, Berlin, Catalogue 292, Autographen aus den Gebieten der Musik […] (May 1929), no. 82.
167 Ibid., quoted here from: Karl Ernst Henrici, Berlin, Auction Catalogue CXXXV, Autographen (June 25, 1928), no. 386. Underlines have been added to represent expanded letter spacing in the catalogue.
himself translated the short text into Latin – as he had already done with his Psalm 115 – and enclosed it with the letter of March 24, 1839: “The Latin text is enclosed.”168 It should be mentioned for the sake of thoroughness that a certain Mr. Herold169 wrote to Mendelssohn on the occasion of the Leipzig premiere on October 30, 1839, more than half a year later and long after the edition had been published. He reminded the composer that he was supposed to prepare a translation, which he sent with the letter.170 It is not known whether Mendelssohn responded to this belated assistance.
On his way to the 21st Lower Rhine Music Festival, which took place in Düsseldorf from May 19 to 21, 1839, Mendelssohn spent a few days in Frankfurt am Main in late April and early May. Thanks to this circumstance, posterity is well informed about the further fate of the first edition of “Verleih uns Frieden”, as this stop meant that all arrangements now had to be made by post. At the beginning of May, Mendelssohn first assumed that the edition would soon be published. He wrote from Frankfurt: “As soon as my ‘Verleih uns Frieden’, in the separate edition with the dedication to President Verkenius, is ready, I would ask you to send a copy to Cologne in my name.”171 However, the reply revealed that there had been a delay and that not even the title of the work had been decided yet: “Will you have the kindness to share with us the title and dedication of ‘Verleih’ uns Frieden’ again, or rather – forgive the haste and disorder of my letter – only the title (I can find the dedication in your letter of March 22), in other words, the actual name of the piece – I believe ‘Prayer’ – and should this be described in more detail?”172 At the same time, Mendelssohn’s wish was confirmed: “As soon as ‘Verleih’ uns Frieden’ is finished, we will not fail to send a copy to Mr. Verkenius in accordance with your instructions.”173 The enquiry led to a lengthy letter. The difficulties in replying were mainly due to the fact that Mendelssohn – still in Frankfurt am Main – did not have the manuscripts at his disposal: “The title you ask for is, if I am not mistaken: Prayer, after words of Luther composed und dedicated to &c &c …… by FMB. Please place the dedication in the title exactly as I indicated. If my earlier indication of the title can still be found, and if it differs from this, please follow the earlier one. If there is still time, perhaps you
will send me a revision of the separate edition as well as of the title – if not, I will trust the Leipzig editors’ accuracy and corrections. Novello, who is publishing the piece in London, tells me that he thinks he can sell several copies of the facsimile score in England, if you would like to send him some; I am faithfully informing you of this, although I do not know whether this is suitable to you.”174
The London publisher Joseph Alfred Novello (1810–1896) had been informed of Mendelssohn’s plans in early March 1839 in a letter that has not survived. The letter was not sent by post, but passed on in person by Ferdinand David (1810–1873).175 Novello contacted Mendelssohn two months later: “I have great pleasure in becoming the purchaser of the english copyright of your prayer for chorus and orch: at the price you name five guinees […].“176 The letter suggested a publication date of May 25, 1839. Two days before this, on May 23, Mendelssohn – still in Düsseldorf – completed the formal business agreement: “Received of Mr. J. A. Novello the sum of five Guinea’s for the English Copyright of my ‘Prayer’ for Chorus in [sic] Orchestra in E flat 3/4”.177 There is nothing to suggest that Mendelssohn had any influence on the content or design of the English edition. The production process in Leipzig had by this time entered its decisive phase: “You are receiving enclosed for revision, ‘Verleih’ uns Frieden’, score and piano reduction, and we will consider sending copies of the autograph to Mr. Novello. The series you have opened has already grown quite considerably.”178 Breitkopf added as a postscript: “I would kindly ask for the corrections to be returned soon […].”179 Mendelssohn complied with this request in no time at all. Not even a week after Breitkopf sent the corrections from Leipzig, he was already able to send them back from Frankfurt: “The corrections you sent are hereby returned. There were still significant errors, which I would like to have corrected very carefully.”180
In September 1839, Mendelssohn asked Verkenius about the score, at the same time suggesting that the work also be used for the Catholic rites: “My ‘Verleih uns Frieden’ is hopefully already in your hands; at least I hear from Breitkopf & Härtel that it left two months ago. I hope they have also sent parts, otherwise I will send them to you later; perhaps you can use it as a gradual or offertory in church if you have an abundance of cellos.”181
168 Letter of March 24, 1839, to Dr. Hermann Härtel, D-DS, see above note 158.
169 According to the Leipzig address book for the year 1839, there were two teachers with this name working in Leipzig at this time: an emeritus J. Chr. Herold (p. 65) and a teacher who is simply referred to as “M[agister] Herold” from the elementary school associated with the Bürgerschule [vocational middle school] (p. 64). It is also possible that it was the town councillor Georg Eduard Herold.
170 Letter of October 30, 1839, from Herold to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 36, Green Books X-113.
171 Postscript to the letter of May 8, 1839, to Breitkopf & Härtel, D-DS, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 6 [note 157], p. 391.
172 Second postscript to the letter of May 15, 1839, from Breitkopf & Härtel to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-158.
173 Ibid.
174 Letter stamped May 30, 1839, to Breitkopf & Härtel, D-DS, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 6 [note 157], pp. 393–394, quotation on p. 394.
175 David mentions such a letter, which he gave to J. A. Novello as soon as he arrived in London, in a joint letter with Ignaz Moscheles to Felix Mendelssohn Bartholdy dated April 13, 1839, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-124.
176 English letter of May 9, 1839, from J. Alfred Novello to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-114.
177 Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, MT/2011/149 [original in English].
178 Letter of June 13, 1839, from Breitkopf & Härtel to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 35, Green Books IX-187.
179 Letter of June 14, 1839, from Breitkopf & Härtel, ibid.
180 Letter of June 19, 1839, to Dr. Hermann Härtel, D-DS, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 6 [note 157], pp. 415–416, quotation on p. 416. In this letter, he once again asks for the score and piano reduction to be sent to Verkenius.
181 Letter of September 14, 1839, to President [E. H. W. Verkenius], Paul Sacher Stiftung, Basel, Sammlung Rudolf Grumbacher, Ref. Nr. 753, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 6 [note 157], pp. 466–467, quotation on p. 466.
Felix Mendelssohn Bartholdy was very careful in choosing which of his works he wished to have published. However, this does not mean that conclusions can be drawn from this regarding the importance the composer attached to his pieces. On the contrary, with respect to several work-groups, it is evident that copies of individual unpublished compositions were provided exclusively to selected people and thus by no means intended to be kept secret. Notable examples of this are “Tu es Petrus” MWV A 4, the solo song “Mein Liebchen, wir saßen zusammen” MWV K 91, and the male chorus “Abschiedstafel” MWV G 33. Several chorale arrangements also belong to this category of works, as Mendelssohn gave away copies and supported occasional performances. He also came into contact with individual works years later – sometimes through unexpected circumstances.
In November 1831, Mendelssohn made a total of eight works, all composed during his trip to Italy, available to the Frankfurt Cäcilien-Verein for copying. This resulted in a substantial bundle of music that is still preserved in Frankfurt am Main today.182 As a special token of appreciation, Mendelssohn himself copied his “Ave Maria” MWV B 19 for J. N. Schelble and presented it to him on November 17, 1831. Mendelssohn still had time to write a letter on that same day: “We are usually all together, in the evenings we make music in corpore, the other day at the Cäcilienverein Schelble performed some Handel, a chorus by Mozart, then ‘es ist der alte Bund’ by Bach, which sounded heavenly[,] the Credo from the great B minor Mass, and one of my choruses. Tonight he is having ‘Ihr werdet weinen und heulen’ [BWV 103], a piece of church music from my Roman works, etc., sung by another choir […].”183 The premiere of “Verleih uns Frieden” also took place that evening, November 17, 1831. The next day Mendelssohn reported: “The pen is blunt from writing parts, yesterday Schelble had a pair of my Roman pieces (Verleih uns Frieden and Aus tiefer Noth) performed and copied most of the parts himself. In addition, before ‘Du Hirte Israel’ [BWV 104] came another little cantata ‘lieber Gott wenn werd ich sterben’ [BWV 8], ‘es ist der alte
Bund’ [from BWV 106], some organ pieces […], and a free fantasy on themes of Seb. Bach. It was an uplifting evening.”184 The document was titled Recipe for the sisters. This unusual designation should be seen in the same context as the above-mentioned Messages to the bookbinder185 that were enclosed with the items carried privately to Berlin. This time, the note accompanied a parcel that was to be carried to Berlin by Friedrich von Savigny (1814–1875).186 The package included two drawing books,187 the “nuns’ pieces”, and presumably some chorale arrangements, but not the score of “O Haupt voll Blut und Wunden”, which the composer himself took with him to London. Of all eight chorale arrangements, Mendelssohn would subsequently devote the most time to “Verleih uns Frieden”. After assuming his position in Düsseldorf, Mendelssohn spent his first Christmas in Bonn, where he visited his cousin Georg Benjamin (“Benni”) Mendelssohn (1794–1874) and his wife Rosamunde (“Rosa”) Ernestine Pauline Mendelssohn, née Richter (1804–1883). During his stay at the end of 1833, Mendelssohn presented them with a piano reduction of “Verleih uns Frieden”, which he had prepared specifically as a gift for them. Six months later, when it started to look as if a performance of the piece would be possible in Düsseldorf, Mendelssohn looked to his family in Berlin for help: “O Fanny, another task for you: Rosa has a piano reduction of my ‘Verleih uns Frieden’ which I made for her in Bonn; she is likely to have it in Berlin as well; why don’t you copy for me the vocal parts from it (just below one another as a score, without the piano reduction) and send them here, perhaps in a letter, the whole thing is short. I have made some changes to the voice leading that I must take care of.”188
Mendelssohn then also transferred corrections to the original score before he sent the work off to be copied as score and parts. His Düsseldorf rehearsal diary189 mentions seven rehearsals and performances of “Verleih uns Frieden” within a year, between July 15, 1834, and June 23, 1835. In public performances, the piece was paired with Luigi Cherubini’s Mass in C major (July 20, 1834) and Beethoven’s Mass in C major op. 86 as well as with two Bach cantatas190 (June 16, 1835). Considering his extensive engagement with the piece, it understandable that Men-
182 See Critical Report, Description of the Sammelhandschrift III.
183 Letter of November 14 and 17, 1831, to Fanny Hensel (section of letter from November 17), D-B, MA Depos. Berlin 3,5, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 421–422, quotation on p. 421.
184 Letter of November 18, 1831, to Fanny Hensel and Rebecka Dirichlet, with the heading Recept an die Schwestern, The Courtauld Institute of Art, London, Accession no. Ms. 1952.RW.4100.1. I would like to thank Peter Ward Jones, (Oxford), for calling my attention to this still unpublished source.
185 See the wording above from February 25, 1831, with regard to the package containing “Vom Himmel hoch”, note 95.
186 Evidenced in the letter of December 28, 1831, Fanny Hensel, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 13, fols. 99–100, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 2 [note 32], pp. 442–445. At this time, Mendelssohn was in Paris, still waiting for news as to whether the shipment had reached Berlin.
187 Wehner, Bildwerkeverzeichnis [note 57], pp. 324–328 (ZB 9 and ZB 10).
188 Letter of June 12 to 14, 1834, together with Hermann Franck to Lea Mendelssohn Bartholdy, US-NYp, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, family letters, no. 202, printed in: Sämtliche Briefe, vol. 3 [note 31], pp. 454–455 (there dated June 14, 1834), quotation on ibid. The date was overwritten several times; the letter was apparently begun on June 12, 1834, but not completed that day; the postmark is dated June 14, 1834, which indicates that it was written between June 12 and 14.
189 Preserved in fragments, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 49, fols. 15–17, see Matthias Wendt, Felix Mendelssohn Bartholdys Düsseldorfer Probenplan Mai 1834 – Juli 1835, in: “Übrigens gefall ich mir prächtig hier”. Felix Mendelssohn Bartholdy in Düsseldorf, ed. by Bernd Kortländer (Catalogue of the exhibition in the Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf, October 1, 2009, to January 10, 2010), Düsseldorf 2009, pp. 60–69, with transcriptions and detailed commentary.
190 “Du Hirte Israel, höre” BWV 104 and “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” BWV 106. For both cantatas, Mendelssohn had made a practical performance arrangement, which saw the addition of clarinets and bassoons for a planned performance on June 29, 1834, see Mendelssohn Thematic Catalogue, p. 500.
delssohn sought to publish it soon after in autumn 1835 (see the chapter “Publication plans”).
The Leipzig premiere took place in the Gewandhaus on October 30, 1839. The surviving handwritten parts were probably prepared for this occasion.191 On the program, the piece was simply called: Prayer by Luther. Gewandhaus chronicler Alfred Dörffel (1821–1905) later commented on this designation: “This is how the composition was described at its first performance – without the composer’s name. It was said at the time that Mendelssohn wanted to observe the impression the piece made on the audience members independent of their knowledge of its author, which, at the same time, was meant as a sort of test with regard to the impartiality of their judgment.”192
Robert Schumann’s (1810–1856) review of the performance in his résumé of the concert season illustrates well how the piece was in step with the times: “Another novelty was a prayer ‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ by Mendelssohn, based on words by Luther, which was heard here for the first time on the eve of the Reformation Festival; a uniquely beautiful composition, the effect of which one can hardly imagine when merely looking at the score. The composer wrote it during his stay in Rome, to which we also owe some of his other church compositions. […] The little piece deserves world renown and will achieve it in the future; Madonnas by Raphael and Murillo cannot remain hidden for long.”193
Among the pieces the composer allowed copied in Frankfurt in 1831 was “O Haupt voll Blut und Wunden”. Another copy of this Frankfurt score was made without Mendelssohn’s knowledge, evidence of which is found in the correspondence between Dr. Eduard Krüger (1808–1885) and Robert Schumann.194 Krüger had several copies of Bach’s works brought back from Frankfurt am Main and had piano reductions made of them, which he wanted to offer for publication in Leipzig in 1841 with Schumann’s help. These included a cantata “O Haupt voll Blut und Wunden”, which was completely unknown at the time. Schumann showed Mendelssohn the new piano reduction during a visit from the latter shortly afterwards. He described Mendelssohn’s unexpected reaction in a letter to Krüger: “I have
a discovery to share with you about the 4th piece ‘O Haupt voll Blut’. Mendelssohn was with me when I received it from you and presented it to him as a Bachian. It was a droll scene. In short, the composition was written by him in his youth. He did not understand how you could have ended up with it.”195 When asked about the origin of his source, Krüger told Schumann: “A certain Carl Köhl, son of an actor from Frankfurt (if I am not mistaken), who lived here for a long time as a piano and drawing teacher, traveled there 2–3 years ago and brought back a manuscript: […] 2) O Haupt voll Blut u. W., with the signature J. S. Bach. We now have twice as much admiration for Felix, who was able to imitate the immortal master so early on in his youth – […].”196 The experience must have left a lasting impression on Robert Schumann, because years later he noted the following sentence in his memoirs about Mendelssohn: “The Krüger Bachianum and Mendelssohn’s | face when seeing it.”197 The template for the Frankfurt copy of “O Haupt voll Blut und Wunden” was a score prepared in Vienna in September 1830, which Mendelssohn provided a title page for in his own hand at an unknown date and took with him on his journey to England. There he gave it as a gift to Thomas Attwood in 1832. Attwood passed it on to Ignaz Moscheles, who took the manuscript with him when he moved to Leipzig in 1846, thus bringing it to the city in which Mendelssohn was then living. This score – now preserved in Berlin – would go on to serve as the basis for a performance initiated by Moscheles for a memorial service held in 1853 to mark the 6th anniversary of Mendelssohn’s death.198 In the 20th century, the winding path of this score, which can justifiably be counted among the most traveled manuscripts that Mendelssohn owned, led first again to London, from there to New York and, finally, back to Germany in the early 1970s.199 Its history is just one example of a fate often met by manuscripts, one which, especially in the case of Mendelssohn and above all in this particular work-group, can lead to a worldwide scattered source situation.200
Although Mendelssohn had classified his Weihnachtslied as “amusing”201 in 1831, he was ultimately not entirely convinced by it, which is why he did not take it with him on his subsequent
191 See Critical Report, Source O
192 Statistik der Concerte im Saale des Gewandhauses zu Leipzig, Leipzig, 1881, p. 40.
193 Musikleben in Leipzig während des Winters 1839–1840, quoted here from: Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Third Volume, Leipzig, 1854, Reprint Leipzig, 1985, pp. 283–284, originally in: Neue Zeitschrift für Musik XII/36 (May 1, 1840), p. 144.
194 These events, presented here in abbreviated form, are examined in detail by Armin Koch in a commentary in: Robert Schumann. Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy, ed. by Gerd Nauhaus and Ingrid Bodsch, ed. and with commentary by Kristin R M. Krahe and Armin Koch, Bonn, 2011 (2012), (hereafter: Schumann, Erinnerungen an Mendelssohn), pp. 87–88 (note 57).
195 Letter of September 26, 1841, from Robert Schumann to Eduard Krüger, privately owned, quoted here from the first printing: Robert Schumann’s Briefe. Neue Folge, ed. by F. Gustav Jansen, Leipzig, 1886, pp. 177–178, quotation on p. 178.
196 Letter of October 17, 1841, from Eduard Krüger to Robert Schumann, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Korespondencja Roberta Schumanna, vol. 12, no. 2068.
197 Erinnerungen an F. Mendelssohn vom Jahre 1835 bis zu s. Tode. (Materialien), Robert-Schumann-Haus Zwickau, archive no. 4871/ V, 3, 1–6, quotation in fascicle 1, fol. 5r. This original document was printed first in 1947 in facsimile: Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy. Nachgelassene Aufzeichnungen von Robert Schumann, published by Städtischen Museum Zwickau (Saxony), ed. by Georg Eismann, Zwickau, 1947, 2nd edition, revised and extended, 1948. A high-quality color facsimile is now available, see: Schumann, Erinnerungen an Mendelssohn [note 194].
198 This according to a note by Moscheles on the manuscript, c.f. Critical Report, Description of Source C. See also the short notices in: Neue Berliner Musikzeitung 7 (1853), no. 40 (28. November), p. 318, and Signale für die Musikalische Welt 11 (1853), no. 45 (November), p. 357. The solo (originally for baritone) was performed by the conservatory student Auguste Koch from Bernburg.
199 For exact evidence, see Provenance in the Critical Report, Source C
200 See also the chapter “The transmission of sources”.
201 See above accompanying letter of February 25, 1831, to Rebecka Mendelssohn Bartholdy, note 96.
journey and sent it to his family from Rome instead. After his return in 1835, Mendelssohn had the autograph bound together with two other copies into a volume in landscape format for his manuscript collection.202 A little known fact is that he lent this collection to the Thomaskantor Moritz Hauptmann (1792–1868) for a performance. In a letter from the beginning of December 1842, which was printed in an obscure publication, he wrote: “In the following book you will find the Christmas music we discussed, it is the third. If you can in fact use it for your purpose, it would be a great pleasure for me and a curious feeling to hear the piece again after such a long time, and on an occasion and in a place that I had imagined at the time, but never thought possible. However, arm yourself to the teeth with leniency, at the very least please do not laugh at me too much.”203 Sure enough, Hauptmann, who had only recently taken up the post of Thomaskantor,204 put the work on the Thomaner’s program for Christmas 1842. On December 23, he invited Mendelssohn to a rehearsal the following day: “Tomorrow morning we are having an orchestra rehearsal of the Christmas song and would of course very much like you to join us. It starts at 10 o’clock, but if it is too early for you, we can rehearse a few other things first so that you don’t have to be there. I would like to prepare you somewhat for the performance of the bass solo, which is very much at the level of a Thomas-scholar. I wish I could sing it, which should not really be an unheard-of demand for a cantor, but I only know how it should be sung.”205 On December 25, 1842, the previously unknown work was finally performed in the Nikolaikirche Leipzig and the following day in the Thomaskirche.206 It is not documented whether Mendelssohn attended the rehearsal or one of the two performances of the Weihnachtslied. There is evidence of further performances at both churches two years later – again on Christmas Day and Boxing Day.207 The material for these performances was still found in the music library of the Thomasschule Leipzig in 1921, but has been lost since the inventory was evacuated in 1944.208
The volume lent by Mendelssohn was returned and was later counted as volume 21 of the Mendelssohn estate in the so-called “Schleinitz Catalogue”209 when the estate was catalogued in 1848. A further compilation – volume 23 of the estate – was bound after 1837 and also contained horizontal-format manuscripts, primarily from the years of travel 1830 to 1832. According to the autograph label on the cover,210 it contained “Verleih uns Frieden” as well as “Wir glauben all an einen Gott”. However, when Mendelssohn’s heirs donated the volumes of his musical estate to the Royal Prussian Library in 1878,211 the autograph of “Wir glauben all an einen Gott” was missing from volume 23 – and to this day has not been found.
Details of the fate of his autograph are found in some of English-language documents that have been preserved together with copies of the work in Oxford.212 These were compiled anew in 2010 by William A. Little and enriched by further documents.213 According to these accounts, Paul MendelssohnBartholdy, the composer’s younger brother and executor of his estate, had, at the request of the Mayor of Bradford, Samuel Smith (1805–1873), selected an unknown Mendelssohn work for the opening celebrations of a prestigious concert hall that still exists today, St. George’s Hall in Bradford, Yorkshire. He then sent the autograph of “Wir glauben all an einen Gott” to England together with a copy. In a letter dated May 24, 1853, Smith sent these manuscripts on to William Bartholomew (1793–1867) in order to prepare an English version of the text.214 This led to Elizabeth Mounsey (1819–1905) also gaining access to Mendelssohn’s autograph. As an organist interested in this work, Mounsey copied the Nachspiel in D major MWV W 12, which in the manuscript immediately followed the vocal piece.
The new concert hall in Bradford, which could seat over 3,500 people, was officially opened by Queen Victoria on August 31, 1853.215 Under the musical direction of Michael Costa (1808–1884), a three-day music festival with a focus on Mendelssohn
202 Now Estate-Volume 21, see Critical Report, Sammelquelle IV.
203 Letter of December 4, 1842, to Moritz Hauptmann, location unknown, The letter was most likely destroyed during the bombing raid on Kassel on October 22, 1943, quoted from: La Mara [i.e., Marie Lipsius], Ungedruckte Briefe Mendelssohn’s. Nach den Handschriften mitgetheilt, in: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, no. 33 (March 18, 1890), p. 130, letter no. 5.
204 Moritz Hauptmann was formally inaugurated on September 12, 1842, see Stefan Altner, Das Thomaskantorat im 19. Jahrhundert. Bewerber und Kandidaten für das Leipziger Thomaskantorat in den Jahren 1842 bis 1918, Leipzig, 2007, p. 36.
205 Letter of December 23, 1842, from Moritz Hauptmann to Felix Mendelssohn Bartholdy, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 42, Green Books XVI-189.
206 Leipziger Tageblatt und Anzeiger, no. 358 (December 24, 1842). Anselm Hartinger was the first to draw attention to the premiere and the following repetitions of the performance, see Anselm Hartinger, “Es gilt dem edelsten und erhabensten Theil der Musik”. Felix Mendelssohn Bartholdy, die Thomaner, die Thomaskirche und die Leipziger Stadtkirchenmusik. Neue Dokumente und Überlegungen zu einer unterschätzten Arbeitsbeziehung, in: Mendelssohn-Studien 16 (2009), pp. 139–186.
207 Leipziger Tageblatt und Anzeiger, no. 359 (December 24, 1844).
208 See Critical Report, Evidence for Source [D].
209 On the various copies of this catalogue see Ralf Wehner, Das Schicksal des Bandes 43 und weiterer Manuskripte aus dem Nachlass von Felix Mendelssohn Bartholdy, in: Die Tonkunst 3 (2009), issue 2 (April), pp. 189–200 (hereafter: Wehner, Schicksal ), especially pp. 189–192.
210 Reproduction in Critical Report on MWV A 12, Source [B].
211 On this topic see Ralf Wehner, The Nachlass Volumes and Other Forms of Manuscript Transmission, Series XIII, Volume 1A (2009) of this edition, pp. XLII–L.
212 See Critical Report, Sources D and E
213 Wm. A. Little, A Minor Mendelssohnian Mystery: The Curious Case of the ‘Credo’ and the ‘Nachspiel’, in: Journal of Musicological Research 29 (2010), nos. 2–3, pp. 148–158 (hereafter: Little, Mendelssohnian Mystery).
214 A copy of this letter from Elizabeth Mounsey has been preserved, GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 51, fols. 65–66. Partial quotation see below.
215 See Opening of St. George’s Hall, in: The Bradford Observer 20 (1853), no. 1018 (September 1), pp. 5–6. A contemporary illustration of the new building with a report on the festival can be found in: The Illustrated London News 23 (1853), no. 642 (September 3), p. 193.
followed. A 200-piece mixed choir, brought together just for the opening of the hall, was responsible for all of the choral parts in the vocal-instrumental works of the festival. This ensemble later led to the formation of the Bradford Festival Choral Society, which is still active today. The festival opened with St. Paul and included the Symphony No. 3 in A minor op. 56 MWV N 18, the so-called “Scottish”; the finale of the opera fragment Die Lorelei MWV L 7, which had only been published a year earlier; the incidental music to A Midsummer Night’s Dream op. 61 MWV M 13; and, finally, the new work “Wir glauben all an einen Gott”, which was consistently referred to as “Credo” in the contemporary press.216 The “Credo” opened the morning concert on the last day of the festival (September 2, 1853), and was followed by large excerpts from Haydn’s oratorio The Creation and Handel’s Israel in Egypt. The praise of the critic from the Musical World, who had traveled to Bradford especially for the event, was teeming with enthusiasm: “The Bradford Musical Festival has terminated as it began – triumphantly.”
The extensive discussion of the festival217 that followed also went into more detail about the new piece: “The ‘Credo’ being an unknown work, its composer, from whose pen every fragment that now can be traced is eagerly looked for, excited the greatest curiosity and interest. Luckily it opened the performance, which leaves time to say a few words about it. According to the books, ‘it was presented to the Festival Committee by the representatives of the late composer.’ For ‘presented’ it may be presumed ‘lent’ should be substituted, since it cannot be supposed for an instant that so fine a work should remain in manuscript, lost to the numberless admirers of Mendelssohn’s genius. We believe it was in the Sistine Chapel at Rome that Mendelssohn was inspired with the idea of writing this ‘Credo;’ and if such be the case, it must be an earlier work than was supposed.”218 The reaction the work elicited from the audience was, more than anything, a testament to the high esteem in which Mendelssohn was still held in England six years after his death: “The impression produced upon the audience (among whom were observed some relatives219 of the composer) was deep and serious; and a conviction that another noble contribution to the treasures of the art, from the pen of one who had already given so much, was unanimous among those most capable of appreciating it.”220
Whether the manuscript was really a gift, as noted in the review, or merely a loan, has not yet been determined with certainty. However, Samuel Smith wrote to the translator immediately after receiving the delivery from Berlin: “I have this moment the honour to recieve [sic] from Mr Paul Mendelssohn of Berlin a Copy Mss. of an unpublished composition by the late Felix
Mendelssohn & which has been presented to the Committee of the opening Festival of St George’s Hall Bradford by the family & representatives of the composer.”221 Ultimately, there is only one fact that is certain: William Bartholomew sent the Mendelssohn manuscripts given to him for translation back to Bradford, where they formed the basis for the premiere of the piece on September 2, 1853. Since then, every trace has been lost, leading William A. Little to speculate in 2010: “Possibly, it is hidden away in some dusty attic in Bradford …”222.
A number of aspects of the transmission of the chorale arrangements’ sources also apply to Mendelssohn’s works in general: Many sources were scattered throughout Europe and North America, were affected by partial evacuations of libraries during the Second World War, and many ended up in private ownership, which often led to decades of uncertainty about the location of individual manuscripts. With regard to these works in particular, it is evident that a large proportion of the copies made came from unknown copyists. Looking specifically at “Verleih uns Frieden”, an important factor in the transmission is the different versions and piano arrangements. Nevertheless, it is still possible to make sense of the situation, as the number of works in question is limited. Three libraries – in Berlin, Darmstadt, and Frankfurt am Main – stand at the center of the transmission history, each with three or more relevant sources. Individual manuscripts are kept in Basel, Chicago, Leeds, Leipzig, New Haven, Oxford, Paris, and Washington, D. C. An important starting point is Mendelssohn’s musical estate, which was given to the Prussian state for safekeeping by the four Mendelssohn children in 1878. The scores of the Weihnachtslied MWV A 10 and “Verleih uns Frieden” MWV A 11, both produced in Rome in 1831, have been preserved here. The autograph score of “Wir glauben all an einen Gott” MWV A 12 had also belonged to the collection, but was lost as early as 1853. Mendelssohn only kept copies of two other pieces: “Christe, du Lamm Gottes” MWV A 5 and “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” MWV A 13. During the Second World War, these volumes were evacuated from the library and, in the summer of 1943, were taken together with 36 other volumes and holdings pertaining to Mendelssohn223 first to Altmarrin Castle in Pomerania (Kolberg district). This depository was destroyed by a fire in February 1945. Fortunately, however, the Mendelssohn manuscripts were kept in the very boxes that were able to be saved at the last minute and sent back to Berlin. The holdings
216 A preview of the festival program also appeared in various national newspapers, for example in: The Athenaeum, no. 1346 from August 13, 1853, p. 954, or: The Literary Gazette, no. 1909 from August 20, 1853, p. 824. Reports about the festival even reached foreign countries, see the New York journal The Musical Review and Choral Advocate 4 (1853), no. 11 (November), pp. 165–166.
217 Anon., The Bradford Musical Festival, in: The Musical World XXXI (1853), no. 37 (September 10), pp. 577–582, quotation on p. 580.
218 Ibid., p. 580, the quoted excerpt was followed by a brief analysis of the work.
219 According to research by Rosemary Cole, Alexander Mendelssohn (1798–1871) was present, see Little, Mendelssohnian Mystery [note 213], p. 153.
220 The Musical World XXXI (1853), no. 37 (September 10), p. 580.
221 Letter of May 24, 1853, from Samuel Smith to William Bartholomew, location unknown, quoted from the copy in: GB-Ob, MS. M. Deneke Mendelssohn c. 51, fols. 65–66, quotation on fol. 65r.
222 Little, Mendelssohnian Mystery [note 213], p. 155.
223 A detailed breakdown of the documents is found in the Mendelssohn Thematic Catalogue, p. XLV.
were hurriedly loaded onto a barge, which reached its destination of Schönebeck on the Elbe after a twelve-day journey on the waterways of Brandenburg. There they were stored in a mineshaft 440 meters below the ground, the so-called “Graf-MoltkeSchacht”. In the summer of 1946, the library was returned to its old location in Berlin (Unter den Linden) after the idea of transporting the holdings of the Staatsbibliothek stored in this depot to the Soviet Union as a form of reparations was rejected.224
Much of the city of Frankfurt am Main was also destroyed during the war. However, a group of Mendelssohn’s choral works – also evacuated225 and therefore rescued – was preserved in a section of the historical archive of the Frankfurter CäcilienVerein, the institution that Mendelssohn had allowed to make copies before the pieces went to print. This led to the survival of certain versions which can clearly establish the state of the works composed in Vienna and Rome. Sometimes these versions differ from the later printed versions of the works. In addition, J. N. Schelble, the director of the choir, had received the autograph score of “Ach Gott, vom Himmel sieh darein” as a gift, which added further value to the Frankfurt collection.
Another important factor in the source transmission is Franz Hauser. Although the singer’s library was scattered and decimated at the end of the Second World War,226 three works that are important in our context were among the Mendelssohn sources that did indeed survive. However, the complete details of their provenance cannot be determined with certainty. Answering one question, in particular, would be extremely useful in this regard: On what occasion did Hauser – whether during the composer’s lifetime or after his death – come into possession of the composite manuscript of two works that are labeled in Italian as Cantata and Cantate on a title page.227 One means of answering this question would be to identify the copyist, which has not yet been possible.
In general, the relatively high number of unknown copyists in this work-group is striking, which has less to do with the intrinsic nature of the work-group than with the purposes and places of origin of the copies. Looking at all eight works, a total of 20 copies in score and parts are known or verified. This does not include those copies from the 19th century that have no direct connection to the composer’s life and therefore cannot be considered in detail in this volume.228 The proportion may seem small in comparison to other composers, for example, those from the 18th century, whose works have survived primarily in
copies. In the context of Mendelssohn’s entire œuvre, however, the situation is unusual. This is because the transmission here is generally characterized by very different autograph source types as well as by authorized or unauthorized copies, the philological value of which can vary greatly.229 When it came to making copies, Mendelssohn worked at certain stations in his life with professional copyists, i.e., professional musicians working as copyists who were familiar with Mendelssohn’s handwriting. In Leipzig, this position was held by Eduard Henschke (1805–1854) and Friedrich Louis Weissenborn (1813–1862), who produced the majority of the copies; in Düsseldorf, Johann Gottlieb Schauseil (1804–1877) performed this function. The situation for the chorale arrangements is different: Several copyists worked in Berlin and Frankfurt; copyists from Düsseldorf, Leipzig, and Vienna are represented with individual copies. The only professional copyists known by name are the aforementioned J. G. Schauseil, one of Mendelssohn’s chief copyists in Düsseldorf, and Carl Wilhelm von Inten (1799–1877) in Leipzig. Both are connected with the performance material of “Verleih uns Frieden”. In addition, there are the parts from the Frankfurt premiere – although these have not survived – which were mainly taken from the score by J. N. Schelble, and in some cases also by Mendelssohn himself. Equally uncertain is the exact origins of the score of “Wir glauben all an einen Gott”, marked A. Schirmer. It may have been prepared just before it was sent to England in 1853 and intended for the specific performance there, but it also may have already been available. Theoretically, it could have been composed in the 1840s, as Schirmer was already working as a chorister and copyist in Berlin at this time.230 The particular editorial challenges in this volume arose most of all from the many differences among the individual copies of a work or between the copies and the autograph sources.231 One basic problem when examining the transmission of chorale arrangements is the fact that some were privately owned for decades. This applies, for example, to the autograph score of “Jesu, meine Freude”. Mendelssohn gave this score to Heinrich Conrad Schleinitz in 1836 as part of a compilation of music, which was listed as volume 43 in the 1848 estate and later ended up completely scattered232; it was auctioned off from Schleinitz’s estate in 1882, remained for a further eight decades in unknown private ownership, and was only acquired by an American library in 1962 after another auction – as mentioned above.
224 Further information on this topic with references in ibid.
225 Franz Fischer, Die Freiherrlich Carl von Rothschildsche Bibliothek (Bibliothek für neuere Sprachen und Musik) 1928–1945, in: Die Rothschild’sche Bibliothek in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, 1988 (= Frankfurter Bibliotheksschriften; vol. 2), pp. 68–100, details of the evacuation to Upper Franconia, in particular, on pp. 92–93.
226 Large parts of the Franz Hauser archive were burned in Weinheim an der Bergstraße in February 1945, see Karl Anton, Neue Erkenntnisse zur Geschichte der Bachbewegung, in: Bach-Jahrbuch 42 (1955), p. 9. It is highly likely that the original letters from Mendelssohn to Hauser were also destroyed. However, some of the compositions survived the firestorm.
227 For the exact formulation see Description of the Sammelhandschrift I.
228 The Répertoire Internationale des Sources Musicales (RISM) contains a number of these scores and part materials.
229 On the functionality of these and other source types see Thomas Schmidt, Von der Skizze zum Druck, in: Mendelssohn Handbuch, ed. by Christiane Wiesenfeldt, Kassel and Berlin, 2020, pp. 104–123.
230 The copyist A. Schirmer from Taubenstraße 17 can be found in the Berlin address book as early as 1844, where his profession is described as: “Chorister at the Royal Theater and music copyist”, see Allgemeiner Wohnungsanzeiger für Berlin, Charlottenburg und Umgebungen auf das Jahr 1844, 23rd year, Berlin, 1844, p. 406.
231 Further details can be found in the critical notes (Textkritische Anmerkungen) in the Critical Report on the individual compositions.
232 See Wehner, Schicksal [note 209], with evidence pertaining to the dates on p. 195.
A copy of “Christe, du Lamm Gottes”, given away by Mendelssohn in England in 1829, was acquired by the collector William Thomas Freemantle (1849–1931) in 1872.233 After more than five decades in his possession, it spent time with another private owner before ending up in the Leeds University Library. A copy of “Wer nur den lieben Gott lässt walten” was inaccessible for even longer and had to be listed in the 2009 Mendelssohn Thematic Catalogue with an unknown location. It was not even known whether this copy – last referenced in 1942234 – had survived the Second World War. During research for the preparation of this volume, this source was tracked down and made available for Mendelssohn research for the first time.
The autograph manuscripts for three works are still missing: “Christe, du Lamm Gottes”, “Wer nur den lieben Gott lässt walten”, and “Wir glauben all an einen Gott”. In theory, all three manuscripts could be in the possession of a member of the many branches of the Mendelssohn family tree. The most recent pieces of evidence – all from the 19th century – are, after all, linked to the composer’s family. The first work was copied in Berlin in 1835 from a score that Mendelssohn had given to his older sister as a gift in 1827. After her death, Fanny Hensel’s collection remained with her widower Wilhelm Hensel (1794–1861) and their son Sebastian Hensel (1830–1898). Whether this collection included “Christe, du Lamm Gottes” or “Wer nur den lieben Gott lässt walten” is beyond our knowledge. As a four-movement work, the latter was more suitable for a concert performance than single-movement chorales, such as “Christe, du Lamm Gottes” or “Jesu, meine Freude”. Thus it makes sense that Mendelssohn brought a score of it with him to England in 1829. The fact that this was a copy is confirmed by the source findings, as the score that Mendelssohn gave to Charles Neate is now kept in Leeds. The autograph must therefore have remained in Berlin, which also served as the template for a further copy that was prepared at an unknown date and is now part of the Hauser estate in Darmstadt. When one considers the enthusiasm Mendelssohn expressed for the Bach cantata of the same name, “Wer nur den lieben Gott lässt walten”, in his letter to Franz Hauser in 1835, together with his remark that he had also set the text to music himself in the past, it is at least possible to conclude that Hauser was not aware of Mendelssohn’s work at this time, as the wording in the letter would otherwise have been different. The copy from Hauser’s estate must therefore have been made later. Whether the motivation for the copy came from Mendelssohn himself or from someone else as a memorial to him after his death has not been established.
Of the last-mentioned compositions, all of which have only survived in copy form, only “Wir glauben all an einen Gott” was listed in 1848 in the inventory of the estate, the so-called “Schleinitz Catalogue”235. Originally part of volume 23, this autograph score was sent on loan to England for a performance
(see previous chapter) in 1853. However, it was apparently not returned to the volume and thus was not transferred to the Royal Library in 1878.
This last-mentioned work leads to another mystery, one which is connected with the organ piece referred to above. Mendelssohn notated a Nachspiel in D major MWV W 12 beginning on the first page after “Wir glauben all an einen Gott”. The proximity in the manuscript led initially to the Frankfurt copyist notating the organ piece together with the chorale arrangement in 1831. The postlude must also have been physically connected to the autograph of the chorale, as it would otherwise not have been sent to Bradford in 1853. It has therefore been discussed whether the piece was indeed meant as a postlude to the chorale or whether it might have been either an independent work or a part of another work altogether.236 As there is no definitive answer to this question and the organ piece is already available in this edition,237 it has not been reprinted in this volume.
The editor received support from several places during the preparation of this volume, and would first like to thank those libraries that allowed the inspection and evaluation of their holdings and permitted reproductions of selected pages: the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, the Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main and Georgetown University, Washington, D.C. Together with the documents cited in the introduction, the manuscripts come from six different countries with the following libraries: Basel (Paul Sacher Stiftung); Chicago (The Newberry Library); Düsseldorf (Heinrich-Heine-Institut); Kraków (Biblioteka Jagiellońska); Leeds (University Library, Brotherton Collection); Leipzig (Stadtgeschichtliches Museum); London (The British Library, The Courtauld Institute of Art); New Haven (Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University); New York (Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and Tilden Foundations as well as The Morgan Library & Museum); Oxford (Bodleian Library, University of Oxford); Paris (Bibliothèque nationale de France) and Zwickau (Robert-Schumann-Haus). Integral to the success of the volume were also the constructive contributions of Birgit Müller, Christiane Wiesenfeldt, Thomas Schmidt, and Tobias Bauer. I would like to extend a special thanks to Kevin Delinger from the Family Center for Special Collections at Georgetown University Library for valuable assistance in locating the copy of “Wer nur den lieben Gott lässt walten”.
Leipzig, January 15, 2022
Ralf Wehner (Translation: Sean Reilly)
233 Ralf Wehner, “There is probably no better living authority on Mendelssohn’s Autograph.” W. T. Freemantle und seine Mendelssohn-Sammlung, in: Mendelssohn-Studien 16 (2009), pp. 333–369.
234 For evidence see Critical Report on MWV A 7, Source B
235 See Wehner, Schicksal [note 209].
236 Most recently in 2010 in: Little, Mendelssohnian Mystery [note 213].
237 See Series IV, Volume 7 (2004) of this edition, where a reproduction of the documents pertaining to the 1853 performance in Bradford can also be found on pp. 139–140.
Chri ste, - du Lamm Got tes, - du Lamm Got tes,
der du
der du trägst die Sün de -
der
die Sün de
der
der du trägst die Sün de
- der Welt, der du
A Tempo ordinario für gemischten Chor und Orchester
de, ge, Je ach, su, wie
ne ach
Je ach, su, wie - mei lang, ne ach
mei ach, ne wie
Freu lan de! ge!
„Wer nur den lieben Gott lässt walten“
für Sopran solo, gemischten Chor und Orchester 1 Choral
(Violoncello e Contrabbasso)
Mein Gott, du weißt am al ler - be - sten - - das,
Mein Gott, du weißt am al ler - be - sten - - das,
Ü Mein
Gott, du weißt am al ler - be - sten - - das,
Mein Gott, du weißt am al ler - be
das,
was mir gut und nütz lich - sei. Hin weg - mit al ler - Men schen -
was mir gut und nütz lich - sei. Hin weg - mit al ler - Men schen
Ü was mir gut und nütz lich - sei. Hin weg - mit al ler - Men schen -
was mir gut und nütz lich - sei. Hin weg -
Ve sten, - weg mit dem ei ge - nen - Ge bäu. - Gib, Herr, dass
Ve sten, - weg mit dem ei ge - nen - Ge bäu. - Gib, Herr, dass
Ü Ve sten, - weg mit dem ei ge - nen - Ge bäu. - Gib, Herr, dass
Ve sten, - weg mit dem ei ge - nen - Ge bäu. - Gib, Herr, dass
ich auf dich nur bau und dir al lei - ne - ganz ver trau! -
ich auf dich nur bau und dir al lei - ne - ganz ver trau! -
Ü ich auf dich nur bau und dir al lei - ne - ganz ver trau! -
ich auf dich nur bau und dir al lei - ne - ganz ver trau!
„Verleih uns Frieden“ / „Da nobis pacem, Domine“
für gemischten Chor, kleines Orchester und Orgel
„Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ für Bariton solo, gemischten Chor und Orchester [1 Chor]
„Verleih uns Frieden“ / „Da nobis pacem, Domine“
Es nam ist nul doch lusja est kein qui an va drer li -
nicht, deder pro für no uns bis - pos könn te sit -
cresc.
cresc.
strei sta ten, re,
Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.
This is an excerpt. Not all pages are displayed.
Have we sparked your interest?
We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com.
