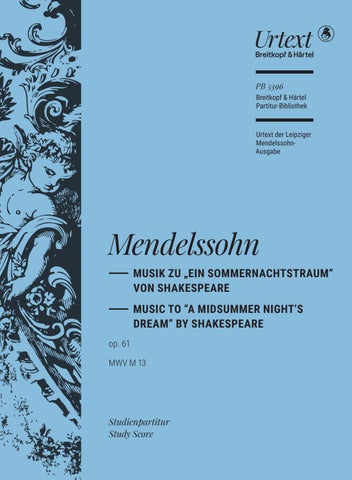Vorwort
Die hier vorgelegte Komposition ist ein Zeugnis für die eminente Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ihres Komponisten, der es ohne Einbuße an ästhetischer Qualität verstand, im Abstand von rund 17 Jahren zwei musikalische Werke unterschiedlicher Gattung, aber gleich hohen An spruchs zum selben literarischen Gegenstand zu verfassen: Im Sommer 1826 entstand die Konzert-Ouvertüre zum Sommernachtstraum, welche bei der Drucklegung 1835 die Opuszahl 21 erhielt und zusammen mit den Konzert-Ouvertüren op. 26 und 27 dem Preußischen Kronprinz und späteren König Friedrich Wilhelm IV. gewidmet wurde; 1842 bis 1843 schrieb Mendelssohn im Auftrag eben dieses Königs die Schauspielmusik op. 61 zur selben Komödie von William Shakespeare. Er benutzte dabei die Übersetzung durch August Wilhelm von Schlegel, dessen Übertragungen der Shakespeare-Dramen in die deutsche Sprache grundlegend waren für die zu jener Zeit in Mitteleuropa aufkommende Begeisterung für den englischen Dichter. Und beim Sommernachtstraum kann behauptet werden, dass es überhaupt erst Mendelssohns Musik war, die der Dichtung in den deutschsprachigen Ländern zum Durchbruch verholfen hat; in jedem Fall galt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein seine Schauspielmusik als selbstverständlicher Bestand teil einer Aufführung dieser Komödie.1
Die Genesis von op. 61 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Mendelssohns Anstellung durch den Preußischen König in Berlin, von dem er am 22. November 1842 zum Generalmusikdirektor für kirchliche und geistliche Musik ernannt wurde. Neben dieser Haupttätigkeit hatte er, wie er am 23. November 1842 seinem Freund Carl Klingemann berichtet, zusätzlich „einzelne Arbeiten im besondern Auftrage des Königs zu machen (jetzt habe ich z. B. Musik zum Sommernachtstraum, zum Sturm und zum Oedipus auf Kolonos zu liefern).“ 2 Mehrere briefliche Zeugnisse belegen, dass die kompositorische Arbeit sowohl an op. 61 als auch an Oedipus in Kolonos bereits Ende 1842 einsetzte. Der Fortgang der Kompositionsarbeit indes ist nicht genau zu verfolgen, weil sich zum einen in den Quellen keine Datierungen finden, zum anderen die Erwähnungen in der Korrespondenz kaum inhaltlich bestimmt sind. Gewissheit aber haben wir wieder hinsichtlich des Abschlusses der Arbeit, denn zum Beginn der Proben am 27. September 1843 in Potsdam brachte Mendelssohn die fertige Partitur aus Leipzig mit 3; und es gibt auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass er während der Probenarbeit noch etwas an der Musik änderte. Die Uraufführung im Neuen Palais in Potsdam fand am Sonnabend, dem 14. Oktober 1843 unter der Regie von Ludwig Tieck statt. War diese Aufführung noch geladenen Gästen des Königs vorbehalten, so wurde die erste öffentliche Vorstellung des Sommernachtstraums am 18. Oktober 1843 in Berlin gegeben. Bei den Proben indes hatte sich eine problematische Divergenz zwischen Mendelssohns fertiger Partitur und der dramaturgischen Disposition Tiecks herausgestellt. Der Komponist war von Schlegels (und Shakespeare’s) fünfaktiger Gliederung der Komödie ausgegangen, während Tieck die Akte II bis IV zu einem durchgängigen Teil zusammengefasst hatte und somit eine dreiaktige Disposition präsentierte, in welcher die Zwischenaktmusiken Nr. 5 und 7 im eigentlichen Sinne keinen Platz hatten. Doch wollte man sie aus verständlichen Gründen auch nicht entfallen lassen. „Es mußten also Auskunftsmittel gefunden werden,“ so berichtet Devrient, „diese Orchesterstücke, die nun im Verlauf des Actes, bei offner Scene, eintraten, einigermaßen zu motiviren. Bei dem Agitato in A moll (No. 5) konnte das gelingen, wenn die Darstellerin der Hermia das Suchen nach dem Geliebten in anziehender und abwechselnder Pantomime ausführte; bei dem Notturno E dur (No. 7) mußte immerhin der langdauernde Anblick der schlafenden Liebespaare peinlich
wirken, und die Auskunft, welche Tieck traf: Versetzstücke von Buschwerk zur Deckung der Liebenden vorzuschieben, war etwas plump theatralisch und bedenklich dazu.“4
Dieser Bericht deutet auf das besondere Gewicht voraus, das die Zwischenaktmusiken, ja die reinen Orchesterstücke der Schauspielmusik insgesamt, in der Rezeption des Werkes gefunden haben. Zu einigen von ihnen haben sich sogar Titel eingebürgert, die in unterschiedlicher Weise durch den Komponisten legitimiert sind. Während die Namen Scherzo für Nr. 1, Hochzeitsmarsch für Nr. 9 und Ein Tanz von Rüpeln für Nr. 11 in den Quellen zu allen Fassungen des Werkes verbürgt sind, bedürfen Elfenmarsch für das Allegro vivace der Nr. 2, Intermezzo für Nr. 5 und Notturno für Nr. 7 der klärenden Erläuterung. Es steht außer Frage, dass sie auch von Mendelssohn und in seinem Umkreis benutzt wurden. Ihre Rolle innerhalb der musikalischen Quellen dagegen ist unterschiedlich, und diese Differenzierung ist gut begründet und muss daher bewahrt werden. Elfenmarsch ist eine treffende Charakterisierung allgemeiner Art, die sich in keiner musikalischen Quelle findet. Intermezzo und Notturno dagegen stellen spezifische und im ganzen 19. Jahrhundert in dieser Weise benutzte Bezeichnungen für Lyrische Klavierstücke dar; genau in diesem Sinne hat Mendelssohn selbst sie ausschließlich in den Quellen der Klavier-Arrangements verwendet, nie dagegen in den Quellen zur Orchesterfassung5
Über den weltweiten Ruhm des Hochzeitsmarsches brauchen keine Worte verloren werden – er ist zweifellos das berühmteste Stück seines Komponisten geworden6. Hinzuweisen indes ist auf die besondere Bedeutung, die der Ouvertüre zukommt. Die Tatsache, dass Mendelssohn die ursprüngliche Konzert-Ouvertüre zum integralen Bestandteil der Schauspielmusik, ja zum substantiellen Ausgangspunkt von deren musikalischem Diskurs werden lässt, zieht für die Komposition die –historisch wohl einmalige – Konsequenz nach sich, dass ihre ästhetische Existenz gedoppelt wird: Sie ist als op. 21 ein selbständiges, in sich geschlossenes Konzertstück, innerhalb von op. 61 dagegen der erste Satz einer mehrteiligen und umfangreichen Schauspielmusik. Besonders hervorzuheben ist der Zusammenhang zwischen Ouvertüre und Finale, die beide – als Rahmen des Ganzen – nicht in die durchlaufende Nummerierung der Sätze einbezogen sind. Mendelssohn gelingt es im Finale eindrucksvoll, zu dem weitgehend unveränderten Tonsatz der Ouvertüre eine Gesangsschicht hinzu zu komponieren und aus dem rein instrumentalen Stück eine Vokalkomposition werden zu lassen.
Der Erfolg der Sommernachtstraum-Musik hatte sich nach den ersten Aufführungen in Potsdam bzw. Berlin rasch herumgesprochen. Pläne wurden geschmiedet, um die Komposition auch an dernorts aufzuführen, und der Bedarf an Materialien dafür wurde nach nur kurzer Zeit immer größer. Interessanter Weise war Mendelssohn aber weniger daran interessiert, den Druck der Partitur schnell heraus zu bringen, als vielmehr durch die Druckausgabe seines vierhändigen Klavierauszugs die allgemeine Kenntnis des Werkes zu fördern. Und so schrieb er am 10. Dezember 1843 an Breitkopf & Härtel in Leipzig: „Sind Sie mit einem Honorar von 100 Friedr d’or für ClavierAuszug und Partitur einverstanden? Doch wäre mir es freilich lieb, wenn die Partitur um ein Bedeutendes später als der Auszug erschiene; eigentlich möcht’ ich sie nur für Concert-Aufführungen nicht für Theater drucken lassen, da das aber nicht zu machen ist, so möchte ich damit warten bis wenigstens die Haupt-Theater, von denen es zu erwarten ist, daß sie die Partitur schreiben lassen, dieselbe im Manuscript haben.“ 7 Für die Partitur also setzte der Komponist zunächst auf Abschriften, die ihm offenkundig höhere Einkünfte versprachen. Darüber hat er genau Buch geführt, und so wissen wir, dass die Schauspielmusik in den vier Jahren nach ihrer Uraufführung in insgesamt 14 Städten aufgeführt wurde. Den Druck der Partitur dagegen zö gerte er bis kurz vor seinem Tode hinaus. Während der vierhändige Klavierauszug sowohl in
Leipzig als auch in London bereits im Mai 1844 und der zweihändige Auszug der Nummern 1, 7 und 9 im November 1844 erschienen, konnte Breitkopf & Härtel die Partitur erst im Juni 1848 und die Orchesterstimmen kurz danach auf den Markt bringen.
Berlin, Herbst 2007
Christian Martin Schmidt
1 Siehe zu all diesen Aspekten die noch immer grundlegende Studie von Friedhelm Krummacher, „… fein und geistreich genug“. Versuch über Mendelssohns Musik zum Sommernachtstraum, in: Das Problem Mendelssohn, hrsg. von Carl Dahlhaus (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 41), Regensburg 1974, S. 89–117.
2 Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, hrsg. von Karl Klingemann [jun.], Essen 1909, S. 273–277, das Zitat S. 275.
3 Siehe dazu den ausführlichen Bericht in Eduard Devrient, Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy und Seine Briefe an mich, Leipzig 1869, S. 238–241.
4 a.a.O., S. 238 f.
5 Deshalb sind sie in der vorliegenden Orchesterpartitur auch nicht zu finden.
6 Die Kontinente überspannende Verwendung des Marsches bei Hochzeitsfeiern ist einigermaßen sinnvoll, weil er innerhalb der Komödie zwei ernsthaft gewünschte Eheschließungen vorbereitet. Der analoge Gebrauch von „Treulich geführt“ aus dem 3. Aufzug von Richard Wagners Lohengrin dagegen bringt die pikante Note mit sich, dass die Ehe zwischen Elsa und Lohengrin gerade nicht vollzogen wird.
7 Original in der Universitäts- und Landesbibliothek, Darmstadt; abgedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe an deutsche Verleger, hrsg. von Rudolf Elvers, Berlin 1968, S. 135 f.
Preface
The work presented here is a testimony to the enormous flexibility and adaptability of its composer, who managed, at a distance of about 17 years, to write two musical works of a different genre but of equal sophistication on the same literary source, without any loss of aesthetic quality. In the summer of 1826 Mendelssohn wrote the concert overture to William Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream, which was given the opus number 21 at its publication in 1835 and was dedicated to the Prussian Crown Prince and later King Friedrich Wilhelm IV along with the concert overtures op. 26 and 27. And in 1842/43 he wrote the Incidental Music op. 61 to the same Shakespeare comedy as a commission from the same monarch. Mendelssohn used the version by August Wilhelm von Schlegel, whose German-language translations of Shakespeare’s stage works played a fundamental role in spreading the Shakespeare mania that began sweeping through central Europe at that time. As to A Midsummer Night’s Dream, one can rightly claim that Mendelssohn’s music was actually responsible for helping the comedy make its breakthrough in the German-language countries. Even well into the 20th century, the incidental music was regarded as a perfectly normal element of any performance of the comedy in those countries.1
The genesis of opus 61 is directly related to Mendelssohn’s appointment as General Music Director for church and sacred music by the Prussian king in Berlin on 22 November 1842. In addition to his principal task, his duties also comprised “occasionally writing pieces specially commissioned by the
king (now, for instance, I am expected to deliver music to the Midsummer Night’s Dream, the Tempest and Oedipus at Colonos),” as he wrote to his friend Carl Klingemann on 23 November 1842. 2 Several letters confirm that the compositional work on both op. 61 and Oedipus at Colonos began in late 1842. Unfortunately, the further progress of the work cannot be charted in detail as the composer neither entered any dates in the sources, nor made practically any reference to the contents of the works in his correspondence. We do know, however, when the work was finished, since Mendelssohn brought the complete score with him from Leipzig for the rehearsals which began in Potsdam on 27 September 1843.3 There is no evidence suggesting that he made any changes in the music during the rehearsals. The first performance took place in Potsdam’s Neues Palais on Saturday, 14 October 1843 in a production overseen by Ludwig Tieck. Following this performance, which was reserved for the king and his personal guests, the Midsummer Night’s Dream was given its first public performance in Berlin on 18 October 1843.
During the rehearsals, it soon emerged that there was a problematic discrepancy between Mendelssohn’s score and Tieck’s dramaturgical concept. The composer had based his work on Schlegel’s (and Shakespeare’s) five-act layout of the comedy, while Tieck had condensed Acts II to IV into one continuous section. He had thus created a three-act version in which the entr’actes nos. 5 and 7 had literally become superfluous. Understandably, no one was willing to discard the pieces. Devrient reported: “One now had to find a way of providing some kind of motivation for these orchestral pieces, which were now played during the course of the act, to an open curtain. This was made plausible with the Agitato in A minor (no. 5) when the actress portraying Hermia played out her search for her lover in a charming and entertaining pantomime; but at the Notturno in E major (no. 7), the prolonged view of the slumbering pairs of lovers would have been disconcerting, and the device chosen by Tieck – having set pieces depicting bushes pushed out to cover the lovers –was rather awkward in its staginess and questionable to boot.”4
This report prefigures the particular significance which not only the entr’actes but also all of the orchestral pieces in the incidental music have acquired in the reception of the work. A few of them have become known under titles legitimated by the composer in various ways. While the titles Scherzo for no. 1, Wedding March for no. 9 and A Dance of Clowns for no. 11 are authenticated in the sources to all versions of the work, the Fairy March for the Allegro vivace of no. 2, Intermezzo for no. 5 and Notturno for no. 7 still require clarification. While it is undisputed that these titles were used by Mendelssohn and his circle, their role within the musical sources varies – a distinction that has its reasons and must be maintained. Fairy March is a good general characterization of the piece, even though it can be found in no musical source. Intermezzo and Nocturne, however, are terms used to designate lyrical piano pieces, and which were used for this purpose throughout the entire 19th century. Mendelssohn himself also used them in this sense, but only in the sources of the piano arrangement, never in those of the orchestral version.5
It would be superfluous to point out the universal fame of the Wedding March, which has become the composer’s arguably most famous piece. 6 Yet one should mention the particular importance assumed by the Overture. Mendelssohn incorporated the original concert overture into the incidental music as an integral component, indeed, as the nucleus for the substance of the entire musical discourse. For the Overture, this means that its aesthetic existence was doubled, a phenomenon that is no doubt unique in music history: whereas it is an autonomous, self-contained concert piece as op. 21, within op. 61 it is the first movement of a lengthy, multipartite incidental music. Special mention must be made of the connection between the Overture and the Finale, which serve as the outer brackets of the entire work but are not included in the consecutive numbering of the
movements. In the Finale, Mendelssohn impressively succeeded in adding a vocal layer to the broadly unchanged substance of the Overture, thus deriving a vocal composition from a purely instrumental piece.
After its first performances in Potsdam and Berlin, news of the success of the Midsummer Night’s Dream incidental music spread like wildfire. Plans were made to perform the work elsewhere, and soon there was an increasingly urgent need for material. Interestingly, Mendelssohn was less interested in quickly bringing out a printed score than in promoting a general knowledge of the work through the printed edition of his four-hand piano reduction. He thus wrote to Breitkopf & Härtel in Leipzig on 10 December 1843: “Would you agree to an honorarium of 100 Friedr d’or for the piano reduction and score? I would prefer it, however, if the score were published considerably later than the piano reduction. Actually, I would like it printed solely for concert performances and not for the theater, but since this is not feasible, I would like to wait until at least the principal theaters – of whom it can be expected that they will have the score copied – have it in manuscript.”7 The composer thus reckoned at first with copies of the score, which apparently promised higher profits. He kept track of this very meticulously, which is how we know that the incidental music was performed in altogether 14 cities in the four years after its first performance. He delayed the printing of the score, however, until shortly before his death. While the four-hand piano reduction appeared in print both in Leipzig and London in May 1844, and the two-hand reduction of numbers 1, 7 and 9 in November of that year, Breitkopf & Härtel did not release the score until June 1848 and the orchestral parts shortly thereafter.
Berlin, Fall 2007 Christian Martin Schmidt
1 On all these aspects see Friedhelm Krummacher’s article, which is still of fundamental importance today: “… fein und geistreich genug”. Versuch über Mendelssohns Musik zum Sommernachtstraum in: Das Problem Mendelssohn, ed. by Carl Dahlhaus (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Vol. 41), Regensburg, 1974, pp. 89–117.
2 Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London , ed. by Karl Klingemann Jr., Essen, 1909, pp. 273–277, quote on p. 275.
3 See the detailed report in Eduard Devrient, Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy und Seine Briefe an mich, Leipzig, 1869, pp. 238–241.
4 loc. cit., pp. 238f.
5 This is why they are also not to be found in the present orchestral score.
6 The global custom of playing the march at weddings makes a good deal of sense because it prepares two earnestly desired marriages within the comedy. The analogous use of “Treulich geführt” from the 3rd act of Richard Wagner’s Lohengrin, in turn, is somewhat provocative, since the union of Elsa and Lohengrin will not be consummated …
7 Original in the Universitäts- und Landesbibliothek, Darmstadt; printed in: Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe an deutsche Verleger, ed. by Rudolf Elvers, Berlin, 1968, pp. 135f.
Besetzung
2 Flöten
2 Oboen
2 Klarinetten
2 Fagotte
2 Hörner
3 Trompeten
3 Posaunen
Ophikleide
Pauken
Becken
Scoring
2 Flutes
2 Oboes
2 Clarinets
2 Bassoons
2 Horns
3 Trumpets
3 Trombones
Ophicleide
Timpani
Cymbals
Triangel Triangle
Streicher
2 Elfen (Sopran I, II solo)
Chor der Elfen (Sopran I, II, Alt I, II)
Strings
2 Fairies (Soprano I, II solo)
Chorus of Fairies (Soprano I, II, Alto I, II)
AufführungsdauerPerforming Time
etwa 45 Minuten approx. 45 minutes
Aufführungsmaterial mietweise lieferbar.Performance material available on hire.
Dazu käuflich lieferbar:
Nr. 1 Scherzo
Nr. 9 Hochzeitsmarsch
Nr. 5, Nr. 7, Nr. 11
Available for sale:
PB/OB 5365No. 1 Scherzo
PB/OB5366No. 9 Wedding March
PB/OB 5367No. 5, No. 7, No. 11
PB/OB 5365
PB/OB5366
PB/OB 5367