
Breitkopf & Härtel Partitur-Bibliothek
Nr. 5315
Schubert
Messe Es-dur
für Soli, Chor und Orchester
D 950
Studienpartitur
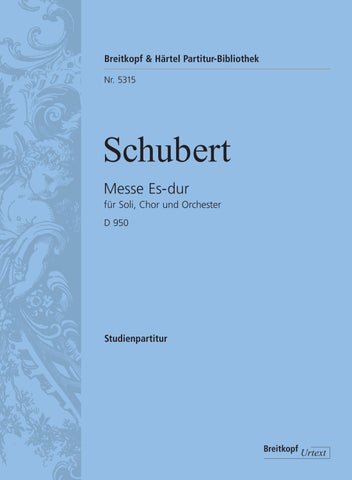

Breitkopf & Härtel Partitur-Bibliothek
Nr. 5315
für Soli, Chor und Orchester
D 950
Studienpartitur
(1797–1828)
für
Mass
Orchestra
D 950
herausgegeben von/edited by Peter Jost
StudienpartiturPB 5315
Printed in Germany
Franz Schuberts sechste und letzte lateinische Messe in Es-dur D 950 wird im Allgemeinen als Auftragswerk des „Vereins zur Pflege der Kirchenmusik” der Wiener Kirchengemeinde „Alsergrund” zur Aufführung in der dortigen Dreifaltigkeitskirche angesehen.1 Auf Initiative des von Jugend auf mit Schubert bekannten Chorleiters Michael Leitermayer wurde im Oktober 1828 besagter Kirchenmusikverein gegründet, der die Aufführung auch großer und anspruchsvoller Werke ermöglichen sollte. Ob Leitermayer aus diesem Anlass bei Schubert eine feierliche Messe bzw. noch weitere, zeitlich benachbarte kleinere liturgische Werke, Tantum ergo in Es-dur D 962 sowie möglicherweise auch Intende voci in B-dur D 963, bestellt hat, lässt sich allerdings nicht nachweisen. Einziges Indiz für die eingangs erwähnte Annahme ist ein Bericht über die posthume Uraufführung der Messe am 4. Oktober 1829 in der Dreifaltigkeitskirche durch den Kirchenmusikverein unter der Leitung von Schuberts Bruder Ferdinand in der Wiener allgemeinen Theaterzeitung: „Ungeachtet dessen [= der technischen Schwierigkeiten] wurde diese Messe bey einer sehr zweckmäßigen Besetzung vortrefflich exekutirt. Dieses muß man aber nur der anerkannten Geschicklichkeit, dem unermüdeten Eifer und der persönlichen Freundschaft des dortigen Hrn. Musikdirektors, Michael Leitermayer, zum verstorbenen Komponisten, der den Wunsch hegte, daß diese Messe am ersten, und zwar bey dieser Gelegenheit in der Kirche der Alservorstadt aufgeführt werden möchte, beynahe ausschließend zu schreiben.”2 Unklar bleibt der konkrete Sinn von „bey dieser Gelegenheit”, denn, wie der anonyme Rezensent zu Beginn ausgeführt hatte, wurde am betreffenden Tag „ein schönes dreyfaches Fest gefeyert, und zwar die glorreiche Nahmensfeyer Sr. Majestät unsers allergnädigsten und allgemein geliebten Kaisers, dann das Ordensfest der P.P. Minoriten, und endlich der erste Jahrstag des dortigen Kirchenmusikvereins.”3 Sollte tatsächlich die Zweckbestimmung der Messe für den entsprechenden Festtag im Jahr zuvor, im Oktober 1828, von Anfang an festgestanden haben, so dürfte die Initiative eher von Schubert selbst ausgegangen sein. Dieser Eindruck wird bestärkt durch ein indirektes Zeugnis über die Arbeit an der Messe. Schuberts Freund Johann Baptist Jenger schreibt am 4. Juli 1828 aus Wien an Marie Pachler in Graz: „Schubert hat ohnehin projektiert gehabt, ein Teil des Sommers in Gmunden und der Umgegend – wohin er schon mehrere Einladungen erhielt – zuzubringen, woran ihn jedoch bis jetzt die obbesagten Finanz Verlegenheiten abgehalten haben. Er ist dermalen noch hier, arbeitet fleißig an einer neuen Messe, und erwartet nur noch – wo es immer herkommen mag – das nötige Geld, um sodann nach Ober-Östereich auszufliegen.”4 Hier ist weder von einem konkreten Auftrag oder Anlass noch von einer möglichen Honorierung der Messe die Rede. Zu Beginn der eigenhändigen, heute in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrten Partitur der Es-dur-Messe findet sich die autographe Datierung Juny 1828 5 Dies dürfte in Übereinstimmung mit Jengers Brief den Zeitpunkt festhalten, an dem Schubert mit der Partiturniederschrift begann. Der Zeitpunkt des Partiturabschlusses ist nicht vermerkt; aus der Benutzung von unterschiedlichen Papiersorten glaubt die Schubert-Forschung jedoch schließen zu können, dass sich diese über den ganzen Sommer, möglicherweise noch bis in den Herbst 1828 hinzog.6 Insofern wäre eine beabsichtigte Aufführung zur Gründung des Alser Kirchenmusikvereins Anfang Oktober schon aus Mangel an Probenzeit nicht mehr in Frage gekommen. Jedoch liegt nicht
nur der Abschluss der Komposition, sondern auch dessen Beginn im Dunkeln. Aufgrund einiger markanter Korrekturen in der Partitur, die auf eine bereits ausgearbeitete Vorlage hindeuten, lässt sich vermuten, dass Schubert – wie in den Spätwerken mit Orchester üblich – vor der Partiturniederschrift Entwürfe für den gesamten Verlauf der Messe festhielt. Davon haben sich lediglich drei, heute in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek aufbewahrte Manuskripte mit als Particell notiertenEntwürfenfür Teile des Gloria (Schlussfuge„CumSanctoSpiritu”), Credo (zehntaktiger Ausschnitt), Sanctus (vollständig), Benedictus (bis auf Nachspiel vollständig) und Agnus Dei (bis auf die Schlussabschnitte von „Dona nobis pacem” nahezu vollständig) erhalten. Keiner dieser Entwürfe ist datiert; nach Maßgabe der Handschriften und Papiersorten reichen die Einschätzungen von März bis Mai 1828.7 Ließe sich tatsächlich nachweisen, dass Schubert bereits mehrere Monate vor der Ausarbeitung der Partitur Messsätze oder Teile davon konzipiert hätte, wäre ein Zusammenhang mit der Gründung des Kirchenmusikvereines in der Alservorstadt kaum noch einleuchtend. Dann wäre die Es-dur-Messe im Gegensatz zu den ersten vier lateinischen Messen sowie zahlreichen weiteren Kirchenwerken, die zwischen 1814 und 1816 im Zusammenhang mit Schuberts Tätigkeit als Hilfslehrer bei seinem Vater in Lichtental komponiert wurden,8 wie ihre unmittelbare Vorgängerin, die Messe in As-dur D 678 (1819–22, Zweitfassung 1825/26), ohne eigentlichen Anlass entstanden. Da die Messe in Es-dur nicht zuletzt im Hinblick auf die gesteigerten künstlerischen Ansprüche den Weg des As-dur-Werkes fortsetzt, erscheint eine freie Konzeption und Ausführung im Bewusstsein, solche Werke seien seinem „Streben nach dem Höchsten der Kunst”9 zuzurechnen – was für die späten Messen „Kunstfertigkeit und Bekenntnis”10 umschließt –, durchaus plausibel. Nicht nur die beträchtlichen technischen Schwierigkeiten, sondern auch die starken sinfonischen Züge der Komposition, die auf eine Orgelbeteiligung verzichtet, deren Basis jedoch die Chorstimmen bleiben, deuten eher auf ein ohne Rücksicht auf eine bestimmte Gelegenheit konzipiertes Werk hin. Eine Beantwortung der Frage, ob die letzte Messe tatsächlich aus eigenem Antrieb oder als Auftragswerk verfasst wurde, lässt sich freilich derzeit nach Lage der Dinge nicht mehr eindeutig beantworten.
Wurde die Erstaufführung zum Jahrestag des Kirchenmusikvereines in der Alservorstadt wohlwollend aufgenommen, so blieb das Werk, nicht zuletzt aufgrund einer mangelhaften weiteren Aufführung wenige Wochen später, am 15. November 1829, in der Wiener Kirche Maria Trost doch eine „beinahe ganz unbekannte Arbeit”, wie der Schubert-Biograph Heinrich Kreißle von Hellborn 1865 urteilte.11 Im gleichen Jahr aber wurde die Voraussetzung für eine weitere Verbreitung geschaffen, indem das Werk auf die Initiative von Johannes Brahms hin, der selbst den entsprechenden Klavierauszug revidierte, beim Verlag Rieter-Biedermann erstmals im Druck erschien. Als Herausgeber fungierte Franz Espagne, der damalige Kustos der Königlichen Hofbibliothek zu Berlin, die das Manuskript der Partitur erst drei Jahre zuvor erworben hatte. Von nun an konnte sich die Messe langsam, aber stetig den Weg zur Anerkennung als ein den späten Sinfonien Schuberts ebenbürtiges Meisterwerk bahnen. Heftig diskutiert wurden lange Zeit die Textauslassungen, die Schubert allerdings mit wechselnden Akzenten in allen seinen lateinischen Messen vornahm. Wurde das Fehlen zentraler Glaubenssätze wie insbesondere „Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam” im Credo von kirchlicher Seite vor allem in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gerügt, so galten sie am Jahrhundertende viel-
fach als Beleg für Schuberts kirchenferne Haltung und zeitgeschichtliche Kritik. Genaue Analysen und Vergleiche der gängigen Praxis deuten dagegen darauf hin, dass sich hier weniger eine Entfremdung mit der Konfession, als vielmehr eine Nähe zum Gedankengut der katholischen Aufklärung niederschlägt.12 Inzwischen hat diese Diskussion ihre Brisanz eingebüßt und das Urteil Ferdinand Schuberts aus dem Jahre 1839 wird allgemein akzeptiert: „gewiss eines seiner tiefsten und vollendetsten Werke.”13
Gedankt sei der Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz für die Bereitstellung von Kopien der autographen Partitur und für die Genehmigung zum Abdruck der Faksimile-Abbildung in der Dirigierpartitur PB 5286 sowie dem Verlagslektor Christian Rudolf Riedel für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Buchloe, Frühjahr 2005Peter Jost
1Vgl. z.B. Otto Erich Deutsch, Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge, Kassel usw. 1978, S. 610; Reclams Musikführer Franz Schubert, hrsg. von Walther Dürr und Arnold Feil, Stuttgart 1991, S. 209; Schubert-Lexikon, hrsg. von Ernst Hilmar und Margret Jestremski, Graz 1997, S. 301; Malte Korff, Franz Schubert, München 2003, S.165; Franz Schubert. Dokumente 1801–1830. Erster Band: Texte … Addenda und Kommentar, hrsg. von Ernst Hilmar, Tutzing 2003, S. 416.
2 Franz Schubert. Dokumente 1817–1830. Erster Band: Texte, hrsg. von Till Gerrit Waidelich, Tutzing 1993, S. 559.
3Ebenda, S. 553.
4 Schubert. Die Dokumente seines Lebens, gesammelt und erläutert von Otto Erich Deutsch, Kassel usw. 1964 (= Deutsch 2), S. 525.
5Vgl. das Faksimile in: Franz Schubert. Messe Nr. 6 Es-Dur D 950. Faksimile der autographen Partitur und der überlieferten Entwürfe, Kassel usw. 1996.
6Vgl. Walther Dürr, Einleitung, in: Franz Schubert. Messe Nr. 6 Es-Dur D 950. Faksimile der autographen Partitur und der überlieferten Entwürfe, a.a.O., S.VII.
7Ebenda.
8Vgl. Werner Bodendorff, Die kleineren Kirchenwerke Franz Schuberts, Augsburg 1997, S. 33.
9So Schubert in einem Brief an den Verlag B. Schott’s Söhne vom 21. Februar 1828 unter ausdrücklicher Bezugnahme u. a. auf die Messe As-dur, Deutsch 2, S. 495.
10Walther Dürr, Dona nobis pacem. Gedanken zu Schuberts späten Messen, in: Bachiana et alia musicologica.Festschrift Alfred Dürr zum 65. Geburtstag, hrsg. von Wolfgang Rehm, Kassel usw. 1983, S. 62–74, hier S. 68.
11Heinrich Kreißle von Hellborn, Franz Schubert, Wien 1865, S. 563.
12Vgl. Manuela Jahrmärker, Schubert – ein Anhänger der katholischen Aufklärung? Zu den Textauslassungen in Schuberts Messen, in: Schubert-Jahrbuch 1997, Duisburg 1999, S. 127–153.
13 Aus Franz Schubert’s Leben, in: Neue Zeitschrift für Musik, Bd. 10, 1839, S. 142.
Franz Schubert’s sixth and last Latin mass, the Mass in E flat major D 950, is widely held to have been commissioned by the “Verein zur Pflege der Kirchenmusik” [Society for the cultivation of church music] of the Vienna “Alsergrund” [the then suburb of Alser] church community for performance at the Dreifaltigkeitskirche [Holy Trinity church].1 This society, which also enabled the church to perform large and sometimes quite demanding works, was founded in October 1828 at the initiative of choral director Michael Leitermayer, who had known Schubert since his childhood. It cannot be ascertained, however, that Leitermayer commissioned Schubert to write a solemn mass for this occasion, or that he perhaps ordered some of the other smaller liturgical works that were also written about this time, the Tantum ergo in E flat major D 962 and perhaps the Intende voci in B flat major D 963. The only clue supporting the aforementioned assumption is a review of the posthumous first performance of the mass under the direction of Schubert’s brother Ferdinand – it was arranged by the church music societyand held at the Dreifaltigkeitskirche on 4 October 1829 – in the Wiener allgemeine Theaterzeitung: “In spite of this [= the work’s technical difficulties], the mass was executed superbly with the assistance of the most appropriate forces. Credit here is due almost exclusively to the recognized skill and tireless energy of the church’s music director Michael Leitermayer, as well as to his friendship with the departed composer, who had expressed the wish that this mass be given its first performance in the church of the Alservorstadt for this occasion.”2 It is unclear as to what “this occasion” refers to specifically, for as the anonymous reviewer mentioned at the beginning of his article, a “triple feast was celebrated” that day, namely “the glorious name day of His Majesty our most gracious and beloved Emperor, the feast of the Order of the P.P. Minorites, and finally the first anniversary of the church music society there.”3 In the event that Schubert really had intended from the very beginning that the mass be performed on the same feast day, but one year earlier, in October 1828, then the initiative must have come from the composer himself. Lending weight to this supposition is an indirect report on the composer’s work on the mass. On 4 July 1828 Schubert’s friend Johann Baptist Jenger wrote from Vienna to Marie Pachler in Graz: “At all events, Schubert intended to spend part of the summer in Gmunden and surroundings, from where he received several invitations; however, the above-mentioned financial straits have prevented him from leaving. He is thus still here, working diligently on a new mass and awaiting the funds – from wherever they may come – that will let him escape to Upper Austria.”4 There is no mention here of either a concrete commission or a specific occasion, nor of a possible honorarium for the mass. The beginning of the autograph score of the E-flat-major Mass, which is located today in the Staatsbibliothek zu Berlin, bears the autographic dating Juny 1828 5 Consistent with the information in Jenger’s letter, this could be seen as the terminus a quo of Schubert’s work on the score. Although the date of completion is not inscribed anywhere, Schubert scholars believe that, on the basis of the different types of paper used, the compositional process extended over the entire summer and possible into the fall of 1828.6 Had the work been intended to be played at the founding of the church music society of the Alservorstadt in early October, the performance would have had to be cancelled, if only for the lack of rehearsal time. Nevertheless, both
the beginning and the end of the composer’s work on this mass are shrouded in darkness. On the basis of several conspicuous emendations in the score which suggest a previously elaborated source, one can assume that Schubert had sketched the entire course of the mass before writing down the score, as he was accustomed to doing in his late works for orchestra. Of these sketches, only three manuscripts have survived, which are preserved in the Wiener Stadt- und Landesbibliothek. Notated as short scores, these sketches comprise sections of the Gloria (closing fugue “Cum Sancto Spiritu”), Credo (ten-measure segment), Sanctus (complete), Benedictus (complete save for the postlude) and Agnus Dei (nearly complete save for the end passages of “Dona nobis pacem”). None of these sketches are dated, but according to the physical evidence of the manuscripts and types of paper, the estimate ranges from March to May 1828.7 If one could actually prove that Schubert had already conceived the movements of the mass or parts thereof several months before working them out in score form, then it would hardly be plausible to establish a connection with the founding ceremony of the church music society of the Alservorstadt. In this case, the E-flat-major Mass would have been created without a specific occasion in mind, just like its immediate predecessor, the Mass in A flat major D 678 (1819–22, second version 1825/26), but unlike the first four Latin masses and many other sacred works written between 1814 and 1816 when Schubert worked for his father as assistant teacher in Lichtental.8 Since the Mass in E flat major continues the path defined by the A-flatmajor Mass, also with respect to the heightened artistic demands, it becomes increasingly plausible to postulate that the work was freely conceived and composed, and that it was one of those works that resulted from the composer’s “striving for the highest in art,”9 which also comprises “finesse and a profession of faith”10 in the late masses. Not only the work’s substantial technical difficulties, but also its markedly symphonic traits and absence of organ accompaniment – even though the work is still solidly based on the choral texture – suggest that the work was conceived without a specific occasion in mind. Due to the state of the sources, it is impossible today to provide a definitive answer to the question as to whether Schubert’s last mass was indeed written as a commission or as the realization of a personal wish.
While the first performance of the work held on the first anniversary of the founding of the church music society of the Alservorstadt was favorably received, the mass remained “almost totally unknown,” as Heinrich Kreißle von Hellborn claimed in his Schubert biography of 1865,11 not least because of a substandard performance a few weeks later, on 15 November 1829, at the church of Maria Trost in Vienna. However, in the same year that Kreißle’s biography was published, the publisher Rieter-Biedermann issued the first edition of the E-flat-major Mass on the initiative of Johannes Brahms, who revised the respective piano reduction himself. This edition, which laid the foundation for a further dissemination of the work, was prepared by Franz Espagne, the custodian of the Königliche Hofbibliothek zu Berlin, which had acquired the manuscript of the score three years previously. The mass was now able to make its way slowly but steadily towards its recognition as a masterpiece equal in rank to the composer’s late symphonies. For a long time, there were heated discussions of the text omissions made by Schubert in all of his Latin masses, albeit with shifting emphases. Church authorities faulted the omission of central expressions of faith such as, in particular, the “Et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam” of the Credo. While this criticism was leveled at Schubert especially
in the first decades of the twentieth century, at the end of the century such omissions were often viewed as evidence of Schubert’s spiritual distance towards the Church and of his sociocritical stance. However, precise analyses and evaluations of the practice of his time suggest that Schubert was not so much distancing himself from his confession as expressing a closeness to the ideology of Catholic Enlightenment.12 The discussion has since lost much of its explosiveness and Ferdinand Schubert’s judgment of 1839 is now widely accepted, namely that the E-flatmajor Mass is “no doubt one of his most profound and consummate works.”13
We wish to thank the Music Division of the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz for placing copies of the autograph score at our disposal and for allowing the print of the facsimile reproduction in the full score PB 5286. We also wish to extend our thanks to the reader of the publishing house, Christian Rudolf Riedel, for the excellent collaboration. Buchloe, Spring 2005Peter Jost
1See for example Otto Erich Deutsch, Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge, Kassel etc., 1978, p. 610; Reclams Musikführer Franz Schubert, ed. by Walther Dürr and Arnold Feil, Stuttgart, 1991, p. 209; Schubert-Lexikon, ed. by Ernst Hilmar and Margret Jestremski, Graz, 1997, p. 301; Malte Korff, Franz Schubert, Munich, 2003, p. 165; Franz Schubert. Dokumente 1801–1830. Erster Band: Texte … Addenda und Kommentar, ed. by Ernst Hilmar, Tutzing, 2003, p. 416.
2 Franz Schubert, Dokumente 1817–1830. Erster Band: Texte, ed. by Till Gerrit Waidelich, Tutzing, 1993, p.559.
3Ibid., p. 553.
4 Schubert. Die Dokumente seines Lebens, collected and annotated by Otto Erich Deutsch, Kassel etc., 1964 (= Deutsch 2), p. 525.
5See the facsimile in: Franz Schubert. Messe Nr.6 Es-Dur D 950. Faksimile der autographen Partitur und der überlieferten Entwürfe, Kassel etc., 1996.
6See Walther Dürr, Introduction, in: Franz Schubert. Messe Nr.6 Es-Dur D 950. Faksimile der autographen Partitur und der überlieferten Entwürfe, loc.cit.,p.VII.
7Ibid.
8See Werner Bodendorff, Die kleineren Kirchenwerke Franz Schuberts, Augsburg, 1997, p. 33.
9Schubert in a letter of 21 February 1828 to the publishing house B. Schott’s Söhne with express reference to the Mass in A flat major and other pieces, Deutsch 2, p. 495.
10Walther Dürr, Dona nobis pacem. Gedanken zu Schuberts späten Messen in: Bachiana et alia musicologica Festschrift Alfred Dürr zum 65. Geburtstag, ed. by Wolfgang Rehm, Kassel etc., 1983, pp. 62–74, here on p. 68.
11Heinrich Kreißle von Hellborn, Franz Schubert, Vienna, 1865, p. 563.
12See Manuela Jahrmärker, Schubert – ein Anhänger der katholischen Aufklärung? Zu den Textauslassungen in Schuberts Messen, in: Schubert-Jahrbuch 1997, Duisburg, 1999, pp. 127–153.
13 Aus Franz Schubert’s Leben, in: Neue Zeitschrift für Musik, vol. 10, 1839, p. 142.
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
.1
.26
.88
.167
. .182
.208
Sopran-, Alt-, Tenor-, Bass-SoloSoprano-, Alto-, Tenor-, Bass-solo vierstimmiger gemischter Chorfour-part mixed choir
2 Oboen2 Oboes
2 Klarinetten2 Clarinets
2 Fagotte2 Bassoons
2 Hörner2 Horns
2 Trompeten2 Trumpets
3 Posaunen3 Trombones
PaukenTimpani
StreicherStrings
etwa 55 Minutenapprox. 55 minutes
Dazu käuflich lieferbar:Available for sale:
Partitur mitFull score with RevisionsberichtPB5286“Revisionsbericht”PB5286 OrchesterstimmenOB5286Orchestral partsOB5286 KlavierauszugPiano vocal score (J.Spengler)EB8777(J.Spengler)EB8777 ChorpartiturChB5311Choral scoreChB5311
Der Revisionsbericht der Dirigierpartitur PB5286, auf den in Vorwort und Notenteil Bezug genommen wird, steht als Download auf www.breitkopf.de zur Verfügung.
The “Revisionsbericht”(Critical Commentary) of the full score PB 5286, which is referred to in the Preface and in the music text, can be downloaded from www.breitkopf.com.
Andante con moto, quasi Allegretto Kyrie
Oboe II I
Clarinetto in BII I a 2
Fagotto II I
Corno in EsII I
Tromba in BII I
Timpani
Andante con moto, quasi Allegretto
D 950
herausgegeben von Peter Jost
Violoncello, Basso
Contrabbasso
Studienpartitur PB 53152005 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden ©
cresc.
lei cresc.
cresc.
cresc.
decresc.
decresc.
decresc.